

Fernsehspione, seltsame Drahtgewebe
und Suggestiv-Tonbänder.
Manuel Delgado ist ein Genie, das man nicht mit ge-
wöhnlichen Maßstäben messen darf.
Murray Douglas will herausbekommen, weshalb
Manuel Delgado bestimmte Schauspieler von allen
möglichen Bühnen zusammengesucht hat. Warum
hat er sie an einem abgelegenen Ort eingesperrt?
Warum fördert er ihre Schwächen und Laster? Wes-
halb werden sie von schweigsamen Dienern bewacht
und bevormundet? Wer ist dieser Manuel Delgado –
und was hat er vor?
Die Schauspieler ahnen nicht, daß das geplante Thea-
terstück im Grunde genommen ganz unwichtig ist. Es
dient Delgado nur als Tarnung, und die Mitwirken-
den sind wie Marionetten in seiner Hand.
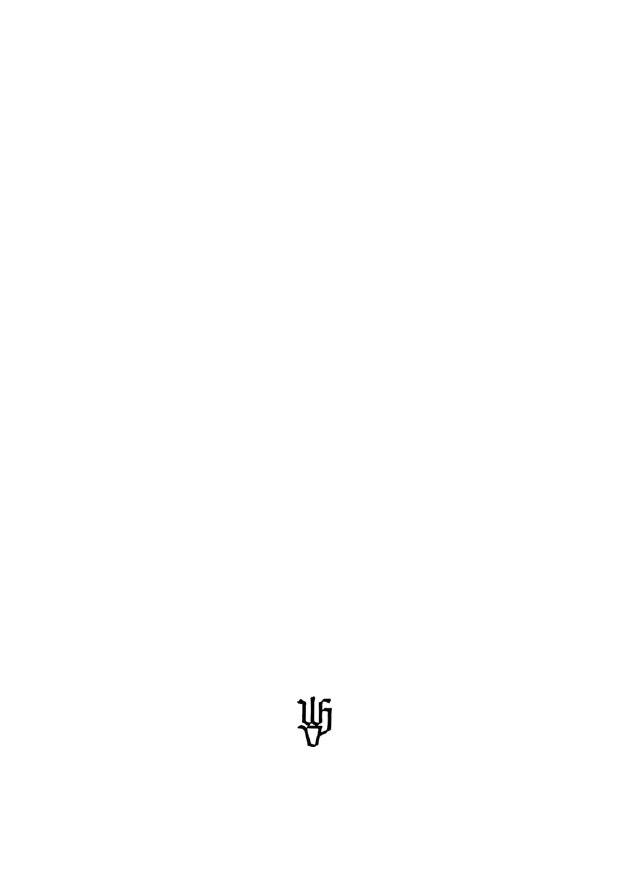
JOHN BRUNNER
SPION AUS
DER ZUKUNFT
Utopischer Roman
Deutsche Erstveröffentlichung
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN

HEYNE-BUCH Nr. 3137
im Wilhelm Heyne Verlag, München
Titel der englischen Originalausgabe
THE PRODUCTIONS OF TIME
Deutsche Übersetzung von Wulf H. Bergner
Copyright © 1967 by Brunner Fact & Fiction Ltd.
Printed in Germany 1969
Umschlag: Atelier Heinrichs & Bachmann, München
Gesamtherstellung:
Verlagsdruckerei Freisinger Tagblatt,
Dr. Franz Paul Datterer oHG., Freising

1
Eben weil die bloße Vorstellung ihn bereits nervös
machte, rief Murray Douglas im Restaurant Prosceni-
um an und ließ sich einen Tisch reservieren, bevor er
seinen Wagen auslöste. Murray kannte die Stimme
des Mannes nicht, der seine Bestellung aufnahm, und
der andere wiederholte völlig geschäftsmäßig, als be-
deute ihm der Name nichts:
»Mister Murray Douglas ... einen Tisch für eine
Person ... ein Uhr. Sehr wohl, Sir.«
Es war lange her, viel zu lange. Inzwischen war ei-
ne Ewigkeit verstrichen.
Seine Hand zitterte, als er den Hörer auflegte. Er
holte tief Luft, um seine Selbstbeherrschung zurück-
zugewinnen, und atmete langsam aus. Dann tastete
er zum zwanzigstenmal nach seiner Brieftasche, als
wolle er sich vergewissern, daß das Geld inzwischen
nicht verschwunden war. Schließlich zog er seinen
Mantel an, nahm die Reisetasche auf, sah sich noch
einmal in seinem Appartement um und ging auf die
Straße hinunter, um ein Taxi zu finden.
Immerhin hatte die Werkstatt sich nicht verändert.
Tom Hickie saß wie früher in seinem engen Glaska-
sten vor ganzen Stapeln ölverschmierter Kunden-
dienstblätter und dem ständig klingelnden Telefon.

Von draußen her drangen Musik und Arbeitslärm in
das winzige Büro. Murray Douglas ging an reparier-
ten Fahrzeugen vorbei, stolperte über einen Preßluft-
schlauch und erreichte den Glaskasten ohne weitere
Zwischenfälle.
Hickie sah von seiner Arbeit auf, als die Tür geöff-
net wurde. Einen Augenblick lang runzelte er fra-
gend die Stirn. Dann fing er sich wieder.
»Oh, Mister Douglas! Sie waren schon so lange
nicht mehr hier, daß ich Sie fast nicht wiedererkannt
hätte.«
»Haben Sie meinen Brief bekommen?« fragte Mur-
ray scharf. Er dachte nicht gern an die lange Zeit oder
an Leute, die ihn nicht wiedererkannten. Der Spiegel
hatte ihm bereits zuviel erzählt. Als er zuletzt hier in
der Werkstatt gewesen war, hatte er bereits viel von
seinem jugendlichen Aussehen verloren, dem er ei-
nen großen Teil seines Erfolgs verdankte; damals wa-
ren seine Augen schon wäßrig geworden, und die
Tränensäcke waren immer geschwollen gewesen.
Aber nun war er wirklich verfallen. Die Haut am
Unterkiefer war erschlafft. Auf seiner Stirn zeichne-
ten sich tiefe Falten ab. Und er trug stets einen Hut,
weil sein Haar sich bereits lichtete und überall grau
wurde. Trotz seiner zweiunddreißig Jahre sah Mur-
ray Douglas wie ein Mann von Fünfzig aus und fühl-
te sich wie ein Greis.

»Selbstverständlich, Sir. Wir haben Ihren Brief be-
kommen, und Ihr Wagen ist gleich fertig. Wir haben
uns gut um ihn gekümmert, darauf können Sie sich
verlassen.« Hickie legte seine Papiere fort; in seinen
Augen erschien ein neugieriger Ausdruck. »Ich habe
gehört, daß Sie krank gewesen sind, Sir. Das hat mir
wirklich leid getan. Hoffentlich haben Sie sich wieder
gut erholt.«
Murray hatte diese Erklärung, die sein Agent ver-
breitet hatte, plötzlich satt. »Unsinn!« widersprach er.
»Ich bin nicht krank gewesen – ich war in einem Sa-
natorium, um mich behandeln zu lassen, bevor ich
mich zu Tode trinke.«
Hickie öffnete den Mund, als wolle er etwas sagen.
Dann schwieg er doch und sah auf seine Papiere her-
ab.
»Tut mir leid, Mister Douglas. Ich wollte nicht
neugierig ein.«
»Schon gut.« Murray nahm sein Zigarettenetui aus
der Tasche; hier achtete niemand auf die großen
Schilder Rauchen verboten, die überall an den Wänden
hingen. »Zigarette?«
»Nein, vielen Dank, Sir. Ich will mir gerade das
Rauchen abgewöhnen.« Hickie versuchte zu lachen,
aber dann wurde ein Krächzen daraus. »Ah! Dort
kommt Bill, um zu sagen, daß Ihr Wagen fertig ist.«
Er ging an Murray vorbei zur Tür.

Bill, ein großer Westinder in braunen Overalls, rief
ihm zu: »Der Daimler ist fertig, Mister Hickie. Ich ha-
be das Arbeitsblatt eben abgegeben, damit die Rech-
nung geschrieben wird.«
»Gut!« sagte Hickie. »Wir wollen Sie nicht allzu
lange aufhalten, Mister Douglas.«
»Ist der Wagen in Ordnung?« wollte Murray wis-
sen.
»Der Daimler, Boß?« Bill wandte sich an ihn. »Nun
wir hatten einiges daran zu arbeiten. Entschuldigen
Sie, daß ich das sage, aber Sie schenken Ihren Wagen
nichts, Sir.«
»Das war früher«, murmelte Murray. »Früher habe
ich mir selbst auch nichts geschenkt.«
»Ja, Boß?« Bill warf ihm einen fragenden Blick zu.
»Das habe ich nicht verstanden.«
»Macht nichts.« Murray nahm seine Brieftasche
heraus. »Was bin ich Ihnen für die Aufbewahrung
schuldig, Tom?«
Als Murray endlich wieder hinter dem Steuer saß
und den wunderbar gleichmäßigen Ton des Achtzy-
linders unter der abfallenden Motorhaube hörte, ver-
gaß er sogar, daß Hickie ihn nicht gleich wiederer-
kannt hatte. Murray fuhr langsam durch das West
End zur St. Martin's Lane und dem Proscenium.
Aber auch dort hatte sich einiges verändert. Mur-

ray stieß auf bisher unbekannte Einbahnstraßen, und
an den Straßenrändern standen plötzlich überall
Parkuhren. Nachdem er viel Benzin und eine gute
halbe Stunde damit vergeudet hatte, in überfüllten
Seitenstraßen nach einem Parkplatz zu suchen, be-
fand er sich wieder in der Stimmung, in der er sich in
den letzten Monaten meistens befunden hatte. Was
wollte er überhaupt im Proscenium? Das Ganze war
nur eine theatralische Geste. Ein Ruf: »Murray ist
wieder da!« Um welche Antwort zu bekommen? Viel-
leicht einige hochgezogene Augenbrauen und ein
spöttisches: »Na, und?«
Verdammt noch mal, ich muß es trotzdem durchstehen.
Ich habe schon zu oft nachgegeben. Ich bin zu lange allen
Schwierigkeiten aus dem Weg gegangen.
Er fand schließlich einen Parkplatz und machte
sich mit mürrischem Gesicht auf den Weg zum Re-
staurant.
Emile, der Oberkellner, erkannte ihn wieder, aber
selbst sein professionelles Lächeln konnte den
Schock, den er angesichts dieser Veränderung inner-
halb eines Jahres empfand, nicht ganz verdecken.
Und er hatte noch einen weiteren Grund, sich unbe-
haglich zu fühlen.
»Es tut mir wirklich sehr leid, Mister Douglas«,
sagte er eben, »aber Sie hatten einen Tisch für ein Uhr
bestellt, nicht wahr? Als Sie um halb zwei noch nicht

gekommen waren, mußte ich ...« Er machte eine viel-
sagende Handbewegung, die seine Erklärung been-
dete.
Hätte er mich früher so behandelt, hätte ich Krach ge-
schlagen. Aber das hätte er früher gar nicht gewagt. Nun
bildet er sich ein, ich sei fertig ...
Murray zwang sich dazu, trotzdem zu lächeln. »Ich
habe eine halbe Stunde auf der Suche nach einem
Parkplatz vergeudet«, sagte er. »Tut mir leid, wenn
Sie dadurch Schwierigkeiten gehabt haben, Emile. Ist
irgendwo ein anderer Platz für mich frei?«
»Ah ... Wir haben nur noch einen freien Tisch, Mi-
ster Douglas.« Emile deutete nach rückwärts. »Fran-
çois wird sich Ihrer annehmen. François, führen Sie
Mister Douglas bitte an den Tisch. Ja, Mister Crom-
bie, ich komme sofort zu Ihnen!«
Fragende Blicke (›Ich kenne ihn bestimmt und
weiß, wer er ist, aber ...!‹) folgten ihm durch das Re-
staurant. Er kannte keinen der Gäste, die zu ihm auf-
sahen; selbstverständlich waren hier einige Leute
anwesend, die er kannte, aber er war froh, daß alle
seine ehemaligen Freunde anderweitig so beschäftigt
waren, daß sie nicht auf ihn achteten. Der Tisch, zu
dem er geführt wurde, war zum Glück halb hinter ei-
ner mit Efeu begrünten Trennwand verborgen. Am
Nebentisch, der in einer kleinen Nische stand, saßen
zwei Männer, deren Stimmen er sofort erkannte: Pat

Burnett, Kolumnist und Theaterkritiker der Gazette,
und Ralph Heston-Wood von der Theaterzeitschrift
Acting.
Die beiden hatten ihn nicht hereinkommen gese-
hen. Sie diskutierten eben eine Probe, die sie miter-
lebt hatten. Murray hörte interessiert zu und versuch-
te sich in die Vergangenheit zurückzuversetzen.
Du lieber Gott, was er alles versäumt hatte! Warum
war er so verrückt gewesen, hier allein aufzutauchen,
anstatt seinen Agenten anzurufen. Roger wäre gern
bereit gewesen, ihn ...
Nein, wahrscheinlich nicht, und es hat keinen Zweck,
wenn ich mich selbst betrüge. Er hat bestimmt allmählich
genug von mir; ich habe ihn endlos angepumpt, habe mich
bei ihm beschwert und bin ihm auf die Nerven gefallen.
Seitdem er das Sanatorium verlassen hatte, seitdem
er gewartet und gehofft hatte, wo es keine Hoffnung
gab, hatte Murray Douglas einen gewissen Murray
Douglas wesentlich besser kennengelernt.
Und Murray Douglas ist mir nicht übermäßig sympa-
thisch.
Er studierte die Speisekarte mit der Begeisterung
eines eben entlassenen Sträflings (und die gräßlichen
Schnellimbisse waren eine Art Gefängnis gewesen)
und entschied sich für Forelle blau.
»Welchen Wein darf ich dazu bringen, Sir?« fragte
der Ober.

»Keinen«, antwortete Murray kurz. »Ich trinke Ap-
felsaft.«
Er zündete sich eine Zigarette an und lehnte sich
zurück.
Die beiden Kritiker am Nebentisch hatten jetzt das
Thema gewechselt. Murray hörte zunächst kaum zu,
aber als ihm auffiel, worüber sie sprachen, war er
plötzlich ganz Ohr.
»Was halten Sie von diesem Delgado, Ralph – Sie
wissen doch, dieser Argentinier, den Blizzard aufge-
gabelt hat?«
»Oh, der Mann ist nicht übel, das steht fest«, ant-
wortete Heston-Wood. »Haben Sie nicht gesehen,
was er in Paris mit Jean-Paul Garrigue auf die Beine
gestellt hat? Trois Fois à la Fois war der Titel, soviel ich
mich erinnere.«
»Nein, ich habe es nicht gesehen, aber allen Berich-
ten nach hätte es mir auch nicht gefallen«, grunzte
Burnett.
Heston-Wood lachte. »Ja, ich weiß noch, was Sie
über The Connection geschrieben haben, Pat.«
»Hören Sie, Ralph, was soll eigentlich dieser ganze
Unsinn?« erkundigte Burnett sich. »Ein Theaterstück
ist ein Theaterstück und hat einen Autor, der es ge-
schrieben hat. Aber soviel ich gehört habe, handelt es
sich hier nicht um ein Theaterstück. Da gibt es einen
gerissenen Südamerikaner, der angeblich sehr avant-
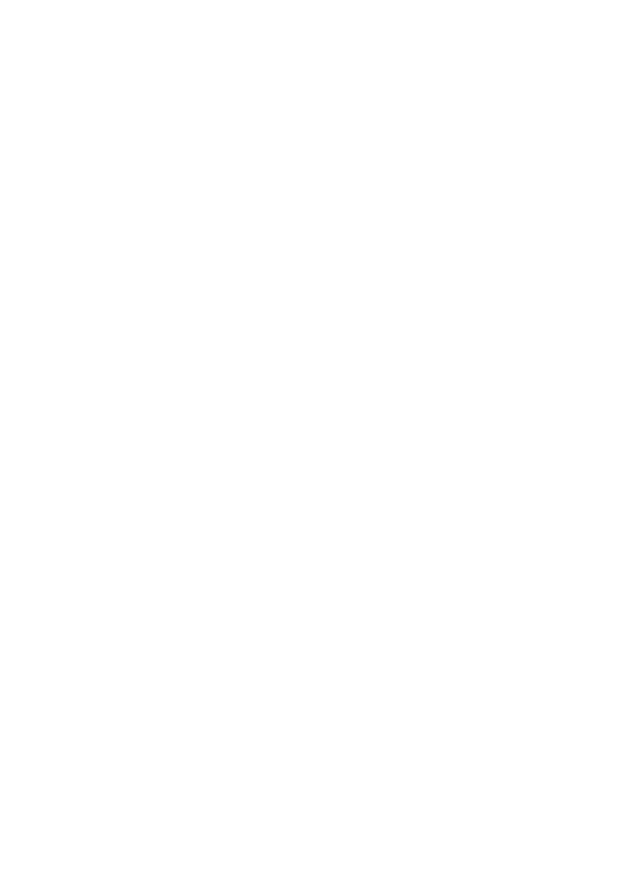
gardistisch ist; er hat es fertiggebracht, Blizzard und
einige Geldgeber auf seine Seite zu bringen, und holt
nun von überall her Taugenichtse, ehemalige Größen
und abgehalfterte Schauspieler aus irgendwelchen
Winkeln zusammen, weil kein vernünftiger Mensch
sich mit seinem Unsinn abgeben würde.«
Murray spürte, daß ihm der Schweiß auf der Stirn
ausbrach.
»Pat, manchmal übertreiben Sie wirklich mit Ihrer
Theater-für-die-Massen-Pose. Sie haben Delgados
Arbeit noch nie selbst gesehen, aber Sie verdammen
sie trotzdem.« Heston-Wood trank einen Schluck
Wein. »Das Stück mit Garrigue in der Hauptrolle war
für mich das größte Theatererlebnis seit Godot.«
»Es war trotzdem kein Erfolg«, stellte Burnett fest.
»Richtig. Nun, schließlich hat Garrigue Selbstmord
begangen.«
»Ja, aber warum war damit alles zu Ende? Warum
ist nicht ein Ersatzmann für ihn eingesprungen?«
»Weil das Stück auf einer bestimmten Besetzung
aufgebaut war. Ein Ersatzmann hätte alles ruiniert.
Diese Idee hat etwas für sich, Pat. Das wollen Sie nur
nicht einsehen.«
»Doch, doch, ich weiß. Vor einigen Jahren war Sa-
royan hier, erinnern Sie sich noch? Er hat etwas ähn-
liches im Werkraumtheater versucht. Aber was ist
dabei herausgekommen? Unsinn!« Burnett schenkte

sich ein Glas Wein ein. »Man stellt die Schauspieler
auf die Bühne, wirft ihnen einige Vorschläge hin,
entwickelt daraus in Gemeinschaftsarbeit den Dialog
und bezeichnet das Ergebnis als Bühnenstück. Aber
wie soll ein Meisterwerk daraus werden, wenn sich
lauter zweitklassige Leute zusammentun? Das kann
ich nicht glauben, Ralph. Der beste Mann ist noch
Murray Douglas, und Sie wissen so gut wie ich, daß
es keinen Produzenten in London gibt, der diesen al-
ten Ginsäufer auch nur ansehen würde. Und er hatte
ohnehin nie viel Talent – nur ein hübsches Gesicht.«
Murray stand ruckartig auf. Er machte sich gar
nicht erst die Mühe, den Tisch zurückzuschieben; die
Beine scharrten über den Teppichboden. Einige
Besteckteile fielen hinunter. Murray war kreidebleich,
als er an den Nebentisch trat.
Heston-Wood ließ seine Gabel fallen, die gegen den
Teller klirrte. Das war zunächst das letzte Geräusch.
Im ganzen Restaurant herrschte einige Sekunden lang
tiefe Stille.
Burnett sah zu Murray auf, als habe er ein Ge-
spenst vor sich. Er war ein großer, kräftig gebauter
Mann mit rotem Gesicht. Seine Lieblingsmasche, die
vom Herausgeber der Gazette gefördert wurde, war
›Theater für die Massen‹, und er ließ über seine Ko-
lumne eine Fotografie setzen, die ihn mit einer Meer-
schaumpfeife im Mund zeigte.

»Stehen Sie auf!« fuhr Murray ihn an.
»He ... Seien Sie doch vernünftig, Murray!«
Murray packte Burnett an der Krawatte. In seinem
Zorn entwickelte er ungeahnte Kräfte. Er riß Burnett
hoch, so daß der Stuhl des anderen krachend umfiel.
Dann versetzte er Burnett einen gutgezielten Kinnha-
ken.
Der
Kolumnist
stolperte
rückwärts,
stieß
gegen
ei-
nen
Tisch
und
griff
mit
einer
Hand
in
eine
Schale
Ka-
ramellpudding,
als
er
sich
aufstützen
wollte.
Murray
holte
tief
Luft,
ohne
auf
das
Stimmengewirr
zu
achten.
»Das hätte Ihnen schon vor Jahren gebührt, Bur-
nett. Haben Sie verstanden, Sie armseliger Kerl? Sie
sind kein Kritiker und werden nie einer sein. Sie sind
ein bösartiger Schwätzer ohne Takt und ohne Manie-
ren. Als ich noch ganz oben war, hätte ich Ihnen oft
gern die Zähne ausgeschlagen, aber ich habe es nicht
gewagt, weil Ihre schmutzige Kolumne Ihnen Macht
gibt. Jetzt bin ich ganz unten, und Sie können mir
nicht mehr schaden. Aber Sie versuchen es trotzdem,
was? Sie haben mich einen alten Ginsäufer genannt,
nicht wahr? Schön, jetzt haben Sie Gelegenheit, es mir
ins Gesicht zu sagen!«
Burnett richtete sich schweratmend auf. Er ent-
schuldigte sich murmelnd bei dem Gast, dessen Ka-
ramellpudding ihm unter die Finger gekommen war.
»Mister Douglas! Bon Dieu, was haben Sie getan?«

Emile kam aufgeregt aus dem Hintergrund herange-
stürzt.
»Schon gut, Emile, ich gehe bereits. Hätte ich ge-
wußt, daß ich hier mit Burnett unter einem Dach sein
würde, wäre ich ohnehin nicht gekommen. Sein An-
blick verdirbt mir den Appetit.« Nun benützte Mur-
ray absichtlich die Resonanz seiner ausgebildeten
Stimme, mit der er früher die Albert Hall ohne Mi-
krophon gefüllt hatte. Er wußte, daß alle Gäste jedes
einzelne Wort verstanden. »Hier, nehmen Sie das als
Schadenersatz.« Er drückte Emile fünf Pfund in die
Hand und suchte gleichzeitig in der Hosentasche
nach Kleingeld. »Das hier ist für Sie, Burnett.«
Er warf dem großen Mann einen Penny zu. Die
Münze fiel vor ihm auf den Teppich. Murray drehte
sich um und ging langsam zum Ausgang; diesmal
wußte er, daß alle Gäste ihn beobachteten. Diesmal
fragte niemand, wer das sein könnte.
Der beste Abgang seit langem, überlegte er sich erbit-
tert.
»Murray!«
Er blieb stehen und sah sich um. An einem Tisch in
der Nähe der Tür sah er Fleet Dickinson, der sich
ganz oben befand und wohl nie absinken würde.
Fleet lächelte strahlend.
»Murray, ich bin wirklich verdammt froh, daß Sie
wieder unter die Lebenden zurückgekehrt sind. Gra-

tuliere, das war ein prächtiger Kinnhaken, den Sie
Burnett verpaßt haben. Was tun Sie im Augenblick?
Ich habe gar nichts mehr von Ihnen gehört, seitdem ...
nun, Sie wissen schon.« Er machte eine verlegene
Handbewegung.
»Seitdem ich eine Entziehungskur machen mußte«,
stellte Murray fest. »Ich habe mich ausgeruht. Mei-
stens vor anderer Leute Türen. Ich habe mich auch
um eine Audienz bei Ihnen bemüht, aber Sie waren
nicht zu sprechen.«
Fleet ließ sich nicht anmerken, daß ihm unbehag-
lich zumute war. »Nun, Murray, Sie wissen selbst,
wie es in solchen Fällen ist ...«
»Das weiß ich nur zu gut. Lassen Sie sich nicht wei-
ter von Ihrem Essen abhalten.«
»Augenblick noch ... äh ... Murray!«
Murray blieb stehen und sah sich um.
»Hören Sie, wenn Sie wirklich Schwierigkeiten ha-
ben ...«
»Jetzt nicht mehr, danke. Blizzard hat mich für sei-
ne Ansammlung von Taugenichtsen und Schmieren-
komödianten angeheuert, die Delgados neues Stück
auf die Bühne bringen sollen. Bis dahin bin ich ver-
sorgt. Wir sehen uns bei der Premiere wieder.«
Dieser Seitenhieb zum Abschied war ausgesprochen kin-
disch, warf Murray sich vor, als er auf die Straße hi-

naustrat. Das Dumme an der ganzen Sache war na-
türlich, daß er wie Burnett an Delgados Projekt zwei-
felte. Hätte sein Agent etwas anderes aufgetrieben –
irgend etwas anderes –, hätte er sich nie darauf einge-
lassen, obwohl er hier eine phantastisch hohe Gage
erhielt.

2
Murray fuhr nach Norden durch London auf die M1
zu und dachte dabei noch immer an die Ereignisse
der letzten halben Stunde zurück. Er hielt einmal an,
um das Verdeck zurückzuklappen – frische Luft
würde ihm helfen, Burnett zu vergessen – und ein
Sandwich zu kaufen, das die gute Forelle blau erset-
zen mußte, die er im Restaurant Proscenium zurück-
gelassen hatte.
Bisher war er vorsichtig gefahren; schließlich hatte
er seit seinem Zusammenbruch nicht mehr am Steuer
eines schnellen Wagens gesessen. Als er jedoch die
Autobahn erreichte, fuhr er absichtlich immer schnel-
ler, schaltete erst bei hundertsiebzig in den vierten
Gang und beschleunigte weiter, bis das Tachometer
zweihundert Stundenkilometer anzeigte.
Murray war Manuel Delgado dankbar, wenn auch
nur dafür, daß er ihm genug Geld vorgestreckt hatte,
damit er den Wagen wieder auslösen konnte.
Er hatte den Daimler nicht verkauft, weil der Wa-
gen im Lauf der Zeit ein wichtiges Symbol für ihn
geworden war. Das Nummernschild trug die Kombi-
nation 1 MQD – Murray Quest Douglas –, und die
Leute erkannten den weißen Daimler SP 250 auf offe-
ner Straße. »Das ist Murray Douglas in seinem Wa-

gen!« hieß es dann. »Ich habe ihn erst letzte Woche
im Fernsehen gesehen.«
Einmal hatte ihn sogar ein Taxifahrer um sein Au-
togramm gebeten, als sie beide nebeneinander vor ei-
ner blockierten Kreuzung standen.
Vielleicht war er unerklärlich hartnäckig gewesen.
Er hätte noch immer sieben- oder achthundert Pfund
dafür bekommen, obwohl der Wagen damals nicht in
bestem Zustand war. Er hätte anständig essen kön-
nen, anstatt aus Büchsen zu leben; er hätte nicht die
billigsten Zigaretten zu rauchen brauchen, und er
hätte nicht in ungebügelten Anzügen zu nutzlosen
Interviews zu kommen brauchen. Roger Grady hatte
ihm oft genug vorgeworfen, es sei idiotisch, den Wa-
gen in der Garage stehen zu lassen, wo jede Woche
Geld kostete; Roger hatte nochmals davon angefan-
gen, als er Murray die unglaubliche Mitteilung mach-
te, daß Sam Blizzard Schauspieler für Delgados neues
Stück suchte und Murray Douglas engagieren wollte.
Murray
dachte
an
dieses
Gespräch
mit
Roger
zurück.
Murray hatte selbstverständlich schon von Delgado
gehört. Der Autor stammte aus Argentinien. Er hatte
schon früher einen Film gedreht, als der einzige süd-
amerikanische Name, der einigermaßen bekannt war,
Leopoldo Torre-Nilsson hieß. Murray hatte den Film
nicht selbst gesehen – er war nur auf irgendeinem ob-

skuren Festival gezeigt worden –, aber er kannte eini-
ge Leute, die ihn gesehen hatten und als phantastisch
bezeichneten. Eine Comédie noire, die das Ende aller
Comédies noires bedeutete.
Delgados Ruf bei seiner Ankunft in Europa war auf
diesem Film begründet, und vergangenes Jahr hatte
Jean-Paul Garrigue, einer der besten jungen Schau-
spieler in Paris, die Hauptrolle des Experimentier-
stücks übernommen, von dem Burnett und Heston-
Wood gesprochen hatten. Murray hatte auch dieses
Stück nicht gesehen; er war damals bereits im Sanato-
rium gewesen. Aber er hatte die Kritiken gelesen; die
Kritiker waren teilweise begeistert gewesen.
Dann hatte Garrigue Selbstmord begangen. Dieser
kurzlebigen Sensation war monatelanges Schweigen
gefolgt. Man hätte glauben können, Garrigues De-
pression sei ansteckend, denn Delgado schien nicht
mehr imstande zu sein, andere zu begeistern.
Und dann kam Roger mit der Nachricht.
»Ob ich annehme?« wiederholte Murray und
schüttelte verblüfft den Kopf. »Blizzard will mich en-
gagieren, und ich könnte da noch zögern? Bist du
verrückt geworden, Roger?«
»Ich kenne einige Leute, die nicht annehmen wür-
den«, sagte Roger nach einer kurzen Pause.
»Warum? Du lieber Gott, Delgado ist doch letztes
Jahr von der Kritik in den Himmel gehoben worden!«

»Ganz recht.« Roger starrte seine Zigarre an. »Du
bist seitdem natürlich nicht mehr ganz auf dem lau-
fenden. Du hörst kaum noch Gerüchte, verstehst du?
Ich behaupte nicht, daß die Sache keine große Chance
wäre, oder daß du sie nicht verdient hättest, seitdem
du dich so zusammengerissen hast. Aber ich muß dir
auch sagen, daß es einige Leute gibt, die keine Rolle
in Delgados Stück übernehmen würden, selbst wenn
sie dafür tausend Pfund täglich bekämen.«
»Warum nicht?«
»Weil Garrigue Selbstmord begangen hat. Weil Léa
Martinez in einer Nervenheilanstalt sitzt. Weil Clau-
dette Myrin ihre kleine Tochter ermorden wollte.«
Roger sprach völlig ernsthaft, und sein Gesichtsaus-
druck hatte sich verändert.
»Das mit den Mädchen habe ich nicht gewußt«, gab
Murray zu. »Sie haben in Paris mitgespielt, nicht
wahr? Aber hör zu, Roger, das heißt doch nur, daß
ein paar Abergläubische sich einbilden, Delgado habe
diesen Leuten Unglück gebracht.«
»Mehr oder weniger.«
»Hast du schon einmal erlebt, daß ich abergläu-
bisch bin, Roger?«
»Nein.« Der Agent seufzte. »Aber ich mußte dich
trotzdem warnen. Ich habe erst gestern mit jemand
über diese Sache gesprochen, der sofort ablehnte, be-
vor ich überhaupt ein Angebot machen konnte. Bliz-

zard hat einige verrückte Vorstellungen davon, wel-
che Leute er haben oder nicht haben will ...«
»Gehöre ich auch dazu, Roger?« warf Murray ein.
»Nein. Wirklich nicht, Murray. Bildest du dir ein,
ich sei dumm genug, jemandem vierhundert Pfund
zu leihen, wenn ich annehmen müßte, der Betreffen-
de habe keine Aussichten mehr in seinem Beruf?
Nein, ich bin davon überzeugt, daß du es wieder
schaffen wirst – vielleicht sogar besser als zuvor, weil
du dich jetzt nicht mehr auf dein gutes Aussehen ver-
lassen kannst.« Roger wußte, daß er mit Murray offen
sprechen konnte. »Aber du bist bisher das einzige
Mitglied des Ensembles, das mir vertrauenerweckend
erscheint. Ich bin allerdings nicht dafür verantwort-
lich, und Blizzard hat einen harten Kopf. Außerdem
hast du auf jeden Fall die Chance, die Kritiker zu be-
eindrucken, selbst wenn das dämliche Stück schon
nach drei oder vier Tagen abgesetzt werden müßte.«
»Du bist nur froh, daß ich dich auf diese Weise ei-
nige Wochen lang nicht mehr belästigen kann«, stellte
Murray vorwurfsvoll fest.
»Du wirst allmählich verdammt lästig, Murray,
und du schuldest mir einen Haufen Geld. Dabei ver-
dankst du es nur meinem Langmut, daß ich dich
nicht schon längst vor die Tür gesetzt habe. Du
kämpfst nicht gern, mein Junge, und du läßt es dir
auch anmerken!«

»Schon gut, schon gut«, lenkte Murray ab. »Erzähl
mir lieber mehr von dieser Sache. Die Gage spielt
keine Rolle. Im Augenblick würde ich auch eine
Komparsenrolle übernehmen.«
»Du hast zum Glück etwas mehr zu erwarten. Da-
bei ist Geld zu verdienen, alter Junge! Blizzard hat ei-
nen bankrotten Klub namens Fieldfare House bei
Bedford übernommen und will dort das Ensemble
unterbringen, bis das Stück in London aufgeführt
wird. Wahrscheinlich soll es Amaranth im Margrave-
Theater ablösen; Amaranth zieht schon lange nicht
mehr recht. Vielleicht habt ihr Gelegenheit, eine Wo-
che vor der Londoner Aufführung in der Provinz zu
proben, aber wahrscheinlich kommt ihr gleich in vier
Wochen ins Margrave-Theater.«
»Hast du vier Wochen gesagt?«
»Nein, Blizzard hat davon gesprochen. Du kannst
selbst mit ihm darüber diskutieren, alter Junge. Dazu
hast du genügend Zeit – er erwartet dich am Freitag
in seinem Klub.«
Am Freitag fuhr Murray eine Stunde früher als er-
wartet, weil er das Mittagessen hatte ausfallen lassen,
an dem verblichenen Hinweisschild vorbei, das in
Richtung Fieldfare House zeigte.

3
Die kiesbestreute Auffahrt zweigte von einer schma-
len Nebenstraße ab und führte durch einen weitläufi-
gen Park. Murray vermutete, daß der Klub auch we-
gen dieses Grundstücks Bankrott gemacht haben
mußte, das ungewöhnlich großzügig angelegt und
bepflanzt war. Hinter dem Hauptgebäude sah er den
erhöhten Rand eines Schwimmbeckens.
Das große Haus aus grauem Stein und roten Zie-
geln war bis zur Dachrinne mit Efeu bewachsen. Es
wirkte unbewohnt; die Fenster waren schmutzig, und
im Parterre waren die Fensterläden einiger Zimmer
geschlossen. Links neben dem Eingang wartete ein
geräumiger Parkplatz auf die Fahrzeuge der Besu-
cher.
Murray stellte den Wagen dort ab, schaltete die
Zündung aus und erschrak fast, als es um ihn herum
totenstill blieb. Er mußte die Befürchtung unterdrük-
ken, dies sei alles nur ein alkoholisierter Wunsch-
traum. Hatte Blizzard nie nach ihm gefragt? War er
vergebens zu diesem menschenleeren Haus gefah-
ren?
Er zog den Zündschlüssel ab und stieg langsam
aus. Dann knallte er die Wagentür zu und öffnete den
Kofferraum. Er griff nach seiner Reisetasche.

»Sie sind bestimmt Mister Murray Douglas.«
Die leise Stimme kam völlig unerwartet. Murray
ließ den Kofferraumdeckel krachend zufallen. Rechts
neben ihm stand ein Mann unbestimmbaren Alters;
er trug einen schwarzen Anzug und eine schwarze
Krawatte. Murray hatte nicht einmal den Kies unter
seinen Füßen knirschen gehört.
»Ja, das bin ich«, antwortete Murray unsicher. »Sie
scheinen mich erwartet zu haben.«
»Ganz recht, Sir. Ich heiße Valentine und bin hier
Butler. Darf ich Ihre Tasche nehmen und Ihnen Ihr
Zimmer zeigen?«
Murray schüttelte verblüfft den Kopf. Er starrte Va-
lentine an, betrachtete das blasse, faltenlose Gesicht
mit den dunklen Augen und stellte fest, daß der
Mann ihn an einen Beerdigungsunternehmer erinner-
te.
»Ihre Tasche, Sir?«
»Oh ... bitte sehr. Ist Mister Blizzard schon ange-
kommen?«
»Nein, Sir. Sie sind der erste. Ich erwarte Mister
Blizzard gegen sechs Uhr, und Mister Delgado beglei-
tet ihn vermutlich. Die übrigen Mitglieder des En-
sembles dürften im Laufe des Nachmittags eintreffen.
Folgen Sie mir bitte, Sir.«
Valentine wandte sich ab. Obwohl er jetzt die Rei-
setasche trug, knirschte der Kies unter seinen Füßen

nicht. Murray hatte das Gefühl, neben einem Ge-
spenst zu gehen, das ihn in die riesige Eingangshalle
des Hauptgebäudes führte, über der sich eine Glas-
kuppel wölbte. Hier und entlang der Treppe zum er-
sten Stock waren überall Dekorationsstücke aus der
Zeit des Klubs übriggeblieben: Stiche von Jagdsze-
nen, Waldhörner, Geweihe, alte Waffen und ein Ti-
gerfell vor dem gewaltigen Kamin.
Der Butler führte Murray in den ersten Stock hin-
auf, wo ein langer Korridor nach rechts abzweigte.
Murray vermutete, daß er sich hier in einem neuen
Seitenflügel des Hauses befand, den er von der Ein-
fahrt aus nicht gesehen hatte.
»Ihr Zimmer, Sir«, stellte Valentine fest und steckte
einen Schlüssel in die letzte Tür. »Nummer Vier-
zehn.«
Murray fiel auf, daß die vorletzte Tür die Nummer
Dreizehn trug, und er fragte sich, ob dieser Raum
leerstehen würde. Oder sollte dort jemand unterge-
bracht werden, der von sich behauptete, er sei durch-
aus nicht abergläubisch? Dann folgte er dem Butler in
sein Zimmer und vergaß diese Frage wieder. Statt
dessen stieß er einen leisen Pfiff aus.
Der quadratische Raum war mit Ahorn getäfelt.
Neben dem niedrigen Bett standen zwei moderne
Tischchen; auf einem hatte das Telefon seinen Platz
gefunden, auf dem andern stand eine große Vase voll

Blumen. An der Wand über dem Bett hing die Re-
produktion eines Gemäldes von Picasso. Das breite
Fenster war von flaschengrünen Vorhängen einge-
rahmt und gab den Blick auf den Rasen hinter dem
Haus frei. Auf einem weißen Gestell am Fenster stand
ein Fernsehgerät; in bequemer Reichweite des Schau-
kelstuhls lagen einige Nummern von Acting und an-
dere Magazine in einem Zeitungsständer.
Murray nickte beeindruckt und ging ans Fenster.
Als er sich umdrehte, sah er, daß Valentine seine Ta-
sche auspacken wollte.
»Nein, lassen Sie das, Valentine«, forderte Murray
ihn auf. »Hier.« Er suchte nach Trinkgeld, aber Valen-
tine hob abwehrend die Hand.
»Das ist nicht notwendig, Sir Mister Blizzard zahlt
mir ein sehr großzügiges Gehalt.«
»Aha.« Murray zuckte mit den Schultern und
steckte das Kleingeld wieder ein. »Hören Sie, gibt es
hier schon eine Art Stundenplan?« Er begann die Ta-
sche auszupacken.
»Soviel ich weiß, hängt alles von Mister Delgado
und den Fortschritten ab, die das Stück macht, Sir.
Heute abend wird um halb acht gegessen; anschlie-
ßend will Mister Delgado die Anwesenden selbst
kennenlernen und ihnen Gelegenheit zu Fragen und
Vorschlägen geben.«
»Ausgezeichnet. Waren Sie übrigens schon früher

hier im Klub beschäftigt?« Murray legte Socken und
Hemden in die dafür vorgesehenen Schubladen der
Kommode, nahm seinen zweiten Anzug und ging
damit an den Einbaukleiderschrank.
»Nein, Sir. Mister Blizzard hat mich angestellt. Ich
bin hier ebenso fremd wie Sie.«
»Der alte Blizzard zieht die Sache gleich richtig auf,
was?« Murray öffnete die Tür des Kleiderschranks,
blieb wie gelähmt stehen und achtete kaum auf Va-
lentines Antwort.
»Das kann ich nicht beurteilen, Sir. Dazu bin ich zu
wenig mit dem Theaterleben vertraut. Ist etwas nicht
in Ordnung, Sir?«
Murray gab sich einen Ruck. »Ja«, bestätigte er
grimmig. »Das hier.« Er öffnete die Tür ganz, nahm
eine Flasche White Horse aus dem untersten Fach
und drückte sie Valentine in die Hand.
»Und das! Und das! Und das!« Murray holte weite-
re Flaschen aus dem Schrank – Booth's Dry Gin, Le-
mon Hart Rum und Cognac Hennessy. Er sah auch
Gläser, eine Flasche Sodawasser und Flaschen mit Zi-
tronen- und Orangenkonzentrat – aber das alles war
ungefährlich. Murray schwitzte, als er sich wieder
Valentine zuwandte, der mit den Flaschen in den
Armen und einem höflich fragenden Ausdruck auf
dem Gesicht vor ihm stand.
»Schaffen Sie das Zeug fort«, wies Murray ihn an.

»Hat Blizzard Ihnen gesagt, Sie sollten es mir brin-
gen?«
»Ganz recht, Sir. Mister Blizzard hat mich beauf-
tragt, für Erfrischungen in den Zimmern der Gäste zu
sorgen.«
»Schön, lassen wir das. Bringen Sie das Zeug weg.
Erfrischungen! Hm ... Sie können mir ein paar Dosen
Obstsaft bringen.«
»Sehr wohl, Sir.« Valentine ließ sich nicht anmer-
ken, ob er wußte, weshalb Murray so erregt war. »Ist
das vorläufig alles?«
»Ja.« Murray kehrte ihm den Rücken zu.
Es würde nicht leicht sein. Aber das hatte er von An-
fang an gewußt. Im Sanatorium war er gewarnt wor-
den, daß es unter Umständen einige Jahre dauern
konnte, bevor er ein Glas Bier riskieren durfte. Mur-
ray war sich darüber im klaren, daß er keinen Trop-
fen Alkohol trinken durfte, bevor er nicht fünf Jahre
lang beruflich erfolgreich gewesen war; sonst würde
er wieder in die Gosse hinabsinken und dort bleiben.
Murray Douglas hielt nicht sonderlich viel von
Murray Douglas. Aber in der Gosse würde er nur
noch Haß für ihn empfinden.
Er hatte noch einige Beruhigungspillen übrig, die
er im Sanatorium bekommen hatte. Er nahm die klei-
ne Schachtel aus der Reisetasche, ging ans Waschbek-

ken und schluckte eine Pille mit etwas Wasser. Einige
Minuten später fühlte er sich bereits besser.
Sein Gepäck konnte bis später warten. Im Augen-
blick wollte er sich in dem ehemaligen Klub orientie-
ren, in dem er gelandet war. Valentine hatte den
Zimmerschlüssel außen in der Tür stecken lassen. Er
schloß die Tür ab und begann seine Entdeckungsrei-
se.
Das Innere des großen Hauses hielt ihn nicht lange
auf. Von der Eingangshalle aus führte eine Tür in den
geräumigen Speisesaal; andere Türen führten in den
Aufenthaltsraum mit der Bar, in eine Bibliothek und
zu den Wirtschaftsräumen. Murray hob sich die eine
Tür, die seiner Meinung nach in den neuen Seitenflü-
gel führte, bis zuletzt auf. Dahinter lag jedoch kein
Korridor, sondern ein vollständig eingerichtetes klei-
nes Theater mit etwa sechzig Plätzen, zwei Kinopro-
jektoren und einer überraschend weiträumigen Büh-
ne.
Murray pfiff anerkennend. Blizzard hatte diesen
Klub absichtlich ausgewählt! Es war bestimmt nicht
leicht gewesen, etwas Passendes zu finden. Plötzlich
kam ihm die Idee, ein Stück innerhalb von vier Wo-
chen auf die Beine zu stellen, nicht mehr so unwahr-
scheinlich vor. Autor, Ensemble, Produzent – und
vermutlich auch Bühnenbildner, Beleuchter und so
weiter – unter einem Dach, wo es ein Miniaturtheater

für Proben gab. Das konnte wesentlich produktiver
als die gewohnte Arbeitsweise sein, bei der sich die
Schauspieler nach den Proben wieder verliefen.
Nach einem letzten Blick auf die leeren Sitzreihen
verließ Murray das Theater. In der großen Halle
glaubte er Valentine zu sehen, mußte aber feststellen,
daß es sich um einen Diener gehandelt hatte; der
Mann sah Valentine allerdings ähnlich, war nur et-
was größer und trug ebenfalls einen schwarzen An-
zug. Die Eingangstür stand offen. Murray schloß das
Verdeck seines Wagens, weil es nach Regen aussah,
und ging dann ums Haus, um den Park zu besichti-
gen.
Hinter dem Hauptgebäude lag ein großes
Schwimmbecken, das jetzt allerdings kein Wasser
enthielt. Weite Rasenflächen und ein Tennisplatz
schlossen sich an. Den Abschluß bildete in dieser
Richtung ein Tannenwäldchen, das Murray bereits
von seinem Zimmer aus gesehen hatte. Er folgte ei-
nem Fußpfad zwischen den Bäumen und hatte das
Haus bereits aus den Augen verloren, als er auf den
Zaun stieß.
Dieser Zaun war fast zweieinhalb Meter hoch, be-
stand aus schwerem Maschendraht und wurde oben
durch einen dreifachen Stacheldraht wirkungsvoll
abgeschlossen. Murray wußte nicht, ob der Klub oder
der Grundstücksnachbar ihn errichtet hatte.

Murray wandte sich ab. In entgegengesetzter Rich-
tung hatte er genügend freie Fläche vor sich, und was
außerhalb des Zauns geschah, brauchte ihn nicht zu
interessieren. Gleichzeitig überlegte er sich, daß es ei-
gentlich schade war, hier nur zu arbeiten. Hier hätte
er sich nach seiner Entziehungskur wunderbar erho-
len können – wenn er das Geld dazu gehabt hätte.
Er näherte sich bereits wieder dem Haus, als er ei-
nen Wagen vorfahren hörte. Er ging schneller, denn
er war neugierig, wen Blizzard sonst noch für dieses
Unternehmen eingefangen hatte, das in so unerwartet
luxuriösem Rahmen stattfand.

4
Als Murray den Butler anwies, die Flaschen aus sei-
nem Zimmer zu entfernen, war ihm eingefallen, es
könnte schwierig sein, einen Drink abzulehnen, wenn
sich alle zum Abendessen versammelten. Als die
zehn oder zwölf Mitglieder des Ensembles sich um
halb neun nach dem Essen im Aufenthaltsraum an
der Bar versammelten, wo die von Valentine erwähn-
te Diskussion stattfinden sollte, fühlte Murray sich
versucht, seine Sorgen in Alkohol zu ertränken.
Irgendwie brachte er es trotzdem fertig, nicht zu
Valentine und den beiden Dienern hinüberzusehen –
alle drei gleich gekleidet und gleich schweigsam –,
die jetzt auf Wunsch Drinks servierten. Die Bar in der
Ecke war vor dem Abendessen geöffnet worden, und
die vorhandenen Alkoholvorräte hatten seitdem
sichtlich abgenommen. Die Luft wurde stickig, weil
alle rauchten; irgend jemand hatte einige Schallplat-
ten gefunden und legte sie nacheinander auf den
Plattenspieler in der Ecke. Die Anwesenden lachten
und sprachen überlaut, so daß die Versammlung eher
an eine Party als an eine grundsätzliche Besprechung
erinnerte.
Nur Murray hockte allein in einem großen Lehn-
sessel, hielt ein Glas Zitronensaft mit beiden Händen

umklammert und runzelte die Stirn, während er zu-
hörte und beobachtete.
Die Unterhaltung drehte sich meistens um die bei
Schauspielern so beliebten Themen – Klatsch, Eigen-
lob und die Unfähigkeit aller Kritiker. Bisher hatte
noch niemand Murrays Zusammenstoß mit Pat Bur-
nett erwähnt, und Murray war froh darüber. Viel-
leicht war es Heston-Wood gelungen, seinen Kolle-
gen zu beruhigen. Natürlich würden die Leute früher
oder später davon erfahren, aber wenigstens hatten
die Abendzeitungen noch nichts darüber gebracht.
Gelegentlich erhitzten sich die Gemüter, wenn ein
allgemein interessierendes Thema angeschnitten
wurde: die Aussichten dieses Unternehmens und der
Wert der Improvisation als Grundlage eines Bühnen-
stücks. Murray hatte in den letzten Tagen viel dar-
über nachgedacht und rechnete mit einer ernsthaften
Diskussion. Aber er hatte nicht den Mut, sie zu be-
ginnen. Er wußte jetzt, wen Blizzard außer ihm enga-
giert hatte, und er wollte möglichst wenig mit diesen
Leuten zu tun haben.
Blizzard und Delgado waren nicht zum Abendes-
sen erschienen. Valentine hatte den Schauspielern er-
klärt, die beiden hätten noch einige Probleme zu be-
sprechen und zögen es deshalb vor, allein zu essen.
Murray glaubte nicht recht daran. Er hatte eher den
Eindruck, dieser Delgado wolle sich mit der Aura des

Geheimnisvollen umgeben. Bisher hatte ihn noch
niemand zu Gesicht bekommen.
Allerdings schien das niemand zu stören. Alle wa-
ren mit dem guten Essen und den kostenlosen Drinks
mehr als zufrieden.
Murray sah sich um. Die lautere der beiden kleinen
Gruppen bestand aus fünf Leuten; mit vier von ihnen
hatte er bereits zusammengearbeitet. Dort saß Ida
Marr, rothaarig, noch immer schlank, aber nicht mehr
die Jüngste, was an den Krähenfüßen und den Falten
am Hals zu sehen war; sie posierte bewußt – aber sie
führte sich stets so auf, als stehe sie auf der Bühne.
Neben ihr saß Gerry Hoarding; er wirkte sogar jünger
als vierundzwanzig, wenn man das hagere Gesicht
unter dem wirren Blondschopf sah. Hoarding sollte
ihr Bühnenbildner sein; er hatte ohne Zweifel Talent,
aber ...
Rechts neben Ida saß Adrian Gardner, der in den
letzten Jahren etwas Fett angesetzt hatte. Murray hat-
te in Skeleton mit ihm auf der Bühne gestanden und
kannte ihn als gut durchschnittlich begabten Schau-
spieler. Aber auch er ...
Er hatte Constant Baines vor fast zehn Jahren in ei-
nem Repertoiretheater kennengelernt. Constant saß
neben Adrian und beteiligte sich nur selten an der
Unterhaltung. Er war immer auf der gleichen Stufe
stehengeblieben als Murray das West End erreicht

hatte; keiner von ihnen hatte sich über dieses Zu-
sammentreffen gefreut, und sie hatten sich eisig be-
grüßt.
Und noch jemand. Ida machte eine Bemerkung, die
Murray nicht verstand, die anderen lachten, und das
Mädchen, das zu Idas Füßen auf einem Kissen saß,
hob den Kopf Ida wurde auf die Bewegung aufmerk-
sam und strich dem Mädchen rasch übers Haar.
Wahrscheinlich ihre letzte Eroberung. Gräßlich.
Murray runzelte die Stirn. Er hatte das Mädchen noch
nie gesehen und vermutete, daß es von irgendeinem
Provinztheater kam; beim Abendessen hatte er ge-
hört, daß es Heather hieß. Es war bestimmt nicht älter
als zwanzig. Seine langen Haare waren rabenschwarz
und umrahmten ein interessant geschnittenes Ge-
sicht. Auch die Figur in dem knappen roten Kleid
war sehenswert.
Wirklich eine Schande!
Murray zuckte mit den Schultern. In diesem Au-
genblick verstummte die Unterhaltung; er hob den
Kopf und stellte fest, daß Blizzard in Begleitung eines
Mannes hereingekommen war, der nur der berühmte
Manuel Delgado sein konnte.
Blizzard – dick, im dunkelblauen Zweireiher, mit
einer gewaltigen Zigarre in der Hand – stapfte durch
den Raum und grüßte nach rechts und links. »Ida,
meine Liebe, ich bin entzückt! Hallo, Murray! Freut

mich, daß Sie sich uns angeschlossen haben! Und die
kleine Heather – wie geht's bisher, Süße?«
Aber niemand achtete wirklich auf ihn. Alle starr-
ten nur Delgado an.
Das Gesicht des Autors trug einen merkwürdigen
Ausdruck. Wie das einer Schlange? Ja, entschied
Murray nach kurzem Zögern. Man hatte den Ein-
druck, die Augen seien lidlos. Delgado war mittel-
groß und schlank; er hatte das dunkle Haar und die
gebräunte Haut eines Südamerikaners; er war ele-
gant, aber nicht auffällig gekleidet und hielt sich sehr
gut. Man hätte ihn eher für einen Schauspieler halten
können, als ... nun, zum Beispiel Constant Baines, der
eher wie ein erfolgloser Buchhalter wirkte.
Murray erwiderte den Blick dieser schwarzen Au-
gen und hatte das Gefühl, abgeschätzt und gewogen
zu werden. Dann wandte Delgado sich ab, und Mur-
ray stellte fest, daß dieser Vorgang sich bei jedem von
ihnen wiederholte.
»Alle mal herhören!« Blizzard hatte hinter einem
Tisch an der Längsseite des Raums Platz genommen,
so daß er die Schauspieler vor sich hatte. »Manuel?«
Delgado nickte und ging um den Tisch herum.
Murray fiel auf, wie geschmeidig er sich bewegte; er
sah zu Adrian Gardner hinüber. Tatsächlich! Ade
beobachtete diesen graziösen Gang. Murray hätte am
liebsten zum erstenmal seit seiner Ankunft gelacht,

aber er unterdrückte diesen Impuls, weil Blizzard
jetzt wieder das Wort ergriff.
»Na, ich schätze, daß Sie alle diese ganze Sache für
ziemlich verrückt halten, was?«
Das Mädchen Heather kicherte nervös, und Adrian
machte irgendeine unverständliche Bemerkung.
»Das habe ich mir gedacht.« Blizzard lächelte jetzt
nicht mehr. »Schön, ab sofort gibt es keinen Grund
mehr dafür! Dieses Haus ist kein vornehmer Klub,
sondern nur zufällig der ideale Rahmen für unser
Unternehmen. Wie viele von Ihnen haben das Theater
im Seitenflügel gesehen?«
Blizzard machte eine erwartungsvolle Pause. »Was,
nur Murray hat es sich angesehen?« fragte er dann
enttäuscht. »Du lieber Gott! Seht es euch gefälligst
nach der Diskussion an, ja? Es wird euch gefallen.
Schön, kommen wir also zur Sache.
Ihr wißt alle, was wir hier erreichen wollen. Wir
haben uns etwas vorgenommen, das wirklich nicht
leicht ist, aber Manuel hat es bereits zwei- oder drei-
mal mit solchem Erfolg vorexerziert, daß die Kritiker
noch immer nicht zur Ruhe gekommen sind. Viele
Leute wären froh, wenn sie nur einmal solchen Erfolg
hätten, bevor sie sterben.«
»Jean-Paul Garrigue?« murmelte Constant im rich-
tigen Augenblick. Die anderen drehten sich nach ihm
um.

»Constant,
das
war
nicht
witzig«,
stellte
Adrian
fest.
»Es war auch nicht witzig gemeint«, antwortete
Constant.
Wie reagierten die anderen? Murray sah sich um
und glaubte ein leichtes Lächeln auf Delgados schma-
len Lippen erkannt zu haben, das sofort wieder ver-
schwand. Er war plötzlich neugierig auf Delgados
Ausführungen.
»Tut mir leid, Manuel«, flüsterte Blizzard dem Au-
tor zu. Delgado nickte geistesabwesend, zündete sich
eine Zigarette an und beugte sich leicht vor.
»Soll ich mir deswegen Gewissensbisse machen?«
fragte er. Er sprach gutes Englisch mit spanischem
Akzent und amerikanisch gefärbter Aussprache. »Sie
sind sich hoffentlich darüber im klaren, daß Jean-Paul
das Stück nicht zu diesem ... diesem Erfolg hätte füh-
ren können, wenn er nicht dem Selbstmord nahe ge-
wesen wäre.«
Sein Gesicht verschwamm in einer Rauchwolke. Er
legte den Kopf schief und erinnerte Murray dadurch
noch mehr an ein Reptil. »Sie alle kennen mich bisher
noch nicht. Ich habe natürlich einen gewissen Ruf,
und einige von Ihnen haben vielleicht meinen Film
gesehen. Aber keiner von Ihnen hat Trois Fois gese-
hen, sonst wäre er jetzt nicht hier. Ich habe kein Inter-
esse daran, mich zu wiederholen. Ich bin nur an et-
was anderem interessiert. Hören Sie zu, dann erzähle

ich es Ihnen, und wenn ich das sage, befehle ich Ih-
nen zuzuhören, weil Sie damit leben werden.«
Murray beugte sich in seinem Sessel nach vorn. Er
hatte im Lauf seiner Karriere als Schauspieler genü-
gend Gelegenheit gehabt, mit begabten Schriftstellern
und Regisseuren zusammenzukommen; er konnte
sich an etwa ein halbes Dutzend arroganter Genies
erinnern. Dieser Mann gehörte unzweifelhaft dazu.
Delgado machte eine kurze Pause, bevor er weiter-
sprach. »Wir hören immer und überall die gleichen
Feststellungen, und wir wissen, daß sie wahr sind. Sie
werden in gelehrten Abhandlungen, in langen Bü-
chern, in Predigten und in philosophischen Semina-
ren getroffen. Wir befinden uns in einer Periode des
Verfalls. Nicht Dekadenz, sondern Verfall. Hier ist
eine Beschreibung eines Mannes dieser Zeit, die so
großen Wert auf die persönliche Freiheit des einzel-
nen Menschen legt.
Dieser Mann gleicht einer Marionette und ist inner-
lich verdorben. Kennen Sie ihn? Er hat kein bestimm-
tes Ziel. Er gilt allgemein als Individualist, aber inner-
lich schämt er sich seiner Wünsche, die ihm doch ei-
gentlich nur vergessen helfen, daß er ständig Ent-
scheidungen treffen muß, denen er im Grunde ge-
nommen nicht gewachsen ist. Er klammert sich an ir-
gend etwas; er imitiert seine Nachbarn, um sich nicht
selbst entscheiden zu müssen; er hat Kinder, in denen

er einen Schatten seiner selbst über die Zeit hinweg-
retten will, und er bringt es fertig, auch ihre Jugend
zu verderben. Schließlich wird er zum Trinker und
tröstet sich mit Alkohol.« Hier sah Delgado zu Mur-
ray hinüber, und Murray fühlte sich wie ein kleiner
Junge, der in der Schule unartig gewesen ist.
»Er widert mich an, und er widert Sie an. Jeder
kennt ihn, aber niemand versteht ihn, so daß seinet-
wegen nichts unternommen wird. Das interessiert
mich, und für die nächsten vier Wochen – und solan-
ge das Stück später in London oder sonstwo aufge-
führt wird – werden Sie sich dafür interessieren müs-
sen. Ist das klar?«
Delgado drückte seine Zigarette aus, lehnte sich in
den Sessel zurück und sah von einem zum anderen,
als habe er eine Herausforderung vorgetragen und
erwarte nun eine Antwort darauf.
Die anderen schwiegen. Schließlich ergriff Ida das
Wort.
»Bedeutet das, Mister Delgado, daß das Ergebnis
unserer ... unserer kollektiven Anstrengungen ein ge-
sellschaftskritisches Stück sein soll?«
»Nein, ich habe nicht die Absicht, den Anstoß zu
einer Reform zu geben.« Delgado sprach absichtlich
gelassen. »Ich bin ein Künstler, kein Arzt. Meine Spe-
zialität sind Krebs und Wundbrand in einem Stadi-
um, in dem es keine Hoffnung mehr geben kann.«

Er schob einen Sessel zurück und erhob sich.
»Wir treffen uns morgen früh um halb zehn zu ei-
ner vorläufigen Diskussion des Gesamtthemas. Gute
Nacht.«

5
Als Delgado den Raum verlassen hatte, spürte Mur-
ray vor allem das Bedürfnis nach frischer Luft. Er hat-
te mit Blizzard über die Flaschen sprechen wollen,
die er in seinem Zimmer gefunden hatte, aber das
war vorläufig nicht weiter wichtig. Während die an-
deren dort weitermachten, wo sie durch Delgados
Auftritt unterbrochen worden waren, ging Murray
nach draußen. Er setzte sich auf die niedrige Steinba-
lustrade am Eingang, zündete sich eine Zigarette an
und betrachtete nachdenklich die dunklen Büsche
entlang der Auffahrt.
Er schrak auf, als er eine Stimme hinter sich hörte.
»Mister Douglas? Sie sind doch Murray Douglas,
nicht wahr?«
Murray drehte sich halb um und sah Heather in
der Tür stehen.
»Oh, hallo. Hat Ida Sie einen Augenblick von der
Leine gelassen?« Er hatte nicht boshaft sein wollen,
aber in seiner trübseligen Stimmung fiel ihm nichts
anderes ein.
»Wie bitte? Ich weiß nicht ...?«
»Macht nichts. Ja, ich bin Murray Douglas.« Er
warf seine Zigarette fort. »Warum?«
»Ich dachte, Sie müßten es sein, aber ich wollte

niemand fragen.« Heather kicherte nervös. »Ich kann
mich einfach nicht daran gewöhnen. Ich habe das Ge-
fühl, ich müßte wie früher von einem zum anderen
gehen und um Autogramme bitten.«
»Hier, setzen Sie sich«, forderte Murray sie auf und
rückte zur Seite. »Zigarette?«
»Nein, danke, Mister Douglas. Ich habe heute
abend schon zuviel geraucht.« Sie kam näher und
setzte sich neben ihn. »Was halten Sie von der ganzen
Sache, Mister Douglas?« fragte sie nach einer kurzen
Pause. »Ich habe noch nie etwas Ähnliches gehört –
und Sie?«
»Nennen Sie mich nicht immer Mister«, sagte Mur-
ray. »Ich sehe wahrscheinlich alt genug aus, um Ihr
Vater zu sein, aber ich bin es nicht.«
Sie holte erschrocken Luft. »Das tut mir wirklich
leid!«
Murray zögerte und lachte dann. »Schon gut. Wie
heißen Sie überhaupt? Bisher weiß ich nur Ihren Vor-
namen.«
»Heather Carson.«
Unbekannt. »Und wie sind Sie hier gelandet, Hea-
ther?«
»Nun, das weiß ich selbst nicht recht.« Wieder ein
nervöses Kichern. »Ich war zwei Jahre lang auf der
Gourlay-Schule und bin seitdem in Southampton en-
gagiert gewesen. Anscheinend ist Mister Blizzard auf

mich aufmerksam geworden; er war vor einigen Mo-
naten bei uns, und dann ... nun, dann bin ich eingela-
den worden.«
Murray war verblüfft; er hätte nie erwartet, daß ein
Mädchen wie Heather ausgerechnet die Gourlay-
Schule absolvieren würde, die als besonders streng
galt. Nun, das spielte keine Rolle. Offenbar hatte er
sich auch geirrt, als er eine Verbindung mit Ida an-
nahm, denn sonst hätte das Mädchen bestimmt da-
von gesprochen.
Heather wiederholte ihre ursprüngliche Frage.
»Was halten Sie von der ganzen Sache ... äh ... Mur-
ray?«
»Wollen Sie es wirklich wissen?« Er zündete sich
eine Zigarette an. »Schön, ich erzähle Ihnen gern, was
mir bisher aufgefallen ist. Delgado weiß, was er tut.
Sam Blizzard weiß es nicht. Ich habe in London ge-
hört, wie Burnett von der Gazette behauptet hat, Sam
habe sein Ensemble aus Taugenichtsen und abgehalf-
terten Schauspielern zusammengestellt. Wenn man
von Ihnen absieht, hat er mit dieser Meinung ver-
dammt recht. Ich habe noch nie eine derartige Ver-
sammlung von zweitklassigen Leuten gesehen.«
Heather schwieg betroffen. Dann sagte sie leise:
»Aber das verstehe ich nicht. Sie sind doch auch hier.
Ich meine, Sie waren doch sechs oder sieben Jahre
lang ein Star.«

Murray stand auf. »Das war einmal«, stellte er fest.
Ȇberlegen Sie doch selbst, wen wir hier haben. Ich
bin der Mann, der Hauptrollen im West End spielte,
bevor er zu trinken begann und innerhalb weniger
Monate bei Agenten betteln gehen mußte. Ida Marr
ist ... äh, lassen wir das. Wenn Sie es noch nicht wis-
sen, werden Sie es bald genug merken. Adrian Gard-
ner ist ein ähnlicher Fall. Erinnern Sie sich nicht an
den Skandal, als Ade in Oxford einen Vierzehnjähri-
gen von der Straße aufgelesen hatte? Damals wäre er
fast hinter Gittern gelandet. Das Privatleben anderer
Leute ist mir piepegal, solange es wirklich privat
bleibt, aber Ade fällt immer wieder öffentlich auf.
Dann ist Gerry Hoarding an der Reihe. Gerry war ein
Wunderkind wie ich, nicht wahr? Vor einigen Jahren
behaupteten die Leute noch, seine Bühnenbilder seien
der Beginn einer neuen Epoche der Theatergeschich-
te. Warum ist er Ihrer Meinung nach hier, anstatt in
einem Appartement in Mayfair zu sitzen und sich die
besten Aufträge auszusuchen?«
»Warum?« fragte Heather. Ihre angenehme Stimme
zitterte leicht.
Murray holte tief Luft. »Lassen wir das. Ich will
kein Pharisäer sein.«
»Nein, Sie dürfen jetzt nicht aufhören. Sonst kann
ich nicht beurteilen, ob Sie nur verbittert sind oder ...«
Er zuckte mit den Schultern. »Gut, meinetwegen.

Der arme Kerl ist rauschgiftsüchtig. Ohne Schnee
kann er nicht arbeiten. Hat er seine Tagesration weg,
ist er so unzuverlässig, daß niemand ihn haben will.
Mir ist es damals ähnlich gegangen, als ich getrunken
habe. Zufrieden?«
Murray wartete noch einen Augenblick, aber Hea-
ther antwortete nicht. Er hatte das Gefühl, dem ar-
men Kind die Spielsachen zerbrochen zu haben, nick-
te ihm kurz zu und verschwand im Haus. In der Bar
ging es lauter als vorher zu. Er ging in sein Zimmer
und nahm eine kalte Dusche, als könne er seine Be-
fürchtungen damit von sich abwaschen.
Auch die Dusche half nichts. Murray nahm noch
eine Beruhigungspille und überlegte sich dabei, daß
er seinen kleinen Vorrat auf diese Weise rasch auf-
brauchen würde.
Bevor er ins Bett ging, fiel ihm ein, daß er noch
nicht nachgesehen hatte, ob Valentine seine Anwei-
sung befolgt hatte. Er öffnete die Schranktür und sah
ein Dutzend Konservendosen mit verschiedenen
Fruchtsäften auf dem untersten Regal stehen. Die Fla-
schen waren verschwunden. Ausgezeichnet. Er lösch-
te das Licht und streckte sich unter der leichten Decke
aus.
Morgens schrak er auf, als das Telefon auf dem
Tischchen neben ihm leise summte. Als er verschlafen

nach dem Hörer griff, teilte Valentine ihm mit unper-
sönlicher Stimme mit, das Frühstück werde zwischen
acht und neun Uhr serviert. Murray bedankte sich
und stand auf, bevor er wieder einschlafen konnte.
Er hatte am vergangenen Abend nicht alles ausge-
packt, und sein Rasierzeug lag noch in der Reiseta-
sche. Murray rasierte sich und öffnete dann den Spie-
gelschrank über dem Waschbecken, um dort sein Ra-
sierzeug unterzubringen. Im Schrank standen ein
Zahnputzglas – und eine halbe Flasche Whisky.
Murray starrte die Flasche lange verblüfft an. Dann
griff er wütend danach, schlug den Hals am Wasch-
becken ab und ließ den Whisky auslaufen. Der Ge-
ruch betäubte ihn. Er legte die Flasche ins Becken und
ging ans Telefon. Der Apparat hatte keine Wähl-
scheibe. Murray hob ab und wartete.
Valentine meldete sich. »Ja, Mister Douglas? Was
kann ich für Sie tun?«
»Warum hat im Spiegelschrank über dem Wasch-
becken eine Flasche Whisky gestanden?«
»Eine Flasche Whisky, Sir? Das überrascht mich
sehr.«
»Tatsächlich?« Murray holte tief Luft. »Gut, ich
warne Sie. Wenn ich noch einmal Alkohol in meinem
Zimmer finde, flöße ich ihn Ihnen mit Gewalt ein,
verstanden? Schicken Sie jetzt jemand herauf, der hier
sauber macht!«

»Ich kümmere mich nach dem Frühstück selbst
darum, Mister Douglas«, versicherte Valentine ihm.
»Darf ich Sie daran erinnern, daß es bereits fünfund-
zwanzig nach acht ist, Sir?«
»Ach, scheren Sie sich zum Teufel!« Murray knallte
den Hörer auf die Gabel. Er ballte die Fäuste und sah
sich im Zimmer um. Hier gab es überall genügend
Verstecke für Whiskyflaschen. Er erinnerte sich noch
gut daran, wo er früher Flaschen vor Freunden und
Ärzten versteckt hatte.
Murray durchsuchte den Raum gründlich, ohne
etwas zu finden. Er atmete erleichtert auf und griff in
seine Reisetasche, um einen Pullover herauszuneh-
men, der ganz unten lag. Dann richtete er sich er-
schrocken auf. Unter dem Pullover war eine weitere
Flasche Scotch versteckt.
Er hielt sie in der Hand und fragte sich im ersten
Augenblick, ob er vielleicht selbst ... Nein, das war
ausgeschlossen! Murray drehte sich um und warf die
Flasche an die Wand über dem Waschbecken. Glas-
splitter flogen nach allen Seiten, und die bernstein-
farbene Flüssigkeit floß ins Becken.
Murray zog den Pullover an und ging zur Tür. Er
hatte mit Blizzard zu reden.

6
Aber Blizzard war nicht im Speisesaal. An einem En-
de des langen Tisches saßen zwei junge Männer ne-
beneinander, die Murray nur flüchtig kannte. Alle
anderen schienen bereits gefrühstückt zu haben – bis
auf Heather, die in der Nähe der Tür saß. Das Gedeck
neben ihr war noch unbenützt. Murray nahm dort
Platz, und einer der Diener brachte ihm ein Glas
Orangensaft.
»Guten Morgen«, sagte Murray. »War Blizzard
schon hier?«
»Oh ... guten Morgen, Murray.« Sie war geistesab-
wesend und merkte erst jetzt, wer neben ihr saß. »Ich
wollte ... äh ... diesen Platz eigentlich für Ida aufhe-
ben. Sie hat mich darum gebeten.«
Das sieht ihr ähnlich. »Dann soll sie rechtzeitig
kommen«, entschied Murray. »Haben Sie Blizzard
gesehen?«
»Nun ... Ja, er hat bereits gefrühstückt und ist vor
einigen Minuten hinausgegangen.« Heather zögerte.
»Ist etwas nicht in Ordnung?«
»Ja, aber es hat nichts mit Ihnen zu tun.« Murray
leerte das Glas Orangensaft auf einen Zug und hatte
kurz das Gefühl, Whisky getrunken zu haben. »Ver-
dammt noch mal«, murmelte er vor sich hin.

»Ah, guten Morgen, Murray!« sagte Ida zuckersüß
hinter ihm. »Ist das der Platz, den Sie mir aufheben
wollten, meine liebe Heather?«
»Tut mir leid, Ida, aber ich konnte ihn nicht länger
...«
»Macht nichts, gegenüber ist noch einer frei.« Ida
ging darauf zu. Sie trug heute morgen einen schwar-
zen Rollkragenpullover und schwarze Samthosen. Sie
sah müde aus. »Ich hätte eben früher kommen sol-
len.« Sie wandte sich an den Diener, der ihren Oran-
gensaft brachte. »Danke. Bringen Sie mir nur noch
trockenen Toast und viel Kaffee. Was ist mit Ihnen
los, Murray? Haben Sie einen Kater?«
Murray löffelte schweigend seine Cornflakes.
»Nicht witzig?« fragte Ida lächelnd. »Keine Angst,
Murray, das gibt sich bis mittags.«
»Unsinn«, sagte Murray. »Sie wissen genau, daß
ich nichts mehr trinke.«
»Richtig, das habe ich gestern abend gehört. Des-
halb ist mir der Whiskygeruch in Ihrem Zimmer auf-
gefallen, als ich eben daran vorbeigekommen bin. Ei-
ner der Diener hat irgend etwas aufgeräumt und da-
bei die Tür offengelassen.«
Ida lächelte strahlend. Murray nahm undeutlich
wahr, daß Heather ihm einen erschrockenen Blick
zuwarf. Er hatte plötzlich keinen Appetit mehr.
»Dieses Haus ist kein Klub«, stellte er fest und

schob seinen Stuhl zurück, »sondern ein Irrenhaus.
Wenn wir vier Wochen so weitermachen, wird es je-
denfalls eines. Lassen Sie sich nicht weiter bei Ihrer
neuen Liebesaffäre stören, Ida.« Er wandte sich ruck-
artig ab.
Das hat sie wegen ihrer unverschämten Unterstellungen
verdient, überlegte er sich. Aber ich wollte, Heather
hätte es nicht gehört.
Um halb zehn hatten sich alle Mitglieder des En-
sembles in dem kleinen Theater versammelt – nur
Delgado und Blizzard fehlten auch diesmal. Lester
Harkham, der etwa vierzigjährige Beleuchter, der seit
langem mit Blizzard zusammenarbeitete, kam als
letzter und teilte der Versammlung mit, der Autor
und der Produzent würden in einigen Minuten er-
scheinen; dann ließ er sich in den Sessel neben Gerry
Hoarding fallen.
Murray sah sich um. Links neben dem Aufgang
zur Bühne stand ein Konzertflügel, und Jess Aumen
saß auf dem Klavierhocker. Er bewegte die Hände
über den Tasten, ohne sie jedoch anzuschlagen. Er
wirkte affektiert, aber Murray wußte, daß er ein guter
Komponist war.
Lester, Jess, Blizzard und Gerry – eine hervorra-
gende Mannschaft, mit der sich ein gutes Stück auf
die Beine stellen ließ. Aber warum hatte Blizzard
nicht bessere Schauspieler engagiert? Murray kannte

die meisten von der Bühne her – nur die beiden jun-
gen Männer nicht, die er beim Frühstück gesehen hat-
te – Rett Latham und Al Wilkinson –, und ein Mäd-
chen namens Cherry Bell, von dem er nichts wußte.
Das Mädchen saß in der ersten Reihe zwischen Rett
und Al.
Die Leute warteten gespannt. Das merkte man,
auch ohne ihre Unterhaltung zu verfolgen.
Dann erschienen Delgado und Blizzard im Hinter-
grund der Bühne. Sie trugen jeder einen Stuhl, auf
dem sie an der Rampe Platz nahmen. Der Autor zün-
dete sich als erster eine Zigarette an.
»Okay, fangen wir also an«, sagte Blizzard und
nickte seinen Zuhörern zu. »Vor allem ...«
»Vor allem eine Frage, Sam!« Murray war aufge-
sprungen. »Ich wollte sie Ihnen privat stellen, aber Sie
sind leider nie erreichbar und immer beschäftigt.
Warum haben Sie Valentine angewiesen, überall in
meinem Zimmer Schnapsflaschen zu verteilen?«
Delgado warf ihm einen interessierten Blick zu, als
sei ihm etwas eingefallen.
»Sind Sie übergeschnappt, Murray?« erkundigte
Blizzard sich erstaunt. »Ich weiß genau, daß Sie nicht
mehr trinken, und ich werde mich hüten, Sie dazu zu
verleiten. Ich habe Valentine angewiesen, in jedem
Zimmer Erfrischungen bereitzustellen, und dabei
vergessen, ihn auf diesen Ausnahmefall aufmerksam

zu machen. Tut mir leid, das soll nicht wieder vor-
kommen.«
»Ich meine etwas anderes, Sam.« Murray beugte
sich vor. »Ich meine nicht die offen aufgestellten Fla-
schen, sondern die Flasche im Schrank über dem
Waschbecken und die andere, die in meiner Reiseta-
sche versteckt war.«
»Davon weiß ich nichts, Murray«, versicherte ihm
Blizzard. »Halten Sie lieber den Mund, bevor ich Ih-
nen erzähle, auf welche Weise die Flasche meiner
Meinung nach in Ihre Reisetasche gekommen ist.«
Murray sah sich um. Die anderen beobachteten ihn.
Ida Marr lächelte leicht, aber die anderen warfen ihm
mürrische oder besorgte Blicke zu. Er zögerte unent-
schlossen.
»Nein, halten Sie nicht den Mund, Douglas!« for-
derte Delgado ihn auf. Der Autor beugte sich nach
vorn. »Jetzt wird es erst interessant. Sie haben ein
Thema vorgeschlagen Sie behaupten, jemand wolle
Sie zum Trinken verführen, obwohl Sie nicht mehr
trinken dürfen, nicht wahr?«
»Ich habe nichts dergleichen behauptet«, antworte-
te Murray und setzte sich.
»Schön, überlegen wir also weiter.« Delgado achte-
te nicht auf Murrays Widerspruch. »Cherry, kommen
Sie hierher.«
Das Mädchen, von dem Murray nichts wußte, er-

hob sich und nahm auf der Rampe in Delgados Nähe
Platz. Es öffnete seine Handtasche, holte einen Steno-
block heraus und setzte sich eine Hornbrille auf.
Oh Murray hatte Cherry für ein Mitglied des En-
sembles gehalten. Aber sie brauchten natürlich je-
mand, der die Einfälle notierte und später das Manu-
skript schrieb. Das schien ihre Aufgabe zu sein.
»Denken Sie an Formen der Verfolgung«, schlug
Delgado vor. »Zum Beispiel in der Werbung. Kaufen
Sie dieses oder jenes Gerät – wer es nicht besitzt, ist
rückständig oder einfach dumm.«
»Man kann auch Leute dazu bringen, einwandfrei
funktionierende Geräte durch neue zu ersetzen«,
warf Constant ein. »Das ist auch eine Art Verfolgung,
nicht wahr?«
»Richtig. Mehr?«
Das Stück wuchs. Es wuchs geradezu unglaublich.
Gegen Mittag waren sie bereits so gefesselt, daß sie
nur widerstrebend die Bühne verließen, als im Spei-
sesaal serviert wurde. Nachmittags stand bereits eine
halbe Szene fest, und Jess Aumen improvisierte mo-
derne Musik dazu. Auch Gerry Hoarding improvi-
sierte auf seine Weise; er hatte offenbar von irgend-
woher seine Tagesration bekommen, die seine Phan-
tasie unglaublich beflügelte. Jetzt entwarf er mit
Kreidestrichen auf dem Boden ein geniales Bühnen-

bild, das den Schauspielern alle Entfaltungsmöglich-
keiten ließ.
Um fünf Uhr beendete Delgado plötzlich die Probe,
wies Cherry an, ihre Notizen ins reine zu schreiben,
und verschwand mit Blizzard durch den rückwärti-
gen Bühnenausgang. Die Spannung nahm langsam
ab, ohne schlagartig zu verschwinden; die Mitglieder
des Ensembles zogen sich in den Aufenthaltsraum
zurück und diskutierten dort noch lange weiter.
Murray hatte schon lange nicht mehr erlebt, daß
derartige Begeisterung sich in so kurzer Zeit entfa-
chen ließ. Das war offenbar Delgados Verdienst, des-
sen blitzschnell arbeitender Verstand sie alle ständig
gelenkt und verbessert hatte. Nicht einmal Ida hatte
es gewagt, ihm zu widersprechen.
Aber wie lange würde die Begeisterung anhalten?
Murray konnte sich vorstellen, wie übermüdet sie alle
nächste Woche um die gleiche Zeit sein würden. Aber
vielleicht gönnte Delgado ihnen dann einige Tage Er-
holung, während er das Manuskript überarbeitete.
Die Sache wirkte allmählich wahrscheinlicher.
An
diesem
Abend
blieb
Murray
im
Aufenthalts-
raum,
bis
auch
einige
andere
zu
Bett
gingen.
Dann
nick-
te
er
den
Zurückbleibenden
zu
und
trat
in
die
Halle
hinaus.
In
diesem
Augenblick
wurde
er
angesprochen.
»Murray, haben Sie einen Moment Zeit für mich?«
fragte Gerry Hoarding.

»Ja, natürlich.«
»Vielleicht lieber oben?« Gerry wies auf die Treppe
zum ersten Stock. »Ich ... äh ... ich weiß nicht recht,
wie ich mich ausdrücken soll, aber ich muß es sagen.
Sie kennen doch meine Schwierigkeiten, nicht wahr?«
»Ja, ich weiß. Warum?«
Der junge Bühnenbildner zuckte hilflos mit den
Schultern. »Nun, ich ... ich habe mehr als genug von
dem Zeug in meinem Zimmer. Ich weiß nicht, wo
Sam es aufgetrieben hat, aber ich habe es in meinem
Zimmer gefunden – wie Sie den Schnaps. Aber ich
habe mich nicht darüber beschwert. Ich habe bereits
einmal eine Entziehungskur mitgemacht, die ich fast
nicht überlebt hätte; außerdem wäre ich dann beruf-
lich fertig gewesen, deshalb komme ich von dem
Zeug nicht mehr los.«
Sie erreichten den Treppenabsatz und bogen nach
rechts in den Korridor ein.
»Das ist mein Zimmer – Nummer Zehn«, sagte
Gerry, während er nach dem Schlüssel suchte. »Es
liegt ziemlich genau über dem Mittelpunkt des Thea-
ters. Eigentlich seltsam, nicht wahr? Ein so gut einge-
richtetes Theater! Nein, kommen Sie herein, Murray,
ich bin noch nicht fertig.«
Er ließ Murray den Vortritt. Sein Zimmer war ähn-
lich wie Murrays eingerichtet.
»Hören Sie, ich weiß, daß Sie mehr Mut und Wil-

lenskraft als ich haben«, fuhr Gerry fort, nachdem er
die Tür geschlossen hatte. »Im Gegensatz dazu bringe
ich kaum den Mut auf, Ihnen meine Bitte vorzutra-
gen. Aber ich muß, verstehen Sie? Hier!«
Er wandte sich ab und öffnete die oberste Schubla-
de der Kommode am Fenster. Murray sah ein großes
Glas, das bis zum Rand mit weißem Pulver gefüllt
war.
»Ich habe noch nie soviel auf einmal gesehen«, sag-
te Gerry leise. »Der Himmel weiß, was es gekostet
hat! Stellen Sie sich vor, das Zeug ist chemisch reines
Heroin. Und wenn ich ... nun, falls irgend etwas ... oh,
verdammt noch mal! Heben Sie es für mich auf, Mur-
ray? Im Augenblick besitze ich noch genügend
Selbstbeherrschung, um Sie darum zu bitten, aber
vielleicht bringe ich nie wieder den Mut dazu auf.
Heute hat alles gut geklappt – vielleicht zu gut. Aber
wenn es einen Rückschlag gibt, habe ich nicht mehr
die Geduld, meine Portion zu nehmen und die Wir-
kung abzuwarten. Das weiß ich aus Erfahrung. Dann
nehme ich eine zweite Portion und mache sie viel-
leicht zu groß, weil ich zuviel von dem Zeug habe.
Und das wäre Selbstmord. Ganz bestimmt! Hier!«
Er drückte Murray das Glas in die Hand, als fürch-
te er, im nächsten Augenblick wankelmütig zu wer-
den. »Bewahren Sie das Zeug für mich auf? Erzählen
Sie mir nicht, wo Sie es verstecken. Schließen Sie es

am besten irgendwo ein. Geben Sie mir nie mehr als
drei Grane auf einmal, verstanden? Lassen Sie mich
um Gottes willen nie mehr nehmen, auch wenn ich
weinend zu Ihnen komme und Sie anflehe, mir mehr
zu geben!«
Murray nickte, wog das Glas in der Hand und ging
schweigend zur Tür. Als er die Klinke herabdrückte,
fügte Gerry noch hinzu:
»Murray, ich ... ich bin Ihnen sehr dankbar dafür.
Ich weiß natürlich, daß ich kein Recht habe, Sie um
diesen Gefallen zu bitten. Aber Sie wenden sich doch
an mich, wenn ich etwas für Sie tun kann, nicht
wahr?«
»Klar«, sagte Murray und ging hinaus.

7
Murray schaltete das Licht in seinem Zimmer ein,
schloß die Tür hinter sich und schüttelte trübselig den
Kopf.
Du lieber Gott, hat es je eine traurigere Versammlung
von abgehalfterten Größen als diesen Haufen hier gegeben?
Aber dieser erste Tag unter Delgados Einfluß hatte
sich zumindest auf Gerry Hoarding günstig ausge-
wirkt. Murray hätte nie gedacht, daß der Bühnen-
bildner jemals den Mut aufbringen würde, sich frei-
willig von seinem kostbaren Stoff zu trennen.
Wo sollte er ihn jetzt verstecken? Eine Schublade
kam offenbar nicht in Frage. Draußen auf dem Fen-
sterbrett? Murray sah hinaus und stellte fest, daß das
Fensterbrett viel zu schmal dafür war. Gut, dann
eben im Fernsehgerät. Das war eines der besten Ver-
stecke gewesen, als er noch seine Flaschen zu ver-
stecken hatte.
Der Apparat war allerdings ziemlich schmal wie al-
le modernen Geräte. Als Murray ihn umdrehte und
durch die Luftschlitze der Rückwand sah, mußte er
feststellen, daß es kaum möglich war, das Glas dort
zu verstecken, ohne daß es irgendwelche Drähte be-
rührte. Außerdem war die Rückwand mit Spezial-
schrauben befestigt, die er nicht einfach mit dem Ta-

schenmesser lösen konnte. Er biß sich auf die Unter-
lippe und drehte den Apparat wieder um.
Murray dachte an seine Reisetasche, aber dann fiel
ihm ein, daß er den Schlüssel dazu irgendwo verloren
haben mußte; er hing jedenfalls nicht mehr an seinem
Schlüsselring. Nun, das war eben nicht zu ändern.
Gerrys Zeug mußte vorläufig unter die Matratze, bis
ihm ein besseres Versteck dafür einfiel.
Er zog das Bettuch ab. Dabei stieß er mit dem Fuß
an den niedrigen rechteckigen Sockel, auf dem die
Matratze lag. Der Sockel schien hohl zu sein, aber
Murray achtete zunächst nicht darauf. Unter dem
Bettuch lag die Matratze. Murray betrachtete sie er-
staunt und runzelte die Stirn, als er das eigenartige
Gewebe aus hauchzarten Metalldrähten sah, das fast
die gesamte Oberfläche bedeckte.
Merkwürdig. Ich habe noch nie eine so verrückte Ma-
tratze gesehen.
Aber er griff nach dem Kopfende und hob die
schwere Matratze an dieser Seite hoch. Dann merkte
er, weshalb der Sockel vorhin hohl geklungen hatte.
In die Auflagefläche war eine bewegliche Klappe
eingelassen.
»Was, zum ...«
Murray mußte sich anstrengen, um die ganze Ma-
tratze hochzuheben und auf der anderen Seite des
Betts zu Boden gleiten zu lassen. Dabei schien irgend

etwas zu reißen, und er wurde auf ein Glitzern auf-
merksam gemacht. Als er vorsichtig danach tastete,
stellte er fest, daß ein hauchdünner Draht von der
Matratze zu der Klappe geführt hatte. Diese Verbin-
dung war gerissen, als er die Matratze bewegt hatte.
Er streckte die Hand aus und öffnete langsam die
Klappe.
Darunter sah er ein Tonbandgerät stehen. Auf den
ersten Blick wirkte es ganz normal. Es war nicht ein-
geschaltet. Die beiden Spulen mußten für einige
Stunden Spieldauer genügen – etwa ein Drittel des
Tonbands war auf die rechte Spule aufgewickelt.
Murray stellte fest, daß dieses Tonbandgerät sich
doch von anderen unterschied: es wies keine Schalter
und Knöpfe auf und war offenbar nicht von außen zu
steuern.
Murray studierte es einige Zeit lang und zuckte
dann mit den Schultern. Er verstand nichts von Ton-
bandgeräten; er wußte nur, wie man sie ein- oder
ausschaltete. Aber er hätte gern gewußt, was dieses
verdammte Ding unter seinem Bett zu suchen hatte.
Gehörte es ebenfalls zur Ausstattung des ehemaligen
Klubs? Leise Musik, damit die Mitglieder besser ein-
schliefen? Aber wo war dann der Lautsprecher – und
wo ließ das Gerät sich ausschalten, wenn man keine
Musik wollte?
Er richtete sich auf und runzelte die Stirn. Er würde

nicht schlafen können, bevor er einige peinliche Fra-
gen gestellt hatte. Aber dann fiel ihm Gerrys Glas ein.
Verdammt! Er mußte es noch verstecken, bevor er
das Zimmer verließ. Warum nicht hinter dem Vor-
hang? Ganz oben, dicht unter der Stange? Murray
zog einen Stuhl heran, tastete nach einem herunter-
hängenden Band und verknotete es um das Glas.
Dann bewegte er die Vorhänge mehrmals, um ganz
sicherzugehen, daß von außen nichts zu merken war.
Schließlich nickte er zufrieden und ging in den Korri-
dor hinaus.
Im gleichen Augenblick kam Gerry Hoarding von
der Toilette in sein Zimmer zurück. Er nickte Murray
zu und wollte rasch verschwinden.
»Augenblick, Gerry!« sagte Murray. »Darf ich
schnell etwas nachsehen?«
»Ja, natürlich. Was?« Gerry warf ihm einen er-
staunten Blick zu.
»Darf ich mir Ihr Bett ansehen? Ich möchte wissen,
ob meines ein spezieller Fall ist oder ob alle ähnlich
ausgerüstet sind?«
»Womit ausgerüstet?« erkundigte Gerry sich ver-
wundert. Er sah wortlos zu, als Murray das Bettuch
abriß, auf die Metalldrahtstickerei der Matratze deu-
tete und ihm schließlich das Tonbandgerät unter der
Klappe zeigte. Diesmal schien etwas weniger Ton-
band abgespielt zu sein.

»Du lieber Gott«, meinte Gerry verständnislos.
»Was soll denn das?«
»Keine Ahnung«, gab Murray zu, »aber ich wüßte
es gern, das dürfen Sie mir glauben.«
»Ich nehme an, daß Sie das entdeckt haben, als Sie
mein ... mein Zeug verstecken wollten.« Gerry lächel-
te schwach. »Na, dort brauche ich jedenfalls nicht
mehr zu suchen.«
»Richtig.« Murray tastete nach dem hauchdünnen
Metalldraht zwischen Matratze und Sockel, den er
diesmal intakt gelassen hatte. Der Draht führte zu
dem Tonbandgerät.
»Glauben Sie, daß die Klubmitglieder früher damit
in den Schlaf gewiegt worden sind?« meinte Gerry
zweifelnd. »Der ganze Klub ist ziemlich luxuriös, und
ich finde die Idee gar nicht so abwegig.«
»Daran habe ich auch schon gedacht.« Murray
nickte. »Ich sehe allerdings keinen Lautsprecher.«
»Er müßte eigentlich irgendwo hier oben ange-
bracht sein«, stellte Gerry fest und untersuchte inter-
essiert das feine Drahtgewebe.
Murray stieß einen leisen Schrei aus. Gerry drehte
sich nach ihm um. »Was ist los?« wollte er wissen.
»Was haben Sie eben getan?« fragte Murray seiner-
seits.
»Ich habe nur die Drähte angefaßt«, erklärte Gerry
ihm. »Hier ...«

»Das genügt«, unterbrach Murray ihn. »Dort muß
ein Schalter angebracht sein, der auf Druck reagiert.
Da, sehen Sie – das Tonband läuft!«
Gerry drückte noch immer auf die gleiche Stelle
und verdrehte den Hals, um besser sehen zu können.
Das Tonband lief tatsächlich ab.
»Schön, wo bleibt also die Musik?« fragte Murray.
»Eigenartig«, stimmte Gerry zu. »Aber vielleicht ist
die Aufnahme versehentlich gelöscht worden?«
»Kann sein«, murmelte Murray zweifelnd. Dann
nickte er langsam. »Gut, diese Möglichkeit müssen
wir auch berücksichtigen. Wissen Sie, in welchem
Zimmer Lester Harkham schläft? Ich nehme an, daß
er als einziger etwas von diesen Dingen versteht.«
»Nein,
ich
weiß
nicht,
wo
er
schläft.«
Gerry
fuhr
sich
nervös
mit
der
Zungenspitze
über
die
Lippen.
»Hören
Sie,
Murray,
ist
die
ganze
Aufregung
nicht
etwas
ver-
fehlt?
Was
macht
es
schon
aus,
ob
hier
Musik
spielt
oder nicht? Warum sehen Sie nicht bei Ihrem nach?«
»Weil ich die Verbindung zwischen Matratze und
Tonbandgerät versehentlich zerrissen habe«, erklärte
Murray ihm. Er legte eine Hand auf die Matratze.
»Ein ziemlich leichter Druck genügt bereits, haben Sie
das gemerkt? Wahrscheinlich beginnt das Gerät zu
laufen, wenn man den Kopf aufs Kissen legt.«
Draußen im Korridor waren Schritte zu hören; eine
Tür wurde geöffnet und geschlossen.
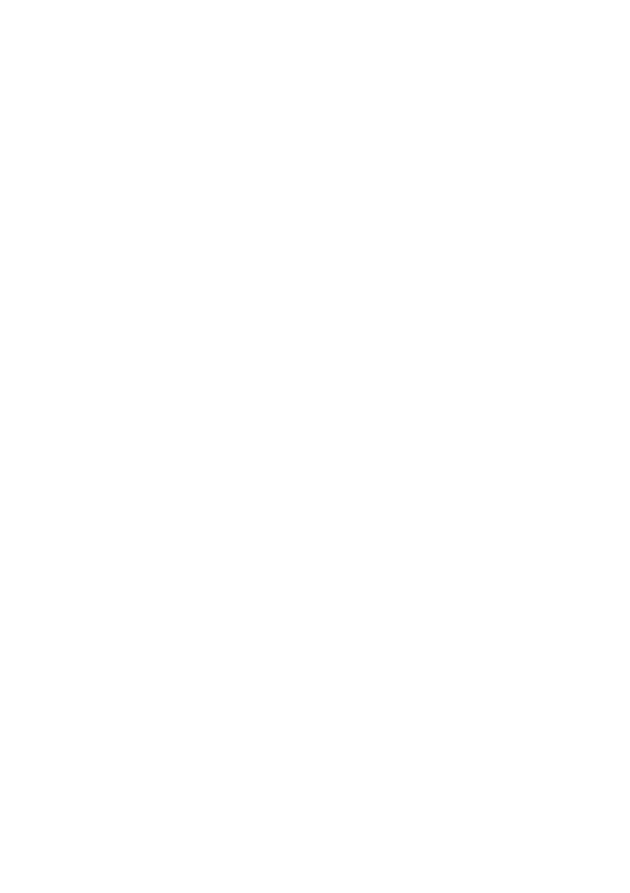
»Da ist jemand«, stellte Murray fest. »Kommen Sie,
Gerry.«
Der Bühnenbildner zuckte mit den Schultern und
folgte ihm.
Im Korridor war jedoch nicht mehr festzustellen,
welche Tür eben geöffnet worden war. Murray seufz-
te. Er horchte an den Türen Nummer Elf und Zwölf
und schüttelte jeweils den Kopf.
»In Nummer Dreizehn schläft niemand«, stellte
Gerry fest. »Ich habe Valentine danach gefragt.«
»Und Vierzehn ist mein Zimmer. Dann muß es auf
der anderen Seite gewesen sein. Versuchen wir es mit
Neun.« Murray ging zurück. Er glaubte leise Stim-
men in Nummer Neun zu hören, bevor er klopfte.
»Wer ist da?«
Heather! Wie interessant! Murray schloß eine kleine
Wette mit sich selbst ab. Gleichzeitig sagte er laut:
»Hier ist Murray. Gerry Hoarding steht neben mir.
Können wir einen Augenblick hereinkommen? Die
Sache ist ziemlich wichtig.«
Ein aufgeregtes Flüstern, das Murray nicht
verstand; dann hörte er: »Gut, kommen Sie herein.
Die Tür ist offen.«
Er drückte die Klinke herab. Heather saß im Bett.
Ihr Gesicht wirkte ohne Make-up noch jugendlicher.
Sie trug eine Bettjacke aus Satin über ihrem schwar-
zen Nachthemd. Im Sessel neben ihrem Bett saß Ida

in schwarzem Rollkragenpullover und schwarzer
Samthose; sie rauchte und hielt ein Whiskyglas in der
linken Hand. Murray hatte seine Wette mit sich selbst
gewonnen.
»Ha!« sagte Ida, als Gerry die Tür hinter sich
schloß. »Wie kommen wir zu dieser Ehre, Freunde?«
»Tun Sie mir einen Gefallen, Heather?« bat Murray.
»Hören Sie Musik, wenn Sie sich auf Ihr Kopfkissen
legen? Hören Sie irgend etwas, wenn Sie fest auf das
Kissen drücken?«
»Was soll der ...?« begann Heather. Dann kicherte
sie, horchte umständlich an der Matratze und richtete
sich wieder auf, wobei sie den Kopf schüttelte.
»Schön,
was
hat
das
zu
bedeuten?«
fragte
Ida
scharf.
»Nur Geduld«, wehrte Murray ab. »Stehen Sie bitte
auf, Heather, dann zeige ich Ihnen, warum ich ge-
fragt habe.«
Heather sah unsicher zu Ida hinüber und warf Ger-
ry einen fragenden Blick zu.
»Im Sockel unter der Matratze ist irgendein Appa-
rat versteckt«, erklärte Gerry ihr. »Murray sucht eine
Erklärung dafür und kann nicht schlafen, bevor er sie
gefunden hat.«
»Was für ein Apparat?« erkundigte Heather sich
verwirrt. »Oh ... meinetwegen. Ida, seien Sie doch so
nett und geben Sie mir meinen Morgenrock, ja? Er
hängt über der Sessellehne.«

Sie erhob sich so umständlich, als stehe ihr Bett auf
der Bühne und sie habe die Theaterzensur zu be-
fürchten. Murray zeigte ihr, was er meinte – das Me-
tallgewebe, den Verbindungsdraht und das Ton-
bandgerät im Bettsockel.
Selbst Ida war verblüfft. »Das haben Sie also mit
der Musik im Kopfkissen gemeint«, gab sie zu. »Aber
vorläufig passiert gar nichts, oder? Die Spulen drehen
sich nur, wenn man auf die Matratze drückt.« Sie
drückte selbst darauf.
Murray fiel ein, daß jedes Tonbandgerät lautlos
lief, solange es aufnahm. Diese Möglichkeit schien al-
lerdings hier auszuscheiden. Er wußte nicht, weshalb
ihm bei dem Gedanken daran ein kalter Schauer über
den Rücken lief.
»Weiß jemand, wo ich Sam Blizzard erreichen
kann?« fragte er laut. »Gerry hat ganz recht – ich
kann erst schlafen, wenn ich eine Erklärung dafür ge-
funden habe.«
Ida lachte. »Sie sind ein verrückter Kerl, Murray.
Wenn das Tonbandgerät unter meinem Bett nicht lau-
ter ist, schlafe ich bestimmt ausgezeichnet.« Sie
drückte ihre Zigarette aus und leerte das Glas. »Aber
wenn Sie Sam wirklich in seiner Löwenhöhle aufsu-
chen wollen, finden Sie ihn vermutlich in dem Raum
rechts neben dem Speisesaal, wo er gemeinsam mit
Delgado Pläne schmiedet. Der Raum ist eine Art Bü-

ro, soviel ich gesehen habe. Ich gehe jetzt ins Bett. Gu-
te Nacht, Heather.«
Sie lächelte allen zu und rauschte hinaus. Einige
Sekunden später breitete Gerry hilflos die Hände aus
und folgte ihr.
»Murray, ich wollte, Sie hätten mir nichts von die-
sem Ding erzählt«, sagte Heather mit einem Blick auf
das Tonbandgerät. »Es ist mir unheimlich, weil es
keinen Zweck zu haben scheint. Oder hat es einen?«
»Das weiß ich nicht, Kleine«, antwortete Murray
grimmig. »Aber ich suche jetzt Sam, um ihn danach
zu fragen, und wenn ich etwas erfahre, komme ich
noch mal zurück. Einverstanden?«

8
Murray klopfte nicht erst an die Tür des Raums, den
Ida ihm beschrieben hatte, sondern drückte gleich die
Klinke herab. Die Tür war abgeschlossen. Dahinter
hörte er eine elektrische Schreibmaschine klappern
und leise Stimmen, die sofort verstummten, als er die
Klinke bewegte.
»Augenblick!« rief Blizzard. Murray trat von der
Tür zurück. Der Produzent erschien auf der Schwelle.
»Oh, Sie sind's, Murray. Was wollen Sie?«
»Unterhalten wir uns hier, oder darf ich herein-
kommen?«
Blizzard zögerte, zuckte dann mit den Schultern
und trat zurück. Murray folgte ihm in den Raum, der
früher als Sekretariat des Klubs gedient haben mußte.
Cherry Bell saß an einem Schreibmaschinentisch; ihre
Finger flogen über die Tastatur einer IBM. Delgado
hatte einige Blätter auf dem Schoß liegen. Er sah in-
teressiert auf, als Murray hereinkam.
»Nun?« fragte Blizzard. »Ist die Sache wichtig,
Murray? Wir haben noch viel zu arbeiten und lieben
keine Störungen.«
»Es handelt sich um die Tonbandgeräte, die unter
unseren Betten versteckt sind«, antwortete Murray
laut. Er beobachtete dabei Delgado und stellte zufrie-

den fest, daß ein besorgter Ausdruck über dieses völ-
lig beherrschte Gesicht huschte.
»Was soll das schon wieder?« erkundigte Blizzard
sich. »Haben Sie nichts anderes mehr im Kopf, Mur-
ray? Wenn das wieder eine Sache wie heute morgen
ist, verliere ich bestimmt bald die Geduld mit Ihnen!«
»Fragen Sie Delgado danach«, forderte Murray ihn
auf. »Er weiß, was ich meine. Nicht wahr, Delgado?«
»Ja, natürlich.« Delgado legte die Blätter fort. »Die-
se Tonbandgeräte sind Bestandteil meiner neuartigen
Arbeitsweise, die noch weitgehend unbekannt ist.«
Murray hatte das Gefühl, daß der andere diese Er-
klärung improvisierte – aber er konnte seinen Ver-
dacht nicht beweisen.
»Weiter«, forderte er Delgado auf.
»Kennen Sie die Bedeutung des Wortes Hypnopä-
die?«
Murray antwortete nicht gleich. Er sah zu Blizzard
hinüber und stellte fest, daß dieser ebenfalls ver-
ständnislos zuhörte.
Sehr interessant. »Sie meinen das Verfahren, mit
dessen Hilfe man angeblich im Schlaf lernen kann?
Ich habe bisher nur gehört, daß es nicht funktioniert.«
»Glauben Sie, was Sie wollen.« Delgado machte ei-
ne wegwerfende Handbewegung. »Für mich genügt
es jedenfalls. Ich benütze es immer. Ich bin nicht mit
Schauspielern zufrieden, die nach den Proben völli-
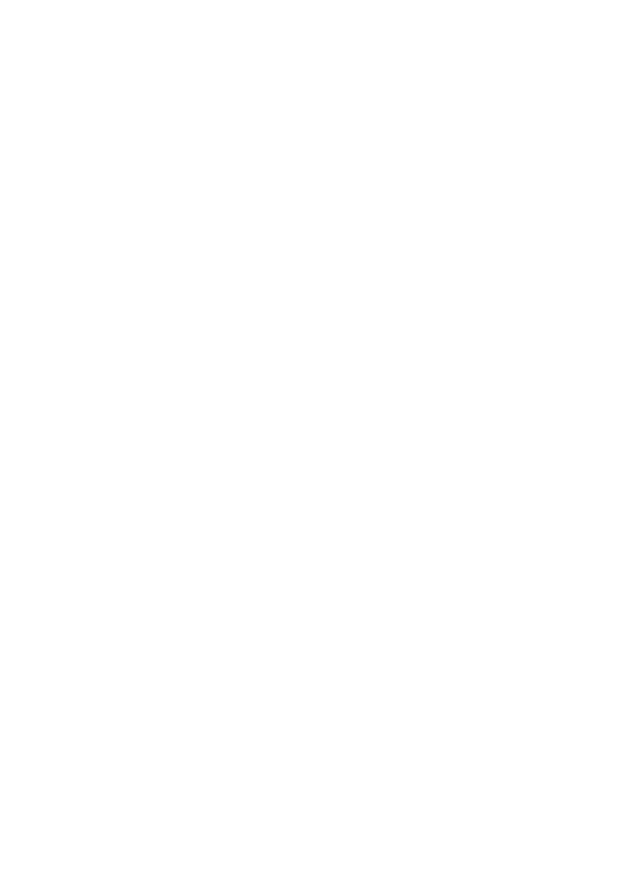
ges Desinteresse zeigen, und die Hypnopädie gibt
mir die Möglichkeit, sie in meinem Sinn zu beeinflus-
sen. Das ist alles.«
»Manuel, mir ist nicht ganz klar, was Sie damit sa-
gen wollen«, warf Blizzard ein.
»Wirklich nicht?« fragte Murray. »Gut, hören Sie
zu. Bisher habe ich unter meinem, unter Gerry Hoar-
dings und unter Heathers Bett am Kopfende ein Ton-
bandgerät gefunden. Ein leichter Druck auf die Ma-
tratze genügt, um die Geräte einzuschalten; sobald
man sich im Bett ausstreckt, beginnt das Band zu lau-
fen. Delgado behauptet, dadurch solle unsere Rollen-
beherrschung im Schlaf gefördert werden – durch
ständige Wiederholung. Welche Rolle wollen Sie üb-
rigens Gerry Hoarding eintrichtern, Delgado? Er ist
Bühnenbildner, kein Schauspieler.«
»Bauschen Sie die Sache nicht unnötig auf, Mur-
ray?« erkundigte Delgado sich. »Ich habe die Ton-
bandgeräte nicht erst einbauen lassen, wissen Sie. Sie
sollten den Klubmitgliedern beruhigende Musik vor-
spielen und sind deshalb unter allen Betten instal-
liert.«
»Wirklich? Das ist aus zwei Gründen unwahr-
scheinlich. Erstens fehlen die Lautsprecher und zwei-
tens sind die Tonbänder offenbar leer.«
»Du liebe Güte!« Delgado machte eine ungeduldi-
ge Handbewegung. »Murray, diese Tonbandgeräte

sind lange nicht mehr in Betrieb gewesen. Ich habe sie
wieder anschließen lassen, um sie zu überprüfen –
das ist aber nur möglich, wenn man ein Tonband auf-
spult, was ich getan habe. Selbstverständlich sind die
Bänder noch leer! Die Lautsprecher, die Sie vergeb-
lich gesucht haben, befinden sich im Innern der Ma-
tratzen. Außerdem werden Sie ohnehin nichts zu hö-
ren bekommen, selbst wenn Lernbänder aufgelegt
werden, weil mein Verfahren auf das Unterbewußt-
sein einwirkt, ohne daß der Betreffende diese Beein-
flussung wahrnimmt. Hoffentlich gelingt es Ihnen,
Sam, unseren Freund davon zu überzeugen, daß
meine etwas ungewöhnlichen Methoden kein Grund
sind, Krach zu schlagen.«
Blizzard nahm eine Zigarre aus der Tasche und biß
mechanisch das Ende ab. »Warum haben Sie mir bis-
her nichts davon erzählt, Manuel? Die Idee klingt in-
teressant, aber ...«
»Sie werden bald merken, wie gut das Verfahren
funktioniert«, unterbrach Delgado ihn. »Ich habe nur
nichts davon erwähnt, weil die Tonbandgeräte zufäl-
lig bereits vorhanden waren. Wäre das nicht der Fall
gewesen, hätten Sie mir ein Dutzend beschaffen müs-
sen, und wir hätten darüber gesprochen. Ist die Sache
wirklich soviel Aufregung wert?«
»Nein, wahrscheinlich nicht«, gab Blizzard zu.
»Aber falls Sie noch andere Überraschungen vorha-

ben, Manuel, wäre es vielleicht besser, die Leute zu
informieren.«
»Bestimmt nicht.« Delgado schüttelte den Kopf.
»Ich bedaure nur, daß Murray zufällig über diese Sa-
che gestolpert ist. Hoffentlich wird die Aufnahmebe-
reitschaft des Unterbewußtseins dadurch nicht beein-
trächtigt. Aber das stellt sich noch heraus. Vielleicht
sieht Murray später ein, daß die Hypnopädie doch
nützlich sein kann.«
Cherry hatte eben das letzte Blatt aus der Maschine
genommen. Das Klappern verstummte plötzlich, und
der Raum war sehr still.
»Fertig, Mister Blizzard«, stellte sie fest.
»Oh, wunderbar.« Blizzard gab sich einen Ruck.
»Geben Sie Mister Delgado die letzte Seite, dann
können Sie ins Bett gehen. War das alles, Murray?«
»Nein, keineswegs. Aber ich muß wohl vorläufig
damit zufrieden sein.«
Murray wollte sein Versprechen halten und klopfte
deshalb an Heathers Tür, um dem Mädchen zu erzäh-
len, was Delgado gesagt hatte. Er bekam jedoch keine
Antwort; offenbar schlief Heather bereits. Er ging in
sein Zimmer, betrachtete nochmals das Drahtgewebe
auf der Matratze, wickelte sich ein Taschentuch um
die Hand und zog den Draht heraus. Als er fertig
war, hatte er zwanzig Meter Draht vor sich liegen.

Sonst nichts. Er sah keinen Anschluß. Die Matratze
enthielt keinen Lautsprecher. Delgado hatte gelogen.
Welchen Zweck konnte ein Tonbandgerät ohne
Lautsprecher haben? Was konnte es aufnehmen, da
es offenbar nichts abspielen konnte? Und wie? Er hat-
te auch kein Mikrophon gefunden. Nur den langen
Draht.
Bildete der Draht selbst vielleicht eine Art Mikro-
phon oder Lautsprecher? Das war die einzige Mög-
lichkeit, die ihm einfiel. Aber er verstand nicht genug
von Elektronik, um beurteilen zu können, ob ein ein-
facher Draht Schallwellen erzeugen oder aufnehmen
konnte ...
Der Teufel sollte alles holen. Murray drehte die
Matratze um, breitete das Bettuch darüber aus und
kroch unter die Decke. Er blieb noch lange wach lie-
gen und fragte sich, worauf er sich hier eingelassen
hatte. Aber dann schlief er doch ein.
Am nächsten Tag hatte er nicht gleich Gelegenheit,
Lester Harkham nach den Tonbandgeräten zu fragen,
denn die drei anderen, die davon wußten, schienen
sich deswegen keine Sorgen zu machen, sondern
wollten nur an die Arbeit zurück. Heather erkundigte
sich, was er erfahren habe, schien jedoch nicht sehr
interessiert zu sein; ihr genügte offenbar, daß Delga-
do sich überhaupt zu einer Erklärung bereitgefunden

hatte, und sie zog es vor, nicht über die Möglichkeit
nachzudenken, daß er nur die halbe Wahrheit gesagt
haben könnte.
Gegen Abend war Murray fast der gleichen Auf-
fassung. Unter Delgados geschickter Anleitung ent-
wickelte sich allmählich eine bestimmte Form aus
zahlreichen widersprüchlichen Ideen. Nein, daran
gab es keinen Zweifel – der Mann war gut.
Und trotzdem ...
Delgado beendete die Probe auch diesmal wieder
pünktlich um fünf Uhr mit einigen kurzen Worten
und verschwand dann mit Blizzard durch den Büh-
nenausgang. Die Spannung ließ allmählich nach, und
die Schauspieler starrten sich gegenseitig an, als sei
ihnen erst jetzt klar, daß sie sich nicht in ihrer künstli-
chen Welt, sondern auf der Bühne eines kleinen Thea-
ters befanden. Dann atmeten sie erschöpft auf und
verschwanden nach draußen, um sich an der Bar bei
einigen Drinks zu erholen.
Jess
Aumen
blieb
am
Flügel
sitzen
und
versuchte
zum
zehntenmal
eine
eigenartige
Tonfolge,
die
ihm
nicht
recht
gelingen
wollte.
Gerry
Hoarding
ging
mit
einem
Blatt
Papier
und
einem
Bandmaß
über
die
Büh-
ne,
um
die
geplante
Dekoration
auszumessen
Lester
Harkham,
der
für
die
erstaunlich
gute
Beleuchtungs-
anlage
verantwortlich
war,
stand
im
Mittelgang
und
sah
mit
nachdenklich
gerunzelter
Stirn
zur
Bühne auf.

Murray gab sich einen Ruck und trat auf ihn zu.
»Haben
Sie
einen
Augenblick
Zeit
für
mich,
Lester?«
»Hmmm?« Lester schien aus weiter Ferne zurück-
zukommen. »Oh, natürlich, Murray. Was gibt's?«
»Nun ...« Murray hatte plötzlich das Gefühl, es sei
lächerlich, wieder von Delgado und seinen Tonband-
geräten anzufangen. Deshalb wechselte er rasch das
Thema. »Hören Sie, Lester, die Sache muß unter uns
bleiben, verstanden? Gerry hat mich gebeten, ein Glas
Heroin für ihn aufzubewahren, weil er fürchtet, er
könnte eine Überdosis nehmen, wenn er deprimiert
ist. Das beste Versteck dafür wäre natürlich im Fern-
sehapparat – dort findet er das Zeug nie. Aber die
Rückwand des Geräts in meinem Zimmer läßt sich
nicht einfach abschrauben, und ich möchte sie nicht
beschädigen. Könnten Sie mir dabei helfen?«
Lester starrte ihn verständnislos an. »Menschens-
kind, das ist die verrückteste Bitte, die ich je gehört
habe!« rief er dann aus.
»Das glaube ich«, stimmte Murray zu. »Ich bin nur
auf Sie gekommen, weil Sie bestimmt der einzige von
uns sind, der etwas von Elektronik versteht.«
»Richtig, mit Fernsehgeräten kenne ich mich aus.
Ich komme gleich mit. Ich muß nur noch etwas mit
Gerry besprechen.«
»Aber kein Wort davon, Lester! Er darf nicht erfah-
ren, wo ...«

»Schon gut, schon gut! Ich bin schließlich kein Trot-
tel. Warten Sie hier auf mich, Murray. He, Gerry, ich
muß Sie sprechen!« Lester ging nach vorn zur Bühne.
Bisher hatte alles geklappt, überlegte Murray sich.
Jetzt konnte er das Gespräch unauffällig auf die Ton-
bandgeräte bringen. Und er war gespannt, wie Lester
auf Delgados Ausflüchte reagieren würde.
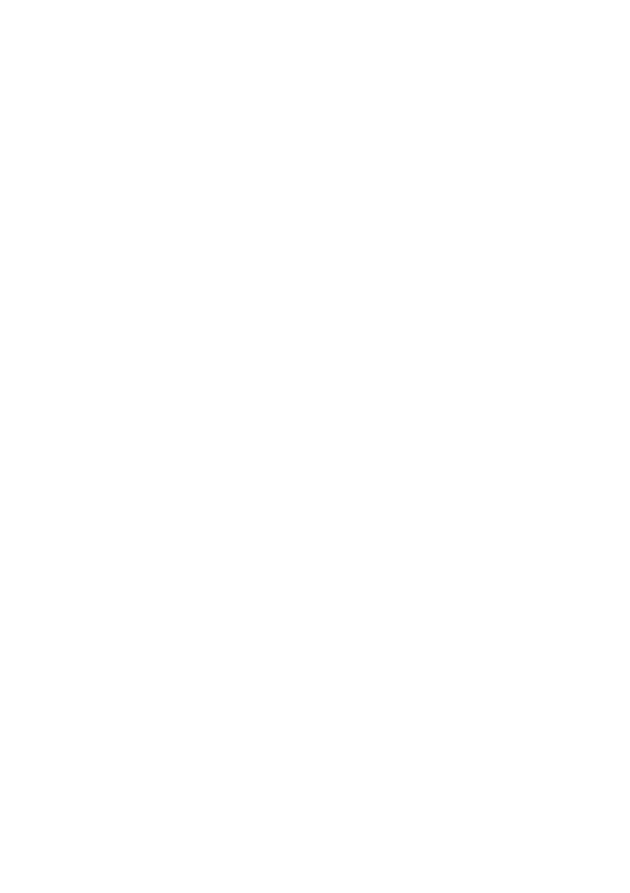
9
»Ah, richtig. Wieder einmal die komplizierten Ver-
schlüsse, die Amateure gleich abschrecken sollen.«
Lester beugte sich über den Fernsehapparat, suchte in
seiner Jackentasche nach einem Mehrzweckschrau-
benzieher und machte sich an die Arbeit. »Was halten
Sie bisher von der Sache, Murray? Delgado ist ein be-
gabter Mann, was?«
»Er hat Talent«, gab Murray zu. »Ich wüßte aller-
dings gern mehr über ihn.«
»Das haben wir alle gemeinsam! Ich möchte zum
Beispiel gern wissen, wo er bisher gesteckt hat.« Le-
ster löste den ersten Verschluß und nahm den näch-
sten in Angriff. »Wissen Sie, als Sam Blizzard mir zu-
erst von diesem Plan erzählt hat, habe ich ihn gefragt,
ob er übergeschnappt sei. Wie kann man soviel Geld
für eine so unsichere Sache ausgeben? Bevor das
Stück nach London kommt, hat es ihn bestimmt fünf-
tausend Pfund gekostet. Aber allmählich komme ich
zu der Überzeugung, daß er vielleicht doch nicht so
unrecht hat. Vor allem die Idee mit diesem Theater
hier war ausgezeichnet. Normalerweise würde ich in
der letzten Reihe sitzen und an den Nägeln kauen;
aber hier kann ich mir bereits überlegen, wie ... He,
verdammt noch mal!«

Er zog die Hand zurück und ließ den Schrauben-
zieher fallen. Murray sprang auf.
»Was ist passiert?«
»Der
verdammte
Kasten
steht
unter
Strom.
Ich
habe
einen
Schlag
abbekommen.«
Lester
beugte
sich
über
das
Gerät
und
rüttelte
an
einem
Knopf.
»Hier
steht
Aus«,
murmelte
er.
»Der
verflixte
Schalter
muß
defekt
sein.
Aber
ich
sehe
trotzdem
nicht
ein,
weshalb
dann
...«
Er sprach weiter mit technischen Fachausdrücken
über Kriechströme und Kondensatoren, die sich nicht
richtig entluden. Murray hörte zu, ohne etwas davon
zu verstehen.
»Soll ich den Stecker aus der Steckdose ziehen?«
fragte er nur.
»Ja, natürlich. Das hätte ich gleich selbst tun müs-
sen.« Lester legte eine Hand auf den Apparat und
roch dann prüfend an den Luftschlitzen. »Komisch.
Der Kasten ist kalt, obwohl er unter diesen Umstän-
den doch wenigstens warm riechen müßte.«
Murray untersuchte das dicke Kabel, das vom Ge-
rät aus zum Boden führte. Es verschwand unter dem
Teppichboden; er ließ sich auf die Knie nieder und
hob den Teppich etwas hoch.
»Eigenartig«, murmelte er vor sich hin. »Lester,
diese Leitung führt nicht zu einer Steckdose. Sie ver-
schwindet einfach unter der Abschlußleiste. Hier, se-
hen Sie das?«

»Was?« Lester kam heran und stützte sich mit einer
Hand auf Murrays Schulter. »Hmm, das ist wirklich
ungewöhnlich.« Das dicke schwarze Kabel lief tat-
sächlich geradewegs auf die Wand zu, erreichte die
Abschlußleiste und verschwand dort in einem Schlitz.
»Das ist neu«, stellte Murray fest. »Sehen Sie, hier
ist erst vor kurzem ein Stück aus der Leiste herausge-
sägt worden.« Er bewegte das Kabel, um Lester zu
zeigen, was er damit meinte.
»Das muß ein Rediffusionssystem sein«, sagte Le-
ster ohne große Begeisterung. »Aber normalerweise
gehört dazu ein externer Wählschalter. Am besten
sehe ich mir den Apparat nochmals an – aber diesmal
ohne einen Schlag.«
Murray drehte sich um und blieb mit dem Rücken
zur Wand auf dem Boden sitzen. Er brauchte nicht
lange zu warten, bis Lester die Rückwand abgenom-
men hatte und einen Blick ins Innere des Geräts wer-
fen konnte. Lester pfiff leise vor sich hin.
»Noch etwas Außergewöhnliches?« fragte Murray,
der nichts anderes erwartet hatte.
»Wirklich sehr außergewöhnlich«, bestätigte Le-
ster. »Der Kasten enthält viel mehr als ein normaler
Fernsehapparat. Murray, haben Sie das von Anfang
an gewußt?« fügte er hinzu. »Haben Sie mich nur mit
Gerrys Stoff hierher gelockt, damit ich einen Blick in
diesen Apparat werfen würde?«

»Wie kommen Sie darauf?« erkundigte Murray
sich ehrlich verblüfft.
»Ida hat beim Mittagessen erzählt, daß Sie eigenar-
tige Drahte in Ihrer Matratze gefunden haben sollen.«
»Ah, richtig.« Murray verbarg seine Erleichterung
nicht.
»Ich bin froh, daß Sie das schon von anderer Seite
erfahren haben.«
Er berichtete rasch, was am vergangenen Abend
passiert war. Lester hörte aufmerksam zu und unter-
suchte dabei weiter das Innere des Fernsehgeräts.
»Und er behauptete, diese Apparate sollten euch
helfen, im Schlaf zu lernen?« erkundigte sich Lester,
als Murrays Bericht zu Ende war. »Hören Sie, das ist
alles blanker Unsinn. Diese Methode wird gelegent-
lich erwähnt – Huxley hatte sie in Brave New World,
erinnern Sie sich? Aber soviel ich weiß, ist sie niemals
mit Erfolg angewandt worden. Falls Delgado sich
einbildet, sie sei für seine Zwecke brauchbar, kann
die Sache jedenfalls nicht schaden, nehme ich an.«
»Aber was soll das alles ohne Lautsprecher? Ich
habe den ganzen Draht aus meiner Matratze gezogen
– aber er war weder mit einem Lautsprecher noch mit
einem Mikrophon verbunden.«
»Nun, es gibt einige Versuchseinrichtungen ...«,
begann Lester. Dann schüttelte er den Kopf. »Nein,
das ist lächerlich. Die Dinger kosten über fünfhundert

Pfund pro Stück, und niemand würde auf den Ge-
danken kommen, sie hier in den Zimmern zu vertei-
len. Kann ich mir die Sache ansehen?«
»Nur noch die traurigen Überreste«, sagte Murray
und stand auf. »Wahrscheinlich sind die gleichen
Drähte an Ihrer Matratze angebracht, wenn Delgado
die Wahrheit gesagt hat. Aber alles andere ...«
Er sprach nicht weiter. Er hatte das Bettuch zu-
rückgeschlagen. Das Drahtgewebe war wieder intakt.
»Delgado scheint die Sache ziemlich ernst zu neh-
men«, stellte er fest. »Er hat den Draht ersetzen las-
sen.« Murray ließ sich nicht anmerken, wie erregt er
war. »Okay, was halten Sie davon?«
Lester sagte zunächst gar nichts. Dann hob er die
Matratze hoch, verfolgte den hauchdünnen Draht bis
zu der Klappe und ließ sich zeigen, wann das Ton-
bandgerät zu laufen begann. Schließlich legte er die
Matratze an ihren Platz zurück.
»Eines steht jedenfalls fest«, sagte er dabei. »Die
Drähte auf der Matratze können unmöglich als Laut-
sprecher oder Mikrophon dienen.«
»Welchen Zweck haben sie sonst?«
»Das weiß ich nicht.« Lester biß sich auf die Unter-
lippe. »Das ist nicht mein Fachgebiet, wissen Sie.
Aber wenn ich etwas vermuten sollte ...«
»Ja?« warf Murray ein.
»Ich könnte mir vorstellen, daß es sich dabei um

eine hochempfindliche Antenne handelt. Sehen Sie
hier.« Lester benützte Daumen und Zeigefinger als
Stechzirkel und maß einzelne Abschnitte des Draht-
geflechts ab. »Das Muster besteht aus Einzelteilen, die
in einem harmonischen Verhältnis zueinander stehen,
nicht wahr? Diese langen Stücke erinnern an einen
Dipol – wie bei Fernsehantennen.« Er schüttelte den
Kopf. »Aber das erklärt noch lange nicht, weshalb das
Zeug hier ist.«
»Besteht eine Verbindung zwischen dem Drahtge-
flecht und dem Kasten dort drüben?« Murray deutete
auf den Fernsehapparat.
»Kann ich nicht sagen. Ich müßte mich stunden-
lang damit beschäftigen, aber solange das Ding unter
Spannung steht, habe ich keine rechte Lust dazu.«
»Können Sie sich überhaupt nicht vorstellen, was
nachträglich eingebaut worden ist?«
»Nein«, antwortete Lester. Er fuhr sich mit dem
Handrücken über die Stirn. »Jedenfalls ist dort nicht
Platz genug für Gerrys Zeug. Am besten schraube ich
die Rückwand jetzt wieder an und lasse den Kasten
stehen.«
»Wollen Sie Delgado danach fragen?«
»Ich
will
ihn
unbedingt
nach
seiner
Hypnopädie
fra-
gen.
Interessiert
es
Sie,
was
ich
wirklich
davon
halte?«
»Natürlich. Mich interessiert jede Meinung. Die Sa-
che beunruhigt mich nämlich.«

»Okay.« Lester steckte die Hände in die Hosenta-
schen. »Meiner Meinung nach wird sich früher oder
später herausstellen, daß Delgado in seinem Fort-
schrittsglauben hereingelegt worden ist. Heutzutage
fallen viele Leute, die eine Diode nicht von einem
Pferdeschwanz unterscheiden können, auf gerissene
Kerle herein, die neue Erfindungen auf dem Gebiet
der Bioelektronik gemacht haben wollen. Meistens
genügen schon ein paar hochtrabende Worte über die
Einstellung auf kosmische Wellenlängen, um die Leu-
te dazu zu bringen, einen kleinen schwarzen Kasten
für hundert Pfund zu kaufen – und der gerissene Kerl
verschwindet lachend. Ich nehme an, daß Sie richtig
vermutet haben: Delgado benützt die Hypnopädie
nur als halbwegs plausible Ausrede, um blanken Un-
sinn zu verdecken. Wie Mrs. Smith, die ihr Bett auf
den magnetischen Nordpol ausrichtet, wissen Sie?«
»Ist das Ihr Ernst?« Murray zögerte noch, obwohl
er zugeben mußte, daß Lester recht zu haben schien.
»Ich würde sogar darauf wetten.« Lester zeigte auf
das Drahtgewebe. »Das Muster ist nicht einmal so
sinnlos, wie es auf den ersten Blick wirkt. Bestünde es
aus Kupferrohren, könnte man es sogar als Fernseh-
antenne benützen. Aber im Grunde genommen ist es
doch zwecklos; es ist gerade unsinnig genug, um zu
meiner Theorie zu passen.«
»Gilt das auch für das Zeug im Fernsehgerät?«

»Höchstwahrscheinlich.« Lester trat an den Appa-
rat und setzte die Rückwand vorsichtig ein. »Ich
glaube nicht, daß es sich lohnt, sich deswegen Sorgen
zu machen. Meinetwegen kann Delgado ans Tisch-
rücken glauben, wenn es ihm Spaß macht. Wichtig ist
doch nur, daß er Talent hat und gut arbeitet, was?«
»Ja, aber ...«
Lester zog die letzten Schrauben an, richtete sich
auf und klopfte Murray auf die Schulter.
»Lassen Sie doch den Unsinn!« mahnte er. »An Ih-
rer Stelle wäre ich froh, noch mal eine Chance be-
kommen zu haben, anstatt mir wegen Delgados Ver-
rücktheiten Gedanken zu machen.«
Murray rang sich ein Lächeln ab. »Das wäre be-
stimmt vernünftiger, was? Sie haben wirklich recht.
Lieber das hier als eine Suppenküche der Heilsar-
mee.«
Als Lester gegangen war, zündete Murray sich eine
Zigarette an und betrachtete nachdenklich das Mu-
ster auf der Matratze.
Das klingt alles ganz plausibel. Aber ich habe trotzdem
das Gefühl, daß es sich nicht so einfach erklären läßt. Hin-
ter der Sache steckt bestimmt irgend etwas anderes.
Er faßte plötzlich einen Entschluß, der dem Ver-
such glich, ein Hornissennest mit einem Stock in Auf-
ruhr zu bringen. Er wurde allmählich ungeduldig.

Diese Probleme hinderten ihn daran, auf der Bühne
wirklich sein Bestes zu geben.
Murray hob die Matratze hoch, bis der dünne
Draht riß. Dann zog er den ganzen Draht aus der Ma-
tratze und ließ ihn im Aschenbecher liegen. Nun war
das Fernsehgerät an der Reihe. Als er davorstand, fiel
ihm ein, daß er das Kabel lieber nicht mit bloßen
Händen anfassen durfte, wenn es tatsächlich unter
Spannung stand, wie Lester behauptet hatte. Statt
dessen hob er das ganze Gerät hoch – es war viel
schwerer als erwartet – und trug es durchs Zimmer.
Als das Kabel straff gespannt war, holte er tief Luft,
machte einen großen Schritt und erwartete dabei, daß
das Kabel entweder reißen oder aus der Wand geris-
sen würde. Aber nichts dergleichen geschah. Weitere
zwei oder zweieinhalb Meter Kabel kamen unter der
Fußbodenleiste hervor, und Murray hörte ein Klirren
und einen gewaltigen Krach im Zimmer Dreizehn.
Murray zog die Augenbrauen hoch und lächelte
leicht. Dann stellte er den Fernsehapparat sorgfältig
auf das Tischchen zurück, versteckte das lange Kabel
unter dem Teppich und ging an die Tür. Er öffnete sie
einen winzigen Spalt breit und beobachtete den Kor-
ridor. Seine Geduld wurde wenig später belohnt: er
sah den sonst so steifen Valentine den Korridor ent-
langrennen.
Wer hätte das gedacht?

Die Tür von Nummer Dreizehn öffnete und schloß
sich. Murray schloß seine eigene Tür und horchte an
der Wand zum Nebenzimmer. Er hörte jedoch nur
ein leises Klirren und Klimpern, als sei Valentine da-
mit beschäftigt, die Trümmer einzusammeln.
Das genügte vorläufig. Nun blieb nur noch Delga-
dos Reaktion abzuwarten. Er verließ sein Zimmer
und ging pfeifend nach unten.

10
Die Reaktion kam, aber obwohl Delgado den Anstoß
dazu gegeben haben mochte, wurde sie von Blizzard
vorgetragen, und Murray mußte bis eine Stunde nach
dem Abendessen darauf warten.
Draußen regnete es. Murray hörte Regentropfen an
die Scheiben klatschen, während er sich mit Adrian
Gardner unterhielt. Dann fiel ihm plötzlich etwas auf.
Nur Blizzard und Delgado waren nicht anwesend; al-
le übrigen Mitglieder des Ensembles waren hier ver-
sammelt, als entwickle die Gruppe allmählich eine
Agoraphobie. Bisher hatte noch niemand vorgeschla-
gen, die hiesigen Pubs zu besuchen oder auch nur ei-
nen Spaziergang im Park zu machen. Draußen regne-
te es, aber die anderen benahmen sich, als wüte ein
arktischer Schneesturm.
Am besten mache ich morgen nach dem Abendessen eine
kleine Spazierfahrt. Ich will mich hier nicht isolieren lassen
...
»Murray, ich habe etwas mit Ihnen zu besprechen.
Entschuldigen Sie uns, Ade – es handelt sich um eine
wichtige Sache.«
Murray schrak aus seinen Gedanken auf. Blizzard
war erschienen und hatte ihm gegenüber Platz ge-
nommen. Adrian zuckte mit den Schultern und stand

auf, um sich einen anderen Gesprächspartner zu su-
chen.
»Ja,
Sam
–
was
kann
ich
für
Sie
tun?«
fragte
Murray.
»Sie können aufhören, sich so verdammt lästig zu
benehmen, wenn Sie es unbedingt wissen wollen«,
antwortete Blizzard. Er nahm eine Zigarre aus der
Tasche, biß das Ende ab und griff nach einem Tisch-
feuerzeug.
Murray wartete, bis Blizzards Zigarre brannte.
Dann sagte er: »Sam, war das ironisch gemeint, oder
wollten Sie mich ärgern? In welcher Beziehung be-
nehme ich mich lästig?«
»Was haben Sie mit dem Fernsehgerät in Ihrem
Zimmer angestellt?«
»Ich wollte es lieber auf der anderen Seite des Betts
stehen haben«, log Murray. »Ist das etwa verboten?«
Blizzard warf ihm einen prüfenden Blick zu, aber
Murrays professionelle Maske war undurchdringlich.
Der große Mann seufzte schließlich.
»Schön, lassen Sie das in Zukunft«, wies er Murray
an. »Valentine hat Ihretwegen fast einen hysterischen
Anfall bekommen. Die Fernsehgeräte im ersten Stock
sind alle mit einem Rediffusionssystem verbunden.
Sie haben offenbar am Kabel Ihres Apparats gezogen
und dadurch einige Geräte umgerissen. Der Schaden
beträgt über fünfzig Pfund.« Er fuhr sich mit einem
Taschentuch über die Stirn. »Hören Sie, Murray, ich

brauche Ihnen wahrscheinlich nicht zu erzählen, daß
mir für dieses Unternehmen mehr Geld zur Verfü-
gung steht, als ich je für eine Produktion habe ausge-
ben können. Aber auch diese Mittel sind nicht uner-
schöpflich, wissen Sie.«
»Aha, jetzt ist es also ein Rediffusionssystem«,
murmelte Murray, ohne auf Blizzard zu achten. »Wie
eigenartig! Lester war der Überzeugung, das sei aus-
geschlossen.« Er betrachtete Blizzard mit einem un-
schuldigen Lächeln.
»Lester! Daran sind Sie auch schuld! Murray, was
wollen Sie eigentlich? Fühlen Sie sich etwa in Ihrem
Stolz verletzt? Los, reden Sie endlich, verdammt noch
mal! Wenn es Ihnen hier nicht gefällt, läßt sich be-
stimmt arrangieren, daß Sie schon morgen ...«
»Augenblick«, unterbrach Murray ihn. »Was soll
ich Lester angetan haben?«
»Er ist vor dem Abendessen bei mir gewesen, um
mich ernsthaft vor Delgado zu warnen.« Blizzard sah
sich um, als habe er Angst, die anderen könnten zu-
hören. »Lester hält Delgado für leicht verrückt, weil
Sie ihm von den Tonbandgeräten in den Betten er-
zählt haben. Murray, tun Sie mir bitte den Gefallen,
in Zukunft Ihren Mund zu halten.«
Murray beugte sich vor. »Sam, wollen Sie den Klub
wie ein Konzentrationslager führen? Wollen Sie uns
verbieten, neugierig zu sein? Du lieber Gott, ist Ihnen

nicht klar, welche Leute Sie hier haben? Wollen Sie
eine Massenhysterie hervorrufen?«
»Genau das will ich nicht – und genau das erzeugt
Ihr Gerede unweigerlich. Hören Sie zu, Murray. Wir
kennen uns seit Jahren – wir haben schon oft zusam-
mengearbeitet –, so daß Sie mich nur absichtlich miß-
verstehen könnten. Ich bin auch nicht damit zufrie-
den, daß hier ein Dutzend erregbarer Leute unter ei-
nem Dach versammelt und unerbittlich gedrillt wer-
den. Ich habe noch nie etwas Ähnliches gehört oder
miterlebt. Aber das ist eben Delgados Methode, und
wenn er darauf besteht, will ich es auch. Welchen
Eindruck haben Sie bisher von Delgado, Murray?«
»Das kann ich noch nicht sagen.«
»Ich habe jetzt seit vier oder fünf Monaten mit ihm
und seinem Kapitalgeber zu tun.« Blizzard streifte die
Asche von seiner Zigarre. »Ich weiß, was ich von
Delgado halte. Der Mann ist ein Genie. Ich finde ihn
unsympathisch, aber ich habe auch einen Heidenre-
spekt vor ihm. Glauben Sie, daß ich das leichtfertig
von einem Menschen behaupten würde, Murray?«
»Nein.«
»Gut, dann verstehen wir uns. Er ist phänomenal
begabt. Er arbeitet mit Unterstützung eines argentini-
schen Multimillionärs, der anscheinend beweisen
will, wie kulturell hochstehend seine Heimat ist, in-
dem er ihre Kultur den Europaern nahebringt. Ich

muß alle diese Neurotiker unter Kontrolle halten ...
Tut mir leid, Murray, das ist mir nur so herausge-
rutscht.«
»Wir sind alle neurotisch«, stellte Murray humorlos
fest.
»Richtig.
Sie
müssen
vor
allem
begreifen,
daß
ich
keine
Ablenkung
dulden
kann.
Dieser
Unsinn
kostet
nur
Zeit.
Wenn
Delgado
von
seiner
Hypnopädie
über-
zeugt
ist,
soll
er
es
meinetwegen
damit
versuchen.
Warum
regen
Sie
sich
deswegen
auf?
Falls
die
Sache
funktioniert,
ist
es
gut;
funktioniert
sie
dagegen
nicht,
kann
es
Ihnen
auch
gleichgültig
sein.
Ich
will
niemand
verbieten,
nach
Herzenslust
neugierig
zu
sein.
Ich
ver-
suche nur, unser Stück zu Ende zu bringen.«
Murray zögerte kurz. »Sie hätten anders anfangen
sollen, Sam«, meinte er dann. »Ich mache mir keine Il-
lusionen, was mich betrifft. Sie dürfen mich nicht für
undankbar halten; ich bin froh, daß ich diese Chance
bekommen habe. Aber angesichts des Films, den Del-
gado gedreht hat, und seines Theaterstücks in Paris
hätten Sie doch Fleet Dickinson engagieren können ...
oder etwa nicht?«
Dieser Nachsatz war nicht geplant. Aber Murray
erinnerte sich jetzt an ein Gespräch mit Roger Grady.
Der Agent hatte ihm von einem Schauspieler erzählt,
der abgelehnt hatte, bevor Roger ihm ein Angebot
machen konnte.

Zum Glück war Blizzard ahnungslos. »Es handelt
sich nicht nur darum, Murray. Delgado erwartet, daß
seine Anweisungen genau befolgt werden; das ist Ih-
nen bestimmt schon aufgefallen. Meistens stört das
nicht, solange man sich von seiner Begeisterung an-
stecken läßt. Aber ich habe schon mit Fleet Dickinson
zusammengearbeitet und weiß deshalb, daß er es
gewöhnt ist, den Boß zu spielen.« Blizzard schüttelte
verblüfft den Kopf. »Was ist plötzlich in mich gefah-
ren? Bisher habe ich noch mit keinem anderen Mit-
glied des Ensembles über diese Dinge gesprochen.«
»Er ist in Sie gefahren«, stellte Murray fest. »Das
macht mir Sorgen, Sam. Wir brauchen natürlich
Selbstvertrauen, wenn wir mit unserem Stück das
West End erobern wollen. Aber ich sehe schon kom-
men, daß wir uns alle daran berauschen und gar
nicht merken, wie schlecht es ist. Sie müssen unbe-
dingt objektiv bleiben, Sam.«
»Ich gebe mir schon Mühe.« Blizzard nickte lang-
sam. »Aber bevor ich kein fertiges Manuskript in
Händen habe, bin ich hier eher Hausvater als Regis-
seur, nicht wahr?«
Murray runzelte die Stirn. »Richtig ... Wissen Sie,
Sam, ich habe eigentlich erwartet, daß wir von einer
bestimmten Idee ausgehen und nur die Dialoge im-
provisieren würden, aber statt dessen haben wir gar
nichts ...«

»Doch, jetzt haben wir etwas!« widersprach Bliz-
zard. »Das können Sie nicht bestreiten. Dabei arbeiten
wir erst seit zwei Tagen.«
»Ja,
natürlich«,
stimmte
Murray
zu,
ohne
überzeugt
zu sein.
»Zuerst habe ich mir deswegen auch Sorgen ge-
macht«, gab Blizzard nach einer Pause zu, »aber an-
scheinend funktioniert die Sache doch ziemlich gut.
Deswegen habe ich mich übrigens auch nicht um
Fleet bemüht. Fleet sucht sich seine Rollen sorgfältig
aus. Selbst Delgados Ruf hätte ihn nicht dazu ge-
bracht, eine Rolle unbesehen zu akzeptieren.«
Murray nickte langsam.
»Hören Sie, Sam, ich muß Sie etwas fragen. Ich
schleppe diese Frage ständig mit mir herum, aber
jetzt muß sie endlich doch heraus. Sie haben mehr-
mals Delgados persönliche Arbeitsweise erwähnt.
Nun, gehört es etwa dazu, uns hier einzusperren, bis
wir fast in die Luft gehen, um dann unser Gekreisch
auf die Bühne bringen zu können?«
Blizzard antwortete nicht gleich. Als er dann
sprach, wich er der Frage aus.
»Wie kommen Sie darauf, Murray?«
»Aus zwei Gründen, Sam. Delgado hat zu Anfang
betont, er lege größten Wert darauf, daß seine Schau-
spieler sich mit ihren Rollen identifizieren. Und ich
verstehe nicht, warum Sie sich diese Schauspieler zu-

sammengesucht haben. Ich und Alkohol. Gerry und
Koks. Ade und hübsche kleine Jungen. Constant, der
eine Chance sieht, doch noch ins West End zu kom-
men – seine erste und letzte Chance. Lauter Leute, die
es sich nicht leisten können, Ihnen den Krempel vor
die Füße zu werfen, weil dies ihre letzte Gelegenheit
ist, Karriere zu machen.«
»Sie können jederzeit mit Ihrem Wagen fortfahren,
wohin Sie wollen«, versicherte Blizzard ihm ge-
kränkt. »Glauben Sie mir jetzt, daß hier niemand ein-
gesperrt wird?«
Murray nickte und stand auf. »Genau das habe ich
vor«, stellte er fest. »Inzwischen regnet es nicht mehr.
Etwas frische Luft tut mir bestimmt gut.«
Er war bereits draußen in der Halle, als ihm auffiel,
daß Blizzard seine Frage eigentlich nicht beantwortet
hatte. Er überlegte noch, ob er zurückgehen und eine
Antwort verlangen sollte, als Valentine aus dem Spei-
sesaal auftauchte.
»Sie wollen ausgehen, Mister Douglas?« erkundig-
te er sich höflich.
»Was geht Sie das an?« fragte Murray.
»Mister Blizzard hat mich angewiesen, das Haupt-
tor um elf Uhr zu schließen, Sir. Wenn Sie wünschen,
kann ich natürlich veranlassen, daß es für Ihren Wa-
gen länger geöffnet bleibt.«

»Nein, danke, das ist nicht notwendig.« Murray
schüttelte den Kopf. »Ich bleibe hier.«
»Sehr wohl, Sir.« Valentine verbeugte sich leicht
und ging davon.
»Valentine!« rief Murray ihm nach.
»Ja, Mister Douglas?«
»Tun Sie mir einen Gefallen? Sagen Sie nicht im-
mer: ›Mister Blizzard hat mich angewiesen.‹ Ich weiß
so gut wie Sie, daß Delgado hier die Befehle erteilt.«
»Ich ... ich weiß nicht, was Sie meinen, Sir.« Valen-
tines Überraschung war gut gespielt, aber nicht ganz
echt.
»Dann wird es langsam Zeit, daß Sie es herausbe-
kommen, nicht wahr?« Murray wandte sich ab und
stieg die Treppe hinauf. Als er sich noch einmal um-
sah, war Valentine verschwunden.
In seinem Zimmer fand wieder das allabendliche
Ritual statt: Murray trennte zwanzig Meter Draht aus
seiner Matratze und ließ sie als Knäuel im Aschenbe-
cher zurück, bevor er zu Bett ging.

11
»Okay, wir machen jetzt eine kurze Pause und sehen
uns um ... äh ... zehn vor zwei wieder.«
»Pause, sagt er«, flüsterte Ida laut. »Dabei brauche
ich demnächst eine Erholungskur. Puh!«
Murray holte tief Luft und atmete langsam aus. Er
notierte sich den Tag in seinem geistigen Kalender.
Donnerstag: Sam Blizzard ordnet zum erstenmal eine
Pause an; bisher hat Delgado ihm diese Entscheidung ab-
genommen. Vielleicht wird doch etwas aus unserem Stück.
Wir haben die Rollen verteilt und kommen gut voran. Ger-
ry macht bereits Entwürfe für das Bühnenbild ...
Er hörte plötzlich auf, sich die Pluspunkte aufzu-
zählen. Er hatte eine schemenhafte Gestalt in der letz-
ten Reihe gesehen.
Heather. Großer Gott – sie hat noch keine Rolle. Sie ist
heute vormittag nicht einmal auf der Bühne gewesen.
Adrian
Gardner
und
Rett
Latham
gingen
vor
ihm
her
zur
Tür;
die
beiden
waren
so
in
eine
Diskussion
über
einen
strittigen
Punkt
vertieft,
daß
sie
nur
kurz
zu
Heather hinübernickten. Murray blieb vor ihr stehen.
»Hallo«, sagte er. »Wo haben Sie gesteckt?«
Sie lächelte gezwungen, hob den rechten Arm und
zeigte ihm einen Farbfleck an ihrem Pullover. »Oh,
ich habe Gerry geholfen.«

Das war nur die halbe Wahrheit. Heather hatte ge-
weint, das merkte man an ihren rotgeränderten Au-
gen. Murray fiel auf, daß bisher noch niemand den
Versuch gemacht hatte, das Mädchen an den Diskus-
sionen und Proben zu beteiligen – nicht einmal Ida,
die Heather damit hätte imponieren können.
»Warum?« fragte er.
»Nun ... Sie wissen schon!« Heather lächelte ver-
zerrt. »Ich bin im Augenblick ziemlich überflüssig.«
»Aber Sie sind doch als Mitglied des Ensembles
engagiert, oder? Sie müssen sich bemerkbar machen,
anstatt im Hintergrund zu bleiben. Wenn Gerry Hilfe
braucht, soll er sich melden.«
»Tut mir leid, ich wollte nicht ...« Sie sah ihn er-
schrocken an.
»Du
lieber
Gott«,
murmelte
Murray,
»ich
wollte
Ih-
nen
keine
Vorwürfe
machen.
Das
war
nur
als
guter
Rat
gedacht. Kommen Sie, wir gehen zum Mittagessen.«
»Danke, ich habe keinen Hunger. Ich gehe lieber
etwas spazieren.«
»Keine schlechte Idee«, stimmte Murray zu. »Wis-
sen Sie was, wir schlagen zwei Fliegen mit einer
Klappe und essen irgendwo im nächsten Pub. Wir
haben eine Dreiviertelstunde Zeit. Die Atmosphäre
hier bedrückt mich allmählich.«
Heathers Miene hellte sich auf. »Oh, das wäre
schön! Aber ich will Ihnen nicht lästig fallen!«

Murray nahm lachend ihren Arm. Am Ausgang
holte Ida sie ein.
»Aha!« sagte sie. »Ich störe doch nicht etwa?
Kommen Sie zum Mittagessen, Heather?«
»Nein ...« Das Mädchen sah verlegen zu Boden.
»Murray hat vorgeschlagen, wir sollten zum Essen in
den nächsten Pub fahren.«
»Vermutlich
in
seinem
Zweisitzer.«
Ida
warf
den
Kopf
zurück.
»Nehmen
Sie
sich
vor
ihm
in
acht,
meine
Liebe. Wissen Sie nicht, wie Murrays Frauen enden?«
Murray ballte die Fäuste. »Wenn du ein Mann
wärst, würde ich dich jetzt verprügeln, Ida«, sagte er
laut. »Aber dazu reicht es eben doch nicht, was?«
Ida antwortete nicht. Sie erkannte offenbar, daß sie
den Bogen überspannt hatte. Anstatt noch etwas zu
sagen, drängte sie sich wortlos an Murray vorbei und
verschwand.
Als Murray die Autoschlüssel aus seinem Zimmer
geholt hatte und wieder nach unten kam, sah Heather
ihm nachdenklich entgegen.
»Murray, darf ich Sie etwas fragen?«
Er wußte, wie diese Frage lauten würde, aber er
nickte, während er Heather die Tür aufhielt.
»Was hat Ida mit ihrer Bemerkung gemeint?«
»Ida ist ein bösartiges Weibsbild«, knurrte er. »Sie
brauchen nicht alles für bare Münze zu nehmen, was
sie sagt.«

»Aber ...« Heather biß sich auf die Unterlippe.
»Murray, ich will nicht neugierig sein. Aber ich habe
gemerkt, daß Idas Bemerkung Sie getroffen hat, und
ich möchte Sie nicht verletzen, ohne es zu wollen.
Wissen Sie, was ich meine?«
Er antwortete nicht gleich, sondern hielt ihr die Au-
totür auf. Heather erwiderte seinen Blick. Murray
setzte sich ans Steuer, steckte den Zündschlüssel ins
Schloß und starrte das Armaturenbrett an. Schließlich
zuckte er mit den Schultern.
»Die Sache ist schon lange kein Geheimnis mehr.
Ganz London weiß davon.« Er holte tief Luft. »Meine
Frau hat den Verstand verloren. Sie ist eines Abends
davongelaufen, während ich auf der Bühne stand.
Zwei Wochen später hat die Polizei sie in einem Bor-
dell in Poplar entdeckt. Zum Glück hatte sie wenig-
stens einen falschen Namen angegeben. Nun ist sie in
einer Nervenheilanstalt untergebracht, die sie nie
wieder verlassen wird. Zufrieden?«
»Oh!« Heather starrte ihn an. »Das habe ich nicht
gewußt, Murray! Haben Sie deshalb ...?«
»Nein,
ich
habe
zu
trinken
begonnen,
um
mein
Ge-
wissen
zu
beruhigen.«
Murray
ließ
den
Motor
an.
»Ich
hätte
meine
Frau
rechtzeitig
zum
Psychiater
schicken
müssen;
vielleicht
wäre
sie
dann
jetzt
gesund.«
Er
fuhr
an. »Wechseln wir jetzt das Thema, einverstanden?«

Um fünf Uhr nachmittags war Murray ihr sogar
dankbar dafür, daß sie diese Angelegenheit zur Spra-
che gebracht hatte. Die alte Bitterkeit, die wieder in
ihm aufgestiegen war, half ihm jetzt, seine Rolle zu
gestalten. Gerry Hoarding hatte in der Mittagspause
vier Leinwände, Tische und Stühle hereingeschleppt
und damit ein Bühnenbild mit zwei Ebenen skizziert.
Er war über und über mit Farbe beschmiert, aber
trotzdem bester Laune; seine gute Stimmung ver-
blüffte Murray, denn Gerry hatte sich seit Montag-
abend kein Heroin mehr geben lassen.
Murray wußte, daß er und die anderen gut gespielt
hatten, als die letzte Probe der ersten Szene vorüber
war. Er erwartete sogar ein Lob von Delgado, denn
sie hatten sich alle im Gegensatz zu früher erheblich
gesteigert. Aber als Blizzard sich nach Delgado um-
drehte und ihm einen fragenden Blick zuwarf, rea-
gierte der Autor auf unerwartete Weise.
»So, jetzt können wir mit diesem Unsinn aufhö-
ren!« Was? Alle starrten Delgado verständnislos an.
Blizzard fand als erster die Sprache wieder; er hatte
sich allerdings auch nicht mit einer Rolle identifizie-
ren müssen.
»Manuel, was soll plötzlich dieser ...?«
Delgado wirkte äußerlich gelassen, aber seine
Stimme zeigte, wie erregt er war.
»Wir können aufhören, habe ich gesagt. Dieser Un-

sinn hängt mir zum Hals heraus. Sie wissen jetzt un-
gefähr, was ich will, und wir fangen morgen mit dem
eigentlichen Stück an.«
»Augenblick!« Blizzard war aufgestanden. Die an-
deren schwiegen noch, weil sie merkten, daß Blizzard
ausdrücken würde, was sie alle dachten. »Manuel, Sie
können doch nicht einfach die Arbeit einer ganzen
Woche wegwerfen, wenn alles tadellos klappt!«
»Glauben Sie?« Delgado machte eine verächtliche
Handbewegung. »Es lohnt sich wirklich nicht, dieses
Zeug aufzuheben. Murray Douglas, den Sie so eifrig
angepriesen haben, ruiniert uns alles – er ist kein
Schauspieler, sondern ein billiger Schmierenkomödi-
ant.«
»He, das ist eine verdammte Lüge!« Erstaunlicher-
weise kam Ida Murray zur Hilfe. Sie drängte sich
nach vorn und blieb vor Delgado stehen. »Jeder weiß,
daß ich nicht gerade in Murray verliebt bin, aber er
hat hier bisher ausgezeichnet gespielt, das müssen Sie
selbst gemerkt haben. Was soll also der Unsinn? Wol-
len Sie uns absichtlich gegeneinander aufbringen?«
»Sie sind rührend loyal«, versicherte Delgado ihr
eisig. »Sobald Sie sich morgen davon erholt haben,
können wir vielleicht mit der ernsthaften Arbeit be-
ginnen. Aber jetzt ... Cherry, bitte das Manuskript.«
Das Mädchen gab ihm den dicken Schnellhefter,
der den Entwurf des Bühnenstücks enthielt.

»So!« sagte Delgado und stand auf. »Damit Sie se-
hen, daß ich es ernst meine.«
Er hielt den Schnellhefter, der über hundert Blätter
faßte, in beiden Händen, zerriß ihn ohne sichtliche
Anstrengung, legte die Hälften zusammen und zerriß
sie ebenfalls. Die anderen staunten über die unerwar-
teten Körperkräfte, die er dabei entwickelte.
»Die Probe ist beendet. Sie können gehen«, fügte
Delgado hinzu und verließ die Bühne in Richtung
Ausgang.
Blizzard eilte hinter ihm her. Murray sah sich um.
»Hat jemand eine Zigarette für mich?« fragte er dann.
»Glauben Sie, daß es sein Ernst war?« erkundigte
Adrian sich nervös und bot ihm seine Packung an.
»Natürlich ist das sein Ernst«, knurrte Murray.
»Und niemand von uns kann es sich leisten, ihm vor
die Füße zu Spucken und abzureisen.« Er zündete
sich die Zigarette an und nahm einen tiefen Zug.

12
Die anderen schwiegen betroffen. Murray sah sich
verständnislos um. Auf allen Gesichtern stand der
gleiche ungläubige Ausdruck.
»Delgado vor die Füße spucken und abreisen?«
wiederholte Constant Baines schließlich. »Hören Sie,
Murray, nur weil er Ihnen Vorwürfe gemacht hat,
brauchen Sie nicht gleich überzuschnappen.«
Murray schüttelte verwirrt den Kopf. »Augenblick!
Was soll das? Nur weil dieser Idiot Delgado ...«
»Hacken
Sie
nicht
immer
auf
ihm
herum«,
unter-
brach
Constant
ihn.
»Ich
habe
alles
gehört.
Trotzdem
bleibt
die
Tatsache,
daß
wir
von
vorn
anfangen
müs-
sen,
weil
ihm
Ihre
Arbeit
nicht
gefallen
hat.
Stimmt's?«
Jess Aumen knallte den Flügel zu, an dem er bisher
gesessen hatte; er sprang auf und ging zum Ausgang.
Lester Harkham erschien auf der Bühne und folgte
ihm mit hängenden Schultern.
»Vielleicht überlegt er sich die Sache noch?« schlug
Adrian hoffnungsvoll vor. »Wir sind doch ganz gut
vorangekommen. Wahrscheinlich will er uns nur
schockieren.«
»Unsinn, Ade«, murmelte Ida. »Der Kerl ist ver-
rückt, darüber brauchen wir uns gar keine Illusionen
zu machen.«

»Ich möchte nur wissen, weshalb Sie auf Murrays
Seite stehen«, sagte Constant. »Sie haben ihn tapfer
verteidigt, aber Delgado kann seine Leistung besser
beurteilen, weil er Sie von dort aus gesehen hat.« Er
deutete auf die Sitze.
»Ich ... mir hat die Szene sehr gut gefallen«, meinte
Heather unsicher von der dritten Reihe aus. »Ich weiß
nicht, was Delgado daran auszusetzen hat.«
»Mischen Sie sich nicht ein, Heather!« forderte
Constant Sie auf. »Sie haben bisher noch nichts beige-
tragen, deshalb müssen Sie auch den Mund halten,
verstanden?«
»Constant hat recht«, behauptete Rett Latham.
»Delgado bleibt bestimmt bei seinem Entschluß, und
wir haben eine ganze Woche vergeudet, weil Mur-
rays Darstellung ihm nicht paßt.«
Die anderen äußerten sich nicht dazu; sie beobach-
teten jetzt Gerry Hoarding, der auf der Bühne er-
schien, ein Messer aus der Tasche holte und die Ent-
würfe zerschnitt, die er vor wenigen Stunden so stolz
aufgebaut hatte. Dann sprang er wortlos von der
Bühne und lief zum Ausgang.
»Na, wenigstens einer, der die Sache ernst nimmt«,
behauptete Al Wilkinson. »Rett, wir verschwinden
jetzt am besten.«
»Gute Idee.«
Die Bühne leerte sich rasch. Nur Ida blieb noch zu-

rück, als wolle sie Murray aufmuntern; dann zuckte
sie jedoch mit den Schultern und ging ebenfalls. Sie
nahm Heather mit. Murray war allein.
Er hatte vorhergesagt, daß der Klub sich in ein Ir-
renhaus verwandeln würde. Gab es eine bessere Me-
thode, um dieses Ziel zu erreichen? Dieser Abend
würde schrecklich werden, aber morgen stand ihnen
noch mehr bevor, wenn Delgado tatsächlich Wort
hielt und von vorn anfing.
Murray
ging
an
der
Reihe
vorbei,
in
der
Heather
ge-
sessen
hatte.
Dort
fiel
ihm
etwas
Weißes
auf.
Ein
Ta-
schentuch,
das
unter
den
Sitz
gefallen
war.
Er
hob
es
auf.
Es
war
tränennaß.
Die
arme
Kleine.
Warum
hatte
Blizzard
sie
engagiert,
wenn
er
ihr
keine
Rolle
geben
wollte?
Man
hätte
fast
glauben
können,
Heather
sei
für
Ida
bestimmt
–
wie
das
Heroin
in
Gerrys
Zimmer,
das
für den Bühnenbildner bereitgelegen hatte ...
In diesem Augenblick hörte er, daß über ihm eine
Tür ins Schloß fiel, und dieses Geräusch alarmierte
ihn sofort.
Gerry hatte ihm erzählt, sein Zimmer liege mitten
über dem Theater. Das war eben Gerrys Tür gewesen.
»Großer Gott!« sagte Murray und lief erschrocken
zum Ausgang.
Der junge Bühnenbildner antwortete nicht, als Mur-
ray kurze Zeit später an seine Tür klopfte. Die Tür

war abgeschlossen. Murray eilte in sein eigenes
Zimmer, sah hinter den Vorhang und atmete erleich-
tert auf, als er das Glas dort sah. Es war noch immer
bis zum Rand gefüllt. Murray versteckte es wieder
und wandte sich langsam ab.
Das ungute Gefühl wurde stärker. Er ging in den
Korridor, legte das Ohr an Gerrys Tür und hielt den
Atem an.
Ein Klirren, Metall auf Metall oder Glas auf Metall.
Ein Zündholz wurde angerissen. Murray erschrak, als
er sich vorstellte, was hinter der Tür geschah.
»Gerry!« rief er laut. »Gerry, lassen Sie das! Hören
Sie auf!«
Er bekam keine Antwort, aber das Klirren war
wieder zu hören. Murray trommelte mit beiden Fäu-
sten gegen die Tür.
»He, was soll das, Murray?« fragte Constant hinter
ihm. Er war aus Nummer Elf gekommen.
»Helfen Sie mir, die Tür aufzubrechen!« verlangte
Murray.
»Sind Sie verrückt?« Constant zog die Augenbrau-
en hoch.
»Helfen Sie mir, Sie Idiot! Gerry ist dabei, sich He-
roin einzuspritzen, und er hat mir gesagt, daß er eine
Überdosis nehmen könnte, wenn er deprimiert ist.
Wollen Sie zusehen, wie er stirbt?«
Constant wurde blaß. Er stellte sich wortlos neben

Murray auf. »Okay, mit der Schulter«, wies Murray
ihn an. »Auf drei ... eins, zwei, drei!«
Sie warfen sich gleichzeitig gegen die Tür; das
Schloß gab nach und wurde aus dem Türstock geris-
sen. Gerry wandte sich langsam vom Tisch ab, auf
dem er seine Ausrüstung liegen hatte – eine Email-
schale, in der eine Injektionsspritze lag, ein Glas mit
weißem Pulver wie das andere, das er Murray zur
Aufbewahrung übergeben hatte, und einen kleinen
Spiritusbrenner. Er hielt einen Teelöffel mit verboge-
nem Stiel in der rechten Hand; sein linker Hemdsär-
mel war hochgekrempelt, und Murray sah, daß Gerry
sich den Arm mit einer Krawatte abgebunden hatte.
Dann
griff
Murray
nach
dem
Teelöffel,
verschüttete
die
wenigen
Tropfen
Flüssigkeit,
die
er
enthielt,
und
drängte
den
hysterischen
Mann
auf
sein
Bett
zurück.
Gerry
wehrte
sich
verzweifelt,
aber
die
beiden
Männer
waren
stärker;
er
gab
schließlich
nach
und
blieb
liegen.
»Das sollte also die zweite Spritze werden«, stellte
Murray fest. Er deutete auf den blutenden Einstich an
Gerrys Arm.
»Der Teufel soll euch beide holen«, zischte Gerry.
»Verschwindet! Los, verschwindet schon!«
»Noch nicht.« Murray wandte sich ab und griff
nach dem Glas. »Constant, durchsuchen Sie alles.
Vielleicht hat er irgendwo noch mehr von diesem
Zeug versteckt.«

»Genügt das nicht?« fragte Constant mit einem
Blick auf das Glas. »Menschenskind, so viel Koks ha-
be ich noch nie gesehen.«
»Er hat mir ein gleichgroßes Glas zur Aufbewah-
rung übergeben. Wo es zwei gibt, gibt es vielleicht ein
Dutzend. Los, suchen Sie endlich!«
»Verschwindet«, forderte Gerry sie auf. Er lag er-
schöpft auf dem Rücken und schwitzte heftig.
Constant drehte sich um und begann den Raum zu
durchsuchen. Murray sah in jedem Versteck nach,
das ihm einfiel. Sie fanden beide nichts. Gerry war
unterdessen eingeschlafen; die erste Spritze wirkte
jetzt, und er würde etwa eine Stunde ruhig schlafen.
»Okay«, meinte Murray, »jetzt kann ihm nichts
mehr passieren. Aber wir nehmen sein Zeug mit, falls
er sich nur schlafend stellt.« Er hob den Teelöffel vom
Boden auf, legte ihn in die Schale neben die Injekti-
onsspritze und blies den Spiritusbrenner aus.
Constant nickte und folgte ihm schweigend in den
Korridor hinaus. Er schien nach Worten zu suchen.
Dann räusperte er sich.
»Ah ... Murray, ich muß mich noch bei Ihnen ent-
schuldigen. Ich weiß wirklich nicht, weshalb Delgado
es auf Sie abgesehen hatte. Ich hätte den Mund halten
sollen.«
»Schon gut«, wehrte Murray ab.
Constant schluckte trocken. Er starrte das Glas in

Murrays Hand an. »Sie haben Gerry das Leben geret-
tet, nicht wahr?«
»Vielleicht«, antwortete Murray. »Höchstwahr-
scheinlich. Das Zeug ist chemisch rein, und Gerry
weiß selbst, wie gefährlich es in diesem Zustand ist.«
»Aber wo hat er es her?« wollte Constant wissen.
»Soviel hat er sich nie leisten können! Ich verstehe
selbst nichts davon«, fügte er rasch hinzu, »aber man
hört schließlich, was andere Leute dafür bezahlen.«
Murray wollte schon antworten, als ihm etwas in
Constants Zimmer auffiel. Neben dem Bett lag ein
Buch auf dem Nachttisch.
»Darf ich?« fragte er und betrat das Zimmer, ohne
die Antwort abzuwarten. Er setzte Gerrys Ausrü-
stung ab und nahm das Buch zur Hand. Der Titel lau-
tete:
»Justine oder Das Unglück der Tugendsamen von Mar-
quis de Sade, neu ins Englische übertragen von Algernon
Charles Swinburne. Mit hundert Illustrationen verschie-
dener Künstler. Privatdruck, London 1892.«
Constant wurde rot und machte eine vage Hand-
bewegung. »Es gehört nicht mir – ich habe es hier ge-
funden. Ich wußte gar nicht, daß es existiert. Manche
Zeichnungen erinnern an Beardsley.«
Murray blätterte das Buch durch, legte es fort und
warf einen Blick auf die übrigen Titel, die das Regal
füllten. Er sah Juliette, Die 120 Tage von Sodom, Millers

Rosige Kreuzigung, eine hübsche Fanny Hill und ein
gutes Dutzend anderer Bücher der gleichen Art.
»Ich ... äh ...« Constant schluckte trocken. »Ich leihe
Ihnen gern ein paar, wenn Sie wollen.«
»Nein, danke.« Murray richtete sich auf. »Ich habe
genug mit meinen eigenen Schwächen zu kämpfen,
ohne mir die anderer Leute zu eigen zu machen.«
»Seien Sie nicht so hochnäsig, Murray!«
»Tut mir leid.« Murray griff wieder nach der Schale
und dem Glas. »Sie wollten wissen, woher Gerry das
Heroin hat – er hat es in seinem Zimmer gefunden,
wie Sie Ihre Bücher hier gefunden haben. Wie ich ge-
nügend Alkohol entdeckt habe, um einen Heiligen in
Versuchung zu führen. Wissen Sie, was ich glaube,
Constant? Delgado hat kein Gehirn, sondern einen
Gully im Kopf.«

13
Murray versteckte auch das zweite Glas Heroin und
die Emailschale mit der Injektionsspritze hinter dem
Vorhang in seinem Zimmer. Er hatte noch kein besse-
res Versteck gefunden. Dann trat er zurück, ließ die
Hände herabsinken und schüttelte deprimiert den
Kopf, als ihm einfiel, daß schon morgen einer der
Diener ein neues Glas und eine neue Spritze in Ger-
rys Zimmer zurücklassen konnte.
Er zündete sich eine Zigarette an und ging im
Zimmer auf und ab. Das mußte bereits geschehen
sein. Alle anderen Möglichkeiten schieden aus. Gerry
hätte sich diese Mengen Heroin nie leisten können.
Das Zeug wurde kostenlos geliefert.
Murray war davon überzeugt, daß das alles Delga-
dos Idee gewesen war. Seine ›Arbeitsweise‹ – woraus
bestand sie eigentlich? Wollte er die Schauspieler
zum Wahnsinn treiben? Murray überlegte sich erst-
mals, ob er versuchen sollte, mit Schauspielern Ver-
bindung aufzunehmen, die in Trois Fois à la Fois mit-
gespielt hatten.
Und trotzdem ... einige Mitglieder des Ensembles
hatten allzu willig reagiert, als Delgado mit der Peit-
sche knallte. Murray dachte an Constant; er hatte sich
später bei ihm entschuldigt – aber erst nachdem er

Gerry in Lebensgefahr gesehen hatte. Selbst Adrian,
der doch viel Bühnenerfahrung besaß, hatte nicht
protestiert. Nur Ida war dazu bereit gewesen – und
Heather, aber ihre Meinung war unwichtig.
Murray drückte seine Zigarette wütend aus und
ging an sein Bett. Er hatte das Drahtgewebe jeden
Abend automatisch entfernt, um es am nächsten Tag
wieder an Ort und Stelle zu finden. Auch heute ent-
deckte er es auf seiner Matratze, aber diesmal gab er
sich nicht damit zufrieden, den Draht abzureißen.
Statt dessen öffnete er die Klappe, nahm die Spulen
vom Tonbandgerät und warf sie nacheinander aus
dem Fenster.
Dann atmete er erleichtert auf. Diese Geste war
ziemlich kindisch, aber sie beruhigte ihn. Er zündete
sich eine neue Zigarette an und überlegte.
Wenn er nicht vor morgen früh herausbrachte, was
Delgado eigentlich beabsichtigte, war der Teufel los.
Die Ressentiments der anderen würden sich dann mit
aller Gewalt über ihm entladen. Wahrscheinlich war
ihre weitere Arbeit dadurch ernsthaft gefährdet. Aber
Murray hatte den Verdacht, daß Delgado sich nicht
sonderlich viel daraus machen würde.
Was wollte er also überhaupt? Murray spielte mit
dem Gedanken, daß Delgado gar keinen Wert darauf
legte, das geplante Stück zu Ende zu bringen. Viel-
leicht hatte er Ähnlichkeit mit den Gestalten in Con-

stants Büchern und fand sein Vergnügen daran, an-
dere zu quälen? Da sein argentinischer Geldgeber
ihm offenbar fast unbegrenzte Mittel zur Verfügung
stellte, kam es ihm bestimmt nicht darauf an, Tau-
sende von Pfund zu vergeuden.
Nein, diese Idee war zu absurd. Delgado hatte ei-
nen Film gedreht, der die Anerkennung aller Kritiker
gefunden hatte. Das in Paris aufgeführte Theater-
stück mit Garrigue in der Hauptrolle war ein großer
Erfolg gewesen ...
An dieser Stelle fiel Murray wieder ein, was Roger
Grady gesagt hatte: »Weil Garrigue Selbstmord be-
gangen hat. Weil Léa Martinez in eine Nervenheilan-
stalt gebracht werden mußte. Weil Claudette Myrin
ihre kleine Tochter zu ermorden versuchte.«
Würde Roger nächstes oder übernächstes Jahr zu
einem anderen sagen: »Weil Murray Douglas wieder
zu trinken begonnen hat. Weil Gerry Hoarding eine
Überdosis Heroin genommen hat. Weil ...?«
Nein.
Murray fühlte, daß ihm der Schweiß ausbrach. Sei-
ne Hände zitterten. Er konzentrierte sich wieder auf
unmittelbare Probleme. Irgend etwas war an der gan-
zen Sache faul. Es gab keinen vernünftigen Grund,
weshalb Delgado plötzlich mit ihren bisherigen Lei-
stungen unzufrieden sein sollte; er hatte sich offenbar
nur über Murray geärgert und wollte sich auf diese
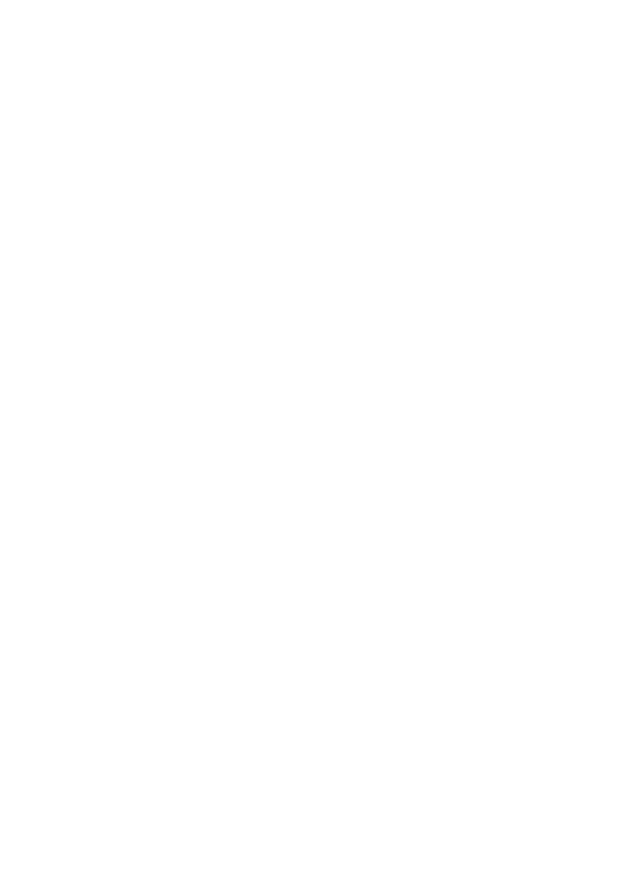
Weise an ihm rächen. Aber Murray hatte ihm erst
einmal Anlaß dazu gegeben, als er nach den Ton-
bandgeräten fragte.
Murray wollte diese Angelegenheit weiter untersu-
chen. Er hatte keine Ahnung, was davon zu erwarten
war, aber er mußte schließlich irgend etwas tun und
sah keine andere Möglichkeit.
Wo sollte er also beginnen? Er zündete sich eine
Zigarette an und betrachtete nachdenklich die Wand
hinter dem Fernsehgerät, die sein Zimmer von
Nummer Dreizehn trennte. Das Kabel war jetzt gesi-
chert – er hatte bereits daran gezogen –, so daß er
keinen Schaden mehr damit anrichten konnte. Und
die Tür war immer abgeschlossen. Davon hatte er
sich ebenfalls überzeugt.
Aber dann fiel ihm etwas ein ...
Murray ging ans Fenster, öffnete es und sah hin-
aus. Ja, er hatte offenbar recht. Wenn Gerrys Zimmer
mitten über dem Theater lag, mußte Zimmer Drei-
zehn sich genau über der Bühne befinden. Er überleg-
te, ob er von hier aus zum Fenster des Nebenzimmers
gelangen könnte, mußte diese Absicht jedoch wieder
aufgeben, weil er keine Übung als Fassadenkletterer
hatte. Außerdem war das Fenster bestimmt fest ver-
schlossen.
Er ging nach unten.

Murray betrat die Bühne, nachdem er das Licht im
Zuschauerraum eingeschaltet hatte. Er sah nach oben,
ohne recht zu wissen, wonach er eigentlich suchte.
Der Raum über der Bühne war dunkel, und Murray
mußte sich anstrengen, um überhaupt etwas zu er-
kennen. Aber dann fiel ihm etwas auf.
Über der Bühne schien eine Art Metallgitter zu
hängen.
Er sah sich um. Im Hintergrund standen der Tisch
und die Stühle, die Gerry hereingeschleppt hatte.
Wenn er einen Stuhl auf den Tisch stellte, mußte er
das Gitter mit ausgestreckten Händen erreichen kön-
nen.
Murray kletterte auf den Tisch. Nun befand sich
das Metallgitter dicht über ihm. Er berührte es nicht,
sondern holte sein Feuerzeug aus der Tasche und be-
leuchtete damit die Kupferstäbe des Gitters, dessen
Muster ihn an das Drahtgeflecht auf seiner Matratze
erinnerte. Dieses Gitter schien sich über den gesam-
ten Bühnenraum zu erstrecken, soviel im Halbdunkel
zu erkennen war ...
»Was finden Sie so interessant, Murray?«
Murray fuhr zusammen, wäre fast von seinem
Stuhl gefallen und hielt sich im letzten Augenblick
am Gitter fest. Unter ihm stand Delgado an der Ram-
pe. Sein blasses Gesicht trug einen wütenden Aus-
druck, aber die Stimme klang beherrscht.

Murray holte tief Luft. Dann antwortete er: »Wenn
Sie es nicht wissen, Delgado, weiß es hier bestimmt
niemand!«
Delgado trat einen halben Schritt zurück, als habe
ihn ein Schlag getroffen. »Kommen Sie sofort herun-
ter, Murray!« befahl er scharf. »Sie haben schon ge-
nügend Schaden mit Ihrer verdammten Neugier an-
gerichtet!«
Murray zog die Augenbrauen hoch. Er fühlte sich
sicher, weil er gesehen hatte, wie Delgado er-
schrocken war. »Okay, wir schließen einen Kompro-
miß«, schlug er vor. »Sie erzählen mir, welchen
Zweck diese Anlage hat, und ich schnüffle nicht wei-
ter herum. Aber diesmal möchte ich die Wahrheit hö-
ren.«
Delgado antwortete nicht gleich; er kam auf die
Bühne und legte eine Hand auf den Tisch, auf dem
Murrays Stuhl stand. »Kommen Sie jetzt herunter
oder muß ich Sie herunterholen? Glauben Sie ja nicht,
daß ich das nicht könnte!«
Murray erinnerte sich daran, daß Delgado ohne
sichtliche Anstrengung Hunderte von Blättern mit ei-
nem Ruck zerrissen hatte; wenn er dazu imstande
war, konnte er auch den Tisch umstürzen. Murray
blieb keine andere Wahl: er mußte sich ergeben.
Delgado trat zurück und beobachtete Murray, der
jetzt vom Tisch sprang.
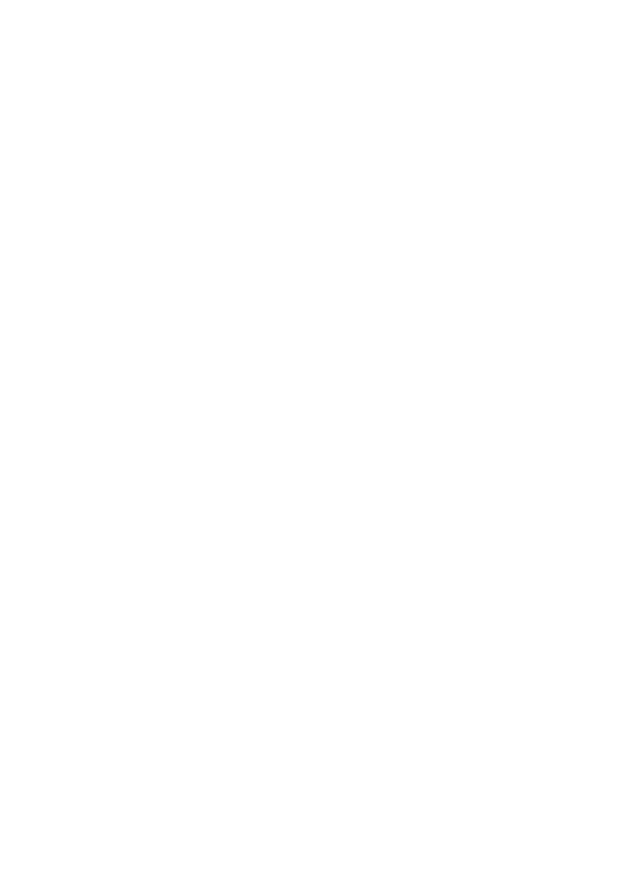
»Ich habe die Sache mit Ihnen allmählich satt, Mur-
ray«, stellte er fest. »Sie bemühen sich anscheinend,
möglichst unangenehm aufzufallen, anstatt anzuer-
kennen, daß Sie hier bequem untergebracht sind,
hervorragend bezahlt werden und noch dazu Gele-
genheit haben, an einem völlig neuartigen Projekt
mitzuarbeiten, das ...«
»Haben Sie diese Rede selbst aufgesetzt?« unter-
brach Murray ihn. »Oder war das auch eine Kollek-
tivimprovisation?«
Delgado zuckte leicht zusammen, und Murray lä-
chelte zufrieden, als er sah, welche unbeabsichtigte
Wirkung seine Frage gehabt hatte.
»Was hatten Sie hier vor, Murray?« wollte Delgado
wissen. »Warum zerstören Sie Sachen, die nicht Ihnen
gehören? Warum machen Sie mir absichtlich Schwie-
rigkeiten?«
»Weil Sie ein ungeschickter Lügner und ein noch
schlechterer Schauspieler sind, Delgado«, antwortete
Murray. »Ich glaube nicht, daß Ihnen wirklich etwas
an unserem Stück liegt. Sie haben Sam Blizzard of-
fenbar davon überzeugt, daß Sie ein Genie sind, und
Sie sind bestimmt talentiert genug, um selbst ein gu-
tes Stück zu schreiben. Aber Sie können sich darauf
verlassen, daß Sie mich weder mit Drohungen noch
durch Bestechung dazu bringen, daß ich mich Ihren
Anordnungen bedingungslos unterwerfe, ohne neu-

gierige Fragen zu stellen! Sie können Gerry sein He-
roin und Constant seine schmutzigen Bücher geben –
vielleicht bilden diese beiden sich ein, Sie täten ihnen
einen Gefallen, und sind Ihnen dafür dankbar. Aber
ich lasse mich nicht von Ihnen hereinlegen! Solange
Sie Ihre Tricks mit mir versuchen, ohne mir die
Wahrheit zu sagen, muß ich selbst sehen, wie ich ihr
auf die Spur komme. Ist das klar?«
Delgado hatte aufmerksam zugehört. Dabei war
sein Selbstbewußtsein offenbar wieder gestiegen,
denn er lachte kurz, und Murray lief ein kalter
Schauer über den Rücken.
»Sie sind sich Ihrer Sache nicht sehr sicher, was?«
fragte er lächelnd. »Sie müssen so laut reden, um sich
selbst Mut zu machen. Sie haben einfach Angst, daß
hier etwas vorgehen könnte, das Sie nicht verstehen.
Sie haben das Gefühl, irgendeinen wichtigen Hinweis
versäumt zu haben und dieser Gedanke erschreckt
Sie. Deshalb zerstören Sie etwas. Sie können es sich
nicht leisten, einfach nach London zurückzufahren,
aber indem Sie etwas zerstören, beweisen Sie sich
selbst, daß Sie eigentlich doch stark sind. Und Sie
versuchen mir die Schuld in die Schuhe zu schieben,
weil Sie sich Ihr Versagen nicht eingestehen wollen.«
»Immer die gleichen Methoden«, stellte Murray
verächtlich fest. »Sie weichen meinen Fragen aus, Sie
beleidigen mich und hoffen, daß ich mich von einem

Temperamentsausbruch ablenken lasse. Aber darauf
falle ich nicht mehr herein. Sie haben irgend etwas
vor und benützen das Theaterstück nur als Vorwand.
Solange Sie diese Tatsache leugnen, werde ich sie zu
beweisen versuchen.«
»Sie sind hartnäckig«, sagte Delgado, »aber ich
weiß, was ich tue, und Sie wissen es nicht. Ich brau-
che mich nicht zu fragen, wer von uns beiden in die-
sem Wettstreit unterliegen wird. Gut, wie Sie wollen.
Sie werden einiges auszustehen haben, wenn Ihre
Kollegen merken, daß Sie absichtlich ihre Arbeit be-
hindern. Ich kann es mir jedoch leisten, Sie und alle
anderen fortzuschicken.«
Er lächelte kurz. »Und Sie können sich nichts lei-
sten. Ich bin Ihre letzte Hoffnung, Murray.«

14
Mein ... mein Kopf? O Gott, mein Kopf!
Murray befreite sich mühsam aus den Klauen eines
Alptraums. Er hatte wütende Kopfschmerzen, die
seinen Schädel zu sprengen drohten. Ihm war fast
schlecht, und sein Hals tat weh, als er zu schlucken
versuchte. Die ganze Mundhöhle fühlte sich pelzig
an.
Murray kombinierte diese Wahrnehmungen zu ei-
ner bestimmten Vorstellung und schrak auf. Ein Blick
zeigte ihm, daß es noch früh sein mußte; durchs Fen-
ster drang graues Tageslicht in sein Zimmer. Er lag in
einem zerwühlten Bett. Es roch nach kaltem Zigaret-
tenrauch, und Murray weigerte sich zunächst, den
anderen Geruch zu erkennen, der fast noch stärker
war.
Er drehte sich um; nun ließ es sich nicht länger
leugnen.
Auf dem Nachttisch stand nicht nur ein übervoller
Aschenbecher. Daneben lag ein umgefallenes Glas,
das längst auf dem Fußboden zersplittert wäre, wenn
es nicht von einer Zigarettenpackung aufgehalten
worden wäre. Der Inhalt des Glases war aufs Bett
und den Boden getropft. Murray brauchte nicht erst
an der Flüssigkeit zu riechen, um zu wissen, daß es

Gin war; er sah die leere Flasche vor seinem Bett lie-
gen.
Aber das ist nicht wahr. Gott, laß es nicht wahr sein!
Murray richtete sich auf und sah eine zweite Fla-
sche unter dem Waschbecken stehen. Er setzte die
Füße auf den Bettvorleger und schlug beide Hände
vors Gesicht.
Gestern abend ... was war gestern abend gesche-
hen? Er konnte sich nicht daran erinnern. Er stand
auf, ging ans Waschbecken und hielt den Kopf unter
das kalte Wasser. Als er etwas davon getrunken hat-
te, konnte er wieder klarer denken.
»So«, sagte er laut, »ich glaube es nicht.«
Das Ganze erinnerte ihn zu sehr an eine Bühnen-
dekoration. Gerry Hoarding hätte diesen Auftrag
übernehmen können: Vermitteln Sie den Eindruck,
der Bewohner dieses Raums sei ein Alkoholiker. Alles
war geradezu bühnenwirksam aufgebaut.
Hatte
Delgado
ihn
diesen
bösen
Streich
spielen
las-
sen?
Murray
war
davon
überzeugt,
auch
am
vergange-
nen
Abend
keinen
Tropfen
Alkohol
angerührt
zu
ha-
ben.
Er
klammerte
sich
an
diese
Überzeugung,
obwohl
sein
Gedächtnis
ihn
im
Stich
ließ.
Nichts
hätte
ihn
wie-
der
dazu
bringen
können
–
weder
Delgados
Vorwürfe
noch die Ressentiments seiner Kollegen. Nichts.
Murray wußte jetzt, daß irgend jemand aus irgend-
einem Grund versucht hatte, diesen falschen Ein-
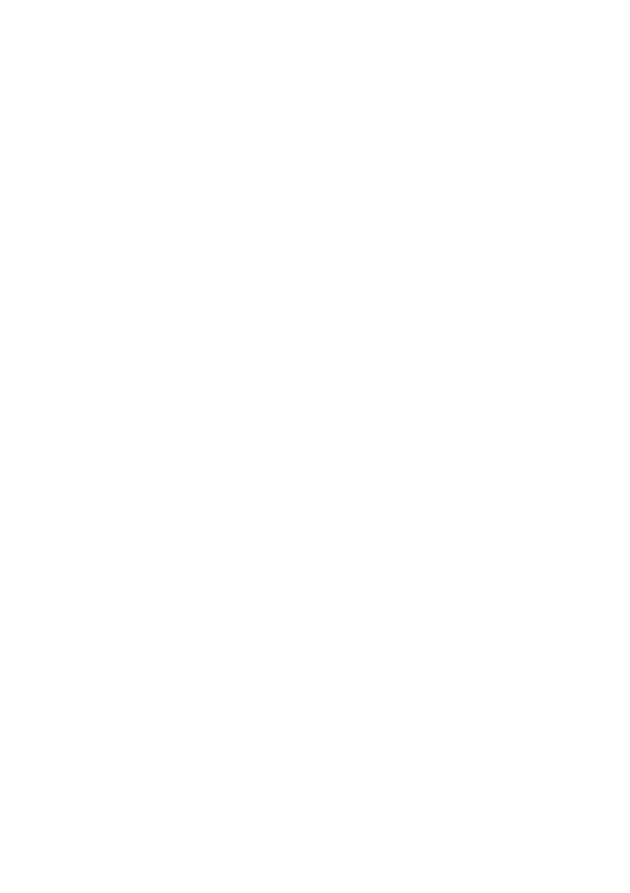
druck in ihm zu erwecken. Eigenartigerweise war un-
terdessen nichts mehr von den Kopfschmerzen und
der Übelkeit zu spüren, unter denen er zuvor gelitten
hatte. Eine Illusion? Lächerlich, aber ...
Er atmete erleichtert auf, als er merkte, daß selbst
der schlechte Geschmack im Mund verschwunden
war. Damit schied eine Möglichkeit aus, die er ge-
fürchtet hatte – daß jemand ihm den Alkohol intrave-
nös beigebracht haben könnte.
Ein Traum? Nein, er konnte alles geträumt haben,
nur die Ginflaschen und das Glas nicht. Dann fiel ihm
etwas anderes ein; er hob seine Matratze hoch und
stellte verblüfft fest, daß die Tonbandspulen, die er
am Vorabend aus dem Fenster geworfen hatte, wie-
der an ihrem Platz waren. Auch das Drahtgewebe
war intakt, und die Verbindung zwischen Matratze
und Tonbandgerät bestand wieder.
Murray sah auf seine Uhr. Noch nicht sieben. Er
überlegte angestrengt. Ein Arzt, der eine Blutuntersu-
chung vornehmen konnte. Ja, das war die einzige Lö-
sung. Und wenn er dann sicher wußte, daß sein Kör-
per keinen Alkohol enthielt, konnte er ...
Murray zog sich in fliegender Eile an und verließ
sein Zimmer. Im gleichen Augenblick kam Valentine
aus Zimmer Dreizehn; er schloß die Tür jedoch so
rasch, daß Murray keine Gelegenheit hatte, einen
Blick in das geheimnisvolle Zimmer zu werfen.

»Guten Morgen, Mister Douglas«, sagte Valentine.
Murray murmelte einen Fluch und hastete weiter.
»Mister Douglas!« rief Valentine ihm nach. »Woll-
ten Sie ausgehen?«
»Was kümmert Sie das?« fragte Murray.
»Ich möchte Ihnen nur mitteilen, daß das Tor um
diese Zeit noch geschlossen ist, Sir.«
Murray blieb stehen und drehte sich um. Er starrte
Valentine an. »Dann öffnen Sie es gefälligst!« verlang-
te er.
»Ich habe meine Anweisungen von Mister Bliz-
zard, Sir. Das Tor soll bis acht Uhr geschlossen blei-
ben. Und jetzt ist es noch nicht einmal sieben, nicht
wahr?«
»Sind wir hier im Gefängnis?«
Valentine zuckte mit den Schultern. »Mister Bliz-
zard besteht darauf, Sir. Ich habe nicht nach seinen
Gründen gefragt.«
»Schön, das wird sich gleich herausstellen. In wel-
chem Zimmer schläft er?«
»Ich glaube nicht, daß er gestört werden möchte,
Sir. Er steht meistens erst spät auf ...«
Murray holte tief Luft. »Blizzard!« brüllte er. »Bliz-
zard, wo stecken Sie?« Er hämmerte mit beiden Fäu-
sten an die nächste Tür. »Blizzard! Kommen Sie her-
aus!«
»Scheren Sie sich zum Teufel!« antwortete Rett

Lathams Stimme Murray ging von einer Tür zur an-
deren und rief weiter nach Blizzard. Einer der Diener
erschien und wollte wie Valentine protestieren.
»Bleiben Sie mir vom Hals«, forderte Murray ihn
auf, »sonst werfe ich Sie die Treppe hinunter, ver-
standen? Blizzard!«
Eine der Türen wurde geöffnet. Sam Blizzard er-
schien im Schlafanzug auf der Schwelle. Er rieb sich
verschlafen die Augen und gähnte.
»Murray! Was soll das Geschrei?«
»Sind wir hier im Gefängnis?« fragte Murray laut.
»Sind Valentine und seine schwarzen Krähen unsere
Gefängniswärter? Dieser Halunke versucht mir zu
erzählen, er dürfe mir das Haupttor nicht aufschlie-
ßen!«
»Was hat das mit mir zu tun?« erkundigte Blizzard
sich aufgebracht. »Warum schreien Sie dann nach
mir?«
»Haben Sie Valentine also nicht befohlen, das Tor
erst um acht Uhr zu öffnen?« Murray ballte die Fäu-
ste.
»Großer Gott, natürlich nicht! Meinetwegen kann
es immer offen sein. Was wollen Sie überhaupt jetzt
schon außerhalb?«
Murray ignorierte Blizzards Frage. Er wandte sich
an Valentine. »Was haben Sie dazu zu sagen?« er-
kundigte er sich.

Valentine zuckte nicht einmal mit der Wimper.
»Tut mir leid, Mister Blizzard«, sagte er. »Ich hätte
nicht gedacht, daß Mister Douglas Sie wecken würde.
Da er sich so eigenartig benahm, hielt ich es für bes-
ser, ihn auf diese Weise davon abzuhalten, das Haus
zu verlassen. Er fährt einen schnellen Wagen, und in
dieser nervösen Verfassung ...«
Die nächste Tür in Richtung Treppe wurde geöff-
net, und Delgado erschien in einem dunkelroten
Schlafrock. Seine Haare waren gekämmt, und er
wirkte keineswegs verschlafen.
Valentine sprach nicht weiter.
»Was soll die ganze Aufregung?« erkundigte Del-
gado sich gelassen.
»Oh ... guten Morgen, Manuel.« Blizzard rieb sich
das Kinn. »Ich bin noch nicht schlau daraus gewor-
den. Murray will fort, und Valentine hat ihm vorge-
schwindelt, er dürfe das Tor erst um acht Uhr öffnen.
Angeblich soll ich den entsprechenden Befehl erteilt
haben – aber ich weiß nichts davon.«
Enttäuschung? Angst? Besorgnis? Irgend etwas
zeigte sich flüchtig auf dem blassen Gesicht. Aber die
Stimme blieb unverändert ruhig.
»Valentine hat sich offenbar geirrt. Ich habe vorge-
schlagen, das Tor nachts zu schließen. Das Haus ent-
hält genügend Dinge, die Einbrecher anlocken könn-
ten – zum Beispiel die Alkoholvorräte der Bar.«
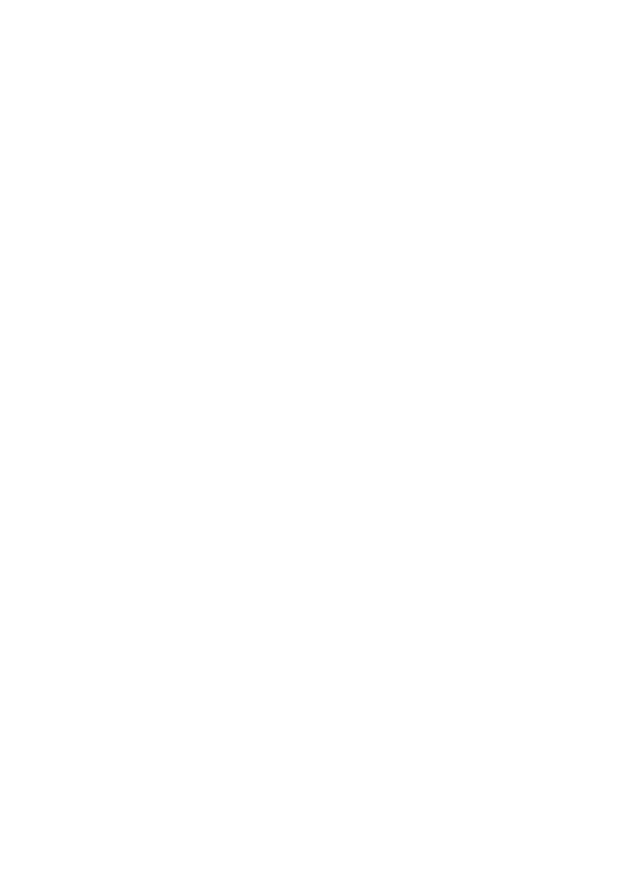
»Tut mir leid, Mister Delgado.« Valentine sah
schuldbewußt zu Boden. »Ich hatte vergessen, daß
Sie mir diese Anweisung gegeben haben.«
»Schön, dann befehlen Sie ihm jetzt, daß er mich
hinauslassen soll!« warf Murray ein.
Delgado
warf
ihm
einen
prüfenden
Blick
zu.
»Sie
scheinen
erregt
zu
sein,
Murray«,
stellte
er
fest.
»Was
treibt
Sie
zu
dieser
unchristlichen
Zeit
aus
dem
Haus?«
»Ich will ... Sam, merken Sie sich das, weil es später
bestimmt wichtig ist ... ich will zu einem Arzt. Sie
kennen den Grund dafür, Delgado.«
»Ich kann mir keinen vorstellen«, murmelte Delga-
do, aber diesmal war sein Unbehagen noch deutlicher
wahrnehmbar.
»Verdammt noch mal, Murray!« Blizzard trat einen
Schritt vor. »Warum haben Sie nicht gleich gesagt,
daß Sie krank sind? Wir haben mit einem Arzt ver-
einbart, daß er sich notfalls um uns kümmert. Er kann
in einer halben Stunde hier sein.«
»Ein Arzt, den Delgado vorgeschlagen hat?« fragte
Murray und schüttelte den Kopf. »Nein, vielen Dank.
Ich fahre jetzt weg und suche mir irgendwo einen
Arzt. Und ich bin keineswegs krank, Sam. Delgado
kann Ihnen erzählen, weshalb ich einen Arzt brauche.
Wird das Tor geöffnet oder nicht?«
»Sam, ich finde, daß Murray in diesem Zustand
nicht ...«, begann Delgado leise.

»Auch recht!« Murray drehte sich wütend um.
»Dann fahre ich eben mit dem Auto dagegen! Mein
Daimler hält einiges aus ...«
»Valentine!« knurrte Blizzard. »Machen Sie ihm
das verdammte Tor auf. Ich will nichts mehr von die-
sem Unsinn hören. Wer hinaus will, darf jederzeit
hinaus, verstanden? Und das ist mein Ernst, Manuel.
Sie machen uns die Arbeit schon schwer genug, los,
beeilen Sie sich, Valentine! Bleiben Sie nicht länger als
unbedingt nötig fort, Murray. Wir haben keinen
leichten Tag vor uns.«
Er sah noch einmal zu Delgado hinüber und ver-
schwand in seinem Zimmer.
Delgado runzelte die Stirn. Murray rechnete schon
damit, daß der andere ihn aufzuhalten versuchen
würde. Aber Delgado zuckte nur mit den Schultern
und wandte sich ab.
Murray ging hinter Valentine her die Treppe hin-
unter.

15
Valentine blieb wie eine Statue am offenen Tor stehen
und sah Murray nach, der nach rechts abbog und
rasch davonfuhr. Murray mußte einige Meilen weit
fahren, bevor er das nächste Dorf erreichte, das nur
aus etwa zwanzig Häusern, einer Kirche, dem Pub
und zwei Läden bestand. Im Vorgarten eines der
Häuser arbeitete eine Frau. Murray trat auf die Brem-
se.
»Entschuldigen Sie, aber können Sie mir sagen, ob
es hier einen Arzt gibt?« rief er.
»Ein Arzt!« wiederholte die Frau. »Ja, natürlich!
Vier Häuser weiter auf der rechten Straßenseite.«
Murray bedankte sich und fuhr wieder an. Inzwi-
schen hatte es zu nieseln begonnen, und das Nieseln
hatte sich in einen Landregen verwandelt, bevor er
das angegebene Haus erreichte. Murray achtete nicht
darauf, sondern sprang aus dem Wagen und lief zur
Haustür.
Eine blasse ältere Frau öffnete auf sein Klingeln.
»Ich muß den Doktor sprechen«, sagte Murray. »Es
ist sehr dringend.«
Die Frau runzelte die Stirn. »Oh! Doktor Cromarty
frühstückt noch. Die Sprechstunde beginnt erst um
...«

»Das ist mir gleich! Ich muß ihn sofort sprechen«,
drängte Murray.
»Handelt es sich um einen Unfall?«
»Nein. Bitte! Ich kann es Ihnen nicht erklären. Ich
brauche nur einen Arzt. Und ich bezahle jedes Hono-
rar.«
»Oh ... nun, kommen Sie lieber herein, Mister ...
Mister ...?«
»Douglas.«
Die Haushälterin starrte ihn an. »Sind Sie etwa
Murray Douglas?«
»Richtig«, bestätigte er.
»Kommen Sie herein, Mister Douglas! Das Warte-
zimmer ist dort drüben. Ich sage Doktor Cromarty
gleich, daß Sie warten.«
Sie
eilte
davon.
Murray
ging
nicht
ins
Wartezimmer,
sondern
blieb
im
Flur
stehen.
Er
überlegte,
welchen
plausiblen
Grund
er
dem
Arzt
angeben
sollte,
aber
be-
vor
er
zu
einem
Schluß
gekommen
war,
erschien
be-
reits
ein
grauhaariger
Mann
vor
ihm,
der
sich
rasch
seine Brille aufsetzte, um ihn prüfend zu betrachten.
»Mister Douglas!« sagte der Arzt. »Ah, ganz recht,
jetzt erkenne ich Sie. Ich dachte schon, meine Haus-
hälterin habe nicht richtig gesehen. Hmm! Kommen
Sie mit in die Praxis und erzählen Sie mir, was ich für
Sie tun kann.«
Murray folgte ihm. Dr. Cromarty nahm Platz und

bot ihm mit einer Handbewegung einen Stuhl an.
»Nun, worum handelt es sich?« fragte er.
»Doktor Cromarty, können Sie feststellen, ob mein
Blut Alkohol enthält?« begann Murray vorsichtig.
»Hmm, Sie sind zufällig an die richtige Adresse
gekommen – obwohl das natürlich um diese Tages-
zeit ein etwas seltsamer Wunsch ist.« Cromarty warf
ihm einen forschenden Blick zu. »Ich nehme derartige
Untersuchungen meistens im Auftrag der Polizei vor,
wenn Verdacht auf Trunkenheit am Steuer besteht.«
Sein Gesichtsausdruck veränderte sich. »Sie haben
doch nicht etwa einen Unfall gehabt, Mister Douglas?
Dann müßte ich ...«
»Nein, nein, keineswegs«, beteuerte Murray. »Die
Sache ist einfach zu erklären, aber ich will es versu-
chen. Ich probe mit dem Ensemble eines neuen Thea-
terstücks im Fieldfare House ...«
»Ah! Wirklich schade, daß der Klub schließen muß-
te. Entschuldigen Sie! Weiter, bitte.« Dr. Cromarty
lehnte sich zurück.
Murray zögerte kurz. Eine halbe Lüge war hier be-
stimmt besser als eine ganze. »Dieser Job bedeutet
mir viel, weil ich einige Zeit arbeitslos war«, fuhr er
dann fort. »Ich war in einer Trinkerheilanstalt.«
Cromarty zog die Augenbrauen hoch.
»Falls der Verdacht aufkommt, ich hätte wieder zu
trinken begonnen, verliere ich meine Rolle. Nun gibt

es in unserem Ensemble jemand, der sie mir ohnehin
nicht gönnt, und er hat mir einen bösen Streich ge-
spielt. Ich bin heute morgen mit einer Ginflasche im
Bett aufgewacht, und in meinem Zimmer stinkt es
nach Fusel. Deshalb muß ich irgendwie beweisen,
daß ich trotzdem nicht getrunken habe.«
Cromarty schwieg nachdenklich. »Haben Sie das
wirklich nicht?« fragte er dann.
»Nein!« antwortete Murray leidenschaftlich.
»Hmmm.« Cromarty schüttelte zweifelnd den
Kopf. »Wir können es ja versuchen, Mister Douglas.
Aber Sie wissen natürlich, daß der Alkoholgehalt des
Bluts seinen höchsten Stand etwa eine Stunde nach
dem letzten Drink erreicht, und daß der Körper man-
cher Menschen den Alkohol verhältnismäßig schnell
abbaut. Ein negativer Befund um diese Tageszeit
braucht nicht allzuviel zu bedeuten.«
»Ich bin seitdem noch nicht auf der Toilette gewe-
sen«, sagte Murray.
Cromarty schüttelte nochmals den Kopf und erhob
sich. »Nun, ich nehme die Untersuchung vor, Mister
Douglas – aber ich kann nichts versprechen.«
»Negativ, Mister Douglas.«
Murray hatte das Gefühl, unendlich lange gewartet
zu haben. Als der Arzt aus seinem Labor zurückkam
und ihm das Untersuchungsergebnis mitteilte, schrak

er so zusammen, daß ihm die Zigarette aus der Hand
fiel. Er bückte sich und hob sie wieder auf.
»Gott sei Dank«, flüsterte er.
»Das Ergebnis ist natürlich nicht hundertprozen-
tig«, fügte Dr. Cromarty hinzu und nahm an seinem
Schreibtisch Platz. »Ich nehme an, daß Sie ein Attest
für den Produzenten haben wollen?«
»Ja, bitte.«
»Gut.« Dr. Cromarty schraubte seinen Füllfederhal-
ter auf. »Ich schreibe am besten, daß Sie um halb acht
zu mir gekommen sind, daß ich auf Ihren Wunsch ei-
ne Alkoholuntersuchung vorgenommen habe, und
daß das Untersuchungsergebnis negativ war.«
Er schrieb rasch, steckte das Attest in einen Um-
schlag und gab es Murray, der es in seine Brieftasche
legte.
»Was bin ich ...?« begann er, aber Dr. Cromarty hob
abwehrend die Hand.
»Ich habe immer Mitleid mit Menschen in Ihrer
Lage, Mister Douglas. Einer meiner besten Freunde
war Alkoholiker, und er hat sich nicht wie Sie davon
freimachen können. Die Untersuchung war kosten-
los.«
Murray bedankte sich und eilte hinaus.
Die anderen saßen noch beim Frühstück, als er zu-
rückkam. Murray stellte fest, daß im Speisesaal eine

gespannte Atmosphäre herrschte. Blizzard und Del-
gado saßen oben am Tisch und stritten sich halblaut;
Ida und Heather, die ihnen am nächsten saßen,
schwiegen und horchten offenbar angestrengt; Adri-
an Gardner, Rett Latham und Al Wilkinson saßen mit
mürrischen Gesichtern am anderen Ende. Als Murray
den Speisesaal betrat, drehten sich alle nach ihm um –
selbst Delgado.
Er hielt Dr. Cromartys Attest in der Hand und legte
es vor Sam Blizzard auf den Tisch.
»Okay«, sagte er laut, »das ist mein Beweis.«
Blizzard las das Attest. Murray sah inzwischen zu
Delgado hinüber. Der Autor lächelte spöttisch, und
Murrays Selbstvertrauen verflog. Er wußte plötzlich,
was geschehen sein mußte.
»Das ist alles gut und schön«, stellte Blizzard fest,
»aber haben Sie deswegen den Krach geschlagen,
Murray?«
Murray sah zu Valentine hinüber, der unbeweglich
am Büfett stand. Dann holte er tief Luft und sagte
langsam: »Heute morgen habe ich eine leere Ginfla-
sche, ein umgefallenes Glas und eine volle Flasche in
meinem Zimmer gefunden. Das war ein gemeiner
Trick, und ich möchte wissen, wer dafür verantwort-
lich ist.«
Blizzard runzelte die Stirn. »Aha!« rief er aus. »Sie
wußten nicht, ob es sich wirklich um einen Trick

handelte, und haben sich deshalb untersuchen las-
sen?« Er deutete auf das Attest. »Ich bin ganz Ihrer
Meinung – das war ein gemeiner Trick.«
Aber Murray beobachtete ihn nicht. Er behielt Del-
gado im Auge. Trotzdem merkte er nicht, daß der
Autor dem Butler ein Zeichen gab. Vielleicht hatten
die beiden sich irgendwie anders verabredet. Jeden-
falls trat Valentine vor und sagte:
»Entschuldigen Sie, Mister Blizzard, aber ich glau-
be eher, daß Mister Douglas einen sehr lebhaften Alp-
traum gehabt hat. Ich habe sein Zimmer selbst aufge-
räumt und nichts Derartiges gefunden.«
Delgado gestattete sich ein leichtes Lächeln, das of-
fenbar nur für Murray bestimmt war. Bevor Murray
jedoch widersprechen konnte, erklang eine andere
Stimme hinter ihm.
»Das ist eine verdammte Lüge!«
Die Anwesenden drehten sich um. Gerry Hoarding
war unbemerkt hereingekommen.
»Ich habe alles gehört«, stellte Gerry fest, »und ich
weiß, daß Valentine lügt. Ich bin heute morgen in
Murrays Zimmer gewesen, um mich bei ihm zu ...
nun, das ist jetzt unwichtig. Ich wollte jedenfalls zu
ihm, habe aber keine Antwort auf mein Klopfen be-
kommen, obwohl im Zimmer etwas zu hören war.
Deshalb habe ich den Korridor von meinem Zimmer
aus beobachtet und Valentine mit einigen Ginfla-

schen unter dem Arm aus der Tür kommen sehen.
Das weiß ich ganz bestimmt!«
Murray atmete erleichtert auf.
»Valentine?« fragte Blizzard scharf.
Der Butler war sehr blaß geworden. »Ich muß mich
entschuldigen, Sir. Ich bin mir darüber im klaren, daß
Mister Douglas unter einer unglücklichen Veranla-
gung leidet – das hat er mir am Tag seiner Ankunft
selbst erzählt. Ich kann nur sagen, daß ich besonders
diskret sein wollte.«
»Sam, ich glaube, daß wir uns privat unterhalten
müssen«, meinte Delgado und schob seinen Stuhl zu-
rück.
»Bleiben Sie sitzen!« brüllte Murray ihn an. »Wir
diskutieren hier in aller Öffentlichkeit. Sam, hören Sie
zu? Ich behaupte, daß Delgado die Flaschen in mei-
nem Zimmer verteilt hat – entweder selbst oder mit
Valentines Hilfe. Als ich zu einem Arzt gefahren bin,
wollte er zurückweichen und hat trotzdem gehofft,
ich würde mich zum Narren machen und den Ein-
druck erwecken, ich litte an Säuferwahn. Das wäre
ihm auch geglückt, wenn Gerry mich nicht hätte be-
suchen wollen. Habe ich recht?«
Murray
glaubte
zunächst,
Blizzard
werde
sich
von
seinen
Argumenten
überzeugen
lassen.
Aber
der
Pro-
duzent
war
so
von
Delgados
Persönlichkeit
hypnoti-
siert,
daß
er
bei
seiner
ursprünglichen
Meinung
blieb.

»Douglas ist überdreht«, behauptete Delgado.
»Dieser ungerechtfertigte Angriff überrascht mich
keineswegs. Offenbar kann er mich nicht mehr aus-
stehen, seitdem ich gestern vorgeschlagen habe, einen
neuen Anfang mit dem Stück zu machen. Vielleicht
hat er Angst vor der Arbeit.«
»Von Ihnen lasse ich mich nicht beleidigen!« knurr-
te Murray. »Jedenfalls steht fest, daß jemand den Gin
in mein Zimmer geschmuggelt hat. Das Zeug ist nicht
von selbst dort aufgetaucht.«
»Nein, natürlich nicht. Aber ich nehme an, daß Sie
uns diese kleine Komödie vorspielen, um Sam zu be-
eindrucken.«
Diesmal widersprach selbst Blizzard. »Nein, Ma-
nuel, das kann ich nicht glauben. Aber ich will hier
keine Hexenjagd veranstalten.« Er stand auf. »Kom-
men Sie, wir müssen unter vier Augen darüber spre-
chen. Murray, Sie bleiben hier und trinken eine Tasse
Kaffee, um sich zu beruhigen.«
»Aber ...«
»Tun Sie, was ich sage. Ich verstehe Ihre Erregung,
aber im Augenblick werde ich aus Ihren Behauptun-
gen nicht recht schlau. Keine Angst, ich komme der
Sache noch auf den Grund, darauf können Sie sich
verlassen!«

16
»Das ist alles Unsinn, glaube ich.« Rett Latham mach-
te eine wegwerfende Handbewegung. »Meiner Über-
zeugung nach hat Murray sich gestern abend in sei-
nem Zimmer die Nase begossen. Und heute morgen
hatte er plötzlich Gewissensbisse.«
»Trottel!« sagte Ida scharf. »Kapieren Sie wirklich
nicht, daß er deshalb zu einem Arzt gefahren ist? Sam
Blizzard hat ein Attest in der Tasche, in dem bestätigt
wird, daß Murray nichts getrunken haben kann.«
»Aber was nützt die Untersuchung nach so langer
Zeit?« warf Al Wilkinson ein. »Manche bauen den
Alkohol schneller ab, und ein alter Säufer ist wahr-
scheinlich schneller als die meisten anderen.«
»Ich glaube Murray«, stellte Heather fest. »Delgado
versucht zu beweisen, daß Murray die Sache selbst
inszeniert hat. Aber warum sollte er das tun?«
»Diese Streiterei geht mir auf die Nerven«, behaup-
tete Constant mürrisch. »Warum sollte Delgado sich
die Mühe machen, Murray diesen Streich zu spielen?
Das ist eine viel bessere Frage.«
»Und ich kann sie beantworten«, erklärte Murray
ihm.
»Okay, ich höre.« Constant verschränkte die Arme.
»Gut, fangen wir an.« Murray holte tief Luft. »Sie

haben gestern selbst zugegeben, daß Sie nicht wirk-
lich glauben, Delgado habe die Probe meinetwegen
abgebrochen, nicht wahr?« Als Constant zögernd
nickte, fuhr Murray fort: »Er hat eine persönliche
Aversion gegen mich, weil ich über die Apparate in
unserem Zimmer gestolpert bin, deren Zweck er
nicht erklären kann oder will. Ich habe zum Beispiel
immer wieder die Drähte aus der Matratze gerissen,
aber ...« Er machte eine Pause, weil er glaubte, Hea-
ther wolle etwas sagen, aber Adrian Gardner ergriff
diese Gelegenheit, um auszurufen:
»Doch nicht schon wieder die verdammten Ton-
bandgeräte! Das wird allmählich langweilig, Mur-
ray.«
»Richtig«, stimmte Jess Aumen zu. Er hatte bisher
am Flügel gesessen und ›stumm‹ geübt; nun stand er
auf und näherte sich der Gruppe.
»Es handelt sich nicht nur um die Tonbänder«,
stellte Murray fest. »Auch die Fernsehapparate sind
umgebaut worden, und in Zimmer Dreizehn stehen
irgendwelche geheimnisvollen Geräte. Lester, wußten
Sie, daß hier über der Bühne ein Netz aus Gitterstä-
ben angebracht ist? Sie können sich selbst davon
überzeugen. Und die Bühne liegt unter Zimmer Drei-
zehn.«
Der Beleuchter schüttelte den Kopf. »Sie haben ge-
hört, was ich davon halte, Murray. Lauter pseudo-
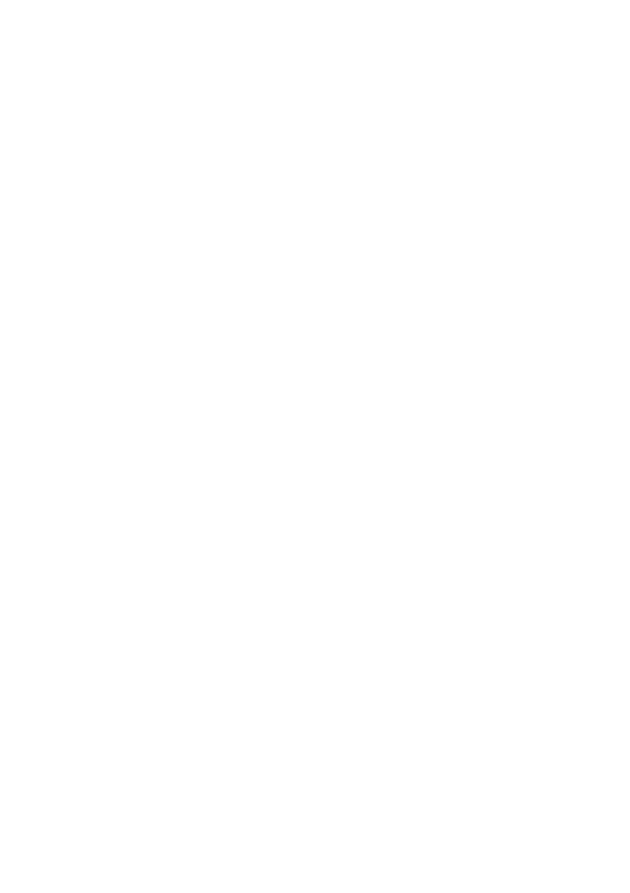
wissenschaftliches Zeug. Die ganze Aufregung lohnt
sich wirklich nicht.«
»Delgado ist anderer Meinung«, erklärte Murray
ihm. »Er ist gestern hier aufgetaucht, als ich mir das
Gitter angesehen habe, und er hat ...«
»Er hat Ihnen einige Grobheiten gesagt, auf die Sie
jetzt auf diese Weise reagieren?« unterbrach Rett
Latham ihn. »Murray, das ist alles nur Geschwätz. Sie
haben bisher nichts bewiesen, und ich habe die Sache
allmählich satt.«
»Hört! Hört!« stimmte Ade zu und sah demonstra-
tiv auf seine Uhr. »Sam und Delgado sollten aufhö-
ren, Murrays Märchen zu diskutieren, damit wir end-
lich weitermachen können.«
»Halt den Mund, Ade!« forderte Gerry Hoarding
ihn auf. »Wie kommen Sie dazu, Murrays Erzählung
als Märchen zu bezeichnen? Glauben Sie denn, daß
ihm das Spaß gemacht hat?«
»Warum Sie auf seiner Seite stehen, ist wohl klar,
was?« Adrian lächelte spöttisch.
»Womit hat Delgado Sie gekauft, Ade?« fragte Ger-
ry leise. Er ballte dabei die Fäuste, als wolle er sich
auf den anderen stürzen. »Mit vielen hübschen Kna-
ben?«
»Verdammt noch mal, haltet endlich die Klappe!«
warf Jess Aumen wütend ein. »Wenn ihr so weiter-
macht, sind wir bald alle irrenhausreif!«

Murray sah ein, daß Jess recht hatte; er zuckte mit
den Schultern, ging nach hinten und ließ sich in der
vorletzten Reihe auf einen Platz fallen. Wenig später
tauchte Gerry neben ihm auf.
»Menschenskind, wie haben Sie es nur fertigge-
bracht, Ade nicht den Schädel einzuschlagen?« fragte
der junge Bühnenbildner.
»Das weiß ich auch nicht«, gab Murray zu. »Ich
weiß es wirklich nicht. Vielleicht will ich Delgado nur
nicht den Gefallen tun, mit den anderen Streit anzu-
fangen.«
»Hmmm.« Gerry zündete sich eine Zigarette an.
»Warum tut Delgado das alles? Um sein Stück reali-
stischer zu machen? Das ist doch verrückt!«
»Wahrscheinlich ist er verrückt«, murmelte Mur-
ray. »Aber das sind wir alle, weil wir uns mit ihm ab-
geben.«
Dann öffnete sich die Tür hinter ihnen. Delgado
und Sam Blizzard marschierten auf die Bühne zu. Der
Autor wirkte etwas angegriffen.
»Sam hat wider Erwarten einen guten Kampf gelie-
fert«, flüsterte Murray Gerry zu. »Sehen Sie sich Del-
gado an!«
Gerry nickte. »Glauben Sie, daß er ihn dazu ge-
bracht hat, einen Rückzieher zu machen?«
»Nein, das bezweifle ich sehr«, antwortete Murray.

Aber Blizzard hatte es tatsächlich geschafft.
Er brauchte sich nicht bemerkbar zu machen, als er
auf die Bühne kletterte. Einige Sekunden lang
herrschte tiefes Schweigen, während Delgado zu sei-
nem Stuhl im Hintergrund der Bühne ging.
»Ich habe lange mit Manuel gesprochen«, begann
Blizzard. »Sie wissen alle, was Murray heute morgen
passiert ist – ja? Nun, ich kann nicht feststellen, wer
ihm diesen gemeinen Streich gespielt hat, aber da es
vermutlich einer der Anwesenden war, möchte ich
eindringlich vor einer Wiederholung warnen. Sollte
es dazu kommen, fliegt der Urheber auf der Stelle,
und ich sorge dafür, daß seine Mitgliedschaft im
Schauspielerverband ebenfalls endet. Dann bekommt
er hierzulande nie wieder eine Rolle. Ist das klar?«
Er sah sich um, nickte zufrieden und wandte sich
an Murray. »Genügt Ihnen das, Murray?«
»Das braucht den Urheber nicht zu kümmern«,
stellte Murray fest. »Er ist kein Mitglied des Schau-
spielerverbands.«
»Halten Sie doch endlich den Mund!« flüsterte
Constant ihm zu.
»Murray, ich weiß, was Sie damit meinen«, erwi-
derte Blizzard, »aber es wäre vielleicht besser, wenn
ich vorgäbe, nichts gehört zu haben.«
»Hört, hört!« sagte Rett Latham.
»Gut, machen wir weiter. Ich habe mit Manuel

auch über den bisher erarbeiteten Text gesprochen.
Manuel?«
Der Autor erhob sich zögernd. Offenbar hatte er
sich Blizzard fügen müssen und war nur widerwillig
bereit, seine Niederlage einzugestehen. »Ich gebe zu,
daß in dem existierenden Manuskript viel Arbeit
steckt, und selbst wenn einer von Ihnen weniger ge-
leistet hat, muß deshalb nicht alles schlecht sein. Des-
halb habe ich mit Sam vereinbart, daß wir auf dieser
Grundlage weiterarbeiten, wenn Sie sich alle mehr
Mühe als bisher geben. Aber Ihre Leistungen dürfen
nicht nur gut, sie müssen verdammt gut sein. Klar?«
Die Zuhörer atmeten erleichtert auf.
»Warum
haben
Sie
das
nicht
gleich
gestern
gesagt?«
wollte
Gerry
wissen.
Er
deutete
auf
seine
zerstörten
Entwürfe.
»Alles
vergeudet,
nur
weil
Sie
einen
Wutan-
fall bekommen haben – Gott, das macht mich krank!«
»Das tut mir leid, Mister Hoarding«, sagte Delgado
nach einer Pause.
Murray starrte ihn an. Diese Entschuldigung paßte
nicht zu Delgado, der es sonst stets irgendwie fertig-
brachte andere als schuldig hinzustellen. Das bedeu-
tete ...
»Gut, wir machen weiter!« rief Blizzard. »Auf die
Plätze! Ade, ich möchte, daß Sie und Murray die bei-
den Stellen wiederholen, die mir gestern nicht gefal-
len haben. Murray, hören Sie mich?«

Murray schrak aus seinen Überlegungen auf. Er
brachte den Gedankengang jedoch zu Ende, während
er zur Bühne ging.
Das bedeutet, daß Delgado nichts mehr an unserem
Stück liegt. Er gibt hier nach, um seine eigentlichen Ab-
sichten zu tarnen.
Welche Absichten?

17
»Je länger man darüber nachdenkt«, erzählte Murray
der Luft, »desto klarer wird einem, daß hier einiges
faul ist. Aber ...«
Er sprach nicht weiter. Er wußte, daß er sich allein
im Zimmer befand, und wenn er Selbstgespräche zu
führen begann, würde seine Lage sich noch ver-
schlimmern. Er zündete sich eine Zigarette an. Der
Rauch trieb zum Fernsehapparat hinüber, der mit
dem Bildschirm zur Wand stand.
Vielleicht war es unsinnig, aber Murray hatte das
Fernsehgerät umgedreht. Seitdem Lester festgestellt
hatte, daß der Apparat ständig unter Strom stand,
bildete Murray sich ein, die Mattscheibe sei eine Art
Auge, das ihn beobachtete.
Werde ich verrückt? Bin ich schon verrückt?
Murray zwang sich dazu, diese Frage ernsthaft zu
untersuchen und kam zu dem gleichen Ergebnis wie
zuvor: irgend jemand war hier nicht ganz normal,
und dieser Jemand schien Delgado zu sein. Murray
lief es bei dem Gedanken an diesen Mann kalt über
den Rücken – aber er hatte trotzdem nicht die Ab-
sicht, alles im Stich zu lassen, um nicht mehr mit ihm
zusammenkommen zu müssen.
Jetzt versuchte er seine Gedanken zu ordnen; er er-

innerte sich daran, wie alles begonnen hatte. Zuerst
war er nur mißtrauisch gewesen, weil ihm diese Idee
absurd erschienen war, das Ensemble unter einem
Dach zu versammeln, um ein Theaterstück ausbrüten
zu lassen. Andererseits hatte Delgado einen guten
Ruf als erfolgreicher Bühnenautor; Sam Blizzard war
der Meinung, dieser Plan lasse sich verwirklichen,
und Murray Douglas brauchte jeden Job, den sein
Agent ihm damals verschaffen konnte.
Dieses Argument traf noch immer zu. Das vorheri-
ge ebenfalls. Murray sah jetzt auch ein, daß er Sam
Blizzard unterschätzt hatte; der Produzent ließ sich
nicht leicht etwas vormachen, und er wußte genau,
welcher Unterschied zwischen Wutanfällen und ech-
ten Krisen bestand. Die heutige Probe, in der sie die
zweite Szene erarbeitet hatten, bewies zur Genüge,
daß Blizzard Wert auf ein gutes Stück legte.
Murray vermutete allerdings, daß Delgado keinen
Wert darauf legte; er konnte diesen Verdacht aller-
dings nicht beweisen.
Warum litt nur er unter diesem krankhaften Miß-
trauen? Alle anderen schienen Delgado zu akzeptie-
ren, wie er war. Lester Harkham war beispielsweise
bereit, die elektronischen Geräte als pseudowissen-
schaftliche Spielerei abzutun, ohne sich darüber Ge-
danken zu machen. Blizzard schien Delgado nur für
einen besonders temperamentvollen Autor zu halten,

dem man mit Nachsicht begegnen müsse. Gerry Ho-
arding hatte sich vorläufig Murrays Auffassung an-
geschlossen, aber daran war vor allem die Erleichte-
rung über den verhinderten Selbstmord schuld; Ger-
ry sah in Murray seinen Lebensretter, dem er sich zu
Dank verpflichtet fühlte. Auch diese Freundlichkeit
konnte jederzeit wieder ins Gegenteil umschlagen.
Constant war am vergangenen Abend fast zugänglich
gewesen, um dann heute zu seiner charakteristischen
Intoleranz zurückzukehren.
Nein, Murrays Verdacht beruhte auf keinem ein-
deutigen Beweis. Es handelte sich bestenfalls um eine
Aufzählung von Anomalien.
An
erster
Stelle
war
das
seltsame
Benehmen
der
Gruppe
zu
nennen.
Murray
hatte
vorhin
an
das
Fern-
sehgerät
gedacht;
dabei
war
ihm
eingefallen,
daß
er
den
Apparat
seit
seiner
Ankunft
noch
kein
einzigesmal
ein-
geschaltet
hatte
–
nicht
einmal,
um
Nachrichten
zu
empfangen.
Er
hatte
einen
Grund
dafür:
die
geheim-
nisvollen
Veränderungen
im
Innern
des
Geräts
er-
schreckten
ihn.
Aber
das
erklärte
noch
lange
nicht,
weshalb
keiner
der
anderen
bisher
von
einem
Fernseh-
programm
gesprochen
hatte,
das
er
hier
gesehen
hatte.
Und es gab in diesem Haus keine Zeitungen. Soviel
Murray wußte, hatte noch niemand eine Zeitung ver-
langt. Niemand las etwas beim Frühstück. Warum ei-
gentlich nicht?

Telefongespräche. Vielleicht war das Ensemble ab-
sichtlich so zusammengestellt worden, daß die Mit-
glieder keine häuslichen Bindungen hatten. Nun, das
war halbwegs verständlich; es gehörte zu Delgados
Plan, die Schauspieler unter dem gleichen Dach zu
versammeln. Es hätte nur gestört, wenn einige von
ihnen abends nach Hause gefahren oder morgens aus
irgendwelchen Gründen zu spät zu den Proben ge-
kommen wären.
Im Grunde genommen hatte es vielleicht wirklich
nichts zu bedeuten, daß alle Anwesenden unverheira-
tet oder geschieden waren oder von ihrer Frau ge-
trennt lebten, wie es bei Murray der Fall war. Aber
das hieß noch lange nicht, daß deshalb alle persönli-
chen Bindungen zu anderen Menschen aufgehoben
waren. Weshalb hatte Murray dann noch nie gehört,
daß hier jemand ans Telefon gerufen worden war?
Auch in seinem Fall – warum hatte Roger Grady
nicht angerufen, um sich zu erkundigen, wie die Din-
ge standen? Murray hatte im Augenblick keine engen
Freunde, weil er es seit seiner Entlassung aus dem
Sanatorium vermieden hatte, unter die Leute zu ge-
hen. Aber war das ein Grund dafür, daß auch die an-
deren keine Telefongespräche mit Freunden führten?
Keine Briefe. In der Halle neben Blizzards Büro war
ein Schwarzes Brett angebracht. Murray konnte sich
nicht erinnern, jemals gesehen zu haben, daß jemand

dort stehenblieb, um seine Post abzuholen. Er hatte es
selbst nie getan – er hatte im Vorbeigehen einen
flüchtigen Blick auf das Schwarze Brett geworfen,
aber da er keine Post erwartete, war ihm die Bedeu-
tung dieser Tatsache erst jetzt klar geworden.
Draußen auf dem Parkplatz standen fünf Autos –
neben seinem Daimler auch Sams Bentley, Idas feuer-
rote Corvette, Lesters Rover und ein Ford, der seiner
Meinung nach Jess Aumen gehörte. Die anderen hat-
ten entweder keine Autos oder hatten sie zu Hause
gelassen, weil sie annahmen, daß sie hier nicht viel
Gelegenheit zu Autofahrten haben würden. Trotz-
dem waren fünf Wagen mehr als genug! Aber bisher
war niemand auf den Gedanken gekommen, eine
Fahrt nach London vorzuschlagen, um dort ins Thea-
ter, auf eine Party oder zum Essen zu gehen. Die Mit-
glieder des Ensembles hatten es sich widerspruchslos
angewöhnt, regelmäßig zu den Mahlzeiten zu kom-
men, abends im Aufenthaltsraum zu sitzen und sich
ganz allgemein so ruhig und zurückhaltend zu be-
nehmen, als seien sie bereits ältliche Leute, die ihren
Lebensabend in einem vornehmen Altenheim ver-
brachten.
Murray schlug mit der flachen Hand auf die Lehne
seines Sessels und sprang auf. Nein, das war gerade-
zu lächerlich! Wer hatte es fertiggebracht, ein Dut-
zend temperamentvoller Theaterleute zu zähmen

und ihnen diesen geruhsamen Tagesablauf als erstre-
benswert hinzustellen?
Oh, es stimmte natürlich, daß Valentine und die
anderen unheimlichen Diener ständig um das leibli-
che Wohl der Gäste besorgt waren, was eine ent-
spannte Atmosphäre förderte, weil es keine kleinen
Probleme zu bewältigen gab. Niemand brauchte sich
um das Waschen seiner Wäsche zu kümmern, nie-
mand brauchte das Haus zu verlassen, um beispiels-
weise Zigaretten zu holen. Für alles wurde wie in ei-
nem erstklassigen Hotel gesorgt. Das Essen war her-
vorragend, die Zimmer waren gemütlich, die Bedie-
nung ließ nichts zu wünschen übrig. Und trotzdem
war irgend etwas faul an der ganzen Sache.
Murray ging zwischen Bett und Tür auf und ab.
Endlich! Nun hatte er seine schlimmste Befürchtung
analysiert, die allerdings am unbestimmbarsten war.
Er hatte so lange dazu gebraucht, weil sie eben so va-
ge war. Nun konnte er seine Liste beliebig verlän-
gern. Morgen war Samstag, und nach der heutigen
Probe hatte niemand davon gesprochen, daß sie
übers Wochenende wie bisher weiterarbeiten wür-
den.
Auch etwas anderes war entschieden merkwürdig.
Murray erinnerte sich an seinen Streifzug durch den
Park und die nähere Umgebung des Hauses. Er hatte
am Schwimmbecken einen Schuppen mit allen mögli-

chen Sportgeräten entdeckt. Eigentlich wäre zu er-
warten gewesen, daß junge Männer wie Al und Rett
sich dafür interessieren würden. Das Wetter war an
manchen Tagen kühl und regnerisch gewesen, aber
trotzdem nicht so schlecht, daß sie alle ständig im
Haus hätten hocken müssen. Hinter dem Hauptge-
bäude lagen Tennisplätze, nicht wahr? Das
Schwimmbecken hätte sich leicht füllen lassen. Drau-
ßen herrschte vielleicht kein ideales Badewetter, aber
schließlich war es auch nicht Winter.
Niemand verließ das Haus zu Spaziergängen So-
viel Murray wußte, war außer ihm und Heather kei-
ner der Anwesenden seit dein ersten Tag außerhalb
des Grundstücks gewesen.
Warum?
Bei dem Gedanken an Heather fiel Murray noch
etwas anderes ein – sie, Cherry Bell, die kaum zählte,
weil sie jeden Abend für Delgado schreiben mußte,
und Ida waren die einzigen Frauen in diesem Haus.
Allerdings wußte jeder, was mit Ida los war. Aber
Heather war wirklich sehr hübsch. Murray hatte sei-
ne eigenen Gründe, sich nicht um sie zu bemühen;
Ade hatte ebenfalls welche, und Gerry war wie alle
Rauschgiftsüchtigen kaum an Mädchen interessiert.
Trotzdem blieben Rett, Al, Jess Aumen und Lester
Harkham übrig – Lester war fast doppelt so alt wie
Heather, aber er besaß einen gewissen Ruf als Lady-
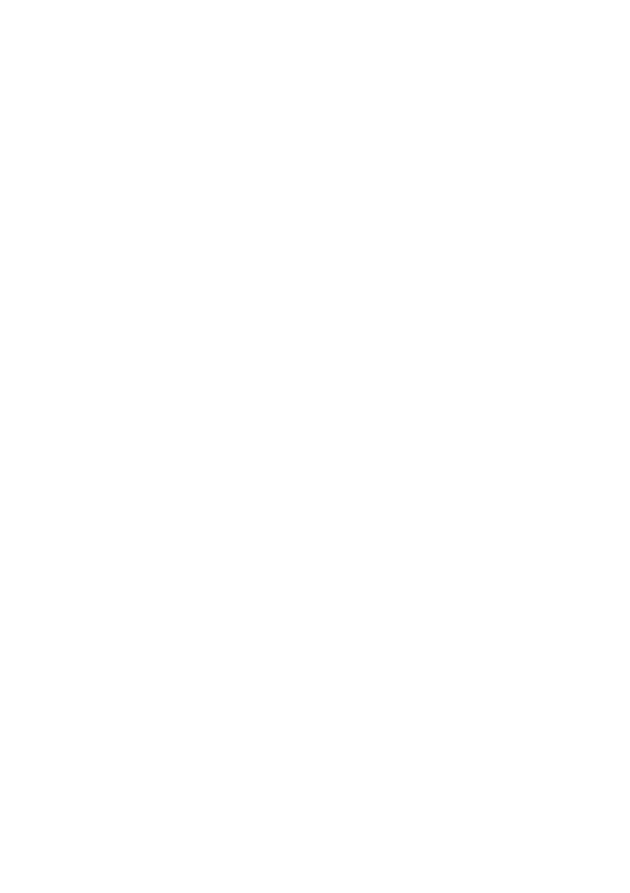
killer. Auch Sam Blizzard kam in Frage; schließlich
hatte er schon drei – oder waren es vier? – Ehen hin-
ter sich. Ganz zu schweigen von Constant, der hinter
jedem hübschen Mädchen hergewesen war, als Mur-
ray und er noch zum gleichen Ensemble gehört hat-
ten.
Also kein Mangel an passenden Männern. Wegen
ihres auffälligen Desinteresses war Murray jedoch zu
der Überzeugung gekommen, Heather sei als Köder
für Ida vorgesehen, wie Gerry sein Heroin bekom-
men hatte. Constant war mit seinen pornographi-
schen Büchern glücklich, und andere hatten vielleicht
Dinge bekommen, von denen Murray nichts wußte.
Murray erinnerte sich daran, was Gerry am glei-
chen Morgen Ade vorgeworfen hatte. »Womit hat
Delgado Sie gekauft, Ade?« hatte der junge Bühnen-
bildner gefragt. »Mit vielen hübschen Knaben?«
Murray schüttelte deprimiert den Kopf. Alle diese
Szenen hätten geradewegs aus einem Theaterstück
von Delgado stammen können. Auf der Bühne fand
man sie vielleicht sogar wirkungsvoll; in Wirklichkeit
war es schrecklich, sie erleben zu müssen und dabei
zu wissen, daß man nicht automatisch in eine andere
Welt zurückkehren konnte, sobald der Vorhang gefal-
len war – in eine andere Welt, in der es Freundschaf-
ten und gemeinsame Interessen gab.
Er blieb abrupt stehen und starrte das Telefon auf

dem Nachttisch an. Es hatte seit seiner Ankunft nur
einmal geklingelt, als Valentine ihn an die Zeit erin-
nert hatte.
Wer war dieser Valentine überhaupt? Seine Versu-
che, den Eindruck zu erwecken, Blizzard habe ihn
angestellt, waren in Murrays Augen längst fehlge-
schlagen. Der Mann stand in enger Verbindung mit
Delgado; vielleicht schon seit Jahren. War Blizzard
sich darüber im klaren – oder bildete der Produzent
sich noch immer ein, er habe Valentine selbst ent-
deckt und als Butler angestellt? Und wie war es über-
haupt dazu gekommen? Auf Delgados Empfehlung
hin? Das wäre zu plump gewesen ...
Murray ballte die Fäuste. Er spürte, daß sein Herz
wie rasend schlug. Aber er durfte sich von dieser Sa-
che nicht unterkriegen lassen, sonst landete er noch
im Irrenhaus. Er war entschlossen, seine Befürchtun-
gen entweder zu widerlegen oder zu bestätigen, als er
jetzt ans Telefon ging und den Hörer abnahm.
Eine Stimme meldete sich. Diesmal war nicht Va-
lentine, sondern einer der Diener am Apparat.
»Ja, Mister Douglas?«
»Ich möchte ein Gespräch nach London anmel-
den.« Murray zog eine Schublade auf und nahm sein
Notizbuch heraus. Er schlug Roger Gradys Privat-
nummer nach.
Als er sie durchgegeben hatte, antwortete der Die-

ner: »Sehr wohl, Sir. Ich verbinde Sie, sobald der
Teilnehmer sich meldet.«
Hoffentlich, dachte Murray und legte wortlos auf.
Seine Zigarette war unbeachtet im Aschenbecher
verglimmt. Er zündete sich eine neue an und merkte
dabei, daß seine Hände zitterten.
Wenn keine Verbindung zustande kommt? Am besten
schreibe ich dann einen Brief – nein, zwei Briefe. Ich muß
irgendwo Briefmarken haben. Einen soll Valentine aufge-
ben, den anderen stecke ich selbst in den nächsten Briefka-
sten; Roger soll mich dann anrufen und mir sagen, ob er
beide Briefe bekommen hat ...
Eine
verrückte
Situation!
Einen
Augenblick
lang
zweifelte
Murray
an
seiner
Zurechnungsfähigkeit;
er
hatte
sich
im
Sanatorium
ähnlich
gefühlt,
als
er
unter
dem
Alkoholentzug
litt
und
phantastische
Pläne
schmiedete,
wie
er
eine
Flasche
in
sein
Zimmer
schmuggeln
könnte.
Aber
darüber
war
er
zum
Glück
hinweg.
Irgendwie
war
es
ihm
gelungen,
ein
neues
Gleichgewicht
zu
finden.
Nun
fürchtete
er
die
Auswir-
kungen
eines
einzigen
Drinks
zu
sehr,
um
dem
gele-
gentlichen Wunsch nachzugeben, der ihn jetzt wieder
quälte. Aber solange er die Folgen bedachte, war er
vor dieser Versuchung sicher.
Und seitdem Delgado ihm diesen gemeinen Streich
gespielt hatte, war Murrays Angst vor den Folgen
deutlich gestiegen.
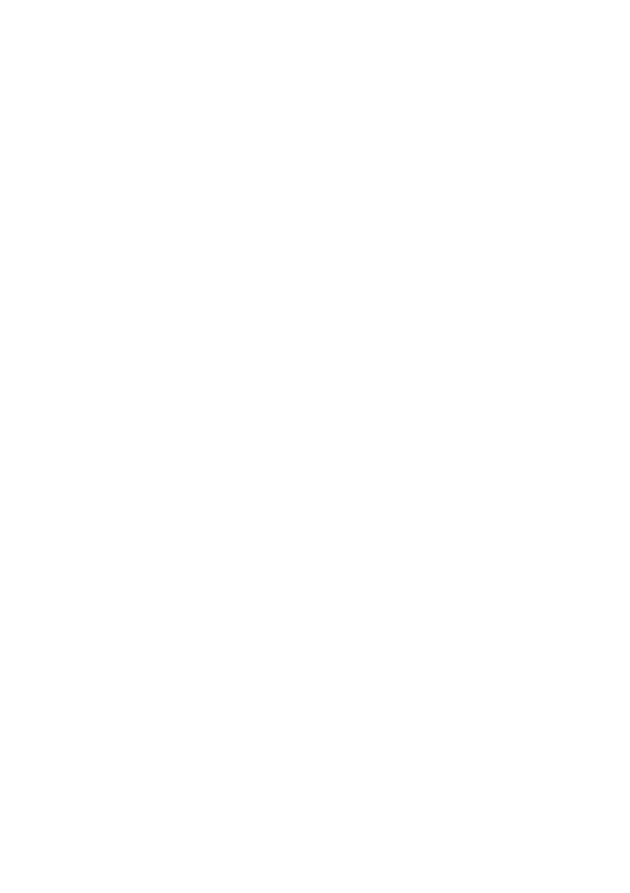
Das Telefon klingelte. Er nahm den Hörer ab.
»Roger?«
»Tut mir leid, Mister Douglas, unter der angegebe-
nen Nummer meldet sich niemand.«
Lügner – Murray sah auf seine Armbanduhr. Vier-
tel vor elf. Nein, es war durchaus möglich, daß Roger
um diese Zeit nicht zu Hause war. Murray wußte,
daß er unwiderlegbare Beweise brauchte, bevor er
annehmen durfte, daß er absichtlich behindert wur-
de.
»Schon gut, vielen Dank«, sagte er ausdruckslos
und legte auf.
Was nun? Sollte er den Brief schreiben? Ein Brief
würde natürlich erst am Montag ankommen. Nein,
besser war ein zweiter Versuch per Telefon. Roger
war kein Frühaufsteher. Wenn Murray ihn in etwa
einer Stunde anrief, brauchte er ...
Jemand klopfte an die Tür. Murray starrte sie an,
und seine Stimme klang ungewohnt heiser, als er
fragte:
»Ja, wer ist da?«

18
Die Tür wurde geöffnet. Heather stand auf der
Schwelle. Sie trug Hosen und eine weiße Nylonbluse.
Sie sah unglaublich jung aus, weil sie auf alles Make-
up verzichtet hatte.
»Murray?« sagte sie unsicher. »Störe ich?«
»Nein, um Gottes willen. Kommen Sie herein!« Er
hoffte nur, daß seine Erleichterung sich nicht allzu
deutlich in seiner Stimme bemerkbar machte.
Sie schloß die Tür hinter sich und sah zu Murray
auf. »Ich ... äh ... ich wollte Sie um Rat fragen«, erklär-
te sie ihm. »Ich habe Vertrauen zu Ihnen, und ich
muß mit irgend jemand darüber sprechen.«
Opa, dachte Murray enttäuscht. Ich bin erst zwei-
unddreißig, aber jetzt kommen die Mädchen schon, um
sich bei mir gute Ratschläge zu holen.
Er ließ sich jedoch nichts anmerken, als er Heather
einen Sessel anbot und seine Zigarette ausdrückte.
Sie nahm Platz, zog ein Knie hoch, faltete die Hän-
de darum und sprach mit gekünstelter Ungezwun-
genheit, als wolle Sie es vermeiden, gleich über ihr
eigentliches Problem zu sprechen.
»Nun, heute ist es besser gegangen, was? Ich kann
mir vorstellen, daß Sie darüber erleichtert sind.«
»Im Gegensatz zu Ihnen.« Murray klappte sein Zi-

garettenetui auf, bot Heather eine Zigarette an und
suchte nach seinem Feuerzeug. Als sie sich vorbeug-
te, um ihre Zigarette anzuzünden, schien ihr erst klar
zu werden, was Murray eben gesagt hatte. Sie richtete
sich auf.
»Was meinen Sie damit?« fragte sie und warf ihm
einen nervösen Blick zu.
»Nicht viel. Es ist schließlich nur menschlich, daß
Sie gehofft haben, Sie würden bei einem neuen An-
fang eine Chance bekommen, anstatt immer in der
letzten Reihe sitzen oder Gerry helfen zu müssen.«
»Das klingt schrecklich, wie Sie es sagen«, meinte
Heather nach einer Pause. »Tut mir leid, wenn Sie
diesen Eindruck von mir haben.«
»War das nicht schon ein Teil des Problems, das Sie
mit mir besprechen wollten?« erkundigte Murray
sich.
»Oh! Ja, Sie haben eigentlich recht.« Heather sah
ihm nicht ins Gesicht; statt dessen betrachtete sie den
umgedrehten Fernsehapparat, als hätte sie am lieb-
sten gefragt, warum die Mattscheibe zur Wand zeig-
te. »Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll, Murray.
Ich bin hier ein fünftes Rad am Wagen. Zuerst war
das nicht weiter wichtig. Ich dachte ... nun, das Ganze
war ein ausgesprochener Glücksfall für mich, auch
wenn ich keine Rolle bekomme und nicht in London
auftreten darf. Immerhin ist die Gage hier doppelt so
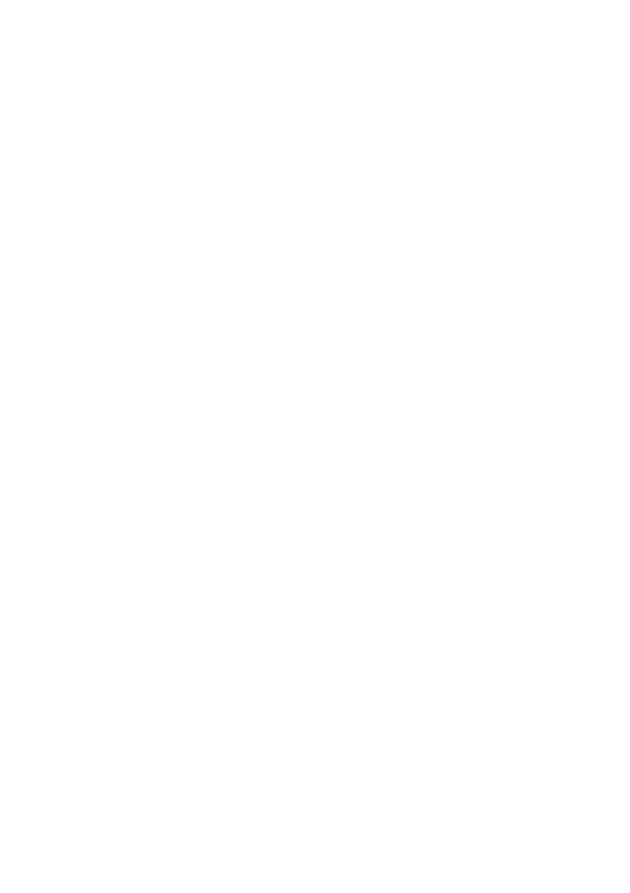
hoch wie in Southampton, und ich lerne allein da-
durch, daß ich Delgado, Sam Blizzard und Sie bei der
Arbeit beobachte. Aber mein anfänglicher Optimis-
mus hat nicht lange vorgehalten. Die ganze Sache
kommt mir so ... so geplant vor.«
Murray starrte sie an. »Was soll das heißen? Wie
kommen Sie darauf?«
»Das weiß ich selbst nicht recht.« Sie zuckte hilflos
mit den Schultern. »Mir ist nur aufgefallen, daß Sam
sich nicht um mich kümmert. Ich meine, er hat mich
doch engagiert, er bezahlt mich doch nicht aus Men-
schenfreundlichkeit, aber bisher hat er kaum etwas
zu mir gesagt und nicht einmal geschimpft, wenn ich
mich verdrückt habe. Und Sie sind der einzige, der
sich irgendwie dazu geäußert hat. Sonst scheint es
niemand aufgefallen zu sein. Ida hat allerdings ...«
Sie sprach nicht weiter. Bevor Murray etwas sagen
konnte, verzog sie das Gesicht und drückte ihre Ziga-
rette aus.
»Ich rauche in letzter Zeit zuviel«, stellte sie fest.
»Mein Hals ist schon ganz rauh. Kann ich ein Glas
Wasser haben?«
»Natürlich.« Murray stand auf. Als er zum Wasch-
becken ging, fiel ihm etwas ein, und er öffnete den
Kleiderschrank. Die Dosen mit Fruchtsaft standen
noch dort. Er nahm eine davon und zeigte sie Hea-
ther.

»Möchten Sie lieber etwas Saft? Ich trinke ihn doch
nicht.«
Sie nickte, als sei ihr gleichgültig, was er ihr gab.
Murray stieß mit seinem Taschenmesser zwei Löcher
ins Blech.
»Sie wollten vorhin noch etwas sagen«, stellte er
fest, während er ein Glas einschenkte und ihr gab.
»Danke.«
Heather
trank
durstig
und
leerte
das
Glas
Orangensaft
auf
einen
Zug,
bevor
sie
sich
in
den
Sessel
zurücklehnte.
»Richtig,
ich
wollte
etwas
sagen.
Nun
...
ich
dachte,
Sie
könnten
mir
am
ehesten
helfen,
weil
Sie
bisher
so
nett
zu
mir
gewesen
sind
und
weil
Sie
mehr
...
Oh,
das
klingt
lächerlich,
aber
ich
kann
es
einfach
nicht
anders
ausdrücken!
Sie
besitzen
mehr
Initiative
als
alle
anderen.
Ich
meine,
die
anderen
außer
Ihnen
wirken
so
passiv,
so
unbeteiligt.
Das
hätte
ich
nie
erwartet.
Wis-
sen
Sie,
was
ich
meine?
Sie
arbeiten
den
ganzen
Tag,
schwatzen
abends
ein
bißchen
miteinander
und
gehen
dann
brav
ins
Bett.
Das
ist
bereits
alles.
Ich
habe
das
Ge-
fühl,
daß
ich
noch
niemand
richtig
kennengelernt
habe.
Ich
habe
das
Gefühl,
daß
sich
niemand
wirklich
für
die
gemeinsame
Arbeit
interessiert
–
nur
Sie
haben
wirk-
lich
Interesse
an
allem.
Sie
sind
überall
gewesen,
Sie
haben
die
Tonbandgeräte
in
den
Betten
gefunden,
Sie
stellen
unbequeme
Fragen
...
Verstehen
Sie,
was
ich
sa-
gen
will?«
Heather
sprach
nicht
weiter,
aber
ihr
fra-
gender Blick verriet, daß sie Angst hatte.

»Ich verstehe es nur allzu gut«, versicherte Murray
ihr grimmig. »Weiter, bitte.«
Sie stellte das leere Glas ab. »Wissen Sie was? Seit-
dem Sie mir das unheimliche Zeug unter meinem
Bett gezeigt haben, mache ich mir ununterbrochen
Sorgen. Den anderen scheint es völlig gleichgültig zu
sein. Sie geben sich gelangweilt, wenn Sie davon an-
fangen, nicht wahr? Aber ich schneide jeden Abend
den dünnen Draht durch, der von der Matratze zum
Tonbandgerät führt – mit meiner Nagelschere.« Hea-
ther lachte. »Ist das nicht verrückt? Aber ich will
nicht, daß das Gerät die ganze Nacht lang unter mei-
nem Kopfkissen läuft. Was haben Sie?«
»Ich denke nur nach.« Murray runzelte die Stirn
und starrte die Wand vor sich an, ohne sie wirklich
zu sehen. Heathers Worte betrafen etwas, das sein
Unterbewußtsein bereits als wichtig erkannt hatte.
»Ich tue sogar noch mehr. Ich ziehe den Draht aus
meiner Matratze und werfe ihn weg. Er wird immer
wieder ersetzt, aber das muß ziemlich lästig sein.
Deshalb tue ich es überhaupt, nehme ich an. Delgado
soll die Geduld verlieren und mir sagen, wozu das
Zeug dient.«
»Sie glauben also, daß er gelogen hat, als er be-
hauptet hat, die Geräte seien Mittel zur ...« Sie suchte
nach dem richtigen Wort.
»Hypnopädie? Natürlich hat er gelogen. Das war

sogar Lesters Meinung, als ich ihm das Zeug gezeigt
habe. Aber er will es nicht ernst nehmen, sondern ist
nach wie vor der Meinung, Delgado sei auf irgend-
welchen pseudowissenschaftlichen Unsinn hereinge-
fallen.«
Heather fuhr sich mit der Zunge über die Lippen.
»Kann ich noch ein Glas Orangensaft haben? Ich bin
noch immer durstig.«
»Natürlich.« Murray erhob sich bereitwillig, öffnete
eine zweite Dose und ließ sie neben ihr stehen.
»Hat der umgedrehte Fernsehapparat auch irgend
etwas mit Delgado zu tun?« erkundigte Heather sich.
»Gut geraten«, stellte Murray trocken fest. »Lester
hat entdeckt, daß der Apparat einige zusätzliche Teile
enthält. Er ist ständig eingeschaltet und läßt sich nicht
abstellen. Ich habe das lächerliche Gefühl, auf diese
Weise beobachtet zu werden. Deshalb ...« Er verzog
das Gesicht und zuckte mit den Schultern.
»Ja. Ich weiß, was Sie meinen.« Heather warf ihm
einen ernsten Blick zu. »Aber warum? Was soll das
alles? Warum kümmern die anderen sich nicht dar-
um?«
»Keine Ahnung«, gab Murray zu. »Ich weiß nur,
daß Delgado sich vor allem um diese Dinge Sorgen
macht, anstatt sich wirklich um unsere Arbeit zu
kümmern.« Er machte eine Pause. »Was wollten Sie
mich übrigens fragen? Hängt es damit zusammen?«
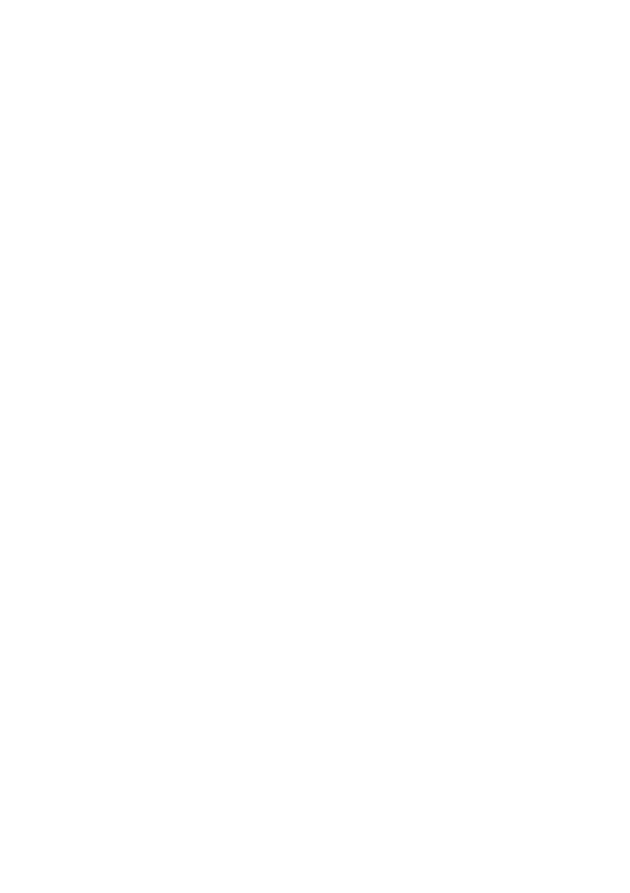
»Nein.« Heather leerte ihr Glas und griff nach der
zweiten Dose. »Oh – trinke ich Ihren ganzen Vorrat
aus?«
»Trinken Sie nur. Ich habe noch keine Dose geöff-
net, und irgend jemand muß das Zeug schließlich
trinken.«
»Danke. Der Saft schmeckt wirklich gut.« Sie füllte
ihr Glas. »Wollen Sie einen Schluck versuchen?«
Er schüttelte den Kopf. »Weiter, bitte«, forderte er
sie auf. »Ich bin schon froh, daß jemand sich die glei-
chen Sorgen macht.«
»Nun, nicht genau die gleichen«, korrigierte sie
ihn. Sie war blaß geworden, als sie von ihren Befürch-
tungen gesprochen hatte; jetzt bekam sie allmählich
wieder Farbe. »Ich versuche mich zu entscheiden, ob
ich nicht lieber aufgeben und nach Southampton zu-
rückfahren soll. Ich bin mit der Illusion hierher ge-
kommen, viel lernen zu können und vielleicht sogar
eine für mich geschriebene Rolle spielen zu dürfen.
Stellen Sie sich nur vor, welche Chance das für mich
war – eine Rolle in einem Stück von Delgado! Haben
Sie gemerkt, wie optimistisch ich bei meiner Ankunft
war?«
»Ich erinnere mich noch daran, daß ich versucht
habe, Ihren Optimismus zu dämpfen«, gab Murray
zu.
»Das war nur gut! Ich hätte Ihnen dafür dankbar

sein müssen.« Sie trank wieder einen Schluck Saft.
»Hätten Sie mich nicht gewarnt, daß ich mir Illusio-
nen mache, hätte es mich härter getroffen, als ich spä-
ter zu dem gleichen Schluß gekommen bin.«
Murray warf ihr einen forschenden Blick zu. Sie
sprach jetzt rascher als zuvor, Schien weniger nervös
zu sein und war dafür fast ein wenig rührselig. Er
konnte sich keinen Grund dafür vorstellen und sagte
deshalb vorsichtig:
»Sie wollten mich nicht nur fragen, ob Sie gehen
oder bleiben sollten? Wäre das tatsächlich das einzige
Problem, würden Sie vermutlich ohnehin bleiben. Al-
lein das Erlebnis, die Entstehung eines Bühnenstücks
verfolgen zu können, ist einiges wert, nicht wahr?«
Heather nickte langsam. Sie stellte ihr Glas ab und
zündete sich selbst eine Zigarette an. Dabei schien ihr
etwas einzufallen; sie legte den Kopf schief, als denke
sie darüber nach, aber dann gab sie den Versuch wie-
der auf.
Sie
kicherte
unerwarteterweise.
»Oh,
du
liebe
Güte!«
sagte
sie.
»Eigentlich
ist
die
Sache
gar
nicht
lustig,
und
ich
habe
sie
vorhin
auch
sehr
ernst
genommen
–
aber
sie
ist
trotzdem
irgendwie
komisch!«
Sie
mußte
auf-
stoßen und schlug sich erschrocken auf den Mund.
»Was war das?« fragte sie. »Der Saft muß viel Koh-
lensäure enthalten, nehme ich an. Ich hätte nie ... oh,
das ist nicht weiter wichtig.«

Schon verstanden. Murray seufzte und wunderte
sich nicht mehr. Die Erklärung für Heathers eigenar-
tiges Benehmen hätte ihm früher einfallen müssen.
Sie hatte sich offenbar etwas Mut angetrunken, bevor
sie mit ihrem Problem zu ihm gekommen war. Nun
wirkten sich die Drinks aus.
»Heather, ich kann wirklich nicht erraten, was Sie
mit mir besprechen wollten«, sagte er geduldig.
Sie warf ihm einen überraschten Blick zu. »Habe
ich Ihnen das noch nicht erzählt? Tut mir leid. Ida be-
hauptet, sie liebe mich, und ich soll mit ihr ins Bett
gehen.«
»Haben Sie etwas anderes von ihr erwartet?« fragte
Murray ausdruckslos. Er wußte, daß Ida rasch unge-
duldig wurde; in dieser Beziehung reagierte sie ty-
pisch männlich. Und er hatte erwartet, daß Heather
die Anzeichen richtig deuten würde; sie war jung,
aber sie war schließlich keine Klosterschülerin.
Das zeigte schon ihre nächste Bemerkung. Sie ki-
cherte nochmals. »Murray, man kann sie einfach
nicht ernstnehmen, nicht wahr? Ich meine, sie ist kei-
ne schlechte Schauspielerin, aber wenn es darauf an-
kommt, etwas zu sagen, das sie wirklich meint, kann
sie es einfach nicht. Man hat immer den Eindruck, sie
stehe auf der Bühne ... Oh!«
Ihre Stimme hatte sich völlig verändert. Sie legte
die Zigarette in den Aschenbecher, ohne darauf zu
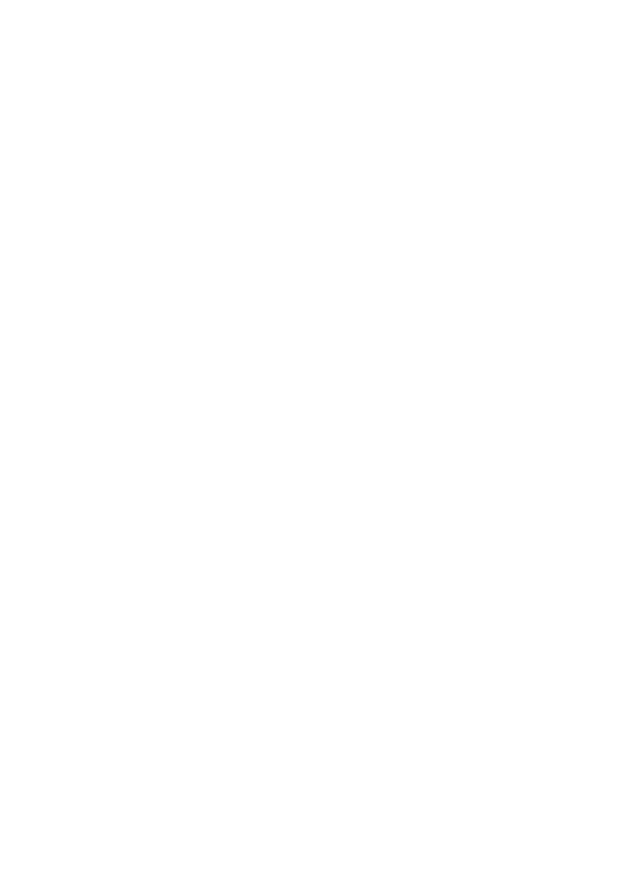
achten, daß sie wieder herausfiel und über den Tisch
rollte. Heather starrte angestrengt geradeaus.
»Murray, mir ist entsetzlich schwindlig. Ich werde
ohnmächtig, glaube ich«, sagte sie. »Ich bin anschei-
nend betrunken. Aber wie kann ich betrunken sein?
Ich habe heute abend nur ein Glas ... o Gott!«
Sie versuchte aufzustehen. Unterdessen war alle
Farbe aus ihrem Gesicht gewichen.
»Murray, Sie haben doch nicht ... Nein, bestimmt
nicht!« Sie streckte die Arme aus, als versuche sie sich
aus dem Sessel zu ziehen. »Oh, mir ist so schlecht.«
Murray sprang auf, stützte Heather und führte sie
zum Waschbecken. Er ließ das kalte Wasser laufen,
und Heather trank etwas davon. Murray kehrte an
den Tisch zurück, griff nach der Dose mit Saft und
roch daran. Dann schüttete er sich etwas Fruchtsaft in
die Handfläche und probierte ihn vorsichtig. Der
Fruchtgeschmack überdeckte fast alles, aber Murray
konnte sich vorstellen, womit der Saft versetzt wor-
den war. Vielleicht mit Wodka – aber wahrscheinlich
eher mit reinem Alkohol.
Heather würde davon höchstens Kopfschmerzen
und einen Kater bekommen. Aber wenn Murray eine
dieser Dosen für sich geöffnet hätte, ohne zu ahnen,
was sie enthielten, hätte er gleich Zyankali trinken
können.

19
Einen Augenblick lang konnte Murray nur an zu-
künftige Möglichkeiten denken. Wenn Delgado es
wirklich darauf abgesehen hatte, ihn zu ... nun, das
Wort traf eigentlich zu ... vergiften, würde er sich
vielleicht nicht mit diesem Versuch begnügen. Was
war also noch von ihm zu erwarten? Die Dosen im
Kleiderschrank wirkten so harmlos wie die beiden,
die er für Heather geöffnet hatte; Murray untersuchte
sie gründlich, ohne etwas Verdächtiges daran zu fin-
den.
Was sollte er tun? Sollte er Blizzard eine der Dosen
zeigen? Würde Blizzard diesen Beweis akzeptieren?
Nicht jede Dose brauchte Alkohol zu enthalten; viel-
leicht hatte er zufällig die einzigen genommen, weil
sie in der ersten Reihe standen und sich ihm gerade-
zu angeboten hatten.
Wie sollte es weitergehen? War der Zitronensaft,
den Valentine ihm zum Abendessen brachte, eben-
falls mit Alkohol versetzt? Kam demnächst Wodka
aus den Wasserhähnen? Murray wußte es nicht und
fühlte sich deshalb wie in Draculas Schloß, wo jeder
Schatten bedrohlich wirkte.
Und er mußte sich mit Schatten zufriedengeben.
Schon der Versuch, einen ehemaligen Alkoholiker

mit Alkohol zu vergiften, hatte etwas großartig Ab-
surdes an sich. Murray hatte diesen Gedanken auf
Blizzards Gesicht gesehen, als er ihm Dr. Cromartys
Attest zeigte. Es hatte vermutlich wenig Zweck, noch
länger hier zu bleiben und mit den anderen zu disku-
tieren. Murray würde fliehen müssen, und der Teufel
konnte seinetwegen alles holen.
Heather wandte sich schwankend vom Waschbek-
ken ab. Sie hatte sich übergeben müssen. Murray
wollte sie stützen, als sie zum Bett taumelte.
»Lassen Sie mich in Ruhe«, verlangte sie. »O Gott,
lassen Sie mich in Ruhe. Das ist mein Ernst.«
»Heather, ich habe nichts in Ihr Glas getan«, versi-
cherte Murray ihr. »Das Zeug war eigentlich für mich
bestimmt, nicht für Sie.«
Sie gab keine Antwort. Wahrscheinlich hatte sie gar
nicht zugehört. Murray konnte sich vorstellen, wie
der reine Alkohol wirkte, den sie getrunken haben
mußte.
Heather ließ sich aufs Bett fallen und legte den
Kopf auf die Arme. Ein Fuß berührte noch den Bo-
den. Sie atmete unregelmäßig und begann leise zu
schluchzen.
Murray ballte die Fäuste. Es war zwecklos, einfach
nur davonzulaufen. Sein eigenes Problem beschäftig-
te ihn so sehr, daß er das Offenbare übersehen hatte.
Delgado würde sich nicht damit zufriedengeben, ihn
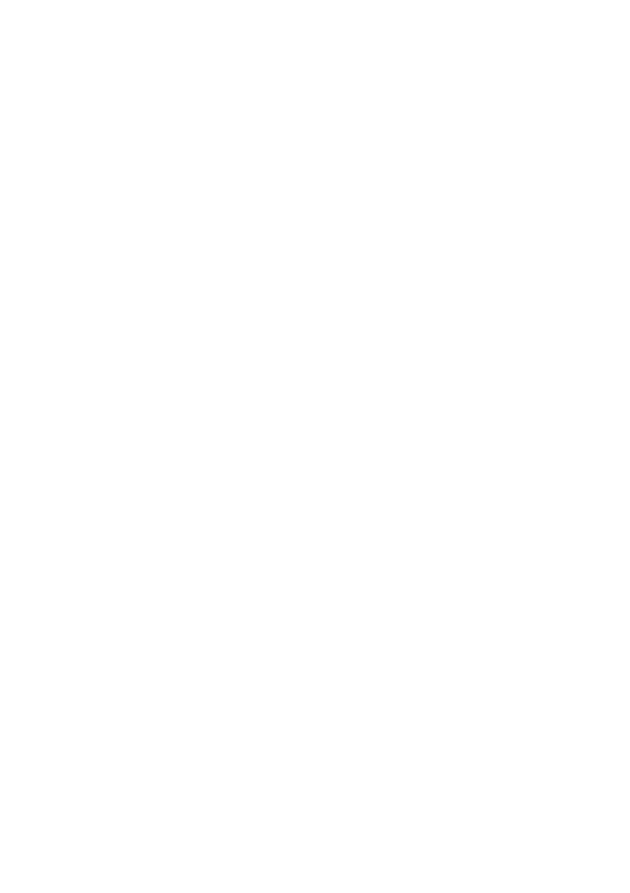
ins Verderben zu reißen; er hatte es auf sie alle abge-
sehen. Heather war das beste Beispiel dafür.
Er mußte nachdenken. Er mußte planen. Irgendwie
mußte er fliehen, Heather zur Flucht verhelfen und
Delgado daran hindern, seine Anstrengungen fortzu-
setzen ...
Klick!
Paris. Garrigues Selbstmord. Er hatte Roger Grady
anrufen wollen.
Murray hob mit zitternder Hand den Hörer ab und
gab nochmals die Nummer in London an. Während
er auf das Gespräch wartete, ging er zur Tür, sah
mißtrauisch auf den Gang hinaus und schloß die Tür
ab. Draußen war niemand in Sicht.
Er ließ sich wieder am Telefon nieder und dachte
über etwas nach, das Heather erwähnt hatte. Sie hatte
ihm erzählt, daß sie ebenfalls jeden Abend die Ver-
bindung zwischen Matratze und Tonbandgerät un-
terbrach ...
Murray sprang plötzlich auf. Er schob Heather zur
Seite. Sie protestierte nicht dagegen. Er hob die Ma-
tratze hoch und sah seinen Verdacht bestätigt: das
Drahtgewebe war ersetzt worden, obwohl er es am
Abend zuvor entfernt hatte. Murray wußte nicht, ob
es ein Mittel zur Beeinflussung des Schlafenden war,
aber diese Erklärung erschien ihm logischer als jede
andere.
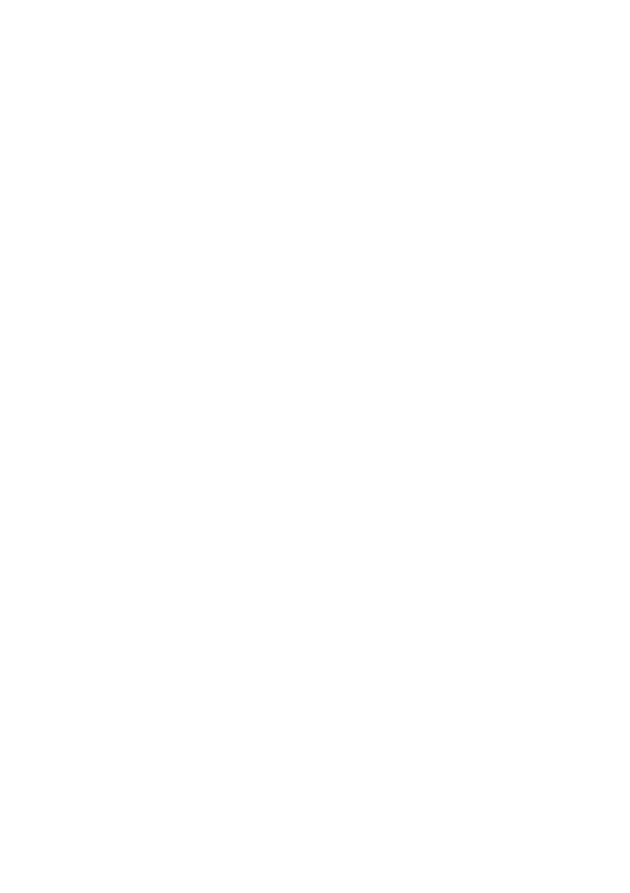
Eine Art elektrisches Feld? Lester hat das Muster mit
einer Antenne verglichen ...
Das Telefon klingelte. Murray hob ab und konnte
kaum sprechen, als er Rogers vertraute Stimme hörte.
»Roger, Gott sei Dank! Murray hier!«
»Oh, du!« Murray konnte sich die Handbewegung
vorstellen, die diesen Ausruf begleitete. »Was willst
du um diese Zeit noch? Ist dir eigentlich klar, was du
angestellt hast? Seitdem du Burnett in aller Öffent-
lichkeit überfallen hast, führt er einen privaten Haß-
feldzug gegen Delgados Stück und jeden, der auch
nur irgend etwas damit zu tun ...«
»Halt den Mund, Roger, ich muß dir etwas erzäh-
len. Wenn die Sache wie bisher weitergeht, gibt es
wahrscheinlich kein Stück von Delgado.«
»Den Eindruck habe ich auch«, knurrte Roger. »Ich
weiß nicht, was Burnett alles versucht hat, aber er
scheint einiges erreicht zu haben. Unter Umständen
bekommt ihr das Margrave-Theater doch nicht.«
»Der Teufel soll das Theater holen! Hörst du jetzt
endlich zu? Roger, dieser Delgado ist verrückt. Ich
übertreibe nicht. Delgado gehört in eine Nervenheil-
anstalt. In der vergangenen Woche haben wir mehr
Katastrophen erlebt als andere Ensembles in einem
Jahr. Delgado hat das erste Manuskript in einem
Wutanfall zerrissen und mußte von Sam beruhigt
werden ...«

»Dann ist doch alles in Ordnung, was?«
»Laß mich endlich ausreden, Roger!« verlangte
Murray aufgebracht. »Gerry Hoarding hätte fast
Selbstmord begangen, weil Delgado ihm Heroin in
unbegrenzten Mengen zur Verfügung stellt. Hier sind
überall geheimnisvolle elektronische Geräte instal-
liert, die Lester Harkhams Meinung nach keinen ver-
nünftigen Zweck haben. Aber ich bin anderer Über-
zeugung, weil ...«
Er sprach nicht weiter, denn in dieser Sekunde fiel
ihm ein, was Heather vorhin angedeutet hatte. Hea-
ther und er waren die einzigen Menschen in diesem
Haus, die peinliche Fragen stellten. Heather und er
hatten es sich angewöhnt, die Verbindung zwischen
Matratze und Tonbandgerät allabendlich zu unter-
brechen.
Zufall?
»Hallo, hallo!« sagte Roger irritiert. Murray kehrte
in die Gegenwart zurück.
»Ja ... nun, das ist noch nicht alles, Roger. Zum En-
semble gehört ein Mädchen, für das keine Rolle vor-
gesehen ist – es soll sich nur von Ida verführen las-
sen. Es ist als Köder ausgelegt wie Gerrys Heroin
oder Constant Baines' Bibliothek schmutziger Bücher.
Und in meinem Fall versucht jemand – dafür kommt
nur Delgado in Frage –, mich zur Flasche zurückzu-
bringen. Selbstverständlich nicht offen, sondern zum

Beispiel durch Konservendosen mit Fruchtsaft, der
mit Alkohol versetzt ist.«
»Murray, stimmt das wirklich!«
»willst du herkommen und es dir beweisen lassen?
Ich wäre schon erleichtert, wenn endlich jemand kä-
me. Manchmal zweifle ich selbst an meinem gesun-
den Verstand.«
»Hmm ...«
»Roger, du weißt irgend etwas, verdammt noch
mal! Los, heraus mit der Sprache! Es ist schon spät
genug!« Murray wartete gespannt, bis Roger sich ent-
schieden hatte.
»Ja, du hast vielleicht recht. Ich meine, bisher habe
ich es nicht recht geglaubt ... habe ich dir erzählt,
warum Léa Martinez nach der Pariser Aufführung
von Trois Fois im Irrenhaus gelandet ist?«
»Nein. Du hast einige Andeutungen gemacht, aber
ich habe nicht darauf geachtet, weil ich den Job
brauchte. Weiter!«
»Léa Martinez hat behauptet, Delgado habe sie ver-
folgt und zum Wahnsinn getrieben«, erklärte Roger
ihm. »Hör zu, Murray, du weißt doch, warum ich dir
das nicht erzählt habe?«
»Ja«, antwortete Murray nur.
»Gut, wir verstehen uns.« Roger zögerte unent-
schlossen. »Aber was soll ich aus deinem Bericht ma-
chen, Murray? Wie kommt es, daß Sam Blizzard und

Ida und Adrian es dort aushalten? Warum sind die
anderen mit Delgado zufrieden? Richtet sich etwa al-
les nur gegen dich?«
»Nein, aber ...« Murray biß sich auf die Unterlippe.
Wie sollte er Roger seinen Verdacht erklären? »Roger,
ich kann jetzt nicht davon sprechen. Ich werde zu
fliehen versuchen, aber falls mir das nicht gelingt ...«
»Was?«
»Das ist mein Ernst. Das Grundstück ist von einem
hohen Stacheldrahtzaun umgeben – und das Tor
wird abends um elf geschlossen. Vielleicht muß ich
den Wagen zurücklassen und zu Fuß fliehen.«
»Murray, das Ganze klingt immer unwahrscheinli-
cher!«
»Hör zu, Roger.« Murray mußte sich beherrschen,
um das Telefon nicht an die Wand zu werfen. »So-
bald ich hier herauskomme, suche ich einen gewissen
Doktor Cromarty in Bakesford auf, verstanden?«
»Ja.«
»Roger, ich gebe nicht voreilig auf. Aber ich glaube,
daß die Pariser Tragödie sich wiederholt, und ich
möchte kein Jean-Paul Garrigue sein.«
»Man könnte glauben, Delgado sei ein zweiter
Marquis de Sade«, wandte Roger ein. »Gut, ich glau-
be dir, daß du nicht voreilig aufgibst. Aber dir ist
doch klar, daß du dann für Sam erledigt bist?«
»Was er denkt, kann mir gleichgültig sein, solange

er nicht merkt, daß sein Ensemble auf diese Weise im
Gefängnis, im Irrenhaus oder auf dem Friedhof lan-
den muß. Komm um Gottes willen hierher, Roger,
wenn ich morgen nicht auftauche und nicht bei Dok-
tor Cromarty erreichbar bin!«
»Gut.« Roger schien einen Entschluß gefaßt zu ha-
ben. »Aber wenn das Stück nach deinem Ausschei-
den ein Erfolg wird, ohne daß jemand sich umbringt
oder im Irrenhaus landet, sind wir geschiedene Leute,
Murray. Dann verliere ich wirklich die Geduld mit
dir.«
»Das riskiere ich«, antwortete Murray nachdrück-
lich und legte auf.
Nun wußte er, was er zu tun hatte. Er ließ sich in
dem Sessel nieder und zündete sich eine Zigarette an
Heather schlief jetzt friedlich. Sie würde sich bald
wieder erholen.
Sie hatte bereits davon gesprochen, daß sie dieses
Haus verlassen wollte. Folglich ...
Murray überlegte sich, daß er den nächsten Mor-
gen abwarten mußte. Er konnte Valentine jetzt nicht
dazu bringen, ihm das Tor zu öffnen, und er konnte
keine Bewußtlose zu seinem Wagen tragen. Aber
morgen früh würde er Heather dazu überreden, ihn
zu begleiten. Und er würde möglichst viel Beweisma-
terial mitnehmen.
Zum Beispiel das Drahtgeflecht. Murray sprang

auf, griff nach seinem Taschenmesser, schnitt den Teil
des Matratzenbezugs ab, auf dem die Drähte ange-
bracht waren, und rollte ihn zusammen. Er steckte
ihn in die Tasche und sah sich suchend um.
Eine Tonbandspule? Warum nicht? Murray hob die
Matratze mit einer Hand hoch, nahm die beiden Spu-
len vom Tonbandgerät und verstaute sie in seiner
Reisetasche. Nur schade, daß der Fernsehapparat zu
groß und schwer war; auf diese Weise hatte Murray
nicht viel vorzuzeigen. Aber die Saftdosen! Nachdem
er sie eingepackt hatte, fiel ihm auf, daß er auch Hea-
thers Tonband mitnehmen könnte.
Er mußte allerdings abwarten, bis er in ihr Zimmer
schleichen konnte. Vorläufig war es noch zu früh. Ida
würde Heather vielleicht besuchen wollen und Krach
schlagen, wenn sie dort Murray fand. Nein, er mußte
noch mindestens eine Stunde lang warten.

20
Gegen ein Uhr, als Murray seit fast einer Stunde nur
noch Heathers gleichmäßige Atemzüge gehört hatte,
konnte er sich nicht länger beherrschen. Er drückte
die letzte von vielen Zigaretten aus, ging vorsichtig
zur Tür und wollte die Tonbandspulen aus Heathers
Zimmer holen.
Er öffnete die Tür einen Spalt weit, ohne etwas zu
hören. In der vergangenen Stunde hatte er deutlich
verfolgen können, wie die anderen nacheinander zu
Bett gingen. Er hatte auch Idas leise Frage an Hea-
thers Tür gehört; Ida war anscheinend daran ge-
wöhnt, stillschweigend abgewiesen zu werden, denn
sie war sofort wieder in ihr eigenes Zimmer gegan-
gen.
Murray hatte in Heathers Taschen nach einem
Schlüssel gesucht, ohne ihn zu finden. Jetzt trat er lei-
se in den Korridor hinaus und schloß die Tür lautlos
hinter sich ab. In diesem Augenblick hörte er die
Stimmen aus Zimmer Dreizehn, das erstmals seit sei-
ner Ankunft offen war. Er holte tief Luft, schloß sein
Zimmer wieder auf, um sich den Rückzugsweg of-
fenzuhalten, und näherte sich vorsichtig der Tür des
Nebenraums.
Die Stimmen gehörten Delgado und Valentine.

Murray hatte nichts anderes erwartet. Eigenartiger
war nur, daß diesmal Valentine im Befehlston sprach,
während Delgados Stimme fast unterwürfig klang.
»Das Mädchen ist nicht in seinem Zimmer«, stellte
Valentine fest. »Wo steckt es?«
»Ich ... ich weiß nicht.« Delgado war offenbar ner-
vös. »Vielleicht draußen im Park?«
»Unsinn! Ich weiß, wer das Haus verläßt oder
betritt. Nein, es muß irgendwo hier sein.«
»Kommt kein doppeltes Signal aus Idas Zimmer?«
»Heather ist nicht dort. Das verdanken wir diesem
Douglas! Sie hätte schon vor vier Nächten auf unsere
Beeinflussung reagieren müssen, aber ihr Tonband ist
nie gelaufen.«
»Wir müssen etwas wegen Douglas unternehmen«,
stellte Delgado fest. Ȁh ... kann sie nicht in seinem
Zimmer sein?«
»Woher soll ich das wissen?« knurrte Valentine.
»Der Kerl ist zu mißtrauisch. Was hilft uns der Detek-
tor im Fernsehgerät, wenn er es zur Wand dreht? Ich
sehe schon den ganzen Abend nur die Wand seines
Zimmers.«
»Aber er weiß nichts«, murmelte Delgado. »Er hat
nur einen Verdacht. Wir könnten ihn zum Schweigen
bringen ...«
»Zu spät«, warf Valentine ein. »Er hat heute abend
mit seinem Agenten in London telefoniert; er will fort

und hat Garrigue erwähnt. Der andere hat ihm ge-
glaubt und von Léa Martinez erzählt. Erinnerst du
dich noch an Léa?« Seine Stimme war schärfer ge-
worden.
»Aber niemand hat ihr ein Wort geglaubt!« wider-
sprach Delgado. »Jetzt sitzt sie in einer dieser primiti-
ven Nervenheilanstalten und ist vielleicht wirklich
übergeschnappt.« Er versuchte zu lachen, aber der
Versuch mißlang.
»Zu spät. Er will fort. Du und deine indirekten Me-
thoden!«
»Aber er ist noch hier, nicht wahr? Wir können di-
rektere Methoden verwenden. Es ist nicht zu spät.«
Delgado widersprach aufgeregt.
»Doch! Er hat seinem Freund mitgeteilt, er wolle
gehen, und dieser Mann soll Nachforschungen anstel-
len, wenn er morgen nicht in London ankommt.«
»Das läßt sich umgehen!« versicherte Delgado eif-
rig. »Wir können ein Band für ihn herstellen, das ihm
suggeriert, weshalb er doch lieber bleiben will. Das
macht auf seinen Freund bestimmt um so mehr Ein-
druck.«
»Meinetwegen soll er verschwinden«, entschied
Valentine gelassen. »Er führt sich schlimmer als Léa
auf.«
»Aber das ist ausgeschlossen!« jammerte Delgado.
»Was wird dann aus dem Stück? Er spielt eine

Hauptrolle, und wenn er geht, haben die anderen
vielleicht auch keine Lust mehr. Dann sind wir rui-
niert!«
»Das Stück geht mich nichts an«, stellte Valentine
ungerührt fest. »Im Augenblick mache ich mir wegen
Heather Sorgen. Sie ist gutes Material, und ich möch-
te sie nicht verlieren.«
»Douglas auch!« Delgado wurde noch aufgeregter.
»Wir haben das erste Band ausgewertet, und du hast
selbst zugegeben, daß er für unsere Zwecke sehr gut
geeignet wäre!«
»Aber das Band ist nur einmal gelaufen, nicht
wahr?« antwortete Valentine scharf. »Ich will jetzt
wissen, wo das Mädchen steckt. Wir suchen jetzt in
den Räumen ohne Detektor nach Heather; wenn sie
dort nicht zu finden ist, müssen wir bei Douglas
nachsehen. Und dann können einige Leute sich auf
ein Donnerwetter gefaßt machen, Delgado! Das war
nicht das vereinbarte Erlebnis, was?«
Murray durfte nicht länger zuhören. Die beiden
Männer konnten jeden Augenblick im Korridor er-
scheinen. Er eilte lautlos in sein Zimmer zurück,
schloß die Tür hinter sich und holte tief Luft. Dann
näherte er sich dem Bett und zupfte Heather am Är-
mel.
»Heather!« flüsterte er ihr ins Ohr. »Wach auf! Los,
wach endlich auf!«

Sie bewegte sich nur etwas und stöhnte dabei leise.
Murray ging ans Waschbecken und kam mit einem
nassen Handtuch zurück, das er ihr auf die Stirn leg-
te.
»Wach auf! Delgado sucht nach dir – du mußt dich
verstecken!«
»Was?« Sie öffnete langsam die Augen. »Laß mich
in Ruhe, ja? Ich will schlafen.«
»Du mußt dich verstecken! Delgado ist hinter dir
her!«
»Was?« Heather war plötzlich hellwach; sie richtete
sich auf und starrte Murray an. »O Gott!« flüsterte sie
dann. »Jetzt erinnere ich mich wieder! Murray, du
verdammter ...« Sie sprach nicht weiter, als ihr auffiel,
daß sie völlig bekleidet war.
»Hör zu!« flüsterte Murray eindringlich. »Ich habe
dir nichts ins Glas getan, verstanden? Der Fruchtsaft
war für mich bestimmt. Das war Delgados Idee.«
Oder Valentines – aber dafür hatten sie jetzt keine
Zeit. »Er sucht nach dir, und du mußt dich verstek-
ken.«
Heather warf ihm einen verständnislosen Blick zu.
Murray konnte sich vorstellen, welche Fragen ihr auf
der Zunge lagen, deshalb sprach er rasch weiter.
»Ich kann dir nicht alles auf einmal erklären«, stell-
te er fest. »Aber ich verschwinde morgen früh, und
wenn du schlau bist, kommst du mit. Sonst findest du

dich in Idas Bett wieder, ohne etwas dagegen tun zu
können.«
»Ida? Nein, ausgeschlossen! Ich wollte dich nicht
fragen, ob ich mich mit ihr einlassen soll oder nicht.
Ich wollte nur wissen, wie ich sie mir vom Hals schaf-
fen kann.«
»Du könntest dich nicht dagegen wehren«, versi-
cherte Murray ihr. »Aber das hat alles Zeit bis später!
Du mußt dich verstecken.« Er sah sich nach einem
geeigneten Platz um und deutete auf den Kleider-
schrank. »Hinein mit dir!«
Heather schrak zusammen. »Murray, ich ... ich
kann nicht«, sagte sie leise. »Ich leide an Klaustro-
phobie. Ich müßte schreien!«
»Aber ...«
»Unmöglich! Ich könnte mich nicht beherrschen«,
beteuerte sie.
»Ausgerechnet ...«, murmelte er und ließ enttäuscht
die Hände sinken.
»Was ist daran so schlimm, Murray?« fragte sie.
»Du kannst die Tür abschließen, nicht wahr?«
»Ich bezweifle sehr, daß sie sich von einem einfa-
chen Türschloß aufhalten lassen«, antwortete Murray
niedergeschlagen. »Nun, dann müssen wir ihnen
eben entgegentreten. Das wird eine verdammt unan-
genehme Sache! Es sei denn, wir ...«
Er sprach nicht weiter. Ihm war eingefallen, daß

Valentine davon gesprochen hatte, dies sei nicht das
vereinbarte Erlebnis gewesen. Er verstand nicht recht,
was damit gemeint war – aber offenbar hatte Delgado
es als Drohung aufgefaßt.
»Es sei denn?« fragte Heather nach einer kurzen
Pause.
»Es sei denn, wir können sie täuschen!« Murray
schaltete das Licht aus. »Keine Widerrede, um Gottes
willen. Zieh dich aus und laß die Kleidungsstücke
dort drüben auf dem Sessel liegen, wo sie von der
Tür aus gut zu sehen sind.« Er machte in fieberhafter
Eile das Bett, während er sprach.
»Murray ...«, sagte Heather mit schwacher Stimme.
»Du brauchst keine Angst zu haben!« flüsterte
Murray eindringlich. »Ich habe vorhin gehört, daß
Delgado dich in Idas Bett, aber in keinem anderen se-
hen will. Das klingt verrückt – aber die ganze Sache
ist nicht normal. Auf diese Weise hat er wenigstens
Grund zur Sorge. Bitte!«
Heather nickte wortlos, zog sich rasch aus und
warf ihre Kleidungsstücke über den Sessel. Dann
streckte sie sich unter der Bettdecke aus. Murray ließ
Schuhe, Hose und Pullover am Bettende zurück und
legte Hemd und Krawatte auf den Sessel neben Hea-
thers Sachen. Er kletterte von der anderen Seite her
ins Bett. Heather rückte etwas nach links, um ihm
Platz zu machen.

»Bleib liegen«, flüsterte er ihr zu. »Stell dich schla-
fend, wenn sie an die Tür kommen. Horch! Das sind
sie schon!«
Draußen waren leise Schritte zu hören. Murray
drehte sich auf die Seite und hoffte nur, daß es ihm
gelingen würde, sich überzeugend schlafend zu stel-
len.
Die Schritte kamen näher. Heather drängte sich
plötzlich an Murray; er spürte ihre Haut warm und
weich an seinem Rücken. Nun wirkten sie tatsächlich
wie ein Liebespaar, während sie darauf warteten, daß
die Tür geöffnet wurde.

21
Murray hatte den Schlüssel im Schloß gelassen, um
zu verhindern, daß sie mit einem einfachen Nach-
schlüssel geöffnet wurde. Aber die Eindringlinge wa-
ren offenbar nicht auf dergleichen primitive Metho-
den angewiesen. Murray öffnete die Augen vorsich-
tig einen Spalt breit, als er hörte, daß die Tür geöffnet
wurde; im Zimmer war es jedoch völlig dunkel, und
im Korridor brannte ebenfalls kein Licht mehr. Valen-
tine
und
Delgado
kamen
fast
lautlos
näher
und
holten
erschrocken
Luft,
als
sie
erkannten,
wer
im
Bett
lag.
Nicht das vereinbarte Erlebnis.
Murray hatte keine Ahnung, was darunter zu ver-
stehen war, aber er überlegte sich, daß er den beiden
zu einem weiteren Erlebnis verhelfen konnte, mit
dem sie nicht rechneten. Er hörte, daß sie auf die an-
dere Seite des Betts gegangen waren. Als er nun aus
dem Bett glitt, war er der Tür näher als die beiden
Männer; er erreichte sie, während Valentine und Del-
gado noch wie gelähmt waren, schloß sie und schalte-
te fast gleichzeitig das Licht ein.
Heather drehte sich im Bett um und schien aus tie-
fem Schlaf zu erwachen. Ihre gespielte Überraschung
machte echtem Erstaunen Platz, als sie erkannte, was
Murray bereits gesehen hatte.
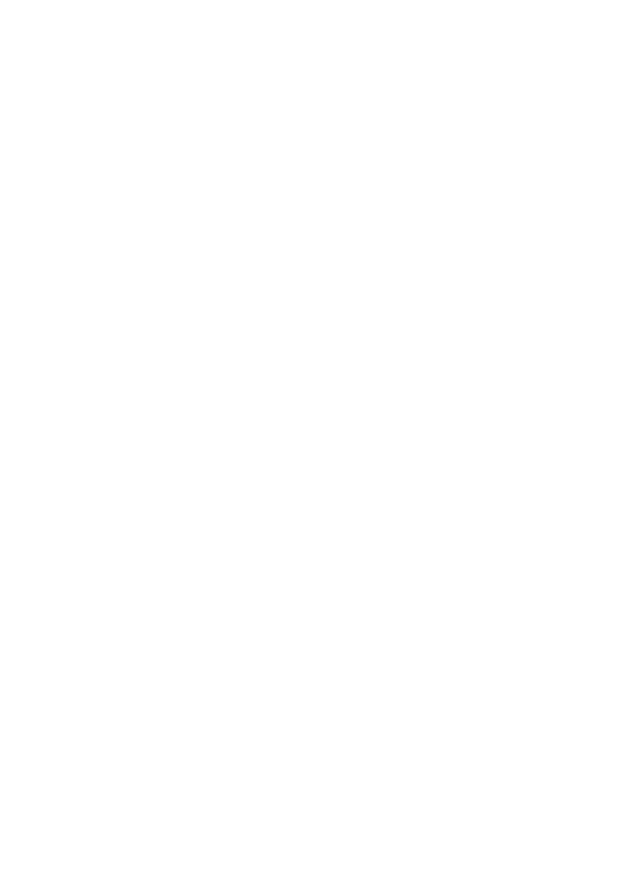
Delgado
und
Valentine
waren
maskiert.
Das
war
der
erste
Eindruck;
sie
trugen
schwarze
Brillen
mit
riesigen
Gläsern,
und
ein
weiteres
Objektiv
mitten
auf
ihrer
Stirn
wirkte
wie
ein
drittes
Auge.
Murray
hatte
noch
nie
eine
derartige
Brille
gesehen,
aber
er
konnte
sich
ihren
Verwendungszweck
vorstellen:
Die
beiden
Männer
trugen
sehr
kompakte
Nachtsehgeräte,
und
das
›dritte
Auge‹ war der dazugehörige Infrarotscheinwerfer.
Valentine hielt in der linken Hand einen Gegen-
stand, der schwerer zu identifizieren war. Murray er-
kannte nur einen länglichen Kasten von etwa fünf-
zehn Zentimeter Seitenlänge und fünf Zentimeter
Breite. An der Vorderseite war ein offenes Gitter an-
gebracht Valentine steckte den Kasten sofort in die
Tasche, bevor Murray ihn näher betrachten konnte.
»Okay«, sagte Murray nach einer Pause, »was ha-
ben Sie in meinem Zimmer zu suchen?«
Delgados Selbstbeherrschung war verflogen; er er-
innerte kaum noch an den arroganten Autor, den
Murray gekannt hatte. Im Gegensatz dazu machte
Valentine keinen Versuch, eine Ausrede oder Ent-
schuldigung zu finden.
»Delgado!« fuhr er seinen Begleiter an. »Du hast
ihn beobachtet. Was wird er vermutlich tun?«
»Äh ...« Delgado nahm seine Brille ab. »Wahr-
scheinlich ... äh ... ruft er die anderen, damit sie uns
hier sehen, nehme ich an.«

»Wie viele Unbeeinflußbare sind noch übrig?«
»Aufhören!« unterbrach Murray sie. »Heather,
Delgado hat einen guten Vorschlag gemacht. Hier!«
Er warf ihr seinen Bademantel zu. »Du mußt Sam
Blizzard aufwecken und herholen. Weißt du, in wel-
chem Zimmer er schläft?«
»Ja«, flüsterte Heather, zog sich den Bademantel an
und verließ barfuß das Zimmer.
Valentine ließ sich nicht anmerken, ob Blizzard tat-
sächlich zu den ›Unbeeinflußbaren‹ gehörte, aber
Murray vertraute darauf. Die beiden Männer schie-
nen sich mit ihrem Schicksal abgefunden zu haben,
und das störte ihn.
»Was soll das Schweigen?« fragte er spöttisch.
»Überlegen Sie sich eine gute Story?«
Valentine sah zu Delgado hinüber. Offenbar wollte
er ihn auffordern, in der Öffentlichkeit wieder die be-
herrschende Rolle zu spielen. Delgado war jedoch zu
aufgeregt, um diesen Wink zu verstehen.
»Das gefällt Ihnen nicht, was?« fuhr Murray fort.
»Dieses Erlebnis war wohl nicht vereinbart?«
Selbst Valentine erschrak sichtlich; Delgado wurde
leichenblaß. »Was haben Sie eben gesagt?« stieß er
hervor.
»Ruhig!« fuhr Valentine ihn an.
»Aha! Langsam machen Sie sich auch Sorgen, nicht
wahr?« Murray lächelte zufrieden. »Dachten Sie et-

wa, ich sei ein zweiter Jean-Paul Garrigue? Aber Sie
haben sich getäuscht! Und ich bin nicht so hilflos wie
Léa Martinez.«
Delgado sah zu Valentine hinüber. »Wir müssen
ihn zum Schweigen bringen!« rief er aus. »Er darf
nicht länger ...«
»Halt den Mund!« knurrte Valentine. »Auf diese
Weise erfährt er erst alles. Vorläufig kann er noch
nichts wissen.«
»Nein?« fragte Murray. »Und warum habe ich die
Tonbänder unbrauchbar gemacht und den Fernseh-
apparat zur Wand gedreht?«
Delgado zuckte zusammen.
»Immer mit der Ruhe«, mahnte Valentine. »Er
blufft nur. Er will uns hereinlegen; wir sollen glau-
ben, er wisse alles.«
Murray hätte beinahe zustimmend gelächelt. Er
beherrschte sich rechtzeitig und fragte sich dann,
warum Heather nicht endlich mit Sam Blizzard zu-
rückkam.
»Sie haben einen entscheidenden Fehler gemacht«,
sagte er zu den beiden Männern, um die Wartezeit
etwas zu verkürzen, »Sie wissen nichts über mich. Sie
sind so an Ihre Detektoren und Tonbänder und ande-
re Geräte gewöhnt, daß Sie vergessen haben, was sich
mit gesundem Menschenverstand erreichen läßt.
Delgado hat Sam Blizzard getäuscht, aber ich habe

mich nie von ihm täuschen lassen. Mir ist schon bald
klar geworden, daß ihm nichts an dem Stück liegt; er
legte es nur darauf an, andere zu korrumpieren.«
»Aber wer mit jungen Mädchen ins Bett geht, kor-
rumpiert sie nicht, was?« meinte Valentine sarka-
stisch.
»Das war nur eine Falle für Sie und Delgado«, er-
klärte Murray ihm. »Und Sie sind sofort darauf he-
reingefallen, wie ich sehe.«
Hinter ihm wurde an die Tür geklopft. Die Span-
nung ließ nach.
»Jetzt haben Sie Gelegenheit, alles zu erklären«,
stellte Murray fest und öffnete die Tür. »Herein zu
mir, Heather!«
Sie kam herein. Aber nicht freiwillig. Murray hatte
so sicher damit gerechnet, daß Blizzard sie begleiten
würde, daß er im ersten Augenblick nicht erkannte,
was wirklich geschehen war. Dann erschrak er so
sehr, daß seine Aufmerksamkeit für einige Sekunden
erlahmte, und Valentine nützte diese Gelegenheit.
Murray wußte nicht, womit der andere zugeschlagen
hatte – vermutlich mit dem Kasten, den er vorhin so
rasch versteckt hatte.
Bevor Murray zu Boden ging, sah er noch, daß ei-
ner der schwarzgekleideten Diener, dessen Namen er
nie erfahren hatte, Heathers Arme hinter ihrem Rük-
ken festhielt, während seine andere Hand vor ihrem

Mund lag. Dann kam ihm der Boden entgegen; er
war nur kurze Zeit bewußtlos, aber als er wieder
aufwachte, war er zu keiner Bewegung fähig.
»Ich wollte Blizzards Tonband auswechseln«, be-
richtete der ›Diener‹ eben, »als das Mädchen an die
Tür kam. Ich habe Blizzards Stimme imitiert und es
hereingelassen. Da es bereits vor der Tür gesagt hatte,
was es wollte, habe ich es lieber mitgebracht.«
»Ausgezeichnet, Walter«, lobte Valentine ihn. »Das
erspart uns viel Mühe.«
»Aber was sollen wir jetzt tun?« Delgado hatte sei-
nen Schock offenbar noch nicht überwunden. »Valen-
tine, du hast mir selbst erzählt, daß Douglas seinem
Freund versprochen hat, morgen früh abzureisen!«
»Ich weiß«, wehrte Valentine ungeduldig ab, »und
ich bin jetzt der Meinung, daß wir ihn nicht einfach
laufenlassen können. Wir müssen herausbekommen,
woher er seine Informationen bezogen hat. War sonst
alles in Ordnung, Walter?«
»Ja, soviel ich weiß. Blizzard war doch der einzige,
der ein neues Band bekommen sollte?«
»Richtig, aber das ist nicht mehr so dringend. Wir
haben in seinem Fall irgend etwas übersehen; das hat
jedoch Zeit bis später. Manuel!«
»Ja?« fragte Delgado zögernd.
»Du machst dich sofort an die Arbeit und stellst ein
Konzenband für das Mädchen her. Am Anfang muß

ein Löscher stehen, damit es endlich aufhört, das Tri-
plem zu seinem Tonbandgerät zu zerschneiden. Wal-
ter, du gibst ihm ein Schlafmittel. Bis morgen früh
muß der Impuls verankert sein.«
»Ist das nicht gefährlich?« warf Walter ein. »Das
kann seine ganze Persönlichkeit durcheinanderbrin-
gen.«
»Der Impuls braucht nicht lange vorzuhalten. Au-
ßerdem haben wir größere Sorgen. Ich komme zu dir,
Manuel, sobald ich meinen Rundgang gemacht habe,
und helfe dir, ein Band für Douglas herzustellen. Wir
müssen eine plausible Erklärung für sein Hierbleiben
erfinden. Los, an die Arbeit!«
Die Tür wurde geöffnet und schloß sich wieder.
Murray versuchte seine Gedanken zu ordnen. Wörter
wie ›Konzenband‹ oder ›Triplem‹ bedeuteten ihm
nichts; er ahnte nur, daß diese Männer imstande wa-
ren, das menschliche Gehirn fast beliebig zu beein-
flussen.
»Was ist eigentlich passiert?« fragte Walter, als die
Tür sich hinter Delgado geschlossen hatte.
Valentine schilderte die Ereignisse der letzten
Stunde. Dann fügte er hinzu: »Irgend jemand muß
unvorsichtig gewesen sein, das habe ich Manuel auch
schon gesagt. Douglas blufft keineswegs nur; er hat
einiges herausbekommen. Wir haben viel Arbeit vor
uns, wenn wir alle seine Erinnerungen löschen wol-

len, die sonst zufällig wieder an die Oberfläche
kommen könnten ... Nun, wir müssen es aber tun,
wenn wir dieses Projekt nicht ganz aufgeben wollen.
Hilf mir, ihn aufs Bett zu legen. Wahrscheinlich hat er
das Triplem wieder von der Matratze gerissen, aber
das macht nichts – ich habe die Konditionierer bei
mir, und er funktioniert vielleicht noch, obwohl ich
ihn Douglas auf den Kopf geschlagen habe.«
Murray sammelte seine Kräfte, streckte die Hand
aus und tastete nach dem ersten Ding, das in Reich-
weite war. Als die beiden Männer sich bückten, um
ihn aufs Bett zu heben, riß er mit aller Kraft daran
und spürte, daß irgend etwas nachgab.
»Verdammt, ich dachte, er sei bewußtlos«, sagte
Valentine gelassen. »Der alte Säufer ist überraschend
zäh, was?«
Sein Fuß traf Murrays Hand, und Murray ließ das
Kabel des Fernsehgeräts los, an dem er gezogen hatte.
Vielleicht hatte er damit wieder etwas beschädigt. Er
konnte nicht darauf hoffen, aber wenn er Valentines
Bemerkungen richtig deutete, war dies vielleicht die
letzte Gelegenheit gewesen, etwas aus dem freien
Willen zu tun.
»Augenblick«, hörte er Walter sagen, »heute fehlt
sogar das Tonband.«
»Wahrscheinlich hat er es wieder aus dem Fenster
geworfen«, seufzte Valentine. »Am besten holst du

gleich eine neue Spule von Manuel. Ich brauche eine
ziemlich lange Aufzeichnung von Douglas, bevor ich
anfangen kann, seine Erinnerungen zu löschen.«
»Wird gemacht.« Walter ging zur Tür.
Murray versuchte seine Kräfte zu sammeln. Wenn
er aufspringen konnte, während Valentine allein im
Zimmer war ...
»Ist etwas nicht in Ordnung?« fragte Valentine
scharf.
»Ja«, antwortete Walter laut. »Ich rieche etwas.
Rauch!«
»Ein Feuer?« erkundigte Valentine sich ängstlich.
»Sieh in Nummer Dreizehn nach!«
Eine Tür wurde geöffnet, dann rief Walter er-
schrocken: »Das reinste Inferno! Douglas muß einen
Kurzschluß verursacht haben! Ich habe Manuel ge-
sagt, er ...«
»Laß das jetzt! Weck Victor auf! Beeil dich – diese
alten Häuser brennen wie Zündholzschachteln ab!«
»Aber was ...?«
»Die anderen sollen selbst sehen, wie sie zurecht-
kommen! Ich habe jedenfalls keine Lust, im Haus zu
bleiben und lebendig gebraten zu werden! Aus dem
Weg, verdammt noch mal!«

22
Jetzt roch auch Murray, daß irgendwo Gummi ver-
schmorte. Dieser Geruch brachte ihn auf die Beine.
Der Raum drehte sich vor seinen Augen; er mußte
sich am Bett festhalten. Dann sah er Heather in dem
Sessel am Fenster kauern. Der halbe Ärmel ihres Ba-
demantels fehlte; sie war damit geknebelt worden.
Ihre Arme waren mit Murrays Krawatte gefesselt, um
die Knöchel war sein Gürtel geschlungen. Heather
stampfte mit den Füßen auf, als wolle sie ihn auf sich
aufmerksam machen, weil er nicht gleich zu ihr kam.
Aber Murray suchte noch nach seinem Taschenmes-
ser. Als er es endlich gefunden hatte, zerschnitt er
damit ihre Fesseln und half ihr auf die Beine.
»Weck sofort die anderen auf!« befahl er ihr heiser.
»Zieh dich nicht erst um. Schnell!«
Heather nickte, schlüpfte nur rasch in ihre Schuhe
und eilte hinaus.
Murray stolperte ans Waschbecken und drehte das
kalte Wasser auf. Er ließ es sich über den Kopf laufen,
aber die Kopfschmerzen blieben. Er sprach mit sei-
nem Spiegelbild, das er nur undeutlich erkannte.
»Ich muß irgendeinen Beweis mitnehmen. Zumin-
dest das Tonband. Oder den Kasten, den Valentine
zurückgelassen hat ... He!«

Er hatte sich unbeabsichtigt gegen die Wand über
dem Waschbecken gestützt, und sein langsam funk-
tionierendes Gehirn hatte so lange gebraucht, um auf
die Empfindung zu reagieren, die seine Nerven über-
trugen.
Die Wand war heiß! Und dahinter lag Zimmer
Dreizehn – mit Delgado!
Murray dachte an nichts anderes mehr. Er lief in
den Korridor hinaus. Heather kam ihm schluchzend
entgegen.
»Ich kann niemand aufwecken, Murray! Alle liegen
wie tot in ihren Betten!«
»Noch mal! Gib dir Mühe! Wenn sie nicht aufwa-
chen, werfen wir sie aus den Fenstern. Hier haben sie
nicht die geringste Chance!«
Er deutete auf die Tür zu Zimmer Dreizehn, unter
der bereits dichter Rauch hervorquoll.
»Delgado ist noch immer dort drin. Valentine ist
mit den beiden anderen verschwunden, und wir ho-
len sie vielleicht nie ein – aber wenn wir Delgado
festhalten können, haben wir immerhin einen Mann,
der unsere Fragen beantworten kann!«
Heather eilte davon, und Murray öffnete die Tür
des Zimmers.
Walter hatte recht gehabt, als er von einem Inferno
sprach. Der Kurzschluß des Kabels hatte einen Licht-
bogen erzeugt. Es stank nach Ozon, und in Fenster-

nähe rief irgend etwas noch immer einen Funkenre-
gen hervor. Gleichzeitig schlugen an mehreren Stel-
len Flammen empor. Als Murray die Tür öffnete, ex-
plodierte etwas; er duckte sich instinktiv und spürte
heiße Glassplitter auf der bloßen Haut. Er war nur
mit Unterhemd und Unterhose bekleidet, und die
Hitze schlug ihm entgegen, als stehe er vor einem
Hochofen.
Er hatte keine Zeit, die elektronischen Geräte zu
untersuchen, die der Raum enthielt, sondern stürzte
auf Manuel Delgado zu, der an seinem Arbeitsplatz
zusammengesunken war. Irgend etwas bohrte sich in
seine Ferse und ließ ihn zusammenzucken – wahr-
scheinlich ein glühendheißer Glassplitter. Aber Mur-
ray achtete weder darauf noch auf die Hitze und den
Rauch, sondern griff nach Delgado und brachte es ir-
gendwie fertig, ihn sich über die Schulter zu legen.
Als er zur Tür schwankte, kam es erneut zu einer hef-
tigen Explosion. Murray erinnerte sich daran, daß es
besser war, die Tür zu schließen, weil sonst dem Feu-
er mehr Sauerstoff zugeführt wurde. Er zog sie hinter
sich zu.
»Murray!«
Heather kam aus einem anderen Zimmer – Idas,
wenn er sich recht erinnerte – und stolperte auf ihn
zu.
»Murray, ich kann niemand wecken! Ich habe geru-

fen und sie geohrfeigt und ... und ... o Gott, Murray,
ich kann nicht!«
»Geh in die Halle hinunter«, befahl Murray ihr und
wankte selbst zur Treppe. »Das Telefon steht in Bliz-
zards Büro. Ruf die Feuerwehr, Krankenwagen, einen
Arzt und die Polizei an. Alle sollen sofort kommen.
Der Seitenflügel steht wahrscheinlich nicht mehr lan-
ge, aber vielleicht ist das Hauptgebäude zu retten.«
Er erreichte die Treppe und bückte sich, um seine
Last zu Boden gleiten zu lassen. Delgado rutschte wie
eine Puppe über die Stufen hinab und blieb auf dem
ersten Treppenabsatz liegen.
Auch
das
würde
er
überleben,
entschied
Murray
zy-
nisch,
falls
er
noch
gelebt
hatte,
als
er
aus
Zimmer
Drei-
zehn
herausgeholt
worden
war.
Seine
Haare
waren
versengt,
und
er
schien
mehrere
Brandwunden
an
Ar-
men
und
Beinen
zu
haben.
Aber
ein
guter
Arzt
würde
nicht
lange
brauchen,
um
ihn
wieder
zurechtzuflicken.
»Los, geh schon ans Telefon!« befahl er nochmals
und blieb nicht stehen, um festzustellen, ob Heather
seinen Befehl ausführte. Statt dessen rannte er in den
Korridor zurück.
Nun begann eine Schreckenszeit, an die er sich nach-
träglich nie mehr ganz deutlich erinnern konnte.
Murray glaubte einen Alptraum zu erleben, in dem er
ständig Schmerzen hatte und eine Höllenvision vor

sich sah. Alles begann in Zimmer Zwölf, wo Adrian
Gardner wie eine Wachsfigur in seinem Bett lag, als
sei er einer der Untoten aus Dracula. Kein Wunder,
daß Valentine und Delgado unvorsichtig geworden
waren und sich nicht mehr darum gekümmert hatten,
ob die Tür des Zimmers Dreizehn offenstand, wäh-
rend sie über ihre Geheimnisse sprachen. Da sie wuß-
ten, daß die meisten Bewohner des Hauses in diesem
todähnlichen Schlaf lagen, waren sie verständlicher-
weise etwas leichtsinnig geworden.
Murray betrat Adrians Raum mit der Absicht, den
Draht von der Matratze zu reißen und ihn mit den
Tonbandspulen aus dem Fenster zu werfen, um spä-
ter zusätzliche Beweise zu haben. Aber er gab dieses
Vorhaben sofort auf, als er einen Fuß über die
Schwelle gesetzt hatte. Zwischen den Bodenbrettern
rauchte es bereits, und der beißende Qualm nahm
Murray den Atem. Hinter der Wand zu Zimmer
Dreizehn knackte und prasselte es laut.
Murray riß die Decke vom Bett und schob und
zerrte, bis Adrian einigermaßen im Gleichgewicht
über seiner Schulter hing. In Zimmer Dreizehn kam
es zu einem neuen Kurzschluß. Das Fernsehgerät in
Ades Zimmer begann zu rauchen; dann schlugen die
ersten Flammen an der Stelle empor, wo das schwar-
ze Kabel hinter der Fußbodenleiste verschwand.
Murray schleppte Adrian zur Tür. Hinter ihm be-

gann der Teppich zu qualmen. Das Zimmer füllte
sich mit dichtem Rauch. Murray sah zu Zimmer
Dreizehn hinüber; die Farbe an der Tür warf bereits
Blasen vor Hitze.
Er hatte eben Adrian die Treppe hinabrutschen las-
sen, als der Boden unter seinen Füßen heftig
schwankte. Irgend etwas krachte und zersplitterte,
und Murray stellte sich vor, wie die schweren Geräte
im Zimmer Dreizehn durch den Fußboden gebrochen
waren. Und darunter lag die Bühne mit den brennba-
ren Vorhängen! Sobald das Feuer sich dort ausbreite-
te, war der erste Stock nur noch durch eine dünne
Decke von einem wirklichen Inferno getrennt. Mur-
ray versuchte die nächste Tür zu öffnen – Constants,
der in Nummer Elf schlief.
Der Kerl hatte seine Tür abgeschlossen.
Murray drehte sich um und hielt nach einem
Werkzeug Ausschau, mit dem er die Tür aufbrechen
konnte; er wußte, daß er nicht mehr Kraft genug be-
saß, um das Schloß mit roher Gewalt zu sprengen. Er
sah einen geschnitzten Stuhl aus Eichenholz zwischen
zwei Türen stehen. Mit Hilfe dieses Stuhls gelang es
ihm, die Tür aufzubrechen. Zum Glück handelte es
sich um eine Tür moderner Bauart, so daß er nur
zwei Sperrholzschichten zu zertrümmern hatte.
Bis er Gerry aus Zimmer Zehn zur Treppe ge-
schleppt hatte, war kein Zweifel mehr daran möglich,

daß nun auch das Theater in Flammen stand. Der
Fußboden unter seinen bloßen Füßen war heiß; über-
all quollen dichte Rauchschwaden aus den Zimmern.
Die Tür zu Nummer Dreizehn war bereits vor einiger
Zeit ein Raub der Flammen geworden, und Murray
hörte überall Fensterscheiben bersten. Der Boden
schwankte nochmals und blieb schräg. Oder war das
nur eine Illusion? Murray bildete sich ein, in jeder
Richtung eine Steigung überwinden zu müssen.
»Danke«, murmelte er und merkte erst dann, daß
tatsächlich jemand in seiner Nähe war. Heather half
ihm, Ida zur Treppe zu tragen. Auch Ida war leichen-
blaß; ihre Blässe trat noch deutlicher hervor, weil sie
ein schwarzes Nylonnachthemd trug.
Murray und Heather brachten es irgendwie fertig,
den vom Feuer am meisten bedrohten Seitenflügel zu
räumen. Die Treppe erinnerte jetzt an eine moderne
Theaterkulisse; sie war mit Bewußtlosen übersät ...
»Jetzt noch Sam!« flüsterte Murray heiser. Er spürte
eine Hand auf seinem Arm. Ja, noch einer, aber nicht
über dem brennenden Theater, sondern ganz vorn an der
Treppe, wo weniger Gefahr bestand.
»Schon gut, schon gut ...« Aber das war nicht Hea-
ther! Murray kniff seine tränenden Augen zusammen
und erkannte eine Gestalt in dunkler Kleidung mit
blitzenden Knöpfen. Jemand mit einem Helm auf
dem Kopf.

»Ich habe sie gebeten, alle Feuerwehren der nähe-
ren Umgebung zu alarmieren – und möglichst viele
Ärzte und ...«
Das war Heather. Murray sah sich langsam um.
Die Gestalten auf der Treppe lagen noch immer un-
beweglich in gleicher Haltung wie zuvor. Aber unten
in der Halle erschienen jetzt Männer mit Wasser-
schläuchen, und irgend jemand brüllte Befehle. Mur-
ray hatte nur noch eine Frage: Sind alle in Sicherheit?
Er hörte wieder Heathers Stimme. »Er hat sie her-
ausgeholt. Murray hat sie herausgeholt. Ja, das sind
alle!«
Feuerwehrmänner. Wasserschläuche. Fenster werden
von draußen eingeschlagen, anstatt durch die Hitze zu zer-
splittern. Hoffnung Hilfe.
Murray vergaß alles, was hinter ihm lag. Er wollte
sich am Treppengeländer festhalten, aber seine Finger
glitten ab, und er hatte nichts unter den Füßen, wo er
eine Stufe erwartet hatte. Dann hielt ihn jemand fest,
bevor er fiel. Er sah ein besorgtes Gesicht unter einem
dunklen Helm vor sich.
Murray wurde bewußtlos.

23
Murray Douglas kam nur langsam wieder zu sich
und mußte eine bewußte Anstrengung machen, um
seine Gedanken allmählich wieder unter Kontrolle zu
bringen. Nachdem er das Bewußtsein zurückgewon-
nen hatte, war er mit seiner gegenwärtigen Lage zu-
frieden; er spürte eine rauhe Decke über sich, hatte
ein zusammengerolltes Kleidungsstück als Kissen un-
ter dem Kopf und hörte den an- und abschwellenden
Lärm, den Männerstimmen, aufheulende Motoren,
Pumpen und prasselnde Flammen erzeugten.
Dann sagte jemand besorgt neben ihm: »Hier ist er,
Doktor. Er ... er ist einfach bewußtlos geworden.«
Heathers Stimme.
Eine
andere
Stimme,
eine
Männerstimme
mit
schot-
tischem
Akzent,
die
Murray
bekannt
vorkam,
antwor-
tete:
»Das
überrascht
mich
keineswegs,
junge
Frau!
Ich
habe
ihn
neulich
gesehen
und
war
entsetzt,
wirklich
entsetzt,
wieviel
älter
er
aussieht,
als
er
eigentlich
ist.«
Dr. Cromarty. Der Name tauchte langsam aus
Murrays Gedächtnis auf, und er zwang sich, die Au-
gen zu öffnen. Der Arzt stand tatsächlich vor ihm; er
mußte sich in aller Eile angezogen haben, denn unter
seinem Pullover war der gestreifte Kragen seines
Schlafanzugs sichtbar.

»Wie geht es den anderen?« wollte Murray wissen.
»Haben wir sie alle rechtzeitig herausgeholt?«
Cromarty setzte sich seine Brille auf. Er warf Hea-
ther einen fragenden Blick zu und machte dann eine
beruhigende Handbewegung. »Ja, Mister Douglas,
den anderen geht es gut. Bleiben Sie jetzt ruhig lie-
gen, damit ich ...«
»Ich meine nicht, ob sie Brandwunden davongetra-
gen haben!« unterbrach Murray ihn. Er richtete sich
mühsam auf den Ellbogen auf. »Ich will wissen, wie
es ihnen geht!«
Cromarty
schüttelte
mißbilligend
den
Kopf
und
ver-
suchte
ihn
auf
die
Decke
zu
drücken.
Aber
Murray
schob
seine
Hand
ungeduldig
fort.
»Um
Himmels
wil-
len!«
rief
er
aus.
»Mir
fehlt
nichts.
Ich
bin
nur
von
der
Hitze und dem Rauch ohnmächtig geworden. Ich ...«
»Deine Füße, Murray«, warf Heather ein. Er mach-
te eine Pause, weil er nicht sofort begriff, was sie
meinte; dann sah er, daß sie recht hatte. Seine Fuß-
sohlen waren sehr empfindlich, aber das hatte Zeit
bis später, denn vorläufig waren die Schmerzen noch
erträglich. Viel wichtiger waren die Untoten, Delga-
dos ahnungslose Opfer, die er wie Leichen aus ihren
Zimmern geschleppt und zur Treppe gebracht hatte.
»Lassen Sie mich doch!« knurrte Murray und be-
freite sich mit einem Ruck aus Dr. Cromartys Griff. Er
richtete sich auf. »Ich muß endlich wissen, was ...«

Er sprach nicht weiter, sondern sah sich um. Im
Gras vor dem Hauptgebäude lagen säuberlich neben-
einander aufgereiht dunkle Gestalten. Zwei Feuer-
wehrwagen und andere Fahrzeuge beleuchteten die-
se Szene mit ihren Scheinwerfern. Uniformierte Män-
ner waren überall zu sehen.
»Vorsicht an der zweiten Pumpe!« rief eine aufge-
regte Stimme. Fast im gleichen Augenblick stürzte
hinter dem Haus etwas krachend in sich zusammen.
Murray sah einen Funkenregen, der die Unterseite
der gewaltigen Rauchwolke beleuchtete, die sich trä-
ge über den Himmel wälzte.
Jetzt ist dort bestimmt nichts mehr zu finden, wo das
Feuer gewütet hat ...
Murray schloß kurz die Augen und bewahrte müh-
sam seine Selbstbeherrschung. Als der Einsturz ihn
erschreckte, hatte er eine Frage stellen wollen. Jetzt
erinnerte er sich wieder daran und drehte sich nach
Dr. Cromarty um. »Krankenwagen«, sagte er. »War-
um sind keine Krankenwagen hier?«
»Auf der Fernstraße hat es einen Unfall gegeben«,
murmelte der Arzt. Ȇber zwanzig Verletzte und et-
liche Tote bei einem Busunglück. Aber die Wagen
kommen so schnell wie möglich.«
»Oh ...«, murmelte Murray enttäuscht und er-
schrocken. »Nun, haben Sie sich die Leute wenigstens
schon angesehen?«

Cromarty fuhr sich mit dem Handrücken über die
Stirn. »Ich bin erst seit einigen Minuten hier, wissen
Sie. Die Feuerwehrmänner sind natürlich in Erster
Hilfe ausgebildet und haben festgestellt, daß nie-
mand ernstliche Verbrennungen davongetragen hat.
Diese junge Dame hat darauf bestanden, daß ich zu
Ihnen ...«
»Delgado?« fragte Murray laut.
»Er scheint einen Schlag bekommen zu haben«, er-
klärte Heather, »aber er ist nicht schwer verletzt.«
Murray nickte erleichtert und kam zu seiner ur-
sprünglichen Frage zurück. »Was fehlt diesen Leuten,
Doktor? Sie schlafen nicht. Sie wirken leblos. Sie ...
verdammt noch mal, überzeugen Sie sich doch
selbst!«
Er ging vier oder fünf Schritte weit auf den näch-
sten ›Untoten‹ zu und stellte beim letzten Schritt fest,
daß die Brandwunden an seinen Füßen wesentlich
schlimmer als erwartet sein mußten. Er schwankte
und konnte sich kaum noch auf den Beinen halten.
Zum Glück war Heather an seiner Seite geblieben
und konnte ihn stützen. Cromarty folgte ihnen, öffne-
te seine schwarze Arzttasche und griff hinein.
»Hier, junge Frau!« knurrte er und gab Heather ei-
ne Tube Salbe und zwei Mullbinden. »Bringen Sie
diesen Idioten dazu, daß er sich ins Gras setzt, wäh-
rend Sie seine Füße verbinden, bevor Schmutz in sei-

ne Brandwunden kommt. Ich versorge ihn später
richtig, aber auf diese Weise hat er weniger Schmer-
zen.«
Heather nickte schweigend, half Murray, der sich
stöhnend niederließ, und holte die Decke, um sie ihm
umzulegen. Murray achtete kaum darauf; er verfolgte
Cromarty mit den Augen. Der Arzt ging von einer
dunklen Gestalt zur anderen, blieb bei jeder kurz ste-
hen und kehrte langsam zurück.
»Ich weiß nicht, was ich davon halten soll«, stellte
er fest, »aber Sie haben gar nicht so unrecht gehabt,
sie schlafen nicht und wirken trotzdem leblos. Diese
armen Leute befinden sich in hypnotischer Trance.«
»Wissen Sie das bestimmt?« erkundigte Murray
sich.
»Ganz bestimmt.« Cromarty räusperte sich verle-
gen. »Meine Praxis ist nicht sehr zeitraubend, und ich
beschäftige mich in meiner Freizeit gern mit hypnoti-
schen Experimenten. Ich habe sogar schon werdende
Mütter hypnotisiert – natürlich nur mit ihrem Einver-
ständnis –, und die Geburt war in jedem Fall
schmerzlos.«
»Ich dachte ...«, begann Heather und biß sich auf
die Unterlippe.
»Ja?«
»Nun ... könnten sie nicht mit irgendeinem Mittel
betäubt worden sein?«

»Möglich«, gab Dr. Cromarty zu. »Aber ich gehe
jede Wette darauf ein, daß diese Leute hypnotisiert
worden sind.«
»Können Sie sie nicht aufwecken?« erkundigte
Murray sich.
Der Arzt schüttelte den Kopf. »Wenn der Hypnoti-
seur seine Sache verstanden hat, sind sie nicht an-
sprechbar.«
»Bleiben sie etwa immer so?« fragte Heather er-
schrocken.
»O nein!« versicherte Cromarty ihr. »Diese Trance
geht allmählich in normalen Schlaf über, aus dem sie
normal erwachen. Aber ...«
»Ja?« sagte Murray.
»Aber sie reagieren vielleicht auf posthypnotische
Befehle«, fügte der Arzt langsam hinzu. »Und wenn
wir nichts dagegen unternehmen, müssen die armen
Leute sie auch gegen ihren Willen ausführen, sobald
sie wieder wach sind.«
Murray hatte oft genug erlebt, wie sich Versuchs-
personen benahmen, die auf der Bühne hypnotisiert
worden waren. Er wußte, was Cromarty sagen wollte;
wenn die hypnotischen Befehle nicht gelöscht wur-
den, bestand die Gefahr, daß die Betroffenen sich wie
Geisteskranke aufführten.
Bevor der Arzt weitersprechen konnte, hielt ein
Streifenwagen hinter ihnen. Der Fahrer stieg aus und

hielt einem Mann in Zivil die Tür auf. Dieser Mann
wechselte einige Worte mit den anwesenden Polizei-
beamten, erkannte dann Cromarty und kam auf ihn
zu.
»Morgen, Doktor!« sagte er. »Tut mir leid, daß ich
so spät komme, aber heute nacht ist einiges los.«
»Wann kommen die Krankenwagen?« wollte Cro-
marty wissen.
»Wir haben dreizehn gebraucht, um die Verletzten
von der Straße wegzubringen. Haben Sie schon da-
von gehört? Aber die Wagen laden nur aus und
kommen so schnell wie möglich hierher. Was geht ei-
gentlich hier vor?«
»Das wollte ich eben Mister Douglas fragen«, stell-
te Cromarty fest. »Mister Douglas – Chefinspektor
Wadeward.«
»Murray Douglas, der bekannte Schauspieler«,
murmelte Wadeward nickend. »Ich habe schon ge-
hört, daß Sie hier mit einem Ensemble proben. Nun?«
Murray fuhr sich mit der Zunge über die Lippen.
Heather hatte ihre Arbeit beendet und seine Füße
verbunden. Jetzt hockte sie neben ihm im Gras, als sei
sie zu erschöpft, um aus eigener Kraft aufzustehen.
»Die ganze Sache ist so kompliziert, daß ich gar
nicht weiß, wo ich anfangen soll.« Murray zögerte
und versuchte seine Gedanken in eine logische Ord-
nung zu bringen.

»Sie könnten damit anfangen, daß Sie uns erklären,
weshalb diese Leute alle hypnotisiert sind«, schlug
Cromarty vor.
»Haben Sie hypnotisiert gesagt?« Wadeward dreh-
te sich um und warf den bewegungslosen Gestalten
im Gras einen ungläubigen Blick zu. »Ich ... nein, er-
zählen Sie mir erst mehr, bevor ich Fragen stelle!«
»Sie wissen also bereits, weshalb wir hier zusam-
mengekommen sind?« fragte Murray.
»Um ein neues Theaterstück zu erarbeiten«, ant-
wortete der Chefinspektor prompt. »Das hat in der
hiesigen Zeitung gestanden. Es war offenbar eine
wichtige Sache.«
»Diese angeblich so wichtige Sache diente aller-
dings nur zur Tarnung«, erklärte Murray seinen Zu-
hörern. »Ich weiß noch jetzt nicht recht, was eigent-
lich beabsichtigt war, aber ich glaube, wir sollten alle
völlig hysterisch gemacht werden. Und dann ...«
Triplem.
Konzenband.
Das vereinbarte Erlebnis.
Zwecklos. Spätestens hier wurde alles so undeut-
lich und verschwommen, als sehe er die Ereignisse
durch die große Rauchwolke, die hinter dem Haus
aufstieg.
»Ich ... ich fange am besten ganz von vorn an«,
murmelte er.

Dr. Cromarty und Chefinspektor Wadeward hör-
ten mit wachsendem Erstaunen von Trois Fois à la
Fois, von Jean-Paul Garrigues Selbstmord, von Léa
Martinez, die in eine Nervenheilanstalt eingeliefert
werden mußte, und von Claudette Myrin, die ver-
sucht hatte, ihre kleine Tochter zu ermorden. Wade-
ward konnte plötzlich nicht länger schweigen.
»Aber hat denn niemand etwas gegen diesen Ver-
rückten unternommen?« wollte er wissen. »Man kann
doch nicht einfach zusehen, wie Unschuldige im Na-
men der Kunst verfolgt und ruiniert werden! Ob Ge-
nie oder nicht – das ist ungeheuerlich und hätte
längst unterbunden werden müssen!«
»Delgado ist so gerissen, daß man seine Behand-
lungsweise aus eigener Anschauung kennen muß,
um sie für möglich zu halten«, stellte Murray fest.
»Ich weiß selbst nicht, weshalb wir ihm nicht zum
Opfer gefallen sind. Wahrscheinlich haben wir ein-
fach Glück gehabt.«
»Nein, nicht nur das«, widersprach Heather ener-
gisch. »Du warst einfach zu zäh für ihn, Murray.«
»Schmeichelhaft, aber leider nicht wahr«, erwiderte
Murray seufzend. »Nun, schon am ersten Abend ...«
Murray erzählte von den Tonbandgeräten unter ih-
ren Betten, von den seltsamen Metallstäben über der
Bühne, von umgebauten Fernsehgeräten und von den
seltsamen Apparaten in Zimmer Dreizehn. Er er-

wähnte Delgados Empfindlichkeit, wenn diese Dinge
zur Sprache gebracht wurden. Er sprach davon, daß
selbst Lester Harkham plötzlich alles Interesse an den
geheimnisvollen Apparaten verloren hatte. Er berich-
tete, daß die Fruchtsaftdosen in seinem Zimmer au-
ßer Saft auch Alkohol enthalten hatten, um ihn wie-
der zum Trinker zu machen. Er wiederholte das Ge-
spräch zwischen Valentine und Delgado, fügte hinzu,
was er später gehört hatte, als Valentine und Walter
ihn für bewußtlos hielten, und ... und ...
Wadeward
schüttelte
schließlich
den
Kopf
und
gab
zu:
»Ich
weiß
einfach
nicht,
was
ich
daraus
machen
soll.
Werden
Sie
daraus
schlau,
Doktor?
Ich
kann
diesen
›Butler‹
und
seine
beiden
Mitverschwörer
höchstens
wegen
Rauschgifthandels
suchen
lassen.
Vielleicht
können
wir
ihnen
noch
Kuppelei
vorwerfen,
aber
das
ist schon alles. Oh, tut mir leid, junge Dame!«
»Ich glaube«, flüsterte Heather, ohne ihn anzuse-
hen, »daß sie mich auch gegen meinen Willen dazu
gebracht hätten, alles zu tun, was sie wollten.«
»Aber die ganze Sache ist unglaublich!« protestier-
te Cromarty. »Sehen Sie sich nur das deutlichste Bei-
spiel an. Mister Douglas ist davon überzeugt, ein
Drahtgeflecht auf der Matratze habe die hypnotische
Trance dieser Leute hervorgerufen. Aber ich beschäf-
tige mich seit Jahren mit diesem Gebiet, und mir er-
scheint diese Vorstellung absurd!«
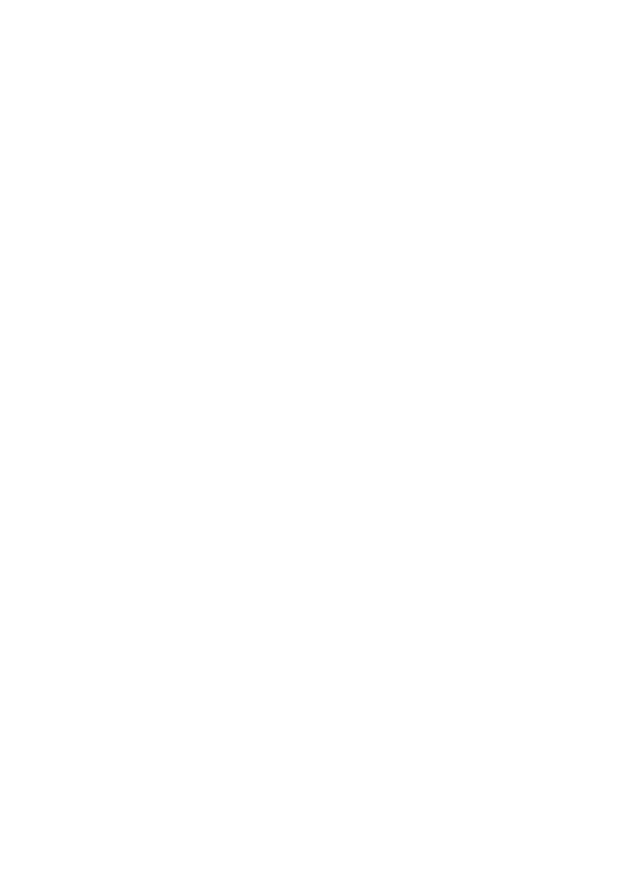
Murray ließ enttäuscht die Schultern sinken. Er hat-
te widersprechen wollen, aber nun sparte er sich lie-
ber die Mühe. Die Beweise, die er hatte in Sicherheit
bringen wollen, waren inzwischen ein Raub der
Flammen geworden. Was würden einige Kleinigkei-
ten helfen, die vielleicht später gefunden wurden?
Pseudowissenschaftlicher Kram, der besser zu Lesters
Theorie als zu Murrays phantastischen Vorwürfen
paßte.
Er legte den Kopf auf die Arme. Cromarty unter-
suchte ihn besorgt. Murray achtete kaum noch dar-
auf, was um ihn herum geschah; deshalb hätte er
Heathers Vorschlag fast überhört.
»Warum fragen wir nicht einfach Delgado, anstatt
selbst Theorien aufzustellen?« meinte sie eben. »Er
muß inzwischen wieder zu Bewußtsein gekommen
sein. Valentine und die anderen sind entkommen,
aber Delgado liegt dort drüben.«

24
Murray richtete sich abrupt wieder auf. Daran hätte
er selbst denken müssen! Er hatte sogar daran ge-
dacht, den ›Autor‹ zu verhören, aber dann war die
Rettung der übrigen Mitglieder des Ensembles wich-
tiger gewesen. Er wartete ungeduldig, bis Dr. Cro-
marty Delgado untersucht und bestätigt hatte, daß
der Mann nur leicht verletzt war. Delgados Brand-
wunden waren bereits versorgt worden, und er war
wieder bei Bewußtsein, als Cromarty ihn erreichte.
Nun zitterte er vor Angst und schluckte dabei hörbar;
er sah erschrocken von einem zum anderen.
Als Cromarty zustimmend nickte, ließ Wadeward
sich neben ihm auf die Knie nieder, gab sich zu er-
kennen und verlangte, Delgado solle zu Murrays Be-
hauptungen Stellung nehmen.
Aber der Mann vor ihm stöhnte nur erschrocken
und drückte die Lippen zusammen.
»Los, reden Sie endlich!« brüllte Murray ihn an.
»Reden Sie, verdammt noch mal!«
Er war so wütend, daß er dem Liegenden einen
Fußtritt versetzt hätte, wenn seine Füße nicht so emp-
findlich gewesen wären. Cromarty war abgelenkt
worden und hatte nicht gesehen, daß Murray auf sei-
nen Verbänden ging, sonst hätte er es ihm verboten.

»Es hat keinen Zweck, noch länger den Mund zu
halten«, stellte Heather fest. »Das hilft Ihnen nicht
weiter. Die anderen haben Sie Ihrem Schicksal über-
lassen. Sie hätten hier sterben können. Ist Ihnen das
klar?«
Delgado zeigte erstmals Interesse. Die Angst ver-
schwand aus seinen Augen, als er Heather prüfend
ansah.
»Die anderen haben Sie in Zimmer Dreizehn zu-
rückgelassen, und Sie wären dort verbrannt«, erklärte
Heather ihm. »Valentine und ... Victor und Walter!
Wir wissen nicht, wohin sie verschwunden sind, aber
sie wollten jedenfalls nicht bleiben und lebendig be-
graben werden. Sie sind fortgelaufen und haben Sie
im Stich gelassen, und wenn Murray nicht gekom-
men wäre, um Sie zu retten, wären Sie lebendig ver-
brannt. Begreifen Sie das nicht? Ihre verdammten
Freunde haben Sie zurückgelassen, aber Murray hat
Ihr wertloses Leben gerettet!«
Heather schluchzte fast, als sie das letzte Wort her-
vorstieß. Delgado war von diesem Gefühlsausbruch
sichtlich beeindruckt; seine Angst machte jetzt blan-
kem Haß Platz.
»Ist das wahr?« flüsterte er und fuhr fort, ohne auf
eine Antwort zu warten. »Ja ... ja, ich erinnere mich
wieder! Ich wollte das Tonband zusammenstellen,
das Valentine brauchte, aber dann gab es plötzlich ei-

nen Funken ... irgendwo ein Kurzschluß ... ich be-
rührte das Mischpult und wurde bewußtlos ...«
Er richtete sich ruckartig auf und sah sich um.
Dann starrte er Murray an.
»Sie ... Sie haben mich dort herausgeholt?« krächzte
er.
Murray nickte langsam.
»Aber ich dachte ...« Delgado machte wieder eine
Pause, und als er weitersprach, klang seine Stimme
erschreckend haßerfüllt.
»Diese herzlosen, erbärmlichen, verdammten Sadi-
sten! Sie haben mich einfach zurückgelassen! Und ich
sollte hier verbrennen!« Delgado schüttelte wütend
die geballte Faust. »Aber dafür bezahlen sie noch! Sie
sollen nur versuchen, sich irgendwie herauszureden,
wenn die Temporegs sie eines Tages erwischen. Das
sollen sie nur! Ich lasse sie bis zum Kinn in Atommüll
vergraben. Ich lasse ihr Gedächtnis löschen, bis sie
nur noch als leere Hüllen ohne Verstand existieren.
Ich lasse sie mit falschen Redukes in Substate ver-
wandeln. Ich ...«
Substate? Redukes? Konzenband? Triplem? Murray
beugte sich nach vorn und sprach eindringlich.
»Sparen Sie sich Ihre Worte. Die anderen können
Sie ohnehin nicht mehr hören. Was ist ein Triplem,
Delgado?«
Der Autor schloß die Augen, lehnte sich auf die

Ellbogen zurück und schien sich resigniert mit sei-
nem Schicksal abzufinden.
»Triplem? Das ist ein mikrominiaturisiertes Mehr-
fachkabel – der feine Draht, den Sie immer von Ihrer
Matratze gerissen haben. Sie konnten es nicht erken-
nen. Es wird erst 1989 entwickelt, wenn ich mich
recht erinnere.«
Einen langen Augenblick herrschte völliges Schwei-
gen. Murray wollte zunächst seinen Ohren nicht
trauen – schließlich machten die Feuerwehrmänner
soviel Lärm, daß man ...
Dann merkte er jedoch, daß alles wunderbar zu-
sammenpaßte. Er hatte richtig gehört, und das Puzz-
lespiel fügte sich vor seinen Augen zu einem logi-
schen Bild zusammen. Das Ende war noch nicht ab-
zusehen, aber Murray wußte jetzt, daß er richtig ver-
mutet hatte.
»Und ... Temporegs?« fragte er langsam. »So haben
Sie sie genannt, nicht wahr?«
»Temporale Regulatoren«, murmelte Delgado. »Ei-
ne Art Polizei. Und wenn sie Valentine erwischen,
hoffe ich nur, daß sie ...«
»Substate?« fragte Murray scharf.
»Unverbesserliche Verbrecher, deren Persönlich-
keit ausgelöscht worden ist, weil sie nicht auf Psycho-
therapie reagierten.«

»Redukes?«
»Umerziehungsbänder, mit deren Hilfe die krimi-
nelle Persönlichkeit durch eine gesellschaftlich an-
nehmbare ersetzt wird.«
»Konzenband?« Murray sah sich nach den übrigen
Zuhörern um; Cromarty und Wadeward hörten sicht-
lich verblüfft zu, aber Heather verfolgte jedes Wort
mit leuchtenden Augen.
»Ein illegal hergestelltes Band, das die Orientie-
rung einer bestimmten Persönlichkeit in eine andere
Richtung ablenken soll.« Delgado brachte seine Ant-
worten in dem mechanischen Tonfall eines Kindes
vor, das ein Gedicht auswendig gelernt, aber nicht
verstanden hat.
»Konditionierer?« Das war der Kasten, mit dem
Valentine ihn bewußtlos geschlagen hatte.
»Ein Gerät zur zeitweiligen absoluten Beeinflus-
sung anderer.«
»Erzeugt dieser ... dieser Konditionierer einen Zu-
stand, der an eine hypnotische Trance erinnert?«
»Es ist eine hypnotische Trance.«
Richtig. Murray holte tief Luft. »Manuel Delgado,
wann sind Sie geboren?«
»Augenblick«, sagte Wadeward und trat einen
Schritt nach vorn, »ich verstehe nicht, was Sie damit
...«
»Ruhe!« verlangte Murray und wiederholte seine

Frage. Dann folgte eine längere Pause. Schließlich
fuhr Delgado sich mit der Zungenspitze über die
Lippen.
»Da ich Ihnen schon soviel erzählt habe – und ich
hoffe sehr, daß es genügt, um Valentine zu sterilisie-
ren und seine Haare ausfallen zu lassen und seine
Haut ...«
»Delgado!«
»Oh ... Ich bin im Jahr zweihundertachtzehn des
Weltkalenders geboren. Nach Ihrer primitiven Rech-
nung wäre das etwa ... äh ... zweitausendvierhundert-
fünfzig.«
Murray nickte langsam. »Jetzt weiß ich auch, was
Sie hier getan haben«, stellte er ruhig fest. »Sie haben
illegal Erlebnisse gesammelt, um sie in die Zukunft
zu schmuggeln.«
Delgado zuckte sichtlich zusammen. »Hören Sie,
ich kann nicht ... ich darf nicht ...«
»Doch, Sie können und müssen sogar«, stellte Mur-
ray fest. »Ich lasse nicht zu, daß Sie durch eine Ma-
sche Ihrer ... temporalen Regulationen schlüpfen. Sie
werden das Loch so sehr vergrößern, daß man mit ei-
nem unserer primitiven Kraftfahrzeuge hindurchfah-
ren könnte. Haben Sie mich verstanden?«
»Aber ich kann nicht!« beteuerte Delgado. »Ich darf
nicht! Ich ...«
Murray beugte sich über ihn, sprach so eindring-

lich wie nur möglich und wußte, daß dies die wich-
tigste Vorstellung seines Lebens war, in der es um
viel mehr als um das Lob der Kritiker und Dutzende
von erfolgreichen Aufführungen ging. »Delgado!«
sagte er laut. »Wenn Sie uns nicht die ganze Wahrheit
sagen, nehme ich Sie auf den Rücken und trage Sie
wieder ins Haus und lasse Sie dort zurück, wo ich Sie
gefunden habe. Sie können sich darauf verlassen, daß
selbst alle Ihre futuristischen Geräte mich nicht davon
abhalten werden!«
Er griff nach Delgados Hemd, raffte es auf der
Brust zusammen und schüttelte kräftig. Aus dem
Augenwinkel heraus beobachtete er, daß Wadeward
den Mund öffnete, als wolle er einen Einwand vor-
bringen; Heather streckte die Hand aus, um ihn zu-
rückzuhalten, und Dr. Cromarty starrte die beiden
Männer fasziniert an, obwohl er offensichtlich nicht
mehr verstand, was sich hier ereignete.
»Aber Sie haben anscheinend noch immer nicht
begriffen!« antwortete Delgado verzweifelt. »Wenn
ich Ihnen mehr erzähle, riskiere ich damit, daß ich be-
straft werde, daß alle möglichen Vergeltungsmaß-
nahmen gegen mich ergriffen werden ...«
»Werden
vielleicht
sogar
Ihre
Erinnerungen
ge-
löscht?«
erkundigte
Murray
sich
verächtlich.
»Um
so
besser,
Delgado!
Eine
gründliche
Säuberung
könnte
Ih-
rem
schmutzigen
Verstand
bestimmt
nicht
schaden!

Aber
die
anderen
sind
nicht
hier,
was?
Und
ich
bin
hier!
Nun,
was
darf's
sein
–
wollen
Sie
reden
oder
lieber
ins
Haus zurückgeschleppt werden, um dort zu braten?«
»Aber wenn ich rede ...« Delgado murmelte etwas
Unverständliches vor sich hin. Dann gab er sich einen
Ruck.
»Was bleibt mir schließlich übrig? Ich habe keine
Hoffnung mehr, nicht wahr? Ich sitze hier fest – der
Teufel soll diesen Valentine holen! – und muß bei
diesen primitiven Idioten bleiben. Wenn ich den
Mund halte, sperren sie mich wahrscheinlich in eines
dieser schrecklichen Irrenhäuser – wie das Mädchen
in Paris. Das könnte ich nicht ertragen, und dies ist
wenigstens ein rascher Ausweg ...«
»Ein rascher Ausweg?« wiederholte Murray und
sah zu Cromarty hinüber. »Doc, sehen Sie lieber nach,
ob er keine Selbstmordpille im Mund hat!«
Dr. Cromarty trat auf ihn zu, aber Delgado winkte
mit einer Handbewegung ab, aus der arrogante Über-
legenheit sprach.
»Gift? Meinen Sie das? Oh, ich weiche nicht so weit
von der Norm ab. Eine Veranlagung zum Selbstmord
wäre schon in meiner Jugend korrigiert worden. Ich
bin kein potentieller Selbstmörder. Ich bin nur ein si-
cherer Todeskandidat.«
Er sah wieder zu Murray auf und lächelte dabei
aus unerfindlichen Gründen.

»Scharfrichter«,
sagte
er
leise.
»Nun,
fragen
Sie
mei-
netwegen.
Aber
ich
kann
nicht
versprechen,
daß
ich al-
le Fragen beantworte.«
»Alle, sonst schleppe ich Sie wie versprochen ins
Haus zurück«, drohte Murray ihm. »Seitdem Sie mir
das alles angetan haben ...«
»Sie wollen nur Ihre Rache«, warf Delgado ihm
vor. »Keine Angst, Sie bekommen bald, was Sie woll-
ten, und ich hoffe nur, daß Sie später noch ruhig
schlafen können, wenn alles vorbei ist. Ihr Primitiven
müßt starke Magennerven haben, um euer normales
Leben auszuhalten, aber wenn das zuviel für euch ist,
habt ihr nicht die gleichen Möglichkeiten, die ich bis-
her bei jeder Rückkehr aus der Vergangenheit gehabt
habe. Sie können schreckliche Erinnerungen nicht
einfach löschen, Douglas – Sie müssen sie aushalten,
nicht wahr?«
»Halten Sie den Mund und reden Sie nur, wenn Sie
gefragt werden«, fuhr Murray ihn an. Sein Gedächt-
nis enthielt zu viele schreckliche Erinnerungen, mit
denen er leben mußte, weil er sie nicht vergessen
konnte.
»Mister Douglas«, warf Cromarty nervös ein, »ich
muß etwas wissen, bevor Sie weiterfragen. Wie steht
es mit den anderen dort drüben? Da ihr Zustand so ...
so ungewöhnlich ...«
»Machen Sie sich ihretwegen keine Sorgen«, ant-

wortete Delgado mit einer wegwerfenden Handbe-
wegung. »Bringen Sie sie in eine Ihrer ›Nervenheilan-
stalten‹ und lassen Sie sie dort aufwachen. Wir haben
bisher nur ihre natürlichen Tendenzen verstärkt. Die
Leute erholen sich in einigen Wochen oder Monaten
wieder davon.« Er warf Murray einen haßerfüllten
Blick zu. »Das verdanken wir alles nur Ihnen!«
Cromarty zögerte noch und zuckte dann mit den
Schultern; er sah zum Tor, als könne er dadurch das
Eintreffen der Krankenwagen beschleunigen.
Delgado hatte wieder den alten Faden aufgenom-
men. »Hier könnte ich es ohnehin nicht aushalten –
was ist also schon dabei? Bei uns ist es schon schlimm
genug, weil es Leute gibt, die dergleichen Dinge pri-
vat genießen wollen, aber hier werden sie als ›Kunst‹
glorifiziert und ...«
»Was?« fragte Murray, ohne eine Antwort zu be-
kommen. Er wartete einige Sekunden lang und fuhr
dann eindringlich fort: »Delgado! Was sind Sie wirk-
lich?«
»Ein ... Augenblick, der richtige Ausdruck fällt mir
gleich ein ... ein Prügelknabe, ein Sündenbock.« Er
war jetzt sehr blaß, und seine blutlosen Lippen be-
wegten sich kaum noch. »Ich hätte nie gedacht, daß
hier jemand die Wahrheit vermuten würde. Wir hät-
ten Sie nicht nehmen dürfen – ich habe Valentine vor
Ihnen gewarnt, aber er wollte nicht auf mich hören.«

»Bleiben Sie bei der Sache«, forderte Murray ihn
auf.
»Ja, richtig ...« Er wurde sichtlich schwächer; seine
Stimme war ein heiseres Flüstern geworden. »Sie
wissen, daß wir imstande sind, in die Vergangenheit
zu reisen; aber dieses Unternehmen ist gefährlich,
unhygienisch und illegal. Und wir haben Methoden
entwickelt, mit denen sich der Verstand und die Per-
sönlichkeit eines Menschen manipulieren lassen.
Manche Leute halten das für einen großen Fortschritt,
andere sind der Meinung, dieses Verfahren sei zu ge-
fährlich, weil die begabtesten Menschen oft charak-
terlich labil sind. Ich weiß nur, daß mir die Idee nie
gefallen hat, mein Verstand könnte offiziell beeinflußt
werden, um dann einer Norm zu entsprechen.«
Delgado machte erschöpft eine Pause; auf seiner
Stirn erschienen große Schweißtropfen. »Man kann
natürlich nicht alle zehn Milliarden Menschen der
Erde auf diese Weise umerziehen; das kommt nur für
Verbrecher und Abweichler in Frage, die sich freiwil-
lig dieser Behandlung unterziehen. Deshalb bleiben
natürlich genügend Leute übrig, die sich öffentlich
normal und privat anomal benehmen. Und die Gerä-
te, die Sie gesehen haben, sind allgemein erhältlich;
sie werden zu Unterhaltungszwecken benützt, und ...
nun, wenn Sie sich beispielsweise von Ihrer Freundin
trennen, können Sie noch ein Band mit gemeinsamen

Erlebnissen herstellen, damit beide ein Andenken ha-
ben.
Aber
manche
Leute
legen
eben
Wert
auf
Erlebnisse,
die
in
unserer
Zeit
nicht
mehr
zugänglich
sind.
Und
Valentine
versuchte
diese
Lücke
zu
füllen,
indem
er
Primitive
in
der
Vergangenheit
für
sich
agieren
ließ.
Er
versuchte
es
mit
verschiedenen
Jahrhunderten,
nach-
dem
er
sich
auf
illegale
Weise
Zugang
zu
einer
Zeitma-
schine
verschafft
hatte,
aber
alle
Versuche
schlugen
fehl – die Bänder waren nicht zu gebrauchen ...«
Delgado fuhr sich mit der Zungenspitze über die
Lippen. Er stöhnte leise, winkte jedoch ab, als Hea-
ther sich ihm nähern wollte.
»Dann habe ich meine große Idee gehabt«, fuhr er
leise fort. »Ich habe Valentine vorgeschlagen, es mit
Schauspielern zu versuchen. Schauspieler sind labil
und leicht zu beeinflussen ... Und es hat geklappt. Er
hat dreimal ein Vermögen damit verdient, dieser
Schweinehund! Alles mit meiner Idee, und er läuft
fort und läßt mich hier zurück, ohne sich darum zu
kümmern, ob ich verbrenne! Schweinehund!«
Diesmal war das Stöhnen lauter und von einer
schmerzverzerrten Grimasse begleitet. Heather fuhr
zusammen. Murray zögerte, weil er nicht wußte, ob
er Delgado in diesem geschwächten Zustand weitere
Fragen stellen durfte. Dann trat Dr. Cromarty plötz-
lich vor und sagte laut:

»Der Mann ist krank!«
Er bückte sich und schlug die Wolldecke zur Seite,
in die Delgado eingewickelt gewesen war. Nun sahen
sie alle, wie Delgado dafür bestraft worden war, weil
er die Wahrheit gesagt hatte, obwohl er hätte schwei-
gen müssen. Und sie sahen, weshalb er zuvor be-
hauptet hatte, sie würden starke Magennerven brau-
chen.
Durch irgendeine teuflische Konditionierung,
durch irgendeine psychomatische Technik der Zu-
kunft, die sich keiner von ihnen erklären konnte, war
sein Körper verfault, während Delgado Sprach. Unter
der Decke hatte sein Körper sich von den Zehen bis
zum Hals in eine widerliche schleimige Masse ver-
wandelt.
In der Ferne heulten die Sirenen der Krankenwa-
gen wie Höllengelächter.

25
Heathers Hand umklammerte Murrays Arm so fest,
daß der Griff schmerzte, und sie rang nach Atem, als
müsse sie sich mit letzter Kraft beherrschen, um sich
nicht zu übergeben. Wadeward starrte wie betäubt zu
Boden, und selbst Cromarty, der in seiner Arztpraxis
schon einiges gesehen haben mußte, schien sich
überwinden zu müssen, bevor er nach der Decke griff
und sie über Delgado breitete.
Dann kamen die Krankenwagen an, und Cromarty
und Wadeward ließen sich gern ablenken. Murray
hatte weniger Glück. Er stand noch immer an der
gleichen Stelle, spürte Heathers Gewicht an seinem
Arm und konzentrierte sich darauf, nicht zusammen-
zusacken. Als er die Augen nach unendlich langer
Zeit wieder öffnete, sah er Cromarty vor sich, der
eben Delgados Überreste fortschaffen ließ.
»Mister Douglas, Sie zittern vor Kälte – und das ist
kein Wunder!« rief Wadeward aus, der inzwischen
wieder herausgekommen war. »Mann, Sie sind prak-
tisch nackt! Los, bringen Sie ihm einen Mantel, Ro-
berts!«
Nicht so laut, das tut mir in den Ohren weh. Aber
Murray konnte nicht sprechen.
»Doktor, ist noch Platz in einem der Wagen?«

»Die verdammten Kerle haben uns nur drei ge-
schickt!« Cromarty fuhr sich mit allen zehn Fingern
durchs Haar. »Aber ich nehme Mister Douglas mit zu
mir nach Hause. Bei mir ist ein Bett frei, und ich muß
seine Verbrennungen ohnehin noch versorgen.« Er
sah zu Heather hinüber. »Und was wird aus Ihnen,
junge Frau? Am besten kommen Sie gleich mit uns.
Mein Wagen steht vorn am Tor.«
Murray
ließ
sich
von
einem
Polizisten,
den
Wade-
ward
herangerufen
hatte,
einen
warmen
Mantel
geben.
Er
konnte
nicht
mehr
allein
gehen
und
mußte
sich
auf
den
Weg
zu
Cromartys
Wagen
stützen
lassen.
Dann
sank
er
erleichtert
auf
dem
Rücksitz
zusammen.
Hea-
ther saß neben ihn und hielt seine Hand.
Als sie abfuhren, sah Murray, daß die Feuerwehr-
männer sich darauf konzentrierten, das Hauptgebäu-
de zu retten. Der Seitenflügel würde wahrscheinlich
noch einige Stunden lang brennen, aber das Feuer
konnte nicht mehr übergreifen.
Hoffentlich sind sie gut versichert, sonst kann Sam Bliz-
zard den Konkurs anmelden ...
Murray fiel etwas anderes ein, und er beugte sich
vor, um zu sagen: »Doktor Cromarty, wahrscheinlich
bekommen Sie morgen Besuch von meinem Agenten
Roger Grady. Ich habe ihm gestern am Telefon er-
zählt, ich würde zu fliehen versuchen und dann zu
Ihnen kommen.«

Erst gestern abend? Großer Gott, wie kurz kann eine
Ewigkeit sein?
»Sie
wollten
fliehen?«
wiederholte
der
Arzt
erstaunt.
»Menschenskind,
wer
Ihnen
zuhört,
muß
glauben,
Sie
hätten in einem Konzentrationslager gesessen!«
»Es war nicht viel besser«, stellte Heather fest.
»Haben Sie nicht gehört, was Murray Ihnen erklärt
hat?«
»Ich kann es kaum glauben«, gab Dr. Cromarty zu.
»Das betrifft Sie nicht persönlich, Mister Douglas,
aber Sie sind nervös überreizt und ...« Er sprach nicht
weiter. »Nein, nein! Ich glaube jetzt jedes Wort, seit-
dem ich diese unerklärliche Auflösung gesehen habe.
Sie erinnert an eine Geschichte von Poe, nicht wahr?«
»Monsieur Valdemar«, warf Heather ein. Murray
spürte, daß ihre Hand zitterte. »Er war hypnotisiert
worden, nicht wahr? Doktor, besteht etwa die Gefahr,
daß die anderen alle ...?«
»Delgado hat selbst gesagt, daß sie auf natürliche
Weise erwachen und sich innerhalb weniger Wochen
oder Monate erholen werden«, antwortete Murray
und legte ihr beruhigend einen Arm um die Schul-
tern.
»Aber ich habe auch gehört, daß er behauptet hat,
er sei irgendwann im nächsten Jahrtausend geboren.«
Heather schüttelte den Kopf. »Er war verrückt, fin-
dest du nicht auch?«

»Nein, er muß die Wahrheit gesagt haben«, erklärte
Murray ihr, »denn sonst gäbe es keine vernünftige
Erklärung für unsere Erlebnisse – und für seine Auf-
lösung.«
»O Gott, das war einfach schrecklich!« rief Heather
aus.
»Ich kann mir vorstellen, was für ein Schock das
für Sie war, junge Frau«, stellte Dr. Cromarty fest.
»Seien Sie unbesorgt, ich gebe Ihnen nachher etwas,
damit Sie schlafen können. Wir sind bald bei mir zu
Hause.« Er wandte sich an Murray.
»Mister Douglas, Sie scheinen sich eine Erklärung
für alles zurechtgelegt zu haben – wer war er also?«
Murray
seufzte
leise.
Morgen
früh
würde
ihm
diese
Nacht
wie
ein
Alptraum
vorkommen.
In
Zukunft
wür-
de
er
seine
Erinnerungen
nicht
mehr
beweisen
können,
weil alle Beweise verbrannt und verglüht waren.
»Ich kann Ihnen nur sagen, was ich selbst vermute,
seitdem ich Delgados Antwort gehört habe«, begann
er. »Irgendwann in der Zukunft – im fünfundzwan-
zigsten Jahrhundert – hat die Wissenschaft solche
Fortschritte gemacht, daß es möglich ist, Zeitreisen zu
unternehmen und die menschliche Persönlichkeit zu
verändern. Dazu wird eine Triplem-Antenne benützt,
die auf unseren Matratzen angebracht war. Um die il-
legalen Wünsche einiger Perverser zu erfüllen, hat
Valentine es übernommen, zahlungskräftigen Kun-

den Bänder mit primitiven Erlebnissen zu liefern.
Diese Kunden müssen gut gezahlt haben, denn Va-
lentine hat offenbar ein Vermögen damit verdient,
nachdem Delgado ihn auf die Idee gebracht hatte, für
seine Zwecke Schauspieler zu verwenden, die leicht
beeinflußbar waren.
Um ihre begrenzten Möglichkeiten besser auszu-
nützen, haben sie labile Menschen absichtlich dazu
gebracht, sich gegenseitig auf die Nerven zu fallen.
Auf diese Weise waren die Gefühlsreaktionen, die sie
auf Band nehmen konnten, erheblich intensiver und
klarer. Hätte ich nicht rechtzeitig etwas dagegen un-
ternommen, wäre ich als hoffnungsloser Alkoholiker
in ihrer Sammlung von ›Erlebnissen‹ aufgetaucht ...«
»Und ich als Lesbierin«, stellte Heather fest. »Das
erschreckt mich noch nachträglich, Murray! Der Im-
puls war mehrmals auf meinem Band, das haben Va-
lentine und Delgado selbst zugegeben, und wenn du
mich nicht gewarnt hättest, wäre ich nie auf die Idee
gekommen, den Draht jeden Abend durchzuschnei-
den. Dann hätte ich mich von Ida verführen lassen,
und später hätte irgend jemand, der noch nicht ein-
mal geboren ist, sich dieses ... dieses Erlebnis ...«
»Nur keine Übertreibung!« warf Dr. Cromarty ein
und versuchte beruhigend zu lächeln, was ihm je-
doch mißlang. »Der Versuch hätte schließlich fehl-
schlagen können, junge Frau!«

»Aber er wäre gelungen«, versicherte sie ihm. »Sie
als Arzt wissen selbst am besten, daß etwas davon in
jedem Menschen steckt. Es liegt unter der Oberfläche
und wartet nur auf eine Gelegenheit, um ...«
Zunehmende Hysterie, stellte Murray fest. Er frag-
te sich, ob ein paar Ohrfeigen helfen würden, falls
Heather noch erregter wurde. Aber in diesem Au-
genblick bremste Dr. Cromarty bereits, und vor ihnen
tauchte sein Haus aus der Dunkelheit auf. An einem
Fenster im ersten Stock bewegte sich der Vorhang.
Die Lampe über der Haustür wurde eingeschaltet,
dann erschien Cromartys Haushälterin auf der
Schwelle.
Sie schlug besorgt die Hände über dem Kopf zu-
sammen, als sie Heathers Zustand sah, und führte sie
fort, um ihr das Bad und ihr Bett zu zeigen. Dr. Cro-
marty brachte Murray einen warmen Schlafrock, be-
vor er sich daran machte, die Verbrennungen an bei-
den Füßen zu behandeln. Er arbeitete schweigend
und stellte die entscheidende Frage erst, als die
Brandwunden versorgt waren.
»Mister Douglas, glauben Sie wirklich, was dieser
Delgado gesagt hat?«
»Fragen Sie mich morgen danach«, bat Murray
müde.
»Ja, natürlich.« Cromarty machte eine entschuldi-
gende Handbewegung. »Tut mir leid, ich hätte Sie

längst ins Bett schicken sollen. Meine Haushälterin
hat das für Sie vorgesehene Bett wahrscheinlich der
jungen Dame gegeben, aber wir finden bestimmt et-
was anderes für Sie ... Mrs. Garbett!«

26
Ein schrilles Klingeln. Murray schrak auf, dachte an
das Telefon auf seinem Nachttisch und bildete sich
ein, Valentine rufe an, um ihm zu sagen, das Früh-
stück werde zwischen acht und neun Uhr serviert. Er
richtete sich auf, bevor ihm klar wurde, daß das alles
vorbei war.
Murray blieb auf der Bettkante ... nein, auf dem
Rand der großen Couch in Dr. Cromartys Wohnzim-
mer sitzen. Draußen schien die Sonne. Er sah auf sei-
ne Uhr und stellte fest, daß sie um zwanzig nach eins
stehengeblieben war. Dann hielt er sie sich ans Ohr
und merkte, daß sie noch tickte.
Sie geht noch. Folglich ...
Jemand klopfte an die Tür. Mrs. Garbett erschien
lächelnd. »Er ist aufgewacht, Doktor«, rief sie über
die Schulter. Dann sagte sie zu Murray: »Guten Mor-
gen, Mister Douglas – oder vielmehr guten Nachmit-
tag. Doktor Cromarty wollte Sie vor allem ausschla-
fen lassen.«
»Ich ... oh, dann ist es also zwanzig nach eins.«
Murray rieb sich die Augen. »Tut mir leid, wenn ich
Ihnen Umstände gemacht habe.«
»Umstände? Gott segne Sie, Sir, nach allen Ihren
Erlebnissen gestern abend ... Es steht in der Zeitung,

und ich habe den Artikel zweimal gelesen. Sie haben
alles verdient, was wir für Sie tun können. Draußen
wartet Besuch für Sie, sonst hätte ich Sie noch nicht
gestört.«
Besuch? Dann bin ich also von der Türklingel aufge-
wacht.
Murray lächelte zufrieden, als er zu diesem logi-
schen Schluß gelangt war. Bevor er fragen konnte,
was bereits in den Zeitungen gestanden habe, trat
Mrs. Garbett zur Seite und ließ den Besucher eintre-
ten. Roger Grady eilte besorgt auf Murray zu.
»Großer Gott, Murray, bin ich froh, dich gesund
wiederzusehen! Als ich beim Frühstück die letzten
Nachrichten gehört habe, bin ich sofort aufgebrochen.
Kannst du mir je verzeihen, daß ich unser Telefonge-
spräch von gestern abend nicht gleich ernst genom-
men habe?«
»Augenblick«, sagte Murray langsam. »Welche
Nachrichten hast du gehört?«
»Daß Fieldfare House abgebrannt ist, und daß du
die Leute gerettet hast!« Jetzt machte Roger ein er-
stauntes Gesicht.
»Aber wie ist das in die Zeitungen gekommen? Es
war doch so spät, daß ...«
»Nicht zu spät für die Londoner Ausgaben, die
mindestens bis hierher geliefert werden. Jemand hät-
te dir sagen können ... oh, du hast natürlich den gan-

zen Morgen verschlafen. Nachdem ich die Meldung
im Radio gehört und mit Sam gesprochen hatte ...«
»Was hast du?« Murray hob abwehrend die Hand.
»Du bist zu schnell für mich. Mein Gott – Sam! Was
tun Sie hier? Sie gehören doch eigentlich ins Kran-
kenhaus!«
»Mir fehlt aber nichts«, stellte Blizzard fest. Er hatte
schweigend an der Tür gewartet, bis Murray auf ihn
aufmerksam wurde. »Nachdem ich gehört hatte, was
letzte Nacht passiert war, habe ich alle gewarnt, daß
sich jeder ein blaues Auge holen würde, der mich
daran zu hindern versuchte, selbst zu Ihnen zu
kommen und Ihnen zu danken.«
»Sam hat mich angerufen, um herauszubekommen,
wohin du verschwunden sein könntest«, erklärte Ro-
ger Murray. »Im Krankenhaus wußte niemand etwas
von dir – das war vielleicht noch dein Glück, weil du
auf diese Weise von Reportern verschont geblieben
bist. Ja, Mrs. Garbett?«
»Hier steht alles, Sir«, sagte Mrs. Garbett und zeig-
te ihm die Morgenzeitung. »›Schauspieler als Lebens-
retter. Heute nacht gegen zwei Uhr brach im Fieldfare
House, Bakesford, wo ein Ensemble unter Delgado
ein neues Stück einstudierte, ein Großfeuer aus. Nur
Murray Douglas, der bekannte Schauspieler, war um
diese Zeit wach; er schlug Alarm und brachte die üb-
rigen Mitglieder des Ensembles, die bereits Rauch-

vergiftungen erlitten hatten, nacheinander in Sicher-
heit. Drei Feuerwehren aus der näheren Umgebung
bekämpften den Brand.‹«
»Hat schon jemand behauptet, das sei nur ein von
Delgado inszenierter Gag?« erkundigte Murray sich
nach einer Pause.
»Ja«, antwortete Roger verlegen. »Du weißt be-
stimmt selbst, wer es war.«
»Tut der Kinnhaken noch weh?«
»Offenbar.«
»Aber ich sorge dafür, daß er seine Lügen nicht
weiter verbreiten kann!« warf Blizzard erregt ein.
»Ich besuche heute nachmittag den Herausgeber der
Gazette, und wenn Burnett sich morgen nicht öffent-
lich in seiner Kolumne entschuldigt, sorge ich dafür,
daß er in jedem Londoner Theater Hausverbot be-
kommt. Darauf kann er Gift nehmen!«
Der Produzent wandte sich an Murray und sprach
leiser. »Ich bin Ihnen nicht nur Dank schuldig, Mur-
ray – ich muß mich auch bei Ihnen in aller Form ent-
schuldigen. Vorläufig weiß ich noch nicht, was Del-
gado eigentlich vorhatte, aber jedenfalls steht fest,
daß nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist.
Wir sollen alle sanft und selig geschlafen haben, wäh-
rend das Haus in Flammen stand? Unmöglich! Das
kann ich nicht glauben. Ich bin weder im Kranken-
wagen noch beim Ausladen aufgewacht. Wir haben

alle wie tot geschlafen. Und ohne Sie wären wir tot
gewesen. Ich habe mich von Delgado täuschen lassen,
daran ist nichts zu ändern!«
»Der Mann war ein Genie. Seine Bänder haben ihm
dazu verholfen.«
»Was?« fragte Blizzard verständnislos.
»Lassen wir das«, wehrte Murray ab. »Ich möchte
jetzt vor allem frühstücken und irgendwo halbwegs
passende Kleidungsstücke auftreiben ...«
»Ich hole dir einen Anzug.« Roger stand auf. »Ich
habe alles mitgebracht, kann aber nicht garantieren,
daß die Schuhe passen.«
Er verschwand, aber Blizzard ließ sich nicht von
seinem Thema abbringen. »Murray, Sie dürfen mich
jetzt nicht im Stich lassen. Wir haben viel Arbeit und
Geld in dieses Theaterstück gesteckt, und ich will es
auch ohne Delgado zu Ende bringen. Mit seiner
Hypnopädie und seinen verdammten Geräten kann
er mir gestohlen bleiben.«
»Seien Sie lieber froh, daß alles so glimpflich abge-
gangen ist«, riet Murray ihm. »Noch einige Wochen
dieser Art, dann hätten Sie ein Stück gehabt, im Ver-
gleich zu dem Marat/Sade ein harmloses Kindermär-
chen wäre.«
»Aber ich bringe das Stück in London heraus«, ver-
sicherte Blizzard ihm. »Wir haben natürlich das Thea-
ter verloren, aber dafür muß die Versicherung auf-

kommen, und wir beide können das Stück und die
Dialoge rekonstruieren. Vielleicht führen wir es zu-
erst in der Provinz auf, bis wir bestimmt wissen, daß
in London nichts schiefgehen kann.«
»Ist das Ihr Ernst?« fragte Murray.
»Soll ich etwa das gute Geld zum Fenster hinaus-
werfen?« rief Blizzard laut.
»Denken Sie dann auch an Heather? Sie wissen
doch, warum Delgado sie im Ensemble haben wollte,
nicht wahr?«
»Das ist mir heute morgen klar geworden«, gab
Blizzard zu. »Sie sollte ... äh ... nur Ida amüsieren.«
»Richtig.« Murray nickte nachdrücklich. »Nun, in
der neuen Produktion bekommt sie eine Rolle, selbst
wenn ich eine für sie schreiben müßte.«
»Darum wollte ich Sie bereits bitten«, sagte Bliz-
zard. »Schließlich verdanken wir Ihnen fast die Hälfte
aller Einfälle, und ...«
Aber Murray hörte nicht mehr zu. Er hatte Dr.
Cromartys Schlafrock angezogen, ging in die Diele
hinaus und achtete nicht auf Roger, der mit einem
Anzug über dem Arm hereinkam. »Mrs. Garbett!
Mrs. Garbett! Wo haben Sie Heather untergebracht?«
»Im Zimmer rechts oben an der Treppe, Mister
Douglas«, antwortete die Haushälterin. »Ich weiß
nicht, ob sie schon wach ist, aber ich wollte ihr eben
eine Tasse Tee bringen und ...«

Sie erschien mit einem Tablett, auf dem zwei Tas-
sen standen. Murray nahm es ihr grinsend ab und
humpelte die Treppe hinauf. Seine Füße schmerzten,
aber diese Schmerzen gehörten noch zur Vergangen-
heit, und er war in die Zukunft unterwegs.
Würde sie ihnen allen tatsächlich bringen, was
Delgado angedeutet hatte? Nun, das spielte jetzt kei-
ne Rolle. Murray war dem Schicksal dafür dankbar,
daß es ihm eine neue Chance gegeben hatte. Er mußte
sich erst an diese Idee gewöhnen, aber die Vorstel-
lung gefiel ihn. Er klopfte an die Tür, die Mrs. Garbett
ihm bezeichnet hatte, betrat das Zimmer und schloß
die Tür hinter sich.
Document Outline
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Brunner John Judasz (opowiadanie)
Brunner John Telepata
Brunner John Człowiek który lubił złe filmy
Brunner John Faktograf nr 6 (opowiadanie)
Brunner, John The Pronounced Effect
Brunner, John Huntingtower(1)
Brunner, John Zarathustra 3 Repairmen of Cyclops
Brunner, John Die Dramaturgisten von Yan
Brunner, John El Mensaje de los Astros
Brunner, John The Iron Jackass
28 Auszug aus der Geburtsurkunde
Antiquus 026 Wahre Faelle aus der Uni
Klavierstück aus der Bonner Beethoven Kantate, S 507 (Liszt, Franz)
Brunner, John The Pronounced Effect
Jünger, Ernst Technik In Der Zukunftsschlacht (Militaer Wochenblatt, 1921)
Brunner John Zbiór opowiadań
Brunner John Urodzony pod Marsem
więcej podobnych podstron