
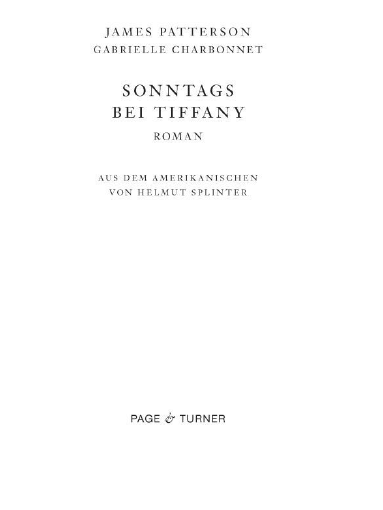
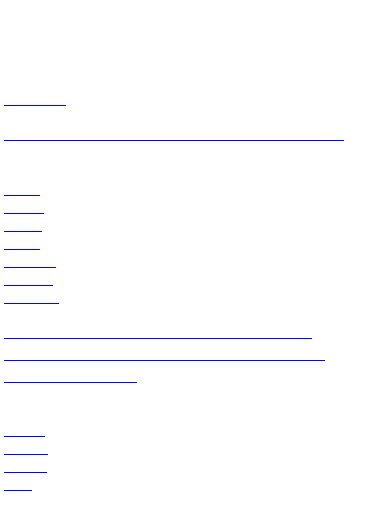
Inhaltsverzeichnis
Â
Â
TEIL EINS – Es war einmal in New York
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÃœNF
SECHS
SIEBEN
Â
TEIL ZWEI – Dreiundzwanzig Jahre
älter, aber nicht unbedingt in gleichem
Maße klüger
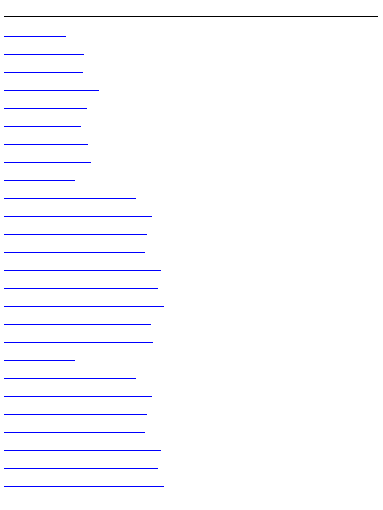
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÃœNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZW EIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
FÃœNFUNDZWANZIG
SECHSUNDZWANZIG
SIEBENUNDZWANZIG
ACHTUNDZWANZIG
NEUNUNDZWANZIG
DREISSIG
EINUNDDREISSIG
ZW EIUNDDREISSIG
DREIUNDDREISSIG
VIERUNDDREISSIG
FÃœNFUNDDREISSIG
SECHSUNDDREISSIG
SIEBENUNDDREISSIG
4/346
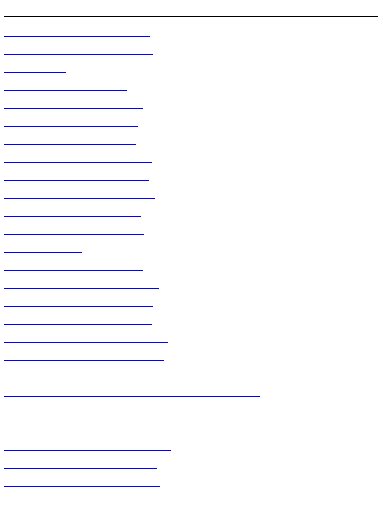
ACHTUNDDREISSIG
NEUNUNDDREISSIG
VIERZIG
EINUNDVIERZIG
ZW EIUNDVIERZIG
DREIUNDVIERZIG
VIERUNDVIERZIG
FÃœNFUNDVIERZIG
SECHSUNDVIERZIG
SIEBENUNDVIERZIG
ACHTUNDVIERZIG
NEUNUNDVIERZIG
FÃœNFZIG
EINUNDFÃœNFZIG
ZW EIUNDFÃœNFZIG
DREIUNDFÃœNFZIG
VIERUNDFÃœNFZIG
FÃœNFUNDFÃœNFZIG
SECHSUNDFÃœNFZIG
Â
SIEBENUNDFÃœNFZIG
ACHTUNDFÃœNFZIG
NEUNUNDFÃœNFZIG
5/346
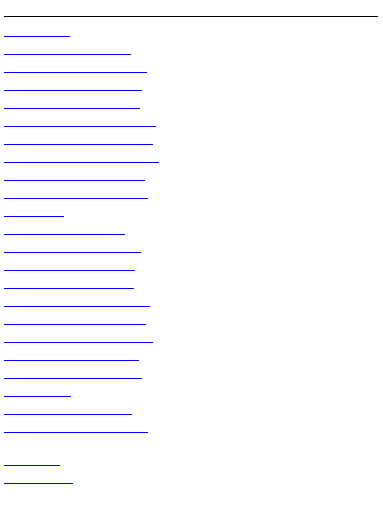
SECHZIG
EINUNDSECHZIG
ZW EIUNDSECHZIG
DREIUNDSECHZIG
VIERUNDSECHZIG
FÃœNFUNDSECHZIG
SECHSUNDSECHZIG
SIEBENUNDSECHZIG
ACHTUNDSECHZIG
NEUNUNDSECHZIG
SIEBZIG
EINUNDSIEBZIG
ZW EIUNDSIEBZIG
DREIUNDSIEBZIG
VIERUNDSIEBZIG
FÃœNFUNDSIEBZIG
SECHSUNDSIEBZIG
SIEBENUNDSIEBZIG
ACHTUNDSIEBZIG
NEUNUNDSIEBZIG
ACHTZIG
EINUNDACHTZIG
ZW EIUNDACHTZIG
Â
6/346

Die Originalausgabe erschien 2008
unter dem Titel »Sundays at Tiffany’s« bei
Little, Brown und Company,
Hachette Book Group USA, New York.

Als mein Sohn Jack vier Jahre alt war, musste ich
nach Los Angeles verreisen. Ich fragte ihn, ob er
mich vermissen werde. »Nicht so richtig«, ant-
wortete er. »Du wirst mich nicht vermissen?«,
vergewisserte ich mich. Jack schüttelte den Kopf.
»Liebe heißt, nichts kann zwei Menschen
trennen«, erklärte er. Ich glaube, dies ist der
Kern dieser Geschichte, in der es um den festen
Glauben daran geht, dass im Leben nichts wichtiger
ist, als zu lieben und geliebt zu werden. Zumindest
meiner Erfahrung nach.
Deswegen ist diese Geschichte Dir, Jack, meinem
klugen Sohn, mit viel Liebe gewidmet. Und Suzie
– deiner Mutter, meiner besten Freundin und
Frau in einer Person.
Und
Richard
DiLallo,
der
an
einem
entscheidenden Punkt bei der Entwicklung der
Geschichte eine große Hilfe war.
Â
J. P.

PROLOG
Janes Michael
Michael rannte, so schnell er konnte, die Straßen
entlang – vorbei am Verkehrsstau – zum New
York Hospital, wo Jane im Sterben lag, als er
plötzlich von einer Szene aus seiner Vergangenheit
verfolgt wurde, von einer wirren Abfolge über-
wältigender Erinnerungen, die ihn beinahe aus
seinen Turnschuhen rissen. Er erinnerte sich, wie er
mit Jane im Astor Court des St. Regis Hotel unter
kaum vorstellbaren Umständen gesessen hatte.
Er erinnerte sich an alles – an Janes
Früchtebecher mit Kaffeeeis und heißer Kara-
mellsoße, an das, worüber sie gesprochen hat-
ten -, als wäre es gestern gewesen. Die ganze
Geschichte war kaum vorstellbar. Nein, nicht nur
kaum, sondern alles andere als vorstellbar.
Wieder eines dieser unbegreiflichen Geheimnisse
des Lebens, dachte Michael, während er noch ein-
en Zahn zulegte.
Wie die Tatsache, dass Jane ihm jetzt nach allem,
was sie gemeinsam durchgemacht hatten, wegstarb.
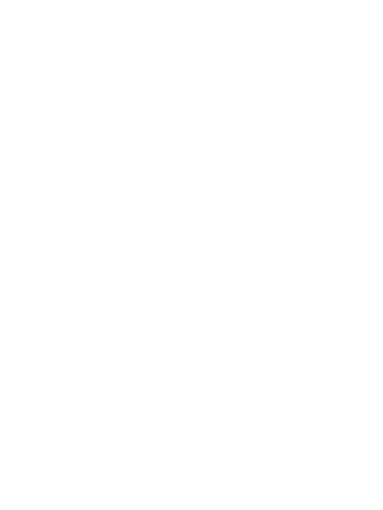
TEIL EINS
Es war einmal in New York

EINS
Jede Kleinigkeit dieser Sonntagnachmittage ist in
mein Gedächtnis eingebrannt, doch statt bei der
Sache mit mir und Michael gleich auf den Punkt zu
kommen, werde ich mit dem weltbesten, leckersten
und vielleicht sündigsten Eisbecher beginnen,
der im St. Regis Hotel in New York City serviert
wird.
Ich nahm immer das Gleiche: zwei faustgroße
Kugeln Kaffeeeis, verwirbelt mit einem Strang
heißer Karamellsoße, die dicker, klebriger und
zäher wird, wenn sie die Eiscreme berührt. Da-
rauf kam echte Sahne. Selbst im Alter von acht
Jahren kannte ich den Unterschied zwischen echter
Schlagsahne und dem gefälschten Nichtmilch-
produkt aus der Sprühdose.
Auf der anderen Seite meines Tisches im Astor
Court saß Michael, unanfechtbar der hüb-
scheste Mann, den ich kannte oder, ich korrigiere,
bis dahin kennengelernt hatte. Und der netteste,
freundlichste und vielleicht klügste Mensch.
An jenem Tag beobachtete er mich mit seinen
leuchtend grünen Augen, als ich mit unver-
hohlener Freude dem Kellner in weißer Livree

entgegenblickte, der den Eisbecher mit quälender
Langsamkeit vor mich stellte.
Michael bekam eine Schale mit Melonenkugeln
und Zitronensorbet. Seine Fähigkeit, den Freuden
eines Früchteeisbechers zu widerstehen, konnte
mein kindliches Gehirn noch nicht begreifen.
»Vielen Dank«, sagte Michael, der seine Liste
beneidenswerter Eigenschaften durch ein hohes
Maß an Höflichkeit ergänzte.
Woraufhin der Kellner … nichts erwiderte.
In den Astor Court ging man, wenn man im St.
Regis Hotel ein schickes Dessert haben wollte. An
diesem Nachmittag saßen hier wichtig aussehende
Menschen, die wichtig wirkende Gespräche
führten. Im Hintergrund spielten zwei Geiger auf
Symphonieorchesterniveau, als wären sie im Lin-
coln Center.
»Okay«, sagte Michael schließlich. »Zeit,
mit dem Jane-und-Michael-Spiel zu beginnen.«
Mit strahlenden Augen klatschte ich in die
Hände.
Das Spiel funktionierte so: Einer von uns deutete
auf einen Tisch, der andere musste sich überle-
gen, um was für Leute es sich handeln könnte.
Der Verlierer bezahlte das Dessert.
12/346

»Und los!« Michael streckte den Finger in
Richtung
dreier
junger
Mädchen
in
fast
identischen hellgelben Leinenkleidern.
Ohne zu zögern sagte ich: »Debütantinnen.
Erste Saison. Gerade den Abschluss an der High
School gemacht. Vielleicht in Connecticut. Vielleicht
– wahrscheinlich – Greenwich.«
Michael legte den Kopf in den Nacken und lachte.
»Du hast eindeutig zu viel Zeit mit Erwachsenen
verbracht. Aber sehr gut, Jane. Ein Punkt für
dich.«
»Also gut.« Ich deutete auf einen anderen
Tisch. »Dieses Paar da drüben. Das aussieht wie
die Cleavers in Leave it to the Beaver. Erzähl mir
ihre Geschichte.«
Der Mann trug einen graublau karierten Anzug,
die Frau eine leuchtend rosa Jacke mit grünem
Faltenrock.
»Ehepaar aus Nord-Carolina«, ratterte Mi-
chael sogleich los. »Wohlhabend, Inhaber einer
Tabakladenkette. Er ist geschäftlich hier. Sie beg-
leitet ihn, um einen Einkaufsbummel zu machen.
Jetzt erzählt er ihr, dass er die Scheidung ein-
reichen will.«
»Oh.« Ich blickte auf den Tisch hinab und
stieß kräftig die Luft aus, während ich den
13/346

Löffel in meinen Eisbecher tauchte und ihn mir
dann in den Mund schob. »Ja, anscheinend lassen
sich alle Paare scheiden.«
Michael biss sich auf die Lippen. »Ach nein,
warte, Jane. Ich habe Unrecht. Er bittet sie nicht
um die Scheidung. Er sagt ihr, er hat eine Ãœber-
raschung – er hat eine Kreuzfahrt geplant. Auf
der Queen Elizabeth II. nach Europa. Es sind ihre
zweiten Flitterwochen.«
»Klingt schon besser.« Ich lächelte. »Ein
Punkt für dich. Hervorragend.«
Ich senkte den Kopf und bemerkte, dass mein
Früchteeisbecher irgendwie fast verschwunden
war. Wie immer.
Michael blickte sich theatralisch im Restaurant
um. »Da sind welche, die errätst du nie«, sagte
er.
Er zeigte auf einen Mann und eine Frau nur zwei
Tische entfernt.
Ich blickte hinüber.
Die Frau war etwa vierzig Jahre alt, gut gekleidet
und atemberaubend hübsch. Man hätte sie
für eine Filmschauspielerin halten können. Sie
trug ein leuchtend rotes Designerkleid und
passende Schuhe zu ihrer großen, schwarzen
Handtasche. Alles an ihr sagte: Seht mich an!
14/346

Der Mann, mit dem sie am Tisch saß, war
jünger, blass und sehr dünn. Er trug einen
blauen Blazer, dazu einen gemusterten Seiden-
Plastron, den man sich noch nicht einmal früher
umgebunden hätte. Beim Sprechen gestikulierte
er kräftig mit den Händen.
»Das ist nicht lustig«, beschwerte ich mich,
musste aber trotzdem grinsen und die Augen
verdrehen.
Weil die beiden meine Mutter, Vivienne Margaux,
die berühmte Broadway-Produzentin, und der
diesjährige Promi-Friseur, Jason, waren. Jason,
die Gewächshauspflanze, die keine Zeit für ein-
en Nachnamen hatte.
Wieder blickte ich zu ihnen hinüber. Eines war
sicher: Mama hätte angesichts ihrer Schönheit
selbst Schauspielerin sein können. Als ich sie ein-
mal gefragt hatte, warum sie keine geworden war,
hatte sie geantwortet: »Schätzchen, ich will nicht
nur auf dem Zug mitfahren, ich will ihn lenken.«
Jeden Sonntagnachmittag, wenn Michael und ich
im St. Regis beim Dessert saßen, nahmen auch
meine Mutter und einer ihrer Freunde ihren Kaffee
und ihr Dessert dort ein. Somit konnte sie tratschen
oder sich beschweren oder Geschäfte abwickeln,
15/346

mich aber trotzdem im Auge behalten, ohne direkt
bei mir sein zu müssen.
Nach dem St. Regis ließen wir unsere Sonntage
bei Tiffany ausklingen.
Meine Mutter liebte Diamanten, trug sie über-
all, sammelte sie wie andere ihre Kristalleinhörner
oder seltsame japanische Katzen aus Keramik mit
einer hochgehobenen Pfote.
Natürlich fanden diese Sonntage meine Zus-
timmung, weil Michael dabei war. Michael, der
mein bester Freund auf der Welt war, vielleicht der
einzige, den ich als Achtjährige hatte.
Mein imaginärer Freund.
16/346

ZWEI
Ich rückte näher zu Michael. »Soll ich dir was
sagen?«, fragte ich. »Das ist echt der Ham-
mer.«
»Was?«, wollte er wissen.
»Ich glaube, ich weiß, worüber meine Mut-
ter und Jason reden. Ãœber Howard. Ich glaube,
Vivienne hat ihn satt. Aus Alt mach Neu.«
Howard war mein Stiefvater und der dritte Ehem-
ann meiner Mutter. Jedenfalls der dritte, von dem
ich wusste.
Ihr erster Mann war Tennisprofi aus Palm Beach.
Er hatte ein Jahr lang gehalten.
Dann war Kenneth gekommen, mein Vater. Er
hatte sich besser angestellt als der Tennisprofi –
und drei Jahre lang ausgehalten. Er war echt
süß, und ich liebte ihn, doch er war geschäft-
lich viel auf Reisen. Manchmal hatte ich das Ge-
fühl, er hatte mich vergessen. Einmal hatte ich
gehört, wie meine Mutter zu Jason sagte, Kenneth
habe kein Rückgrat. Sie wusste nicht, dass ich
gelauscht hatte. Sie hatte gesagt: »Er ist ein gut
aussehender Waschlappen, der es nie zu was bring-
en wird.«

Howard war schon zwei Jahre dabei. Er machte
nie Geschäftsreisen, und seine Arbeit schien aus-
schließlich darin zu bestehen, Vivienne zu helfen.
Er massierte ihre Füße, wenn sie müde war,
kontrollierte, ob ihr Essen auch wirklich kein Salz
enthielt, und stellte sicher, dass unser Fahrer samt
Wagen rechtzeitig zur Stelle war.
»Wie kommst du darauf?«, fragte Michael.
»Kleinigkeiten«, antwortete ich. »Vivienne
hat ihm immer Sachen gekauft. Schicke Slipper von
Paul Stuart und Krawatten von Bergdorf Goodman.
Aber jetzt hat sie ihm schon eine Ewigkeit nichts
mehr geschenkt. Und gestern Abend hat sie zu
Hause gegessen. Allein. Mit mir. Howard war nicht
zu Hause.«
»Wo war er?«, bohrte Michael nach, den Blick
voller Mitgefühl und Sorge.
»Ich weiß nicht. Als ich Vivienne gefragt habe,
hat sie nur gesagt: ›Wer weiß das schon, und
wen kümmert das?‹« Ich hatte die Stimme
meiner Mutter nachgeahmt und schüttelte den
Kopf. »Okay«, fuhr ich fort. »Neues Thema.
Rate mal, was Dienstag für ein Tag ist.«
Michael tippte sich ein paar Mal ans Kinn.
»Keine Ahnung.«
18/346

»Komm schon, du weißt das ganz genau, Mi-
chael. Das ist nicht lustig.«
»Valentinstag?«
»Hör auf!«, schimpfte ich und trat ihn vor-
sichtig unter dem Tisch. Er grinste nur. »Du
weißt ganz genau, was am Dienstag ist. Es ist mein
Geburtstag.«
»Ach ja. Puh, du wirst alt, Jane.«
Ich nickte. »Ich denke, meine Mutter gibt eine
Party für mich.«
»Hm«, machte Michael.
»Na ja, eigentlich ist mir die Party ziemlich egal.
Ich hätte viel lieber einen richtigen eigenen
Hund.«
Michael nickte.
»Cat hat deine …«, begann ich zu sagen, hielt
aber mitten im Satz inne.
Aus dem Augenwinkel heraus sah ich, wie Vivi-
enne den Scheck unterschrieb. Gleich würden sie
und Jason an unserem Tisch stehen und mich mit
sich fortzerren. Auch dieser für mich und Michael
wundervolle Sonntagnachmittag im St. Regis
näherte sich dem Ende.
»Da kommt sie, Michael«, flüsterte ich.
»Mach dich unsichtbar.«
19/346

DREI
Vivienne, Jason im Schlepptau, schlenderte zu un-
serem Tisch, als wäre sie die Besitzerin des St. Re-
gis. Niemand im Astor Court hätte geglaubt, dass
diese wun derschöne Frau mit dem perfekten
Make-up, der perfekten Haut und der perfekten
Tönung auch nur im Entferntesten mit dieser
pummeligen Achtjährigen mit dem krausen Haar
und Karamellsoße auf den Wangen verwandt
wäre.
Aber das waren wir. Mutter und Tochter.
Vivienne küsste mich auf die Wange und
machte sich an die Arbeit. An die Arbeit mit mir.
»Jane-Herzchen …« Fast immer nannte sie
mich »Jane-Herzchen«, als hieße ich wirklich
so. »Musst du immer zwei Desserts bestellen?«
Jason, der Promi-Friseur, versuchte zu helfen.
»Sei doch nicht so, Vivienne. Das zweite Dessert
war Melone. Das ist doch nicht schlimm. Klar, ein
paar Kohlenhydrate, aber …«
»Jane-Herzchen, wir haben uns über dein
Gewicht unterhalten …«, begann meine Mutter.

»Ich bin erst acht Jahre alt«, unterbrach ich
sie. »Wie wär’s, wenn ich dir verspreche,
dass ich später magersüchtig werde?«
Michael lachte so heftig, dass er beinahe vom
Stuhl kippte.
Sogar Jason lächelte.
Vivienne verzog keine Miene. Wie immer ver-
suchte sie, nicht die Stirn zu runzeln, weil sie nicht
so schnell Falten bekommen wollte. Jedenfalls nicht
vor neunzig oder so.
»Sei nicht so altklug, Jane-Herzchen.« Sie dre-
hte sich zu Jason. »Sie liest viel zu viele Büch-
er.«
O ja, wie schrecklich, dachte ich.
Vivienne wandte sich wieder mir zu. »Wir wer-
den später über deine Essgewohnheiten weit-
erreden. Privat.«
»Allerdings ist die Melone gar nicht für mich
gewesen«, wandte ich ein. »Die hat Michael be-
stellt.«
»Ah, ja.« Vivienne klang gelangweilt. »Mi-
chael, der wunderbare, allgegenwärtige ima-
ginäre Freund.« Sie sprach zum Stuhl neben
mir, der leer war, weil Michael auf der anderen
Seite saß. »Hallo, Michael, wie geht’s
denn?«
21/346

»Hallo, Vivienne«, grüßte Michael, der
wusste, dass Vivienne ihn weder sehen noch hören
konnte. »Mir geht’s prima, danke.«
Plötzlich zog Jason an meinem Haar.
»Hey!«, beschwerte ich mich.
»Damit müssen wir endlich was machen«,
sagte er. »Vivienne, gib mir eine Stunde für
dieses Haar. Es gibt keinen Grund, warum jemand
so rumlaufen soll. Sie wird hinterher wie ein Vogue-
Model aussehen.«
»Toll!«, schwärmte Michael. »Genau da-
rauf hat die Welt gewartet – auf ein achtjähriges
Mädchen, das aussieht wie ein Vogue-Model.«
Ich zuckte zusammen und zog mein Haar aus
Jasons Finger.
»Komm, Jane-Herzchen«, forderte Vivienne
mich auf. »Heute Abend habe ich volles Pro-
gramm. Ich muss mich um die Proben küm-
mern.« Ihr neuestes großes Broadway-Musical,
Das Problem mit Kansas, hatte in wenigen Tagen
Premiere.
»Aber zuerst können wir wie immer bei
Tiffany vorbeifahren, meine Liebe. Unsere gemein-
same Zeit.«
22/346

»Was ist mit Janes Haar?«, beharrte Jason.
»Für welchen Tag soll ich die Verschönerung-
saktion einplanen?«
Michael schüttelte den Kopf. »Du bist per-
fekt, so, wie du bist, Jane. Du brauchst keine Ver-
schönerung. Das darfst du nie vergessen.«
»Werde ich nicht«, versprach ich.
»Was wirst du nicht?«, fragte Vivienne. Sie
nahm eine Serviette, tunkte sie ins Wasserglas und
putzte mir die Karamellsoße von den Wangen.
»Eine Verschönerung ist eine tolle Idee, Jane-
Herzchen. Es könnte bald eine gro ße, schicke
Party für dich geben.«
Sie hat daran gedacht! Eine Geburtstagsparty!
Plötzlich hatte ich ihr alles andere verziehen.
»Jetzt komm schon. Ich höre Tiffany rufen.«
Vivienne wirbelte auf ihren Zehn-Zentimeter-Ab-
sätzen herum und stakste zum Ausgang, dicht ge-
folgt von Jason.
Michael und ich erhoben uns. Er beugte sich vor
und küsste mich auf den Kopf, direkt auf das
krause Haar, das Jason derartige Qualen bereitete.
»Wir sehen uns morgen«, verabschiedete er
sich. »Ich vermisse dich jetzt schon.«
»Ich dich auch.«
23/346

Ich blickte meiner Mutter nach, die mit ihren sch-
lanken, gebräunten Beinen in der Drehtür des
St. Regis verschwand. »Jane-Herzchen«, sagte
sie, zu mir gewandt, »komm, Tiffany ruft.«
Ich rannte los, um sie einzuholen.
Das tat ich immer.
24/346

VIER
Arme, arme Jane! Armes, armes kleines Mäd-
chen! Am nächsten Morgen wartete Michael wie
immer vor dem schicken Hochhaus an der Park Av-
enue, in dem sie wohnte. Es war gut, dass er un-
sichtbar war, da seine zerknitterten Hosen, das ver-
waschene blaue T-Shirt und die schäbigen Turn-
schuhe nicht gut in diese teure Gegend passen
würden.
Er dachte an etwas ziemlich Wunderbares, das
Jane gesagt hatte, als sie erst vier Jahre alt gewesen
war. Vivienne hatte sich auf eine einmonatige Euro-
pareise vorbereitet. Er hatte sich Sorgen gemacht,
ob Jane damit zurechtkommen würde. Doch Jane
hatte nur mit den Schultern gezuckt und gesagt:
»Liebe heißt, nichts kann zwei Menschen
trennen.« Michael wusste, diesen Satz würde er
nie vergessen – erst recht nicht, weil er dem
Mund und dem Hirn einer Vierjährigen ents-
prungen war. Aber genau das war Jane – ein un-
glaubliches Mädchen.
Also, was würde er an diesem wunderbaren
Tag anfangen, während Jane in der Schule einges-
perrt war? Vielleicht frühstücken drüben im

Olympia – Pfannkuchen, Würstchen, Eier,
Roggentoast am laufenden Band. Er könnte sich
auch mit ein paar anderen »imaginären Freun-
den« treffen, die in der Nachbarschaft arbeiteten.
Was genau hatte ein imaginärer Freund zu tun?
Er musste einem Kind helfen, sich in der Welt
zurechtzufinden, damit es sich nicht allein fühlte
und keine Angst hatte. Arbeitszeit? Nach Bedarf.
Nutzen? Die unglaublich reine Liebe zwischen
einem Kind und einem imaginären Freund. Etwas
Besseres als das gab es nicht. Wie passte er, Mi-
chael, in den großen kosmischen Plan? Hm, das
hatte ihm noch niemand erzählt.
Michael blickte auf seine Uhr, eine alte Timex, die
genauso weitertickte, wie es die Werbung ver-
sprochen hatte. Es war 8:29 Uhr. Jane würde um
8:30 Uhr unten sein, genau wie jeden Werktag.
Jane ließ nie jemanden warten. Sie war ja so ein
Schatz.
Dann sah er sie, tat aber so, als sähe er sie nicht.
Wie immer.
»Erwischt!«, sagte sie und legte ihre Arme um
seine Taille.
»Boh, jetzt hast du mich aber drangekriegt!«,
stöhnte Michael. »Du schleichst dich besser an
als jeder Taschendieb in Oliver Twist.«
26/346

Janes Grinsen, von dem er nicht genug bekom-
men konnte, hellte ihr Gesicht auf. Sie hievte ihren
Schulranzen auf ihre schmale Schulter, und gemein-
sam machten sie sich auf den Weg.
»Eigentlich habe ich mich nicht angesch-
lichen«, erklärte sie. »Du warst so in deine in-
teressanten Gedanken versunken.« Jane hatte
eine nette Art, aus ihrem Mundwinkel heraus zu re-
den, wenn sie mit ihm zusammen war, damit die
Leute nicht dachten, sie wäre verrückt. Manch-
mal zeigte er sich den Menschen, manchmal nicht.
Sie konnte nie sicher sein, was er gerade tat –
oder warum. »Das Leben geht geheimnisvolle
Wege«, sagte er dann immer.
Sobald sie außer Sichtweite des Portiers war, er-
griff sie Michaels Hand. Dies liebte er mehr, als er
sagen konnte. Es gab ihm das Gefühl … hm, er
wusste nicht recht … ein Vater zu sein?
»Was hat Raoul zum Mittagessen einge-
packt?«, fragte er. »Warte, lass mich raten. Eich-
hörnchen auf Vollkornbrot, verwelkten Eisbergsal-
at, zusammengehalten von drei Tage alter Mayo?«
Jane zog an seiner Hand. »Du bist ein Trot-
tel«, schalt sie ihn.
»Nö, ich bin Hatschi.«
»Eher der Seppi«, lachte Jane.
27/346

Ein paar Minuten später – viel zu schnell –
hatten sie das hohe, imposante Schultor erreicht,
das nur eineinhalb Straßenblocks von Janes
Zuhause entfernt war. Der Bereich vor dem Eingang
sah
aus
wie
ein
Meer
aus
dunkelblauen
Trägerkleidern und schlichten weißen Blusen,
Mary-Jane-Schuhen oder diesen Sportschuhen aus
hellem Leder mit andersfarbigem Einsatz und
natürlich
leger
nach
unten
geschobenen
Strümpfen.
»Morgen ist der besondere Tag«, sagte Jane
und blickte auf ihre Schuhe hinab, damit ihre
Klassenkameradinnen nicht sahen, dass sie mit
einem imaginären Freund sprach. »Vielleicht
bekomme ich meinen Hund. Mittlerweile ist es mir
egal, was für einen. Vielleicht kriege ich ihn auf
meiner Party. Wir müssen uns aber erst Das
Problem mit Kansas ansehen. Du bist natürlich
eingeladen.«
Die Schulglocke ertönte.
»Toll. Ich kann’s kaum abwarten, Kansas
zu sehen. Geh jetzt rein, ich hole dich nachher
wieder ab. Wie immer.«
»Gut«, sagte sie. »Dann überlegen wir,
was wir morgen Abend anziehen.«
28/346

»Ja, du kannst mir helfen, mir ein paar schicke
Sachen auszusuchen. Damit es dir mit mir nicht
peinlich wird.«
Jane blickte ihm direkt in die Augen. Für den
Bruchteil einer Sekunde bekam er eine Ahnung dav-
on, wie sie als Erwachsene aussehen würde –
mit ihrem ernsten Gesicht, dem warmen Lächeln,
dem intelligenten Blick, der direkt bis in seine Seele
vordrang.
»Mit dir wird es mir nie peinlich, Michael.«
Sie ließ seine Hand los und rannte aufs Schulge-
bäude zu. Michael blinzelte erst wieder, als ihre
blonden Locken hinter der Tür verschwunden
waren. Er wartete. Jane spähte noch einmal um
die Ecke, wie sie es immer tat. Sie winkte und
lächelte, dann verschwand sie endgültig.
Plötzlich musste Michael wirklich blinzeln.
Mehrmals sogar. Er hatte das Gefühl, ein Riese
hätte ihm gegen die Brust getreten. Sein Herz tat
richtig weh.
Wie würde er Jane sagen, dass er sie am
nächsten Tag verlassen musste?
Auch das gehörte zu den Pflichten eines ima-
ginären Freundes und war wahrscheinlich die
schlimmste.
29/346

FÃœNF
Diesen Tag werde ich nie vergessen. Da geht es mir
wie einem Menschen, der den Untergang der Titan-
ic überlebt hat und sein Leben lang daran denken
wird. Menschen erinnern sich immer an den
schlimmsten Tag ihres Lebens. Er wird auf immer
ein Teil von ihnen. Genauso erinnere ich mich an
meinen neunten Geburtstag mit erschreckender
Klarheit.
Nach der Schule machten Michael und ich uns
fertig fürs Theater, wo wir uns zur Premiere von
Das Problem mit Kansas auf die VIP-Plätze set-
zten. Ich hatte Vivienne den ganzen Tag nicht gese-
hen, sodass sie keine Möglichkeit gehabt hatte,
mir zum Geburtstag zu gratulieren. Doch Michael
hatte mich mit Blumen von der Schule abgeholt.
Wie erwachsen ich mich dadurch gefühlt hatte!
Diese pfirsichfarbenen Rosen waren das Schönste,
was ich je gesehen hatte.
An das Stück erinnere ich mich kaum, aber ich
weiß, dass die Zuschauer immer an den richtigen
Stellen lachten, weinten oder stöhnten. Michael
und ich hielten Händchen, in meiner Brust
spürte ich ein aufgeregtes Flattern. An diesem

Tag sollte es mir richtig gut gehen – endlich war
einmal ich an der Reihe. Eine Geburtstagsparty und
hoffentlich ein Hund. Michael war bei mir, meine
Mutter würde glücklich sein wegen des Music-
als. Alles schien wunderbar, alles möglich zu sein.
Meine Mutter musste nach der Vorstellung mit
der Besetzung auf die Bühne. Sie tat so, als
wäre sie schüchtern und schockiert darüber,
dass allen ihr neues Stück gefallen hatte. Sie ver-
beugte sich, und die Zuschauer erhoben sich und
klatschten. Auch ich erhob mich und klatschte wie
wild. Ich liebte sie so sehr, dass ich es kaum aus-
hielt. Irgendwann würde sie mich genauso lieben,
dessen war ich mir sicher.
Dann war es Zeit für meine Geburtstagsparty
bei uns zu Hause. Endlich.
Die ersten Gäste waren die Tänzer aus dem
Musical meiner Mutter. Das hätte ich mir vorher
denken können. Tänzer verdienen nicht so viel,
und
wahrscheinlich
starben
sie
nach
der
Aufführung beinahe vor Hunger. Im vorderen
Flur mit dem weißschwarzen Marmorboden zogen
sich gerade ein paar von ihnen die Mäntel von
ihren Strichmännchenkörpern. Selbst als Neun-
jährige wusste ich, dass ich so nie aussehen
würde.
31/346

»Du musst Viviennes Tochter sein«, sagte eine
von ihnen. »Jill, oder?«
»Jane«, korrigierte ich sie, lächelte aber, um
zu zeigen, dass ich keine missmutige Göre war.
»Ich wusste nicht, dass Vivienne ein Kind
hat«, meldete sich ein anderes Strichmännchen
zu Wort. »Hallo, Jane. Du bist ja ein süßer
Schlingel.«
Sie schwebten ins Wohnzimmer, während ich
überlegte, ob »Schlingel« und »süß«
nicht eher ein Gegensatz waren.
»Heiliger Stephen Sondheim!«, sagte einer der
Tänzer. »Ich wusste, Vivienne ist reich, aber
diese Wohnung ist größer als das Broadhurst-
Theater.«
Als ich mich wieder umdrehte, hatte ich den
Eindruck, als ob sich hundert Leute im Wohnzim-
mer aufhielten. Ich blickte mich nach Michael um,
den ich schließlich in der Nähe des Pianospielers
entdeckte.
Hier ging es zu wie in einer Theaterpause. Das
Klavierspiel wurde vom Geplapper übertönt.
Neben der Tür zur Bibliothek stand Vivienne, die
mittlerweile ebenfalls eingetroffen war. Sie unter-
hielt sich mit einem großen, grauhaarigen Mann,
der eine Smokingjacke und Jeans trug. Ich hatte ihn
32/346

ein paarmal bei den Proben zu Kansas gesehen und
wusste, er war so eine Art Autor. Die beiden
standen sehr nahe beieinander, und ich bekam das
Gefühl, dass er für die Rolle von Viviennes
viertem Ehemann vorsprach. Würg.
Eine kleine alte Dame, die in Das Problem mit
Kansas die Großmutter spielte, hakte den Griff
ihres Spazierstocks in meinen Kragen ein.
»Du scheinst ein nettes Mädchen zu sein«,
sagte sie.
»Danke. Ich versuche es zumindest«, er-
widerte ich. »Kann ich Ihnen helfen?«
»Ja, vielleicht könntest du mir von der Bar
dort drüben ein Glas Wasser und einen Jack
Daniels holen«, antwortete sie.
»Klar. Pur oder auf Eis?«
»Meine Güte, du bist aber eine ganz Ges-
cheite. Bist du etwa eine Liliputanerin?«
Lachend blickte ich zu Michael, der dem Klavier-
spieler etwas zuflüsterte. Was hatte er vor?
Als ich auf eine der Bars zuging, meldete sich eine
laute
Stimme.
»Dürfte
ich
um
Ihre
Aufmerksamkeit bitten?« Es war der Klavierspiel-
er. Schweigen legte sich über die Gäste.
»Ich habe soeben erfahren … ich weiß aber
nicht sicher, von wem … dass heute ein
33/346

besonderer Tag für jemanden ist … Sie ist heute
neun Jahre alt geworden … Viviennes Tochter.«
Viviennes Tochter? Das war ja ich.
Ich lächelte glücklich und gleichzeitig selbst-
bewusst. Alle drehten sich zu mir. Der Anführer
der Show hob mich hoch und stellte mich auf einen
Stuhl – plötzlich war ich größer als alle an-
deren. Ich sah mich nach meiner Mutter um, die,
wie ich hoffte, stolz lächelte, konnte sie jedoch nir-
gends erblicken. Auch der Autor war fort. Dann set-
zte die Musik ein, und alle sangen »Happy Birth-
day.« Es geht doch nichts über einen
professionellen
Broadway-Chor,
der
»Happy
Birthday« singt. Ich glaube, es war das schönste
»Happy Birthday«, das ich je gehört habe.
Mein ganzer Körper wurde von einem Schauder
gepackt, und vielleicht wäre dies der schönste
Moment in meinem Leben gewesen, hätte ihn
meine Mutter mit mir geteilt.
Als er vorbei war, hob mich der nette Schauspiel-
er wieder vom Stuhl, alle applaudierten, und die
Party wurde wieder zur Premierenfeier. Der Ge-
burtstag war vorbei.
Plötzlich rief eine bekannte Stimme meinen Na-
men. »Jane! Ich glaube, dieses große, hübsche
Mädchen kenne ich.« Ich wirbelte herum – vor
34/346

mir stand mein Vater Kenneth. Er wirkte furchtbar
groß, insbesondere für jemanden, der angeblich
kein »Rückgrat« hatte.
»Daddy!«, rief ich und rannte in seine Arme.
35/346

SECHS
Gott, wie ich es liebte, umarmt zu werden. Beson-
ders von meinem Vater. Er legte seine Arme um
mich, kalte Luft und ein schwacher Duft seines
Rasierwassers stiegen mir in die Nase. Ich atmete
tief ein, glücklich und erleichtert, dass mein
Vater gekommen war.
»Hast du etwa geglaubt, ich hätte deinen
neunten Geburtstag vergessen?«, fragte mein
Vater. Er ließ von mir ab und zog mich an der
Hand mit sich fort. »Los, schnell nach draußen
in die Halle. Wenn deine Mutter rausbekommt,
dass ich auf ihrer Party aufgetaucht bin, dreht sie
durch.«
»Die anderen werden sie wieder beruhigen«,
sagte ich. »Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie
überhaupt noch hier ist.«
Wir schoben uns durch die Menge in die Eingang-
shalle, wo mich zwei Ãœberraschungen erwarteten:
eine große Schachtel mit einem gelben Band und
die aktuelle Freundin meines Vaters. Ich erinnerte
mich,
dass
Vivienne
etwas
über
Ellies
»Balkon« gesagt hatte, und darüber, dass er
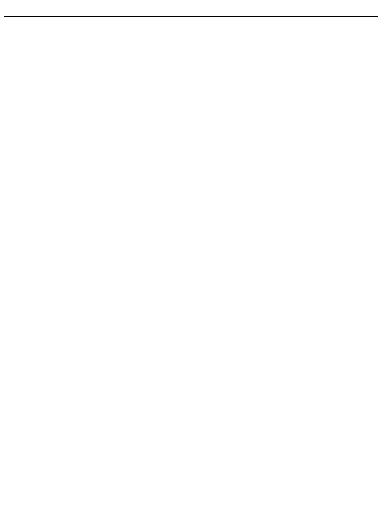
nicht echt sei, aber ich hatte keine Ahnung gehabt,
wovon sie geredet hatte.
»Du erinnerst dich doch bestimmt noch an El-
lie«, stellte Dad sie mir vor.
»Hm. Hallo, Ellie. Ich freue mich, dass du
gekommen bist.« Jahrelanger Anstandsunterricht
machte sich bezahlt.
»Alles Gute zum Geburtstag, Jane«, wün-
schte mir Ellie. Sie war sehr blond und hübsch
und schien sehr viel jünger zu sein als meine
Mutter. Ich wusste, meine Mutter nannte sie »das
Schulmädchen« und verzog ihr Gesicht, sobald
die Sprache auf sie kam.
»Mach dein Geschenk auf«, forderte mich Dad
auf. »Ellie hat mir beim Aussuchen geholfen.«
Ich zog am gelben Band, das sich im gleichen Au-
genblick löste. In der Schachtel befand sich eine
Unmenge an Seidenpapier, das ich aufgeregt durch-
wühlte. Ich berührte etwas Weiches und
Samtiges – aber nichts Lebendiges. Ich griff zu
und zog den größten, lilasten ausgestopften
Pudel heraus, den ich je gesehen hatte. Sein Kopf
war mit einem puffigen Dutt geschmückt, um den
Hals trug er ein mit Rheinkieseln besetztes Band
mit einem goldenen Anhänger, auf dem »Gigi«
stand.
37/346

Ziemlich genau das Gegenteil von dem Hünd-
chen, das ich mir gewünscht hatte.
»Danke, Daddy.« Ich setzte ein breites
Lächeln auf. »Das ist aber eine Freude!« Ich
versuchte, alle Gedanken an einen echten, warmen,
zappelnden Welpen zu verbannen, der mir, nur mir
allein gehört hätte. Es gab keinen echten Hund
… dafür einen ausgestopften Pudel.
»Bedank dich auch bei Ellie«, verlangte
Daddy.
»Danke, Ellie«, sagte ich höflich, woraufhin
sie sich nach unten beugte und mich küsste. Ich
erkannte ihr Parfüm: Chanel Nr. 5. Mein Vater
hatte es immer meiner Mutter geschenkt. Ob Ellie
das wusste?
»Okay.« Dad erhob sich wieder. »Jetzt
fahren wir weiter nach Nantucket.«
Mein Herz machte einen Satz. »Wir?«, schrie
ich beinahe.
Ellie und mein Vater warfen sich einen seltsamen
Blick zu.
»Nein, Schatz«, antwortete Dad. »Ich
meinte, Ellie und ich fahren nach Nantucket. Deine
Mutter würde mich umbringen, wenn ich dich
von deiner Geburtstagsparty wegschleppe.«
38/346

Klar, das würde sie sofort merken, dachte ich
freudlos. »Ich verstehe«, sagte ich und be-
mühte mich, nicht gleich loszuheulen. »Es ist
nur so, dass mir Nantucket richtig gut gefällt.
Echt. Und Michael auch.«
»Wir fahren ein andermal hin, Jane. Ver-
sprochen«, tröstete mich mein Vater. »Und
dann kommt dein Freund Michael auch mit.«
Ich bin sicher, mein Vater meinte es so, weil er
nie etwas sagte, was er nicht meinte. Aber es machte
mich traurig, mit anzusehen, wie er Ellie in den
Mantel half.
»Kommst du hier zurecht?«, fragte Ellie. Ei-
gentlich mochte ich sie. Sie war immer nett zu mir.
Ich hoffte, mein Vater würde sie bald heiraten.
Auch sie brauchte Umarmungen. Jeder braucht sie.
Vielleicht auch Vivienne.
»Natürlich. Es ist mein Geburtstag. An einem
Geburtstag kommt man immer zurecht.«
Wir umarmten uns. Wir küssten uns. Wir ver-
abschiedeten uns. Dann betraten mein Vater und
Ellie den Fahrstuhl und verschwanden in die Nacht.
Um sich auf die glückselige Fahrt nach Nantucket
zu machen.
Die Premierenfeier war wieder in vollem Gang.
Nichts erinnerte mehr daran, dass vor ein paar
39/346

Minuten jemand »Happy Birthday« gesungen
hatte.
Es
gab
keinen
Grund
für
mich
hierzubleiben.
Ich manövrierte durch die Menge der Erwach-
senen und rannte schließlich den langen, mit dick-
em Teppich ausgelegten, stillen Flur entlang, der zu
meinem Zimmer führte. Ich knallte die Tür
hinter mir zu, warf mich aufs Bett und vergrub mein
Gesicht ins Kissen. Hier, wo mich niemand sah,
begann ich zu weinen wie die weltgrößte
Heulsuse.
Dann wurde die Tür geöffnet.
Es war Michael. Gott sei Dank war es Michael,
der gekommen war, um mich zu retten.
40/346

SIEBEN
Jane lag schluchzend auf ihrem Bett, als er eintrat.
Sie sah wirklich nicht wie ein glückliches Ge-
burtstagskind aus. Aber wie sollte sie auch, das
arme Mädchen?
Michael seufzte, setzte sich neben sie und legte
seine Arme um sie. Nein, sie verdiente es nicht, so
verletzt zu werden. Kein Kind verdiente das.
»Es ist in Ordnung, Schatz. Lass es raus«,
flüsterte er in ihr Haar, das immer nach Baby-
schampoo roch, ihrem derzeitigen Lieblingsduft.
»Okay. Du hast es so gewollt.«
Schniefend und mit tränennassem Gesicht zog
sich Jane die Schuhe aus und ließ sie auf den
Boden fallen.
»Ich glaube, Vivienne hat meinen Geburtstag
total vergessen«, begann sie und holte zittrig Luft.
»Und mein Dad ist gekommen, was schön war,
aber er ist nach zwei Minuten wieder verschwun-
den. Er fährt nach Nantucket, meinem absoluten
Lieblingsort! Ohne mich! Und einen Hund habe ich
auch nicht bekommen.«
Jane drückte den lila Pudel an ihre Wange. Mi-
chael hatte bemerkt, dass sie oft Gegenstände an

sich drückte – einen Wintermantel, ein Kissen,
ein ausgestopftes Tier. Sie hatte viele Umarmungen
zu vergeben, aber nicht genügend Menschen
dafür.
»Du bist ein guter Zuhörer«, sagte sie mit
einem letzten Schniefen. »Danke. Mir geht’s
schon besser.«
Michael blickte sich in ihrem Zimmer um. Es war
typisch Jane: stapelweise Kinderbücher, für
die sie noch viel zu jung war; in der Ecke ein echtes
Saxophon; ein Poster mit französischen Vokabeln;
über dem Schreibtisch ein Bild von Warren
Beatty mit Autogramm. Vivienne hatte es von einer
dreimonatigen Geschäftsreise aus Los Angeles
mitgebracht, während der sie kein einziges Mal
nach Hause gekommen war, um ihre Tochter zu
sehen.
Jetzt musste Michael mit Jane reden. Ihr
gemütliches Zimmer, in das sie vor der Party ge-
flohen war, hätte nicht geeigneter dafür sein
können. Der Zeitpunkt – unmittelbar, nachdem
sie von ihren beiden Eltern verletzt worden war –
hätte nicht ungeeigneter sein können.
»Du bist ein ganz, ganz wunderbares Mäd-
chen«, begann Michael. »Weißt du das? Ja, das
weißt du sicher.«
42/346

»Irgendwie ja, aber nur, weil du mir das jeden
zweiten Tag sagst«, erwiderte sie mit einem
schwachen Lächeln.
»Du bist schön, innen wie außen«, fuhr er
fort. »Du bist unglaublich klug, belesen, lustig und
aufmerksam. Und großzügig. Du hast so viel zu
geben.«
Jane merkte auf. Er hatte gerade gesagt, sie sei
klug – und genau das würde sie ihm jetzt
beweisen.
»Michael, was versuchst du mir zu sagen? Was
ist los? Etwas Schlimmes?«
Seine Knie wurden weich, und Tränen ver-
schleierten seinen Blick. Warum jetzt? Warum
Jane? Warum er?
»Du bist jetzt neun Jahre alt«, zwang er sich
zu sagen. »Du bist ein großes Mädchen. Und
deswegen … und deswegen … ich werde dich
heute Abend verlassen, Jane. Ich muss gehen.«
»Ich weiß. Aber du kommst morgen wieder.
Wie immer.«
Michael schluckte. War das furchtbar. Es brach
ihm das Herz.
»Nein, Jane. Die Sache ist die, ich werde nie
wieder zurückkommen. Ich habe keine andere
Wahl, so lauten die Regeln.« Noch nie hatte er
43/346
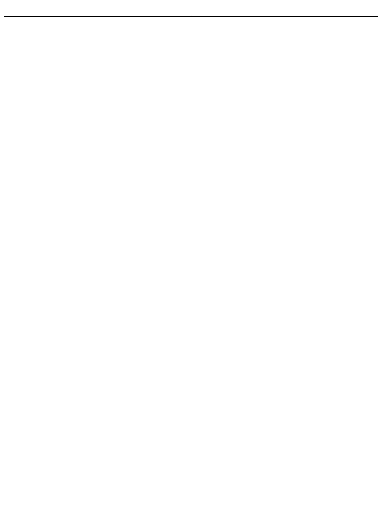
sich so schlimm gefühlt wie jetzt, als er ihr diese
Worte sagen musste. Jane war etwas Besonderes.
Sie war anders. Er wusste nicht, warum, er wusste
es einfach. Zum ersten Mal kam Michael die Regel,
ein Kind an seinem neunten Geburtstag verlassen
zu müssen, dumm und ungerecht vor. Er wäre
lieber gestorben, als Jane diesen Schmerz zuzufü-
gen. Aber es stimmte: Er hatte keine andere Wahl.
Die hatte er nie.
Sie weinte nicht, bewegte keinen Muskel ihres
Gesichts – genau wie Vivienne. Sie blickte Mi-
chael direkt in die Augen und hüllte sich in ein
schreckliches Schweigen, das er bei ihr noch nie er-
lebt hatte.
»Jane, hast du mich verstanden?«, fragte er
schließlich.
Die Pause schien eine Ewigkeit zu dauern.
»Ich bin noch nicht so weit, dass du gehen
kannst.« Große Tränen kullerten über ihre
Wangen. »Ehrlich, ich bin noch nicht so weit.«
Als sie nach einem Papiertuch griff, um sich die
Nase zu putzen, zitterten ihre kleinen Hände. Das
gab ihm den Rest. Diese zierlichen, kleinen
Hände, die unkontrolliert zitterten. Es war
unerträglich.
44/346

Verdammt, dachte er. Dann kam ihm eine Idee,
doch es war etwas, das er noch bei keinem Kind get-
an hatte.
»Jane, ich erzähle dir ein Geheimnis. Es ist ein
Geheimnis, das ich noch nie jemandem erzählt
habe, und du darfst es niemandem weitererzählen.
Es ist das Geheimnis imaginärer Freunde.«
»Ich will deine Geheimnisse nicht hören«,
wehrte sie stur ab. Ihre Stimme zitterte, doch Mi-
chael fuhr fort.
»Kinder haben imaginäre Freunde, damit
diese ihnen im Leben helfen. Wir helfen Kindern,
damit sie sich nicht so allein fühlen und ihren
Platz in der Welt und in ihren Familien finden. Aber
dann müssen wir gehen. Das war schon immer so
und wird immer so sein. Jane. So … funktioniert
das eben.«
»Aber ich habe dir gesagt, ich bin noch nicht so
weit.«
Michael verriet ihr ein anderes Geheimnis.
»Sobald ich weg bin, wirst du dich nicht mehr an
mich erinnern, Schätzchen. Das tut niemand.
Wenn du je an mich denkst, wirst du glauben, du
hättest geträumt.« Damit wurde diese Angele-
genheit wenigstens annähernd erträglich.
45/346

Jane packte seinen Arm. »Bitte verlass mich
nicht, Michael. Ich flehe dich an. Das darfst du nicht
– nicht jetzt. Nie! Du weißt nicht, wie wichtig du
für mich bist!«
»Du wirst sehen, Jane, du wirst mich ver-
gessen«, versprach er ihr. »Und morgen wird es
nicht mehr wehtun. Abgesehen davon hast du selbst
gesagt: Liebe heißt, nichts kann zwei Menschen
trennen. Deswegen werden wir nie getrennt sein,
Jane, weil ich dich so sehr liebe. Ich werde dich im-
mer, immer lieben.«
Und mit diesen Worten verblasste Michael ganz
im Stil eines imaginären Freundes, verfolgt von
den letzten Worten seiner kleinen, lieben Jane.
»Michael, bitte geh nicht! Bitte! Wenn du gehst,
habe ich niemanden mehr. Ich werde dich nie ver-
gessen, Michael, egal, was passiert. Ich werde dich
nie vergessen!«
Womit die Geschichte in der heutigen Zeit an-
gekommen ist.
Nicht in einer imaginäre Zeit.
In einer echten.
46/346

TEIL ZWEI
Dreiundzwanzig Jahre älter, aber nicht
unbedingt in gleichem Maße klüger

ACHT
Elsie McAnn sah so blass aus wie der Schaum auf
einem Milchkaffee. Sie war von Panik ergriffen und
wahrscheinlich einem tödlichen Schlaganfall nahe.
Das war neu. Schließlich war Elsie seit achtun-
dzwanzig stressigen Jahren der Empfangsdrachen
bei ViMar Productions, der Produktionsfirma mein-
er Mutter. Jetzt atmete sie zwar noch, aber spuckte
kein Feuer mehr.
»Oh, Gott sei Dank, endlich bist du da, Jane«,
begrüßte sie mich erleichtert.
»Es ist doch gerade mal zehn Uhr.«
»Ich weiß nicht, was heute los ist, aber Vivi-
enne ist schon hundertmal rausgekommen und hat
nach dir gefragt.«
»Dann sag ihr, dass ich jetzt da bin.«
Doch das war nicht mehr nötig. Viviennes
Stilettoabsätze
klackerten
bereits
den
Flur
entlang.
»Wo warst du, Jane-Herzchen? Es ist fast schon
Mittag«, fragte sie den Bruchteil einer Sekunde,
bevor sie in mein Blickfeld trat.
»Es ist zehn Uhr«, wiederholte ich auch für
sie.

»Und wo bist du gewesen?«, fragte sie weiter,
bevor sie mich wie immer auf die Wange küsste.
Mein Guten-Morgen-Kuss.
Ich war bei mir zu Hause gewesen, hatte Kaffee
getrunken und mir im Fernsehen Matt Lauer an-
geschaut, der eine Frau darüber interviewte, wie
man eine außer Kontrolle geratene Werkstatt
leitete – die Antwort lautet übrigens: Auf-
hängeplatten für das Werkzeug anbringen.
Gefolgt von Vivienne, ging ich den Flur entlang in
mein Büro.
»Ich hoffe, diese Papiertüte da enthält kein-
en dick machenden Blaubeer-Muffin.«
»Nein«, erwiderte ich wahrheitsgemäß. Die
Papiertüte enthielt einen dick machenden Ahorn-
Walnuss-Donut. Glasiert.
Ich setzte mich an meinen Schreibtisch und
arbeitete mich durch einen drei Zentimeter dicken
Stapel Telefonnachrichten. Viele stammten von
Agenten und waren dementsprechend gelogen.
Eine stammte von meinem »persönlichen
Einkäufer« bei Saks – Viviennes Idee. Auch
gelogen.
Fünf Nachrichten waren mit »Deine Mut-
ter« markiert.
49/346

Eine stammte von Hugh McGrath, meinem Fre-
und. Das Licht und der Untergang meines Lebens,
alles eingewickelt zu einem scharfen, bezaubernden
Paket.
Die nächste Nachricht war von meinem Hautar-
zt, der mich zurückgerufen hatte.
Die einzige andere wichtige Nachricht hatte Karl
Friedkin hinterlassen, und die war wirklich wichtig.
Der wohlhabende Immobilienentwickler war daran
interessiert, in mein Filmprojekt zu investieren.
Drei Jahre zuvor hatte meine Mutter mir gestat-
tet, ganz allein ein Stück zu produzieren. Die Be-
setzung bestand aus zwei Personen – einem
achtjährigen Mädchen und einem fünfund-
dreißigjährigen Mann. Es gab zwei Schauplätze
– das Astor Court im St. Regis Hotel und eine
Wohnung in Manhattan. Vivienne hatte sicher
gedacht, die Produktion würde so billig werden,
dass der Verlust im Falle eines Flops zu verkraften
wäre.
Das Stück hieß Dem Himmel sei Dank und
basierte eher mehr als weniger auf meiner lang
zurückliegenden Beziehung zu meinem ima-
ginären Freund Michael. Dieses Stück zu
produzieren war vielleicht meine Art, Michael nicht
zu vergessen. Vielleicht war unsere Geschichte
50/346

einfach eine entzückende Idee für ein Theater-
stück gewesen.
Sowohl zu Viviennes als auch zu meinem Er-
staunen war Dem Himmel sei Dank ein Erfolg ge-
worden. Ein Bombenerfolg, um genau zu sein, und
es hatte den Tony Award gewonnen. Das Publikum
hatte die Geschichte des pummeligen kleinen
Mädchens und ihres hübschen imaginären
Freundes geliebt. In der Szene, in der Michael sie
schließlich verlassen hatte, hatte man die
Zuschauer schluchzen hören. Oft genug war ich
eine davon gewesen.
Ein vergrößertes Zitat aus der New York
Times von Ben Browning hing über meinem
Schreibtisch:
»Nennt mich einen sentimentalen Esel
oder, wer mag, etwas Schlimmeres, aber
Dem Himmel sei Dank ist unwiderstehlich.
Wie das Leben von seiner besten Seite ist es
die perfekte Kombination aus Charme,
Tränen und Lachen.«
Natürlich würde mir Dem Himmel sei Dank
Michael nicht zurückbringen, doch es hatte Hugh
McGrath in mein Leben gebracht. Hugh hatte in
dem Stück Michael gespielt, im echten Leben war
ich mit ihm eine Beziehung eingegangen.
51/346

Als ich Vivienne erzählt hatte, ich wolle einen
Kinofilm von Dem Himmel sei Dank produzieren,
hatte sie ihre Bedenken angemeldet: »Das ist
keine schlechte Idee, aber das wirst du nicht allein
umsetzen können, Jane-Herzchen. Du wirst auf
jeden Fall meine Hilfe brauchen. Leider bin ich aber
im Moment nicht sehr flüssig.«
Der Plan war, die Hälfte der Produktionskosten
selbst aufzubringen und für den Rest bei einem
Hollywood-Studio anzuklopfen. Vivienne hatte
gesagt, sie würde den Betrag, den Karl Friedkin
aufbringen würde, um den verbleibenden Rest
aufstocken.
»Ich breche eine der Hauptregeln bei der
Produktion – investiere nie dein eigenes Geld«,
hatte Vivienne gesagt. »Aber schließlich ge-
hörst du zur Familie, Jane-Herzchen.«
Ah, sie erinnerte sich.
52/346

NEUN
Ruf Karl Friedkin an«, verlangte Vivienne in
meinem Büro. »Jetzt. Sofort! Das ist ein Befehl
deiner Mutter.« Das war nicht unbedingt nur als
Witz gemeint.
Als treue Dienerin, die ich war, drückte ich die
Kurzwahltaste.
»Warte eine Sekunde, Jane-Herzchen. Leg
wieder auf. Lass mich nachdenken.«
Ich legte auf.
Vivienne drückte ihre Hände aneinander,
während sie in meinem kleinen Büro auf und ab
ging. Es schien, als betete sie zu dem Heiligen der
Theaterinvestoren. »Also, ich hätte gerne, dass
du Folgendes zu Karl sagst«, begann sie. »Sag
ihm, Gerry Schwartz von Phoenix Films hat starkes
Interesse an dem Projekt, und Gerry hat ein Auge
für Kassenschlager.«
»Oh,
mein
Gott!«,
rief
ich
begeistert.
»Phoenix hat echt Interesse an dem Film?«
Sie warf mir aufgebracht einen Blick zu. »Ach,
um Himmels willen, Jane-Herzchen, das haben sie
nicht. Aber Friedkin soll ruhig glauben, es wäre
so. Sag ihm, wenn er heute nicht das Geld

zuschießt, dann, nun ja, sei es morgen zu
spät.«
Ich legte das Telefon zur Seite. »Mutter, ich ver-
stehe, wenn man die Wahrheit etwas zurechtbiegt.
Aber richtig lügen? Du weißt, ich hasse das.«
Ein weiterer aufgebrachter Blick. »So läuft
nun mal das Spiel.«
»Woher wusstest du eigentlich, dass Karl
Friedkin mich angerufen hat?«, fragte ich
misstrauisch.
»Intuition«, antwortete sie und ging klackernd
Richtung Tür.
»Du hast meine Telefonnachrichten gelesen.«
Sie täuschte einen Schock vor. »So etwas
würde ich nie tun.« Mit gekränktem Blick
huschte sie zur Tür hinaus, nur um gleich darauf
noch einmal hereinzuschauen.
»Ach, und wenn du Karl Friedkin angerufen
und unser Geld bekommen hast, vergiss nicht, dein-
en Hautarzt zurückzurufen.«
54/346

ZEHN
Mein Freund Hugh McGrath war lächerlich
hübsch, aber sollte man ihm das vorhalten? Gut,
vielleicht. Mir fallen da ein paar Gründe ein. Ein-
mal war in East Hampton ein Mann auf ihn
zugegangen und hatte ihn gefragt: »Wo kann man
ein solches Lächeln kaufen?« Und er war ernst
geblieben. So ein Typ war Hugh. Die Art von Typ,
dem so etwas passierte. Die Art von Typ mit
smaragdgrünen Augen, perfekter Nase, hohen
Wangenkno chen und einem fein geschnittenen
Kinn, das Bond, James Bond, alle Ehre machte.
Hugh war Broadway-Schauspieler und bereits mit
neunzehn Jahren für einen Tony nominiert
gewesen. Er war mit der Gabe geboren worden,
nicht auf den Mund gefallen zu sein – er hätte
einem Eisbären Eis verkaufen können.
Eines Morgens hatte er sich im Bett auf einen Ell-
bogen gestützt und mir erzählt, allein mein An-
blick am Morgen mache ihn wahnsinnig glück-
lich. Da ich wusste, wie ich nach dem Aufwachen
aussah, hatte ich nur erwidert: »Willst du Soße
zu diesem Quatsch?«

Wir waren zum Abendessen im Babbo verabredet,
unserem Lieblingsitaliener in Greenwich Village.
Vor über zwanzig Jahren, als ich noch ein kleines
Mädchen gewesen war, hatte das Babbo noch The
Coach House geheißen. Meine Mutter und ich
waren immer sonntagabends dorthin gegangen. Im-
mer hatte ich eine Suppe mit schwarzen Bohnen be-
stellt, und immer hatte meine Mutter gesagt:
»Keine saure Sahne in die Suppe, Jane-Herzchen.
Denk daran, du hattest erst vor ein paar Stunden
einen großen Eisbecher.« Ja, mit Michael.
Am Abend traf ich vor Hugh im Restaurant ein,
und die wahnsinnig gut aussehende Blondine russ-
ischer Abstammung am Empfang führte mich auf
die Empore. Sobald ich Platz genommen hatte, war
ich gezwungen, die Leute zu beobachten. Das, muss
ich zugeben, war schon seit ewigen Zeiten eine
Sucht von mir.
Auf der anderen Seite des Gangs saß ein
auffälliges Pärchen, eine Schwarze und ein blon-
der Weißer, beide noch keine dreißig.
Sein dunkelblauer Ralph-Lauren-Anzug sagte
»erfolgreicher Anwalt«, ihre langen Beine sagten
»Laufsteg-Model«. Sie waren eindeutig verliebt
und scharf aufeinander. Zumindest an diesem
Abend.
56/346

Am nächsten Tisch saß ein Paar Mitte bis
Ende vierzig. Sie trug Jeans und ein schlichtes
Fünfhundert-Dollar-T-Shirt, er eine Stoffhose,
ein dunkelbraunes Hemd und eine noch dunkel-
braunere Samtjacke. Sein schwarzes Brillengestell
war original Fünfzigerjahre.
Ich hielt die beiden für Kunsthändler, die
Frau zudem für eine Künstlerin. Es war ihr
zweiter Jahrestag. Sie versuchte, ihm ihre schwar-
zen Fettuccine mit Tintenfisch zum Kosten zu
geben.
Ja, ich spielte das Jane-und-Michael-Spiel. Und,
ja, ich merkte es nicht einmal. Und, ja, verdammt,
Hugh hatte sich an diesem Abend bereits eine Vier-
telstunde verspätet. Es war nicht das erste Mal –
besonders nicht in letzter Zeit. Hm, eigentlich war
das schon immer so, seit ich mit ihm zusammen
war.
57/346

ELF
Ich zog mein Handy aus der Tasche und legte es auf
den Tisch. Dann bestellte ich einen köstlichen
Bellini, an dem ich nippte, während ich auf mein-
en Freund wartete.
Hugh war schon eine halbe Stunde zu spät. Ver-
dammter Kerl.
Schließlich wurde mir klar, dass es bereits das
dritte Mal nacheinander war, dass Hugh erheblich
zu spät kam, ohne mich anzurufen. Ich versuchte
mir Sorgen zu machen, mir einzureden, er wäre
von einem Taxi angefahren worden und läge viel-
leicht
im
Krankenhaus,
wäre
überfallen
worden, doch rasch merkte ich, dass nur Wut aus
mir sprach.
Hugh war vielleicht im Sportstudio. Er war be-
sessen davon, in lächerlich guter Form zu bleiben.
Wie könnte ich etwas dagegen haben?
Hugh war mittlerweile genau eine Stunde zu
spät. In so guter Form braucht niemand zu sein.
Und ich war von meinem zweiten Bellini schon
leicht benommen und hungrig.
»Vielleicht könnte ich Ihnen eine kleine Vor-
speise bringen, Miss Margaux?«, fragte mein

Lieblingskellner. Er war wirklich immer nett und
erinnerte sich jedes Mal an mich. Schließlich kam
ich schon seit Jahren hierher.
»Wissen Sie, ich denke, ich werde bestellen.«
Ich erinnere mich, Hunger gehabt zu haben –
und dann, satt gewesen zu sein. Ich erinnere mich,
nach unten geblickt und meine Hand mit dem Löf-
fel gesehen zu haben, auf dem sich eine Art vollen-
deter Schokoladenpudding befand. Ich erinnere
mich, dass der Kellner eine kleine Tasse Espresso
und einen Teller Kekse vor mich gestellt hatte.
»Ich habe das Essen auf Ms. Margaux’
Rechnung gesetzt«, sagte der Kellner. »Es war
nett, Sie wiederzusehen. Ich hoffe, es hat Ihnen
geschmeckt.«
»Es war alles ganz wunderbar.« Hm, vielleicht
doch nicht alles.
Ich trat in den kühlen Manhattan-Früh-
lingsabend hinaus. Allein. Meine Wangen glüht-
en, doch ob von den Bellinis oder der Erniedrigung,
wusste ich nicht. Ich lebte in dem alten Klischee,
dass alle anderen fabelhaft aussehen, wenn das ei-
gene Liebesleben auseinanderbricht. Musste ich mir
wirklich ein Pärchen mittleren Alters ansehen, das
im Park händchenhaltend spazieren ging? Oder
die Jugendlichen, die nur ein paar Schritte von mir
59/346

entfernt stehen blieben und sich wild küssten?
Nein! Warum waren plötzlich alle in New York so
wahnsinnig verliebt, während ich allein mit vor
der Brust verschränkten Armen umhergeisterte?
Mein Handy klingelte.
Hugh! Natürlich war es Hugh. Und als
Entschuldigung würde er … ja, wie würde
seine Entschuldigung heute lauten?
»Hallo?« Vielleicht etwas zu sehr gekeucht?
Zu Bellini-fiziert?
»Jane Margaux?«, fragte die Stimme am an-
deren Ende.
»Ja, hier ist Jane«, bestätigte ich, ohne die
Stimme zu erkennen.
»Hier ist Verizon Wireless, wir würden Ihnen
gerne von unseren neuen Telefontarifen erzählen
…«
Ich klappte das Telefon zu und ließ es zurück
in meine Tasche gleiten. Ich wünschte, zu der Art
von Menschen zu gehören, die es fertigbrachte, es
einfach in den nächsten Abfalleimer zu werfen.
Natürlich würde ich es dann wieder herausfis-
chen müssen, und natürlich würde genau in
dem Moment ein Bekannter vorbeikommen,
während ich im Müll wühlte, und dann
wäre der Tag perfekt.
60/346

Ich schluckte und spürte bereits die Tränen
hinter meinen Augen. Perfekt – auf der Straße
weinen. Eine neue Art von Tiefpunkt, auch für
mich.
Ich war eine jämmerliche Verliererin. Je eher
ich mich der Wahrheit stellte, desto besser. Tat-
sache war, ich befand mich auf der Seite jenseits der
dreißig, ich arbeitete für meine Mutter, und ich
gehörte zu der Art von Frauen, die von ihrem wun-
derbaren, für sie viel zu guten Freund im Res-
taurant sitzengelassen wurden. Ja, genauso war es.
61/346

ZWÖLF
Michael verputzte gerade seinen zweiten Hot Dog.
Er genoss ihn in vollen Zügen. Mann, hatte er ei
nen Hunger. Einen Heißhunger! Und Gott sei
Dank brauchte er sich keine Sorgen über die Kal-
orienzufuhr zu machen.
Er war zwischen zwei Aufträgen wieder in New
York und schlug die Zeit tot. Er ging aus, hatte sein-
en Spaß, wartete, was er als Nächstes zu tun
bekommen würde. Er hatte bereits alle neuen
Filme gesehen und die besten Museen besucht –
unter anderem das Museum of the American Indian
in Washington Heights -, er war in den meisten
Donutläden und Cafés auf der Insel von Man-
hattan gewesen, zielstrebig auf der Suche nach dem
alten Krapfenrezept. Ach ja, und er nahm
Boxunterricht.
Genau, Boxunterricht. Im Lauf der Jahre hatte er
so viele Dinge entdeckt, die ihm gefielen. Bei eini-
gen davon hatte er früher gedacht, sie würden
ihm überhaupt nicht gefallen. Wie zum Beispiel
Boxen. Aber es war ein wahnsinniger Sport, und er
half einem, das Selbstbewusstsein aufzubauen. Und
sich seiner selbst bewusst zu werden. Außerdem

brachte Boxen ihn auf eine seltsame Weise den
Menschen näher. Manchmal ein bisschen zu nah.
Zwei Abende in der Woche besuchte er ein
schäbiges Sportstudio im zweiten Stock an der
Eighth Street, wo ihm ein Schwarzer mit nach
Whiskey und Pfefferminz riechendem Atem bei-
brachte, wie er ordentlich zuschlagen, sich vor
einem Angriff schützen und sich an seinen Gegn-
er ranmachen musste, um ihm einen linken Haken
nach dem anderen zu verpassen.
Er hatte sich an die achtzehnjährigen Schwar-
zen und Latinos gewöhnt, die ihm seine Nase
blutig schlugen. Und auch daran, von seinen
Sparring-Partnern, die ihn trotzdem zu mögen
schienen, »Alter« genannt zu werden. Klar, jeder
mochte Michael. Das war schließlich seine
Aufgabe.
Aber an den kräftigen Appetit, der ihn an-
schließend immer überfiel, hatte er sich noch
nicht gewöhnt. Der Hunger danach war so heftig,
dass er nur durch drei oder vier Hot Dogs und
mindestens zwei große Becher Schokomilch
gestillt werden konnte, die er sich auf der Straße
kaufte.
Nachdem er an diesem Abend seine Hot Dogs
und
Schokomilch
bestellt
hatte,
dachte
er
63/346

darüber nach, wie nett es war, wieder in New
York zu sein. Er hatte gerade in Seattle die
Betreuung
eines
sechsjährigen
Jungen
abgeschlossen, dessen lesbische Eltern in der Kin-
dererziehung genauso viele Fehler machten wie alle
anderen auch. Sie kümmerten sich viel zu sehr
um ihren Sam – zu viel Musikunterricht, zu viele
Sportstunden, zu viele Nachhilfelehrer und zu oft
die Frage: »Wie fühlst du dich damit, Sam?«
Der Junge setzte Michaels »höfliches Durch-
setzungstraining« in die Tat um, und den beiden
Müttern gefiel es sogar, dass Sam in letzter Zeit
viel lebhafter geworden war. Michael hatte ihm ge-
holfen, derjenige zu sein, der er war. Schließlich
hatte Michael den Jungen, der sich nicht mehr an
ihn erinnern würde, verlassen müssen. Aber so
lief die Sache nun einmal. Michael hatte keinen Ein-
fluss darauf.
Jetzt hatte Michael so etwas wie Urlaub, hatte
seinen Spaß, blickte sich nach Mädchen um,
fuhr mit dem Fahrrad durch den Central Park, aß
alles, was ihm schmeckte, ohne ein Gramm zuzun-
ehmen. Und er tat, was ihm gerade in den Sinn
kam, und ließ sich zweimal die Woche verprü-
geln. Nein, das war nicht zu schlagen.
64/346

Als er den letzten Schluck seiner Schokomilch
nahm, ging eine Frau an ihm vorbei. Automatisch
blickte er ihr nach, betrachtete sich ihre Kurven.
Das war nichts Neues. In New York blickte er im-
mer hinter den Frauen her. Diese hier wirkte, als
würde sie versuchen, tapfer zu sein und das Beste
aus ihrer Situation zu machen. Lächelnd erinnerte
er sich plötzlich an die Art, wie die kleine Jane
Margaux …
Aber da …
Eine bestimmte Drehung des Kopfes …
Die Art zu gehen … irgendwie »heiter«.
Das war komisch … nein, das konnte nicht sein.
Aber wie sie die Arme schwang …
Hm, vielleicht … ein Blick in seine Richtung.
Diese Augen. Nein, nicht auch noch diese Augen!
Sie war es! Sie musste es sein. Aber das war doch
nicht möglich.
Oder doch?
Ihr Haar war nicht gelockt wie damals bei dem
Mädchen, aber es war immer noch blond. Sie trug
einen lockeren schwarzen Mantel, ihre große
Ledertasche
war
halb
Handtasche,
halb
Aktentasche.
Michaels Kiefer klappte nach unten. Es war völ-
lig unmöglich, aber es musste Jane sein!
65/346

O Gott, dies war seine Jane Margaux! Dort ging
sie, keine fünfzehn Meter von ihm entfernt.
Der Hot-Dog-Verkäufer blickte ihm mis-
strauisch nach, als Michael sich vom Stand
fortschlich.
So etwas war ihm noch nie passiert, wunderte
sich Michael. Noch nie war er einem seiner Kinder
als Erwachsenem begegnet.
Jane ging langsam und schien in Gedanken ver-
sunken zu sein. Also verfolgte er sie ebenso lang-
sam, während er versuchte zu entscheiden, was er
als Nächstes tun sollte. Ihm kam nichts in den
Sinn – keine Worte, keine Idee, kein gar nichts.
An der Ecke Sixth Avenue und Eighth Street
winkte sie nach einem Taxi und erwischte auch so-
fort eines. Sie rannte los, sprang hinein und schlug
die Tür zu. Michael zögerte, auch wenn er
wusste, was er eigentlich tun sollte – sie fahren
lassen und die Sache als seltsamen Zufall abtun.
Aber genau das tat er nicht. Stattdessen hielt er
das nächste Taxi an, das die Eighth Street entlan-
graste. Dem Fahrer sagte er etwas, was er schon im-
mer hatte sagen wollen: »Folgen Sie diesem
Taxi!«
Folgen Sie Jane.
Er konnte nicht anders.
66/346

DREIZEHN
Der Taxifahrer drückte gleich so kräftig aufs
Gaspedal, dass Michaels Kopf gegen die Kopf-
stütze gedrückt wurde. Diese Situation war
völlig absurd. Wieso traf er auf eines seiner
Kinder, das erwachsen geworden war? Das war ihm
noch nie passiert. Warum gerade jetzt? Was hatte
das zu bedeuten? Mit geschlossenen Augen betete
er, erhielt aber wie üblich keine Antwort. Zu-
mindest in dieser Hinsicht erging es ihm wie allen
anderen auch – er hielt sich hier an diesem Ort
aus irgendeinem Grund auf, den er aber nicht kan-
nte. Eines war jedoch sicher: Je länger er hier war,
desto »menschlicher« fühlte er sich. War dies
der springende Punkt – dass er menschlicher
wurde? Wozu sollte das gut sein?
Und was wusste Michael schließlich über sich
selbst? Jedenfalls nicht so viel, wie er gerne wissen
würde. Er hatte ein begrenztes Gedächtnis
für die Vergangenheit, konnte sich nur versch-
wommen
an
Gesichter
und
unbestimmte
Zeiträume erinnern. Er hatte keine konkrete Vor-
stellung, wie lange er schon diese Arbeit machte
oder um wie viele Kinder er sich gekümmert

hatte. Mit Sicherheit wusste er, dass er seine Arbeit
liebte, vielleicht bis auf im Durchschnitt einen Tag
im Monat. Und im Durchschnitt blieb er vier bis
sechs Jahre lang bei einem Kind, bevor er gehen
musste, ob er wollte oder nicht. Oder ob ihn das
Kind gehen lassen wollte oder nicht. Dann hatte er
eine kleine Pause, wie jetzt. Eines Tages würde er
in einer anderen Stadt aufwachen, und in seinem
Innern würde er wissen, um welches Kind er sich
kümmern musste. Andererseits wurden alle seine
Bedürfnisse befriedigt. Er war kein richtiger
Mensch, aber auch kein Engel – er war nur ein
Freund. Allerdings ein verdammt guter.
In der Zwischenzeit jagte das Taxi mit Jane die
Sixth Avenue hinauf.
Es bog nach rechts auf die Central Park South, ge-
folgt von Michaels Taxi.
Wieder nach links auf die Park Avenue.
Fuhr sie in die Wohnung ihrer Mutter? Oh, Jane,
nicht! Sag nicht, du wohnst noch bei deiner Mutter!
Er zuckte zusammen, als ihm klar wurde, dass ihr
zu folgen ein schrecklicher Fehler war. Er erinnerte
sich an Vivienne Margaux, an ihr Ego, das größer
war als ihre Persönlichkeit. Sie hatte die Sonntag-
nachmittage mit Jane verbracht und sie hin und
wieder auf die Wange geküsst, aber das war’s
68/346

dann auch gewesen. Janes Schule war eineinhalb
Straßenblocks
von
der
Wohnung
entfernt
gewesen, doch Vivienne hatte sie kein einziges Mal
dorthin begleitet.
Michael stöhnte, als Janes Taxi vor der 535 Park
Avenue hielt – doch sie stieg nicht aus.
Stattdessen trat der Portier ans Fenster. Er schien
glücklich zu sein, sie zu sehen, warf ihr ein
breites Lächeln zu und tippte an seinen Hut. Jane
wirkte weniger traurig, als er zurücklächelte
und ihr zwei große Briefumschläge reichte. Die
beiden klatschten sogar gegenseitig ab.
Dann fuhr Janes Taxi weiter.
Okay. Zumindest wohnte sie nicht mehr bei Vivi-
enne. Michaels Taxi folgte, bis das von Jane an der
Ecke 57th Street und Park Avenue hielt. Der Portier
trat an den Wagen und öffnete ihre Tür.
Michael reichte dem Taxifahrer rasch einen
Zwanzig-Dollar-Schein, ließ Jane aber nicht aus
den Augen. Sie schnappte sich ihre Tasche und legte
sich ihren schwarzen Mantel über den Arm.
Sie sah, nun ja, hinreißend aus. Sehr erwachsen.
Sehr attraktiv. Es war komisch, die kleine Jane Mar-
gaux so zu sehen. Als Frau. Jane lächelte den
Portier herzlich an, er lächelte zurück. Sie war
dieselbe alte Jane, wie Michael sie gekannt hatte.
69/346

Jedem gegenüber freundlich, mit jedem gut Fre-
und. Immer ein Lächeln für ihr Gegenüber.
Michael stellte sich hinter einen riesigen Blumen-
kübel. Er kam sich lächerlich vor wie ein Kind,
das jemandem nachspioniert, doch irgendetwas
zwang ihn zu bleiben. »Mr. McGrath ist vorbei-
gekommen«, berichtete der Portier. »Ich sollte
Ihnen ausrichten, falls Sie vorher noch nach Hause
kommen, dass er heute Abend vielleicht nicht zum
Essen kommen würde.«
»Danke, Martin. Aber er hat es doch noch
geschafft«, erwiderte Jane, biss sich allerdings auf
die Lippen.
Der Portier blieb mit der Hand an der schweren
Glaseingangstür
stehen.
»Wirklich,
Miss
Jane?«
Jane seufzte. »Nein, Martin, er kam nicht.«
»Miss Jane, Sie wissen, was ich denke.«
»Ich weiß, ich weiß. Ich bin ein Einfalltspin-
sel. Ein Idiot.«
»Nein, Miss Jane«, widersprach der Portier
energisch. »Mr. McGrath ist der Idiot, wenn Sie
mir verzeihen. Sie verdienen jemanden Besseren als
ihn.«
Michael hinter dem Pflanzkübel konnte dem
nur zustimmen. Jane hatte ihrem Gegenüber die
70/346

Stirn geboten! Jetzt war er sich absolut sicher, dass
diese Frau seine Jane von damals war. Er hatte sie
ohnehin auch an ihrer Stimme erkannt. Sie klang
reifer, tiefer, hatte aber noch ihre charakteristische
Färbung. Und nach all der Zeit ließ sich Jane im-
mer
noch
verletzen.
Ihre
Mitmenschen
enttäuschten sie immer noch, behandelten sie
nicht wie den wertvollen Menschen, der sie war.
Was sollte das? Wie konnte jemand sie verletzten?
Und auch Michael war einer derjenigen gewesen,
der sie verletzt hatte, musste er sich beschämt
eingestehen. Er hatte ihr wehgetan. Doch er hatte
keine andere Wahl gehabt! Er hätte daran nichts,
absolut gar nichts ändern können! Jedenfalls
hatte sie ihn ohnehin am nächsten Tag vergessen.
Damit zählte die Tatsache, dass er sie verletzt
hatte, eigentlich nicht. Anders als die Sache mit
diesem fiesen McGrath.
Aber warum war Michael ihr wiederbegegnet?
Sie hatte das Haus betreten, in dem sie wohnte.
Doch plötzlich stand Martin, der Portier, neben
dem Pflanzkübel und blickte misstrauisch auf Mi-
chael hinab.
»Kann ich Ihnen helfen, Sir?«
71/346

Michael zuckte zusammen und richtete sich auf.
»Nein … äh, danke. Das bezweifle ich. Ich gehe
lieber mal weiter.«
»Ja, Sir. Ich dachte gerade das Gleiche.«
72/346

VIERZEHN
Meine Mutter hatte alles getan, außer sich tat-
sächlich vor die Wohnungstür zu werfen, um
mich davon abzuhalten, nach dem College von zu
Hause auszuziehen.
»Ausziehen? Quatsch! Warum, um alles auf der
Welt, solltest du ausziehen? Raoul ist hier! Ich bin
hier! Jane-Herzchen, mit mir und Raoul und dem
chinesischen Restaurant auf der Lexington hast du
alles, was du dir wünschen kannst.«
Ja, Mutter. Alles außer Privatsphäre, ein
Leben und vielleicht meine Gesundheit.
»Du kommst ohne mich nicht zurecht!«, hatte
Vivienne behauptet. »Wer wird dir helfen, deine
Kleider auszusuchen? Dich daran erinnern, dich an
deine Diät zu halten? Dich bei deinem praktisch
nicht vorhandenen Liebesleben unterstützen?
Ach, was mich daran erinnert – meine Freundin
Tori hat mir die Nummer von ihrem Cousin
gegeben, und ich glaube wirklich, du solltest ihn
mal anrufen – anscheinend ist er ein sehr erfol-
greicher Ohrenarzt. Aber, Jane-Herzchen …«
Das
hatte
mich
schließlich
in
meiner
Entscheidung endgültig bestätigt.

Als die Männer von der Umzugsfirma meine
Biedermeierkommode durch die Tür trugen,
hatte Vivienne eine Teilniederlage – aber wirklich
nur eine Teilniederlage – eingestanden. »Wir
werden es ein paar Monate versuchen, Jane-
Herzchen. Und wenn es nicht funktioniert, kannst
du deine Wohnung untervermieten und zurück-
kommen.«
Egal, wie sehr ich meine neue Situation hassen
würde – zurück zu meiner Mutter stand
nicht zur Debatte. Nicht einmal, wenn ich jeden
Abend beim Einschlafen einsam in mein Kissen
würde weinen müssen. Es würde immer
noch mein Kissen in meiner Wohnung sein, und
niemand würde hereinspaziert kommen und
mich fragen, welche Ohrringe zu welchem Kleid
passten.
Schließlich hatte Vivienne beschlossen, auf ihre
Art das Beste daraus zu machen. Als ich zwei
Wochen auf Geschäftsreise gewesen war, hatte sie
meine neue Wohnung völlig renovieren lassen. Bei
der Rückkehr in meinen kleinen Privathafen war-
en Wohn- und Schlafzimmer weiß in weiß
gestaltet, genau wie ihre Wohnung. Die Küche,
die ich ausschließlich benutzte, um mitgebrachtes
Essen
aufzuwärmen,
war
wie
eine
74/346

Restaurantküche ausgestattet: Profiherd, Warm-
halteherd, zwei Spülmaschinen, Kühlschrank
mit Glastür und hübscher Anzeige. Ein ein-
samer Becher fettfreier Jogurt schimmerte durchs
Glas.
Ich war viel zu überwältigt gewesen, um die
Umgestaltung rückgängig zu machen. Doch ich
hatte ihr meine persönliche Note hinzugefügt
– mit einem Foto von meiner Mutter, meinem
Vater und mir, als ich noch sehr klein gewesen war.
Wir standen in Griechenland vor dem Parthenon
und lächelten sogar. Waren wir wirklich so eine
glückliche Familie gewesen, wenn auch nur für
einen Tag? Oder einen Augenblick? Der Glaube
daran gefiel mir.
Also hatte ich das Foto gleich in den vorderen
Flur gehängt. Meine Mutter hatte es sofort bei ihr-
em nächsten Besuch entdeckt. »Ich würde dir
eine meiner weniger wertvollen Picasso-Zeichnun-
gen geben, damit du sie statt dieses sentimentalen
Mülls hier aufhängst«, hatte sie mit gerüm-
pfter Nase gesagt.
Jedes Mal, wenn ich nach Hause kam, lächelte
ich das Foto an.
Aber nicht an diesem Abend.
75/346

Ein bisschen angespannt von den Bellinis im
Babbo, verletzt von Hughs ständiger Gedanken-
losigkeit und geplagt von dem schlechten Gewissen,
zu viel gegessen zu haben, schaltete ich im Flur das
Licht ein und blickte auf diese glückliche Familie
vor dem Parthenon. Aus irgendeinem Grund gelang
es mir nicht, mich besser zu fühlen.
Der Anrufbeantworter im Schlafzimmer sagte
mir, ich hatte drei Nachrichten. Ich drückte die
Abspieltaste. Komm schon, Hugh. Mach die Sache
wieder gut. Sag mir, dass du im Krankenhaus bist.
Muntere mich auf.
»Jane-Herzchen, wo, um alles auf der Welt,
steckst du? Bist du da – und hörst zu? Geh ran,
Schatz. Komm schon, geh ran. Mir ist gerade etwas
völlig Geniales eingefallen …«
Ich drückte die Löschen-Taste und hörte
mir die nächste Nachricht an.
»Dies ist eine Erinnerung vom The Week
Magazine. Ihr sechsmonatiges Gratisabonnement
…«
Wieder die Löschen-Taste.
Die letzte Nachricht. Sie stammte von meiner al-
ten Mitbewohnerin aus der College-Zeit.
»Jane, hier ist Colleen. Sitzt du gerade?«
76/346

Ja, auf der Bettkante, wo ich mir vorsichtig die
Schuhe auszog.
»Also,
ich
habe
echt
ungewöhnliche
Neuigkeiten. Ich heirate wieder. Nachdem Dwight
und ich uns haben scheiden lassen, dachte ich, ich
würde nie wieder jemanden kennenlernen oder
haben wollen. Aber Ben ist toll. Ehrlich. Ich
schwör’s. Warte, bis du ihn kennenlernst. War
nie verheiratet und arbeitet hier in Chicago. Die
Hochzeit ist am zwölften September, und du
musst als Brautjungfer dabei sein. Ich versuch’s
morgen noch mal bei dir. Hoffe, bei dir ist auch
alles in Ordnung. Ach ja, ich schreibe wieder
Kurzgeschichten. Hurra! Ich hoffe, dir geht’s
gut.«
Ich freute mich für Colleen, ehrlich. Sie hatte
ihr ganzes Leben nur schreiben und eine Familie
haben wollen, jetzt bekam sie in beiden Fällen
eine neue Chance. Ja, hurra! Und wie ich mich
für sie freute. Echt. Na ja …
Ich ging ins Badezimmer, entfernte Lidschatten
und Mascara mit einem von diesen »ölfreien
Hyperallergen-Augenpads« und wusch mir das
Gesicht
mit
Cawell-Massey-Mandelseife
–
»Wenn sie gut genug für Jackie Kennedy war,
77/346

ist sie auch gut genug für dich«, hatte meine
Mutter gesagt.
Dann ging ich ins Bett, schaltete meinen Laptop
ein und begann, mir Notizen für den Vertrag zu
meinem Film zu machen. Ich würde sie noch an
diesem Abend Viviennes Anwalt schicken, der da-
raus einen juristisch hieb- und stichfesten Vorsch-
lag an Karl Friedkin basteln würde.
Eine Stunde später klappte ich den Laptop
wieder zu. Ich war viel zu müde, um noch einen
vernünftigen Gedanken auf die Reihe zu bekom-
men, und hoffte, meine Notizen ergaben einen Sinn.
Ich stand auf und ging barfuß durch die
Wohnung. In der Küche schenkte ich ein Glas
Wasser ein, das meine Mutter aus Schweden hatte
anliefern lassen. Nach mehreren anständigen
Schlucken kribbelten meine Finger vor Verlangen.
Ich stellte das Glas ab.
Jane, sei stark.
Ich blickte zu den Schranktüren unterhalb der
Landhaus-Steinspüle.
Streckte die Hand aus.
Geh nicht hin, Jane. Tu das nicht.
Ich öffnete die Schranktür unter der Spüle.
Du blickst in den Abgrund. Tritt zur Seite! Es ist
noch nicht zu spät!
78/346

Ich kniete mich nieder. Und da ich mich auf eine
Anbetung vorbereitete, war dies die passende
Stellung.
Ich griff hinter die Topfreiniger, hinter das
Spülmittel, hinter die Scheuermilch zu meinem
geheimen Vorrat an Doppelkeksen. Auf der
Schachtel stand: »Nur für den Notfall!«
Genau. Dieser Abend wies alle entscheidenden
Merkmale eines Notfalls auf.
Langsam aß ich vier Doppelkekse, genoss jeden
Bissen, die perfekte Kombination aus Schokoladen-
teig und süßer, cremiger Füllung.
Nachdem ich mein Ritual beendet hatte, ging ich
wieder ins Schlafzimmer.
Mit zwei weiteren Doppelkeksen in der Hand.
Sie waren weg, noch bevor ich den Kopf aufs Kis-
sen sinken ließ.
79/346

FÃœNFZEHN
Michaels Wohnung lag in SoHo, einem seiner
Lieblingsviertel von New York City. Oder vielmehr
von allen Städten. Wie seine Kollegen verfügte
auch er über ein gewisses Maß an freiem Willen
und konnte die meisten Entscheidungen selbst tref-
fen. Er brauchte nur seine Arbeit zu erledigen, eine
Mission zu erfüllen – als imaginärer Freund
für Kinder. Die Arbeit war gar nicht schlecht.
Manchmal sprach er es laut aus: »Ich liebe meine
Arbeit.«
Trotzdem genoss er die Pausen zwischen zwei
Aufträgen, zwischen zwei Kindern. Es ließ sich
nicht sagen, wie lange die Pause dauern würde,
weswegen er gelernt hatte, aus jedem Tag das Beste
herauszuholen, im Moment zu leben, all das zu tun,
wovon die Leute gerne redeten, besonders im
Fernsehen, das sie aber oft nicht umsetzen konnten.
An diesem Abend kam er gegen elf nach Hause,
völlig aufgewühlt, weil er Jane gesehen hatte
– die erwachsene Jane. Es war ein großer
Schock für ihn gewesen. Jane Margaux. Puh.
Als Michael auf dem Weg in den dritten Stock den
zweiten Treppenabsatz erreichte, spürte er, wie

die Treppe von Rockmusik vibrierte. Kein Zweifel,
aus welcher Wohnung sie stammte: oben aus der
von Owen Pulaski.
Owen Pulaski. Michael war sich nicht sicher, was
er von diesem rücksichtslosen, unbekümmer-
ten, flegelhaften Mann, der nicht erwachsen werden
wollte, halten sollte. Klar, er war freundlich, offen,
immer bemüht. Als Michael im dritten Stock
ankam, begrüßte Owen gerade zwei Frauen an
seiner Wohnungstür. Die Frauen waren groß,
schlank und unmenschlich prachtvolle Wesen, und
sie hatten über das gelacht, was Owen ihnen
gerade erzählt hatte. Owen war fast einsneunzig
groß und kräftig, und seinem jungenhaften
Lächeln konnte man, wie Michael vermutete, nur
schwer widerstehen.
»Mikey, komm rein und feiere mit. Wenn du
nein sagst, bin ich beleidigt«, rief Owen quer
über den Flur.
»Danke, danke, aber ich bin heute Abend ziem-
lich fertig«, wehrte sich Michael, doch Owen war
bereits auf ihn zugekommen und legte seinen Arm
um ihn.
»Das ist Claire De Lune, und das ist Cindy
Two«, stellte Owen die beiden Augenweiden vor.
»Sie studieren an der Columbia – ich glaube
81/346

Columbia. Sie sind ziemlich gute Studentinnen und
arbeiten nebenher als Models. Meine Damen, das
ist Michael. Prima Kerl. Er ist Chirurg im New York
Hospital.«
»Ich bin nirgendwo Chirurg«, stellte Michael
klar, als er in Owens volle, laute, überhitzte
Wohnung gezogen wurde.
»Hallo«,
grüßte
ihn
die
große
Brünette, die von Owen als Claire De Lune
vorgestellt worden war. »Ich bin Claire … Parker.
Owen ist, nun ja, Owen.«
Michael verzog seine Lippen zu so etwas wie
einem Lächeln. »Hallo, Claire. Und? Alles
klar?«
»Nein, eigentlich nicht, aber lassen wir das. Wir
haben uns schließlich eben erst kennengelernt.«
Michael spürte die Sorge, von der das Mäd-
chen aufgewühlt wurde, und konnte nicht wider-
stehen.
Immer,
wenn
er
einer
einsamen,
niedergeschlagenen Seele begegnete, wollte er ihr
irgendwie helfen. War dies sein Schwachpunkt?
Seine Art? Er hatte keine Ahnung und aufgehört
– jedenfalls in den meisten Fällen -, sich über
Dinge Sorgen zu machen, die er nicht beeinflussen
konnte.
82/346

»Nein, wir lassen das nicht. Mich interessiert
das«, widersprach er Claire.
»Klar interessiert dich das.« Sie lachte. Je-
mand ging vorbei und drückte ihnen Getränke
in die Hand. Wieder lachte sie. »Jungs lieben es,
sich unsere Probleme, unsere Gefühle und diesen
Kram anzuhören.«
»Ja, ich tue das wirklich. Reden wir.«
Also lauschte Michael in einer winzigen Ecke vom
Flur, der in die Küche führte, länger als eine
Stunde der Lebensgeschichte von Claire Parker. Sie
stand in dem Konflikt, nach ihrem Studium Lehrer-
in werden zu wollen, sich aber von dem Geld an-
gezogen zu fühlen, das sie plötzlich als Model
bei der Ford Agency verdiente.
Schließlich blickte sie in seine Augen und
lächelte ihn sehr lieb an. »Michael«, sagte sie,
»auch wenn du kein Chirurg bist und ich nicht
Claire De Lune bin, willst du trotzdem zu mir nach
Hause mitkommen? Meine Mitbewohnerin ist zu
Aufnahmen in London, und meine Katze gehört
nicht zu den eifersüchtigen Typen. Hast du Lust?
Sag ja.«
83/346

SECHZEHN
Ehrlich oder offen oder was auch immer gesagt, war
dies nicht das erste Mal, dass Michael so etwas
passierte, vor allem während seiner Pausen, aber
manchmal auch während eines Einsatzes. Aber
auf jeden Fall konn te er Entscheidungen treffen, er
hatte ein Leben und war nicht unzugänglich für
Schönheit.
»Ich wohne hier auf demselben Stock gleich ge-
genüber«, sagte er zu Claire.
Michael hatte die Wohnung gemietet, sie war
ziemlich ordentlich und hübsch eingerichtet und
gehörte einem Anthropologieprofessor an der New
York City University, der für ein Semester in die
Türkei gegangen war. Michael hatte Talent darin,
tolle Wohnungen zu finden – noch ein Vorzug
seiner Arbeit.
»Du bist dran mit Reden.« Claire zog auf dem
Sofa ihre Beine hoch, machte sich aber nicht die
Mühe, ihre Knie mit dem Rock zu bedecken.
»Komm, setz dich«, forderte sie Michael auf und
klopfte auf das Kissen neben sich. »Du musst mir
alles erzählen.« Michael setzte sich, Claire fuhr
mit einem Finger über seine Wange. »Wer ist

sie? Was ist passiert? Warum bist du zu haben? Du
bist doch zu haben, oder?«
Michael lachte, vor allem aber für sich selbst.
»Komisch, dass du fragst. Es gab tatsächlich je-
manden, könnte man sagen. Ich habe sie lange
Zeit aus den Augen verloren, aber ich glaube, heute
Abend habe ich sie wiedergefunden. Irgendwie. Es
ist etwas kompliziert.«
»Das ist es immer.« Claire grinste. »Mich in-
teressiert deine Geschichte, und wir haben den gan-
zen Abend Zeit. Hast du Whiskey? Irgendwas an-
deres Alkoholisches?«
Michael – oder zumindest der Professor –
hatte sehr guten Wein, den er vor seinem Auszug
ersetzen würde. Er öffnete eine Flasche Cay-
mus, dann eine Flasche ZD, während er und die
liebreizende Claire De Lune redeten und redeten,
bis sie um vier Uhr morgens, noch angezogen und
einander in den Armen liegend, einschliefen. Das
war in Ordnung so. Eigentlich sogar perfekt.
Am Morgen machte Michael, der perfekte Mann,
Claire ein Frühstück aus Vollkorntoast, Eiern
und Kaffee. Er war stolz auf seinen Kaffee – diese
Woche gab es einen afrikanischen, im Schatten ge-
wachsenen Kona. Als Claire ging, drehte sie sich um
und legte einen Arm um Michaels Schultern.
85/346

»Danke, Michael, es war sehr schön mit dir.«
Sie beugte sich vor – sie waren beide fast gleich
groß – und küsste Michael auf die Lippen.
»Sie kann sich glücklich schätzen.«
»Wer?«, fragte Michael.
»Jane. Diejenige, von der du heute Nacht
erzählt hast – ab der zweiten Flasche Wein.«
Claire warf ihm ein resigniertes Lächeln zu.
»Viel Glück mit ihr.«
86/346

SIEBZEHN
Morgens um 7:15 Uhr war die Tochter der Chefin
die Allererste im Büro der ViMar Productions –
mit Ausnahme des Postjungen, eines steppenden
britischen Jugendlichen, der, wie ich glaube, derzeit
unter dem Sortiertisch im Postraum wohnte.
In Los Angeles war es vier Uhr morgens, sodass
ich dorthin nur E-Mails schicken oder Nachrichten
auf dem Anrufbeantworter hinterlassen konnte.
Doch in London war es Mittag, was hieß, ich kon-
nte mit Carla Crawley, der Produktionsleiterin der
Londoner Dependance von Dem Himmel sei Dank,
Kontakt aufnehmen. Das Stück war in London
sogar ein noch größerer Erfolg als in New York.
Die Bühnen, die Schauspieler, alles war besser da
drüben.
»Jane, ich bin froh, dass du anrufst. Wir haben
ein kleines Problem. Offenbar mag Jeffrey das neue
Mädchen nicht, das wir gecastet haben.«
Jeffrey war Jeffrey Anderson, der britische Sch-
warm in der Rolle von Michael.
»Jeffrey sagt, er kommt mit diesem neuen
Mädchen nicht zurecht. Aber glaub mir, Jane, das
Mädchen ist brillant, ein echter Schwarm. Das

Beste ist, sie ist elf Jahre alt, sieht aber aus wie acht,
sie kann also sprechen.«
»Hör mal, ruf Jeffreys Agent an und schlag
vor, man soll ihm den Teil in seinem Vertrag noch
einmal vorlesen, in dem es heißt, er muss mit
einem dreibeinigen Affen als Partner spielen, wenn
wir das von ihm verlangen.«
»Ich werde es weitergeben, Vivienne junior«,
sagte Carla Crawley und lachte. Ein Schauer lief mir
den Rücken hinab. Vivienne junior. Oh Gott, sag,
dass das nicht wahr ist.
88/346

ACHTZEHN
Um Punkt 9:00 Uhr tauchte MaryLouise, meine
persönliche
Assistentin,
im
Büro
auf.
MaryLouise: völlig ehrlich, total sarkastisch,
tiefster Bronx-Akzent diesseits der Throgs Neck
Bridge.
»Morgen, Janey«, grüßte sie, als sie einen
Stapel Post und Telefonnachrichten auf meinen Be-
sprechungstisch fallen ließ. »Du wirst sicher
wieder Mitarbeiterin des Monats.«
»Morgen. Ich bin doch echt bemitleidenswert,
oder? Bitte darauf keine Antwort.« Ich blätterte
durch die Telefonnachrichten, sortierte sie nach
»Feuer – muss gelöscht werden«, »Rauch
– im Auge behalten« und »zurückrufen,
wenn du unbedingt bestraft werden willst«.
»Übrigens brennt in Godzillas Büro noch
kein Licht.« MaryLouise ließ eine Kaugum-
miblase knallen.
»Du weißt doch, dass sich Vivienne am Dien-
stagmorgen immer ihre Haare machen lässt.«
»Ach, du meinst, dieses Neongelb mit dem rosa
Unterton ist nicht natürlich?«, MaryLouise
prustete los. »Brauchst du Kaffee?«

Bevor ich antworten konnte, hörte ich vor
meinem Büro zwei eindeutig bekannte Stimmen.
Die von meiner Mutter und die von Hugh. Im
gleichen Moment spürte ich ein Brennen im
Magen.
»Mein süßer Hugh-du-du-du«, säuselte
Vivienne mit einer Mädchenstimme, bei der sich
immer meine Fußnägel hochbogen. »Wo warst
du, als ich nach meinem Ehemann Nummer vier ge-
sucht habe?«
Vielleicht in der Grundschule, dachte ich.
Dann stand Vivienne vor mir – mit Hugh, der
in der Hand einen Strauß weißer Rosen hielt, der
ihn um zweihundert Dollar ärmer gemacht haben
musste.
»Schau mal, wen ich mitgebracht habe.
Höchstwahrscheinlich den hübschesten Mann
in New York.« Vivienne beugte sich vor, um mir
meinen Guten-Morgen-Kuss auf die Wange zu
drücken. Sie hatte mit Hugh nicht völlig Un-
recht. Wie er dort mit zerzaustem, blondem Haar,
Bartstoppeln, ausgebleichten Jeans und grauem
Kapuzenpullover stand, sah er genauso aus, wie ein
Hauptdarsteller aussehen sollte. Er war eindeutig
ein Traum, eine Augenweide, ein Womanizer. Und
theoretisch sogar meiner.
90/346

»Es tut mir leid. Es tut mir ja so, so leid,
Jane.« Er schaffte es, wenigstens annähernd
glaubhaft und ernst zu klingen. Auch wenn ich ihm
am liebsten eins über die Birne gezogen hätte,
beschloss ich, die Sache etwas lockerer anzugehen.
»Was tut dir denn so leid?«, fragte ich mit
hochgezogenen Augenbrauen.
»Das mit gestern Abend natürlich. Machst du
Witze? Ich habe es nicht ins Babbo geschafft.«
»Halb so wild«, wimmelte ich ab. »Ich habe
nett zu Abend gegessen und noch was gearbeitet.«
»Ich hatte vergessen, dass ich zum Squash ver-
abredet war.«
»Kein Problem. Squash ist dein Leben.« So ein
Quatsch. Spiegel waren sein Leben.
MaryLouise nahm ihm den Blumenstrauß ab.
»Ich werde ein Schwimmbecken suchen, um sie
hineinzustellen.«
Nach kurzem, viel sagenden Sechstklässler-
Räuspern und übertriebenem Augenrollen ver-
ließ auch meine Mutter endlich das Büro. Hugh
schloss die Tür hinter ihr. Ich runzelte die Stirn.
Was sollte das? Schließlich umfasste er meine
Schultern und küsste mich auf den Mund. Ich
ließ ihn auf eine Art gewähren, wofür ich mich
hätte selbst in den Hintern beißen können. Ich
91/346

wette, sogar einer von den Anonymen Harmon-
iesüchtigen hätte mir einen Korb gegeben. Aber
Hugh konnte einfach zu gut küssen, und wenn
seine grünen Augen dabei in meine blickten, be-
nebelte mich sein erotisches Parfüm.
»Es tut mir wirklich leid, Jane.« Seine Hand
wanderte meinen Rücken auf und ab, und sein
Lächeln war einfach bewundernswert. »Ich liebe
dich doch«, behauptete er mit warmer Stimme
und ultraernstem Blick. Vielleicht sagte er sogar die
Wahrheit.
Er beugte sich vor und hauchte mir Küsse auf
den Hals. Plötzlich wurde mir warm, und ich
fühlte mich sicher, so, wie ich mich mit Michael
immer gefühlt hatte. Hm? Warum, um alles auf
der Welt, dachte ich jetzt an Michael?
Ich lenkte meine Gedanken wieder auf Hugh,
Hugh, der an meinem Hals knabberte. Der lächer-
lich hübsche, bezaubernde, wahnsinnig ro-
mantische Hugh, wenn er es sein wollte.
Dann fiel es mir wieder ein.
Hugh war Schauspieler.
92/346

NEUNZEHN
So etwas hatte Michael noch nie getan – auch
nicht ansatzweise -, doch an diesem Morgen verfol-
gte er Jane in sicherem Abstand, während sie von
ihrer Wohnung in ein Bürogebäude auf der
West 57th Street ging. Er fühlte sich gezwungen,
ihr nachzugehen, aber warum genau, war ihm nicht
klar. Auf der 57th Street erkannte er plötzlich das
Gebäude, in dem sich Viviennes Produktionsfirma
befunden hatte und offenbar immer noch befand.
Oh, Jane, geh nicht da rein! Nicht in die Höhle der
Bösen Hexe von der West Side! Sie wird dich mit
ihrer schwarzen Magie in die Falle locken.
Doch Jane ging hinein.
Und Michael folgte ihr wider besseres Wissen.
Was tust du da, dachte er und sprach es beinahe
laut aus. Jetzt wäre es an der Zeit, umzukehren.
Genau jetzt. Der Wahnsinn ließe sich noch
aufhalten.
Aber er konnte nicht. Und als er seinen Blick
durch die Eingangshalle schweifen ließ, wurde
ihm klar, dass Vivienne noch erfolgreicher ge-
worden war. ViMar Productions nahm bereits zwei

volle Etagen in Beschlag. Vivienne musste böser
geworden sein.
Er beobachtete die erwachsene Jane durch die
Eingangshalle. Sie winkte mindestens einem halben
Dutzend Menschen zu, die lächelnd zurück-
winkten oder kurz mit ihr plauderten. Es
verblüffte ihn, dass sie sich eigentlich nicht ver-
ändert hatte. Sie ließ sich immer noch von an-
deren Menschen enttäuschen, und trotzdem war
sie allen gegenüber nett und freundlich. Sie war
eindeutig bei allen beliebt, die sie kannten. Bei allen
außer diesem Fiesling, der sie am Abend zuvor
versetzt hatte.
Dann verschwand Jane in einen Fahrstuhl. Die
Zahlen über der Tür wechselten in Sekun-
denschnelle von »EG« zu »24«.
In diesem Moment traf Michael eine schicksal-
strächtige Entscheidung – auf Jane zu warten.
Warum? Er wusste es nicht. Würde er versuchen,
mit ihr zu reden? Nein, natürlich nicht. Hm, viel-
leicht doch? Aber nur vielleicht. In der Zwischenzeit
… er war einen Straßenblock entfernt an einem
Doughnut-Laden vorbeigekommen. Die mit Bayr-
ischer Creme machten ihn besonders an.
Nach seiner Doughnut-Pause ging er zurück
und
drückte
sich
in
der
Nähe
des
94/346

Bürogebäudes herum, wo er sich wie ein Span-
ner vorkam. Doch er war unfähig, fortzugehen.
Gegen Viertel nach zwölf öffneten sich die Fahr-
stuhltüren, und sie trat heraus. Aber nicht allein.
Leider hatte ein gut aussehender Kerl seinen Arm
um ihre Taille gelegt, doch Jane befreite sich. Mi-
chael vermutete in ihm diese Flasche McGrath
höchstpersönlich.
Sie verließen, dicht gefolgt von Michael, das Ge-
bäude. Selbst falls sich Jane zufällig umdrehen
sollte, würde sie ihn nicht erkennen. Sie hatte ihn
vergessen. So funktionierte es nun einmal. Michael
versuchte, ungezwungen zu wirken, während er
sich nah hinter ihnen hielt, um sie bei ihrem Ge-
spräch zu belauschen. Sie und McGrath redeten
über etwas, das sich Dem Himmel sei Dank nan-
nte, eine von Viviennes Produktionen, wie Michael
vermutete.
»Jane, Dem Himmel sei Dank ist der Schlüs-
sel zu allem, für das ich gearbeitet habe, aber ich
glaube, du nimmst das nicht ernst«, hörte er
McGrath sagen – oder vielmehr winseln.
»Das stimmt nicht, Hugh«, erwiderte Jane.
»Ich nehme das sehr ernst. Du weißt, wie sehr
mir Dem Himmel sei Dank am Herzen liegt.«
95/346

Hugh. Dieser Kerl hieß Hugh. Vertraue nie
einem Hugh. Jane war mit einem Mann zusammen,
der den lächerlichsten Namen auf diesem Plan-
eten hatte. Hugh-du-du-du .
Kopfschüttelnd folgte Michael ihnen ins Res-
taurant im Four Seasons. Dort ging er an die Bar,
bestellte eine Cola und beobachtete die beiden, wie
sie zu einem Platz geführt wurden. Er wusste,
dass es von Anfang an ein Fehler gewesen war, Jane
zu verfolgen, und mit jeder Minute ging es ihm
schlechter damit.
Am Tisch auf der anderen Seite des Restaurants
beobachtete Michael mit zunehmendem Unmut,
wie Hugh ununterbrochen redete, während Jane
nur zuhörte. Wenn ihr der Widerling keinen Vor-
trag hielt, bearbeitete er seine Umgebung. Hugh,
der einem Zeitschriftenherausgeber die Hand
schüttelte. Hugh, der einer Talkshow-Moderator-
in einen Luftkuss zuwarf. Hugh, der seine unfehl-
baren Kommentare über die Weinliste abgab.
Was sah sie nur in diesem Wichser?
Als Hugh und Jane gerade mit dem Mittagessen
beginnen wollten, trat eine heruntergekommene
Frau an ihren Tisch. Sie entschuldigte sich für die
Unterbrechung und hielt Hugh einen Zettel und
einen Stift für ein Autogramm hin. Das hieß, er
96/346

war prominent. Ein Schauspieler-Schrägstrich-
Model? Ein Wetterfrosch? Hatte er vielleicht in Saw
II mitgespielt?
Er erhob sich, ganz der Charmeur. Widerlich. Mi-
chael konnte es nicht glauben. Janes Hals und
Gesicht waren rot geworden, sie fühlte sich
eindeutig unwohl, doch Hugh schien davon nichts
mitzubekommen.
Schließlich hielt es Michael nicht mehr aus. Er
bezahlte seine Cola und ließ Jane mit ihrem Hugh
allein. Er wusste nicht, was Jane vorhatte, doch sie
war ein großes Mädchen. Wenn dies die Art von
dummer, oberflächlicher Beziehung war, die sie
suchte,
verdienten
Hugh-du-du-du
und
sie
einander.
97/346
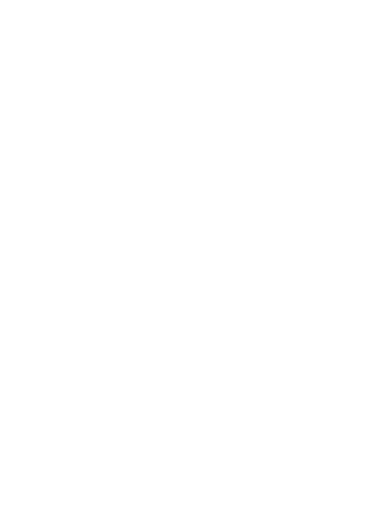
ZWANZIG
Während Hugh mit einem gefährlich hüb-
schen und krankhaft dünnen Model flirtete, das
sein Stück vier Mal gesehen hatte, tat ich so, als
studierte ich die Dessertkarte, die ich leider schon
auswendig kannte. Gott sei mir gnädig, aber in
dem Moment hätte ich jemanden für ein
Stück Schokocremetorte umbringen können.
Aber das sollte, würde, könnte ich nicht tun.
Ehrlich.
Denk an was anderes! Gut. Ich musste zurück
ins Salzbergwerk zu einer Besprechung für Dem
Himmel sei Dank. Ich musste unseren potenziellen
Geldgeber Karl Friedkin einigen Kreativleuten vor-
stellen – dem Casting-Agenten, dem Kostüm-
bildner, dem Ausstatter. Mir gegenüber blieb ich
hart: Nix mit Schoko-bäh-cremetorte.
Hugh gab seiner dürren, vernarrten Bewunder-
in einen Luftkuss, während ich die dicke Rech-
nung für unser Mittagessen bezahlte.
»Macht es dir was aus, wenn ich nicht mit dir
zurückgehe, Jane?«, fragte er. »Ich muss noch
ins Sportstudio.« Unbewusst spähte er in den
Spiegel über der Bar, strich sich über die

perfekt-glatte Wange und drehte den Kopf leicht hin
und her. Mein Gesicht konnte ich natürlich dre-
hen und wenden, wie ich wollte, es sah immer
gleich langweilig aus.
»Nein, ist schon in Ordnung«, antwortete ich.
»Ich komme zurecht.«
Und ich sagte sogar die Wahrheit. Je weniger er
von den Interna zum Film mitbekam, desto besser.
Da er die Rolle am Broadway gespielt hatte, ging er
davon aus, auch die Hauptrolle im Film zu spielen.
Das dachte auch meine Mutter. Die beiden hatten
harte Lobbyarbeit geleistet, weil ich ihn für die
Rolle unter Vertrag nehmen sollte, doch in mir
sträubte sich alles dagegen. Hugh hatte kein
Gesicht für Nahaufnahmen. Er war kein
Filmschauspieler.
Er war einfach nicht Michael.
Hugh gab mir einen Kuss auf die Wange,
nachdem er sich in letzter Sekunde daran erinnert
hatte, mir keinen Luftkuss zuzuwerfen. »Bis
später, Baby«, verabschiedete er sich, dann war
er weg. Strahlendes Gesicht, strahlendes Lächeln.
Aalglatt.
Das Verlangen nach einem Stück Schoko-
bäh-cremetorte
zum
Mitnehmen
unter-
drückend, eilte ich in die 57th Street zurück,
99/346

wo ich natürlich gerade noch rechtzeitig eintraf.
Wie »Jane« von mir. Nachdem sich alle vorges-
tellt hatten, eröffnete ich die Runde. Meine Nerven
beruhigten sich, sobald ich angefangen hatte zu re-
den – ich hatte das Gefühl, das Projekt in der
Hand zu haben.
»Wir finden es alle ziemlich spannend, wie der
Film Gestalt annimmt«, begann ich, ermutigt
durch die gespannte Aufmerksamkeit der anderen.
»Einer der besten Regisseure ist gerade mit an
Bord gekommen. Ich glaube, bis zum Ende der
Woche werden wir die formale Zusage vom Studio
haben.«
Die versammelte Mannschaft brach spontan in
Applaus aus, was meine Stimmung noch mehr hob.
Ich wusste, dieses Projekt konnte meinem Kreat-
ivteam nicht so viel bedeuten wie mir – wie denn
auch? -, doch ich genoss ihre Begeisterung und
Unterstützung.
Plötzlich wurde die Tür aufgerissen.
»Bitte keinen Applaus«, sagte Vivienne in
zuckersüßem Ton. »Ich will mich nur hinset-
zen und zuhören. Mach ruhig weiter, Jane-
Herzchen.«
Mir wurde bange, doch ich straffte meine Schul-
tern, entschlossen, weiterzumachen, obwohl die
100/346
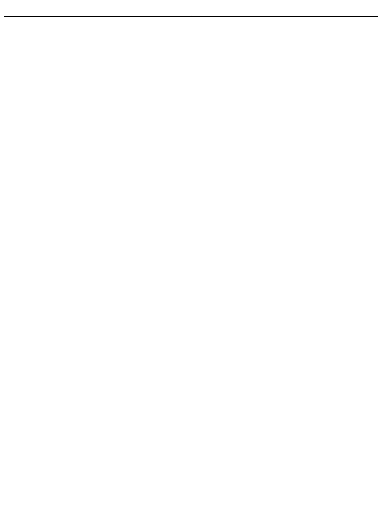
Chancen, dass meine Mutter still sitzen bleiben oder
nur zuhören würde, genauso hoch waren wie
die, dass ein Komet auf die Erde stürzen und das
Fett von allen Hüften fortschmelzen würde. Es
wäre ganz praktisch, würde aber nicht
geschehen.
»Ich
würde
gerne
über
die
Sets
sprechen«, fuhr ich fort. »Clarence, wie ist deine
Einschätzung?«
»Ich denke, wir werden eine genaue Nachb-
ildung vom Astor Court bauen müssen«,
erklärte er.
»Ich habe gehofft, wir könnten direkt im St.
Regis drehen«, wandte ich ein. »Sowohl um Geld
zu sparen als auch wegen der Authentizität. Geht
das nicht irgendwie?«
»Wenn ich kurz was sagen dürfte, Jane-
Herzchen«, meldete sich meine Mutter zu Wort.
»Ich glaube, wir sollten den Drehort selbst bauen.
Damit hätten wir mehr Einfluss auf die Kamer-
aeinstellungen und das Licht.«
Natürlich hatte sie recht, und plötzlich wurde
rundum verständig genickt – niemand wider-
sprach meiner Mutter.
Als Nächstes war die Kostümbildnerin an der
Reihe. »Ich dachte, das kleine Mädchen könnte
101/346

immer Weiß tragen, wenn sie mit ihrem ima-
ginären Freund im St. Regis sitzt.«
Weiß würde den Gedanken an die un-
schuldige Kindheit perfekt wiedergeben, dachte ich.
»Ja, das klingt gut«, sagte ich. »Und das hat
das kleine Mädchen tatsächlich getragen.«
Wieder unterbrach uns Vivienne. »Janey, ver-
giss nicht, es ist kein biographischer Film. Ich den-
ke, Abwechslung in der Kleidung ist besser, weil sie
Farbe auf den Bildschirm bringt. Eigentlich bin ich
mir dessen sicher. In dem Punkt kannst du mir ver-
trauen. Es geht mir nicht darum, recht zu haben, ich
sage nur die Wahrheit.«
In dem Moment fiel auch noch der letzte
Groschen. Mir wurde plötzlich klar, dass meine
Mutter und ich eine völlig unterschiedliche Vor-
stellung davon hatten, wie man an diesen Film her-
angehen
sollte.
Und
dass
meine
Mutter
entschlossen war, ihren Einfluss auf »mein« Pro-
jekt auszuüben. Welch ein Schock für mich!
»Ich habe eine Frage«, meldete sich Karl
Friedkin.
Erleichtert drehte ich mich ihm zu. »Ja?«
»Wer
wird
diesen
Phantasiemenschen
spielen?«
102/346

»Also, er gehörte nicht unbedingt ins Reich
der Phantasie«, antwortete ich. »Eher in die
Welt der Imagination.«
Alles schwieg. Toll, dachte ich, während ich
nach einer Möglichkeit suchte, mich aus der
Affäre zu ziehen. Aber mir fiel nichts ein. Ich er-
rötete. Jetzt hielten sie mich wahrscheinlich für
verrückt. Hervorragend – ein vollendetes Ende
für einen vollendet scheußlichen Tag.
Meine Mutter erhob sich, lächelte matt und ging
zur Tür.
»Ich habe mit Ryan Goslings Agentin ge-
sprochen«, meldete sich der Casting-Agent zu
Wort, »und sie war sehr angetan. Natürlich gibt
es noch viele andere hervorragende Möglich-
keiten: Matt Damon, Russell Crowe, Hugh Jackman
oder Hugh Grant. Auch Patrick Dempsey wäre
möglich.«
Meine Mutter drehte sich an der Tür noch ein-
mal um, wohl wissend, dass alle Augen auf sie
gerichtet waren. »Ihr könnt dieses Hollywood-
Namen-Spiel so lange spielen, wie ihr wollt,
Kinder«, sagte sie, den Blick auf mich gerichtet,
»aber mir scheint, der Mann für die Hauptrolle
steht direkt vor euch.«
Alle verzogen verwirrt ihr Gesicht. Außer mir.
103/346

Ich war gerade beim Mittagessen mit dem Hugh,
den Vivienne bereits für Dem Himmel sei Dank
auserwählt hatte, und er hieß mit Nachnamen
weder Jackman noch Grant.
104/346

EINUNDZWANZIG
Jahre zuvor, wenn er und Jane aus der einengenden
und erstickenden Welt in der Park Avenue fliehen
wollten, hatten sie den Bus zur Upper West Side
genommen. Wie abgefahren und vielseitig die Welt
doch damals gewesen war, vor den Kindern aus den
geburtenstarken Jahrgängen in ihren schicken
Kindersportwagen. Mit großen Augen hatten Mi-
chael und Jane Läden mit gebrauchten Klamotten
und westafrikanische Restaurants, spanische Bo-
degas und jüdische Delikatessenläden erkun-
det, die alle mit Anstand und in Harmonie
nebeneinander bestehen konnten.
Jetzt hatte Michael den Eindruck, als ginge er
durch eine Vorstadt-Einkaufsstraße irgendwo in
Ohio. Aus Goldblums Reinigung war ein Prada-
Laden geworden, in Johannsens Haushaltswaren-
laden befand sich ein Baby Gap. Der weltbeste
Bagels-Laden hatte sich zu einem schicken
Seifengeschäft gewandelt. Der Gedanke an diese
genialen Bagels löste sich sozusagen in Seifen-
blasen auf.
Nur noch ein toller Ort erinnerte an die alte Jane-
und-Michael-Zeit: das Olympia Diner an der Ecke

Broadway und 77th Street. Es wurde in dritter Gen-
eration von Griechen geführt, die immer noch die
fettigsten Rühreier, den fettigsten Schinkenspeck
und einen Kaffee ser vierten, der so stark war, dass
man sich nach einer Tasse die Zähne bleichen
lassen musste. Für Michael war es das beste
Essen in New York, viel besser als das im Daniel
oder Per Se.
Schon die Schrift auf dem Schaufenster war einen
Besuch wert: JA! JA! JA! PFANNKUCHEN RUND
UM DIE UHR!
Immer wenn Michael seit der Zeit mit Jane
wieder in New York war, gehörte das Olympia zu
seinem Samstagmorgen-Ritual. An diesem Tag war
er mit Owen Pulaski dort, als Dank für die Ein-
ladung zur Party, auf der er Claire De Lune
kennengelernt hatte. Die Nacht mit ihr – oder
vielmehr das Gespräch mit ihr über Jane –
war wirklich nett gewesen.
»Erzähl, was ist passiert, Mike?«, wollte
Owen wissen, als sie zu einem Tisch auf der Seite
zum Broadway gingen. »Ich habe gesehen, wie dir
die nette Claire ein Ohr abgekaut hat. Dann, puff,
habt ihr beide euch in Luft aufgelöst.« Grinsend
boxte er Michael auf den Arm.
106/346

»Wir haben geredet«, berichtete Michael.
»Mehr nicht. Bis ungefähr vier Uhr. Sie ist der
Wahnsinn. Für ihre zweiundzwanzig Jahre viel zu
weise.«
»›Geredet‹, hm? Die ganze Nacht.«
Owen warf Michael einen wissenden Blick zu. »Ich
wette, ihr habt über Frauenschuhe geredet. Oder
über die Yankees? Nicht über die Jints. Du bist
mir ein Fuchs, du.«
Owen beugte sich über den Tisch und sah Mi-
chael mit seinem unwiderstehlichen Lächeln an
– wahrscheinlich das gleiche Lächeln, das er
schon als Kind gehabt hatte. »Ich sag dir mal was,
Mike, ich war noch nie mit einer Frau zusammen,
die für mich kein Sexobjekt gewesen wäre. Und,
Kumpel, ich war sogar einmal verheiratet. Sage und
schreibe zwei Jahre lang. Was so viel wie zweimal
verheiratet bedeutet.«
»Tatsächlich?« Michael war erstaunt. »Alle
Frauen sind für dich Sexobjekte?«
Wieder Owens Lächeln, das Blinzeln seiner Au-
gen. »Spiel jetzt nicht den Richter über mich,
Michael.«
»Nein, tue ich nicht, Owen. Es ist nur so … ich
weiß nicht … Frauen haben noch viel mehr als
das. Klar, das Körperliche, aber auch das, was zwei
107/346

Menschen miteinander verbindet, ist doch wichtig.
Ich denke, Liebe kann was Großartiges sein.«
»Ah, du denkst«, sagte Owen grinsend.
»Aber du weißt es nicht, oder? Klingt das nicht
ein bisschen bescheuert? Nur ein bisschen?« Er
presste seine großen Finger aufeinander und warf
Michael sein teuflisches Owen-Lächeln zu. Das
Zwinkern, die Grübchen. Michael fühlte sich
beinahe verführt.
Owen lachte. »Der ist toll, was? Dieser Blick?
Meine Geheimwaffe. Jahrelange Übung!«
Michael widmete sich dem Kreuzworträtsel,
Owen dem Sportteil, während sie aufs Früh-
stück warteten. Owen schnaubte und murmelte
ab und zu laut vor sich hin, wenn er etwas über
Mannschaften, Sportler und Pferde las, die ihn per-
sönlich enttäuschten.
»Weißt du ein Wort mit acht Buchstaben
für ›positive zwischenmenschliche Gefühls-
regung‹?«, fragte Michael schließlich.
»Geilheit«,
antwortete
Owen,
ohne
aufzublicken.
»Und sind wir überrascht, dass du immer
noch allein bist?«, fragte Patty, die wohlgeformte,
sehr niedliche Bedienung mit langem, blondem
Haar, nach der Michael schon lange verrückt war.
108/346

Owen, der sich alles andere als vor den Kopf
gestoßen fühlte, lachte. »Was gibt’s denn
Gutes heute, Kleine? Aufßer dir?«
Patty hob eine Augenbraue und zog ihren Block
heraus.
»Wie kommst du darauf, dass er allein ist?«,
fragte Michael.
»Nimm die Eier Benedikt«, empfahl sie Owen.
»Und den echt holländischen Zwieback.« Zu
Michael gewandt, sagte sie: »Er hat diesen
Blick.«
»Welchen Blick?«, wollte Michael wissen. Das
war die Art von Gespräch, die er liebte, da er dabei
an die Infos aus dem tiefsten Innern der Mensch-
heit gelangte.
»Diesen ›Ich bin allein‹-Blick«, antwor-
tete sie, schob sich den Stift hinter ihr perfekt ge-
formtes Ohr und blickte Owen von oben bis unten
an, als würde er es nicht merken. »Irgendwie
hungrig.«
Owen warf ihr sein Killergrinsen zu. »Hungrig
nach dir.«
Patty verdrehte die Augen. Nachdem sie die Bes-
tellung aufgenommen hatte, nickte sie und huschte
blond und anmutig davon, verfolgt von Owens
Blick.
109/346

»Patty ist sehr süß. Alleinerziehende Mama
mit einer vierjährigen Tochter«, erklärte Mi-
chael, als sie gegangen war.
Owen lächelte. »Nur ein Kind? Ich habe im-
mer nach einer alleinerziehenden Mama mit
mindestens drei oder vier Kindern gesucht.« Er
zwinkerte Michael zu. »Das war ein Witz, Alter.
Spiel nicht den Richter, Michael. Ich mag Patty. Sie
könnte sogar die Richtige für mich sein.«
Plötzlich tat es Michael leid, dass er Owen samt
dessen Grinsen und zwinkernden Augen ins
Olympia mitgenommen hatte.
»Tu ihr ja nicht weh«, sagte Michael, was nur
unmerklich an einer Drohung vorbeiging.
»Und du spiel nicht den Richter, Mikey«, er-
widerte Owen.
110/346

ZW EIUNDZWANZIG
Ich blickte mich im Badezimmerspiegel an und kam
mir wie ein Soldat vor, der in den Krieg zog. Ich
spürte den Druck, doch diesmal übte ich ihn
selbst auf mich aus. Mir blieben weniger als fün-
fundvierzig Minuten, um eine komplette Elle-
Ãœberarbeitung an mir vorzunehmen, und ich
brauchte alles – Make-up, Frisur, Kleider, Ac-
cessoires. Wenn es eine Pille gegeben hätte, mit
der man sieben Kilo in fünfundvierzig Minuten
abnehmen und fünf Jahre jünger aussehen
könnte, hätte ich zwei davon genommen.
Ich wollte mich mit Hugh im The Metropolitan
Museum treffen, und ich musste absolut genial aus-
sehen, was in meinem Fall gleichbedeutend war mit
»vorzeigbar«. Es gab eine Cocktailparty und ein-
en Empfang für eine Jacqueline Kennedy Fashion
Retrospective. Ich würde an Hughs Arm hän-
gen, was hieß, man würde mich mit Argusaugen
beobachten, und von einigen Seiten würde mir
Eifersucht entgegenschlagen.
Gut, zuerst die Stimmung: Ich legte Once Again
von John Legend in den CD-Spieler und drückte

die Abspieltaste. Wenn mich das nicht inspirierte,
wäre ich am Arsch. Ah ja, viel besser.
Zweitens, dem Feind ins Gesicht blicken. In
meinem Bad befand sich ein Schrank, der nur
ungeöffnetes Make-up enthielt – Fläschchen
und Tuben, Lotionen und Flüssigkeiten, die Vivi-
enne mir regelmäßig gab. Nach dreißigirgend-
was Jahren hoffte sie immer noch, ich würde
mich vom hässlichen Entlein in einen zauber-
haften Schwan verwandeln. Nichts zu machen, Viv.
Weder heute noch sonst irgendwann.
Drittens, greife zu den Waffen. Ich holte tief Luft
und öffnete eine Packung Clinique Dramatically
Different Moisturizing Lotion. Ich verteilte sie, wie
angewiesen, im Uhrzeigersinn auf meiner Haut. Bis
jetzt sah ich noch keinen dramatischen Unter-
schied. Aber ich gab nicht auf. Als Nächstes
probierte ich eine »fast unsichtbare« Grundier-
ung, die mir eine perfekte porzellanglatte Haut ver-
sprach.
Hm.
Nachdem
die
Sommersprossen
überdeckt waren, sah meine Haut, äh, sagen wir
zwanzig Prozent besser aus. Das war nicht un-
bedingt toll, aber eine Verbesserung. Zumindest
für meine Seele.
Schließlich tat ich mein Bestes mit Wimper-
ntusche, Lidstrich und Lippenstift von Bobbi
112/346

Brown. War Bobbi Brown ein Mann oder eine Frau?
Keine Ahnung.
Zum Glück und wunderbarerweise war meine
Haarfarbe ganz gut, eine Art temperamentvolles
Blond, und dank dem unaufhörlichen Drängen
meiner Mutter konnte ich sicher sein, dass wenig-
stens meine Frisur gut war. »Stimmt die Frisur
nicht, ist alles andere für die Katz’«,
wiederholte
Vivienne
ständig.
Um
gleich
nachzuschieben: »Du brauchst schließlich jede
Hilfe, die du bekommen kannst.«
Alle Vorsicht in den Wind schießend, sprühte
ich eine gehörige Portion Calvin Klein Spikey Styl-
ing Mousse auf meine Hände und fuhr mit den
Fingern durchs Haar. Die Locken plusterten sich
auf und umrahmten mein Gesicht. Ich wusste nicht,
ob es gut oder schlecht aussah, aber es sah anders
aus … und modern … und nicht nach Langwei-
lige Jane.
Plötzlich erinnerte ich mich an die Zeit, als Mi-
chael und ich unzertrennlich gewesen waren.
»Kriegsbemalung«, hatte Michael gesagt, als
er Vivienne gesehen hatte, die bis zu den Zähnen
für
eine
Tony-Verleihung
bewaffnet,
äh,
aufgemacht war. Ich hatte zwar gekichert, doch
Vivienne hatte blendend ausgesehen – eine
113/346

schlanke, blonde Göttin, der zu ähneln ich mir
auf jeden Fall abschminken konnte.
Jetzt, als ich mich im Spiegel betrachtete, be-
merkte ich überrascht ansatzweise eine Ähnlich-
keit mit Vivienne. Ich hatte ihre Wangenknochen
– zumindest würde man sie sehen, wenn ich
mindestens zehn Kilo leichter wäre. Meine Augen
waren größer, runder und braun, doch die Wim-
pern waren von ihr. Meine Nase war kräftiger,
aber sie ähnelte mehr ihrer Nase als der meines
Vaters.
All das war mir vorher noch nie aufgefallen. Ich
erinnerte mich an Michael, der mich voller Liebe
angesehen und »Du bist eine Schönheit« gesagt
hatte. Er hatte ehrlich geklungen. Hatte er gemeint,
meine Mutter in meinem Gesicht zu erkennen?
Vielleicht hatte er mich einfach nur um meiner
selbst willen für schön gehalten.
Quatsch.
Jane! Weiterarbeiten! Ich straffte die Schultern,
riss die Tür zu meinem begehbaren Kleiders-
chrank auf und versuchte mich nicht so zu füh-
len, als warteten darin Menschen, die unbedingt se-
hen wollten, wie ich von Löwen gefressen wurde.
O Gott, es war schlimmer, als ich gedacht hatte.
Meine panischen Augen sahen ein Meer aus Beige,
114/346

Schwarz und Erdtönen. Ich hatte nichts auch an-
nähernd Erotisches – oder Farbiges.
Moment! Warte mal! Was haben wir denn hier?
Ich wühlte mich durch einige aus der Mode
gekommene Mäntel und erspähte ganz hinten
zwei Chanel-Retro-Cocktailkleider. Vivienne –
natürlich! – hatte sie mir gekauft, als ich noch
ein junges Mädchen gewesen war. Ich zerrte eines
heraus und nahm es unter die Lupe. Es sah nach
Fünfzigerjahre aus – grellrosa mit engem Ober-
teil und flatterndem, kokettem, knielangem Rock.
»Irgendwann wirst du alle deine Sachen lang-
weilig finden, Schatz, dann ziehst du eins von
diesen hier an«, hatte sie gesagt. »Merk dir
meine Worte.«
Natürlich hatte sie recht gehabt. Und natür-
lich hatte sie die perfekte Wahl getroffen. Sie hatte
mal wieder meinen Arsch gerettet – denselben,
der seit weiß Gott wann keinen Stepper mehr
gesehen hatte.
Die Seide rutschte angenehm über meine Haut.
Doch ich bekam den Reißverschluss nicht zu.
Jetzt hatte ich eine Mission zu erfüllen – und
kippte den Inhalt meiner Wäscheschublade aufs
Bett. Unter meinen zweckmäßigen BHs und un-
erotischen Slips befand sich ein Einteiler, der mit
115/346

etwas Glück aus Kevlar gemacht war. Damit
könnte es funktionieren.
Ich zwängte mich hinein.
Ich streifte das Kleid über.
Nichts zu machen mit dem Reißverschluss.
Ich holte aus der Gerümpelschublade in der
Küche eine Zange. Damit konnte der Reißver-
schluss nicht mithalten, und der Vorteil war, dass
das viel zu enge Oberteil meinen Titten nur einen
Ausweg offen ließ – den nach oben. Solange ich
mich nicht bücken oder tief Luft holen müsste,
war die Sache geritzt.
Noch abenteuerlicher als meine Entscheidung,
das rosa Kleid anzuziehen, war die, auf eine Jacke
zu verzichten. Wenn meine Arme etwas zu fleischig
waren, dann waren sie es eben. Im besten Fall und
im besten Licht würde ich vielleicht etwas fül-
lig aussehen.
Ich wagte es nicht, mich im großen Spiegel im
Flur anzuschauen. Was wäre, wenn ich wie ein
Kind in einem Halloween-Kostüm aussah? Die
Zeit, mich umzuziehen, reichte ohnehin nicht mehr.
Jetzt kann’s losgehen, dachte ich, als ich den
Fahrstuhlknopf drückte. »Sie sehen ganz hin-
reißend aus, Miss Margaux«, sagte der Portier.
»Soll ich ein Taxi rufen?«
116/346

»Nein, danke. Ich gehe lieber zu Fuß.«
Zur Abwechslung wollte ich mich mal sehen
lassen.
117/346

DREIUNDZWANZIG
Ich ging Richtung Westen zur 75th Street und von
dort nach Norden. Endlich hatte ich einmal das Ge-
fühl, tatsächlich auf die Fifth Avenue zu ge-
hören. Als ich mit kla ckernden Absätzen die
Stufen zum Metropolitan Museum hinaufstieg, kam
ich mir eindeutig anders vor – exotisch, glam-
ourös und weiblich. Aber nicht wie Jane.
Hugh lehnte oben gegen eine Säule, als posierte
er für eine Ralph-Lauren-Werbung. Seine Jacke
hatte er salopp über die Schulter gehängt und
tat so, als bemerkte er die vielen bewundernden
Blicke nicht. Sobald er mich sah, richtete er sich auf
und riss die Augen weit auf.
»Mein Gott«, begrüßte er mich. »Was
hast du mit Jane gemacht?«
Ich lachte, erfreut, dass er es bemerkt hatte. Er
küsste mich auf die Wange und auf die Lippen.
Dann trat er einen Schritt zurück und be-
gutachtete mich erneut.
»Also, was hast du mit dir angestellt?«
»Ich war es satt, dass nur du immer der Hüb-
sche bist«, antwortete ich kokett. Ich wollte nicht

nur anders aussehen, sondern auch anders
auftreten.
»Du meinst, der einzige Hübsche«, er-
widerte Hugh und versetzte meinem Glück einen
kleinen Dämpfer. Er lachte, um seine Bemerkung
abzumildern, doch er hatte sie sich nicht verkneifen
können. Kein Wunder, dass er und Vivienne sich
so gut verstanden.
Er nahm meine Hand in seine und führte mich
zu den hohen Museumstüren. Wir gaben ein
gutes Paar ab, und ich passte perfekt in dieses Bild
gut gekleideter Männer und glanzvoller Frauen,
die zur Rezeption stolzierten.
Ich war glücklich, und ich sah gut aus, doch
eine Frage ging mir nicht aus dem Kopf: Wollte ich
mir für den Rest meines Lebens diesen Stress
antun?
119/346

VIERUNDZWANZIG
Ja, diese Jackie Kennedy wusste sich anzuziehen.
Jedes gezeigte Kleidungsstück war unglaublicher
als das vorhergehende. Und mit jedem Schluck von
meinem Apfelmartini wurden die Kleider noch un-
glaublicher. Das himmelblaue Halston. Das gedie-
gene, goldfarbene Cassini. Der beigefarbene, zeitlos
modische Chanel-Anzug.
Das Beste, was mir an diesem Abend passierte
– au ßer dass sich Hugh wunderte, wie gut ich
aussah -, war, von Anna Wintour, der Vogue-
Redakteurin, mit steinernem Gesicht begrüßt
zu werden. »Sie sehen gesund aus, Jane«, sagte
sie. Ein hohes Lob, echt.
»Mein Knie tut vom Tennis heute Morgen total
weh. Setzen wir uns«, bat Hugh schließlich.
Also setzten wir uns an einen winzigen Cocktailt-
isch in der Großen Halle des Museums. Ich wäre
lieber stehen geblieben, um einmal in meinem
Leben gesehen zu werden, doch auch meine
Füße konnten eine kleine Pause vertragen.
»Ich werde eine Zigarette rauchen, bis jemand
einen Eimer Wasser über mich kippt«,
verkündete Hugh.

Noch bevor er sie angezündet hatte, blickte ich
auf und sah Felicia Weinstien, Hughs kriecherische,
aufdringliche Agentin, Arm in Arm mit Ronnie
Morgen auf uns zukommen, Hughs gleichermaßen
mafiösem Finanzmanager. Ich riss die Augen weit
auf.
»Jane, schau mal.« Hugh war freudig über-
rascht. »Felicia und Ronnie! Was für ein Zufall.
Hey, kommt doch zu uns. Das ist doch in Ordnung,
Schatz, oder?«
Ich war sprachlos, doch Hugh hatte sich bereits
erhoben, um Platz für seine Agentin und seinen
Finanzmanager zu machen.
Erniedrigt musste ich feststellen, dass ich an der
Nase herumgeführt worden war.
Das war ein Schlag ins Gesicht, die Sache mit
Hughs
Agentin
und
seinem
Finanzmanager.
Unglaublich! Ich hätte den Braten eigentlich
riechen müssen, nachdem Hugh ausnahmsweise
mal pünktlich gewesen war.
»Was machen die denn hier?«, fragte ich. Der
Apfelmartini lag mir schwer wie Blei im Magen.
»Felicia hatte schon angekündigt, sie kä-
men vielleicht vorbei«, erklärte Hugh.
121/346

Meine Augen verengten sich zu Schlitzen. Felicia
war zu viel … zu viele Haare, zu viel Make-up. Und
sie ließ Kaugummiblasen knallen.
»Hä?«, murmelte ich angewidert. »Hat die
ihren Zuhälter draußen gelassen?«
Hugh warf mir einen strengen Blick zu, antwor-
tete aber nicht.
Ronnie trug eine Kombi aus Miami-Vice-T-Shirt
und -Jacke, passend für eine Besprechung im
Chateau Marmont in Hollywood – Mitte der
Achtziger.
»Fantastisch, euch beide hier zu treffen«,
sagte Ronnie, während er mir einen Kuss auf die
Wange drückte.
»Alles Modeliebhaber«, mutmaßte Felicia,
die mich kaum eines Blickes würdigte.
»Ich hole was zu trinken«, bot Hugh fröhlich
an. Der feige Löwe sprang hoch, als hätte sich
eine Feder unter seinem Hintern gelöst. »Diese
Apfelmartinis sind delicioso.«
»Nein«, währte Ronnie ab. »Ich arbeite
für dich. Ich hole sie.«
Doch Hugh beharrte darauf und ließ mich mit
diesen beiden großen Gaunern an einem sehr
kleinen Tisch zurück.
122/346

»Sie sehen heute Abend so in-ter-ess-ant
aus«, stellte Felicia fest. »Rosa, hm.«
»Ist das ein Kompliment?«, fragte ich.
»Sie entscheiden.«
Ich entschied mich für »nein«. Meine Haut
kribbelte, und ich fürchtete, einen Nesselaussch-
lag zu bekommen.
Ronnie kicherte komisch und zog sich die Jacke
aus. Er war der einzige Mann in einem Saal mit
fünfhundert Menschen, der in Hemdsärmeln
dasaß.
»Jane, wenn wir hier schon zusammen sind,
können wir uns auch unterhalten, oder?«,
begann er mit vorgetäuschter Herzlichkeit.
»Felicia und ich wollten diese Woche ohnehin ein-
en Termin bei Ihnen, aber da wir uns hier zufällig
begegnet sind …«
Hugh kehrte zurück. »Apfelmartinis für al-
le«, verkündete er strahlend.
»Hugh, welch ein Glück, dass wir euch hier
einfach so getroffen haben«, wiederholte Felicia.
»Ja, aber wirklich«, stimmte Ronnie ein. Hat-
ten die drei das hier geprobt?
»Es hat keinen Sinn, um den heißen Brei her-
umzureden, Jane«, wandte sich Ronnie an mich.
»Felicia und ich … und Hugh natürlich …
123/346
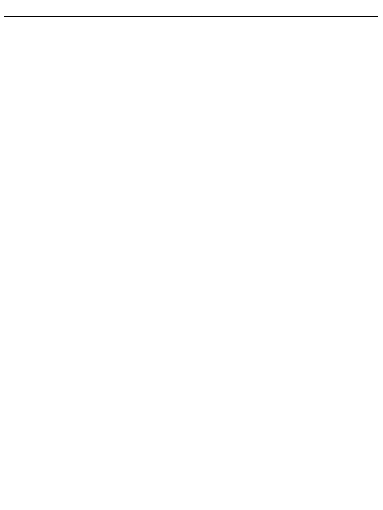
nun, wir müssten wissen, wann er offiziell die
Hauptrolle in Dem Himmel sei Dank bekommt. Wir
haben andere Angebote, aber wir möchten diese
Rolle. Jedenfalls Hugh möchte sie. Und wissen
Sie, was? Hugh verdient sie. Meinen Sie nicht? Sich-
er meinen Sie das. Das tun wir doch alle. Ebenso
wie Vivienne.«
Ich war wütend … und nervös … und
traurig. Aber vor allem wütend.
»Ich glaube nicht, dass wir das hier und jetzt be-
sprechen sollten«, wehrte ich ab. Ich spürte, wie
mein Gesicht erstarrte.
»Ich glaube, Ort und Zeit sind perfekt«, mel-
dete sich Hugh mit stahlhartem Blick zu Wort. Jede
Spur eines Lächelns war verschwunden.
»Kommen Sie, lassen Sie uns das durchs-
prechen, Jane«, drängte Felicia. »Es ist ein
spaßiges Thema auf einer spa ßigen Veranstal-
tung.«
Es war kein spaßiges Thema und auch keine
spaßige Veranstaltung mehr.
»Du hast doch vor, mir die Rolle in dem Film zu
geben, oder?«, fragte Hugh mit stechendem Blick.
»Das geht ja nicht anders.«
»Wir müssen deine Möglichkeiten durchge-
hen«, erwiderte ich steif. Weil du in dem
124/346

Theaterstück schon nicht die richtige Besetzung
warst, und ich will nicht, dass mein Film eine Pleite
wird.
Meine ganze romantische Zukunft ging in diesem
Moment unter den wachsamen Spürhundaugen
von Felicia und Ronnie in Flammen auf. Ich hasste
es. Plötzlich hatte ich das Gefühl, als ob alle
fünfhundert Leute im Saal gleichzeitig aufge-
hört hatten zu reden.
»Ich bin mir nicht sicher, ob du für die Rolle
geeignet bist, Hugh«, brachte ich schließlich mit
ruhiger Stimme heraus. »Das meine ich ehrlich.«
Ich griff nach seiner Hand, doch er entzog sie mir.
»Du musst deine Meinung ändern«, ver-
langte er angespannt. So schikaniert hatte er mich
noch nie – am liebsten hätte ich ihm mit
meinem
Judith-Liebermann-Täschchen
eins
übergebraten.
»Ich war für die Bühne die richtige Beset-
zung«, fuhr er fort. »Ich hätte einen Tony
gewinnen müssen.«
Ich wollte sagen, dass er höchstens okay für
die Bühnenrolle gewesen war. Für einen Tony
war er nicht einmal nominiert gewesen.
Es war das kleine Mädchen, das die Herzen der
Zuschauer und die der Kritiker gewonnen hatte.
125/346

Hughs Kritiken waren, nun ja … annehmbar. Sein
bester Moment war gewesen, als er sich umzog, um
sich mit dem kleinen Mädchen vor der Schule zu
treffen. Etwa fünf Minuten lang hatte er mit
nacktem Oberkörper herumlaufen müssen.
Darin war er sehr gut.
Plötzlich stand Hugh auf.
»Ich will diese Rolle, Jane. Ich habe sie mir
verdient. Ich habe das Stück zum Laufen geb-
racht. Ich. Ich gehe jetzt. Wenn ich jetzt nicht gehe,
schnappe ich mir diesen Tisch und schleudere ihn
gegen die Wand. Du mit deinem dämlichen Spiel.
Ich scheiß auf dich, und ich scheiß auf Jac-
queline Kennedy!«
Plötzlich war ich allein mit Ronnie und Felicia.
Wie hatte dieser Abend nur so enden können?
»Ich hole uns noch was zu trinken«, sagte
Ronnie.
»Für mich nicht«, wehrte ich ab. »Mir ist
schon kotz übel.«
Eine Minute später hörte ich, wie meine Ab-
sätze durch die Große Halle und dann die
Treppe hinunterklackerten.
Ich kam mir wie ein dummer, bulliger Idiot in
einem dummen, rosa Kleid vor, das viel zu
126/346

jugendlich für mich und jetzt von Tränen und
Wimperntusche vollgeschmiert war.
127/346
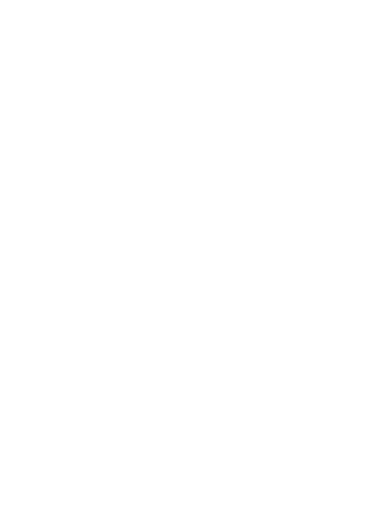
FÃœNFUNDZWANZIG
Michael fühlte sich in seiner Verfolgerrolle schon
ganz wohl. Vielleicht ein bisschen zu wohl. Das ist
das letzte Mal, nahm er sich selbst das Versprechen
ab. Heute Abend hat das ein Ende. Etwa eine
Stunde zuvor war er überrascht gewesen, als Jane
wie eine Diva das Haus verlassen hatte. Er hatte sie
den ganzen Weg über bis zum Metropolitan Mu-
seum beschattet.
Ihr Gang hatte etwas Entschlossenes, bemerkte
er. Etwas Stolzes. Und dieses scharfe rosa Kleid …
sie sah aus, als hätte sie sich von Hugh erholt. Vi-
elleicht konnte sich Michael glücklich schätzen,
als er sie in sicherem Abstand verfolgte. Wenn mit
Jane jetzt wieder alles in Ordnung war, konnte er
wieder verschwinden.
Â
Zeitsprung eine Stunde später – wieder folgte er
ihr die Fifth Avenue entlang, aber diesmal in entge-
gengesetzter Richtung. Wieder ging Jane allein,
doch viel langsamer und mit hochgezogenen Schul-
tern. Kein federnder Gang mehr. Als sie in die
Madison Avenue bog, blieb sie stehen und blickte

ziellos in die Schaufenster, auch in das eines
Ladens, in dem es Zigaretten und TicTac gab.
Irgendwie wirkte sie auf ihn besonders einsam.
Und traurig und elend. Anscheinend war im Mu-
seum etwas passiert. Ganz sicher hatte es etwas mit
Hugh McGrath zu tun, diesem Schuft.
Immer mehr glaubte Michael, es wäre alles sein
Fehler. Er hatte ihr eine Menge hochtrabender Ver-
sprechen gegeben und Vorhersagen gemacht, als sie
noch ein Kind gewesen war. Und die waren einfach
nicht eingetreten. Er hatte ihr erzählt – und es
geglaubt -, dass ihr jemand ganz Besonderes über
den Weg laufen würde. Das war ja eindeutig nicht
passiert. Könnte er ihr jetzt helfen? Nein, eher
nicht. Jane gehörte nicht mehr in seinen
Zuständigkeitsbereich. Er konnte sich nicht
einmischen.
Aber er hätte es gerne getan. Seine Gefühle
wanderten in ihre Richtung. Er wollte sie halten
und trösten, genauso wie damals, als sie noch ein
kleines Mädchen gewesen war. An der 81st Street
überquerte sie die Madison Avenue, betrat den
Seiteneingang des Carlyle Hotels und von dort die
Bemelman’s Bar.
129/346

So, was sollte er jetzt tun? Welche Möglich-
keiten gab es? Michael wartete einen Moment, be-
vor er beschloss, ihr zu folgen.
Janes rosa Kleid war leicht zu erkennen. Ja, da
saß sie an der Bar.
Michael setzte sich ans andere Ende hinter zwei
ziemlich große Typen. Sie tranken Scotch, den sie
mit Budweiser hinunterspülten, und stopften sich
mit Erdnüssen voll.
Jane bestellte ein Gin Tonic. Sie sah wunder-
schön aus, wie eine tragische russische Heldin.
Komm schon, Jane, Kopf hoch! Das kannst du
doch viel besser.
Eine wahnsinnige Sekunde lang überlegte er,
einfach zu ihr zu gehen und sie anzusprechen. Sch-
ließlich würde sie ihn nicht erkennen. Er wäre
für sie irgendein Kerl. Doch eigentlich wusste er
nicht, was er tun sollte. Was sehr ungewöhnlich
war. Er war noch nie wegen irgendetwas unsicher
gewesen.
Wieso saß er hier im Bemelman’s mit Jane
Margaux? Na ja, nicht direkt mit ihr, auch wenn er
es sich wünschte.
Es ergab keinen Sinn. Es war unerträglich, ver-
wirrend und auf keinen Fall eine gute Idee. Nein, es
war der reine Wahnsinn!
130/346

»Was darf ich Ihnen bringen, Sir?«, fragte der
Barmann.
Ȁh, nichts, tut mir leid. Mir ist gerade einge-
fallen,
ich
war
ganz
woanders
verabredet.
Entschuldigen Sie.«
Der Barmann zuckte mit den Schultern, als Mi-
chael sich erhob. Er fühlte sich elend, was un-
typisch für ihn war. Mit gesenktem Kopf ging er
Richtung Tür, riskierte aber einen letzten Blick zu
Jane.
Was für eine schöne Frau sie geworden war.
Wie immer war sie etwas Besonderes.
»Leb wohl, Jane«, sagte er und ging, ohne sie
anzusprechen. Dies war die einzige Möglichkeit.
Eigentlich wünschte er, sie nicht wiedergesehen
zu haben.
131/346
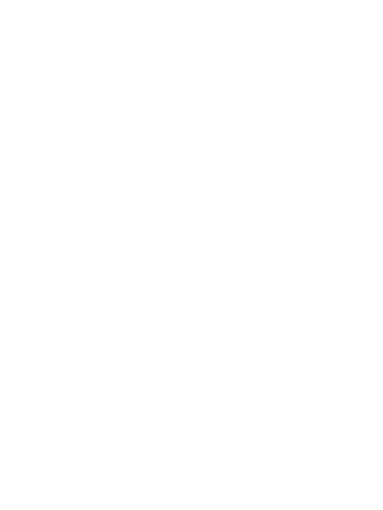
SECHSUNDZWANZIG
Das Gin Tonic war kalt und erfrischend. Tanqueray
mit Zitrone. Genau richtig. Gab es einen besseren
Ort als das Bemelman’s, um nachzudenken und
sich auf widerliche Weise in Selbstmitleid zu
ergehen?
Ich war eine zweiunddreißigjährige Frau, bei
der gleichzeitig alles und nichts klappte. Ich hatte
eine tolle, theoretisch faszinierende Arbeit, die mich
und meine Zeit allerdings völlig in Anspruch
nahm, ohne mich persönlich zu befriedigen.
Ich hatte eine wohlhabende, erfolgreiche Mutter,
die mich wie ein idiotisches Kind behandelte, es
aber Liebe nannte. Schlimmer war, ich liebte sie
trotzdem über alles.
Ich hatte einen Freund … ja, das wusste ich
sicher.
Ich
hatte
einen
Freund.
Vergangenheitsform.
Meine Gedanken überschlugen sich, rasten alle
gleichzeitig in die gleiche falsche Richtung.
Vielleicht waren meine Ziele zu langfristig. Viel-
leicht sollte ich eine Möglichkeit finden, um
glücklich zu sein, nicht ein Leben lang, aber für
eine oder zwei Stunden. Vielleicht gab es jemanden,

der mit mir herumsitzen und japanisches Essen be-
stellen wollte und der es nicht hasste, zum vierten
oder fünften Mal eine DVD mit den Filmen E-
Mail für Dich oder The Shawshank Redemption
anzusehen.
Plötzlich spürte ich, wie mir jemand auf die
Schulter klopfte. Ich zuckte zusammen und hätte
beinahe aufgeschrien. In meiner sanften, weltfrau-
lichen Art.
Ich drehte mich um, und zwei Männer grinsten
mich irgendwie schwachsinnig an. Ihre grellen,
karierten Sportjacketts wirkten nicht nur im Carlyle
Hotel fehl am Platz. Auf diese Art von Zuwendung
konnte ich im Moment gerne verzichten.
»N’Abend, Ma’am«, sagte Nummer
eins. »Mein Freund und ich haben überlegt, ob
Sie etwas Gesellschaft bräuchten.«
»Nein, danke«, lehnte ich entschieden ab.
»Ich entspanne mich nur nach einem langen Tag.
Danke.«
»Sie scheinen allein zu sein«, merkte Nummer
zwei an. »Und irgendwie deprimiert. Kommt uns
jedenfalls so vor.«
»Es geht mir wirklich gut. Mehr als gut. Danke
der Nachfrage.« Ich täuschte für sie sogar ein
133/346

Lächeln
vor.
»Tja,
ich
bin
der
reinste
Sonnenschein.«
»Die Dame hätte gerne noch was zu
trinken«, sagte einer der beiden zu dem
Barkeeper.
Ich blickte den Barkeeper an und schüttelte
den Kopf. »Ich möchte wirklich nichts mehr
trinken. Und ich möchte auch nicht mit diesen
Kerlen reden.«
Der Barkeeper beugte sich vor. »Vielleicht
möchten sich die Herren wieder ans andere Ende
der Bar setzen.«
Schulterzuckend entfernten sie sich. »In dieser
Bar gibt’s aber hochnäsige Nutten«, sagte
einer.
Der Barkeeper und ich blickten uns schockiert an,
brachen aber in Lachen aus. Entweder lachen oder
heulen. In meinem rosafarbenen Designerkleid, den
Fünfhundert-Dollar-Schuhen, dem sorgfältig
aufgetragenen
Make-up
und
dem
schicken
Haarschnitt sah ich wie ein Callgirl aus? Wie viel
verdienten denn Callgirls heutzutage? Ich drehte
mich auf dem Barhocker zum Spiegel. Ich sah vor
allem eine Ansammlung von Menschen, aber auch
die bunten Zeichnungen über der Bar.
134/346
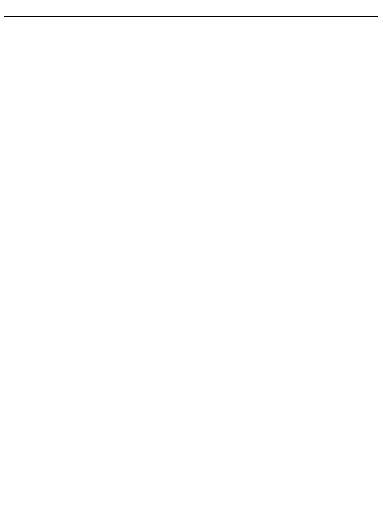
Schwach lächelnd blickte ich mein Spiegelbild
an – die verschmierten Augen, die gerötete
Nase. Gott, als Nutte sähe ich ziemlich jämmer-
lich aus.
Plötzlich fiel mir etwas anderes auf. Ich kniff die
Augen zusammen, mein Herz machte einen Satz. Es
war völlig und total unmöglich. Kurz hatte ich
einen Mann erblickt, der die Bar verließ. Er schien
mich anzublicken.
Natürlich lag ich völlig falsch – aber ich
hätte schwören können, Michael gesehen zu
haben.
Kaum hatte ich ihn entdeckt, war er schon durch
die Tür verschwunden.
Das war jetzt echt der Wahnsinn.
Ich nahm einen Schluck von meinem Gin Tonic.
Meine Hände zitterten, als ich das Glas wieder ab-
stellte. Dieser Mann – es war lächerlich. Mein
Unterbewusstsein hatte sich vom Schattenspiel
täuschen lassen und ein Bild von dem Menschen
erzeugt, den ich am meisten vermisste und un-
bedingt hätte wiedersehen wollen.
Gut, jetzt musste ich mir ernsthaft Sorgen um
mich machen. Würde ich durchdrehen? Ich
begann, Phantome zu sehen. Wie unglücklich
musste ein Mensch sein, damit das eigene
135/346

Unterbewusstsein ihm in seinem Leben herump-
fuschte? Wie schlimm war ich dran, dass ich
glaubte, Michael gesehen zu haben?
Michael, der eine Imagination war.
Michael, den es nicht gab.
Hatte ich mir Michael so sehr herbeigewün-
scht, dass er eine Sekunde lang wieder erschienen
war?
Wach auf, Jane. Du hast dich täuschen lassen.
Ich nahm einen Zwanzig-Dollar-Schein aus mein-
er Handtasche und legte ihn auf die Bar. Dann ging
ich hinaus und zu Fuß nach Hause.
Ich wusste, ich hatte Michael gesehen. Aber
wichtiger war die Frage: Warum hatte ich ihn bisher
nicht vergessen können?
136/346

SIEBENUNDZWANZIG
Also gut, dann zu besseren und bedeutenderen The-
men. Wenn ich in der Stadt war, arbeitete ich im-
mer am Sonntagmorgen in einem Frauenhaus auf
der East 119th Street in Spanish Harlem. Nichts
Besonderes, es gab keine Medaillen dafür, aber
ich konnte wenigstens ein bisschen helfen, und es
gab mir einen anderen Blick auf mein Leben. Nach
sechs Stunden im Frauenhaus war ich selig, wenn
ich nach Hause kam. Es hatte etwas von einem
Kirchgang, nur besser – weil ich etwas Sin-
nvolleres tat.
Also schaufelte ich Rühreier und Bohnen auf
Pappteller, teilte harte Brötchen und Margarinev-
ierecke aus, schenkte Orangensaft in Plastikbecher.
Es fühlte sich gut an, zu wissen, dass diese
Menschen gleich einen vollen Magen haben
würden – zumindest eine Zeit lang.
»Könnten Sie meinem Sohn noch etwas von
den Eiern geben?«, fragte eine Mutter mit einem
fünf- oder sechsjährigen Jungen. »Ginge
das?«

»Natürlich«, antwortete ich. Ich gab noch
eine Portion Eier aus und legte ein hartes
Brötchen darauf.
»Sag der Dame danke, Kwame.«
»Danke.«
»Schaffst du das denn auch alles, Kwame?«,
neckte ich den Jungen.
Er nickte schüchtern, während seine Mutter
flüsterte: »Ehrlich gesagt, isst er jetzt nur ein
bisschen davon.« Sie zog ein Stück alte Alufolie
aus ihrer Einkaufstasche. »Den Rest gibt’s
zum Mittagessen.«
Weitere Hungrige kamen, denen ich Eier austeilte
und das Gefühl geben wollte, willkommen zu
sein. »Schön, Sie zu sehen. Kommen Sie ruhig
wieder«, ermutigte ich sie.
Eine alte, gutherzige Italienerin aus der Ge-
meinde St. Rose schenkte neben mir Orangensaft
und Milch aus. »Schauen Sie mal da drüben«,
flüsterte sie und deutete mit dem Ellbogen in die
Mitte der Reihe. »Sie ist selbst noch ein Mäd-
chen.«
Ich erblickte eine spindeldürre Frau, höch-
stens achtzehn Jahre alt, mit einem Baby in einem
abgewetzten Tragetuch. Ein Junge hing an ihrem
dünnen Bein. Was sie wirklich von den anderen
138/346

abhob, waren ihre schwarzen Augen und ein
schmutziger Verband um ihren schlaffen rechten
Arm.
Wenn ich so etwas sah – dass jemand damit
durchkam, einem anderen Menschen derart wehzu-
tun -, verkrampfte sich mein Magen.
»Setzen Sie sich«, forderte ich sie auf, als sie
an der Reihe war. »Ich werde Ihnen und den
Kindern das Essen bringen.«
»Nein, das schaffe ich schon.«
»Ich weiß, dass Sie das schaffen. Lassen Sie
mich trotzdem helfen. Das ist meine Arbeit.«
Ich griff zu einem Plastiktablett, auf das ich die
Teller mit Eiern und Brötchen stellte, dazu zwei
Plastikbecher und eine volle Tüte Orangensaft.
Auch drei Bananen holte ich aus der Küche, wo
die Nonnen frisches Obst für besondere Gelegen-
heiten oder Notfälle aufbewahrten.
»Hey, danke«, sagte das Mädchen leise, als
ich an ihren Tisch trat und die Teller abstellte.
»Sie sind eine nette weiße Frau.«
Hm, ich versuch’s zumindest.
139/346

ACHTUNDZWANZIG
Schließlich wanderte der Rest der Rühreier auf
den Pappteller einer zahnlosen älteren Dame, die
Plastiktüten über ihre Hände und Schuhe
gezogen hatte. »Den Tag kriegst du auch noch
rum«, wiederholte sie ständig. Es war ers-
chreckend, wie sehr ich mich mit diesem Satz iden-
tifizieren konnte.
Kurz vor Mittag trat ich hinaus in die noch
kühle Frühlingsluft von Spanish Harlem in
New York. Meine Arme taten weh, und ich hatte
Kopfschmerzen, doch es hatte etwas Elementares
und Gutes, Essen an hungrige Menschen aus-
zuteilen. Ãœberall um mich herum erblickte ich nur
schöne Dinge, alles schien voller Leben und viel
versprechend zu sein, was mir nach dem Debakel
des vorangegangenen Abends wie ein Wunder
vorkam.
Auf den Stufen zur Kirche standen fünf kleine,
wie Minibräute gekleidete Mädchen, die auf ihre
Erstkommunion warteten. In der Nähe tranken
ernst blickende Männer cerveza und spielten
Domino auf Holzkisten. Ich atmete tief ein. Der

Geruch von frittierten churros, Maiskolben und
Chili hing in der Luft.
Ich überquerte die Park Avenue, wo die
Vorortzüge aus dem Tunnel kommen und die
bunte Park Avenue von Harlem in die schicke Park
Avenue von Upper Eastside übergeht. Ich ging
weiter. Ich fühlte mich pudelwohl, da ich den
Abend im Metropolitan Museum ziemlich gut ver-
daut hatte.
Als ich die nächste Straße überquerte und
das Haus in Sicht kam, in dem ich wohnte,
drückte irgendein Wichser wegen mir auf die
Hupe.
Ich drehte mich um und sah, dass dieser wider-
liche Wichser Hugh war.
Er saß mit verschämtem und um Verzeihung
bittendem Blick in einem leuchtend blauen Mer-
cedes Kabrio. Sein Engelsgesicht verscheuchte alle
vernünftigen Gedanken.
O je, wie sich unser Gehirn doch von unseren Au-
gen täuschen lässt.
141/346
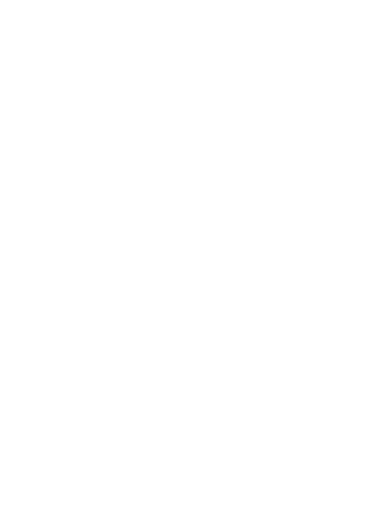
NEUNUNDZWANZIG
Hübscher als der dunkelblaue, in der Sonne
funkelnde Sportwagen war nur der Mann am
Steuer, und er wusste das. Hugh, auf der Nase eine
italienische Sonnenbrille, trug eine leichte braune,
kuschelig wirkende Lederjacke. Und um wie ein
»normaler« Kerl auszusehen, hatte er sich eine
Kappe der New York Giants aufgesetzt, deren Schild
an den Seiten gebogen war. Einfach so.
»Komm, wir machen eine Spritztour, meine
Schöne.« In humorvollem Ton gesagt, den er
sich, wie ich wusste, von Mr. Big aus Sex In The City
abgeguckt hatte.
Hugh und der Wagen gaben ein hübsches Paar
ab, doch ich dachte, ich käme ohne sie ganz gut
zurecht. Schließlich waren mir beide egal. Ehrlich.
Hm, also fast. Ach, Mist, vielleicht doch nicht so
ganz.
»Ich bin mit meiner Mutter in einer Stunde zum
Mittagessen verabredet«, wimmelte ich ihn
kühl ab. »Sie ist in letzter Zeit nicht ganz auf
der Höhe.« Die Worte strömten ohne meinen
Willen aus mir heraus, aber sie hörten sich toll an.

»Ich bringe dich in einer Stunde wieder her. Du
weißt, ich würde es nicht wagen, Vivienne vor
den Kopf zu sto ßen.«
»Hugh, nach gestern Abend … ich kann nicht
…«
»Komm schon. Steig ein. Ich will mit dir reden,
Jane. Ich bin extra von Village hier raufgefahren.«
»Ich weiß wirklich nicht, worüber wir reden
müssen, Hugh«, erwiderte ich mit sanfter
Stimme.
»Ich bin ein veränderter Mann.« Hugh ver-
strömte tiefe Ehrlichkeit. »Und ich kann dir auch
sagen, warum. Gib mir die Gelegenheit dazu.«
Ich seufzte und machte volle dreißig Sekunden
lang ein widerwilliges Gesicht, bevor ich einstieg.
Hugh drückte fröhlich aufs Gaspedal und fuhr
die Park Avenue entlang.
Plötzlich bog er nach links ab, kurz darauf
fuhren wir über den Franklin D. Roosevelt Drive,
auf dem wir ziemlich gut vorwärtskamen – aber
mit welchem Ziel?
»Ich muss dir sagen, was ich dir offenbar schon
so oft gesagt habe, Jane.«
Wenn er »Gib mir die Rolle« sagen würde,
nahm ich mir vor, ihm einen Kugelschreiber ins Ohr
zu stechen.
143/346

»Ich muss dir sagen, dass es mir leidtut.«
Damit verblüffte er mich. »Ich wusste nicht,
was Felicia und Ronnie im Schilde geführt haben,
das schwöre ich bei Gott. Dann sind meine Zunge
und mein Temperament mit mir durchgegangen.«
Mein Hirn sagte mir, dass das nicht stimmte,
auch wenn mein Herz wahrnahm, wie unglaublich
ehrlich er klang. Langsam begann mein Widerstand
zu bröckeln, was mir aber überhaupt nicht ge-
fiel. Ich versuchte, stark zu bleiben. Ich schwieg,
konzentrierte mich nur auf den Horizont. Wir
fuhren über die Brooklyn-Brücke. Wohin? Und
warum? Auf der anderen Seite der Brücke hielt
Hugh an einer Stelle mit einem atemberaubenden
Postkartenblick auf Manhattan. Ehrlich, die Stadt
sah aus, als wäre sie in Silber gegossen. Ich war
noch nie mit Hugh hier gewesen, und plötzlich
fragte ich mich: Wer, wenn nicht ich?
»Ich bin davon ausgegangen, dass wir uns we-
gen der Rolle im Film einig sind, Janey«, fuhr er
fort. »Ich kann mir mich in der Rolle sehr gut vor-
stellen. Ich habe sie am Broadway gespielt. Sie ist
ein Teil von mir. Ich bin davon ausgegangen, dass
du mich auch für den Film für die perfekte Be-
setzung hältst.« Er warf mir ein umwerfendes
144/346

Lächeln
zu,
gleichzeitig
zerknirscht
und
großspurig.
Gut, was er sagte, ergab fast einen Sinn. »Du
hast nicht zugehört, Hugh.« Wie üblich.
Er legte seinen Arm über meine Rücken-
lehne und streichelte meinen Nacken.
»Weißt du, Jane, ich dachte auch, dass dieses
Projekt, dieser kleine Film, uns zu dem Team
machen könnte, das wir, wie ich glaube, sein
können. Ich habe mir vorgestellt, wie wir
zusammenarbeiten – es wäre fantastisch. Unser
gemeinsames Privat- und Berufsleben. Weißt du,
ich wäre für dich da. Ich könnte dir helfen,
dich unterstützen. Ich habe viel darüber
nachgedacht. Es ist mein Traum. Ehrlich.«
Seine Stimme war tief und ernst. Er hielt meine
Hand, rieb zart über meine Knöchel. Was war
hier los? Mir wurde leicht schwindlig. Ich wurde
doch nicht etwa schwach?
Er öffnete das Handschuhfach und griff hinein.
Meine Augen fielen beinahe heraus, als er ein
wanderdrosseleierblaues
Schmuckkästchen
herauszog.
Mein Herz blieb stehen. Er konnte doch nicht …
er würde doch nicht …
Das hatte ich nicht erwartet.
145/346

Als Hugh die Tiffany-Schachtel öffnete, blinkte
mir ein hübscher Diamant entgegen. Er war nicht
riesig, aber auch nicht klein. Ich bemühte mich,
die Luft nicht hörbar einzusaugen.
»Jane,
ich
weiß,
wir
können
wieder
großartig miteinander zurechtkommen. Ich habe
den Ring, und du hast den Film. Machen wir ein
Geschäft, Schatz. Abgemacht?«
Die Zeit blieb stehen, die Erde unter mir kippte
zur Seite. O … mein … Gott. Nein, das konnte
nicht wahr sein. Ich kam mir vor, als hätte mir je-
mand in die Brust getreten. Eine lange Pause folgte,
während der mein verblüfftes Hirn versuchte,
sich für eine Reaktion zu entscheiden. Sofort in
Tränen ausbrechen? Vor Wut toben? Die
Erniedrigte spielen? Dies war mein erster und einzi-
ger Heiratsantrag, und er könnte nicht bescheuert-
er laufen. Machen wir ein Geschäft? Abgemacht?
War Hugh krank im Hirn, oder war ich eine noch
größere Niete, als ich vermutet hatte?
Hughs Lächeln erstarb, während er mein
Gesicht beobachtete.
Schließlich begannen die Funken zwischen
meinen Synapsen zu sprühen. Ich bekam kaum
Luft. »Es tut mir leid, Hugh«, sagte ich an-
gespannt – na gut, das ist etwas untertrieben,
146/346

»aus vielerlei Gründen – vor allem, weil ich
dir noch eine Chance gegeben und etwas für dich
empfunden habe. Und am allermeisten tut mir leid,
was du mir gesagt hast. Machen wir ein Geschäft,
Schatz? Abgemacht? Wie kannst du so was nur
sagen?« Ich war mit jedem Satz lauter und
wütender, meine Stimme immer schriller ge-
worden. Eigentlich müsste er die Beine in die
Hand nehmen und abhauen.
»Ich bin kein Redenschreiber, sondern Schaus-
pieler«, brummte er. »Gut, ich habe meine
Worte nicht genügend aufgepeppt, dafür
entschuldige ich mich. Aber ich wollte direkt und
ehrlich sein. Das hast du doch immer von mir ver-
langt.«
»Aufgepeppt?«, platzte ich heraus. »Bist du
übergeschnappt? Wie wär’s mit ›-
größte Beleidigung meines Lebens‹? Oder
›der
abscheulichste
Heiratsantrag
aller
Zeiten‹?«
Hughs Gesicht war kalt und wie erstarrt. »Jane,
das siehst du völlig falsch. Vielleicht solltest du das
mit Vivienne besprechen.«
Ich hatte gedacht, noch schlimmer könnte es
nicht kommen, doch ich wurde aufs Ãœbelste
enttäuscht. Ich war offiziell am Boden zerstört.
147/346

»Ach, Hugh«, war alles, was ich herausbrachte,
während ich mich immer mehr verkrampfte.
»Bring mich hier weg. Fahr mich nach Hause. Jet-
zt gleich.«
Hugh blickte mich lange an. Unglaube verunstal-
tete sein hübsches Gesicht. Als hätte er keine
Vorstellung davon, warum ich mich so aufregte.
Schließlich wandte er sich nach vorn zum Lenkrad
und drehte den Zündschlüssel.
»Gut, dann bis irgendwann mal.« Er beugte
sich über mich, öffnete die Beifahrertür und
löste meinen Sicherheitsgurt. Danach setzte er
sich wieder aufrecht hin und wartete. Verachtung
schlug mir entgegen.
»Was?«
»Steig aus«, verlangte er mit eisiger Stimme.
Seine Fingerknöchel am Lenkrad wurden weiß.
Als ich nicht sofort reagierte, drehte er sich zu mir.
»Steig aus meinem Wagen aus, verdammt!«,
schrie er.
Mein Gesicht schien zu glühen, als ich aus dem
Wagen sprang. Er warf mich hinaus? Und das in
Brooklyn?
Ohne abzuwarten, bis ich die Tür geschlossen
hatte, fuhr er rückwärts los und brauste davon.
Kieselsteine wirbelten gegen meine Beine.
148/346

Er hatte es getan. Er hatte mich nach Brooklyn
verschleppt und mich dort ausgesetzt, statt mich
nach Hause zu fahren.
Komisch, dass ich keine Träne vergoss.
Jedenfalls nicht in den ersten sechseinhalb
Sekunden.
149/346

DREISSIG
Zeit hatte er genug. Es war ein wunderschöner
Tag, an dem er versuchte, sich Jane aus dem Kopf
zu schlagen, und deswegen spazieren gehen
würde, vielleicht auch ins Kino. Auf dem Weg
nach unten kam ihm Owen entgegen – mit Patty,
der Kellnerin aus dem Olympia. O nein, was hatte er
getan? Owen und Patty?
Sie waren ein ganz ansehnliches Paar, trotzdem
traute Michael diesem Owen nur so weit über den
Weg, wie er ihn werfen konnte, und er hatte Patty
wirklich gern. Er wollte nicht, dass sie von einem
diplomierten Casanova verletzt wurde.
»Hallo, Michael.« Patty strahlte, wie sie es im-
mer im Restaurant tat. »Ich habe gehofft, dich
hier zu treffen. Ich wollte dir danken, dass du neu-
lich Owen mitgebracht hast.«
»Ach, nicht der Rede wert. Ihr habt schließlich
die besten Pfannkuchen der Gegend. Wie geht’s
euch?« Michael versuchte, Owen einen warnenden
Blick zukommen zu lassen, so etwas wie »wenn du
diesem Mädchen wehtust, bringe ich dich um«,
doch Owen wich seinem Blick aus.

Patty lächelte weiterhin und schien glücklich
zu sein. »Mir geht’s prima. Aber der hier –
der ist zum Schießen. Total lustig. Der neue Dane
Cook.«
»Bin ich doch gar nicht.« Owen machte ein
beleidigtes Gesicht. »Wie kommst du nur darauf?
Und wer ist Dane Cook?«
»Siehst du?«, meinte Patty liebevoll. »Er
weiß genau, dass Dane Cook ein Komiker ist.«
»Ja, stimmt, Owen ist ein Witzbold«, be-
stätigte Michael, der Patty am liebsten direkt ge-
warnt hätte. Owen war nicht absichtlich grausam,
doch Michael war klar, dass diese Sache ein böses
Ende nehmen würde. »Gut, bis bald also.«
»Tschüss!«, verabschiedete sich Patty. Mi-
chael ging seufzend die Treppe hinunter. Er war
nervös wegen Patty – und wegen ihrer kleinen
Tochter. Owen hatte frei heraus gesagt, für ihn
sei bisher jede Frau ein Sexobjekt gewesen, selbst
seine Ehefrau. Echt toll. Hm, vielleicht würde
Patty ihn vor sich selbst retten.
Er blickte die Treppe hinauf zu den beiden, und
da war es wieder – Owens »Ich komme mit al-
lem durch«-Lächeln. Super. »Spiel nicht den
Richter über mich, Mikey!«, rief Owen
grinsend.
151/346
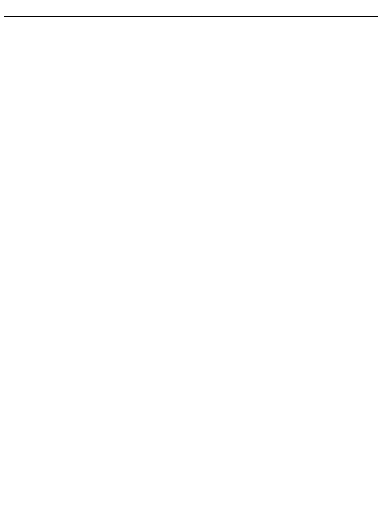
Und er hatte die beiden zusammengebracht.
Toller Freund, der er für Patty war.
Draußen auf der Straße wusste Michael nicht,
was er tun sollte. Er hatte beschlossen, sich Jane
nicht mehr zu nähern, also war das Thema
erledigt. Es war Wochenende, sodass die Straßen
nicht so voll wie sonst waren. Das war gut. Doch zu
sehen, wie Patty mit Owen nach Hause ging, hatte
ihm den Tag vermiest, noch bevor er angefangen
hatte. Abgesehen davon hatte er sich noch nicht
richtig von der Begegnung mit Jane erholt.
Schließlich kam ihm eine Idee, zu der er, wie er
hoffte, nicht von Owen angeregt worden war. Viel-
leicht konnte er damit aber den Tag retten.
Er rief Claire De Lune an – sie war an diesem
wunderschönen Sonntag zu Hause und, ja, sie
würde sich freuen, ihn zu sehen.
152/346
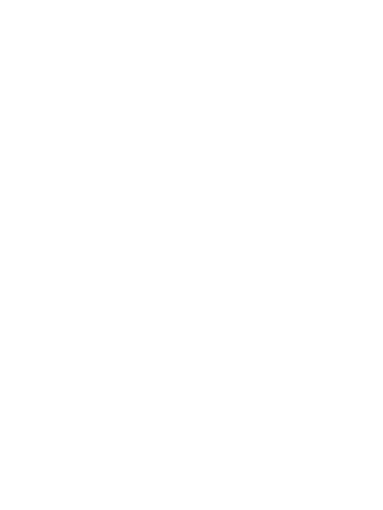
EINUNDDREISSIG
Ich musste schließlich in Brooklyn ein Taxi gefun-
den haben. Es musste über die Brooklyn-
Brücke zurückge fahren sein. Und es musste
mich vor meiner Wohnung in der 75th Street abge-
setzt haben.
So musste es passiert sein – aber daran erin-
nerte ich mich nicht genau.
Ich erinnere mich, dass Hugh losgefahren ist; ich
erinnere mich an die scharfen Kieselsteine, die mein
Bein getroffen haben; ich erinnere mich vor allem
daran, ihm den Stinkefinger gezeigt zu haben. Als
Nächstes hielt mir Martin die Haustür auf, und
ich stolperte zum Fahrstuhl.
Als ich die Wohnungstür öffnete, klingelte
das Telefon. Völlig benommen hob ich ab, ohne
daran zu denken, dass es Hugh sein könnte.
»Hier ist Jane«, meldete ich mich mechanisch
und schleuderte die Schuhe von den Füßen.
»Jane-Herzchen!« Die gebieterische Stimme
meiner Mutter. »Wo steckst du? Du hast gesagt,
du würdest zum Brunch kommen! Ich habe
diesen wunderbaren Graved Lachs von Zabar hier.

Und Karl Friedkin ist hier. Und ich habe Fotos von
der letzten Valentino-Kollektion. Und …«
»Tut mir leid, ich werde nicht kommen, Mutter.
Mir
geht’s
nicht
allzu
gut.«
Leichte
Untertreibung.
»Ich kann mir denken, was los ist … ist es we-
gen Hugh McGrath?«, fragte meine Mutter spiel-
erisch. »Bring den guten Jungen mit. Das wird
nett. Wir können uns über Dem Himmel sei
Dank unterhalten.«
Oh, auf gar keinen Fall.
»Hugh ist nicht hier, und mir geht’s nicht
besonders gut. Wir unterhalten uns später, Mut-
ter.«
Ich wartete nicht, bis sie sich verabschiedet hatte.
In meiner leeren Wohnung hielt ich es nicht aus.
Überall, nur nicht hier. Na ja, überall, nur nicht
hier und in Brooklyn. Ich zog meine verdreckte
Hose aus und eine Jeans und ein »Music in the
Park«-T-Shirt an und machte mich auf den Weg
ins Zentrum. Ziellos.
Nach etwa zwanzig Minuten bog ich auf der 57th
Street Richtung Westen ab. Dort lagen die Robinson
Galleries. Und Hermes. Und meine Kindheit-
sheimat fern der Heimat: das Tiffany.
154/346

Auf dem Schild am Fenster stand »Sonntags
11-18 Uhr geöffnet«. Was ich natürlich wusste,
da ich unzählige Sonntagnachmittage mit Vivi-
enne hier verbracht und Diamanten durch eine
Lupe begutachtet hatte, um zu versuchen, ihren
Wert einzuschätzen. Wahrscheinlich war ich die
einzige Siebenjährige gewesen, die sich mit den
Facettenproportionen und den Vorzügen eines
Asscher-Schliffs im Vergleich zum Brillantschliff
auskannte.
Eilig schlüpfte ich durch die Drehtür auf der
57th Street, als würde ich seilhüpfen. In null
Komma nichts war ich am Eingang der Fifth Avenue
und ertappte mich dabei, wie ich einen Diamanten
aussuchte.
155/346

ZW EIUNDDREISSIG
Immer, wenn ich bei Tiffany war, kamen die Erin-
nerungen zurück. Das Gefühl des Teppichs
unter meinen Füßen, das schimmernde Holz an
den Wänden, die Hitze der Lampen unter dem
Glas der Auslagen. Hier waren Vivienne und ich im-
mer allein hingegangen, ohne ihr Gefolge, und hier
hatten wir ein echtes Mutter-Tochter-Verhältnis
gelebt. Hier schien meine Mutter am ehesten sie
selbst gewesen zu sein – mehr noch als im Theat-
er. Und glücklich.
Ich sah mir die Auslagen an, als plante ich eine
Hochzeit im Juni, die ich doch heute erst in den
Sand gesetzt hatte. Die Diamantringe waren wie zu
einer göttlichen Ordnung aufgereiht: vom klein-
sten, kaum sichtbaren Ring mit einem Stein bis zu
den exquisiten, naturrosa und -gelben viereckigen
oder birnenförmigen Diamanten. Ein Ring kostete
schon so viel wie ein Luxuswagen.
»Darf ich Ihnen etwas zeigen?« Eine junge
Verkäuferin war wie aus dem Nichts aufgetaucht.
Sie entsprach meiner Vorstellung von Eleganz –
einfaches schwarzes Kleid mit schwarzer Perlen-
kette. Ganz schlicht.

»Hm«, sagte ich.
Ich bemerkte ihren verstohlenen Blick auf die
nackten Finger meiner rechten Hand.
»Wissen Sie«, begann sie in einem gekonnt
vertrauensvollen Ton, »viele Frauen beschenken
sich selbst mit einem Diamanten für ihre rechte
Hand.« Beschenken sich selbst. Na, wie sich das
anhörte. Viel besser als, sagen wir, »sich selbst
befriedigen«.
Ja, ich hatte tatsächlich die Anzeigen in Vanity
Fair und Harper’s Bazaar gesehen. Die
Diamanten für die rechte Hand. Die linke Hand
heißt, man wird geliebt. Die Rechte sagt, man ist
unabhängig. Bla-bla-bla. Doch offenbar hatte die
Werbung gewirkt. Zumindest bei mir.
»Dürfte ich den dort mal sehen?« Ich zeigte
auf einen klassischen Tiffany-Celebration-Ring mit
mehr als einem Dutzend makelloser Diamanten auf
einem Platinband.
»Er ist wunderschön, nicht wahr?«, sagte die
Verkäuferin, als sie ihn vorsichtig auf ein Stück
schwarzen Samt legte. Die Diamanten leuchteten
von innen heraus, und selbst als Siebenjährige
hätte ich sagen können, dass sie perfekt geschlif-
fen waren.
157/346

Gott, war dieser Ring schön. So schön, dass
mir beinahe die Augen schmerzten. Und mein Herz.
»Stecken Sie ihn sich einmal an«, drängte
die Handlangerin des Teufels.
Ich schob ihn über den Ringfinger meiner
rechten Hand. Oh! Ich kam mir wie eine richtige Er-
wachsene vor. Der Ring ließ meine Hand beinahe
auf den Tresen knallen. Er war einfach nur phant-
astisch. In jeder Hinsicht ein Celebration-Ring.
»Er sitzt wie angegossen und braucht gar nicht
angepasst zu werden«, flüsterte sie mir konspir-
ativ zu.
Ich war oft genug bei Tiffany gewesen, um zu wis-
sen, dass der Mann in grauem Anzug neben mir, der
so tat, als würde er sich ebenfalls Diamantringe
anschauen, vom Sicherheitsdienst war. Sah ich so
verdächtig aus? Gefährlich? Wäre schön.
»Was würde dieser hier kosten?«, fragte
ich.
»Fünfundsechzigtausend«, flüsterte sie.
Irgendwie schaffte sie es, zu klingen, als wäre der
Ring zu diesem Preis geschenkt.
»Ich würde ihn gerne kaufen«, sagte ich
gelassen.
»Natürlich«, erwiderte die Verkäuferin,
als hörte sie diesen Satz alle zehn Minuten.
158/346

Kreditkarten, Ausweis und Schecks wurden
hinübergereicht. Alles ging ganz schnell, und ja,
Virginia, es gibt einen Grund dafür.
Nachdem sie meinen Führerschein inspiziert
hatte, fragte die Verkäuferin: »Sind Sie zufällig
mit Vivienne Margaux verwandt?«
»Sie ist meine Mutter.«
»Ich verstehe.« Die Verkäuferin nickte wis-
send, und nach wenigen Minuten stand ich auf der
Fifth Avenue, wo das Licht in den Diamanten an
meiner Hand perfekt funkelte.
Ich schielte beim Gehen zu meiner rechten Hand
hinab. An der Ampel wagte ich einen weiteren Blick.
Dann blickte ich nach links.
Das war es.
Genauso verführerisch wie das Tiffany.
159/346

DREIUNDDREISSIG
Das St. Regis! Ich liebe das St. Regis«,
schwärmte Claire, als sie und Michael um die Ecke
der Fifth Avenue bogen und das Hotel erblickten. Er
hatte sie in der Nähe Bryant Park abgeholt, wo sie
mit einem anderen Model wohnte, von dort waren
sie auf der Sixth und dann auf der Fifth Avenue
nach Norden gegangen. Er hatte gewitzelt, er kön-
nte ihr etwas Kleines bei Tiffany kaufen – wieder
so eine komische Erinnerung an Jane, die ihm
gekommen war.
»Bist du reich, Michael?«, fragte Claire
lachend.
»Nur im Geiste«, antwortete er. Eigentlich
brauchte er nur mit den Fingern zu schnippen,
dann hatte er fast alles, was er wollte. Wortwört-
lich. Schnipp! Und schon steckte etwas Geld in sein-
er Tasche. Er wusste nicht, wie das passierte, doch
warum sich dagegen wehren? Aber er brauchte
ohnehin nicht viel, das einfache Leben gefiel ihm
am besten.
»Können wir hineingehen?«, fragte Claire.
»Na klar. Wir lieben das St. Regis!«

Und plötzlich stand er direkt davor – vor dem
Astor Court. Das Restaurant hatte sich völlig ver-
ändert, dennoch kam es Michael noch genauso vor
wie früher. Frauen in Designerkleidern, Väter,
die ihre Kinder zum Essen ausführten, Familien,
die sich über Petit Fours, Cremeschnitten,
Kuchen und Crème brûlées hermachten.
»Sind Sie zu zweit?«, fragte der Oberkellner.
»Ja, zu zweit«, bestätigte Michael. Er
spürte, wie sein Puls stieg. Aber warum? Es war
ja nicht so, als würde er Jane hier treffen. Auch
nicht die achtjährige Jane.
Er und Claire bekamen einen Vierertisch, von
dem die beiden überflüssigen Gedecke abger-
äumt wurden.
»Das ist traumhaft!«, schwärmte Claire.
»Ich war noch nie hier, obwohl ich schon fünf
Jahre in New York lebe.«
Michael lächelte sie an, froh, ihr diese Freude
bereiten zu können. Er ließ seinen Blick umher-
schweifen. Das Restaurant schien in der Zeit stehen
geblieben zu sein, mit der Musik – »Love in
Bloom« -, den Servierwagen voller Desserts, den
Porzellantabletts mit Sandwiches.
Aber es gab keinen imaginären Freund, der
Melone, kein achtjähriges Mädchen, das Eis mit
161/346

Karamellsoße aß. Es war, als fehlte auf der
Bühne einer der beiden Hauptdarsteller.
Jane.
Was tat er hier? Versuchte er, einige der schön-
sten
Nachmittage
seines
Lebens
wieder
wachzurufen? Mit Claire De Lune als Statistin für
ein trauriges, tapferes, wunderbares Mädchen, das
seinen Mut nicht verloren hatte, als er sie verlassen
hatte? Er blickte Claire an. »Ist das hier für dich
in Ordnung?«, fragte er.
Sie strahlte. »Natürlich! Ich liebe es, Michael!
Das würde jede Frau tun. Und falls du es nicht
bemerkt hast: Ich bin eine Frau.«
Er schluckte. »Ja, äh, ich habe es bemerkt.«
162/346

VIERUNDDREISSIG
Das Schwirren im Kopf, nachdem ich ein Vermö-
gen für einen Stein ausgegeben hatte, der als
Scheinwer fer auf einer Weltraumstation verwendet
werden konnte, ließ nach.
Zurück blieb nur noch ein leichtes Flattern. Als
würde die Wirkung einer Droge nachlassen. Jetzt
musste ich mich unbedingt entspannen, mich ber-
uhigen. Und, ja, nach diesem vermaledeiten Tag
auch ein Dessert essen. Das St. Regis war der per-
fekte Ort, um all das zu tun. Das Elend zog sich wie
ein roter Faden durch mein Leben: Mein Exfreund
war ein Egomane und totaler Wichser; meine ak-
tuelle Mutter trieb mich schon seit Jahrzehnten in
den Wahnsinn; ich hatte eine Unsumme für ein-
en Ring ausgegeben, den ich nicht brauchte.
Abgesehen davon ging es mir prächtig.
»Hätten Sie gerne die Speisekarte, Miss?«,
fragte der Kellner.
Woher wusste er, dass ich eine »Miss« war?
Sah er es in meinen Augen? An der Art, wie ich
mich gab?

Ich musste mich wieder unter Kontrolle bekom-
men. »Nein, nur einen Eistee, bitte«, bestellte
ich tugendhaft.
»Gerne.«
Dann
kehrte
meine
Zurechnungsfähigkeit
zurück. Mit Pauken und Trompeten – aber zu
spät. Ich trug einen riesigen Diamantring, den ich
mir selbst gekauft hatte.
»Moment! Warten Sie!«, rief ich den Kellner
zurück. »Wissen Sie, was? Ich nehme den
Früchteeisbecher mit Karamellsoße. Und mit
Kaffeeeis.«
»Eine weit bessere Entscheidung.«
Ich sandte Diamantlaserstrahlen durchs ganze
Astor Court, als der Kellner mit meinem Früchte-
becher
zurückkehrte.
Der
Silberteller
war
größer als Hughs Kopf. Ich würde ihn auf
keinen Fall schaffen, jedenfalls nicht, wenn ich mich
noch einmal erhobenen Hauptes in der Öffentlich-
keit sehen lassen wollte. Wie hatte ich so ein Ding
als Achtjährige nur geschafft? Vielleicht war ich
doch etwas fülliger gewesen als in meiner Erin-
nerung. Quatsch, der Becher war damals nicht so
groß gewesen. Ja. Das war die Erklärung.
Der erste köstliche Löffel voll Eis brachte alles
zurück. Alles war sehr »proustisch«. Auf der
164/346

Suche nach den verlorenen schuldbewussten
Freuden und so.
Wie hatte ich diese Sonntagnachmittage hier mit
Michael und bei Tiffany geliebt, egal, wo,
Hauptsache, Vivienne hatte mich mitgenommen.
Meine Mutter und ihre Freunde hatten sich un-
terhalten oder Geschäfte abgeschlossen, und Mi-
chael und ich hatten uns in unsere eigene ima-
ginäre Welt begeben. War dies der letzte
Glücksmoment in meinem Leben gewesen?
Wenn ja, dann war ich bedauernswerter, als ich
zugeben wollte.
Ich nahm noch einen Löffel voll, diesmal aber
die richtige Mischung aus Eis mit Karamellsoße.
Das war genau das, was ich brauchte. Das, und den
großkotzigen Ring an meiner rechten Hand. Ich
bewegte die Finger und ließ den Stein im Licht
funkeln.
Apropos bemitleidenswert, ich musste mir
eingestehen, dass ich immer noch an meinen ima-
ginären Freund aus der Kindheit dachte. Was
könnte mir das über mich selbst verraten?
Und dann …
Ich blinzelte, blickte zur Seite, blinzelte wieder.
Was, zum …
165/346

Ich hatte ein Paar entdeckt, das nur ein paar Tis-
che entfernt saß. Ein gut aussehendes Paar. Ei-
gentlich die perfekte Wahl für das Jane-und-
Michael-Spiel.
Aber das war gar nicht so schockierend.
Ich legte meinen Löffel ab, wischte mir langsam
mit der Serviette über den Mund und starrte
hinüber.
Plötzlich zitterten meine Hände, meine Knie
und meine Unterlippe.
Der Mann …? Das konnte nicht sein …
Michael?
Wieder blinzelte ich rasch wie eine Katze im
Zeichentrickfilm und begann zu schwitzen.
»Michael« war mit einer sehr hübschen
Frau mit seidigem, schwarzem Haar zusammen. Sie
sah wunderbar aus. Eine dieser Frauen, die schön
wie Models waren, eine Missbildung der Natur, aber
im positiven Sinn. Michael hatte immer erzählt, er
könne nur für Kinder den imaginären Freund
spielen. Achtjährige waren die Grenze. Deswegen
hatte er mich an meinem neunten Geburtstag ver-
lassen. War er jetzt befördert worden? Konnten
Erwachsene auch imaginäre Freunde haben?
Wenn ja, wo war meiner?
166/346

Vielleicht war er auch gar nicht Michael. Ich
meine, natürlich war er nicht Michael. Der war
schließlich nur eine Imagination.
Aber dieses unverwechselbare Lächeln. Die
wunderbaren grünen Augen. Er sah so gut aus
wie immer, wenn nicht gar besser.
Ich könnte ja auch verrückt sein, kam mir in
den Sinn.
Hm, gut, das könnte ich gelten lassen. Was soll-
te ich jetzt damit anfangen? Die 911 anrufen? Da fiel
mir ein: Wenn ich wirklich durchgedreht war,
wäre ich für mein Handeln nicht verantwort-
lich. Auf eine Art machte mich das frei.
Ich erhob mich und ging auf die beiden zu.
Wenn dieser Mann nicht Michael war … nun,
dann würde ich trotzdem meine Arme um ihn le-
gen. Ihn vielleicht sogar küssen und ihn bitten,
mich zu heiraten.
An dem Tag, als Michael mich verlassen hatte,
hatte er gesagt, ich werde mich nicht mehr an ihn
erinnern. Damit hatte er völlig unrecht gehabt. Ich
erinnerte mich an jede kleine Kleinigkeit von ihm.
Und das hier war eindeutig Michael …
Sofern ich nicht völlig irre war.
Beides war möglich.
167/346

FÃœNFUNDDREISSIG
Wenn ich diesen ganzen Früchtebecher esse, ist
das, erstens, ausschließlich dein Fehler. Zweitens
werde ich für die Aufnahmen am Montag nicht
mehr in die Kleider passen, und drittens werde ich
rausgeschmissen.«
Michael lachte. »Jedes Unglück hat auch sein
Gutes. Dann studierst du Vollzeit, machst deinen
Abschluss und wirst noch eher eine wunderbare
Lehrerin.«
Sie nahm einen Löffel von ihrem Eis – einen
großen Löffel voll – und verzog ihr Gesicht mit
dem Eis zwischen den Zähnen, wie es nur wun-
derbare Models und kleine Kinder tun können,
ohne auf Erwachsene unanständig zu wirken. Hm,
vielleicht können das nur Models tun. »Meinst
du?«, fragte sie.
»Natür…« Plötzlich starrte Michael quer
durchs Restaurant.
»Erde an Michael«, meldete sich Claire.
»Ground Control to Major Tom.«
Michael starrte noch immer hinüber und
dachte: Das kann doch nicht wahr sein. Das darf
nicht wahr sein.

Einen Moment lang bekam Michael Panik, bis er
sich sagte, dass dies nur ein Zufall war. Sie konnte
sich nicht an ihn erinnern. Das taten sie nie. Immer,
wirklich immer vergaßen sie alles. Das machte die
Sache erträglich.
Er senkte den Blick und beschäftigte sich mit
der Speisekarte.
Dann spürte er, dass sie neben ihm am Tisch
stand. Lässigkeit vortäuschend, blickte er auf.
Ihre dunklen Augen waren weit aufgerissen, ihr
hübsches Gesicht war blass. »Michael«, sagte
sie.
Er erwiderte nichts. Er brachte keinen voll-
ständigen Satz zusammen. Und keinen zusam-
menhängenden Gedanken.
Wieder sprach Jane. Nicht das kleine Mädchen
Jane, sondern die erwachsene Frau.
»Michael? Du bist es doch, oder? O mein Gott,
Michael? Du bist da.«
169/346

SECHSUNDDREISSIG
Meine Stimme war, gelinde gesagt, zittrig und rau,
sodass ich mich beinahe selbst nicht wiedererkan-
nte. Ich war kurz davor, mich völlig zu blamieren.
»Du bist doch Michael, oder?«, fragte ich noch
einmal und dachte, dass ich mich umdrehen und
fortrennen musste, wenn ich falsch lag.
Er holte tief Atem. »Du kennst mich?«, fragte
er. »Bist du sicher?«
O Gott, es könnte tatsächlich wahr sein.
»Natürlich kenne ich dich. Ich würde dich
überall erkennen.«
Und dann sagte er meinen Namen, einfach so:
»Jane?«
Das Astor Court war ein großes Restaurant,
doch ich fühlte mich beengt. Auch die Ger-
äusche waren etwas abgedreht. Alles kam mir,
gelinde gesagt, plötzlich so unwirklich vor. Das
hier konnte nicht wahr sein, war es aber.
Die schöne Frau, mit der Michael am Tisch
saß, wischte sich mit einer Serviette über den
Mund und erhob sich. »Ah, die geheimnisvolle
Jane«, sagte sie freundlich. »Ich muss gehen,
Michael. Danke für das Eis und den Ratschlag.«

Sie lächelte mich an. Ich musste blinzeln, weil sie
wirklich viel schöner war als ich. »Setz dich bitte,
Jane.«
SECHSUNDDREISSIG
Als auch Michael sich erhob, hatte ich Angst, er
würde ebenfalls gehen. Diesmal würde ich es
nicht zulassen wie damals als Neunjährige. Dies-
mal würde ich mich auf einen Zweikampf ein-
lassen, gleich hier im Astor Court, wenn es sein
musste. Auf dem Orientteppich.
Doch Michael deutete auf den leeren Stuhl.
»Bitte, setz dich, Jane. Jane Margaux.«
Ich setzte mich, dann blickten wir einander an. Es
war, als säße ich jemandem aus einem Traum,
einer Phantasie oder einer Person aus einem Ro-
man gegenüber. Wie war das hier möglich?
Mir fiel keine logische Antwort ein. Zum Glück
hatte ich mit zwölf Jahren das logische Denken
aufgegeben, als mir klar geworden war, dass ich Si-
mon Le Bon nie heiraten würde. Michael schien
noch immer zwischen dreißig und fünfund-
dreißig zu sein, und auf seiner Nase prangten dies-
elben Sommersprossen. Seine Augenbrauen, seine
Ohren, sein Haar, seine Augen – alles war noch
genauso wie damals. Diese wunderschönen
grünen Augen, die freundlichsten Augen, die ich
171/346

je gesehen hatte. In diese Augen hatte ich eine Mil-
lion Mal geblickt, und jetzt blickte ich wieder in sie
hinein. Sie waren so unglaublich grün.
Die nächste Frage hätte meinerseits nicht ehr-
licher sein können. Es ging um etwas, das ich un-
bedingt wissen musste. »Michael, bist du eine
Imagination?«
Er machte ein verlegenes Gesicht. »Ich denke,
das ist Ansichtssache.«
»Was tust du hier? Wieso ist das möglich?«
Er breitete die Hände aus. »Ehrlich, ich habe
keine Ahnung. Ich bin gerade in New York … und
warte … auf meinen nächsten Auftrag.«
»Ach, dann war sie das gar nicht?« Ich nickte
in die Richtung, in die die tolle Frau verschwunden
war.
»Du bist die Letzte, die das fragen muss«, er-
widerte Michael. »Du weißt, was ich tue, und das
tue ich nicht mit Erwachsenen.« Er runzelte die
Stirn.
»Das
habe
ich
ungeschickt
aus-
gedrückt.«
»Und du bist zufällig im Astor Court gelandet?
An einem Sonntag? Und ich auch?«
Er zuckte hilflos mit den Schultern und blickte
mich genauso ratlos an, wie ich mich fühlte.
»Sieht so aus, hm?«
172/346

Auf eine Art war es ein Trost, ihn genauso verwir-
rt zu sehen, wie ich es war.
»Jane.«
Ich konnte nicht glauben, dass er es war, Michael,
der meinen Namen sagte.
»Wieso erinnerst du dich an mich? Das
dürfte eigentlich nicht sein.«
»Ich weiß nicht«, sagte ich. Ein seltsames
Gefühl der Ruhe überkam mich. »Du hast
gesagt, ich würde dich vergessen. Ich würde
aufwachen und mich nicht mehr an dich erinnern.
Aber am nächsten Tag bin ich aufgewacht und
habe gemerkt, dass du wirklich gegangen bist. Ich
hatte das Gefühl, ein dicker Stein wäre auf
meine Brust gefallen. Ich konnte nicht aufstehen.
Tagelang habe ich geweint.«
Michael blickte mich entsetzt an.
»Ich habe dich … nie vergessen. Dreiundzwan-
zig Jahre lang habe ich jeden Tag an dich gedacht.
Und jetzt bist du wieder da. Das ist … unglaub-
lich.« Gelinde gesagt.
»Es tut mir leid, Jane. Normalerweise vergessen
mich die Kinder immer. Ich hätte dir nie solche
Schmerzen bereitet, wenn ich etwas dagegen hätte
tun können.«
173/346

Mit der Hoffnung einer Achtjährigen blickte ich
in seine Augen. »Hm, ich glaube, du kannst es
wiedergutmachen.«
174/346

SIEBENUNDDREISSIG
Klar im Kopf war ich erst wieder, als Michael und
ich an diesem sonnenverwöhnten Sonntag-
nachmittag die Fifth Avenue entlanggingen. Ich
kam mir wie in einem Wachtraum vor. Oder so
ähnlich. Auf jeden Fall war es unglaublich und
belebend und verwirrend.
Im Alter von sechs Jahren hatte ich Michael als
lustig, klug und als wirklich netten Kerl erlebt. Doch
jetzt, wo ich als erwachsene Frau mit ihm redete,
wurde mir klar, dass er noch viel mehr Ei-
genschaften hatte. Auf jeden Fall war er ein hervor-
ragender Zuhörer, was ihn an die Spitze all jener
stellte, mit denen ich je was gehabt hatte.
»Erzähl mir alles«, verlangte er. »Alles, was
ab deinem neunten Geburtstag passiert ist.«
Also erzählte ich und versuchte, mein Leben in-
teressanter und aufregender klingen zu lassen, als
es tatsächlich gewesen war. Es gefiel mir, ihn zum
Lachen zu bringen, was mir während unseres
Spaziergangs ziemlich oft gelang. Sobald wir ins
Freie getreten waren, war er sehr locker und
entspannt gewesen. Mir war es genauso ergangen.
Mehr oder weniger.

Mit dem Bewusstsein einer Erwachsenen merkte
ich, dass Michael das Leben und die Menschen
liebte. Er konnte allem etwas Lustiges abgewinnen,
und er akzeptierte es. Er konnte über sich selbst
lachen, und er zählte sich selbst zu den Lach-
haften. Er lachte mit den Menschen, nicht über
sie.
»Wer war sie denn?«, erkundigte ich mich
über die Brünette im St. Regis.
»Ich erinnere mich an keine andere Frau.
Welche andere Frau?«, fragte Michael lächelnd.
»Sie ist nur eine Freundin, Jane. Sie heißt
Claire.«
»Nur eine Freundin?«
»Nicht so eine Freundin … auch keine an-
dere.«
»Und was bedeutet der rote Fleck an deinem
Hals? Ein Vampirbiss?«, wollte ich wissen. »Will
ich das überhaupt wissen?« Nicht, dass ich
eifersüchtig gewesen wäre. Wegen meines ima-
ginären Kinderfreundes. Gott, ich denke, ich war
echt – ganz echt – übergeschnappt. Nun,
damit würde ich wohl leben müssen.
»Ich boxe ein bisschen«, erklärte er.
»Oh.« Ich versuchte ihn mir vorzustellen.
»Ich trete täglich gegen meine Mutter im Ring
176/346

an, also haben wir noch eine Gemeinsamkeit.« Er
warf lachend seinen Kopf zurück. Auch ich
musste
lachen
–
die
Freude
war
kaum
auszuhalten.
Dies war eindeutig mein Michael, der Michael aus
meiner Kindheit, doch jetzt, als Erwachsene, konnte
ich ihn auf eine ganz andere Art genießen. Seine
Intelligenz, sein Witz und sein Aussehen … mein
Gott! Boxen und der Fleck an seinem Hals hatten
auf unpolitisch korrekte Weise sogar etwas völlig
Unmodernes. Sein Lächeln war immer ansteckend
gewesen, hatte mich mit Glück erfüllt. Das tat
es noch immer.
Auch wenn mein Herz auf Entdeckungsreise ging,
ließ ich ihm Raum für die Möglichkeit, dass
Michael jeden Moment verschwinden konnte, dass
er sich plötzlich umdrehen und mir sagen kön-
nte: »Du wirst mich vergessen, Jane. So funk-
tioniert das eben.«
Aber so war es nicht gewesen. Vielleicht, so hoffte
ich, würde er diesmal nicht wieder verschwinden.
»Ach, hier ist das Metropolitan Museum«,
stellte Michael fest. »Es hat noch eine Stunde
geöffnet.«
Waren noch keine vierundzwanzig Stunden ver-
gangen,
seit
ich
hier
drin
einen
meiner
177/346

fürchterlichsten Abende verbracht hatte? Es kam
mir wie ein Jahr vor. Doch ich wollte unbedingt mit
Michael hineingehen.
178/346

ACHTUNDDREISSIG
Wohin sollen wir zuerst gehen?«, fragte ich ihn,
als wir in der riesigen Eingangshalle des Museums
standen.
»Ich würde dir gerne was zeigen«, begann
Michael, bevor er über sich selbst lachte. »Ich
meine, ich bin sicher, du hast es schon tausendmal
gesehen, aber ich wollte es gerne mit dir zusammen
anschauen. Okay?«
»Klar.« Er hätte auch fragen können, ob ich
mit ihm eine Dose Katzenfutter essen wollte, ich
hätte auf keinen Fall nein gesagt. Michael nahm
meinen Arm, was für ihn nur natürlich zu sein
schien, mir aber eine Gänsehaut bereitete und
mich fast umhaute. Im positiven Sinn. Tot umzufal-
len wäre nicht so gut gewesen.
Arm in Arm gingen wir die breite Treppe hinauf.
Ich genoss es, an seiner Seite zu sein, aber es war
egal, wo wir waren, weil ich schließlich nur
träumte, oder?
Wir bogen nach links ab, gingen durch eine
große Holztür und standen in einem der
schönsten Säle der Welt. Riesige Leinwände

mit Monets Wasserlilien hingen an den Wänden,
umgaben uns, führten uns in eine andere Welt.
»Warum bringen mich so schöne Dinge immer
fast zum Weinen?«, fragte ich Michael, als ich
mich gegen ihn lehnte. Meine Frage war unbedacht,
eine, die ich Hugh nie gestellt hatte.
»Ich weiß nicht«, antwortete Michael. »Vi-
elleicht ist Schönheit, wahre Schönheit, so
überwältigend, dass sie uns direkt ins Herz
trifft. Vielleicht weckt sie Gefühle, die in uns ver-
schlossen sind.« Er blinzelte und lächelte ver-
schämt. »Entschuldige. Ich habe mir wieder so
eine Talksendung angesehen.«
Ich lächelte zurück, entzückt über
diesen Mann, der tatsächlich über sich selbst
lachen konnte. Das genaue Gegenteil von Hugh –
weder dem Grant noch dem Jackman, sondern dem
aus meinem alten Leben.
Schweigend schlenderten wir durch diesen aufse-
henerregenden Saal, der unsere Augen und unsere
Herzen erfüllte.
Nach einer Weile schienen wir beide das Ge-
fühl zu haben, dass es Zeit war zu gehen.
»Ich begleite dich nach Hause«, bot Michael
an. »Möchtest du?«
180/346

Mochte ich? Natürlich mochte ich. »Klar, das
wäre prima«, antwortete ich. »Es ist nicht weit
von hier, auf der anderen Seite vom Park. In den
Siebziger-Straßen.«
»Ich weiß«, sagte er.
Ich war überrascht. »Woher weißt du
das?«
Er blieb stehen. »Ich weiß es einfach, Jane. Du
weißt, wie ich bin. Bestimmte Dinge weiß ich
einfach.«
Als der Nachmittag in den Abend überging,
wurde die Luft kühler und der Himmel grauer.
Wir gingen Richtung Osten zur Park Avenue. Mi-
chael hielt nicht mehr meinen Arm, und ich be-
dauerte bereits den Abschied. Ich wusste nicht, ob
ich ihn aushalten würde, aber ich hatte keine an-
dere Wahl.
Auf der 80th Street kamen wir an einem schicken
Gebäude vorbei. Die Eingangshalle hinter den
Glastüren war mit französischen Antiquitäten
ausgestattet, die Wände mit Goldblatt verkleidet.
In der Mitte der Halle stand ein großer Emailtopf
mit dem größten Gardenienbusch, den ich je
gesehen hatte.
»Oh, ich liebe Gardenien«, schwärmte ich.
»Ihren Duft. Sie sind so hübsch.«
181/346

»Geh weiter«, sagte Michael. »Ich hole dich
ein.«
Nervös betend, er möge nicht verschwinden,
ging ich langsam weiter, ohne zu versuchen, nach
hinten zu blicken. Einen Moment später war er
wieder neben mir – in der Hand eine einzelne
weiße, duftende Gardenie mit zart rosa ger-
änderten Blütenblättern.
»Wie machst du das nur?«, fragte ich.
»Was? Dass ich dir die Blume besorgt habe?«
»Nein. So … perfekt zu sein.« Als ich den
süßen Duft der Gardenie einatmete, war ich
wieder den Tränen nahe.
Michael fühlte sich so warm und vertraut an,
als er, ohne zu antworten, meinen Arm nahm.
Wir gingen weiter die Park Avenue entlang. Ich
versuchte, den Abschied hinauszuzögern, indem
ich immer langsamer ging. Doch das Unvermeid-
liche ließ sich nicht vermeiden, und schließlich
standen wir vor meinem Haus.
»N’Abend, Miss Margaux«, grüßte
Martin. »Oh, und … N’Abend, Sir.« Martin
blickte Michael an, als hätte er ihn schon einmal
gesehen, doch das war nicht möglich.
Ich verging fast bei dem Wunsch, Michael nach
oben zu bitten, aber das wäre zu aufdringlich, zu
182/346
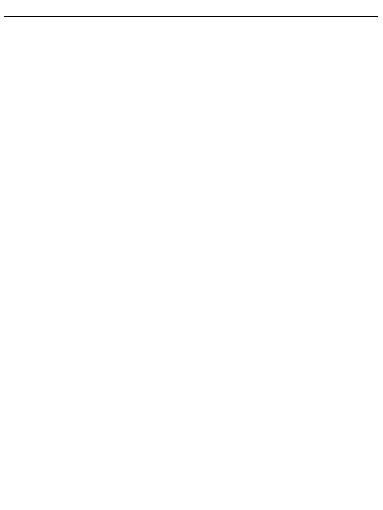
anmaßend, zu Vivienne gewesen. Noch komischer
als die plötzliche Stille zwischen uns war unser
höflicher Handschlag. Aber ich konnte nicht zu-
lassen, dass Michael so einfach in die Nacht
verschwand.
»Michael, ich muss dich das fragen«, platzte
ich heraus. »Es tut mir leid, aber ich muss. Wirst
du wieder weggehen?«
Michael schwieg einen Moment. Der Druck, der
sich in mir aufbaute, war kaum auszuhalten. Ich
hatte Angst, meine Ohren würden gleich platzen.
Dann ergriff Michael erneut meine Hand und
lächelte freundlich.
»Wir sehen uns morgen, Jane. Ich … ich ver-
misse dich schon jetzt.«
183/346

NEUNUNDDREISSIG
Ich hatte das undeutliche Gefühl, dass es früh-
er Morgen und ich kurz vor dem Aufwachen war.
Und dass sich etwas in meinem Leben drastisch
geändert hatte. Dann erinnerte ich mich an Mi-
chael und riss meine Augen weit auf. Bitte, lieber
Gott, lass es keinen Traum sein, betete ich im
Stillen.
Ich hatte Angst, mein Kopf könnte wie Glas zer-
brechen, als ich mich zum Nachttisch drehte. Dort
stand meine weiße Gardenie, die Michael mir am
Abend zuvor geschenkt hatte.
Ich berührte sie, um sicherzugehen, dass sie
echt war – sie war es -, setzte mich auf und
schwang die Beine über die Bettkante. Es war
kein Traum gewesen!
So fühlt sich Glück an, dachte ich. Die Ener-
gie, das unausweichliche Lächeln. So ist es, wenn
man sich auf den Tag freut, wenn man glaubt, es
könnte etwas Schönes passieren. Es war ein
neues und ganz anderes Gefühl.
In der Küche schenkte ich mir zunächst ein
großes Glas Orangensaft ein, dann widmete ich
mich
meinem
aufdringlich
blinkenden

Anrufbeantworter. Um keinen Herzinfarkt zu
bekommen, drückte ich lieber die Abspieltaste.
»Jane, ich bin’s. Was soll ich sagen. Es tut
mir schrecklich leid. Ich weiß nicht, was in mich
gefahren ist. Die Sache in Brooklyn macht mir echt
zu schaffen. Ruf mich an und …«
Löschen.
»Jane-Herzchen, ich denke, es war etwas
rücksichtslos von dir, nicht zum Mittagessen zu
kommen. Ich kam nicht dazu, dir deinen Kuss zu
geben.
Und
weißt
du,
Karl
Friedkin
ist
lebenswichtig für …«
Löschen.
»Jane-Herzchen, ich habe gerade über die
vierte Szene in Dem Himmel sei Dank nachgedacht.
Ich weiß nicht, welchen Hollywood-Schreiberling
du engagiert hast, der das Drehbuch …«
Löschen.
Auch die restlichen neun Nachrichten waren mir
egal. Löschen.
Anschließend nahm ich eine Dusche, drehte
aber, mal anders als sonst, das kalte Wasser stärk-
er auf. Die Wasserstrahlen prickelten auf meiner
Haut, brachten mein Blut in Wallung. Ich fühlte
mich lebendig. Als ich mich abtrocknete, mied ich
ausnahmsweise
nicht
den
Blick
in
den
185/346

Ganzkörperspiegel. Na, so schlimm sah ich gar
nicht aus – frische, rosige Haut, dichtes, gesundes
Haar. Hatte ich Ãœbergewicht? Quatsch, nein. Ich
hatte eine üppige Figur, weibliche Rundungen.
So sehen Frauen eben aus, sagte ich mir.
Ich schlüpfte in helllila Seidenhöschen und
ging zum Schrank. Ich wusste bereits, dass ich nicht
wie üblich einen schwarzen Rock und ein
schwarzes T-Shirt anziehen würde.
Ich entschied mich für meine weiche, be-
queme, verblasste Lieblingsjeans, dazu die weiße
Bluse, mit der ich mich immer wohlfühlte. Um
die Hüfte schnallte ich mir einen alten Cowboy-
Gürtel.
Jetzt war ich sorgenfrei und glücklich und
hatte vielleicht zum ersten Mal seit meinem achten
Lebensjahr das Gefühl, in meiner eigenen Haut
zu stecken.
Bevor ich die Wohnung verließ, um ins Büro
zu gehen, roch ich noch einmal an der Gardenie und
steckte mir meinen neuen Diamantring an den
Finger.
186/346

VIERZIG
Hier sind deine Nachrichten. Hier ist dein Kaffee.
Und dieses Presslufthammergeräusch sind die Ab-
sätze deiner Mutter, die über den Flur angeran-
nt kommt.«
MaryLouise, meine Sekretärin, reichte mir ein-
en Becher mit einem Filmlogo von History Boys
– Fürs Leben lernen. Mir hatte sowohl das
Stück als auch der Film gefallen, also bestand
Hoffnung für Dem Himmel sei Dank, oder?
»Hm, danke. Der ist köstlich«, lobte ich,
nachdem ich einen großen Schluck getrunken
hatte.
»Gut. Wenn man mich hier rauswirft, kann ich
ja bei Starbucks arbeiten.«
»Vielleicht trifft’s uns beide«, murmelte
ich. »Es lebe der Beruf des barista.«
Ich arbeitete mich durch den Stapel Nachrichten.
Was nicht überraschte: Die meisten stammten
von Hugh und seiner schmierigen Agentin und
seinem schäbigen Finanzmanager. Die drei hatten
es sogar geschafft, getrennt anzurufen. Sie konnten
mich mal an meinem mit Jeansstoff bekleideten Ar-
sch lecken.

»Ich habe dir erspart, dir die Nachrichten von
…«, begann MaryLouise, bis die Tür aufflog
und Vivienne wutschnaubend hereinstürmte.
»… deiner Mutter zu geben. Tärä, und hier
ist sie schon!«
Vivienne blieb stehen, die Hände in ihre
Wespentaille gestemmt.
Ich musste mich richtig zusammenreißen, um
nicht zu fragen: »Sind Sie bereit für Ihre Na-
haufnahmen, Miss Desmond?«
Zuerst gab sie mir meinen morgendlichen Kuss.
Dann legte sie los.
»Es ist fast Mittag, Jane. Wo, zum Teufel, hast
du gesteckt? Und was hast du da an? Gehst du zu
einem Rodeo?«
Ich schaute weiter die Nachrichten durch. Von
Michael war keine dabei.
»Ich habe dich was gefragt«, ermahnte mich
Vivienne laut und beugte sich über meinen
Schreibtisch, als wollte sie mir ins Gesicht springen.
»Und zwar in einem sehr zivilisierten Ton, sollte
ich hinzufügen.«
»Hast du noch Süßstoff?«, fragte ich
MaryLouise.
Sie
nickte
und
öffnete
eine
Schreibtischschublade.
188/346

Meine Mutter war sprachlos, aber nur für ein-
en kurzen Moment. Wäre auch zu schön
gewesen. Sie holte wieder Luft, als ich den
Süßstoff umrührte.
»Ich brenne darauf, zu erfahren, wo du gestern
tagsüber und am Abend gesteckt hast«, fuhr sie
mit fester Stimme fort. »Ich habe dich so oft an-
gerufen, dass ich schon fast die Wahlwiederholung-
staste demoliert habe. Findest du es nicht mehr an-
gebracht, auf die Anrufe deiner Mutter zu ant-
worten? Ist dein AB kaputt? Oder ist dies so etwas
wie eine zwanzig Jahre verspätete Jugendrebel-
lion?«
Angesichts meines fortgesetzten Schweigens
änderte Vivienne ihre Strategie. »Ich habe ge-
hört, was gestern mit dem armen Hugh und Feli-
cia und Ronnie passiert ist.«
So, wie sie es sagte, hörte es sich an wie:
»Hiroshima hat angerufen. Es heißt, du hättest
sie bombardiert.«
»Ich weiß nicht, was in dich gefahren ist«,
fuhr sie fort. »Weißt du, wie wütend die drei
auf dich sind? Und zu Recht. Weil du dickköpfig
bist. Und unrecht hast. Ich kenne das Showbusi-
ness, wie du es nie kennen wirst, und Hugh
189/346

McGrath ist perfekt für diese Filmrolle. Ohne
Hugh wird es keinen Film geben.«
Ohne Hugh-du-du-du, meinte sie wohl. »Danke,
Mutter.«
Nachdem ich noch einen Schluck Kaffee genom-
men hatte, ließ ich den Rest der Nachrichten wie
Konfetti in den Papierkorb fallen.
»Du hast Glück, dass ich zur Schadensbe-
grenzung hier bin«, fuhr meine Mutter fort. »Wir
müssen uns mit dem armen Hugh und seinen
Leuten zum Mittagessen treffen. Ruf in der Gotham
Bar and Grill an. Wir treffen sie dort um eins. Wenn
man dich in deiner Cowgirl-Kleidung reinlässt.«
Ich trank meinen Kaffee leer.
»Bist du fertig, Mutter?«
Ihre Augen funkelten.
»Erstens bin ich eine erwachsene Frau. Ich war
gestern aus. Mit einem Freund. Wo wir waren, geht
dich nichts an.
Nein, mein AB ist nicht kaputt, ich war
beschäftigt. Dies ist keine Jugendrebellion, da ich,
wie schon gesagt, eine erwachsene Frau bin. Und
ich benehme mich wie eine erwachsene Frau. Ich
empfehle dir, es mir gleichzutun.
Jetzt zu Hugh, weder Grant noch Jackman, und
die Rolle im Film. Die Diskussion ist beendet. Wir
190/346

werden nie wieder darüber reden. Dem Himmel
sei Dank ist mein Eigentum. Die Finanzierung ist
unter Dach und Fach. Ich habe das Studio
eingeschaltet. Und ich möchte einen Besseren als
Hugh McGrath. Hast du mich verstanden, Mutter?
Ich möchte nicht noch einmal darüber
diskutieren.
Es tut mir also leid, dass das Mittagessen mit
Hugh und seinen Lakaien ausfällt. Zu deiner
Kritik über meine Kleidung werde ich mich nicht
äußern, weil ich entscheide, was ich anziehe, und
ich bin weder an deiner Meinung noch an der von
jemand anderem interessiert.« Außer an der von
Michael. »Und weißt du, was, Mutter? Ich
glaube, ich sehe toll aus.«
Meine Mutter starrte mich an, als wären mir
Fühler gewachsen. Sie stammelte und stotterte
vor sich hin, bis sie sich umdrehte und davon-
stürmte. Zuerst knallte meine Bürotür, dann
die von ihrem Büro am Ende des Flurs.
»Wäre das dann alles?«, fragte MaryLouise.
»Ich denke, wir sind mit allem durch.«
191/346
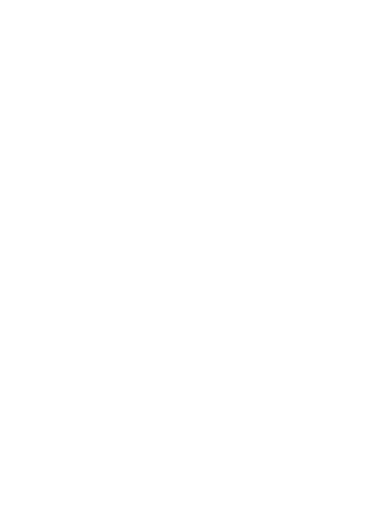
EINUNDVIERZIG
Was war los mit ihm? Genauer gesagt: Was war los
mit ihm und Jane?
Michael stieg in die Dusche und drehte das Wass-
er, anders als sonst, so heiß wie möglich. An
diesem Tag würde er sich mit Jane treffen. Er
war nervös, aufgeregt, glücklich und irgendwie
ängstlich. Alles gleichzeitig. Einen solchen Ge-
fühlswirrwarr hatte er bisher nicht erlebt, und es
war ihm nicht wohl dabei. Lange blieb er unter der
Dusche stehen, dann band er sich ein Handtuch um
die Hüften und wischte den beschlagenen Spiegel
ab.
Nachdem er dieses Gesicht, das er im Spiegel
nicht wiedererkannte, mit Rasierschaum eingeseift
hatte, begann er, sich mit einem der super-leis-
tungsstarken Rasierer mit fünf Klingen zu
rasieren.
Und dann passierte es. Etwas, das ihm noch nie
zuvor passiert war. Das Undenkbare.
Er schnitt sich beim Rasieren. Zum allerersten
Mal.
Blut sickerte aus der Stelle neben seinem Kinn
und vermischte sich mit dem weißen Schaum.
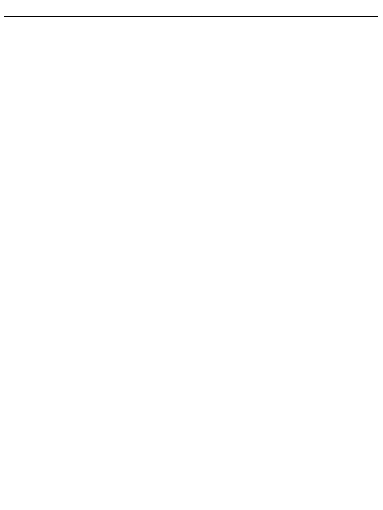
Er starrte darauf wie auf ein Wunder, als
würde plötzlich Wasser aus einem Felsen spru-
deln oder als würden fünftausend Menschen
mit Brot und Fisch gespeist werden. Als er sich fer-
tig rasiert hatte, wusch er sein Gesicht ab und klebte
ein kleines Stück Toilettenpapier auf die blutende
Stelle.
Unglaublich! Ein Pflaster aus Toilettenpapier!
Auch das eine Neuheit für ihn.
Er zog sich irgendwas Sauberes an und trat
hinaus in den Flur. In dem Moment, als er sich um-
drehte, schlich sich Patty, die Kellnerin aus dem
Olympia, aus Owens Wohnung. »Hallo, Mi-
chael«, grüßte sie und wurde auf altmodische
Weise rot. »Hast du dich beim Rasieren geschnit-
ten?«
»Hey, Patty. Ja, sieht wüst aus, nicht?«
»Stimmt. Äh, ich muss los … meine Mutter
passt auf Holly auf. Meine Tochter. Ich muss sie zur
Schule bringen und dann los zur Arbeit in die
Pfannkuchenfabrik.«
»Sei vorsichtig da draußen«, sagte er. Er
wollte auf Owens Wohnungstür zeigen und
sagen: »Sei vorsichtig da drin«, tat es aber nicht.
Patty grinste. »Polizeirevier Hill Street. Die
Sendung fand ich immer geil. Das hat der Sergeant
193/346

immer gesagt, oder? Bis später, Michael.« Er fol-
gte Patty die Treppe hinunter, doch als er auf die
Straße trat, war sie bereits fort. Hoffentlich ging es
ihr gut. Er fühlte sich irgendwie für sie verant-
wortlich. Vielleicht war das falsch.
Schließlich konzentrierte er sich auf seinen ei-
genen Tag.
Er hatte keine Ahnung, was er an diesem Vormit-
tag tun sollte, doch er wusste, Jane war ein Teil
davon.
»Ich habe mich beim Rasieren geschnitten!«,
sagte er laut und fing sich ein paar komische Blicke
von Passanten ein. »Ich denke, du solltest besser
aufpassen.«
194/346

ZW EIUNDVIERZIG
Normalerweise – sofern man das so nennen kon-
nte – frühstückte er mit »Freunden«.
Doch an diesem Tag musste er Jane wiedersehen
und mit ihr reden. Zumindest noch ein letztes Mal.
Also wagte er sich in das Gebäude, in dem sie
arbeitete, was ihm ursprünglich wie eine tolle
Idee, jetzt aber wie ein großer Fehler vorkam, ein
Fehler aus einer Reihe von vielen. Was tat er hier?
Was hoffte er zu erreichen?
»Guten Morgen.« Die Empfangsdame von
ViMar Productions riss ihn aus seinem Däm-
merzustand. »Sie sind sicher Schauspieler, oder?
Möchten Sie nur Ihre Bewerbung abgeben?«
Michael schüttelte den Kopf. »Wieso fragen
Sie mich das?«
Ȁh, haben Sie heute schon in den Spiegel
geschaut?«
Er überlegte, was er erwidern sollte, als ein
beängstigendes Bild aus der Vergangenheit hinter
der Empfangsdame durch die Schwingtür kam.
Es war Vivienne, das lebende Zeugnis der
Schönen Künste der plastischen Chirurgie.
Welche Unsummen an Geld hatte sie auf den Tisch

geblättert, um ihre Haut derart straffen zu lassen?
Apropos Wunder: Sie war keinen Tag gealtert.
Ihre Stirn glänzte wie nach einem plastischen
Eingriff, ihre Wangenknochen standen eine Idee zu
weit heraus. Doch sie sah toll aus. Ein bisschen zer-
brechlicher als früher, aber immer noch
betörend. Und voller Energie, natürlich.
Vivienne blickte ihn an. Michael hatte sie bereits
tausende Male gesehen, aber sie sah ihn zum ersten
Mal.
»Ah, hallo.« Vivienne hatte ihren Charme auf
volle Leistung aufgedreht. »Ich bin Vivienne Mar-
gaux. Ich kenne alle führenden Männer in New
York. Warum also kenne ich Sie nicht? Sagen Sie
nicht, Sie sprechen kein Englisch.«
»Gut, dann sage ich es nicht.« Michael
lächelte freundlich.
»Und dieses Eine-Million-Dollar-Lächeln«,
stellte Vivienne fest, als sie ihre Hand ausstreckte.
Michael ergriff sie. Sie war weich und glatt. Güti-
ger Himmel, selbst die Hände hatte sie über-
arbeiten lassen.
»Ich weiß nicht, warum sich unsere Wege
bisher nicht gekreuzt haben, aber es ist mir eine
Freude, Sie kennenzulernen. Zu wem möchten
Sie?«, fragte sie immer noch lächelnd, den Kopf
196/346

leicht zur Seite gedreht wie ein schüchternes
Schulmädchen.
»Eine Freundin von mir arbeitet hier«, ant-
wortete Michael.
»Oh, wirklich? Wer ist Ihre Freundin, wenn ich
fragen darf?«
»Ich bin wegen Jane hier.«
Das Lächeln verschwand. »Ich verstehe«,
sagte sie.
Als hätte Jane den Zeitpunkt für den besten
dramatischen Auftritt abgepasst, betrat sie den
Empfangsbereich.
Sie erstarrte nur einen kurzen Moment, über-
rascht, Michael im Büro zu sehen, bevor sie ihr
Gesicht zu einem entzückten Lächeln verzog.
Sie ging direkt auf ihn zu und zupfte das Toiletten-
papier von seinem Kinn, als wäre dies die
natürlichste Sache der Welt.
»Er hat Schmerzen«, war alles, was sie sagte.
»Das hat er. Und er blutet.«
»Ich habe gerade deinen Freund kennengelernt,
Jane-Herzchen«, sagte Vivienne.
»Gut«, erwiderte Jane.
»Wie heißt er? Das wollte er mir nicht ver-
raten.«
»Michael«, antwortete Michael.
197/346

»Michael was?«, hakte Vivienne nach.
»Nur Michael«, antwortete Jane für ihn und
drückte den Knopf vom Fahrstuhl.
»Oh, wie Sting oder Madonna.«
»Genau«, bestätigte Jane heiter. Vivienne
brannte vor Neugier, doch Michael beschloss, ihr
nicht nachzugeben, solange Jane dies nicht tun
wollte.
Michael blickte zu Jane. »Fertig zum Mitta-
gessen?«
»Ich sterbe vor Hunger.«
»Jane, du bist erst ins Büro gekommen«,
beschwerte sich Vivienne. »Wir haben Be-
sprechungen und Telefonate zu erledigen – und
diese Sache mit Hugh ist nicht beigelegt.«
»Okay, tschüss dann«, verabschiedete sich
Jane, als hätte sie Vivienne nicht gehört.
Die Fahrstuhltüren glitten zischend zur Seite.
»Wir hätten es beinahe nicht lebendig hier raus-
geschafft, Bonnie«, sagte Michael, als sie sich
hinter Michael und Jane wieder schlossen.
»Fast, Clyde. Aber wir haben es geschafft. Schau
nicht zurück, sonst wird sie uns zu Gesicht-
spudersäulen erstarren lassen.«
»Ich werde mich bemühen«, sagte Michael.
198/346

DREIUNDVIERZIG
Könnte ich einen Moment aus meinem Leben an-
halten, um ihn unvergänglich zu machen,
würde ich den wählen, in dem Michael am Em-
pfang zum Büro meiner Mutter gewartet hat.
Nicht den, als ich ihn im St. Regis zum ersten Mal
wiedergesehen habe.
Nicht den, als ich mit ihm die Fifth Avenue
entlanggegangen bin.
Nein. Es wäre der Moment im Büro. Weil er
bedeutete, dass Michael echt war. Und er machte
alles andere zu einem echten Erlebnis: Den Tag im
St. Regis; unsere Exkursion ins Museum; die
Gardenie, die er mir gegeben hatte. Es war alles
wirklich passiert. Was möglicherweise hieß, es
gab auch einen Weihnachtsmann, einen Osterhasen
und einen George Clooney.
»Lass uns abhauen, ganz weit weg«, bat ich
Michael.
»Gut, und wohin soll’s gehen?«
»Paris. Allerdings müsste ich zur Zwei-Uhr-
Besprechung wieder zurück sein.«
»Dann fällt Paris wohl eher flach. Nehmen wir
ein Taxi und schauen, wohin es uns bringt.«

Michael schnippte mit den Fingern … und ein
Taxi hielt vor uns an. Interessant.
»Was war das?«, fragte ich mit großen
Augen.
»Ehrlich, Jane, ich weiß es nicht. Das konnte
ich schon immer.«
Zehn Minuten später spazierten wir durch West
Village. Zuerst machten wir bei einem unserer
Lieblingsläden aus alten Zeiten halt, das Li-Lac
Chocolates an der Eighth Avenue. Ich war so
glücklich, dass der Laden noch existierte. Wir
nahmen Schokotrüffel. Michael sagte, es sei
für »nach dem Mittagessen«. Ich erwiderte, er
könne mir nicht mehr sagen, was ich zu tun habe,
und schob mir – ebenso wie er sich – rasch ein
Stück in den Mund, noch bevor wir den Laden
wieder verlassen hatten.
»Musst du mir alles nachmachen?«, fragte ich.
»Das ist die ehrlichste Form des Sch-
meichelns.«
Wir gingen über die Hudson Street und be-
traten einen Laden, in dem es nur wunderbare, alte,
schmiedeeiserne Spardosen zu kaufen gab. Wie die,
bei der man einem Hund eine Münze in den
Mund legt und einen Knopf drückt, woraufhin
200/346

der Hund die Münze mit der Zunge einem
Jongleur in die Hand schnippt.
»Diese Spardose kostet neunhundertfünfund-
neunzig Dollar«, rief Michael.
»Geld spielt keine Rolle«, erwiderte ich
großspurig. »Hättest du sie gerne?«
»Gib nicht so an, reiches Mädchen«, sagte er,
aber mit liebevollem Blick. Plötzlich zog er mich
mitten im Laden in seine Arme und hielt mich fest,
ohne ein Wort zu sagen. In diesem Moment wusste
ich genau, was ich in meinem Leben wollte: dieses
Gefühl, dieses Glück, diese Umarmung.
Wir aßen in einem entzückenden französis-
chen Restaurant zu Mittag, das sich schlicht
»French Restaurant« nannte. Bei Hühnchen
mit Pommes frites und Wein unterhielten wir uns
so locker, als wäre dies die natürlichste Sache
der Welt. Wir. Zusammen zu sein als Mann und
Frau. Oder als Frau und das, was Michael war. Ein
Engel?
Wir hatten ein ganzes Leben aufzuholen. Ich
erzählte Michael von meinen vier Jahren in Dart-
mouth, wo ich der einzige Mensch gewesen war, der
sich geweigert hatte, Ski zu fahren. Er lachte, als ich
gestand, dass ich in der Prüfungswoche einer
201/346

religiösen Sekte beigetreten war – den Weight
Watchers.
»Du brauchst die Weight Watchers nicht«,
sagte Michael. »Du siehst toll aus. Das hast du
schon immer getan. Weißt du das nicht?«
»Ehrlich gesagt, nein. Das war mir nie klar.«
Alles erzählte ich Michael nun doch nicht. Ich
erzählte ihm zwar die besten Geschichten
darüber, wie es war, für Vivienne zu arbeiten,
erwähnte aber nicht den Erfolg des Bühnen-
stücks Dem Himmel sei Dank über ein kleines
Mädchen und ihren imaginären Freund, das
zufällig auf der Geschichte von Michael und mir
basierte. Oder dass wir einen Film darüber dre-
hen wollten.
Als ich Michael endlich dazu brachte, sich zu
öffnen und über sich zu reden, war er nicht nur
auf charmante Weise bescheiden, sondern auch
diskret. Er erzählte mir ein bisschen von seinen
Lieblingsaufträgen der vergangenen Jahre. Zwill-
ingsjungs in Nord-Carolina, die Tochter einer Sen-
atorin
in
Oregon,
ein
paar
fürchterliche
Geschichten über einen frühreifen Jungen, der
bereits als Schauspieler arbeitete und von dem ich
sogar gehört hatte.
202/346

»Ich habe eine Menge Fragen über diese
Sache mit dem ›Freund‹«, sagte ich.
»Leider habe ich nicht viele Antworten darauf.
Du ahnst nicht, wie gerne ich welche hätte.«
Die Antwort war nicht befriedigend, doch wahr-
scheinlich die einzige, die ich bekommen würde.
Schließlich fragte ich Michael etwas Persön-
liches, das ich unbedingt wissen wollte. »Hattest
du jemals was mit einer Frau? Beziehungs-
mäßig?«
Er rutschte auf seinem Stuhl hin und her und
zuckte
mit
den
Schultern.
»Ich
treffe
Menschen«, antwortete er, ohne genau auf meine
Frage einzugehen. »Ich mag Menschen, Jane. Alle
Arten von Menschen.«
»Und ich wette, sie mögen dich.«
Michael schien sich nicht unwohl zu fühlen. Er
kam mir nur, hm, reserviert vor. Und natürlich
geheimnisvoll.
Michael ergriff meine Hand. »Unternehmen wir
was. Egal, was.« Und er schnippte mit den
Fingern, um ein Taxi anzuhalten.
203/346

VIERUNDVIERZIG
Es war gleichgültig, was wir an diesem Tag unter-
nahmen. Wir hätten Gräben ziehen können
und wären begeistert gewesen.
Doch wir taten etwas viel Besseres: Wir fuhren
auf Rollschuhen durch den nördlichen Central
Park, wo die Wege glatt und nur wenige Leute un-
terwegs waren. Wir flogen wie Engel über den
Beton, kurvten knapp um Jogger, Radfahrer und
Spaziergänger mit ihren bellenden Hunden her-
um. Und die ganze Zeit über war ich selig in Mi-
chaels Gesellschaft und fragte mich: Was ist hier ei-
gentlich los? Mit Sicherheit etwas, das vorher noch
keinem Menschen passiert war. Es musste eine lo-
gische Erklärung geben. Vielleicht musste ich aber
auch akzeptieren, dass es keine gab.
Seit meinem zehnten Lebensjahr war ich nicht
mehr Rollschuh gelaufen. Ich erinnerte mich, dass
meine Mutter mich »Klotz« genannt hatte, einen
Menschen, der keine natürliche Anmut besitzt. In
dieser Hinsicht schien ich mich nicht großartig
verändert zu haben. An der 96th Street versuchte
ich, den steilsten Hügel im Park zu erklimmen.
Meine Waden und Schenkel taten weh. Und

plötzlich waren wir oben und rasten unkontrolliert
wieder hinunter. »Michael!«, schrie ich.
Er packte meine Hand. »Vertrau mir!«, rief er
zurück.
Also vertraute ich ihm. Und auf wundersame
Weise bauten wir keinen Unfall. Michael sorgte
wieder für mich, wie er es immer getan hatte.
Wohlbehalten erreichten wir den Fuß des
Hügels und ließen uns keuchend neben einer
alten Frau im Rollstuhl ins dichte Gras fallen. Sie
war in Begleitung einer Krankenschwester in
gestärkter, weißer Uniform.
Michael blickte auf seine Uhr. »Ich dachte, du
hättest um zwei Uhr eine Besprechung«, erin-
nerte er mich.
»Oh, habe ich versäumt.« Was mich über-
haupt nicht kümmerte. Interessant.
Die alte Frau beobachtete uns lächelnd. Ihre
Begleiterin legte ein Tuch um ihre Schultern und
schob sie weiter.
Doch die Frau drehte sich noch einmal um.
»Viel Glück Ihnen beiden«, rief sie. »Sie
geben ein wunderbares Paar ab.«
Dem konnte ich nur zustimmen. Ich blickte zu
Michael, dessen Gesicht nichts verriet. »Sind wir
ein Paar?«, fragte ich ihn und hielt den Atem an.
205/346

»Ein durchgeknalltes Paar vielleicht«, antwor-
tete er mit einem leichten Lachen.
Nicht genau das, was ich hören wollte, aber nun
ja.
Zum
Abendessen
wählten
wir
scharfe,
würzige und in Senf getauchte Hotdogs im Park.
Wir marschierten und redeten und standen
schließlich wieder vor meinem Haus.
»Nun, da sind wir«, stellte ich geistreich fest.
Martin, der Portier, entfernte sich taktvoll. Ja, jet-
zt würde ich Michael bitten, mit mir nach oben zu
kommen. Natürlich würde ich das. Und Martin
wäre damit einverstanden.
Doch gerade als die schicksalsschweren Worte
aus meinem Mund purzeln wollten, beugte sich Mi-
chael zu mir vor. Ja, dachte ich. O ja, bitte. Sein
Gesicht war einen Fingerbreit von meinem entfernt.
Mir stockte der Atem. Aus dieser Nähe hatte ich
ihn, seine weiche Haut, seine grünen Augen nie
gesehen.
Plötzlich wich er wieder zurück, fast so, als
hätte er Angst.
»Gute Nacht, Jane«, sagte er. »Es war ein
toller Tag, aber ich denke, ich sollte lieber gehen.«
Er drehte sich um und ging rasch davon – dies-
mal ohne sich umzudrehen.
206/346

»Ich vermisse dich schon jetzt«, flüsterte
ich.
Ins Leere.
207/346

FÃœNFUNDVIERZIG
Gute Nacht, Jane? Ich denke, ich sollte lieber ge-
hen? Wie hatte er das nur tun können? Die schla-
flose Nacht nach einem Tag, an dem ich mich in Mi-
chaels Augen verloren hatte, war vorprogrammiert.
Ich wollte eindeutig nicht allein in meiner Wohnung
sein, aber ich war es.
Mit ein paar Doppelkeksen ging ich ins Wohnzi-
mmer und blickte auf die Stadt. Ja, gut, vier Dop-
pelkekse. Ich wohnte so hoch, dass ich über die
Nachbargebäude hinwegblicken konnte, und ich
hatte eine herrliche Aussicht über den Central
Park. New York war immer die richtige Stadt für
mich gewesen, und an diesem Abend galt das noch
viel mehr. Vielleicht, weil Michael irgendwo da
draußen war. Was war er? Ein »imaginärer
Freund«? Ein Engel? Eine Halluzination? Nichts
von alldem ergab für mich einen Sinn. Doch eine
andere Antwort hatte ich nicht.
In dem Moment klingelte das Telefon. Auf keinen
Fall wollte ich mit meiner Mutter oder mit Hugh re-
den und wütend werden. Sollte der AB die Sache
übernehmen.

Zuerst meldete sich meine Stimme, die dem An-
rufer sagte, er solle eine Nachricht hinterlassen.
Dann hörte ich die Stimme meiner Freundin
Colleen, diejenige, die heiraten wollte. Damals war-
en wir gemeinsam in einem Buchclub, einem
Filmclub, einem Rockkonzertclub und einem Club
für Haustiere auf Reisen gewesen. Heute verband
uns vielleicht nicht mehr so viel miteinander.
»O Jane, hier ist Colleen. Schade, dass du nicht
zu Hause bist. Wir haben noch nicht miteinander
geredet, seit ich dir von Ben erzählt habe.«
Ich rannte zum Telefon und hob ab. »Colleen!
Ich bin da. Ich bin gerade zur Tür reingekom-
men. Wie geht’s dir? Ich hatte dir eine Na-
chricht hinterlassen. Ich habe ja gesagt, dass ich da-
rauf brenne, deinen Anwalt aus Chicago kennen-
zulernen.«
»Ich weiß, aber ich wollte deine Stimme
hören«, erwiderte Colleen. »In echt. Ich wollte
die echte Jane hören.«
»Hier ist sie.«
Also unterhielten wir uns. Als Colleen etwa eine
Stunde später fertig war, hätte ich in der Chica-
go Tribune, in der New York Times und im Boston
Globe die Hochzeitsberichte über die beiden
schreiben können. Ben, der Sohn von Dr. Steven
209/346

Collins und Gemahlin, hatte den ersten Abschluss
in Wirtschaftswissenschaften gemacht, war dann
auf die Michigan Law School gewechselt, um einen
weiteren Abschluss zu machen. Und er hatte zwei
Jahre bei der Staatsanwaltschaft von Chicago
gearbeitet. Colleen hatte er bei einer Party auf
Martha’s Vineyard kennengelernt, zu der ihn
seine Schwägerin mitgenommen hatte. Von seiner
Wohnung, in die Colleen gemeinsam mit ihrer
Katze Sparkle derzeit einzog, hatte man einen Blick
auf den Lake Michigan. Als sie begann, mir von der
Füllung für ihre Hochzeitstorte zu erzählen,
zog ich die Notbremse.
»Wow, das hört sich an, als hättest du schon
alles
geplant«,
versuchte
ich
Begeisterung
vorzutäuschen. Ich mochte Colleen, doch falls sie
mir noch erzählen wollte, sie würde zwei kleine,
als Brautpaar verkleidete Marzipanmäuse auf ihre
Torte stellen lassen, bestand die Gefahr, dass ich
das Telefon aus dem Fenster werfen würde.
»O Jane. Ich habe ja nur von mir erzählt. Du
bist so eine großartige Zuhörerin.«
»Kein Problem – dafür bin ich ja da. Es
freut mich, wenn du glücklich bist.« Und sollte
ich ein bisschen eifersüchtig sein, wäre das
mein Problem.
210/346

»Das nächste Mal rufst du mich an, dann
darfst du mich genauso volltexten. Was gibt’s
denn im Moment bei dir Neues?«
»Nicht sehr viel«, antwortete ich. »Du
weißt ja – Arbeit und der ständige Kampf, um
meine Mutter gefügig zu machen.«
Colleen kicherte. »Wie immer.«
Ach, fast hätte ich es vergessen – ich bin
gerade dabei, mich in den perfektesten Mann zu
verlieben, den es gibt – lieb, lustig und unglaub-
lich gut aussehend. Aber er ist nur ein Produkt
meiner Einbildung. Ansonsten ist alles noch beim
Alten.
211/346

SECHSUNDVIERZIG
Am nächsten Morgen war Michael da.
Wie früher wartete er geduldig vor dem Haus.
Heute allerdings in Fleisch und Blut, sozusagen.
Keine Halluzination. Zumindest ging ich davon aus.
In seiner Hand hielt er eine wunderschöne
weiße Gardenie.
»Hallo, Jane«, grüßte er. Er sah leicht
verknittert, aber bewundernswert gut aus. »Gut
geschlafen?«
»O ja, als hätte man bei mir einen Schalter
umgelegt«, log ich. »Und du?«
Wir gingen in perfekter Harmonie nebeneinander
her genau wie damals auf dem Weg zur Schule. Tja,
passte er wieder auf mich auf? Beschützte er
mich wieder? Warum? Ob ihm das überhaupt
klar war? Warum wusste er nicht auf alles eine Ant-
wort? Er hatte immer alles gewusst, als ich klein
gewesen war. Er war nie unsicher gewesen, hatte
nie gezögert. Dass er wegen dieser Sache genauso
verwirrt war wie ich, machte ihn aber auf eine Art
sehr viel menschlicher.
Das Wetter war kalt für einen späten Früh-
lingsmorgen, und es sah nach Regen aus, doch

nichts konnte mir an diesem Tag meine gute Laune
verderben. Ich war voller Hoffnung. Zum ersten
Mal nach so langer Zeit.
Wir unterhielten uns ununterbrochen über
alles und nichts, über die Vergangenheit und die
Gegenwart – aber nicht über die Zukunft. Viel-
leicht waren die Gespräche mit Michael das Beste
an dieser Sache, oder an jeder Freundschaft oder
Liebe. Trotzdem hätte ich ihn am liebsten gepackt,
ihn geküsst und, wenn ich ehrlich bin, noch viel
mehr mit ihm gemacht. Er war ein Kerl, wie ihn
eine Achtjährige nicht zu schätzen weiß.
»Jane! Willst du da reingehen? In Erinnerung
an alte Zeiten?«
Michael zeigte über die Madison Avenue hin-
weg auf einen kleinen, schrecklichen Laden, der
»The Muffin Man« hieß. Vor mehr als zwanzig
Jahren waren wir vormittags oft dorthin gegangen,
und ich hatte, wie ich gestehen muss, die Tradition
bewahrt.
»Einmal scharf auf Muffins, immer scharf auf
Muffins«, sagte ich. »Ich lasse dir den
Vortritt.«
»War nicht Apfel-Zimt-Walnuss das Muffin
deiner Wahl?«, fragte Michael, als wir in der Sch-
lange warteten.
213/346

»Ist immer noch so.« Unter anderem. Was
Muffins angeht, bin ich nicht so heikel.
Als wir unsere Muffins hatten, merkte ich, dass
ich gar nicht so einen großen Hunger hatte, was
seltsam, aber auch in Ordnung war. Michael hatte
einen Kaffee-Frappée, ich einen Koffeinfreien
genommen.
Was mir mit Michael plötzlich deutlich wurde,
war, wie wenig Hugh und ich – im Gegensatz
dazu – je miteinander geredet oder tatsächlich
gemeinsam hatten.
Sobald wir wieder draußen und noch etwa einen
Straßenblock
vom
Büro
entfernt
waren,
schüttete es wie aus Eimern.
»Wir können unter dieser Markise warten,
oder wir rennen einfach los«, bat Michael zur
Auswahl an.
»Rennen.« Danach stand mir der Sinn. Und
laut schreien.
Also rannten wir durch knöchelhohe Pfützen
und um Leute herum, die so schlau gewesen waren,
Regenschirme mitzunehmen. Das mit dem Schreien
ließ ich dann doch lieber sein.
Am Bürogebäude angekommen, fielen wir
beinahe durch die Eingangstür. Wir waren nass
bis auf die Knochen, lachten aber wie Kinder oder
214/346

zumindest wie ausgelassene Erwachsene. Uns doof
anlächelnd, kamen wir uns näher, immer näh-
er … o Gott, wie sehr ich mir wünschte, dass es
passierte.
Aber …
Michael wich zurück. »Wir sehen uns
später.« Sein Lächeln war verschwunden, und
er machte ein nachdenkliches Gesicht. »Ist das in
Ordnung? Bin ich dir … lästig?«
Ja, klar, du bist mir total lästig mit deiner
Zurückhaltung, dachte ich. Diesmal wollte ich ihn
mir nicht durch die Lappen gehen lassen.
Also packte ich seinen Arm, damit er nicht aus-
weichen konnte, und küsste ihn – auf die
Wange. Der Kuss war nass vom Regen, aber voller
Gefühl.
»Wir sehen uns später. Ich will dich immer
wiedersehen«, sagte ich und musste hinzufü-
gen: »Ich vermisse dich schon jetzt.«
Ja, so war ich – risikobereit, auf den Putz
hauen. Born to be wild …
Michael warf mir einen letzten, zärtlichen Blick
zu, bevor ich in den überfüllten Fahrstuhl stieg
und den Knopf für unser Büro drückte.
215/346

»Born to be wild«, sang ich laut. Ich hatte kein
Problem damit, zu zeigen, wie durchgedreht ich
war.
Gott, war ich glücklich.
216/346

SIEBENUNDVIERZIG
Michael war tatsächlich glücklich, was bei ihm
aber auch etwas Quälendes hatte.
Also traf er sich mit einigen seiner besten »Fre-
unde« und erzählte ihnen von Jane, von dem
Wiedersehen mit ihr und dass sie sich seltsamer-
weise an alles erinnerte. »An die Früchtebecher,
den Weg zur Schule, den furchtbaren Tag, an dem
ich sie verlassen habe – an alles!« Die Gruppe
hörte interessiert, aber auch erstaunt zu. Keiner
von ihnen hatte jemals zuvor so etwas erlebt.
»Sei vorsichtig, Michael«, riet Blythe, die ihm
vielleicht am nächsten stand. »Deinetwegen und
wegen Jane. Sie müssen uns vergessen. Nur so
funktioniert das. So war das schon immer. Hier ist
etwas Seltsames im Gange.«
»Hm, meinst du?«, fragte Michael.
Um Viertel vor sechs tauchte er wie versprochen
in Janes Büro auf und wünschte Elsie, seiner
neuen Freundin am Empfang, einen guten Abend.
»Ich glaube nicht, dass Jane mich erwartet«,
sagte er.
»Selbstverständlich erwartet Jane Sie. Schon
fast den ganzen Tag.«

Nachdem Elsie Jane informiert hatte, erschien
diese kurz darauf am Empfang. Sie sah frisch aus
mit ihren rosa Wangen. Oder errötete sie etwa?
»Ich habe dir doch angedroht, dich zu belästi-
gen«, grüßte Michael sie.
»Er ist wirklich lästig«, vertraute Jane der
Empfangsdame an.
»Bitte, mich dürfen Sie ruhig belästigen«,
bot Elsie an, die weit über sechzig war.
Es hatte wieder angefangen zu regnen, doch Mi-
chael hatte einen Regenschirm mitgebracht. Sie gin-
gen zu Fuß ins Primavera, ein Restaurant an der
Upper East Side, und unterhielten sich, als hätten
sie sich monatelang – und nicht nur ein paar
Stunden – nicht gesehen.
»Du schaust also Fernsehen?«, fragte Jane, die
näher an ihn herantrat, um einer Pfütze auszu-
weichen. »Was denn, zum Beispiel?«
»Meistens
Kabel«,
antwortete
Michael.
»Sachen wie Deadwood und Big Love.«
»Die gefallen mir auch!«, schwärmte Jane.
»Was machst du sonst noch? Für was in-
teressierst du dich?«
Michael dachte nach.
Normalerweise fragten ihn Menschen nicht aus.
Wie Claire De Lune gesagt hatte, war er ein
218/346

hervorragender Zuhörer. »Äh, ich liebe es, ins
Football-Stadion zu gehen. Ich liebe Corinne Bailey
Rae. Autorennen. Cézanne. The White Stripes.«
Jane lachte. »Also alles.«
»So ziemlich.« Er grinste.
»Was hast du heute gemacht?«, fragte sie
weiter und hakte sich bei ihm ein.
»Mich mit einigen Freunden getroffen«, gab er
zu. »Freunde, die … dieselbe Arbeit machen wie
ich. Und ich habe einen Dauerlauf gemacht. Und
ein Mittagsschläfchen.«
»Na, das ist aber ganz was Ausgefallenes«,
neckte ihn Jane.
»Hey, ich habe Urlaub!«, beschwerte er sich.
Sie hatten mittlerweile das Restaurant erreicht, als
es Michael plötzlich in den Sinn kam: War dies
hier ein Rendezvous? So fühlte es sich jedenfalls
an.
219/346

ACHTUNDVIERZIG
Und, wie war dein Tag?«, fragte Michael, sobald
wir uns gesetzt und den Kellner losgeschickt hatten,
damit er uns eine Flasche Frascati besorgte.
Ich verzog mein Gesicht. »Geht so, wenn man
außer Acht lässt, dass ich sechs Besprechungen
mit Vivienne hatte.«
»Das Alter hat sie eindeutig nicht langsamer
gemacht.«
»Nicht sehr. Vielleicht ein ganz kleines bis-
schen. Weißt du, ich produziere einen Film, einen
kleinen Kinofilm, nichts Großes. Klein und fein
wie ein Konfekt.«
»Wie Chocolat«, sagte Michael lächelnd.
»Der Film hat mir gefallen.«
Eine Pause entstand, in der ich überlegte, wie
ich weiterreden sollte, ohne allzu viel zu verraten.
»Rede weiter«, verlangte Michael. »Erzähl
mir von dem Film. Ich würde gerne mehr über
deine Arbeit erfahren.«
»Da bist du vielleicht der Einzige.« Ich ver-
suchte, nicht allzu verbittert zu klingen. »Also, wir
haben einen Ko-Investor namens Karl Friedkin. Als
wir heute Morgen total durchnässt an Viviennes

Büro vorbeigegangen sind, saß, ob du’s
glaubst oder nicht, Karl Friedkin bei ihr. Also habe
ich MaryLouise, meine Assistentin, gefragt. Weißt
du, was sie geantwortet hat?«
»Dass Vivienne auf der Jagd nach einem neuen
Ehemann ist. Ihrem vierten, stimmt’s?«
Ich ließ das Stück italienisches Brot fallen,
mit dem ich herumgestikuliert hatte, und blickte
Michael an. »Komisch. MaryLouise wusste es
auch. Ich bin die Einzige, die nichts mitbekommen
hat. Ich muss ziemlich begriffsstutzig sein.«
»Nein. Du bist nur ein netter Mensch. Deswe-
gen muss man dich immer erst auf solche Dinge
aufmerksam machen.«
»Und bei dir braucht man das nicht?«, fragte
ich.
»Sagen wir, ich habe deine Mutter in Aktion
gesehen. Dir ist schon bewusst, dass sie dich
liebt?«
Ich runzelte die Stirn. »Wer würde das nicht?
Ich bin doch sooo nett.« Der Kellner kam, und
jeder bestellte für sich. Ich hatte keinen großen
Appetit, was auf angenehme Weise eigenartig war,
weil ich mich nicht krank fühlte.
Â
Nach zwei Espresso und zwei Sambuca schlender-
ten wir die Park Avenue nach Süden. Es hatte
221/346

aufgehört zu regnen, Michaels Regenschirm ben-
utzte ich als Spazierstock. Ich tippte rhythmisch auf
den Boden, bis ich eine jämmerliche Version von
»Singin’ in the Rain« schmetterte. Es war,
als beobachtete ich mich selbst, wie ich von einer
Klippe sprang, ohne aufgehalten werden zu
können. »The sun’s in my heart, and
I’m ready for love …«
»Tut mir leid. Ich weiß nicht, was über mich
gekommen
ist.
Die
verrückte
Jane«,
entschuldigte ich mich, als ich mich wieder in den
Griff bekam. Ich merkte, dass meine Wangen
erröteten.
»Ich mag Verrückte«, beruhigte mich Mi-
chael. »Abgesehen davon war das niedlich, nicht
verrückt.«
Tja, genau diese Dinge intensivierten meine Liebe
für ihn. Als ich aufblickte, merkte ich, dass wir
nur wenige Straßenblocks von mir zu Hause ent-
fernt waren. Wir gingen weiter, zur Abwechslung
mal schweigend. Sollte ich ihn nach oben bitten?
Täte ich gerne. Sehr, sehr gerne.
Ich versuchte mich zusammenzureißen, als ich
Michael anblickte. Plötzlich blieben wir stehen,
und er nahm mich wieder in seine Arme.
222/346

Ich riss meine Augen auf, schloss sie aber flat-
ternd wieder, als sich Michael langsam zu mir
vorbeugte. Ich keuchte beinahe, als sich seine Lip-
pen auf meine drückten, und mein Herz machte
einen riesigen Satz, den er, wie ich mir sicher war,
gespürt haben musste. Jetzt war ich innerlich
nicht nur angeschlagen, sondern ruiniert.
In meinem ganzen Leben hatte ich so etwas noch
nicht gefühlt, auch nicht annähernd. Schließ-
lich ließen wir wieder voneinander ab. Ich blickte
zu ihm auf, schnappte nach Luft und wollte sagen
…
Doch wir küssten uns wieder. Ich war mir nicht
sicher, wer damit angefangen hatte, sondern wusste
nur, dass Michael mein Gesicht in seinen Händen
hielt. Dann hielt er mich ganz, ganz fest, so wie ich
es liebte. Wir rückten ein Stück voneinander
ab, aber nur, um uns gleich wieder zu küssen.
Wie gerne wäre ich noch länger so verharrt,
sagen wir, vielleicht für den Rest meines Lebens.
Auch mein Schwindelgefühl sollte nicht auf-
hören. Nie.
223/346

NEUNUNDVIERZIG
Als ich von meinem »Rendezvous« mit Michael
– für mich war es eindeutig ein Rendezvous
– nach Hause kam, hatte ich keine Gelegenheit,
das Geschehene zu verarbeiten, weil jemand in
meiner Wohnung war.
Das Licht im Flur, das Deckenlicht in der
Küche und mindestens eine Lampe im Wohnzim-
mer brannten.
Mir kam ein wahnsinniger Gedanke: War es Mi-
chael? Wer weiß, vielleicht konnte er einfach ir-
gendwo erscheinen.
Oder war es Hugh, weil er noch den Schlüssel
hatte?
Aber wenn es Michael war, wollte ich nicht
»Hugh« rufen und umgekehrt. Welch ironisches
Dilemma für eine Frau, die, was Beziehungen
anging, eine Niete war.
Also holte ich tief Luft und rief: »Hallo?«
»Jane-Herzchen«, tönte es aus dem Wohnzi-
mmer. Als ich um die Ecke bog, saß meine Mutter
im Lehnstuhl.
»Ich dachte, ich komme mal vorbei, um ein bis-
schen zu reden«, sagte sie.

»Oh«, meinte ich und dachte, ich würde
mich lieber mit Honig beschmieren und auf einen
Ameisenhaufen binden lassen. »Wie bist du
reingekommen?«
»Ich habe noch einen Schlüssel vom Renov-
ieren.«
Ach, und warum überrascht mich das nicht?
Plötzlich hatte ich Lust auf einen kleinen Après-
Rendezvous-Cocktail – doch, doch, es war
eindeutig ein Rendezvous. Ich ging zum Schrank,
wo ich meinen jämmerlichen Schnapsvorrat
aufbewahrte.
»Möchtest du auch etwas, Mama?«
Vivienne zuckte zusammen, doch ich liebte es, sie
so zu nennen, liebte den Gedanken, dass meine
Mutter tatsächlich ein Mamatyp war. Außerdem
war sie gerade in meine Wohnung eingebrochen,
also war »Mama« angesagt.
»Sherry«, antwortete sie. »Du weißt doch,
was ich mag, Jane-Herzchen.«
Ich schenkte ihr einen Sherry ein – und ihrer
sich ausgenutzt fühlenden Tochter einen ordent-
lichen Schluck Whiskey.
Schließlich nahm ich ihr gegenüber im ander-
en Sessel Platz. »Prost.«
225/346

»Jane-Herzchen«, begann sie schließlich,
»ich weiß nicht, was mit Hugh oder diesem an-
deren Typen oder sonst jemandem los ist, den es in
deinem arbeitsreichen Leben gibt.« Ihr Ton ließ
vermuten,
dass
das
Gericht
noch
immer
herauszufinden versuchte, ob ich ein arbeitsreiches
Leben oder überhaupt ein Leben führte.
Ich musste sie einfach unterbrechen. »Wow, ich
bin beeindruckt. Mein arbeitsreiches Leben!«
»Bitte.« Vivienne hielt eine Hand hoch.
»Lass mich reden.«
Ich nickte und nahm einen Schluck aus meinem
Glas, verzog aber das Gesicht, als der flüssige
Brennstoff meine Kehle hinablief. Ich vermisste Mi-
chael sehr. Jetzt schon.
»Jane-Herzchen, ich kam her, um dir zu sagen
…« Meine Mutter schien ausnahmsweise nach
Worten zu suchen. Ich runzelte die Stirn und
richtete mich auf dem Sessel auf. War sie mit Karl
Friedkin bereits verlobt?
»Ja?«, ermunterte ich sie entgegen meiner
sonstigen Art.
»Nun, ich werde nicht immer hier sein, und
wenn ich weg bin, wird die Firma dir gehören.
Dann kannst du die Entscheidungen treffen, die du
226/346

für richtig hältst.« Sie nahm einen raschen
Schluck von ihrem Sherry.
Gut, damit schlug sie einen völlig neuen Kurs
ein. Ich machte mir Sorgen. »Was willst du damit
sagen, Mutter?«, fragte ich.
»Unterbrich mich nicht. Es gibt noch eine
Sache. Ich habe dir das nie erzählt, aber meine
Mutter starb an Herzversagen, als sie siebenund-
dreißig Jahre alt war. Du bist zweiunddreißig.
Denk darüber nach.«
Mit diesen Worten erhob sich meine Mutter, kam
auf mich zu und gab mir einen Kuss auf die Wange.
Dann verließ sie die Wohnung auf dem Weg, den
sie gekommen war.
Was, zum Teufel, sollte das denn? Fürchtete
sie, ich könnte an Herzversagen sterben? Ihr Ver-
halten war eigenartig und passte nicht zu ihr. Wollte
sie mir sagen, dass sie ein Herzproblem hatte? Nein,
dann wäre sie weitaus dramatischer gewesen, mit
ausladenden
Gesten
und
Bette-Davis-
Ohnmachtsanfällen.
Aber wie immer hatte Vivienne das letzte Wort
gehabt.
227/346

FÃœNFZIG
Ja, ja, schon gut. Ich weiß, dass der Fahrstuhl
nicht schneller kommt, wenn man immer wieder die
Taste drückt. Aber ich konnte nicht anders.
Nach meinem Herzklopf-Rendezvous mit Michael
– ach, und was für ein Rendezvous das war –
und dem eigenartigen Gespräch mit der geheim-
nisvollen Vivienne hatte ich etwa zwanzig Minuten
geschlafen. Jetzt, am nächsten Morgen, hoffte ich,
dass Michael in der Eingangshalle wartete, um mich
zur Arbeit zu begleiten. Ich wollte ihn unbedingt
wiedersehen, wenigstens noch ein Mal. Bitte, bitte,
bitte, lieber Gott, lass ihn da unten auf mich warten.
Mach, dass er nicht wieder aus meinem Leben
verschwindet.
Ich
überlegte,
die
zehn
Stockwerke
hinunterzurennen.
Zum Geburtstag hatte mir Vivienne einen
Einkäufer vom Saks Fifth Avenue geschenkt –
und mit welchem Geschenk kann man am besten
»du siehst peinlich aus« ausdrücken als mit
einem persönlichen Einkäufer? Meiner hatte mir
einen schicken Lagerfeld-Anzug geschickt. Hose
und Jacke aus heller, bläulich grüner Seide. Ich

dachte, ich sehe ganz gut darin aus. Hm, vielleicht
besser als ganz gut.
Verdammt, ich sah toll aus! Ich hatte sogar drei
Pfund abgenommen!
Drei ganze Pfund – das war mir noch nie
passiert.
Als ich endlich in den Fahrstuhl stieg, hatte ich
das Bedürfnis, auf und ab zu springen, um ihn zu
beschleunigen. Jane, bitte, entspann dich, ermahnte
ich mich und versuchte sogar, auf meine eigenen
Worte zu hören.
Als der Fahrstuhl das Erdgeschoss erreichte, set-
zte ich ein Lächeln auf, doch mein Herzrasen
übertraf alle Rekorde.
Nur der Vormittagsportier, Hector, stand dort.
»Guten Morgen, Miss Jane«, grüßte er.
»Guten Morgen, Hector, wie geht’s?« Ich
selbst war am Boden zerstört.
Kein Michael in der Eingangshalle!
Kein Michael, der vor der Tür herumlungerte.
Kein Michael, nirgendwo.
»Darf ich Ihnen ein Taxi rufen?«, fragte
Hector.
Ich musste Zeit schinden.
»Ich weiß nicht. Vielleicht gehe ich zu
Fuß.«
229/346

»Ja, natürlich. Ein herrlicher Tag dafür.«
»Ja, es ist wunderschön draußen.«
Vielleicht kam Michael zu spät. Hm, eher un-
wahrscheinlich. Michael kam nie zu spät.
Während meiner Kindheit war das kein einziges
Mal passiert.
»Ich brauche wohl doch ein Taxi«, entschied
ich mich. Während ich unter der Markise wartete,
blickte ich die Straße auf und ab in der Hoffnung,
dass auf der Park Avenue plötzlich Michaels
Gesicht aus dem Meer der Geschäftsleute, Tour-
isten und Schüler auftauchte.
Doch Michael war nirgends zu sehen.
War er wieder aus meinem Leben verschwunden?
Wenn ja, würde ich ihn umbringen, auch wenn
ich ihn bis zum Ende meiner Tage suchen
müsste. Oder ich würde ihm wenigstens ein
Halsband umbinden, mit einem Glöckchen dran.
Ich meine, warum hatte er sich überhaupt die
Mühe gemacht, noch einmal in mein Leben zu
treten?
230/346

EINUNDFÃœNFZIG
Als ich den Empfangsbereich von ViMar Produc-
tions betrat, war ich zwar etwas angeschlagen, aber
was meine Person betraf – wer ich war und
welche Richtung mein Leben nehmen müsste -,
seltsam ausgeglichen. War dies der Grund, warum
Michael zurückgekommen war? Weil mein Selb-
stvertrauen einen kleinen Schub oder vielmehr eine
Generalüberholung brauchte? War es das, was
Vivienne am Abend zuvor hatte sagen wollen?
Elsie winkte mir vom Empfang aus zu.
»In deinem Büro«, sagte sie. »Eine Ü-
berraschung.«
O ja, ich war in der Stimmung für Unerwar-
tetes. Selbst an guten Tagen mochte ich keine Ü-
berraschungen, und an diesem Tag hatte ich Lust,
laut aufzuschreien. Als ich die Tür öffnete, war
ich tatsächlich überrascht, aber nicht auf an-
genehme Weise. Es war Hugh. Er saß an meinem
Schreibtisch und sah meine Post durch.
»Wenn du meine Schneckenpost durch hast,
kannst du dir ja noch meinen Blackberry
vornehmen«, schlug ich vor und stellte ihn auf den
Schreibtisch.

Hugh sprang auf. »Jane«, sagte er und kam
mit ausgebreiteten Armen um den Schreibtisch auf
mich zu. Er trug ausgebleichte Jeans, schwarze
Prada-Stiefel, die Uhr, die er von mir zu Weihnacht-
en bekommen hatte, und ein teures Jeanshemd, das
aussah, als hätte es höchstens zehn und nicht ein
paar hundert Dollar gekostet.
Statt meinen entsetzten Blick und meine abweis-
ende Haltung zu ignorieren, umarmte er mich und
machte Anstalten, mir einen Kuss zu geben. Ich dre-
hte den Kopf angewidert weg, sodass seine Lippen
nur meine Wange streiften.
»Ich bin nicht mehr sauer auf dich«,
verkündete er.
»Toll. Ich wünschte, ich könnte dasselbe
sagen. Geh jetzt bitte.«
»Ich sehe, du hast es sicher von Brooklyn nach
Hause geschafft.« Er wartete auf eine Reaktion auf
seinen kleinen Witz, die darin bestand, dass ich
meine Augen ein wenig zusammenkniff. Ich zog
seine Hand von meinem Rücken und setzte mich
hinter meinen Schreibtisch. »Hugh, warum bist
du hier?«
»Weil du mein bestes Mädchen bist. Komm
schon, Jane, gib mir noch eine Chance.«
232/346

Nichts da! Ich war nicht unbedingt gefühlskalt,
aber ich empfand nichts mehr für Hugh.
»Hugh, ich habe einen Berg an Arbeit zu erledi-
gen.«
Plötzlich legte er den »Ich bin ein kleiner
Junge, hab Mitleid mit mir«-Blick auf. »Jane, ich
brauche deine Hilfe. Es ist nichts Großes.«
Meine Augenbrauen zuckten nach oben, doch er
fuhr trotzdem fort.
»Schau, seien wir ehrlich zueinander. Ich
brauche diese Rolle in dem Film. Ich brauche Dem
Himmel sei Dank. Okay, bist du jetzt glücklich?
Ich bin gedemütigt und erniedrigt.«
Ich sagte immer noch nichts, auch wenn ich ver-
stand, was er meinte. Und ich empfand sogar ein
ganz kleines bisschen Mitleid. Doch er war noch
derselbe Hugh, der mir einen Verlobungsring im
Tausch für eine Filmrolle angeboten und mich
mutterseelenallein in Brooklyn zurückgelassen
hatte.
»Es tut mir ehrlich leid, Hugh. Du wirst die
Rolle nicht bekommen. Du bist nicht Michael.«
»Das bin ich! Jane, ich habe diese Figur
geschaffen.«
233/346

»Nein, das hast du nicht. Mit Michaels Erschaf-
fung hattest du nichts zu tun. Das kannst du mir
glauben.«
Er riss die Augen weit auf und setzte sein höh-
nisches Grinsen auf, wie man es von ihm kannte.
»Du widerliches, kleines Stück Scheiße!«,
blaffte er. »Mamas kleines Mädchen tut so, als
wäre sie selbst die Mama. Du lebst wohl immer
noch in der Märchenwelt, in der du als
Achtjährige gelebt hast.«
Als ich mich hinter meinem Schreibtisch erhob,
erwartete ich, dass meine Hände zitterten. Taten
sie aber nicht. »Das war widerlich, Hugh. Selbst
für deine Verhältnisse.«
»Weißt du, wohin du dir diesen mickrigen
Film schieben kannst? Ich habe dir mit dem Ange-
bot, die Rolle in diesem bescheuerten, senti-
mentalen Stück zu übernehmen, einen Ge-
fallen getan! Dieses Stück wäre gar nicht zus-
tande gekommen, wenn du nicht Vivienne Mar-
gaux’ sehr bedürftige Tochter wärst.«
Tränen traten mir in die Augen, was Hugh aber
nicht wahrzunehmen schien. Das war das einzig
Gute an der ganzen Sache. Er trat näher an den
Schreibtisch und stieß, während er weiterredete,
mit dem Finger in meine Richtung. »Du brauchst
234/346

mich, Jane. Ich brauche dich nicht. Du brauchst
mein Talent, deines brauche ich nicht. Was gut so
ist. Weil du kein Talent hast.«
Alles wurde rot um mich, genau wie es in
Büchern beschrieben wird, und ich wurde von
einer enormen Wut gepackt. »Da wäre ich nicht
so sicher«, widersprach ich. »Schau dir das mal
an, Hugh.«
Ich holte aus und boxte Hugh, so fest ich konnte,
ins Gesicht.
Stille.
Wir waren beide verblüfft. Hugh presste beide
Hände auf sein linkes Auge, das rechte hatte er
weit aufgerissen. Eine Sekunde später spürte
ich einen unerträglichen Schmerz in meiner Hand.
Ich überprüfte, ob ich mir die Knöchel
gebrochen hatte.
»Mein Gott, Jane, hat du den Verstand ver-
loren?«
Mit dem für mich typischen Glück war
meine Mutter in dem Moment eingetreten, als ich
Hugh den Schlag verpasst hatte. Ich war sicher, sie
würde mir dies verzeihen. Eines Tages. Dann,
wenn sie sich auch von meiner Entscheidung wegen
des Kleides erholt haben würde, das ich bei der
Abschlussfeier nach der sechsten Klasse angezogen
235/346

hatte, was sie mir immer noch ab und zu unter die
Nase rieb.
»Die, die …«, stammelte Hugh, »die ist
total übergeschnappt!«
Dagegen hatte ich eigentlich nichts einzuwenden.
Ich meine, was hätte ich sagen sollen? Etwa, dass
ich ihn nicht geschlagen hätte, wenn mein ima-
ginärer Freund und möglicher Liebhaber hier
gewesen wäre?
Ich glaube nicht.
236/346

ZW EIUNDFÃœNFZIG
Meine Mutter war auf ihren verdammten Stilettos
in mein Büro geklackert, allerdings nicht, um
mich zu besuchen, sondern um sicherzugehen, dass
ich Hughs lausige Entschuldigung angenommen
hatte.
»Jane, was ist hier los?«, fragte sie.
»Sie
ist
wahnsinnig
geworden,
das
ist
passiert!«, schrie Hugh.
»Nichts von Belang, Mutter«, antwortete ich
gelassen. »Hugh und ich haben uns nur formal
getrennt.«
»Getrennt?«, fragte sie. »Wie? Warum? Was
habe ich verpasst? Ich weiß doch sonst immer, um
was es geht.«
»Ich verstehe, dass du etwas verwirrt bist«,
erklärte ich. »Aber schließlich waren Hugh und
ich von Anfang an kein richtiges Paar. Eher wie ein
Solostück, in dem ich nur als Statistin aufgetre-
ten bin.«
Meine Mutter starrte mich mit großen Augen
an, bevor sie sich zur Tür hinausbeugte.
»MaryLouise!«

MaryLouise muss vor der Tür herumgelungert
und dem Feuerwerk gelauscht haben, weil sie in
Rekordzeit in meinem Büro stand.
»Hol mir ein wenig in ein Leinentuch gewick-
eltes Eis«, trug Vivienne ihr auf.
Oh, ein Leinentuch. Wie aufmerksam!
Hugh dankte ihr für ihre Fürsorge, als sie
ihn zum Dreisitzersofa führte. »Es geht mir
gut«, beruhigte er sie. »Ich setze mich hier nur
kurz hin. Vivienne, ich weiß nicht, was ich falsch
gemacht habe.«
Wie gesagt, er ist Schauspieler.
Nun schenkte meine Mutter mir ihre Fürsorge.
»Siehst du das, Jane? Was ist nur in dich ge-
fahren? Du kannst doch Leuten wie Hugh nicht ein-
fach eine reinhauen. Du hättest ihn verletzen
können.«
»Sie hat mich verletzt«, beschwerte sich Hugh
mit gedämpfter Stimme.
»Nicht mehr, als er mich verletzt hat«, hielt
ich dagegen. »Ich vermute, du hast von dem Heir-
atsantragsdebakel noch nichts gehört.«
»Jane, werd nicht schnippisch. Ich meine es
ernst.«
»Ich auch. Oder zählen meine Gefühle
nichts, nur weil es meine sind?«
238/346

»Hör zu, Jane, das hier ist nicht deine Phant-
asiewelt, in der du alles tun kannst, wonach dir der
Sinn steht«, ermahnte mich Vivienne.
»Gut, dass du das geklärt hast«, erwiderte
ich diesmal tatsächlich schnippisch und vers-
chränkte die Arme.
»Ich kann mir nicht vorstellen, was Hugh getan
haben könnte, um dich zu körperlicher Gewalt zu
provozieren.«
»Tatsächlich? Lass mir ein paar Stunden Zeit,
dann erstelle ich dir eine Liste. Im Moment
möchte ich aber, dass ihr beide mein Büro ver-
lasst.«
Viviennes Wangen wurden rot, sie trat auf mich
zu und blieb knapp vor meinem Schreibtisch
stehen.
»Das ist nicht dein Büro. Das ist mein
Büro. Jeder Aschenbecher, jeder Schreibtisch,
jeder Rechner, jede Toilette, jedes Fitzelchen Papi-
er, jedes Kopiergerät …«
Mein Mund öffnete sich überrascht.
»Du würdest hier nicht arbeiten, wenn ich
nicht wäre. Du würdest hier nicht einmal
arbeiten, wenn ich gewusst hätte, dass du einen
talentierten Schauspieler wie Hugh McGrath
239/346

tätlich angreifst. Ein solches Verhalten brauche
ich nicht hinzunehmen.«
»Du hast recht, Mutter. Das brauchst du
nicht.«
Ich kochte vor Wut, als ich meine schwarze
Ledertasche schnappte und so viel hineinstopfte,
wie ich von den Sachen auf meinem Schreibtisch
hineinbekam – Papiere, Briefe, Stifte und Fotos,
aber natürlich auch meine Rollkartei.
»Sei nicht lächerlich, Jane.«
»Oh, das bin ich nicht, Mutter. Ich bin so klar
im Kopf wie schon seit Jahren nicht mehr.« Und
ich fügte hinzu, weil ich Jane bin: »Es tut mir
leid.«
Ich ging an ihr und Hugh vorbei. Und plötzlich
fiel mir etwas Verrücktes ein: Kein Kuss heute,
Mutter?
An der Tür stieß ich beinahe mit MaryLouise
zusammen.
»Es gibt kein Leinentuch, Ms. Margaux«, sagte
sie zu Vivienne, als ich zum Fahrstuhl ging. »Sie
müssen sich mit einem Baumwolltuch begnü-
gen.«
240/346

DREIUNDFÃœNFZIG
An diesem Morgen war Michael ins Olympia gegan-
gen, um nachzuschauen, ob mit Patty alles in Ord-
nung war, doch sie war nicht da. Also früh-
stückte er ausgiebig und versuchte, nicht
darüber nachzudenken, was derzeit so alles
passierte. Zum Beispiel, dass er das Gefühl hatte,
er würde sich in Jane Margaux verlieben.
Er zeigte alle klassischen Symptome: Herzklop-
fen,
verschwitzte
Hände,
verträumte
Aufmerksamkeitslücken, ein gewisses Maß an
Unreife, Glücksgefühle so ungefähr in allen
Körperteilen. Nach dem letzten Abend musste er
Jane wiedersehen. Heute. Schlimmer noch, er
musste sie wieder küssen. Er würde sie am
Abend vom Büro abholen. Er konnte sich nicht
zurückhalten, auch wenn dies für alle
Beteiligten das Klügste gewesen wäre.
Als er vom Frühstück nach Hause kam, ran-
nte er beinahe in Patty hinein, die gerade mit ihrer
Tochter das Haus verließ.
Uh, das hatte nichts Gutes zu bedeuten!
Patty weinte, und auch das kleine Mädchen
wirkte traurig und verstört. Michael hatte bei

Kindern diesen Blick schon oft genug gesehen, und
jedes Mal wieder brach er ihm das Herz.
»Hallo, Patty«, grüßte er sie und beugte
sich nach unten, um mit dem Mädchen zu reden.
»Hallo, Herzchen. Du heißt Holly, oder? Was ist
denn los?«
»Meine Mama ist traurig«, antwortete sie.
»Sie hat mit ihrem Freund Owen Schluss
gemacht.«
»Ja? Deine Mama ist aber sehr stark. Sie hat
starke Krallen. Und dir geht’s gut?«
»Ja. Ich habe mit meiner Freundin Martha
darüber geredet«, sagte sie und flüsterte:
»Sie ist unsichtbar, weißt du.«
»Na klar weiß ich das«, bestätigte er, da
Martha mit besorgtem Blick daneben stand. Sie
winkte ihm zu, als Michael sie mit »Hallo« be-
grüßte und Holly zuzwinkerte. »Wie ge-
ht’s dir, Martha?«
Martha drehte die Hand in einer »so-so-la-
la«-Geste.
Michael richtete sich wieder auf. »Du bist eine
tolle Frau, Patty. Das weißt du, oder? Owen ist ein
… er ist noch nicht reif für Erwachsenen-
spiele.« Er wollte nicht lange um den heißen Brei
herumreden.
242/346

»Danke, Michael. Ist ja nicht dein Fehler«,
sagte Patty. »Sondern meiner.«
Sie eilte, Holly an der Hand hinter sich
herziehend, die Stufen hinab.
»Owen ist ein Arsch«, murmelte Martha, als
sie an Michael vorbeiging.
Er blickte dem Trio hinterher, bevor er die vier
Stockwerke hinaufrannte. Ohne zu wissen, was er
eigentlich tun sollte, trat er vor Owens Tür und
wollte schon dagegenhämmern, hielt sich aber
zurück.
Scheiß was drauf! Owen Pulaski war es nicht
wert und würde es wahrscheinlich nie sein. Ir-
gendwas musste in seiner Kindheit passiert sein,
was ihn verdorben hatte. Das war bei vielen Män-
nern so. Michael würde es nicht wieder richten
können, dass Jungs keine Gefühle zeigen
durften. Das war ungerecht und machte sie
wütend, manchmal für den Rest ihres Lebens,
sodass sie ihre Wut an jedem ausließen, vor allem
an Frauen.
Plötzlich wurde die Tür geöffnet, und Owen
stand vor ihm. Sein überraschter Gesichtsaus-
druck wandelte sich in den eines Mannes mit
schlechtem Gewissen, aber nur kurz, weil er den
243/346
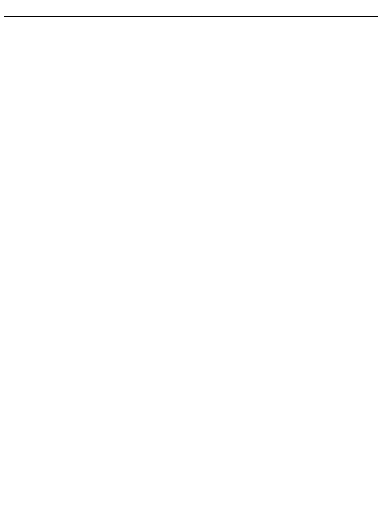
Mund zu einem breiten, dämlichen Grinsen
verzog.
»Hey, Mike! Was ist los, Kumpel?«
Michael schlug ihn zu Boden. »Ich spiele den
Richter über dich, Owen. Betrachte dich als ver-
urteilt.«
Und weil Michael eben Michael war, reichte er
dem großen Kerl die Hand und half ihm, wieder
aufzustehen.
»Ich will dir mal was sagen, Owen. Du hast gar
nichts kapiert. Das Wichtigste und Schönste im
Leben ist die Liebe. Ich gebe dir einen Auftrag:
Suche dir einen Menschen, der dich liebt, und tue
alles, was du kannst, damit du diesen Menschen
ebenfalls liebst. Aber halte dich von Patty fern,
sonst kriegst du noch mal eins drauf.«
Nachdem Michael seinen Teil gesagt hatte, ging
er wieder nach draußen. Er musste Jane sehen.
Sofort!
244/346

VIERUNDFÃœNFZIG
Zehn, vielleicht zwölf Minuten später – so
wichtig war das auch nicht – stand Michael im
Fahrstuhl und fuhr zu Janes Büro hinauf. Das
hier konnte nicht warten. Als die Türen zur Seite
glitten, merkte er gleich, dass etwas nicht stimmte.
Elsie begrüßte ihn nicht mit einem Lächeln,
sondern einem aufgebrachten Blick.
»Ich gehe nach hinten zu Jane«, sagte
Michael.
»Sie ist nicht hier. Ich habe gehofft, sie wäre
bei Ihnen. Jane ist vor einer halben Stunde gegan-
gen.«
Michael hörte Vivienne hinter der Tür schim-
pfen. Und er erkannte die schrille Stimme dieses
schlechten Schauspielers, der Hugh hieß.
Er verstand nicht, was sie sagten, sondern
schnappte nur die Wörter »Jane« und
»wahnsinnig« auf. Die beiden schienen sehr
aufgeregt zu sein. »Das Mädchen hat ja keine
Ahnung, wie sehr ich sie liebe«, hörte er Vivi-
enne. »Sie hat null Ahnung.«
»Was ist mit Jane passiert?«, erkundigte sich
Michael bei Elsie. »Ist mit ihr alles in Ordnung?«

»Hm, ich bin mir nicht sicher, aber sie hat sich
fürchterlich mit ihrer Mutter und ihrem Freund
gestritten …«
Michael wollte sie schon unterbrechen und sagen,
Hugh sei nicht ihr Freund, hielt sich aber zurück.
»Ich weiß nur, dass Jane rausgestürmt
ist«, fuhr Elsie fort. »Und sie hat gesagt, ich soll
die Anrufe für sie in die Warteschleife legen.
Für alle Ewigkeit.«
Elsie hatte ihren Satz kaum beendet, als Vivienne
und Hugh herauskamen. Hugh hielt ein Tuch vor
sein Gesicht. Michael hoffte, dass ihn jemand gesch-
lagen hatte. Zum Beispiel Jane.
»Sie!«, fuhr Vivienne ihn mit gehässiger
Stimme an. »Sie haben damit doch was zu tun. So
hat sich Jane noch nie verhalten. Sie haben sie ver-
dorben!« Sie wedelte mit dem Zeigefinger herum
wie eine strenge Lehrerin.
»Ich weiß nicht, wovon Sie reden«, unter-
brach sie Michael. »Jane ist erwachsen. Und sie ist
nicht korrumpierbar. Im Gegensatz zu Hugh!«
Hugh kniff die Augen zusammen und stürmte,
den Arm irgendwie schwingend, wie man es viel-
leicht für die Bühne lernte, auf Michael zu. Mi-
chael parierte den Schlag mit Leichtigkeit und
246/346

versetzte,
ohne
nachzudenken,
Hugh
einen
Aufwärtshaken in die Magengrube.
Hugh kippte vornüber und landete, mehr ü-
berrascht als verletzt, auf dem Boden.
Michael war noch überraschter – zwei
Schläge in weniger als einer Stunde.
»Es tut mir leid«, entschuldigte sich Michael,
änderte aber seine Meinung. »Nein, tut es nicht.
Sie haben es so gewollt, Hugh. Um Owen tut es mir
ein bisschen leid, aber bei Ihnen bin ich froh, dass
ich Ihnen eine verpasst habe.«
»Elsie, ruf die 911!«, schrie Vivienne mit ho-
chrotem Kopf. »Ruf die Sicherheit! Ruf irgendje-
manden!« Und zu Michael gewandt, zischte sie:
»Und Sie! Sie halten sich von Jane fern. Und von
Hugh. Und wagen Sie es nicht, noch einmal dieses
Büro zu betreten.«
»Auf zwei Ihrer Forderungen kann ich gerne
eingehen«, erwiderte er.
247/346

FÃœNFUNDFÃœNFZIG
Erst auf der Straße kam Michael wieder richtig zu
sich. Er hatte dieselbe Angst wie zuvor, spürte
den gleichen unangenehmen Druck in der Brust,
hatte die gleichen Fragen über Jane und sich.
Was er nicht hatte, war Janes Handynummer.
Daran dachte er, als er an einem der Janes han-
dynummer. Daran dachte, als er an einem der weni-
gen in New York noch verbliebenen öffentlichen
Telefone vorbeikam.
Zu Jane nach Hause zu gehen hatte keinen Sinn.
Wenn sie das Büro wütend verlassen hatte,
würde sie nirgendwo hingehen, wo Vivienne sie
finden könnte. Wohin war sie also verschwunden?
Er ging weiter, und als er keine Lust mehr hatte,
lief er schneller, und als er dazu auch keine Lust
mehr hatte, rannte er los. Die Passanten wichen
ihm weiträumig aus, als wäre er verrückt. Vi-
elleicht hatten sie recht damit. New Yorker hatten
ein Gespür für Verrückte.
Er setzte seine Kopfhörer auf und hörte
Corinne Bailey Rae. Das half ein wenig. Corinne
hatte einen beruhigenden Einfluss. Ohne bestim-
mtes Ziel ging er den Riverside Drive entlang, und

als er die 110th Street erreichte, füllten die
Türme der Cathedral of St. John the Divine den
Blick zum Himmel aus.
Eigentlich war diese Straße als Cathedral Park-
way bekannt, und die St. John the Divine war die
größte Kathedrale der Welt. Aber auch nur, weil
der Petersdom in Rom keine Kathedrale war. Mi-
chael kannte sich in diesen Dingen aus. Er hatte im-
mer viel gelesen und Freude am Lernen.
Er öffnete eine der kleineren Türen, die in die
großen Tore eingelassen waren, trat ein, kniete
nieder und bekreuzigte sich.
Die Kirche war riesig, fast zweihundert Meter
lang. Plötzlich kam sich Michael sehr winzig vor.
Er erinnerte sich, irgendwo gehört oder gelesen zu
haben, dass die Freiheitsstatue bequem unter die
Mittelkuppel passen würde. Das schien zu
stimmen.
Michael fühlte sich so … menschlich, als er
sich hier in der Kathedrale niederkniete. Und er war
nicht sicher, ob ihm dies gefiel oder nicht.
249/346

SECHSUNDFÃœNFZIG
Michael stellte die Musik in seinem Kopfhörer ab
und begann zu beten. Er wollte, er brauchte Ant-
worten, aber auf diesem Weg schien er keine zu er-
halten. Schließlich hob er den Kopf und blickte
sich in der prächtigen Kirche um. Hier hatte ihm
schon immer alles gefallen: die Mischung aus fran-
zösischer Gotik und Romanik; die vom Kreuzgang
abgehenden Kapellen; die byzantinischen Säulen
und Bögen; die hallenden Stimmen; die Orgel, auf
der geübt wurde. Hier lebt Gott, dachte er. Ganz
sicher.
Ruhe überkam ihn, als er sich die prächtige
Fensterrose über dem Altar betrachtete.
Und was ihn am meisten verwunderte: In seinem
Auge bildete sich eine Träne. Sie trübte seinen
Blick, bevor sie über seine Wange hinablief.
»Was ist denn mit mir los?«, flüsterte er. Er
hatte sich beim Rasieren geschnitten, an einem Tag
zwei Kerle niedergeschlagen, auch wenn sie es
verdient hatten, und jetzt weinte er. Ja, Traurigkeit
überkam ihn. So fühlte sich also Kummer an.
Dies war der Schmerz, den man mit dem Herzen

spürte, der einem die Kehle zuschnürte, von
dem er so viel gehört und gelesen hatte.
Noch nie zuvor hatte er so etwas gespürt, und
weil es so schmerzhaft und unangenehm war, wollte
er, dass es aufhörte. Er schnippte mit den Fingern,
doch nichts passierte. Hatte er die Sache hier etwa
nicht mehr in der Hand? Er war verloren und ver-
wirrt, er quälte sich. Das laute Herzklopfen war
von schwachen Herzstichen abgelöst worden, und
mit den Schmerzen setzten Klarheit und Erkenntnis
ein. Eine schreckliche Erkenntnis.
Und vielleicht eine Botschaft. War es das, was
hier passierte?
Michael hatte das Gefühl, eine Antwort auf
seine Gebete erhalten zu haben – eine Antwort,
die ihm ganz und gar nicht behagte. Doch jetzt
glaubte er zu wissen, warum er wieder in New York
und Jane Margaux über den Weg gelaufen war.
Solche Gefühle, eine Art Vorahnung, waren sein-
en Aufträgen immer vorangegangen, genau wie
jetzt. Die Botschaft war sehr klar, und er konnte
sich nicht erinnern, dass sich eine Vorahnung
jemals so falsch angefühlt hätte. Nie, so weit er
zurückdenken konnte.
»O nein«, flüsterte er laut. »Das kann
nicht sein.«
251/346

Doch es konnte. Damit ergab alles, was bisher
passiert war, einen Sinn. Dies war das fehlende
Puzzleteil, nach dem er gesucht hatte. Es erklärte,
warum er Jane wiedergetroffen hatte. Klar, das war
die perfekte Antwort.
Wieder blickte er zu der herrlichen Fensterrose
hinauf, von dort zum Altar. Er wollte nicht glauben,
was ihm eben klar geworden war.
Vor vielen Jahren hatte Michael Jane geholfen,
den Weg ins Leben zu finden. Er hatte ihr den Weg
geebnet,
war
ihr
»imaginärer
Freund«
gewesen, bis er sie an ihrem neunten Geburtstag
hatte verlassen müssen.
Und jetzt … war er derjenige, der auserwählt
worden war, um Jane aus dem Leben zu führen.
Das hatte er verstanden. Es ging um die Sterblich-
keit des Menschen.
Jane würde sterben.
Deswegen war er hier in New York.
252/346

TEIL DREI
Kerzen im Wind

SIEBENUNDFÃœNFZIG
Man kann es auch eine Botschaft nennen. Oder ein-
en Weckruf. Oder Instinkt?
Ich spürte das Bedürfnis, an einen »unser-
er« Orte zu gehen: zu den Stufen des Metropolitan
Museums mit einem Blick auf New York, der mir
schon als kleines Mädchen am besten gefallen
hatte.
Eine Zeit lang blieb ich auf den Stufen sitzen. Als
ich aus dem Büro meiner Mutter gestürmt war,
hatte ich dem Taxifahrer automatisch dieses
Fahrziel
genannt.
Jetzt
hatte
meine
Wut
nachgelassen und sich in so etwas wie Stärke ge-
wandelt. Zumindest redete ich mir das ein. Was
dich nicht umbringt, macht dich stark. So heißt es
doch, oder? Dieses Klischee hatte mir nie besonders
gut gefallen, aber ich war mir nicht zu schade, es
jetzt für mich gelten zu lassen.
Jede Frühlingsblume schien aufgeblüht zu
sein. Von meinem Platz aus sah ich die rosa Apfel-
bäume im Central Park, seitlich der Stufen
standen Azaleen in lebhaftem Rot. Ein gold- und or-
angefarbenes
Schachbrettmuster
aus
frisch

gepflanzten Ringelblumen schmückte einen
Garten in der Nähe der Fifth Avenue.
Das ist besser, viel besser.
Vor dem Museum sprangen Schüler aus Schul-
bussen. Alte Damen gingen an Stöcken vorsichtig
die Treppe hinauf, vielleicht um sich Jackie
Kennedys Kleiderausstellung anzusehen. Ich war
schon da gewesen. Konnte ich also abhaken.
Ein jugendliches Pärchen saß ein paar Stufen
von mir entfernt. Ihr sehnsüchtiger Kuss war zu-
mindest in diesem einen Moment ein Zeichen
hoffnungsloser Liebe. War ich auch verliebt, und
war diese Liebe hoffnungslos?
Die gute Nachricht war: Ich hatte das Gefühl,
ein riesiges Gewicht wäre von meinen Schultern
gefallen. Ich war frei von Vivienne, frei von Hugh,
frei von dem Druck meiner Arbeit, frei von neun bis
siebzehn oder vielmehr von neun bis einundzwanzig
Uhr, frei von der Sorge, ob ich gut oder schlecht
aussah. Zumindest für die nächste Stunde oder
so.
Ich wollte nur noch eines in meinem Leben: Mi-
chael. Ich wusste, ich konnte mich nicht auf seine
Gegenwart verlassen, weil er sie selbst nicht voll-
ständig unter Kontrolle hatte. Ich wusste, er kön-
nte eines Tages wieder verschwinden und würde
255/346

es auch tun. Doch mit der Liebe geht man Risiken
ein, und genau dazu war ich bereit. Ein Mal in
meinem Leben wusste ich, was ich wollte.
Das war doch schon mal ein Anfang.
Als mich jemand ansprach, blickte ich auf, die
Hand vor der Sonne schützend über die Augen
gelegt.
»Entschuldigen Sie, Miss, ist diese Stufe beset-
zt?«
Es war Michael.
»Woher wissen Sie, dass ich eine Miss bin?«,
fragte ich.
256/346

ACHTUNDFÃœNFZIG
Es war wirklich Michael. Er hatte mich gefunden.
Aber er sah völlig scheiße aus!
»Was ist mit dir passiert?«, fragte ich,
nachdem ich ihn gemustert hatte.
»Was meinst du? Was soll denn mit mir los
sein?«
»Du siehst aus, als hättest du tagelang nicht
geschlafen. Deine Augen sind blutunterlaufen,
deine Kleidung ist nass geschwitzt. Du bist …«
Er setzte sich neben mich und ergriff meine
Hand. »Mir geht’s gut, Jane. Wirklich.« Er
beugte sich zu mir und küsste meinen Hals. Ob
sanft oder stark, wusste ich nicht, es war mir egal.
Der Kuss auf die Lippen, der folgte, ließ jeden
Nerv in mir zerbersten. Er küsste mich ein
zweites Mal. Und ein drittes Mal. Als ich in seine
Augen blickte, prickelte die Haut an meinem ganzen
Körper.
»Warum bist du nicht bei der Arbeit?«, fragte
er.
Nur mit Mühe konnte ich mich auf seine Worte
konzentrieren.
Mir war klar, er wusste, was geschehen war.

»Jane?«
»Warum ich nicht bei der Arbeit bin? Weil ich
Hugh McGrath zu Brei geschlagen habe. Und mir
dabei die Knöchel verletzt habe, glaube ich.«
Michael küsste meine Hände.
»Und weil ich meiner Mutter endlich gesagt
habe, dass sie mich mal kreuzweise kann. Hat sich
toll angefühlt, Michael. Weil ich heute meine
Tagesarbeit gekündigt habe, die zufällig auch
meine Abendarbeit war.«
Michael blickte mich liebevoll an. »Ein Hurra
für Jane! Gut für dich!«
Ich lachte. »Ein Hurra für Jane? Gut für
mich? Ich hoffe nicht, du glaubst, deine Arbeit
wäre hiermit erledigt. Das ist sie nämlich nicht,
nicht mal annähernd.«
»Du bist ein Endlosprojekt«, beruhigte er
mich mit einem Lächeln. »Abwechslungsreich,
mit Entwicklungspotenzial, überraschend.«
»Hervorragend
ausgedrückt.
Du
hast
geübt.«
Ich beugte mich zu ihm und küsste ihn. »Ich
habe beschlossen, damit aufzuhören, mich elend
zu fühlen und mich manipulieren zu lassen. Ich
will das Leben genießen. Ich will Spaß haben.
258/346

Habe ich das nicht genauso verdient wie alle ander-
en auch?«, fragte ich.
»Auf jeden Fall«, antwortete er. »Und du am
meisten von allen.« Plötzlich machte er ein ern-
stes Gesicht und mied meinen Blick. Oh, oh.
»Was ist?«, fragte ich.
»Jane, erinnerst du dich, als dich dein Vater
damals zu diesem langen Wochenendtrip nach Nan-
tucket mitgenommen hat?«
»Das war der Ausgleich dafür, dass er mich
an meinem fünften Geburtstag nirgendwohin
mitgenommen hat. An meinem vierten auch nicht.
Wahrscheinlich ebenso wenig wie an meinem drit-
ten.«
»Ja, genau das.«
»Es war das erste Mal, dass ich wirklich
glücklich war«, sagte ich lächelnd. »Wir
beide haben mit meinem lächerlichen Barbie-
Puppen-Eimer und der dazu passenden Schaufel
Sandburgen gebaut. Wir sind in die Stadt in eine
Eisdiele gegangen, wo sie Schokosplitter und Erd-
nüsse in der richtigen Mischung in Kaffeeeis
gemischt haben. Wir sind jeden Tag schwimmen
gegangen, obwohl das Wasser b-b-bitterkalt war.«
»Das war toll, was?«, fragte Michael.
259/346

»Richtig toll. Erinnerst du dich an den Cliffside
Beach Club? Und Jetties Beach?«
»Lass uns dorthin zurückfahren, Jane.«
Ich lächelte. »Liebend gerne. Wann?«
»Jetzt. Heute. Fahren wir. Was meinst du?«
Ich blickte in Michaels grüne Augen und
spürte, dass etwas nicht stimmte, wollte ihn aber
nicht danach fragen. Früher oder später
würde er es mir schon sagen. Außerdem war ich
wieder das kleine Küken Jane. Die Phantasie ist
viel besser als die Realität.
»Liebend gerne würde ich nach Nantucket
fahren«, sagte ich. »Aber du musst mir ver-
sprechen, mir ein paar Fragen zu beantworten,
wenn wir dort sind.«
260/346

NEUNUNDFÃœNFZIG
Erste Frage«, begann Jane bereits auf der Fahrt
zum Flughafen. »Du bist mir ausgewichen, als du
mir erzählen solltest, ob du jemals was mit einer
Frau hattest. Aber hast du dich jemals verliebt?«
Michael verzog sein Gesicht und seufzte. »Die
Sache läuft so, dass ich nach einer Weile anschein-
end vergesse, was in der Vergangenheit passiert ist.
Darauf habe ich keinen Einfluss. Um deine Frage zu
beantworten: Ich glaube nicht.«
»Dann wäre dies hier das erste Mal?«, fragte
Jane. Michael musste über ihre selbstbewusste
Vermutung lächeln, dass er sich in sie verliebt
hatte. Er hatte es nicht verraten, aber sie merkte es.
»Was ist mit Sex?«, fragte sie als Nächstes.
Michael begann zu lachen. »Hey, machen wir
uns die Sache nicht allzu schwer. Eine Frage nach
der anderen, ja? Und lass uns lieber von was ander-
em reden, Jane-Herzchen.«
»Gut. Ich erinnere mich, als ich ein kleines, win-
ziges Mädchen war, flogen wir hinauf nach Cape
Cod. Jeden Sommer ein paar Mal«, erzählte
Jane, als das Taxi am LaGuardia-Flughafen zum al-
ten Marine Terminal fuhr.

Michael gab ihr einen Kuss, verweilte auf ihren
weichen Lippen, hielt seinen Blick auf ihre
funkelnden Augen gerichtet. Sie war eine erwach-
sene Frau, doch er liebte das Unschuldige und
Kindliche in ihr, das sie sich bewahrt hatte.
»Versuchst du, mich mundtot zu machen?«,
fragte Jane. »Mit dem Küssen?«
»Überhaupt nicht. Es … gefällt mir ein-
fach.« Und er küsste sie wieder.
»Steigen Sie aus, oder wollen Sie sitzen bleiben
und bis zum Abend rumturteln?«, bellte der Taxi-
fahrer nach hinten.
»Rumturteln«, antwortete Jane lachend. Ein
kaum merkliches Lächeln huschte über das
Gesicht des Fahrers.
Michael gab ihm das Geld und schnappte sich die
beiden kleinen Reisetaschen. Sobald sie das alte
Terminal erreicht hatten, blieb er stehen und blickte
sich um.
»Wonach suchst du denn?«
»Nach ihm.«
Michael deutete auf einen alten Kerl in weiter,
brauner Windjacke mit dem Logo »CCPA« auf
der Brusttasche. Sein Gesicht war von der Sonne
braun gebrannt und voller Falten.
262/346

Michael ging auf ihn zu. »Cape Cod Private
Air?«, fragte er.
»Genau der«, antwortete der Kerl mit rauer
Stimme. »Folgen Sie mir. Sie sind Jane und Mi-
chael, oder?«
»Die sind wir«, bestätigte Jane.
Sie folgten dem Alten, und einige Minuten
später bestiegen sie ein kleines Flugzeug, das dem
auf den Fotos von Lindberghs Atlantiküberquer-
ung, die Michael gesehen hatte, verdächtig
ähnelte.
»Meinst du, das Flugzeug schafft es nach Nan-
tucket?«, fragte Jane nur halb im Spaß. Michael
hoffte, sie erinnerte sich nicht an Abstürze von
kleinen Maschinen, die sich in letzter Zeit ereignet
hatten.
»Etwas mehr Vertrauen, meine Dame«,
forderte der Pilot.
»Davon haben wir mehr als genug«, erwiderte
Michael. »Sie haben ja keine Ahnung.«
Ein paar Minuten später drehten sich die Pro-
peller, und das Flugzeug torkelte über den As-
phaltstreifen wie ein Betrunkener durch die
Bowery.
»Als ich mir meinen eigenen Tod vorgestellt
habe, hatte er nichts mit einem Flugzeugabsturz zu
263/346

tun.« Jane versuchte, witzig zu klingen, doch sie
hielt Michaels Hand fest umklammert.
Michaels Brust tat wieder weh, und es schnürte
ihm die Kehle zu. Jane war lustig, doch er hatte ein
ungutes Gefühl bei dem, was sie gerade gesagt
hatte. Wenn sie abstürzten, würde er dann
auch sterben? Schließlich hatte er in letzter Zeit
eine Reihe »erste Male« erlebt. Würde der
Tod das letzte »erste Mal« sein wie für die
Menschen auch?
»Wir werden nicht abstürzen, Jane«, ber-
uhigte er sie und umschloss ihre Hand noch fester.
264/346

SECHZIG
Nachdem das Flugzeug abgehoben hatte, brauchte
es einige Zeit, bis es seine Flughöhe erreicht hatte.
Michael war der Meinung, sie verbrachten zu viel
Zeit damit, die Dächer von Queens zu betrachten.
Doch auch damit, die Dächer vor Queens zu be-
trachten. Doch auch nachdem sie in die Wolken ein-
getaucht waren, ließ das Flugzeug ein wenig ber-
uhigendes Tuckern hören.
Irgendwie näherten sie sich allerdings fünfzig
Minuten später Nantucket. Unter ihnen breiteten
sich kilometerlange Sandstrände und ein paar
kleinere Inseln aus. Schließlich landeten sie sogar,
ohne zu ruckeln. Erst jetzt ließ Jane Michaels
Hand los.
Obwohl es erst Spätfrühling war, wimmelte
es hier von Menschen in leuchtender Som-
merkleidung. Ein Meer aus Pink und Gelb und Li-
mone. Sorgfältig abgetragene Jeans und Surfan-
züge. Seemöwen kreischten über ihnen, als
hätten sie noch nie zuvor Touristen gesehen. Oder
mehr als genug.

Michael und Jane gingen zum Taxistand. Die
Sonne stand senkrecht über ihnen, die Luft war
kühl und klar.
Während sie warteten, umfasste Jane Michaels
Gesicht mit beiden Händen. »Michael, wo bist
du?«, fragte sie.
»Was? Ich bin doch hier.«
Er wusste nicht, was er sagen sollte, aber er
wusste, dass er sich zusammenreißen musste. Er
hatte darüber nachgedacht, dass Jane sterben
würde, doch sie war ja noch hier. Sie waren beide
hier. Wieso vergeudete er also kostbare Zeit? War-
um tat man das überhaupt? Warum verschwen-
dete man eine Sekunde seiner Zeit? Dies war ihm
genau in diesem Moment bewusst geworden.
»Wir sind zusammen«, sagte Jane und blickte
in seine Augen. »Lass uns einfach die Zeit
genießen. Schieb alles beiseite, was dir im Kopf
herumgeht, und sei bei mir. Lass uns einen Tag
nach dem anderen leben. Eine Stunde nach der an-
deren. Eine Minute nach der anderen. Okay?«
Michael legte seine Hände über ihre und dre-
hte den Kopf, um sie sanft zu küssen, bevor er
lächelnd nickte.
»Ja«, stimmte er zu. »Eine Minute nach der
anderen. Eine Stunde nach der anderen. Einen Tag
266/346

nach dem anderen.« Taxen und kleine Linien-
busse hielten am Flughafen. Die Reisenden luden
ihre Koffer und Einkaufstüten ein. Michael und
Jane wurden immer ungeduldiger, doch schließ-
lich standen sie am Anfang der Reihe.
»Werfen Sie Ihr Reisebündel hinten in den
Kofferraum«, bat der Taxifahrer.
Reisebündel. Was für ein herrliches Wort
für ihr Gepäck. Michael musste lächeln, was
Jane zum Lachen brachte. »Gut, da bist du ja
wieder.«
»Ja, ich bin hier, Jane. Das ist meine Hand, die
deine hält. Das ist mein schnell schlagendes Herz,
das du hörst.«
Jane lächelte und blickte sich noch einmal um
– Erinnerungen wachrufen, dachte Michael. Das
hohe, im Wind geneigte Seegras. Die Möwen in
der Luft. Ein blondes Mädchen, das neben dem
Taxistand selbst gemachte Marmelade verkaufte.
Der Taxifahrer hätte ein Bruder des Piloten sein
können, mit dem sie hergeflogen waren. Ein
bodenständiger, todernster Neuengländer ir-
gendwas zwischen sechzig und fünfundachtzig
Jahren.
»So, meine Hübschen, wohin darf ich euch
fahren?«, fragte er.
267/346

»Ins India Street Inn«, antwortete Michael.
»Gute Wahl«, erwiderte er. »Das is’n
altes Haus von einem Walfängerkapitän.«
Jane lächelte und drückte Michaels Hand.
»Gute Wahl«, wiederholte sie. »Ich liebe
Walfängerkapitäne.«
»Und, ja«, flüsterte ihr Michael plötzlich
ins Ohr, »als Antwort auf eine Frage, die schon et-
was zurückliegt. Ja, ich hatte schon mal Sex.«
268/346

EINUNDSECHZIG
Es gab viele Dinge, die Jane und Michael bei ihrer
Fahrt in die Stadt nicht sahen: Schnellrestaurants,
Souvenirgeschäfte und Verkehrsampeln. Sie war-
en im Paradies! Sie sahen ein paar handges-
chriebene Schilder, auf denen für das 10. Wein-
fest von Nantucket oder das 35. Figawi-Renn-
wochenende geworben wurde. Ein guter Auftakt
für ihren Besuch.
Schließlich hielt ihr Taxi vor dem India Street
Inn.
»Genauso habe ich mir eine Übernachtung mit
Frühstück in Nantucket vorgestellt«, sagte
Jane, als sie durch die Eingangstür traten. Es war
Michaels Idee gewesen – etwas Einfaches und
Schönes. Nichts Übertriebenes.
Hier war alles aufeinander abgestimmt: rote Ger-
anien in königsblauen Blumenkästen vor den
Fenstern, farbige Quilts an der Wand, Drucke von
Schlittenfahrten in den Fluren und natürlich die
barsche
Neuengländerin,
der
dieses
Haus
gehörte.

»Haben Sie reserviert? Wenn nicht, haben wir
kein Zimmer«, begrüßte sie die beiden. »Das
heißt, kein Zimmer im India Street Inn.«
Michael gab »Michaels« als Namen an, dann
wurden sie in den ersten Stock in Suite 21 geschickt.
Dort gab es ein großes Zimmer mit einem breiten
Bett und eine Menge alter Kiefernholzmöbel, an
einer Seite befand sich ein Wandgemälde, und
überall lagen flauschige, weiße Handtücher
herum. Eine Tür des Badezimmers führte in
ein kleineres Schlafzimmer. Miteinander ver-
bundene Schlafzimmer, wie Michael per Telefon re-
serviert hatte.
»Das ist toll«, war alles, was Jane sagte, als sie
die Suite inspizierte.
Sie öffnete im größeren Schlafzimmer das
Fenster. Als eine kühle Brise ihr Haar zurück-
wehte, dachte Michael, sie hätte nie hübscher
ausgesehen. Gab es etwas Schöneres, als mit Jane
hier zu sein? Er glaubte nicht. Noch nie hatte sein
Herz wegen jemandem so heftig geschlagen. Daran
hätte er sich sicher erinnert.
Jane griff zu einer Broschüre auf dem Schreibt-
isch und begann zu lesen: »›Kaffee im vorderen
Salon ab sechs Uhr früh. Surf-Unterricht in der
abgelegenen Bucht jeden Montag und Donnerstag.
270/346

Fahrradverleih. Sie können auch den Turm der Al-
ten Nordkirche besteigen.‹ Können wir? Ich
würde gerne alles von dem hier machen.«
Er merkte Janes Stimme an, dass sie glücklich
war. Sie spielte nicht das kleine Kind, sondern sie
hatte dieselben wunderbaren Eigenschaften –
Enthusiasmus, Forscherdrang, Unschuld.
Ich liebe sie, dachte er und sagte: »Gut. Alles,
was du willst.«
Und beschloss, es für den Moment dabei be-
wenden zu lassen.
271/346

ZW EIUNDSECHZIG
Die Wirtin gab ihnen zwei alte Fahrräder. Nichts
Schickes: dicke Reifen, verrostetes Gestell, Rück-
trittbremsen und viele quietschende Teile. »Die
meisten Touristen glauben, Siasconset ist hübsch
und was Besonderes«, erklärte sie und deutete in
die Richtung des Dorfes. »Weil es tatsächlich
hübsch und was Besonderes ist.«
Jane fuhr voran, Michael folgte ihr die Milestone
Road entlang. Es herrschte nicht viel Verkehr –
hin und wieder ein Jeep, ein Motorrad, ein Fis-
chlieferant, ein großer, ordinärer, taxigelber
Hummer, dann eine Gruppe Kinder auf Fahr-
rädern, die schneller waren als einige der Autos.
»Fröhliche Flitterwochen!«, rief eines der
Kinder. Michael und Jane blickten sich an und
mussten lächeln. Nach acht oder neun Kilometern
kamen sie an einen Lattenzaun, von dem sie einen
Ausblick wie auf die Serengeti in Afrika hatten. Als
Nächstes überquerten sie die Tom Nevers Road,
von der sich ihnen ein Panorama auf die Preisel-
beerfelder bot, am Golfclub von Nantucket blickten
sie über die ausgedehnten Hügel mit dem kurz

gemähten Rasen, was den Eindruck erweckte,
Golfspielen könnte wirklich Spaß machen.
Sie erreichten einen weiteren Hügel, der höh-
er war als der Rest. Auf einem Holzschild in Pfeil-
form stand: »SIASCONSET«. Sie rollten den
Hügel hinab, und da war er – ein weißer
Strand, der zum Meer abfiel. Michael fragte sich, ob
Jane gewusst hatte, dass die tiefrote Abendsonne in
diesem Augenblick unterging und sie beide in ein
wunderschönes Licht tauchte.
»Sag mir, dass du noch nie so was Schönes
gesehen hast«, verlangte sie, als sie sich in den
Sand setzten.
»Doch, habe ich.« Er blickte in ihre Augen.
»Stopp!«, rief sie lachend und mit rotem
Gesicht. »Sonst verlierst du schon am ersten Tag
hier deine Glaubwürdigkeit.«
»Gut.«
»Nein, hör nicht auf.«
Also legte er seinen Arm um sie und beobachtete
sie aus dem Augenwinkel heraus. Er lebte im
Moment.
Ich liebe Jane, dachte er. Mehr zählt im Mo-
ment nicht.
273/346

DREIUNDSECHZIG
Diese Sache mit dem Sex … da passierte nichts in
der ersten Nacht in Nantucket, und ich versuchte,
nicht zu viel daran zu denken, was mir aber nicht
gelang, oder es mir irgendwie nahegehen zu lassen.
Auch das misslang mir aufs Kläglichste.
Früh am nächsten Morgen brachen wir zu
dem angeblich höchsten Punkt der Insel auf, dem
Folger Hill. Wir waren sogar so vernünftig, uns
mit Sonnenblocker einzuschmieren und langärm-
lige Hemden anzuziehen. Ich genoss jede Minute,
jede Sekunde unserer Reise. Auch wenn ich nicht
wusste, was als Nächstes kam, und trotz all der
Fragen, die mir noch auf der Seele brannten, nahm
ich mir meinen eigenen Rat zu Herzen und war von
allem begeistert – Tag für Tag, Stunde für
Stunde, Minute für Minute.
Die Fahrt auf der Polpis Road kam mir lang vor.
Vielleicht war ich nur müde. Außerdem war der
Himmel bedeckt, und wegen des Nebels kamen die
Fähren, aber auch die Versorgungsboote zu spät.
Schließlich erreichten wir die kleine Hafenstadt
Madaket. Dort gab es einen Köderladen, einen

Haushaltswarenladen und einen Treffpunkt, den
Smith’s Point.
Gegen halb zwölf aßen wir Fisch mit Pommes
in einer kaputten Hütte, von der wir zuerst dacht-
en, sie wäre verlassen.
»Woher wusstest du von diesem Ort?«, fragte
ich.
»Bin ich mir nicht sicher. Ich wusste es ein-
fach.«
Vielleicht, um mich diesmal mundtot zu machen,
küsste Michael mich, was mich nie ermüdete.
Dann machten wir uns über den knusprigen,
köstlichen, frittierten Fisch her. Der Koch hatte
ihn in eine Zeitung eingewickelt. Wir sprenkelten
Malzessig über den Kabeljau, und weil Michael
glaubte, man könnte nie genug frittierte Sachen
auf einmal essen, bestellten wir eine Tüte aus
zusammengerolltem Zeitungspapier mit Pommes
ebenfalls mit Essig. Aus der unter freiem Himmel
stehenden Küche drangen Bob-Dylan-Lieder.
Wieder war alles so perfekt und zauberhaft, dass
mir nach Weinen zumute war.
Manchmal erwischte ich Michael, wie er aufs
aufgewühlte Meer blickte. In diesen Momenten
schien er sich wieder forttreiben zu lassen. Ich woll-
te wissen, wohin er ging und was er dachte. Wusste
275/346

er bereits, wann er mich verlassen würde? Ich
schloss die Augen und weigerte mich, darüber
nachzudenken. Dies wollte ich erst wieder tun,
wenn es so weit war.
Es musste wohl unweigerlich passieren. Das Ende
war vorherbestimmt. Michael würde gehen, um
sich irgendwo um ein Kind zu kümmern, viel-
leicht nicht einmal in New York.
Es war unvermeidlich, weswegen ich diesen
traurigen Gedanken verbannte. Ich war im Urlaub
und in Michael verliebt.
»Woran erinnerst du dich bei mir als kleines
Mädchen?«, fragte ich und lehnte mich
zurück. Eine Stunde lang lauschte ich Michaels
Erinnerungen. Interessanterweise erinnerte er sich
noch an alles, selbst an das Kaffeeeis mit der zer-
laufenen Karamellsoße.
276/346

VIERUNDSECHZIG
Ich hätte nicht gedacht, dass mir diese Worte ein-
mal über die Lippen kommen würden«, sagte
ich.
»Und was für Worte sind das?«
»Ich bin viel zu satt für einen Nachtisch.«
»Jane, wir haben seit Mittag nichts mehr ge-
gessen.«
»Du isst, ich schaue nur zu«, schlug ich vor.
Michael blickte mich fast besorgt an.
Im India Street Inn duschten wir uns und zogen
uns Jeans, T-Shirts und Windjacken an.
Dann gingen wir zu Fuß. Auch so eine Eigenheit
von uns: gehen und reden.
Wir entfernten uns vom Stadtzentrum, fort von
den Geschäften, den Sorgen, der Verantwortung,
fort von allem, das mit der sogenannten realen Welt
– meiner Arbeit und Vivienne – zu tun hatte.
Wir gingen an dreihundert Jahre alten Häusern
vorbei, in denen die Seefahrer und Walfänger ein-
mal gelebt und ihre geduldigen, treuen Ehefrauen
auf ihre Rückkehr gewartet hatten; Häuser, die
schon lange hier gestanden hatten, bevor sich die

Medienpromis, Popsänger, Schauspieler und
Autoren auf der Insel niedergelassen hatten.
Wir kamen an einer der drei Windmühlen, an
vielen kleinen Tümpeln, Spazierwegen und mehr
»Trophäen«-Häusern vorbei, als man mit
Seemuscheln hätte bewerfen können.
»Du bist dir sicher, dass du keinen Hunger
hast?«, fragte Michael auf dem Rückweg zu un-
serem Hotel.
»Es gibt nur zwei Dinge, deren ich mir sicher
bin«, antwortete ich. »Erstens, ich habe keinen
Hunger, und zweitens …« Ich machte eine Pause,
nicht um Wirkung zu erzeugen, sondern weil ich
mir meine Worte genau überlegen wollte.
»Rede weiter«, forderte er mich auf. »Zweier
Sachen bist du dir sicher. Was ist die zweite?«
»Zweitens, ich liebe dich, Michael. Ich glaube,
ich liebe dich schon mein ganzes Leben lang. Das
musste ich laut aussprechen, nicht nur in
Gedanken.«
Wir blieben stehen. Michael legte seine Hände
um meine Hüften und ließ sie über den
Rücken nach oben wandern, was mich auf eine
Art erregte, die mich, nun ja, zu allem bereit
machte. Wir küssten uns wieder, und er nahm
mich wieder so fest in die Arme, wie ich es liebte.
278/346

Schließlich gingen wir das kurze Stück
zurück zum Hotel. Ich hatte das Gefühl, im
Fenster leuchtete ein Neonschild mit der Aufschrift:
»Und jetzt?«
279/346

FÃœNFUNDSECHZIG
Fast hätte ich euch beide ohne Fahrrad zwischen
den Beinen nicht wiedererkannt«, begrüßte
uns die Wirtin, als wir das Haus betraten. Verwun-
dert blickte ich sie an. Ich glaube nicht, dass sie es
so meinte, wie es sich anhörte, weil sie keinen Ton
mehr sagte.
Michael und ich lachten und gingen Händchen
haltend, aber schweigend in unser Zimmer hinauf.
Im Moment hatte ich nicht einmal mehr eine Frage
an ihn.
Im Schlafzimmer küssten wir uns wieder –
heftiger, dann sanfter und wieder heftiger und
wieder sanft, während wir unsere Lippen anein-
anderrieben und auf den Atem des anderen lauscht-
en. Wie weit würde dies gehen? Wie weit konnte
ich gehen?
»Zu dir oder zu mir?«, brachte ich schließ-
lich heraus.
»D… d…«, stammelte Michael mit besor-
gtem Gesicht.
»Ich fasse das als ein ›da‹ mit Hinweis auf
dieses Bett dort auf«, sagte ich grinsend. Er blickte
mir ernst in die Augen.
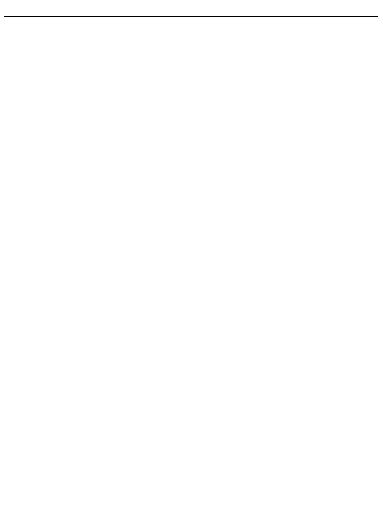
»Michael … komm schon.« Ich streichelte
sanft über seinen Rücken und drückte mich
an ihn. »Es ist in Ordnung. Und es wird gut, ich
schwöre es. Ich verspreche es. Ich hoffe es? Ich
glaube, ja.«
Er lächelte mich an und führte mich an der
Hand ins kleinere Schlafzimmer. »Es wird gut
werden«, murmelte er leise. »Das muss es. Alles
hat zu diesem Moment geführt. Und jetzt sind
wir hier. Ist mit dir alles in Ordnung?«
Ich lächelte. »Mit deinem ›d… d…‹
hast du mich ganz schön geschafft.«
281/346

SECHSUNDSECHZIG
Ich war ungeduldig und nervös. Eher ungeduldig,
aber … »Das ist immer der schlimmste Teil«,
sagte ich und setzte mich aufs Bett.
»Was?«
»Ausziehen.«
»Für dich vielleicht«, neckte mich Michael.
»Für mich wird es der Höhepunkt der letzten
Jahre, dir beim Ausziehen zuzusehen.«
Während ich an den Knöpfen meiner Bluse
fummelte, überkamen mich plötzlich wie im-
mer, wenn ich mich verzweifelt auf etwas anderes
konzentrieren wollte, diese seltsamen, unlogischen
Zweifel. Ich hatte eine Frage an alle Pfarrer, Priester
oder Rabbis da draußen: Ist es richtig, mit seinem
imaginären Freund ins Bett zu gehen? Aber etwas,
das mit so viel Liebe erfüllt war, konnte keine
Sünde sein. Wenn es allerdings auf unerklär-
liche Weise doch eine Sünde war, war es dann
eine schwere oder eine kleine? Eine Todsünde
oder eine verzeihliche Sünde? Was ist, wenn dein
Freund ein Engel ist, er es aber selbst nicht genau
weiß?

Egal, was es war, Michael bemerkte mein
Zögern und nahm die Sache in die Hand, das
heißt, meine Bluse. Und mit meinem BH war er
noch geschickter – er öffnete ihn mit einer Hand
in weniger als fünf Sekunden.
»Du bist gut«, lobte ich ihn. In meinem Magen
spürte ich ein Flattern, und ich errötete.
Er blickte mir tief in die Augen. »So etwas hast
du noch nicht erlebt.«
»Oh, das hoffe ich.«
»Ich auch.«
Wir küssten uns wieder, Michael umfasste
meine Brüste mit seinen Händen, ließ mich
auf eine Art wimmern, die unter anderen Um-
ständen völlig peinlich gewesen wäre. In
diesem Fall, muss ich sagen, klang es eher erotisch.
Er hielt mich sanft fest, als hätte er Angst, mir we-
hzutun, und rieb mit den Daumen über meine
Brustwarzen. Ich erschauderte. Er war so sanft, so
lieb, so nett, wie jemand nur sein konnte. Dann glitt
er mit seinen Fingerspitzen über meinen Bauch.
Auch das gefiel mir. Ich schmolz unter seinen
Händen dahin.
Seine Berührungen waren wirklich wunder-
schön. Vielleicht war er tatsächlich ein Engel,
was mich in diesem Moment allerdings nicht
283/346

kümmerte. Meine Haut kribbelte vor Lust darauf,
was auch immer in diesem vorzüglichen Moment
passieren konnte. Ich hatte keine Ahnung –
»vorzüglich« hatte bisher nicht zu meinem
Leben gehört.
»Mir gefällt die Art, wie du mich berühr-
st«, flüsterte ich gegen seine Wange. »So hat
mich noch keiner berührt.«
Sein Atem wurde heftiger. »Mir auch«, sagte
er zwischen zwei Küssen.
Er zog mich zu sich herunter. Als er mit seiner
Zunge über meine Brustwarzen fuhr, stieß ich
ruckartig den Atem aus. Alle Gedanken daran, ob
Michael Erfahrung mit so etwas hatte oder nicht,
waren wie weggeblasen. Wir waren zusammen, und
genau das liebte ich. Vielleicht weil ich wusste, dass
auch Michael in diesem Moment glücklich war.
Ich spürte es an seiner Berührung, und ich sah
es in seinen grünen Augen. Er liebte diesen Mo-
ment genauso wie ich.
Ich küsste ihn, schmeckte seine weichen Lip-
pen, bevor ich ein wenig zurückwich. »Okay, ja,
bitte«, flüsterte ich mit Blick in seine Augen.«
»Okay, Jane, ja, danke.« Michael lächelte
wie die aufgehende Sonne. Er drehte mich auf den
Rücken und legte sich mit seinem warmen
284/346

Körper auf mich, während ich mich für ihn
öffnete. Dann war er in mir – das konnte nur
richtig sein, weil Michael sagte: »Ich liebe dich so
sehr, Jane. Ich habe dich schon immer geliebt und
werde es immer tun.«
Und das entsprach fast genau dem, was ich selbst
Wort für Wort dachte.
285/346

SIEBENUNDSECHZIG
Diese Nacht dauerte für beide lange, bis Jane
schließlich wie ein Baby einschlief, während Mi-
chael wach lag und mindestens eine Stunde lang ihr
Haar streichelte.
Sie in ihrem friedlichen Schlaf zu beobachten,
weckte in ihm den Wunsch … alle Scheiben im
Zimmer einzuschlagen. Das Leben war ungerecht
– dies wurde ihm zum ersten Mal richtig bewusst.
War er deswegen hier, damit er lernen konnte,
mehr Mitgefühl aufzubringen? Wenn ja, war das
ziemlich bescheuert, weil er schon verdammt viel
Mitgefühl hatte. Das hatte jeder, der als ima-
ginärer Freund für Kinder arbeitete. Also,
welche Rolle spielte er in diesem kleinen Melo-
drama?
Einen
Engel?
Einen
gewöhnlichen
Menschen? Einen imaginären Freund? Ihn
plagten ebenso viele Fragen wie Jane, und auf keine
erhielt er eine Antwort.
Leise stand er auf, ging ins Badezimmer und be-
trachtete sich im Spiegel.
Du musst Jane sagen, was los ist. Was mit ihr
passieren wird.

Aber war dies der richtige Weg? Es könnte der
falsche sein. Er drehte die Dusche so heiß auf, wie
er es aushielt. Die Ablage stand voll mit Janes
Sachen – Mandelseife, Conditioner, Schampoo.
Wie krank war sie? War es Krebs? Hatte es etwas
mit ihrem Herzen zu tun? Gestern, nach dem Fisch
mit Pommes, hatte sie gesagt, sie sei so satt, dass sie
lieber mit dem Taxi als dem Fahrrad zurückge-
fahren wäre. Und beim Spaziergang durchs Dorf
war sie müde gewesen. Zudem aß sie für ihre
Verhältnisse ziemlich wenig.
»Hey, ich dachte schon, das Badezimmer steht
in Flammen, so viel Dampf gibt es hier.«
Er lächelte.
»Michael? Bist du da drin?«, rief sie.
»Nein, er ist nicht da. Ich habe nur die gleiche
Stimme wie er.«
Lachend zog Jane den Duschvorhang zur Seite.
»Oh. Und da ist noch was von Michael. Mein Gott,
ist das groß. Und es wächst. Da muss man
drauftreten oder mit dem Stock draufhauen. Oder
… okay … ich denke, mit dem Ding kannst du
sogar jemanden umwerfen.«
287/346

ACHTUNDSECHZIG
Und was geschah als Nächstes?
Sie schliefen wieder miteinander, dann nebenein-
ander. Am Morgen erwachten sie mit einem
Lächeln auf dem Gesicht und einem neuen,
freudigen Gefühl des Staunens und der Zufried-
enheit. Nach dem Frühstück fuhren sie auf
einem Boot mit, um Wale zu beobachten. Michael
gefiel Janes Aufregung, als sie in bedenklicher
Nähe des Boots tatsächlich den Rücken eines
Buckelwals entdeckten. Nach dem Mittagessen gin-
gen sie zum Brant Point Lighthouse. Diesem Besuch
folgte – Händchen haltend – ein langer
Strandspaziergang, auf dem sie manchmal im Ge-
spräch vertieft, manchmal schweigend nebenein-
ander hergingen.
Michael beantwortete Janes Frage danach, wie
lange er dies schon machte – ein »Freund« zu
sein -, und ließ sich so weit darüber aus, wie er
sich erinnerte. An die letzten Aufträge konnte er
sich noch gut erinnern, von anderen hatte er nur
noch eine Ahnung, weil seine Erinnerungen wie
Träume verblassten. Jane jetzt zu sehen, als

Erwachsene, brachte seine Erinnerungen an sie als
kleines Mädchen zurück.
Er wusste nicht, ob jedes Kind einen unsichtbaren
Freund hatte, aber er hoffte es.
Am Abend rief Michael im Hummerrestaurant
von Nantucket an und ließ Hummer, Muscheln
und Maiskolben direkt an den Strand liefern. An-
schließend gingen sie zurück ins Hotel und
schliefen wieder miteinander, was sie einander noch
näher brachte als zuvor. Und der Sex war toll,
besser, als Michael es sich vorgestellt hatte. Viel-
leicht weil Liebe mit im Spiel war und sie beide sich
so gut kannten. Jane fühlte sich in der Nacht
nicht so wohl, dachte aber, es könnte an den
Muscheln liegen.
Am nächsten Morgen liehen sie sich Neopren-
anzüge und fuhren mit einem Fischerboot zum
Angeln hinaus, wo sie etwa ein Dutzend Blau-
barsche fing, er keinen einzigen. Er versuchte, sich
ihren Ausdruck von Begeisterung und Triumph zu
merken, wenn sie den nächsten zappelnden Blau-
barsch ins Boot zog. Ihr Haar glänzte in der
Sonne, ihr Lächeln erleuchtete den Himmel. Er
konnte es kaum abwarten, wieder mit ihr allein zu
sein.
289/346

Vor dem Abendessen schliefen sie mit einer
Heftigkeit miteinander, die sie beide überraschte.
Doch sie redeten nicht darüber, sondern
schnappten sich ihre Fahrräder und fuhren noch
einmal ins malerische Siasconset. Auf dem Rück-
weg hielten sie an und pflückten dicke
Sträuße wilder, duftender Rosen. Diese ließen
sie in den Fahrradkörben und aßen in Ozzies
und Eds Restaurant zu Abend, wo Ozzie und Ed die
beiden praktisch adoptierten und sie immer wieder
mit »entzückend« bezeichneten.
»Habe
ich dir
je von Kevin
Uxbridge
erzählt?«, fragte Michael auf dem Weg vom Res-
taurant zum Hotel.
»Nein. War er eines von deinen Kindern? Oder
ein Freund?«
»Nein, Kevin Uxbridge ist ein Douwd, ein un-
sterbliches Wesen in Star Trek.«
»Das Original oder die Nächste Genera-
tion?«
»Nächste Generation. Er lernte eine Frau na-
mens Rishon kennen und verliebte sich so sehr in
sie, dass er beschloss, auf seine außergewöhn-
lichen Kräfte zu verzichten, um diese Frau zu heir-
aten und das ›Leben eines Sterblichen‹ zu
führen.«
290/346

»Ich hoffe, es hat mit den beiden geklappt«,
sagte Jane. »Ich sehe doch eine gewisse Paral-
lele.«
»Hm, eigentlich hat es nicht geklappt«,
räumte Michael ein. »Die Husnocks kamen und
griffen ihre Kolonie an. Rishon wurde getötet.
Kevin Uxbridge war so wütend und am Boden
zerstört, dass er die Husnocks ausrottete, alle
fünfzig Milliarden.«
»Großer Gott«, stöhnte Jane, »das kommt
mir doch leicht übertrieben vor. Aber Moment
mal – wer von uns beiden ist Kevin?«
»Keiner von beiden.« Michael klang beinahe
gereizt.
»Okay.« Jane ergriff seine Hand. »Mir per-
sönlich haben die Tribbles immer am besten ge-
fallen.«
Michael beschloss, das Thema fallenzulassen.
Jedes Mal, wenn Jane hustete oder auch nur
leicht erschöpft aussah, wurde Michael in die
Wirklichkeit zurückgeholt. Jedes Mal, wenn sie
einen Krampf im Bein hatte oder ihre plötzliche
Appetitlosigkeit erwähnte, erschauderte er. Doch
er konnte ihr nichts erzählen … weil … weil
diese Angelegenheit zu traurig für Worte war und
291/346

sich diese besonderen Momente in etwas Schreck-
liches verwandeln würden.
292/346

NEUNUNDSECHZIG
Wenn sich die Nacht über Nantucket legt, kann
es stockdunkel werden, viel dunkler, als es jemals in
New York City wird, besonders bei bedecktem Him
mel. Kein Mond, keine Straßenlaternen, keine
lärmenden Touristen, die durch die gepflasterten
Straßen irren. Jane schlief, während Michael aus
dem Fenster ihres Zimmers im India Street Inn
starrte. In der Dunkelheit konnte er kaum die Nach-
barhäuser erkennen.
Es war unglaublich, dass er Jane wiedergetroffen
und als Frau kennengelernt hatte. Und die Ge-
fühle, die zwischen ihnen wuchsen, das Essen
und die Gespräche, das Lachen, das mitunter
krampfartig aus ihnen hervorbrach. Die nervösen,
zaghaften Küsse, die eher etwas Spielerisches
hatten, und die leidenschaftlichen, in denen sich
ihre Herzen und Seelen miteinander vereinten, um
schließlich miteinander zu schlafen, Jane in der
Nacht stundenlang im Arm zu halten und sich eine
Zukunft für sie beide vorzustellen, die über
Nantucket hinausreichte.
Gegen vier Uhr morgens setzte sich Michael auf
die Bettkante. Während er Jane beobachtete,

versuchte er, sich einen Plan, irgendeine Lösung
auszudenken, nachdem sie auf geheimnisvolle
Weise gespürt haben musste, dass er da war.
»Was ist los, Michael?«, fragte sie leise mit
verschlafener Stimme. »Ist was passiert? Bist du
krank?«
»Nichts, Jane. Ich werde nicht krank, weißt du
nicht mehr? Schlaf weiter. Es ist vier Uhr.«
»Komm, leg dich zu mir. Es ist vier Uhr.«
Also legte sich Michael zu Jane und kuschelte sich
an sie, bis sie wieder eingeschlafen war. Er hielt
Wache über sie, bis seine Augen brannten. Er
würde alles in seiner Macht Stehende tun, um sie
zu retten. Selbst wenn … es das Undenkbare
bedeutete.
Vielleicht war dies die Lösung. Ihm kam eine
Idee, zumindest der Ansatz einer Idee, doch die Lo-
gik hatte etwas Bestechendes. Er war hier, um Jane
aus der Welt zu begleiten – aber was wäre, wenn
er gar nicht da wäre?
Sein Herz zog sich zusammen, sobald er sich
seine finstere, schwarzweiße, Jane-lose Existenz
vorstellte. Doch es wäre die Sache wert, wenn sie
weiterleben könnte. Wenn er sie nicht aus der
Welt
begleitete,
würde
sie
doch
bleiben
müssen, oder?
294/346

Er wusste es nicht, aber in diesem Moment war es
alles, was er aufzubieten hatte.
Während er seine Idee durchdachte, sich viel-
leicht an einen Strohhalm klammerte, begann er,
seine Sachen in seine Leinentasche zu werfen. Dann
schloss er das Fenster, damit Jane nicht fror. Er
blickte sie an und fragte sich: Tue ich das Richtige,
indem ich sie jetzt verlasse?
Wird die Sache funktionieren? Sie muss. Jane
darf jetzt nicht sterben.
Er verkniff es sich, ihr einen Abschiedskuss zu
geben, sie ein letztes Mal zu umarmen, mit ihr zu
reden, ihre Stimme zu hören, weil er sie nicht
wecken wollte. Wie konnte er dies schon wieder tun
– sie verlassen? Vielleicht weil er keine andere
Idee, keine andere Wahl hatte. »Ich liebe dich,
Jane«, flüsterte er. »Ich werde dich immer
lieben.«
Vorsichtig schloss er die Tür hinter sich, eilte
den Flur entlang und die Treppe hinunter. Um halb
sechs würde eine Fähre nach Boston fahren. An
der Rezeption hinterließ er eine Nachricht beim
Nachtportier. »Meine Freundin schläft in Zim-
mer 21. Kann am Morgen jemand nach ihr sehen?
Und ihr sagen, dass ich unerwartet abreisen musste,
295/346

weil … ein Freund krank ist? Sagen Sie auf jeden
Fall, es ist ein Freund. Ein Kind.«
Michael marschierte durch die dunklen, leeren
Straßen von Nantucket. Er fühlte sich allein,
isoliert und hilflos. Er hatte Mühe, Luft zu holen,
was ungewöhnlich war, und seine Beine fühlten
sich unglaublich schwer an. Und auf einmal liefen
Tränen über seine Wangen. Echte Tränen.
Auch eine Neuheit.
Er zog die Windjacke fest um sich und wartete an
der Anlegestelle. Das Boot würde in einer halben
Stunde eintreffen. Am Horizont schimmerte bereits
trübes Sonnenlicht. War dies ein Zeichen der
Hoffung?
Es musste Hoffnung geben, weil Jane nicht ster-
ben durfte. Schon bei dem Gedanken daran
spürte er einen nicht auszuhaltenden Druck auf
seinem Herzen.
Jane darf jetzt nicht sterben.
296/346

SIEBZIG
Am nächsten Morgen wachte ich bereits mit
einem Lächeln auf und streckte mich ausgiebig.
Ich fühlte mich auf glückliche, sichere Art
gesättigt, war aber leicht wacklig auf den Beinen
– aber nicht vom Sex, sondern von der Liebe, die
diesen Sex zu etwas ganz Besonderem machte.
Es ging mir prächtig. Das Sonnenlicht erfüllte
das Zimmer, als wollte die Sonne nur für uns
scheinen. Als ich mich umdrehte, war ich
enttäuscht, Michael nicht neben mir zu sehen.
Dieser kleine, dumme Reisewecker auf dem wackli-
gen Nachttischchen zeigte fünf vor neun an. So
spät schon?
Was hatten Michael und ich für diesen Vormit-
tag überhaupt geplant? Mal sehen. Wir hatten
darüber
geredet,
noch
einmal
in
einen
Antiquitätenladen reinzuschauen. Dort gab es
Schnitzereien
aus
Walzähnen,
die
Michael
gefielen.
Doch zuerst wollten wir in einem Café in der
Stadt frühstücken, wo es leckere Blaubeerp-
fannkuchen gab, auch wenn ich keinen Hunger
hatte. Vielleicht weil ich gerade am Abnehmen war

und dieses Gefühl genoss. Oder, eher wahr-
scheinlich, weil ich verliebt war.
Egal, jedenfalls waren wir spät dran. Jeder Tag,
den wir zusammen verbrachten, konnte nicht lang
genug sein – wir mussten jede Minute nutzen.
Außerdem liebte es Michael, zu essen, weil er nie
ein Gramm zunahm. Echt fies.
Ich wollte gerade aus dem Bett springen, als mir
der Abend zuvor einfiel. Michael hatte über etwas
reden, mir etwas sagen wollen. In der Nacht war ich
aufgewacht, und Michael hatte sich wieder zu mir
gelegt.
Wo steckte er?
»Michael?«, rief ich, bekam aber keine Ant-
wort. »Michael, bist du da? Michael? Mikey?
Mike? Hey – du!«
Ich stieg aus dem Bett, schob mir die Haare aus
dem Gesicht und blickte mich um. Kein Michael. Er
war nirgendwo zu finden.
Auch eine Nachricht entdeckte ich nicht. Ich war
schockiert.
Michael hatte versprochen, mich nie wieder zu
verlassen. Er hatte es versprochen.
Wortlos presste ich die Hand auf meinen Mund.
Das konnte er nicht getan haben.
298/346
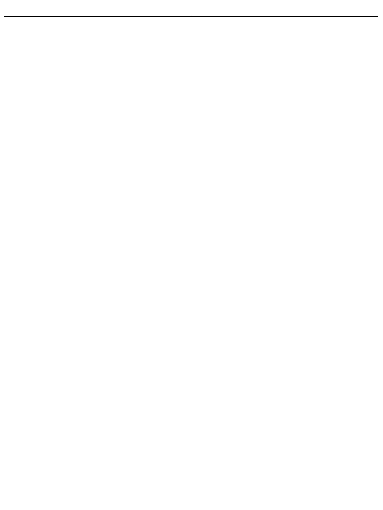
Andererseits wäre dies nicht das erste Ver-
sprechen gewesen, das er gebrochen hatte.
Ich stolperte in mein Zimmer zurück, wo mich
das zerwühlte Bett zu verhöhnen schien. Der
Gedanke, dass mich Michael lieben und trotzdem
verlassen würde, war mir nie in den Sinn gekom-
men. Ich wusste nicht, ob ich mir Sorgen machen
oder wütend sein sollte oder ob mir das Herz
gebrochen war.
»Michael«, flüsterte ich ins leere Zimmer.
»Michael, wie konntest du nur? Liebst du mich
nicht? Du warst der einzige Mensch, der es getan
hat …« O Gott, das war’s, was er mir hatte
sagen wollen, oder? Der Grund, warum er nicht
mehr hatte schlafen können.
Er hatte mich wegen eines anderen Kindes ver-
lassen. Er war für jemand anderes der ima-
ginäre Freund.
Wie eine Wahnsinnige rannte ich durch die
beiden Zimmer. Alles von ihm war weg, auch seine
Reisetasche. Ich riss Schubladen und Schrank-
türen auf – nichts drin, was Michael gehörte.
Kein Anzeichen, dass er hier gewesen war.
Ich blickte aus dem Fenster. Der Tag war strah-
lend schön wie alle anderen auch, die wir in Nan-
tucket verbracht hatten. Ein perfekter Tag, um eine
299/346

Radtour zu machen und Trödel zu kaufen, bei Oz-
zie und Ed zu Mittag zu essen und mit jemandem
zusammen zu sein, den man mehr liebte als das
Leben.
»O Michael«, sagte ich, »wie konntest du
mich nur allein lassen? Zum zweiten Mal?«
Diesmal würde ich ihn nicht vergessen, weil ich
ihm nie würde verzeihen können – dafür,
dass er mir zweimal mein Herz gebrochen hatte.
300/346

EINUNDSIEBZIG
Männer sind Schweine! Selbst die imaginären.
Als ich am selben Tag in New York eintraf,
fühlte ich mich in meiner eigenen Wohnung wie
eine Fremde. Alles sah aus, als gehörte es nicht
mir, sondern jemand anderem. Waren dies meine
Möbel? Hatte ich die Bilder an den Wänden aus-
gewählt? Wer hat sich für diese Vorhänge
entschieden? Ach, Moment. Es gab einen Grund,
warum die Wohnung mir fremd vorkam, als
stünde ich zum Beispiel in Viviennes Wohnung.
Und wer ist das dort im Flurspiegel? Es waren
nicht nur die dunklen Schatten unter meinen Au-
gen, die mich zweifeln ließen. Ich war so dünn!
Ich schleppte mein Reisebündel ins Schlafzim-
mer und setzte mich aufs Bett. Mein getrübter
Blick glitt zum Nachttischchen. Die beiden
Gardenien, die ich von Michael bekommen hatte,
waren weg. Meine Putzfrau musste die verwelkten
Blumen fortgeworfen haben.
Neue Tränen traten in meine Augen – und ich
hatte gedacht, ich hätte mir bereits die Seele aus
dem Leib geheult.

Ach, da ist noch so einiges möglich, Jane-
Herzchen!
Plötzlich wurde mir speiübel. Mein Magen
verkrampfte sich, und ein brennendes Gefühl
breitete sich aus. Ich schaffte es gerade noch ins
Bad, wo ich mich vor die Toilette kniete und die
leckeren Muscheln aus Nantucket von mir gab.
Als die Welle schließlich abebbte und ich mein
Gesicht wusch, zitterten meine Hände noch im-
mer. Ich war blass und etwas grün im Gesicht.
Lebensmittelvergiftung,
genau
das,
was
ich
brauchte.
Als ich mich einigermaßen erholt hatte, hörte
ich meine Nachrichten entgegen jeglicher Hoffnung
ab,
Michael
könnte
angerufen
und
eine
Erklärung hinterlassen haben. Aber die erste Na-
chricht stammte natürlich von meiner Mutter.
»Jane-Herzchen, ich mache mir Sorgen um dich.
Ernsthafte Sorgen. Bitte ruf mich an. Mich, deine
Mutter.«
Und tatsächlich hatte ich plötzlich das
Bedürfnis, Vivienne anzurufen, auch wenn sie
wegen meines Verschwindens einen Schlaganfall
bekommen würde. Eigentlich war ich überras-
cht – das meine ich auch so -, dass sie mir keinen
Detektiv auf den Hals gehetzt hat.
302/346
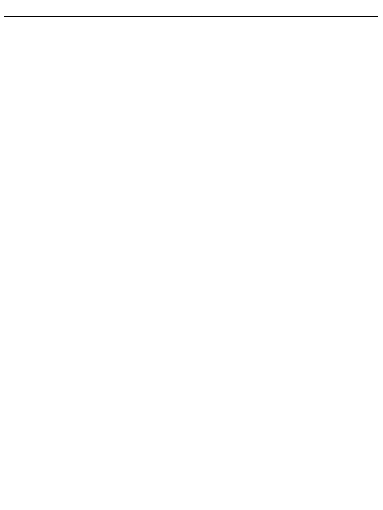
Ich tippte die Kurzwahltaste für Viviennes
Nummer. Es meldete sich keiner ihrer beiden
Hausangestellten,
sondern
nur
der
Anrufbeantworter.
»Hier ist der Anschluss von Vivienne Margaux
…«
Während ich ihrer Ansage lauschte, überlegte
ich, was ich sagen wollte. Dann piepste es.
Doch auf einmal brach ich innerlich zusammen,
und meine wohl überlegten Worte wurden
über Bord geworfen.
»Mama, ich bin’s, Jane. Hör zu. Michael
hat mich verlassen. Bitte ruf mich an. Ich liebe
dich.«
Im Moment brauchte ich unbedingt einen Kuss
von meiner Mutter. Mehr als je zuvor in meinem
Leben.
Danach brachte ich kein Wort mehr heraus, also
drückte ich die Austaste und legte das Telefon
aufs Bett. Wieder begann ich zu schluchzen, aber
auch zu husten, und mein Herz tat mir weh.
Die nächste Welle der Übelkeit ließ sich
nicht unterdrücken. Ich stolperte ins Bad und
übergab mich. Die Übelkeit ließ nach, aber
der Husten blieb. Ich versuchte zu schlucken, was
die Sache nur schlimmer machte. Und wieder
303/346

wurde mir übel, was mir mittlerweile Angst
bereitete. Alles in mir brannte, der Brechreiz plagte
mich, obwohl mein Magen leer war, und mein
Körper war mit kaltem Schweiß überzogen.
Als ich zusammenbrach, landete ich mit dem Kopf
auf der Badezimmermatte. Mir war heiß, und
gleichzeitig zitterte ich vor Kälte. Ich hatte das Ge-
fühl zu sterben. Mehr als mit den Augen zu blin-
zeln brachte ich nicht mehr zustande.
Ich hörte das Telefon im Schlafzimmer klingeln,
glaubte aber nicht, dass ich es schaffen würde,
aufzustehen oder auch nur zu kriechen. Es musste
Vivienne sein. Wie gerne hätte ich mit ihr geredet.
Oder war es Michael?
Mühsam drückte ich mich vom Boden hoch
und taumelte hinüber.
304/346

ZW EIUNDSIEBZIG
Michaels Sorgen und Ängste, sein schlechtes
Gewissen und der Mangel an Schlaf setzten ihm auf
der Fünf-Uhr-dreißig-Fähre von Nantucket
aufs Festland ordentlich zu.
Seine Augen brannten, und sein Pullover mit
Zopfmuster schützte nicht gegen den feuchten,
kühlen Wind vom Atlantik.
Sein fürchterlicher Zustand und seine Verwir-
rung lie ßen auch im Bus zum Flughafen von Bo-
ston und auf der Strecke von Logan nach LaGuardia
nicht nach und wirkten sich seltsam auf seine Se-
hfähigkeit aus. Alles Farbige um ihn herum war
verwaschen oder grau in grau. Erst einige Stunden
zuvor hatte er mit Jane ein paar glückliche Tage
in Nantucket verbracht, die glücklichste Zeit
seines Lebens. Jetzt hatte sich alles geändert.
Â
An seinem Wohnhaus angekommen, schleppte er
sich die Treppe hinauf. Aus Owens Wohnung drang
Gelächter. Die Stimme einer Frau. Eine neue
Eroberung? Mein Gott, was war Jane ihrer Meinung
nach für ihn gewesen? Hatte sie jetzt denselben
Eindruck von ihm wie er von Owen? Natürlich.

Er ließ seine Tasche auf den Boden fallen, doch
er hielt es in seiner Wohnung nicht aus. Jetzt nicht,
nicht in diesem Zustand.
Wenige Minute später eilte er den Broadway
entlang, vorbei an grauen Menschen, grauen Taxis
und den grauen Häusern von New York. Er ver-
misste Jane so sehr, dass der Schmerz in seiner
Brust für ihn etwas Lebensbedrohliches hatte.
Was tat sie gerade? Ging es ihr gut? Hatte sein Plan
funktioniert?
Schließlich hielt er es nicht mehr aus und rief
bei ihr zu Hause an. Nachdem das Telefon
mehrmals geklingelt hatte, hörte er Janes Stimme:
»Hier ist Jane. Hinterlassen Sie bitte eine Na-
chricht, wenn sie wichtig für mich ist. Danke.«
Wie er diese Stimme liebte!
In der Nähe des Lincoln Center wurde er bei-
nahe von einem Motorrad angefahren, das rechts
abbog. »Wach auf, du Arschloch!«, rief der Fahr-
er. Guter Tipp. Gerne wäre er aus diesem schreck-
lichen Albtraum aufgewacht.
Er ging noch einen Block weiter, weil er sich be-
wegen wollte, bis es ihm plötzlich bewusst wurde:
Ich habe ein Ziel, ich gehe an einen bestimmten
Ort!
Aber wohin?
306/346

Offenbar Richtung Nordosten.
Endlich merkte er, dass ihn eine äußere Kraft
lenkte. Und plötzlich wusste er es oder glaubte es
zumindest.
Er rannte los.
Seine Augen füllten sich mit Tränen, die nicht
mehr versiegen wollten. Menschen starrten ihn an
und boten ihre Hilfe an. Er rannte einfach weiter. Er
kannte das Ziel.
Das New York Hospital.
Und er wusste, was ihn dort erwartete.
»O Gott, Jane! Das darf nicht geschehen!«
Ich wünschte, ich hätte Jane mehr geküsst
und umarmt, dachte er.
Ich wünschte, ich wäre in Nantucket
geblieben.
Ich wünschte …
307/346

DREIUNDSIEBZIG
Endlich, die York Avenue Ecke 68th Street. Michael
war fast da.
Er preschte durch die Eingangstür des New
York Hospital. Ironie des Schicksals: Hier war er
schon einmal gewesen, als sich Jane als Kind die
Mandeln hatte herausnehmen lassen müssen.
Er wusste, wo sich die Fahrstühle befanden,
weswegen er am Empfangsschalter vorbeilief.
Den Flur entlang nach rechts.
Er musste in den siebten Stock.
Zimmer 703.
Vor ihm strömten Menschen in den Fahrstuhl.
Zwei Krankenschwestern, die Händchen hielten,
ein Arzt, ein paar Besucher, ein kleines Mädchen,
das um seinen Großvater weinte. Warum gab es
all dieses Leiden auf der Welt? Immer mehr Fragen
drängten sich ihm auf.
»Ich glaube nicht, dass noch jemand rein-
passt.« Der Arzt wollte ihn aufhalten.
»Doch, doch, das geht«, widersprach Michael.
»Sie wären überrascht, wozu wir fähig
sind.«
»Wir«, hatte er gesagt. Wir.

Die Menschen im Fahrstuhl blickten sich an, als
wollten sie sagen: Wir haben einen Verrückten an
Bord.
Schließlich schlossen sich die Türen, und der
Fahrstuhl bewegte sich nach oben.
»Ich hätte sie nicht verlassen dürfen«,
murmelte Michael. Ich hätte in jedem Fall bei
Jane bleiben müssen. Und jetzt? Sein verrück-
ter Plan hatte nicht funktioniert. Er hatte ihr
grundlos Schmerzen bereitet. Wie dumm er
gewesen war!
Endlich hielt der Fahrstuhl im siebten Stock. Mi-
chael verließ ihn als Erster, rannte an der Sch-
westernstation vorbei und blieb vor Zimmer 703
stehen.
Die Tür stand einen Spaltbreit offen. Er strich
sein verschwitztes Haar nach hinten und wischte
sich das Gesicht am Hemdsärmel ab. Er musste
gelassen, gefasst wirken, obwohl er sich wie ein
Häufchen Elend vorkam. Er hatte das Gefühl,
sein Herz würde platzen. Schon vorher hatte er
diesen Druck in seiner Brust gespürt, und jetzt
war er stärker geworden.
Schließlich öffnete er die Tür und ließ
seinen Blick durchs Zimmer wandern. Eine
309/346

Krankenschwester saß neben dem Bett und beo-
bachtete einen Herzmonitor.
Was er dann sah, ließ seinen Atem stocken. Er
hob die Hand an seinen Mund, dennoch stieß er
laut die Luft aus.
Das hatte er nicht erwartet. Das als Letztes. Aber
damit ergab alles einen Sinn, was passiert war. Es
hatte doch einen Plan gegeben.
310/346

VIERUNDSIEBZIG
Jemand anderes lag in dem Krankenhausbett.
Nicht Jane. Nicht der Mensch, den er dort erwar-
tet hatte und um den es ihm so leidgetan hätte.
Es war Vivienne.
Die Puzzleteile, die er vorher nicht hatte
zuordnen können, rutschten wie von allein an die
richtige Stelle. Es war Vivienne, die sterben musste.
Um ihr zu helfen, hatte er zurückkommen
müssen.
Reglos lag sie da. So hatte er sie noch nie gesehen.
Ihr Gesicht unter der gebräunten Haut war un-
natürlich blass, und sie war nicht geschminkt.
Der weiße Ansatz ihres offenen Haars war zu
erkennen. Doch auf eine Art sah sie gelassen und
schön aus. Sie ähnelte stark Jane, an die er mit
Schmerzen dachte. Er würde gerne helfen, wenn
er könnte. Beiden.
»Vivienne«,
sagte
er,
und
zur
Krankenschwester: »Ich gehöre zur Familie.
Kann ich kurz mit ihr allein sein?«
Die Krankenschwester erhob sich lächelnd.
»Ich warte gleich draußen. Sie wissen ja, dass sie
einen Schlaganfall hatte.«

Vivienne öffnete die Augen und blickte ihn an,
schloss sie aber kurz wieder, als müsste sie
überlegen, was los war.
»Vivienne«, sagte er leise. »Ich bin hier, um
Ihnen zu helfen. Ich bin Michael.«
Sie öffnete ihre Augen, deren Blau noch immer
bestechend war. »Michael?«, fragte sie mit einer
sanften Stimme, wie er sie noch nie von ihr gehört
hatte. »Janes Michael?«
»Ja, Janes Michael.« Er nahm ihre Hand.
»Ich wünschte, Sie könnten sehen, wie wun-
derschön Sie sind. Sie sehen aus, wie Sie immer
aussehen wollten. Wunderschön.«
»In meiner Handtasche ist ein Spiegel«, sagte
sie.
Michael holte ihn und hielt ihn Vivienne vors
Gesicht. Er hatte sie nie so verletzlich erlebt, wie ein
Kind, das sich endlich nach draußen traute.
»Ich habe schon besser ausgesehen. Und
schlimmer vermutlich auch. Spielt aber jetzt keine
Rolle mehr.«
»Doch, das tut es«, widersprach Michael.
»Gut auszusehen ist die beste Rache.«
Lächelnd legte sie ihre Hand auf seine. »Wo
ist meine Tochter? Ist Jane hier?«, fragte sie.
312/346

»Ich kann nicht gehen, ohne mein Jane-Herzchen
noch mal gesehen zu haben.«
313/346

FÃœNFUNDSIEBZIG
Was wäre gewesen, wenn ich es nicht geschafft
hätte, ans Telefon zu gehen und mir die
schluchzende MaryLouise nicht völlig unzusam-
menhängend erzählt hätte, dass ich so schnell
wie möglich rüber ins New York Hospital gehen
sollte? Nachdem ich aufgelegt hatte, hatte ich das
Gefühl, neben mir zu stehen. Noch immer ging es
mir schlecht, aber mir war weniger übel. Nur ein
bisschen schwindlig im Kopf und etwas wacklig auf
den Beinen. Ich zog mich um, und während ich
zur Eingangshalle rannte und Martin, den Portier,
bat, ein Taxi zu rufen, dachte ich wieder, ich
würde eine andere Frau beobachten.
Aber ich war es, die vor dem New York Hospital
aus dem Taxi ausstieg und zur Information rannte
und erfuhr, dass Vivienne Margaux in Zimmer 703
lag.
MaryLouise wartete vor der geschlossenen Tür.
Sie küsste mich auf die Wange und schüttelte
den Kopf. Karl Friedkin stand ein Stück weiter
entfernt auf dem Flur, den Kopf schmerzvoll gesen-
kt. »Karl war bei ihr, als es passierte«, erklärte
MaryLouise.

In dem Moment wurde die Tür geöffnet, und
eine Frau in weißer Uniform fragte mich, ob ich
Jane sei. Sie stellte sich als die Neurologin meiner
Mutter vor. »Ihre Mutter hatte einen Schlagan-
fall«, erklärte sie vorsichtig. »Es ist gestern
Abend im Theater passiert. Sie hat nach Ihnen ge-
fragt.«
Ich nickte und versuchte, nicht zu weinen, son-
dern tapfer zu sein, so wie Vivienne es sicher von
mir erwartete. Doch als ich das Zimmer betrat, zit-
terte ich am ganzen Körper.
Mutter lag dort. Sie war blass, wirkte sehr klein
und ganz und gar nicht wie sie selbst.
Neben ihr stand Michael und hielt ihre Hand.
315/346

SECHSUNDSIEBZIG
Michael blickte mich an und nickte mir kaum merk-
lich zu, bevor er den Mund zu einem verständnis-
vollen Lächeln verzog. »Hallo«, flüsterte er.
»Komm, setz dich auf meinen Stuhl.«
Ich nahm neben Viviennes Bett Platz. »Hallo,
Mutter, ich bin’s, Jane, ich bin da.«
Meine Mutter drehte den Kopf und blickte mir in
die Augen. Sie atmete schwer. Ich dachte, sie ver-
suchte zu sprechen, brachte aber kein Wort heraus,
was vorher noch nie passiert war. Sie war nicht
geschminkt, und ihre Haare waren unordentlich.
Als ich ihr gewöhnliches Krankenhaushemd be-
merkte, wurde mir klar, wie schlecht es um sie
stand. Wäre sie auch nur annähernd sie selbst
gewesen, hätte sie sich gegen dieses Ding gewehrt.
Doch sie schien froh zu sein, mich zu sehen.
Ich beugte mich näher zu ihr. »Was ist, Mut-
ter? Was willst du sagen?«
»Ich war hart zu dir, Jane-Herzchen«, begann
sie schließlich mit leiser, sanfter Stimme. »Das
weiß ich.« Dann begann sie zu weinen. »Es tut
mir leid. Es tut mir so leid.«

»Es ist in Ordnung. Es ist alles in Ordnung«,
beruhigte ich sie.
»Aber das habe ich getan, damit du stark wirst.
Damit du nicht so wirst wie ich. So kalt und hart
und überheblich. So Vivienne Margaux. Das
wäre doch furchtbar gewesen.«
»Bitte sag nichts. Halte nur meine Hand,
Mama.«
Sie lächelte. »Ich mag es, wenn du Mama zu
mir sagst.« Sie hatte mir gesagt, sie hasse es. Sie
nahm meine Hand und drückte sie. »Gott sei
Dank, bist du auch nicht annähernd so wie ich,
Jane-Herzchen. Du bist einfach nur klug. Deswegen
wirst du noch erfolgreicher werden. Aber du wirst
dabei immer freundlich bleiben. Du wirst Jane sein.
Du tust die Dinge auf deine Art.«
Dieses Eingeständnis entlockte mir die Trän-
en, die ich seit Jahren zurückgehalten hatte.
»Ich dachte, ich wäre die reinste Enttäuschung
für dich, weil ich nicht so war wie du.«
»Oh, Jane-Herzchen. Nein, nein, nein. Nie. Soll
ich dir was sagen?«
»Was?«
»Du bist der einzige Mensch, den ich je geliebt
habe, der einzige. Du bist die Liebe meines
Lebens.«
317/346
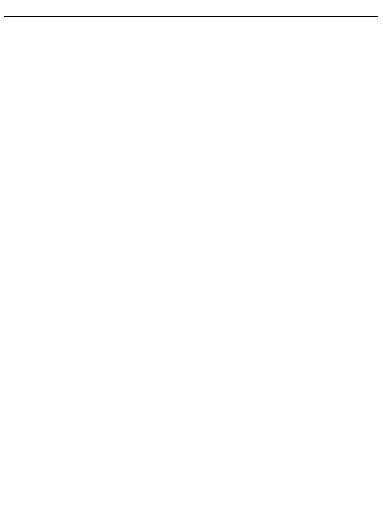
Die Liebe ihres Lebens.
Meine Augen brannten von den Tränen, meine
Kehle und mein Brustkorb taten weh, doch meine
Mutter strahlte Frieden aus. Und dann dachte ich:
Das war’s jetzt? Nach all den Jahren, in denen
sie Bühnenarbeiter und Sekretärinnen anges-
chrien und mit Investoren gekämpft hatte? Nach
all den Jahren, in denen sie Hausmädchen,
Chauffeure, Catering-Lieferanten und Dekorateure
herumkommandiert hatte? Nach den Schränken
voller
Designerkleidern
und
Tausend-Dollar-
Schuhen? Nach all den Reisen nach Paris, London,
Bangkok und Kairo? So endet also dieses Leben –
eine zerbrechliche Frau in einem Krankenhausbett.
Meine Mutter und ich. Am Ende vereint.
»Komm näher, Jane-Herzchen«, bat sie.
»Ich werde nicht beißen.« Sie grinste matt.
»Wahrscheinlich nicht.«
Unsere Gesichter berührten sich beinahe.
»Ich muss dich noch um einen Gefallen bit-
ten.«
»Natürlich,
Mutt…
–
Mama.
Was
möchtest du?«
»Sorge, um alles auf der Welt, dafür, dass sie
mich … in diesem neuen Galliano-Brokatkleid
318/346

beerdigen. Nichts Schwarzes. Ich sehe furchtbar aus
in Schwarz.«
Ich musste lächeln. Bis zum Ende blieb sie Vivi-
enne, immer ehrlich sich selbst gegenüber.
»Das
Galliano«,
bestätigte
ich.
»Wird
erledigt.«
»Und noch eins, Jane.«
»Ja?«
»Zieh auf der Beerdigung auch nichts Schwarzes
an. Schwarz lässt die meisten Menschen dünner
wirken. Aber aus unerfindlichen Gründen siehst
du in Schwarz aus, als hättest du eine riesige
Oberweite.«
Mein Lächeln wurde noch breiter. »Okay,
Mama. Ich werde Rosa tragen. Ich habe nur dieses
eine Kleid.«
»Du bist lustig«, sagte meine Mutter. »Das
warst du immer. Rosa auf einer Beerdigung. Bitte,
mach das.«
Ich blickte hinüber zu Michael, der ebenfalls
lächelte.
Meine Mutter schloss die Augen. Ihr Körper er-
schauderte. Ich hasste es, sie zu verlieren. Meine
Mama. Endlich war sie meine Mama.
319/346

Michael ging um das Bett herum und ergriff ihre
andere Hand. Tja, das war’s. Es ging alles viel
zu schnell.
Ich beugte mich zu Vivienne und gab ihr einen
sanften Kuss auf die Wange. Lächelnd öffnete sie
die Augen noch einmal. Mit einem leichten Nicken
bedeutete sie mir, wieder näher zu kommen.
»Jane, das Einzige, was mir am Sterben miss-
fällt, ist, mich von dir verabschieden zu
müssen. Ich liebe dich so sehr. Mach’s gut,
Jane-Herzchen.«
»Mach’s gut, Mama. Ich liebe dich auch.«
Dann gab mir meine Mutter einen letzten Kuss,
der mich immer an sie erinnern würde.
320/346

SIEBENUNDSIEBZIG
Wie es sich Vivienne gewünscht hatte, wurde sie
in ihrem Galliano-Kleid beerdigt. Sie sah wunder-
schön aus. Eigentlich war die gesamte Beerdigung
phantastisch und ergreifend. Klar, Vivienne hatte
alles bis ins kleinste Detail geplant.
Ich trug Rosa. Yves-Saint-Laurent-Rosa.
Die Trauerfeier fand natürlich auf der Park Av-
enue in der St. Bartholomew’s Church statt.
Zwei Pianisten gaben einen makellosen Brahms
zum Besten, als hätte Vivienne über ihnen ge-
wacht. Anschlie ßend spielte ein Solist die Melodi-
en aus mehreren Musicals, die meine Mutter
produziert hatte. Ein paarmal sangen die Trauer-
gäste einfach mit.
Am Ende der Trauerfeier an diesem sehr warmen
Frühlingstag erhoben wir uns und sangen das
Lieblingslied meiner Mutter: »Jingle Bells«. Das
war allerdings so un-Vivienne, dass es schon wieder
perfekt war. Wie sie es erwartet hätte. Ich war
glücklich für sie. Meine Mutter hatte einen let-
zten Hit produziert.
»Haben nur noch die Cocktails gefehlt, dann
wäre
es
eine
Vivienne-Margaux-

Wiedersehensfeier gewesen«, bemerkte Michael
draußen auf dem Weg zu den Limousinen.
»Mir hat es sehr gefallen.« Ich umarmte ihn.
»Weil es ihr gefallen hätte.«
Jeder, der etwas darstellte oder dies zumindest
glaubte, war gekommen. Nicht nur Elsie und
MaryLouise und die anderen Leute aus dem
Büro, sondern sehr berühmte Schauspieler,
Regisseure
und
Choreographen,
dazu
die
Bühnenarbeiter, Requisiteure und Maskenbild-
ner. Alle waren sie da, um meine Mutter und ihre
Leistungen zu ehren. Ja, sie hatte viel geleistet,
unter anderem mich erzogen, damit ich so bin, wie
ich bin.
Mein Vater war mit seiner Frau Ellie gekommen,
die im Alter von achtundvierzig Jahren endlich äl-
ter aussah als dreißig. Oder vielleicht hatte sie sich
nur wegen meiner Mutter entsprechend angezogen.
Howard,
mein
Stiefvater,
war
gekommen.
Nüchtern. Er erzählte, er habe nie aufgehört,
Vivienne zu lieben. »Ich auch nicht, Howard. Ich
auch nicht«, sagte ich und nahm ihn in den Arm.
Der alte Friseur meiner Mutter, der mit dem Solo-
Namen Jason, war erschienen. Wie Vivienne war er
ein Zeugnis für die perfekte plastische Chirurgie.
Und er hatte meiner Mutter einen letzten Gefallen
322/346

erwiesen. Er war von Palm Springs nach New York
geflogen, nur um ihr die Haare zu richten.
Selbst Hugh McGrath tauchte auf. Er schüttelte
meine Hand, umarmte mich, als wäre ich seine
Exfrau, und sagte, wie leid ihm alles tue. Beinahe
glaubte ich ihm, bis ich mich daran erinnerte, dass
er Schauspieler war. Und ein Schwein.
Die Fortsetzung der Feierlichkeiten auf einem
Friedhof in Westchester County war ergreifend und
kurz. Auch das entsprach Viviennes genauen An-
weisungen. Der Pfarrer erinnerte uns daran, dass
das Leben viel zu kurz ist und wir für eine andere
Welt jenseits dieser bestimmt sind. Er habe keinen
Zweifel, dass Vivienne im Himmel ihre Shows
produziere. Gut gesagt, aber dann reichte es auch.
Ich legte eine einzelne Rose auf den Sarg meiner
Mutter. Das entsprach meinem Stil. Ich betete,
meine Mutter möge in Frieden ruhen und, falls sie
von oben zuschaute, dass alles so war, wie sie es
hatte haben wollen. Ich trage Rosa, Mama!
Schließlich ergriff Michael meine Hand, und wir
gingen los.
»Wir müssen reden«, sagte er. Ein Schaud-
er lief über meinen Rücken.
323/346

ACHTUNDSIEBZIG
Die warme Sonne beleuchtete den Friedhof wie eine
Bühne.
Das
Grün
der
Bäume,
die
leuchtenden Farben der Blumen, alles schien zu
knistern und zu vibrieren. Warum also zitterte ich?
»Wunderbarer Tag«, sagte ich.
Michael lächelte. »Selbst der liebe Gott will es
sich mit Vivienne nicht verscherzen.« Er hatte
seine Krawatte gelockert und die Jacke ausgezogen,
über die Schulter gehängt und einen Finger in
die Schlaufe gehakt. Sehr Michael, der immer er
selbst war.
»Jetzt wissen wir also, warum ich nach New
York geschickt wurde«, begann er. »Und warum
ich diese Ahnungen zum New York Hospital und zu
dem ganzen Rest hatte.«
Ich nickte, ohne ein Wort zu sagen.
»Ich war hier, um deiner Mutter zu helfen.
Dessen bin ich mir fast sicher.«
Ich blieb stehen und blickte ihn an.
»Aber du bist immer noch hier.«
Er lächelte. »Ja, anscheinend. Sofern ich nicht
wirklich dein imaginärer Freund bin, wäre das
möglich.«
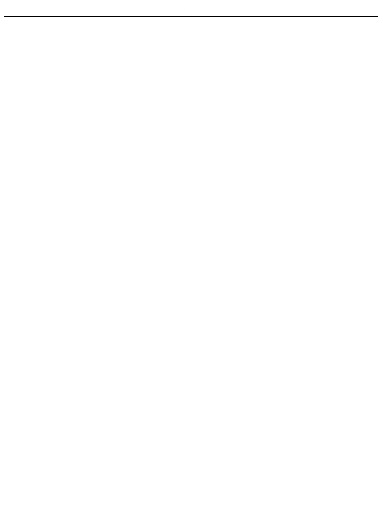
Ich boxte ihm in den Bauch.
»Spürst du das?«
»Aua, ja. Und mittlerweile schneide ich mich
ziemlich regelmäßig beim Rasieren.«
Es entstand eine Pause. Michael blinzelte mit
seinen grünen Augen in die grelle Sonne.
»Ich denke, ich bin hier, weil ich hier sein will.
Und weil du der einzige Mensch bist, den ich je
geliebt habe. Ich bin hier, weil ich es nicht ausgehal-
ten habe, dich zu verlassen, Jane.«
Überwältigt drehte ich mich zu ihm und
küsste ihn zärtlich.
»Ich habe aber noch Fragen, auf die ich eine
Antwort möchte«, verlangte ich.
»Ich weiß nicht, ob ich Antworten habe. Aber
ich werde es versuchen.«
»Also gut. Fangen wir mit was Schwierigem an.
Hast du je … äh … zu Gott gesprochen?«
Michael nickte. »Ja, natürlich. Ganz oft.
Leider hat er oder sie oder wer auch immer nie mit
mir gesprochen. Nächste Frage.«
»Dann glaubst du an …?«
»Hm, wie soll man all das« – er blickte sich
um – »sonst erklären? Oder mich? Oder uns?
Oder die Snocones, Pokemon, die Simpsons, das
amerikanische Rechtssystem oder iPods?«
325/346

»Ich verstehe. Dann bist du ein Engel?«
»Manchmal. Aber ab und zu bin ich eine Art
frecher Bengel.« Er grinste und blinzelte mich an.
»Ich versuche nur, ehrlich zu sein.«
Ich stampfte mit dem Fuß auf. Ich brauchte eine
Antwort. »Bist du ein Engel, Michael?«
Er blickte mir tief in die Augen. »Ich weiß es
ehrlich nicht, Jane. Ich vermute, ich bin wie alle an-
deren. Ich habe keine Ahnung.« Er nahm mich
wieder in seine Arme. »Schau mich an, spüre
mich«, flüsterte er. »Wir haben es bis hierher
geschafft.«
Wir gingen weiter.
»Michael, ich muss dich noch was fragen. Eine
Sache, die mich wirklich beunruhigt. Wirst du im-
mer so aussehen wie jetzt?«
»Ausgesprochen hübsch, salopp und un-
gekämmt?«
»Das trifft’s ziemlich gut.«
»Du meinst, ob ich jemals älter werde?«
»Ja.«
»Ich weiß es ehrlich nicht.«
»Du musst mir versprechen, dass wir nicht nur
zusammen älter werden, sondern dass wir auch
äußerlich gemeinsam altern. Das würde mir
viel bedeuten.«
326/346

»Ich werde mein Bestes tun, um Runzeln und
einen Buckel zu bekommen, und ich werde einen
großen, schwarzen Buick fahren.«
»Danke«, sagte ich. »Ich verpflichte mich, es
dir gleichzutun. Und wie steht’s mit Geld? Wie
wirst du an Geld herankommen?«
»Das ist einfach.« Michael schnippte mit den
Fingern.
Nichts passierte. Er runzelte die Stirn und
schnippte noch einmal.
»Eigenartig«, murmelte er. Immer wieder
schnippte er, aber nichts passierte. »Das ist ja
beängstigend. Normalerweise komme ich so an
mein Geld. Und an ein Taxi, wenn es regnet.«
Er versuchte es noch einmal.
»Nichts. Mich beim Rasieren zu schneiden ist
eine Sache. O je, ich muss mir Arbeit suchen. Viel-
leicht als Boxer.«
Ich versetzte ihm wieder einen Stoß in seinen
Bauch.
»Vielleicht doch nicht als Boxer.«
Schließlich stellte ich die schwierigste Frage, die
mir am meisten Angst machte. »Wirst du bei mir
bleiben, Michael? Oder wirst du mich wieder ver-
lassen? Sag es mir. Ich möchte es ein für alle
Mal wissen.«
327/346

NEUNUNDSIEBZIG
Michael verdrehte die Augen, was mir ein etwas
besseres Gefühl gab. Dann verzog er sein Gesicht
zu einer Grimasse, und er legte die Hand auf seine
Brust. »Jane«, sagte er verwirrt. »Jane.«
Plötzlich brach er auf dem Gehweg zusammen.
»Michael!« Ich sank neben ihm auf die Knie.
»Michael, was ist los? Was ist denn? Michael!«
»Schmerzen … in meiner Brust«, brachte er
heraus.
Ich rief um Hilfe, und zum Glück befanden sich
noch einige Trauergäste in der Nähe, die sofort
herbeigerannt kamen. »Die 911! Schnell«, rief
ich. »Ich glaube, er hat einen Herzanfall. Bitte,
rufen Sie die 911 an!«
Ich blickte wieder zu Michael. Er war blass im
Gesicht und schwitzte stark. Ich lockerte seine
Krawatte und öffnete den obersten Knopf seines
Hemdes, der absprang und auf dem Gehweg
landete.
Wie konnte das hier nur passieren? Ausgerechnet
jetzt? Ich drohte, durchzudrehen und hysterisch zu
werden, versuchte aber, mich zusammenzureißen.
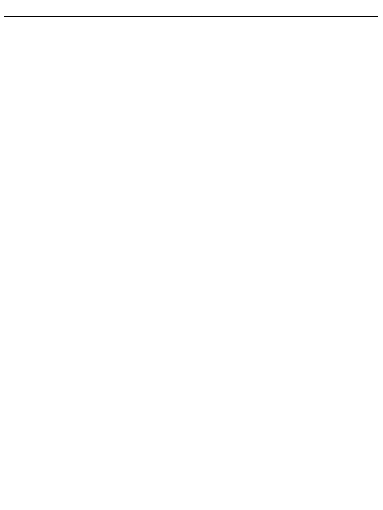
»Michael, es kommt gleich Hilfe. Ein Kranken-
wagen. Halte durch, ja?«
»Jane«, flüsterte er.
»Bitte, nicht sprechen.«
Michael war leichenblass, und er sah unglaublich
krank aus. Alles war so plötzlich geschehen, wie
aus dem Nichts heraus.
»Wir haben die 911 angerufen«, sagte ein
Mann in schwarzem Anzug, den ich als jemanden
vom Beerdigungsinstitut erkannte. »Sie sind
schon auf dem Weg. Versuchen Sie sich zu
entspannen, Sir. Es ist besser, wenn Sie nicht re-
den.«
»Jane«, wiederholte Michael irgendwie ver-
träumt. »Du hast freundliche Augen.«
Ich beugte mich nah zu ihm hinunter. »Bitte,
Michael, pst.«
Michael schüttelte den Kopf, und ich dachte
schon, er wollte sich aufrichten.
Aber er blieb liegen. »Lass mich reden. Ich muss
dir ein paar Dinge sagen.«
Ich ergriff Michaels Hand und beugte mich
wieder nach unten. Um uns herum hatten sich ein-
ige Menschen versammelt, doch für mich gab es
nur uns beide dort auf dem Boden. Nur uns beide,
wie immer.
329/346

»Jahrelang habe ich gebetet, dich als Erwach-
sene wiederzusehen«, flüsterte er mit rauer
Stimme. »Ich habe gebetet, dass das hier passiert,
Jane. Ich habe viel darüber nachgedacht, habe
mir gewünscht, dass es passiert. Und dann ist es
passiert. Jemand hat mich erhört. Ist das nicht
wunderbar?«
»Pst«, machte ich. Tränen traten in meine
Augen. Doch Michael wollte nicht schweigen.
»Du bist etwas Besonderes, Jane. Ist dir das
klar? Ja? Ich muss wissen, dass du das verstehst.«
»Ja.« Ich nickte und sagte, was er hören
wollte. »Ich habe dich verstanden. Ich bin was
Besonderes.«
Als Michael lächelte, sah er kurz wieder aus wie
er selbst. Sein Lächeln war unglaublich, es war
warm und freundlich und zärtlich. Ein Lächeln,
das mich schon als Kind berührt hatte.
»Ich hatte keine Ahnung, wie sehr ich dich
lieben würde … und wie schön es werden
würde«, fuhr er fort.
Er drückte fest meine Hand. »Ich liebe dich,
Jane. Ich liebe dich. Ich weiß, das habe ich schon
gesagt, aber ich wollte es noch mal sagen. Ich liebe
dich.« Tränen traten in seine Augen. »Das
330/346

fühlt sich gar nicht so schlecht an«, stellte er
mit einem komischen Lächeln fest.
Dann schlossen sich seine Augen.
331/346
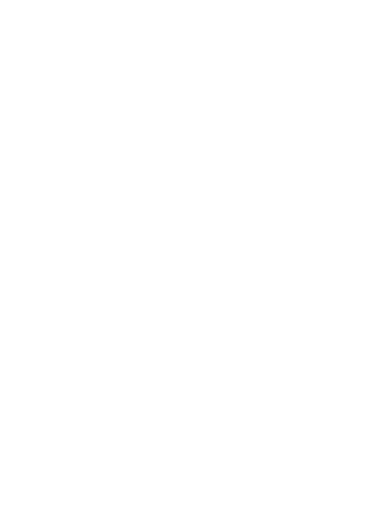
ACHTZIG
Das, was anschließend passierte, war so unmög-
lich, dass es hätte gar nicht passieren können,
weil es noch verrückter war als das, was bereits
passiert war.
Ein Krankenwagen brachte Michael ins Northern
Westchester Hospital, dicht gefolgt von einem Pol-
izeiwagen, in dem ich saß. Ein sehr freundlicher
Arzt namens John Rodman erzählte, bei Michael
seien vier zum Herzen führende Arterien ver-
stopft, weswegen diese sofort geweitet werden
müssten. Auch eine Herzoperation stünde zur
Debatte. Ich sollte dem Arzt Dinge über Michael
erzählen, die ich nicht wusste, zum Beispiel, wie
alt er sei und ob er schon früher Herzprobleme
gehabt habe.
Dann war der Arzt fort, und ich saß allein im
Wartezimmer. Bald traten weitere Besucher ein, die
genauso nervös und beunruhigt wirkten, wie ich es
war.
Jetzt wird die Sache wirklich seltsam.
Eine der Frauen – blondes Haar, Mitte
dreißig, sehr liebenswürdig, wie man gleich

bemerkte – erhob sich, holte sich einen Becher
Wasser und kam zu mir.
»Darf ich mich setzen?«, fragte sie. Ich nickte
benommen, woraufhin sie sich setzte. »Ich bin
eine Freundin von Michael«, erklärte sie. Ich
zuckte mit dem Kopf nach oben und blickte in ihr
freundliches Gesicht. »Wir alle sind Freunde.«
Sie deutete zu den anderen im Wartezimmer, die zu
mir herüberblickten und herzlich nickten. »Wir
sind diese Art Freunde. Imaginär!«
»Oh.« Ich war einen Moment sprachlos,
blickte die anderen der Reihe nach an und dann
wieder zu der Frau. »Ich bin Jane.«
»Ja, ich weiß. Wir alle mögen Michael sehr.
Wie geht’s ihm? Weißt du, was los ist?«
»Vier Arterien sind verstopft«, antwortete ich.
Die Frau schüttelte den Kopf. »Das ist …
sehr seltsam. Ich bin übrigens Blythe.«
»Wenn man bedenkt, was er gegessen hat, ist
das nicht seltsam«, erwiderte ich bitter.
»Aber, Jane, wir werden nicht krank«,
erklärte sie. »Niemand von uns. Nie. Deswegen
ist das seltsam. Hier geschieht etwas völlig Uner-
wartetes, etwas Ungewöhnliches.«
333/346

Ich dachte über unsere unglückselige
Liebesgeschichte nach und schüttelte den Kopf.
»Du hast ja keine Ahnung.«
Blythe ergriff meine Hände. Sie war so lieb und
schon jetzt eine perfekte Freundin für mich.
»Doch, habe ich. Michael hat uns von dir erzählt.
Er hat nie aufgehört, von dir zu erzählen. Wir
sind alle damit einverstanden, auch wenn er unsere
Zustimmung nicht braucht. Wir haben Michael
noch nie so glücklich gesehen. Wir mögen dich,
Jane.«
So saßen Blythe, meine neue imaginäre Fre-
undin, und ich nebeneinander und warteten ver-
ängstigt auf Nachrichten. Endlich betrat Dr. Rod-
man das Wartezimmer und kam auf mich zu. Sein
Gesicht war undurchdringlich, doch er lächelte
nicht. Mein Herz zog sich zusammen, und meine
Kehle wurde trocken.
Verzweifelt drehte ich mich zu Blythe, die jedoch
mit dem Kopf schüttelte. »Der Arzt kann uns
nicht sehen.«
Ach ja, klar. Natürlich nicht. Ich bin der einzige
verrückte Mensch hier, der imaginäre Freunde
hat. Als Zweiunddreißigjährige.
»Jane«, sagte Dr. Rodman. »Die Sache ist et-
was seltsam. Kommen Sie bitte mit.«
334/346

EINUNDACHTZIG
Michael blickte Jane entgegen, als sie mit seinem
Arzt den Aufwachraum betrat. Das war wieder eine
Neuheit – sein Arzt. Michael war nie in seinem
Leben krank gewesen, war nie von einem Arzt un-
tersucht worden und hatte mit Sicherheit nie sein
Herz behandeln lassen. Ach, und noch eins: Noch
nie zuvor hatte er solche Angst gehabt.
Nicht deswegen, dass er sterben könnte. Damit
hatte er mehr oder weniger kein Problem. In dieser
Angelegenheit war er eher verhalten optimistisch.
Doch er hatte Jane wiedergefunden und wollte sie
aus keinem Grund der Welt mehr verlieren.
Niemals.
»Hi«, grüßte sie mit einem schwachen
Lächeln. Er bewunderte den Klang ihrer Stimme.
»Hi. Ich muss aussehen, als wäre ich von
einem Laster angefahren worden. So fühle ich
mich jedenfalls.«
»Du siehst phantastisch aus. Für jemanden,
der von einem Laster angefahren wurde.«
Der Arzt klopfte Jane auf die Schulter und ver-
ließ das Zimmer. Jane trat an Michaels Bett,
beugte sich hinab und küsste ihn auf die Stirn

– und plötzlich erinnerte er sich, dass er genau
dasselbe getan hatte, als sie acht Jahre alt gewesen
war.
»Wir sind auf derselben Wellenlänge, Michael.
Natürlich erinnere ich mich«, sagte Jane
lächelnd. »Ich habe dir gesagt, ich würde dich
nie vergessen.«
Sie verschränkten ihre Hände ineinander.
»Dein Arzt war leicht schockiert, weil du so
schnell aus der Narkose aufgewacht bist. Eigentlich
viel zu schnell.«
Michael zuckte mit den Schultern. »Weiß
nicht, warum. Aber was ist mit mir passiert?«
Als Jane erneut lächelte, ging es Michael schon
viel besser. »Was mit dir passiert ist? Viel zu fettes
Essen, viel zu viel Junkfood. Nur Gott weiß, seit
wann schon. Und das meine ich so, wie ich es sage.
Aber es gibt auch gute Nachrichten.«
»Ich höre.«
»Du hast ein Herz, Michael. Du hättest ster-
ben können. Du bist ein Mensch, Michael. Ein
Mensch.« Ihr Gesicht strahlte vor Freude.
»Habe ich das richtig verstanden?«, fragte Mi-
chael. »Der Knüller am Menschsein ist, dass
man stirbt?«
336/346

»Leben und sterben«, bestätigte Jane. »Ja,
darum geht’s so ungefähr. Das ist der
Knüller am Leben.«
Dann begannen Michael und Jane zu weinen und
klammerten sich aneinander.
»Das, was heute passiert ist, ist wirklich ein
Wunder«, brachte Michael schließlich heraus.
337/346

ZW EIUNDACHTZIG
A propos Wunder, wie wär’s mit diesem hier:
Nur weil das Leben hart ist und immer böse en-
det, heißt das nicht, dass dies auch für alle
Geschichten gilt, selbst wenn man das in der Schule
oder in Buchbesprechungen ständig gesagt
bekommt. Eigentlich ist es gut so, dass Geschichten
so unterschiedlich sind wie wir.
Und unsere Geschichte endet glücklich.
Riesige Scheinwerfer erleuchten den nächt-
lichen Himmel über New York, ein Zeichen, dass
es um eine wirklich große Sache geht. Menschen
wedeln mit Stiften und Papier, verlangen schreiend
Autogramme von den Schauspielern. Die Polizei
hält die Menge auf der Sixth Avenue und 54th
Street zurück. Der Andrang ist ziemlich einmalig.
Mein Magen ist verkrampft, ich lächle aber, als
wäre nichts, und gehe an den Paparazzi vorbei ins
Kino. Ich trage ein rotes Satinkleid. Es sitzt an den
Hüften etwas eng und ist unten sehr weit. Aber
ich sehe gut aus. Das weiß ich, weil ich mich lang-
sam an diese Dinge gewöhne und ein Gefühl
für mich bekomme.

Während ich den Gang entlang zu meinem Platz
gehe, kann ich fast meine Mutter hören. »Oh,
Jane-Herzchen, ein schickes Kleid wie dieses
verdient besseren Schmuck«, würde sie sagen.
»Warum gehst du nicht an meinen Tresor und
suchst dir was Hübsches aus? Du siehst so …
unvollständig aus.«
»Mutter, bitte, nicht heute Abend«, sage ich
fast zu laut.
Ich setze mich allein in die dritte Reihe. Das ist
aber in Ordnung so. Damit komme ich zurecht. Ich
bin erwachsen.
Dann sehe ich Michael. Er sieht flott aus, wie er
flott den Gang entlangeilt und sich neben mich set-
zt. »Geschafft«, keucht er.
»Ich bin ein nervliches Wrack«, sage ich, als
wüsste er das nicht.
Er nimmt mich kurz in die Arme, und schon habe
ich mich beruhigt.
Ein wenig. Er ist beruhigend, sexy und lieb –
alles auf einmal.
»Okay, jetzt bin ich ein Nervenwrack, das
tierisch in einen Mann verliebt ist, der vielleicht gar
nicht echt ist.«
Michael stößt mich leicht in die Seite – sol-
che Stöße gehören derzeit zu unserem Leben.
339/346

»Okay, du bist echt«, stelle ich fest.
Endlich wird es dunkel im Saal, und der Film
beginnt.
Die Zuschauer fangen im gleichen Moment zu ju-
beln an, aber das zählt nicht, weil sie vom Studio
und den PR-Agenturen sind.
»Der Film gefällt ihnen!«, sagt Michael.
»Er hat noch nicht begonnen.«
Eine Titelkarte füllt den Bildschirm aus.
»Jane Margaux in Zusammenarbeit mit ViMar
Productions präsentiert Dem Himmel sei Dank.«
Wieder wird anerkennend gejubelt.
Ich beuge mich zu Michael hinüber. »Die
Musik jedenfalls klingt fabelhaft.« Violinen und
sanfte Blechbläser.
Genau richtig als Einführung für die erste
Szene dieser netten, leichten Komödie.
Eine Kamera schwenkt über eine Menschen-
menge, hält vor einem Tisch im Astor Court im St.
Regis Hotel. Die Szene war tatsächlich im St. Re-
gis gedreht worden.
Ein bewundernswertes kleines Mädchen sitzt
am Tisch. Sie bleibt einen Moment im Bild, damit
wir sie kennenlernen. Rote Wangen, unwidersteh-
liches Lächeln.
340/346

Dann schwenkt die Kamera zu ihrem Begleiter,
einem hübschen Mann, vielleicht dreißig Jahre
alt. Lässt sich nicht sicher sagen.
Aber er ist eindeutig ein Star.
»Und was nimmst du heute?«, fragt er.
»Das weißt du doch«, antwortet das
Mädchen.
»Ich weiß. Kaffeeeis mit Karamellsoße.«
Der Schauspieler ist perfekt für diese Rolle. Ein
Unbekannter, den ich zufällig entdeckt habe.
Außerdem brauchte er Arbeit.
Es ist Michael in der Rolle von Michael. Wer
sonst hätte ihn spielen können?
Ich beobachte ihn auf der Leinwand, während
er neben mir sitzt und meine Hand hält. Irgend-
wie ist doch alles im Leben nicht ganz echt.
Dann frage ich mich, ist die Vorstellung oder der
Glaube daran, dass ein Mann und eine Frau ihr
Glück eine Weile gemeinsam leben können, so
abwegig? Schließlich ist das alles, was wir haben.
Ganz und gar nicht. Denn es ist mir, Jane-
Herzchen, passiert, also kann es jedem passieren.
Ãœbrigens, die Zuschauer waren begeistert von
Dem Himmel sei Dank.
341/346

EPILOG
Erdbeeren mit Schlagsahne
DREIUNDACHTZIG
Michael saß an einem Tisch im Astor Court im St.
Regis mit einem bewundernswerten vierjährigen
Mädchen namens Agatha, das aber lieber Aggie
genannt werden wollte.
Aggie war Michaels letzter Auftrag, und obwohl er
immer versuchte, mit jedem seiner Kinder etwas
Neues und Ausgefallenes zu tun, konnte er nicht
widerstehen, am Sonntagnachmittag ins St. Regis
zu gehen. Schließlich war das Café hier voller
guter Erinnerungen.
Der Kellner stellte eine Schale mit Melonen-
bällchen und ein Zitronensorbet vor ihn.
»Oh, vielen Dank«, sagte Michael, als hätte
ihm der Kellner einen großen Gefallen getan,
wovon Michael tatsächlich ausging, weil der Kell-
ner seine Arbeit gut machte.

Der Kellner hatte Aggie bereits ihren Früchte-
becher gebracht – Erdbeeren mit Schlagsahne
und Erdbeereis und ein Klecks Erdbeermarmelade.
»Du bist mir vielleicht ein Mädchen«, neckte
Michael sie.
»Ich bin ein Mädchen, Dummian«, erwiderte
Aggie. Ihr zauberhaftes Lächeln passte sehr gut zu
ihren wunderschönen grünen Augen.
Michael war versucht, ihr etwas beizubringen, das
er Aggie-und-Michael-Spiel nennen würde, doch
er widerstand dem Drang. Er brauchte für Aggie
etwas Besseres – und da kam es.
»Aggie, schau!«
Jane war mit ihrem einjährigen Sohn Jack auf
die Toilette gegangen und kam gerade zurück.
Jack deutete an die Decke und rief »ich, ich«,
was sein Wort für »Licht« und alles andere
war, das ihm gefiel.
»Da kommen Mami und Jack!«, rief Michael.
Sein Herz hüpfte vor Aufregung wie immer, wenn
er Jane sah. Er war glücklich, fühlte sich ge-
segnet, dass er Jane und eine Familie hatte.
»Jetzt können wir ›Schweinchen in der Mit-
te‹ spielen«, sagte Aggie und lachte. »Und du
bist das Schweinchen, Daddy.«
343/346

»Okay«, stimmte Michael zu. »Und was
für ein Schweinchen. Ein ganz niedliches mit
Borsten, oder? Jetzt brauchen wir nur noch einen
Ball.« Zu Jane gewandt, flüsterte er lächelnd
nur ihr zu: »Ich habe dich vermisst. Wie im-
mer.«
»Ich habe dich auch vermisst. Aber jetzt bin ich
hier«, sagte Jane.
»Wir sind alle hier, alle vier. Es gibt nichts
Besseres auf der Welt. Nichts, was ich mir in mein-
en
wildesten
Träumen
hätte
vorstellen
können.«
Jane setzte sich an ihren Platz, nahm einen Löf-
fel von ihrem Früchtebecher mit Karamellsoße
und Kaffeeeis und hielt ihn Jack zum Probieren hin.
»Ich, ich!«, rief der Kleine.
344/346

Â
Â
Page & Turner Bücher erscheinen im
Wilhelm Goldmann Verlag, München,
einem Unternehmen der Verlagsgruppe
Random House GmbH.
Â
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2008 by James Pat-
terson Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe
2008
by Page &Turner/Wilhelm Goldmann Verlag,
München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
First published by Little, Brown and Company, New York,
NY.
Published by arrangement with Linda Michaels Limited,
International Literary Agents.
Redaktion: Ilse Wagner
Gesetzt aus der Janson-Antiqua
bei Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
eISBN : 978-3-641-03304-0
Â
Document Outline
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Die 2 Chance James Patterson
James Patterson Igrzyska
!James Patterson Pamiętnik pisany miłością
James Patterson Róże są czerwone
James Patterson Club 01 First to Die
James Patterson Alex Cross 12 Cross (v1 0)
James Patterson Zabawa w chowanego
James Patterson CIEŃ HAWANY
James Patterson Club 03 Third Degree
James Patterson Pamiętnik pisany miłością
James Patterson Zabawa w chowanego
James Patterson Kobiecy Klub Zbrodni 02 Druga szansa (& Andrew Gross)
James Patterson Cien Hawany
więcej podobnych podstron
