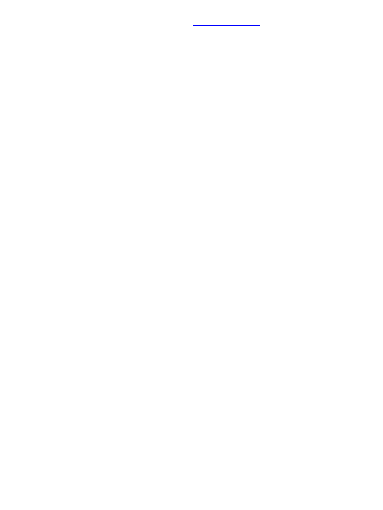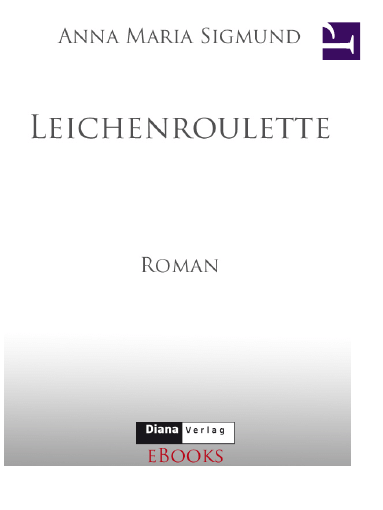

ANNA SIGMUND | Leichenroulette
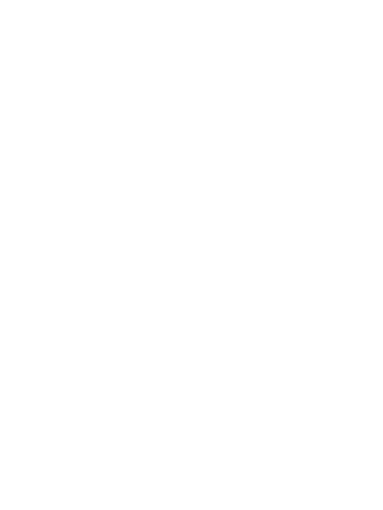
A
NNA
S
IGMUND
IM
G
ESPRÄCH
Frau Sigmund, bislang haben Sie ausschließlich Sachbücher geschrieben. Was hat Sie dazu bewogen,
einen Roman zu verfassen?
Die Frage muss eher umgekehrt lauten: Warum habe ich bislang ausschließlich Sachbücher geschrieben?
Es war eine interessante Arbeit, aber natürlich eine, bei der ich meine Phantasie zugunsten harter Fakten
und penibler Recherchen zügeln musste. Bis ich schließlich dazu überging, abends zur Entspannung kur-
ze Geschichten und heitere Alltagsepisoden niederzuschreiben.
Wie und wann kam Ihnen die Idee zu Hermine, ihrer mordenden Heldin?
Es war mein betagter Schwiegervater, der den Anstoß gegeben hat. Nach der Lektüre eines Buches über
historische Kriminalfälle meinte er nämlich: »Soll ich dir sagen, wie man einen perfekten Mord begeht?
Du musst mir aber versprechen, dass du unsere Familie nicht ausrottest.« Gleich danach ging ich ans
Werk. Meine Familie ist übrigens noch am Leben.
War es am Ende schwer, sich von den Figuren zu verabschieden?
Der Abschied von Hermine war tatsächlich sehr schwer. Für seine Schöpfung trägt man schließlich eine
gewisse Verantwortung. »Wie geht es jetzt mit ihr weiter?«, habe ich mich bange gefragt. »Wird sie auf
den Pfad der Tugend zurückfinden und in Zukunft ein anständiges Leben führen?« Ich wage dies zu bez-
weifeln und fürchte sehr, dass sie ihren unheilvollen Weg fortsetzt. Wohin? Wir wissen es nicht!
Ü
BER
DIE
A
UTORIN
Anna Sigmund studierte Geschichte und Kunstgeschichte an der Wiener Universität. Sie arbeitete als
freie Wissenschaftsjournalistin sowie Historikerin und feierte als Sachbuchautorin mit ihrer Reihe Die
Frauen der Nazis internationale Erfolge. Leichenroulette ist ihr erster Roman. Anna Sigmund lebt mit
ihrem Mann und ihrem Sohn in Wien.
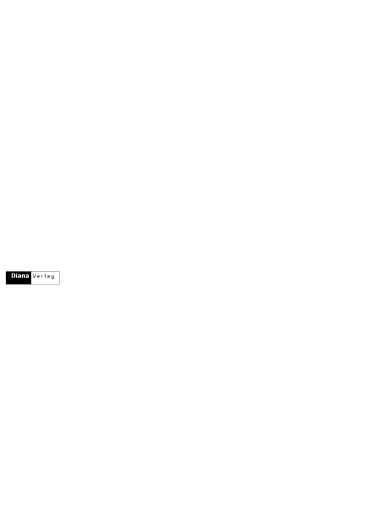
Leichenroulette
ANNA SIGMUND
Leichenroulette
Kriminalroman

Impressum
Originalausgabe 09/2011
Copyright © 2011 by Diana Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion | Uta Rupprecht
Herstellung | Helga Schörnig
Satz | Leingärtner, Nabburg
ePub-ISBN 978-3-641-05652-0
www.diana-verlag.de

Kapitel 1
1
Dick, dick, zu dick – das waren die Worte, die sich wie ein roter Faden durch
meine Kindheit zogen. »Frau Meier, Ihre Hermine wird immer runder. Diese
vielen Süßigkeiten! Man sieht sie aber auch dauernd naschen.« Gerne machten
freundliche Nachbarinnen aus der Schlossergasse meine Mutter beim mor-
gendlichen Einkaufstratsch darauf aufmerksam, dass ihre einzige Tochter fast
einer kleinen Tonne glich.
Schon im Kindergarten habe ich gern gegessen. Selbst die in der Nach-
kriegszeit bei der sogenannten »Ausspeisung« verabreichte dicke Erbsensuppe
mundete mir vortrefflich. Voll Gier musste ich jedes Mal schlucken, wenn man
unser Mittagsmahl in einer großen Milchkanne aus Aluminium herbeitrug, der
Deckel sich klappernd öffnete, mir ein köstlicher – von anderen Kindern als
ekelhaft empfundener – Geruch in die Nase stieg, der gusseiserne Schöpflöffel
in den zähen Brei tauchte.
Zu Hause hingegen war für mich immer Ostern, da meine selbst schlanke
und ranke Mutter dazu überging, ihre Lebensmittel vor meinen gierigen
Händen zu verstecken. Doch ich suchte beharrlich und fand – Rosinen, die
Kochschokolade, die Eierbiskotten. Die Strafe folgte auf dem Fuß. Sehr anpas-
sungsfähig, änderte ich blitzschnell meine Taktik und half emsig in der Küche,
wobei immer das eine oder andere Häppchen für mich abfiel. Ganz nebenbei
lernte ich ausgezeichnet kochen.
Abgesehen von meinen Figurproblemen, die mich getreulich weiterbegleiten
sollten, gestaltete sich meine Kindheit gar nicht so schlecht. Ob ich allerdings,
wie die Schauspielerin Lilli Palmer in ihrer Autobiografie »Dicke Lilli, gutes
Kind« über sich selbst schrieb, auch ein gutes Kind war, könnte man
bezweifeln.

Ich stamme aus einer kleinen Stadt in einer wildromantischen, aber ärmlichen
Region im Norden Österreichs an der böhmisch-mährischen Grenze. Mit El-
tern und Großmutter lebte ich in einer etwas düsteren, zur Gasse hin gelegenen
Wohnung eines Mietshauses, im Schatten der imposanten barocken Stadtpfar-
rkirche. Das ehemalige bäuerliche Anwesen war sehr alt; es bestand aus einem
kleinen Haupthaus, einer durch ein schweres Tor geschützten Einfahrt, einem
für wilde Spiele bestens geeigneten Innenhof und einem winzigen »Ausnahm-
stüberl«. Auf engstem Raum vereinte sich ein wahrer Mikrokosmos mensch-
licher Existenzen. Das Zusammenleben der sogenannten »Parteien« verlief zu
keinem Zeitpunkt konfliktfrei und bot den Kindern der Mieter – meiner besten
Freundin Mizzi und mir sowie den zwei Buben Raini und Günther – stets
Unterhaltung.
Es war eine schöne, spannende und abwechslungsreiche Zeit voll Geborgenheit
und Sicherheit, aber mit festen Regeln und Normen. Bereits in der Volksschule
scharte ich eine kleine Gruppe von gleichaltrigen Buben und Mizzi als einzigem
Mädchen um mich. Sie waren meine »Vasallen« – das Wort hatte ich bei Er-
wachsenen gehört und übernommen –, denen unter meiner Leitung auch ganz
ohne Gameboys und Computerspiele nie langweilig war. Mit Raini, Günther,
Otti, Waldi, Seppi und Mizzi erforschte ich die tiefen und geheimnisvollen
Keller, die sich wie ein Spinnennetz unter der Stadt hinzogen. Nach dem Vor-
bild von Abenteuerromanen, die wir aus der städtischen Leihbücherei bezogen,
klopften wir die Wände auf der Suche nach eingemauerten Schätzen ab.
Der Unterricht endete um 12 Uhr, und einer eisernen Regel zufolge
erledigten wir die Hausaufgaben sofort nach dem Mittagessen. Kaum war eine
hübsche, kunstvolle »Zierleiste« säuberlich unter die Rechnungen und
Übungssätze gemalt und die Schultasche für den nächsten Tag gepackt, veran-
stalteten wir auch schon auf dem Katzenkopfpflaster vor dem Haus polternd
Rennen mit jenen kleinen Leiterwagen, die man damals allgemein zum Trans-
port sperriger Sachen benutzte – sehr zum Missvergnügen der älteren Anrain-
er, die meist gerade dann ihr kleines Schläfchen hielten. Zum Gaudium meiner
Vasallen setzte ich meine schönste Puppe – ein sinnreiches Geschenk einer
Tante zur Förderung meiner weiblichen Eigenschaften – in das klapprige
7/186

Gefährt. Flugs ging es die steile Gasse hinunter. Bald versanken die großen,
tiefblauen, von dichten schwarzen Wimpern gesäumten Augen der zarten
Porzellanfigur in ihrem lieblichen Blondkopf, was ihr ein sinister-dämonisches
Aussehen verlieh. Wir bogen uns vor Lachen.
Einige Mütter sahen uns kopfschüttelnd zu. Naserümpfend stellten sie
meine Mutter zur Rede: »Frau Meier, warum lassn’s denn die Hermi mit sol-
chen Gassenbuben herumrennen?« Ihren behüteten Töchtern untersagten sie
den Umgang mit mir und meiner Bande. Das kam mir gelegen, denn ich verab-
scheute das kindische Getue der niedlichen Mädchen, wenn sie artig im Garten
saßen, Kleidchen für ihre Püppchen nähten, mit ihnen sogar sprachen, sie ba-
deten, spazieren führten und schlafen legten.
Ich als »Old Shatterhand« zog Buben und »Räuber-und-Gendarm«-Spiele
bei einfallender Dunkelheit vor. Noch Jahre später vermeinte ich jenen prick-
elnden Schauer zu verspüren, der mir, versteckt hinter einem Hausvorsprung,
über den Rücken jagte, wenn sich der »Gendarm«, nachdem er bis dreißig
gezählt hatte, mit dem Ruf »Ich komme!« auf die Suche nach uns »Räubern«
machte.
Häufige, kostenlose »Reality-Shows« ersetzten in der Schlossergasse 14 das
Fernsehen, denn es wurde fast täglich gestritten. Zu verschieden waren die
unter einem Dach vereinten Charaktere. Die Schwestern Fröhlich im ersten
Stock distanzierten sich gerne von ihren als vulgär empfundenen Nachbarn.
Altjüngferlich und pedantisch, litten die stets in Weiß gekleideten zwei Damen
vor allem darunter, dass sie ihre Toilette mit dem in ihren Augen rohen und
derben Ehepaar Prosch, dessen frechen Söhnen Raini und Günther, aber auch
deren wechselnden »Bettgehern« teilen mussten.
In besonderer Erinnerung blieben zwei Monteure eines Wiener
Elektrokonzerns, die bei uns in der tiefen Provinz Wartungs- und Reparatur-
arbeiten durchführten. Herr Prosch, ein bei den städtischen Wasserwerken
beschäftigter und daher von allen nur »Wassermann« genannter hagerer und
griesgrämiger Mann, gewährte ihnen Unterkunft. Er war froh über den kleinen
Zusatzverdienst. Und da die jungen Männer im Schichtdienst arbeiteten, schi-
en es ihm ganz logisch, ihnen die Bettbank in der Küche zur gemeinsamen,
8/186

abwechslungsweisen Nutzung zu vermieten. Besuchte ich meine Spielge-
fährten, fand ich immer einen der Burschen tief schlafend vor. Er ließ sich
weder durch die Kochgeräusche der Frau Prosch noch durch den Lärm, den wir
verursachten, stören. Im Wachzustand prahlten die feschen Monteure mit ihr-
er Männlichkeit. Stolz erzählten sie, dass sie, wenn sich die Gelegenheit bot, bei
der Arbeit hübsche und willige Ehefrauen, die sie allein antrafen,
»vernaschten«. Wir spitzten unsere Ohren. Auch Herr Prosch amüsierte sich
königlich, während er von einer der Einfachheit halber an einem Nagel im Tür-
rahmen aufgehängten Speckseite, einem Geschenk seiner bäuerlichen Ver-
wandten, kleine Stücke abschnitt und verzehrte.
Das Lachen verging ihm, als er wegen der mangelnden Hygiene der flotten
»Bettgeher« vor dem Bezirksgericht landete. Dieser betrübliche Fall trat ein,
nachdem der biedere »Wassermann« in höchster Erregung einem der Fräulein
Fröhlich, das sich mit näselnder Stimme über die verschmutzte Toilette
beschwerte, einen heftigen Schlag versetzte. Das vom Bezirksrichter verhängte
Schmerzensgeld händigte er seinen triumphierenden Gegnerinnen in monat-
lichen Raten aus.
Seine privaten Querelen minderten den Status des »Wassermanns« nicht. Im
Gegenteil, er galt als Held. Mit Argusaugen wachte er auch weiterhin über die
»Bassena«, die einzige Wasserstelle zur Versorgung der Schlossergasse 14 mit
dem unentbehrlichen Nass. Als ehrenamtlicher Experte entschied er Fragen,
welche die Parteien des Hauses zutiefst bewegten: »Wer verbraucht viel, wer
wenig Wasser? Wie sollen die Kosten gerecht verteilt werden?« Die Hausge-
meinschaft, die sich – im besten Fall – einmal wöchentlich in das städtische
»Tröpferlbad« begab und sich ansonsten mit oberflächlicher Säuberung in ein-
er Waschschüssel, dem »Lavur«, begnügte, beobachtete missbilligend, welche
Verschwendung meine auf höchste Sauberkeit bedachte Mutter betrieb. Nicht
nur, dass sie unnötig oft die Holzfußböden unserer Wohnung schrubbte, auf
ihr Geheiß hin zogen wir auch – damals eher unüblich – täglich frische
Kleidungsstücke an.
Daraus resultierte, dass meine Großmutter einmal wöchentlich die Ge-
meinschaftswaschküche in Beschlag nahm. Ein beeindruckendes Schauspiel
9/186

nahm seinen Lauf. Es dampfte und brodelte in den Kesseln über der Feuer-
stelle, die voll waren mit zuvor eingeweichten und dann mit Schichtseife auf
der »Rumpel« geschrubbten Textilien aus Baumwolle oder Leinen. Es grenzte
an Zauberei, wie die geschäftig hantierende Wäscherin zeitweise in den dichten
Nebelschwaden vollkommen verschwand. Ich traute mich nie zu fragen, bei
welcher Gelegenheit wir uns, nämlich mein Vater als Beamter in seinem Amt,
meine Mutter zu Hause und ich in der Schule, jemals derart beschmutzten, um
diese komplizierte Prozedur zu rechtfertigen. »Nur gekochte Wäsche ist wirk-
lich hygienisch sauber«, belehrte uns meine Mutter, die nur mit Mühe davon
abgehalten werden konnte, auch unsere Schuhe zu waschen. Auf jeden Fall ver-
rechnete man meiner Familie das Doppelte der pro Person anfallenden
Wassergebühren.
Im Hintertrakt unseres Hauses, neben der Waschküche, logierte eine meist
stark geschminkte, nicht mehr ganz junge Dame, bei der »Mauner«, nämlich
Männer – alt und jung –, nächtens verkehrten. Den Mitbewohnern blieb das
unmoralische Treiben selbstverständlich nicht verborgen. Sie ergötzten sich
daran im Geheimen, sparten jedoch nicht mit verächtlichen Blicken und zynis-
chen Anspielungen. Vermutlich aus Rache rief mich die von allen gemiedene
Frau manchmal zu sich in ihr mit allerlei Kitsch gefülltes Heim. Ich saß dann
unter Heiligenbildern zwischen bunten Kissen auf ihrem Schlafsofa, sie
erzählte mir aus ihrem Leben, und ich erntete gleichsam die Früchte ihrer Un-
zucht, indem ich köstliche Pralinen aus den von nächtlichen Besuchern hinter-
lassenen billigen Bonbonnieren verzehrte.
Für uns Kinder war das alte, verwinkelte, heruntergekommene Gebäude ein
wahres Eldorado. So benutzten wir die aufgrund der Hanglage der Liegenschaft
teilweise ebenerdige Wohnung des – wie es uns vorkam – uralten Ehepaars
Smutny, das im hinteren Trakt, gleich neben Mizzis Eltern, Küche und Zimmer
bewohnte, als praktische Abkürzung zum Kirchplatz. Ungeniert liefen wir die
Treppenstiege im Hof hinauf und kletterten durch ein Fenster hinaus, wenn
wir auf dem Weg zu verwegenen Bandenspielen beim Pfarrhof neben der
Kirche waren.
10/186

Herr Smutny trank exzessiv. Die ordinären Flüche, die er im Zustand der
Volltrunkenheit ausstieß, bereicherten unseren geheimen Wortschatz ganz un-
gemein. Im Sommer barg die Sucht des Herrn Smutny keinerlei Gefahren. Im
Winter jedoch kam er auf dem Heimweg von seinem Wirtshaus manchmal von
der Straße ab und landete in einem Rinnsal, wo ihn von seiner Frau alarmierte
männliche Mitbewohner der Schlossergasse 14 dann aufspürten. Ihr Mitleid
bewahrte ihn in eisigen Nächten vor dem Erfrieren. Sie trugen ihn nach Hause,
wo er seinen Rausch ausschlief.
Der kleine Innenhof des Hauses mit einem verkrüppelten Fliederbaum und
der »Bassena« als Wasserstelle war Allgemeingut. Dort lebte eine von allen
geduldete, von mir jedoch geliebte und gefütterte Katzenfamilie. Dort hielten
manche in kleinen Ställchen Kaninchen, so wie ich meinen »Hansi«, dort legte
Frau Zottl, eine im »Ausnahmstüberl« einquartierte über 90-jährige, stets
keifende alte Frau, ein kleines Gärtchen an, das sie gegen uns ballspielende
Kinder vehement verteidigte, genauso wie den räudigen Fliederbusch neben
dem Plumpsklo.
In der von sämtlichen Bewohnern – mit Ausnahme der Schwestern Fröhlich
und der Familie des »Wassermanns« – benutzten und sommers wie winters
nur über den Hof zu erreichenden Toilette hörten Mizzi und ich, auf einem
Holzbrett sitzend, tief unten oft die Ratten kratzen. Das verschwiegene Örtchen
bildete einen Zankapfel. War es, wie es manchmal geschah, verstopft, verbreit-
ete sich bald ein penetranter Gestank. Zuallererst appellierte man an die Haus-
besitzerin, eine liebenswerte alte Dame, die, wie sie deutlich zu verstehen gab,
mit den Bewohnern ihrer Liegenschaft und auch mit ihrem Besitz selbst nichts
zu tun haben wollte. Das lag, wie uns die Erwachsenen erklärten, an den in der
Inflationszeit nach dem Ersten Weltkrieg eingefrorenen und seitdem nicht
mehr erhöhten Mieten. Man zahlte den sogenannten »Friedenszins«.
Nachdem es keine finanziellen Rücklagen gab, Appelle an die Hausbesitzerin
ungehört verhallten und die Suche nach den Übeltätern stets im Sand verlief,
traten die von den Frauen verköstigten, gelobten und angefeuerten Männer der
Wohngemeinschaft mit Hacken und Spaten in Aktion. Unter derben Flüchen
gruben sie den Hof bis auf die Gasse hinaus auf, legten den Kanal frei und
11/186

säuberten ihn. Wir Kinder liebten die große Aufregung und erschauderten vor
den Ratten, die manchmal unverhofft ans Tageslicht kamen.
Nur ein Wehrmutstropfen trübte mein junges Leben, und zwar in Gestalt
eines großen, dicken, hartgesottenen Buben mit bösartigem Gesicht. Der Hahn
Peter, wie er genannt wurde, war in unserer Kleinstadt berüchtigt. Er schlug
kleinere Kinder und nahm ihnen, wenn er sie im Sommer genüsslich
schleckend auf der Straße antraf, die Eistüten weg. Er entwendete Spielzeug,
verscherbelte es und hatte so immer Geld. Ich hasste den Sohn einer allein-
stehenden Gemüsehändlerin, die ihn maßlos verwöhnte, nicht nur deshalb,
weil er sich ein Vergnügen daraus machte, Tiere zu quälen. Ich fürchtete ihn
vor allem als Chef einer rivalisierenden Bande, mit der er den Kirchenplatz be-
herrschte und mich mitsamt meinen »Vasallen« oftmals vertrieb und
terrorisierte.
Im Schutze meiner Anhänger drohte mir keine Gefahr, ja, da ließ ich mich
sogar zu Schmährufen hinreißen. »Hei, blöder Schwabbler!«, schrie ich forsch,
wenn ich Peter von Weitem kommen sah. »Trau di her, feiger Fettwanst!« Als
ich jedoch eines Tages mit Mizzi allein unterwegs war, verstellte er mir den
Weg. Wortlos gab er mir, bevor er weiterschlenderte, ein paar Ohrfeigen, die
mir auf den Wangen brannten. Und dies vor den Augen meiner ungläubig star-
renden Freundin! Welche Schande! Welcher Gesichtsverlust! Ich merkte so-
fort, wie ich in ihrer Achtung sank. Und sollte bald auch merken, dass sie den
Vorfall weitererzählte.
Am Ende dieses beschämenden Tages weinte ich mich voll ohnmächtigem
Zorn in den Schlaf, und auch an den folgenden Abenden fand ich vor Gram
keine Ruhe. In der irrigen Annahme, dass man mich, wie es oft geschah, wegen
meiner Molligkeit gehänselt hatte, las mir meine besorgte Mutter Hans Christi-
an Andersens Märchen »Das hässliche Entlein« vor. »Es war einmal«, begann
sie ihre Gutenachtgeschichte mit sanfter, beruhigender Stimme. Ich kuschelte
mich unter die weiche Bettdecke und hörte zu. Es gefiel mir, wie das von allen
verspottete hässliche Küken zum wunderschönen Schwan heranwuchs. Eine
Lösung meiner eigenen Probleme fand ich in der sentimentalen Erzählung
nicht.
12/186

Wenige Tage später bedachte mich meine Mutter, als ich aus der Schule kam,
nicht mit dem üblichen forschenden Blick, sondern schaute mich mitleidig an.
Was hatte das zu bedeuten? Leicht verunsichert verstaute ich meine Sachen,
wusch mir die Hände und setzte mich an den Küchentisch. Als ich, was sonst
nur an Sonn- und Feiertagen geschah, ein Wiener Schnitzel vorgesetzt bekam,
befiel mich eine düstere Ahnung. Ich stopfte mir einen großen Löffel mit Kar-
toffelsalat in den Mund und blieb gegen jede Gewohnheit ungerügt. Im Gegen-
teil, meine Mutter lächelte mild, strich ihre weiße Schürze glatt und setzte sich
zu mir. »Sei nicht traurig«, meinte sie. »Aber dein Hansi ist verschwunden.
Heute früh war sein Ställchen leer. Und das Türl offen.« Mir wurde vor Schreck
ganz kalt. Hansi, mein geliebtes schwarz-weißes Kaninchen mit den langen
Ohren, dessen weiches Fell ich so gern streichelte, den ich mit Karotten und
Löwenzahn verwöhnte, ja förmlich mästete! »Wo, glaubst du, kann er denn
sein?«, fragte ich weinerlich. »Werd ich ihn wiederkriegen?«
Bis in die Abendstunden suchte ich die Nachbarschaft nach meinem
Lieblingstier ab. Ich fragte alle, die mir begegneten, erhielt jedoch nur negative
Auskünfte. Schließlich verfasste ich noch eine Suchanzeige, ging zum Rathaus
und klebte sie neben den Schaukasten mit den Verlautbarungen der Gemeinde.
Tags darauf schaute ich nach, begleitet von meiner Runde, die ich sofort einge-
weiht hatte. Schon von Weitem leuchtete uns die auf einen Zettel geschmierte,
trotz Rechtschreibfehlern eindeutige Botschaft in roten Großbuchstaben entge-
gen:
KRIGST NIMER!!!!!
Wir erstarrten vor Entsetzen.
Der infame Schreiber sollte Recht behalten – Hansi tauchte nie wieder auf.
Noch lange rätselte ich, welch trauriges Schicksal ihn ereilt haben könnte. Zwei
Wochen verstrichen. Dann verbreitete sich das Gerücht, dass der Fleischer
eines kleinen Dorfes unweit der Stadt Kaninchenfleisch – es soll sehr fett
gewesen sein – zum Verkauf angeboten hätte. »Ob vielleicht der Hahn Peter?«,
formulierte Mizzi ungeschickt ihren dunklen Verdacht. Ich teilte diesen voll
und ganz, schwieg jedoch. In meinem Innersten hatte ich schon längst einen
Entschluss gefasst. Es fehlte nur noch die passende Gelegenheit. Und die kam.
Schon ab Mitte Juni gingen die Kinder unserer Stadt, wenn das Wetter es nur
halbwegs erlaubte, jeden Nachmittag die kurze Strecke aus der Stadt hinaus
13/186

und durch ein kleines Wäldchen hinunter bis zum Ufer des träge, braun und
mit Laub bedeckt dahinströmenden Flusses. Dort, in der Nähe eines
rauschenden Wehrs, hatten fürsorgliche Stadtväter vergangener Epochen, als
Turnen und Sport groß in Mode kamen, ein Strandbad errichtet. Wir lösten im
Kiosk am Eingang Badekarten, bekamen kleine Schlüssel ausgehändigt und
verstauten unsere Kleider in einem der Kästchen des weitläufigen grünen
Umkleidepavillons, dem kunstvolles Schnitzwerk ein luftiges Aussehen verlieh.
In dessen offenen Gängen konnten wir, obwohl dies die Badeordnung aus-
drücklich untersagte, hervorragend Fangen spielen. Sie boten auch Schutz,
wenn Unwetter aufzog. Wir saßen dann auf den Balustraden und schauten in
den strömenden Regen hinaus, während die von der Sonne aufgeheizte
Holzkonstruktion behagliche Wärme abgab. Bis zum Einbruch der Dunkelheit
verbrachten wir unbeschwerte Stunden. Erwachsene begleiteten uns nur zum
Wochenende, ansonsten genossen wir unsere Freiheit. Meiner Erinnerung
nach ist auch – abgesehen von einer einzigen tragischen Ausnahme – niemals
etwas passiert.
Die Kleinen planschten in einem umzäunten, von der Fließstrecke ab-
getrennten Becken, auf dem Drei-Meter-Brett wippten mutige Jugendliche, be-
vor sie ihre Sprungkünste vorführten, auf den Holzpritschen in der Liegewiese
strickten und plauderten Frauen in bunten Badeanzügen aus dünner Wolle.
Ein strenger »Badewaschl« mit Trillerpfeife wachte über Zucht und Ordnung:
»Schwimm net so weit hinaus! Fredl, gib a Ruh! Kum aussa, du bist ja schon
ganz blau!«, lauteten seine Befehle, denen wir sofort gehorchten. Während sich
meine Freunde noch mit ihren voluminösen Schwimmreifen abquäl-
ten – zweckentfremdeten Schläuchen alter Autoreifen, die ihnen der freund-
liche Herr Waiss, seines Zeichens Händler von Kraftfahrzeugen, kostenlos
überlassen hatte –, konnte ich bereits schwimmen. Mit kräftigen Stößen
durchquerte ich hocherhobenen Hauptes, im Nacken die neidischen Blicke der
Gleichaltrigen, mühelos den Fluss. Am gegenüberliegenden Ufer zog ich mich
an Land, schüttelte mich und drehte mich selbstbewusst um. Von Hahn Peter
und seinem widerlichen rotznäsigen Gefolge, die mir feixend zuschauten, war
natürlich kein Beifall zu erwarten. Allerdings auch keine Aggressionen, denn
auf dem neutralen Territorium des Strandbades ruhte der Kampf. Abgesehen
14/186

von gezischten Schimpfwörtern, Anspucken oder »Haxlstellen« im Vorbeige-
hen, wenn der muskulöse »Badewaschl« wegsah, blieb es friedlich. So konnte
auch Hahn Peter ungestört seinen schwarzen Reifen zu Wasser bringen, sich
mit seinem massigen Körper darauf niederlassen und sich in dem kühlen
Nass – der Fluss wurde niemals richtig warm – hinaustreiben lassen, wobei
ihm die Hände als Paddel dienten. Lange betrachtete ich ihn mit gesenkten Au-
gen, dann wurde mir blitzschnell klar: »Das ist die Gelegenheit, auf die du ge-
wartet hast! Die darfst du nicht verpassen.«
Nichts ist, wie sich bald herausstellte, süßer als Rache! Als er, ganz allein,
langsam auf die Mitte des Flusses zutrieb, glitt ich in die Fluten und folgte ihm.
Die Sonne schien, die Wellen kräuselten sich, die Bäume am Ufer zeichneten
auf der Wasseroberfläche flüchtige, sich rasch wandelnde Schattengebilde. Als
ich näher kam, hob Peter den Kopf: »Bleib weg, du blöde Kuh. Weißt ja, dass
ich no net schwimmen kann! Tu mir ja nix, sonst erlebst was!« – »Was machst
dann da heraußen? G’hörst ins Planschbecken«, lautete meine prompte Ant-
wort. »Fürchtst di gar? Wasserschluckn ist g’sund!« Unter lautem Lachen rüt-
telte ich spielerisch an seinem Reifen, in dem er hingegossen wie eine feiste
Qualle lag. In seiner Angst sah er die grüne Glasscherbe in meiner linken Hand
nicht, mit der ich hurtig die Flicken auf dem oftmals geklebten Schwimmbehelf
löste. Und da niemand aus dem Bad unseren Kindereien Beachtung schenkte,
machte ich noch rasch ein paar kleine Schnitte unter der Wasseroberfläche.
Dann ließ ich von meinem Opfer ab. Als kleine Bläschen, Vorboten kom-
menden Unheils, aus dem durchlöcherten Gummi aufstiegen, entfernte ich
mich schnell, zufrieden über die kleine Lektion, die ich dem bösen Buben er-
teilt hatte. Aus sicherer Entfernung beobachtete ich, wie er sich an den Ret-
tungsanker klammerte, aus dem langsam die Luft entwich, zuerst seinen Fre-
unden winkte, dann um Hilfe schrie, wie wild um sich schlug, unterging,
auftauchte, unterging und schließlich versank. Schließlich stürzte sich der
alarmierte »Badewaschl«, der anfangs an ein dummes Bravourstück des als
Angeber bekannten Wildlings gedacht hatte, in die Fluten, um den offensicht-
lich Ertrinkenden zu retten. Mehrmals tauchte er unter, bis es ihm gelang, den
Buben, dessen Bein sich, wie wir später erfuhren, in Schlingpflanzen verfangen
hatte, an die Oberfläche zu ziehen. Im Kreis neugieriger Badegäste erkämpfte
15/186

ich mir einen Platz in der ersten Reihe und erlebte aus nächster Nähe, wie der
rasch herbeigerufene Gemeindearzt an dem regungslos auf der Wiese lie-
genden Buben energische Wiederbelebungsversuche durchführte. »Er war lang
unter Wasser. Wenn es nur nicht zu spät ist«, meinte er pessimistisch. Zuerst
legte er ihn auf die rechte Seite, dann drückte er mit festen, rhythmischen
Bewegungen gegen seinen Brustkorb, bis Wasser aus seinem Mund quoll. Mir
wurde fast übel. Peter war doch nicht etwa tot? Ich hatte ihn doch nur schreck-
en wollen. Obwohl mir allmählich dämmerte, dass er furchtbare Rache nehmen
würde, war ich doch froh, dass er nach ein paar Minuten erste Lebenszeichen
von sich gab, zuckte und zu atmen begann. Er blieb jedoch ohne Bewusstsein
und hielt die Augen geschlossen, bis ihn ein Rettungswagen mit eingeschal-
tetem Blaulicht in rasender Fahrt ins Krankenhaus fuhr. Die Ärzte dort würden
ihm schon helfen! Ich schob die momentanen Skrupel und aufkeimende Gewis-
sensbisse zur Seite. Bald gewannen andere Gefühle die Oberhand: Was für ein
aufregender Tag! Und welch interessantes Erlebnis! Spannend wie ein
Abenteuerfilm.
Die Weise, in der die Bewohner unserer kleinen Stadt Anteil am Schicksal des
Scheusals nahmen, überraschte mich. Sie schien mir stark übertrieben, grenzte
fast an Hysterie. Man überbot sich in Mitleidsbekundungen, als die Folgen
des – vermeintlichen – Unfalls feststanden und man erfuhr, dass der
»Sonnenschein«, wie Frau Hahn ihren missratenen Sprössling zu rufen pflegte,
zwar mit dem Leben davonkommen würde, aufgrund des erlittenen Sauerstoff-
mangels aber schwere körperliche und geistige Schäden davongetragen hatte.
Angesteckt von der allgemeinen Stimmung, suchte ich mich vor mir selbst zu
rechtfertigen: Warum ist der Blöde auch ins tiefe Wasser, wenn er net schwim-
men kann? Hab ich g’wusst, dass es so ausgeht?
Beinahe hätte ich meinen Eltern alles gestanden, doch eingedenk ihrer
häufigen Ermahnung: »Reden ist Silber, Schweigen ist Gold!« hielt ich den
Mund. Wenn Frau Hahn meinen Ex-Rivalen voll resignierter Traurigkeit im
Rollstuhl durch die Straßen schob und sein Kopf mit leerem Blick lallend zur
Seite sank, grüßte ich besonders freundlich und höflich. Nicht der Schatten
eines Verdachts fiel auf mich, und so wurde mein wiederholtes Angebot, den
16/186

armen Peter spazieren zu fahren, gerne angenommen. Für diese gute Tat
erntete ich viel Lob. Manchmal suchten wir den abschüssigen und einsamen
Teil der Stadtpromenade auf. Mit »Und jetzt ein kleines Spiel« löste ich, wenn
wir allein waren, die Bremsen seines Wägelchens. Langsam rollte es an,
beschleunigte rasch, gewann an Fahrt und schoss auf den Stadtgraben zu.
Knapp vor dem Abgrund brachte ich das Gefährt zum Stehen. Trotz seiner Be-
hinderung spürte Peter die Gefahr, er wurde unruhig, wimmerte und gab
Schreckenslaute von sich. Es war zum Lachen!
Die meisten Eltern zogen aus dem schrecklichen Vorfall Konsequenzen. Sie
vernichteten die gefährlichen porösen Autoschläuche, in denen sie die Ursache
des Unglücks wähnten. Bald sah man im Strandbad viele stolze Besitzer neuer,
bunter Schwimmreifen. Das hatten sie nur mir zu verdanken!
Immer wenn sich das Schuljahr dem Ende näherte, wurden alle Mädchen und
Buben der Volksschule – in unserer Stadt lebten nur Katholiken – in ge-
bührender Weise auf die Beichte eingestimmt. Sollten wir doch, gereinigt von
allen lässlichen und schweren Sünden, beim feierlichen Schlussgottesdienst in
Anwesenheit der gesamten Gemeinde die heilige Kommunion empfangen.
Meist fiel uns bei der Vorbereitung dieses großen Ereignisses nichts ein außer
»Ich habe gelogen« und »Ich habe Vater und Mutter nicht geehrt«, wobei wir
unter Letzterem »Ich bin frech gewesen« verstanden. Dankbar nahmen wir da-
her die Instruktionen des Herrn Religionslehrers entgegen. Mit seiner Hilfe
setzten wir vor dem Gang in die Pfarrkirche auch das uns vollkommen myster-
iöse »Ich habe unkeusch gedacht« auf unsere Merkzettel.
Mir selbst war in diesem Jahr nur allzu bewusst, dass ich die Sache mit
Hahn Peter erwähnen oder zumindest hätte andeuten müssen. Mir standen je-
doch die in unserer Klasse hängenden farbigen Schautafeln biblischer Szenen
aus dem Alten Testament als Warnung vor Augen. Wie grausam wurden dam-
als Sünder bestraft! Wie war das mit Sodom und Gomorrha? Lots Weib erstar-
rte zur Salzsäule, nur weil sie sich verbotenerweise umdrehte und
zurückschaute. Und Kain? Trug der nicht ein Mal? Besser, sich nicht der un-
berechenbaren Gnade der katholischen Kirche auszuliefern. Außerdem,
welches der Zehn Gebote hatte ich denn überhaupt verletzt? Ich glaubte an
17/186

Einen Gott, begehrte nicht des Nächsten Frau, legte nicht Zeugnis ab gegen
meinen Nächsten und heiligte mit Freude den Tag des Herrn, an dem es keine
Hausaufgaben zu erledigen gab!
Wenig später wurden wir geschlossen in das Gotteshaus geführt. Als die
Reihe an mich kam, kniete ich im halbdunklen Beichtstuhl vor dem Priester
nieder. Nach der eingelernten Formel: »Ich bekenne vor Gott, dass ich fol-
gende Sünden begangen habe«, gestand ich alle meine kleinen Verfehlungen.
Der vom Ansturm beichtender Schüler und ihren stereotyp heruntergeleierten
Bekenntnissen schon etwas ermüdete alte Pfarrer hörte mir zerstreut zu, dann
erteilte er mir diskret murmelnd die Absolution. Als Buße hat er mir drei
Vaterunser und fünf Ave Maria auferlegt. Ich betete inbrünstig vor dem Altar,
während Christus vom Kreuz auf mich herabblickte. Nichts geschah! Anschein-
end hatte mir der Allmächtige verziehen. Zeit, auch mir selbst zu verzeihen. Er-
leichtert verließ ich mit gemessenen Schritten die heilige Stätte.
Der dramatische Abgang des gefürchteten Hahn Peter brachte mancherlei
Vorteile mit sich. Ungehindert streunten wir nun über den großen Hauptplatz,
um die wenigen dort geparkten Autos zu bestaunen. Vor allem ein zweifarbiger
»Borgward Isabella« in Rosa und Hellblau hatte es uns angetan. Wir be-
sichtigten ihn von allen Seiten, gingen um ihn herum, bewunderten jedes De-
tail. Ich weiß nicht, was mich überkam, aber ich zückte mein kleines Messer-
chen und kratzte damit ein paar Mal durch den glänzenden Lack. Meine Fre-
undesrunde johlte, Mizzi kicherte vor sich hin.
Den Wunsch, vielleicht selbst einmal ein derartiges Luxusgefährt zu
besitzen, äußerten wir nicht. Er kam gar nicht auf, denn er schien uns zu
vermessen.
Weihnachten erlebte ich als eine geradezu magische Zeit. Am Nachmittag des
Heiligabend, der sich in Erwartung des Christkinds endlos lang hinzog,
nisteten Mizzi und ich uns immer bei der Familie Prosch ein, wo wir ohne An-
meldung oder Einladung stets willkommen waren. Man klopfte einfach an die
Wohnungstür, fragte ob Raini oder Günther zu Hause seien, wurde eingelassen
und gehörte dazu. Im einzigen größeren Zimmer zeichneten wir auf dem Ess-
18/186

und Arbeitstisch mit Aquarellfarben hingebungsvoll goldene Engel auf Sch-
ablonen, widmeten uns aber auch, wenn man uns allein ließ, ganz anderen und
viel spannenderen Dingen. Herr Prosch besaß aus Militärbeständen un-
geklärter Herkunft noch mehrere Revolver samt Munition aus der Zeit des
Zweiten Weltkriegs, die er uns schon öfter mit Stolz vorgeführt hatte. Die hol-
ten wir in seiner Abwesenheit aus dem unversperrten Kasten hervor, gingen
damit in den Keller, luden sie, wie Herr Prosch es uns gezeigt hatte, mit schar-
fer Munition und schossen zum Zeitvertreib an wenig einsichtigen Stellen auf
Ziele in den meterdicken Hauswänden. Ich entpuppte mich als gute Schützin.
Etwa um fünf Uhr, wenn die Spannung bereits unerträglich geworden war,
hörten wir ein Glöcklein läuten. »Das Christkind war da!« Ich verabschiedete
mich schnell von meinen Freunden, stürzte die Stiege hinunter und hinein in
das Schlafzimmer meiner Eltern, wo mich die Pracht eines Lichterbaums über-
wältigte. Und erst die darunter ausgebreiteten Geschenke! Und der überirdis-
che Duft von Kerzen. Alles war wunderbar.
Den Rest des Abends probierte ich die neue praktische Kleidung und ärgerte
mich ein wenig, dass ich anstelle der gewünschten roten Schuhe wieder nur
braune bekommen hatte. Dann packten wir das
DKT
– Das kaufmännische
Talent – aus und spielten, gewannen und verloren Häuser, Hotels, Straßen, ja,
ganze Städte. Viel später als üblich, umweht von dem köstlichen Duft der
gelöschten Kerzen des Christbaums, kroch ich unter die warme Daunendecke
meines Betts und schlief zufrieden ein. Gab es noch Schöneres?
19/186

Kapitel 2
2
Mit dem Eintritt in das Realgymnasium, wohin mein bildungsgläubiger Vater
mich als gute Schülerin nach eingehender Beratung mit meiner Lehrerin
schickte, erfuhr mein Leben eine dramatische Wende. Und zwar zum Sch-
lechteren. Eine harte Zeit brach für mich an. Zuerst verließ mich Mizzi, die
heitere Gefährtin vieler lustiger Stunden. Ihre Eltern hatten noch den Ab-
schluss der Volksschule abgewartet, dann übersiedelten sie samt Tochter nach
Wien, wo sie sich bessere Verdienstmöglichkeiten erhofften. Der Rest der
Bande war aufgrund mangelnden Bildungshungers und dementsprechend
schlechter schulischer Leistungen für die Hauptschule und anschließend für
eine handwerkliche Lehre vorgesehen. Raini und Günther sollten nach dem
Vorbild ihres Vaters den Installateursberuf erlernen, Otti einmal die elterliche
Bäckerei übernehmen, Waldi in die Fleischerei seines Onkels eintreten, und
der etwas begriffsstutzige Seppi sah einer Zukunft als Maurer entgegen. Er-
staunlich rasch entglitten sie meiner strengen Führung, schlossen Freund-
schaft mit anderen Buben – wir entfremdeten uns zusehends. Bald wurde klar:
Die schönen Tage wilder Streiche gehörten für immer der Vergangenheit an,
die Kindheit näherte sich rapide ihrem Ende. Der Ernst des Lebens begann. Oft
sah ich meine einstigen »Vasallen« vor ihren Häusern beim fachkundigen Zer-
legen und Reparieren ihrer Fahrräder, hörte, wie sie über ordinäre Witze lacht-
en. Unter meinem Regime wäre dies nicht möglich gewesen! Traf ich sie zufäl-
lig auf der Straße, mieden sie mich. In ihren Augen war ich als Gymnasiastin
»etwas Besseres«.
Damit saß ich zwischen zwei Stühlen, gleichsam im Niemandsland. Zwis-
chen mir und meinen alten Freunden hatte sich eine tiefe Kluft aufgetan. Eine
ebensolche trennte mich von meinen neuen Klassenkameradinnen, die meisten
von ihnen Fahrschülerinnen aus der näheren und weiteren Umgebung unserer

Bezirkshauptstadt. Im Unterschied zu mir stammten sie aus »besseren« Kreis-
en, hatten Ärzte, Rechtsanwälte oder gut situierte Geschäftsleute als Eltern. Die
»höheren Töchter« trugen modisch schwingende, teure Kleider samt steifer
Unterröcke. Unter toupierten Frisuren blickten sie voll Hochmut auf mich
herab – ich war für mein Alter eher klein. Einige waren, was eine zunehmend
wichtige Rolle spielen sollte und von mir nicht geleugnet wurde, hübsch, viel
hübscher als ich selbst. Auf jeden Fall schlanker.
Zum ersten Mal kamen mir auch Standesunterschiede zu Bewusstsein. Geld,
bis dahin eine Nebensächlichkeit, gewann plötzlich an Bedeutung. Über das
Gehalt, das mein Vater pünktlich jeden Ersten vom Staat erhielt, wurde nie mit
mir gesprochen. Sein Beamtenstatus mit Pensionsberechtigung entsprach dem
Wunsch meiner Eltern nach finanzieller Sicherheit. Beide hatten vor und nach
dem Zweiten Weltkrieg schwere, entbehrungsreiche Zeiten erlebt, nun waren
sie mit ihrer Existenz vollkommen zufrieden. Der Tradition entsprechend, ver-
fuhren sie mit der väterlichen »Besoldung«, wie es damals noch hieß, nach ein-
er einfachen Regel – zwei Drittel gaben sie für das tägliche Leben aus, ein Drit-
tel legten sie als Notgroschen auf ein Sparbuch.
Ich selbst verwaltete mein Taschengeld, wie mir schien, meisterlich, sparte
einen Teil und verprasste den Rest beim Konditor. Es war eine große Freude, in
das kleine Geschäft von Herrn Maxer einzutreten und mich beraten zu lassen.
»Bitte, was krieg ich für einen Schilling?« Der Zuckerbäcker liebte Kinder.
Geduldig und wohlwollend machte er Vorschläge. »Zehn Stollwerck oder eine
kleine Tafel Bensdorp-Schokolade, fünf Deka Seidenzuckerl – oder möchtest
du lieber ein Eis?« Mir fehlte nichts, bis mir die neue Umgebung die Ärmlich-
keit unseres Lebens vor Augen führte. Ich schämte mich.
Mit den reichen Mädchen aus meiner Klasse konnte ich nicht konkurrieren.
Sie zu beeindrucken, ja, sie zu dominieren war ein Ding der Unmöglichkeit.
Einsam, unglücklich und ausgeschlossen, tröstete ich mich an langen,
eintönigen Nachmittagen mit Essen und noch mehr Essen. Meine plumpe Er-
scheinung trug nichts zur Verbesserung meiner Situation bei. In »Leibesübun-
gen« wurde ich zum allgemeinen Gespött, da es mir einfach unmöglich war,
das Reck zu erklimmen. Bei Wettläufen keuchte ich stets als Letzte ins Ziel. Zu
21/186

Partys, von denen sich die anderen Mädchen in einem Winkel des Klassenzim-
mers geheimnisvoll wispernd erzählten, lud man mich nicht ein.
Mein freches Selbstbewusstsein schwand dahin, ich wurde verklemmt und
schüchtern. Schweißgebadet schreckte ich des Nachts aus fürchterlichen Alb-
träumen hoch, in denen ich zitternd vor Angst bei Mathematik-Schularbeiten
saß und keine einzige Aufgabe lösen konnte. Vom Lateinlehrer zur Tafel
gerufen, wusste ich keine Vokabeln. Manchmal stand ich auch an einem offen-
en Fenster, kletterte auf das Gesims, breitete die Arme wie Flügel weit aus und
flog mit raschen Schlägen davon. Kühle Luft umfächelte meinen
durchgestreckten Körper, mein Nachthemd bauschte sich im Abendwind. Ich
zog Kreise, schwebte hoch am Himmel und blickte in das weite, mit bizarren, in
ein fahles Licht getauchten grünlichen Felsen überzogene Land. Mühelos
schraubte ich mich hoch und höher, in einem atemberaubenden Spiralflug dre-
hte ich mich lustvoll um die eigene Achse. Schwungvoll zog ich meine Kreise,
bis ich voll Entsetzen merkte, dass meine Arme erlahmten, ich mich nicht mehr
in der Luft halten konnte. Alle verzweifelten Anstrengungen, mit zusam-
mengebissenen Zähnen und in höchster Konzentration, erwiesen sich als
vergeblich. Unter mir tauchte ein riesiger See auf, der näher und näher kam.
Beim Eintauchen in das eisige Wasser merkte ich, dass ich nicht schwimmen
konnte. Verzweifelt ruderte ich mit den Armen. Den schwarzen Schwimmreifen
vor mir konnte ich nicht fassen, obwohl er zum Greifen nah war. Namenloser
Schrecken erfüllte mich, es wurde dunkel. Langsam sank ich auf den Grund
hinab, tief, immer tiefer. Die Angstvisionen blieben oft bis zum Mittag des fol-
genden Tages präsent.
»Die Hermi schaut gar so traurig drein. Ich glaub, sie ist recht unglücklich in
der neuen Schule«, hörte ich meine Großmutter sagen.
»Das ist die Umstellung. Samma froh, dass sie nimmer mit den Buben un-
terwegs ist«, antwortete meine Mutter.
Betrübt und mit hängenden Schultern schlich ich umher, zog mich zurück und
saß den ganzen Nachmittag allein zu Hause, obwohl man mich bei schönem
Wetter häufig ermahnte: »Warum gehst denn net an die frische Luft? Es is so
22/186

angenehm draußen!« Ich verfasste schaurige, von trauriger Sentimentalität
triefende Geschichten, die ich am Abend vorzulesen pflegte: »Woher nimmt
das Kind nur diese ung’sunde Fantasie?«, wunderte sich meine Mutter. Ich las
alle Romane von Jules Verne, verschlang mindestens fünfzig Bände von Karl
May, vertiefte mich in die »Schatzinsel« von Robert Louis Stevenson und ent-
deckte mit Sherlock Holmes die Faszination von Kriminalromanen. Wenn ich
mich nicht, ans Fenster gekauert, in Bücher vertiefte, kümmerte ich mich um
den schwarzen Kater, der als Einziger von der im Hof lebenden Katzenfamilie
übrig geblieben war. Die sogenannte »alte« Katze war gestorben, ihre drei
Kinder hatten ein neues Heim gefunden. Meinen tierischen Freund nannte ich
»Peterl«. Frau Zottl, der alten Frau aus dem »Ausnahmstüberl«, war der
muntere Kater, der oft in ihrem kleinen Blumenbeet scharrte, um dann seine
Notdurft zu verrichten, ein Dorn im Auge. Sie sah es daher nicht ungern, wenn
ich ihn in unsere Wohnung trug, wo er in Abwesenheit meines Vaters, der dies
als schweren Verstoß gegen die Hygiene empfand, auf dessen alter Freizeithose
schlummerte. Hörte ich Papas Schritte im Flur, wenn er am späteren Nachmit-
tag aus dem Amt nach Hause kam, schob ich den schlaftrunkenen Peterl, der
nicht wusste, wie ihm geschah, schnell aus dem ebenerdigen Fenster. Manch-
mal hob mein Vater den Kopf, um misstrauisch zu schnuppern. Ohne Zweifel!
Seine Kleidung, auf der sich der Kater kurz davor noch geräkelt hatte, fühlte
sich nicht nur warm an, sie roch auch kätzisch. Er ahnte, dass ich sein Verbot,
obwohl ich es mit unschuldigem Blick vehement leugnete, vor allem bei Regen
und Kälte umging.
Peterl mit dem seidig glänzenden schwarzen Fell und dem weißen Schwanz
sollte kein langes Leben beschert sein. Nach einem kurzen, glücklichen Dasein
fand er ein qualvolles Ende. Niemand bemerkte, dass die bereits etwas verwir-
rte Frau Zottl abermals Rattengift in den Ecken des Hofs ausstreute, wie sie
dies schon einige Male getan hatte. Diesmal war jedoch keiner zur Stelle, um
die dunkelgrünen Giftperlen rechtzeitig zu entfernen. Peterl fraß die
wohlschmeckende, nicht für ihn bestimmte Mahlzeit, und bald schreckte das
klägliche Miauen des sterbenden Tiers die Hausbewohner auf.
Frau Zottl gestand ihre Tat ohne Reue: »Na, konn man nix mochen, waas
ma wenigstens, dass wirkt!« Ungerührt trippelte sie, wie immer gegen Abend,
23/186

die kurze Strecke zum Gasthaus am Ende der Schlossergasse. Im Beisl »Zum
goldenen Löwen« holte sie ihr tägliches Viertel Rotwein ab, das die gutmütige
Wirtin Frau Zottl in Anbetracht ihres hohen Alters quasi als Medizin kostenlos
ausschenkte. Nicht ganz zufällig wurde ich Zeugin, wie die alte Frau beim
Heimweg in der dunklen Einfahrt hinfiel. Es sah aus, als ob sie im Gehen an
dem übervollen Glas genippt hätte und dabei gestolpert wäre. Mit »Hoben’s
Ihna weh tan?« eilte ich ihr sofort zu Hilfe, wobei ich rasch den dünnen Faden
entfernte, den ich in zwanzig Zentimeter Höhe sorgfältig zwischen den für den
Winter gestapelten Holzstößen gespannt hatte. Frau Zottl lag jammernd auf
dem Boden. »Au, meine Hüfte! Meine Hüfte! Ich kann net aufstehen! Des tut
weh!« Noch immer hielt sie das Rotweinglas umklammert, dessen über ihr
Kleid verschütteter Inhalt einen üblen Geruch verbreitete. Bei dem Sturz hatte
sie sich einen Bruch des rechten Oberschenkelhalsknochens zugezogen, der
schwer verheilte. Sie konnte sich nicht mehr allein versorgen und landete in
einem Pflegeheim. Ich habe sie nie mehr gesehen und auch nicht vermisst.
Von da an erhellte sich das schwarze Loch, in dem ich zu versinken gedroht
hatte. Wie durch ein Wunder ging es mit mir bergauf. Meine seelische Ge-
sundung unterstützte ich durch aufmunternde Lektüre. »Die neue Klasse« von
Milovan Djilas aus der städtischen Bücherei entsprach jedoch nicht meinen Er-
wartungen. »Damit wirst ka Freud ham!«, prophezeite mir der ältere Biblio-
thekar mit der runden Brille ganz richtig. Tatsächlich entpuppte sich der ver-
meintliche Seelenratgeber für Jugendliche als ein kritisches Werk über den
Kommunismus – ich hatte Klasse mit Schulklasse verwechselt.
»Wos suchst denn eigentlich?«, wurde ich beim Zurückbringen des Buches
gefragt. Verlegen stotternd brachte ich mein Anliegen vor: »Si wolln mi net! Sie
lachn über mi!« Der belesene Mann, der als Pensionist die Leitung der
Städtischen Bücherei übernommen hatte, hob nachdenklich die Augenbrauen,
dann tröstete er mich: »Das ist normal in deinem Alter. Is uns allen so gan-
gen!« Er tauschte die hochpolitische Streitschrift gegen »Autosuggestion für
Anfänger«.
Ich las darin, befolgte die Ratschläge und gewann an Selbstvertrauen. »Es
geht mir jeden Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser!«, murmelte ich,
24/186

wie empfohlen, zwanzig Mal täglich halblaut vor mich hin. Für jede Notlage
gab es passende Sprüche. »Ich glaube es – ich glaube es – ich glaube es!« mo-
bilisierte, morgens vor dem Spiegel gesprochen, meine geheimen Kräfte. Seel-
ische Belastungen verscheuchte ich einfach mit »Es geht-weg-weg-weg-weg«,
und Schularbeiten schaffte ich mühelos mit »Ich kann – kann – kann«. Im
Übrigen galt: »In mir wohnt eine unermesslich große Kraft!« – »Jessas, jetzt
redt die Hermi mit sich selber«, entsetzte sich meine Großmutter, als sie beim
Kartoffelschälen in der Küche zufällig Zeugin meiner Selbstgespräche wurde.
Die Probe aufs Exempel fand statt, als unser nur durch den steifen weißen Kra-
gen als Priester erkennbarer Religionslehrer eines Tages eilig das Klassenzim-
mer betrat. Er kam direkt aus der Morgenmesse, war danach aufgehalten
worden und hatte sich etwas verspätet. Säuberlich trug er die Fehlenden im
Klassenbuch ein, dann stand er auf, um den Unterricht zu beginnen. Ich hob
die Hand. »Nun, Meier?«, fragte er milde. »Herr Professor, Sie haben das
Hosentürl offen!«, klärte ich den Geistlichen über seinen kleinen Toiletten-
fehler auf. Meine Mitschülerinnen erstarrten,waren jedoch hocherfreut über
die willkommene Unterbrechung, und ich erntete zustimmende Blicke ob
meiner Frechheit. Der geistliche Herr räusperte sich verlegen, errötete, kehrte
uns den Rücken zu und fummelte an seiner Hose. Wenig später stieß er aus
schmalen, zusammengepressten Lippen ein knappes »Danke!« hervor. Ein
lautes Kichern erfüllte den Raum, ich sah bescheiden zu Boden. In der Pause
feierte man mich als Heldin. Christl, Klassenbeste und Leitfigur, lobte: »Toll,
Hermi!« Mein Status erfuhr einen wundersamen Wandel. Von da an blickte ich
nicht mehr zurück – man achtete und respektierte mich.
In der Deutschstunde fuhr ich einen weiteren Triumph ein. »Meier, die erste
Strophe von der ›Glocke‹!«, rief der hagere, leicht bucklige, weißhaarige Lehr-
er, der kurz vor der Pensionierung stand. »Du weißt, es war bis heute zu
lernen!« Ich merkte, dass unser ziemlich tauber Lehrer sein Hörgerät nicht
trug, anscheinend hatte er es vergessen. Seiner Aufforderung kam ich gern
nach, denn ich hatte mich gut vorbereitet. Mit beredten, schwungvollen
Gesten, rollenden Augen und ausdrucksvoller Mimik bot ich das bei
Deutschpädagogen überaus beliebte Gedicht von Friedrich Schiller dar: »Das
25/186

Lied von der Glocke. Fest gemauert in der Erden steht die Form aus Lehm
gebrannt. Heute muss die Glocke werden … frisch«, hier beugte ich mich dram-
atisch vor und stampfte anfeuernd mit dem Fuß auf, »Gesellen, seid zur
Hand«. Bei »Von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß« wischte ich mir
heftig über das Gesicht. In der ganzen Zeit entfuhr meinen wild bewegten Lip-
pen kein Laut, was den schwerhörigen alten Herrn sichtlich verwirrte. Er legte
seine Hand an das rechte Ohr und lauschte angestrengt. Er hörte nichts, denn
es war nichts zu hören. Schließlich zog er sich aus der Affäre: »Genug, das hast
du gut gelernt! Schön, sehr schön. Setzen.« Dann wandte er sich zur Klasse:
»Ich weiß nicht, was es bei diesem erhabenen Klassiker zu lachen gibt. Und
merkt euch: Man macht beim Sprechen den Mund auf. Wie Meier soeben!«
Ich sorgte auch weiterhin für ausreichend Spaß. Zum Schrecken der Lehrer
avancierte ich zum Unterhaltungsprofi. Meine anfangs passablen Noten sanken
in den Keller. Hausaufgaben schrieb ich, wenn überhaupt, grundsätzlich nur
während der Religionsstunde. Hefte führte ich nur sporadisch, sodass jede
Vorbereitung auf Prüfungen illusorisch wurde. In den meisten Fächern lavierte
ich stets zwischen Genügend und Nicht genügend. Gegen Ende der 7. Klasse er-
hielt ich die dritte Mathematikschularbeit in Folge mit einem »Nicht genü-
gend« zurück. »Du bist zu faul. Den Kasperl zu spielen ist leichter, aber halt zu
wenig!«, ätzte der unsympathische Pädagoge.
Ein »Sitzenbleiben«, also die Wiederholung einer Klasse, drohte. Diese
Schande sowie den Verlust eines ganzen Jahres galt es zu verhindern. Leicht
beunruhigt trug ich meine Arbeit nach Hause. Die Unterschrift der Eltern
fälschte ich zu diesem Zeitpunkt schon routinemäßig und sehr perfekt. Das war
kein Problem und rettete den häuslichen Frieden. Doch zum Aufsteigen in die
8. Klasse benötigte ich unter allen Umständen ein positives Ergebnis.
Schließlich kam mir eine verblüffend einfache Idee, die ich als Krönung
meiner Schulzeit empfand. Im Nachhinein habe ich mir selbst dazu gratuliert.
Nicht ganz so faul, wie mich der dumme Rechenmaxl einschätzte, löste ich
mithilfe von Pauli, unserer besten Mathematikerin, ein Beispiel der verfehlten
Schularbeit. Den Rechenvorgang notierte ich sorgfältig auf einem Zettel. Zu
Hause, allein im stillen Kämmerlein, nahm ich mir das Heft vor, bog die Heftk-
lammer in der Mitte auf und fügte eine neue Seite ein, auf der ich zuvor in
26/186

bewusst schlampiger Schrift mit vielem Durchstreichen und Ausbessern die
Aufgabe gerechnet hatte. Eine wahre Meisterleistung der Kalligrafie! Am da-
rauffolgenden Tag überreichte ich mein Werk, wobei ich Augenkontakt mied
und schüchtern zu Boden sah: »Herr Professor, ich glaube, Sie haben etwas
übersehen!« Dieser blickte mich scharf an: »Sollte ich mich tatsächlich geirrt
haben? Ich schau mir das nochmals an!« Grollend akzeptierte er meine erstk-
lassige Fälschung. Ich war gerettet.
Das Zeugnis am Ende des Schuljahrs bot ein schönes, weil grafisch vollkom-
men einheitliches Bild – ein »Genügend« reihte sich an das andere. Die Zahl
der Fehlstunden war enorm, denn ab der 7. Klasse nahm ich mir jede Woche
zumindest einmal frei. An diesem Freudentag verließ ich am Morgen, wie ge-
wohnt, pünktlich das Haus. Mein Weg führte mich allerdings nicht zur Schule,
sondern in ein kleines Espresso-Café, wo mir das Läuten der Kirchenglocke um
acht Uhr, das gleichzeitig den Beginn des Unterrichts bedeutete, wie Musik in
den Ohren klang.
Als ich schließlich das Realgymnasium mit einer miserablen Matura abschloss,
stellte sich meinen Verwandten die Frage: »Was soll die Hermi werden? Was
will sie denn selbst?« Ich zeigte keine Präferenz für einen bestimmten Beruf,
denn Arbeit in jeder Form widerte mich an, ich liebte den Müßiggang. Doch ein
Broterwerb musste sein, und so wandte sich meine Mutter an ihren Bruder.
»Er soll sie irgendwie unterbringen«, war man sich bald einig. Onkel Rudi
lebte in Wien, wo er es mit viel Fleiß bis zum Leiter einer Bankfiliale in
Währing gebracht hatte. Mein Vater reiste mit mir zu einem Vorstellungsge-
spräch, wobei er es für klüger hielt, das Maturazeugnis daheim zu lassen – ein
listiger Schachzug, den ich ihm als stets korrektem Staatsdiener nicht zugetraut
hätte. Danach befragt, meinte er, es sei halt durchschnittlich, und versprach, es
nachzureichen. Ich wurde zur Probe angestellt. So kam es, dass ich wie die
meisten meiner Mitschülerinnen nach Wien übersiedelte und ein kleines Zim-
mer in Untermiete bezog.
27/186

Kapitel 3
3
Die mir kaum bekannte Großstadt enttäuschte mich. Dunkle, schmutzige graue
Fassaden öder Mietshäuser entlang düsterer, abends schlecht beleuchteter
Straßen. Ein morbider Hauch hing über der in zahllosen Liedern besungenen
Metropole, in der man gern über den Tod sprach. Wien entpuppte sich als
überaus stille Stadt, voll von Weltschmerz und elegischer Lustigkeit, mit pess-
imistischen, geradezu von Selbsthass erfüllten Menschen. Man »raunzte«,
beklagte die stets schrecklichen Zustände und bedauerte sich zutiefst. Doch
Vorsicht! Stimmte ein Fremder, und sei es auch nur in mildester Form, in die
düster-schwarze Kritik ein, empfand man dies als unerhörtes Sakrileg und wies
ihn scharf zurecht: »Sie, was erlauben Sie sich? Wo san ma denn?«
Allgemeines Lob wurde nur der Wiener Luft und dem Wiener Wasser zuteil.
So begrüßte man den ständigen Kopfschmerzen verursachenden Westwind:
»Gott sei Dank, er bringt uns gute Luft aus dem Wienerwald.« Auch von der
Qualität des Trinkwassers schwärmte man in höchsten Tönen: »Ah, das Wien-
er Hochquellenwasser, kommt hundert Kilometer von unsern Hausbergen, der
Rax und dem Schneeberg. Woanders tät man das in Flaschen füllen und
verkaufen.«
Erst allmählich erschloss sich mir der Charme der Wienerstadt, schätzte ich
das »goldene Wienerherz« mit seiner sprichwörtlichen Gemütlichkeit und
noch mehr den herben »Schmäh«, mit dem man sich das Leben erleichterte.
Ich lernte ihn kennen, als in meiner Gasse die Straßenmarkierung erneuert
wurde. Ich roch die weiße Farbe, empfand sie als angenehm und schnupperte
nochmals. Einer der Arbeiter sah meine Miene und meinte scherzhaft: »Soll’n
ma Ihna sogn, wo ma morgen san?« Und als mich ein Schaffner in der Straßen-
bahn warnte: »Haltn’s Ihna an, Fräulein, mir fahrn ums Eck!«, verfiel ich, wie
viele »Zuagraste«, der Stadt mit den vielen Facetten und der wunderschönen
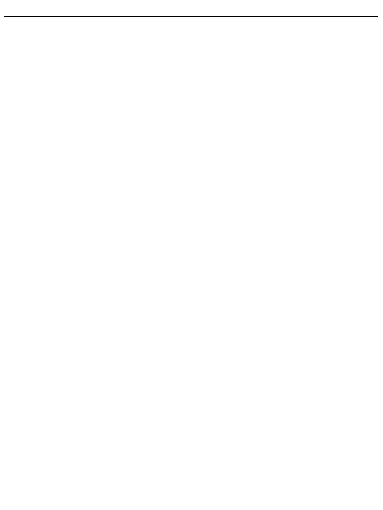
Umgebung vollkommen. Bald antwortete ich auf die oft gestellte Frage: »Sag,
möchst du woanders leben?« mit dem Brustton der Überzeugung: »Na, nir-
gends!«, um anschließend die unhaltbaren Übelstände meiner Wahlheimat zu
beklagen.
Auch mein ungewohntes Dasein als Arbeitssklavin machte mir sehr zu schaf-
fen. Jeden Tag trottete ich morgens kurz vor neun Uhr in die Filiale der Com-
merzbank in der Währinger Straße. Eine Zeit lang schien mir der Posten, den
ich dem Onkel Rudi verdankte, sogar erstrebenswert. »Und du schiebst eine
ruhige Kugel«, meinte meine Mutter. Zu ruhig, wie es sich bald herausstellte.
Meistens versah ich öden Schalterdienst. Nie war es aufregend, die oft un-
höflichen Kunden beim Ausfüllen ihrer Geldüberweisungen zu beraten, ihnen
die Bewegungen ihres Kontostands zu erklären und mit ihnen, die sich, aufge-
hetzt von den Medien, überaus klug und gewieft dünkten, über marginale Zin-
serhöhungen ihrer Spareinlagen zu feilschen.
Auf meinem Konto traf jeden Monat ein bescheidenes Gehalt samt Bonus
ein – je nachdem, wie die undurchschaubaren Geschäfte des Geldinstituts
liefen, das bereits mehrmals den Eigentümer gewechselt hatte. Angesichts der
riesigen Summen, die jeden Tag druckfrisch, gebündelt und mit Schlaufen
versehen aus der Nationalbank geliefert wurden und an den Kassen die Bes-
itzer wechselten, schien mir das ein Affront. Millionen, täglich zum Greifen
nah! Und ich, abgespeist mit ein paar mickrigen Scheinchen! Wenn nichts zu
tun war, lehnte ich gelangweilt hinter meinem Pult und brachte Ordnung in
meine Formulare. Meist jedoch stierte ich ins Leere. »Ah, das Fräulein Meier
träumt schon wieder. Vielleicht von einem Märchenprinzen? Jung müsste man
halt sein«, seufzte der gutmütige Herr Loidolt, der pedantische Hüter des Kas-
senschalters. Welche Ahnungslosigkeit! Der biedere Mann, der, wie er oft
klagte, unter hohem Blutdruck litt, ahnte nichts von der gefährlichen Aufre-
gung, die ihm bevorstand. Plante ich doch einen kleinen, aber feinen Überfall.
Bislang hatten Geldräuber unsere Bank gemieden, sie geradezu verschmäht,
obwohl sie an einer belebten Verkehrsader lag und ihr auffälliges Glas-Entree
verlockend ins Auge sprang. Andere, weniger attraktive Filialen der Com-
merzbank waren, wie ich hörte, nicht nur einmal, sondern schon mehrmals
29/186

ausgeraubt worden. Warum diese offensichtliche Diskriminierung? Gab es für
dafür einen Grund? Auf jeden Fall ein Lapsus, den zu beheben es höchste Zeit
war.
Aus der an Kriminalität reichen jüngsten Zeit war mir kein einziger Fall
bekannt, bei dem Angestellte die eigene Bank ausgeraubt hatten. Eigentlich
schade, dass Insider ihr reiches Wissen über Alarmanlagen, Fluchtwege und
Geldtransporte nicht nutzten. Sie fälschten, wie man las, kunstvoll Bilanzen,
unterschlugen und veruntreuten auch ihnen anvertrautes Geld, vor roher Ge-
walt schreckten sie jedoch zurück. Da ich selbst nur rudimentäre Kenntnisse in
Buchhaltung besaß, entschied ich mich daher für Letzteres. Jemand musste
schließlich den Anfang machen. Ich überlegte hin und her, erwog, änderte, ver-
feinerte und verwarf die verschiedensten Pläne, bis ich mich schließlich
entschied.
Der maßgeschneiderte Raub sollte folgendermaßen ablaufen: Um 10.30 Uhr
herrscht in der Filiale Währingerstraße stets Hochbetrieb. Hermine M. geht in
das Souterrain der Bank. Darin sieht niemand etwas Auffälliges, denn im Un-
tergeschoss befinden sich die Tresore der Kunden. In einem unbeobachteten
Moment betritt sie die dortige Kundentoilette. Sie streift einen bodenlangen
schwarzen Umhang über und setzt eine dazu passende, adrette Maske mit der
Darstellung einer freundlichen Katze auf, in die sie einen schmalen Sehschlitz
geschnitten hat. Um größer zu wirken, schlüpft sie in Schuhe mit Plateau-
sohlen. Ihrer Handtasche entnimmt sie eine Pistole, die sie beim letzten Be-
such zu Hause bei Herrn Prosch hat mitgehen lassen. Ist sie bereit, dann rennt
sie die Treppe hinauf, direkt in Richtung Kasse. Wortlos richtet sie ihre Waffe
auf den ängstlichen Herrn Loidolt, schiebt ihm einen Zettel zu: »Überfall! 500
000 Schilling, schnell, oder es gibt ein Blutbad.« Die genannte Summe hat sie
genau kalkuliert. Sie darf nicht zu hoch sein, damit der Mann an der Kasse kein
Risiko eingeht. Er befolgt die für einen derartigen Fall erhaltenen Richtlinien
und händigt das Geld in 5000-Schilling-Scheinen aus: Hundert Banknoten, ein
kleines Päckchen. Zur Einschüchterung der Menschen, die auf dem Boden
kauern, gibt Hermine M. ein paar Warnschüsse in die Decke ab. Sie rafft das
Geld an sich, rennt dem Ausgang zu, wobei sie die Kunden in Schach hält. Sie
verschwindet im Hauseingang gleich neben der Bank, wo sie die Maske
30/186

abstreift und sich in die biedere Angestellte zurückverwandelt. In dem allge-
meinen Tumult mischt sie sich unauffällig wieder unter das Personal der Bank.
Der Überfall bleibt ungeklärt. Zwei Monate nach dem Vorfall kündigt Her-
mine M. ihren Posten. Sie gibt an, dem aufregenden Leben in der Großstadt
nicht gewachsen zu sein, seit dem Banküberfall unter Angstträumen zu leiden
und in ihre Heimatgemeinde zurückkehren zu wollen. Sie stößt auf wohl-
wollendes Verständnis. Aufgrund ihrer Faulheit und Ineffizienz hinterlässt ihr
Abgang keine Lücke.
»Träume sind Schäume« heißt es nicht zu Unrecht. Den meisten Menschen ist
es leider nicht vergönnt, ihre Wünsche zu verwirklichen. Ich bildete da keine
Ausnahme, denn ich schreckte vor der Ausführung meiner kühnen Pläne
zurück. So sah ich mich weiterhin Tag für Tag mit der harten Realität des
Lebens konfrontiert. In Anbetracht meiner prekären Finanzlage zählte ich auf
die Unterstützung durch meine liebe Mutter. Regelmäßig schickte sie mir
»Fresspakete« mit nahrhaftem Inhalt – Blutwürste und geräucherter Speck,
Grammelknödel mit Sauerkraut, schwarzes Brot und Guglhupf. Das half mir
sparen, denn ich ernährte mich fast ausschließlich von ihren milden Gaben.
Meine Figur ging dabei noch weiter aus dem Leim, mit dem Geld kam ich
trotzdem nur schwer aus – nach der Bezahlung von Miete, Strom und Gas blieb
nicht viel übrig. Das war umso trister, als ich zu dieser Zeit nach Marken-
artikeln geradezu gierte und mich ärgerte, dass ich mir, umgeben vom Luxus
der Großstadt, so wenig leisten konnte. Meine Garderobe bestand daher aus
»Schnäppchen« teurer Designermode, die ich im Ausverkauf billig erwarb.
Bald konnte ich mich nicht mehr erinnern, etwas zum regulären Preis er-
worben zu haben. Und so präsentierte ich mich auch. Im sündteuren Mantel
aus Alpakawolle, der aufgrund seiner grellorangen Farbe lange keine Käuferin
gefunden hatte, bis man ihn auf ein Drittel des Preises reduzierte und mir
überließ. Ich besaß auch einen roten Kaschmirpullover, der zwar etwas eng an-
lag, aber sehr preisgünstig gewesen war. Leider konnte niemand das an der
Innenseite angebrachte Etikett mit der Aufschrift »Christian Dior« sehen. Viele
meiner italienischen Markenschuhe waren Okkasionen. Sie drückten mich oft
fürchterlich, und ich hoffte, dass meine vorstehenden Überbeine – ein Erbe
31/186
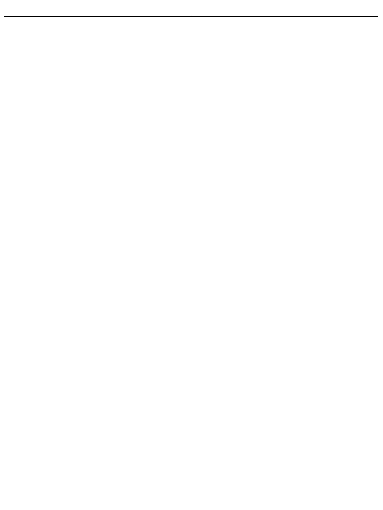
von Großmutter und Mutter, die beide unter Deformierungen der Füße lit-
ten – nicht allzu sichtbar wurden.
Auch Kosmetika leistete ich mir nie, obwohl ich in den großen Droger-
iefilialen in der Nähe meiner Bank zur treuen Stammkundschaft zählte. So
streifte ich jeden Morgen durch die Geschäfte, wobei ich, um nicht aufzufallen,
meine Gunst nach einem genau erdachten Plan reihum auf die Parfümerien
verteilte. Dort rüstete ich mich für den Tag, denn als »Tester« markierte
Utensilien gab es zuhauf. Zuerst zog ich mit einem Kajalstift einen gekonnten
Strich auf meine Lider. Dann trug ich Lidschatten und Make-up auf, bestäubte
mein Gesicht mit losem, schön transparentem, sündteurem Puder. Bei der Ver-
wendung der Produkte achtete ich stets auf erste Qualität. »Ich liebe Prada«,
freute ich mich, wenn ich mich am Ende meiner Toilette mit dem teuersten
Parfum des Regals von oben bis unten bestäubte und, gleichsam auf Vorrat,
mein Taschentuch damit durchtränkte.
Trotz intensiver Schönheitspflege hielt sich das Interesse junger Männer an
meiner Person in sehr engen Grenzen. Über Belästigungen durch das starke
Geschlecht konnte ich mich nicht beklagen, zu meinem großen Bedauern ver-
schonten mich »Stalker« jeder Art. Mir fehlte männliche Gesellschaft, ich
sehnte mich nach Liebe, Flirt und Abenteuer. Eine Schule für modernen
Gesellschaftstanz sollte diesen Mangel beheben.
Positive Gedanken überfluteten mein Hirn. Zu allererst: Tanzen killt Kalori-
en. Bei einer Stunde Walzer verliert man 360 Kalorien, den Gegenwert von
hundert Gramm Blutwurst. Eine Stunde Rock’n’ Roll würden weitere 500 Kal-
orien verbrennen. Abgesehen von einem Training der Bauch-Rücken- und
Beinmuskeln, das mir ein Fitness-Studio ersparte, sollte Cha-Cha-Cha meine
Anmut und Ausdauer fördern und ganz nebenbei meine beiden Gehirnhälften
positiv stimulieren. Das beim Tanzen in erhöhtem Maße ausgeschüttete Sexu-
alhormon Testosteron wiederum würde mir den ersehnten Partner bescheren.
Beflügelt von großen Erwartungen eilte ich daher nach Büroschluss
»aufgemascherlt« zur Tanzschule. Zunächst wies man uns an, auf der langen
Bank Platz zu nehmen, die an der Stirnseite des durch einen Kristalllüster in
gleißendes Licht getauchten festlichen Saals mit seinem spiegelnden Parkett
32/186

stand. Burschen mit weißen Handschuhen verbeugten sich höflich vor den
sitzenden jungen Damen. Ein Mädchen nach dem anderen wurde aufgefordert
und entschwand. Bald war das Parkett voll mit fröhlichen Paaren, die sich zu
den Klängen eben gelernter Tanzschritte flott im Kreis drehten. Niemand woll-
te mich; mitleidig beäugt von allen, blieb ich allein zurück. Schließlich rief die
in einen strengen dunklen Hosenanzug gekleidete, vornehm sprechende
Kursleiterin ein korpulentes Bürschchen mit rotem, pickelübersätem Gesicht
energisch zu sich, ihre ausgestreckte Hand wies auf mich. Widerwillig ge-
horchte er der herrischen Geste, ging linkisch auf mich zu und holte mich zum
Tanz.
Auf diese Weise lernte ich zwar Foxtrott, Boogie und Walzer, doch der
Zweck meiner rhythmischen Übungen, nämlich Arznei für Figur und Herz zu
sein, erfüllte sich nicht. Die feschen, großen und guten Tänzer mieden mich.
Sie schwebten beim feurigen Tango Argentino mit ebensolchen feschen, großen
und guten Tänzerinnen an mir vorbei, während mein hässlicher Partner mit
den schwitzenden Händen und den zahllosen Hautunreinheiten im Gesicht
erbarmungslos auf meinen zarten Füßen herumtrampelte. Kein anderer opferte
sich für mich, und wenn ich ehrlich war, ergänzten wir einander. Auch ich war
nicht gertenschlank und durch die einseitige Ernährung ebenfalls mit Pusteln
übersät. Kein Wunder, dass sich mein armer Körper trotz der himmlischen
Klänge, die an mein Ohr drangen, weigerte, Glückshormone auszuschütten.
Meine Stresshormone reduzierten sich auch nicht, ganz im Gegenteil, wilder
Zorn machte sich breit. Schließlich raffte ich mein goldfarbenes
Abendtäschchen an mich, zischte der Tanzmeisterin »Dafür zahle ich nichts!«
zu, ließ den jungen Mann mitten auf dem Tanzparkett stehen und brach das
misslungene Experiment ab. Beim Verlassen des Saals hörte ich noch ihre er-
regte, laute, gar nicht mehr vornehm säuselnde Stimme hinter mir: »Was hat
sich die Dicke denn erwartet?«
Zurück in meinem kleinen »Untermietkabinett« mit Blick in einen engen,
finsteren Innenhof, holte ich die Fressalien meiner Mutter hervor und
genehmigte mir vor dem Zubettgehen als Trost noch ein großes Stück Brot mit
pikanter Blutwurst. Außerdem murmelte ich, bevor ich auf meinem schmalen
33/186

und harten Bett einschlief, noch zwanzig Mal: »Es geht mir jeden Tag in jeder
Hinsicht immer besser und besser!«
34/186

Kapitel 4
4
Manchmal aß ich zu Mittag nicht das übliche Wurstbrot aus eigener Fabrika-
tion, sondern ging in die Konditorei »Aida« in unmittelbarer Nachbarschaft
meiner Bank. Hauptsächlich ältere, altmodisch gekleidete Damen mit topfför-
migen Hüten und viel Freizeit bevorzugten dieses Eldorado billiger, aber
vorzüglicher Mehlspeisen. Sie trafen sich dort mit gleichaltrigen Freundinnen.
Auch meiner harrten köstliche Gaumenfreuden in Form von Torten, die man
eigentlich nur als Törtchen bezeichnen konnte. Teilten doch die Konditor-
meister ihre Kunstwerke geschickt in winzige, perfekt aussehende Miniportion-
en, ohne dass sie bei dieser schwierigen Prozedur zerfallen wären. Die Wahl
zwischen Esterhazy-Schnitten, Schwarzwälder Kirschtorte und Punschkrapfen
mit glänzendem zartrosa Zuckerguss fiel jedes Mal schwer.
»Schaut wirklich alles verlockend aus, nicht wahr?«, sagte jemand in der
Schlange hinter mir, als ich unschlüssig vor der Vitrine stand. Es war ein klein-
er, wohlgenährter junger Mann mit rundem Gesicht, braunen Haaren und
ebensolchen Augen, der mich aufmunternd anlächelte. Mit »Sie erlauben, dass
ich mich da hersetze?« nahm er an meinem runden Tischchen Platz. »Ich habe
Sie schon öfter in der ›Aida‹ gesehen. Essen Sie auch so gern Süßes wie ich?«
Ich musste lachen: »Ja, leider! Sollte ich nicht!« – »Aber nein, dürre Frauen
sind hässlich«, meinte mein neuer Bekannter. Er stellte sich als Dr. Leopold E.
vom nahen Historischen Institut der Universität Wien vor. Als ich ihn kurz da-
rauf abermals in der Konditorei zwischen lauter alten Damen beim Verzehr
zweier Punschkrapfen antraf, plauderten wir schon wie alte Freunde. Ich er-
fuhr, dass er aus dem Weinviertel stammte und der Sohn eines Bauern war, es
aber abgelehnt hatte, die Landwirtschaft seiner Eltern zu übernehmen. Nach-
dem er schon als Kind ein Faible für österreichische Geschichte entwickelt
hatte, zahlte ihm sein Vater, obwohl es ihm schwerfiel, widerstrebend ein
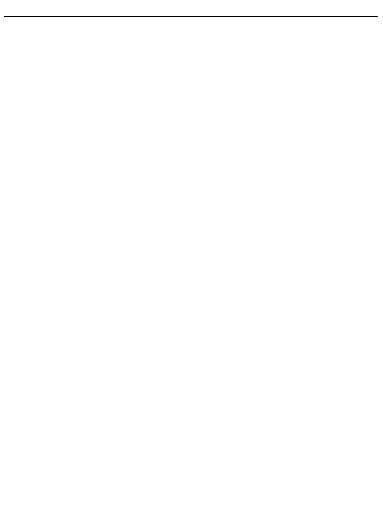
Studium. Seit zwei Jahren sei er nun Universitätsassistent, hoffe sich bald zu
habilitieren. Er schreibe und publiziere sehr viel.
Mein Interesse an dem leider nicht sehr ansehnlichen Weinviertler war
geweckt. Hatte ich doch kurz zuvor in irgendeiner Zeitung eine Notiz gelesen,
dass ein Journalist namens C. W. Ceram von seinem Werk »Götter, Gräber und
Gelehrte« fünf Millionen Exemplare verkauft hatte und reich geworden war.
»Welche Art von Büchern schreiben Sie denn?«, erkundigte ich mich neugierig.
»Sachbücher?« – »Ja, ganz genau. Und ich versuche mich populär zu fassen,
ich möchte mit Themen zum Mittelalter ein breites Publikum erreichen!«
Wow, genau wie C. W. Ceram. Und er ist nicht bloß ein Journalist, sondern
Historiker, ein richtiger Fachmann!, dachte ich bei mir, um laut zu fragen:
»Was bekommt man denn so für ein Exemplar?« – »Zwischen 7 und 10 % vom
Ladenpreis, bei Bestsellern natürlich mehr. Verkauft man die Filmrechte, ist
man ein gemachter Mann«, kam die Antwort.
Ich schwieg, denn mein Gehirn surrte wie eine Rechenmaschine: Angenom-
men, ein Buch kostet 150 Schilling. Das mal, sagen wir bescheiden, drei Mil-
lionen Stück macht 450 Millionen. Und zehn Prozent davon, das sind ja unge-
heuerliche 45 Millionen. Mein Blick ruhte freundlich und wohlwollend auf dem
kleinen Historiker mit dem abgewetzten Sakko und der vielversprechenden
Zukunft.
Dieser hustete, wurde rot: »Fräulein Hermine, darf ich Sie am Sonntag zu
einem Spaziergang nach Schönbrunn einladen? Das Wetter soll schön wer-
den.« Gern sagte ich zu. In Gedanken tätigte ich bereits Einkäufe um 45, viel-
leicht sogar noch mehr Millionen, denn es war die Zeit des guten, alten öster-
reichischen Schilling – bis zur Einführung des ungeliebten Euro sollte es noch
dauern. Aber auch in der neuen Währung hätte Dr. Leopold E. den gewaltigen
Betrag von über drei Millionen Euro erzielt.
Am Wochenende spazierten wir gemeinsam, zuerst nebeneinander her, dann
bald Hand in Hand durch die kunstvollen Blumen-Parterres der imperialen
Gärten von Schloss Schönbrunn. Wir nahmen den gewundenen Pfad, der durch
ein kleines Wäldchen hinauf zur Gloriette führt. Mittendrin küsste mich der
künftige Erfolgsautor schüchtern. »Ich bin der Poldi!« – »Ich die Hermi!«
36/186

Anschließend gab er mir eine Probe seines historischen Wissens: »Die Glori-
ette ist ein Belvedere, das den Schönbrunner Berg krönt und zugleich den har-
monischen Abschluss der Schlossanlage bildet. Den frühklassizistischen Kolon-
nadenbau ziert, wie du siehst, ein mächtiger Reichsadler mit Weltkugel.« Wir
ließen uns in dem Kaffeehaus der Gloriette nieder und tranken Kaffee. Danach
bestiegen wir die Plattform des flachen Daches, wo mir Poldi von der luftigen,
etwas windigen Höhe aus geduldig die Silhouette der Stadt erklärte. Unsere
Blicke wanderten über das raffiniert angelegte Areal der riesigen einstigen kais-
erlichen Domäne, Wiens beliebtester Sehenswürdigkeit. »Weißt du, früher ist
das alles offenes Land gewesen. Jetzt ist es noch immer eine beschauliche Oase
der Ruhe und Erholung, nur halt fast am Rand der Großstadt.« Die ausge-
dehnten barocken Gärten, die dichten, mit Statuen gesäumten Laubengänge,
die lauschigen, versteckten Rondelle, plätschernden Brunnen und künstlichen
Ruinen waren tatsächlich sehr schön. Doch meine Gedanken schweiften ab:
Was konnte man sich um 45 Millionen Schilling alles leisten? Eine Prachtvilla
in Hietzing mit großem Garten, ein tolles Auto, eine Weltreise …
»Ich glaube, du passt nicht auf! Ich erzähle dir gerade die Geschichte von
Schönbrunn.« Ich heuchelte Interesse, und Poldi setzte von Neuem dozierend
an: »Also, das Prunkschloss geht, obwohl es bereits einen Vorgängerbau gab,
auf die schon allen Volksschulkindern gut bekannte und von vielen Historikern
als bedeutendste Herrschergestalt des Hauses Habsburg eingestufte Kaiserin
Maria Theresia zurück. Ihr Architekt Nicolo Pacassi gestaltete Schönbrunn als
ihre Sommerresidenz. Du weißt schon, dass Maria Theresia nur durch Zufall an
die Macht kam? Ihrem Vater, Karl
VI
., war der männliche Thronerbe im
Säuglingsalter verstorben. Danach setzte er ganz auf seine energische älteste
Tochter, die er sehr liebte. Unermüdlich warb Karl
VI
. an den europäischen
Fürstenhöfen für die Anerkennung der weiblichen Erbfolge. Er opferte dafür
ein Vermögen und schloss Verträge, an die sich bei seinem Tod niemand hielt.
Seiner Tochter eine fundierte Ausbildung mit auf den Lebensweg zu geben hielt
er nicht für notwendig. Im Alter von 23 Jahren stand Maria Theresia dann eine
übermächtige Allianz von Bayern, Spanien, Preußen, Frankreich, Schweden,
Neapel und Kurpfalz gegenüber. Man bestritt ihr Erbrecht und plante die
Aufteilung der habsburgischen Länder. Acht Jahre dauerte der Kampf um die
37/186

Existenz der Monarchie.« Ich drehte gerade meinen Kopf zur Seite, um ein
Gähnen zu verbergen, als Poldi seinen langen Vortrag abschloss: »Für heute ist
es genug, zu viel kannst du gar nicht fassen! Nächste Woche mehr davon. Ich
bin neugierig, was du dir merkst. Ich werde dich prüfen.« Mein Privatlehrer
beendete seine erste Lektion. Viele weitere sollten folgen.
Als ich Poldi ungefähr sechs Monate lang kannte, bestanden meine Eltern,
denen ich von meiner Bekanntschaft erzählt hatte, darauf, dass ihnen »der
Bursch, mit dem die Hermi geht« vorgestellt werde. »Na ja, was wird er schon
sein?«, äußerten sie unverhohlen ihre Skepsis über die Fähigkeiten ihrer
Tochter, sich einen passenden Ehemann zu angeln.
Tatsächlich gefiel Leopold meinem Vater überhaupt nicht. Mit hervorquel-
lenden Augen maß er ihn wortlos von oben bis unten. Welche unerfreulichen
Gedanken er dabei wälzte, blieb uns Gott sei Dank verborgen. Nach der
kürzestmöglichen Begrüßung nahm er meinen Freund beiseite und unterzog
ihn ohne weitere Umschweife einem strengen Verhör. »Woher kommen Sie?
Was machen Ihre Eltern? Verdienen Sie genug, um eine Frau zu ernähren?
Haben Sie berufliche Aussichten?« Er gebärdete sich wie ein viktorianischer
Patriarch aus dem 19. Jahrhundert. Ich genierte mich sehr, doch Poldi murrte
nicht, ließ den Test widerspruchslos über sich ergehen. Geduldig gab er
Auskunft, bis meine Mutter die unwürdige Szene beendete und zu Tisch bat.
Bei Rindsrouladen mit Reis lockerte sich die Atmosphäre, es wurde fast
gemütlich. Beim Abschied überreichte uns meine Mutter die säuberlich ver-
packten Reste des Mittagessens. »Damit ihr nicht verhungert«, scherzte sie.
Mein Vater schwieg eisern, während wir Poldis hellblaues Puch-Auto bestie-
gen. Es war etwas verbeult, in der Bodenplatte klaffte ein großes Loch. Viele
verborgene Mängel machten jede Fahrt mit dem altersschwachen Gefährt zu
einem Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Auch diesmal wollte und wollte
der Motor nicht anspringen. Mein Freund betätigte mit vor Scham hochrotem
Kopf und wachsender Verzweiflung wiederholt den Starter. Erst als meine El-
tern mit vereinten Kräften anschoben, setzte sich das Auto langsam in Bewe-
gung. »Schaut aus, als ob si de Hermi net grod an Millionär g’angelt hätt«,
quittierten die Nachbarn voll Schadenfreude die Episode.
38/186

Kurz danach wünschten auch Poldis Eltern mich zu sehen. Abermals fuhren
wir aufs Land, diesmal in ein abgelegenes Dorf, circa fünfzig Kilometer nörd-
lich von Wien. Niedere Gehöfte säumten die einzige Straße des Orts, in dem es
weder ein Geschäft noch ein Wirtshaus gab. Eine Kapelle und ein Zeughaus der
freiwilligen Feuerwehr genügten den religiösen und sozialen Bedürfnissen der
Einwohner. Alles wirkte öde und ausgestorben. Kein Mensch war zu sehen, als
wir gegen Mittag auf dem Dorfanger parkten. »Wann gießen die eigentlich ihre
Pflanzen?«, fragte ich mich beim Anblick der vielen Fensterkistchen mit
blühenden Petunien und Hängepelargonien. »Schleichen sie sich erst bei Ein-
bruch der Dunkelheit heraus, um den Blumenschmuck in aller Heimlichkeit zu
pflegen?« Schemenhafte Schatten hinter dicht geschlossenen Vorhängen, die
sich, wie im Wind, leicht bewegten, verrieten uns, dass neugierige Beobachter
zwar unser Kommen genau registrierten, es jedoch vorzogen, sich nicht zu
zeigen.
Poldis Eltern bewohnten einen Bauernhof, der sich seit Generationen in
Familienbesitz befand. Das unmittelbar an der Straße gelegene Wohnhaus
wurde zu beiden Seiten von Wirtschaftsgebäuden flankiert. Aus Ställen mit
halb blinden, schwer vergitterten Fensteröffnungen drang das Grunzen von
Schweinen, gelegentlich muhten Kühe, deren Halfter klirrten, wenn sie die
Schwärme von Fliegen, die sie bedrängten, abzuschütteln versuchten. In einer
Ecke des Hofs lag, nur von einer Betonwand abgeschirmt, ein großer Haufen
Stallmist als Dünger bereit. Hinter einem morschen Zaun befand sich ein
Garten mit Gemüsebeeten, krummen Apfelbäumen und einem halb verfalle-
nem Lusthäuschen. Im Anschluss daran folgten die Hofäcker, auf denen man
Rüben, Weizen, Gerste und Hafer anbaute.
Die Lebensumstände der Familie E. wirkten auf mich als Tochter eines
kleinstädtischen Beamten befremdlich. »Wastl«, ein Mischling undefinierbarer
Rasse mit walzenförmigem Körper, dem Kopf eines Schäferhundes und den
krummen Beinen eines Dackels, begrüßte uns stürmisch. Ein weiterer uner-
wartet herzlicher Empfang folgte. Mit den Worten »Se san also die Hermine«
umarmte mich die untersetzte, gemütliche Mutter meines Freundes. Sein
Vater, ein schweigsamer, knorriger Bauer, hieß uns ruhiger willkommen. Pein-
liche Fragen über Herkommen und Vermögen unterblieben. Ohne Umstände
39/186

nahmen wir auf der Sitzbank in der großen, niederen Wohnstube Platz, man
kredenzte uns Holundersaft als Willkommenstrunk. Ich sah mich um. Durch
die kleinen Fenster fiel nur wenig Licht, sodass der Raum auch zu Mittag in ein
Halbdunkel getaucht blieb. Eine bunte, pflegeleichte Plastikdecke bedeckte den
Esstisch im Herrgottswinkel unter dem mit verstaubten Palmkätzchen
geschmückten Kruzifix. An der Wand hing eine von der Hausfrau selbst be-
stickte Zierdecke mit dem besinnlichen Spruch »Der Herrgott sieht alles!« in
blauen Kreuzstichen. »Vielleicht eine Warnung an ihren Mann!«, dachte ich
mir. In einer altmodischen Kredenz befand sich allerlei Geschirr. Auf einer
bunt bemalten Truhe räkelte sich eine getigerte Katze. Ein durchgelegenes Sofa
mit bestickten Polstern und weicher Decke neben dem riesigen gemauerten
Herd wies Spuren häufiger Benützung auf.
»Wir essen nur leicht«, kündigte Poldis geschäftig mit Pfannen und Töpfen
hantierende Mutter an, nachdem mir der Hausherr bei einem Rundgang Haus,
Hof und Tiere gezeigt hatte. Sie trug daher zuerst eine dampfende Le-
berknödelsuppe, dann eine saftig gebratene, im Fett schwimmende Sch-
weinsstelze auf. »Bei uns is heut das Feuerwehrfest. Da ess ma dann ordent-
lich. Ihr kommst’s ja eh mit?« Und wir gingen.
Auf einer Wiese außerhalb des Dorfes hatte man ein stabiles, für alle Launen
des Wetters gewappnetes Zelt errichtet. Einfache hölzerne Tische und Bänke
erwarteten die Besucher, die in aufgeräumter Stimmung gruppenweise her-
beiströmten. Die nicht mehr ganz jungen »Pulkautaler Buam« standen samt
einem ältlichen pseudoländlichen Sänger im Steireranzug bereit, um uns, wie
es so schön heißt, »durch den Abend« zu führen. Der Sänger grinste sein Pub-
likum frech an. Anscheinend bedauerte er sich selbst, glaubte fehl am Platz zu
sein und sein großes Talent des schnöden Mammons wegen an eine primitive
Landbevölkerung zu verschwenden. »Ta, ta, ta, umtata, umtata« dröhnte die
Kapelle heimischer Musikanten, während der Entertainer schwungvoll zum
Mikrofon griff und hingebungsvoll gängige Schnulzen mit viel Amore zum
Besten gab. »Seemann, deine Heimat ist das Meer« trug er den der Scholle ver-
hafteten Bauern vor. Die Sehnsucht nach der Ferne übermannte ihn, mit ver-
drehten Augen besang er den »Griechischen Wein«, um sich dann der Südsee
zuzuwenden. »Wie wär’s mit uns zwei, bist du dabei, ich fahr nach Hawaii«
40/186

begeisterte die für das Fest herausgeputzten Gäste. Nicht wenige waren in
ihren schönsten bunt glänzenden, bequemen Jogginganzügen erschienen. Viele
sangen die Refrains der Ohrwürmer aus voller Kehle mit, wobei sie ungeniert
große Zahnlücken oder einige wenige verbliebene schwarze Zahnstummel en-
thüllten. Es ging um Herzeleid, ewige Treue und innige Sehnsucht: »Liebe
kann so wehtun, aber sie gibt auch viel!« Sentimentale Gefühlsregungen, die
man den in Nutzvieh, Ernten und Forstwirtschaft denkenden Bauern in keiner
Weise zugetraut hätte. Die vierschrötigen Landwirte machten eher den
Eindruck, als ob sie ihr Liebesleben ganz und gar nach materiellen Erwägungen
abwickelten.
Die Tische bogen sich förmlich unter den schweren Bierhumpen. Von kleinen
Papptellerchen mit Miniservietten verschlang man Grillhühner, die sich zuvor,
reichlich mit Gewürzen bedeckt, langsam an einem Spieß in einer Ecke des
Zeltes gedreht und dabei einen penetranten Duft verströmt hatten. Es gab
auch, passend zu den sentimentalen Gesängen, Kulinarisches mit dem Flair
weit entfernter Inseln: Schweinesteaks Hawaii, garniert mit Scheiben blassgel-
ber Ananas aus der Dose. Reißenden Absatz fanden auch »Gordon Blö« genan-
nte gefüllte Schweinsschnitzel von riesigem Ausmaß, garniert mit fettigen
Pommes Frites. Der Bürgermeister des Ortes ging eingedenk der baldigen Ge-
meinderatswahl jovial von Tisch zu Tisch und grüßte seine Schäfchen freund-
lich. »Hamma Glick mit’n Wetter, heut. Unterhalt’s eich nur guat! Und ver-
gesst’s net, spendet’s ordentlich für unsere brave Feuerwehr!« Alle waren per
Du. Es wurde gesoffen und gegrölt. Jung und alt bewegte sich wie ein Ele-
fantenballett mit schweren, schlurfenden Schritten über den erhöhten Tan-
zboden. Außer Atem vom Slowfox mit ihrem um einen Kopf kleineren Mann,
sank Poldis Mutter schwer atmend neben mir auf die Bank. »Ah, das tut gut!«
Sie nahm einen großen Schluck aus ihrem Bierhumpen, den sie schon fast zur
Gänze geleert hatte.
Der ungewohnte Alkohol löste ihre Zunge und riss sie zu Vertraulichkeiten
hin. Mit geröteten Augen betrachte sie freudlos ihren Sohn, der gerade mit
seiner Cousine einen kessen Foxtrott auf die roh gezimmerten Planken hin-
legte. Dann brach es aus ihr heraus: »Wast, Hermi, ich darf eh Hermi sagen,
41/186

net wahr?« Ich versicherte ihr, dass sie durfte. »Also wast, Hermi, es is scho
traurig. Der Poldl is ja liab. Aber seine Spinne-rein! Warum is er net dobliebn?
Wir ham zwanzig Hektar Landwirtschaft, unsern eigenen Wein, zwanzig Ferkel
und Säu, zehn Küh, is a guats Auskommen. Aber er hot in die Stodt miassen!
Und mir san allane mit der gonzn Arbeit!« Sie musterte mich, und ihr Blick
wurde zweifelnd und kritisch. Deutlich merkte ich, dass sie in mir nicht die
ideale zukünftige Schwiegertochter sah, die den abtrünnigen Poldi dem
Bauernstand zurückgeben würde.
Sie irrte nicht. Ein paar Mal ging ich mit einem verheirateten Kollegen mein-
er Bank ins Kino, aber er machte kein Hehl daraus, dass er nur ein flüchtiges
Abenteuer zur Belebung seines eintönigen Ehelebens suchte. Ich bemühte mich
weiterhin redlich, versuchte dies und das. Sogar eine Kontaktannonce setzte
ich in die Sonntagsausgabe des »Tageskurier«. Es meldeten sich lauter
merkwürdige Typen: Ein versoffener Langzeitarbeitsloser, dessen weit
geöffnetes Hemd nicht nur eine behaarte Brust, sondern auch ein großes
goldenes Kreuz freigab. Er war auf der Suche nach einer molligen, karten-
spielenden Frau mit etwas Kapital für die langen Wintermonate in Florida, wo-
hin er regelmäßig der kalten Jahreszeit in Österreich zu entfliehen pflegte. Ein
vergammelter Aussteiger mit schulterlangem Haar und »Flinserln« im Ohr,
der sich mit einer vermögenden Partnerin auf eine griechische Insel zurück-
ziehen wollte. Ferner ein grauhaariger Methusalem, der schon mit einem Bein
im Grab stand und dem sein ausschweifendes Leben die tiefen Falten eines al-
ten Bernhardiners in sein hässliches Gesicht geprägt hatte. Es war zum
Verzweifeln.
Nachdem sich beim besten Willen kein passabler Mann finden ließ, resig-
nierte ich schließlich. Nach einer Bekanntschaft von mehr als einem Jahr
entschloss ich mich, mein Schicksal mit dem des Dr. Leopold E. zu verbinden,
der unterdessen in seiner Freizeit – ohne von meinen Kontakten auch nur das
Geringste zu ahnen – voll Schaffensfreude an seinem Bestseller über das Mit-
telalter geschrieben hatte. Der Arbeitstitel des Werks klang vielversprechend:
»Wilde Ereignisse in dunkler Zeit«. Nach reiflicher Überlegung und genauen
finanziellen Berechnungen bat ich meine Vermieterin, mir doch an einem
Freitagabend ihren Herd zu überlassen, lud den Erfolgsautor in spe für den
42/186

darauffolgenden Tag zur Nachmittagsjause und entfaltete meine verführ-
erischen Backkünste. Eigenhändig fabrizierte ich, wie ich es bei meiner Mutter
gelernt hatte, köstliche zierliche Punschkrapferln, eine Mehlspeise, die nicht
ganz einfach herzustellen ist. Zuerst bereitete ich aus vier Eiern, 160 Gramm
griffigem Mehl und zwei Esslöffeln lauwarmem Wasser einen zarten Biskuit-
teig. Ich trennte das Eiweiß von den Dottern, die ich mit Zucker und Wasser
schaumig schlug. Ich schlug auch das Eiweiß steif und hob es vorsichtig unter
die Masse. Dann strich ich den Teig auf das eingefettete Kuchenblech, schob es
in den vorgewärmten Herd und backte es 15 Minuten. Inzwischen richtete ich
die Fülle her. Dazu benötigte ich vier Esslöffel duftenden Inländer-Rum, sechs
Löffel Orangenmarmelade und 200 Gramm fein geriebene Kochschokolade.
Nach dem Auskühlen zerschnitt ich den fertigen Biskuitteig in zwei
Hälften – wobei ich mich selbst mit Kostproben belohnte. Eine davon bestrich
ich mit der locker-flaumigen Fülle, bevor ich sie auf die andere stülpte. Auch
die Punschglasur stellte ich aus 160 Gramm Staubzucker, drei Esslöffel Rot-
wein und drei Esslöffeln Rum selbst her. Es ist der richtig dosierte Rotwein, der
die schöne rosa Farbe macht. Bewusst verwendete ich auch bei der Glasur Rum
und nicht wie manche Köchinnen Zitronensaft. Sollte doch die ganze Prozedur
einem ganz bestimmten Zweck dienen! Sorgfältig teilte ich das Biskuit in Wür-
fel und tauchte sie in die Glasur. Ich verzierte die verführerischen Süßigkeiten
mit je einer halben Cognac-Kirsche und stellte sie kalt.
Ganz wie erwartet, machte mir Poldi nach dem Genuss des fünften, stark mit
Alkohol getränkten Punschkrapfens einen Heiratsantrag, den ich huldvoll
annahm.
43/186

Kapitel 5
5
Ich wusste es sehr zu schätzen, dass uns der angenehm zurückhaltende, fre-
undliche Vater meines Bräutigams mit viel Mühe eine große ländliche Hochzeit
ausrichtete. Die alte, kühle Dorfkirche war zum Bersten voll, als der Pfarrer die
ergreifenden Fragen stellten: »Und du, Leopold, willst du … Und du, Hermine,
willst du …« Wir wollten. Ich trug ein langes, eng geschnürtes weißes Kleid mit
Jäckchen und Poldi einen knapp sitzenden schwarzen Anzug. Die Fotos der
Zeremonie zeigen uns als ein ganz hübsches Paar. Der anschließend im
»Goldenen Lamm« servierte Festschmaus bestand aus Schweinsbraten und
Knödeln sowie wuchtigen Schnitten einer weißen, mehrstöckigen Biskuittorte,
die ich, wie ich es bei Prominentenhochzeiten im Fernsehen gesehen hatte, mit
einem riesigen Messer vor den Gästen anschnitt, wobei mir Poldi die Hand
führte. Fernsehen und Presse fehlten bei uns, doch wir blinzelten für Erinner-
ungsfotos freundlich lächelnd in die Kamera.
Meine angeheirateten bäuerlichen Verwandten kamen aus Dörfern der na-
hen und weiteren Umgebung. Von meiner Seite hielt sich die Zahl der Besucher
in Grenzen. Es berührte mich, als mir verhutzelte, knorrige Bauern in sorgfältig
gebürsteten antiquierten schwarzen Sonntagsanzügen wortlos und leicht verle-
gen mit Banknoten gefüllte Umschläge überreichten. Alte Weiblein in dunklen
Gewändern, denen ein starker Geruch von Mottenkugeln entströmte, griffen in
ihre zerknitterten, altmodischen Handtaschen, die sie für den Festtag her-
vorgekramt hatten, und steckten mir Geldbeträge zu. Andere wiederum trugen
mit allerlei sinnigen Geräten zur Haushaltsgründung des jungen Paares bei.
Einen Fremdkörper in dem archaischen Treiben bildete Poldis »Pepi-
Großonkel«, den ich bei dieser Gelegenheit kennenlernte. Die biedere Land-
bevölkerung musterte ihn mit einer Mischung von Achtung und Verachtung,
die Unsicherheit verriet. Er war ihrer Überzeugung nach aus der Art

geschlagen, hatte seiner Heimat früh den Rücken gekehrt und in Wien Meteor-
ologie – »Was is des eigentlich?« – »Aha, a Wetterfrosch! Wia im Fernse-
hen!« – studiert. Ironisch, lässig, sportlich-elegant gekleidet, ein Herr vom
Scheitel bis zur Sohle, verfolgte er das Treiben der von ihm nur »Rustici«
genannten Landbevölkerung mit milder Nachsicht. Sein gepflegtes Hoch-
deutsch machte die jungen Bauernburschen, die ihn nicht kannten, stutzig. »Is
des a Deitscher? Er redt so g’schwollen.« Der ob seines Gehabes in der Art
eines englischen Gentlemans nur »Sir« genannte, nunmehr angeheiratete Ver-
wandte zog meinen Vater in seinen Bann. Bald waren die Herren in ein
angeregtes Gespräch über die Niederungen der österreichischen Politik
vertieft.
Mein Eheleben, in das ich im Vertrauen auf die kommenden Bestseller
meines akademisch gebildeten Mannes große Erwartungen setzte, begann mit
kurzen Flitterwochen im herrlichen Florenz. Sie waren schrecklich
ernüchternd: fader kurzer Sex im Zimmer einer billigen Pension mit durchhän-
genden, knarrenden Betten und einer schmutzigen Dusche, deren grauer
Plastikvorhang eine Tendenz hatte, am Körper zu kleben. Endlose Führungen
meines enthusiastischen Ehemannes durch ich weiß nicht mehr wie viele
Kathedralen, Klöster und Paläste, endlose Beschreibungen von Altarbildern
und hässlichen Grabmonumenten, die ich auf hartem Steinpflaster und von
einem Bein auf das andere tretend mühsam ertrug, vergällten mir die Zeit in
der Stadt am Arno. Bald plagten mich höllische Rückenschmerzen, und ich war
froh, als wir abreisten.
Mit einem Darlehen von Poldis Eltern – sie hatten für ihren Sohn einen
Wald verkauft, während die meinen bedauernd abwinkten – gingen wir an die
Gründung einer eigenen Existenz. Anfangs dachten wir an ein Fertighaus und
suchten zu diesem Zweck die »Blaue Lagune« am südlichen Rande Wiens auf,
dort, wo die Großstadt am hässlichsten ist, um eine Ansammlung von preiswer-
ten Musterhäusern zu besichtigen. Ein beflissener, korrekt mit einem billigen
dunklen, leicht verknitterten Anzug samt rosa Krawatte bekleideter Verkäufer
mit dem Gesicht eines gierigen Wiesels stürzte sich auf uns, um uns die
Vorteile seiner dünnwandigen Eigenheime für Kleinverdiener näherzubringen.
»Und das ist unser Verkaufsschlager! Schön, sehr, sehr günstig, prompt
45/186

lieferbar und vor allem, ganz onkologisch. Alles an diesem Prachtobjekt ist
garantiert onkologisch!« Die Aussicht auf inkludierte Krebserkrankungen
schreckte mich, die ich sehr auf Nachwuchs hoffte, doch ab.
Wir durchforsteten alle Zeitungen und stießen im »Penzinger Bezirksblatt«
auf das zum Kauf angebotene Häuschen einer Pensionistin. Bei einem Treffen
klagte sie, dass ihr »das alles« zu viel geworden sei: »Für meine letzten Jahrln
brauch i nur mehr a klane Wohnung mit Balkon, ebenerdig, ohne Stufen. Ich
dahatsch des nimmer.« Mit »Na, schaun’s halt mein Häusl an« überreichte sie
uns vertrauensselig einen großen Haustürschlüssel und gab uns die genaue
Adresse ihres bereits verlassenen Domizils: Tulpengasse 3 im 14. Bezirk. »Es is
am Bierhäuslberg. Den kennen’s eh?« Wir verneinten, orientierten uns nach
dem Stadtplan und machten uns auf den Weg.
Die Fahrt führte durch die Hüttelbergstraße, eine sehr schöne grüne Gegend
des 14. Wiener Gemeindebezirks mit historistischen, aus der Zeit um 1900
stammenden Prunkvillen. Ich genoss die Fahrt in unserem
VW
-Käfer
sehr – Poldis alter Puch hatte den Geist aufgegeben und war verschrottet
worden. Doch dann setzte Leopold ungefragt zu einer seiner Geschichtslektion-
en an: »Schau, da hat Otto Wagner, einer der berühmtesten Architekten des
Fin de Siècle, hier im engen, etwas finsteren Tal des Halterbachs, als man
glaubte, die verheerenden Strahlen der Sonne tunlichst meiden zu müssen,
gleich zwei überaus prächtige Häuser errichtet. Eines mit Anklängen an den
Stil Palladios, mit mächtigem Portikus und einer grandiosen Auffahrt. Es sollte
als Schaustück für zahlungskräftige Bauherren die Künste des Architekten
demonstrieren. Und eines für sich selbst. Sag mir, was hat er denn sonst noch
in Wien gebaut?« Ich schwieg. »Na, die Stadtbahn natürlich. Das sollte man
schon wissen! Die Stadtbahn mit ihren Stationen im Jugendstil, die das Stadtb-
ild von Wien prägen. Bist ja schon hundert Mal damit gefahren!« Ich staunte
nur über das völlig veränderte Aussehen der großen Wagner-Villa, die ich von
Fotos her kannte. Ein namhafter Künstler hatte das Haus zu seinem Atelier
erkoren, es damit vor dem Abriss sowie den Garten vor der Parzellierung ger-
ettet, aber gleichzeitig seinem unwiderstehlichen Drang nach greller Far-
bgestaltung und ebenso bunten pegasusähnlichen Fabelskulpturen keinen
Zwang angetan. In einer Orgie von Blau, Violett und Grün hatte er eine
46/186

Mischung aus der alten Grottenbahn im Wiener Prater und den antiken Tem-
peln von Knossos auf Kreta geschaffen. Die aus dem Dunkel dichter Bäume un-
vermittelt auftauchende bunte Monstrosität wirkte niederschmetternd auf
mich. »Gott sei Dank ist Wagners zweites Haus der Gestaltungswut der
Pseudomoderne entgangen«, meinte Poldi. Ich konnte ihm nur zustimmen.
Bescheiden und intim, entsprach es dem persönlichen Geschmack des Ar-
chitekten, der es als Witwensitz für seine überaus geliebte, viel jüngere zweite
Frau vorgesehen hatte. Wie es sich fügte, verschied die Gattin jedoch vor ihrem
Mann, der danach die Gegend mied.
In nachdenklicher Stimmung, sinnierend über die unberechenbaren Zufälle
des Lebens, fuhren wir in unserem
VW
-Käfer weiter. Die Idylle der großen,
schattigen Gärten mit den riesigen alten Bäumen und dem romantischen
Charme einer längst vergangenen Epoche versetzte mich in melancholische
Stimmung. 1900, dachte ich, das ist so lange nicht her. Trotzdem kann man
sich das Leben in diesen riesigen, jetzt oft verfallenden Gebäuden, die in ihrer
Glanzzeit von großen Familien mit Gouvernanten, Köchinnen, Dienstmädchen
und Gärtnern bewohnt wurden, eigentlich nicht mehr richtig vorstellen.
Das Vergnügen, in die Vergangenheit einzutauchen, hielt nicht lang an, denn
als unser Ziel erwies sich nicht die versunkene, sondern die moderne Welt.
Schon von Weitem glotzte uns der Hütteldorfer Bierhäuslberg mit seiner aus-
nehmend hässlichen Schrebergartenkultur entgegen. Ein ganzes Netz von skur-
rilen Häusern bedeckte wie ein bösartiges Geschwür besagten Hang, für den
die Bezeichnung »Berg« wahrlich übertrieben war. Schmale, enge Straßen,
gesäumt von Zerrbildern menschlicher Behausungen, wanden sich hinauf in
das Reich der Gartenzwerge mit ihren Zwergengärten und den in winzigen Vor-
gärten putzig dahinkriechenden Zwergpflanzen. Manche Garagen standen of-
fen, bis zur Decke hinauf gekachelt, sahen sie aus wie Pissoirs. An den Wänden
hingen säuberlich aufgereiht Werkzeuge aller Art.
Das Heim der betagten Pensionistin jedoch entpuppte sich als freundliches
Knusperhäuschen mit spitzem Dach, grünen Fensterläden und vollständig
überwuchertem Garten. Dichte Hecken schirmten es gegen die Blicke der na-
hen Nachbarn ab. Im Erdgeschoss gab es einen Mini-Vorraum, ein
WC
, eine
47/186

Dusche, eine winzige Einbauküche, ein überraschend geräumiges Wohnzim-
mer und ein weiteres Zimmer. Im ersten Stockwerk befanden sich noch drei
Räume und ein großes Bad. Auf der mit Laub übersäten Terrasse stand eine an-
tiquierte Sitzgarnitur aus Rattangeflecht, daneben lagerten zerbrochene
Gartengeräte und verdorrte Kübelpflanzen. Über den Seerosen des Biotops in-
mitten der Wiese surrten Libellen. Ob hier am Abend Frösche quakten?
Unsere Blicke schweiften in die dunkelgrünen Baumkronen des gegenüber-
liegenden Waldes. Wir genossen die Fernsicht und vergaßen die hinter uns
liegende »Bierhäusl-Siedlung«. Für Kinder würde es hier paradiesisch sein!
Wir waren entzückt und entschlossen uns an Ort und Stelle zum Kauf. Die
alte Besitzerin setzte, gerührt von unserer ehrlichen Begeisterung, den Preis et-
was herab, überließ uns ihre alten Möbel und wünschte uns Glück. Wir er-
warben die günstige Liegenschaft mit dem Geld von Poldis Eltern sowie einem
auf zwanzig Jahre anberaumten Bausparkredit, den mir meine Bank gewährte.
Die Raten sollten wir pünktlich am 1. jeden Monats abzahlen. Ich war sehr zu-
frieden. Noch lieber wäre mir allerdings ein altes Haus mit Charakter, großen,
hohen Räumen, Stuckaturen und individuellem Aussehen gewesen. Wir hätten
es genauso billig kaufen können wie das Zwergenheim der Witwe, um es dann
mithilfe von »Pfuschern«, wie die Schwarzarbeiter aller Herren Länder ohne
Arbeitserlaubnis, Aufenthaltsgenehmigung und daher auch ohne teure Sozial-
versicherung bei uns genannt werden, selbst zu restaurieren. Doch diesen
Traum schmetterte Leopold, der sich einmal beim Einschlagen eines Nagels
fast den Daumen verstümmelt hatte, von Anfang an vehement ab.
Mit Feuereifer gab ich unser Barvermögen bis auf den letzten Schilling aus.
Poldi beteiligte sich nicht daran, die Ausstattung unseres Heims interessierte
ihn nicht. Er durfte nicht gestört werden, denn er verpasste seinem
»Bestseller« gerade den allerletzten Schliff. »Die heikelste Phase meines Schaf-
fens ist angebrochen«, meinte er nervös. Ich hatte dafür größtes Verständnis,
ließ ihn in Ruhe und ersteigerte im Dorotheum, Wiens größtem Auktionshaus,
einige originelle Möbelstücke. Bei
IKEA
kaufte ich Betten, Textilien, billiges
Geschirr und allerlei Hausrat. Begeistert blätterte ich in Tapetenkatalogen. Für
das Wohnzimmer wählte ich schließlich ein wildes gelb-grünes Muster, das Il-
lusionen an einen tropischen Dschungel weckte. Für das Schlafzimmer im
48/186

ersten Stock schienen mir liebliche Blümchen, auf die ich sogar die Bettwäsche
abstimmte, sehr passend.
Einige Tage vor dem Einzug kehrte ich die Terrasse und rodete ein wenig im
Garten, als ich ein lautes Maunzen an meiner Seite vernahm. Ein weiches Fell
strich gegen mein rechtes Bein. »Ja, wo kommst du denn her?«, wunderte ich
mich beim Anblick einer wunderschönen grauen Katze und kraulte sie hinter
dem Ohr. Ich gab ihr in einem Schälchen Milch. Sie folgte mir ins Wohnzim-
mer, wobei sie die ganze Zeit vorwurfsvolle, sehr unfreundliche Laute von sich
gab. Allem Anschein nach beklagte sie sich in Katzensprache ausführlich über
ein ihr widerfahrenes Ungemach. Nach einer ausgiebigen Fütterung schlief sie
erschöpft ein. Ich war gerührt. Was für ein gutes Omen, beim Einzug in unser
neues Heim eine Katze vorzufinden! Poldi teilte meine Freude nicht, gestattete
jedoch, dass der ungebetene Schnurrer vorerst blieb. Er nahm an, dass es sich
um das neugierige Tier eines Nachbarn handelte, das sich, wie er sagte, bald
»ganz von allein trollen« würde. Seine Hoffnung erfüllte sich nicht, denn
»Murli«, wie ich ihn – er entpuppte sich als Kater – rief, hielt es wie einstens
Cäsar: Er kam, sah und siegte.
Wir richteten uns gemütlich und häuslich ein. Als Poldi sein monumentales
Werk vollendet hatte, entkorkten wir in der Vorfreude auf üppige Tantiemen
aus dem Buchverkauf eine Flasche echten Champagner. Beseelt von großen Er-
wartungen, fertigten wir ein Dutzend Kopien an, packten die eng beschrieben-
en Blätter sorgfältig in braunes Packpapier und versandten sie mit freundli-
chem Begleitschreiben an die führenden Sachbuchverlage in Deutschland und
Österreich.
Während wir gespannt auf Antwort warteten, erkundeten wir voll Neugier
die engen Gässchen unserer neuen Heimat. Uns verblüffte, dass sich, im
krassen Gegensatz zu der auf Kleinheit getrimmten und höchstens für
Zwergmenschen passenden Mini-Welt, die Bewohner der Siedlung als höchst
substanzielle Wesen erwiesen. Bei guter Witterung schoben leicht bekleidete
übergewichtige Männer voll Inbrunst ihre Rasenmäher über die Miniwiesen.
Bückten sich die Kurzbehosten, um den letzten unbotmäßigen Gräslein am
Wegrand den Garaus zu machen, quoll ihr von einem T-Shirt nur notdürftig
49/186

verhüllter Bauch, in Wien »Wampe« genannt, hervor, verhüllte ihre Männlich-
keit und machte sie zu seltsam geschlechtslosen Wesen.
Als wir auf den Bierhäuslberg zogen, war uns als gartenlosen Menschen das
Problem und die Plage der Nacktschnecken kein Begriff gewesen, im Gegenteil.
Als Naturliebhaber und -schützer sammelten wir die spanischstämmigen Sch-
leimspurzieher bei unseren ersten Spaziergängen voll Mitleid und in
ahnungsloser Naivität auf den Fahrbahnen ein. Wir setzten sie an den Straßen-
rand, um sie vor den Autos zu retten. Diese harmlose, jedoch von Anrainern
scheel beobachtete Tat hatte üble Folgen. Man lachte hinter unserem Rücken,
es zirkulierte das Gerücht, dass sich eigenartige Sonderlinge und weltfremde
Spinner angesiedelt hätten. Lange litten wir unter diesem Ruf, obwohl ich mich
bald voll Begeisterung und Stolz von der Schneckensammlerin zur -vernichter-
in wandelte.
Wir hatten ja anfangs keine Ahnung vom Wirken der spanischen Wegsch-
necke, die als Trägerin des reizvollen lateinischen Namens »Arion Lusitanicus«
von unbekannten Übeltätern von der Iberischen Halbinsel nach Mitteleuropa
eingeschleppt worden war. Der schleimige Grünpflanzenvertilger hatte zu sein-
er großen Freude in unseren Breiten keine natürlichen Feinde vorgefunden
und sich aufgrund der paradiesischen Zustände unheimlich schnell vermehrt.
Zu Abertausenden fraß er die Wiener Blumenkulturen kahl. Petunien, Dahlien,
aber auch Gemüse jeder Art galten als seine mit Strunk und Stiel vertilgte
Lieblingsspeise.
Bald fand auch ich mich mit einer Schere bewaffnet frühmorgens im Garten
ein, wo mir das Zerschnipseln Hunderter dieser Undinger für den ganzen Tag
gute Laune bescherte. Vorübergehenden erzählte ich gern einen Schnecken-
witz: »Wie sind die spanischen Schnecken nur nach Wien gekommen? – Lang-
sam, sehr langsam, lieber Herr!«
Beim Kampf um die Vernichtung der Schnecken entspannen sich erste Ge-
spräche, knüpfte ich in unserer Siedlung Kontakte, lernte ich die unterschied-
lichen Charaktere vieler Leute kennen. Einige setzten auf Zerschneiden der
Tiere, andere zerhackten sie mit Spaten oder ertränkten sie in Salzlösungen.
Besonders grausame Gemüter bevorzugten gar ihre Verbrennung.
50/186
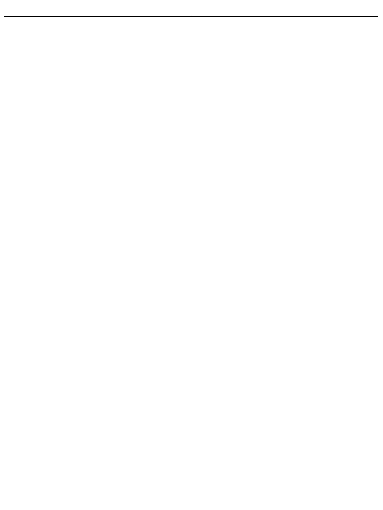
Bange, erwartungsvolle Monate verstrichen, ohne dass Post von Verlagen ein-
traf. Dann jedoch erhielt Poldi fast lawinenartig alle seine Manuskripte zurück.
Jeden Tag schleppte der Briefträger Pakete an, was er mit der freundlichen Be-
merkung: »Ah, haben’s bei Versandhäusern Großeinkauf g’macht!« quittierte.
»Wir bedauern sehr …«, schrieben die einen. »Leider passt Ihr Werk nicht in
unser Programm«, die anderen. »Nicht ganz uninteressant, aber nicht wirklich
originell«, ein dummdreister Verleger. Es war ein Schock.
Leopold ging mit gekränktem Gesicht umher; die kompromisslose Zurück-
weisung seines Meisterwerks traf ihn tief. Mich auch, denn die erwarteten und
im Geiste bereits verplanten Millionen lösten sich in Luft auf. Da der
enttäuschte Autor keinesfalls auf die Publikation seines Werks verzichten woll-
te, sprangen seine Eltern mit einem Geldbetrag ein. Hundert Stück von »Wilde
Ereignisse in dunkler Zeit« erschienen schließlich im Selbstverlag. Mein Mann
legte die Exemplare an strategisch günstigen Punkten unseres Wohnzimmers
auf, um dann in lockerem Gespräch wie zufällig auf sein Œuvre zu verweisen.
Mit sanfter Gewalt drängte er das auf teures Glanzpapier gedruckte Buch sein-
en Verwandten und Bekannten als Geschenk auf. Kaum jemand wollte es
freiwillig nehmen. »Aber na, du bist zu großzügig, lass es sein«, wehrten sie ab.
Ich konnte mich nicht zurückhalten und gab einen Witz zum Besten: »›Also,
Sie sind jetzt ein Schriftsteller?‹, wird der Autor eines Erstlingswerks gefragt.
›Ja!‹ – ›Und was haben Sie bis jetzt schon verkauft?‹ – ›Bis jetzt meinen Win-
termantel und meine Uhr!‹« Das saß. Poldi schaute giftig – unsere Besucher
lachten. Einige entsorgten das Buch meines Mannes beim Gehen heimlich, wie
ich später beim Entleeren des Mülls merkte, in der Abfalltonne vor unserem
Haus.
Zu meiner tiefen Enttäuschung erfüllte sich auch mein Wunsch nach Kindern
nicht – ich hatte zwei geplant, ein Mädchen und einen Buben. Poldi sprach sich
vehement dagegen aus: »Was brauchen wir Gschrappn? In Zeiten wie diesen!
Nur Geschrei, Kosten, Ärger und Wirbel, all das täte mich nur beim Arbeiten
stören. Ich will das nicht! Ich brauch Ruh!« Ich brachte dann das Thema noch
ein paar Mal zur Sprache, stieß aber auf immer heftigere Ablehnung und
schließlich fast rabiate Zurückweisung. So musste ich neidvoll miterleben, wie
51/186

auf dem Bierhäuslberg ein Ehepaar nach dem anderen zur Familie wurde. Viel-
leicht ging meine Fantasie mit mir durch, aber mir schien es, als ob mich junge
Mütter, während sie ihre Kinderwagen plaudernd nebeneinander vor sich her-
schoben, oft mitleidig musterten. Die Taktlosen unter ihnen stellten mich sogar
ungeniert zur Rede: »Und Sie, Frau E., wolln’s kane Kinder? Sind schon herzig,
die Kleinen! Die Katz, die Sie ham, ist Ihnen die g’nug?« Ich blieb selbstver-
ständlich die Antwort schuldig, fühlte mich jedoch bedrückt, ja sogar
minderwertig.
Schließlich resignierte ich. Den südseitigen Raum im ersten Stock unseres
Häuschens, den ich als Kinderzimmer vorgesehen und in Gedanken bereits mit
IKEA
-Möbeln, hellen Tapeten und lustigen Vorhängen liebevoll für ein Baby
hergerichtet hatte, betrat ich nur mehr selten und ungern. Allmählich wurde er
zur Rumpelkammer. Im Laufe der Zeit habe ich mich mit meinem Schicksal
abgefunden, obwohl mich der Anblick kleiner, fröhlich vor sich hinplappernder
Kinder stets wehmütig stimmt.
Die Kinderlosigkeit ließ mich unsere scheußliche Bierhäuslberg-Siedlung,
die sich mir wegen der Grünlage, der guten Luft und der Möglichkeit des Au-
slaufs für mein Mädchen und meinen Buben empfohlen hatte, mit immer krit-
ischeren Augen sehen. Viele hatten sich hier ihre kühnen Träume vom billigen
Wohnen erfüllt. Es gab Holzhäuser im Stil der Tiroler Bergwelt, moderne
asymmetrische Betongebilde mit Flachdächern und schlitzartigen Fenstern, die
wie auf Belagerung eingerichtete Bunker wirkten, neben lieblichen von spanis-
chen Haziendas inspirierten Minivillen. Alle verfügten über kleine, gut ein-
sehbare Gärten, die, wie es der Obmann und die strengen Statuten des
Siedlungsvereins vorschrieben, stets gepflegt zu sein hatten. Große, blättertra-
gende Bäume waren unerwünscht, immergrüne, kleinwüchsige Koniferen be-
vorzugt. Das Gras der Grünstreifen musste kurz bleiben, Naturwiesen durfte es
aufgrund des Pollenflugs der Unkräuter nicht geben. Grillplatz samt Pizzaofen
gehörte zur erlaubten und allgemein vorhandenen Standardausstattung. Auf
Ruhe, vor allem mittags und abends, wurde streng geachtet. Selbst Hun-
debesitzer mussten ihren heiß geliebten und verwöhnten Lieblingen, deren
Exkremente stets für wilde Streitereien mit den Müttern kleiner Kinder sor-
gten, zu dieser heiligen Stunde des Verdauens das ansonsten ohne Unterlass
52/186

durch die Anlage gellende Kläffen untersagen. Für Mähen und Häckseln – ein
überaus beliebter Zeitvertreib – waren genaue Zeiten vorgeschrieben, die auch
auf die Sekunde genau eingehalten wurden. »Es ist schon erstaunlich, wie all
die Leute, die sonst ordinär über jeden Schmarrn schimpfen, vor dem Herrn
Obmann kriechen«, kommentierte ich Poldi gegenüber die von unserer Sied-
lungsgenossenschaft ausgeübte Diktatur.
53/186

Kapitel 6
6
Die Sonne über meinem Eheleben verdüsterte sich zusehends, Leopold wurde
immer schrulliger. Er gab endlose Tiraden von sich, vernachlässigte sein
Aussehen und sah immer hässlicher aus. »Er is schon komisch, glaubst net?«,
fragte mich meine Schwiegermutter bei einem ihrer Wienbesuche ganz un-
verblümt. »Er wird immer mehr wie der Pepi-Onkel. Nur hat der a große Pen-
sion.« Damit spielte sie auf Poldis Großonkel an, der seit Jahrzehnten seinen
Ruhestand genoss. Die Aussicht, infolge der Unfähigkeit meines Mannes bis
zur Rente arbeiten zu müssen, verdross mich sehr. Trotzdem blieb ich stumm.
Zum einen lehnte ich es ab, mich auf derart primitive Weise mit meiner Sch-
wiegermutter zu verbrüdern, zum anderen schätzte ich Poldis Großonkel sehr.
War doch jeder Besuch bei dem mittlerweile sehr betagten Herrn keine Pflicht,
die es zu absolvieren galt, sondern eine mein eher eintöniges Leben erhellende
Abwechslung.
»Sir«, so nannten wir respektvoll den 97-jährigen, scharfsinnigen, höchst
originellen Bruder von Leopolds Großvater. Er war ein ehemaliger Meteorologe
und Flieger, der schon seit Jahrzehnten seine erstaunlich hohe Pension genoß
und sich bis in sein biblischen Alter noch das Aussehen und den Charme eines
Gentlemans der alten Schule bewahrt hatte. Er verfügte auch noch immer in
überreichem Maße über all das, was seinem schwerfälligen Neffen fehlte: Witz,
Humor und Ironie. Seit ihn vor einiger Zeit beim hastigen Überqueren der
Straße ein Auto mitten auf dem Zebrastreifen umgefahren hatte, war er fast
ganz an seinen Lehnstuhl gefesselt. Er trug diesen Schicksalsschlag mit be-
merkenswerter Fassung und ohne Murren oder Klagen. Bücher waren von je-
her seine Leidenschaft gewesen, die neue Situation machte ihn zum geradezu
unersättlichen Leser, den es ständig nach neuer Lektüre verlangte. Auch ein
Werk über historische Verbrechen hatte er studiert. In seiner witzig-
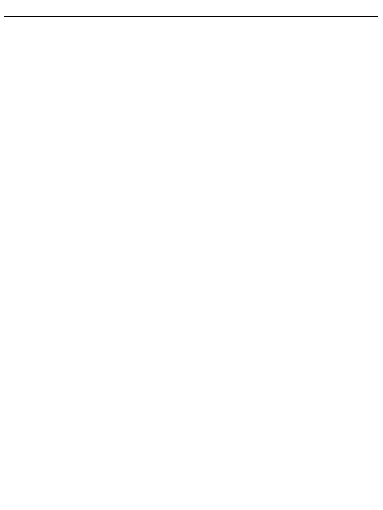
penetranten Art sagte er zu mir: »Soll ich dir schildern, wie man einen perfek-
ten Mord begeht? Du musst mir aber versprechen, nicht vielleicht den Poldi
umzubringen!
Ha,
ha,
ha!«
Damit
machte
er
mich
auf
die
»Badewannenmorde« aufmerksam, die im Jahr 1915 in England geschehen
waren.
Das war unser »Sir«, wie er leibte und lebte. Von ihm bekam ich nicht nur
Anregungen, sondern er hat mich oft aus den Anflügen düsterer Depression
gerissen, die bei mir ganz ohne Übergang einsetzten und die Phasen heiteren
Wohlbefindens ablösten. Meist besprachen wir die österreichische Politik, der-
en Vertreter er ohne Ausnahme des Schwachsinns bezichtigte. Er gab auch die
eine oder andere aufregende Episode seiner Kriegserlebnisse aus dem Zweiten
Weltkrieg zum Besten, den er als Pilot von Aufklärungsflugzeugen zur Gänze
mitgemacht und unbeschadet überstanden hatte. Manchmal erzählte er von
seiner wilden Jugend im Wien der Dreißigerjahre, wo sich die paramil-
itärischen Verbände von »Heimwehr« und »Schutzbund« regelrechte Kämpfe
lieferten und bürgerkriegsähnliche Zustände herrschten. Am Schluss jeden Be-
suchs nahm ich die vom »Sir« in rapider Folge verschlungenen Bücher an
mich, um sie bei Gelegenheit in der Nationalbibliothek gegen andere
umzutauschen.
Poldi stürzte sich nach dem – vehement geleugneten – Misserfolg seines
Buches voll Leidenschaft auf die historische Landeskunde. Er beschäftigte sich
mit der Identifizierung und Interpretation des niederen mittelalterlichen Adels
anhand seiner Reihung in den Zeugenlisten von Besitzurkunden. Die daraus
resultierenden Artikel veröffentlichte er – selbstverständlich ohne jegliches
Honorar – in Fachzeitschriften. Veröffentlichen war dabei eigentlich nicht das
richtige Wort, denn soweit ich es beurteilen konnte, lasen seine langatmigen,
schlecht geschriebenen, mit Hunderten von Fußnoten versehenen Ergüsse nur
zwei Menschen: er selbst und der Lektor der staatlich gestützten Fachzeits-
chrift für Mediävistik, die sein Werk druckte. »Glaubst du wirklich, dass dein
neuer Artikel ›Gewisse Aspekte zur Geschichte des niederen Adels im Bezirk
Amstetten im dritten Viertel des 12. Jahrhunderts‹ viele interessieren wird?«,
meinte ich zweifelnd. Dies wischte meine Ehehälfte, mit der ich zu diesem
55/186

Zeitpunkt nur noch recht und schlecht – mehr schlecht, wenn ich ehrlich
war – verheiratet war, vom Tisch: »Na wirklich, Hermine, Hermiiinchen! Wie
auch sonst, hast du auch davon keine Ahnung.«
In dieser tristen Situation half es auch nicht viel, dass ich meinem faden Beruf
etwas »Pep« verlieh. Im Besitz der Kontonummern meiner Kunden und
gestützt auf das Insiderwissen, dass die Unterschriften bei Überweisungen nie-
derer Beträge kaum jemals kontrolliert werden, ging ich häufig ans Werk.
Listig überwies ich vom Konto der Frau Dr. Weis, einer Rechtsanwältin, die mit
Vorliebe notorische Schwerverbrecher aller Art verteidigte, an Amnesty Inter-
national. Der Autohändler Franz Huber wiederum, der sich auf den Vertrieb
teurer Benzinfresser spezialisiert hatte, trug gegen sein Wissen – und sicher ge-
gen seine Überzeugung – zur Verbesserung der Luftqualität bei; er zahlte an
den World Wild Fund zur Nutzung alternativer Energiequellen regelmäßig
kleine Geldbeträge, die zu hinterfragen ihm nie in den Sinn kam. Ein fashiona-
bler Createur edler Pelzbekleidung wurde ebenfalls von mir zur Kasse gebeten;
er unterstützte zu wiederholten Malen den Verein »Vier Pfoten« zur Rettung
bedrohter Pelztiere.
Kam ich abends nach Hause, hielt mir Poldi beim Essen einen seiner langat-
migen Vorträge über die Krise der von den Naturwissenschaften in den Hinter-
grund gedrängten und bedrohten Geisteswissenschaften im Allgemeinen und
der Misere des Historischen Instituts der Universität Wien im Besonderen:
»Mathematiker, Biologen, Evolutionstheoretiker und Physiker sind in«, jam-
merte er. »Man überschüttet sie mit Geld, baut ihnen neue Institute, finanziert
ihre Reisen in alle Welt. Vor allem die Mathematiker scheinen sich, unter den
Fittichen eines krankhaft ehrgeizigen Dekans, geradezu wie die Kaninchen zu
vermehren. Eine Stelle nach der anderen gewährt ihnen der verblendete und
getäuschte Rektor unserer Universität. Was es bei denen noch zu erforschen
gibt, verstehe ich überhaupt nicht. Evolutionstheorie, ein Humbug! Ach, wie
ich darunter leide, dass man die Vergangenheit unseres Landes und die Pflege
der lateinischen Sprache derart barbarisch missachtet. Wen interessiert noch
das Mittelalter?«
56/186

Eine Frage, auf die ich keine tröstende Antwort wusste. »Ja, ja, Poldi,
plausch net«, dachte ich mir abfällig, während ich voll Schadenfreude ver-
nahm, wie gemein man Leopolds Spezialgebiet, die österreichischen
Ministerialien-Geschlechter des 13. Jahrhunderts, vollkommen ignorierte und
schon gar nicht honorierte.
Mich ärgerte auch, wie sich mein Mann von unseren Nachbarn behandeln ließ.
Einmal, als ich nach Arbeitsschluss mit dem Volkswagen zügig in unsere Straße
einbog, kam ich gerade dazu, wie ihm Herr Pollatschek vor der Haustür in
präziser, fast ultimativer Form gute Ratschläge zur Gartengestaltung erteilte.
Poldi nahm sie demütig, mit leicht gebeugtem Rücken und betretenem, ein-
fältigem Schweigen entgegen. Wut stieg in mir auf, doch ich lauschte schwei-
gend, bis wir endlich allein waren. Dann sagte ich Poldi meine Meinung:
»Nicht nur, dass du dir das blöde Geschwätz über günstige Angebote im Bau-
markt, die neuesten Einfassungen für Gemüsebeete und Mini-Springbrunnen
anhörst und nie widersprichst! Ich weiß, dass du das Zeug auch kaufst!« Wenig
später brachte der Feigling doch tatsächlich ein von Fritz Pollatschek ange-
priesenes Gift gegen Nacktschnecken heim.
Bei »Wetten, dass« vor dem Fernseher griff ich das Thema Pollatschek/Leo-
pold erneut auf. Eine erregte, etwas einseitige Debatte über die Nachbarn im
Allgemeinen, Pollatschek im Besonderen und Poldis kriecherischen Umgang
mit ihnen entspann sich. Mit meinem Mann zu streiten war ein schweres Un-
terfangen, das Geschick und Übung erforderte. Auch diesmal riefen meine Vor-
würfe keine Reaktion, sondern nur ein verlegenes, entschuldigendes Hüsteln
hervor. Das erboste mich und trieb mich zu schrillen, ausfälligen Beschimpfun-
gen, wobei ich mich auf die körperlichen Defizite meines Gatten konzentrierte.
Leopold als verklemmter Einzelgänger lebte ohne Freunde und Bekannte. Nur
Dr. Franz Wegner, ein Historikerkollege und Sonderling wie er selbst, stattete
ihm hin und wieder einen Besuch ab. Allerdings nur so lange, bis der stets kor-
rekt gekleidete, steife unverheiratete Mann mit dem kleinen Schnauzbart und
dem umständlichen Gebaren entdeckte, dass wir unser Heim mit Murli teilten.
Er beäugte ihn voll Abscheu. »Gehört der fette Kater Ihnen? Er schaut aus wie
57/186

ein Hängebauchschwein!«, fragte er erregt und schwer atmend, um uns dann
über seine Krankheit aufzuklären, eine schwere Allergie gegen Katzenhaare.
Dies und eine daraus resultierende, drastisch formulierte Antipathie gegen
Haustiger aller Art hielten den honorigen Wissenschaftler in der folgenden Zeit
von unserem Zuhause fern. Trafen wir ihn in einem Restaurant, wurde er nicht
müde, uns, vor allem aber mir, voll Gusto zu schildern, wie man im von
Aberglauben erfüllten dunklen und engstirnigen Mittelalter mit den Ahnen der
Auslöser seiner Krankheit, in denen man die Träger von Unheil vermutete, ver-
fahren war. Dass man in schwarzen Katzen den Teufel sah, den es mittels Ex-
orzismus auszutreiben galt. Von Prozessen, in denen die Tiere zu Hunderten
auf Scheiterhaufen verbrannt oder gevierteilt wurden. Wie man noch im 18.
Jahrhundert als »ausnehmendes Plaisir« adeliger Kreise das sogenannte
»Fuchsprellen« veranstaltet hatte. Dazu wurden auf Befehl des Oberjäger-
meisters Füchse und andere geeignete Tiere, wie Katzen und Hunde, gefangen.
»Cavaliers und Dames« schnellten diese dann mit einem festen Tuch, der
Prelle, in die Luft. Man amüsierte sich über die Luftsprünge und Kapriolen der
gequälten Tiere, die dabei oft Verletzungen erlitten.
Dr. Wegner teilte, wie er erklärte, voll und ganz die Ansicht des Universal-
Lexikons von 1735: »Thiere in ihrem Blut liegen sehen, selbst die Hand an sie
gelegt haben, neue Arten ihrer Martern erdencken, ist noch keine
Grausamkeit.« Mich ekelte vor dem unscheinbaren, aber bösartigen Mann.
Meine empörten Einwände, dass wir diese Barbareien und finsteren Zeiten
zum Glück überwunden hätten und dass man bereits im alten Ägypten Katzen
als Götter verehrt und nach ihrem Tode einbalsamiert und ehrenvoll bestattet
habe, wischte Dr. Wegner als sentimentale Ansichten einer weltfremden Dilet-
tantin zur Seite. Er brillierte stattdessen mit seinem Historikerwissen: »Stellen
Sie sich das vor! Spaniens ältestes gedrucktes Kochbuch aus dem 15. Jahrhun-
dert enthält ein köstliches Rezept für Katzenbraten!« Auf meine entsetzte
Frage, ob er denn Tiere nicht liebe, meinte er höhnisch: »Aber doch, selbstver-
ständlich. Vor allem Heringe in Dosen.« Dieser gemeinen Antwort fügte er
genüsslich hinzu, dass es immer noch viele Leute gebe, die Katzen Glassplitter
unter das Futter mischten oder es mit Rattengift versetzten. »Wahrscheinlich
sprichst du von dir selbst«, dachte ich mir wutentbrannt.
58/186

Wegners verbale Rohheiten verfolgten mich lange, sie störten sogar meine
Nächte. Kam ich dann endlich zur Ruhe, so quälten mich Alpträume. Im
Wachen erfüllten mich böse Gedanken an den kleinen Historiker. Doch was
konnte man tun? Man war doch hilflos gegen die Schlechtigkeit dieser Welt.
Wenig später wurden die gelegentlich anberaumten Treffen, bei denen ich
anwesend sein durfte, aus hygienischen Gründen in die Kochgasse Nr. 22 im 8.
Wiener Gemeindebezirk verlegt. Dort besaß Dr. Wegner in einem zwar schön-
en, aber heruntergekommenen Haus mit bröckelnder Fassade, wo in dem einst
eleganten Entree die Abfallkübel gleich hinter der Eingangstür fast den Weg
versperrten, eine große, von seinen Eltern übernommene und seither unver-
ändert belassene, katzenfreie und düstere Wohnung.
Als wieder ein Besuch bei Dr. Wegner bevorstand, machte ich mir Gedanken
über ein passendes Gastgeschenk. Nach Erwägungen verschiedenster, aber
stets unfreundlicher Art füllte ich schließlich Katzenfutter aus einer Dose mit
dem Etikett »Ragout des Canards. Für verspielte Kätzchen« in ein kleines
Keramik-Töpfchen um, verzierte es mit ein paar Preiselbeeren, verschloss es
sorgfältig mit einer bunten Plastikhülle und versah das Ganze mit der ver-
schnörkelten Aufschrift »Wildpastete nach Hausfrauenart«.
Dr. Wegner freute sich sehr darüber. Ich bedauerte allerdings, dass es mir
verwehrt blieb, ihn beim Verzehr der kätzischen Köstlichkeit zu beobachten.
Auf jeden Fall habe es ihm, wie er mir mitteilte, sehr geschmeckt.
Und mich hat es zu weiteren Taten ermutigt und angeregt.
Bei einer neuerlichen Einladung zu Tee, gekauftem trockenem Anker-Kuchen
und gespreizter Konversation entpuppte sich der Experte für Diplomatik des
15. Jahrhunderts nicht nur als potenzieller Tierquäler, sondern auch als
Frauenhasser. »Ja, das verstehen die Mädels eben nicht«, äußerte er sich
wiederholt, wenn ich eine Bemerkung zur Tagespolitik von mir gab. Sehr
schnell beschloss ich, dass der hässliche Macho eine weitere, etwas deftigere
Lektion erhalten sollte. Mit stärkeren Mitteln, denn Katzenpastete allein, und
war sie auch vom Feinsten gewesen, hatte sich eindeutig als zu schwach er-
wiesen! Allem Anschein verfügte der verkümmerte Mediävist über einen
ebenso verkümmerten Geschmackssinn.
59/186

Kurz bevor wir Dr. Wegner wieder einmal die Ehre erweisen sollten, unterzog
ich Murli mithilfe eines feinen Staubkamms einer ausgiebigen Körperpflege,
was der Kater sehr zu schätzen schien. Er warf sich lustvoll auf den Rücken und
schnurrte vor Begeisterung so laut, dass ich lachen musste, während ich
sorgfältig die dünnen Unterhaare seines Fells entfernte. Anschließend gab ich
den derart gewonnenen Knäuel aus grauen Katzenhaaren sorgfältig in einen
Briefumschlag, und verstaute ihn in meiner Handtasche. Die Höflichkeitsvisite,
der ich diesmal mit gespannter Neugier entgegensah, versprach nicht ganz so
fad wie sonst immer zu werden. In eleganter Aufmachung begrüßte ich mit
wahrer, ungeheuchelter Freude den in ein altmodisches kariertes Sakko samt
Fliege gekleideten Katzenhasser, der uns in sein stickiges, selten gelüftetes
Wohnzimmer mit den schweren braunen Samtvorhängen und den verblichen-
en Polstermöbeln von anno Schnee bat. »Delikat war neulich Ihre Pastete aus
eigener Produktion, kleine Frau!«, meinte er wohlwollend zu mir, obwohl ich
ihn überragte. Die erste Portion meines geheimen Mitbringsels schob ich
diskret in die Ritzen des Fauteuils, von dem sich der Gastgeber umständlich er-
hob, um nach dem auf dem Küchenherd aufgesetzten Teewasser zu schauen.
Eine weitere ließ ich während seiner Abwesenheit auf den Teppichboden
gleiten und mit einer dritten strich ich unauffällig über das Tischtuch.
Als Dr. Wegner mit einer abgeschlagenen Teekanne aus dünnem Porzellan
zurückkehrte, die er vorsichtig in der Hand balancierte, räusperte er sich
mehrmals, wobei er den Kragen seines Hemds mit zwei Fingern lockerte. Ich
hatte auch den Eindruck, dass er etwas um Atem rang. Mit Wohlgefallen beo-
bachtete ich, während ich den ganz exzellenten Tee schlürfte, dass es unserem
Gastgeber gar nicht gut zu gehen schien. Auf die Äußerungen meines Mannes
über die lamentablen, ja skandalösen Zustände am Historischen Institut, die
ihn ansonsten sehr bewegten und zu wahren Hasstiraden verleiteten, antwor-
tete Wegner heute nicht. Seine Gesichtsfarbe änderte sich allmählich. Und spä-
testens zu dem Zeitpunkt, als sie ein hübsches Grau annahm, merkte ich, dass
er das Interesse an uns gänzlich verloren hatte. Seinen keuchend her-
vorgestoßenen Worten konnte ich nur mehr mit Mühe entnehmen, dass es ihn
nach seinen Tropfen gegen allergische Anfälle dürstete, die auf dem Glasregal
über dem Waschbecken im Badezimmer standen.
60/186

Ich eilte natürlich sofort ins Bad, schnappte mir das Fläschchen, ließ es
durch das winzige, auf groteske Art mit angegrauten Gardinen geschmückte
Fenster ins Freie gleiten und kehrte nach kurzer Pause, Besorgnis und Atem-
losigkeit heuchelnd, ins Wohnzimmer zurück. Eine, wie sich herausstellte,
sinnlose Aktion, denn mein Bericht über die vergebliche Suche nach der
rettenden Medizin ging im Chaos unter. Der Gastgeber wand sich bereits, nach
Luft ringend und von Krämpfen geschüttelt, auf dem Boden, während
mein – im praktischen Leben vollkommen hilfloser – Gatte das Telefonbuch
mit zittrigen Händen lange vergeblich nach einer Telefonnummer des ärzt-
lichen Notdienstes durchsuchte. Ich drängte mich nicht weiter auf, sondern
beobachtete das geschäftige Treiben. Bedauerlicherweise war der honorige
Doktor, dessen Hals beträchtlich anschwoll, beim Eintreffen der Ambulanz
bereits ganz blau angelaufen. Im Spital konnte der im 51. Lebensjahr stehende
Patient dann, wie wir später erfuhren, mittels antiallergischer Injektionen, In-
fusionen, Herzmassage und größtem ärztlichen Einsatz gerettet werden. Ein
partielles Organversagen ließ ihn jedoch als bedauerlichen Pflegefall zurück. So
wurde er tatsächlich zum Anwärter auf die staatliche Frühpension, von der er
stets geträumt hatte – allerdings unter anderen Voraussetzungen.
Nachdem wir noch einen Neffen von Dr. Wegner verständigt hatten, erreichten
wir verstört und verwirrt – auch mich ließ das grauenhafte Unglück selbstver-
ständlich nicht unberührt – unser Zuhause, wo uns Murli wie immer schon auf
der Straße ungeduldig entgegeneilte, ungeachtet der großen Gefahr, der er sich
damit aussetzte. Erstaunlich, dass das Tier die verschiedenen Autogeräusche
unterscheiden konnte, aber so war es.
Während sich Leopold bald zur Ruhe begab, zog ich Murli vertrauensvoll ins
Gespräch. »Fett, hat er dich geschimpft! Fett! Ich habe ihm eine saftige Lehre
erteilt. Er wird sie nie vergessen!«, erklärte ich ihm flüsternd. Der Kater blickte
mich klug, aufmerksam und, wie mir schien, sogar mit einer gewissen Zustim-
mung an. Ob er mich tatsächlich verstanden hatte? Mich jedenfalls durch-
strömte von Kopf bis Fuß ein ganz neuartiges prickelndes Glücksgefühl, ein
wohliges, warmes Behagen, das ich seit den lange zurückliegenden
61/186

Unglücksfällen von Hahn Peter und der alten Frau Zottl in dieser Form nicht
mehr verspürt hatte und das ich sehr genoss.
Auch die nächsten Tage schwebte ich geradezu auf Wolken, kam mir all-
mächtig, gerecht und gescheit vor, beinahe wie ein weiblicher St. Franziskus,
der Schutzherr aller Tiere. Auf Poldis Drängen hin besuchte ich Dr. Wegner im
St.-Josefs-Spital, wo er aufgrund seiner Privatversicherung, die er fürsorglich
abgeschlossen hatte, den Luxus eines Einzelzimmers genoss. Vielleicht nicht
richtig genoss, denn er lag, angeschlossen an die verschiedensten Infu-
sionsschläuche, auf dem Rücken und starrte hilflos zur Decke. Das Sprechen
fiel ihm schwer, und die Laute, die er mühsam von sich gab, waren
unverständlich.
Ich entschloss mich, sein Sprachvermögen zu stimulieren, zog die mitgeb-
rachten Erzählungen von Patricia Highsmith, in denen sich Tiere an Menschen
rächen, hervor und begann vorzulesen. Die Lektüre beendete ich mit Sinns-
prüchen berühmter historischer Persönlichkeiten. »Das kleinste Kätzchen ist
ein Meisterwerk!«, meinte Leonardo da Vinci. »Was ist größer als die Liebe
einer Katze?«, fragte Charles Dickens. Auch eine Warnung der Schriftstellerin
Faith Resnick durfte nicht fehlen: »Leute, die Katzen hassen, werden im näch-
sten Leben als Mäuse geboren!«
Dr. Wegner wollte sich, wie ich merkte, zu diesem Ausblick auf seine Zukun-
ft äußern, brachte jedoch nur etwas hervor, das wie »Gogo« klang, zu mehr war
er nicht imstande. Ein freundliches Lächeln umspielte meine Lippen, als ich
aufstand und mit dem Versprechen der baldigen Wiederkehr meinen – etwas
einseitigen – Abschied nahm. Auf dem Gang stieß ich auf eine freundliche
Krankenschwester, die mich vertraulich ansprach: »Sind Sie eine Verwandte?
Ein wirklich tragischer Fall, der Dr. Wegner. Warum hat er nur seine Medizin
nicht parat gehabt und sie rechtzeitig eingenommen? Die Ärzte haben leider
nur wenig Hoffnung!« Ich nickte traurig und seufzte wehmütig.
Zu Hause berichtete ich Poldi über den schlechten Zustand des Patienten
und seine unverständlichen Laute. Mein belesener und mit der wirren
Geisteswelt des Dr. Wegner vertrauter Mann klärte mich auf: »›Gogol‹ hat er
gesagt. Gogol. Und er wollte sicher auf eine Episode aus dem Leben des psych-
isch labilen russischen Schriftstellers Nikolai Gogol anspielen. Dieser hat im
62/186

Alter von fünf Jahren seine Hauskatze mit einer Stange langsam in einem
Teich ertränkt.« Nach dieser Mitteilung betrübte mich der Tod von Dr. Wegn-
er, der drei Tage später eintrat, in keiner Weise. Die menschliche Natur ist
wirklich von wunderbarer Widerstandsfähigkeit, dachte ich bei mir. Ver-
schwindet ein Obstakel, egal welches – und sei es auch durch Tod –, schon
schöpfen wir Hoffnung, und die Freude kehrt wieder.
63/186

Kapitel 7
7
Die Jahre zogen, wie man oft so treffend liest, ins Land. Ich wurde langsam äl-
ter, ein Ende meiner widerwärtigen Berufstätigkeit war nicht abzusehen. Ganz
im Gegenteil! Die wachsende Lebenserwartung ließ das Pensionsalter immer
weiter in die Höhe schnellen. Würde ich auch noch mit neunzig arbeiten, ob-
wohl doch jede nur erdenkliche Vorsorge zur Erreichung eines hohen Alters
getroffen worden war? Da klang mir der Titel eines Buches unangenehm in den
Ohren, denn er schien die Gedanken der Pensionskassen auszudrücken:
»Hunde, wollt ihr ewig leben?«
An einem schönen, ja wirklich wunderschönen Oktobertag musste ich das
Bett hüten. Die Bäume hatten sich bereits prächtig rot, gelb und golden ver-
färbt und die Luft hatte allmählich jene Kühle und Schärfe angenommen, die,
trotz wehmütiger Gedanken an den verflossenen Sommer, belebte und Wohl-
behagen schuf. Getäuscht von den trügerischen Strahlen der mittäglichen
Sonne, hatte ich mir infolge mangelhafter Kleidung eine Erkältung zugezogen.
Demnach las ich zum x-ten Mal voll Bewunderung das Meisterwerk von Agatha
Christie, »The Murder of Roger Ackroyd«, und ließ meine Gedanken müßig
umherschweifen.
Wie hoch mochte wohl die Dunkelziffer jener Mörder sein, die unter den Au-
gen der Kriminalpolizei emsig und still ihrem bösen Handwerk nachgingen,
ohne je verdächtigt, erwischt und zur Rechenschaft gezogen zu werden? Die
Überlegung bereitete mir einen prickelnden Reiz. Ich spann sie weiter und kam
zu dem unweigerlichen Schluss, dass es massenweise Fälle geben musste, bei
denen jemand, aus welchen Gründen auch immer, unerkannt den Todesengel
spielte. Hatte mir da nicht unlängst der »Sir« von besonders spektakulären
Morden erzählt, die lange Zeit ungelöst blieben und nur durch Zufall aufgeklärt

wurden? Ich selbst hatte ja stets die Meinung vertreten, dass viele der Opfer ihr
Schicksal nicht nur herausforderten, sondern es auch mehr als verdienten.
Die Stunden im Bett zogen sich, nur von Schlafen, Fiebermessen und In-
halieren unterbrochen, zäh und endlos dahin. Am Abend gesellte sich zu der
fast unerträglichen Langeweile noch ein von der rechten Schläfe ausgehender
bohrender Kopfschmerz hinzu. Voll übler Laune erwartete ich die Heimkehr
meines lieben Ehemanns von seiner Dienststelle, dem Historischen Institut der
Universität Wien.
Gerade als ich die High-Society-Spalte einer Illustrierten mit vielen schönen,
jungen und reichen, oft sogar adeligen Menschen mit klingenden Namen sowie
zeit- und faltenlosen Gesichtern durchblätterte, eine Leidenschaft, der ich mit
Begeisterung frönte, hörte ich, wie sich die Eingangstür öffnete. Mein Leopold,
der »Poldi«, machte seinem Namen alle Ehre, indem er polternd eintrat und
wie stets über den Teppich im Vorzimmer stolperte.
Und dann war er auch schon bei mir. Er sah natürlich aus wie immer, mein
Ritter von der traurigen Gestalt. Welch ein Gegensatz! Brutal der edlen Welt
voll Glamour und Eleganz entrissen und in die Realität zurückgeworfen, hatte
ich vor mir einen kleinen, dicken Mann von 52 Jahren mit sich lichtendem
Haar, in zerbeulten, zu kurzen Hosen, einem über seinem rundlichen Bauch et-
was auseinanderklaffenden zerknitterten Hemd samt Fettfleck, einem abgewet-
zten Sakko und »verhatschten« Schuhen. Obwohl ich die Bemühungen zu sein-
er Verschönerung schon längst resigniert aufgegeben hatte und mich nicht
mehr um Leopolds Kleidung kümmerte, ärgerte mich sein ungepflegter An-
blick. Eine Rüstung sollte er tragen, schoss es mir durch den Kopf. Das würde
ihm als Mittelalter-Historiker das richtige Flair verpassen und wäre überdies
auch haltbar. Doch wie ich Poldi, den kuriosen Ritter, kannte, hätte er es
schnell geschafft, selbst ein Kettenhemd zu ruinieren oder zumindest etwas
daran zu zerbrechen, zu verbiegen oder auszubeulen. Meine Gedanken blieben
ihm verborgen, denn er murmelte mitfühlend: »Arme Hermine. Soll ich dir Tee
kochen oder ein Butterbot streichen?« Aufgrund schlechter Erfahrungen mit
seinen kulinarischen Fähigkeiten, bei denen er stets die Küche verwüstete,
lehnte ich seine Samariterdienste ab, worauf Poldi, sichtlich erleichtert,
entschwand.
65/186

Seufzend lehnte ich mich in die Kissen zurück und kehrte zurück in das faszini-
erende Leben der eleganten Welt. Ich reihte mich ganz selbstverständlich unter
die Schönen und Erfolgreichen ein. An ihrer Seite tummelte ich mich, um-
fächelt von den Palmen der französischen Riviera, in heißer Sonne, räkelte ich
mich am Swimmingpool des direkt an der Promenade des Anglais gelegenen
berühmten Luxushotels »Palais de la Mediterranee«, flirtete ich hemmungslos
mit athletischen jungen Männern und schlürfte dabei genüsslich Caipirinha.
Mit einem Wort, ich genoss mein Party-Dasein in vollen Zügen, bis aus dem
Stockwerk unter mir bedrohliche Geräusche heraufdrangen. Es klapperte,
krachte und zischte; offenbar war Poldi etwas aus der Hand gefallen. Murli
maunzte empört auf, vielleicht war der ungeschickte Rohling unserem
hübschen, etwas übergewichtigen Kater, der stets voll Neugier und in der
Hoffnung auf Futter durch das Haus strich, auf den Schwanz getreten.
Als sich ein beißender Geruch verbreitete, hielt es mich nicht länger in mein-
er sonnigen Scheinwelt. Ich verließ mein warmes Bett, stand auf und ging hin-
unter in die Küche, um nach dem Rechten zu sehen. Leopold lehnte ermattet
neben dem Herd, warf mir aus braunen Hundeaugen einen anklagenden Blick
zu und kühlte wehleidig eine kleine Brandwunde am Zeigefinger seiner rechten
Hand. Beim Zubereiten eines simplen Spiegeleis hatte er sich verbrannt. Fast
gekränkt erklärte er mir seine kochtechnischen Fehlleistungen und bezichtigte
mich, ihn falsch instruiert zu haben. Zuerst habe er, wie ich es ihn gelehrt
hatte, in einer Pfanne Öl erhitzt, dann mit flinker Hand ein Ei hineingeworfen.
Leider sei das siedende Konglomerat fast bis zur Decke gespritzt, wobei es ihn
verbrühte. Er würde es doch nie lernen! Beim letzten Versuch hatte er Öl und
Ei gleichzeitig in die Pfanne geleert, einen Fehler, den er diesmal anscheinend
vermeiden wollte.
Ich verarztete Poldi und machte mich an die Zubereitung unseres Abendes-
sens. Aus Erfahrung klug geworden, und zur Schonung meiner Nerven, zog ich
meinen »Göttergatten«, wie man Ehemänner in Wien nicht ohne scherzhafte
Ironie zu bezeichnen pflegt, nicht einmal zum Decken des Esstisches heran.
Bereitete ihm doch das Auffinden der seit Jahren am selben Platz verwahrten
Küchenutensilien wie Teller, Besteck und Servietten jeden Tag aufs Neue große
Mühe. Ich ertrug es nur schwer, wenn er, mit seinen Gedanken irgendwo,
66/186

wahrscheinlich jedoch im mystischen und fernen Mittelalter, pathetisch einen
Küchenschrank nach dem anderen öffnete, bis er endlich, während das auf
dem Tisch angerichtete Essen auskühlte, alles beisammen hatte. Einmal hatte
er sogar geistesabwesend im Kühlschrank gesucht. Ich krümmte mich im Stil-
len vor Lachen. »Bingo«, rief ich fröhlich, als er beim zehnten Versuch fündig
wurde und die gewünschten Gabeln erspähte. Oft jedoch war ich nicht zu
Scherzen aufgelegt, sondern zischte nur böse: »Servietten fehlen. Nein, nicht in
der Bestecklade!«
Müde, deprimiert und angeschlagen durch die Erkältung, suchte ich alle meine
unerfreulichen Gedanken weit von mir zu schieben. Ich murmelte, wie ich es in
meiner Jugend getan hatte: »Es wird alles immer besser und besser«, und
konzentrierte mich auf die Planung der Einkäufe für die kommenden Tage.
So galt es etwa, Murli, der geschlossene Türen hasste, sein ungehindertes
Streifen durch das Haus zu erleichtern. Ich begab mich daher in den großen,
scheußlichen Supermarkt am Fuße des »Bierhäuslbergs« und suchte nach Tür-
stoppern. Ich irrte durch die langen Gänge. Wütend, dass die Verkäufer schon
wieder einmal, gemäß der listig-primitiven Verkaufsstrategie der Geschäfts-
führung zur Steigerung der Aufmerksamkeit ihrer Kunden, alles umgeräumt
hatten, suchte ich im gleißenden Neonlicht die endlosen Regale ab. Wie immer
war kein Personal in Sicht.
Plötzlich hörte ich hinter mir eine zwar laute, aber angenehme Stimme:
»Jessasmaria, wer is denn des?« Ich drehte mich um, und wen sah ich? Maria,
blond, stämmig und fröhlich, die Freundin meiner längst verflossenen Kindert-
age. »Die Hermi!«, rief sie. »Die Mizzi!«, rief ich. Wir begrüßten einander voll
überschwänglicher Freude und verfielen instinktiv sofort in den Dialekt unser-
er Waldviertler Heimat. »Wos mochst do? Wo kummst her? Wia geht’s da?«
Wir betrachteten einander voll Wohlwollen. »Guat host di g’holten!«, kom-
mentierten wir höflich die geringen Spuren unseres fortgeschrittenen Alters,
umarmten uns freudig und verabredeten an Ort und Stelle ein Treffen.
»Gemma am Somstag um zehn ins Dommayer?«
Mizzi erzählte mir, dass sie einen wesentlich älteren Handelsangestellten ge-
heiratet habe, die gemeinsamen Kinder seien mit ihren vierundzwanzig und
67/186

zwanzig Jahren bereits erwachsen und außer Haus. Zu unserem Entzücken
stellten wir fest, dass wir in Hietzing und Hütteldorf, also in benachbarten
Bezirken, nur getrennt durch den Wienfluss, wohnten – und dies, ohne es
geahnt zu haben, schon seit vielen Jahren. Das Dommayer in Alt-Hietzing war
uns beiden natürlich ein Begriff. Ich selbst durfte mich dort sogar, was mich
mit Stolz erfüllte, zu den privilegierten Stammgästen zählen.
Dieses alteingesessene Lokal ist ein Kaffeehaus in der typischen Wiener Tra-
dition. Die Einrichtung ist schönstes Art déco aus der Zeit um 1930, behaglich
und gemütlich – gepolsterte Bänke in Nischen, sogenannte Logen für intimere
Privatgespräche, Tischchen und Thonet-Sessel in der Mitte für die Gäste, die
nicht lange zu verweilen gedenken. Schwarz gekleidete Kellner wachen über
das Wohl der Gäste und ihren eigenen Status. Sie werden respektvoll mit »Herr
Ivo« oder »Herr Albert« angesprochen und herrschen nach Art aufgeklärter
Monarchen des 18. Jahrhunderts über ihre Untertanen, streng, gerecht, aber
undemokratisch. Ihre Gunst muss man sich verdienen. Beim Antreten ihres Di-
enstes schweifen ihre Blicke aufmerksam durchs Lokal: »Guten Morgen, die
Herrschaften!« Unbotmäßige Gäste werden nicht beachtet oder in die
Schranken gewiesen.
»Es ist Ihre Aufgabe, mir einen Platz zu suchen!«, hörte ich einmal einen der
Aussprache nach norddeutschen Eindringling rufen. »Na, wirklich net, i glaub,
i dram (träume)!«, lautete die höhnische Antwort von Kellner Ivo. »Was, der
Garten ist noch nicht geöffnet?«, erboste sich jemand an einem schönen Mait-
ag. »Ich komme nie mehr wieder!« – »Do san’s ober selber schuld«, replizierte
Ober Albert herablassend. »So a Lokal gibt’s in gonz Wien net!«
Stammgäste hingegen, die sich durch anständiges Benehmen und eine
gewisse Unterwürfigkeit in die Seele der bedienenden Götter geschlichen
haben, leben – egal ob Tier oder Mensch – im Paradies. Sie werden verwöhnt,
verhätschelt, physisch und psychisch betreut. Hunde jeder Größe erhalten
Wasser, gleiten auf das bereitgestellte »Tackerl« unter die Tische, wo sie schlä-
frig vor sich hinbrüten, um nur bei der Annäherung eines Rivalen kläffend her-
vorzuschießen. Von der schwarzen, überheblichen Hauskatze, die erhobenen
Hauptes und ohne Furcht hochmütig durch das Lokal schreitet, auf den Fens-
terbrettern sitzt, liegt und sich putzt, werden sie, wie wir Wiener sagen, nicht
68/186

einmal ignoriert. Die Katze »Gundi« lebte, als ich Mizzi wiederfand, schon eine
geraume Weile im Lokal, genauer gesagt seit dem Tag, als sie ein älterer Gast
der Obhut der Kellner anvertraute, bevor er selbst in ein Seniorenheim
entschwand.
Menschliche Stammgäste befragt man ausführlich nach ihrem Befinden, er-
füllt ihnen exzentrische Sonderwünsche. Man bestreicht für sie resche Früh-
stückssemmeln mit Butter, bestreut ihnen Brote mit Schnittlauch, serviert an
die zwanzig verschiedene Kaffeesorten, versorgt sie mit Ersatzbrillen, wenn sie
die eigenen vergessen haben, bringt ihnen die gewünschten Zeitungen samt
Kommentar an den Tisch und verabreicht sogar Aspirin, wenn die Auswüchse
der österreichischen Politik ein Ausmaß angenommen haben, dass sie Kopf-
schmerzen bereiten. Einen hochbetagten erkrankten Stammgast hat – wie man
sich voll Bewunderung und Grausen zuraunte – Kellner Ivo sogar zu Hause
aufgesucht, um ihm seine gewohnte Bestellung – Thunfisch-Brot, gefolgt von
einem Wiener Krapfen und einem Kaffee (einem »Einspänner«) – zu überbrin-
gen. Ereilt die derart Verwöhnten trotz langer Jahre aufmerksamster
Betreuung ihr menschliches Schicksal, kündet davon eine schwarz umrandete,
im Lokal ausgehängte »Parte«, und der Lieblingsober des Verstorbenen nimmt
an seinem Begräbnis teil.
Als Mizzi und ich am darauffolgenden Wochenende in einer der rot gepolster-
ten Logen des Kaffeehauses, das mir damals schon fast zur zweiten Heimat ge-
worden war, Platz nahmen, und jede von uns, als hätten wir es verabredet, eine
»Melange« bestellt hatte, begann ein Erzählen, das kein Ende nehmen wollte.
Ich freute mich aufrichtig Maria, alias Mizzi, wiederzusehen.
Nach zweistündigem Plaudern und oftmaligem, von lautem Gelächter unter-
brochenen »Erinnerst du di no, wie wir …?«, tauschten wir Adressen und Tele-
fonnummern aus. Wie viele Jahre hatten wir doch nur einen Steinwurf entfernt
voneinander gelebt! Wir beschlossen, uns häufig zu sehen und uns vor allem
nicht mehr aus den Augen zu verlieren – ein feierliches Versprechen, das wir
zur beiderseitigen Freude lange eingehalten haben. Mizzi sollte tatsächlich bald
zu meinem Lebensmenschen, wie man so schön zu sagen pflegt, werden, vor
dem ich – fast – keine Geheimnisse hatte.
69/186

Am Ende dieses aufregenden Tages legte ich mich erschöpft nieder. Der Schlaf
wollte sich bei mir nicht so recht einstellen.
Nachdem ein mildes Beruhigungsmittel, das ich in Form von Tropfen zu mir
nahm, keine Wirkung zeigte, stand ich schließlich auf, heiser von mehrmali-
gem, jedoch vergeblichem Räuspern zur Unterbrechung der Grunzlaute an
meiner Seite, verließ das eheliche Gemach und begab mich ins Wohnzimmer,
wo mich wohltuende Stille umfing.
Auf dem kleinen, geschwungenen Couchtisch bei der großen Sitzgarnitur lag
noch immer das von Poldis Großonkel empfohlene Buch über sensationelle
Kriminalfälle aus der Zeit nach 1900. Da mir die nötige Müdigkeit zur Schlafre-
ife fehlte, nahm ich es zur Hand und vertiefte mich darin.
Im Dezember 1913 hatte sich in Blackpool ein Unfall ereignet, der den Bür-
gern des beschaulichen englischen Badeortes willkommenen Gesprächsstoff
bot. War doch die Urlauberin Mrs Alice Smith nach einem Anfall im Bad er-
trunken. Die Vorgeschichte der Toten entpuppte sich als wahre Romanze. Die
junge Krankenschwester und ein nicht mehr ganz junger Handlungsreisender
hatten, stürmisch ineinander verliebt, gegen den Widerstand der Eltern des
Mädchens nach ganz kurzer Bekanntschaft geheiratet. Ihre Hochzeitsreise
führte Mr und Mrs Smith in die Küstenstadt Blackpool an der Irischen See, wo
man sich in einer kleinen und preiswerten Pension einmietete. Rührend um
das Wohlergehen seiner Gattin besorgt, unterzog der Ehemann die Unterkunft
einer peniblen Prüfung und inspizierte auch das Bad. Wieso er die Wanne
genau abmaß, blieb der jungen Gattin vorläufig verborgen. Sie nahm diese
harmlose Marotte jedoch mit einem toleranten Lächeln zur Kenntnis.
Kurz darauf klagte Alice über heftige Kopfschmerzen und suchte den Arzt
Dr. Billing auf, der ein Medikament verschrieb. Auf Geheiß ihres Mannes nahm
sie anschließend ein heißes Vollbad. Als Mr Smith, wie er angab, irgendwann
beunruhigt nach ihr rief, erhielt er keine Antwort. Er betrat daraufhin den
Raum und fand seine Frau tot im Wasser liegend. Der rasch herbeigerufene Dr.
Billing stellte nach kurzer Untersuchung fest, dass das heiße Bad zweifelsohne
eine Herzattacke oder einen Ohnmachtsanfall ausgelöst hatte. In ihrer Hil-
flosigkeit sei die Frau dann ertrunken. Fremdverschulden schloss der
70/186

Mediziner kategorisch aus, da die Leiche auch nicht die geringste Spur von Ge-
waltanwendung zeigte. Sein Trost galt dem völlig gebrochenen Witwer.
Sicher, ein trauriger Unfall. Und schon lange her. Was hat der »Sir« daran
nur so Bemerkenswertes gefunden?, wunderte ich mich. Mangels anderer Lek-
türe las ich jedoch weiter.
Im Dezember 1914, fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Vorfall in
Blackpool, berichtete das Wochenblatt »The News of the World« über einen
tragischen Fall, der demjenigen von Blackpool aufs Haar glich. Der Bericht des
völlig gebrochenen Ehemanns lag vor: Nach ihrer schönen Trauung in Südeng-
land hatte er mit seiner Frau Margaret zwei Zimmer in einer Pension im Lon-
doner Bezirk Islington gemietet. Die Frau klagte über Kopfschmerzen, der Arzt
Dr. Bates verschrieb Medikamente, der Ehemann riet zu einem heißen Bad.
Schließlich hielt Mr Lloyd im Badezimmer Nachschau und fand, wie er zu Pro-
tokoll gab, die innig geliebte Ehefrau leblos in der zu drei Viertel mit Wasser
gefüllten Wanne. Für Dr. Bates, den man sofort rief, gab es keinen Zweifel an
den Umständen des tragischen Unglücks. Seine Diagnose lautete: »Tod durch
Ertrinken aufgrund eines Schwächeanfalls nach einer kürzlich überstandenen
Grippe.« Ohne Bedenken stellte er den Totenschein aus.
An dieser Stelle brach ich, obwohl die Sache spannend zu werden versprach,
ab, da mich der Schlaf übermannte. Ich nahm mir vor, mit unserem »Sir«
nochmals über das Buch zu reden.
Ich wusste, wie sehr es Poldi hasste, sein Bett nicht nur mit mir, sondern
auch dem Kater zu teilen. Trotzdem trug ich Murli, der sich schnurrend auf
meinem Schoß zu einer Kugel eingerollt hatte und die Augen mit einer Pfote
bedeckt hielt, mit mir ins Schlafzimmer.
Schon am darauffolgenden Tag griff ich erneut zu dem Buch, um mehr über
die rätselhaften Unglücksfälle zu erfahren, deren Lösung mir der alte Herr
nicht hatte verraten wollen.
Es war ein kurioser Zufall, dass Mr Joseph Crossley, der Inhaber jener Pen-
sion in Blackpool, wo sich Mr und Mrs Smith im Dezember 1913 einquartiert
hatten und Alice Smith auf tragische Weise gestorben war, »The News of the
World« las und den groß aufgemachten Bericht über das Ableben der Mrs
71/186

Lloyd sah. So erfuhr er zu seinem Erstaunen, dass – fast auf den Tag genau ein
Jahr nach dem tragischen Unfall in seinem Haus – wieder eine Frau unter
frappierend ähnlichen Umständen ums Leben gekommen war. Mr Crossley
stutzte. Welch ein Zufall! Oder doch kein Zufall? Als ein Misanthrop, der sein-
en Mitmenschen aus Prinzip misstraute, schnitt er den Zeitungsartikel aus,
legte die alte Notiz über den Unglücksfall in seiner eigenen Pension dazu und
schickte beides, auf die Erfahrung und Kompetenz der Polizeibehörden ver-
trauend, im Januar 1915 an Scotland Yard. Wäre es möglich, dass zwischen
dem Badezimmertod der Mrs Lloyd in Islington und dem der Mrs Smith in
Blackpool irgendein Zusammenhang bestand? Er bitte die Kriminalpolizei um
Untersuchung der Vorgänge!
Wenig später begab sich der für den Bezirk Islington zuständige Detektiv-In-
spektor Arthur Neil an den Ort des Geschehens in der Bismarck Rd. 14 und
sprach mit der Vermieterin. Ms Blatch erinnerte sich genau. Den Ehemann Mr
Lloyd beschrieb sie als mittelgroß, hager, zwischen vierzig und fünfzig Jahre
alt, mit verbissenem Gehabe und stechendem Blick. Er war ihr aufgefallen:
»Ich bin jetzt seit vierzig Jahren im Gewerbe und an die kuriosen Wünsche von
Gästen gewöhnt. Aber so etwas habe ich noch nie erlebt! Vor meinen Augen hat
er die gusseiserne Wanne abgemessen!« Als der Mieter nach dem Unfall seiner
Frau um Hilfe rief, war Ms Blatch die Stufen zu dem im Halbstock gelegenen
Baderaum hinaufgeeilt. Sie kam gerade zurecht, um zu sehen, wie Mr Lloyd
den leblosen Oberkörper seiner Frau aus der Wanne zog. Dr. Bates vermochte
leider nicht mehr zu helfen, Mrs Lloyd war bereits tot. Nach Erledigung der
Beerdigungsformalitäten sei der tieftraurige Mr Lloyd verzogen. Wohin, das
wusste die Vermieterin nicht zu sagen.
»Interessant«, dachte ich schläfrig. »Wie mag das nur weitergehen? Recht
unheimlich.«
Zurück im ehelichen Schlafgemach war an Ruhe nicht zu denken, denn
während ich mich hin und her wälzte, erfüllte ein sonores Schnarchen und
Keuchen den Raum. In der Stille der Nacht zog ich Bilanz: »Zugegeben, ich
leide unter der proletarischen Umgebung, in der wir leben, aber wenn es uns
72/186

schlecht geht, sind sie alle stets zur Stelle. Bei Krankheiten geben die Nachbarn
Ratschläge, sie gehen in die Apotheke, machen für uns Einkäufe im nahen Su-
permarkt, denn bei uns am Berg hat natürlich der letzte Lebensmittelladen
schon längst zugesperrt.« Die milde Toleranz meiner nächtlichen Gedanken er-
streckte sich nicht auf meinen Mann, den ich lange schlaflos und voll Groll be-
trachtete. »Du bist es«, sprach ich zu dem laut Schnarchenden, »der mir von
allen Menschen, die ich kenne, am meisten auf die Nerven geht.« Schließlich
stand ich auf und vertiefte mich erneut in die Lektüre.
Das Problem, mit dem sich einst Inspektor Neil im Jahre 1915 konfrontiert
sah, faszinierte mich ungemein. Zu frappierend schienen dem Kriminalinspekt-
or – und auch mir – die Übereinstimmung der Unglücksfälle »Smith und
Lloyd« zu sein.
Im Zuge eines Lokalaugenscheins überprüften Neil und seine Mitarbeiter
das Bad, in dem Mrs Lloyd gestorben war. Es wies keine Besonderheiten auf
und enthielt eine in dieser Zeit oft verwendete billige kleine Eisenwanne, deren
Länge am Boden 1,25 Meter und am oberen Rand 1,65 Meter betrug. Wie kon-
nte ein gesunder, normal gewachsener Mensch darin ertrinken? Dr. Bates, der
die Leiche untersucht hatte, bekräftigte seine ursprüngliche Aussage voll Vehe-
menz: »Tod durch Unglücksfall. Jede andere Diagnose ist absurd und vom
medizinischen Standpunkt aus nicht vertretbar!«
Eines war ihm jedoch ungut aufgefallen. Mr Lloyd hätte nicht die geringste
Spur von Trauer gezeigt, hatte nur den billigsten Sarg für seine unter so tragis-
chen Umständen verstorbene Frau bestellt. Der Inspektor hatte peinlicher-
weise mitgehört, wie der Witwer mit dem Bestattungsinstitut um den Preis des
Sargs gefeilscht hatte.
Als Inspektor Neil in sein Büro zurückkehrte, erwartete ihn eine interessante
Nachricht. Sie besagte, dass sich Mr Lloyd, bevor er schließlich in der Bismarck
Rd. 14 Quartier bezog, auch in einer anderen in der Nähe gelegenen Pension
umgesehen hatte. Er hatte dort einige Zimmer besichtigt und sich erkundigt,
ob man in der Badewanne auch tatsächlich liegen könne. Als er begann, die
Wanne genau abzumessen, hatte ihn die von Misstrauen gepackte Vermieterin
unter einem Vorwand aus ihrem Haus gewiesen.
73/186

Weitere Recherchen ergaben, dass Mrs Lloyd nur drei Stunden vor ihrem
Tod ein Testament verfasst hatte, in dem sie ihren, wie sie es formulierte,
geliebten Ehegatten als Alleinerben einsetzte. Darüber hinaus hatte sie an ihr-
em Todestag in Begleitung von Mr Lloyd ihr gesamtes Guthaben von der Posts-
parkasse abgehoben. Wenig später meldete die Yorkshire Insurance Company,
dass Mrs Lloyd eine hohe Lebensversicherung zugunsten ihres Ehemanns
abgeschlossen hatte. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war Inspektor Neil
überzeugt, einem, mehreren oder sogar einer ganzen Serie von Gewaltver-
brechen auf der Spur zu sein.
Schon erstaunlich, wie verdächtig jene wirken, die vom Ableben eines Part-
ners profitieren, schoss es mir durch den Kopf. Auch Leopold und ich hatten,
wie Tausende anderer Paare, kurz nach der Hochzeit eine wechselseitige
»Lebensversicherung auf Ableben« geschlossen. Ich fand damals, dass dies
eine durchaus vernünftige Art der Absicherung war, die man seinem Lebens-
partner und den heranwachsenden Kindern einfach schuldete. Da Nachwuchs
ausblieb und ich mich selbst erhalten konnte und musste, war mir unsere Po-
lice samt ihren vielen kleingedruckten Vereinbarungen herzlich egal. Die fälli-
gen Zahlungen buchte die Bank mittels Dauerauftrag in geringen monatlichen
Raten automatisch von unserem Konto ab, und die Höhe der im Ernstfall aus-
zuzahlenden Summe hatte ich schon längst vergessen. Ich werde sowieso
nichts davon haben, denn der Poldi bringt mich durch seine unangenehme,
pedantische Art ohnehin frühzeitig ins Grab, war meine fatalistische Meinung.
Die Überlegung, dass er mich zwar überleben, aber die Früchte seines Wohl-
stands nicht genießen würde, da er ohne mich hilflos im Schmutz erstickte,
bereitete mir einen gewissen Trost.
Nach der Aufnahme des Tatbestands in Islington bat Inspektor Neil seine
Kollegen in Blackpool im »Fall Smith« um Hilfe. Diese teilten mit, dass Alice
Smith, geb. Burnham, am Tag vor der Hochzeit eine Lebensversicherung in der
beträchtlichen Höhe von fünfhundert Pfund zugunsten ihres Gatten
abgeschlossen hatte. Außerdem hatte Alice Smith zwei Tage vor der Hochzeits-
reise nach Blackpool ein Testament verfasst und hinterlegt, in dem sie all ihre
irdischen Güter ihrem, wie sie es formulierte, geliebten Ehemann vermachte.
Vier Tage später war sie tot.
74/186

»Er hat nicht viel Zeit verloren, dieser Smith-Lloyd«, dachte ich mir. Ich
teilte nämlich voll und ganz den bei Inspektor Neil aufkeimenden Verdacht.
Neil suchte am 23. Januar 1915 Sir Charles Mathews, den zuständigen öf-
fentlichen Ankläger, auf, um freie Hand für weitere Ermittlungen zu erhalten.
Nach der Schilderung der Verdachtsmomente rief Sir Mathews voll Empörung:
»Was wollen Sie eigentlich? Das ist ja unglaublich! Ein Mann soll zwei Frauen
ohne sichtbare Gewaltanwendung in ihrem Bad ermordet haben? Sie wissen
nicht, auf welche Weise! Glauben aber mehr zu wissen als zwei Ärzte, die den
natürlichen Tod der Damen bestätigten! In meinem ganzen Leben habe ich
keinen derartigen Unsinn gehört!«
»So eine Ungerechtigkeit!«, empörte ich mich, atmete jedoch erleichtert auf,
als man Inspektor Neil den Fall nicht entzog, sondern ihn weiterermitteln ließ.
Die Lektüre der »Badewannenmorde« bereitete mir großes Vergnügen. Über-
haupt las ich gern – Krimis, Biografien berühmter Menschen, populäre
Erzählungen zur Geschichte Wiens, aber auch Triviales. Es war vor allem Letz-
teres, was Poldi mit unverhohlenem Sarkasmus bedachte. Dem zum Trotz ver-
tiefte ich mich an müßigen Nachmittagen oder Abenden gerne in Illustrierte,
die ich mir – natürlich kostenlos – über das Probeabonnement eines
Lesezirkels bestellte. Mittels der Hochglanzseiten von Zeitungen wie »Society
News« oder »Insider« konnte ich einen Blick hinter die Kulissen der großen
Welt werfen, erfuhr vom »Fluch der Flicks« und dem traurigen Schattenda-
sein, das Prinz Philip an der Seite der strengen englischen Queen führen
musste. Fasziniert informierte ich mich über die prunkvollen Feste der
Hocharistokratie, Anlässe, bei denen manche der älteren weiblichen
Gäste – viele von ihnen mit hageren Gesichtern, die an edelrassige Pferde erin-
nerten – tatsächlich, wie vor hundert Jahren, funkelnde Diademe im Haar hat-
ten und üppige Colliers trugen, deren Gewicht ihnen den faltigen Nacken zu
beugen schien. Im Fürstentum Monaco ging es zur Freude der Gazetten wild
her, bis die Erbprinzessin nach zahlreichen Eskapaden gar einen Rennfahrer
heiratete. Auch in Schweden machte sich ein Hang zum Bürgertum bemerkbar.
Die Vorgänge am dortigen Königshof ließen mich nicht kalt. Ganz wie im
75/186

Märchen hatte sich der junge König in eine hübsche, jedoch nicht ebenbürtige
Olympiahostess verliebt und sie nach vielen Widerständen geheiratet.
Poldi lachte dazu abfällig und äußerte sich wahrhaft schändlich. »Das liegt
in der Familie«, bemerkte er herzlos. »Die Dynastie der Bernadotte geht auf
den Schreiber eines Notars aus der Zeit Napoleons zurück. Was willst
du?« – »Na, immer noch besser als Stallknechte aus dem Weinviertel«, erin-
nerte ich meinen Gatten voll Schlagfertigkeit an seine eigene Herkunft und traf
ihn damit an einer wunden Stelle. Poldis große, geheime Sehnsucht nach einem
langen Stammbaum voll bedeutender Ahnen war mir bekannt. Ebenso natür-
lich, dass ihn ein unberechenbares Schicksal als Sohn von zwar anständigen,
aber insignifikanten Kleinbauern in die Welt gesetzt hatte. Auf jeden Fall stellte
Leopold nach unserem kleinen Geplänkel seine hässlichen Blasphemien gegen
die Bernadottes ein, und ich kehrte hämisch lächelnd zu meiner Zeitschrift
zurück, wo ich die Roben der ewig jungen Stars von Film und Fernsehen be-
wunderte. Ich konnte nicht umhin, ihre aufregenden Sexkrisen mit wech-
selnden Partnern mit meinem eigenen Dasein zu vergleichen, von den
entzückenden, gern zur Schau gestellten Kindern der weiblichen Filmstars gar
nicht zu reden.
Ein Lifting konnte ich mir nicht leisten, nicht einmal ein kleines! »Da wäre
schon einiges zu tun«, meinte der Schönheitschirurg Prof. Dr. Lauscher, den
ich konsultiert hatte, weil seine erste Beratung nichts kostete, wohlwollend,
beinahe väterlich zu mir. »Man darf nicht zu lange warten! Sie haben eine
schöne Haut, aber Augenlider und Hals sind Ihre Problemzonen.« Flugs zeich-
nete er mit einem Farbstift Linien in mein Gesicht. »Da und da und da werde
ich ansetzen und hier etwas raffen und anheben.« Wie eine derartige Operation
denn vor sich ginge? »Wie bei einem Huhn«, erklärte der berühmte Mann
ohne Scheu. »Ich hebe die Oberhaut vom darunterliegenden Gewebe ab,
schneide Überflüssiges weg und ziehe sie hinter dem Ohr fest. Komplikationen
sind ausgeschlossen. Gnä Frau, glauben’s mir, Sie werden zehn Jahre jünger
aussehen, man wird Sie beneiden, oft sogar net wiedererkennen. Nur ka
Angst!«, glitt er vertraulich ins Wienerische.
Dann zückte der Joviale ein kleines Zettelchen und notierte. Ober- und Un-
terlider je 30 000 Schilling, großes Lifting 60 000 Schilling, Spitalkosten je
76/186

nach Privatklinik zwischen 20 000 und 30 000 Schilling. Es ginge auch ohne
Rechnung, wie er mir augenzwinkernd bedeutete. Dann würden wir uns beide
die lästige Mehrwertsteuer ersparen und den Staat nicht bei seiner Geld-
verschwendung unterstützen. Ich nahm die genannten Beträge, die ich nicht
besaß, niemals besessen habe und auch nicht auftreiben konnte, ohne mit der
Wimper zu zucken, gleichsam wie eine nebensächliche Lappalie zur Kenntnis.
Höchstes Interesse heuchelnd, quasi nur mehr unsicher wegen meines über-
füllten Terminkalenders. Mit »Sie wissen ja, Herr Professor, viele gesellschaft-
liche Verpflichtungen und dann die Reisen! Ach, wie ermüdet das alles!«, ver-
abschiedete ich mich als Dame von Welt. Die Frau des Arztes, mindestens
zwanzig Jahre jünger als er selbst, mit einer zeitlos glatten, maskenhaften
Physiognomie, bei der das faltenlose Kinn irgendwie nicht ganz in das übrige
Gesicht passte, begleitete mich, vornehm säuselnd, zum Ausgang der Ordina-
tion, wo sie mir ihre verwelkte Hand reichte: »Bitte lassen Sie uns Ihre
Entscheidung bald wissen, wir sind sehr, sehr ausgebucht. Patientinnen von
Film und Fernsehen überfluten uns, wir müssen lange im Voraus planen.«
In der mondänen Praxis in Oberdöbling hat man mich nicht mehr gesehen.
Dabei wäre, wie Meister Frankenstein ganz richtig bemerkte, wirklich
»einiges« zu tun gewesen. Nicht besonders schön, mit hängenden Oberlidern,
kleinen Tränensäcken, abstehenden Ohren, Stupsnase, mausgrauen Haaren
und zur Fülligkeit neigender Figur war mir – gerechterweise, wie ich selbst
zugeben musste – jeder Erfolg verwehrt geblieben. Im Beruf und auch, wie mir
der tägliche Anblick meines mickrigen Mannes vor Augen führte, im Priva-
tleben. Von Glamour keine Spur. Meine Finanzen waren stets so deprimierend,
dass ich mich nur mühsam von einem Monatsersten zum anderen schleppte.
Noch immer weilten meine Gedanken bei Inspektor Neil im Jahre 1915. Auch
als ich bei meinem täglichen Besuch im Drogeriemarkt in der Nähe meiner
Bank noch ein paar Kosmetiktücher, die zur freien Entnahme bereitlagen, als
Vorrat für den Tag einsteckte, bevor ich an meine Arbeitsstelle eilte,
beschäftigte mich das »Rätsel der Badewannen«.
Höchst gespannt und im Bewusstsein, dass Inspektor Neil weiterermitteln
durfte, begleitete ich meine Kollegen am Mittag nicht in das billige, mit
77/186

goldenen Ornamenten vollgestopfte, übelriechende China-Restaurant an der
Ecke Währinger/Nußdorfer Straße, wo wir zwei- bis dreimal die Woche hingin-
gen und wo man sich um nur 35 Schilling nach Belieben am Buffet bedienen
konnte. Die Devise des Lokals »Essen Sie, so viel Sie können« sagte mir zu, und
da sie keine Zeitangabe enthielt, legte ich sie stets großzügig aus, hatte eine
Tupperware-Schale bei mir und versorgte mich und Poldi auch gleich für das
Abendessen.
Doch die Neugier auf »Smith-Lloyd« ließ mich diesmal auf den glutamat-
geschwängerten chinesischen Einheitsbrei, der oftmals Kopfschmerzen bereit-
ete, und die leiernde Singsangmusik verzichten. Ich entschuldigte mich mit Ap-
petitlosigkeit, ließ die anderen ziehen, setzte mich in den winzigen Aufenthalts-
raum für Angestellte und las weiter.
Inspektor Neil verhaftete Smith-Lloyd beim Abheben der Lebensversicher-
ung und nahm ihn in vorübergehenden Gewahrsam. Bald kannte man seinen
richtigen Namen: George Joseph Smith, Sohn eines Versicherungsagenten,
Zögling einer Besserungsanstalt für kriminelle Jugendliche, der später eine
Karriere als Betrüger, Schwindler und Dieb einschlug und etliche Jahre im
Zuchthaus verbrachte. Mit seinen wechselnden Identitäten konfrontiert, gab
Smith-Lloyd die Namensänderung zu. »Aber was haben Sie mir, einem zwei-
fachen schwer geprüften Witwer, sonst noch vorzuwerfen? Ich führe schon
längst ein anständiges Leben, meine letzte Verfehlung ist verjährt«, meinte er,
ob der Belästigung tief gekränkt.
»Du bist ein Mörder!«, rief ich voll Emotion laut aus und wusste mich damit
mit Inspektor Neil im Einklang. »Wer, ich?«, ließ sich mein Kollege Gerhard
Grätz, der gerade aus der Mittagspause zurückkehrte, verwundert vernehmen.
Ich gab ihm keine Antwort. Zu sehr gefiel mir die Hartnäckigkeit von Neil,
dem es gelang, Bernard Spilsbury, den berühmten Pathologen des Home Of-
fice, für sich zu gewinnen. Er sollte den geheimnisvollen Fall von der medizin-
ischen Seite her aufrollen. Fehlten uns doch Beweise, Beweise und nochmals
Beweise.
Spilsbury ordnete zunächst die Exhumierung der Leiche von Margaret Lloyd
an, um festzustellen, ob die junge Frau ertrunken war oder man sie ertränkt
hatte, eine Unterscheidung, die sich um 1915 noch sehr schwierig gestaltete. Es
78/186

gab zwar bereits diagnostische Möglichkeiten, doch beim Tod durch gewalt-
sames Ertränken setzte man immer noch auf einen Faktor: Die Opfer setzten
sich zur Wehr, im Todeskampf entwickelten sie Riesenkräfte. Sie zwangen ihre
Mörder, zur Gewaltanwendung, die unausweichlich Quetschungen und
Kratzwunden zurückließ. Spilsbury untersuchte die Leiche mit der Lupe und
zunehmender Verzweiflung Zoll um Zoll nach Spuren von Verletzungen
ab – alles vergebens. War Gift im Spiel gewesen? Organproben bewiesen das
Gegenteil.
Obwohl sich die Kriminalpolizei um Geheimhaltung bemühte, erfuhr die
englische Presse von den Recherchen des Pathologen. »Die Bräute im Bad«
wurden zu einer landesweiten Sensation und einem Sport – Laien und Exper-
ten wetteiferten bei ihrer Suche nach einer Lösung des Rätsels.
Es war die unerwünschte Popularität, der die Kriminalpolizei die Kenntnis
von einer dritten toten Braut an der Küste von Kent verdankte. Der Fall lag
schon Jahre zurück und war genauso verlaufen wie die zwei bereits bekannten
Todesfälle. Mit einem winzigen, makabren Unterschied – der Ehemann hatte
die kleine, billige Wanne aus Gusseisen selbst gekauft und sie seiner Frau ges-
chenkt. Neil und Spilsbury ließen daraufhin die drei Unglücks-Badewannen
nach London transportieren. Sie sahen alle gleich aus, sehr kurz, mit steilem
Fußende und schrägem Kopfende. Die Verstorbenen waren alle über 1,65
Meter groß gewesen. Das Missverhältnis zwischen den Körpermaßen der Opfer
und den Abmessungen der Wanne gab zu denken, und es stellte sich wiederum
die alte Frage: »Wie konnten sie in den winzigen Badezubern ertrinken?«
Schließlich engagierten der Pathologe und der Kriminalinspektor
Sportschwimmerinnen, deren Größe und Gewicht den mutmaßlichen Opfern
glich. Kuriose, unheimliche Experimente an der Grenze der Legalität fanden
statt: Helfer versuchten Kopf und Oberkörper der Versuchspersonen unter
Wasser zu drücken. Dies gelang ihnen nur selten oder erst nach langem
Ringkampf mit heftiger Gegenwehr, wobei sich Wasser über den ganzen Boden
ergoss. Selbst als man zu einem bedenklichen Mittel griff, die Schwimmerinnen
ablenkte, sie unerwartet attackierte und ihnen den Kopf unter Wasser drückte,
konnte man nicht verhindern, dass sich die Hände der Opfer am Wannenrand
anklammerten und Halt fanden. Spilsbury grübelte Tag und Nacht – bis er in
79/186

einer langen, schlaflosen Nacht schließlich die Erklärung der Morde fand. Sie
war teuflisch und zugleich verblüffend einfach!
»Mein Gott, wie simpel und effizient!«, dachte ich bewundernd. »Darauf
muss man erst kommen. Geradezu genial! Eigentlich ist jeder, auch ein blutiger
Anfänger, imstande, auf diese Weise zu morden.«
80/186
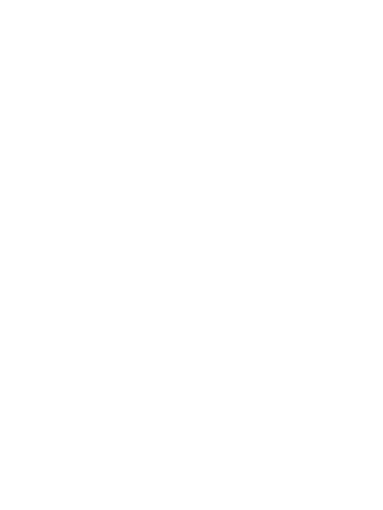
Kapitel 8
8
Beim nächsten meiner häufigen Telefonate mit Mizzi, die ich mittlerweise als
meine beste Freundin ansah, erzählte ich ihr von den »Bräuten«: »Was denkst
du? Wie hat er sie umgebracht?« Sie wurde sehr neugierig, riet hin und her,
blieb jedoch von der richtigen Lösung meilenweit entfernt. Da ich – ich wusste
eigentlich selbst nicht, warum – die Enthüllung des Rätsels für mich behalten
wollte, quälte mich Mizzi noch lange Zeit mit bohrenden Fragen. Ich antwor-
tete jedoch stets nur ausweichend. Selbst als wir zwei wieder einmal zu unseren
scherzhaft so genannten »Viennese trips for two« aufbrachen, suchte sie mir
listig Hinweise zu entlocken. Doch ich schwieg eisern und lenkte sie ab.
Unser skurriles Hobby, dem wir gerne frönten, erfüllte alle Kriterien, die wir
an Unterhaltung stellten. Es war billig, ja fast kostenlos, und trotzdem höchst
vergnüglich.
Wer von uns beiden dieses Freizeitvergnügen ersonnen hat, weiß ich nicht
mehr. Auf jeden Fall kann man es allen Wienern mit so schmalen Geldbörsen
wie den unsrigen nur wärmstens empfehlen. Als Vorbereitung zu dem Vergnü-
gen durchforstete ich als Stammgast des »Dommayer« bei einem »kleinen
Braunen« – dem einzigen Luxus, den ich mir dort gönnte – stundenlang die
Zeitungen. Während ich den wahrhaft köstlichen Kaffee schlürfte, nahm ich
unauffällig die Immobilienbeilage des »Kurier« an mich, eine Tat, über die
man bei mir als langjährigem Gast wohlwollend hinwegsah. Zu Hause wählte
ich dann mithilfe der stets unternehmenslustigen Mizzi geeignete Objekte aus:
Wohnungen oder Häuser – im Idealfall leerstehend oder aus Erbschaftsfällen.
Anschließend vereinbarten wir Besichtigungstermine, auf die wir uns jedes Mal
sehr freuten und die wir mit Spannung erwarteten.
Wie sah wohl die angebotene »prächtige Ringstraßenwohnung« tatsächlich
aus und wie das »kleine, gepflegte, voll möblierte Häuschen einer

Hofratswitwe«? Vor allem jedoch, was würde man uns bieten? Wir dachten
natürlich nicht im Traum daran, etwas zu mieten oder zu kaufen, hätten es uns
mit unseren kargen Einkünften auch gar nicht leisten können. Vielmehr ver-
sorgten wir uns beim Gang durch die meist verwahrlosten Liegenschaften mit
nützlichen Utensilien aller Art und fanden dort originelle Geburtstags- und
Weihnachtsgeschenke für das laufende Jahr. So steckte ich, während sich Mizzi
umständlich die anfallenden Betriebskosten erklären ließ, in der total verkom-
menen Küche einer Altbauwohnung zwei schöne, fein geschliffene Gläser ein.
Im Keller der verkaufswilligen Hofratswitwe wiederum lagerten hochwertige
Spirituosen, die uns beiden sofort ins Auge stachen. Mizzi zwinkerte mir zu,
und ich reagierte sofort. »Hat es nicht gerade geklingelt?«, machte ich den jun-
gen Makler höflich aufmerksam. Der Mann entschuldigte sich für einen Augen-
blick, um virtuellen Interessenten die Haustür zu öffnen. Aus den Augen-
winkeln bemerkte ich voll Vergnügen, wie sich Mizzi, die bereits eine Tisch-
decke erbeutet hatte, sich grinsend eine Bouteille französischen Rotwein vom
Jahrgang 1987 sowie eine Flasche Champagner aneignete und beides in ihre
voluminöse Handtasche gleiten ließ. Darüber hinaus rettete die Kluge eine
Schachtel mit alten, vergilbten Fotos.
Streifzüge und Exkursionen dieser besonderen Art führten uns durch die
City von Wien mit ihren alten Palais und verschnörkelten Barockhäusern, aber
auch in die bürgerlichen Außenbezirke voll bezaubernder Biedermeierhäuser,
verwunschener Innenhöfe und Gärtchen. Bei schönem Wetter erweiterten wir
unseren Horizont, indem wir Immobilien in der wirklich atemberaubend
schönen grünen, mit Wäldern bedeckten, hügeligen Umgebung der Großstadt
aufsuchten. All das war in jeder Weise überaus befriedigend. Es kostete nichts.
Wir lernten unsere Heimatstadt und ihre Geschichte wirklich gründlich und in
ihrer ganzen Vielfalt kennen, erfuhren viel über Architektur, sahen Neues,
lernten interessante Leute kennen und kamen meistens auch materiell bereich-
ert zurück. Denn man hätte nicht glauben sollen, was in den angebotenen Ob-
jekten alles herumstand und -lag: Schuhlöffel aus Horn beim Eingang, Ölbilder
und Stiche in den Vorräumen, alte, kunstvoll gearbeitete Textilien in den
Wohnzimmern, kostbarer Hausrat und vieles mehr. Unlängst konnte ich in
82/186

einer dieser Fundgruben sogar einen kleinen alten Perserteppich ergattern,
ohne dabei das geringste Aufsehen zu erregen.
Poldi ahnte von diesen Exkursionen, die mein Leben etwas aufmöbelten, nicht
das Geringste. Ich tarnte sie listig als Spaziergänge mit meiner Freundin im
»Lainzer Tiergarten«, dem einstigen kaiserlichen Jagdrevier am Rande Wiens,
das nach dem Ende der Habsburgermonarchie für das allgemeine Publikum
geöffnet worden war. Tatsächlich spazierten wir oft in der einstigen riesigen
Domäne der Kaiserin Elisabeth herum. Man kann dort, vor allem unter der
Woche, stundenlang in herrlich unberührter Natur wandern, nur beäugt von
den in großer Zahl herumstreifenden und die Erde aufwühlenden Wildsch-
weinen. Mizzi und ich liebten den Tiergarten und hielten uns dort gern auf,
aber eben nicht immer.
Als mich Mizzi von unserem letzten diebischen Streifzug am frühen Abend
heimbrachte, saß Leopold über seiner Arbeit, von der er sich bei unserer
Ankunft nicht einmal erhob.
Wir ließen uns durch diese Unhöflichkeit nicht stören und verkosteten in der
Küche den gar nicht üblen Wein der Hofratswitwe. Nach dem zweiten Gläschen
in beste Laune versetzt, erklärte mir »Mizzi« das komplizierte Stickmuster ihr-
er neu akquirierten Decke. Dann öffneten wir den Karton, um dessen Inhalt zu
begutachten. Die alten, bereits vergilbten Fotos und Postkarten riefen unser
Entzücken hervor. »Wie schön Wien einmal war! Schau, die Ringstraße, gep-
flastert, nicht asphaltiert, und kaum Autos. Das muss so um 1930 gewesen
sein! Und die Leute, alle so elegant gekleidet, obwohl doch die Zeiten der
Wirtschaftskrise hart waren«, meinte ich. Mizzi pflichtete mir bei: »Jetzt, wo es
den meisten gut geht, gehen sie in billigen Jogging-Anzügen auf die
Straße!« – »Und das Stadtbild ist noch nicht verschandelt durch die
grässlichen Emmentaler-Bauten der Nachkriegszeit!« – »Weißt was? Wir
verkaufn unsern Fund am Samstag am Flohmarkt auf dem Naschmarkt!« Das
war eine der guten Ideen von Mizzi. Ich freute mich. »Ja, und dann gemma
essn zum Inder! Chicken Curry, eine Thali-Platte oder ein Tandoori.«
Dann sprang meine Freundin auf, erschrocken über die bereits vorgerückte
Stunde, um zwecks Versorgung ihres Mannes, der pünktliche Mahlzeiten
83/186

forderte, nach Hause zu eilen. Wir selbst aßen kalt, und danach delektierte sich
Poldi an irgendwelchen faden Dokumentarsendungen im Fernsehen. Mir die
»Seitenblicke« anzuschauen, in denen der
ORF
das Treiben von Wiens Schick-
eria zeigt, erlaubte er mir nicht. Es sei »Volksverblödung«, und meine Bildung
lasse sowieso zu wünschen übrig. »Weißt du endlich, wann Cäsar ermordet
worden ist? Und die Reihe der Herrscher aus dem Hause Habsburg? Kannst du
sie aufsagen?«, stellte er mir seine Fangfragen, die ich hasste. Bald gingen wir
beide zu Bett, wo sich mein Mann, wie immer, als Versager der Sonderklasse
entpuppte. Meist schlief er, begleitet von starkem Schnarchen, sofort ein.
Manchmal jedoch, so ein- bis zweimal im Monat, griff er nach mir. Öfter sei es
ihm, wie er glaubte, mir umständlich erklären zu müssen, physisch leider nicht
möglich. Er als Historiker wisse natürlich, dass Martin Luther zweimal
Geschlechtsverkehr pro Woche empfohlen habe. Aber leider, leider!
Auch diesmal küsste er mich, wobei seine schlechten Zähne einen üblen
Atem verbreiteten, murmelte »Engelchen« und warf sich mit seinem beträcht-
lichen Übergewicht auf mich. Die mühsamen Turnübungen des »Ungustel«
waren mehr als unangenehm. Auf jeden Fall ließ mich das alles kalt. In-
teressiert betrachtete ich seine blaßrosa Schultern, die, übersät von braunen
Flecken und von Warzen, aus denen lange Haare wuchsen, ganz zu seinem
übrigen Erscheinungsbild passten. »Hoppla«, dachte ich mir. »Könnten diese
dunklen, verdächtigen Stellen nicht Muttermale sein? Solche, aus denen ge-
fährliche Melanome entstehen?« Ich beschloss, mich zu informieren.
Während Poldi bald der Schweiß von der Stirn tropfte, dachte ich daran, was
am nächsten Tag alles zu erledigen und zu bezahlen sein würde. Da fiel es mir
nicht schwer, ein paar Mal zu stöhnen, wie es die Höflichkeit erforderte, und
dann war alles auch schon vorbei. Leopold zog sich auf die Toilette zurück, wo
es dann laut plätscherte. Eine ähnliche Fülle kenne ich nur von Kühen, schoss
es mir durch den Kopf. Wenn sie sich im Sommer auf der Weide erleichtern.
Dann sinnierte ich weiter: Vielleicht sollte ich dem sexuellen Unfug ein für
alle Mal ein Ende bereiten, ganz in der Art, wie es schon einst meine Großmut-
ter tat? Diese hatte sich nach der Geburt ihres dritten Kindes energisch und für
alle Zukunft die Avancen ihres Mannes verbeten. »Meine Pflicht habe ich get-
an. Für deine typisch männlichen, auf jeden Fall perversen Gelüste stehe ich
84/186

nicht länger zur Verfügung«, teilte sie ihm, wie sie mir in einem vertraulichen
Moment enthüllt hatte, dezidiert mit. Großzügig, wie sie war, zweigte sie dann,
seufzend ob der unnützen Ausgabe, einmal im Monat einen Betrag von ihrem
Haushaltsgeld ab, mit dem der Großvater eine Prostituierte aufsuchen durfte.
Ob in unserer sexbesessenen Zeit derartige Maßnahmen überhaupt noch mög-
lich sind?, überlegte ich verunsichert. So können viele Frauen an die fün-
fzig – die Jungen denken ja ganz anders – auch heutzutage nur schweigen und
leiden. – »Und er gibt noch immer ka Ruh!«, hatten mir nicht nur meine Ver-
traute Mizzi, sondern auch einige andere weibliche Bekannte meines Alters zu
wiederholten Malen verstohlen gebeichtet.
Der Sache mit Poldis dunklen Hautflecken ging ich mithilfe eines medizinis-
chen Lexikons, das wir in unserer Wohnzimmerwand aufbewahrten, auf den
Grund. Dort las ich: »Der Schwarze Hautkrebs oder malignes Melanom ist der
bösartigste Hauttumor und eines der gefährlichsten Karzinome überhaupt.
Sechzig Prozent aller Melanome entwickeln sich aus einem bestehenden Mut-
termal, die Zahl der Erkrankungen hat in den letzten zwanzig Jahren um fün-
fzig Prozent zugenommen. Männer erkranken durchschnittlich im Alter von
dreiundsechzig Jahren – Tendenz sinkend, das heißt, immer jüngere werden
davon befallen.« Das klang gar nicht so schlecht, sehr vielversprechend sogar,
fand ich, nachdem ich auch die Risikofaktoren – erhöhte
UV
-Belastung, hohe
Anzahl von Sonnenbränden – in Betracht gezogen und folgerichtig überlegt
hatte, ob wir vielleicht öfter in den Süden fahren sollten. Ein Urlaub in Aus-
tralien mit seiner extrem hohen
UV
-Bestrahlung wäre natürlich toll gewesen,
sprengte aber leider bei Weitem den Rahmen unseres Budgets.
Doch wo ein Wille ist, ist oft auch ein Weg. Ich würde dem zur Blässe nei-
genden Poldi einfach zum Besuch eines Bräunungsstudios raten. Oder noch
besser – er würde von mir ein Abo mit zehn Behandlungen als Weihnachtsges-
chenk bekommen! Das war die ideale Lösung. Mit Verlängerungsmöglichkeit!
Einen Versuch war es wert.
Eines Tages, ich weiß nicht mehr aus welchem Anlass, gestand mir Mizzi, dass
sie, um den Frust des grauen Alltags abzuschütteln, jeden Morgen ihre
Gedanken zu Papier bringe. »Du kannst dir alles ausdenken, alles erfinden, du
85/186

hast keine Grenzen«, meinte sie zu ihren geheimen Tiraden, in denen sie, wie
sie zugab, mit ihrem ältlichen Mann abrechnete, sich über die zwei missraten-
en Kinder, die abwechselnd arbeitslos, auf Jobsuche oder in »Auszeit« waren,
ausließ und ihr frustrierendes Hausfrauendasein ohne eigenes Geld beklagte.
Das gab mir zu denken. Soll ich vielleicht auch zu schreiben beginnen?,
überlegte ich mir an einem Samstagmorgen, als ich wieder einmal in meinem
geliebten Kaffeehaus saß. Immer am Wochenende ließ ich den mürrischen
Poldi – er verachtete es aus Kostengründen, außer Haus zu frühstücken – da-
heim zurück, um im Dommayer die erste Mahlzeit des Tages zu genießen. Dort
war es am Morgen, inmitten weniger, in stiller, fast sakraler Atmosphäre über
die Tageszeitungen gebeugten Gäste besonders schön. Alle kannten einander
schon seit Jahren, und Standesunterschiede spielten keine Rolle: Der pen-
sionierte Politiker saß neben einer Historikerin, der Hausverwalter neben
einem ehemaligen Flugkapitän. Eine dicke Hausmeisterin äußerte sich gerne
mit schnarrender Stimme. Selbst unseren in Hietzing beheimateten Ex-Bun-
deskanzler hatte sein Weg nach der Niederlegung seines schweren Amtes wie
selbstverständlich ins »Domi« geführt. Er bestellte sich zwei Eier im Glas, ein
Schnittlauchbrot und einen Kaffee und blühte sichtlich auf.
Nach langem Grübeln beschloss ich, den Versuch zu wagen. Ich würde es Mizzi
gleichtun und meine Gedanken dem, wie man so sagt, geduldigen Papier an-
vertrauen. Hatte ich nicht schon in der Schule gute und originelle Aufsätze ges-
chrieben? Oft hatte die Deutschlehrerin sie der Klasse vorgelesen und als
Musterbeispiel gepriesen: »Warum bemüht ihr euch nicht wie Hermine?«
Im Vertrauen auf meine jugendlichen Mini-Erfolge kreierte ich sogleich ein
verlockendes Szenario. Ich sah mich schon als Schriftstellerin in einer von mir
geschaffenen Welt, in der ich die Gesetze diktierte und zugleich meine Seele be-
freite. Vielleicht – wer konnte das wissen – würde ich sogar berühmt werden?
Oh, wie mich das reizte! Ich könnte meine tollsten Fantasien walten und sch-
weifen lassen, in verborgene Regionen eindringen, die ich sonst nicht zu betre-
ten wagte.
Tags darauf, als sich Mizzi am späten Nachmittag nach einem an-
strengenden Tag in der Bank zum Kaffee bei mir einfand, erzählte ich ihr von
86/186

meinen schriftstellerischen Plänen. Mit »Ja, warum schreibst denn net an
Krimi?« traf sie bei mir einen offenen Nerv. Fast verschlug es mir den Atem,
aufgeregt ging ich unverzüglich ans Werk. Könnten die »Badewannenmorde«
nicht als Vorlage dienen und das Thema meines kriminalistischen Erstlingsro-
mans sein? Der Mörder sollte allerdings eine Frau sein und – natürlich – An-
gelika heißen. Ich überlegte lange hin und her. War das nicht zu direkt? Der
Name Angelika, den ich mir voll Bosheit wählte, war der für eine Mörderin
überhaupt passend? Sinnend legte ich mehrmals die Füllfeder aus der Hand,
bevor ich mich schließlich doch in die ehrenwerte Zunft der Schreiberlinge ein-
reihte. Zwei Wochen später hatte ich nicht nur einen groben Entwurf fertigges-
tellt, sondern auch die ersten Seiten meines Krimis geschrieben. Stolz präsen-
tierte ich Poldi die Früchte meines Geistes.
Während ich wie fast jeden Abend pünktlich um 19 Uhr den Tisch im
Wohnzimmer für das warme Essen deckte, fragte ich leicht verlegen: »Darf ich
dir etwas vorlesen? Nur ganz kurz! Und du sagst mir dazu, ganz ehrlich, was du
denkst!« Ich tat dies nicht etwa, weil ich Poldi als Experte schätzte oder mir an
seiner Meinung auch nur das Geringste lag. Es ging mir darum, etwaigen
späteren Diskussionen vorzubeugen. »Du weißt, ich habe mir schon immer
gewünscht, einen Krimi zu schreiben, mich aber nie getraut. Jetzt habe ich
mich dazu aufgerafft. Stell dir vor, ich glaube, es macht mir wirklich Freude.
Das ist der Anfang.« Stockend begann ich mit dem Vortrag des kurzen
Manuskripts.
»Es war ein Kinderspiel. Angelika richtet sich auf, erleichtert und froh, dass
sie sich einen lang gehegten, insgeheim genährten Wunsch auf derart einfache
Weise hat erfüllen können. Ein stummes Lachen erschüttert ihren Körper. Et-
was nass geworden, trocknet sie sich sorgfältig die Hände, um sich dann im
Spiegel des Badezimmers zu betrachten. Hinterlässt die Tat vielleicht Spuren,
verräterische Änderungen in Ausdruck und Mimik, wie man das immer be-
hauptet? Nichts davon ist der Fall. Ein bleiches, aber, wie ihr scheint, durchaus
attraktives Gesicht schaut ihr entgegen. Die großen blauen Augen blinzeln froh.
Das regelmäßige Oval ihres Antlitzes versetzt sie in Entzücken. Sie findet sich
sehr reizvoll!
87/186

Wie hässlich er aussieht, wie er da in der Badewanne liegt. Noch hässlicher
als zu seinen Lebzeiten. Na ja, eine Schönheit war er nie. Seine offenen Augen
scheinen nicht nur hervorzutreten, sondern sie auch in impertinenter Weise
anzustieren, während sein Mund offen steht. Die schütteren grauen Haare
kleben am von abstoßenden braunen Flecken bedeckten Kopf. Das Wasser um-
spült seine reglosen Glieder. Der Bauch ist auch nicht weniger geworden.
Angelika ist kein Unmensch. Trotz der vielen unangenehmen Erinnerungen
an die Zeit mit Robert ist sie froh, ihrem langjährigen Gefährten ein so
schnelles, fast schmerzloses Ende bereitet zu haben. Alles ist nach Plan und
genau so verlaufen, wie sie es in einem Buch über berühmte Kriminalfälle ge-
lesen hat.«
An dieser Stelle unterbrach mich empörtes Hüsteln. Als ich aufsah, ers-
chreckte mich die grimmige Miene meines Mannes. »Es muss natürlich noch
bearbeitet, ausgefeilt werden und so, es ist ja auch erst der Anfang«, erklärte
ich hastig beim Anblick von Leopolds verächtlichem Grinsen. »Interessiert es
dich, wie es weitergehen soll, wie ich mir das weitere Schicksal Angelikas
vorgestellt habe? Sie …«
Er ließ mich nicht ausreden. »Nein, es interessiert mich nicht im Geringsten.
Glaubst du wirklich, man kann einen Menschen in der Badewanne so mir
nichts, dir nichts ertränken, ohne dass er sich wehrt? Und was für eine boden-
lose Frechheit! Dein Elaborat ist nicht nur unaussprechlich primitiv, sondern
auch gemein. Ich habe mich gleich erkannt! Mit deiner beschränkten Fantasie
wählst du mich als Opfer aus, deine blöde Angelika ermordet natürlich mich.
Dass du noch immer diese Frau ins Spiel bringst, immer wieder alte Sachen
aufwärmst, ist lächerlich. Durchsichtig und lächerlich!«
Kopfschüttelnd über meine Idiotie, die sich in seinen Augen wieder einmal
aufs Neue bestätigt hatte, stand mein zur Korpulenz neigender Mann umständ-
lich auf, zerknüllte die hoffnungsfrohen Anfänge meines literarischen Versuchs
mit den Worten »Robert! Pah, ich kenne dich!« und verschwand in sein Zim-
mer, um weiter an einem seiner kleinkarierten, unverständlichen historischen
Texte mit den vielen hundert Fußnoten zu werken.
Zutiefst gekränkt und nachdenklich blieb ich noch eine Weile sitzen. So ist
das also, ging es mir durch den Kopf. An seine widerliche Affäre mit Angelika
88/186

will er nicht mehr erinnert werden. Man ist empfindlich! Dabei wäre sie in
meinem Roman, ganz im Gegensatz zum wirklichen Leben, eine schöne Frau!
Die Erinnerung an die Zeit, als der erbärmliche Wicht an der Schwelle zum Al-
ter glaubte, mich mit seiner Kollegin Angelika, genauer gesagt, Dr. Angelika
Bauer, Spezialistin für mittelalterliche illuminierte Handschriften, sozusagen
mit letzter Kraft betrügen zu müssen, stieg in mir hoch. Wie mag sich das
Geschlechtsleben der beiden hässlichen Historiker damals so im Detail
abgespielt haben? Die Vorstellung rief in mir keine nachträgliche Eifersucht,
sondern nur Abscheu hervor, denn vor meinem inneren Auge sah ich die
widerliche Paarung zweier plumper Dinosaurier.
Von dem Verhältnis der verschrobenen Historikergestalten hatte ich nur
durch Zufall erfahren. »Weißt du, wen ich gesehen habe?«, berichtete mir
Heidi Huber, eine pensionierte Bierhäusl-Bewohnerin und flüchtige Bekannte,
deren kleinen Argusaugen nichts in der Siedlung und auch sonst nichts ent-
ging, eines Tages ganz aufgeregt und mit schlecht verhohlener Schadenfreude.
»Deinen lieben Mann – und nicht allein! Stell dir vor, als ich auf dem Grab der
Hanni-Tant Chrysanthemen ausgesetzt hab, seh ich ihn mit der schiachen
Bauer auf dem Hernalser Friedhof. Du weißt, ich kenn die Frau Doktor vom Se-
hen; sie war doch ein paar Mal bei euch. Sind die Leute doch dumm! Sie
glauben, wenn sie zwischen verfallenen Gräbern herumschleichen, sieht sie
keiner.« Damit wusste ich Bescheid, ärgerte mich eine Weile, um mich dann an
Poldis absurden Lügen zu ergötzen, die er hastig erfand, wenn ich mich
unschuldig-besorgt nach dem Grund seiner späten Heimkehr erkundigte.
Beim Aufräumen in der Küche gönnte ich mir noch ein zweites Glas Rot-
wein. »Dieser verklemmte Mensch, wie er sich zum Richter über meine literar-
ischen Fähigkeiten aufspielt! Immer ist es so. Alles, was ich tue, kritisiert der
hochnäsige Affe.« Und der Affe hatte mir doch tatsächlich die Freude am
Schreiben genommen! Die Gedanken an die mörderischen Bäder verließen
mich jedoch nicht, im Gegenteil, sie sogen sich förmlich in meinem Bewusst-
sein fest.
89/186

Der bedauerliche Streit wegen meiner im Frühstadium erstickten literarischen
Ambitionen fand im Spätherbst statt. Allerheiligen stand vor der Tür. Dichte
Nebel kamen auf, es wurde früh dunkel, und die Mehrzahl der überwiegend
katholischen Bevölkerung ging auf die oft uralten, verwunschenen Wiener
Friedhöfe. Man schmückte die letzten Ruhestätten seiner Verstorbenen, putzte
die diversen Grabstatuen, schrubbte verwitterte Marmorplatten, füllte die
Laternen mit neuen Lichtern und trug schließlich opulente Kränze herbei. Es
galt, den Grüften und Gräbern für Allerheiligen und Allerseelen, das Fest der
Toten, ein respektierliches und würdiges Aussehen zu geben. Niemand sollte
glauben – wie es tatsächlich oft der Fall war –, dass man sich vielleicht nicht
um die dahingeschiedenen und bereits beerbten lieben Toten kümmerte. Zu
dieser Zeit fanden sich Mizzi und ich ebenfalls auf dem Zentralfriedhof, dem
mit seinen 330 000 Grabstellen zweitgrößten Totenhain Europas und dem
größten von Wien, ein. »Halb so groß wie Zürich, aber doppelt so lustig«, lautet
ein alter Witz, den Fremde nicht begreifen. Sie verstehen nicht, was an einem
Friedhof »so lustig« sein kann. Tatsächlich bietet er jedoch viele, teils
amüsante Gschicht’ln und Kuriositäten. Wir streiften an der imposanten Gruft
der österreichischen Präsidenten vorbei und besichtigten die letzte Ruhestätte
der Opfer großer Katastrophen: der Märzrevolution von 1848, des Ringtheater-
brands von 1881, des Absturzes eines Luftschiffes 1914. Die erschossenen De-
monstranten vom Justizpalastbrand des Jahres 1927 liegen friedlich neben den
damals getöteten Polizisten. Prunkvolle Ehrengräber sind Wolfgang Amadeus
Mozart, Ludwig van Beethoven, Johann Strauß Vater und Sohn, Ludwig
Boltzmann und anderen Genies gewidmet. Wir fütterten die vielen
quicklebendigen, von den Wienern allesamt »Hansi« genannten Eichhörnchen
und erinnerten uns, dass in dem Totenhain viele Rehe und noch mehr Hasen
und Feldhamster ein beschauliches Leben führen. Ungestört fressen sie
heutzutage vor sich hin, vortrefflich munden ihnen die vielen frischen Pflan-
zen. Bis vor Kurzem hatte man die stillen Genießer jedoch, wenn im Herbst
zum Halali geblasen wurde, unsanft aus ihrer Ruhe gerissen – der Friedhof war
lange Zeit begehrtes Jagdgebiet. Unter den halb geschlossenen Augen einer
verschlafen blinzelnden Friedhofseule, deren weiches Federkleid mit der Farbe
perfekt mit dem Ast harmonierte, auf dem sie sich niedergelassen,
90/186
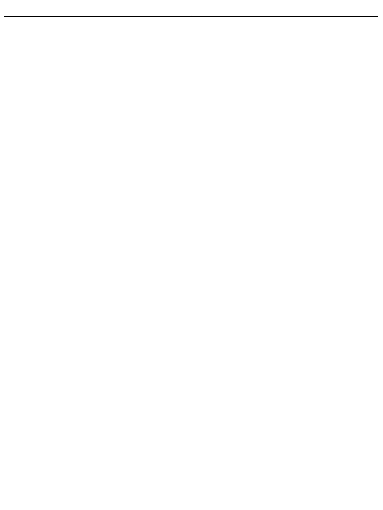
schlenderten wir zu den spektakulären Ruhestätten. Ein steinerner Fußball,
eine »Wuchtel«, markiert jene von Matthias Sindelar, dem Kapitän des le-
gendären »Wunderteams«. 15 000 Fans folgten 1939 seinem Sarg, als hätten
sie den Niedergang des österreichischen Fußballs vorausgeahnt. Auf dem Grab
jener Mercedes Jellinek, die einer Automarke ihren Namen gab, steht eine tief
trauernde Frauengestalt. »Na ja, die Preise von Mercedes sind auch wirklich
zum Weinen«, bemerkte Mizzi. Der extravagante, samt Motorrad abgebildete
Rennfahrer Martin Schneeweiß blickte uns nachdenklich an. Weiter ging es zu
Reihen mit weniger prätentiösen Ruhestätten, wo wir mit Vergnügen die Gra-
baufschriften lasen, die oft Berufe, meist jedoch Titel angeben. Es gab Wirk-
liche Hofräte und Hofratswitwen, Oberoffiziale und Oberoffizialswitwen.
»Schau, da liegt eine Hausbesitzerswitwe vom Alsergrund«, amüsierte sich
Mizzi. »Sie hat ihren Mann um vierzig Jahre überlebt. Sollte uns ein Vorbild
sein.« Gern verglichen wir die Lebensdaten sowie das Alter der
Dahingeschiedenen und stellten dabei mit Befriedigung fest, dass Frauen viel
älter wurden als Männer.
Die auf den Grabsteinen eingemeißelten Sprüche, letzte Begleiter auf dem
Weg in die Ewigkeit, zeugten von der Verlogenheit der Menschen: »Bis zum
Wiedersehen!«, »Auf bald!«, »Zu früh verstorben«, »Für ewig Dein!« stand da
zu lesen, womit viele ihre geheimen Gedanken kaschierten, die gelautet haben
mögen: »Gott sei Dank, dahin!« oder »Welche Erlösung!« In dem irrigen
Glauben, ihr Aussehen der Nachwelt vermitteln zu müssen, hatten viele das
Anbringen ihrer Porträts mittels kleiner, in den Grabstein eingelassener
Medaillons verfügt. »Auch nicht schön, der Ferdinand Schulz mit seinem
Kropf!«, bemerkte ich. Unser Augenmerk galt jedoch den Accessoires der
Gräber. Wir bewunderten den üppigen Blumenschmuck nicht nur, wir nahmen
ihn auch mit, um damit unsere eigenen Gärten auszustatten. Wie teuer waren
doch Pflanzen, die hier mangels Pflege bald verwelkten, denen jedoch bei uns
zu Hause, gehegt und gepflegt, noch ein langes Leben beschieden sein würde!
»Ich frage dich«, meinte Mizzi, vermutlich um ihr schlechtes Gewissen zu
beschwichtigen, »was haben die Toten von dem Kram?« Sie lachte frivol.
»Gestatten Sie?«, fragte sie, bevor sie von dem Grab eines Friedolin Mayer eine
schöne, im Advent sehr nützliche Kerze entfernte.
91/186

»Erinnerst du dich noch, wie wir als Kinder zum Muttertag immer Blumen
vom Friedhof holten?«, fragte ich nostalgisch. »Unsere Mütter haben sich zwar
über die typischen Totenblumen anstelle von Vergissmeinnicht und Hortensien
gewundert, aber nie etwas gesagt. Ach, Waldviertel,
mon amour
!« – »Gib nicht
an, du weißt doch, dass wir nie Französisch hatten, weil kein Lehrer in das
provinzielle Waldviertel am Ende der Welt wollte«, beendete Maria meine Sen-
timentalität. »Es ist dir schon klar, dass wir miese Grabfledderer
sind?« – »Pfui, zähme deine Worte!«, antwortete ich entrüstet, während wir
unsere Beute verstauten. »Letzte Ruhestätten sind Orte der Besinnung und des
Gedenkens!« Dann fiel mir ein Zeitungsartikel ein, denn ich kurz zuvor gelesen
hatte. »Stell dir vor, in Italien, wo der Totenkult blüht, besorgt die Mafia den
Schutz der Friedhöfe. Man sucht die Hinterbliebenen auf und bringt ihnen die
Notwendigkeit der Bewachung der toten Lieben in derart pietätvoller Weise
nahe, dass kaum jemand die angebotene Hilfe ablehnt. Die ›ehrenwerte Gesell-
schaft‹ bietet ihre Dienste natürlich nicht kostenlos an. Für die Mühe werden
regelmäßig kleine Beträge kassiert, quasi ›Körberlgeld‹ für die Mitglieder der
Organisation. Dass es immer wieder zahlungsunwillige Außenseiter gibt, passt
ins Konzept der Mafiosi. Bald stehen die Renitenten fassungslos vor steinernen
Engeln, denen man die Flügel abgebrochen hat, und vor ihren mit ordinären
Sprüchen beschmierten und verwüsteten Gräbern. Die bösen Rachetaten dien-
en als Strafe und Reklame. Sie erweitern auch den Kundenkreis. »Nicht
schlecht«, grinste Mizzi. »Vielleicht sollten wir uns auf diesem Gebiet etablier-
en? Ich denke an eine Firma mit dem Namen ›Grabschutz
AG
‹.« – »Klingt
nicht uninteressant«, stimmte ich ihr bei. »Und da fällt mir noch etwas ein. Du
kennst
doch
die
Familie
Schneider
aus
unserer
Siedlung?« – »Ja,
flüchtig.« – »Sie hat mir unlängst eine unglaubliche, aber wahre Geschichte
erzählt. Hör zu: Frau Schneider hatte eine Großtante, die sie manchmal im Al-
tersheim Lainz besuchte. Als die alte Dame im Sterben lag, bat sie: ›Ich möchte
bei meinem Rudi begraben sein!‹ Die Schneiders, ihre einzigen überlebenden
Verwandten, respektierten diesen letzten Wunsch. Sie erledigten alle Be-
hördenwege und veranlassten die Beisetzung der Tante in der Gruft ihres
langjährigen Lebensgefährten. Beim Begräbnis waren sie, neben dem Geist-
lichen und den Sargträgern, allein bei der kurzen Zeremonie. Plötzlich stutzte
92/186

Herr Schneider. Mit vor Entsetzen geweiteten Augen, zog er seine Frau beiseite
und flüsterte ihr aufgeregt zu: »Jessas, schau doch! Auf dem Grabstein steht
Werner Sokol. Ich weiß genau, der Freund hat aber Rudolf Sokol ge-
heißen!« – »Um Gottes willen« kam gewispert, obwohl sich niemand in Hör-
weite befand, die Antwort zurück. »Und die Tante wünschte sich noch diese In-
schrift! Schrecklich, vielleicht hat der Werner Sokol eine Witwe hinterlassen.
Die kommt auf den Friedhof, sieht dort am Grabstein ihres Mannes den Na-
men einer fremden Frau eingemeißelt und darunter: Auf ewig Dein!« Die Sch-
neiders haben, wie sie mir erzählten, überstürzt den Zentralfriedhof verlassen,
sich nie mehr bei der Gruft blicken lassen und den peinlichen Vorfall einfach
verdrängt!« Mizzi lachte Tränen: »Kommt vielleicht öfter vor, dass einer im
falschen Grab liegt!«
Wenig später waren Poldi und ich bei Rosi und Fritz Pollatschek eingeladen,
den rechts von uns wohnenden stolzen Besitzern eines putzigen Schweizer
Almhäuschens. Mich ekelte schon im Vorhinein vor dem »Grillabend im klein-
en Freundeskreis« bei dem unsymphatischen Ehepaar, und ich irrte nicht. Es
gab wie erwartet die riesigen marinierten Fleischfladen und die fetten
Käsekrainer-Würste, aus denen eine unappetitliche Käsesoße quoll, wenn Fritz
sie mit einer Grillgabel anstach, während er sie aus einer roten Plastikschüssel
fischte, um sie auf den Rost zu legen.
Während sich penetranter Qualm ausbreitete, mischte Rosi Salate: mit
Wasser, Bona-Öl, Essig und Zucker, eine Mischung, die vor langer Zeit im alten
Wien en vogue war, einen süß-sauren Geschmack ergibt und die Salatblätter
welken lässt. Die Zubereitung mit Olivenöl, Kräutern und Aceto balsamico, wie
ich sie liebte, war hier verpönt. Die Freunde unserer Nachbarn, neben denen
wir in der Veranda auf preiswerten Heurigenbänken aus dem nahen Baumarkt
Platz genommen hatten, waren meist kleine Beamte in gesicherten Positionen,
etwa bei den Stadtwerken, der Post, der Bahn oder dem Magistrat der Stadt
Wien. Viele befanden sich auch bereits – von allen glühend beneidet – trotz re-
lativer Jugend und augenscheinlich guter Gesundheit in krankheitsbedingter
Frühpension, jenem von vielen Österreichern herbeigesehnten idealen
Lebenszustand. Die Glücklichen waren, wie sie erzählten, erschöpft durch den
93/186

unmenschlichen Stress am Arbeitsplatz oft und lange in Krankenstand gegan-
gen. So lange, bis ihnen das Gutachten eines wohlgesonnenen Amtsarztes
schwarz auf weiß bescheinigte, dass jede weitere Berufstätigkeit ein lebensge-
fährliches Gesundheitsrisiko für sie bedeuteten würde.
Die meisten der Anwesenden, egal ob noch bedauerte Berufstätige oder
bereits Jungrentner, gingen interessanten Hobbys nach. Die Lethargie, mit der
sie widerwillig ihren Beruf ausübten, und die Krankheiten, die sie arbeitsun-
fähig gemacht hatten, streiften sie dabei auf mysteriöse Weise ab. So entpuppte
sich ein pensionierter »Charly« als Eisenbahn-Fan, der in zugigen Fabrikhallen
antike Lokomotiven reparierte. Sein ebenfalls anwesender Schwager »Freddi«
verbrachte die Freizeit, über die er als Beamter in Hülle und Fülle verfügte, mit
der Erforschung napoleonischer Schanzen im Wienerwald. Während der Dien-
stzeit schrieb er dann seine Erkenntnisse in Artikeln für lokale Zeitschriften
nieder.
Gemeinsam war jedoch allen Gästen, dass sie – ganz im Gegensatz zu
meinem akademisch gebildeten Mann, der unter der uneingestandenen Erfol-
glosigkeit und seiner geringen Entlohnung als Dozent für Geschichte sehr
litt – keinesfalls mit ihrem Schicksal haderten. Beruflicher Ehrgeiz, in welcher
Form auch immer, war den meisten der Anwesenden fremd. Man pflegte
genüsslich sein kleinbürgerliches Dasein, zählte die Monate und Jahre bis zur
ersehnten gesicherten Pension, deren erwartete Höhe der Bürgerservice der
Pensionsversicherungsanstalt gern im Voraus berechnete, und gab sich mit
dem Erreichten voll und ganz zufrieden. »Soll uns nie schlechter gehn« lautete
der allgemeine Tenor. Die Hast unseres unruhigen Zeitalters blieb ihnen
unverständlich.
Wie immer, so wurde auch bei diesem letzten launigen Grillfest des Jahres
viel und genüsslich gegessen, ein »G’schpritzter« nach dem anderen rann
durch die durstigen Kehlen. Der eher saure, hierzulande in rauen Mengen kon-
sumierte Veltliner stammte aus den Rieden der Umgebung nördlich von Wien,
dem sogenannten Weinviertel. Böse Zungen verhöhnen die billige Version
dieses beim Heurigen bevorzugten Weißweins, den es auch in erlesenen Sorten
gibt, als »Veltliner, die Rache der Wiener«!
94/186

Die Pollatschek-Gäste berührte dies in keiner Weise. Wie angewurzelt saßen
sie ununterbrochen essend und trinkend um den Tisch und bewegten sich
stundenlang nicht vom Fleck. Den üppigen Grillplatten folgte eine deftige
Jause mit selbst gemachtem Guglhupf, Schlagobers und Kaffee. Langatmig und
voll melancholischem Genuss wurden die erstaunlichen, oft ungerechten, meist
aber traurigen Wechselfälle des Lebens anhand der Ereignisse in der Ver-
wandt- und Bekanntschaft besprochen: die schweren Krankheiten, die tragis-
chen Schicksale, die vielen Todesfälle und die Begräbnisse, an denen man teil-
genommen hat. Man kommentierte die Anzahl der Kränze in der Leichenhalle
und wen man dort ganz unvermutet, oft nach vielen Jahren und stark gealtert,
wiedergetroffen hatte: »Also, den Seppi, der war so ein lustiger Bursch, ich hätt
ihn net wiedererkannt!« Auch das – entweder zu sparsame oder zu üp-
pige – Menü vom Leichenschmaus im Wirtshaus »Zum Schwarzen Adler«
gleich beim Hütteldorfer Friedhof kam zur Sprache: »So fressen braucht man
wirklich nicht, wenn einer grad verstorben ist!« Bei einem kargen Mahl hieß es
dann: »Muss man wirklich so sparen, wenn einer stirbt?« Ebenso wurde kom-
mentiert, dass eine am Grab noch schmerzgebeugt schluchzende Witwe beim
Totenmahl schon wieder laut gelacht hatte: »Ja, so ist das Leben, ungerecht!«
Eine Bemerkung, die den lockeren und logischen Übergang zu Heiterem
schaffte, und bald »rannte«, wie es bei uns heißt, der klassische Wiener Sch-
mäh. Man begann harmlos, wobei unsere Toleranz – Leopold und ich galten als
empfindlich, als »ang’rührt« – voll List und Tücke ausgelotet wurde. »Was ist
der Unterschied zwischen …?« Schnell wurde man ordinär: »Schaut eine uralte
Frau nackt in den Spiegel und sagt: ›Des vergunn i eahm‹«. Wobei sie mit dem
Verfall ihres Körpers anscheinend den angetrauten Ehemann zu strafen
gedachte. Zu meinem heimlichen Vergnügen wand sich mein prüder Poldi vor
Verlegenheit, sagte aber nichts. Auch der Witz über den Herrn, der eine ältere
Dame mit höflichen Worten zum Tragen eines
BH
s aufforderte: »Gnädigste,
man erwartet Bodenfrost!«, wurde mit brüllendem Gelächter quittiert. Die
Stunden, die für die anderen im Flug vergingen, zogen sich für mich quälend
langsam dahin. Immer häufiger warf ich Leopold eindringliche Blicke zu, um
ihn zum Gehen aufzufordern. Doch er rührte sich nicht. Als einziger Aka-
demiker in der Runde, wollte der »Herr Doktor« nicht als »fad«, als muffiger
95/186

Spaßverderber gelten und blieb schweigend sitzen. Du erbärmlicher Waschlap-
pen, wie ich dich und dein unechtes, gequältes, dummes Grinsen zutiefst ver-
achte!, dachte ich mir grimmig.
Am Tag nach dem schrecklichen Proleten-Fest waren wir zu unserem »Sir« un-
terwegs, um Wogen zu glätten. Hatte dieser doch, einer Laune des Augenblicks
folgend, Herrn Stenzl, einen dicken Bewohner seines Hauses, der aufgrund
seiner Körperfülle mehr watschelte als ging, lachend als »Wal« bezeichnet und
ihn damit zutiefst beleidigt. Es war einer der Fälle, wo dem Onkel sein Humor,
oder was er darunter verstand, durchgegangen war. Tatsächlich verfügte der
alte Herr über eine erstaunliche, manchmal jedoch taktlose und oft kon-
traproduktive Schlagfertigkeit. Er konnte seinen Schalk manchmal kaum zü-
geln, was sich schon einmal unangenehm bemerkbar gemacht hatte, als
wir – noch vor seinem Unfall – einen staatlichen Pflegezuschuss für den allein-
lebenden Witwer beantragt hatten.
Dieser kam eines Tages, frohgemut und elegant wie immer, vom Einkaufen
heim, fand zum Zwecke der Feststellung seiner Bedürftigkeit einen Arzt der
Krankenkasse neben der Eingangstür vor und bat ihn in seine gemütliche, alt-
modische, ein wenig finstere und abgewohnte Wohnung voll schöner
Antiquitäten und mittelmäßiger Barockbilder. Die beiden Herren plauderten
voll ausgesuchter Höflichkeit. Sir, den Leopold und ich, nachdem sich der Arzt
angekündigt hatte, händeringend gebeten hatten, seinen Witz zu bezähmen
und Hilflosigkeit sowie Gedächtnisverlust zu mimen, vergaß beim Anblick des
freundlichen jungen Mannes alle seine guten Vorsätze und lief zur Hochform
auf. Auf die listige Frage des Mediziners zur Testung seines Gedächtnisses, wie
denn unser verehrter Herr Bundespräsident mit Namen heiße, bog er sich vor
Lachen, um dann prompt und ohne langes Nachzudenken zu antworten: »Mein
lieber Herr Doktor, der heißt leider gar nichts!« Nachdem sich auf diese Weise
ein freundschaftliches Verhältnis eingestellt hatte, erklärte unser »Sir« dem
Beauftragten der Krankenkasse noch kurz Einsteins Relativitätstheorie, mit der
er sich damals gerade intensiv beschäftigte. Der Belehrte lauschte dem Ausflug
in die hohe Physik mit ehrlichem Interesse und Bewunderung. Schließlich ver-
abschiedete er sich jedoch mit großem Bedauern von unserem Onkel, den er,
96/186

wie übrigens die meisten Menschen, sehr sympathisch fand. »Leider, leider,
lieber Herr Doktor, Pflegegeld kann ich Ihnen nicht bewilligen! Sie erreichen
nicht einmal die erste Stufe. Später einmal, vielleicht, wir werden sehen.«
Damit hatte der alte Herr, ein Mann der überaus großzügigen Gesten, aber
auch von großer Sparsamkeit, nicht gerechnet. Seinen fatalen Irrtum, der ihn
um jenen Zuschuss gebracht hat, den der österreichische Staat seinen betagten
Bürgern gewährt, zutiefst bedauernd, blieb er betroffen zurück. In diesem amt-
lichen Fall konnten Poldi und ich leider nichts mehr ändern. Bei dem letzten
Fauxpas unseres »Sir« gelang es uns, Herrn Stenzl mit dem Hinweis auf das
hohe Alter des Beleidigers zu besänftigen.
97/186

Kapitel 9
9
Ab dem 1. Dezember erwachte unsere Siedlung, wie jedes Jahr um diese Zeit,
zu neuem Leben und geradezu hektischer Aktivität. Das Startsignal dafür gab
die Rentnerin Heidi Huber aus der Sonnenblumengasse, indem sie ihren Enkel
Norbert mit der Installation von drei Elektrokerzen auf der Fensterbank ihres
Wohnzimmers beauftragte. Beim Entleeren des Abfalleimers beobachtete ihr
Nachbar die Weihnachtsoffensive und konterte umgehend mit der Aufstellung
eines zehnarmigen dänischen Kerzensets im Küchenfenster. Danach gab es
kein Halten mehr. Zwei Tage später erstrahlte der Bierhäuslberg allabendlich
in märchenhaft-kitschigem Glanz. Sternengeschmückte Kettenschaltungen
überzogen die Obstbäume, Lichterketten umwanden die Gartenzäune, Garten-
zwerge erhielten ein schimmerndes Kleid. Mit der Aufstellung eines
funkelnden Rentiergespanns aus reinem Plastik in seinem Garten setzte Fritz
Pollatschek zweifellos den neidlos anerkannten Höhepunkt des gespenstischen
Treibens.
Vorweihnachtliche Stimmung breitete sich aus, und ich beschloss, vom allge-
meinen Adventtreiben in milde Sentimentalität versetzt, Bekannte einzuladen
und ihnen eines meiner deftigeren Lieblingsgerichte zu kredenzen: Wiener
Fiakergulasch mit Nockerln, Ei und Gurkerln. Und das, obwohl Leopold meine
Bemühungen um die bodenständige Wiener Küche gar nicht schätzte. Undank-
bar, wie er immer gewesen ist, jammerte er, dass er die vielen Zwiebeln im Gu-
lasch nicht vertragen könne. Sie würden ihm Magendrücken und Übelkeit
bereiten: »Jedes Mal wird mir danach schlecht.« Ich schenkte seinen
Beschwerden keinen Glauben, fasste seine Äußerungen als Beleidigung meiner
Kochkünste auf und nahm daher auch auf diese, wie mir schien, übertriebenen
Empfindlichkeiten keine Rücksicht. War doch gerade dieses Gericht – wie mir

die Komplimente unserer seltenen Gäste bestätigten –, pikant und perfekt
nach einem alten Familienrezept meiner seligen Großmutter zubereitet, ein
wahres Gedicht.
In diesem Sinne schälte ich eines Abends im Dezember eine Unmenge von
Zwiebeln – Zwiebel zu Fleisch sollten im Verhältnis 1:1 stehen – und hackte sie
würfelig. Ich wusch Paprikaschoten und schnitt sie in Streifen. Auch den Wad-
schunken (gut abgelegenes, leicht mit Fett durchzogenes Beinfleisch vom Rind)
schnitt ich in Würfel, die ich sorgfältig in Mehl wälzte. Dann briet ich die
Zwiebeln in Schmalz, bis sie goldbraun waren und mischte das Fleisch,
Paprika, Tomatenmark, Paprikapulver sowie eine Prise Salz und Pfeffer dar-
unter und ließ alles etwa fünf Minuten anrösten.
Und dann kam das Besondere. Unserer Familientradition folgend, goss ich
nach dem Vorbild meiner Großmutter, die aus einer Familie von schweren
Säufern stammte, mit Rotwein und nur mit Rotwein auf – normalerweise nim-
mt man Wasser. Anschließend fügte ich reichlich Knoblauch, Petersilie, Küm-
mel, Majoran und Thymian dazu. Das Gulasch köchelte zwei Stunden langsam
vor sich hin, um dann, nochmals mit Wein aufgegossen, weitere zwei Stunden
ganz langsam bei mittlerer Hitze gar zu werden. Über Nacht ließ ich die Speise
stehen, denn aufgewärmt schmeckt sie noch besser.
Ich servierte mein Fiakergulasch mit gebratenen Frankfurter Würstchen,
einer fein geschnittenen Znaimer Gurke und einem Spiegelei. Ich musste
schmunzeln, als ich mich erinnerte, wie sich Poldi bei der ungeschickten
Zubereitung letzterer Zutat verbrüht hatte.
Unsere Gäste, das Ehepaar Gruber, waren beide in derselben Bank wie ich
beschäftigt. Sie war eine lebhafte brünette Fünfzigjährige, er ein etwas älterer,
untersetzter Mann mit kleinem Schnurrbart. Wie vereinbart trafen sie, mit Blu-
men bewaffnet, pünktlich um acht Uhr abends ein. Frau Gruber bewunderte
den schönen alten Türklopfer in Gestalt eines kleinen Löwenkopfes aus Mess-
ing am Eingang. »Habe ich am Flohmarkt gekauft!«, erklärte ich das in
Wahrheit aus dem Palais Pallavicini in der Wiener Innenstadt stammende und
auf einem meiner kleinen Raubausflüge mit Mizzi erworbene antike Stück. Die
Gäste aßen tüchtig, bedienten sich ein zweites Mal, sprachen auch den
»Schusterlaberln«, die ich zum Gulasch als Gebäck reichte, zu und tranken
99/186

sehr viel. Selbst Poldi häufte sich von meiner Götterspeise eine große Portion
auf den Teller. »Ich nehme dazu kein Mineralwasser, sondern Rotwein«, mur-
melte er vor sich hin. »Dann werde ich das Essen schon vertragen!« Der Alko-
holverächter öffnete eine Bouteille Cabernet Sauvignon aus dem kalifornischen
Napa Valley von unserem kleinen Weinvorrat, den ihm seine Studenten im
Laufe der Zeit geschenkt hatten, dann eine zweite, und ehe wir’s uns versahen,
entkorkte Poldi, bereits etwas beschwipst, eine dritte und vierte Flasche. »So
kennen wir Ihren Mann ja gar nicht. So gelöst und heiter!«, raunte mir Herr
Gruber verwundert zu, nachdem Poldi gerade einen Witz erzählt hatte, den ich
auf mich münzte: »Meine Frau ist eine gute Köchin. Und solang wir ein an-
gebranntes Reindl haben, haben wir auch eine Suppe.« – »Ha, ha, ha«, röhrte
Gruber. »Vielleicht sollte der Herr Dozent öfter trinken. Es scheint ihn zu
entspannen!« – »Heute gibt’s gar keine Suppe«, wies ich ihn ärgerlich zurecht.
Nachdem ich meinen Ärger hinuntergeschluckt hatte, entspann sich eine
angeregte Konversation um die große Dürer-Ausstellung in der Wiener Alber-
tina, wo viele Skizzen des deutschen Meisters zu sehen waren. Wir besprachen
auch das Programm der kommenden symphonischen Konzerte im Wiener
Musikverein.
Hitzig wurde die gepflegte Unterhaltung erst, als – auf dem Umweg über die
vielen nächtlichen Überfälle am Heimweg von Veranstaltungen – das wie in
den meisten europäischen Großstädten auch in Wien schwelende Ausländer-
problem zur Sprache kam. »Man kann nicht alle Ausländer pauschal verur-
teilen, nicht alle sind Verbrecher«, gab ich mich weltgewandt und konziliant.
»Ja, das stimmt. Und nicht alle Nigerianer sind Drogenhändler!«, pflichteten
mir die Grubers bei, als sich der zu diesem Zeitpunkt bereits ganz rot an-
gelaufene, stumpf vor sich hinbrütende Poldi laut zu Wort meldete. Zu unserer
Verblüffung äußerte er sich sehr radikal. Der Alkohol hatte dem sonst als toler-
ant bekannten Historiker die Zunge gelöst und seine wahren Ansichten an die
Oberfläche gespült, wo sie nun aus ihm herausbrachen. »Nicht alle, aber die
meisten!«, lallte er. »Der Großteil der Asylanten handelt mit Drogen! Jeder
weiß das, niemand spricht die Wahrheit aus! Das Gesindel gehört ausgewiesen,
ausgerottet oder in Arbeitslager, ja in Arbeitslager, in Arbeitslager!« Wir
100/186

schwiegen betroffen. Erst bei dem mit reichlich Inländerrum versetzten Tiram-
isu besserte sich die Stimmung, deren Umkippen Poldi entgangen war.
Unsere Bekannten verabschiedeten sich gegen Mitternacht. Poldi brachte
sie, überaus heiter und stark schwankend, zur Tür. Kater Murli, der das unge-
wohnte Treiben vom oberen Absatz des Treppenhauses betrachtet hatte, putzte
sich sorgfältig, um sich dann, leicht pikiert durch den im Haus herrschenden
Lärm, nach ausgiebiger Fellpflege lang ausgestreckt niederzulassen und an Ort
und Stelle einzuschlafen. Ich hielt mich noch in der Küche auf, als mich ein
dumpfes Gepolter aufschreckte, gefolgt von einem schrillen Schrei. »Um Gottes
willen«, rief ich entsetzt, als sich mir das Ausmaß der häuslichen Katastrophe
enthüllte. Mein angetrunkener Mann hatte, als ihn Übelkeit überkam und er
rasch in die Toilette des Obergeschosses eilen wollte, Murli, dessen Farbe der
des Teppichs zum Verwechseln glich, einfach übersehen, war über den
dösenden Kater gestolpert und die ganze Länge unserer engen und steilen
Treppe, einer veritablen »Hendlstiege«, hinuntergestürzt. Wimmernd und fast
ohnmächtig vor Schmerz lag er im Vorzimmer, aus seinem rechten Hosenbein
quoll Blut, der rechte Arm stand in einem kuriosen Winkel vom Körper ab. Ich
suchte ihn aufzurichten, doch er sackte immer wieder stöhnend in sich zusam-
men. Es war ihm unmöglich, das schmerzende Bein zu belasten. Hektische Akt-
ivitäten folgten. Die städtische Rettung erschien, junge – recht attrakt-
ive – Sanitäter transportierten den Verunglückten auf einer Trage und in mein-
er Begleitung in das Meidlinger Unfallkrankenhaus.
Dieses für Katastrophen aller Art bestens gerüstete Spital ist eine einz-
igartige Institution. Effizienz wird in dem Zweckbau des 12. Gemeindebezirks
großgeschrieben. Verwundete versorgt man dort mit viel Routine und sarkas-
tischem Humor im Eiltempo, gleichsam wie am Fließband. Formalitäten hat
man auf ein Mindestmaß reduziert, Papiere spielen kaum eine Rolle, Ausweise
gar keine. Nicht wie in manchen Krankenhäusern, wo man selbst in schweren
Fällen und mit Wunden, aus denen das Blut auf den Boden tropft, am Auf-
nahmeschalter Fragebögen auszufüllen hat. »Name, Vorname, wie schreibt
man das? Reden Sie bitte deutlicher! Versicherungsnummer? Krankenkasse?
Wohnort? Postleitzahl? Name des Ehemanns, Vorname der Mutter, des
101/186

Vaters? Wo geboren? Wie alt? Wie heißt Ihr Hund?« Nein, Meidling ist da ganz
anders! Eine kurze Registrierung genügt.
Als wir eintrafen, saßen auf dem weiß getünchten Gang zahlreiche War-
tende. Resigniert starrten sie auf Bildschirme kryptischen Inhalts: »Bei Aufruf
eintreten und Einzelaufruf abwarten!« – »Schmuckstücke von den verletzten
Körperteilen entfernen!« In Windeseile karrte man Leopold vorbei an den Pa-
tienten, die sich aus eigener Kraft hergeschleppt hatten. Viele trugen, wie ich,
neben meinem Mann einhergehend, beobachten konnte, abstoßende, ama-
teurhaft gewickelte Verbände. Einer streckte krampfhaft sein verletztes Bein
von sich, ein anderer bewegte sich mit dick bandagierter Zehe aus eigener Kraft
per Rollstuhl in Richtung Röntgen. Ein Einarmiger mit zertrümmerter Nase
und eingegipster Hand röchelte auf seinem Rollbett vor sich hin. Was mochte
der für ein Schicksal haben? Trotz allem konversierten die Maladen in
angeregtem, mitleidigem Ton: »Wia is Ihnen denn des passiert?« – »Na, so a
Unglück!« – »Die Kellerstiagn sans obigfalln, wias an Wein gholt ham? So a
Pech!« Gips verbindet!, fiel mir dazu ein.
Poldi kam zur Notaufnahme in ein Zimmer, wo seine Alkoholfahne die
nüchtern-sterile Atmosphäre des Raumes belebte. Die Erstversorgung samt
Röntgen erfolgte sehr rasch. Als ich ihn bei Morgengrauen verließ, dämmerte
er mit einem hübsch in Weiß eingegipsten Bein, eingelullt durch eine schmerz-
stillende Injektion, in seinem Krankenbett dahin. »Die komplizierte Fraktur
der Hand und des Armes sowie die gerissenen Sehnen können wir erst operier-
en, wenn Ihr Mann nüchtern ist«, sagte lächelnd ein junger, gut aussehender
Arzt. »Entschuldigen Sie die Frage, aber ist Ihr Mann ein schwerer
Alkoholiker?«
Tatsächlich erforderte der Splitterbruch des rechten Handgelenks eine
mehrstündige Operation, gefolgt von einem fünftägigen Aufenthalt im
Krankenhaus. »Dein Essen, dein fettes, schweres Essen war es!«, keuchte der
Patient, als es ihm ein wenig besser ging, er aufstehen durfte und in meiner
Begleitung, mühsam gestützt auf eine Krücke, nunmehr auch den rechten Arm
genagelt, vergipst und in einer Schlinge, auf dem Gang ungelenk auf und ab
humpelte. »Du bist schuld. Zur Verdauung deines Fraßes habe ich Alkohol geb-
raucht. Und was hatte das blöde Katzentier im Treppenhaus herumzuliegen?«,
102/186

fauchte er trotz der ungewohnten Anstrengung böse, als sich niemand in Hör-
weite befand. Kamen wir an seinem Zimmernachbarn vorbei, der einen trau-
matischen Schädelbruch erlitten hatte und wehmütig aus einem turbanähn-
lichen Verband hervorlugte, änderte sich sein Ton. Freundlich und voll Jovial-
ität säuselte er: »Aber heute geht es Ihnen doch viel besser. Sie schauen
wesentlich frischer aus! Das wird schon wieder!«
Zu Hause erwies sich Leopold als ungeduldiger und unleidlicher Patient,
dem ich nichts recht machen konnte. Die Unfähigkeit, seine rechte Hand zu
gebrauchen, und die Aussicht, dass dieser Zustand lange anhalten und nach
Abnahme des Gipses eine physikalische Therapie in einem Rehabilitationszen-
trum erfordern würde, machte ihn Murli und mir gegenüber bitter und gemein.
Oft lockte er den Kater, in dem er den Urheber seines Unglücks sah, zu sich.
Kam dieser freundlich heran, um arglos das Gipsbein zu beschnuppern, trat er
nach ihm und verscheuchte ihn mit seiner Krücke und derben Flüchen, wie ich
sie von dem feinen Mediävisten nie erwartet hätte. Da Leopold ständig Sch-
merzen peinigten und er auch nachts meiner Hilfe bedurfte, gestaltete sich das
Zusammenleben mit ihm von Tag zu Tag schwieriger.
Ich merkte auch, dass er, der Alkohol immer verabscheut hatte, heimlich zu
trinken begann. In Windeseile sank der Spiegel in den Flaschen mit Slibowitz
und Whisky, die bis dahin in einem Winkel des Glasschranks unseres Wohnzi-
mmers unbeachtet gereift und verstaubt waren, auf ein Drittel. Wenn ich tag-
süber arbeitete, las Poldi so lange, bis ihn Kopfschmerzen peinigten, um dann
dumpf vor sich hin zu stieren. Kam ich müde nach Hause, überschüttete er
mich mit Vorwürfen. »Ich lese die miserablen und falschen Artikel meiner Kol-
legen und bin machtlos. Ich kann keine Entgegnung auf ihre stumpfsinnigen
Thesen schreiben, sie nicht widerlegen, weil du mich zum Krüppel gemacht
hast!« Mizzi, der ich mein Leid klagte und die alles sozusagen aus zweiter Hand
miterlebte, hetzte mich auf: »Lass dir nicht alles gefallen! Je mehr du für ihn
tust, desto mehr wird er dich sekkieren.«
Drei Wochen, nachdem man Poldi in meine Obhut entlassen hatte, riss mir
der Geduldsfaden – es war, wie ich mich erinnere, ein Sonntagnachmittag. Ich
hatte Poldi gerade Kräutertee zubereitet und schickte mich an, ihm diesen im
Wohnzimmer zu servieren, wo der Patient tagsüber auf dem von Zeitungen und
103/186

Büchern überquellenden Sofa zu ruhen pflegte. »Mit wem redet er denn?«,
wunderte ich mich, als ich leise näher kam. »Du Mistvieh«, hörte ich zu meiner
Verwunderung. »Das wirst du büßen. Dich bring ich um. Und zwar auf die Art
des Gogol!« Und zu wem sprach mein Gatte diese Worte? Derjenige, den der
Widerling da mit dem Tod bedrohte, war Murli, der harm- und ahnungslos auf
einem gepolsterten Sessel ruhte.
Ich erstarrte vor Schreck. »Meinst du das im Ernst?«, brüllte ich außer mir
vor Wut. Leopold verzog das Gesicht, sein unbeherrschter Ausbruch war ihm
peinlich. »Es sind die Schmerzen! Du weißt doch, ich könnte unserem lieben
kleinen Murli niemals ein Haar krümmen!«, log er voll Scheinheiligkeit und
ohne Scham, wie sich später herausstellen sollte.
Es dauerte eine Ewigkeit, bis Leopold nach Ablauf der vorgesehenen Wartefrist
zu einer dreiwöchigen Kur auf Kosten der Krankenkasse aufbrechen konnte.
Die bekannte Heilstätte von Ober-Stinkenbrunn sollte ihn, wie es das ärztliche
Begleitschreiben unverblümt ausdrückte, durch Physiotherapie und Unter-
wassergymnastik rasch für den Wiedereintritt in den Arbeitsprozess mobilis-
ieren. Endlich erschien doch ein kleiner Bus, aus dessen Fenstern ähnlich Un-
fallgeschädigte traurig herausschauten, um den Patienten und seine drei mit
vielen Büchern, aber wenig Kleidung vollgestopften Koffer abzuholen. Poldi
verzögerte die Weiterfahrt des Sammeltransports, da er noch ein paar Mal
hastig ins Haus zurückhumpelte, um weitere historische Zeitschriften an sich
zu raffen. Doch auch dies ging vorüber. Ich murmelte noch ein paar aufmun-
ternde Worte, winkte dem entschwindenden Gefährten kurz mit krampfhafter
Fröhlichkeit nach.
Dann wich die Hektik himmlischem Frieden. Ich konnte ausruhen, meine
Nerven erholten sich, und meine Lebensgeister kehrten zurück. Bald dürstete
mich nach Unterhaltung, und ich animierte einige meiner weiblichen Bekan-
nten zu einem Casino-Besuch in der Wiener Innenstadt. Wir – Gitta, mollig,
hübsch und lieb, immer zum Einsatz für ihre Freundinnen bereit, Mizzi, mein
Lebensmensch, Heidi, eine dunkelhaarige Zynikerin, Elisabeth, extravagant,
überlegen und humorvoll, und meine Wenigkeit – wählten einen Mittwoch,
den sogenannten »Damentag«, an dem man uns in der schummrigen
104/186

Spielhölle kostenlos Sekt kredenzte. Elegant in Schwarz gekleidet, prosteten
wir einander fröhlich zu, bevor wir, jede mit Jetons im Wert von 300 Schilling
bewaffnet, zu den um 18 Uhr bereits umlagerten Roulettetischen eilten. Es war
kaum Platz. Ich drängte mich vor und platzierte unter den Augen der wie mis-
strauische Adler spähenden Croupiers meinen kleinen Einsatz. An meine
Ohren schallte es unaufhörlich: »Bitte, auf 3, 7, 12! Auf das Karree mit 20 und
Zero! Cheval 11 und 12!« Und schließlich eine strenge Stimme: »Keine Einsätze
mehr. Bitte, keine Einsätze mehr! Rien ne va plus!« Trotzdem warfen einige
besonders Nervöse ihre Jetons erst im letztmöglichen Moment auf den Tisch,
lange nachdem sich die Scheibe des Roulettekessels in Bewegung gesetzt hatte.
Sie suchten die magischen Momente des Bangens um ihr Geld möglichst zu
verkürzen.
Das im Casino versammelte spielwütige Publikum erstaunte mich sehr.
Niemand hatte auch nur die geringste Ähnlichkeit mit jenen eleganten Gestal-
ten, wie ich sie aus James-Bond-Filmen kannte, die meisten sahen nach klein-
en Gewerbetreibenden und Pensionisten aus. Viele der krampfhaft ihre Mün-
zen umklammernden Glücksritter waren, wie ich erstaunt sah, ältere Damen,
einige sogar mit Gehstock, den sie neben sich an den Tisch lehnten. Fiel die
Kugel nicht auf die erhoffte Zahl und fegte der Croupier mit entspannter Miene
und einem kleinen Rechen unerbittlich das mit grünem Tuch bespannte
Spielfeld leer, verhärteten sich ihre Züge. Die Enttäuschung währte jedoch nur
kurz, dann öffneten sie flink ihre Handtaschen. Mit verwelkten, bril-
lantengeschmückten Händen förderten sie große Geldscheine zutage, die sie
zum Wechseln weiterreichten. Manche notierten sich lange Kolonnen von
Gewinnzahlen. Ich hörte gemurmelte Selbstgespräche: »Aha, dreimal 16, das
deutet jetzt auf 20. Fünfmal Rot, da muss gleich Schwarz kommen!«
Auch ich hatte mir eine Strategie ausgedacht. Roulette umfasst 36 Zahlen.
Man kann auf das erste, zweite und dritte Dutzend, also die Nummern von
1–12, 13–24 und 25–36 setzen. Um das Risiko zu minimieren, wählte ich jew-
eils zwei der drei Kolonnen. Oder ich versuchte es mit Rot und Schwarz. Auch
Gerade und Ungerade sagte mir zu. Sogenannte »Einfache Chancen«, bei den-
en man auf eine bestimmte Zahl setzt, riskierte ich nicht. Wie sollte ich von 36
Möglichkeiten die richtige erraten? Das schien mir absurd. War ich
105/186

Nostradamus? Also keine sinnlose Geldvernichtung! Meine Methode bewährte
sich. Langsam, aber stetig gewann ich kleine Sümmchen. Auch an den anderen
Spieltischen – wir waren abergläubisch und hatten uns getrennt – machte ich
bei meinen Freundinnen frohe Gesichter aus.
Nach einer Stunde verglichen wir unsere Erlöse. Mit insgesamt 3000
Schilling hatten wir den Einsatz verdoppelt. »Was tun wir mit dem Geld?«,
fragte Gitta, denn der Abend war noch jung. »Das genügt für das Sacher«,
meinte die kundige Heidi. Als Fremdenführerin, die in jeder Saison Hunderte
amerikanischer Touristen durch Wien schleuste und sie in den Nobelherbergen
betreute, kannte sie sich aus. Der Vorschlag wurde mit Begeisterung aufgen-
ommen, und wir eilten in Wiens vornehmstes Traditionshotel. Genüsslich
nahmen wir im edlen Plüschambiente des »Roten Salons« Platz, das für seinen
Charme berühmte Sacher-Personal umschwirrte uns. Die zarten Klänge eines
Pianisten, der populäre, einschmeichelnde Walzermusik zum Besten gab, ver-
setzten uns in angeregte Laune.
Bezüglich unserer Menuwahl wurden wir von Heidi genauestens instruiert:
»Zuerst leisten wir uns jede ein Glas Sekt. Keine Vorspeise! Man serviert als
Geschenk des Hauses sowieso ein Amuse-bouche, Gebäck und Butter. Das
reicht. Dann jede eine Hauptspeise, dazu den guten offenen Blaufränkischen
oder Weißburgunder – der Inhalt der Flaschenweine ist auch nicht besser, aber
sündteuer! Abschließend Kaffee, selbstverständlich die berühmte Sacher-Mis-
chung. Denn dazu gibt es, obligatorisch serviert auf einem schönen kleinen
Tafelaufsatz, köstliche und gleichzeitig kostenlose Petits Fours. Die sparen uns
den Nachtisch.«
In diesem Sinne tafelten wir üppig, aber preisgünstig, inmitten von Wiens
bester Gesellschaft. Riesige Porträts von Mitgliedern der Habsburger-Dynastie
sowie das überdimensionale Bild eines freundlichen weißen Hundes mit rotem,
neckisch gebundenem Halsband – vermutlich der Liebling eines Mitglieds des
Herrscherhauses – blickten wohlwollend auf uns herab. Wir ließen die Zeugen
vergangener Tage mit Sekt-Orange hochleben, schmausten Wiener Schnitzel,
gebackene Leber, Tafelspitz und Backhuhn – alles vom Feinsten –, lachten viel
und genossen unseren Triumph über die »Austrian Casinos«. Es war eine
Wonne.
106/186

Heidi unterhielt uns mit amüsanten Anekdoten aus ihrem Fremdenführer-
dasein: »War ich doch unlängst mit einer Gruppe älterer Amerikaner in der
Hofburg. Sie wollten die Appartements von Kaiser Franz Joseph und seiner
schönen »Sisi« mitsamt der großen, für ein Galadiner von anno dazumal
gedeckten k. und k. Hoftafel besichtigen. Damit das ganze mehr historisches
Flair bekommt, hat der Touristenverband beim Eingang in die Prunkgemächer
zwei junge, als Kaiser und Kaiserin kostümierte Schauspieler postiert. Er trägt
eine Uniform wie einst Franz Joseph, sie eine schulterfreie Abendtoilette. Mit
ihrer lang wallenden Perücke ähnelt sie wirklich der Elisabeth. Und stellt euch
das vor! Die Amis werden verlegen, schauen an ihren T-Shirts und Bermudas
hinunter, spucken ihre Kaugummis aus. Ein Dicker versteckt seinen Ham-
burger, an dem er bis dahin schmatzend gekaut hat, nimmt sein Baseball-Kap-
perl ab, geht mutig auf den ihm huldvoll zunickenden, ganz in seiner Rolle
aufgehenden Pseudomonarchen zu und sagt: ›Majesty, we are from Oakland!‹
Seine Frau macht einen ungelenken Hofknicks, die anderen Frauen machen ihr
das nach! Sie haben geglaubt, in Austria regieren noch die Habsburger, und die
Begrüßung durch die Herrscher gehöre als besondere Ehre für die Oakländer
zum Programm!« – »Net möglich, fast achtzig Jahr nach dem Ende der Mon-
archie«, wunderte sich Gitta. »Na ja, man erlebt schon einiges. Ich hab sie
jedenfalls nicht enttäuscht. Solln’s glauben, was sie wolln«, meinte Heidi
lakonisch. »Nur wann’s immer wieder Austria mit Australia verwechsln, werd i
wüid. I trag jetzt oft a Leiberl mit der Aufschrift ›There are no kangaroos in
Austria‹. Ob’s a derartige Subtilität verstehn, waas i net.«
Beim Verlassen des Roten Salons betrachteten wir noch das Bild der le-
gendären zigarrenrauchenden Anna Sacher, deren eisernes Regime im 19.
Jahrhundert den Ruhm des Hauses begründete. Wir gingen durch die kleine
Galerie, in der Unmengen signierter Fotos und Aquarelle eine glanzvolle Ver-
gangenheit dokumentierten. Prominente aller Gesellschaftsschichten, die
während der letzten 120 Jahre das »Sacher« beehrten, hatten voll Dankbarkeit
persönliche, oft schwülstige Widmungen verfasst. Darunter waren habsburgis-
che Erzherzöge, die oftmals in Damenbegleitung, diskret in den kleinen, inti-
men – inzwischen aufgelassenen – Separees gespeist hatten, Adelige aus allen
Teilen der österreichisch-ungarischen Monarchie, Politiker und weltberühmte
107/186

Künstler. Vom Portier höflich verabschiedet, traten wir beschwingt den Heim-
weg an – Mizzi und ich, im Hinblick auf die Noblesse des Hauses, voll Zurück-
haltung sogar ohne die üblichen Souvenirs. Nicht einmal einen der kleinen,
zierlichen Sacher-Aschenbecher nahmen wir mit!
Kurz darauf brachte ich Schwung und Unterhaltung in unsere Siedlung – ich
veranstaltete die von mir schon lange geplante, aber bislang von Poldi ver-
hinderte »Schneckenolympiade«. Die Regeln waren ganz einfach. Jeder Teil-
nehmer bekam einen Kübel, ließ die Größe seines Gartens beim Schriftführer
registrieren und begab sich nach dem Anpfiff in der Dämmerung auf Schneck-
enjagd. Ein weiterer Pfiff nach vierzig Minuten beendete die emsige Sam-
meltätigkeit. Stichproben des mit Gummihandschuhen ausgestatteten Ob-
manns unseres Siedlungsvereins überprüften die korrekten Angaben der
Teilnehmer.
Schließlich stand der Sieger fest. Es war Helmut Widder, der in einem Kopf-
an-Kopf-Rennen tatsächlich 187 der Undinger aufgelesen hatte. Ein kleines
Mädchen überreichte ihm den 1. Preis: eine große, blau schimmernde
Keramikschnecke und einen Gutschein für ein Essen in einem auf Wein-
bergschnecken spezialisierten Haubenlokal. Der Obmann schickte sich gerade
an, Herrn Widder zu gratulieren, als sich ein kleiner rothaariger Bursche
vordrängte: »Opfeschoin! Opfeschoin!« – »Sag, siehst net, dass du störst? Was
willst denn? Und red ordentlich!«, wies ihn der Gratulant brüsk zurecht. »Herr
Obmann, er hat in der Früh Apfelschalen g’streut!«, rang sich der Zurechtgew-
iesene in mühevollem Hochdeutsch ab. »Wer, was?« – »Na, der Herr Widder,
heut in der Früh. Ich hab’s g’sehn. Des fressen die Schnecken gern! Es lockt sie
an!« – »Oho, wenn das wahr ist, wäre das ja unlauterer Wettbewerb. Stimmt
das, Herr Widder?« Den Angesprochenen, der verlegen zu Boden blickte, ver-
riet die Schamesröte, die sein Gesicht verfärbte. Schließlich wurde er disqualif-
iziert, und Alfred Horvath – mit 175 gefangenen Schnecken an zweiter
Stelle – wurde zum Sieger gekürt.
Die kleine Panne mit Widder sorgte zwar für lautstarke Empörung, störte
aber unsere gute Laune nicht nachhaltig. Mit einem lustigen Umtrunk und dem
Verzehr vieler Schmalzbrote klang die »1. Bierhäusler Schneckenolympiade«
108/186

aus. Einem allgemeinen Wunsch zufolge wählten wir gleich das Personenko-
mitee zur Organisation der Rallye im darauffolgenden Jahr.
Als ich Poldi wenig später pflichtschuldigst in seiner »Rehab« aufsuchte, kam
er mir bereits wie ein seltsames Wesen von einem fremden Stern vor. In dem
befreienden Bewusstsein, ihn in dem muffig riechenden, da kaum gelüfteten
Heim mit Ostblockflair zurücklassen zu können, wo graugrüne Kunststoff-
böden die düsteren Gänge bedeckten, billige Waschmittel einen unangeneh-
men Geruch verbreiteten und harsche, ungeduldige Pfleger die Patienten her-
umscheuchten, ertrug ich geduldig seine mit weinerlicher Stimme vorgetragen-
en Tiraden. Das Billigste schien dem Heim zu genügen, denn wir saßen auf
klapprigen Sesseln an einem kleinen, wackeligen Tischchen in der für Besucher
reservierten, zugigen und nur schwach beleuchteten Ecke des Ganges. Ich
sehnte mich nach dem Sacher. »Wirklich schrecklich«, kommentierte ich,
automatisch und ohne richtig hinzuhören, Poldis Erzählungen, die Klagen über
seine Schmerzen und weitere arge Unbillen. Drohten dem Pechvogel doch ein
abermaliges Ruhigstellen seiner verletzten Gliedmaßen, roh ausgedrückt neue
Bandagen aus Gips. Der Heilungsprozess war, wie ihm die Ärzte geradezu vor-
wurfsvoll und bar jeder falschen Gefühlsduselei mitgeteilt hatten, gar nicht zu-
friedenstellend verlaufen.
109/186

Kapitel 10
10
Mein ruhiges, friedliches Bierhäusl-Arkadien mit Murli, der nicht nur auf-
blühte, sondern auch, da ich ihn nach Strich und Faden verwöhnte, weiter an
Gewicht zulegte, währte daher nicht allzu lange – Leopold kehrte samt neuen
blendend weißen Gipshüllen zurück. Weiter im Krankenstand und ans Haus
gefesselt, widmete er sich erneut voll Verbissenheit der Genealogie des nieder-
en mittelalterlichen Adels im Bezirk Amstetten. Mich interessierte das schon
längst nicht mehr.
Schwerer wog, dass mein Mann begann, Murli nachzustellen. Bald wurde es
klar, dass er sich an dem unschuldigen Tier, das er für seinen Unfall verant-
wortlich machte, zu rächen gedachte. Mit Argusaugen und tiefer Abscheu beo-
bachtete und verhinderte ich seine plumpen, als Unfälle getarnten Versuche
zur Beseitigung meines über alle Maßen geliebten Katers. Einmal wollte er ihn
doch tatsächlich in einem unbeobachteten Moment nach Gogol’scher Manier
mit seiner Krücke in das Biotop unseres kleinen Gartens stoßen, ein anderes
Mal trat er mit seinem Gipsbein nach ihm, wobei er ihn nur um Haaresbreite
verfehlte. Dies in der bitterbösen Absicht, ihm das Rückgrat zu brechen. Die
Mordattacken blieben nur dank meiner ständigen Wachsamkeit erfolglos. Wir
diskutierten erbittert, Poldi leugnete alles. Mit unerhörter Frechheit warf er
mir krankhafte Hysterie und übertriebene Einbildungskraft vor.
Daraufhin wechselten wir tagelang kein einziges Wort. Schließlich nahm
Poldi Vernunft an und brachte eine halbherzige Entschuldigung vor. Es täte
ihm leid, er wäre zu weit gegangen. Sein Einlenken führte ich auf meinen be-
vorstehenden 50. Geburtstag zurück. Geheimnisvoll tuschelte er mit Mizzi,
telefonierte er mit meiner Mutter und meiner Schwiegermutter. An dem Tag,
an dem ich ein halbes Jahrhundert vollendete, war mir nicht fröhlich zumute.
Visionen von Alter und Tod stiegen in mir auf: Ab heute stehe ich im sechsten

Lebensjahrzehnt. Wie viel Zeit bleibt mir noch? Werde ich bald sterben? Es ist
schrecklich!
Die Worte meiner Mutter klangen mir im Ohr: »Du wirst seh’n, was da auf
dich zukommt. Alt zu sein ist ein Fulltime-Job.« Ich wollte nur allein sein, aber
Poldi überredete mich am Abend, ganz gegen meinen Willen, zu einem
Gasthausbesuch. Er wolle doch mit mir beisammensitzen und ein wenig feiern.
Zu meinem Erstaunen führte uns der Wirt vom »Schwarzen Bären« in sein für
größere Gesellschaften reserviertes Extrazimmer.
Die Überraschung war perfekt! Lautes Hallo begrüßte mich. Da saßen sie
alle: meine Eltern und Schwiegereltern, Mizzi und ihr Mann, unser »Sir«, zwei
Kollegen aus der Bank, auch die dicken Pollatscheks grinsten mir entgegen. Ich
dankte Poldi, freute mich, vergaß mein Alter, auch meine ungewaschenen
Haare, und nahm an der festlich geschmückten Tafel Platz. Ich bekam wunder-
schöne Blumen und vielversprechend aussehende Päckchen, die ich auf einem
kleinen Beistelltischchen neben mir deponierte.
Poldi hielt mich vom Auspacken zurück. »Wart noch ein bisschen – ich
möchte ein paar Worte sagen!« Er schlug mit seiner Gabel gegen ein Weinglas.
»Ich habe ein Gedicht von Hermann Hesse gefunden und es speziell für dich
adaptiert.« Die Runde blickte auf. Sie erwartete eine scherzhafte Rede über
ewige Jugend, blendendes Aussehen oder Ähnliches, wie man sie eben zu
diesem Anlass zu halten pflegt. Mein lieber Mann hüstelte, dann begann er
langsam und theatralisch: »Die Frau von fünfzig Jahren. Von der Wiege bis zur
Bahre sind es fünfzig Jahre. Dann beginnt der Tod. Man vertrottelt, man ver-
sauert, man verwahrlost, man verbauert und zum Teufel gehen die Haare.
Auch die Zähne gehen flöten. Und statt dass sie mit Entzücken …« Weiter kam
mein unglückseliges Gespons nicht – Protestschreie setzten seiner Rezitation
ein abruptes Ende. »Ja, is er denn vollkommen verblödet? So eine Frechheit!«,
rief mein Vater. »Aber Leopold! Was meinst du denn?«, tadelte meine Mutter
sanft. »Ich hab’s immer g’sagt, er spinnt, und es wird ärger«, kommentierte
meine Schwiegermutter emotionslos. Alle anderen schüttelten missbilligend
den Kopf. Nur »Sir« meinte lachend: »Wirklich nicht schlecht. Man kann dem
Gedicht eine gewisse Originalität nicht absprechen!«
111/186

Trauer stieg in mir auf, und ich begann still zu weinen. »Findet ihr es denn
nicht lustig? Es ist doch ein literarischer Scherz!«, fragte Poldi verwirrt. »Das
tut mir leid, das wollte ich nicht.« – »Halt endlich den Mund«, fiel ihm meine
Schwiegermutter ins Wort, als er Atem holte, um zu weiteren Erklärungen an-
zusetzen. Beim anschließenden Essen herrschte Grabesstille, früh gingen wir
nach Hause.
Bald sah ich, wie Poldis Blicke erneut voll Bösartigkeit auf unserem Kater ruht-
en. Mir schwante nichts Gutes. Schließlich reduzierte sich die Situation für
mich auf eine simple Frage: »Poldi oder Murli?« Eine winzige Kleinigkeit
entschied das Dilemma und brachte das Fass des Leopold zum Überlaufen.
An einem späten Nachmittag hinkte mein Mann nach einem kurzen Spazier-
gang – der Arzt hatte ihm Bewegung verordnet – heim in unsere Siedlung. Vi-
elleicht gedachte er der niederen mittelalterlichen Adelsgeschlechter, vielleicht
bewunderte er auch die Weihnachtsdekoration in unserer Gasse, die in diesem
Jahr besonders üppig ausgefallen war, auf jeden Fall tappte Leopold in die vom
Schnee nur dürftig bedeckten Exkremente der Hunde, die sich vor unserem
Haus in großer Zahl erleichterten. Selbst ihn musste der bestialische Geruch an
seinen Sohlen gestört haben, denn er begab sich schuldbewusst in die Küche,
wo er seine Schuhe sorgfältig über dem sauberen, bereits trockenen Geschirr
im Spülbecken putzte. Ermattet von der ungewohnten physischen An-
strengung, gönnte er sich dann zur Stärkung ein Stamperl Eierlikör, das er,
mühsam in der linken Hand balancierend, in den ersten Stock trug, wobei es
aus dem randvoll gefüllten Glas auf jede einzelne Stufe der mit einem Teppich-
boden bedeckten Stiege tropfte.
»Es ist genug«, dachte ich mir, als ich nach einem anstrengenden Arbeitstag,
ermüdet und mit Einkäufen bepackt, nach Hause kam und die stinkende Bes-
cherung in der Küche sowie die klebrigen Spuren im Stiegenhaus sah, an denen
ein leicht betrunkener, schwankender Murli mit Wonne herumschleckte,
während sich ihm ein lautes, behagliches Schnurren entrang. »Es ist genug! So
kann es nicht weitergehen«, entrang sich mir, als ich den Stapel von Tellern
nochmals säuberte. Während ich meine Hände in die Sodalauge
112/186
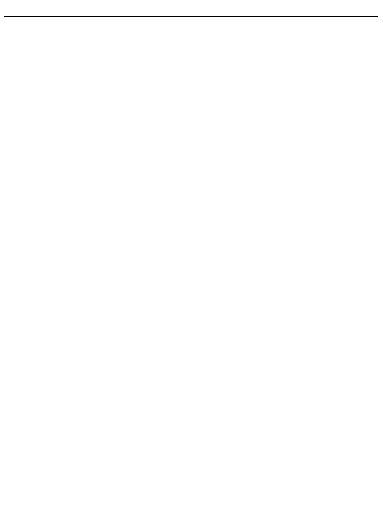
tauchte – herkömmliche Geschirrspülmittel erlaubte mein Gatte nicht –,
schimpfte ich vor mich hin: »Fix Teufel noch einmal, warum können wir nicht,
wie alle anderen Leute auch, einen Geschirrspüler kaufen?« Poldis Argumente,
dass derartige Küchenhilfen nicht nur Stromfresser, sondern aufgrund der
giftigen Spülmittel umweltschädigend seien, fand ich lächerlich – eine absurde
Marotte, der ich mich nur unwillig unterwarf und die mir den Spott meiner
Freundinnen eintrug, die über glänzend sauberes Geschirr verfügten. Beim
Schrubben des Teppichs auf den Treppenstufen machten sich ketzerische
Überlegungen in mir breit: »Ist nicht mein Ehegespons schuld an meiner Mis-
ere? Wäre ich nicht ohne ihn besser dran? Könnte ich dann nicht ein frohes,
heiteres und freies Leben führen? Und dieses nicht aus zweiter, dritter Hand
aus Illustrierten beziehen? Für Kinder ist es leider zu spät, um aufregende
Männer kennenzulernen, nicht. Mit 50 tatsächlichen und 44 eingestandenen
Jahren ist man heutzutage doch nicht alt.«
Lange drehte ich meine Gedanken hin und her, schmiedete Pläne und beo-
bachtete Leopold, der mir täglich widerlicher wurde, genau. Dann traf ich
sorgfältige Maßnahmen, wobei ich mit Methode vorging.
Dabei erwies es sich als überaus opportun, ja, wie von der gütigen Vorherse-
hung bestimmt, dass mein Mann immer eindringlicher klagte: »Baden, ich
möchte endlich baden!« Das leuchtete mir ein, denn seit seinem Unfall hatte er
nur oberflächliche Waschungen erfahren. »Merkst du nicht, wie ich stinke? Mir
graust vor mir selbst.« Schließlich gab ich Poldis Drängen nach. Schon lange
hatte er, der warme Vollbäder sehr liebte und sich gern in unserer kleinen
Wanne räkelte, diesen Luxus entbehren müssen. Als ich ihn zu wiederholten
Malen, seine Verbände zum Schutz gegen Feuchtigkeit notdürftig in
Plastiksäcke gehüllt, umständlich in die Dusche steigen sah, wo er, an die
Brause geklammert, nur labilen Halt fand, heuchelte ich Mitleid und machte
einen konstruktiven Vorschlag: »Wenn du dich seitwärts an den Wannenrand
setzt, dich in das Wasser gleiten lässt und sowohl den Gips am Bein als auch
den am Arm hinausstreckst, damit nichts nass wird, geht es schon. Pass nur
auf, dass du nicht ausrutschst!« Ich assistierte gerne, ließ häufig warmes
113/186

Wasser nachlaufen und beobachtete, wie sich mein Mann trotz der notwendi-
gen Verrenkungen vollkommen entspannte und vor Behagen seufzte.
Von da an nahm Poldi mit meiner Hilfe täglich wohltuende Bäder, wobei er ak-
robatische Fähigkeiten – man könnte auch sagen, die Geschicklichkeit eines
Affen – entwickelte, die ich ihm als dicken Menschen nicht zugetraut hätte.
Sein fetter, von dünnen Beinchen getragener Körper, der kugelförmig gewölbte
Bauch, die mageren Schultern und seine schütteren, schweißnassen, zwecks
Verbergung einer sich rapide vergrößernden Glatze kunstvoll auf dem Kopf
drapierten recht langen Haare boten keinen schönen Anblick. Die kleine Narbe
an seiner Stirn, die er sich beim ungelenken Stutzen seiner buschigen Augen-
brauen zugefügt hatte, leuchtete tiefrot. »Ah, das tut gut! Wasser, warmes
Wasser!«, seufzte der arme Hässliche, bevor ich ihn mit größter Anstrengung
sozusagen wieder an Land zog. Eine Prozedur, die mir bald unerträgliche
Kreuzschmerzen eintrug.
Nachdem dieses Ritual schon einige Zeit stattfand, besorgte ich mir einen
»Ratgeber für den Todesfall. Servicefaden für schwierige Stunden«, den die im
Eigentum der Gemeinde stehende »Bestattung Wien« auf Verlangen gratis
zusandte. Zu seinem großen Bedauern hatte das Unternehmen aufgrund eines
Gesetzes über unlauteren Wettbewerb das Monopol auf die Verstorbenen ver-
loren, befand sich seither in harter Konkurrenz mit privaten, überaus agilen In-
stituten wie »Charon«, »Pax«, »Vita Eterna« oder »Zum Licht« und suchte mit
allen Mitteln den rapiden Kundenschwund aufzuhalten.
Zu diesem Zweck hatte man auch einen Gag der besonderen Art ersonnen,
auf den der Prospekt mit der Bitte um Vormerkung des Termins hinwies. Es
handelte sich um die einmal im Jahr von der städtischen Sargfabrik veranstal-
teten makabren »Nacht im Jenseits«. Alle potenziellen Kunden – und wer
zählte nicht dazu? – waren herzlich eingeladen. Man konnte die Werkstätten
besichtigen, die angepriesenen Erzeugnisse überprüfen: »Probieren Sie doch,
wie man sich in einem Sarg fühlt!« Die Veranstaltung fand, wie ich las, stets
großen Zuspruch. Alles war da für die den echten Wienern so wichtige »schöne
Leich«. Hunderte Ausstellungsstücke dokumentierten die Geschichte der
Bestattung, der einstigen »Pompfüneberer«. Man konnte einen mehrfach
114/186

verwendbaren »Sparsarg« bestaunen, den Rettungswecker für Scheintote aus-
probieren und in einem praktischen »Sitzsarg« Platz nehmen. Für alkoholische
Getränke war gesorgt. Ihr reichlicher Konsum sollte die nüchterne Atmosphäre
der Industriehallen auflockern und etwaige trübe Gedanken an die unvermeid-
liche Zukunft verscheuchen. Zu fortgeschrittener Stunde forderte man zum
»Probeliegen« auf. Es dauerte eine Weile, bis die ersten Mutigen ihre Scheu
überwanden. Dann jedoch bestiegen sie die Särge, wo sie sich unter allge-
meinem Gelächter der Zuschauer räkelten, die Hände falteten, fromme Tote
mimten und dem Treiben den burlesken Charakter eines Volksfestes verliehen.
Sozusagen ein »Jedermann« für kleine Leute. Nur ein beamtetes Gehirn kom-
mt auf eine derartig geschmacklose Idee!, dachte ich. Wie kann man das lustig
finden? Der bloße Gedanke, mit einem Glas Wein durch die Reihen der aufges-
tellten Särge zu gehen, jagte mir kalte Schauer über den Rücken. Selbst an ein-
en traditionellen »Leichenschmaus« war gedacht. Um 20 Uhr sprach ein Geist-
licher das Tischgebet, dann begann ein Gelage, das die ganze Nacht anhielt.
Abgesehen von der Einladung zu dem in meinen Augen widerlichen Spek-
takel enthielt der Ratgeber jedoch viele wichtige Informationen über die Ab-
wicklung eines Todesfalls. Die Menge der vom Dahingeschiedenen geforderten
Dokumente verblüffte mich. Wozu musste denn ein Toter seine Geburt beweis-
en? Staatsbürgerschafts- und Heiratsurkunde, Meldezettel und – ein öster-
reichisches Phänomen – bei Akademikern den Nachweis über die Berechtigung
zur Führung des akademischen Grads: Der Weg ins Jenseits war mit Identität-
spapieren gepflastert. Gab es vielleicht in logischer Fortsetzung des irdischen
Bürokrams ein extraterrestrisches Abkommen, das den Eintritt in Himmel,
Hölle oder Fegefeuer genau regelte? »Greifen Sie auf die Dokumentenmappe
zurück«, lautete ein guter Ratschlag. Der sicherlich nützliche Hinweis »Sie
können die Kleider des Verstorbenen (außer Schuhe!) in der Kundenservices-
telle der Bestattung Wien während der Dienstzeiten abgeben!« gab mir zu den-
ken, blieb mir jedoch unverständlich. Glaubten die Beamten, dass man im
Himmel zwar bekleidet, aber ohne Schuhe umherging? Ich unterließ es, mein-
en Mann zu fragen.
115/186

Kapitel 11
11
Genau nach Plan kochte ich dem Leopold an einem der folgenden Samstage
sein Lieblingsessen, Marillenknödel mit Zwetschkenröster. Danach schenkte er
sich selbst, zur besseren Verdauung, flott einige Stamperl Schnaps ein. Dazu
benötigte es keiner Ermutigung von meiner Seite, denn seine alk1oholfreien
Zeiten gehörten schon längst der Vergangenheit an. Seit dem Unfall griff Poldi
häufig und regelmäßig zur Flasche, wobei sich Murli – zu meinem großen
Missfallen – an seine Seite schmiegte, ihn aufmerksam, ja fast gierig be-
trachtete und sich mit der Zunge über das Mäulchen schleckte. Seit sich ihm
mit der unerwarteten Kostprobe von Eierlikör auf dem Teppich der Treppe
eine neue, aufregende Genusswelt erschlossen hatte, war mein sorgsam gep-
flegter und erzogener Kater auf den Geschmack gekommen. Nicht ohne Grund
argwöhnte ich, dass Poldi voll Bosheit diese kätzische Unart förderte, indem er
den Inhalt von Murlis Milchschälchen heimlich mit süßem Alkohol versetzte.
Er hatte das unschuldige Tier zu einem Lasterleben verführt und zu seinem
Kumpan erkoren – zwei Säufer in einem Haus!
Manchmal ertappte ich den Kater, wie er sich, offenkundig betrunken, unter
Poldis heiterem Lachen laut grollend und mit komisch steifem Gang einem als
Feind erkannten Sessel näherte, den er mit seinen Krallen wild attackierte.
Oder er lief ohne erkennbaren Anlass in rapider Folge ein paar Runden im Kre-
is, um dann, lang ausgestreckt und wohlig schnarchend, stundenlang mitten
auf dem Wohnzimmerteppich seinen Rausch auszuschlafen. Beim Anblick der
beiden Betrunkenen stiegen Vorahnungen in mir hoch. Unwillkürlich sah ich
Parallelen zu jenem berühmten Kater Arthur, der sich in einem amerikanis-
chen Seniorenheim durch seinen fast hellseherischen Instinkt großen Ruhm er-
worben hatte. Das Tier ahnte nämlich, wenn die letzte Stunde eines Senioren
nahte, schloss sich dem Todgeweihten in rührender Weise an, legte sich zu ihm

ins Bett und wich ihm bis zu seinem Ende nicht mehr von der Seite. Diese
traurige Geschichte kam mir jedes Mal in den Sinn, wenn ich Mann und
Haustier in gemeinsamer Eintracht durchs Haus wanken sah.
Nachdem Poldi an besagtem Samstag, wie er es sich angewöhnt hatte, einen
ausgiebigen Schlaftrunk zu sich genommen hatte, bereitete ich ihm sein ge-
wohntes abendliches Bad, wobei ich zur Steigerung des Wohlbehagens
duftende, ölige Badeessenzen beifügte. »Was soll denn das?«, knurrte Poldi,
während er umständlich in das schäumende, glitschige Wasser hineinrutschte.
»Du sollst es doch genießen, es wird dir guttun«, meinte ich geheimnisvoll.
Und dann war es nur ein Kinderspiel! Als es vorbei war, richtete ich mich,
genau wie ich es in meinem Romanfragment beschrieben und vorhergesehen
hatte, erleichtert auf.
Die Anspannung machte sich trotzdem bemerkbar, denn ein stummes, leicht
hysterisches Lachen erschütterte meinen Körper. Ein wenig nass geworden,
trocknete ich mir sorgfältig die Hände, um mich dann im Spiegel des Badezim-
mers zu betrachten. Hinterließ die Tat vielleicht Spuren, verräterische Änder-
ungen in Ausdruck und Mimik, wie man das immer behauptete? Nichts davon
war der Fall. Ein bleiches Gesicht schaute mir entgegen. Meine Augen blinzel-
ten, wie es mir vorkam, froh. Ich fühlte mich gut und reizvoll zugleich.
Mich seitwärts drehend, nutzte ich die Gelegenheit zur kritischen Betrach-
tung meiner Figur. Ich war schlanker geworden! Die abstoßenden Fettpolster
um die Hüfte waren tatsächlich der letzten strengen Krautsuppenkur zum Op-
fer gefallen. Eine Mühe, an die ich mit Stolz zurückdachte! Fünf Tage nichts
anderes als dünne Süppchen und Wasser. Doch alles war gut verlaufen, und
wie nach der Affäre mit dem unglücklichen Dr. Wegner durchströmte mich
auch diesmal ein angenehm prickelndes Wohlgefühl von Kopf bis Fuß.
Alles war nach Plan und genau so geschehen, wie ich es in dem Buch über
die Badewannenmorde gelesen hatte. Dort stand nämlich, für jedermann leicht
begreiflich: Der Mörder – oder wie in diesem Fall ich, die Mörderin – nähert
sich unverdächtig dem Opfer, das sich arglos in der Badewanne räkelt. Lässt vi-
elleicht etwas warmes Wasser ein. Spricht freundliche Worte, erzählt Alltäg-
liches, scherzt ein wenig. Um dann dem ahnungslos das Vergnügen eines
117/186

Vollbades Genießenden die Füße anzuheben und diese ganz plötzlich über den
unteren Rand der Wanne hinwegzuziehen. Dadurch gleitet der Oberkörper des
Opfers zwangsläufig unter Wasser, dessen jähes Eindringen in Nase und Mund
einen Schock mit sofortigem Bewusstseinsverlust verursacht. Gegenwehr ist, so
unglaublich das auch klingt, praktisch ausgeschlossen. Ohne Anzeichen von
Gewaltanwendung erleidet der Attackierte innerhalb von Minuten den Erstick-
ungstod. Gerichtsmedizinische Untersuchungen bestätigten diese Art des
Ertrinkens, besser gesagt des Ertränkens. Wie ich bezeugen konnte, stimmte
das alles mit meiner eigenen Erfahrung überein. Eine leichte Prozedur, die
man nur jedermann empfehlen kann!
Allerdings hatte ich den wissenschaftlichen Fortschritt seit 1915 berücksichtigt
und auch den jüngsten Streit um den Weiterbestand der Gerichtsmedizin
genauestens verfolgt. »Es ist Verschwendung, in Österreich fünf derartige In-
stitute zu unterhalten«, schrieben die Zeitungen. Und der Rechnungshof der
Republik hatte bei einer Finanzkontrolle bemängelt: »Der Bauzustand der
Wiener Gerichtsmedizin ist skandalös.« In Wien trug man der Kritik Rech-
nung, senkte aus Kostengründen drastisch die Zahl der – bei Verdacht auf Ver-
brechen – behördlich angeordneten Obduktionen, schloss das uralte, aus dem
18. Jahrhundert stammende, baufällige Gerichtsmedizinische Institut, in
dem – wie man munkelte – des Öfteren Ratten gesichtet worden waren, und
verteilte die Leichen auf vier dafür nur schlecht ausgerüstete und infolge der
Zwangsbeglückung nur wenig kooperative Spitäler.
Die Empörung der Mediziner blieb nicht aus: »Früher gab es 750 Obduk-
tionen pro Halbjahr, jetzt sind es nur mehr 60! So lässt sich keine vernünftige
Todesursachenstatistik mehr erstellen!« Dies hatte mir, wie vermutlich allen,
die gewisse Absichten hegten, sehr lieblich in den Ohren geklungen, war aber
in der Öffentlichkeit vollkommen ungehört verhallt, denn die Mehrzahl der
Bürger interessierte dieses Thema ja nicht.
Obwohl man also in entgegenkommender Weise das Risiko der Feststellung
der genauen Todesursache auf ein Minimum reduziert hatte, empfahl es sich
trotzdem, jeden Anschein eines Verbrechens tunlichst zu vermeiden. Doch wer
sollte beim Anblick eines friedlichen toten Gipsträgers, eines Säufers, dem der
118/186

Alkohol zum Verhängnis geworden war, Verdacht schöpfen? Wer hätte über
jene riesigen Kräfte verfügt, die nötig waren, um die fast hundert Kilogramm
des Dr. Leopold E. unter Wasser zu drücken? Und warum sollte dies jemand
dem harmlosen Historiker antun wollen? Wer hätte dazu ein Motiv besessen?
O nein, der Arme war nach zu viel Schnapsgenuss einfach mit seinem un-
versehrten Bein ausgerutscht, hatte das Gleichgewicht in dem mit glitschigem
Badeöl angereicherten Wasser verloren, sich vielleicht den Kopf leicht angesch-
lagen und war schließlich, benommen durch seinen Rausch, im »Dusel« hilflos
im Wasser ertrunken. Ein schöner Tod. Das halb volle Glas neben der Schnaps-
flasche auf dem Boden des Badezimmers sprach eine mehr als deutliche
Sprache!
Ermittlungen im Meidlinger Unfallkrankenhaus konnten den Eindruck nur
verstärken. Enthielt doch die ausführliche Akte des Dr. E. die kleine, aber
wichtige Notiz, dass der Patient schon einmal nach einem Alkoholexzess ver-
unglückt und in volltrunkenem Zustand in das Spital eingeliefert worden war.
Außerdem rechnete ich damit, dass die überlasteten Krankenhäuser nicht
gerade am Sonntag nach zeitaufwändigen Obduktionen gierten. Sehr intelli-
gente Überlegungen, nicht wahr? Und dies, obwohl mein seliger Mann des
Öfteren beleidigend zu mir gesagt hatte: »Dein Gehirn ist quasi unbenutzt!«
Im Anschluss an die unangenehmen, aber unausweichlichen Ereignisse zog ich
mich an und verließ das Haus, um Mizzi, wie ich es ihr einige Tage zuvor ver-
sprochen hatte, Kochrezepte und Zeitschriften vorbeizubringen. »Dank dir«,
meinte Mizzi. »Du bist a Schatz. Aber a bisserl blass bist. Es war doch net so
dringend. Hätt je net heut sein müssen.«
Damit irrte sie natürlich. Ich blieb nur kurz, ging bald nach Hause und
bereitete mich zum Schlafengehen vor.
Meine Tat hatte sich als einfach entpuppt – sie ließ mich aber trotzdem sehr
müde zurück. Ich beschloss, mich hinzulegen und alles Weitere auf den näch-
sten Tag zu verschieben. Ein warmes Bad wäre gut gewesen, das konnte ich mir
aber leider nicht gönnen – die Wanne war besetzt. Unter der Dusche genoss ich
das an meinem Körper entlangströmende heiße Wasser, dann cremte ich mich
119/186

sorgfältig von Kopf bis Fuß ein. Das war wichtig, denn meine allmählich
trockener werdende Haut bereitete mir großen Kummer.
Nur kurz ließ ich mich auf dem geflochtenen Hocker des Badezimmers
nieder. Dessen gediegene moderne Einrichtung hatte zwar viel Geld gekostet,
erfüllte mich aber mit großem Stolz. Keine altmodischen Fliesen, sondern
holzverkleidete rustikale Wände, der Waschtisch mit dem eingelassenen Beck-
en in beige-rosa Kunststoff. Und vor allem die nicht sehr große Ein-
bauwanne – die in der Fachliteratur beschriebene ideale Voraussetzung für
einen
sogenannten
»Badewannenmord«.
Weiße,
mit
chinesischen
Schriftzeichen – was mochten sie wohl bedeuten? – bedruckte originelle Jal-
ousien filterten das grelle, durch das große Fenster eindringende Licht in
überaus angenehmer Weise. Das gedämpfte Ambiente, der milde Schein der
raffiniert angebrachten Beleuchtung wirkte sehr schmeichelnd auf mich und
ließ vor allem meine, wie ich fand, wenigen Falten ganz verschwinden.
Die nur angelehnte Tür öffnete sich ohne Laut. Murli schlich herein, hüpfte
auf die Badewanne, wie er es gern zu tun pflegte, ging mit weichen Pfoten den
breiten Rand entlang und starrte in das Wasser mit dem ruhigen, stillen, unge-
wohnten Objekt. Niemand lockte und streichelte heute den Kater, ließ die
Finger an der nassen Wannenkante entlanggleiten, um ihn zum Spielen zu ani-
mieren. Als sich Murli voll Neugier anschickte, die leblose Masse zu besteigen,
nahm ich ihn mit sanfter Hand auf, sprach beruhigend auf ihn ein und be-
förderte ihn schließlich zart ins Vorzimmer. Ich liebte ja Murli, wie überhaupt
Tiere, allen voran Katzen, ganz ungemein.
Ich holte Agatha Christies »Mord im Orientexpress« hervor, ein Buch, das
ich fast auswendig kannte, wegen seiner verschlungenen, voll mathematischer
Akribie konstruierten Handlung überaus bewunderte und immer wieder aufs
Neue las – ohne Lektüre konnte ich noch nie einschlafen, egal, wie spät es war.
Das Buch unter dem Arm zog ich mich in das Doppelbett meines behaglichen
Schlafzimmers zurück. Nach getaner Arbeit war gut ruhen. Niemand würde
mich durch Keuchen und Schnarchen in meiner Nachtruhe stören, und morgen
war auch noch ein Tag!
120/186

Die Nacht verlief angenehm, denn in dieser Nacht der Nächte, die ich mir oft in
langen Fantasien vorgestellt hatte, blieb ich von allen unangenehmen Träumen
verschont. Ich schlief ruhig, den Kater an meiner Seite, sein Kopf lag in der
Beuge meines Armes. Sein sanftes, angenehmes Schnurren begleitete mich in
den Schlaf.
Erfrischt wachte ich auf. Ausgeruht und hungrig setzte ich mich an den
Küchentisch und drehte das Radio an. Die Welt präsentierte sich voll schreck-
licher Gewalttaten. »Ist es wahr, dass die Menschen zunehmend verrohen?«,
fragte ich mich beim Frühstück. Diese meine Lieblingsmahlzeit zelebrierte ich
ausgiebig. Mit hübschem Gedeck, schönem Designer-Geschirr, einem
Blümchen in einer Glasvase. Orangensaft, ein weiches Ei, köstliche fünffach
gekerbte Semmeln – wir in Wien nennen sie »Kaisersemmeln« – und echter,
starker Meinl-Kaffee belebten meine Sinne. Während ich mir Butter auf das
knusprig geblähte Gebäck strich, rekapitulierte ich schon im Geiste den Ablauf
des kommenden Tages, ging noch einmal voll Akribie die durchdachte Planung
durch.
Seufzend stand ich auf, gerne wäre ich noch ein wenig länger gesessen. Aber
die Arbeit ging natürlich vor. Beim gründlichen Putzen der Zähne, die ich wie
stets ordentlich und lange säuberte, warf ich einen verstohlenen Blick auf die
Leiche meines einst – wenn auch nur wenig – geliebten, jetzt aber toten Leo-
pold. Nichts hatte sich geändert – alles beim Alten. Ich verschüttete noch eine
Portion Schnaps auf dem Boden.
Dann trug ich sorgfältig grünen Lidschatten auf, verwischte die Konturen or-
dentlich und erhielt das gewünschte bleiche Aussehen. Etwas »Cleaner for dry
Skin« nicht auf die Haut, sondern in die Augen geschmiert, ließ diese – auch
das hatte ich ausprobiert – in erfreulicher Weise rot anschwellen. Den Bade-
mantel enger gezurrt, zum Handy gegriffen, und Kapitel zwei meines raffinier-
ten, jedoch einfachen Komplotts konnte beginnen.
Einfach! lautete die Devise. Einfach und plausibel! Diese Lehre hatte ich aus
den Hunderten von Kriminalromanen gezogen, die ich im Laufe der Zeit ge-
lesen habe. Sosehr ich Agatha Christie und viele andere Kriminalautoren auch
liebte: Sie neigten zu absurd komplizierten Morden, deren Gelingen an einem
seidenen Faden und vielen unvorhersehbaren Faktoren hing, mit einem
121/186

Zeitplan, bei dem es um Sekunden ging, mit verschlungenen Zusammenhän-
gen, Alibis und Zeugen. Und dann musste man die Leiche vielleicht auch noch
in einen Teppich rollen, in kleine Teile zersägen, auf jeden Fall aber heimlich
im Schutz der Dunkelheit fortschaffen, verstecken oder gar im Wald begraben.
Welche schweißtreibende Mühsal, in einem von Wurzeln durchzogenen harten
Boden des Nachts ein Grab zu schaufeln! Schaurig! Patricia Highsmith hatte
dies in ihren Büchern genau beschrieben. Ich besaß nicht die Kräfte und die
Nerven ihres talentierten Helden Tom Ripley. Dazu war ich wirklich nicht im-
stande! Oder im Keller verscharren? Wer möchte schon mit einer Leiche im
Haus leben?
Nein, sinnierte ich vor mich hin, während ich meine Haare zuerst frisierte
und dann, dem Anlass entsprechend, etwas zerwühlte, nein, wie käme ich denn
dazu? So viel Arbeit, die einem doch von den zuständigen staatlichen und dafür
bestens ausgerüsteten Institutionen abgenommen werden konnte. Wofür
zahlte man schließlich seine Steuern? Konnte man bei über dreißigjähriger
Berufstätigkeit, wie in meinem Fall, denn gar keine Ansprüche an Vater Staat
stellen, keine Hilfe erwarten? Andere gingen schließlich jedes Jahr auf Kosten
der Allgemeinheit auf Kur.
Ich wählte den ärztlichen Notruf, verharrte eine Zeit lang in der Warteschleife,
bis sich eine nicht besonders freundliche Stimme meldete. »Er rührt sich nicht,
was soll ich tun?«, schrie ich bewusst konfus. »Rührt sich nicht, bitte helfen Sie
mir«, japste ich atemlos ins Telefon. »Schnell, schnell!« Ich brach in unkon-
trolliertes hysterisches Schluchzen aus.
»Name, Adresse, worum geht es? Wir kommen.«
Und sie kamen. Wenig später läutete es an der Sprechanlage, ich öffnete.
Zwei junge, fesche, von einem Arzt begleitete Sanitäter eilten herbei. Mit letzter
Kraft »da, da« stammelnd, wies ich den Weg ins Bad. Schon packten mich Sch-
windel und Übelkeit. Das war auch kein Wunder. Hatte ich doch nach dem
Frühstück in kluger, vorausschauender Weise mehrere starke und – wie es auf
der Packung hieß – die Verkehrstüchtigkeit beeinträchtigende Beruhigung-
spillen geschluckt. »Warum hat er das nur getan?«, fragte ich verzweifelt den
Notarzt, der sich über die Leiche beugte, wobei ich keine Antwort erwartete.
122/186

»Warum? Ich hab ihm gesagt, ohne meine Hilfe kannst du nicht baden. Das ge-
ht einfach nicht. Allein geht das nicht. So ein Unglück! Und warum hat er im-
mer gar so viel getrunken?«
Nachdem ich dermaßen geschickt das Terrain vorbereitet hatte, wankte ich
kreidebleich und einer Ohnmacht nahe aus dem Bad, um mich, nicht ohne zu-
vor noch Mizzi zu verständigen, auf die Couch im verdunkelten Wohnzimmer
zu legen. Unterdessen hatte man, wie mir der Notarzt später mit einem Anflug
von Bedauern erklärte, mit der Überprüfung von Poldis Vitalfunktionen be-
gonnen. Reine Routine vonseiten der erfahrenen Mannschaft des Notdienstes,
denn wie klar ersichtlich war, gab es natürlich keine mehr: Der Mann war tot!
Vielmehr zeigten sich bereits Anzeichen von Leichenstarre.
»Pfui Teufel, wie’s da nach Fusel stinkt. Der muss schon gestern Abend in
seinem Suff ersoffen sein«, meinte der Notarzt, der mich außer Hörweite wäh-
nte, emotionslos zu den Sanitätern. Es freute mich zu hören, dass er der von
mir ausgelegten Fährte folgte. »Des wor a Unfall. Hat Pech g’habt, der arme
Teufel. Mit an Gips und an Rausch badet man halt net! Rufts an!« Damit
meinte er, wie ich von dem Ratgeber der städtischen Bestattung her wusste,
seinen Kollegen, den Totenbeschauarzt. Ich wusste auch genau, wie es weit-
ergehen würde und dass zwei Möglichkeiten bestanden: Der Beschauarzt gibt
die Leiche frei, die Bestattung holt den Verstorbenen ab und bereitet ihn für die
Beerdigung vor. Wird die Leiche nicht freigegeben, dann, ja dann, kommt der
Tote zur Untersuchung in die Gerichtsmedizin. Naturgemäß gefiel mir die
zweite Variante erheblich weniger als die erste. Dass sie nur nicht die Toten-
ruhe stören!, hoffte ich im Stillen.
Der Totenbeschauer, ein gemütlicher ältlicher Arzt mit rundem, leicht ger-
ötetem Gesicht, der im Dienste der Gemeinde Wien alle Aussichten auf Karri-
ere und Erfolg gegen ein bequemes Leben mit sicherem Gehalt und Pensions-
berechtigung eingetauscht hatte, startete eine flüchtige, oberflächliche
Routineuntersuchung der Leiche auf Spuren von Gewaltanwendung und
Blutergüssen. Er ließ auch die Fingernägel nicht außer Acht. Du wirst nichts
finden, beruhigte ich mich, als kurze Panik in mir aufstieg, obwohl von Fremd-
verschulden oder gar Mord nie die Rede war. »Ja, wo warn denn Sie gestern
Abend bei dem Unglück?«, fragte er mich schließlich. Ich nickte tapfer und gab
123/186

zu Protokoll, was ich mir genau zurechtgelegt hatte: »Ich habe an dem frag-
lichen Abend meine Freundin Mizzi, das heißt Frau Eva Maria Horvath, in Hi-
etzing in der Auhofstraße 36 besucht. Als ich gegen zehn Uhr abends
heimgekommen bin, war es im Erdgeschoss bereits ruhig und finster. Ich habe
angenommen, dass mein Mann, der seit seinem schweren Unfall im Wohnzim-
mer schläft, bereits zu Bett gegangen war. Ich wollte ihn nicht stören, duschte
kurz in dem kleinen Bad im ersten Stock und hab mich dann hingelegt. Am
Morgen, ja am Morgen die grässliche Entdeckung! Ich habe versucht, ihn aus
dem Wasser zu ziehen, aber er war kalt, ganz kalt!« – »In Ihrer Abwesenheit
hätte jemand ins Haus eindringen können. Haben’s Spuren von Einbrechern
bemerkt?« – »Nein, nein, gar nichts. Alles war wie immer.«
Hier endete mein Bericht in hysterischem Schluchzen. Mit meinem Zusam-
menbruch gewann ich, wie ich fühlte, das Mitleid des beamteten Arztes. »Was
für ein schrecklicher, ungewöhnlicher Unfall!« – »Die arme Frau, was muss sie
unter dem Säufer gelitten haben«, murmelte einer der Sanitäter leise. »Ja, der
Alkohol is bei uns scho a Volksseuche.« Ein wenig enttäuschte mich allerdings,
dass niemand die im täglichen Leben etwas lächerliche Standardfrage aller
Krimis an mich stellte: »Wissen Sie, ob Ihr Mann Feinde hatte?« Weder Feinde
noch Freunde, ging es mir durch den Kopf. Er war einfach eine Null. Niemand
nahm von ihm so richtig Kenntnis, er ging unauffällig durchs und hoffentlich
auch aus dem Leben!
Die Quintessenz des Totenprotokolls sollte schließlich lauten: »Dr. Leopold E.
ist bei dem Versuch, trotz Rauschzustands infolge übermäßigen Alkoholkon-
sums und Immobilität infolge Gipsverbänden an den Extremitäten – rechtes
Bein, rechter Arm – ein Vollbad zu nehmen, ertrunken. Zur Zeit des Unfalls be-
fand sich der Betreffende, dessen schwere Alkoholsucht amtskundig ist, allein
in seinem Einfamilienhaus.«
Nachdem das Offizielle abgehandelt worden war, ließ sich der Toten-
beschauer schwer auf einen Korbsessel in der Küche fallen, öffnete umständ-
lich seinen Arztkoffer und entnahm ihm seufzend einige Formulare, die er nach
meinen Angaben hin, ausfüllte. »Immer ich hab am Sonntag Dienst«, erklärte
er mir seine düstere Miene. »Das da ist die Anzeige des Todes, die brauchen’s
124/186

für die Eintragung ins Sterbebuch. Und das da ist der Leichenbegleitschein.
Den brauchen’s fürs Begräbnis. Geben’s halt einfach alles der Bestattung, die
erledigt das für Sie. Was für eine haben’s denn?« Ich gab an, über Bekannte
nur Gutes von »Charon« gehört zu haben.
Tatsächlich war mir die »Bestattung Charon« beim Vergleich verschiedener
Institute durch ihr umfangreiches Serviceangebot positiv aufgefallen. Dazu
zählte die Abholung der Leiche innerhalb von zwei Stunden mittels Holzsarges,
wie es auch im Fall des Dr. Leopold E. geschah.
Zu diesem Zeitpunkt war Mizzi auf meinen Anruf hin herbeigeeilt, um mir
beizustehen. Aufgeregt erzählte sie den herumstehenden Anwesenden von
meinem Besuch am Abend des Vortages. Ungefragt und wahrheitswidrig
meinte sie: »Sie hat ihn so gern g’habt. Jetzt ist sie ganz allein. Eine Tragik!«
Womit sie mir einen großen Gefallen erwies.
Tags darauf erschien ein in schwarzes Tuch gekleideter Herr von »Charon« bei
mir. Ich beobachtete ihn, wie er gemessenen Schritts mit Trauermiene durch
unseren – pardon – meinen Vorgarten schritt. Er verbreitete jene »beruhi-
gende Atmosphäre«, die seine Firma anpries, und ich passte meine fröhliche
Physiognomie hastig den Umständen an. Tieftraurig schluchzend kochte ich
dem Besucher Kaffee, während dieser in sanftem Tonfall kluge, gut gewählte
»Worte des Trostes, der Zuversicht und der Hoffnung« sprach. Das macht er
jeden Tag, muss sich bald auf sein Gemüt schlagen, dachte ich mir.
Nach einer angemessenen Pause begann das Geschäftliche. Der Trauerspezi-
alist belebte sich, flugs schlug er seine Mappen mit Fotos vieler Särge auf, die
sinnigerweise alle die Namen schöner Städte wie Salzburg oder Florenz trugen.
Behutsam erklärte er mir die Vor- und Nachteile jedes einzelnen, diskret
flüsterte er mir die – exorbitanten – Preise zu. »Alle unsere Produkte sind
garantiert aus einheimischem Holz. Die Innenausstattung aus Damast wird per
Hand genäht. In Graz.«
Als musikalische Begleitung wählte ich Partien aus Gustav Mahlers fünfter
Symphonie, grandiose weich-sentimentale Klänge, die mich meist, wie in dem
Film »Tod in Venedig«, zum Weinen brachten. Außerdem bestand ich, einen
Wunsch des teuren Verstorbenen vortäuschend – tatsächlich wollte ich
125/186

natürlich auf Nummer sicher gehen –, auf Feuerbestattung im Wiener Kremat-
orium. Blieb nur noch die Parte. »Bevorzugen Sie ein bestimmtes Zitat aus den
Evangelien? Bitte schicken Sie mir den gewünschten Text«, erklärte der Re-
präsentant von »Charon« dramatisch lächelnd, wobei er mir eine Muster-
sammlung frommer Sprüche samt Formular in die Hand drückte.
»Es hat sich ausgeschnarcht!«, schrieb ich scherzhaft an den rechten oberen
Rand der Traueranzeige, bevor ich mich an die Gestaltung des Textes machte.
»Plötzlich und unerwartet … mein innig geliebter Mann …« Bla, bla, bla – das
Übliche halt. Dabei summte ich vergnügt das berühmte rabenschwarze Hofer-
Lied von Wolfgang Ambros vor mich hin: »Schau des is makaber, da liegt ja a
Kadaver! Schau, da liegt a Leich im Rinnsal, s’Bluat rinnt in Kanal!«
Zwei Tage später erreichte mich ein Anruf von »Charon« mit der elegisch
vorgetragenen Bitte um Erklärung. »Wir verstehen das nicht. Soll tatsächlich
›Es hat sich ausgeschnarcht‹ am rechten oberen Rand der Parte neben dem
Kreuz stehen? Dieses biblische Zitat ist uns leider unbekannt!« – »Natürlich
nicht! Ein Irrtum!«, rückte ich alles im letzten Augenblick ins rechte Lot. »Ein
Fehler des Computers!«
Die Nachricht vom Tod meines Mannes verbreitete sich wie ein Lauffeuer in
unserer Siedlung und rührte die goldenen Wiener Herzen. In tiefem Sch-
warz – ich hatte Trauerkleidung angelegt, denn ich schätze Tradition – nahm
ich schmerzgebeugt, aber gefasst die Kondolenzbesuche der »Bierhäusler« ent-
gegen. Einige Frauen brachten Essen, um mich bei Kräften zu halten, andere
boten sich an, bei mir zu übernachten, damit ich nachts nicht allein mit meinen
traurigen Erinnerungen an dem, wie sie sagten, Ort des Schreckens zerbrechen
würde.
Der hagere, durch ein nervöses Zucken seines rechten Augenlids auffallende
Vorstand des Historischen Instituts erschien, drückte mir pathetisch sein
Beileid aus, würdigte in unglaubwürdigem Ton die wissenschaftlichen Verdien-
ste des allzu früh Dahingeschiedenen, der eine durch niemanden zu füllende
Lücke hinterlasse, und erklärte mir dann nüchtern die Wege zur Erlangung
einer Witwenpension.
126/186

Nur Mizzi, mein liebster Lebensmensch, auf die ich eigentlich gezählt hatte,
ließ sich gar nicht mehr bei mir blicken. Ich empfand diese offensichtliche
Herzlosigkeit als höchst merkwürdig, insbesondere da sie nach Poldis Unfall
sofort zur Stelle gewesen war. Immer wenn ich bei ihr anrief – und ich tat dies
natürlich oft –, gab sie vor, schwer beschäftigt zu sein, wies alle meine
Vorschläge zu Ausflügen, Essengehen oder auch nur Plaudern zurück und
entschuldigte sich mit Zeitmangel. Diese Zurückweisung durch meine beste
Freundin kränkte und beunruhigte mich sehr. War mir ein Fehler unterlaufen?
Welcher und wann? Ahnte sie etwas? Im Geist ging ich meine Gespräche, die
ich mit ihr, soweit ich mich erinnern konnte, in der letzten Zeit geführt hatte,
genau durch. Mir fiel kein Lapsus auf.
Das Begräbnis, beziehungsweise die Feuerbestattung, fand im Krematorium
der Stadt Wien im 11. Bezirk nahe dem Zentralfriedhof statt. Der turm- und
zinnenbewehrte Bau des berühmten Architekten Clemens Holzmeister aus dem
Jahr 1922 sollte an das ehemalige Lustschloss »Neugebäude« Kaiser Maximili-
ans
II
. erinnern, in dessen Park man die Feuerhalle und den Urnenhain
errichtet hatte. Der erbitterte Streit, den die Errichtung des Krematoriums
durch die sozialdemokratische Gemeindeverwaltung hervorrief, ist heute nur
noch schwer nachzuvollziehen.
Die Befürworter stammten aus »roten«, antiklerikalen Kreisen, die römisch-
katholische Kirche lehnte sich gegen die »Gotteslästerung« auf. Sie drohte mit
der Verweigerung eines christlichen Begräbnisses. Eine schwere Waffe, denn
ohne einen Pfarrer begraben zu werden war damals für viele Gläubige eine
schreckliche Vorstellung! Priester horchten Sterbende auf dem Todesbett aus.
Sprachen sie sich mit letzter Kraft für eine Einäscherung aus, wurden ihnen die
Sterbesakramente vorenthalten. Man erklärte sie quasi zu Ketzern. Jahrzehnte
vergingen, bis das Heilige Offizium den gläubigen Katholiken die Wahl ihrer
Bestattung freistellte.
Das Begräbnis von Dr. Leopold E. ging an einem klirrend kalten Dezembertag
mit leichtem Schneefall würdevoll vonstatten. Eine Menge teurer Kränze be-
deckten den schlichten Sarg. Poldis Verwandte aus dem Weinviertel nahmen
127/186

an der schönen Zeremonie teil, meine Eltern aus dem Waldviertel, viele vom
»Bierhäuslberg« und auch Vertreter seines Universitätsinstituts, die an ihrem
verstorbenen Kollegen zu Lebzeiten kein gutes Haar gelassen hatten. Letztere
trugen heuchlerische Trauer zur Schau, während sie, wie ich wusste, bereits
emsig um die Neubesetzung seines Postens rangen und ihre Favoriten in Stel-
lung brachten.
»Sir«, dem ich die Einzelheiten vom Tod seines Großneffen rücksichtsvoll
vorenthalten und nur von »Herzversagen« erzählt hatte, saß aufgrund seiner
Gehbehinderung in einem Rollstuhl. Seine Schwerhörigkeit beruhigte mich,
denn der katholische Pfarrer fand nicht nur würdigende Worte, sondern hob
auch die tragischen Umstände des Todes hervor. Zur Sicherheit hatte ich al-
lerdings aus dem Hörgerät des alten Herrn die Batterien entfernt. Ich hörte ihn
murmeln: »Zu blöd, ausgerechnet jetzt funktioniert es nicht!« Bei den tief ber-
ührenden Klängen von Mahlers Fünfter Symphonie heulte ich wie ein
Schlosshund. Aus den Augenwinkeln sah ich Mizzis forschenden Blick.
Der von mir bestellte Leichenschmaus fand in einem benachbarten
rustikalen, auf Leichenfeiern spezialisierten Gasthaus statt. Der Schweins-
braten mit Waldviertler Knödeln mundete den lustig plaudernden Gästen her-
vorragend, lag mir aber noch tagelang wie ein Stein im Magen.
128/186

Kapitel 12
12
Danach kehrte für mich und Murli, der sichtlich unter dem Alkoholentzug litt
und mir oft bittere, vorwurfsvolle Blicke zuwarf, ein sehr geruhsamer – für den
Kater asketischer – Alltag ein. In meiner Bank hatte ich einen vorgezogenen vi-
erwöchigen Jahresurlaub beantragt, der mir, im Hinblick auf die Umstände
und die Jahreszeit – alle anderen gingen im Sommer in die Ferien – auch an-
standslos gewährt wurde.
Ich genoss die freie Zeit und die mustergültige, durch nichts und niemanden
gestörte Ordnung in meinem Heim, aus dem ich zuallererst den persönlichen
Kram Poldis, darunter Stapel von Wissenschaftsblättern und verstaubte
Geschichtsbücher, entfernte.
Danach hielt ich nach verborgenen Sparbüchern und Goldmünzen
Ausschau. Ich wusste, dass manche Leute ihre eiserne Reserve geschickt ver-
stecken: in Polsterüberzügen, hinter Schränken, zwischen Büchern. In einem
konkreten Fall hatte jemand, wie ich in der Zeitung las, sogar die Furniere sein-
er antiken Möbel gelockert und seine Ersparnisse dazwischengeklemmt. Unter
den gekränkten Augen des Katers warf ich auch die vielen leeren Wein- und
Schnapsflaschen weg. Die Klamotten des Verstorbenen trug ich zur Sammel-
stelle von »Humana«. Bald blitzte das Häuschen vor Sauberkeit.
Als ich mir einmal zum Verschnaufen eine kleine Pause im Café Dommayer
gönnte, nahm ich dort eine eigenartig kühle, geradezu unheilschwangere Stim-
mung wahr. Lustlos drehten die Kellner ihre Runden. Kein huldvolles Lächeln,
kein verständnisvoller Blick, kein jovialer Scherz. Endlich fragte jemand Herrn
Walter, der, finster vor sich hin brütend, kleine Kärtchen mit der unheilvollen
Botschaft des Lokal-Besitzers auf den Tischen verteilte: »… trete ich meinen
wohlverdienten Ruhestand an und übergebe nach 43 Jahren an die privat

geführte Konditorei …« Herr Walter erklärte, dass »unser« Dommayer bereits
in einer Nacht-und-Nebel-Aktion verkauft worden sei.
Der Schock saß tief. Vom Sehen jahrelang bekannte, jedoch unzugängliche
Gäste, die sonst mit niemanden ein Wort wechselten und, schweigsam über
ihre Zeitungen gebeugt, Plaudernden oder gar Telefonierenden giftig-strafende
Blicke zuwarfen, wurden lebhaft, stellten sich vor und sprachen hektisch. Ein
besonders Hochmütiger, der stets alle Avancen zum Smalltalk eisig zurückgew-
iesen hatte, gab sich als renommierter Hausverwalter zu erkennen und rief
pathetisch aus: »Was soll ich jetzt tun? Man raubt mir meine Heimat!« Eine
allgemeine Verbrüderung fand statt. Eine Dame, die meinte, eine Konditorei
wäre auch nichts Schlechtes, wurde mit Zischlauten zum Schweigen gebracht,
stand unter Protest auf und ging.
Die Aufregung legte sich auch in der nächsten Zeit nicht – ich konnte dies
gut beobachten, denn ich war täglich dort. Immer weitere Kreise erfuhren die
Neuigkeit und reagierten mit gebührendem Entsetzen. Frauen, die ihre pen-
sionierten Ehemänner bislang gut im Dommayer aufgehoben wussten, erzähl-
ten einander im Vertrauen, dass sie zwar, wie gelobt, gern Freud und Leid mit
ihrem Partner teilten, ihn aber nicht den ganzen Tag zu Hause ertragen kön-
nten – ein Problem, das sich bei mir auf erfreuliche Weise gelöst hatte! Ein
schadenfroher Mensch aus dem vornehmen, aber kaffeehauslosen Wiener
Bezirk Pötzleinsdorf verbarg seine Häme nicht: »Nun sind wir gleich!« Und ein
in der Blüte seiner Jahre stehender Journalist, der sich in der Hektik seines
schweren Alltags damit tröstete, einst ruhigere Tage im engeren Dommayer-
Kreis zu verbringen, sah seine Zukunftshoffnungen schwinden.
»Man kann sich auf nichts mehr verlassen«, lautete der allgemeine Tenor.
»Ist das Kaffeehaussterben noch nicht zu Ende?« Die Besitzerin eines Stands
für edles Obst am Naschmarkt fasste mit unangenehm schnarrender Stimme
die Überlegungen ihrer Mitgäste zusammen: »Wo soll ma nur hingehn? Viel-
leicht durthin, wo immer der Dichterling g’sessn is?« In ihrer respektlosen Art
meinte sie Thomas Bernhard im Café Bräunerhof.
Wenige Wochen später stand die Schließung des Paradieses zwecks
Neugestaltung unmittelbar bevor. Berührende Szenen spielten sich ab. Einige
nostalgische Gäste wollten die Sitzgelegenheiten, auf denen sie jahrelang viel
130/186

Zeit zugebracht hatten, gern erwerben. Als ein Schild beim Eingang verkün-
dete: »Heute ab 18 Uhr geschlossen!«, wusste man Bescheid. Normalerweise
war bis 24 Uhr geöffnet und dies, mit Ausnahme des 24. Dezember, täglich. Im
gedrängt vollen Lokal schlürfte auch ich bis zum letzten Augenblick
Dommayer-Kaffee. Um 18 Uhr wurden wir alle vertrieben!
Drei Wochen nach dem Begräbnis fand ich die Zeit reif für den nächsten Sch-
ritt in ein neues und schöneres Leben. Ich entnahm Leopolds Schreibtisch die
kostbare, mich begünstigende Lebensversicherungspolice, machte eine
Kopie – Originale dieser Art gibt man nicht aus der Hand – und reichte sie bei
der »Städtischen Versicherung« ein. Mein kindlich-naiv gehaltenes Begleits-
chreiben lautete:
Nach dem Tod meines innig geliebten Gatten fand ich beiliegendes Dokument
unter seinen persönlichen Sachen. Mit der Bitte um Aufklärung, bzw. Anweisung
für weiteres Vorgehen zeichne ich
Ihre Hermine E.
Die Versicherung hetzte sich nicht mit einer Antwort, und ich drängte sie auch
nicht, sondern übte mich in weiser Geduld. Zu gut erinnerte ich mich an die
Causa des Udo Proksch. Der in Wien Unvergessene, ein trotz kleiner, korpu-
lenter Statur, hässlichem Äußeren und schütteren fetten Haaren erklärter
Liebling der Damenwelt, brillierte als Initiator des »Vereins der Senkrechtbeg-
rabenen« zur Schaffung von mehr Platz auf den Friedhöfen, aber auch als
Gründer des elitären »Club 45«, dem viele Politiker mit großem Vergnügen an-
gehörten. Darüber hinaus hatte er, gänzlich ohne Barmittel, auf mysteriöse
Weise die einstige k. u. k. Hofzuckerbäckerei Demel erworben. Dort ging es
sehr vornehm zu. Das Personal sprach die Gäste nur in der dritten Person an:
»Haben der Herr schon gewählt? Wünschen die Dame …?« Den ersten Stock
des Etablissements für feinste Wiener Backwaren reservierte Proksch für die
131/186

manchmal ebenfalls feinen, aber auch die weniger feinen, jedoch stets unter-
haltsamen Events des »Club 45«.
Nicht ausgelastet durch seine regen skurrilen gesellschaftlichen Aktivitäten,
mit denen er zahlreiche Mitglieder der österreichischen Regierung amüsierte
und unterhielt, plante der rastlose, originelle und kriminelle Society-Liebling
einen klassischen Versicherungsbetrug größten Ausmaßes samt Mord. Im Ver-
trauen auf seine Beziehungen zu den höchsten politischen Kreisen charterte
der Fantasievolle mit morbidem Humor die »Lucona«, ein hochseetaugliches
Schiff, ließ sie mit wertlosem Schrott beladen, den er als eine wertvolle
Uranerzmühle deklarierte, und schloss auf die »kostbare« Ladung eine hohe
Versicherung ab. Ein kleiner, aber nicht unbedeutender Teil der Fracht bestand
allerdings aus Sprengstoff samt Zeitzünder. Proksch ließ es sich nicht nehmen,
die Crew im Hafen von Triest höchstpersönlich mit einer köstlichen »Demel«-
Torte charmant und herzlich zu verabschieden, ehe sie ins ferne China auf-
brach, den fiktiven Bestimmungsort der fiktiven Uranerzmühle.
Wenig später stach die »Lucona« in See, an einer tiefen Stelle des Indischen
Ozeans fand eine mysteriöse Explosion statt, und das Schiff versank in den
Fluten. Es gab sechs Tote. Prokschs Rechtsanwalt, ein kühner Mann der Tat,
zauderte nicht lange. Auf Drängen seines prominenten Klienten meldete er den
Verlust des Schiffes umgehend der Versicherung, wobei er unter Androhung
des Rechtswegs in rüder Weise die sofortige Auszahlung der Schadenssumme
in der Höhe von 212 Millionen Schilling forderte. Er räumte dafür kurzerhand
eine Frist von vierzehn Tagen ein.
Erfolg, Reichtum und Mega-Honorar zum Greifen nah, waren Klient und
Rechtsvertreter geblendet. Im Vertrauen auf mächtige Gönner hatten sie bei
dem mörderischen Coup eine winzige, jedoch nicht ganz unwichtige Kleinigkeit
übersehen – zu dem Zeitpunkt, als sie ihre Forderungen erhoben, galt das
Schiff nämlich weder als vermisst, noch lag eine offizielle Meldung vom Unter-
gang der »Lucona« vor. Die Versicherungsgesellschaft reagierte mit kleinli-
chem, aber berechtigtem Misstrauen, und die Rechtsangelegenheit erfuhr, trotz
langer Behinderung und Verzögerung durch mit Proksch eng befreundete
Politiker, eine entschiedene Wendung zum Dramatischen. Udo Proksch wurde
132/186

des mehrfachen Mordes angeklagt und verurteilt. Den Rest seines Lebens ver-
brachte er in der Männer-Strafanstalt von Karlau.
Derartig plumpe Fehler würden mir nicht passieren. Geduld, Geduld, keine
Gier! Trotz großer Nervosität und schlafloser Nächte hielt ich still, bis ich nach
mehr als sechs Wochen eine Aufforderung erhielt, unter Vorweis der Police bei
einer namentlich genannten Referentin der »Wiener Städtischen« zu
erscheinen.
An einem schönen Frühlingstag, als ein sanftes Lüftchen über die Stadt strich,
machte ich mich auf den Weg in die Innenstadt. Ruhig, gefasst und sehr kor-
rekt in Dunkelblau fuhr ich samt allen möglichen und unmöglichen Papieren
zum Gebäude der Versicherung am Schottenring. Eine ältliche Dame, der ihr
Griesgram tiefe Falten in das Gesicht gezogen hatte, empfing mich in ihrem
nüchternen Büro im 5. Stockwerk mit Blick auf die schmutzig grauen Gewässer
des Donaukanals. In einer Ecke des kleinen Zimmers mit dem abgenützten
Schreibtisch vegetierte ein kümmerlicher, fast blattloser Philodendron vor sich
hin, der anscheinend weder leben noch sterben konnte. Frau Mag. Krassolter-
Schlupenskys kühle stahlblaue Augen taxierten mich stumm. Innerlich musste
ich lachen: Was für ein Name! Manche kriegen nie genug!
Dann sprach sie mir zum allzu frühen Tod meines Ehemanns ihr inniges
Beileid aus. Mir wurde schnell klar, dass sie die primitive Masche »von Frau zu
Frau« spielte. »Sie Ärmste, mir scheint gar, Ihr armer Mann wollte freiwillig
aus dem Leben scheiden. Sie haben doch auch diesen Verdacht?«, fragte sie
listig, denn die Police enthielt eine infame Klausel, wonach bei Selbstmord des
Kunden keine Leistung zu erbringen sei.
Oho, so plump geht es nicht, du Trampel! Ich senkte nur traurig den Blick
und überreichte ihr wortlos das amtliche Totenprotokoll. Sie gab nicht auf.
»Hat Ihr Gatte nie unter Depressionen gelitten? War er nicht nach dem Unfall
und der langen Rekonvaleszenz entmutigt und zum Aufgeben bereit? Das ist
häufiger, als man vermutet!« – »Nein, niemals, wie kommen Sie darauf?«, ant-
wortete ich ruhig, worauf sie mich aus bösen Augen gleichsam mit Giftpfeilen
beschoss – wahrscheinlich kassierte sie im Erfolgsfall einen Bonus.
133/186

Unwillig und nur teilweise resignierend machte sie mir klar, dass eine
genaue Prüfung aller Fakten und deren Vergleich mit den vielen kleingedruck-
ten Klauseln des Vertrages unerlässlich sei. Bei dieser Erklärung schöpfte sie
selbst, wie ich bemerkte, neue Hoffnung: »Oft, sehr oft liegt dann gar kein Ver-
sicherungsfall vor. Das heißt, Ihre Ansprüche wären dann aus der Luft gegrif-
fen.« Nur mit Mühe enthielt ich mich jeder Äußerung. »Auf jeden Fall hören
Sie von uns!« Huldvoll und gnädig-herablassend nahm die Dame meine Unter-
lagen entgegen, gab mir im Sitzen die Hand, und nur ihr säuerlicher Blick
geleitete mich zur Tür. Ich war entlassen und wartete – im Inneren bebend, je-
doch Ruhe vortäuschend – den weiteren Lauf der Dinge ab.
In diesen nervenaufreibenden Tagen kränkte es mich umso mehr, dass mich
meine beste Freundin mied. Warum nur?
Das Rätsel löste sich, als mich Mizzi eines Tages unangemeldet besuchte. Sie
vermied es, mich anzuschauen, streichelte Murli, der sie voll Freude begrüßte,
druckste ein bisschen herum, um dann plötzlich herauszuplatzen: »Du, ich
habe mir ein Buch in der städtischen Leihbibliothek besorgt.« – »Ja, und?«,
fragte ich verwundert. »Das Jahrhundert der Detektive, von dem du geredet
hast. Ich weiß alles.«
Wir starrten einander sprachlos an. »Ich muss jetzt gehen«, wollte sie ab-
rupt Abschied nehmen, doch ich hielt sie zurück. »Erklär mir das. Was willst
du mir sagen?« – »Ganz einfach, ich glaube, dass du nachgeholfen hast. Oder
war es nicht so?« – »Du bist eine dumme Gans. Wobei soll ich nachgeholfen
haben?« – »Hast du den Poldi nicht ertränkt, wie der Badewannenmörder von
1915?« – »Um Gottes willen! Diese grausige Idee! Das mutest du mir zu? Soll
es ein makabrer Scherz sein? Dafür ist es zu früh! Wenn du dich nicht sofort
entschuldigst, sind wir geschiedene Leute. Du weißt doch, dass es ein Unfall
war. Du weißt auch, dass Poldi zuletzt ein Säufer war!«
Mizzi blickte mich an. »Ich glaub, du warst schon immer ein Luder. Das mit
dem Hahn Peter, da warst du doch auch dabei!« Dann ging sie.
Ich ärgerte mich, vermisste sie jedoch sehr, ebenso wie mir meine Fre-
undinnen Gitta und Heidi fehlten, die sich, vermutlich aufgehetzt von Mizzi,
ebenfalls von mir fernhielten.
134/186

Endlos lange Tage verstrichen, und das Frühjahr neigte sich schon dem Ende
zu, als endlich ein amtliches Schreiben mit der Nachricht eintraf, dass mir die
gesetzlich vorgesehene Witwenpension nach einem pragmatisierten Beamten
der Dienstklasse A, Gehaltsstufe 5 zustehe. Der genannte, ab dem Stichtag des
Todesfalls monatlich fällige Betrag war nicht groß, denn mein Mann hatte ja
bedauerlicherweise kein hohes Alter erreicht. Aber der österreichische Staat
sorgte doch für die Seinen – Pensionen und Gehälter werden in Österreich
vierzehn Mal jährlich ausbezahlt, zwei Mal davon sogar fast steuerfrei –, und
ich war es zufrieden.
Wiederum verstrich geraume Zeit. Dann jedoch teilte mir auch die
»Städtische Versicherung« in dürren Worten, aus denen eine gewisse Ent-
täuschung herausklang, mit, dass mir als Witwe des eines natürlichen Todes
verstorbenen Dr. Leopold E. aufgrund der vor fünfundzwanzig Jahren
abgeschlossenen Lebensversicherung die unglaubliche Summe von fast zwei
Millionen Schilling, genauer 1 987 423 Schilling und 50 Groschen, zustand. Ich
möge eine Kontonummer für die Überweisung des Betrages angeben.
Ich jubelte laut auf, las mir das Schreiben mehrmals laut vor, ließ mir den
Betrag inklusive Groschen auf der Zunge zergehen, legte den Brief auf den
Couchtisch im Wohnzimmer und holte zwei Flaschen aus dem Keller. Einen
Champagner der dem Anlass entsprechenden Marke »Veuve Clicquot« für
mich, Eierlikör für Murli. Mit »Heute feiern wir« weckte ich den Kater, der wie
immer am Nachmittag schlummerte, um Kräfte für seine nächtlichen Aben-
teuer zu sammeln. Sein Glück, nach langer Zeit völliger Abstinenz wieder das
geliebte süße, in unerreichbare Sphären entschwundene alkoholische Getränk
schlecken zu können, war unüberseh- und -hörbar. Ich wiederum betrachtete
in Gedanken versunken die aufsteigenden Perlen der »Witwe Clicquot«,
während ich an meinem schön geschliffenen Glas nippte. Poldi mit seinem
Faible für die Aristokratie hatte die alten, mit Monogramm und Krone gezier-
ten Sektkelche einst im Wiener Dorotheum erworben. Ich schenkte mir und
Murli, der mich aus großen grünen Augen flehentlich ansah, ein paar Mal nach.
Wehmütige Melancholie breitete sich in mir aus, ich fühlte einen Stich in
meiner beschwipsten Brust. Eigentlich sehr nobel von Leopold, mich derart
großzügig zu versorgen. Meine Gedanken an den Verblichenen grenzten fast an
135/186

Nostalgie, und ich beschloss sein Grab oft zu besuchen, es mit einer teuren,
lebensgroßen Steinskulptur – mir schwebte eine klassische griechische
Frauengestalt in wallenden Trauergewändern vor – zu verschönern und nur-
mehr freundlich an ihn zu denken. Hatte ich nicht in der Schule gelernt: »De
mortuis nihil nisi bene?« So würde ich es in Zukunft halten.
Gerührt über mich und meine Selbstlosigkeit vergoss ich noch einige Trän-
en, dann jedoch gab ich mich regelrechten Genussfantasien hin. Was würde ich
mir jetzt alles gönnen! Ein neues Auto und Ciao dem alten Puch, Klamotten
nach dem Motto »Der Teufel trägt Prada«, Luxus-Reisen an die Traumstrände
dieser Welt, tollen Schmuck, eine, zwei oder mehrere Rolex-Uhren in ver-
schiedenem Design, Kosmetik vom Feinsten, Massagen, Gesichtspflege, Lift-
ings groß und klein und und und. Auch der Wiener Tierschutzverein würde be-
dacht werden. Vor allem jedoch eines: keine widerliche Arbeit mehr!
Im Besitz von genügend Moneten stand mir ein Leben mit erfrischendem
Müßiggang und reichlich Selbstverwirklichung ohne Job bevor. Zu abs-
chreckend waren für mich jene abgehärmten Frauen, die knapp vor
Geschäftsschluss durch die Supermärkte hetzten, wobei sie vor Nervosität und
Überanstrengung gleichsam zitterten. Viele der Armen trugen auch noch ihr
eben aus der Säuglingskrippe abgeholtes Kind auf dem Arm. Eile war geboten,
denn trotz eines anstrengenden und langen Arbeitstages wartete die Familie
daheim auf das Abendessen. Ich wusste, dass meine Einstellung zur weiblichen
Doppel-, Dreifach-, Vierfach-Belastung im krassen Widerspruch zum
herrschenden Zeitgeist stand. Utopische, verlogene Plakate junger, fröhlicher,
schöner – vorzugsweise alleinerziehender – Mütter mit mehreren Sprösslingen
und dem Text: »Kinder und Beruf, wir schaffen das, warum nicht?« entlockten
mir nur ein müdes Lächeln. Die Sucht der modernen Welt – egal, ob arm oder
reich – nach Arbeit und Karriere war meine Sache nicht. Im Gegensatz zu
diesen getriebenen Geschöpfen würde ich am Morgen nicht mehr außer Haus
hetzen, sondern lange, lange schlafen und mein kontemplatives Leben nach
Lust und Laune kreativ gestalten.
136/186

Kapitel 13
13
Zwischen der Ankündigung und der Überweisung des Geldes – alles innerhalb
Wiens – verstrichen trotz des Fortschritts der Computertechnik gute zwei
Wochen, denn die Versicherung krallte sich an ihren Zaster. Jeder Bote, ob zu
Fuß oder zu Pferd, gehbehindert oder altersschwach, hätte den Betrag in dieser
Zeit Dutzende Male überbringen können. Dafür erhielt ich fast gleichzeitig mit
dem überaus erfreulichen Kontoauszug, den ich nicht müde wurde zu betracht-
en, das prompte Schreiben eines Finanzberaters aus der Zentrale meiner Bank.
Sehr verehrte, liebe Kollegin!
Der tragische Tod Ihres Gatten hat uns tief bewegt. Die Commerzbank als Ihr
Arbeitgeber hat mich als diplomierten Berater für Asset-Management beau-
ftragt, Ihnen in dieser schweren Lage – sofern Sie es wünschen – mit Rat und
Tat zur Seite zu stehen. Für eine erste unverbindliche Besprechung Ihrer finanzi-
ellen Angelegenheiten scheint der Rahmen eines Abendessens passend. Ich
möchte Sie herzlich einladen und schlage das Restaurant »Roma« im 1. Bezirk
vor. Welcher Tag wäre Ihnen angenehm?
Mit kollegialen Grüßen
Ihr Florian Schmid
Unverzüglich klickte ich den Namen des Herrn in der internen Personalliste
meiner Bank an: Mag. Florian Schmid, Kundenbetreuer, Fachbereich Aktien
und Anleihen, Privat- und Geschäftskunden.

So kam es, dass ich mich an einem Donnerstagabend in ein neues hellblaues
Dior-Kostüm zwängte. Es saß etwas knapp. Mein Bauch quoll über den engen
Bund, denn als Folge von Müßiggang und Wohlleben mit erlesenen Speisen
hatte sich ein weiterer Speckgürtel um meine Taille gelegt. Gegen etwaige
Abendkühle legte ich ein schwarzes Kaschmircape bereit. Amüsiert gedachte
ich meines orangenen Alpaka-Mantels. Ich hatte ihn schon längst zu Putzlap-
pen zerschnitten, die sich im Übrigen als sehr saugfähig erwiesen.
Vorsichtig zog ich hochglänzende und hochpreisige »Wolford«-Strümpfe der
Marke »Satin Touch« an, schlang das neue Täschchen mit der markanten Prä-
gung »Prada« über die Schulter und fand mich zur vereinbarten Stunde im
»Roma« ein. In dem italienischen Lokal der gehobenen Preisklasse verkehrten
biedere Bürger; es war beileibe kein In-Lokal.
»Gnädige Frau, ich freue mich sehr!« Die Begrüßung des auf die Verwaltung
meines Vermögens erpichten Vertreters der Commerzbank, der mich mit
Handkuss empfing, hätte nicht charmanter ausfallen können. Während wir
dem Kellner zu unserem reservierten Tisch in einem holzgetäfelten Alkoven
folgten, musterte ich meinen Begleiter unauffällig aus raffiniert betonten blau
geschminkten Augenwinkeln: Groß und schlank, ca. vierzig Jahre, dunkle
Haare, grüne Augen, teures Outfit, kein Ehering, breite Schultern, schmale
Hüften, schöne, männliche Hände.
Bei Prosecco, Prosciutto di Parma und Risotto con Funghi – einem Gericht,
das mir Kollege Schmid als passionierter Pilzesammler und, wie er verschämt
gestand, Hobbymykologe wärmstens empfahl – sowie Fegato Veneziano, alles
begleitet von einem Monfernato Rosso aus den Kellereien der Villa Antinori,
plauderten wir locker: über unsere Arbeit, das Bankengeschäft, die schwierige
Wirtschaftslage und wie schön das Leben in Wien sei. Schön, aber doch auch
teuer! Immer wieder traf mich ein bewundernder Blick, der mir trotz seiner
Durchsichtigkeit schmeichelte.
Dann erwähnte der geschulte Profi die Notwendigkeit, für unser, wie er
scherzend meinte, sauer verdientes Geld – er wusste zum Glück nicht, wie
sauer in meinem Fall – einen sicheren Hafen zu finden: »Gerade jetzt sind die
Zeiten mehr als günstig, die Fonds steigen unaufhörlich, und wir bieten, wie
Sie ja selbst am besten wissen, erstklassige Finanzprodukte an.« Nach weiteren
138/186

Worten über sichere, ja todsichere Anlagen mit großem Erfolgspotenzial und
minimalem Risiko nahm das Gespräch wieder eine scherzhafte, belanglose
Wendung. Ich formte meine Meinung, während seine Blicke, wie mir schien,
unauffällig an meinem Körper auf und ab glitten: ein sympathischer, unauf-
dringlicher, durch und durch seriöser Mann. Auf jeden Fall war es ein an-
genehmer, mit leichter Erotik geschwängerter Abend!
Wir vereinbarten einen Termin für einen ernsthaften »Business-Talk«. »Vi-
elleicht in der Nähe Ihrer Bankfiliale? Ich darf Sie anrufen!« Warum soll ich
mich diesem profunden Kenner der Finanzwelt nicht anvertrauen?, überlegte
ich. Immerhin standen zwei Millionen Schilling – und zwar meine – zur Dis-
position, die anscheinend noch vermehrt werden konnten! In Gedanken über-
schlug ich meine Lage und stellte eine Art »Milchmädchenrechnung« auf, die
ein Finanzmanager sicher verachtet hätte: Also, die Reparatur der kaputten
Dachrinnen würde mich Geld kosten. Dann wollte ich mir eine Wellness-Oase
einbauen lassen. Der Tierschutzverein bekam auch eine größere Spende. Bei
mir selber mochte ich auch nicht sparen – persönlicher Luxus musste sein. Wie
viel sollte ich dem Mag. Schmid geben? Ich rechnete gewissenhaft. Und
schließlich würde ich mich an die Börse wagen – dazu war Kapital nötig!
Schon lange hegte ich den sehnlichsten Wunsch, mit Aktien, Optionen, Fu-
tures und Derivaten zu spekulieren, ganz wie die smarten und reichen Finan-
zhaie, über die ich immer wieder las. Dass ich als kleine Bankangestellte von
der großen, gefährlichen Finanzwelt, die nie bis in unsere Vorstadtfiliale
vorgedrungen war, wenig, nein, eigentlich gar nichts verstand – die Weiter-
bildungskurse, zu denen mich mein Arbeitgeber genötigt hatte, hatten sich auf
Basiswissen im Umgang mit Computern beschränkt –, störte mich nicht im
Geringsten. Im Gegenteil, ich sehnte mich nach einem heimlichen Zocker-
leben! Heimlich deswegen, da ich meinem »Personal Manager« – im Innersten
hatte ich mich schon dazu entschlossen, den größten Teil meines Vermögens in
Florian Schmids sicherem Hafen anzulegen – nicht in meine Pläne einweihen
wollte. Nichts fürchtete ich mehr als überhebliche Ratschläge, herablassende
Warnungen und schlecht verhüllten Spott. Das zarte Zocker-Pflänzchen sollte
gedeihen und nicht vernichtet werden!
139/186

Dies alles ging mir durch den Kopf, während mich Mag. Schmid zu meinem
durch diverse missglückte Parkmanöver leicht verbeulten uralten Volkswagen-
Käfer begleitete. Etwas verlegen stieg ich ein. Kurz überlegte ich, ob ich nicht
eine Erklärung für das armselige Vehikel abgeben sollte. Doch mir fiel nicht
ein, wie ich auf ungezwungene Art und ohne Prahlerei, quasi nebenbei, hätte
mitteilen können, dass der zu meinem Reichtum eher passende schwarze
Jaguar
XJ
6 4,0 mit stolzen 310
PS
zwar bestellt, aber noch nicht geliefert
worden war.
Zu Hause studierte ich die Studienangebote des
WIFI
, des Wirtschaftsförder-
ungsinstituts der Stadt Wien, dann inskribierte ich kühn den Lehrgang: »Fu-
tures und Optionen I«. Lächerlich verzinste Sparbücher oder mündelsichere
Anleihen reizten mich nicht. Ich suchte das Abenteuer – alles oder nichts.
Wenig später kündigte ich meinen Posten mit Pensionsberechtigung bei der
Commerzbank, kassierte die mir zustehende Abfindung und zog mich, wie ge-
plant, ins Privatleben zurück. Mag. Schmid traf ich sehr häufig. Ich stellte ihm
eine Vollmacht aus, mit der ich ihm die uneingeschränkte Verwaltung von zwei
Dritteln meines Vermögens übertrug. Als ich bei der Beglaubigung der Unters-
chrift einen Personalausweis vorlegen musste, litt ich Höllenquallen. Nein,
nicht wegen des Risikos! Ich schämte mich, mein wahres Alter von nunmehr
stolzen fünfzig Jahren einzugestehen, es sozusagen amtlich preiszugeben. Der
Freund, Börsenguru und Mann von Welt, reagierte souverän. Er nahm die
zwölf Jahre, die uns trennten, kopfschüttelnd zur Kenntnis, wobei er leise zu
sich selber sagte: »Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Sie sieht viel
jünger aus!« Erst später wurde mir klar, dass er meine persönlichen Daten
schon lange gekannt hatte.
Im Café Dommayer, bei »Mario« oder einem netten Bummel erläuterte mir
mein Berater seine raffinierte Anlagestrategie, die mich von der reichen zur
noch reicheren Frau machen sollte. Ganz wie einst mit dem seligen Poldi
spazierte ich durch die farbenfrohen Blumen-Parterres des Parks von Schloss
Schönbrunn – nun allerdings an der Seite eines attraktiven Mannes. Das
Schicksal hat es endlich gut mit mir gemeint, frohlockte ich, als wir zum Bassin
des Neptun-Brunnens kamen, wo sich die Sonne im Wasser spiegelte und der
140/186

von Nymphen umringte, mit dem Dreizack bewehrte Meeresgott wie einst in
seinem Muschelwagen thronte. Vor fünfundzwanzig Jahren habe ich da mit
Poldi Kaffee getrunken, erinnerte ich mich beim Anblick der Gloriette. Wie
dumm man doch in seiner Jugend ist. Ich hab’ wirklich geglaubt, dass in dem
armen Wurm das Zeug zum Bestsellerautor steckt.
Die mir seit Jahrzehnten bekannten barocken Gärten, die dichten, mit Statu-
en gesäumten Laubengänge, die lauschigen versteckten Rondos, die
plätschernden Brunnen und künstlichen Ruinen, alles erschien mir wie verza-
ubert. Selbst das Gelb der Schlossfassade erstrahlte in neuem, glänzendem
Licht. Dank der Belehrungen des seligen Poldi wusste ich, dass die leuchtende
Farbe auf Kaiserin Maria Theresia zurückging. Diese ließ 1752 den in Rosa und
Blau gehaltenen Palast auf jenes warme »Schönbrunner Gelb« umstreichen,
das international Furore machte und bis zum heutigen Tag gern verwendet
wird.
Was für eine erstaunliche Frau, diese Kaiserin! Wie hatte sie sich mühelos in
einer Männergesellschaft durchgesetzt, siebzehn Kinder zur Welt gebracht und
ein Riesenreich beherrscht, ging mir durch den Kopf. Da sollte es mir doch
möglich sein, wenigstens bescheidene Erfolge zu erringen! Wie eine adelige
Dame aus einer versunkenen Epoche schritt ich an der Seite meines Kavaliers,
dem, wie ich voll Befriedigung sah, sogar junge Mädchen interessierte Blicke
zuwarfen, durch die langen, zu kunstvollen Dächern geschnittenen
Baumreihen.
Es störte nicht, dass kichernde, stets in Gruppen auftretende japanische
Touristen wie wild fotografierten, sich mit seltsam schlurfendem Gang auf den
kiesbestreuten Wegen fortbewegten und manchmal zum Gruppenbild auf einer
der kunstvollen Parkbänke Platz nahmen. Florian Schmid und ich entdeckten
auf diesen magischen Spaziergängen viele Gemeinsamkeiten, wir diskutierten
über Gott und die Welt. »Ich glaube schon, dass es einen Schöpfer gibt, der un-
sere Geschicke lenkt. Sonst wären wir heute nicht hier!«, gab mein Freund zu
bedenken, wobei er mich bedeutungsvoll ansah. Dann erklärte er mir mit
einem Anflug von Verlegenheit, dass er mit jungen Mädchen nur schlechte Er-
fahrungen gemacht habe. Sie seien unreif, arrogant und dumm. Sie machten
ihn nervös.
141/186

Bei seiner Erzählung, wie er die Katze seiner Eltern nach einem Unfall be-
treut hatte, kamen mir die Tränen. Es wurde mir warm ums Herz: »Ein
Autoraser hatte sie angefahren. Sie schleppte sich mit Abschürfungen, einem
gebrochen Bein und einer zerbissenen Zunge nach Hause. Ich brachte sie zum
Tierarzt, der sie versorgte und operierte. Danach habe ich mehrere Nächte
neben dem Kisterl der Katze geschlafen.«
Wir formten eine Seelenfreundschaft, die in eine traumhafte Beziehung
überging. Berührte Flo, wie ich ihn bald nannte, ganz zufällig meinen Arm,
durchrieselte es mich wie elektrisiert von Kopf bis Fuß. Hörte ich seine
männlich-tiefe Stimme am Telefon, schwebte ich im siebenten Himmel. Wenn
von meinen Finanzen die Rede war, hörte ich nur zerstreut hin. Die geringsten
Komplimente sog ich jedoch gierig auf. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte
ich mich verliebt, litt die Qualen einer Liebenden, die ich bis dahin nur aus der
Literatur gekannt hatte, und suchte diesen Zustand krampfhaft zu verbergen.
Bald trafen wir uns auch an Wochenenden, wanderten viele Stunden in der
Nähe des Dorfes Kaltenleutgeben, wo schon Mark Twain Erholung suchte,
saßen auf moosbedeckten Steinen in den einsamen Nadelwäldern. Florian
zuliebe und unter seiner Anleitung lernte ich den Unterschied zwischen Speise-
und Giftpilzen. Erstere wusste der passionierte Hobbykoch nicht nur raffiniert
zuzubereiten, er lagerte sie auch ein, um damit die Wintergerichte zu verfein-
ern. Meist kehrten wir am frühen Abend, kurz vor Einbruch der Dunkelheit, bei
einem Heurigen ein. Wenn wir in Perchtoldsdorf, der schönen mittelalterlichen
Kleinstadt vor den Toren Wiens, im idyllischen, blumengeschmückten Garten
beim »Zechmeister« an einem der grünen Heurigentische saßen, Wein tranken
und Flo mir in die Augen sah, konnte ich die wunderbare Wendung meines
Schicksals kaum fassen.
Eine große Freude war für mich in jener Zeit auch der Kurs am
WIFI
, den ich
zweimal wöchentlich besuchte. Er stand unter der Leitung des witzigen Mag.
Gierer, einst Analyst einer renommierten Wiener Bank, nunmehr privater Fin-
anzberater und Lehrbeauftragter, der freimütig seine eigenen Misserfolge bei
Spekulationen eingestand: »Und am nächsten Tag is dann der Dollar g’falln!«
Von ihm wurde ich mit zehn anderen Amateurzockern mit mehr oder weniger
Praxis über die schillernde und tückische Börsenwelt aufgeklärt. »Warum,
142/186

glauben S’, erfinden die Geldinstitute immer neue Anlageprodukte? Weil s’ so
gscheit sind? Na, na! Nur um Ihnen Sand in die Augen zu stran. Denen geht’s
nur um den Ausgabeaufschlag, die Verwaltungsgebühren und Nebenspesen.
Ob des Papier was bringt oder net, ist denen wurscht! Sie wern immer
draufzahln!« Gebannt lauschten wir dem Meister, es fiel uns wie Schuppen von
den Augen! Lustige Anekdoten aus dem Finanzmilieu, einem wahren Eldorado
für Groß- und Kleinkriminelle, belebten die Lektionen. Der Taschenrechner
machte mir nur anfangs Schwierigkeiten, bald jedoch konnte ich die Rechen-
beispiele für Gewinn, Verlust, Margen und Renditen mühelos lösen.
Nach dem Unterricht eilte ich nach Hause, setzte die Lesebrille auf, warf
meinen neuen Personalcomputer an, loggte mich in mein Portefeuille ein und
setzte meine Kenntnisse um. Ein Mausklick, und schon war ich online dabei.
Wild »tradete«, kaufte und verkaufte ich also, was das Zeug hielt: Aktien von
Banken, Futures auf Öl und Kakao, Gold und Devisen. Die Spekulation mit un-
bekannten Titeln des aufstrebenden chinesischen Marktes lockte mich beson-
ders. Ebenso zogen mich kleine, innovative südkoreanische Software-Firmen
magisch an.
Ich erwarb auch das von Mag. Gierer empfohlene Magazin »Der erfolgreiche
Zocker«, schlug es auf und lachte über den Bericht von einem Experiment.
Hatte man im alten Griechenland das Orakel von Delphi befragt und zweis-
chneidige Antworten erhalten, so beschritt die Finanzwelt nun anscheinend
ähnliche Wege. Man stattete Schimpansen mit Darts aus und ließ sie auf eine
Tafel mit Firmennamen schießen. Bald verging den Profis das Lachen. Zur
Verblüffung der Fachwelt erzielten die Affen eine ausgezeichnete »Perform-
ance«. Sie wählten lukrativere Aktien aus als gewiefte, jahrelang an Charts und
Analysen geschulte Banker. Den Herren und Damen im Nadelstreif dürfte es
nur geringen Trost bereitet haben, dass sie mit den Schimpansen 98 % ihrer
Gene teilten, also nah mit ihnen verwandt waren.
Nach der Lektüre des Artikels wusste ich selbstverständlich, was zu tun war.
Mittels ausgesuchter Leckerbissen – »Incentives« oder »Boni«, wie das bei uns
Profis heißt – sicherte ich mir die freudige Mitarbeit eines Experten. Ich
schrieb eine Anzahl börsennotierter Titel auf ein kariertes Blatt Papier, jede
Firma in ein Kästchen, legte dieses auf den Boden, tauchte Murlis Pfoten in
143/186

eine – selbstverständlich unschädliche – Lebensmittelfarbe und animierte ihn
zu einem Spaziergang über die Aktienlandschaft. Dies stellte eine Notlösung
dar, denn mir war ganz klar, dass Murli den Umgang mit Darts verweigern
würde. Die vom Kater markierten Titel erwarb ich ohne Widerspruch. »Murli,
solln wir wirklich China Mobile kaufen? Und Anteile australischer Goldminen?
Na ja, wenn du meinst!« Murli wurde ein versierter, sehr erfolgreicher, etwas
eingebildeter Börsenspekulant. Für jeden Gewinn erhielt er, wie bei Finan-
zgeschäften üblich, ein Erfolgshonorar, das Menschen oft, Tiere jedoch stets in
Naturalien beziehen. Bald trug mein Mitarbeiter ein mit glitzernden Steinen
verziertes Halsband, dessen Echtheit er nicht weiter hinterfragte. Er ruhte in
einem mit einer Kaschmirdecke ausgeschlagenen Luxus-Körbchen. Für müßige
Stunden stand eine mechanische Spielmaus bereit. Gourmetmenus vom Fein-
sten bewirkten, dass er sich bald über die Charts mehr wälzte als ging.
Vor Flo hielt ich mein aufregendes Hobby, dem ich täglich viele Stunden
widmete, geheim. Ich dachte daran, ihn eines Tages mit meinen gar nicht so
bescheidenen Amateurerfolgen zu überraschen. Vielleicht würden wir sogar
lachend unsere Gewinne vergleichen.
144/186

Kapitel 14
14
Dem schönen Hochsommer folgte ein ebensolcher Frühherbst. Es war die
glücklichste Zeit meines Lebens, und ich stellte mich, da sich, wie ich mir ver-
schämt eingestand, Weiteres anzubahnen schien, mit einer gewissen lustvollen
Gier auf ein romantisches Abenteuer und einen in der Diktion der modernen
Zeit als »Lover« bezeichneten Mann ein. Dabei war mir etwas bang zumute.
Erstaunlicherweise konnte ich die Nachwirkungen meiner konservativen,
prüden Erziehung selbst im reifen Alter nicht abschütteln.
In meiner Kindheit hatte auf jedem Bild, jedem Wort, das sich nur irgendwie
auf den Liebesakt bezog, ein Bann gelegen. Man empfand es als unanständig,
wenn sich ein Paar auf offener Straße küsste. Schon im zarten Alter warnten
mich meine Eltern vor einem Schicksal »in der Gosse«, wie sie es bezeichneten.
All dies verlieh dem Tabuthema Sexualität unwiderstehlichen Reiz. Ich er-
lauschte und vernahm vieles, was nicht für meine Ohren bestimmt war, und
tauschte mein Wissen mit Gleichaltrigen aus. Trotzdem glaubten wir, meine
Freunde aus der Schlossergasse 14 und ich, lange an das geheimnisvolle
Wirken der Störche.
Meine und Mizzis sexuelle Aufklärung fand dann auf dem Dachboden der
Schlossergasse 14 statt, wo allerlei Gerümpel lagerte, das wir neugierig in Au-
genschein nahmen. Neben einem hübsch bemalten, etwas wackeligen
Schaukelpferd entdeckten wir eines Tages auch ein altes medizinisches
Lexikon. Aufklappbare Tafeln erklärten uns, die wir natürlich unsere Eltern nie
nackt gesehen hatten, anschaulich und in Farbe den Unterschied zwischen
Frau und Mann. Nach diesem vielversprechenden Anfang gab es kein Halten
mehr. Wir schlugen bei aufgeschnappten Stichwörtern nach, komplettierten
unser Wissen und gaben es – im Austausch gegen ein Mickymaus-Heft und ein
gemischtes Eis mit Vanille und Schokolade – an interessierte Freunde weiter.

Seit jenen fernen Tagen hatte sich in unserer Gesellschaft ein vollständiger
Wandel aller Werte und Tugenden vollzogen. Tabus gehörten der Vergangen-
heit an. Ich stellte mir daher die Frage: Wie konkret durfte, beziehungsweise
konnte ich meine Sexabsichten äußern? Oder sollte ich einfach nur abwarten?
Vollkommen »out« auf diesem Gebiet – meine miesen Erfahrungen mit Poldi
zählten nicht in diesem Spiel –, »gab ich mir«, wie es nun hieß, voll Vorfreude
Reportagen über Liebe & Männer. Lifestyle-Magazine – und nicht, wie man
meinen könnte, Pornohefte – informierten mich ohne Scheu über One-Night-
Stands, Quickies an Hauswänden, oralen Sex sowie Orgasmen und öffneten
mir die Augen für eine neue, fremde und rohe Welt.
Mein Gott, was gab es da alles, das mir entgangen war! Ich lernte begierig.
Direkte Äußerungen, in der Art von »Willst du mit mir Sex?« sollte ich eher
unterlassen, weil das unerotisch sei. Es törne nicht an – was immer man damit
meinte. Besser sei es, nonverbal vorzugehen, klare, aber diskrete Signale zu
senden. Nicht den Blick zum Hosenschlitz wandern lassen oder gar dorthin
greifen, sondern Augenkontakt suchen. Eine für mich unnütze Ermahnung.
Florians Hose zu mustern hätte mir mein Schamgefühl nicht erlaubt, alles
darüber Hinausgehende auch nicht. Lächeln, wie beiläufig seinen Unterarm
streifen, dies ja. Urinstinkte beachten! Der Mann fühle sich nämlich in der
Rolle des Jägers wohler als in der des Gejagten – kein Problem für mich!
Viele radikale Feministinnen widersprachen jedoch ihren gemäßigten
Geschlechtsgenossinnen. Von den harten Girls erfuhr ich, dass es neuerdings
sehr wohl zum guten Ton gehörte, einen Arbeitskollegen ganz beiläufig zu fra-
gen: »Soll ich dir in der Mittagspause so zwischen eins und zwei einen blasen?«
Sie plädierten für Sex zwischen den Regalen des Supermarkts: »Besorgst du es
mir hinter den Teigwaren bei den Gummibärlis?« Sie empfahlen stumme One-
Night-Stands. Ja, warum denn?, begehrte ich auf. Warum sollte man in dieser
Situation nichts reden?
Überhaupt herrschten strenge Regeln: »Die Reihenfolge einhalten – vorstel-
len, kennenlernen, Bett.« Das klang logisch, aber doch eher wie die Vorbereit-
ung eines Ringkampfes. Umso mehr, als rückständige Männer die totale
sexuelle Emanzipation anscheinend nicht begriffen. Noch immer stellten sie
die irrelevante infantile Frage, gegen wie viele Ex-Lover sie im Bett
146/186

»anzutreten« hätten. Derartige Blödheiten lasse man unbeachtet und unbeant-
wortet, lautete der Ratschlag der modernen Amazonen. Ich vernahm, dass man
durch männlichen Schweißgeruch »an- oder abgetörnt« werden konnte. Ekelte
man sich vor Ausdünstungen und wünschte sich einen sauberen Mann im Bett,
wurde zu einem eleganten Schachzug geraten: »Solltest du dich noch frisch
machen wollen – hier ein Handtuch!« hieß es dann. Außerdem wäre es Mode,
am ganzen Körper haarlos zu sein.
Auch das sollte kein Hindernis sein! Ich unterzog mich, obwohl es mir sehr
unangenehm war, einer radikalen Body-Rasur, während der ich voll Angst,
hässlich, alt und altmodisch zu sein und nicht mehr mithalten zu können, vor
mich hin sinnierte: Hatten sich die Wünsche der Frauen seit meiner Jugend
wirklich so drastisch gewandelt?
Die grundlose Verwendung unflätiger Ausdrücke entsetzte mich, bis ich
lernte, zwischen den forschen Zeilen zu lesen. Verblüfft merkte ich: Es hatte
sich rein gar nichts geändert. Die verschämten »Liebesbeichten« meiner Ju-
gend hießen nun »Intim-Protokolle«. Statt Damen outeten sich nun Mädels
und dies in einer Art, die mir die Schamröte ins Gesicht trieb. Ich bin halt nicht
»in«, das muss ich überwinden!, tadelte ich mich für meine bedauerliche Sch-
wäche. Man sprach nicht, sondern »talkte« über die große Liebe. Romantische
Gefühle jeder Art waren dabei »out«.
Trotzdem begriff ich bald: »Nicht nur für eine Nacht!«, die frühere Absage
an sexlüsterne Männer ohne feste Absichten, hieß nun, leicht idiotisch
formuliert: »Ich will, dass ein Mann mit der kompletten Packung von mir
schläft, nicht nur mit meinem Körper!« Sprach das »Blatt für die Hausfrau«
einst verschämt von »Erfüllung«, »großer Liebe« und »Wie erobere ich einen
Traummann?«, so lautete dies nun: »Richtig guten Sex hat man nur, wenn
man ein eingespieltes, aber nicht routiniertes Paar ist!«
Wie unerotisch. Kein Wort von Scham, von Sünde, keine Verbote, keine
Tabus, deren Bruch reizte. Nun riss man sich anscheinend nach einer – selbst
bezahlten – Tasse Kaffee im Hinterzimmer oder auf der Toilette eines Lokals
für einen Quickie die Kleider vom Leib, betrieb – nach Gebrauchsan-
weisung – oralen, analen oder sonst einen Sex, um sich nachher wieder nahtlos
in den Job zu stürzen. »Liebe und Lust bedeuten Arbeit! Man muss wach
147/186

bleiben – im Alltag und im Bett!«, lautete die Aussage einer 23-jährigen Psy-
chotherapeutin, die Sex wohl mit schwerer körperlicher Strafarbeit
gleichsetzte.
Mich amüsierte, dass die kessen »Lifestylemagazine« ohne Ausnahme und
ganz wie die biederen Damenzeitschriften von anno Schnee Tages- und
Wochenhoroskope boten. »Sind Sie verliebt?«, las ich unter meinem
Sternzeichen, dem des Löwen. »Dann gehen Sie doch aufs Ganze. Jupiter
prophezeit Glück in der Liebe und im Spiel.« Ein gutes Omen! Geradezu
maßgeschneidert für mich! Auch Ratschläge für die gute Küche fehlten nicht.
Kein lustvolles Sex-Abenteuer ohne ein Rezept für Kalbsbraten mit Beilagen im
Kerzenschein, kalorienarme Gerichte zum »Slimmen« oder die Empfehlung,
die Haare nur nach den Mondphasen zu waschen und den Lauf der Gestirne
beim Gießen der Blumen zu beachten. Eigentlich doch sehr bieder, die ul-
tramoderne Welt der Girls.
Verwirrt von den rasch wechselnden Sitten und Gebräuchen erlitten meine
hochfliegenden romantischen Träume einen Dämpfer. Im Zwiespalt der Ge-
fühle bedauerte ich, mich bei niemandem aussprechen zu können. Eine ehema-
lige Kollegin vorgeschrittenen Alters, von der ich wusste, dass sie ihren Mann
regelmäßig betrog, meinte auf meine zaghaften Andeutungen: »Nur im Fin-
stern, im Finstern, sonst geht gar nichts mehr!« Und meine Kosmetikerin, mit
der ich in der Hoffnung, von fremden Erfahrungen zu lernen, die vielen Affären
prominenter Mitbürger erörterte, während sie die Falten in meinem Gesicht
mit einer Pflegemaske zu glätten suchte, sagte emotionslos: »Na ja, Sie wissen
eh, auf dem Gebiet san die Männer jo wie die Tiere!« Ich suchte sogar eine
bekannte Sexologin auf, die mich gegen gutes Geld in den Techniken des
Geschlechtsverkehrs unterwies. Frau Dr. U. lehrte mich Atemübungen, ver-
bunden mit der, wie sie es nannte, doppelten Beckenschaukel zur Erhöhung
der Lust. Es war eine keineswegs billige Lektion, die ich als höchst ordinär und
wenig hilfreich empfand. Das Gute dabei war nur, dass ich, während ich den
komplizierten Anweisungen der Frau Dr. U. folgte und alle möglichen Verren-
kungen durchführte, den Vorsatz fasste, regelmäßig Body-Work zur Straffung
meines Körpers zu betreiben.
148/186

Im Übrigen harrte ich neugierig, etwas ängstlich, aber doch erwartungsfroh
der kommenden Dinge. Da ich auch »Sir«, dessen Betreuung mir zugefallen
war, selbstverständlich nicht mit solchen Problemen belästigen konnte, fand
ich in meiner Not den Weg zu Poldis Grab. Dort nahm ich auf einer Bank Platz,
beobachtete die im Wind schwankenden Zypressen und sinnierte traurig vor
mich hin. Menschen kamen und gingen. Sie waren meist schon alt, zittrig, oft
auch verwirrt, hatten Blumen bei sich und füllten an der Wasserleitung
Gießkannen. Zu meinem Erstaunen ertappte ich mich, wie ich mangels Gesell-
schaft – denn Mizzi mied mich weiterhin – dem Toten ausführlich von dem
sich rapide anbahnenden Abenteuer erzählte.
Reue über das Vergangene empfand ich nicht. Doch der Gedanke keimte in
mir, dass vielleicht alles anders gekommen wäre, hätte Poldi mit mir jemals ein
vernünftiges Gespräch geführt. Vollkommen durcheinander, schloss ich mein-
en Monolog: »Und was soll ich jetzt tun?«
Meine Verwirrung hatte ihren Grund. Drei Wochen nach unserer ersten
Begegnung hatte mich »Flo« in der schummrigen »Sky Bar« hoch über der
Kärntnerstraße, nach einem Bericht über erfreuliche Zuwächse in meinem
Bankdepot und dem vierten Drink, plötzlich an sich gezogen und mich mit ein-
er Leidenschaft, die mir fremd war und die auf mich fast unanständig wirkte,
geküsst. Mit pochendem Herzen und starken Kopfschmerzen war ich nach
Hause zurückgekehrt.
In meiner Aufregung hatte ich sogar das allabendliche Ritual des Bürstens
von Murli vergessen, der in dieser Zeit vollkommen in den Hintergrund trat.
Nachbarn klagten, dass er während meiner häufigen Abwesenheit auf fremden
Grundstücken herumstreunte und dort, auf dem Gartenzaun balancierend und
aus sicherer Entfernung, von oben herab ihre Hunde verhöhnte und bis zur
Weißglut reizte – viele der Behüteten und schon sehr Betagten erregten sich
derart, dass man um ihr Leben fürchtete. Darüber hinaus balgte sich mein
Kater, wie ich zu hören bekam, zu später Stunde unter ohrenbetäubendem
Gekreische mit anderen Katzen herum. Ich glaubte den Beschwerden, denn
sein lädiertes linkes Ohr und andere kleine Verletzungen bezeugten, dass Murli
zusehends zum kampferprobten Straßenkater verwilderte.
149/186

Es war an der Zeit, sein Leben wieder in sanftere Bahnen zu lenken und
auch gleich mich selbst zu beruhigen. Dazu würde sich die in den Tageszeitun-
gen angekündigte Tiersegnung hervorragend eignen. »Gläubige katholische Ti-
erhalter haben am 4. Oktober die Gelegenheit, ihren animalischen Begleiter vor
dem Wiener Stephansdom segnen zu lassen«, hieß es. »Tiere sind ein Teil der
Schöpfung, die uns Gott anvertraut hat«, verkündete der Dompfarrer von St.
Stephan, der sich nicht nur als Hirte zweibeiniger Schäfchen verstand, sondern
auch ein Herz für alle Vierbeiner bewies. »Da, lieber Murli, geh’n wir hin!«,
versprach ich dem Kater. »Stell dir vor! Sie schreiben, dass auf alle Tiere ein
Geschenkpackerl wartet!«
Ich kaufte für den Transport ein hübsches, bequemes, mit flauschigem Stoff
ausgeschlagenes Körbchen aus Weidengeflecht. Am Tierschutztag, dem Na-
menstag des hl. Franz von Assisi, machten wir uns um vier Uhr nachmittags
auf den Weg zum Domplatz. Ich im dunklen Kostüm, Murli, dem festlichen An-
lass entsprechend, mit roter Halsschleife. Unfreundlich lugte er durch das Git-
ter seines Korbes.
Als wir an der Hofburg vorbeigingen, hielt ich eine kleine Ermahnung für
angebracht: »Weißt du, Murli, dass es hier ›Dienstkatzen‹ gibt? Die verdienen
ihren Unterhalt nicht so leicht wie du mit den Aktien!« Tatsächlich hielt die
Burghauptmannschaft einige Katzen zur Bekämpfung der Mäuseplage in den
unterirdischen Gängen des mittelalterlichen Gebäudes. Im Budget gab es einen
eigenen Posten für das Futter der »Dienstkatzen«, wie ihr offizieller Titel
lautete.
Beim Singertor des Stephansdoms hatte sich, als wir ankamen, schon eine
große Menge versammelt. Ich stellte den Käfig, in dem sich Murli wütend hin
und her warf und sich mit Gewalt zu befreien suchte, ab und sah mich um.
Hunde aller Rassen, groß und klein, hässlich und hübsch, waren in Begleitung
ihres »Frauerls« oder »Herrchens« erschienen. Die meisten saßen artig da.
»So benimmt man sich!«, zischte ich dem Kater zu. Ein Mann führte eine sanft
käuende Ziege herbei, auch einige Pferde hatten sich eingefunden. Jugendliche
mit wilden Tattoos und auffälligen Piercings trugen Ratten und Mäuse unter
ihren Anoraks. Von Zeit zu Zeit verrenkten sie sich wie wild, um ihre Lieblinge
an der Flucht zu hindern. Dabei hatte die Kirche empfohlen, empfindsame
150/186

Tiere wie Kaninchen, Hamster, schreckhafte Mäuse und ähnliches Getier da-
heim zu lassen und an ihrer Stelle ein Foto mitzubringen.
Um fünf Uhr startete die Segnung mit einem Marsch der Gardemusik. Eine
Staffel von Polizeidiensthunden zeigte ihr Können. Murli ließ ein abfälliges
Fauchen hören. »Segen kennt keine Grenzen«, begann der Dompfarrer seine
Ansprache. Dann segnete er mit eigens aus Assisi importiertem Weihwasser die
Tiere samt Begleitung. Wieder zu Hause, entließ ich den Kater aus seinem tem-
porären Gefängnis. »Es war eine schöne Zeremonie«, rief ich hinter dem Kater
her, der wie ein Wirbelwind im Garten verschwand.
Eines Tages lud mich Flo ein zu einem kleinen Abendessen, keinem »Event«,
wie er betonte, in sein Loft im achten Bezirk, hoch über den Dächern Wiens mit
Blick auf die City. Er wollte mich seinem Freundeskreis vorstellen und mir
sein – sündteures – Domizil zeigen. Er gedachte selbst zu kochen. Im Lift traf
ich ein Mädchen: »Flo hat’s gut – ich wär auch gern da in Boboville, nicht im
asseligen Ottakring!«
Die Wohnung bestand, abgesehen von einem winzigen Schlafkämmerchen,
dessen angelehnte Tür ein ungemachtes Bett enthüllte, und einem Winter-
garten mit vorgelagerter Terrasse, aus einem einzigen riesigen, fast kahlen, tep-
pichlosen Raum. Gemütlich wie ein steriler Operationssaal, dachte ich sarkas-
tisch. Mittendrin thronte eine monströse, für den Ein-Personen-Haushalt
grotesk überdimensionierte Küche aus Edelstahl, die einem gut frequentierten
Restaurant zur Ehre gereicht hätte. Dort hantierte der fröhliche Hausherr, in
eine bunte Küchenschürze gehüllt und ein Glas Rotwein in der Hand, bei
dampfenden Töpfen.
Seine Gäste begrüßten sich überschwänglich mit Küsschen links, Küsschen
rechts. Alle kannten einander gut. Sie waren, wie ich gleich sah, viel jünger als
ich. Und sie gebärdeten sich auch so, kreischten beim geringsten Anlass schrill
auf und lungerten in der in den Wohnbereich integrierten Küche herum, wobei
sie »aperölten«, das heißt, Aperol tranken, Alkopops – Whisky mit Frucht-
saft – versenkten oder sich mit den Worten »Heute ist mir nach Chill-out« als
»Cocacoliker« zu erkennen gaben. Man kicherte, als ich einen »Sundowner«
wünschte.
151/186

Einige der »toughen« Girls steckten in mit wehenden Schals drapierten
Minikleidern, riesige »Ethno-Pletschn« um den Hals. An ihren dünnen, teil-
weise auch dicken Beinen machte ich extreme High Heels aus, in denen sie af-
fektiert über das Parkett klapperten. Allein ihr Anblick brachte meine Über-
beine, die ich in flachen, breiten Schuhen kaschierte, schon zum Schmerzen.
Andere wiederum trugen warme, kurze Wollkleider mit Stiefeln, die über die
Knie reichten. Auch kurze Shirts, kombiniert mit auf den Hüften sitzenden und
tätowierte Pobacken enthüllende Hosen gab es zu sehen.
Die jungen Männer, alle mit gesträubten, Gel-gestylten Frisuren – sie erin-
nerten mich an die Zeichnungen von Max und Moritz aus meiner Kind-
heit –, gefielen sich in zerknitterten Rollkragenpullovern oder offenen Hemden
zu abgewetzten, durchlöcherten Jeans und schweren, erstaunlich sorgfältig ge-
putzten Designerschuhen, vermutlich Statussymbolen. Krawatte trug keiner.
Alle wirkten unrasiert. Meine eigene, von einem Push-up-
BH
unterstrichene
und in Zaum gehaltene bürgerliche Eleganz wirkte in dieser In-Szene selbst auf
mich komisch. Flo, der meine Unsicherheit nicht zu bemerken schien und den
das hektische Treiben um ihn herum nicht beim Kochen störte, reichte mir
grinsend ein Glas. Ganz auf mich allein gestellt, lauschte ich den mit grotesken
Floskeln gespickten, größtenteils unverständlichen Gesprächen von Mau, Lizzi
und Sue, die sie in hysterischem Tonfall mit Gio, Joe und Dido führten, wobei
sie sich einer sehr affektierten, dialektlosen Sprache bedienten: »Tagsüber nur
Deskfood, macht aggro, super, dass Flo herdet.« Ein häufiger, wohl dem Ter-
roristenmilieu entnommener Schrei lautete: »Das ist Bombe!«
Niemand aus der Gruppe selbstsicherer, betont hochmütiger Jung-Invest-
mentbankerinnen und -banker würdigte mich eines Wortes. Einige musterten
mich jedoch schweigend wie ein altes, abstoßendes Insekt, das sich in die
Gesellschaft edler Schmetterlinge verirrt hatte. Ich hörte, wie eine der anderen
zuzischte: »Die ist aber wirklich kein Burner!« Schließlich fragte mich eine Lea
erstaunt, woher ich Flo denn eigentlich kenne. Sie tat dies in der steifen, über-
höflichen Art, in der man eben mit alten, etwas schwerhörigen Damen Konver-
sation betreibt. Keiner saß, wie ich es gewohnt war, artig Nüsse knabbernd
beim Aperitif in einer Wohnlandschaft, um sich dann auf entsprechende
Aufforderung hin zum hübsch gedeckten Tisch zu begeben.
152/186

Schließlich seihte Florian die »Pasta« genannten Nudeln ab, rührte die Pilz-
sauce um und forderte dann unter allgemeinem Gebrüll Lizzi zum Kosten auf.
Gespreizt entledigte sie sich der Sache: »Ist eh mega-hipp!« Dann nahmen die
Schrägen und Schicken alle um den großen Holztisch Platz, jemand verteilte
ohne Zeremonie Besteck und tiefe Teller, man warf einander die Papierservi-
etten zu, und das Festmahl begann.
Ich zwängte mich zwischen zwei junge Männer, von denen der Dido genan-
nte nur von »Spreads«, »Underlying«, »Swaps« und »Private Commodities«
faselte. Er lehnte sich, meine störende Anwesenheit sichtlich bedauernd,
gestikulierend über mich hinweg, wobei er seinen Ellbogen fast in mein Essen
tauchte.
Der Abend begann in Horror auszuarten, ich fühlte mich alt, müde und aus-
gestoßen. Dann jedoch machte sich Wut in mir breit, ich sammelte meine
Kräfte und nahm den Kampf mit den kindischen jungen Leuten auf. »Und wie
war die Performance Ihrer Portefeuilles im letzten Jahr?«, fragte ich Dido, der
mich durch sein weiches Kinn und seinen blöde-stieren Blick besonders reizte.
»Da habe ich andere Ergebnisse«, meinte ich herablassend, als er mir magere
Zahlen nannte. »›Bet and Gain‹ hat allein 500 Prozent zugelegt, und ›Inter-
antibiotics‹ – was sagen Sie zu dem neuen Impfstoff, dessen Zulassung bevor-
steht? Haben Sie wirklich nicht auf Euro-Dollar-Zertifikate gesetzt? Auch nicht
auf die Brent-Oil Futures von Goldman-Sachs? Und die tollen brasilianischen
Staatsanleihen? Ich wundere mich!«
Es wurde still in dem Affentheater. Didos Mund stand offen. »Sie scheinen
ein gutes Händchen zu haben«, murmelte er. »Die textet dich aber ganz schön
ab, Oider!«, lachte ein Girl. »Oh, fuck!«, antwortete der Angesprochene simpel.
Von da an betrachtete man mich mit einer gewissen Scheu, es gab keine
frechen Blicke und keine Schwierigkeiten mehr, ich beherrschte die komische
Tafelrunde. Als sie sich schließlich nach übermäßigem Alkoholgenuss weit
nach Mitternacht auflöste und sich der letzte Gast schwankend verabschiedet
hatte, blieb ich zurück. Das schmutzige Geschirr auf dem edlen Küchenblock
stank bestialisch, ebenso wie die Teller und die vielen Gläser auf und unter
dem Tisch, die einen abstoßenden Geruch verbreiteten. Flo war stark be-
trunken, ich war es auch. Trotzdem genehmigten wir uns noch Champagner,
153/186

den wir nackt – ich hatte alles, sogar meinen Push-up abgelegt – auf der (Gott
sei Dank stockfinsteren) Terrasse tranken. Beim Hineingehen brachte mich der
Kontrast zwischen dem unordentlichen Loft und den pedantisch in Reih und
Glied zum Trocknen aufgelegten Pilzen im Wintergarten zum Lachen.
Flo war nicht sehr sauber, er roch auch nicht gut, und das galt ebenfalls für
seine grellbunte Bettwäsche. Entgegen den Ratgebern sagte ich nichts von
»Frischmachen«. An den eigentlichen Liebesakt fehlte mir später die Erinner-
ung, er konnte nicht sehr lang und aufregend gewesen sein. Sehr wohl erin-
nerte ich mich an das knarrende, miese Bett, das mir beim Liegen Kreuz-
schmerzen verursachte. Die Sehnsucht nach meinem eigenen duftenden
Zuhause wurde riesengroß, als der wohlgeformte junge Körper an meiner Seite,
der lang ausgestreckt auf dem Rücken lag und mich an den Rand des Bettes
drängte, ein mächtiges, in hohe und tiefe Intervalle gegliedertes Schnarchen
von sich gab. »Mein Gott, nicht schon wieder!«, entrang sich mir, während ich
die gelbe Tapete betrachtete, wo die Lichter des Straßenverkehrs wechselnde
Schatten warfen. Ich zählte große und kleine Schafe und sehnte das Morgen-
grauen herbei. »Ach, wär ich doch daheim!«, seufzte ich.
Glücklich war ich trotz allem. Glücklich, die Liebe eines gut aussehenden
jüngeren Mannes errungen zu haben. Das gemeinsame Frühstück, für das ich
mich züchtig in den etwas schmuddeligen Bademantel meines Geliebten hüllte,
fand in merkwürdig schaler, trüber Atmosphäre statt, die mich etwas
enttäuschte. Keine Zärtlichkeit. Flo lächelte melancholisch und sprachlos, fast
wie ein Märtyrer. Es gab nur schwarzen Kaffee und Orangensaft: Beides bran-
nte mir im Magen und verursachte mir Übelkeit. »So spät schon, ich muss
laufen!« Flos Blicke glitten über den Unrat, dann sah er mich herausfordernd
an. »Bleibst du noch?«
Sollte ich das vielleicht für ihn putzen? Lieber nicht, sonst wirkte ich noch
wie seine Tante! Ich ignorierte den nicht ausgesprochenen, aber doch mani-
festen Wunsch. Wir verließen daher die Wohnung gemeinsam, und während
Flo nach einem flüchtigen Abschiedskuss ins Büro eilte, fuhr ich nach Hause,
nahm mir eine flauschige Decke, legte mich auf die Couch im Wohnzimmer
und überdachte die Ereignisse der letzten Nacht. Murli kuschelte sich an meine
154/186

Seite. Zu mir werde ich ihn nicht einladen können – das ist ihm hier zu
bieder!, war mein letzter Gedanke, bevor wir den Tag wohlig verschliefen.
155/186

Kapitel 15
15
Drei Tage später rief mich Flo an. Seine unerwartete Nachricht freute mich
sehr. »Du«, meinte er, »ich habe noch Resturlaub, den ich verbrauchen
müsste. Die Zeit wäre günstig, es ist ruhig in der Firma! Gönnen wir uns
miteinander eine kleine, feine Reise?« Empfand mein kühler »Lover« tatsäch-
lich Zuneigung für mich? »Das wäre wunderbar«, flötete ich entzückt und
stürzte mich in die Planung.
Es gab herrliche Ferienangebote. Für die Insel Mauritius im Indischen
Ozean warb ein Reiseveranstalter mit den Worten: »Die Vergangenheit war
gestern, und was kommt morgen? Hier lebt man jetzt und heute!« Ich sah mich
bereits in einem Luxushotel, vielleicht im eigenen Bungalow, faulenzen,
schnorcheln, an der Seite meines Freundes in der Sonne und im Bett liegen.
Ein Tauchkurs in der riesigen Lagune bot sich an. Hatte nicht die berühmte Re-
gisseurin Leni Riefenstahl diesen Sport im Alter von über siebzig Jahren
erlernt und dann zusammen mit ihrem um vierzig Jahren jüngeren Partner
Unterwasserfilme gedreht?
Meine Überlegungen schweiften weiter. Eine Luxus-Kreuzfahrt in die Süd-
see? Eine Rundreise nach Samoa – schon der Name weckte Sehnsüchte in
mir –, nach Tonga oder zu den Fidschi-Inseln? »Alles ist möglich« war nicht
nur das Motto der Klassenlotterie, sondern auch meines als wohlhabende Frau.
Sanfter Luxus, süßes Leben in einem teak-romantischen Kolonialhotel in Thail-
and, auch nicht schlecht! Dutzende malerische Inselchen der Maledivien lock-
ten mit 2700 Sonnenstunden im Jahr. Eine eklige Note brachte nur die Web-
site des Ministerpräsidenten des Inselstaates ins Spiel. Suchte der Spießer doch
allen Ernstes Ausweichquartiere für die Bewohner seiner kleinen Paradiese,
welche aufgrund des Klimawandels in naher Zukunft im Meer versinken

würden. Ein mieser Spiel-verderber, vergällt den Leuten ihren romantischen
Urlaub, der pessimistische Spinner!
Doch meine Träume von Palmen, Sonne, Meer und Südsee versanken noch
schneller als die Malediven, als mein Partner ein unspektakuläres Reiseziel
vorschlug: »Ach nein, nicht so weit weg! Ich dachte an D. im Waldviertel. Zum
Ausspannen und Erholen genau das Richtige. Ein Insider-Tipp! Und recht nah!
Ganz rustikal! Kein Internet, sogar das Handy funktioniert dort, wie ich höre,
nur sporadisch. Es ist Relaxen pur, und die heimischen Wälder geben in
puncto Pilzen einiges her. Es wird dir sehr gefallen.«
Ich schluckte. Enttäuschung machte sich in mir breit, bis Positives die Über-
hand gewann. Wollte mir mein Partner, der wusste, dass ich aus dem Wald-
viertel stammte, vielleicht eine Freude bereiten? So viel Zartgefühl brachte
mich fast zum Weinen.
D. war mir, obwohl die Entfernung zu meinem Heimatort nur etwa dreißig
Kilometer beträgt, persönlich unbekannt. Das lag daran, dass in meiner Kind-
heit nur wenige Familien Autos besaßen und selbst nahe Ziele in weite Ferne
rückten, sofern keine günstige öffentliche Verkehrsverbindung – hin und re-
tour an einem Tag – bestand. Postbusse verkehrten nur sporadisch, und Aus-
flüge, die ein Übernachten notwendig machten, zog man aus Gründen der
Bequemlichkeit und der Sparsamkeit nicht gern in Betracht. Auch die seltenen
Fahrten meiner Familie nach Wien waren stets aufregende, von meiner Mutter
sorgfältig geplante Unternehmungen.
So fand sie sich am Vortag der Reise – und zwar um fünf Uhr früh, dem Zeit-
punkt der Abfahrt des täglichen Busses – an der Haltestelle ein, gab dem
Chauffeur ein kleines Trinkgeld und reservierte für die zweistündige Fahrt am
darauffolgenden Tag Plätze in der ersten Reihe. Begaben wir uns mit der Bahn
in die Metropole, suchten wir alle knapp vor dem Aufbruch unser Plumpsklo
auf. Die Benutzung der tatsächlich immer sehr schmutzigen Zugtoilette hatte
meine Mutter streng verboten, Ausnahmen gab es nur in äußerst dringenden
Fällen. Wir trugen außerdem Handschuhe und waren mit weißen Leintüchern
ausgerüstet, mit denen wir unsere Sitze im Abteil belegten. Die Ermahnungen,
während der Fahrt so wenig wie möglich anzufassen, da bei den Österreichis-
chen Bundesbahnen alles verdreckt sei, klang mir noch lang in den Ohren.
157/186

D., das Ziel meiner Reise mit Flo, hatte sich bei den Wienern schon in der k.
u. k. Monarchie als idyllische Sommerfrische großer Beliebtheit erfreut. Wirkt
doch die kleine Stadt auf dem steilen Felsplateau, um das sich ein Fluss schlän-
gelt, wie die Illustration aus einem Bilderbuch. Eine uralte, mit Wachttürmen
und Schießscharten vollständig erhaltene Befestigungsmauer, einst trutziges
Bollwerk gegen Überfälle aus Böhmen, vermittelt Ritterromantik. Mit dem
Fortschritt der Technik war dem Städtchen seine strategische Bedeutung als
Grenzbastion verloren gegangen, es versank in Bedeutungslosigkeit. Die daraus
resultierende chronische Ebbe in der Stadtkasse hatte den Ort vor jeglicher
Modernisierung bewahrt. Gleichzeitig sorgte der Geldmangel auch für die
Erhaltung seiner mittelalterlichen Architektur.
Wir reservierten ein Zimmer in der »Schlosspension D.«, wenig später bra-
chen wir auf. Die Fahrt durch die Monokulturen des Weinviertels war lang und
öde. Doch als wir uns dem Manhartsberg näherten, wo sich Landschaft und
Klima ändern, gratulierte ich Flo zu seiner guten Idee. In der rauen, herben
Luft nahe der Heimat meiner Kindheit fühlte ich mich wohl. Die Zeit schien
stillzustehen, in die winzigen, ärmlichen Dörfer, die sich in Senken duckten
und unter der Abwanderung ihrer Bevölkerung litten, war der Fortschritt noch
nicht gelangt.
Es wurde immer einsamer, ruhiger und schöner. Dunkelgrüne Nadelwälder
gaben der menschenleeren hügeligen Landschaft ein melancholisches Gepräge
und machten den Rest der Strecke zum Fest für die Augen. Auf schmalen,
gewundenen Landstraßen erreichten wir das Ziel. Dieses entpuppte sich als
riesiges, von Weitem sichtbares Schloss, eine in der Barockzeit umgebaute
ehemalige Burg. Wir betraten den dreieckigen, mit unregelmäßigen Steinen
ausgelegten kühlen Hof, in dem ein alter Brunnen vor sich hin plätscherte. Es
herrschte vollkommene Stille. Erst nach einiger Suche fand sich ein dienstbarer
Geist, der uns einen großen Zimmerschlüssel aushändigte. Das Innere des his-
torischen Gemäuers wirkte, als hätte es der hochadelige Schlossherr schon vor
Jahrzehnten verlassen und dabei – absichtlich oder unabsichtlich – auf die
Mitnahme seiner gesamten beweglichen Habe verzichtet.
Wir bezogen einen Raum, groß wie ein Saal, mit einem riesigen Kachelofen
und einer kunstvollen alten Stuckdecke. Um diese zu schonen, hatte man – und
158/186

das sichtlich auch schon vor geraumer Zeit – Bad und WC in plumpen schrank-
artigen Verschlägen aus Holz installiert. Das aus verschiedenen Epochen bunt
zusammengewürfelte Mobiliar – barocke Truhen, wackelige Biedermeiersessel,
hohe, knarrende altdeutsche Betten – war, wie alles in dem herrschaftlichen
Bau, von edler Provenienz. Sehr abgewohnt, teilweise unbrauchbar, wie die Ra-
dios aus der ersten Phase des Rundfunks, oder unmotiviert, wie die alten Bets-
chemel in den Zimmern, verströmte es Stil und Charme und einen leichten
Modergeruch, der uns von der Benützung der Kleiderschränke abhielt. Unzäh-
lige, teils wertvolle Ölbilder, überlebensgroße Ahnenbilder in schweren Rah-
men, vergilbte Stiche und Zeichnungen verzierten die Wände der Gästezimmer
und die langen, mit abgetretenen Läufern bedeckten Gänge, wo Geweihe von
der Jagdleidenschaft der einstigen Bewohner zeugten.
Flo ruhte sich nach der anstrengenden Fahrt etwas aus, ich erkundete das
verschlafene Städtchen. Was ich sah, entzückte mich: gotische, dicht anein-
andergedrängte Bürgerhäuser samt großem Rathaus, gruppiert um einen teils
gepflasterten, teils als kleinen Park gestalteten, lang gestreckten Hauptplatz. In
der Mitte ein schmiedeeiserner Ziehbrunnen, dessen steinerne Einfassung ein
engmaschiges Gitter bedeckte. Dies hatte, wie ich bald merkte, einen guten
Grund. Dauerte es doch eine ganze Weile, bis das Echo des Steins, den ich
hineinwarf, vom Grund der Talsohle zurückschallte. Ein mittelalterlicher
Pranger mit Kette und Steinkugel in der lieblichen Grünfläche erinnerte an die
martialische Gerichtsbarkeit vergangener Tage, als man Verbrecher öffentlich
zur Schau stellte. In der Ortsmitte erhob sich eine romanische, von mächtigen
Pfeilern gestützte Kirche mit ebenso mächtigen Bogengewölben im halb
dunklen, kalten Inneren. Alte Grabplatten aus rotem Marmor an den Wänden
und im Boden kündeten von längst ausgestorbenen Bürger- und Adels-
geschlechtern. In einem gläsernen Sarg ruhten die in ein vermoderndes
Prunkgewand gehüllten Reliquien der hl. Valentina, laut einer vergilbten Ins-
chrift, das milde Geschenk einer frommen Schloss- und Patronatsherrin für
ihre Pfarrgemeinde, Souvenir einer Reise nach dem fernen Rom vor über zwei-
hundert Jahren.
Unter dem Steinbogen eines Hauses fiel mir eine Gruppe spielender Katzen
auf, die munter durch ein kleines Türchen ein und aus huschten. Als ich näher
159/186

trat, um die putzigen Tiere zu streicheln, entdeckte ich einen schon etwas ver-
schmutzten Brief, den jemand mit einem rostigen Nagel brutal an das Holztor
genagelt hatte. Sein Inhalt nahm mich weiter für D. ein. Schrieb doch der Bür-
germeister des Ortes höchstpersönlich und leicht verzweifelt:
Liebe Mitbürger!
Die herrenlosen Katzen werden zur großen Plage. Sie vermehren sich sehr.
Manche, wie Frau N., füttern sie auch noch. Es geht so weit, dass sie im Rathaus
sogar auf die Stiegen des Sitzungssaals hinmachen. Und das ist nicht schön!
Der Appell enthielt mehrere Rechtschreibfehler, die ein höhnischer Tierfreund
mit Rotstift korrigiert und mit einem beißenden Kommentar versehen hatte.
Nach einem Spaziergang auf der idyllischen »Sommer- und Winterpromen-
ade«, die man im 19. Jahrhundert unterhalb der Stadtmauern angelegt hatte,
kehrte ich gut gelaunt in unser verträumtes Schloss zurück. Am Abend bot das
einzige Wirtshaus des Ortes eine erfreuliche Überraschung: weiß gedeckte Tis-
che, köstliche ländliche Speisen wie Waldviertler Knödel, Schopfbraten, Kno-
blauchsuppe und Mohnnudeln, dazu eine Fliegenklappe zum Erschlagen lästi-
ger Besucher. Die Konversation der Gäste auf der wunderschönen Terrasse mit
weitem Blick über Wiesen und Felder bis zum Horizont ließ uns aufhorchen.
Wir hatten ländlichen Dialekt erwartet, hörten jedoch nur gepflegtes Parlieren:
über Regieführung, Literaturereignisse und Kongresse für Quantenphysik. Das
Rätsel löste sich: »San olle, blede Weaner, de ham die oiten Heiser kauft!«,
klärte uns einer der seltenen, mit »Hoizfiren und Hoizschneiden« für den
rauen Winter beschäftigten Ureinwohner missbilligend auf. »Aner hat Staner
g’suacht, a Deitscher, der is glei dobliebn!« Gemeint war ein Universitätspro-
fessor der Geologie aus Tübingen. Dieser hatte sich, überwältigt von der Fülle
der Fossilien, Muscheln und Haifischzähne, die er in dem vor zwanzig Million-
en Jahren am Rande eines Meers gelegenen Gebiet aufspürte, für immer in
einem der schönsten Häuser von D. niedergelassen. Überhaupt befand sich der
ganze Ortskern, wie wir erfuhren, fest in der Hand »zuagraster Spinner«, die
einen Filmclub betrieben und auf der Promenade nebst Hängematten allerlei
160/186

»Kunst« genannte Objekte aufgestellt hatten. Sie hielten Lesungen ab und be-
nahmen sich auch sonst unverständlich!
Am darauffolgenden Morgen genossen wir bei strahlend schönem Wetter
einen der letzten Tage am Fluss und erlebten dabei die »zuagraste« Gesell-
schaft von D. aus nächster Nähe. Das Buffet auf der Liegewiese betrieb eine
höfliche junge Dame, Literatin und Nachfahrin des großen Generalissimus
Wenzel von Wallenstein, dem Oberbefehlshaber der kaiserlichen Streitkräfte
im Dreißigjährigen Krieg. Sie kochte ausgezeichnet.
Ein pensionierter Hofrat maß stündlich Wasserstand und Temperatur des
sanft dahinströmenden grünlichen Gewässers. Die Daten notierte er, ob der
Kapriolen des Waldviertler Wetters häufig den Kopf schüttelnd, sorgfältig in
einem Büchlein. Kinder tobten auf der Wiese, spielten beim rauschenden
Wehr, schwammen und paddelten in kleinen Kanus, betagte Damen in ebenso
betagten Badeanzügen räkelten sich auf vergilbten Liegestühlen in der Sonne,
Schönheiten in knappen Bikinis belebten das Strandleben – mit einem Wort,
das Szenario wirkte wie die filmreife Kulisse zu »Sommerfrische 1950« von Fe-
derico Fellini. Es fehlte nur noch die betörende Begleitmusik von Nino Rota.
Alle waren heiter und gelöst.
»Was habe ich dir gesagt?«, meinte Flo beifallheischend. »Ist es da nicht
traumhaft?« Und es gab, wie er ganz richtig vermutet hatte, in unserer Her-
berge kein funktionierendes Internet. Ich konnte mich davon selbst überzeu-
gen, als ich den antiquierten, in einem Winkel des Schlosses verborgenen Com-
puter mit der Aufschrift »Eine halbe Stunde – 10 Schilling« benutzen wollte,
um den Stand meiner Aktien zu erfahren. Die Münze verschwand klirrend in
einer mit einem schweren Vorhängeschloss vor dem Zugriff böser Menschen
gesicherter Blechbüchse, doch das Gerät reagierte nicht. Auch das Handy hatte
nur sporadisch Empfang. Wir pflegten daher Erholung pur, verzichteten sogar
auf Zeitungen. Aber wir machten eine interessante Bekanntschaft, die den
Mangel an Publikationen und virtueller Kommunikation vollkommen ausglich.
Ein höflicher, distinguierter, gut gekleideter Herr mit beeindruckendem
grauem Cäsarenkopf und blendenden altösterreichischen Manieren, mit dem
wir zufällig ins Gespräch gekommen waren, lud uns am zweiten Abend unseres
Aufenthalts zu einem Drink in sein Vorgärtlein am Hauptplatz des Ortes. Er
161/186

war, wie sich herausstellte, die Seele der Wiener Clique von D. In oder vor sein-
er einfachen, finsteren, aber strategisch günstig gelegenen Wohnung – er hatte
das ehemalige Milchgeschäft zu seinem Wochenenddomizil erkoren – hielt er
Hof, hieß jedermann bis in die frühen Morgenstunden willkommen und bewir-
tete alle.
Wir entspannten uns im Schein der untergehenden Sonne auf seiner Garten-
bank und gaben die neutralen Beobachter. Hochinteressante, aber exzentrische
Typen, lauter großstädtische »Zuagraste«, schlenderten vorbei, setzten sich
dazu, blieben ein Weilchen. Ihre mit pikantem lokalem, teils bösartigem
Tratsch gewürzten konträren Weltanschauungen – das Spektrum reichte von
extrem rechts bis extrem links – entluden die meist akademisch gebildeten
Herrschaften in wilden Diskussionen. Cäsar wirkte besänftigend. Uns erzählte
er lächelnd, dass er bereits seit seiner Geburt, ja sogar schon kurz davor, die
Ferien stets hier in der Sommerfrische verbracht habe. Endgültig dieser ro-
mantischen Stätte vieler Kindheitserlebnisse verfallen sei er jedoch, als er in D.
eine in der Modebranche tätige attraktive Verehrerin des Philosophen Ludwig
Wittgenstein kennenlernte und sie heiratete.
Jeden Nachmittag frequentierten wir das einzige Café des Ortes. Dessen Bes-
itzer, ein junger Mann mit aufmerksamem Blick, war, wie uns schnell klar
wurde, kein Freund seiner Mitmenschen. »Na, kochen tua i net für die Leit!«
war sein Motto, mit dem er die Speisekarte auf ein Mindestmaß an köstlichen
Torten beschränkte. Die Äußerungen seiner Gäste registrierte er genau. Ver-
nahm oder vermutete er nur den Schatten von Kritik an seiner Person oder
seiner Geschäftsführung, verwies er sie unverzüglich des Lokals. Dies geschah
auch, wie man uns berichtete, wenn sich jemand der Not gehorchend, wie etwa
bei einem Wolkenbruch, »ohne Konsumation« in seinem Lokal unterzustellen
wagte.
Als passionierter Mykologe fand der Inhaber des »Mohncafés« jedoch an Flo
Gefallen. Gnädig erteilte er ihm seinen fachlichen Rat, mich duldete er. Am
misstrauischen Aufflackern seiner Augen erkannte ich aber deutlich, dass ich
mich haarscharf am Abgrund bewegte, als ich mich harmlos als Waldviertlerin
zu erkennen gab und meinte: »Auch meine Mohntorte ist gut, sehr saftig, ich
162/186

hab das Rezept von meiner Großtante!« – »Wird sitzenblieben sein, Ihr
Kuchen!«, erklärte er streitlustig die Saftigkeit meiner Backkunst.
Mein Freund graste nach dem Ratschlag des Cafétiers die Schwammer-
lplätze der Umgebung von D. ab. Manchmal ging ich mit, oft jedoch blieb ich
im Schloss, setzte mich in die tiefe Fensternische unseres Zimmers und las.
Oder ich beobachtete die Tennisspieler des örtlichen Clubs und lachte über die
Aussprüche des strengen, korpulenten ehrenamtlichen Sportwarts, der seine
eigenen Tennisfähigkeiten nur selten unter Beweis stellte. »Jessas, net amal
den erwischt er!«, bemerkte er, oder »Net schlecht, gö, Rudi, da schaust!« Oder
resignierend: »Rennen muaß ma halt!«
Als wir nach einer Woche heimfuhren, nahm ich mit Bedauern Abschied. D.
und seine Originale, egal ob Einheimische oder »Zuagraste«, sagten mir zu.
Mir kam es auch vor, als ob sich meine fragile Liebesbeziehung fern den Ver-
lockungen der Großstadt irgendwie gefestigt hätte. Auf jeden Fall hoffte ich,
mit Flo recht bald wiederzukommen. Wir könnten uns ein Häuschen in D.
mieten und dazugehören. Ich könnte sogar Tennis spielen lernen, träumte ich
im Stillen.
Der Empfang am Bierhäuslberg war kühl. Murli, den ich der Obhut einer
Nachbarin anvertraut hatte, strafte mich mit tiefer Verachtung. Er drehte sich,
als er mich sah, um und zeigte mir den Rücken. Dann ging er demonstrativ auf
ein Blumenbeet zu, setzte sich hinein und verrichtete seine Notdurft. »Ist das
notwendig?«, tadelte ich ihn sanft.
Voll Neugier schaltete ich meinen »Compi« ein, um die Entwicklung der
Börsen während meiner Abwesenheit zu überprüfen. Meine Aktien standen
ausgezeichnet – sie hatten beträchtlich zugelegt. Im Allgemeinen ging es den
Weltfinanzen jedoch schlecht. Vor allem Asien und Japan schienen in eine
Krise zu taumeln, auch Technologiewerte waren abgestürzt.
Im Vertrauen auf Flos Fähigkeiten regte mich dies nicht weiter auf, und ich
nahm den lange geplanten Umbau des Abstellraums im Keller zu einer edlen
»Wellness-Oase« frohgemut in Angriff. Dampfbad, Jacuzzi, Sauna sowie In-
frarotkabine sollten entstehen, und ich genoss die Vorfreude auf den zusätz-
lichen Komfort in meinem Heim.
163/186

Die Überwachung der Arbeiten nahm mich voll in Anspruch. Ein kleiner
Rohrbruch führte zu einer mittleren Überschwemmung, deren unerfreuliche
Beseitigung Zeit kostete, wie auch der – erfreuliche – Einkauf von elegantem
Wellnesszubehör.
»Meine Güte, in welchem Luxus lebe ich jetzt, welch ein Kontrast zu meiner
Kindheit!«, sagte ich zu mir. Nur wenige der alten Häuser in W. hatten damals
über fließendes Wasser verfügt, geschweige denn über richtige Bäder. Mein
Vater pflegte mich manchmal zu belehren: »Auch Goethe lebte nicht anders!
Kultur hat gar nichts mit eigenem WC und Bad zu tun! Trotzdem kann man
sauber sein. Kommt man nach Hause, wäscht man sich zuallererst im Lavur die
Hände!« Wünschte man ein Vollbad, hieß es viele Kübel bei der »Bassena« zu
füllen und das Wasser umständlich auf dem mit Holz geheizten Ofen zu erwär-
men. Erst dann konnte man den hölzernen Zuber besteigen.
Aufgrund der zeitraubenden Beschäftigung mit meinem modernen »Bade-
tempel« entgingen mir die immer drohender aufziehenden Wolken an meinem
eigenen Finanzhimmel, bis, ja, bis zu jenem fatalen Tag, an dem ich in die bei
uns einfach »Stadt« genannte City fuhr, um meine Garderobe dem neuesten
Stand anzupassen. Bepackt mit Einkäufen rastete ich im Kaffeehaus »Bräuner-
hof«. Im Allgemeinen ist es dort sehr ruhig, die Leute unterhalten sich gedäm-
pft. Diesmal jedoch störte mich, dass in zwei Logen hinter mir immer wieder
Gelächter aufbrauste.
Vorsichtig drehte ich mich um, denn ich glaubte einige mir bekannte Stim-
men zu hören. Tatsächlich die jungen Damen und der Mann waren alle aus der
Runde von Flos Abendeinladung! Was suchten sie in dem bürgerlichen
Kaffeehaus?
Als ich merkte, dass sie über mich, tatsächlich über mich redeten, traten mir
fast die Augen aus den Höhlen. Unwillkürlich spitzte ich meine Ohren, obwohl
ihre lauten Gespräche nicht zu überhören waren. »Ho, ho«, erklang es. »Erin-
nert ihr euch an die Alte bei der letzten Fete von Flo? Er managt ihr Vermögen
und muss, weil sie so zudringlich ist, mit ihr ins Bett. Sie hat an Narrn an ihm
gfressn.« – »Ja«, ließ sich eine weibliche Stimme vernehmen. »Und es soll, wie
er sagt, grauslich sein. Sie ist überall rasiert und faltig. Nackert schaut sie aus
wie ein hässliches altes Huhn.« – »Aber ist er denn nimmer mit der
164/186

Kathi?« – »Schon, aber heimlich. Ihr wisst, er hat das Geld der Alten auf Yen-
Hausse gesetzt. Alles, ohne Asset Allocation! Ist nimmer viel übrig. So opfert er
sich halt. Kostet den armen Flirtspecht viel Überwindung. Aber was tut man
nicht alles für den Job!« Ein tiefes Seufzen bemitleidete das Opfer seines
Berufes. »Ist wirklich alles weg?«, fragte eine männliche Stimme ungläubig.
»Weiß es nicht genau, glaub aber schon!«, ließ sich ein anderer vernehmen.
Ich wurde starr vor Schreck und Scham. Kälte stieg in mir auf. Leise rief ich
den Kellner, zahlte und schlich davon. »Na klar, der stille Urlaub in dem got-
tverlassenen Nest. Ich sollte nichts erfahren, niemand sollte mich sehen! Er
geniert sich mit mir!« Vielleicht hatte mein intimer Finanzberater auch auf die
Erholung der Märkte gehofft oder einen verzweifelten Coup gestartet. Die erste
Frage, die ich mir stellte: Bin ich wirklich so hässlich?, wurde bald durch eine
andere verdrängt: Wie viel ist denn um Gottes willen noch von meinem Geld
übrig? Oder ist tatsächlich alles verspekuliert?
Schock und Wut gingen tief. Wie betäubt saß ich zu Hause, stierte lange re-
gungslos vor mich hin und wartete auf das Abklingen von Schmerz und Ent-
täuschung. »Nur Mittel zum Zweck, wie eine Sexsklavin, eine alte!« Die bittere
Erkenntnis ließ mich weinen. »Nur du bleibst mir!« Ich streichelte das Fell von
Murli, der mir meine Abwesenheit bereits gnädig verziehen hatte.
Nachdem ich mich einigermaßen beruhigt und wieder in der Gewalt hatte,
griff ich zum Telefon. »Du hast Recht, es geht nicht besonders. Aber mach dir
keine Sorgen, ich hab das im Griff!«, log Flo ohne Hemmung. »Wird sich alles
bald erholen! Natürlich gibt es Verluste. Deine habe ich aber sehr gering halten
können!«
Tags darauf schrieb ich meiner Bank und bat um Kontoauszüge. Wenige
Tage später hielt ich Belege samt Kommentar in Händen. Vor meinen flim-
mernden Augen sah ich nur die Zeile: »… der negative Erfolg Ihres Eigenkapit-
als … Turbulenzen auf den Finanzmärkten … trotz sorgfältigem Management …
unvermeidliche Verluste …« Kurz ausgedrückt bedeutete es, dass Flo achtzig
Prozent meines Geldes in den Sand gesetzt hatte.
Mein Ex-Liebhaber, der bald von meinen Recherchen erfahren hatte, ließ
sich am Telefon verleugnen. »So geht es nicht, mein Lieber!«, tobte ich nach
dem x-ten Anruf bei ihm und der säuselnden Auskunft seiner Sekretärin, dass
165/186

sich der Herr Magister leider noch immer oder schon wieder auf einer wichti-
gen Dienstreise befinde. Der Vernichter meines Vermögens war für mich nicht
mehr zu sprechen. Auch sein stets eingeschalteter Voice-Recorder bedauerte
höflich die Abwesenheit seines Meisters, bat um Namen, Adresse und Telefon-
nummer für einen Rückruf, der ausblieb.
Inzwischen hatte ich alle Hemmungen abgestreift. Mit Mordgelüsten im
Herzen lauerte ich Abend für Abend vor dem Eingang von Flos edlem Zuhause.
Stundenlang ging ich bei Kälte und Regen auf und ab. Ein älterer Mann hielt
mich sogar für eine Prostituierte und sprach mich an. Ich harrte trotzdem aus,
bis meine Geduld nach drei Tagen belohnt wurde. Endlich sah ich, wie Flo zu
später Stunde unbeschwert pfeifend um die Ecke seines Wohnblocks bog. Seine
Züge umspielte ein selbstsicheres, zufriedenes Lächeln.
Grimmig und durchgefroren verstellte ich ihm den Weg: »Ich habe mit dir
zu reden!« Er wollte mich unwirsch zur Seite drängen. »Nachdem du mich so
gemein bei der Bank angezündet hast, gibt es nichts mehr zu reden«, suchte er
mich abzuwimmeln. Er war nicht mehr sanft, lieb oder einfühlsam, sondern
nur noch kalt und zynisch: »Du hast dich auf mich geschmissen. Als Sexfrus-
trierte hast nichts anders gewollt.« Ich gab mich versöhnlich: »Darf ich mir
wenigstens meine Kosmetika abholen?« Während ich in dem Badezimmer des
Lofts unleugbare weibliche Spuren registrierte, hagelten wüste Beschimpfun-
gen auf mich ein. »Du alter Trampel« war noch das Harmloseste. Selbst der se-
lige Poldi hat sich nie derartig geäußert, durchzuckte es mich. Ich raffte meine
persönlichen Habseligkeiten an mich.
Ein letztes Mal ging ich durch den Wintergarten auf die Terrasse. Und dabei
erledigte ich eine Kleinigkeit – ich tat ganz einfach, was ich unbedingt tun
musste. Es war ein hässlicher Abschied und ein trauriges Ende. Eine ganze
Woche lang litt ich fürchterlich, aß wenig und trank viel. Dann jedoch hob ich
den Kopf und zog Bilanz. Mit meinen eigenen Aktien, der Pension und
dem – gerade noch – aus Flos Fängen geretteten Rest meines Vermögens kon-
nte ich gut auskommen. Doch was für eine Zeit! Und was war seit Poldis Tod
alles passiert!
166/186

Hart war das Leben und ungerecht das Schicksal, das mich friedfertigen, gut-
mütigen Menschen in die Rolle einer M… – mir widerstrebte es, das hässliche
Wort zu verwenden – getrieben hatte. Alles sehr, sehr unangenehm, aber leider
unvermeidlich. Wer hätte an meiner Stelle anders gehandelt?
Zuerst die miese Sache mit dem verrückten, widerlichen Dr. Wegner. Emp-
fand ich als militante Katzenfreundin Mitleid mit ihm? Nein, wirklich nicht.
Dann die viele Mühe, die langen Jahre mit dem schwierigen Poldi. War ganz
schön anstrengend! Und vielleicht ein Grenzfall, der ohne die Aussicht auf die
Lebensversicherung gar nicht so stattgefunden hätte. Allerdings konnte ich
trotz gelegentlicher sentimentaler Anfälle nicht behaupten, dass ich meinen
Ex-Gatten wirklich vermisste. Und nun die Geschichte mit dem hinterhältigen
Flo. Flo, ach, Flo, lieber Flo! Ich bedauerte mich unendlich. Die Vorsehung
hatte mir zwar Schweres auferlegt, mir jedoch auch, wie ich zugeben musste,
prickelnde Momente und Erfolg beschert: »Kein Preis ohne Fleiß!«
Mittlerweile war es abermals Winter geworden. Weihnachten kündigte sich an.
Auf Plätzen und an Straßenecken verströmten die von fröhlichen
Menschentrauben umlagerten heimeligen Punschstände ihre verlockenden
warmen Duftwolken. Schnee fiel in dichten Flocken, und ein eisiger Nordwind
blies, als ich eines Morgens die »Nachrichten des Tages« aus dem Postkasten
holte. Neben der großen Weltpolitik stach mir sofort eine kleinere Überschrift
ins Auge: »Schreckliche Tragödie in der Josefstadt – menschliches Versagen.«
Konnte das tatsächlich mein Fall sein? Ich wagte kaum zu hoffen, denn sicher
ist in diesem Leben gar nichts. Aufgeregt blätterte ich schnell auf Seite 8, es
galt Näheres zu erfahren. Tatsächlich, ich irrte nicht. Endlich! Wie ich vermutet
und lange vergeblich gehofft hatte. Mein Warten hatte ein Ende. »Fünf Tote im
8. Bezirk nach Pilzvergiftung« lautete die Überschrift.
F. S., ein erfolgreicher Banker, galt als versierter Kenner aller heimischen Pilzarten. Am
Dienstag vergangener Woche feierte er seinen 39. Geburtstag. Die aus diesem Anlass
versammelte Gesellschaft erregte durch lautes Lärmen und Kreischen zu später Stunde
den Unmut der Nachbarn, niemand ahnte jedoch das schreckliche Ende des fröhlichen
Abends voraus. Wie sich später herausstellte, hatte der passionierte Hobby-Mykologe
167/186

seiner jungen Freundin sowie dreien seiner Kollegen ein selbst gekochtes Pilzgulasch
serviert. Tags darauf machten sich bei Gastgeber und Gästen Anzeichen von schwerer
Vergiftung bemerkbar, und sie wurden in das Allgemeine Krankenhaus eingeliefert.
Für die Betroffenen kam jede Hilfe zu spät, sie starben vier Tage später. Nach dem
Urteil der behandelnden Ärzte war die Todesursache der Patienten Leberversagen nach
dem Genuss von Grünen Knollenblätterpilzen. Die Umstände, die zum tragischen Ir-
rtum, der fatalen Verwechslung der Pilzsorten führten, bleiben im Dunkeln.
»Mir nicht, mir nicht«, jubelte das Böse in mir, während ich noch einen Bissen
vom Frühstück in den Mund schob und einen Schluck Kaffee dazu trank.
»Endlich! Endlich! Alle tot! Ich hab schon befürchtet, dass es nicht klappt!«
Dann kramte ich jenes kleine Büchlein hervor, das mir wertvolle Hilfe geleistet
hatte: »In Wald und Flur. Grundkurs Pilzbestimmung.« Ich betrachtete die
Widmung auf dem Deckblatt: »Von F. seiner gelehrigen Schülerin Hermine
herzlich gewidmet.«
Darin las ich: »Grüne Knollenblätterpilze (Amanita Phalloides). Sie enthal-
ten Amantin, das eine lebertoxische Wirkung entfaltet. Der Genuss der Pilze
verursacht das phalloide Syndrom, das mit einer Latenzzeit von 8–12 Stunden
auftritt. Es bewirkt Übelkeit und Brechdurchfall. Nach 24 Stunden stellt sich
häufig eine Beruhigung ein, die jedoch nur bei leichter Vergiftung ein Zeichen
von Genesung ist. In schweren Fällen kommt es zu Leberschäden, die meist
nach vier bis sechzehn Tagen zum Tod führen.« Und so war es auch bei den
fünf Unglücklichen gewesen.
Vor meinem geistigen Auge rollte die bereits mehrere Monate zurücklie-
gende peinliche Szene mit Flo ab. Und ich dachte daran, wie ich die zu der
schrecklichen Aussprache mitgebrachten getrockneten Grünen Knollenblätter-
pilze bei einem letzten, sentimentalen Rundgang durch die Wohnung meines
Geliebten schnell und geschickt unter Flos Trockenpilze gemischt hatte. Ich
erinnerte mich auch, welchen Spaß ich bei der Vorbereitung der Aktion hatte,
nämlich bei der Berechnung der für eine Person tödlichen Menge. Ja, in
Mathematik war ich in der Schule gar nicht so schlecht gewesen. Wir lernen
eben fürs Leben und nicht für die Schule!
168/186

Für einen erwachsenen Menschen beträgt die tödliche Dosis Amantin etwa
0,1 mg pro Kilogramm seines Körpergewichts. Für eine etwa 70 kg schwere
Person genügten also 7 Milligramm. Diese Substanz ist in weniger als 35
Gramm Frischpilz enthalten. Da ein Fruchtkörper oft 50 Gramm oder mehr
wiegt, ist ein einzelner verspeister Pilz bereits tödlich. Um jedes Risiko zu ver-
meiden, richtete ich die doppelte Menge her. Kein großer Aufwand, nur ein
Schwammerl mehr!
Einen kleinen humorvollen Gag meinerseits, auf den ich sehr stolz war, stell-
ten einige von mir zusätzlich servierte Fliegenpilze dar. Sie verursachen näm-
lich zwei bis vier Stunden nach der Einnahme Rauschzustände, Erregung und
Halluzinationen – die Erklärung für die exzessive Lustigkeit bei Flos letztem
Fest, das durch das raffinierte Fliegenpilz-Grüne-Knollenblätter-Gemisch zu
einem makabren Totentanz ausartete.
Es tat mir nur leid, dass Flo und seine Gäste nicht erfahren konnten, mit
welchen historisch bedeutenden Persönlichkeiten sie ihr Schicksal teilten. So
starb der römische Kaiser Claudius ebenso an einer Pilzvergiftung wie auch der
Habsburger Karl
VI
., der Vater von Kaiserin Maria Theresia. Beim Tod des Let-
zteren hatte der französische Philosoph Voltaire ausgerufen: »Ce plat de cham-
pignons a changé la destinée de l’Europe.« (Dieser Teller mit Pilzen hat das
Schicksal Europas geändert.)
Das Ende von Flo und seiner Tafelrunde erregte weit weniger Aufsehen.
Sollte ich Betroffenheit über den Tod Unbeteiligter empfinden? O nein! Ich
erinnerte mich, wie mich mein Liebhaber und sein Freundeskreis verleumdet
und der Lächerlichkeit preisgegeben hatten. In Militärkreisen spricht man bei
derartigen Fällen von Kollateralschäden, die zur Erreichung strategischer Ziele
in Kauf genommen werden müssen.
169/186

Kapitel 16
16
Flos Tod brachte keine pekuniären Vorteile, aber unendliche Genugtuung.
Danach bündelte ich meine Energiereserven und ging zur Tagesordnung über.
Fleißig bearbeitete ich mit Murli den Aktienmarkt, ging in Ausstellungen,
Konzerte und frequentierte wieder das Dommayer, wo inzwischen ein neuer,
jedoch nicht unangenehmer Geist herrschte. Eine Zeit lang hatte es ja finster
ausgesehen. Die Baustelle des an einen neuen Besitzer verkauften Kaffeehauses
hatte einen düsteren, wenig verheißungsvollen Anblick geboten. Stammgäste
lugten hinter die Planken, wo mit Rasanz gesägt, gehämmert und gestrichen
wurde, und kamen zu dem Schluss: »Da bleibt nichts übrig!«
Die Wiedereröffnung, zu der auch ich mich neugierig einfand, kam schneller
als erwartet. Zu unserer Verblüffung stießen wir Stammgäste auf eine uns
fremde Spezies, nämlich die Freunde der Konditorei Oberlaa. Wir beäugten
einander mit unverhohlenem Misstrauen. Einer Dame aus dem »alten« Dom-
mayer entfuhr beim Anblick der neuen roten Tapezierung der Sitzplätze ein
schriller Schrei: »Wie in einem Puff!« Die Tortenesser quittierten dies, der der-
ben Sprache wegen, mit sanftem Kopfschütteln. Schwerer wogen die Änder-
ungen auf der Speisekarte. Das »Kleine Gulasch« war ebenso verschwunden
wie das beliebte »Schnittlauchbrot«, und eine riesige Mehlspeisenvitrine
thronte an der Stelle einiger Logen. Ausnehmend hübsche Serviererinnen hat-
ten die grantig-humorvollen Ober ersetzt. Die Zeitungsständer waren nur mehr
dürftig bestückt.
Doch dann renkte sich alles auf mysteriöse Weise wieder ein. Die Zahl der
vom übermäßigen Genuss der ersten Tage erschöpften Tortenschlemmer nahm
ab, die typischen Kaffeehausbesucher behaupteten und engagierten sich auf
ihre Weise: Sie intrigierten und intervenierten, bis die alten Kellner samt Zei-
tungen zurückkehrten und die Speisekarte wieder ihren Vorstellungen

entsprach. Das Dommayer war gerettet. »Nachrichten von meinem Tod stark
übertrieben«, meinte ein gebildeter Gast, Mark Twain zitierend.
Der regelmäßige Kaffeehausbesuch war jedoch nicht tagesfüllend. Bald merkte
ich, dass ich mich eigentlich recht langweilte. Das Vorhaben, mir einen neuen
Bekanntenkreis zu schaffen, stieß auf unerwartete Schwierigkeiten, denn die
meisten Menschen lernt man doch an seinem Arbeitsplatz kennen. Gern wäre
ich der umschwärmte Mittelpunkt eines lustigen Freundeskreises gewesen.
Dies scheiterte jedoch, niemand schätzte mich besonders. Mühsam auf-
getriebene und hofierte Bekannte plauderten höflich und freundlich mit mir,
wenn ich sie anrief, um mich eindringlich nach ihren Familienproblemen zu
erkundigen, die mir tatsächlich vollkommen egal waren. Doch sie riefen mich
nie zurück, wie ich in meinem kleinen Büchlein sah, in dem ich alle Telefonate
genau vermerkte und registrierte. Bei der Lektüre meiner peniblen Notizen
verspürte ich denn auch einen schalen Nachgeschmack, Verbitterung über die
Zurückweisung machte sich breit. Mein Leben, meine Sorgen, meine Ängste,
meine Krankheiten und Leiden berührten niemanden.
Wut staute sich in mir auf. Manchmal stieg ich freudlos in meinen tollen
Wagen, den ich mir nur mehr schwer leisten konnte. Ich verkaufte ihn nicht,
weil mich die Tatsache maßlos ärgerte, dass der Jaguar in der kurzen Zeit-
spanne seit der Anschaffung enorm an Wert verloren hatte. So nutzte ich den
Luxusschlitten, wenn ich durch den dichten Verkehr ganz allein ins nächste
Kino fuhr. Steckte ich im Stau, dann dachte ich daran, dass man sich in meiner
Kindheit frei und gefahrlos auf den Straßen von W. bewegen konnte, denn
Autos hatten damals im Leben unseres Städtchens keine Rolle gespielt.
Überhaupt ist früher alles schöner gewesen, sinnierte ich vor mich hin. Wie
aufregend war für mich und meine Bande jeder Kinobesuch! Filme, besonders
jugendverbotene, waren schon in der letzten Klasse der Volksschule, als wir
kaum zehn Jahre zählten, unsere Leidenschaft. Selbstverständlich hätte uns
Herr Knoll, der strenge Besitzer des Stadtkinos, der stets beim Eingang stand,
um höchstpersönlich die Karten abzureißen, am Betreten des mit rotem Plüsch
üppig dekorierten und nach jeder Vorstellung mit Tannennadelduft besprühten
171/186

Saals gehindert. Er hätte auch sofort unsere Eltern verständigt. Und wir hätten
aus unserem Taschengeld nur schwer das Geld für den Eintritt aufgebracht.
Doch die Not machte uns erfinderisch. Nach Beginn der Vorführung, dem
Schließen der Tür und dem Abgang des Zerberus, der sich wieder hinter den
Schalter setzte, um Eintrittskarten zu verkaufen, traten wir in Aktion. Wir sch-
lichen durch den Hintereingang, nahmen im Schutz der Dunkelheit in der let-
zten Reihe Platz und genossen die verbotenen Früchte unseres Handelns: John
Wayne im Wilden Westen, den nur von wenigen beherzten Gladiatoren ver-
hinderten Untergang Roms, das sündige Leben der High Society, verkörpert
durch das Mädchen Rosemarie. Nicht alles verstanden wir, aber alles haben wir
genossen wie nie mehr im späteren Leben. Sonntags, wenn wir, als Belohnung
für gute Noten, säuberlich gekleidet und manierlich, von unseren Eltern in die
Nachmittagsvorstellung von »Schneewittchen und die sieben Zwerge« oder
ähnlichem Kinderkram geführt wurden, zwinkerte Mizzi mir zu. Wir kannten
anderes!
Überwältigt von diesen sentimentalen Erinnerungen beschloss ich, mit Mizzi
eine Aussöhnung herbeizuführen, koste es, was es wolle. Schon am nächsten
Tag entwarf ich einen versöhnlichen Brief, mit dem ich symbolisch eine
Friedenspalme schwenkte und eine Friedenstaube sandte. Da er auch Lügen
enthielt, kreuzte ich, abergläubisch wie ich war, beim Aufkleben der Brief-
marke fürsorglich den Mittel- über den Zeigefinger.
Liebe Mizzi!
Nach dem Tod meines lieben Leopold war alles für mich sehr schwer und
traurig. Die letzten Monate habe ich zurückgezogen gelebt, wollte niemanden se-
hen und schirmte mich von der Außenwelt ab. Ich musste mit meinem Schmerz
allein sein. Doch auch die größte Trauer kann nicht ewig währen, das Leben ge-
ht weiter. Deine Gesellschaft fehlt mir sehr, und ich möchte Dich sehen. Wie geht
es Dir und den Deinen?
In alter Verbundenheit
Deine Hermi
172/186

Zu meiner großen Freude antwortete Mizzi umgehend, wir trafen uns und nah-
men den Faden der zerrissenen Verbindung wieder auf. Ich trug ihr nichts
nach, suchte ihre Vorwürfe zu vergessen, denn auch sie blickte auf eine
schwere Zeit zurück. Ihr Mann hatte sie nach dreißigjähriger Ehe wegen einer
jungen, blonden und vollbusigen Physiotherapeutin verlassen, die nach einem
Bandscheibenvorfall durch gefühlvolle Massage seine Schmerzen beseitigt und
dabei sein Herz errungen hatte. Allen durch einen geschulten Mediator her-
beigeführten Versöhnungsversuchen war nur kurzer Erfolg beschieden
gewesen. Der reuige Sünder kehrte zwar einmal kurz zurück, bat mit Tränen in
den Augen und kniend um Verzeihung, erlag jedoch bald darauf wieder den
Lockungen der blonden Sirene. Kurze Zeit später machte er sich für immer aus
dem Staub. Mizzis Sohn hatte seinen Posten – den wievielten eigentlich? – ver-
loren, ihre Tochter war schwanger und ohne Mann. Die totale Misere! Unsere
gemeinsamen Spaziergänge an der frischen Luft gestalteten sich daher eher
trist. Nicht einmal der stimmungsvolle Adventsmarkt im Ehrenhof des
Schlosses Schönbrunn, wo wir am Fuß der imposanten Freitreppe zu weih-
nachtlichen Klängen einen oder mehrere Sisi-Punschs tranken, heiterten uns
richtig auf. Aber zwischen meiner Freundin und mir herrschte wieder die alte
Vertrautheit.
Alles war wie früher. Wirklich alles? Manchmal kam es mir vor, als ob mich
Mizzi in unbeobachteten Momenten mit seltsam lauernden Blicken musterte.
Vielleicht war es aber auch nur Einbildung. Auf jeden Fall dachte keine von uns
daran, die einst so lustigen »Viennese trips for two« wieder aufzunehmen. Die
dafür nötige Leichtigkeit war uns abhanden gekommen.
Die kleinen, spannenden Nervenkitzel aus meiner sparsamen Lebensphase
fehlten mir trotzdem sehr. Es blieb mir daher nichts anderes übrig, als eigene
Wege zu gehen. Ich trug meinem Verlangen Rechnung, schlich in der Cava-
liersbar des Hotels Imperial auf die Toilette und nahm dort kleine
Gästehandtücher aus Frottee an mich, für die ich keinerlei Verwendung hatte.
Ich raubte Kleinigkeiten, wie Minischokoladen aus dem Supermarkt, und ging
dazu über – wie ich es früher regelmäßig getan hatte – mich in Parfümerien zu
schminken. Bei Regenwetter stellte ich mich an den Straßenrand, notierte mir
173/186

die Nummern knapp vorbeizischender Autos und zeigte Lenker mit dem Hin-
weis auf meine ruinierte Garderobe an. Nach Flugreisen – ab und zu machte
ich eine kleine Städtereise zum Wochenende – führte ich eine lange Korres-
pondenz
um
die
Entschädigung
von – wie
ich
log – beschädigten
Gepäckstücken.
An manchen Tagen steckte ich nur zehn Schilling in meine Geldbörse und
bestritt mit dieser winzigen Summe, unterstützt von allerlei Tricks, mein
Essen. Ich nahm Gratiskostproben im Supermarkt und an den Ständen am
Naschmarkt. Bei »Billa« riss ich verstohlen Packungen auf und konsumierte
den Inhalt an Ort und Stelle. Allmählich kehrten wieder etwas Farbe,
Leichtigkeit und Spannung zurück in mein Leben, das dabei gewesen war, in
Monotonie zu versinken. Ich gab mich diesen kleinen Eskapaden selbstver-
ständlich nicht aus finanzieller Not hin, denn mein Vermögen wuchs an; ich
hatte, wie Börsianer zu sagen pflegten, ein »goldenes Händchen«, was Aktien
anbetraf.
Zur Abwechslung fuhr ich sogar an einem Wochenende nach D., wo ich mit
Flo so glückliche Stunden verbracht hatte. Doch im tiefen, nebeligen Winter
mit grau verhangenem Himmel, ohne Sonne und vor allem ohne die »Zuagras-
ten«, bot das Städtchen ein trauriges und bedrückendes Bild. Am Wirtshaus,
das den Besitzer gewechselt hatte, hing ein Schild: »Wegen Kälte geschlossen«.
Ich stapfte eine Weile im Schneematsch herum, bis mir die Nässe in den
Stiefeln unangenehm wurde. Fröstelnd nahm ich im Café Platz. Ich war der
einzige Gast des Menschenfeindes, der mir auf die Frage »Wie geht’s Ihnen
denn immer so?« griesgrämig antwortete: »Na ja, g’sund san ma halt!«, als ob
er schwere Krankheiten herbeisehnte.
Gesprächig wurde er erst, als er mir seine Pläne für die nächste Fremden-
verkehrssaison enthüllte. »Die Zimmer kosten jetzt bei mir 300 Schilling pro
Nacht, nimmer 200. Ich hab nix zum Verschenken. Und vermieten tu ich nur
mehr für drei Tage, Minimum! Wer net will, soll daham bleibn.« Wie er auf
diese Weise seine schon bisher wenig ausgelastete Herberge füllen wollte,
erklärte er nicht.
174/186

Ich kaufte mir im Lebensmittelgeschäft am Hauptplatz noch eine Semmel
mit warmem Leberkäs, aß sie, während ich zum Auto ging, und fuhr enttäuscht
nach Wien zurück.
Zwei Wochen nach unserer Versöhnung bat mich Mizzi um einen kleinen Geld-
betrag. »Mein Ex zahlt seine Alimente nicht regelmäßig. Kannst du mir bis zum
nächsten Ersten aushelfen?« Ich sprang gern ein. Da wir beide einsam war-
en – Mizzis Sohn gönnte sich von seinem Arbeitslosengeld einen Sex-Urlaub in
Thailand, ihre Tochter hatte die lang ersehnte Einladung der Familie ihres Fre-
undes erhalten –, beschlossen wir, den Heiligen Abend zu dritt in meinem
Häuschen zu feiern.
Ich traf alle Vorbereitungen, besorgte für meine Freundin einen
Kaschmirschal, für Murli eine Portion Lachs, schmückte einen kleinen Christ-
baum und kaufte eine Weihnachtsgans. Als Höhepunkt des Festmahls sah ich
eine saftige, köstliche Waldviertler Mohntorte vor, von der Art, wie ich sie von
einer Großtante her kannte. Am Tag vor dem Heiligen Abend ging ich an die
Zubereitung der Köstlichkeit. Ich stellte die Zutaten bereit: 160 g geriebener
Graumohn, 160 g feine Thea-Margarine, 160 g Puderzucker, 160 g
Kochschokolade, einen Esslöffel Rum sowie den Schnee von fünf Eiern. Dann
mischte ich Thea, Zucker, Dotter und Rum mit der geschmolzenen Schokolade,
mengte den Eischnee darunter, strich die Masse in eine gefettete Form und
schob sie für vierzig Minuten in das vorgeheizte Backrohr. Nach dem Abkühlen
überzog ich die Torte mit einer Schokoladenglasur.
Der Abend des 24. Dezember verlief ruhig, besinnlich und wehmütig. Zum
Auftakt tranken wir – alle drei – Sekt, packten die Gaben aus und setzten uns
an beziehungsweise unter den weihnachtlich geschmückten Tisch. Die Gans
roch nicht nur köstlich, sie schmeckte auch so, und die Torte war ein großer Er-
folg. »Kann ich das Rezept haben?«, gurrte eine gesättigte Mizzi. »Ich habe es
noch niemand verraten«, sagte ich zögernd. Oft schon hatte man versucht, mir
das Rezept zu entlocken, doch ich hatte mich stets standhaft geweigert. »Ich
gebe dir dafür das von meinem Risotto, der allen, auch dir, so gut schmeckt. Ist
175/186

auch ein Geheimnis!« – »Na gut, ich bringe es dir morgen vorbei«, gab ich
mich konziliant.
Wir hörten Weihnachtsmusik, plauderten noch ein bisschen, hauptsächlich
über Unverfängliches aus dem heimatlichen W., denn wir sparten die traurigen
Ereignisse der jüngsten Vergangenheit aus. »Wie aufregend ist der Heilige
Abend zu Hause immer gewesen. Die Spannung und die Ungeduld waren fast
unerträglich. Erinnerst du dich noch, wie dein Vater mit uns beiden und einer
ganzen Schar von Kindern, die daheim die geheimen Vorbereitungen für das
Christkind störten, unterwegs war?«
Tatsächlich hat mein Vater an jedem 24. Dezember in heroischer Weise die
Unterhaltung und Ablenkung der »Gschrappn« der Schlossergasse bestritten,
um den Müttern das Schmücken des, wie wir glaubten, vom Christkind her-
beigeflogenen Baums zu ermöglichen. Am Vormittag marschierten wir mit
ihm, vorbei an der Aufbahrungshalle mit der besinnlichen Aufschrift »Was wir
sind, werdet Ihr sein. Was Ihr seid, sind wir gewesen!« auf den außerhalb der
Stadt gelegenen Friedhof, wo wir Gestecke auf die Gräber unserer Vorfahren le-
gen und Kerzen anzünden durften. Auf dem Rückweg zeigte er uns in der
Stadtpfarrkirche die dort aufgestellte Weihnachtskrippe und hieß uns ein
kleines Gebet sprechen – eine erstaunliche Tatsache, denn mein antiklerikaler
Vater sparte ansonsten – zum Leidwesen meiner frommen Großmutter – nicht
mit abfälliger Kritik an Pfarrern und der katholischen Kirche. Er unterhielt uns
auch mit spannenden, gruseligen Geschichten, organisierte kleine Wettläufe
oder setzte sich an unsere Spitze, wobei er eine dampfende Lokomotive imit-
ierte, während wir in einer langen Reihe die Waggons spielten. Am frühen
Nachmittag lieferte er die Kinder bei ihren Eltern ab.
»Denkst du noch manchmal an die Puppe?«, fragte mich Mizzi. Ich wusste
sofort Bescheid. Kramte diese Frau jetzt sämtliche kleinen Untaten längst ver-
gangener Tage hervor? »Jetzt, wo du mich erinnerst, fällt es mir ein«, antwor-
tete ich vorsichtig. »Ich weiß aber nicht mehr, was aus dem teuren Spielzeug
geworden ist. Wahrscheinlich haben es mir meine Eltern weggenommen und
mir eine düstere Zukunft prophezeit.« Mizzi gab ein unechtes Lachen von sich,
um die nun folgende Beleidigung zu entschärfen: »Wenn ich so zurückdenk,
warst du doch ein kleines Luder. Gern g’habt hast du nur deinen Hasen und die
176/186
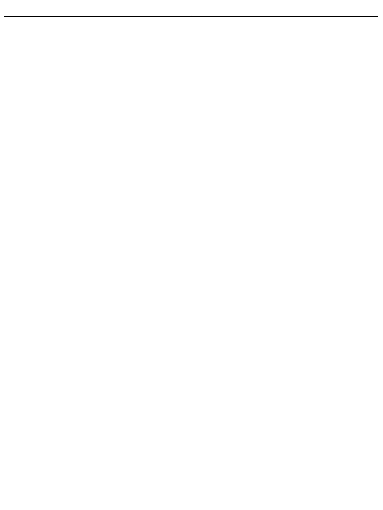
Katzen. Uns alle hast sekkiert. Nur der Hahn Peter …« Sie beendete den Satz
nicht.
Am ersten Weihnachtsfeiertag kopierte ich das Rezept der Waldviertler
Mohntorte auf teures Briefpapier, umwickelte es mit Goldfäden, hängte noch
einen Schokoladeengel daran und machte mich auf den Weg zu meiner Fre-
undin, in der vielleicht eine Feindin steckte. Sie empfing mich in ihrer bei der
Scheidung erkämpften Genossenschaftswohnung, die sie seit dem Abgang ihres
Mannes und dem Auszug der Kinder allein bewohnte. Freundlich lächelnd
überreichte ich meine Gabe.
Unerklärlicherweise lachte Mizzi wie eine Hyäne, drehte sich um und ver-
schwand in ihrer Speisekammer. Komisch, will sie mir das Rezept nicht aufs-
chreiben?, wunderte ich mich. Kurz darauf erschien meine Freundin grinsend
wieder. In der Hand hielt sie zwei Päckchen eines Fertiggerichts von Knorr mit
der Aufschrift »Risipisi für Genießer. Schnell zubereitet. In kaltes Wasser ein-
rühren, acht Minuten kochen – fertig!« Das also war das raffinierte Geheim-
rezept von Mizzis begehrtem, mysteriösem Risotto. Mir war nicht zum Lachen
zumute, doch ich nahm den Scherz gelassen hin, machte gute Miene zum bösen
Spiel und lud Mizzi zum Saunieren in meinem neuen Badetempel ein.
Die plötzlich so problematische Freundin meiner Jugendzeit kam, bewun-
derte mein Auto, meine Garderobe, einfach alles, und bat mich erneut um
Geld, obwohl sie den ersten Betrag noch nicht zurückgezahlt hatte. »Du wirst
es nicht glauben, aber mir geht es wirklich schlecht. Ich habe niemanden, den
ich bitten kann, nur dich. Du hast schon so viel Trauriges erlebt, du verstehst
mich, du wirst es mir nicht abschlagen, gell?« Dabei sah sie mich eigenartig
frech, fast herausfordernd an. Bahnte sich da eine Erpressung an?
In der Sauna musste ich mir dann zum x-ten Mal ihr Gejammer um das ent-
fleuchte Ehegespons anhören. »Und weißt du, dass diese Therapeutin eine Wil-
derin war?« – »Was ist eine Wilderin?«, fragte ich erstaunt. »Na ja, in ihrer
Freizeit pirscht sie ohne Jagdschein in Tiroler Wäldern und erlegt Rehe. Ein-
mal hat man sie ertappt und verurteilt. Stell dir das einmal vor! In so eine Frau
verliebt sich mein Trottel von einem Mann!« Ich heuchelte höfliches Er-
staunen, doch nach dem, was ich selbst in den letzten Monaten erlebt hatte,
wunderte mich nichts mehr.
177/186

Wir duschten uns kalt, und Mizzi blieb noch einige Zeit sitzen, um sich bei
dem Wechsel in die raue Winterluft nicht zu erkälten. »Sag mal, hast du nicht
den Mag. Schmid gekannt, den, der nach einer Pilzvergiftung gestorben ist?«,
fragte sie scheinbar beiläufig. Ich traute meinen Ohren nicht, antwortete je-
doch vollkommen gelassen: »Nicht wirklich, er war ein Kollege in der Com-
merzbank, der mich – und dies wirklich schlecht – beraten hat. Er ist ver-
storben? Bist du sicher? Weißt du Näheres?«
Mizzi erzählte mir daraufhin ausführlich, was ich schon über Flos Ende aus
der Zeitung wusste. Ich lauschte atemlos. Kleine Entsetzensrufe entrangen sich
mir. Meine Augen weiteten sich ob der schaurigen Tragödie. Ich hätte die Aus-
führungen mühelos mit noch schaurigeren Details ergänzen können, hütete
mich aber selbstverständlich vor jedem Kommentar. »Der Mag. Schmid ist
doch noch ziemlich jung gewesen?«, war alles, was ich glaubte gefahrlos von
mir geben zu dürfen. »Ja, viel jünger als wir beide!«, meinte Mizzi. Sollte das
eine Anspielung sein?
Danach hatte ich selbstverständlich keine ruhige Minute mehr. Was wusste
diese Frau? Und wie gefährlich konnte sie mir werden? Würden sich die ver-
langten Beträge steigern, bis ich nicht mehr bezahlen konnte? Oder war Mizzi
nur blöd, aber harmlos und alles ein Zufall?
Die mich plagenden Zweifel vergällten mir an den folgenden Tagen die
Laune. Hin und her gerissen zwischen Angst und Optimismus, gewannen
schließlich rationale Argumente die Oberhand. »Was könnte man mir beweis-
en? Im Fall des eingeäscherten Poldi gar nichts mehr. Bei Flo auch nicht. Es
gab keine Verbindung zwischen seinem Ableben und meiner Wenigkeit. Unsere
kurze Beziehung war doch schon Monate davor abgebrochen worden. Für un-
sere letzte – fatale – Begegnung gibt es überhaupt keine Zeugen! Und Hahn
Peter? Das ist ja fast nicht mehr wahr, so lang liegt die Sache zurück! Auch vom
Gesetz her ist das verjährt. Außerdem war ich minderjährig.«
Ich beruhigte mich, schöpfte Hoffnung und übte mich in Gelassenheit. Mizzi
sah ich auch weiterhin, sozusagen zu Beobachtungszwecken. Wir vertrugen uns
gut, obwohl unsere Freundschaft andere Dimensionen angenommen hatte. Mir
178/186

kam es vor, als ob wir einander belauerten in der Hoffnung, die Schwachstellen
der anderen festzustellen.
Zu diesem Zeitpunkt quälte mich schon seit Längerem eine hartnäckige
Bronchitis, ich hustete erbärmlich und fühlte mich schlecht. Mir schien es das
Beste, die Krankheit durch einen Klimawandel zu bekämpfen. Es gelang mir,
Mizzi am wolkenlosen, kalten, aber sonnigen Stephanitag zu einem Ausflug
nach Reichenau an der Rax, einen nur siebzig Kilometer von Wien entfernten
Luftkurort am Fuß von Schneeberg und Rax, den hochalpinen Hausbergen der
Wiener, zu überreden. Nach einer angenehmen Zugfahrt keuchten wir an der
Talstation der Seilbahn die steile Treppe zur kleinen Abfahrtshalle hoch. »Zwei
Seniorenfahrten, hin und retour«, verlangte ich forsch und in der Hoffnung auf
ungläubigen Widerspruch. Das wettergegerbte Männchen an der Kasse warf
einen Blick auf uns, dann händigte es die ermäßigten Karten aus, ohne einen
Ausweis zu verlangen. Wir verspürten Ärger. Dieser schwand jedoch augen-
blicklich, als wir in der Gondel standen. Eingekeilt zwischen lauter sportlichen
Schifahrern in voller Ausrüstung, schwebten wir in eine glitzernde Märchen-
landschaft, hinauf über schneebedeckte Baumwipfel, immer weiter, hinaus
über die Baumgrenze bis zur fast 2000 Meter hoch gelegenen Bergstation. Von
dort reichte die Sicht in der fahlen Wintersonne bis zum Semmering und zum
Sonnwendstein.
Wir tranken in der rustikalen Gaststube der Berghütte einen wärmenden
Glühwein und gingen dann eine kurze Strecke in Richtung Ottohaus, auf einem
von meterhohen Schneewächten gesäumten Weg. An manchen Stellen hatte
der Schneepflug Schneisen hinterlassen, man erahnte den tiefen Abgrund. Von
Neugier getrieben, tastete sich meine Freundin an den gefährlichen Schlund,
um hinabzusehen und die Aussicht zu bewundern. Kurz, ganz kurz geriet ich in
Versuchung. Soll ich es wagen? Kann ich es? Ist jemand in der Nähe? Werden
wir beobachtet? Ein kleiner, aber heftiger Stoß, und ich wäre mich von allen
realen oder irrealen Sorgen befreit gewesen.
Im letzten Augenblick riss ich mich zurück. Lass das, es ist deiner nicht wür-
dig! Nein, nicht so plump!, dachte ich bei mir, als sich Mizzi weit vorbeugte.
»Pass auf, Mizzilein! Was fällt dir ein? Zurück, zurück!«, schrie ich aufgeregt
und hielt sie am Ärmel ihres Anoraks fest. Drei Unglücksfälle genügten mir, ein
179/186

vierter hätte das Maß der Glaubwürdigkeit beträchtlich überschritten. »Danke,
aber es wär mir schon nichts passiert«, sagte meine Freundin, die Gefahr, in
der sie sich befunden hatte, stark unterschätzend. »Aber du weißt doch, dass es
jedes Jahr auf der Rax mehrere Unfälle mit tödlichem Ausgang gibt«, erklärte
ich ihr eindringlich.
Bald darauf kehrten wir ausgefroren, aber einträchtig nach Wien zurück.
Zum Abschied steckte ich ihr einen Umschlag mit einem kleinen Geldbetrag zu
und küsste sie – was ich sonst nie tat – auf beide Wangen.
Die Zuversicht jener Tage erfuhr durch Murlis Krankheit eine Wende zum Sch-
lechten. Als ich vom Ausflug auf die Rax zurückkehrte, sah ich die Mahlzeit des
Katers, der im Allgemeinen mehr, als ihm guttat, zu sich nahm, unberührt im
Vorzimmer stehen. Er aß auch weiterhin nichts, wirkte apathisch und verkroch
sich schließlich in eine Schublade meines Schreibtischs. Selbst seine
Lieblingsspeise, norwegischen Lachs, verschmähte er. Nachdem ich dies eine
Weile lang sorgenvoll beobachtet hatte, trug ich den Gefährten, mit dem ich,
wie dies übrigens auch Hemingway getan hatte, Tisch und Bett teilte, am näch-
sten Tag sofort zu jenem Tierarzt, der ihn schon seit Langem liebevoll betreute.
Jedes Jahr schrieb Dr. S. eine lustige Karte, mit der er Murli zu einer Kontrol-
luntersuchung samt Impfung einlud.
Dr. S. empfing seinen Privatpatienten freundlich. Nach kurzer Unter-
suchung schüttelte er bedenklich den Kopf und teilte mir die Diagnose mit:
»Leukose, Katzenseuche, unheilbar.« – »Wie ist das möglich? Sie haben ihn
doch immer geimpft? Ihm sogar einen Katzenpass ausgestellt.« – »Dagegen
leider nicht. Mir schien, dass Ihnen die Kosten dieser Impfung zu teuer sein
würden«, erklärte mir der infame Arzt, während ich in Tränen ausbrach.
»Was für eine idiotische Ausrede, um das eigene Versäumnis zu kaschier-
en!« Ich wankte mit Murli, der still in seinem Körbchen lag, erschüttert aus der
Ordination. »Diese Gemeinheit. Wie kann er mir unterstellen, dass ich bei
Murli Geld sparen wollte.« Noch am selben Tag brachte ich den Kater zur Am-
bulanz der tierärztlichen Hochschule, wo man mittels Infusionen und Injek-
tionen seinen Tod gerade noch verhindern konnte. Man teilte mir allerdings
mit, dass er nicht mehr ganz gesund werden würde, und riet mir zu einem
180/186

jungen Kätzchen. Als Gesellschaft für Murli und für alle Fälle. So kam »Carlo«
zu uns, ein hübsches, verspieltes sechs Monate altes Tierchen, ein Findling, das
mitleidige Menschen in der Tierklinik abgegeben hatten.
Von diesem Zeitpunkt verordnete ich mir, zur Aufrechthaltung meiner selbst
und um nicht zu verzweifeln, richtige Pep-Talks: »Wir sind nicht auf dieser
Welt, um stumm zu leiden. Der liebe Gott hat uns mit Verstand und Tatkraft
zur Lösung unserer Probleme ausgestattet«, sagte ich zu mir. Hatte ich mir das
nicht schon mehrfach bewiesen?
Am 1. Jänner des neuen Jahres leistete ich mir einen von langer Hand ge-
planten unerhörten Luxus – das berühmte Neujahrskonzert der Wiener Phil-
harmoniker, den gesellschaftlichen und musikalischen Höhepunkt der be-
ginnenden Saison im Wiener Musikverein. 300 000 Menschen aus aller Her-
ren Länder bewarben sich jedes Jahr um 1300, teils sogar durch das Los
vergebene, Plätze im »güldenen« Saal, der traditionellen Heimstatt der Phil-
harmoniker. Mir selbst war es erst nach vielen gescheiterten Versuchen gelun-
gen, eine der heiß begehrten Karten zu einem sagenhaften Preis auf dem Sch-
warzmarkt zu bekommen.
Mindestens 100 Millionen Zuschauer verfolgen jedes Mal das von einem
Stardirigenten geleitete und von Fernsehstationen in die ganze Welt übertra-
gene Konzert. Ich saß in der vordersten Reihe einer Loge im ersten Stock, das
wunderbare Ereignis überwältigte mich. Der Klang sich einstimmender Instru-
mente erfüllte den Raum. Welche Atmosphäre, welche Roben, welch festlicher
Rahmen. Welche Prominenz! Berühmte Schauspieler, altbekannte Politiker,
namhafte Künstler. Ältliche Industriekapitäne zeigten sich ebenso an der Seite
schöner, junger Damen, genau wie derbgesichtige, breitschultrige Männer, in
denen ich musikalische Drogenbosse vermutete. Zarte Japanerinnen trippelten
in traditionellen, kostbaren Festtagskimonos herbei.
Ich war natürlich auch sehr elegant gekleidet, aber leider ohne Begleitung.
Könnten doch Flo und Dr. Wegner – ich vermutete beide in der Hölle – herau-
flugen und mich in meinem Glanz sehen oder Poldi mich vom Fegefeuer aus
beobachten. Der Gedanke ließ mich schmunzeln. Dann hob der mit Ovationen
empfangene Dirigent seinen Taktstock, es wurde ganz still. Wahrlich
181/186

überirdische Klänge entführten mich in eine Sphäre der Seligkeit, ja der Wol-
lust. Altbekannte Melodien, dargeboten vom wahrscheinlich besten Orchester
der Welt, erzeugten in meinem Inneren eine unbeschreibliche Wonne. Ich
schwebte im siebenten Himmel. Der »Pizzicato-Polka« von Joseph und Johann
Strauss folgte die heitere »Tritsch-Tratsch-Polka«, das »Plappermäulchen«
und der »Künstlergruß«. Die »Champagner-Polka« ließ die Herzen des Audit-
oriums höher schlagen, und der »Champagner-Galopp« bewog selbst ältere
Herrschaften, sich verstohlen im Takt zu wiegen. Dem Walzer »An der schönen
blauen Donau« folgte lang anhaltender Jubel. Die Wiener Philharmoniker,
jeder von ihnen ein Star, erhoben sich feierlich gemessen von ihren Plätzen
und wünschten samt ihrem Dirigenten »Ein Prosit Neujahr«. Der von einem
internationalen Publikum mit enthusiastischem Mitklatschen begleitete Radet-
zkymarsch beendete das Programm.
Als veränderter Mensch, aufgeputscht und in dem Bewusstsein, eine
wichtige Mission im Dienste der Gerechtigkeit erfüllen zu müssen, verließ ich
hocherhobenen Hauptes den Konzertsaal. Was für ein Glück, in dieser herr-
lichen Stadt leben und zudem nachhaltig wirken zu dürfen. Warm in meinen
flauschigen Mantel aus Kunstpelz gehüllt – eine Tierliebhaberin trägt keinen
Nerz – trat ich ins Freie.
Die Zukunft hatte ihren Schrecken für mich verloren.
Ich war mir ganz sicher: Meine kreative Fantasie würde mich nicht ver-
lassen, dafür jedoch – vielleicht, wer weiß – Dr. S. und Mizzi! Im Vertrauen auf
meine Fähigkeiten und ein gnädiges Schicksal stellte ich mich den Aufgaben
des noch jungen Jahres: »Man kann nie wissen, was passiert!«
182/186

Glossar
Glossar
aufgemascherlt
festlich gekleidet
Ausnahm
Altenteil
Ausnahmstüberl
Wohnort des Altbauern,
nachdem die Kinder den Hof übernommen haben
Ausspeisung
Versorgung mit Essen, Armenspeisung
Badewaschl
Bademeister, aber auch Waschlappen
Bassena
öffentliche Wasserstelle in einem Mietshaus
Besoldung
Beamtenbezüge
Bettgeher
Mieter für eine Schlafstelle
Deka
Abkürzung für ein Dekagramm,
entspricht zehn Gramm
Dusel
Rauschzustand
Einspänner
österreichische Kaffeespezialität:
ein kleiner Espresso mit Sahnehaube und Puderzucker
Flinserl
silberne Ohrstecker
G’schpritzter
Weinschorle
Grammelknödel
Knödel, die mit gewürfeltem
Schweinespeck gefüllt sind
Gschrappn
verächtlicher Ausdruck für kleine Kinder
Haxlstellen
ein Bein stellen
Hendlstiege
schmale Treppe
Jause
Imbiss
Kleiner Brauner
österreichische Kaffeespezialität:
ein kleiner Espresso mit Kaffeesahne
Körberlgeld
Nebeneinkommen
Lavur
Waschschüssel (von frz. lavoir)
Mauner
Männer, hier: Freier
Melange
österreichische Kaffeespezialität:
ein kleiner Espresso mit Milch und Milchschaum
Parte
öffentlich ausgehängte Todesanzeige, oft mit Bild
raunzen
nörgeln
Reindl
rechteckige Auflaufform bzw. Bräter aus Metall

Rumpel
Waschbrett
schiach
hässlich
Schmäh
Witz, gepaart mit Schlagfertigkeit
Schusterlaberl
mit Kümmel bestreute Brötchen
aus Weizen- und Roggenmehl
sekkieren
drangsalieren, quälen
Stollwerck
Kurzbezeichnung für die im 19. Jahrhundert berühmten Hustenbonbons des
späteren Kölner
Schokoladenfabrikanten
Tackerl
Fußmatte
Tröpferlbad
öffentliches Brausebad
Ungustel
unangenehmer Mensch
Untermietkabinett
kleines Untermietzimmer
verhatscht
abgetreten
Wuchtel
Fußball
Zuagraste
»Zugereiste«, Bewohner eines Ortes,
die von anderswoher stammen
184/186

Danksagung
Danksagung
Für die Begleitung des »Hermine«-Projekts mit Ideen, Anregungen sowie konstruktiver
bis vernichtender Kritik danke ich herzlich:
Ingela und Gerhard Bruner, Angelika Euler-Rolle, Heidi Grätz, Klaus Hanousek, Eva
Horvath, Erwin Hirnschall, Elisabeth Leitner, Katharina Limberg, Hertha Kratzer, Eve-
line Mauermann, Freda Meissner-Blau, Walter Mika, Christa Mittermayer, Doris
Nacmer, Johanna und Christian Palmers, Hildegunde Piza, Katharina Scheidl, Johann
Sigmund, Gitta Tambornino, Martin Trautmann, Evelyn Trefny, Evelin Urbanski, Inge
Wagner, Stefan Weidinger, Eleonore Wegerer-Wöss, Renate Wiesbauer, Margarete und
Helmuth Widder, Albin Zuccato sowie der um Bonmots nie verlegenen Belegschaft des
Café Dommayer.
Für die sachkundige und gewissenhafte Lektorierung des Buches schulde ich Frau Uta
Rupprecht Dank.
Document Outline
- Leichenroulette
- Impressum
- Kapitel 1
- Kapitel 2
- Kapitel 3
- Kapitel 4
- Kapitel 5
- Kapitel 6
- Kapitel 7
- Kapitel 8
- Kapitel 9
- Kapitel 10
- Kapitel 11
- Kapitel 12
- Kapitel 13
- Kapitel 14
- Kapitel 15
- Kapitel 16
- Glossar
- Danksagung
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
def, p usz201006, Anna Maria Ziółkowska
czrwone gitary Anna Maria
Anna Maria
Bł Anna Maria Taigi
8 ANNA MARIA doc
Anna Maria
ANNA MARIA doc
Anna Maria
Anna Maria
Anna Maria(1)
Tajemnice Radosne s Anna Maria Pudełko AP
Anna Maria Orwat CHOROBY GENETYCZNE
Anna Maria Scarfo Napiętnowana
więcej podobnych podstron