
1945 und wir
Wie aus Tätern Opfer werden
Von Norbert Frei
Am 21. Januar verlassen die sächsischen NPD-Landtagsabgeordneten bei der
Schweigeminute "für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft"
demonstrativ geschlossen den Plenarsaal. In der anschließenden, auf Antrag der
NPD-Fraktion zustande gekommenen aktuellen Stunde zum 60. Jahrestag der
Bombardierung von Dresden sprechen die NPD-Abgeordneten Holger Apfel und
Jürgen Gansel offen vom „Bomben-Holocaust".
Dezidierter und kalkulierter ist in der Geschichte der Bundesrepublik die Verkehrung
der Unterscheidung von Opfern und Tätern bis dahin noch nicht betrieben worden.
Dabei stellt der Skandal von Dresden nur den vorläufigen Höhepunkt einer langen
Geschichte der Schuldabwehr und Schuldverkehrung dar. Diese reicht bis zu den
Anfängen der Bundesrepublik zurück - und erlebt in den vergangenen Jahren eine
fatale Renaissance. Weit über das rechtsradikale Spektrum hinaus mehren sich die
Anzeichen für einen Rückfall in die Deutungsmuster der 50er Jahre, in denen sich die
Deutschen als Hitlers erste - und eigentliche - Opfer verstanden.
1
"Wer sind denn wirklich die Kriegsverbrecher?" So fragte rhetorisch, im Oktober
1952, Bernhard Rameke beim ersten Nachkriegstreffen der WaffenSS in Verden an
der Aller. Die Antwort des Fallschirmjäger-Generals a. D. war damals weit über seine
Zuhörerschaft hinaus populär: Jene, "die ohne taktische Gründe ganze Städte
zerstörten, die die Bomben auf Hiroshima warfen und neue Atombomben
herstellen".
2
Solch scheinmoralische Kritik an den Siegermächten war Anfang der 50er Jahre im
Westen Deutschlands keine Seltenheit, aber auch im Osten anzutreffen – dort freilich
seitens des Regimes propagandistisch streng begrenzt auf das Stichwort Dresden
und die Kriegführung von Briten und Amerikanern. Handelte es sich in der DDR um
den "von oben" gelenkten Versuch, jüngst vergangene deutsche Leiderfahrung im
Sinne der aktuellen Ost-West-Konfrontation politisch auszumünzen, so in der
Bundesrepublik um das "von unten" artikulierte Verlangen nach Rücknahme der
politischen Säuberungsanstrengungen der westlichen Alliierten, das in der Forderung
nach Freilas-
*
Dieser Text basiert auf dem soeben im C.H. Beck-Verlag erschienenen Buch des Autors "Hitlers
Erbe: Die Deutschen und das Dritte Reich".
1
Vgl. Robert G. Moeller, War Stories. The Search for a Usable Past in the Federal Republic of
Germany, Berkeley, Los Angeles und London 2001; als Überblick und guter Einstieg in das
Themenfeld: Klaus Naumann (Hg.), Nachkrieg in Deutschland, Hamburg 2001.
2
Zit. n. Norbert Frei, Vergangenheitspolitik, München 1996, S. 282.

sung der seit 1945 verurteilten Kriegsverbrecher gipfelte. Unter der Oberfläche
allerdings ging es in diesen Diskursen hier wie dort um mehr, nämlich um
sozialpsychische Schuldentlastung auf sozusagen breitester Front.
Denn während die außenpolitische Räson der beiden neuen Staaten es gebot, der
"Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft" bzw. der "Opfer des Fa-
schismus" zu gedenken, erwartete die Mehrheit der vormaligen Volksgemeinschaft
wie selbstverständlich die Anerkennung aller ihrer Opfer - auch jener, die sich für die
Sache des Nationalsozialismus geopfert hatten.
Von den Opfern der Deutschen zu den Deutschen als Opfer
Das größte Interesse an dieser Politik der Schuldeinebnung lag bei der um 1905
geborenen Funktionsgeneration des Nationalsozialismus, die die Geschicke der
westdeutschen Gesellschaft noch lange bestimmte (und auch im Osten nicht ohne
Einfluss blieb). Es war in aller Regel diese Altersgruppe, aus der – anders als heute
vielfach behauptet: keineswegs erst nach Jahrzehnten, sondern regelmäßig seit
Gründung der Bundesrepublik – das Argument des tu quoque und der Hinweis auf
Bombenkrieg, Flucht und Vertreibung kam, wenn sich das offizielle Bonn zu einem
verantwortungsvollen Umgang mit der Jüngsten Geschichte" bekannte. Mit ihrer
reflexartigen Schuldabwehr, die Besucher wie Hannah Arendt schon in den ersten
Nachkriegsjahren konstatierten
3
, später mit dem beredten Schweigen auf die Fragen
der eigenen Kinder, verstellten sich wohl die meisten aus diesen Jahrgängen, die an
Hitler geglaubt und das System getragen hatten, die Möglichkeit einer echten Trauer
auch über das eigene Leid.
Die "skeptische Generation" der Wehler, Walser, Grass und Habermas zog aus
dieser Grundstimmung ihre eigenen Schlüsse. Dazu gehörte zunächst die
Weigerung, sich dem Selbstmitleid der nach-nationalsozialistischen Volks-
gemeinschaft anzuschließen, seit den späten 50er und frühen 60er Jahren dann aber
auch zunehmend der Mut, dem fortlebenden Hang zur Apologie einen anderen,
aufklärerischen Diskurs entgegenzustellen. Herrschaftsfrei war daran freilich wenig;
den einstigen Flakhelfern und jungen Frontsoldaten ging es, wie bald darauf den
Achtundsechzigern, um politisch-kulturelle Hegemonie, die sich nicht zuletzt im
richtigen – und das hieß: selbstkritischen – Sprechen über die Vergangenheit
manifestierte.
Für die "deutschen Opfer", für die Bomben- und Vertreibungstoten, auch für die
gefallenen Soldaten, war in diesem neuen Diskurs tatsächlich wenig Platz -
wenngleich, wie die florierende Verbandspublizistik und nicht zuletzt die offiziösen
Großdokumentationen über Flucht und Kriegsgefangenschaft belegen, von einer
"Tabuisierung" keine Rede sein konnte. Aber der Entschluss der damals um die
30jährigen, links bis liberal gesinnten Intellektuellen, den Oktroi des Westens als
"zweite Chance" (Fritz Stern) zur Demokratie kraftvoll zu nutzen, bedurfte einer
gewissen Selbstimmunisierung: auch durch die Zurückweisung falsch gestellter
Fragen und revisionistischer Antworten.
3
Hannah Arendt, Besuch in Deutschland, in: dies., Zur Zeit. Politische Essays, München 1989, S.43-
70.
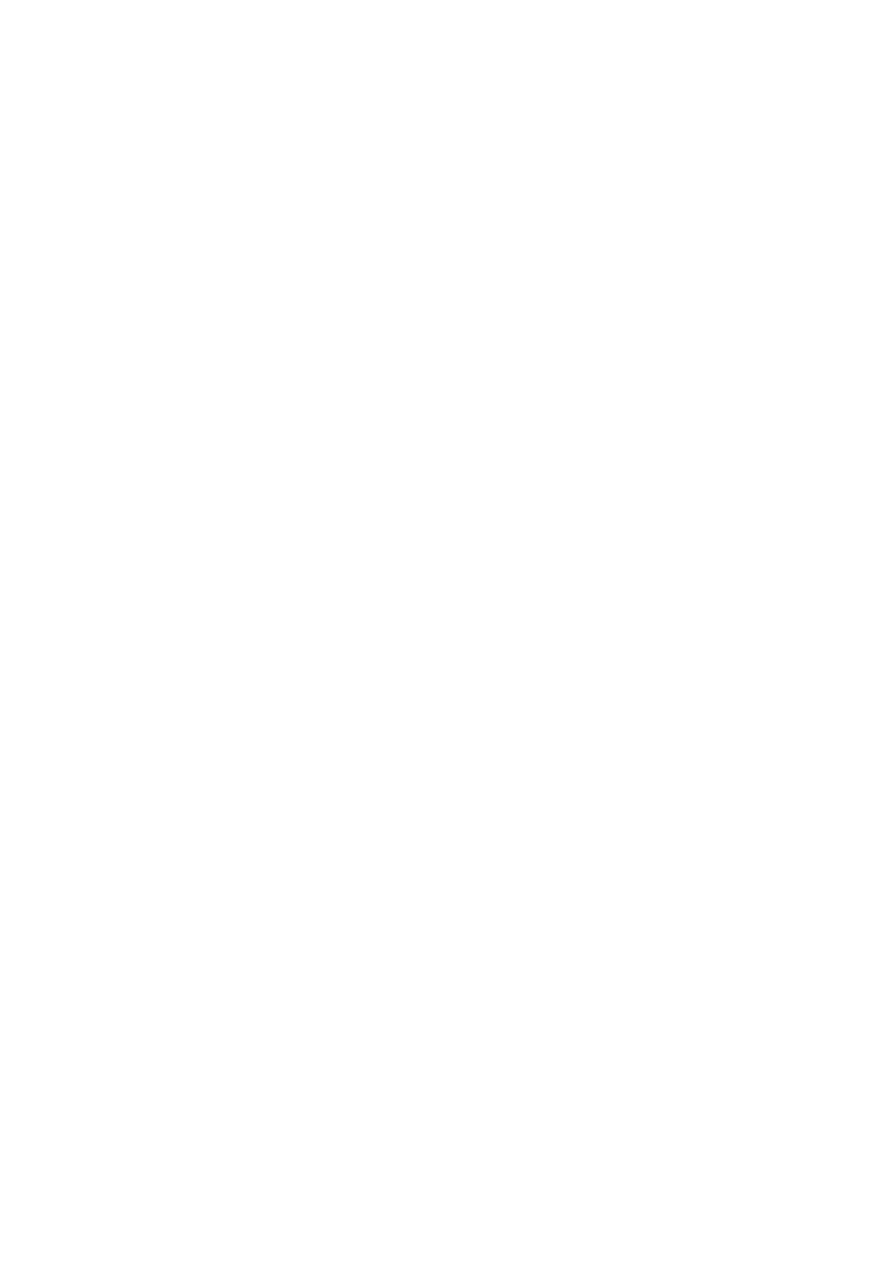
Aus dieser Einsicht in die demokratiepolitisch notwendige Unterscheidung zwischen
privater Erinnerung und staatlicher Geschichtsrepräsentation erklären sich die
Stärken wie manche Schwächen jener altbundesrepublikanischen "Vergangen-
heitsbewältigung", die sich als Gegenentwurf zur fortgesetzten Verdrängung
herausbildete und inzwischen selbst schon Historie geworden ist. Wer ihren
gesellschaftlichen Nutzen im Rückblick bewerten möchte, tut gut daran, die
denunziatorische Opposition der Verstockten in Rechnung zu stellen, die in der
kritischen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit über Jahrzehnte hinweg stets
nur eine schwarze Pädagogik der "Umerziehung" erblickten, die den nationalen
Selbstbehauptungswillen der Deutschen unterminiere.
4
Vielleicht spielte das Nachlassen dieser Abwehrhaltung eine Rolle, ganz sicher aber
die veränderte Generationenkonstellation und ein die Selbstversöhnung des Alters
suchender Blick auf die eigene Biographie, wenn sich im Laufe der 90er Jahre
manche ihrer ursprünglichen Verfechter vom Ethos der "Vergangenheitsbewältigung"
zu distanzieren begannen.
Jedenfalls war jene Selbstentpflichtung aus dem "Erinnerungsdienst", die Martin
Walser 1998 in der Paulskirche vortrug, nur das spektakulärste Beispiel für sich
wandelnde Positionen. Die Suche nach einem Verhältnis zu unserer Vergangenheit,
das den neuen Konstellationen angemessen scheint, ist seitdem eröffnet. Vielen geht
es dabei, wie Günter Grass 2002 in seiner Novelle über den Untergang der "Wilhelm
Gustloff ", offenbar um mehr Verständnis für die Erfahrungen und Zwangslagen des
Einzelnen- und um nachgetragene Empathie (auch) für die Opfer unter den
Deutschen. Irritierend an diesem "Krebsgang" bleibt allerdings Grass' rhetorischer
Trick, in der Gestalt des "Alten" sich selbst als Überwinder eines ungerechtfertigten
"Tabus" zu feiern – nämlich der angeblichen Vernachlässigung des Leids der
Vertriebenen. Fast musste man den Eindruck bekommen, als habe der
Nobelpreisträger seine Blechtrommel beiseite gestellt und eifere der frivolen
vergangenheitspolitischen Egozentrik seines Altersgenossen Walser nach.
Inzwischen zeichnet sich deutlicher ab, was bereits in der nicht sonderlich großen,
aber signifikanten Gruppe der Soldatensöhne zu beobachten war, die seinerzeit
gegen die Wehrmachtsausstellung demonstrierte: Auch in Teilen der Acht-
undsechziger-Generation, nicht zuletzt bei denen, die sich einst als Revolutionäre
begriffen, wächst die Bereitschaft zum milderen Urteil, ja zur Revision. Der radikale
Perspektivenwechsel – von den Opfern der Deutschen zu den Deutschen als Opfer
–, wie ihn der vormalige Linksaußen Jörg Friedrich mit seinen expressionistischen
Kaskaden über den Bombenkrieg zelebriert
5
mag immer noch die Ausnahme sein.
Aber wer ein wenig darauf achtet, der vernimmt aus Kreisen, die einstmals alles,
gerade auch das Private, für politisch hielten, unterdessen vielfach erstaunlich
unpolitische Töne einer pri-
4
Vgl. Caspar von Schrenck-Notzing, Charakterwäsche. Die amerikanische Besatzung in Deutschland
und ihre Folgen, Stuttgart 1965; Armin Mohler, Der Nasenring. Im Dickicht der Vergangenheitsbe-
wältigung, Essen 1989.
5
Jörg Friedrich, Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg, München 2002; ders., Brandstätten. Der
Anblick des Bombenkriegs, München 2003; kritisch dazu: Lothar Kettenacker (Hg.), Ein Volk von
Opfern? Die neue Debatte um den Bombenkrieg 1940-45, Berlin 2003.

vatistischen Geschichtsbetrachtung, in der sich die Unterschiede zwischen Tätern,
Opfern und Mitläufern verwischen.
Wo man vor drei Jahrzehnten (meist vergeblich) nach dem "roten Großvater"
fahndete, dominiert mittlerweile der Wunsch nach Aussöhnung mit den alten Eltern.
Und wo diese nicht mehr möglich ist, entdeckt sich – wir leben im Zeitalter der
Opferkonkurrenz – neues Leid aus der Scham über die vertane Chance. Ent-
sprechend mahnt eine pathetische Psychohistorie, den letzten Zeitzeugen" Gehör zu
schenken. Unter dem Motto: "Bevor es zu spät ist, geht es nicht mehr nur um
Gespräche mit Überlebenden der nationalsozialistischen Verfolgung, sondern ganz
unterschiedslos – und gleichwohl empathisch – um" Begegnungen mit der Kriegs-
generation"
6
. Die deutsche Gegenwartsliteratur reagiert auf dieses Bedürfnis nach
weicheren Bildern mit dem grassierenden Genre des Familienromans ".
7
Doch nicht allein in Büchern wird den Mitläufern und Tätern, die zu Opfern wurden,
das späte Mitgefühl ihrer Kinder zuteil; die Therapeutenszene kennt augenscheinlich
viele Deutsche der "zweiten Generation", die als Täter-Kinder nun versuchen, ihre
Väter und Mütter zu verstehen. Die Psychodynamik der Generationenfolge will es,
dass sich für die Kinder des Krieges mit dem Verschwinden der letzten aus den
Jahrgängen ihrer Eltern die Perspektiven auf die Vergangenheit noch einmal deutlich
verändern – bis hin zur Chance, sich selbst und die eigene Kohorte als Opfer zu
erkennen: des Bombenkriegs, der Vertreibung, der ererbten Schuldgefühle. Die
Identifikation mit den Opfern des Holocaust, einstmals Ausdruck einer bewussten
Distanzierung von der Elterngeneration, tritt darüber offenbar in den Hintergrund.
8
Die Folge davon ist ein vielschichtiger Prozess der Diffusion, wenn nicht des
Transfers von Empathie. Denn nicht nur rücken die Deutschen der "ersten
Generation` in der Wahrnehmung ihrer Kinder dorthin zurück, wo sie sich selbst am
Ende der Hitler-Zeit gesehen hatten, nämlich an der Seite oder gar an der Stelle der
Opfer des Nationalsozialismus; darüber hinaus erheischt die "zweite Generation" –
für sich selbst und für ihr Bild von ihren Eltern – die Anerkennung der eigenen
Kinder, mithin der "dritten Generation". Damit stehen, weil die Täter fast aus-
nahmslos gestorben sind, den wenigen noch lebenden Opfern des Holocaust und
anderer nationalsozialistischer Verbrechen sowie deren Kindern und Kindeskindern
inzwischen immer mehr Deutsche gegenüber, die sich ihrerseits als Opfer begreifen.
Seit die Flakhelfer abgewählt sind, seit dem Ende der Ära Kohl, hat ein neuer Ton im
Umgang mit der Vergangenheit auch Einzug in die Politik gehalten. Dabei ist es von
verstörender Ironie zu sehen, mit welchem Behagen sich die Generation Schröder im
Gnadenstand jener" späten Geburt" einrichtet, von der, seine Dankbarkeit zum
Ausdruck bringend, der vormalige
6
Bruni Adler, Bevor es zu spät ist. Begegnungen mit der Kriegsgeneration, Tübingen 2004.
7
Vgl. exemplarisch Harald Welzer, Schön unscharf. Über die Konjunktur der Familien- und Genera-
tionenromane, in: "Mittelweg 36", 1/2004, S, 53-64.
8
Dazu aus psychoanalytischer Sicht aufschlussreich: Christian Schneider, Der Holocaust als
Generationsobjekt. Generationsgeschichtliche Anmerkungen zu einer deutschen Identitätsproble-
matik, in: Margrit Frölich, Yariv Lapid und Christian Schneider (Hg.), Repräsentationen des Holocaust
im Gedächtnis der Generationen. Zur Gegenwartsbedeutung des Holocaust in Israel und Deutschland,
Frankfurt a. M. 2004, S. 234-252.

Hitler-Junge Günter Gaus gesprochen hatte, noch ehe sich ein nur wenig älterer
Helmut Kohl damit in Israel blarnierte.
9
Von Kohl zu Schröder
Doch das ist 20 Jahre her. Seitdem sind weitere Verkündungen des "Endes der
Nachkriegszeit" ins Land gegangen, und der Nachfolger im Kanzleramt des "neuen
Deutschland" (auch dies schon ein Kohl-Wort von damals) kann vieles äußern, was
einem Vorgänger noch reichlich übel genommen worden wäre – zum Beispiel den
bei Amtsantritt formulierten Wunsch nach einem Holocaust-Denkmal, zu dem die
Menschen" gerne hingehen".
10
Wenn Gerhard Schröder im Irakkonflikt einen
selbstbewussten "deutschen Weg“ bezeichnet, wenn er auf einem ständigen Sitz im
UN-Sicherheitsrat beharrt – für Deutschland, nicht für Europa – und in der Normandie
aus Anlass des 60. Jahrestages der alliierten Invasion postuliert, für eine Nation zu
sprechen, die "den Weg zurück in den Kreis der zivilisierten Völkergemeinschaft"
gefunden hat,
11
dann ist das alles keineswegs nur die Konsequenz einer durch den
Epochenbruch von 1989/90 objektiv veränderten politischen Lage. Es ist vielmehr
auch Ausdruck einer subjektiv als derart groß erlebten Distanz zum "alte[nl
Deutschland jener finsteren Jahre", dass sogar ein neues Spiel auf der Klaviatur des
symbolpolitisch wieder für attraktiv gehaltenen Patriotismus erlaubt zu sein scheint.
Gerhard Schröder, Halbwaise, Jahrgang 1944, aufgewachsen in prekären ma-
teriellen Verhältnissen, hat beste Aussichten, zum heimlichen Repräsentanten jener
rasch sich ausbreitenden Erinnerungsgemeinschaft der Kriegskinder12 zu werden,
deren Selbsterfindung wir gerade erleben: "Das Grab meines Vaters, eines Soldaten,
der in Rumänien fiel, hat meine Familie erst vor vier Jahren gefunden. Ich habe
meinen Vater nie kennen lernen dürfen." - Wer als Staatsmann in diesem Modus des
Privaten über die Geschichte spricht, der bekennt sich damit nicht nur zu einer
kohortentypischen " Schicksalslage " (Helmut Schelsky), der wirkt auch mit an einer
Umcodierung der Vergangenheit. In deren Mittelpunkt schieben sich nun: die
Deutschen als Opfer.
Dort aber liegen auch die Intentionen jenes "Zentrums gegen Vertreibungen", dessen
Errichtung die Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach, Jahrgang
1943, seit einiger Zeit mit aller Macht verfolgt. Die beträchtliche mediale Resonanz
13
,
die das Projekt im Zeichen des Übergangs
9
Kohl benutzte die von Gaus geprägte Wendung am 24.1.1984 zur Eröffnung einer Ansprache vor der
Knesset: "Ich rede vor Ihnen als einer, der in der Nazizeit nicht in Schuld geraten konnte, weil er die
Gnade der späten Geburt und das Glück eines besonderen Elternhauses gehabt hat.
10
So Gerhard Schröder am 1.11.1998 in einem Interview mit dem Fernsehsender SAT1.
11
Rede des Bundeskanzlers am 6.6.2004 in Caen, dokumentiert in: "Blätter", 7/2004, S. 895 f.
12
Vgl. Sabine Bode, Die vergessene Generation. Die Kriegskinder brechen ihr Schweigen, Stuttgart
2004; Hilke Lorenz, Kriegskinder. Das Schicksal einer Generation, München 2003.
1 3
Sowohl ARD als auch ZDF haben das Thema mit mehrteiligen Dokumentationen und
Begleitbüchern aus der Perspektive der Zeitzeugen aufgegriffen. Aus der Fülle der aktuellen Literatur
vgl. Helga Hirsch, Schweres Gepäck. Flucht und Vertreibung als Lebensthema, Hamburg 2004.
Exemplarisch für das demagogische Spiel mit angeblichen Tabus: Klaus Rainer Röhl, Verbotene
Trauer. Ende der deutschen Tabus. Mit einem Vorwort von Erika Steinbach, München 2002.

von der "Erlebnis-" zur "Bekenntnisgeneration" der Vertriebenen erfährt, ist zweifellos
einer der Gründe dafür, dass die Bundesregierung dagegen bisher nur par-
teitaktische Ablehnung zu formulieren wagte, aber kaum inhaltliche Kritik. Ungeachtet
der gravierenden Bedenken vieler in- und ausländischer Fachleute,
14
vor allem aber
auch gegen die öffentliche Meinung in Polen und Tschechien, soll das Zentrum nun
im nationalen Alleingang realisiert werden – und zwar in Berlin, in demonstrativer
Konkurrenz zum Denkmal für die ermordeten Juden Europas und zu anderen, zum
Teil erst noch entstehenden Erinnerungsstätten für die Opfer der NS-Verbrechen,
darunter dem Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma. Steinbachs wiederholte
Beteuerungen, man wolle mit der Stiftung die europäische Dimension der
Vertreibung betonen und ein "weltweit" wirkendes Instrument schaffen, "das dazu
beiträgt, Vertreibung und Genozid grundsätzlich als Mittel von Politik zu ächten"
15
,
wirken vor diesem Hintergrund wenig überzeugend. Die Verheerungen, die das
Vorpreschen der Vertriebenenfunktionärin und ihre unklare Haltung zu den
Restitutionsforderungen einer obskuren "Preußischen Treuhand" in den deutsch-
polnischen Beziehungen angerichtet haben, bedeuten nicht zuletzt einen schweren
Rückschlag für die Bemühungen um ein gemeinsames europäisches Geschichts-
bewusstsein hinsichtlich des Zweiten Weltkriegs und seiner Folgen.
Nationalsozialismus und Stalinismus
Doch die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus ist unterdessen
noch auf einer anderen Ebene der Relativierung ausgesetzt, auf der es ebenfalls um
deutsche Opfer geht: nämlich mit Blick auf die Verbrechen des Stalinismus. Das
Problem liegt dabei nicht so sehr, wie noch zu Zeiten des Historikerstreits, in der
Frage der Singularität des Holocaust und der Legitimität des Vergleichens, sondern
in dem nivellierenden Anspruch auf Anerkennung einer "doppelten Diktatur". Wo
historisch-politischer Verantwortungssinn es gebietet, auf Abfolgen, Kausalitäten und
Dimensionen des Terrors zu achten, neigt eine vor allem in Ostdeutschland (natürlich
nicht bei der PDS) populäre Opferperspektive zur Entdifferenzierung des Gedenkens.
Ausgangspunkt ist dabei das Gefühl, die Stätten politischer Verfolgung unter der
sowjetischen Besatzung und in der DDR erführen weniger Beachtung und finanzielle
Förderung als die Orte der Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus.
Im Deutschen Bundestag hat diese Auffassung ihren Niederschlag in einem Antrag
gefunden, mit dem die Unionsfraktion – symbolträchtig am 17. Juni 2004 – ein
"Gesamtkonzept für ein würdiges Gedenken aller Opfer der beiden deutschen
Diktaturen" verlangte. Der "millionenfache Mord an den europäischen Juden" weide
zwar, so hieß es in einer erst nach Protesten in die
14
Als Einstieg ausgezeichnet: "Zeitschrift für Geschichtswissenschaft", 1/2003, Themenheft: Flucht
und Vertreibung in europäischer Perspektive.
15
Zit. n. www.bund-der-vertriebenen.de/infopool/zentrumggvertreibung.php3.

Vorlage aufgenommenen, nicht nur sprachlich misslungenen salvatorischen Klausel,
"immer ein spezielles Gedenken erfordern"; im Übrigen aber seien beide deutschen
Diktaturen "von einer Gewaltherrschaft geprägt [gewesen], die sich in der
systematischen Verfolgung und Unterdrückung ganzer Bevölkerungsgruppen
manifestiert hat". Die Sorge, dass eine solche Argumentation auf angleichende
Deutung zielt, die kategorialen Unterschiede von Gewalt und Genozid verwischt und
zum Thema Zustimmung, Regimeloyalität und Täterschaft kein Wort verliert, vermag
auch der Hinweis nicht zu zerstreuen, mit dem der einstige DDR-Bürgerrechtler
Günter Nooke den Antrag im Parlament einbrachte: "Es steht ohne Zweifel: Bautzen
ist nicht Auschwitz! "
16
Diese Rhetorik der Plattitüden ist Teil des Problems, das zu lösen sie vorgibt. Ihr Ziel
ist eine politische Diskursverlagerung und die staatliche Kanonisierung eines
"nationalen Gedenkens", das die historischen Proportionen zu Gunsten der
Erinnerung an die Opfer des deutschen Kommunismus – und nicht zuletzt: an die
Vorkämpfer seiner friedlichen Überwindung – verschiebt. Anstelle der deutschen
Täter und Mitläufer sollen die deutschen Opfer und Freiheitshelden in den
Vordergrund treten, und dazu passt, dass die Antragsbegründung drei weitere
"Ereignisse und Themenkomplexe" aufzählt, die "in der Erinnerungskultur der
Deutschen zu Recht einen herausgehobenen Platz beanspruchen": die "Opfer von
Flucht und Vertreibung", die "zivilen Opfer der alliierten Luftangriffe" sowie die
"friedliche Revolution und Wiederherstellung der staatlichen Einheit " .
17
Bereits vor dieser aufschlussreichen Geschichtsdebatte des Bundestages, die im
Ausland kritischere Beachtung als im Inland fand, hatte im Februar 2003, von einer
breiteren Öffentlichkeit ebenfalls kaum registriert, der sächsische Landtag ein
Gedenkstättengesetz verabschiedet, dessen "Analogisierung und Relativierung von
NS-Verbrechen gegenüber denen des Stalinismus und der Staatssicherheit der
DDR" den Zentralrat der Juden in Deutschland zur Aufkündigung seiner
Zusammenarbeit mit der Stiftung Sächsische Gedenkstätten bewog. Auch die
Empörung des stellvertretenden Zentralratsvorsitzenden Salomon Korn über die
ethnozentrische Rede der vormaligen lettischen Außenministerin und nachmaligen
EU-Kommissarin Sandra Kalniete, die im Frühjahr 2004 auf der Leipziger
Buchmesse "Nazismus und Kommunismus" als "gleich kriminell" bezeichnete, von
der Beteiligung der Letten am Holocaust jedoch geschwiegen hatte, stieß in den
deutschen Feuilletons auf wenig Unterstützung – ganz zu schweigen von den herben
Reaktionen auf Korns Plädoyer gegen die auf Wunsch des Bundeskanzlers von der
Stiftung Preußischer Kulturbesitz präsentierte "Friedrich Christian Flick Collection " in
Berlin.
18
Schröders dortige Eröffnungsrede demonstrierte, wie frei sich der Kanzler im
Umgang mit der deutschen Vergangenheit fühlt: Nicht nur rechtfertigte er
16
Vgl. Otto Köhler, Gedenkstättendialektik, in: "Blätter", 8/2004, S. 906-908.
17
Deutscher Bundestag, 15. Wahlperiode, Drucksache 15/3048 bzw. Stenographische Berichte, 114.
Sitzung vom 17.6.2004.
18
Beide Texte jetzt in: Salomon Korn, Die fragile Grundlage. Auf der Suche nach der deutsch-
jüdischen "Normalität", (erweiterte Auflage) Berlin 2004.

die Entscheidung zu Gunsten Flicks, dabei Ursache und Wirkung vertauschend, als
eine "Garantie gegen "Geschichtsvergessenheit"; seinen Kritikern erteilte er auch
noch Zensuren: "Die öffentliche Debatte, die um die Ausstellung und ihren Sammler
entbrannt ist, ist produktiv - jedenfalls gelegentlich – und auch lehrreich – nicht
immer. "
19
In den Medien verlief die Sache am Ende so, wie Schröders spin doctors
sich das gewünscht haben mussten: im Sande, aber nicht folgenlos.
"Schlussstrich mit links" ?
Denn inzwischen gilt Gerhard Schröders Auftritt vor der Flick-Collection manchen
Beobachtern bereits als Glied in einer Kette, die mit den Veranstaltungen zum 60.
Jahrestag des D-Days und des Warschauer Aufstands begann und außenpolitisch
mit der Teilnahme an den Moskauer Feierlichkeiten zum 9. Mai 2005 ihren Abschluss
finden soll: "Bausteine einer Neupositionierung Deutschlands – einer sehr bewussten
Vergangenheitspolitik", so ein Kommentator des ZDF.
20
Und unter der Überschrift
"Schlussstrich mit links“ feierte im "Stern" einer der treuesten journalistischen
Interpreten des Kanzlers diesen ob seines Eintretens für Flick gar als "Erlöser, der
Schluss macht mit vergangenheitsverhafteter Selbstkasteiung. Die Bürde der NS-
Verbrechen wird umgeladen von der Schulter drückender Schuldgefühle auf die
Schulter historischer Verantwortung - und damit leichter".
21
Das Ende der Schuld scheint also nahe, und von links bis rechts sind die Er-
wartungen an diesen Zustand groß. Einem Land, in dem keine Täter mehr leben,
eröffnen sich, so die Auguren, bisher nicht gekannte Chancen, Vielleicht noch größer
als in der Politik, wo Europa Halt und Rahmen gibt, sind die Hoffnungen in der
Wirtschaft, deren Wortführer auf den Abschied von "deutscher Selbstzerstörung"
durch zu viel Geschichte setzen
22
und wo die erzwungene Zwangsarbeiter-
entschädigung als abgehakter letzter Akt auf dem Weg zu fürderhin ungestörten
Geschäften mit dem Ausland gilt. Von dem Aufbruch in eine Unternehmenskultur, die
Anfang der 90er Jahre Selbstaufklärung und historische Bewusstseinsbildung
versprach, ist denn auch kaum mehr geblieben als ein Dutzend ungelesener
Konzerngeschichten.
Noch unausgegoren, aber unübersehbar, macht sich ein neues Geschichtsgefühl
breit.
23
Gewiss, die politisch-normative Großdeutung der Kapitulation des Deutschen
Reiches wird auch im Abstand von 60 Jahren der Linie folgen, welcher Richard von
Weizsäcker 1985 – spät genug – zur Durchsetzung ver-
19
Rede von Bundeskanzler Schröder zur Eröffnung der Friedrich Christian Flick Collection am
21.9.2004 in Berlin, dokumentiert in: "Blätter“, 11/2004, S. 1398-1400.
2 0
Peter Frey, Der Kanzler und ein neues Klima. in: ZDF online vom 29.9.2004,
http://zdf.de/ZDFde/inhalt/21/018722195925.00.html.
21
Hans-Ulrich Jörges, Schlussstrich mit links, in: "Stern", 46/2004, S. 60.
22
So jetzt Hans-Olaf Henkel, Die Kraft des Neubeginns, Deutschland ist machbar, München 2004.
23
Anstelle einer Vielzahl publizistischer Belege und demoskopischer Daten vgl. die empirische
Untersuchung auf der Basis einer Befragung von mehr als 2 000 Essener Studenten7 Klaus Ahlheim
und Bardo Heger, Die unbequeme Vergangenheit. NS-Vergangenheit, Holocaust und die
Schwierigkeit des Erinnerns, Schwalbach 2002; außerdem Alphons Silbermann und Manfred Stoffers,
Auschwitz. Nie davon gehört? Erinnern und Vergessen in Deutschland, Berlin 2000.

half und die nach einer weiteren Dekade im Westen Deutschlands so befestigt war,
wie sie im Osten bezweifelt wurde: der 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung. Doch
wenn nicht alle Zeichen trügen, dann leben wir, was unseren Umgang mit der
Vergangenheit betrifft, in einem Gezeitenwechsel. Zwar sind manche der Täter noch
immer unter uns, und die jüngsten ihrer Opfer, die damals überlebten, werden uns,
zu unserem Glück, noch ein Zeitlang begleiten. Dennoch wird die Zukunft der
Vergangenheit eine Gegenwart ohne die Überlebenden sein. Damit stehen wir an der
Schwelle des Übergangs von der Erfahrung zur Geschichte.
Im Unterschied zur Zeitgenossenschaft, die nun ihren Abschluss findet, ist die "Arena
der Erinnerungen“
24
jedoch gerade erst eröffnet. Denn das "Zeitalter des
Gedenkens", für dessen Entstehen Auschwitz die erste und entscheidende Ursache
war,
25
kommt nicht zu Ende, aber es geht nicht mehr in diesem Ursprung auf. In
einer Welt vernetzter Gedächtnisse und globaler Imagologien ist der Holocaust zu
einer Metapher geworden, die für vieles stehen kann, und Hitler – auch – zur
Gruselgröße einer multimedialen Populärkultur.
Eine angemessene – und das heißt nicht zuletzt: auf sich verändernde Fragen
Auskunft gebende – Vergegenwärtigung der nationalsozialistischen Vergangenheit
bleibt auch im 21. Jahrhundert politisch-moralisches Gebot und intellektuelle
Herausforderung. Nötig allerdings ist dazu Wissen, nicht nur die Bereitschaft zur
Erinnerung. Mit Blick auf eine Gegenwart, die kein persönliches Erinnern an die NS-
Zeit mehr kennen wird, sind deshalb neue Anstrengungen gefragt. Das ist im Übrigen
nicht allein eine Frage unseres kulturellen Selbstverständnisses, sondern von
praktischem Sinn und politischem Nutzen: Denn nur dort, wo aufgeklärtes
Geschichtsbewusstsein entsteht, wird der Abbau kollektiver Mythen möglich, die
Europa auch sechs Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch
beschweren.
24
Vgl. den Katalog zur Ausstellung des Deutschen Historischen Museums: Monika Flacke (Hg.),
Mythen der Nationen, 1945 – Arena der Erinnerungen, 2 Bde., Mainz 2004.
25
Vgl. Henry Rousso, La hantise du passé, Paris 1998.
Quelle: Blätter für deutsche und internationale Politik, Heft 3/2005, S.356-264,
Blätterverlagsgesellschaft mbH, Bonn 2005

Rezension: Norbert Frei, 1945 und Wir– Das Dritte Reich im Bewusstsein der
Deutschen
In einer ausführlichen Besprechung des Buches von Norbert Frei in der tageszeitung vom
17.03.05 schreibt Christian Semler unter anderem:
„Über diesen Phasenablauf (unterschiedliche Phasen der Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit, G.St.) legt Frei ein Generationenmodell im 15 – Jahres – Rhythmus: die
Tätergeneration, dann die der Flakhelfer und kurz vor Kriegsende Eingezogenen, die Frei mit
der ‚skeptischen Generation’ identifiziert, und schließlich die 68er. Was danach kommt,
verschwimmt. So verführerisch es ist, mit Generationen zu hantieren, so leicht gerät hier die
Analyse auf Abwege. Frei untersucht nicht, um welches Sinn stiftende Erlebnis herum sich die
einzelnen Generationen (vereinfacht die Jahreskohorten) konstituiert haben. Auch verzichtet
er darauf, bei dieser glitschigen Erkundung soziale und ökonomische Daten als Trennpflöcke
zu verwenden. Ergebnisse der empirischen Sozialforschung, die einiges zur
Selbsteinschätzung der jeweiligen Generation beitragen könnten, werden nicht berücksichtigt.
Es fehlen trennscharfe Kriterien. Nur ein Beispiel: Wieso ist Habermas ein Vertreter der
‚skeptischen Generation’, die sich doch nach ihrem Erfinder Schelsky durch Ablehnung von
politischem Engagement und durch Misstrauen gegenüber großflächigen Ideen ausgezeichnet
hat? Reichlich konstruiert scheint mir auch der Verdacht gegenüber ‚Teilen der 68er’, sie
seien jetzt ebenfalls in den Opferwettbewerb als Kriegskinder eingetreten. Das Engagement
vieler Vertreter dieser Generation, etwa für die Entschädigung der Zwangsarbeiter, spricht
da eine andere Sprache. Damit soll nicht gesagt werden, ein Generationenschema sei wertlos.
Nur, bei Norbert Frei erschließt sich seine Bedeutung nicht.
Hat Frei Recht mit seiner Feststellung, es gebe heute in der Politik wie in der Gesellschaft die
Tendenz, die Naziverbrechen ihres Orts, ihres Kontexts zu entkleiden und im Zeichen einer
falschen Universalisierung des Leids im ‚Jahrhundert der Barbarei’ untergehen zu lassen?
Für diese Tendenz gibt es tatsächlich beunruhigende Hinweise, zu denen auch die
entpolitisierende Wirkung vieler Erzeugnisse der Fernsehgeschichtsindustrie a la Guido
Knopp oder Filme wie ‚Der Untergang’ gehören.
Von deren emotionalen Subtexten wären freilich die offenen politischen Zielsetzungen zu
unterscheiden, wie sie etwa das ‚Zentrum gegen Vertreibungen’ verfolgt. Hier gibt es
mittlerweile klare politische Fronten, es gibt Argumente der Befürworter wie der Gegner des
Zentrums (darunter übrigens auch 68er!), deren Stichhaltigkeit Frei zu prüfen hätte. Was
aber nicht funktioniert, ist eine Art Symptomatologie, in der alles, von Äußerungen des
Bundeskanzlers bis zu Helga Hirschs Lebensläufen von Vertriebenen, als Indizienkette für den
‚Gezeitenwechsel’ hinsichtlich der Beurteilung der Nazizeit aufgebaut wird.
Frei hat Recht, Bereitschaft zur Erinnerung reicht nicht, das Wissen um historische Kontexte
ist gefragt. Das trifft allerdings auch auf die gegenwärtigen Akteure zu. Denken wir nur an
die zwiespältige Wirkung des Menschrechtsdiskurses, der sowohl historisches Bewusstsein
schärfen als auch abtöten kann. Der Massenmord von Srebrenica 1995 ist hierfür ein
Beispiel. Einwände dieser Art mindern nicht die Bedeutung von Freis Arbeit. Sie hat einen
Fehdehandschuh geworfen. jetzt ist der Weg der Auseinandersetzung mit den
Geschichtsmythologen offen.“

Erika Steinbach MdB
Präsidentin des Bundes der Vertriebenen
8. Mai 1945
Die Vertreibung der Deutschen aus Ostmitteleuropa
– integraler Bestandteil der deutschen Geschichte?
In diesen Monaten blicken wir aus unterschiedlichen Perspektiven 60 Jahre zurück. Im
Mittelpunkt steht mit Recht das offizielle Kriegsende am 8. Mai 1945. Gedenkveran-
staltungen und „Jubiläen“ dieser Art lassen in aller Regel entweder den Blick erleichtert
zurückschweifen oder sie erzwingen eine beklemmende Rückschau. Das Ende des Zweiten
Weltkrieges ist für uns Deutsche eine Symbiose beider Gefühle. Theodor Heuss, der erste
deutsche Bundespräsident unserer jungen Demokratie formulierte sehr treffend: „Erlöst und
vernichtet in einem.“
Mit Ende dieses mörderischen Zweiten Weltkrieges atmeten nicht nur die Menschen in
unseren Nachbarländern auf, sondern auch für Deutsche war es die Erlösung von
allgegenwärtiger Angst um Brüder, Väter oder Söhne im Krieg, Angst vor Bombardements,
Angst vor den feindlichen Truppen, Angst vor Bespitzelung und Denunziation. Das Grauen
der nationalsozialistischen Diktatur, für die Auschwitz zum Synonym wurde, hat
grenzenloses Leid in Europa erzeugt und die eigenen Bürger in den Abgrund gerissen. All
das hat tiefe Brüche und Risse in den Herzen und Seelen der Menschen hinterlassen.
Mit dem 8. Mai 1945 aber hatten Unmenschlichkeit und Grausamkeit in Europa noch immer
kein Ende. Stalins harte Faust lag über Mittel- und Osteuropa und raffte Millionen Menschen
vieler Völker dahin. Und über viele Jahre hinweg, bis fast in die fünfziger Jahre, wurden
Deutsche aus ganz Mittel- und Osteuropa aus ihrer Heimat vertrieben oder waren in
Zwangsarbeit geknechtet. Es gab keine Fragen nach individueller Schuld oder Ver-
antwortung. Es reichte aus, deutscher Volksangehöriger zu sein, ob Säugling oder Greis,
Mann oder Frau. Alle wurden in eine Kollektivhaftung genommen, wenn sie nicht im Westen
Deutschlands ihre Heimat hatten.
Von den Ursachen her war dies auch eine Folge der NS-Diktatur. Im Ergebnis aber waren diese
Menschenrechtsverletzungen gleichermaßen unentschuldbar. Ein Historikerstreit darüber ist
müßig. Es reicht, die Zeitzeugen zu Wort kommen zu lassen. Jeder forsche Satz von "gerechter
Strafe" für die Verbrechen Hitlers bleibt dann im Halse stecken.
Jürgen Thorwald berichtet in dem Sammelband "Die große Flucht", auch wiedergegeben im
Schwarzbuch der Vertreibung von Heinz Nawratil, folgendes. Der deutsche Pfarrer Karl Seifert
stand am Abend des 20. Mai 1945 in der Gegend des sächsischen Pirna mit einigen Männern
seiner Gemeinde am Ufer der Elbe. Er hatte dem sowjetischen Kommandanten die Erlaubnis
abgerungen, tote Deutsche zu bestatten, die Tag für Tag an dieses Ufer getrieben wurden. Sie
kamen elbabwärts aus der Tschechoslowakei. Und es waren Frauen und Kinder und Säuglinge,
Greise und Greisinnen und deutsche Soldaten. Und es waren Tausende und Abertausende,
von denen der Strom nur wenige an jenen Teil des Ufers spülte, an welchem der Pfarrer und
seine Männer die Toten in die Erde senkten und ein Gebet über ihren Gräbern sprachen. An
diesem 20. Mai geschah es, daß der Strom nicht nur solche Deutsche von sich gab, die
zusammengebunden ins Wasser gestürzt und ertränkt worden waren und nicht nur die
Erdrosselten und Erstochenen und Erschlagenen, ihrer Zungen, ihrer Augen, ihrer Brüste
Beraubten, sondern auf ihm trieb, wie ein Schiff, eine hölzerne Bettstelle, auf der eine ganze
deutsche Familie mit ihren Kindern mit Hilfe langer Nägel angenagelt war. Als die Männer die
Nägel aus den Händen der Kinder zogen, da konnte der Pfarrer nicht mehr die Worte denken,
die er in den letzten Tagen oft gedacht hatte, wenn er sich mit den Tschechen beschäftigte und

wenn Schmerz und Zorn und Empörung ihn übermannen wollten: "Herr was haben wir getan,
daß sie so sündigen müssen." Dies konnte er nicht mehr ...
Ortswechsel: Im jugoslawischen Vernichtungslager Gakowo kamen innerhalb weniger Monate
8500 Donauschwaben zu Tode. Ab Mai 1947 betreute Kaplan Paul Pfuhl die Sterbenden. In
seinem späteren Bericht darüber heißt es unter anderem: „Diese Häuser waren Stätten des
Grauens. Wie oft habe ich Beichte gehört und die letzte Ölung gespendet. Ein Fall steht mir
noch ganz lebendig vor Augen. Da lag eine Frau im Hausgang, ich fragte sie, ob sie nicht
beichten wolle. Schroff wies sie mich ab. Sie hätte nichts zu beichten. Als ich ihr zuredete, daß
wir doch alle Sünden hätten und die Verzeihung Gottes brauchten, kam es hart über ihre
Lippen: Mir hat Gott nichts zu verzeihen, höchstens habe ich ihm zu verzeihen.“ Für die meisten
der deutschen Vertreibungs-, Deportations- und Lageropfer aber war Gott die einzige Zuflucht,
ja der Rettungsanker in ihrem fast unerträglichen Leben, in ihrem entwurzelten Dasein.
Bis zum Jahre 1950 fanden acht Millionen Heimatvertriebene und Flüchtlinge in den
westlichen Besatzungszonen Aufnahme. Vier Millionen in Mitteldeutschland. Die
Eingliederung so vieler seelisch und teils auch körperlich verwundeter und erschöpfter
Menschen schien nach 1945 schier unmöglich. Das Land lag in Trümmern. Ein fünf Jahre
währendes Bombardement hatte mehr als tausend Städte und Ortschaften durch nahezu
eine Millionen Tonnen Spreng- und Brandbomben überwiegend dem Erdboden
gleichgemacht. Aus den öden Fensterhöhlen schaute das Grauen. Diesen „mörderischen
Verheerungen“, wie der Spiegel am 6. Januar 2003 schrieb, fielen mehr als eine halbe
Million Menschen zum Opfer. Die seit dem Mittelalter gewachsene deutsche
Städtelandschaft war weitgehend vernichtet. Hinzu kam der moralische Schock mit den
Bildern aus den geöffneten Konzentrationslagern, die niemanden kalt lassen konnten. Es
war kaum vorstellbar, dass aus dieser Wüstenei ein geordnetes Miteinander und eine stabile
Demokratie erwachsen konnte.
Zu den obdachlosen, verarmten und hungernden Einheimischen strömten schon ab 1944
Millionen und Abermillionen deutsche Flüchtlinge und Vertriebene aus ganz Mittel-, Ost- und
Südosteuropa. Sie kamen aus den baltischen Ländern, aus Rumänien, Jugoslawien,
Ungarn, Polen, der Sowjetunion und der Tschechoslowakei, aus den Ländern, in denen sie
seit Jahrhunderten siedelten. Einige aus den Gebieten, in die sie von Hitler umgesiedelt
worden waren. Und sie kamen aus dem Osten Deutschlands, der heute zu Polen und
Russland gehört. Ohne jede Habe, heimatlos, verzweifelt und mit der festen Hoffnung im
Herzen auf Rückkehr.
Wie sollte, wie konnte dieses kumulierte menschliche Elend zu einer stabilen Demokratie
führen? Das war völlig unvorstellbar. Stalin hatte gehofft, dass die Millionen Vertriebenen das
ohnehin daniederliegende Deutschland destabilisieren würden und auch Westdeutschland
unweigerlich in die Arme des Kommunismus treiben würde.
Konrad Adenauer, der erste deutsche Bundeskanzler, war sich dessen bewusst. Zu Beginn
seiner Kanzlerschaft 1949 stellte er fest: „Ehe es nicht gelingt, den Treibsand der Millionen
von Flüchtlingen durch ausreichenden Wohnungsbau und Schaffung entsprechender
Arbeitsmöglichkeiten in festen Grund zu verwandeln, ist eine stabile innere Ordnung in
Deutschland nicht gewährleistet“. In der Aufnahme und Eingliederung dieser riesigen
Menschenmasse sah er eines der drängendsten Probleme der jungen westdeutschen
Demokratie, in der die ersten Früchte des Marshall-Plans erst langsam wuchsen. Er schuf
ein eigenes Ministerium für Flüchtlinge und Vertriebene mit dem Schlesier Hans Lukaschek
an der Spitze. Und in einer ganzen Reihe von Gesetzen wurde in dieser ersten
Legislaturperiode unserer jungen Demokratie der Grundstein für eine friedliche Zukunft
gelegt. Stalins Rechnung ging nicht auf.
Wie aber fand die Aufnahme dieses Teils deutscher Geschichte in unsere Gesetze,
Lehrbücher und Köpfe der Menschen statt? Was ist bis heute geblieben an Folgen für die
Praxis und an Anteilnahme im Bewusstsein der Vertriebenen und der Nicht-Vertriebenen?

Die „integralen Bestandteile der deutschen Geschichte“ spiegeln sich auch, aber nicht nur
am Niedergeschriebenen in Geschichtsbüchern wieder. Im folgenden wird daher der Reihe
nach eingegangen auf die Gesetzgebung unmittelbar nach Kriegsende, auf die Integration
der Menschen, ihres Kulturgutes und der landsmannschaftlichen Zusammenschlüsse, auf
die politische und insbesondere wissenschaftliche Aufbereitung- und Erinnerungskultur und
damit auf das öffentliche Bewusstsein in Deutschland.
Eines der ersten überhaupt vom Deutschen Bundestag verabschiedeten Gesetze war das
Soforthilfegesetz vom September 1949. Von Gewicht war auch das Lastenausgleichsgesetz
von 1952. Mit dem Bundes-Vertriebenen- und Flüchtlingsgesetz vom 19. Mai 1953 war die
so genannte Kriegsfolgengesetzgebung vorläufig abgeschlossen. Dieses Gesetz ging über
die sozialen Aspekte weit hinaus. Es hatte und hat den Sinn, den Deutschen aus dem Osten
einen angemessenen Platz in der hier heimischen Gesellschaft zu gewährleisten und per
Legaldefinition festzuschreiben, wer Heimatvertriebener, wer Vertriebener, wer Flüchtling ist.
Der wirtschaftlichen Eingliederung zu Beginn der 50er Jahre und der ersten Sicherung
wenigstens elementarster Grundbedürfnisse sollte nun die gesellschaftliche Eingliederung
folgen. Integration, nicht Assimilation war und ist das Ziel dieses Gesetzes. Das sind die
ideellen Grundgedanken von Eingliederungspolitik, die den Vertriebenen nicht mit bloßer
Caritas, sondern mit Solidarität und Gleichberechtigung begegnen will.
Den grausamen Kriegs- und Nachkriegsverlusten Deutschlands stehen auf der anderen
Seite unschätzbare Gewinne der Aufnahmegesellschaft gegenüber, auch wenn diese das
zunächst überhaupt nicht so gesehen hat: Das „unsichtbare Fluchtgepäck“ der Vertriebenen,
ihr technisches, handwerkliches oder akademisches know how, ihre sieben-,
achthundertjährige kulturelle Erfahrung im Neben- und Miteinander mit ihren slawischen,
madjarischen, baltischen oder rumänischen Nachbarn hat Deutschland nachhaltig geprägt –
Erfahrungen, die in Verbindung mit vielfacher Mehrsprachigkeit in keinem anderen
westlichen Industriestaat so verdichtet sind wie in Deutschland! Die Heimatvertriebenen
haben interkulturelle Kompetenz mitgebracht. Und sie haben als unsichtbares Fluchtgepäck
ihre kulturelle Identität eingebracht. Es war nichts, was sofort sichtbar gewesen wäre,
sondern das, was in Kopf und Herzen mitgetragen wurde aus der Heimat hierher. Es war
allerdings hörbar in den Klangfarben der regionalen Mundarten.
Das Bundesvertriebenengesetz macht deutlich, dass das Kulturgut der Vertriebenen
gesamtdeutsche Aufgabe ist. Unverzichtbarer Teil der Identität des ganzen deutschen
Volkes. Das Erbe der Karlsuniversität in Prag hat unser Volk genauso geprägt wie das der
Universitäten Königsberg, Breslau, Dorpat, Czernowitz oder Heidelberg, Tübingen, Marburg,
München, Leipzig oder Berlin. Das zu ignorieren hieße, geistige Wurzeln kappen. So war es
weise, dass Bund und Länder der jungen Bundesrepublik Deutschland 1953 mit diesem
Gesetz die Verantwortung für das gesamte kulturelle Erbe unabhängig von Grenzen und von
staatlicher Zugehörigkeit hervorhoben. So heißt es in § 96 BVFG: „Bund und Länder haben
das Kulturgut der Vertreibungsgebiete in dem Bewusstsein der Vertriebenen und Flüchtlinge,
des gesamten deutschen Volkes und des Auslandes zu erhalten, Archive, Museen und
Bibliotheken zu sichern, zu ergänzen und auszuwerten, sowie Einrichtungen des
Kunstschaffens und der Ausbildung sicherzustellen und zu fördern. Sie haben Wissenschaft
und Forschung bei der Erfüllung der Aufgaben, die sich aus der Vertreibung und der
Eingliederung der Vertriebenen und Flüchtlinge ergeben, sowie die Weiterentwicklung der
Kulturleistungen der Vertriebenen und Flüchtlinge zu fördern“. Dieser gesetzliche Auftrag ist
geboren aus der Erkenntnis, dass es ein einheitliches, ein gemeinsames kulturelles
Fundament gibt. Hier liegt heute in der Umsetzung des Gesetzesauftrages manches im
Argen.
Die schönsten Seiten unseres Vaterlandes sind in seinem kulturellen Reichtum mit vielen
unterschiedlichen Facetten zu finden. In schöpferischem Geist erwuchsen über die
Jahrhunderte Musik, Literatur, Philosophie, Baukunst und Malerei. Neugier an Wissenschaft
und Forschung hatten Heimstatt an den Hochschulen. Studenten aus aller Welt pilgerten

deshalb zu deutsch geprägten Universitäten in und außerhalb Deutschlands. Bedeutende
Frauen und Männer hatten ihre Wurzeln in den Vertreibungsgebieten:
•
Gregor Mendel, Ferdinand Porsche, Bertha von Suttner, Adalbert Stifter, Marie von
Ebner Eschenbach, Rainer Maria Rilke, Franz Kafka oder Franz Werfel in Böhmen
und Mähren,
•
Andreas Schlüter, Arthur Schopenhauer oder Franz Halbe in Danzig,
•
Nikolaus Kopernikus oder Emil von Behring in Westpreußen,
•
Immanuel Kant, Johann Gottfried Herder, E.T.A. Hoffmann, Lovis Corinth, Käthe
Kollwitz, Agnes Miegel, Ernst Wiechert oder Hannah Arendt in Ostpreußen,
•
Angelus Silesius, Friedrich Schleiermacher, Joseph von Eichendorff, Adolf von
Menzel, Gustav Freytag, Gerhart Hauptmann oder Edith Stein in Schlesien,
•
Ernst Moritz Arndt, Caspar David Friedrich, Philipp Otto Runge, Rudolf Virchow oder
Otto Lilienthal in Pommern,
•
Werner Bergengruen im Baltikum und
•
Gregor von Rezzori und Rose Ausländer in der Bukowina oder
•
die Familie unseres derzeitigen Bundespräsidenten Horst Köhler in Bessarabien.
Und das ist nur eine kleine Auswahl.
Eine andere, ebenso wichtige Wegmarkierung enthält dieses Gesetz. Es legt fest, wer als
deutscher Vertriebener oder Flüchtling gilt und dauerhaft hier Aufnahme finden durfte und
darf. Das hat Auswirkungen bis heute. Seit dem Abschluss der so genannten allgemeinen
Vertreibungsmaßnahmen 1950 sind auf der Grundlage dieses Gesetzes über vier Millionen
Deutsche und Familienzugehörige als Aussiedler aus den Vertreibungsgebieten in die
Bundesrepublik Deutschland gekommen, die meisten seit 1988/89. Hunderttausende warten
noch auf ihre Aufnahmebescheide, weil sie es in den jetzigen Wohnsitzstaaten nicht mehr
aushalten.
Das trifft insbesondere auf die Deutschen aus Russland zu. Die gesamte deutsche
Volksgruppe in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion war seit 1941 über Jahrzehnte von
kollektiven Strafmaßnahmen betroffen. Die Auswirkungen reichen bis heute. Die
jahrzehntelange zwangsweise Verbannung mit den Einweisungen in Sondersiedlungen, der
jahrelange Dienst als Zwangsarbeiter in der Trudarmee, der Verlust der Bürgerrechte und
aller kulturellen Einrichtungen haben nicht nur die Existenz des Einzelnen und seiner
Familie, sondern auch die Grundlagen der nationalen Identität der Volksgruppe erschüttert
und vielfach zu einer dauerhaften Entwurzelung geführt, unter der die Deutschen aus
Russland noch immer zu leiden haben.
Die Härte des Lebens in der Verbannung, der Mangel an einfachen Unterrichtsmaterialien,
strikte Verbote oder administrative Hürden haben dazu geführt, dass 16 Jahre lang ein
großer Teil der Kinder und Jugendlichen keine Möglichkeit hatte, eine Schule zu besuchen.
Damit war eine ganze Generation der partiellen oft sogar der totalen Analphabetisierung
Preis gegeben. Eine Rehabilitierung der Deutschen hat es nie gegeben. Mit dem
Aufkommen nationalistischer Tendenzen in den mittelasiatischen Republiken, den
Verbannungsgebieten, in denen sie überwiegend nach wie vor leben, waren sie in den 90-er
Jahren einem verstärkten Aussiedlungsdruck ausgesetzt. Rechtlich und moralisch trägt
Deutschland eine besondere Verantwortung für diese Menschen, die länger und
schmerzhafter als andere darunter leiden mussten, dass sie als Deutsche geboren und
Opfer einer unmenschlichen Nationalitätenpolitik Stalins wurden.

Hannah Arendt, in Königsberg aufgewachsen, gehörte zu den vielen Vertriebenen der
Hitlerdiktatur. Für sie gab es keinen Determinismus, der in die Barbarei führen muss. Ihr
Werk ist bis heute eine Schatzkammer für politisches Denken. Mit ihrem scharfen Intellekt
erkannte sie als eines der brisantesten Probleme der modernen Zivilisation das Phänomen
der Flüchtlinge. Das erste Menschenrecht ist nach Hannah Arendt das Heimatrecht, denn
„der erste Verlust, den die Rechtlosen erlitten, war der Verlust der Heimat. Die Heimat
verlieren heißt die Umwelt verlieren, in die man hineingeboren ist und innerhalb der man sich
einen Platz geschaffen hat, der einem sowohl Stand und Raum gibt“. Wie ähnlich klingt es
doch in der Charta der deutschen Heimatvertriebenen: „Heimatlose sind Fremdlinge auf
dieser Erde. Gott hat die Menschen in ihre Heimat hineingestellt. Den Menschen mit Zwang
von seiner Heimat zu trennen bedeutet, ihn im Geiste zu töten“.
Heute, 60 Jahre nach Beginn der gezielten Massenvertreibungen kann man von einer alles
in allem gelungenen Eingliederung von weit über zwölf Millionen Vertriebenen und vier
Millionen Aussiedlern in die deutsche Gesellschaft sprechen, wenn wir von den
Spätaussiedlern dieser Tage absehen. Vieles, was in den 50er Jahren noch dringend und
drängend war, ist es eben heute nicht mehr – dank der Eingliederungsleistung, die die
Vertriebenen, die Aussiedler und die Einheimischen gemeinsam erbracht haben. Diese
großartige Gemeinschaftsleistung war und ist nahezu ein Wunder. Erst daraus konnte
Frieden und Wohlstand in Deutschland erwachsen.
Der französische Politikwissenschaftler Alfred Grosser hat die Integration der Vertriebenen
und Flüchtlinge als die größte sozial- und wirtschaftspolitische Aufgabe bezeichnet, die von
der Bundesrepublik gemeistert worden sei. Dem kann ich nur zustimmen. Dennoch wird in
der Darstellung der Nachkriegsgeschichte Deutschlands diese grandiose Leistung praktisch
nicht benannt, sondern überwiegend ignoriert. Warum aber konnte diese Herkulesaufgabe
gelingen? Die Aufnahme einer solch großen Zahl von Menschen in so kurzer Zeit hätte
schon ein intaktes Staatswesen vor kaum lösbare Probleme gestellt.
Zweierlei hat dazu beigetragen. Der erste Grund: Die Heimatvertriebenen haben nicht
Rachegedanken kultiviert, sondern immer und immer wieder manifestiert, dass sie
Versöhnung wollen mit den Staaten und den Menschen, die sie vertrieben haben. Und in der
schon legendären Charta von 1950 zudem artikuliert: „Wir werden durch harte, unermüdliche
Arbeit teilnehmen am Wiederaufbau Deutschlands und Europas“. Aber auch in der DDR
haben die Vertriebenen unter ganz anderen, viel schwierigeren Bedingungen ihren Beitrag
zum Aufbau geleistet. Obwohl sie sich nicht zusammenschließen durften, keine Not- und
Trostgemeinschaften bilden konnten wie die Vertriebenen im Westen Deutschlands.
Der zweite Grund, warum unsere Demokratie eine Chance hatte, zu wachsen und stabil zu
werden: Die Parteien der Bundesrepublik Deutschland unterstützten über zwei Jahrzehnte
einmütig die Anliegen der Vertriebenen und waren sich ihrer Verantwortung sehr bewusst.
Nicht nur Bundeskanzler Adenauer, sondern auch der Fraktionsvorsitzende der
Sozialdemokratischen Opposition, Kurt Schumacher, und Erich Ollenhauer als Partei-
vorsitzender standen an der Seite der Heimatvertriebenen und mit ihnen der freidemo-
kratische Bundespräsident Theodor Heuss.
Doch Ende der 60-er Jahre wandelte sich das Klima. Es kam zu einem Prozess der
Entsolidarisierung großer Teile der politischen Klasse, insbesondere der politisch links
Stehenden gegenüber den Vertriebenen. Ein Mantel des Schweigens und Verschweigens
begann sich über Deutschland zu legen.
Selbstkritisch stellte Bundesinnenminister Otto Schily 1999 in seiner Rede im Berliner Dom
fest: „Die politische Linke hat in der Vergangenheit, das lässt sich leider nicht bestreiten,
zeitweise über die Vertreibungsverbrechen, über das millionenfache Leid, das den
Vertriebenen zugefügt wurde, hinweggesehen, sei es aus Desinteresse, sei es aus
Ängstlichkeit vor dem Vorwurf, als Revanchist gescholten zu werden, oder sei es in dem
Irrglauben, durch Verschweigen und Verdrängen eher den Weg zu einem Ausgleich mit

unseren Nachbarn im Osten zu erreichen. Dieses Verhalten war Ausdruck von Mutlosigkeit
und Zaghaftigkeit. Inzwischen wissen wir, dass wir nur dann, wenn wir den Mut zu einer
klaren Sprache aufbringen und der Wahrheit ins Gesicht sehen, die Grundlage für ein gutes
und friedliches Miteinander finden können“. Das hat sich auf das Gesamtklima unseres
Landes positiv ausgewirkt. Auch wenn bis heute noch nicht jeder davon zu überzeugen war,
so gibt es immerhin eine lebendige Diskussion, der sich kein Medium verschließt.
Dem objektiven Sachverhalt der völligen gewaltsamen Umformung der beiden deutschen
Nachkriegsgesellschaften BRD und DDR durch die Aufnahme soziokulturell, religiös oder
dialektal teilweise total von den Aufnahmeregionen unterschiedenen Vertriebenen und
„Flüchtlingen“ stand über sehr lange Zeit eine subjektive Wahrnehmungsverweigerung dieser
ganz Deutschland und das gesamte Deutsche Volk betreffenden einschneidenden
Katastrophe gegenüber. Das Thema Vertreibung wurde primär als soziales Problem
gesehen und nicht als deutsche Identitätsfrage. In jüngster Zeit hat sich das deutlich
geändert.
War es während des Kalten Krieges noch wenig opportun und „nicht politisch korrekt“, sich
mit Völkermord, Vertreibung und ethnischer Säuberung zu beschäftigen, wenn Deutsche
eben nicht Täter, sondern unschuldige Opfer waren, so änderte sich dies spätestens in der
Zeit der grausigen Balkankriege 1991-95 und endgültig 1999, als deutsche
Bundeswehrsoldaten mit ihren NATO-Kameraden dem Gemetzel auf dem Amselfeld
(Kosovo) ein Ende bereiteten. Doch selbst damals vor sechs Jahren kamen führende
bundesdeutsche Außenpolitiker nicht ohne eine Rechtfertigung der NATO-Intervention unter
Beteiligung der Bundeswehr durch eine Parallelisierung der serbischen Verbrechen mit
„Auschwitz“ aus, obwohl eine solche mit dem Grauen im Deutschen Osten oder auf dem
Balkan 1944/46 doch sehr viel näher gelegen hätte: Vukovar, Ossijek (Esseg) oder Slavonski
Brod waren nicht erst 1991/92, sondern schon 1944/48 Orte schrecklicher „ethnischer
Säuberungen“, doch waren damals die Opfer nicht Kroaten, sondern deutsche
Donauschwaben. Der Vertreibung der Donauschwaben aus Jugoslawien, die nur von zwei
Dritteln der nicht zuvor bereits Geflüchteten überlebt wurde, hat der Würzburger
Völkerrechtler Dieter Blumenwitz in einem wissenschaftlichen Gutachten Völkermord-
charakter attestiert.
Nur wenige begriffen bereits in den 50er Jahren, was die Vertreibung und die Aufnahme
Millionen ost- und sudeten- und südostdeutscher Heimatvertriebener in West- und dem
damaligen Mitteldeutschland bedeutete. Der bedeutende Soziologe Eugen Lemberg
beschrieb schon 1950 den unter tumultuarischen, von Not und Mangel bestimmten
Nachkriegsverhältnissen verlaufenden und oft auch konfliktreichen Prozeß wissenschaftlich
kühl-distanziert als die „Entstehung eines neuen Volkes aus Binnendeutschen und
Ostvertriebenen“, also gewissermaßen als intraethnische Ethnomorphose. Niemals seit dem
Augsburger Religionsfrieden 1555 oder seit dem Dreißigjährigen Krieg waren die
demographischen und konfessionellen Verhältnisse in Deutschland dermaßen umgestürzt
worden. Jeder zweite Deutsche lebte schon 1945 nicht mehr dort, wo er 1939 seinen
Lebensmittelpunkt gehabt hatte. Nicht nur die Vertriebenen, auch die Ausgebombten,
Evakuierten oder Kriegsgefangenen. Jedoch: Außer den Vertriebenen konnten alle in ihre
Heimatorte zurückkehren, wenn sie denn wollten. Nicht so die Vertriebenen. Hundert-
tausende zogen es deshalb vor, aus dem zertrümmerten Deutschland nach Übersee
auszuwandern.
Wie hat sich die Wissenschaft zur Vertreibung der Deutschen verhalten? Unverzichtbares
Standardwerk ist nach wie vor die Dokumentation der Vertreibung, die so genannte
Schieder-Dokumentation, hat Karl Schlögel sehr richtig festgestellt. Er selbst hat im letzten
Jahrzehnt bemerkenswerte Beiträge geliefert. Die bedeutendsten Beiträge zur Aufarbeitung
der Vertreibung und ihrer Vorgeschichte in den späten 60er und den 70er Jahren kamen von
Ausländern; beispielhaft seien genannt der Amerikaner Alfred de Zayas mit seinem bis heute
nicht überholten Standardwerk „Die Anglo-Amerikaner und die Vertreibung der Deutschen“
(1978) und der Niederländer Hiddo M. Jolles „Zur Soziologie der Heimatvertriebenen und
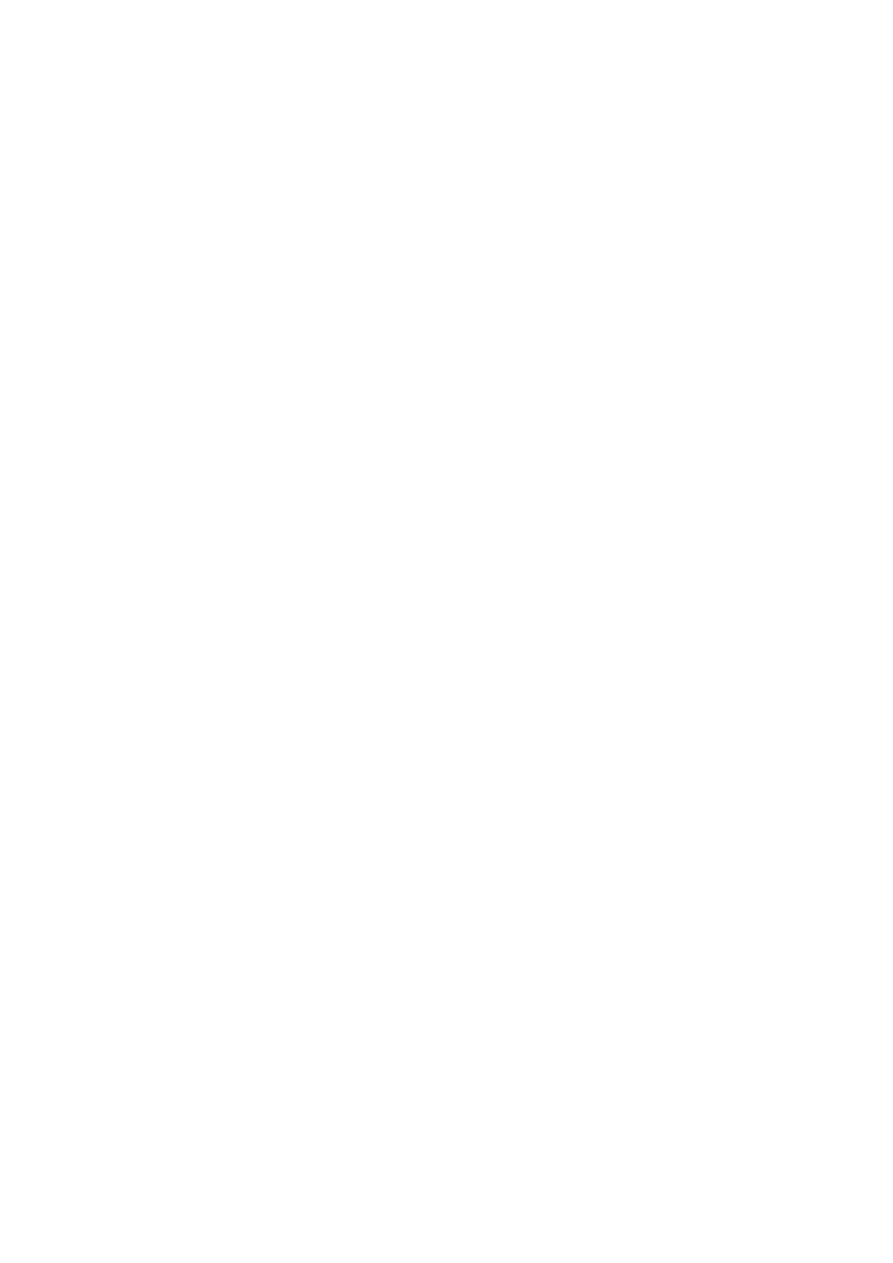
Flüchtlinge“, 1965. Natürlich gab es über die ganzen Jahrzehnte unzählige wissenschaftliche
Veröffentlichungen und wichtige Bücher zum Geschehen. Eine breite Rezeption fand jedoch
nicht statt. Die ganze Thematik galt offen-kundig bis weit in die 80er Jahre der mittlerweile
etablierten „68er“ ´scientific community´ als anachronistisch, wenn nicht gar als suspekt und
anrüchig. Erst gegen Ende der 80er Jahre begann man im Zuge einer theoretisch hoch
aufgeladenen und alimentierten Welle zur „Migrationsforschung“, sich auch wieder für die
ost- und sudetendeutschen Migranten zu interessieren. Zahllose und oft verdienstvolle Lokal-
und Regionalstudien zur Aufnahme und Eingliederung der Vertriebenen sind seither
erschienen.
Die Vertreibung selber als historisches prae kam aber erst in den 90er Jahren wieder ins
Blickfeld der akademischen Öffentlichkeit. Dies hatte wohl zwei Gründe: Zum einen die
„ethnischen Säuberungen“ im zerfallenen Jugoslawien 1991-95, die man jeden Abend per
TV dokumentiert bekam und ganz andere Einstellungen evozierte als irgendwelche vielleicht
viel schlimmeren Massenmorde in Vorderasien, Zentralafrika oder sonst wo „weit hinten in
der Türkei“ (J.W. Goethe). Zum anderen die Tatsache, daß sich seit dem Zusammenbruch
des Kommunismus in Ostmittel- und Südosteuropa dort junge Historiker, Germanisten,
Sozialwissenschaftler etc. nach der teilweisen – und inzwischen zum Teil auch wieder
zurückgenommenen – Öffnung der Archive offen und unbefangen mit den Nachkriegs-
geschehnissen in den früheren Ostprovinzen und anderen Herkunftsgebieten deutscher
Vertriebenen befassten.
In der jüngsten Zeit sind sehr viele gediegene und wissenschaftlich wertvolle Arbeiten nicht
mehr nur zu Aufnahme und Eingliederung der Vertriebenen, sondern zur Vertreibung und
ihrer Vorgeschichte selber erschienen. In Polen, in Ungarn, in Tschechien, mit einiger Ver-
zögerung in Deutschland und inzwischen z.B. sogar in Serbien – und das sogar noch zu
Zeiten eines Milosévic´.
Im Falle der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert haben wir es mit dem einzigartigen
Fall zu tun, daß seit eineinhalb Generationen dutzende Schülerjahrgänge – ausdrücklich, oft
unausdrücklich – die Geschichte ihres Heimatlandes nur in Fragmenten kennengelernt
haben. Glücklicherweise ändert sich das zur Zeit. Deutsche Vertriebene hatten keinen Platz
in einem häufig gewollt, des öfteren aber fast fahrlässigen ideologisiertem
Bildungsprogramm. Wer diese Feststellung für überspitzt hält, lese die luzide und im
Ergebnis äußerst ernüchternden Analyse von Richtlinien und Schulbüchern im Fach
Geschichte von 1945 bis zur Gegenwart „Der historische deutsche Osten im Unterricht“ von
Jörg-Dieter Gauger (2001). Der Verfasser resümiert. „ Das beruhigende, pazifizierte und
stillgelegte Europa, in dem wir heute leben, ist in Wahrheit aus einem ungeheuren Tumult
von Flucht- und Umsiedlungsbewegungen hervorgegangen. Dieser Tumult hatte so ziemlich
alles erfasst: die Grenzen, die einmal anders verliefen, die Städte, in denen einmal andere
Bevölkerungen und Bevölkerungsgruppen lebten, die Regionen, in denen andere Sprachen
gesprochen wurden. Wer heute über Europa sprechen will, muß ... von den Säuberungen
und Entmischungen, denen es unterworfen war, sprechen.“
Die überwältigende Mehrheit der 15 Mio. deutschen Vertriebenen stammte nicht aus
irgendwelchen Mischzonen, Gemengelagen oder Minderheitengebieten, sondern aus seit
Jahrhunderten kompakt deutsch besiedelten Gebieten, über 70 Prozent davon überdies aus
deutschem und Danziger Staatsgebiet. So etwas hatte es seit biblischen Zeiten nicht mehr
gegeben. Das macht einen enormen qualitativen Unterschied etwa zu den „ethnischen“
Säuberungen in Kroatien und Bosnien-Herzegovina 1991-95 aus, wo es sich tatsächlich um
eine freilich gleichfalls verbrecherische menschenrechtswidrige gewaltsame „Entmischung“
handelte.
Darüber sollte nicht vergessen werden, daß auch hunderttausende Deutscher über zum Teil
abenteuerliche Odysseen aus Gegenden nach Deutschland gelangten, von denen außer
Fachleuten heute kaum jemand mehr etwas weiß. Wer weiß denn, daß in der heute
serbischen Vojvodina die donauschwäbischen Siedlungsgebiete Batschka sowie Teile des

Banats und Syrmiens liegen? Wer weiß, daß die Sathmarer Schwaben nicht aus dem Allgäu
stammen, sondern aus dem Nordwesten Rumäniens – oder dem Südosten Ungarns, wie
mans nimmt. Die weitverbreitete Unkenntnis über die Vielfalt der Herkunftsgebiete der
deutschen Vertriebenen wird beispielhaft deutlich an der allgemeinen Verwirrung über die
Herkunft unseres jetzigen Bundespräsidenten. Die Köhlers waren eine deutsche Familie in
Bessarabien – also dem heutigen Moldawien – wo deutsche Kolonisten seit Beginn des 19.
Jahrhunderts auf den Ruf der damaligen russischen Zaren hin siedelten. Nach der
Umsiedlung 1940 infolge des Hitler-Stalin-Pakts und der erzwungenen Abtretung
Bessarabiens durch Rumänien an die UdSSR landete die Familie zwischenzeitlich in
Siebenbürgen und nach einiger Zeit im – heutigen – Südosten Polens, also in West-Galizien,
wo Horst Köhler 1943 zur Welt kam.
Man mag diesen prominenten „Fall“ als Beispiel für die Irrungen und Wirrungen der
Geschichte der Deutschen in und außerhalb Deutschlands in den 40er Jahren des
vergangenen „Jahrhunderts der Vertreibungen“ nehmen; eine anekdotische Ausnahme war
er nicht. Für die außerhalb der Reichsgrenzen lebenden Volksdeutschen – aus Bessarabien
und dem Buchenland, aus den baltischen Ländern und Wolhynien, aus Ost-Galizien und der
Dobrudscha zwischen Unterlauf der Donau und Schwarzem Meer - war es eher der
Regelfall, aufgrund von ihnen nicht oder kaum zu beeinflussenden politischen Entwicklungen
und Entscheidungen umgesiedelt, „eingedeutscht“, angesiedelt und schlußendlich vertrieben
zu werden wie auch die neun Millionen Reichsdeutschen.
All diese Facetten deutscher Geschichte gehören zur gesamtdeutschen Identität. Hier ist
heute nach wie vor ein riesiger weißer Fleck zu sehen. Wer sind wir? Wie haben wir im
heutigen Deutschland zueinander gefunden? Das ist für die meisten Deutschen Terra
incognita. Die Stiftung ZENTRUM GEGEN VERTREIBUNGEN will diesen Mangel beheben
helfen.
Die Vertreibung der Deutschen aus Ostmitteleuropa – integraler Bestandteil der deutschen
Geschichte? Unbedingt. Aber eben zugleich ein noch im kollektiven Bewusstsein zu
integrierender. Dieser Teil deutscher und europäischer Geschichte und Schicksale geht nicht
nur die Opfer an, sondern alle Deutschen. Im Bewusstsein ist das bis heute nicht.
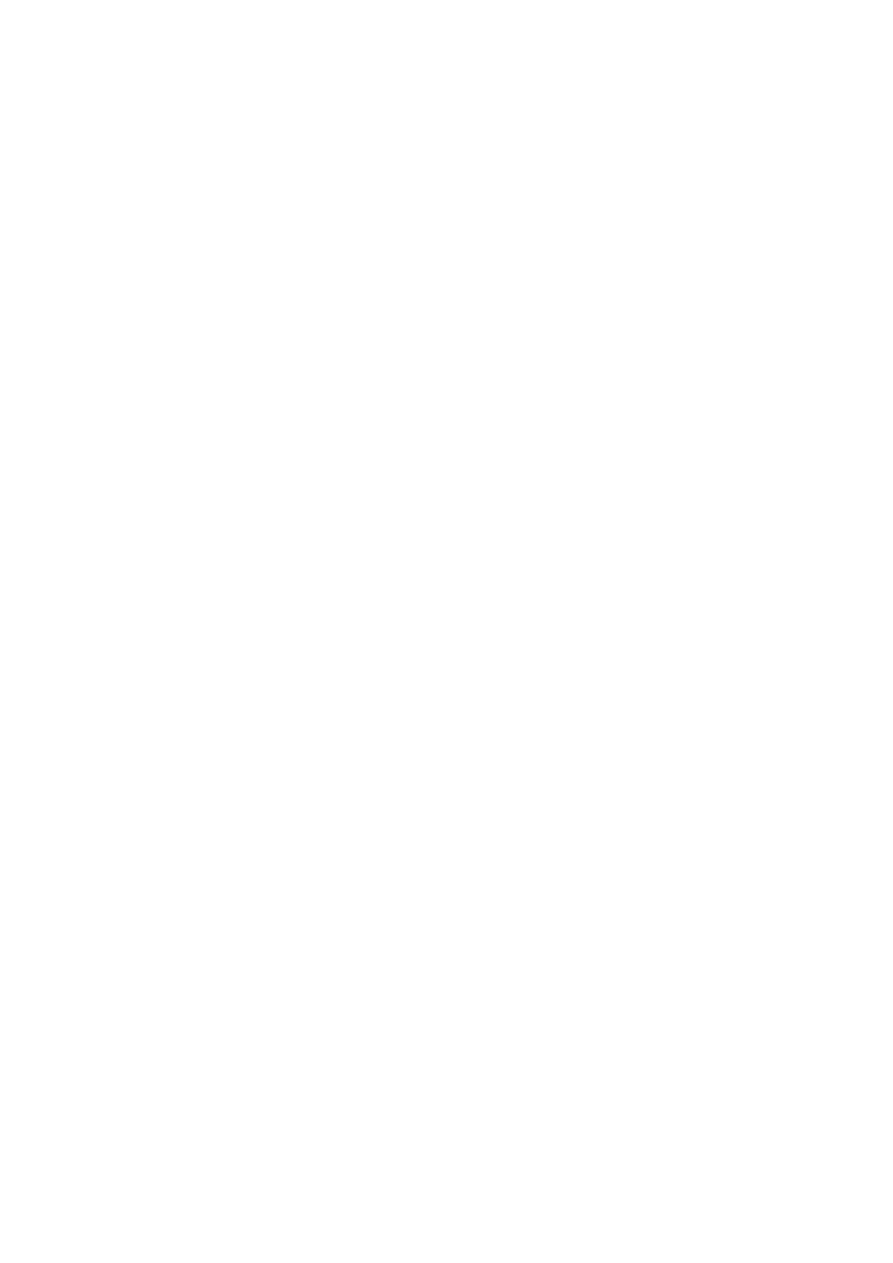
Der folgende Text von Hans-Ulrich Wehler ist ein Auszug aus seiner Einleitung
zu: Die Flucht. Über die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten. Hrsg.
Stefan Aust und Stephan Burgdorf, dtv, München 2005, S. 9 - 14
Jahrzehntelang blieb die Diskussion über dieses euphemistisch "Transfer" genannte
Verbrechen eine Sache der Landsmannschaften und Vertriebenenverbände.
Dagegen wurde die allgemeine Öffentlichkeit in Westdeutschland – in der
Sowjetischen Besatzungszone und dann in der DDR blieb das Thema ohnehin tabu -
durch dieses Problem nur relativ selten bewegt. Diese Zurückhaltung besaß geraume
Zeit ihre Berechtigung. Denn die Deutschen mussten sich erst den eigenen
Verbrechen stellen, mithin die Gefahr vermeiden, deutsches Leid sogleich gegen
deutsche Untaten aufzurechnen – etwa gegen das Menschheitsverbrechen des
Holocaust. Bei diesem Massenmord an zwei Dritteln der europäischen Judenheit
ging es um eine geradezu industrielle Liquidierung ohne Ansehen von Person, Alter
und Geschlecht, während die deutschen Vertriebenen trotz aller Schrecken ungleich
verteilte Überlebenschancen besaßen.
Jahrzehntelang lief die Mehrheitsmeinung darauf hinaus, den Vertriebenen die
Privatisierung ihres Leids zuzumuten. Nach ersten Untersuchungen in den
1950er/60er Jahren kam auch im Grunde keine seriöse Vertreibungsforschung in
Gang. Erst in den letzten zehn, fünfzehn Jahren ist Bewegung in diese Problematik
geraten. Mit der Fusion der beiden Neustaaten von 1949 entstand erstmals ein
deutscher Staat, der ohne Grenz- und Minderheitenprobleme existiert. Diese
neuartige Konstellation erleichtert die nüchterne Analyse, die nach Möglichkeit eine
vergleichende Perspektive besitzen sollte. So gehört etwa die Vertreibung der
Deutschen aus Schlesien in ein und den selben Zusammenhang mit der Vertreibung
der Polen aus dem im Hitler-Stalin-Pakt der Sowjetunion zugesprochenen Ostpolen.
Überdies haben die Balkankriege der 1990er Jahre die Gräuel der "ethnischen
Säuberung" erneut heraufbeschworen. Sie erinnern an die Erfahrungen der
Vertriebenen ein halbes Jahrhundert zuvor, und sie demonstrieren auch den damals
nicht betroffenen jüngeren Deutschen die barbarischen Schrecken dieser
Gewaltpolitik.
Die jetzt in der Bundesrepublik einsetzende Diskussion könnte eine befreiende
Wirkung insofern haben, als die verdrängte, abgesunkene Leidensgeschichte von
Millionen Menschen zutage gefördert wird und endlich im hellen Licht der
Öffentlichkeit ernsthaft diskutiert werden kann. Offensichtlich gibt es dabei aber eine
Gefahr: Wenn diese Diskussion nicht behutsam, auch ohne Selbstgerechtigkeit,
geführt wird, könnte sie eine Hemmschwelle aufbauen, die sich gegen den EU-Beitritt
der osteuropäischen Staaten auswirkt. Doch ihre Aufnahme ist nach den Schrecken
des Zweiten Weltkriegs und der Sowjetisierung schon deshalb geboten, um die
politische und sozialökonomische Verfassung dieser genuin europäischen Länder
endlich zu stabilisieren.
Wie konnte es zu den Massenvertreibungen in Osteuropa und Ostdeutschland
kommen: erst der Polen durch die deutsche Besatzungsherrschaft, dann der
Deutschen und "Volksdeutschen" in Polen und der Tschechoslowakei, in Ungarn
Rumänien und Jugoslawien? Die Vorläuferphänomene, die Vertreibung der
Armenier, Türken und Griechen, galten bis 1939 als Schreckenstaten in Kleinasien
und auf dem Balkan, abseits der Kernzone europäischer Zivilisation. Wozu man aber
eben dort fähig war, trat seit 1939 zutage. Den Anfang machte die NS-Politik, mitten

in Europa, mit einer riesigen "Umsiedlung" von Polen, um für "Volksdeutsche" aus
Osteuropa Platz zu schaffen: für die Baltendeutschen und die deutschsprachigen.
"Volksgruppen" aus Wolhynien, Galizien und den Karpaten, später aus der
Bukowina, aus Siebenbürgen und Bessarabien, aus der Dobrudscha und der
Gottschee.
Hitler hatte im Herbst 1939 die Neuordnung der nationalen Landkarte Europas
angekündigt. Dem "Reichsführer SS" Heinrich Himmler wurde als neu ernanntem
"Reichskommissar für die Festigung Deutschen Volkstums" die umfassende
Germanisierung des Ostensübertragen. Dort sollte ein riesiges Vorfeld des
"Großgermanische Reiches“ entstehen, besiedelt mit "volksdeutschen" und
reichsdeutschen Wehrbauern. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion sollte
sich dieses Gebiet bis zum Ural erstrecken, da der "Generalplan Ost", später
umfassender noch der "Generalsiedlungsplan", eine derartige Expansion mit einer
kühl einkalkulierten Verlustquote von rund 32 Millionen Russen vorsah.
Zunächst wurden in kurzer Zeit 500 000 Polen aus Westpreußen und Posen in das
südliche Restpolen, das Generalgouvernement", abtransportiert, während zwei
Millionen polnische Zwangsarbeiter ins Reich verschleppt wurden. In die entleerten
polnischen Dörfer wurden "volksdeutsche" Umsiedler eingewiesen, die nach drei, vier
Jahren vor der Roten Armee flüchteten. Der Hexenkessel dieser deutschen
Germanisierungspolitik mit ihren brutalen Bevölkerungsverschiebungen von
gewaltigem Ausmaß erzeugte einen selbstgeschaffenen Druck, der auch den
Übergang zur "Endlösung" der "Judenfrage" beförderte, da das Chaos ausgenutzt
wurde, um "judenfreie" Gebiete zu schaffen. Die Umsiedlung von "Volksdeutschen"
erfasste die Zone vom Baltikum bis zur Krain, aber für die Germanisierung der weiten
Räume des Osten fehlten dann nach Himmlers Berechnungen immer noch fünf bis
sechs Millionen reichsdeutsche Siedlungswillige. Doch die Bauernsöhne im "Altreich"
dachten nicht daran, als Wehrbauern in die Ungewissheit des östlichen Vorfelds zu
ziehen.
Hinzu kam seit 1941 aber auch noch die rabiate Umsiedlungspolitik Stalins. Der ließ,
als die deutschen Truppen schnell vorrückten, ganze Völkerschaften, wie etwa die
Tschetschenen, und die große Minderheit der Wolgadeutschen wegen des
Kollaborationsrisikos in die kasachische Steppe abtransportieren, ohne jede
Rücksicht auf die horrenden Verluste an Leben. Eine künftige Siegermacht
demonstrierte damit ganz konkret die Möglichkeiten menschenfeindlicher Politik.
Nach dem Kriegsende erwies sich: Der gewaltsame "Transfer" als Folge deutscher
und russischer Politik hatte den Erfahrungs- und Denkhorizont der Zeitgenossen
unheilvoll ausgeweitet. Die Planung eines neuen "Transfers" der deutschsprachigen
Minderheiten aus Osteuropa und der deutschen Bevölkerung aus Ostdeutschland
galt seither als ein legitimes Mittel zur Beseitigung künftiger Konflikte (wie das auch
Churchill glaubte), zugleich als verständlicher Racheakt, um den Todfeind aus dem
eigenen Land oder aus dem soeben annektierten ehemaligen deutschen
Staatsgebiet möglichst lückenlos zu vertreiben. Als Folge des anlaufenden
"Transfers" wurden die Deutschen, sofern sie nicht rechtzeitig geflüchtet waren, mit
gnadenloser Härte vertrieben. Die riesige Verlustziffer liegt weit über einer Million,
nähert sich aber vielleicht, wenn man die späteren Todesfälle als Folge wochenlang
anhaltender Transporte oder Trecks mit einbezieht, sogar der Zwei-Millionen-Grenze.

Wurde dadurch tatsächlich, wenn man das unermessliche Leid einmal verdrängt, der
innere Frieden in Europa gesichert, wie das die politisch verantwortlichen Akteure
anfangs beansprucht haben? Hunderttausende von deutschsprachigen Bewohnern
Ungarns und Rumäniens, wo keine derart fanatische Vertreibung wie in Polen oder in
der Tschechoslowakei stattfand, warfen mit ihrer Anwesenheit für diese Staaten kein
gravierendes Problem auf. Die inhumane Vertreibung aus Polen, der
Tschechoslowakei und aus Jugoslawien löste auch nicht die inneren Nachkriegs-
probleme dieser Länder, reduzierte aber die Konfliktmöglichkeiten der Nationali-
tätenpolitik.
Ein bitter erkaufter Gewinn: Die Bundesrepublik hat heute keine Irredentaprobleme,
keine "unerlösten" Minderheiten jenseits ihrer Ostgrenzen, auch wenn eine
Landsmannschaft wider alle Vernunft die kleine deutsche Minderheit in Polen
künstlich zu vergrößern sucht. Solch eine Entspannung entkräftet indes nicht die
Gefahr, dass aus der Konfliktminderung auf dem Feld der Nationalitätenspannungen
eine quasi-moralische Rechtfertigung grässlicher Verbrechen hergeleitet wird.
Gegen die unterkühlte, mit dem Argument des inneren Friedens operierende
Legitimierung der Vertreibung der Deutschen und "Volksdeutschen" lässt sich
einwenden: Im Kalten Krieg sorgte das Gleichgewicht des atomaren Schreckens für
einen prekären Frieden, nicht aber die "ethnische Säuberung" mit ihrer
Nomadisierung von Millionen Menschen. Die verblüffend schnelle Integration der
Vertriebenen und Flüchtlinge in die Wachstumsgesellschaft des westdeutschen
Wirtschaftswunders verhinderte einen militanten Revanchismus, mithin die
Erzeugung gefährlicher Spannungen nicht nur in Deutschland, das die Alliierten doch
hatten ruhig stellen wollen.
Was bleibt? Die osteuropäischen Siedlungsgebiete und die ostdeutschen Provinzen
sind ein für allemal verloren. Es überlebt ein wenig Folklore, die Erinnerung an
historische Leistungen, für Ältere die nostalgische Beschwörung der Heimat.
Millionen zahlten mit dem Verlust ihrer Heimat und den erlebten Schrecken der
Vertreibung einen hohen Preis für den zweiten verlorenen totalen Krieg, für den
Gegenschlag gegen die nationalsozialistische Bevölkerungspolitik. Doch die
Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik haben es ermöglicht – und ermöglichen es
weiterhin – diese Bürde zu ertragen.
Sollte es in naher Zukunft tatsächlich zu einem "Zentrum der Erinnerung" an die
Vertreibung kommen, müssen zwei Vorbedingungen erfüllt sein. Zum einen müsste
eine solche Begegnungsstätte der Erinnerung einer gemeineuropäischen
Katastrophe gewidmet sein, mithin nicht auf eine isolierte Behandlung der
Vertreibung der Deutschen beschränkt werden. Zum anderen läge ein solches
Zentrum ungleich besser in Breslau als in Berlin. Denn in Schlesien fördert es die
Verständigung mit Polen, das ebenfalls den Millionen seiner Vertriebenen eine neue
Heimat schaffen musste. Vor allem aber implizierte die symbolpolitische Konkurrenz
eines Berliner Zentrums mit dem Holocaust-Denkmal die Gefahr, dass in nächster
Nähe des Totenmals doch noch eine Aufrechnung unvergleichbaren Leidens
unternommen würde.
Stefan Aust/Stephan Burgdorff (Hg.), Die Flucht. Über die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten.
(c) 2002 Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart/München und SPIEGEL-Buchverlag, Hamburg
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
von der Lippe, Juergen und Cleves, Monika Sie und Er Botschaften aus parallelen Universen
Graham, Lynne Ein Prinz wie aus dem Märchen
Graham, Lynne Ein Prinz wie aus 1001 Nacht
Jack Young 640 kuriose und witzige Gesetze aus Amerika
Und wir dachten der Toten, S 338 (Liszt, Franz)
1968 – Ein Jahr des Aufbruchs und der Zäsur Adelbert Reif im Gespraech mit Norbert Frei
zeit, Wie wir unsere Zeit verbringen
David Irving Wie Krank War Hitler Wirklich Der Diktator und seine Ärzte (1980)
Aus Literatur und Kultur Günter Grass
Aus Politik und Zeitgeschichte
8 WIE WÄHLT MAN AUS
Bilingualismus und Code switching bei der zweiten türkischen Generation in der BDR Sprachverhalten u
023 028 Teil 1 Und wenn alles, was wir wissen, falsch wäre
Kanonische Variationen Bach Thema aus Musikalisches Opfer
Ich gehe aus dem Hof und biege links ab
Aus Literatur und Kunst Joseph Beuys
Aus Literatur und Kultur Heinrich Böll
więcej podobnych podstron