

Karen Finneyfrock
Ihr werdet schon sehen!
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von
Friederike Zeininger
Deutscher Taschenbuch Verlag
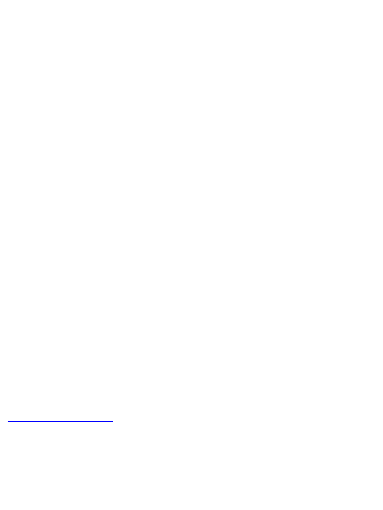
Deutsche Erstausgabe
2014 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH und Co. KG, München
© 2013 Karen Finneyfrock
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
›The Sweet Revenge of Celia Door‹,
2013 erschienen bei VIKING, Penguin Group USA
Published by Arrangement with Karen Finneyfrock
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur
Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Umschlagkonzept: Balk & Brumshagen
Umschlaggestaltung: buxdesign I München,
unter Verwendung einer Illustration von Carla Nagel
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit
Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Ver-
vielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Ver-
arbeitung in elektronischen Systemen.
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
eBook ISBN 978-3-423-42286-4 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-78280-7
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden
Sie auf unserer Website

Für Molly Eleanor Rhoades

1
Mit vierzehn ließ ich die Finsternis in mein Leben. Seither bin ich
Celia die Finstere.
Am ersten Tag der neunten Klasse legte ich die zwanzig Blocks von
zu Hause zur Schule in so schweren Stiefeln zurück, dass es aussah,
als wäre ich über den Sommer fünf Zentimeter gewachsen. Ich trug
ein graues T-Shirt und darüber meine schwarze Jacke. Die Kapuze
hatte ich mir bis zum Eyeliner in die Stirn gezogen. Ich schlich mich
durch den Hintereingang ins Gebäude, fand meinen Spind im ersten
Stock und klebte mit Kreppband ein Schild auf die Tür: ein Stück
schwarzer Karton mit Buchstaben, die wie bei einem Erpresserbrief
aus Zeitschriften ausgeschnitten waren.
Manche Leute gehen ja angeblich zur Schule, um etwas zu lernen.
Viele, um Freunde zu finden oder weil sie gerne Theater oder Fußball
spielen. Die meisten kommen, weil es die Schulpflicht gibt und ihre
Eltern es wollen. Ich ging in die Hershey Highschool, um mich zu
rächen. Ich wusste noch nicht genau, wie, aber so viel war klar:
Meine Rache sollte absolut erniedrigend sein. Alle sollten davon er-
fahren und mein Opfer sollte sofort wissen, dass ich dahintersteckte.
Ich bin ein Planet, der die rachegelbe Sonne umkreist.
Ein Samenkorn, aus dem Vergeltung erwächst.
Ich bin warmes Wasser, das den Eiswürfel lyncht.
Bitterkeit, die das Essen verdirbt.
Ich bin eine Filmrolle. Schau dir an, was ich tu.

Dieses Gedicht habe ich im Sommer geschrieben. Seit ich finster ge-
worden bin, habe ich jede Menge Gedichte geschrieben.
Während ich die Bücher aus meinem Rucksack in meinen Spind
packte, füllten sich die Gänge mit Schülern, die sich wie immer am
ersten Schultag endlos viel zu erzählen hatten. In diesem Moment
hörte ich sie, süßlich zwitschernd über all dem Stimmengewirr. Wie
ein kleiner Vogel mit einer viel zu lauten Stimme. Sie zeigte auf mein-
en Spind und flötete: »Mit jedem Jahr stranger.« Und die Mädchen,
die sie anhimmelten, hielten sich die Hand vor den Mund und
kicherten.
Sandy Firestone! Wenn mein Herz eine Armbrust wäre, würde
jeder Pfeil auf sie zielen.
***
Auf dem Schild stand: CELIA DIE FINSTERE.
6/254
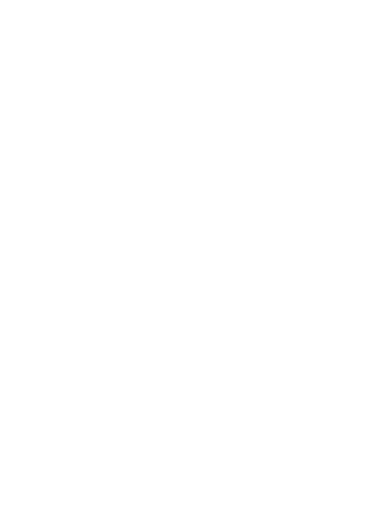
2
Zur Sicherheit befestigte ich das Schild mit ein paar zusätzlichen
Streifen Klebeband und machte mich dann auf den Weg zur ersten
Stunde. Englisch. Englisch ist nicht nur mein Lieblingsfach, es ist
überhaupt das einzige Fach, für das ich mich interessiere. Alle ander-
en Fächer sitze ich nur ab, um die Punkte zu kriegen, aber in Eng-
lisch vergeht die Zeit wie im Flug und es klingelt meistens viel zu
früh. Ich habe schon immer gerne gelesen. Normalerweise lese ich
mindestens zwei Bücher gleichzeitig, und ich liebe Bibliotheken nun
mal so wie die Leute aus der Schwimmmannschaft ihre Handtücher.
Kurz bevor es gongte, kam ich ins Klassenzimmer und schob mich
auf einen Platz in der letzten Reihe. An der Fensterseite standen zwei
lange Tische mit Stapeln und Stapeln von Büchern. Mein Puls ber-
uhigte sich und ein schmales Lächeln stahl sich in mein Gesicht. Ich
holte mein Notizbuch und einen Stift heraus und hoffte, dass der Un-
terricht mit der Frage: »Was habt ihr denn über den Sommer so ge-
lesen?« beginnen würde.
Mit einem Kaffeebecher in der Hand kam unser Lehrer herein und
setzte sich an sein Pult. Er war kaum größer als ich, hatte schon fast
eine Glatze und trug eine zerknitterte Hose. Nicht gerade der ro-
mantische Typ, den ich mir als Englischlehrer gewünscht hätte. Aber
man sollte vielleicht nicht gleich sein Urteil fällen.
Während ich noch auf den zweiten Gong wartete, ereignete sich die
erste Schulanfangskatastrophe. Sandy Firestone kam herein. Sie

hatte ihr Beiboot, ihre beste Freundin, im Schlepptau: Mandy Hew-
ton. Ja, richtig, die Namen der beiden reimen sich. Und nein, das ist
kein Zufall. In der sechsten Klasse hieß Mandy noch Amanda Hew-
ton. In der siebten Klasse stieg sie in der Beliebtheitsskala so weit
auf, dass sie Sandys beste Freundin wurde, und sie bat ernsthaft alle
Lehrer, sie Mandy zu nennen. Unübersehbar ist allerdings, dass
Sandy Mandy trotz ihrer neuen Position eher wie eine Assistentin
und nicht wie eine ebenbürtige Freundin behandelt.
Ich kenne Sandy Firestone seit der sechsten Klasse. Und wenn ich
kennen sage, meine ich nicht mögen. Wer Sandy zum ersten Mal
begegnet, wird einer Musterung von Kopf bis Fuß unterzogen. Ihre
Augen scannen dich, bevor ihre Lippen preisgeben, ob sie dich für
einen Jäger oder für die Beute hält. Wenn sie dich für die Beute hält
– was bedeutet, du bist ein hässliches Mädchen oder ein verklem-
mter Junge –, dann verzieht sie die Lippen zu einem lautlosen Nee.
Wenn sie Angst hat, du könntest Jäger sein, ein hübsches Mädchen
also, das neu zugezogen ist, oder ein Junge, der clever ist, aber nicht
an ihr interessiert, dann setzt sie ein breites Lächeln auf, das ihre
makellosen Zähne aufblitzen lässt.
Sandy hat in den letzten Jahren immer wieder an irgendwelchen
Schönheitswettbewerben teilgenommen und ihr Lächeln hat ihr den
Spitznamen Miss Hershey eingebracht.
Sandy und Mandy ließen sich auf der anderen Seite des Klassenzi-
mmers auf zwei Stühle plumpsen, und ich versuchte, die kleinen Sch-
weißperlen, die sich an meinem Haaransatz bildeten, wieder in die
Haut zurückzuzwingen.
»Celia, Kapuze runter, bitte«, waren die ersten Worte, die mein
neuer Englischlehrer an mich richtete. Freue mich auch, Sie kennen-
zulernen, Mr Pearson.
8/254

»Also, herzlich willkommen im Sprach- und Literaturunterricht
der neunten Klasse. Ihr merkt, ich habe nicht Englischunterricht
gesagt. Es geht nämlich nicht nur darum, Bücher zu lesen. Ihr sollt
vielmehr lernen, Bücher zu analysieren, Aufsätze darüber zu
schreiben und die Arbeiten der anderen zu beurteilen. Wir wollen
Bücher nicht einfach als Lektüre begreifen, die man liest und wieder
vergisst, sondern als Texte, die man genau durchleuchtet und ver-
steht. Als Erstes aber setzt ihr euch bitte auf eure zugewiesenen
Plätze.«
Jedes Mal, wenn ein Lehrer von den »zugewiesenen Plätzen«
spricht, geht ein Stöhnen durch die Klasse. Wir stöhnten – wie
erwartet.
»Tut mir leid, aber ich will in Zukunft keine Zeit damit verlieren,
die Anwesenheit zu überprüfen. Es geht also nach dem Alphabet.« O
nein! Das hatte ich schon mal erlebt! Door und Firestone sind im
Alphabet ziemlich nah beieinander. Die ganze Acht hindurch saß ich
im Englischunterricht neben Sandy. Ich konnte nur hoffen, dass je-
mand mit dem Namen Susan Edward oder David Emanuel in die
Klasse gekommen war. »Cynthia Adams, hier.« Mr Pearson zeigte
auf einen Stuhl in der Ecke rechts hinten im Klassenzimmer und
arbeitete sich von dort aus nach vorne. »Alicia Brady«, sagte er,
»Chad Brooks, Jahlil Cromwell, Anupa Dewan, Celia Door.« Er zeigte
auf einen Stuhl auf halber Höhe der Fensterreihe. Ich hielt den Atem
an. Komm schon, Susan Edward. »Sandy Firestone«, fuhr er fort,
»bitte hier.«
Ein ganzes Jahr Englisch mit Sandys blonden Haaren auf meinem
Tisch! Diese Folter hatten mir wohl die Götter zugedacht! Lustlos
schlurfte ich zu meinem Platz und knallte meinen Rucksack auf den
Tisch. »Celia, etwas weniger Theatralik, bitte«, wies Mr Pearson
9/254

mich zurecht und bot Sandy damit die perfekte Gelegenheit, breit zu
grinsen, während sie sich auf dem Stuhl vor mir niederließ. Sie kreis-
chte leise auf, als Amanda Hewton den Platz neben ihr einnahm. Sie
fassten sich über den Gang hinweg an den Händen und schlangen
ihre Finger ineinander.
Für den Rest der Stunde versuchte ich mich auf den Unterricht zu
konzentrieren. Wir bekamen den Stoff für das Schuljahr ausgeteilt
und unsere erste Pflichtlektüre war ›Wer die Nachtigall stört‹ von
Harper Lee. Ich aber konnte an nichts anderes denken, als dass mein
Schuljahr schon ruiniert war, bevor es überhaupt begonnen hatte.
Ich schlug mein Notizbuch auf und versuchte mich auf meine einzig
mögliche Weise zu trösten. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht,
dachte ich. Vielleicht verschafft mir diese Sitzordnung die Gelegen-
heit, Rache zu üben.
10/254

3
Wenn ich sage, ich habe die Finsternis in mein Leben gelassen, dann
heißt das, ich habe aufgegeben. Ich habe aufgegeben, mich anzu-
passen und zu erwarten, dass alle mich mögen. Im Gegenteil, ich
habe akzeptiert, dass niemand mich mag, und ich mache mir nichts
mehr daraus, was die anderen denken. Nach all den schrecklichen
Dingen, die in der Achten passiert sind, ist mir klar geworden, dass
ich das einzige Nachtschattengewächs in einem Beet voller Sonnen-
blumen bin.
Genau gesagt begann meine Finsternis am 21. Juli, meinem
vierzehnten Geburtstag. Vielleicht sieht es nicht so aus, als hätte sich
viel verändert. Ich habe mich nicht in ein Gothic-Girl verwandelt, mir
nicht die Zunge gepierct und mir auch nicht die Haare schwarz ge-
färbt. Meine Haare sind ohnehin dunkel und meine Haut ist eher
blass, aber ich trage neben den schwarzen Klamotten manchmal
auch bunte. Hier ein Gedicht über meine Haut:
celias haut
ist so weiß wie
die sonnengebleichten knochen
eines gestrandeten
walskeletts

Schon bevor ich finster wurde, haben mich die Leute gedisst. Und sie
dissen mich immer noch. Der Unterschied ist nur, dass ich jetzt
zurückdisse.
Der Rest des ersten Schultags war erträglich. In den meisten Stun-
den folgte die Sitzordnung dem Alphabet. Ich musste mir also gar
nicht erst Gedanken machen, wer neben mir sitzen würde. In Fran-
zösisch bildeten wir für die Dialogübungen Dreiergruppen. Ich kam
mit Liz Thompson und Vanessa Beale zusammen, die jetzt jeden Tag
eine Schulstunde lang mit mir reden müssen. In den kurzen Pausen
zwischen den Stunden tat ich so, als wäre ich an meinem Spind
beschäftigt. Die Mittagspause aber war nicht so leicht zu bewerkstel-
ligen. Ich riskierte es, mich beim Basketballfeld ins Gras zu setzen,
und aß kalte Pizza, während ich meine Nase in ein Buch steckte. Und
danach beschloss ich, die Pause am sichersten, ruhigsten Platz einer
jeden Stadt, einer jeden Schule, eines jeden Gefängnisses zu verbrin-
gen: in der Bibliothek.
Bibliotheken sind mein Kraftzentrum. Wenn in einem Videospiel
mein Avatar irgendwo hingehen müsste, um nach einem Kampf seine
Lebenskraft wieder aufzuladen, würde ich ihn in eine Bibliothek
schicken. In diesem Sommer habe ich jede Woche zwei Bücher ver-
schlungen. Für den Herbst habe ich mir vorgenommen, zehn Sach-
bücher zu lesen, die mit Schule direkt nichts zu tun haben. Wenn ich
jede Woche eins schaffe, bin ich bis Thanksgiving durch.
Also machte ich mich auf die Suche. Die Bibliothekarin sah mich
überrascht an, als ich mir ein Buch mit dem Titel ›Fremde Welten.
Der Einfluss anderer Kulturen auf unsere Sprache‹ ausleihen wollte.
»Steht das auf eurem Lehrplan?«, fragte sie mit einem Blick auf
meinen Ausweis.
12/254

»Es ist nicht für den Unterricht«, erklärte ich finster. Mehr sagte
ich an diesem Tag in der Schule nicht, zu niemandem.
Die nächsten beiden Tage verliefen ohne große Zwischenfälle.
Abgesehen vom Mittwochmorgen, als ich mich in Englisch zu Wort
meldete, um zu sagen, dass ich es nicht gerade aufbauend fand, an-
gesichts unserer wirtschaftlichen Lage einen Roman zu lesen, der zur
Zeit der Großen Depression spielte. Sandy stöhnte und sagte: »Celia,
du bist immer so … negativ.«
»Ach ja?«, entgegnete ich. »Dann lass uns doch mal zusammen in
’ne Dunkelkammer gehen und wir schauen, was passiert.« Was ich
für eine super Retourkutsche hielt, weil ich an Fotonegative dachte.
»Iiih«, machte Sandy. »Celia ist lesbisch.«
»Mädchen«, mischte Mr Pearson sich ein, »hört auf zu streiten.«
Aber schon in der Mittagspause nannten mich die anderen Celia, die
schwarze Lesbe.
Trotzdem hatte ich die Hoffnung noch nicht verloren, mich in der
Highschool hinter anderen Spinnern und Mauerblümchen versteck-
en zu können. Sicher gab es hier Schüler und Schülerinnen, ob nun
neu an der Schule oder in den höheren Klassen, die die
Aufmerksamkeit von mir ablenken würden. Ich würde meinen
Schützengraben ausheben und dort den Krieg überdauern.
Am Mittwoch nach der Mittagspause aber sollte alles anders
werden.
Auf dem Weg von der Bibliothek zum Geschichtsunterricht legte
ich einen Stopp an meinem Spind ein. Ich ging in die Knie, um einen
Roman gegen ein Schulbuch zu tauschen. Seine Stimme durchbrach
eine dreitägige Stille. Ich war so erschrocken, dass ich die ›Europäis-
che Geschichte‹ fallen ließ.
»Was soll das denn bedeuten: ›Celia die Finstere‹?«
13/254

Seine gelb-blauen Sneakers standen kaum einen Schritt weit von
mir entfernt, die dicken Schnürsenkel krochen über die Schuh-
laschen wie aufgequollene Regenwürmer nach einem Schauer. Ein
Fuß ruhte auf dem Boden, während der andere mit der Sohle lässig
gegen den Spind lehnte. Seine Waden steckten in engen Jeans und
unter einer locker sitzenden orangefarbenen Kapuzenjacke umspan-
nte ein schmal geschnittenes T-Shirt seinen schlanken Oberkörper.
Das ganze Outfit war eine Mischung aus körperbetont und lässig.
Er aß einen Burrito, obwohl es in der Schule verboten ist, außer-
halb der Cafeteria zu essen. Er war voll der coole Typ. Ich hatte ihn
schon auf dem Gang gesehen und er war in meinem Erdkundekurs.
Er hieß Drake Berlin und er hatte einen Stil, den man nur haben
kann, wenn man in New York City oder im Ausland aufgewachsen ist.
Aus der Vorstellungsrunde am ersten Tag wusste ich, dass Drake tat-
sächlich von New York hierhergezogen war.
Noch nie zuvor war ein cooler, gut aussehender Junge zu mir an
den Spind gekommen. Ich war misstrauisch und aufgeregt zugleich
und versuchte, locker und eher gleichgültig zu klingen. »Weil ich
eben finster bin«, erklärte ich und hob mein Geschichtsbuch auf.
Daraufhin sagte er etwas, was seit Langem niemand mehr zu mir
gesagt hatte: »Cool.« Und dann fügte er hinzu: »Magst du Comics?«
Damit stopfte er sich den letzten Bissen seines Burritos in den Mund.
An diesem Tag gingen Drake und ich nach der Schule zum ersten
Mal zu der Stelle im Wäldchen.
14/254

4
Die Stadt Hershey im Bundesstaat Pennsylvania wurde im Jahr 1903
von Milton S. Hershey gegründet, der für die Arbeiter seiner
Schokoladenfabrik Unterkünfte brauchte. Der Slogan der Stadt lautet
»Der süßeste Ort der Welt«. Eigentlich sollte er eher heißen: »Die
Stadt, die sich der Anbetung von Weißzucker verschrieben hat«. Die
Hälfte meiner Mitschüler und Mitschülerinnen leidet an einem
Aufmerksamkeitsdefizit, und wir alle werden von morgens bis
abends mit Hershey-Schokolade vollgestopft.
Drakes Großmutter wohnt im gleichen Viertel wie ich. In unserer
Stadt, die auf dem Reißbrett entworfen wurde, stehen fünf ver-
schiedene Haustypen zur Auswahl. Die einzige echte Wahl aber, die
ein Hauskäufer hat, ist die Wahl zwischen einer einfachen und einer
Doppelgarage. Unser Haus ist eines vom Typ 3, »Cape Cod« genannt.
Früher ist mein Vater durch die Gegend gefahren und hat die Leute
aufgezählt, die sich ebenfalls für »Cape Cod« entschieden hatten.
»Hier, schau, Steve Bishop auch«, erklärte er meiner Mutter. »Selbst
wenn es nur ebenerdig ist, ich glaube trotzdem, dass bei dieser Bau-
weise der quadratische Grundriss am besten genutzt wird.«
Und meine Mutter gab dann Sätze zur Antwort wie: »Wann war
noch mal der Elternsprechtag?« Meine Eltern klangen oft wie zwei
Menschen, die nicht am selben Gespräch beteiligt waren. Gerade so,
als würde jeder über ein unsichtbares Headset mit jemandem reden,

der nicht anwesend war, und dabei sein Gegenüber nur zufällig
ansehen.
Das Haus von Drakes Großmutter entspricht allerdings keinem der
fünf Typen. Es stand schon, bevor die Stadtplanung kam. Und so
thront es am Ende einer Sackgasse wie ein Apfelbaum auf einer
Wiese mit lauter Pfirsichbäumen. Es ist das einzige Haus, das an un-
erschlossene Flächen angrenzt.
Während wir auf dem säuberlich gefassten Gehweg von der Schule
zu unserem Viertel gingen, erzählte Drake, wie es zu diesem Haus
gekommen war. »Meine Großeltern sind vor vielen Jahren von New
York City nach Hershey gezogen, weil sie später als Rentner in einer
ruhigeren Stadt leben wollten. Als sie ihr Haus bauten, standen hier
überall noch Bäume.« Drake machte eine Handbewegung, als sägte
er sämtliche Häuser entlang der Straße ab. »Aber dann kamen
Bauunternehmer und kauften die Grundstücke rund um das Haus
auf. Großmutter sagt immer, die Bäume fielen um wie Dominosteine
und die Häuser schossen wie Löwenzahn aus dem Boden. Und jetzt
wohnt sie mitten in dieser Siedlung und ist die Einzige, die noch
Bäume im Garten hat. Bis heute rufen jedes Jahr irgendwelche
Bauunternehmer bei Großmutter an und fragen, ob sie ihr Haus
nicht verkaufen will.«
Seit Drake und ich das Schulgebäude verlassen hatten, fingerte ich
unbehaglich an meinen Klamotten herum. Ich zog mir die Kapuze
über den Kopf und nahm sie wieder ab. Ich zerrte die Kordel zuerst
mit der rechten Hand ganz zur einen Seite, dann mit der linken zur
anderen. Etwa so, als wollte ich mir mit einer Klinge aus weicher
Baumwolle den Kopf absägen. Irgendwann zwang ich mich, die Kor-
del loszulassen und etwas zu dem gut aussehenden und wortge-
wandten Typen, der neben mir herging, zu sagen.
16/254

»Magst du … Hershey?«, erkundigte ich mich roboterhaft. Bingo!
Ich hatte die langweiligste aller Fragen gestellt! Innerlich jaulte ich
auf, sobald die Worte draußen waren.
»Die Schokolade schon, egal welche Sorte«, sagte Drake. »Die
Stadt nicht so.«
Als wir da waren, schwenkten wir um den Vorgarten von Drakes
Großmutter herum und gingen am Haus vorbei und durch den wie
mit der Nagelschere gepflegten Garten zum dahinter angrenzenden
Wäldchen. Wir liefen so tief hinein, bis die Baumkronen ein dichtes
Dach bildeten, und stießen auf einen umgestürzten Baum, auf den
wir uns wie auf eine Bank setzten. Der Stamm war längst
abgestorben, aber neue kleine Bäume, die die Nährstoffe des ver-
wesenden Stamms nutzten, wuchsen daraus hervor. Über dieses
Prinzip der Totholzverjüngung hatte ich in einem Buch mit dem Titel
›Nachts in unseren Wäldern‹ gelesen.
Hier draußen roch die Luft süßlich und feucht und statt der typis-
chen Geräusche – Fernseher, vorbeifahrende Autos und bellende
Hunde – waren Vogelgezwitscher, das Fiepen der Eichhörnchen und
das Rascheln der Zweige zu hören.
Ich hatte schwarze Leggings und schwarze Stiefel an. Die Kapuze
zog ich mir tief ins Gesicht und meine Arme schlang ich fest um
meine Beine. Ich tat so, als wäre mir kalt, aber in Wirklichkeit fühlte
ich mich vor allem verletzlich. Und gleich stellte Drake die Frage, die
ich am allermeisten fürchtete.
»Mit wem bist du in der Schule denn so zusammen?«, meinte er
beiläufig, als wollte er mich nur kennenlernen.
»Äh«, sagte ich und meine Stimme klang viel zu hoch. Nicht mal
ein vollständiges Wort hatte ich zu dem Thema von mir gegeben und
schon hatte ich die Sache verschissen! Ich versuchte es mit einem
17/254

anderen Ton, etwas tiefer, aber meine Stimme versagte vollkommen.
Ich fühlte mich so leer wie eine verlassene Kohlenmine.
»Warum bist du von New York hierhergezogen?«, fragte ich und
tat so, als wäre mir die Frage ganz plötzlich eingefallen.
Drake stand auf und ging zu einem Baum mit tief hängenden Zwei-
gen. Vorsichtig drückte er gegen einen Zweig, dann setzte er seinen
Fuß in die Astgabel und zog sich hoch.
»Ich hab was verbockt«, antwortete er von oben. »In New York
muss man sich um die Aufnahme an einer Highschool bewerben. Ich
wollte auf eine Kunstschule. Ich habe die drei besten Schulen aus-
gewählt und meine Bewerbungsmappe zusammengestellt. Aber ich
war zu spät dran und jetzt sind alle Plätze vergeben. Meine Eltern
haben ein schlechtes Gewissen, weil sie sich nicht gekümmert haben,
und jetzt versuchen sie, die Sache noch irgendwie zu regeln«, erklärte
er und platzierte einen Fuß auf dem nächsthöheren Ast. »Aber erst
mal muss ich bei Gran bleiben und auf die Hershey High gehen.
Sonst bleibt mir nur die Schule, die in New York für unser Viertel
zuständig ist. Und die ist absolut krass.« Er kletterte immer weiter
den Baum hinauf.
Ich wusste, wie grausam die Regelung mit den Schulbezirken sein
konnte. Während der Grundschule war ich die ganze Zeit mit vier
Mädchen befreundet gewesen: Jane, Emily, Raisa und Sarabeth. In
der vierten und fünften Klasse lud immer freitagabends eine von uns
die anderen zum Übernachten ein. Wir steckten so eng zusammen,
dass mein Vater, wenn er zwei von uns sah, fragte: »Wo sind denn
die anderen?« Aber nach der fünften Klasse gab es neue Schulbezirke
und ich wurde der Hershey Middleschool zugeteilt, während die an-
deren auf die Hilltop gingen.
18/254

In den Sommerferien nach der Fünften spielten wir noch zusam-
men und in der Sechsten wurde ich noch zu den Geburtstagsfeiern
der anderen eingeladen. Als sie aber anfingen, sich über einen Lehrer
lustig zu machen, der beim Sprechen Spucke regnen ließ, konnte ich
nicht mitlachen. Und wenn der Name Chad fiel, warf ich mich nicht
jedes Mal auf das nächstbeste Bett und kicherte los. Ich gehörte nicht
mehr dazu und nach einer Weile zerrissen die ewigen Bande unserer
Freundschaft.
Wer auf die Hilltop Middleschool ging, kam anschließend auf die
Lower Dauphin Highschool, die bei den Schulwettkämpfen der
schlimmste Rivale von Hershey High ist. Wenn ich also die Nerven
hatte, Anfang Oktober zum Spiel zu gehen, würde ich meine ehemali-
gen Freundinnen wiedersehen. Die Plakate dafür hingen schon auf
sämtlichen Gängen der Schule.
»Das heißt, du bleibst nur für die Neunte hier?«, fragte ich.
»Wie bitte? Ich hoffe, dass ich in maximal einem Monat wieder
weg bin!«, lachte Drake vom Baum herunter. »Bei zwei Schulen stehe
ich auf der Warteliste, und es kann gut sein, dass ich noch rein-
rutsche. Ich will mich in Hershey gar nicht erst eingewöhnen«, fügte
er hinzu und zog mit beiden Händen an einem Ast. »Ich bin nur zu
Besuch hier.«
Ich hatte nicht gemerkt, dass Hoffnung in mir aufgekeimt war, nur
um sofort wieder erstickt zu werden. Er war nur zu Besuch hier. Klar.
»Ich kann mir vorstellen, warum du nicht viele Freunde hast«,
fuhr Drake jetzt fort und prüfte den nächsthöheren Ast mit seinem
Fuß. »Die Leute hier sind viel zu spießig für dich.« Er trat in die Ast-
gabel und sein Gesicht verschwand zwischen den Zweigen.
Ein paar Meter weiter flirteten zwei Schmetterlinge miteinander.
Die Kapuze rutschte mir vom Kopf, während ich zu Drake hochsah.
19/254

Ein leichtes Wippen der Zweige, dann war er vollends im Baum
verschwunden.
20/254

5
Bevor Drake zum Abendessen ins Haus ging, drehte er sich noch ein-
mal um. »Bis morgen in der Schule!«, rief er mir zu. Auf dem Nach-
hauseweg ließ ich die Worte in einem fort neu abspielen. Bis morgen
in der Schule hallte es in meinem Kopf, so wie eine Glocke noch ein-
ige Sekunden nachklingt, nachdem man sie geläutet hat.
Wie gewöhnlich war meine Mutter nicht zu Hause. An drei Tagen
in der Woche arbeitet sie von zwei Uhr nachmittags bis zehn Uhr
abends. Das ist so ziemlich das Einzige, worauf man sich bei ihrem
Schichtdienst als Krankenschwester verlassen kann. Weil sie noch
nicht so lange dabei ist, muss sie die Schichten nehmen, wie sie kom-
men. Manchmal arbeitet sie auch die Nachtschicht bis sechs Uhr
früh, schläft dann ein paar Stunden und fängt mit der Nachmit-
tagsschicht wieder an. Sie arbeitet auf der Kinderstation. Worauf
man sich bei meiner Mutter wirklich verlassen kann, ist, dass sie
müde aussieht.
Sie hat mir eine Notiz geschrieben:
Du kannst Nudeln essen oder ein Käsesandwich.
Dein Bettzeug ist noch im Trockner.
Bitte sei um zehn im Bett.

Die Nachrichten meiner Mutter werden allmählich so dürftig, dass
sie als Gedichte durchgehen könnten. Ich habe die Sätze so
bearbeitet, dass daraus ein Haiku geworden ist.
Nudeln und Käse.
Laken sind noch im Trockner.
Sei um zehn im Bett.
Bevor Dad ausgezogen ist, war ich nicht so oft allein zu Hause. Meine
Eltern befinden sich gerade in einer Trennung auf Probe, die offiziell
im Juli begonnen hat, als mein Dad nach Atlanta gezogen ist. Ich
wäre gern mitgegangen, musste aber hier in Hershey bleiben – bei
meiner Mutter, die die ganze Zeit arbeitet. Sie haben noch nicht ein-
mal gesagt: »Mach dich darauf gefasst, dass du aus dem Nest gekickt
wirst, kleiner Vogel.« Eines Tages wurde das Nest einfach umgekippt
und seitdem versuche ich zu fliegen. Natürlich ist die ganze Kühls-
chranktür vollgepappt mit Notfallnummern und mit Anweisungen,
wie man mit allem Möglichen von Feuer bis zu Schlangenbissen fer-
tig wird. Und es gibt drei Nachbarinnen, die mir zu Hilfe eilen, wenn
ein verdächtiger Lieferwagen ohne Kennzeichen auch nur die Straße
entlangfährt.
Ich nahm das Schälchen mit den kalten Nudeln aus dem Kühls-
chrank und ging in mein Zimmer. Ich wollte nachsehen, ob E-Mails
von Dorathea gekommen waren. Das Schälchen stellte ich auf
meinem Schreibtisch ab, vergaß dann aber, die Nudeln zu essen. In
meinem Kopf saß ein Schlagzeuger und der Rhythmus seiner
Basstrommel klang wie Drake, Drake, Drake. In meinem
Posteingang gab es keine neuen E-Mails von Dora, die mich hätten
ablenken können.
22/254
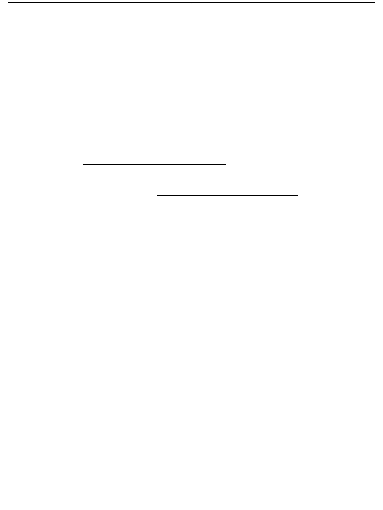
Dorathea ist meine einzige Cousine. Sie studiert im dritten
Semester an der Universität von Berkeley, in Kalifornien. Sie ist für
mich eine Art Orakel. Wann immer ich eine ominöse Antwort von
zweifelhafter Zuverlässigkeit brauche, wende ich mich an sie. Ich
beschloss, ihr eine neue E-Mail zu schicken, obwohl ich auf meine
vorige noch keine Antwort bekommen hatte. Hoffentlich wirkte ich
dadurch nicht allzu bedürftig.
Betreff: Frage
Von: Celia (celia@celiadiefinstere.com)
Gesendet: Mittwoch, 8. September 18:42
An: Dorathea Eberhardt (deberhardt@berkeley.edu)
hallo dora,
wenn ein junge zu deinem spind kommt und dich fragt, ob du
nach der schule mit ihm im wäldchen abhängst, und wenn er fin-
det, dass du für die anderen in der schule zu cool bist, bedeutet
das dann, dass er dich mag oder dass er was von dir will?
wie geht’s im college?
celia
Mir liegt daran, dass Dora mich cool findet. Das hört sich vielleicht
schwach an, aber sie ist die Einzige, die ungefähr so alt ist wie ich
und mich nicht für einen Loser hält. Ich habe ihr natürlich nicht
erzählt, was in der Achten passiert ist. Davon habe ich niemandem
erzählt.
Ich stand vom Computer auf, ließ mich auf mein Bett plumpsen
und schob eine Hand in die kühlen, dunklen Regionen unter meiner
Matratze. Ich stelle mir mein Bett gern als mein Haus vor. Der Raum
unter dem Bett ist der Keller. Dort unten im Keller, zu Füßen des
Nachttischs, liegt mein Notizbuch.
23/254

Für den Fall, dass es brennt und auf der Flucht ein wildes Gerangel
entsteht, brauchen sich meine Besitztümer um die Auszeichnung
»Gegenstand, der zuerst gerettet wird« gar nicht erst zu streiten. Der
Gewinner ist mein Notizbuch mit den Gedichten. Die einzige Frage
hierbei ist nur: Welches? Drei Notizbücher habe ich schon vollges-
chrieben. Gerade bin ich dabei, mich durch das vierte zu kritzeln.
Meistens sind meine Notizbücher ganz normale Kladden, mit
schwarz-weiß marmorierten und schon ziemlich ramponierten Um-
schlägen. Sie strotzen von Stickern, abgemalten Manga-Zeichnungen
und mit Filzstift geschriebenen Zitaten berühmter Dichter. Auf
meinem aktuellen Buch steht: »Großes wird nicht von denen voll-
bracht, die Trends und Modeerscheinungen und weit verbreiteten
Meinungen folgen. Charles Kuralt«.
Ich schreibe jeden Tag Gedichte. Manche Menschen glauben, Gedi-
chte müssten unverständlich oder kompliziert sein oder dem Dichter
mit magischer Naturgewalt direkt aus der Seele springen. Ich glaube,
Gedichte schreiben ist wie Musik machen – man liebt es oder eben
nicht.
Ich dachte, du verschwindest,
immer höher in den Baum hinauf,
ein Beben der Zweige
und weg warst du, als
hätte es dich nie gegeben.
Aber du bist heruntergeklettert
und hast mir ein Blatt überreicht.
»Vom siebten Ast und schon gelb«,
hast du gesagt.
Und dann bist du davongegangen
24/254

und du warst immer noch real.
Ich holte das Blatt aus der Tasche meiner Kapuzenjacke und legte es
zwischen die Seiten meiner Kladde. Dann streckte ich mich auf
meinem Bett aus und versuchte zu lesen. Es dauerte noch zwei Stun-
den, bis sich mein Puls so weit beruhigt hatte, dass ich einschlafen
konnte.
25/254

6
Als ich am nächsten Morgen zur Schule kam, brummte ein ganzer
Bienenkorb von Fragen in meinem Schädel. Würde Drake wieder mit
mir reden? Ob er irgendwie herausgefunden hatte, dass ich eine
Außenseiterin war? War er nur eine Halluzination, die ich meiner ex-
tremen Einsamkeit zu verdanken hatte, ein imaginärer Freund, den
mein Unterbewusstsein zu meinem Schutz erschaffen hatte? Ich ging
zu meinem Spind, um mein Englischbuch zu holen, und als ich die
Tür öffnete, fiel ein kleiner Zettel heraus. Jemand musste ihn durch
den Lüftungsschlitz hineingesteckt haben. Eine Nachricht von
Drake? Voller Hoffnung hob ich das Papier auf und faltete es ausein-
ander. Dort stand:
Du kannst uns nichts vormachen, Emo. Du bist und
bleibst ein Loser.
Ich sackte nicht zusammen, ich schnappte nicht nach Luft. Äußerlich
ließ ich mir nichts anmerken. In der Schule haben nämlich nicht nur
die Wände Ohren. Sondern auch die Spinde, die Tische in der Cafet-
eria und die Schulbänke besitzen Ohren und zusätzlich noch
klatschsüchtige Mäuler.
Meine erste Vermutung war natürlich, dass der Pitbull Sandy Fire-
stone oder jemand aus ihrem Rudel von Straßenkötern diese Na-
chricht geschrieben hatte. Seit Schuljahresbeginn hatte Sandy eine
ganze Gruppe von Highschoolneulingen im Schlepptau. Drei Tage

hatte ich ohne sichtbare Bissverletzung überstanden. Wahrscheinlich
dürstete es sie inzwischen längst nach meinem Blut. Je länger ich
aber auf die Notiz starrte, desto klarer wurde mir, dass sie nicht
Sandys Werk war. Die Schrift war schlampig, und aus grausamer Er-
fahrung weiß ich, dass Sandy und ihre Kläffer raffinierter und ge-
meiner sind, als nur eine anonyme Notiz in einen Spind zu werfen.
Wie Peaches, unsere Nachbarskatze, die tote Mäuse vor der
Haustür ablegt, nachdem sie sie die ganze Nacht hindurch gefoltert
hat, so spielt auch Sandy mit ihrem Opfer. In der Siebten habe ich
mal zufällig mitbekommen, wie sie auf dem Klo mit Becky Shapiro
sprach, während ich in einer Kabine saß.
»Becky«, sagte Sandy, die nach mir hereingekommen war und jetzt
offenbar vor dem Spiegel stand, um sich den Lippenstift
nachzuziehen.
»Ja?«, erwiderte Becky überrascht, weil Sandy sie ansprach, und
drehte den Wasserhahn ab.
Becky Shapiro ist ziemlich dick. Seit der Sechsten sitzt sie auf
einem Lehrerstuhl, weil einer der normalen Klassenstühle schon mal
unter ihr zusammengebrochen war.
»Ich habe mit ein paar anderen Mädchen gesprochen, und wir
finden alle, dass du eine Diät machen solltest«, sagte Sandy so unbe-
fangen, als hätte eine Freundin sie um Rat gefragt.
Ich hörte Becky stöhnen, während sie ein Papierhandtuch aus dem
Spender zog.
»Sorry, Becky«, fuhr Sandy fort. Sie schien sich über Beckys Reak-
tion zu ärgern. »Aber du musst etwas tun! Es ist sonst echt … dep-
rimierend.« Sandy klang, als hätte sie das schlimmste Wort gefun-
den, das ihr zur Verfügung stand.
27/254

Das war etwa ein Jahr bevor sie mich als Wetzstein für ihre Klauen
zu benutzen begann. Damals hatte ich mich noch nicht für das
Finstere entschieden. Ich blieb länger auf dem Klo sitzen als nötig
und versuchte, kein Geräusch von mir zu geben.
Und dann sagte Becky etwas, das mein Herz wie ein zerbrochenes
Windspiel klirren ließ. »Du hast recht, Sandy. Danke.«
»Bitte, bitte«, erwiderte Sandy, als hätte alles wieder seine Ord-
nung, und schloss ihren Lippenstift mit einem Klick.
Das Stück Papier, das ich jetzt in der Hand hielt, war zu unpersön-
lich, um von Sandy Firestone zu stammen. Sandy strich gern die An-
erkennung für ihre Gemeinheiten ein.
»Hast du einen Liebesbrief bekommen?«, raunte eine Stimme an
meinem Ohr.
Ich erschrak, knüllte den Zettel rasch zusammen und grub meine
schwarz lackierten Fingernägel hinein.
»Tut mir leid«, sagte Drake mit einem Dackelblick. »Ich wollte
dich nicht erschrecken.«
Ich starrte ihn wortlos an.
»Ähm, äh«, machte er und trat ein paarmal leicht mit seinem
Schuh gegen die Wand unter meinem Spind. »Hast du vielleicht
Lust, mit mir Mittagspause zu machen?«
Ich warf den Zettel in meinen Spind wie in einen Papierkorb.
»Klar«, antwortete ich und schlug die Tür zu.
28/254

7
Was für ein Ereignis! Zum ersten Mal, seit die Schule vor vier Tagen
begonnen hatte, saß ich mittags nicht allein da. Draußen war es so
warm, dass es sich eher nach August anfühlte und nicht nach
September. Wir suchten uns einen Platz auf der Wiese beim Basket-
ballfeld. Drake zog seinen Pullover aus, aber ich behielt meine
schwarze Kapuzenjacke an. Meine Kapuze muss ich immer in Reich-
weite haben.
Ich trug eine schwarze Strumpfhose, Springerstiefel und ein Kleid,
das meine Mutter mir abgetreten hatte: ein Fummel aus den 1970er-
Jahren. Ich hatte es abgeschnitten, sodass es mir gerade bis zu den
Knien reichte.
Als Mittagessen hatte ich die Nudeln mitgebracht, die ich am Tag
zuvor nicht gegessen hatte. Drake aß ein Sandwich. Ich spürte die
Blicke der ganzen Schule auf uns: Der Neue und die Außenseiterin
sitzen auf der Wiese zusammen und essen! Ehrlich gestanden war ich
über Drakes Interesse an mir genauso verwirrt wie meine Mitschüler.
Wer neu ist an einer Schule, hat immer hart zu kämpfen, um Freunde
zu finden. Drake war allerdings ziemlich cool und sah gut aus. Er
hätte die Chance gehabt, in eine der großen Cliquen mit den be-
liebten Leuten aufgenommen zu werden, die die Picknick-Tische
bevölkerten. Warum suchte er sich eine Einzelgängerin aus? Wollte
Drake vielleicht etwas von mir? War dieses Sandwich-und-Nudeln-
Lunch vielleicht unser erstes kleines Date?

Ich setzte meine nachtschwarze Sonnenbrille auf und versuchte,
mir meine Verwirrung nicht anmerken zu lassen. Wir hatten kaum
ein paar Bissen gegessen, als sich schon die ersten Jungs auf dem
Basketballfeld versammelten. Ich werde nie verstehen, wie Jungs so
schnell essen können!
»Spielen die jeden Mittag?«, erkundigte sich Drake und stützte
sich auf einen Ellbogen.
»In den letzten drei Tagen jedenfalls …«, antwortete ich.
»Kann man da einfach so mitspielen?«, bohrte er weiter.
»Keine Ahnung«, sagte ich. Allerdings wurde Drakes Frage beant-
wortet, als von den sieben Spielern auf dem Feld einer »Sonst noch
jemand?« zu den Picknicktischen hinüberrief.
Drakes Augen scannten das Feld, als würde er ein Buch querlesen.
Er schien irgendetwas abzuschätzen.
»Interessierst du dich für Basketball?«, fragte ich.
»Ja«, sagte Drake, ohne den Blick von den Spielern zu wenden.
»In New York habe ich so gut wie nichts anderes gemacht.«
Ach ja, New York. Meine gute Stimmung kippte auf der Stelle um.
Zum ersten Mal hatte ich jemanden, mit dem ich die Mittagspause
verbringen konnte – und dann blieb er nur einen Monat. Was auch
immer sich zwischen Drake und mir entwickeln würde, es lief nur auf
Zeit.
»Ich spiele mit«, rief Drake mit einem Mal und sprang auf. »Passt
du auf meine Sachen auf?« Er lief zum Spielfeld hinüber, während
ich seinen Pullover aus dem Gras pflückte und sein angebissenes
Sandwich in die Papiertüte zurückschob.
Drake kam genau in dem Moment dazu, als gewählt wurde. Ein
paar Jungen winkten ihm betont lässig zu. Sobald er auf dem Feld
stand, steckte Drake die Hände in die Hosentaschen und nahm eine
30/254

lässige Haltung an. Es sah aus, als konkurrierten sämtliche Jungs um
die coolste Pose. Endlich gab es einen Sprungwurf und damit fing das
Spiel an.
Joey Gaskill, der ebenfalls in die neunte Klasse ging, war der ein-
zige Junge auf dem Spielfeld, den ich kannte. Seit wir zusammen in
die Sechste gegangen waren, wusste ich, wie aggressiv Joey war. Und
mit jedem Jahr wurde es schlimmer. In der Sechsten war er einmal
vom Unterricht ausgeschlossen worden, weil er sich geprügelt hatte.
In der Siebten flog er fast von der Schule, weil er sich in der Mittags-
pause in einen Mathe-Raum geschlichen und einen Stapel Klassen-
arbeitshefte angezündet hatte. Das Wasser der Sprinkleranlage hatte
die Bücher und Computer des ganzen Gebäudetrakts beschädigt. In
der Achten brach jemand in den Werkraum ein und zertrümmerte
sämtliche Gefäße, die im Keramik-Ofen gebrannt werden sollten.
Dass Joey dahintersteckte, konnte niemand beweisen, aber alle war-
en sich sicher, dass er der Urheber war.
Ich war platt, als ich sah, dass Joey sich eine Mannschaftssportart
ausgesucht hatte. Und noch viel platter war ich, als ich sah, dass auf
seinem Trikot der Aufdruck des Basketballteams der Hershey High-
school prangte – was bedeutete, dass er es in die Schulmannschaft
geschafft hatte.
Von der ersten Minute an war Drake am Drücker. Ich habe keine
Ahnung von Basketball, aber wenn ein Spieler dauernd den Ball
bekommt und damit losrennt, dann muss er wohl gut sein. Außer-
dem warf er zwei Körbe. Durch das, was ich da sah, bekam ich Lust
zu schreiben. Ich experimentierte nämlich gerade mit visueller
Poesie.
BASKETBALL
31/254

jungs stöhnen, schieben herum,
schauen nach rechts und links, schwitzen,
beißen die zähne zusammen, während die erde
sich den ball wieder zurückholt. sie versuchen,
wie presslufthammer zu sein. sie versuchen,
wie männer zu sein, brauchen etwas,
das sie gewinnen können.
basketball
Ich war so sehr mit meinem Gedicht beschäftigt, dass ich Sandy und
Mandy zunächst gar nicht bemerkte, sondern erst, als sie direkt
neben mir mit vier weiteren Mädchen als Handlangerinnen, die ich
nicht kannte, eine Decke ausbreiteten. Ein kühler Wind wehte aus
ihrer Richtung. Ich zog mir die Kapuze auf, steckte die Nase noch
tiefer in meine Kladde und tat so, als würde ich weiter an meinem
Gedicht arbeiten.
»Es wird wohl ein Kleid von ihrer Großmutter sein«, hörte ich
Mandys Stimme, begleitet von affektiertem Gelächter. »Und es war
schon aus der Mode, als ihre Großmutter es getragen hat.«
»Sie glaubt, sie ist was Besseres«, fiel Sandy ein. »Dabei ist sie ein-
fach nur abstoßend. Sie riecht nach Secondhandladen.«
»Nach Müllhalde«, echote Mandy.
»Habt ihr das Schild gesehen, das sie an ihre Spindtür geklebt
hat?«, war ein drittes Mädchen zu hören.
Ich musste mich zwingen, nicht zu ihnen hinüberzusehen. Der Ab-
stand zwischen uns faltete sich zusammen wie der Balg eines
Akkordeons. Sie waren jetzt nur noch Zentimeter von mir entfernt,
nicht mehr Meter. Ich spürte ihren Atem.
32/254

»Seht nur, sie schreibt in eine Kladde! Sie glaubt wohl, sie hat
mehr Grips als wir. Ich wette, die Leute stehen Schlange, um Bücher
von ekligen Highschool-Außenseitern zu lesen«, sagte Sandy.
Ich merkte, wie ich rot anlief, und sah für eine Sekunde zu Drake
hinüber, um mich zu vergewissern, dass er nichts davon mitbekam.
Aber er war voll auf das Spiel konzentriert. Ich schrieb so fest in mein
Notizbuch, dass die Mine durch mehrere Seiten durchdrückte. Ich
hatte gedacht, sie könnten mir nichts mehr anhaben. In dem Mo-
ment, als ich die Finsternis in mein Leben hineingelassen hatte,
dachte ich, Sandy würde mir von jetzt an am Arsch vorbeigehen.
Aber es fühlte sich wieder genauso an wie in der achten Klasse: als
würde sich in meiner Brust ein schwarzes Loch auftun, in das ich
komplett hineingesogen wurde.
»Vielleicht ist sie in den Neuen verknallt«, meinte Mandy.
»Als ob jemand, der so cool ist, sich mit einer derart Hässlichen
abgeben würde«, konterte Sandy.
»Wahrscheinlich hat er nur mit ihr gegessen, damit sie seine
Hausaufgaben macht«, sagte eins der anderen Mädchen, die ich
nicht kannte.
Eine Begleiterscheinung von gemeinen Highschool-Mädchen sind
noch mehr gemeine Highschool-Mädchen. Und durch nichts wird
man so schnell in eine Clique aufgenommen, wie wenn man über ein
anderes Mädchen ablästert.
Am liebsten wäre ich aufgestanden und weggegangen. Aber damit
hätte ich ihnen eine Botschaft geschickt: »Liebe Mandy, liebe Sandy,
ich unterwerfe mich eurer Macht.« Zwischen meinem Hintern und
dem Gras schien sich Eis gebildet zu haben, an dem ich festgefroren
war. Ich schrieb immer noch in mein Notizbuch und tat so, als würde
ich nichts hören. In Wahrheit aber hörte ich jetzt fünfmal so gut. Ich
33/254

hörte sie mit ihren aufgeklebten Fingernägeln schnippen wie mit
Krallen.
Als es gongte, gingen sie endlich. Sandy schleuderte noch eine Be-
merkung über die Schulter, als würde sie Müll wegwerfen. »Drake
hat mir erzählt, er gibt sich nur aus Mitleid mit ihr ab.«
Ich sah in mein Notizbuch. Mein »Gedicht« lautete:
dinge, die celia ändern muss
dinge, die celia ändern muss
dinge, die celia ändern muss
dinge, die celia ändern muss
dinge, die celia ändern muss
dinge, die celia ändern muss
dinge, die celia ändern muss
Dinge, die Celia ändern muss
34/254

8
Nach dem Basketball wollte Drake von mir wissen, ob ich nach der
Schule wieder mit ihm ins Wäldchen ging. Während der nächsten
drei Unterrichtsstunden konnte ich kaum stillsitzen. Ich habe
bestimmt zwanzigmal gefragt, ob ich aufs Klo gehen könnte. Ich
freute mich so darauf, wieder mit ihm zusammen zu sein, dass ich
sogar vergaß, wie Sandy und Mandy sich in der Mittagspause mir ge-
genüber verhalten hatten. Drake war für mich Teil einer Fantasiewelt
namens New York City, einem Ort, an dem es Menschen gab, die
mich »verstanden«. Wenn ich hier eine Außerirdische war, dann
stammte Drake von meinem Heimatstern, und gemeinsam waren wir
auf diesem bizarren Planeten namens Pennsylvania gestrandet.
»Wie sind die anderen Jungs?«, fragte ich auf dem Nachhauseweg
und versuchte, so locker wie möglich zu klingen.
Drake räusperte sich. »Ganz in Ordnung. Einer hat mir von einer
neuen Ausstellung in der Kunstgalerie erzählt und ein anderer hat
mich zu einem Stummfilmfestival eingeladen.« Er sah mich an und
verdrehte die Augen. Sein Skateboard trug er unterm Arm, damit wir
nebeneinander gehen konnten.
»Tja, die Jungs hier können einfach über nichts anderes reden als
über das nächste Symphoniekonzert«, brachte ich heraus, bevor ich
meine heißen Wangen in meiner Kapuze versteckte. Ich hoffte immer
noch, dem naiven Neuling vormachen zu können, ich sei eine der

coolen Schülerinnen an der Hershey High und nicht ein eifer-
süchtiges Mädchen, das verzweifelt nach Freunden suchte.
»Alle Hinterwäldler lieben Debussy«, antwortete Drake.
Als wir bei Drake ankamen, liefen wir gleich quer über den Rasen
zum Wäldchen. Ich folgte ihm durch das knisternde Unterholz zu
dem umgestürzten Baum, auf dem wir schon am Tag zuvor gesessen
hatten. Es fühlte sich ganz vertraut an, als wir uns auf einer glatten,
rindenlosen Stelle nebeneinandersetzten.
Je mehr Zeit ich mit Drake verbrachte, umso stärker fiel mir auf,
wie gut er aussah. Wenn er lächelte, betonte dies sein markantes
Kinn. Er hatte braune Augen und für einen Jungen ungewöhnlich
lange Wimpern. Seine Haare kämmte er so, dass sie oben auf dem
Kopf hochstanden. Er hatte volle, feste Lippen, besonders die Unter-
lippe war hübsch. Wenn man nahe genug saß, konnte man ihre fein-
en Furchen zählen. Ich kam auf vierzehn.
»Celia«, sagte Drake plötzlich und riss mich damit aus meinen um
Lippenfurchen kreisenden Gedanken. Ich wandte mich ab und
kramte umständlich in meinem Rucksack, damit er mein Gesicht
nicht sehen konnte.
»Ja?«, antwortete ich unbestimmt, zog einen Fettstift heraus und
schmierte mir demonstrativ die Lippen ein.
»Gehst du mit Mädchen weg oder mit Jungs? Oder mit beiden?«
Er klang so locker, als sprächen wir über Bowling. Genauso gut hätte
er sagen können: »Nimmst du noch die kleinen Kugeln für Kinder?
Oder spielst du schon mit den richtigen?«
»Äh, ich würde mal sagen … mit Jungs«, stotterte ich, obwohl ich
seinen coolen Ton übernehmen wollte. Ich zögerte, denn wenn man
sagen soll, ob man mit Jungs ausgeht, müsste man ja auch
36/254

tatsächlich mit Jungs ausgehen. Aber ich hatte noch nie ein echtes
Date gehabt.
Natürlich interessieren mich Jungs. Ich stehe auf so viele Typen,
dass ich sie nach den Gattungen geordnet habe. In der klassischen
Literatur bin ich in Mr Darcy aus ›Stolz und Vorurteil‹ verknallt. Im
Bereich Fantasy ist es Aragorn aus ›Herr der Ringe‹. Bei Science-Fic-
tion steht es in ›Die Tribute von Panem‹ unentschieden zwischen
Peeta und Gale, und in der Neueren Literatur ist mein Lieblingsanti-
held Holden Caulfield aus ›Der Fänger im Roggen‹. Es sind vielleicht
keine echten Jungs, aber ich habe das Gefühl, als würde ich sie alle
kennen, ihre tiefsten Gedanken und Sehnsüchte. Und solange ich zu
Hause Howl aus ›Sophie im Schloss des Zauberers‹ habe, kann ich
mich zurückhalten, mich in irgendeinen Jungen aus der Schule zu
verknallen!
Aber all das wollte ich Drake nicht erzählen, und ich wusste auch
gar nicht, warum er mich danach fragte. Erkundigte er sich nach
meiner sexuellen Vorliebe, bevor er mir sagte, dass er mich mochte?
Machte man das in New York vielleicht so? Ich hielt den Atem an und
wartete darauf, was als Nächstes kam. Ich hoffte, er würde mich nach
einem Date fragen oder mich bitten, seine Freundin zu werden, oder
was auch immer Jungs so sagen, wenn sie ein Mädchen mögen.
»Also ich … ich steh auf Jungs«, sagte Drake unvermittelt und ein
bisschen schroff. Dann wurde seine Stimme weicher und er fügte
hinzu: »Auf einen Jungen, um genau zu sein.«
Plötzlich nahm ich all die Geräusche um mich herum sehr intensiv
wahr. Das Rascheln der trockenen Blätter auf dem Boden, mindes-
tens drei verschiedene Vögel, die auf irgendwelchen Zweigen über
unseren Köpfen zwitscherten, das entfernte Brummen auf der Sch-
nellstraße. Ich wäre niemals darauf gekommen, dass Drake Jungs
37/254

mögen könnte! In unserer Kirchengemeinde gab es zwei ältere Män-
ner, die ein Paar waren, aber ich hatte noch nie jemanden in meinem
Alter kennengelernt, der schwul war.
Drake stand auf und fasste sich an den Kopf. »Wow«, sagte er.
»Das tat echt gut!« Er wischte seine Hände an seiner Jeans ab, als
wären sie verschwitzt. »Ich habe diesen Satz noch nie laut
ausgesprochen.«
»Äh … gratuliere« war die einzige Antwort, die mir einfiel.
»Danke, Celia«, erwiderte er ernst und legte eine Hand auf seine
Brust. »Ich musste es mal proben. Ich musste es jemandem sagen,
der mich noch nicht so lange kennt und der mich nicht gleich deswe-
gen verarscht. Ich war schon den ganzen Tag total aufgeregt.«
Ich saß da und versuchte mir nicht zu wünschen, er hätte etwas an-
deres gesagt. Ich schlug meine Beine mal in der einen, mal in der an-
deren Richtung übereinander und suchte nach einer Position, die
nicht total ungelenk aussah.
»Ich hab das Gefühl, es wird jetzt echt Zeit.« Drake machte
konzentrierte Schritte über die Wurzeln rund um den Baumstamm.
»Neunte Klasse Highschool, eine gute Gelegenheit, sich klar zu wer-
den, wer man ist.« Er benutzte beim Sprechen seine Hände. »Ich
wollte es jemandem erzählen, bevor ich am Wochenende nach New
York fahre und mein richtiges Coming-out habe.«
»Dein richtiges Coming-out?«
»Na ja, ich muss es ja den Leuten erzählen, die mir am nächsten
stehen. Meinen Eltern und Japhy.« Drake setzte sich wieder zu mir
auf den Stamm.
Zum zweiten Mal an diesem Tag rief ich mir in Erinnerung, dass
Drakes eigentliches Leben immer noch in New York stattfand.
38/254
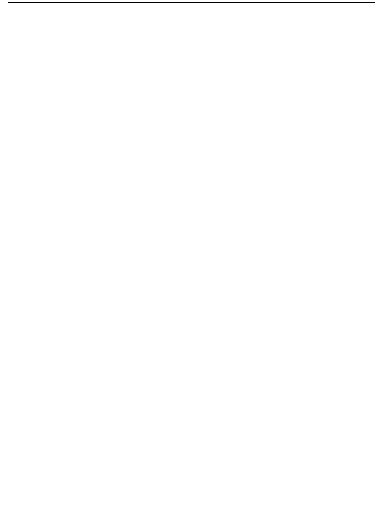
»Japhy?«, brachte ich hervor. »Wie die Figur in dem Roman von
Kerouac?«
»Genau«, lachte Drake. »Er hat so richtige Hippie-Eltern. Seine
Mutter ist Schauspielerin am Theater meines Vaters. Du bist ja
richtig belesen.«
»Und Japhy ist der Junge?«
»Ja, er ist der Junge. Er ist mein bester Freund, seit wir zehn sind.
Wir haben uns von Anfang an supergut verstanden, und ich glaube,
ich wusste schon immer, dass ich was für ihn empfinde. Vor vier
Wochen aber … ich weiß nicht, irgendwas hat sich verändert. Kennst
du das, Celia, wenn du einfach spürst, dass dich jemand mag?«
»Ja. Das ist so … cool, wenn das passiert«, log ich.
»Als er letztes Mal bei mir war …«, fuhr Drake fort. »Na ja, schwer
zu erklären.«
»Hängt ihr viel zusammen ab?« Ich wollte nicht eifersüchtig sein
auf Drakes Freund, seinen besten Freund, den er richtig mochte.
Aber ich war’s.
»Unsere Eltern verabreden sich jeden Dienstagabend zum Essen
und gehen danach ins Theater. Früher haben Japhys Eltern ihn zu
uns mitgebracht und wir hatten dann zusammen einen Babysitter.
Mit zwölf haben wir unsere Eltern überredet, dass wir allein bleiben
können. Na ja, es war Japhy, der sie überredet hat. Japhy liebt
Action.«
Drake hatte so selbstbewusst gewirkt, als ich ihn am Tag zuvor
kennengelernt hatte. Jetzt aber war er knallrot im Gesicht und fum-
melte nervös an seinen Fingern herum. Er stand wieder auf und hob
einen Stecken vom Boden auf.
»Wenn wir etwas machen, das ein bisschen riskant oder sogar ge-
fährlich ist, dann sagt Japhy immer: ›Los, Mann, volles Risiko.‹«
39/254

Drake schob mit dem Fuß ein wenig Laub beiseite und begann an der
freien Stelle mit seinem Stecken auf die Erde zu zeichnen. Ich setzte
mich rittlings auf unseren Stamm.
»Manchmal schleichen wir uns davon und gehen zum Times
Square. Da reden wir mit Obdachlosen, fahren Skateboard auf dem
Bahnsteig in der U-Bahn oder zählen Ratten.« Drake zeichnete einen
Kreis, von dem lauter Pfeile ausgingen. »Unsere Eltern wissen nichts
davon.«
Die Eifersucht drohte mir ein Loch durch meine Jacke zu brennen.
Warum hatte ich nicht eine beste Freundin, mit der ich mich von zu
Hause davonschleichen konnte, um Ratten zu zählen? Warum hatte
ich nicht eine beste Freundin, die mich vielleicht sogar liebte und Ac-
tion mochte? Ich fühlte mich betrogen. Das Gesicht von Sandy Fire-
stone blitzte vor meinem geistigen Auge auf.
»Beim letzten Mal haben wir allerdings beschlossen, zu Hause zu
bleiben. Wir haben im Wohnzimmer Videospiele gespielt und ich
habe ständig gewonnen. Irgendwann riss er mir den Controller aus
der Hand und fing an, mit mir zu raufen. Japhy ist echt sportlich. Er
spielt super Basketball und ist ein perfekter Skater. Ich habe ver-
sucht, mich loszumachen, aber er hat mich total auf den Boden ge-
presst.« Drake warf seinen Stock weg, kniete sich ins Laub und
machte mir vor, wie Japhy ihn festgehalten hatte. »Wir haben immer
schon miteinander gekämpft, aber als er dieses Mal auf mir lag, sah
er mich an und lächelte. ›Du schlägst mich nicht noch einmal‹, sagte
er schließlich und stand auf.«
Drakes Wangen glühten, als hätte er Sonnenbrand.
»Danach haben wir auf der Feuerleiter gesessen und Fußgänger
beobachtet. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, er hat mir dabei et-
was mitgeteilt. Dieses Lächeln. Wow, ich bin so aufgeregt.« Drake
40/254

schüttelte seine Hände, als hätte er sie gerade gewaschen und könnte
kein Handtuch finden.
»Diese Woche gibt es im Theater meines Vaters eine Premiere. Ich
sehe mir das Stück am Freitagabend an. Am Samstagabend, wenn
meine Eltern wieder in der Vorstellung sind, kommt Japhy zu mir.
Und dann werde ich es ihm sagen, Celia. Zumindest will ich mal se-
hen, wie sich die Sache entwickelt, und dann sage ich es ihm viel-
leicht oder aber … Nein. Ich muss es ihm sagen. Ich darf nicht
kneifen.« Drake fuhr sich mit beiden Händen durchs Haar und
zupfte es dann wieder in Form. »Und am Sonntag rede ich mit mein-
en Eltern.«
Jetzt drehte er sich zu mir um. »Celia«, sagte er und verschränkte
die Arme vor der Brust. »Versprich mir, dass du das, was ich dir
gerade erzählt habe, für dich behältst. Ich will nicht, dass es die ganze
Schule weiß, bevor meine Eltern davon erfahren.«
Drake wirkte jetzt so verletzlich, dass ich mich für meine Eifer-
sucht richtig schämte. Außerdem war es schmerzlich lange her, dass
mir jemand ein Geheimnis anvertraut hatte.
»Drake«, sagte ich, schob meine Hände aus den Ärmeln meiner
Jacke und legte sie ineinander. »Das würde ich niemals tun. Ich
werde mit niemandem darüber reden. Versprochen.«
»Danke«, sagte Drake und setzte sich wieder neben mich. »Okay,
und jetzt du. Jetzt musst du mir was erzählen.«
Ehrlich, fast hätte ich Drake auf der Stelle alles erzählt, was in der
Achten passiert war. Es war genau der richtige Moment. Das Ge-
heimnis saß mir schon auf der Zungenspitze und war kurz davor, die
Flügel auszubreiten und aus meinem Mund hinauszufliegen. Aber
das altbekannte schwarze Loch in meiner Brust öffnete sich und sog
meine Worte in sich hinein. Was, wenn ich ihm mein Geheimnis
41/254

anvertraute und er mich dann nicht mehr mochte? Nur für einen
Monat einen Freund zu haben war immerhin besser, als gar keinen
zu haben. Ich brauchte ihn zu sehr, als dass ich offen mit ihm hätte
sprechen können.
»Ich schreibe Gedichte«, platzte ich schließlich heraus.
»Oh, cool«, sagte Drake und klang nur unwesentlich enttäuscht
angesichts meines langweiligen Geheimnisses. »Liest du mir mal was
vor?«
In meiner Brust, dort wo sonst das schwarze Loch war, flackerte
ein schwaches Licht. Ich nickte.
42/254

9
Bevor ich mich auf den Nachhauseweg machte, fragte Drake, ob wir
am nächsten Tag zusammen zur Schule gehen wollten. Darum kam
ich am Freitagmorgen, dem Ende der ersten Woche in der Neunten,
morgens um acht Uhr zu dem kleinen Park in unserer Nähe. Ich war
ein paar Minuten zu früh da, weil ich vor der ersten Stunde noch ein
Buch in die Bibliothek zurückbringen wollte. Ich hatte ›Fremde Wel-
ten‹ nicht zu Ende gelesen, weil es mir ein bisschen so vorkam, als
würde ich ein Lexikon lesen. Aber ich hatte mir ein paar gute Wörter
herausgepickt und tauschte das Buch mit gutem Gewissen gegen ein
neues.
Ich setzte mich auf eine Schaukel und wartete auf Drake.
Ich besitze kein Handy. Ich hatte mal eins, aber nur kurz, als mein
Dad nach Atlanta gezogen ist und mir eins gekauft hat. Damit wir
leichter in Verbindung bleiben könnten, wie er sich ausdrückte.
Leider habe ich es aber in der Tasche meiner Kapuzenjacke vergessen
und aus Versehen mitgewaschen, und das war das Ende meiner Er-
reichbarkeit. »Bis du dir das Geld dafür nicht selber verdient hast,
gibt es kein neues Handy«, erklärte meine Mutter. »Du bist alt genug
und kannst babysitten gehen.« Dieser bemerkenswerte Versuch, mir
Verantwortungsbewusstsein beizubringen, stank ziemlich nach
Scheinheiligkeit, denn sie selbst verliert ihre Sachen öfter als sonst ir-
gendjemand. Nachdem die einzigen Menschen, die mich anrufen,
aber sowieso nur Mom und Dad sind, beschloss ich, ihnen

meinerseits eine Lektion zu erteilen und mich überhaupt nicht dar-
um zu scheren, Geld für ein neues Handy zu verdienen. Jetzt schreibt
mir mein Dad meistens E-Mails, und meine Mutter muss damit fer-
tigwerden, dass sie mich nicht erreichen kann, wann immer ihr
danach zumute ist.
Ich sah nervös auf die Uhr, die ich mir im Secondhandladen
gekauft hatte. Drake kam zu spät. Ich stieß mich mit den Füßen ab
und ließ mich sanft vor- und zurückschaukeln. Dann drehte ich mich
von einer Seite zur anderen, sah die Straße hinauf in die Richtung,
wo Drake wohnte, und die Straße hinunter in Richtung Schule. Um
zehn nach acht fing ich an, mir Gedanken zu machen. Hatte ich viel-
leicht falsch reagiert, als Drake mir sein Schwulsein eröffnete? Hatte
er gehofft, ich sei lesbisch, und hatte er jetzt, nachdem er wusste,
dass ich es nicht war, das Interesse an mir verloren? Vielleicht wollte
er sein Coming-out ja wirklich nur üben und ich hatte meinen Zweck
erfüllt. Aber all das spielte im Grunde auch gar keine Rolle, weil er ja
sowieso bald nach New York zurückging, und dann war ich wieder
die einsame Einzelgängerin, ohne Freunde weit und breit.
Von der sechsten bis zur achten Klasse hatte ich schon mal eine be-
ste Freundin gehabt. Ruth und ich hatten uns an einem Wochenende
in der Bücherei kennengelernt, eine Woche nach Schulanfang. An
einem sonnigen Samstagnachmittag saßen wir beide dort und lasen
›Augen im Goldfischglas‹. Wir fingen an, über das Buch zu reden,
und hörten zwei Stunden lang nicht mehr auf.
Ruth stammte aus einer sehr religiösen Familie und durfte nicht
fernsehen und auch keine Hosen anziehen. Sie trug lange weiße
Kleider und hatte ihr blondes Haar zu einem Zopf geflochten, der ihr
bis zur Hüfte reichte. Sie durfte niemanden zum Übernachten
44/254

einladen und nicht ins Einkaufszentrum gehen. Und so war unsere
Freundschaft zwar intensiv und eng, aber auch irgendwie begrenzt.
Uns verband, dass wir zur selben Zeit das gleiche Buch lasen. Wir
versuchten, immer auf der gleichen Seite zu sein, sodass keine der
anderen etwas von der Handlung verraten konnte. Manchmal rief sie
mich an und gestand: »Ich konnte einfach nicht aufhören und habe
nach dem Abendessen noch hundert Seiten gelesen.« Und dann
musste ich lange aufbleiben, um sie wieder einzuholen. Einmal war
ich krank. Ich hatte Grippe und war so schwach, dass ich das Buch
nicht halten konnte. Da las Ruth mir eine Stunde lang am Telefon
aus ›James und der Riesenpfirsich‹ vor, bis ich mit dem Hörer auf
dem Kissen einschlief.
In der Schule waren wir unzertrennlich und hatten beide gute
Noten. Aber für Kinder, die anders sind als die breite Masse, ist die
Schule eine Schlangengrube. Vielleicht war es die Freundschaft mit
Ruth, durch die ich Sandy Firestones Aufmerksamkeit auf mich zog.
Zu Beginn der Siebten wurde zunächst einmal Ruth zur Zielscheibe.
Als sie sich vor dem Sportunterricht im Umkleideraum umzog und
das hochgeschlossene Kleid abstreifte, kamen ihre weiße Baum-
wollunterhose, die ihr mindestens zwei Nummern zu groß war, und
ein riesiger gesteppter Polyester-BH zum Vorschein. Beides wirkte an
ihrem Körper völlig fehl am Platz, etwa wie ein dreiteiliger Business-
anzug am Strand.
Ruth kam schon »in die Entwicklung« und brauchte wirklich einen
BH. Das bisschen, was ich bislang in der Busengegend zu bieten
habe, zeigte sich noch nicht. Darum trug ich bloß ein Unterhemd.
»Himmel, Ruth«, sagte Sandy Firestone, die vor ihrem Umkleides-
chrank stand. »Trägst du sogar geerbte Unterwäsche?«
45/254

Mandy,
die
damals
noch
darum
wetteiferte,
Sandys
Lieblingsstützrad zu sein, lachte so laut, als wäre sie in einem Com-
edy Club. Die beiden trugen die gleiche Garnitur BHs und Höschen
und ließen sich viel Zeit, bevor sie in ihre Sporttrikots schlüpften.
Ruth sah aus, als wünschte sie sich, die Spindtür sei ein Tor zu ein-
er anderen Welt, durch das sie steigen könnte, um in Narnia zu
landen. Es war, bevor ich die Finsternis in mein Leben gelassen
hatte. Anstatt etwas zu sagen, steckte ich meinen Kopf in meinen
Spind und hoffte, nicht weiter Sandys Aufmerksamkeit zu erregen.
Ihre Attacken setzten sich wochenlang fort.
Ruth unternahm ein paar verzweifelte Versuche, sich anzupassen.
Kaum hatte sie das Schulgebäude betreten, raste sie zum Klo, um
ihren Zopf aufzulösen. Nach der Schule flocht ich ihn wieder zusam-
men. Damit nichts von der Freiheit zeugte, die ihre Haare genossen
hatten, wenn Ruth von ihrer Mutter abgeholt wurde. In dem herzzer-
reißenden Versuch, modischer auszusehen, krempelte Ruth die
Ärmel ihrer Kleider hoch und strengte sich an, offener zu sein, zu
lächeln und außer mir auch mit anderen Leuten zu reden. Trotzdem
gelang es uns nicht, auch nur eine einzige Freundin hin-
zuzugewinnen. Wir blieben das schrullige Pärchen, zwei Bücher-
würmer, die für Sandy und Mandy ein leichtes Ziel abgaben.
Nach der Schule aber hatten Ruth und ich viel Spaß miteinander.
Wir lebten in unseren Fantasiewelten und verbrachten Stunden dam-
it, immer neue Figuren zu erfinden. Ruth war die Dritte von sieben
Geschwistern. Wenn wir bei ihr waren, mussten wir unser Spiel im-
mer wieder unterbrechen, um einem der Kleineren die Windeln zu
wechseln oder etwas zu essen zu richten. Bei mir zu Hause genoss
Ruth die Ruhe. Meine Mutter lernte für die Krankenpflegeschule und
mein Dad kam spät von der Arbeit.
46/254
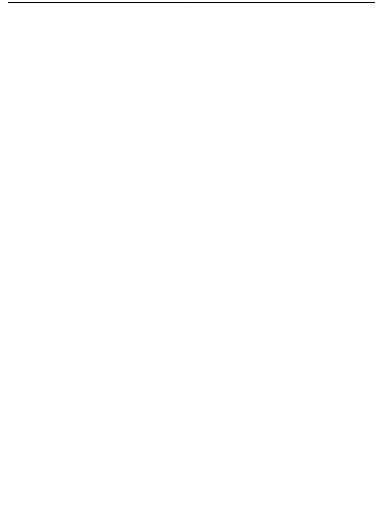
An einem Frühlingstag während des achten Schuljahrs kam Ruths
Mutter an einem Freitagvormittag in die Schule, um Ruth zu ir-
gendeiner Feier in der Kirche abzuholen. Sie ertappte ihre Tochter,
als sie mit mir vor meinem Spind stand. Ruth hatte den Kragen an
ihrem Kleid aufgeknöpft, die Locken wallten über ihre Schultern und
sie trug Lidschatten. Ruths Mutter packte ihre Tochter an der Hand
und zerrte sie Richtung Ausgang. Ihr eigener Zopf schwang dabei hin
und her wie eine Peitsche. Sie ließ Ruth noch nicht einmal mehr ihre
Sachen aus dem Spind holen oder sich verabschieden. Sie entriss sie
der Schule, als müsste sie sie aus Satans Klauen befreien. Ruth
streckte die Hand nach mir aus, als könnte ich ihr einen Rettungsring
zuwerfen. Aber das konnte ich nicht.
Ich versuchte, mit ihr zu sprechen. Ruths Mutter ging ans Telefon,
und beim zweiten Mal bat sie mich höflich, nicht mehr anzurufen.
Eine Woche später bekam ich einen Brief. Ruth berichtete, dass sie
ab jetzt zu Hause unterrichtet würde und dass sie nicht mehr mit mir
sprechen dürfe.
Ich bat meine Eltern um Hilfe. »Es tut mir sehr leid, Celia«, sagte
mein Vater, »aber wir können anderen Eltern nicht vorschreiben, wie
sie ihre Kinder zu erziehen haben.« Meine Mutter wickelte sich eine
Locke um den Finger und seufzte. »Vielleicht ändern sie ihre Mein-
ung ja irgendwann noch mal. Es tut schrecklich weh, aber manchmal
kommt eine Freundschaft einfach an ihr Ende.« Ich las ›Brücke nach
Terabithia‹, heulte jeden Abend und wünschte, das Telefon würde
klingeln. Zwei Wochen später eröffneten mir meine Eltern, dass sie
sich trennen würden, und drei Wochen später war die Sache mit dem
Buch.
Ich saß noch immer auf der Schaukel im Park, dachte an Ruth und
fragte mich, ob ich sie wohl jemals wiedersehen würde, als endlich
47/254

Drake auftauchte. Mit zwanzig Minuten Verspätung! Er raste mit
Höchstgeschwindigkeit auf seinem Skateboard den Gehsteig entlang.
Mit einem gekonnten Schwung hielt er bei den Schaukeln an, trat auf
ein Ende seines Skateboards und schnappte das andere Ende mit der
Hand.
»Hey, Kumpel, tut mir echt leid. Ich hab verschlafen«, sagte er,
fuhr sich mit der Hand durch die Haare und versuchte, sie irgendwie
in Form zu bringen.
»Kein Problem«, sagte ich schulterzuckend und wand mich – ein-
en erleichterten Seufzer unterdrückend – aus der hängemattenarti-
gen Schaukel. Drake war da! Er war nicht einfach abgetaucht! Er
hatte nicht beschlossen, mich nicht zu mögen, und er war auch nicht
von seinen Eltern weggezerrt worden und wurde nun zu Hause un-
terrichtet. So schnell wir konnten, legten wir die zwanzig Blocks zur
Schule zurück.
48/254

10
Es hatte schon gegongt, als ich auf meinen Platz glitt und einen
tadelnden Blick von Mr Pearson erntete. Am Tisch vor mir murmelte
Sandy: »Zu viel Zeit mit der Frage vertrödelt, welcher schwarze Rock
es heute sein soll?« Neben ihr verschluckte sich Mandy fast vor
Lachen.
»Wenn man null Kreativität besitzt, ist es ja keine Kunst, pünktlich
zu sein«, erwiderte ich in liebenswürdigem Ton.
»Richtig, und deshalb hassen dich alle, Celia, weil du so ein kreat-
ives Genie bist!«, fauchte Mandy, um ihre Heldin zu verteidigen.
»Sarkasmus ist die niedrigste Form von Witz«, zischte ich zurück,
obwohl mir klar war, dass dieser Spruch von Oscar Wilde bei Mandy
totale Verschwendung war.
Sie schien gerade einen Gegenangriff vorzubereiten, als Mr Pear-
son uns unverblümt mahnte, den Mund zu halten und unsere Bücher
herauszuholen. Dass ich in diesem Wortgefecht mit Sandy und
Mandy das letzte Wort hatte, würde später sehr wahrscheinlich zu
einer noch schärferen Attacke führen, dennoch genoss ich für den
übrigen Teil der Unterrichtsstunde meinen Triumph.
Der restliche Schultag verlief ohne weitere Zwischenfälle. Keine
Zettel im Spind, keine Zickenattacken. Drake und ich aßen gemein-
sam draußen und dann glänzte er wieder beim Basketball. In
Geschichte und Mathe nutzte ich die Zeit, um ein Gedicht darüber zu
schreiben, dass Zöpfeflechten etwas Ähnliches ist wie Brezelnbacken.

Nachdem es endlich zum Ende der letzten Stunde gegongt hatte,
wartete ich bei meinem Spind auf Drake. Und dann passierten zwei
schreckliche Dinge.
Als Erstes tauchte Clock auf, wie immer in seinem schwarzen
Trenchcoat. Clock heißt in Wirklichkeit Daniel Kloch. Daraus
entstand sein Spitzname. Ich weiß es, weil er früher in meiner Klasse
war. Sooft wir eine neue Lehrerin hatten oder wenn eine Vertretung
seinen Namen falsch aussprach, verbesserte er die Leute genervt:
»Clock! Sagen Sie einfach Clock zu mir!« Ich habe es kein einziges
Mal erlebt, dass jemand darauf bestanden hätte, ihn Daniel zu
nennen. Clock war immer schon in sich gekehrt und grüblerisch
gewesen, aber in der Siebten verlegte er sich vollends auf das Er-
scheinungsbild eines blutdürstenden Vampirs. Ich glaube, er malt
sich sogar extra halbmondförmige Schatten unter die Augen.
Clock kam im typischen Grufti-Schritt den Gang entlanggesch-
lichen. Jahrelang hatte er nicht mehr mit mir gesprochen. Ich über-
legte, ob er mich jetzt wohl zur Kenntnis nehmen würde. Leider tat er
es.
»Hast du den Zettel gesehen, den ich dir reingeworfen habe,
Emo?«, raunte er, als er an mir vorbeiging, und seine Springerstiefel
dröhnten auf dem gebohnerten Linoleum.
Trotz meines Hangs zum Finsteren klappte mir die Kinnlade her-
unter. Als Außenseiter und Freaks hätten Clock und ich eigentlich
Verbündete sein müssen. Er aber hatte sich auf dem chaotischen
Highschool-Schlachtfeld entschieden, mein Feind zu sein. Es war ein
Ding der Unglaublichkeit, dass ausgerechnet er mir diesen Zettel ges-
chrieben hatte!
»Warum liest du nicht lieber irgendwelche Vampirromanzen?«,
schoss ich zurück.
50/254
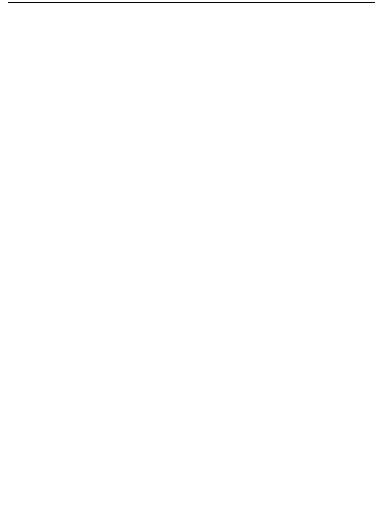
»Wow«, konterte er. »Endlich jemand zum Händchenhalten ge-
funden? Mit deinem neuen Freund traust du dich ja offenbar mehr.«
Und weg war er, sein schwarzer Mantel wehte den Korridor hinunter
und verschwand schließlich in einer Gruppe von Schülern.
Freund? Wie kam Clock denn darauf? Dachten die anderen etwa,
Drake sei mein Freund? Mir blieb nicht viel Zeit, diesen Fragen
nachzugehen. Wenn Clocks Bemerkung ungefähr so brannte wie die
Berührung mit den Nesseln einer Qualle, dann besaß das, was als
Nächstes
passierte,
die
Qualität
des
Giftstachels
eines
Teufelsrochens.
Ich sah Drake den Korridor entlangkommen. An seinem Arm hing
Sandy Firestone. Sie grinste wie ein Honigkuchenpferd. Als Sandy
mein Gesicht zwischen den anderen entdeckte, zog sie Drake am
Arm, damit er stehen blieb. Dann stellte sie sich auf die Zehen-
spitzen, schmiegte ihren Körper an den von Drake und flüsterte ihm
hinter vorgehaltener Hand etwas ins Ohr.
Drake schien nicht zu merken, dass ich sie beobachtete. Sandy aber
sehr wohl. Nachdem sie ihre Flüsterpost losgeworden war, kicherte
sie Drake zu, dann rannte sie davon. Jetzt bereute ich heftig, dass ich
Sandy in der ersten Stunde so übers Maul gefahren war. Ich drehte
mich schnell herum, bevor Drake merkte, dass ich ihn ansah, und
gab mir alle Mühe, wieder zu Atem zu kommen. Zweimal holte ich so
tief ich konnte Luft, dann stand Drake an meinem Spind.
»Und, Promiqueen? Soll dich dein Bodyguard sicher aus dem Ge-
bäude geleiten?«, fragte er.
Trotz all der bitteren Wunden, die ich innerlich zu lecken hatte,
rang ich mir ein Lächeln ab. »Ich hoffe, dass die Drinks in meiner
Limousine dieses Mal wirklich eiskalt sind«, erwiderte ich und
schloss die Spindtür, »sonst rollen Köpfe!«
51/254

11
»Ich glaube, es ist richtig. Meinst du nicht auch, dass ich das Richtige
tue? Er mag mich, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mich
mag. Ich habe das Gefühl, das ist der richtige Moment, aber vielleicht
sollte ich trotzdem noch etwas warten.« Die verschiedenen Stimmen
in Drake schienen heftig miteinander zu diskutieren. Es war das be-
herrschende Thema unseres Gesprächs auf dem Nachhauseweg.
Ich sagte nicht viel dazu, weil ich dauernd daran denken musste,
dass Drake mit Sandy geredet hatte. Ungefähr siebenundvierzig Mal
überlegte ich, ob ich ihn fragen sollte, worüber sie gesprochen hatten.
Aber mir war klar, dass ich eifersüchtig klingen würde. Ich war froh,
dass ich ihm nichts von der Sache in der achten Klasse erzählt hatte,
nichts von meinem alles zersetzenden Wunsch nach Rache. Wie kon-
nte ich ihm jetzt noch vertrauen, wo er mit meiner Feindin sprach?
»Mal ehrlich«, sagte ich heuchlerisch. »Wer sollte dich denn nicht
mögen?« Als wir den Park erreicht hatten, tauschten wir unsere
Nicknames und unsere Telefonnummern aus – die Handynummer in
Drakes Fall, die Festnetznummer bei mir – und verabschiedeten uns
fürs Wochenende.
»Meine Gran wartet schon auf mich. Sie bringt mich nach Harris-
burg. Von dort fährt um sechs der Zug nach New York.« Drake stellte
sich auf sein Skateboard. »Wünsch mir Glück!«
»Viel Glück«, sagte ich mittelmäßig herzlich, während er schon
davonrollte.

Als ich nach Hause kam, telefonierte meine Mutter, was mich nicht
besonders überraschte. Meine Tante Alyce, Doratheas Mutter, lebt in
Oregon. Vor ein paar Jahren hat sie sich von ihrem Mann scheiden
lassen. Wenn man sich von seinem Mann trennt, heißt das wohl, dass
es ziemlich viel zu reden gibt, denn seitdem mein Dad vor drei Mon-
aten nach Atlanta gezogen ist, telefonieren meine Mom und meine
Tante täglich miteinander.
Meine Mutter saß auf einem Stuhl im Esszimmer. Sie trug Jeans
und hatte ihre dünnen Beine auf den Tisch gelegt. Die Leute finden
immer, dass sie zu jung aussieht, um meine Mutter zu sein. Aber
meine Eltern haben mich bekommen, nachdem sie gerade eine
Woche mit dem College fertig waren. Ich war acht, als ich eins und
eins zusammenzählte und das Rätsel der ungeplanten Schwanger-
schaft löste. Niemand peilt freiwillig an, bei der College-Abschlussfei-
er im neunten Monat schwanger zu sein. Außerdem heirateten sie
erst, als ich schon ein paar Monate auf der Welt war. Auf den
Hochzeitsfotos meiner Eltern bin ich diejenige, die ein winzig kleines
Brautjungfernkleid trägt. Weil sie noch so jung ist, wirkt meine Mom
bei jeder Schulveranstaltung, zu der die Eltern eingeladen sind, in
der spießigen Menge der Minivan-Besitzer irgendwie fehl am Platz.
Sie ist die junge Hübsche, die immer zehn Minuten zu spät here-
inschleicht, sich in der Cafeteria oder im Klassenzimmer verlegen
hinten hinsetzt oder sich ihren Weg durch die Reihen bahnt, bis zu
dem Platz, den mein pünktlicher Vater ihr reserviert hat.
»Oh Alyce, ich muss Schluss machen«, sagte meine Mom in
diesem Moment. »Sie ist nach Hause gekommen.«
In der Sekunde, in der sie den Hörer aufgelegt hatte, schlug sich
meine Mutter an die Stirn. »Mist! Ich wollte doch um zwei den
Braten in die Röhre schieben. Aber keine Sorge«, rief sie, während
53/254

sie durch die Schwingtür in die Küche verschwand. »Um fünf ist er
auf jeden Fall fertig.«
Jeder Mensch hat ja so seine Stärken. Und seine Schwächen. Bei
meiner Mutter ist es ihre Schusseligkeit. Mein Lieblingsspiel als Kind
war Wir-suchen-Moms-Sonstwas. Mal ging es um ihre Schuhe, den
Schlüssel, den Geldbeutel, dann um Medikamente oder die
Kinokarten. Für die häufigen Fälle, wo wir fluchtartig das Haus ver-
lassen mussten, weil sie etwa wieder einen Arzttermin oder eine El-
ternsprechstunde verschwitzt hatte, hatte sie einen Maßnahmenplan
aufgestellt. Während wir dann mit dem Auto durch die Straßen ras-
ten, musste ich ihr helfen, eine Lüge zu erfinden. »Wir sagen deinem
Lehrer, dass es einen Notfall in der Familie gab«, sagte sie zum Beis-
piel. »Aber wir müssen vage bleiben und dürfen keine Einzelheiten
liefern.«
Von den Hunderten von Streitigkeiten zwischen meiner Mutter
und meinem Vater fingen neunundneunzig Prozent damit an, dass
meine Mom ihren Geldbeutel verloren, eine Rechnung zu bezahlen
vergessen oder das Garagentor die ganze Nacht offen gelassen hatte.
»Okay, Mom«, rief ich zurück. »Ich checke meine E-Mails.«
Ich ging in mein Zimmer und nahm mir wieder mal vor, endlich
umzuräumen. Das war dringend nötig. Wer mein Zimmer sah und
nicht wusste, wer hier wohnte, der musste denken, dass hier ein
Mädchen zu Hause war, das Ponyhofgeschichten liebte und
Tüllkleidchen trug. Als ich sechs war, hatte mein Dad die Wände lav-
endelfarben gestrichen und meine Mom hatte rosafarbene Vorhänge
mit Satinbesatz dazu ausgesucht. Der winzige Schreibtisch wird von
meinem Computer beherrscht und das Bücherregal ist so
vollgestopft, dass es Bücher auf den Boden reihert. Meine Mom sagt,
wenn ich dreißig Tage am Stück in meinem Zimmer Ordnung halte,
54/254
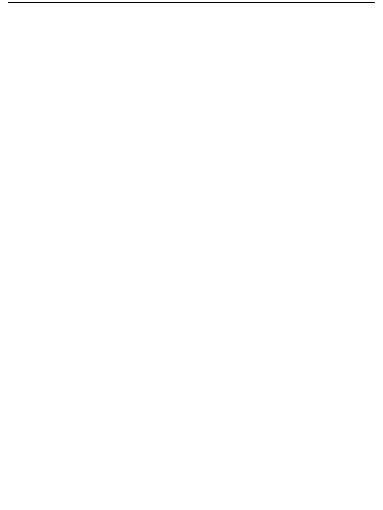
dann räumen wir um. Aber bislang habe ich es nicht länger als fünf
Tage geschafft.
Ich loggte mich ein und sah, dass ich eine E-Mail von Dora und
eine von Dad bekommen hatte.
Die von Dora öffnete ich zuerst.
AW: Frage
Von: Dorathea Eberhardt (deberhardt@berkeley.edu)
Gesendet: Freitag, 10. September 12:12
An: Celia (mailto:celia@celiadiefinstere.com)
hallo celia,
um deine frage zu beantworten: ja. wenn dich ein junge fragt,
ob du mit ihm abhängst, dann bedeutet das, dass er dich mag
UND dass er was von dir will. unsere gesellschaft hat sich viel zu
sehr darin verfangen, beziehungen genau zu definieren, also zu
sagen: »diese person ist mein kumpel« und »jene person ist
mein freund«. zwischenmenschliche beziehungen sind aber viel
komplexer.
ich habe heute in wirtschaftsethik gelernt, dass sechsundvierzig
prozent der weltweiten kakaoproduktion von der elfenbeinküste
stammen und dass das land kindersklaven auf den kakaoplanta-
gen arbeiten lässt. die schokoladenhersteller, auch der, der dein-
er heimatstadt ihren namen gibt, wollen nicht, dass kinder davon
erfahren. du solltest mit deinen freunden eine demonstration vor
dem fabrikgebäude organisieren. SCHLUSS MIT DER SKLAVEREI
IN DER SCHOKOLADENINDUSTRIE!
wie kommst du ohne den kokser mit deinem leben zurecht?
dora
Zunächst mal: Wenn Dora vorschlägt, dass ich mit »meinen Freun-
den« eine Demonstration auf die Beine stellen sollte, dann hat sie
55/254

wohl die E-Mail vergessen, in der ich erwähnt habe, dass es mir an
Freunden ein bisschen mangelt. Dora engagiert sich gern politisch.
Sie ist an der Westküste groß geworden, wo man – wie sie sagt – »be-
wusster« lebt als in Pennsylvania.
Außerdem ist mein Dad kein Kokser. Wir nennen ihn nur so, weil
er nach Atlanta gezogen ist, um für Coca-Cola zu arbeiten. Seit er die
Schokoladenfabrik in Hershey zugunsten einer Limonadenfabrik in
Atlanta verlassen hat, nennt Dora ihn »Kommerzknecht« oder
»Zuckerdealer«. Seinen ersten Job nach dem College bekam er bei
Hershey. Dort ist er Stufe um Stufe die Karriereleiter hochgestiegen.
Als das Unternehmen im vergangenen Jahr Stellen abbaute und er
seinen Job verloren hat, musste er nach Atlanta zu Coca-Cola wech-
seln, weil der Vertrieb für internationale Unternehmen eine ziemlich
spezialisierte Arbeit ist.
Ich öffnete die E-Mail meines Vaters.
Betreff: Hallo Celia
Von: James Door (mailto:jdoor@cocacolacompany.com)
Gesendet: Freitag, 10. September 09:39
An: Celia (mailto:celia@celiadiefinstere.com)
Hi, meine Schnecke,
hier in Atlanta läuft alles prima. Im neuen Job haben wir
Gleitzeit, deshalb kann ich morgens erst mal joggen gehen.
Abends arbeite ich dafür bis zehn.
Gleich in der Nähe meiner Wohnung gibt es drei Parks und ein
neues Einkaufszentrum mit jeder Menge Läden für Teens. Und
eine Bibliothek ist auch nicht weit. Ich kann es kaum erwarten,
dir an Weihnachten alles zu zeigen.
Erinnere deine Mutter bitte an die Hypothekenzahlung.
Hab dich lieb,
56/254

Dad
Mein Dad nennt mich Schnecke. Als ich drei war, sang er mir zum
Einschlafen immer ein Lied vor, in dem alle möglichen Tiere vorka-
men, auch Schnecken. Er erklärte mir, dass Schnecken Tiere sind, die
auf dem Boden kriechen. Danach nannte ich alle Tiere, die nicht flo-
gen oder schwammen, Schnecken. Und weil meine Eltern das so süß
fanden, gaben sie mir den Spitznamen Schnecke.
Die inoffizielle Sorgerechtsregelung meiner Eltern sieht so aus:
Mein Dad kriegt mich an Weihnachten und in den Oster- und Som-
merferien. Die übrige Zeit bin ich bei meiner Mom. Ich habe in dieser
Angelegenheit nichts zu melden. Zuverlässig wie ein Uhrwerk sendet
mir mein Dad jeden Freitag eine E-Mail. Für diese Nachrichten gibt
es eine Mustervorlage: mindestens drei Punkte, die mir an Atlanta
gefallen würden. Und am Ende stets die gleiche Bitte: »Erinnere
deine Mutter …«
Aber meine Eltern haben sich auch nicht nur über die Schusse-
ligkeit meiner Mutter gezankt. Der erste Streit, an den ich mich erin-
nern kann, trug sich zu, als ich sechs war. Ich war völlig begeistert
von einer Buchserie namens ›Jane und Clementine‹. Darin ging es
um zwei Schwestern, die zusammen tolle Abenteuer erlebten. Die
Folge war, dass ich ganz verrückt nach einer Schwester wurde. Ich
fragte unaufhörlich danach und bekniete meine Eltern, noch ein
Baby zu bekommen. Die Antworten aber, die ich von meiner Mom
und meinem Dad darauf erhielt, waren total unterschiedlich.
Dad: »Vielleicht, Schneckchen, wenn wir Glück haben.« Und dann
lächelte er und tätschelte mein Bein.
Mom: »Ich hab doch mit dir schon alle Hände voll zu tun!« Und
dann lachte sie und gab mir einen Kuss.
57/254

Eines Abends, nachdem ich meinen Vater beim Vorlesen zum
zwanzigsten Mal nach einer Schwester gefragt hatte, bekam ich mit,
wie sich meine Eltern im Schlafzimmer darüber unterhielten.
»Ich habe dir immer gesagt, dass ich eine Familie haben will«,
sagte Dad.
»Ja, ja«, antwortete meine Mom. »Aber wir sind doch schon eine
Familie.«
»In einer Ehe muss man Kompromisse machen.«
»Kompromisse! Den Kompromiss, neun Monate lang schwanger
und mit einem weiteren Kind permanent im Stress zu sein? Ich hab
noch anderes im Leben vor!«
»Gina, willst du mir damit sagen, dass wir siebenundzwanzig sind
und das war’s? Wir kriegen keine Kinder mehr?«
»Weck Celia nicht auf!«
Zum ersten Mal weinte ich, ohne zu meinen Eltern zu laufen und
mich trösten zu lassen. Nachts lag ich im Bett und machte mir Sor-
gen, ob wir zu dritt keine Familie waren. Am nächsten Abend fragte
ich meinen Vater beim Vorlesen nicht mehr nach einer Schwester.
Als ich in der fünften Klasse war, fing meine Mutter mit der
Krankenpflegeschule an. Und ein Jahr später wurde sie vergesslich.
»Gina, warum bekommen wir eine Mahnung wegen unserer
Wasserrechnung?«, bellte mein Vater, nachdem er seine Akten-
mappe kaum abgestellt hatte und die Post durchgegangen war.
»Für Rechnungen sind wir beide verantwortlich, nicht nur ich«,
rief meine Mutter von ihrem Schreibtisch im Schlafzimmer zurück.
Dad murmelte dann irgendetwas vor sich hin, was mit den Worten
»kann so nicht leben« endete, bevor er in die Küche ging, um das
Abendessen vorzubereiten.
58/254

Als ich in die achte Klasse kam, trat meine Mutter ihr Praktikum
im Krankenhaus an. Ihre Arbeitszeiten waren total verrückt. Fünfmal
in der Woche hatte sie Nachtschicht und kam nach Hause, wenn
mein Vater zur Arbeit ging. Die Streitereien wurden immer schlim-
mer und trugen sich nicht mehr nur abends im Schlafzimmer zu.
»Gina, gehst du heute mit Celia nach der Schule zum Zahnarzt?«,
fragte zum Beispiel mein Vater, wenn er und ich morgens auf-
standen. Mit müden Augen und gerade bettfertig schlug meine Mom
sich an die Stirn und sagte: »Mist, das hab ich total vergessen. Aber
ich bin vollkommen erschöpft. Können wir den Termin nicht
verschieben?«
»Verdammt, wie lange soll das mit den Nachtschichten noch
gehen?«
»Irgendwer muss sie ja machen.«
»Aber du hast eine Familie!«
»Wir wussten doch, dass wir Opfer dafür bringen müssen.«
»Dann schreiben wir also Celias Zähne auf die Liste der weiteren
Opfer? Na gut, ich komme früher von der Arbeit und bringe sie hin.«
Dann, an einem Samstagmorgen im April, riefen mich meine El-
tern ins Wohnzimmer. Es war zwei Wochen nachdem Ruth mit we-
henden Haaren aus der Schule gezerrt worden war. Ich hatte in
meinem Zimmer gesessen und zum x-ten Mal ›Schweinchen Wilbur
und seine Freunde‹ gelesen. Kaum hatten sie mich gerufen, wusste
ich schon, dass etwas nicht stimmte. Sie saßen beide stocksteif auf
dem Sofa und weder Radio noch Fernseher liefen.
»Celia.« Mein Vater räusperte sich. Er nannte mich in diesem Mo-
ment nicht Schnecke. »Ich habe bei einer anderen Firma einen Job
angeboten bekommen, der unserer Familie mehr Sicherheit bietet.«
59/254

Mom saß neben ihm und starrte auf ihre Hände. Es sah aus, als
hätte sie ein unsichtbares Buch im Schoß liegen, so konzentriert
blickte sie auf ihre Handflächen.
»Allerdings hat die Sache einen Haken«, fuhr mein Dad fort. Er
sah mir fest in die Augen. »Der Job ist in Atlanta.«
»Ziehen wir etwa um?«, fiel ich ihm fast ins Wort. In Gedanken
packte ich schon meine Koffer. Ohne Ruth hatte ich keinen Grund, in
Hershey zu bleiben.
Mein Vater seufzte. »Nein, Schneckchen, du und Mom, ihr bleibt
erst mal hier.«
Ich sah zwischen den beiden hin und her wie bei einem Tennis-
match. Ich verstand einfach nicht, was mein Dad da sagte.
»Lässt du uns etwa allein?«, fragte ich, ohne mir vorstellen zu
können, dass er das wirklich tun würde.
»Du weißt doch, dass deine Mom jetzt eine richtige Stelle im
Krankenhaus bekommen hat. Und wir denken, dass es besser für
dich ist, wenn du hier im Haus und in deiner gewohnten Schulumge-
bung bleibst …« Ich hatte Mühe, mich auf die Worte meines Vaters
zu konzentrieren, denn in meinem Kopf machte sich Panik breit. Was
ich aber ganz deutlich heraushörte, war »Trennung auf Probe«.
Manchmal haben Wörter die Wucht eines Baseballschlägers.
»Trennung? Wollt ihr euch etwa scheiden lassen?«
Jetzt kam endlich Leben in meine Mutter. »Dein Vater und ich
brauchen Zeit, um uns über uns klar zu werden, Celia. Wir wissen
noch nicht, ob am Ende die Scheidung steht.«
»Aber mach dir keine Sorgen«, fügte mein Vater rasch hinzu.
»Überlass es deinen Eltern, sich Gedanken über die Einzelheiten zu
machen. Wir bleiben eine Familie, Schnecke, egal was passiert«,
schloss er mit erstickter Stimme.
60/254

»Ich soll mir keine Gedanken über die Einzelheiten machen? Also
zum Beispiel darüber, mit wem ich leben werde?« Die Angst begann
in meinem Magen Funken zu schlagen.
»Wir halten es einfach für das Beste«, erklärte mein Vater. Meine
Mutter kam zu dem Sessel, in dem ich saß, und versuchte, mich in
den Arm zu nehmen.
»Nein!« war alles, was mir noch über die Lippen kam. Gleichzeitig
machte ich mich aus der Umarmung meiner Mutter los und rannte in
mein Zimmer. Es war nicht einfach, mich wieder auf die Lektüre von
›Schweinchen Wilbur‹ zu konzentrieren, während mir die Tränen
über die Wangen liefen. Aber irgendwie gelang es mir doch.
***
Bevor ich an Dad schrieb, beschloss ich, Dora zu antworten.
Betreff: Freunde
Von: Celia (mailto:celia@celiadiefinstere.com)
Gesendet: Freitag, 10. September 15:46
An: Dorathea Eberhardt (deberhardt@berkeley.edu)
hallo Dora,
na ja, es geht so – ohne dad. wie lange dauert eigentlich »eine
trennung auf probe«? und wenn dad sein job in Atlanta gefällt
und mom ihre arbeit hier, wo sollen wir dann leben, falls sie
wieder zusammenkommen?
kennst du jemanden, der schwul ist?
celia
»Celia, komm mal aus deiner Höhle raus. Ich bin in der Küche«, rief
meine Mutter und riss mich damit von meinen E-Mails weg.
61/254

Widerwillig loggte ich mich aus und schlurfte in die Küche. Der
Braten würde immer noch Stunden brauchen, aber meine Mutter
drückte mir den Kartoffelschäler in die Hand und schlug vor, dass
»wir zwei Mädchen« uns ein bisschen unterhalten sollten. Ich wider-
stand dem Drang, ihr zu sagen, dass sie schon seit weit über zehn
Jahren kein Mädchen mehr war.
»Also, mein Maikäfer«, fing sie an und band sich die Schürze um,
wahrscheinlich, um irgendwie häuslich zu wirken. Ich hatte meine
Mutter seit Monaten nicht mehr richtig kochen sehen, und schon gar
nicht mit Schürze. Seit mein Vater ausgezogen war, war sie sehr
dünn geworden. »Erzähl mal von deiner ersten Woche an der
Highschool.«
In solchen Momenten würde ich meiner Mutter am liebsten die
Kartoffelschalen an den Kopf pfeffern und sie anschreien: »Warum
muss ich eigentlich hierbleiben?« Aber nachdem mein Schreien im
Mai und Juni im Hinblick auf ihre Entscheidung keine Wirkung
gezeigt hat, kann ich nur noch auf Trotz zurückgreifen.
»Ganz in Ordnung«, antwortete ich und stach meiner Kartoffel mit
der Spitze meines Kartoffelschälers die Augen aus.
»Hast du schon ein Lieblingsfach?«, bohrte sie weiter, während sie
den Ofen öffnete, einen Blick auf den immer noch blassrosa Braten
warf und den Kopf schüttelte.
»Keine Ahnung … Erdkunde, glaube ich.« Mir fiel ein, wie Drake
sich in der Stunde zu mir umgedreht hatte, nachdem Mr Diaz’ laute
Stimme ihn wachgerüttelt hatte. »Richtig, Edelgase!« Debra Madis-
on, unermüdliche Briefchenschreiberin und Klassennörglerin, hatte
tatsächlich eine Frage richtig beantwortet!
62/254

»Erdkunde?«, fragte meine Mutter nach und schloss den Ofen.
»Aber du hast dich doch bisher für Englisch und Geschichte
interessiert.«
»Menschen ändern sich, Mom. Reg dich nicht auf!«
Meine Mutter trocknete sich die Hände an der Schürze ab, obwohl
sie gar nicht nass geworden waren, als sie in den Ofen gesehen hatte.
Sie holte tief Luft. Solange mein Vater noch da war, hätte ich mit
meiner Mom niemals so gesprochen. Aber sie hatten ja unbedingt
alles ändern wollen. Sie hätten damit rechnen müssen, dass auch ich
mich ändere.
»Und hast du schon neue Freunde gefunden?«, fragte sie munter
und suchte in ihrem neuen Kochbuch, das sie nach dem Auszug
meines Vaters gekauft hatte, das Rezept für Braten nach
Hausfrauenart.
Weil meine Mutter so oft Spätschicht hatte, wusste sie nicht, dass
ich nach der Schule mit Drake abhing. Wahrscheinlich wäre sie
glücklich darüber gewesen, dass ich einen neuen Freund hatte. Auch
wenn er nur für eine begrenzte Zeit mein Freund war. Sie hätte sich
dann beruhigen können, dass ihre Entscheidung, mich gegen meinen
Willen hier in Hershey festzuhalten, doch richtig war. Ich gönnte ihr
diese Genugtuung nicht und zuckte nur die Schultern. »Okay, ich bin
fertig mit den Kartoffeln. Sonst noch was?«
»Jetzt müssen sie in kleine Stücke geschnitten werden.« Sie reichte
mir das Schneidebrett. Ich knallte es auf die Arbeitsplatte und fing
schludrig an, die Kartoffeln klein zu schneiden.
»Was liest du denn im Moment?« Die Befragung ging weiter.
»›Wer die Nachtigall stört‹«, knurrte ich und wünschte, ich wäre
in meinem Zimmer und könnte lesen. »Dad hat geschrieben, dass ich
dich an die Hypothekenzahlung erinnern soll.«
63/254

Mom stöhnte und schlug mit der Hand auf ihr Kochbuch. »Ich
habe ihm gesagt, er soll dich nicht mit solchen Dingen behelligen«,
blaffte sie. »Wenn dein Vater meint, er müsse mich an meine Pflicht-
en erinnern, kann er sich direkt an mich wenden.« Sie wickelte sich
eine ihrer braunen Locken um einen Finger und löste sie wieder.
Ich sah auf und starrte sie an.
»Entschuldige, Celia«, seufzte sie. »Ich sollte meinen Ärger nicht
an dir auslassen. Ich bin gleich wieder da.« Sie nahm ihre Schürze ab
und ging Richtung Toilette.
Ich schnitt die Kartoffeln zu Ende und warf sie in das kochende
Wasser auf dem Herd. Kleine Wassertropfen spritzten heraus und
fielen zischend auf die Platte. Die gelben Würfel taumelten durch das
Wasser. In diesem Moment klingelte das Telefon. Ich wollte es klin-
geln lassen, weil mich sowieso niemand anrief. Aber dann fiel mir
ein, dass es Drake sein könnte. Vielleicht war er auf dem Weg nach
New York und rief noch mal an, um sich Mut machen zu lassen, be-
vor er Japhy traf.
»Hallo«, meldete ich mich, sorgsam darauf bedacht, nicht zu er-
wartungsvoll zu klingen.
»Gina?«, fragte eine fremde Männerstimme.
»Nein.«
»Oh, pardon, könnte ich bitte mit Gina sprechen?«
Ich zögerte. Ich war mir nicht sicher, ob ich diesen Mann, der
meine Mutter offenbar mit dem Vornamen anredete, mit ihr
sprechen lassen wollte. »Gina, da ist ein Mann für dich am Telefon«,
schrie ich durch den Flur, ohne die Hand auf den Hörer zu halten.
Meine Mutter kam aus der Toilette. In der einen Hand hatte sie ein
Taschentuch, mit der anderen kämmte sie sich durchs Haar. Sie
nahm mir den Hörer aus der Hand und hielt das untere Ende zu.
64/254

»Für dich bin ich immer noch Mom und nicht Gina«, zischte sie.
Dann hob sie den Hörer ans Ohr und meldete sich mit heiterer
Stimme.
»Ach ja, Simon aus dem Krankenhaus«, sagte sie nach einer kur-
zen Pause. Sie drehte mir den Rücken zu und wickelte das Telefonka-
bel um ihren Finger. »Klar, klingt gut«, sagte sie nach einer weiteren
Pause. »Bis dann.« Und sie legte auf.
»Sag bitte, dass das kein Date ist!«, forderte ich sie mit vers-
chränkten Armen auf.
Einen Moment lang schien meine Mutter über meinen Ton ers-
chrocken zu sein. »Nein«, sagte sie dann abwehrend, »ist es nicht.«
»Ihr habt gesagt, es sei eine Trennung auf Probe. Ihr müsstet euch
über euch klar werden.«
Mom drehte sich zu mir um. »Ich bin deine Mutter«, sagte sie mit
erhobener Stimme, »und du hast mich nicht ins Verhör zu nehmen,
Celia.«
Ich stapfte davon und knallte meine Zimmertür hinter mir zu. Ich
ließ mich auf meinen Schreibtischstuhl plumpsen und öffnete noch
einmal mein E-Mail-Programm, obwohl ich wusste, dass es keine
neuen Mails geben würde. Dann versuchte ich zu lesen, aber schließ-
lich schrieb ich ein Gedicht.
Der Herbst stapft ums Haus
wie eine nervige kleine Schwester, rüttelt
an den Fensterläden, tritt in die Haufen
aus Laub, die du zusammengerecht hast,
heult wie ein Wolf. Aber ich bin froh,
dass er da ist. Wir können den Sommer
gemeinsam verfluchen, so tun,
65/254

als hätten wir ihn längst vergessen.
Meine Mutter ließ mich in Ruhe. Erst ein paar Stunden später klopfte
sie sanft an die Tür. »Der Braten ist fertig.«
66/254

12
In der Stadtbücherei bin ich so etwas wie eine Berühmtheit. In der
siebten und achten Klasse habe ich bei den Lesewettbewerben in
meiner Altersgruppe immer den ersten Preis gewonnen. Die Biblio-
thekarinnen schöpften schon irgendwie Verdacht. Nachdem ich mit
zehn aus ›Der Fänger im Roggen‹ vorgelesen hatte, sah mich eine
von ihnen über den Rand ihrer Brille hinweg an und fragte: »Und
was war deine Lieblingsstelle, meine Kleine?« Sie tat nett und
aufgeschlossen, aber ich wusste, dass sie fand, ich sei zu jung für
Salinger.
»Ich fand cool, wie die Hauptfigur Holden Caulfield den Leuten ins
Gesicht sagt, wie verlogen sie sind«, antwortete ich und betonte
dabei besonders das Wort »verlogen«. Ich glaube, ich war schon ein
bisschen finster, bevor ich vierzehn wurde.
Wenn ich plötzlich erblinden würde, hätte ich immer noch gute
Chancen, in der Bücherei den Weg in die Jugendbuchabteilung zu
finden – auch ohne Blindenhund.
»Hallo, Celia«, begrüßten mich schon zwei Bibliothekarinnen, als
ich die Treppe heraufkam und in den Raum mit den Jugendbüchern
ging. Meine Mutter hatte einen ihrer seltenen freien Samstage, und
ich wusste, dass mir Dinge wie den Dachboden aufräumen oder Sil-
berputzen blühen würden, wenn ich zu Hause blieb. Als Entschuldi-
gung dachte ich mir ein Referat für die Schule aus und fuhr mit dem
Fahrrad zur Stadtbücherei.

Mit jedem Regal voller Bücher, an dem ich vorbeikam, ging es mir
besser. Schließlich ließ ich mich auf eines der orangefarbenen Kunst-
stoffsofas fallen, auf denen sich Jugendliche angeblich wohlfühlen,
und öffnete meinen Rucksack. Mein Notizbuch für meine Gedichte
habe ich immer dabei. Man weiß ja nie, wann man ein paar Minuten
Zeit zum Schreiben hat, wann man eine Ablenkung braucht oder ob
man sich verstecken muss.
Schon seit einer ganzen Weile arbeitete ich an einer Anleitung zum
Dichten. Jetzt schien eine gute Gelegenheit zu sein, mir weitere
Gedanken zu notieren.
Celia die Finstere
Wie man Gedichte schreibt
1. Schreib in deinen eigenen Worten. Verwende
keine Wörter wie »weh« oder »ach«. Sonst
klingt dein Gedicht nach Bibel oder nach
Shakespeare.
2. Verzichte möglichst auf Reime. Denn jeder, der
mit dem Dichten anfängt, versucht zu reimen,
und dann hören sich die Gedichte alle irgendwie
gleich an.
3. Sei konkret. Manche Leute machen in ihren
Gedichten nur Andeutungen, weil sie glauben,
damit würden sie tiefgründig klingen.
4. Wenn dir für dein Gedicht kein Schluss einfällt,
dann schreib einfach die ersten beiden Zeilen
68/254

am Ende noch mal. Dadurch bekommt dein
Gedicht etwas Rundes.
5. Scheue dich nicht, finster zu sein.
Ich arbeitete konzentriert an meiner Anleitung. Ich ließ mich von der
Atmosphäre der Bücherei davontragen, vergaß meine Sorge, dass
Drake mit Sandy gesprochen hatte, das schmerzhaft nagende Gefühl,
mich an ihr rächen zu wollen, und den Anruf von Simon. Da hörte ich
plötzlich eine vertraute Stimme. »Bitte … nur ganz kurz!«
Gerade noch rechtzeitig schaute ich zur Treppe hinüber und sah
zwei blonde Zöpfe nach unten verschwinden. Ich stand auf und folgte
ihnen bis zum Fuß der Treppe, aber die Glastür schwang bereits zu,
als wäre eben jemand hinausgegangen. Ich lief zurück, am Sofa
vorbei zum nächsten Fenster. Unten auf dem Parkplatz stand ein
Kombiwagen, der mir bekannt vorkam. Bevor sie einstieg, sah Ruth
herauf und winkte mir zu.
69/254

13
Am Sonntagmittag um zwei klingelte das Telefon. Den Vormittag
über hatte ich Hausaufgaben gemacht und die Waschmaschine an-
geschmissen, was längst fällig gewesen war. Meine Mom und ich
waren gerade mit dem Mittagessen fertig.
»Hallo?«
»Kannst du vorbeikommen?«, fragte Drake.
»Du bist schon wieder da? Ich dachte, du kommst erst heute
Abend.« Mein Herz machte gleich mehrere Sprünge.
»Hast du Zeit? Kannst du sofort kommen?«
Ich sah zu meiner Mutter hinüber, die den Tisch abwischte. »In
zehn Minuten«, sagte ich.
»Wir treffen uns im Wäldchen.«
»Muss gleich los«, rief ich meiner Mom zu, nachdem ich aufgelegt
hatte.
»Wohin denn?«, wollte sie wissen und schob einige Krümel vom
Tisch in ihre Hand.
»Einen … Freund besuchen«, brachte ich heraus, obwohl ich
wusste, dass ich damit ein Rudel Fragen aufwerfender Spürhunde
von der Leine ließ.
»Hat dieser Freund einen Namen, eine Adresse, eine Sozialver-
sicherungsnummer?« Die Neugier von Eltern ist so vorhersehbar!
»Drake«, knurrte ich und holte meine Sneakers aus dem Schuhs-
chrank im Flur. »Cloverdale Avenue.«

»Ah, ein Junge«, sagte sie und warf die Krümel in den Mülleimer.
»Ja, Mom, ein Freund mit männlichen Genitalien. Und ich gehe
jetzt«, sagte ich, schnappte mir meinen Rucksack von seinem Platz
neben der Tür und ging hinaus.
»Vergiss nicht, dass ich heute Nachtschicht habe«, rief sie mir
noch nach, als ich die Tür zuzog. »Und es soll später regnen.«
Am Haus von Drakes Großmutter stapfte ich an den Blumenbeeten
vorbei über die gepflegte Rasenfläche und in die dicke Laubhülle des
Wäldchens. Der Herbst hatte den Blätterbaldachin schon gelichtet.
Mit jedem Tag sah man mehr von den nackten Ästen.
Während ich mir meinen Weg durch das Unterholz bahnte, sah ich
Drake schon auf unserem Baumstamm sitzen. Sein Skateboard stand
aufrecht zwischen seinen Knien, und er werkelte an etwas herum.
»Was machst du da?«, fragte ich und ließ meinen Rucksack in eine
Kuhle zwischen den Wurzeln fallen.
»Ich versuche, ein verrostetes Kugellager auszuwechseln«, antwor-
tete er. »Hab am Wochenende ein neues gekriegt.«
Ich fischte einen Eddingstift aus der Tasche meiner Kapuzenjacke,
streifte meine Schuhe ab und fing an, Muster auf meine weißen Ze-
hen zu malen.
»Wie lief’s?«
»Nicht so gut.«
Ich musterte Drakes Gesicht. Sein Kiefer war angespannt, seine
Wangenmuskeln bebten. Mit der Konzentration eines Chirurgen
arbeitete er an seinem Skateboard. Ich übermalte das Wort »Con-
verse« auf meinem Schuh mit einem Stern.
»Ich bin immer nervöser geworden, bis es endlich Samstagabend
war«, erzählte Drake mit zusammengebissenen Zähnen. »Am Freit-
agabend im Theater und den ganzen Samstag hatte ich das Gefühl,
71/254

dass mein Körper sich von innen her auffraß. Ich tigerte in der
Wohnung herum und erfand Ausreden, um rauszugehen. Als Japhy
endlich bei uns klingelte, zitterten mir beim Öffnen die Hände.«
Drakes Schraubenschlüssel rutschte ab und kratzte über den Lack.
»Scheiße.«
Ich hörte auf zu malen, schob die Kappe auf den Stift und sah
Drake an.
»Dann ist meine Mom mit seinem Vater zum Theater gegangen,
weil Japhys Mom und mein Dad schon dort waren. Kaum waren sie
weg, zog Japhy seine Jacke aus und sagte: ›Hey, komm, wir holen
uns einen Whiskey von deinem Vater.‹ Ich habe noch nie Alkohol
getrunken. Er auch nicht, glaube ich.« Während er erzählte,
schraubte Drake an der Rolle herum. Er sah mich nicht an, gerade so,
als würde er die Geschichte seinem Skateboard erzählen.
»Mir war ganz schlecht vor Aufregung. Vielleicht sollte ich tatsäch-
lich etwas trinken, dachte ich. Dann geht es vielleicht leichter. Wir
holten also die Whiskeyflasche aus dem Schrank. Japhy fuchtelte
damit herum und meinte: ›Du weißt doch, Drake … volles Risiko.‹
Ich mischte meinen Whiskey mit Cola, aber Japhy warf nur ein paar
Eiswürfel in sein Glas. Dann kletterten wir auf die Feuerleiter hinaus
und beobachteten Leute. Eigentlich merkte ich nicht viel. Zumindest
fühlte ich mich nicht betrunken – so wie andere das immer bes-
chreiben. Ich war ein bisschen entspannter. Nach einer Weile
beschlossen wir, uns einen zweiten Drink zu holen.«
Der Wind fuhr durch die Blätter zu unseren Füßen. Im Wäldchen
war es immer ein bisschen kühler als auf den Rasenflächen bei den
Häusern. Ich zog meine Kapuze auf.
»Japhy drehte die Musik auf und nahm für den zweiten Drink die
Wodkaflasche. Dieses Mal goss er weniger Cola in mein Glas und
72/254

verzichtete für sich auf die Eiswürfel. Wir kletterten zurück auf die
Feuerleiter und riefen den Leuten unten auf der Straße Unsinn zu.
›Hey, Alter, Sie haben was verloren‹, rief Japhy zum Beispiel und di-
rigierte den Mann zu einem imaginären Gegenstand. ›Rechts hinter
Ihnen … ein bisschen mehr links … da, sehen Sie es nicht?‹ So lange,
bis der Mann merkte, dass Japhy ihn verarschte. Mit drei Leuten hat
er das gemacht, bis –« Wieder rutschte der Schraubenzieher ab und
hinterließ eine Kratzspur auf Drakes Handrücken. »Verdammt!« Wie
eine Schlange, die ihn gebissen hatte, warf er den Schraubenzieher
ins Laub.
»Alles in Ordnung?«, fragte ich und richtete mich auf. »Lass mal
sehen!«
Drake schüttelte den Kopf und schob die Hand in seine Achsel-
höhle, ohne sie mir zu zeigen. »Es gibt ja nicht gerade viel Platz auf
einer Feuerleiter, wir mussten also eng nebeneinandersitzen. Jedes
Mal, wenn sich einer bewegte, berührte er den anderen. Nachdem
Japhy zum dritten Mal einen Mann unten auf dem Gehsteig ver-
arscht hatte, sah er mich lachend an. Sein Gesicht war direkt neben
meinem. Er sah so fröhlich aus, und da habe ich … ich habe ihn
geküsst. Ich habe ihn einfach geküsst!«
Der Wind wirbelte einige Blätter auf und ließ sie auf Drakes Füße
herabsegeln. Das Haar wehte ihm ins Gesicht – trotz des ganzen
Stylingzeugs.
»Und?«, fragte ich atemlos.
»Er hat mich ebenfalls geküsst.« Drake zog die Hand aus seiner
Achselhöhle und sah auf den Kratzer, aus dem ein paar winzige Blut-
ströpfchen quollen. »Es war total verrückt. Ganz New York wurde
still. Die Feuerleiter löste sich vom Haus und flog wie ein Helikopter
über die Stadt. Die Sonne ging unter und wieder auf. Es war perfekt.«
73/254

Drake fuhr sich mit der unverletzten Hand durch die Haare. Ich at-
mete tief durch, stellte mir vor, wie sich zwei Jungs hoch oben auf
einer Feuerleiter küssten. »Bis er mich wegstieß und sagte: ›Ich muss
gehen.‹ Und er stieß mich noch weiter weg, obwohl wir uns gar nicht
mehr berührten.«
Drake schlurfte durch das Laub. Mit jeder Minute wurde der Wind
stärker. Es fing an, dunkel zu werden, obwohl es erst Nachmittag
war.
»Und dann?«, fragte ich und wühlte in meinem Rucksack nach
einem Pflaster.
»Er ist durchs Fenster in die Wohnung zurückgeklettert, und ich
ihm nach. Ich war drauf und dran, ihm alles zu sagen. Ich war wirk-
lich kurz davor, ihm zu sagen, was ich für ihn empfinde. Da sagte er:
›Ich bin nicht schwul‹, packte seine Sachen zusammen und rannte
aus der Tür. Er ist wirklich gerannt.«
Ich fühlte mich vollkommen hilflos. Verzweifelt suchte ich nach
Pflastern, bis ich endlich ein kleines Erste-Hilfe-Set ganz unten in
meinem Rucksack fand. So ist das eben, wenn man eine Mutter hat,
die Krankenschwester ist. Ich winkte Drake, dass er sich neben mich
setzen sollte, und nahm behutsam seine Hand. Ich riss das Päckchen
auf, zog das Pflaster heraus und klebte es auf Drakes Wunde.
»Ich lief zurück zur Feuerleiter und sah ihm nach, wie er zur U-
Bahn rannte. Ich heulte. Ich wollte schon runterspringen«, berichtete
Drake weiter. »Oder wenigstens den ganzen Whiskey und den
Wodka austrinken. Aber dann räumte ich nur die Flaschen weg und
legte mich ins Bett. Als meine Mutter nach Hause kam, wollte sie
wissen, ob Japhy und ich uns gestritten hatten. Er hatte seinen El-
tern eine SMS geschickt, dass er nach Hause gegangen sei. Seine El-
tern waren ziemlich sauer, weil er einfach abgehauen und abends
74/254

allein U-Bahn gefahren war. Komisch, oder?«, meinte Drake, obwohl
überhaupt nichts daran komisch war.
»Ich habe meinen Eltern gesagt, dass ich heute einen Zug früher
nehmen möchte. Ich habe ihnen nicht erzählt, was wirklich passiert
ist. Ich habe einfach gesagt, dass ich noch Hausaufgaben machen
muss«, schloss er und schob seine Hand in die Jackentasche. »Ich
habe mich so bescheuert gefühlt. Ich bin so bescheuert!«
Ein paar Regentropfen fielen auf meine Schultern, und der Wind
wirbelte noch mehr Blätter auf und wehte sie gegen den
Baumstamm.
»So viel zum Thema Coming-out.« Drake versetzte dem Laub, das
uns allmählich zuzudecken versuchte, einen Tritt. »In seinem Käm-
merchen zu bleiben ist nicht das Schlechteste. Dort ist es wenigstens
warm und trocken«, sagte er ohne den Anflug eines Lächelns.
Es brach mir schier das Herz. Und ich hatte nicht die geringste Ah-
nung, was ich sagen sollte.
Drake stand auf und suchte im Laub nach seinem Schrauben-
zieher. Ich hob sein Skateboard auf.
Fünf schwere Tropfen fielen auf meinen Rücken. Wir legten unsere
Arme umeinander und gingen zurück. Und der Himmel öffnete seine
Schleusen und weinte sich über uns aus.
75/254

14
»Die Hand muss amputiert werden«, sagte ich, als ich Drakes Wunde
am Montagmorgen auf dem Weg zur Schule inspizierte.
»Und was wird dann aus meiner Karriere als Messerwerfer?« Er
trat auf sein Skateboard.
»Vielleicht
können
wir
dich
ja
bei
einer
Freak-Show
unterbringen.«
Drake rollte lustlos den Gehsteig entlang und brachte kaum die
Energie auf, Schwung zu holen. Glücklicherweise ging es auf dem
Weg zur Schule die meiste Zeit bergab.
»So weit alles in Ordnung?«, erkundigte ich mich.
»Ja, nur dass ich sterbe. Wir sterben alle, und alles, was wir auf
dieser Erde tun, ist sinnlos«, antwortete Drake gleichgültig. »Aber
sonst geht’s mir gut.«
In der Schule trennten wir uns und jeder ging zu seinem Spind.
Drake rollte auf seinem Skateboard durch die Gänge, was in der Her-
shey High strengstens verboten ist. Ich sah noch, wie er plötzlich von
seinem Board heruntersprang und es in die Hand nahm, als unser
Direktor, Mr Foster, aus dem Krankenzimmer kam. Mr Foster sah
Drake streng an, nickte ihm mahnend zu und ging davon.
Als ich zu meinem Spind kam, gab neben mir Becky Shapiro an
ihrem gerade ihren Code ein. Wenn Becky zu Beginn der achten
Klasse übergewichtig war, dann war sie jetzt, zu Beginn der neunten,
krankhaft fettleibig.

»Hey, Celia«, begrüßte sie mich freundlich. Becky hat einen klein-
en Kreis von Freundinnen, die am liebsten vor dem Computer hän-
gen. Hätte ich es in der Achten probiert, hätten sie mich wahrschein-
lich gern aufgenommen. Ich hab’s aber nicht probiert.
»Hallo, Becky«, antwortete ich und öffnete meinen Spind. Über
das Wochenende war mein »Celia die Finstere«-Schild verschwun-
den. Vielleicht war es der Hausmeister, denn offiziell dürfen die
Türen nur an der Innenseite beklebt werden.
»Hast du Lust, einen Schokoriegel zu kaufen, zugunsten der Schul-
band?«, fragte Becky und zog eine Schachtel mit Hershey-
Schokoriegeln aus ihrem Spind.
Die Firma Hershey stiftet regelmäßig Schokolade für die Schulen
der Stadt. Diese nehmen dann über den Verkauf Geld ein und finan-
zieren dadurch ihre Cheerleader-Camps oder die Aufführung von
Musicals. Die eine Hälfte der Schüler verkauft also ständig
Schokolade, während die andere Hälfte sie einkauft. Ich boykottiere
dieses Vorgehen, weil ich mich weigere, ein Rädchen im Getriebe der
amerikanischen Großunternehmen zu sein. Das wollte ich Becky
gerade erklären, als Joey Gaskill, flankiert von zweien seiner
holzköpfigen Freunde, den Korridor entlangkam. »Eine fette Nudel,
die Schokoriegel verkauft – wenn man da keinen Appetit kriegt!«
Joeys Begleiter stießen ein derbes, lautes Lachen aus. Es fiel ihnen
wie Spucke aus dem Mund. Ich spürte die Finsternis in mir auf-
steigen. Noch bevor ich nachdenken konnte, knallte ich meine
Spindtür zu und fuhr herum. »Ihr seid ja so was von blöd und mies.
Und außerdem könnt ihr noch nicht mal Basketball spielen.«
Aggression schwelte auf einmal im Korridor. Joey blieb jäh stehen
und sah mich drohend an, als würde er einen Scheinwerfer auf mich
77/254

richten. Ich machte mich darauf gefasst, dass er jeden Augenblick ge-
walttätig wurde.
»Ah, der Troll kann sprechen«, sagte er und musterte mich von
oben bis unten. »Schon gut, ich werd dir deine verfettete Freundin
nicht wegnehmen.«
»Haut bloß ab, ihr Kotzbrocken«, sagte ich mit meiner finstersten
Stimme und zeigte den Gang hinab.
»So ein seltsames kleines Monster«, gab Joey zurück, schüttelte
den Kopf und zog mit seinen beiden Speichelleckern weiter. Er klang
cool, aber sein Blick hätte töten können.
Mein Herz pumpte Blut für drei Körper durch meine Adern. Ich
spürte, wie sich meine Haut in einen Panzer verwandelte, als ich
mich wieder umdrehte, um meinen Spind zu öffnen. Becky starrte
ihre Schachtel mit den Schokoriegeln an. Sie krümmte sich, als hätte
ihr jemand in den Magen geboxt. In ihren Augen standen Tränen,
bereit, sich in ihren Tod auf Beckys Wangen zu stürzen. »Danke,
Celia«, flüsterte sie. Ich nickte nur.
Die Leute kritisieren es, wenn Kinder und Jugendliche zu dick
sind. Aber auf der anderen Seite schenken sie uns Geburtstagstorten,
Osterhasen und Nikoläuse und Unmengen Süßkram zu Weihnacht-
en. Und wenn man sich Becky ansieht, weiß man, dass sie nicht nur
dick ist, weil sie gerne Plätzchen isst. Sie braucht das Fett noch für et-
was anderes, zur Strafe oder zum Schutz. Ich glaube, Becky ist aus
dem gleichen Grund dick, aus dem ich finster bin.
Meine Hände zitterten noch, als ich zur ersten Stunde kam. Ich tat
alles, um meinen Atem unter Kontrolle zu bringen, während Mr
Pearson
durch das Klassenzimmer
ging
und uns unsere
Hausaufgaben zurückgab, die wir am vergangenen Freitag
eingereicht hatten – einen Aufsatz über das Gedicht ›We Real Cool‹
78/254

von Gwendolyn Brooks. Ich hatte mich entschieden, meine Arbeit in
Form eines Gedichts zu schreiben.
Welche dichterischen Mittel verwendet die Lyrikerin Gwendolyn
Brooks in ihrem Gedicht ›We Real Cool‹, um das, was sie sagen
will, zu vermitteln? Ist es Gwendolyn Brooks’ Ansicht nach cool,
die Schule zu schmeißen?
Celia die Finstere
Sterben ist nicht heiß
Cool ist nicht mehr cool, denn cool ist jetzt heiß.
Und Schule ist nicht mehr Schule, wenn man sie schmeißt.
Dann ist die Straße die Schule, und John,
der Abgedrehte, der Aussteiger, ist der Lehrer.
Und es ist nicht cool, weil die coolen Kinder in der Schule sind,
wo andere coole Kinder ihnen sagen, wie heiß sie sind,
und sie wollen sich nichts entgehen lassen.
Kinder, die die Schule schwänzen, sind weder cool noch heiß.
Sie essen weggeworfene Pizza aus der Mülltonne,
wollen von ihren Eltern extra Pausengeld,
für Zigaretten, als wäre ihnen ohnehin alles egal.
Schuleschwänzen ist nicht cool, denn in der Schule
lernen sie, was die Uncoolen erfahren
über das Leben und Sterben.
Ich schloss mein Gedicht sogar mit dem Wort Sterben, fast wie
Gwendolyn Brooks. Und außerdem sagte ich noch eine ganze Menge
darüber, wie es ist, wenn man heutzutage die Schule schwänzt. Ich
79/254

meine, schwänzt noch irgendjemand die Schule, um Poolbillard
spielen zu gehen wie in Brooks’ Gedicht? Vielleicht war das früher so,
in den Sechzigerjahren. Vielleicht schrieb sie das aber auch nur, weil
»Pool« sich auf »cool« reimte.
Als er mir meine Arbeit zurückgab, sagte der glatzköpfige Mr Pear-
son in einem Ton, als hätte ihn noch nie in seinem Leben ein Gedicht
inspiriert: »Celia, was soll das? Ich sagte, ihr solltet einen Aufsatz
schreiben. Hol das bitte nach.«
Mandy lachte leise vor sich hin.
In mir barst ein ganzer Baum, gerade so, als hätte ein Blitz
eingeschlagen. »Verdammt noch mal, halt die Fresse, Amanda«, fuhr
ich sie an und trat mit dem Fuß so fest nach ihrem Tisch, dass er ein-
en Satz nach vorne machte.
Und jetzt ging im Klassenzimmer eine Bombe hoch. »Was hast du
gesagt?« Mandy sprang von ihrem Stuhl auf. Sandy wirbelte herum,
als hätte sie eine solche Ausdrucksweise noch nie gehört.
Mr Pearson hob die Hand wie ein Schiedsrichter und blies bildlich
gesprochen in seine Trillerpfeife. »Mandy, setz dich! Und du, Celia,
du kommst morgen zum Nachsitzen.« Er zeigte mit seinem Wurst-
finger auf mich.
Mandy warf ihr langes Haar über eine Schulter und schob demon-
strativ ihren Stuhl an seinen Platz, bevor sie sich wieder setzte.
»Ein solches Verhalten und eine solche Ausdrucksweise dulde ich
in meinem Unterricht nicht, Celia«, fuhr Mr Pearson fort, während er
zu seinem Pult ging und ein Formular aus der Schublade nahm. Mir
war so schlecht, dass ich Sandy auf der Stelle über den Rücken hätte
kotzen können. Meine Knochen kamen mir vor wie aus Trockeneis
und meine Ohren rauchten. Wie hatte ich nur so die Beherrschung
verlieren können! In Englisch. Ich musste in Englisch nachsitzen.
80/254

Englisch war eigentlich mein sicherer Hafen, meine Oase. Ich schloss
die Augen und erinnerte mich an den Unterricht von Ms Green. Bei
ihr hätte sich dieser Vorfall niemals ereignet!
Ms Green war in der Achten meine Englischlehrerin gewesen. In
ihrem Unterricht hatte ich immer supergute Noten bekommen. Sie
war die Erste, die mich ermunterte, Gedichte zu schreiben. Und sie
hat noch viel mehr für mich getan.
Sie trug immer hochhackige Schuhe und enge Röcke, während an-
dere Lehrerinnen Schlabberkleider und Clogs oder Halbschuhe an-
hatten. Ihr braunes langes Haar streichelte um ihre Schultern, als
wäre sie einer Shampoo-Werbung entstiegen. Während des ganzen
Schuljahrs fehlte Ms Green nicht einen Tag. Sie war nie krank, ließ
sich nie beurlauben. Niemand in ihrer Familie starb. Sie war die ein-
zige Lehrerin, die nie eine Vertretung brauchte, und am Schul-
jahresende überreichte ihr der Direktor eine Auszeichnung für ihr
Engagement.
In Ms Greens Klassenzimmer standen die Tische im Kreis. In der
Mitte lag ein geflochtener Teppich und darauf standen ein dick ge-
polsterter Sessel und eine Leselampe. Jeden Freitag schaltete Ms
Green das Neonlicht aus und ließ stattdessen die Sonne durch die
Jalousien flimmern, während sie uns Gedichte vorlas. Einmal weinte
sie sogar bei einem Gedicht, das von einem Mädchen handelte,
dessen Vater gestorben war. Sie brach aber nicht ab, sondern las
unter Tränen weiter. Es waren nicht nur die Jungs in meiner Klasse,
die für Ms Green schwärmten. Ich glaube, die ganze Achte war in sie
verliebt.
Irgendwann im Mai, etwa einen Monat nachdem Ruth aus der
Schule genommen worden war und zwei Wochen nachdem meine El-
tern ihre Trennung auf Probe verkündet hatten, gab Ms Green mir
81/254

einen kleinen Notizzettel. Sie ging im Kreis von einem zum anderen
und gab uns unsere Aufsätze über Elie Wiesels Autobiografie ›Die
Nacht‹ zurück. Vor jedem Tisch blieb sie stehen und legte den Auf-
satz vor den jeweiligen Schüler oder die Schülerin.
Die Arbeiten sahen alle gleich aus. Oben waren sie zusammen ge-
heftet und links in der Ecke standen mit roter Tinte die Note und
eine Bemerkung. Als sie an meinen Tisch kam, zögerte Ms Green ein-
en Moment. Ich sah zu ihr auf. Ihr Haar umrahmte ihr Gesicht wie
eine Kapuze und sie lächelte ihr strahlendes Lächeln. Wortlos legte
sie meinen Aufsatz, auf dem ein lilafarbener Zettel klebte, vor mich
hin und ging weiter. Auf dem Zettel stand:
Celia,
du bist eine talentierte Schreiberin. In den acht Jahren,
seit ich Lehrerin bin, ist mir noch nie eine so natürliche
und engagierte Stimme begegnet. Ich hoffe, du wirst
auch weiterhin fleißig arbeiten und deine Fähigkeiten
vervollkommnen, sowohl in der Schule als auch in der
Freizeit. Ich finde, du bist wirklich begabt.
Ms Green
Ein Kribbeln zog über meinen Schädel. Es begann hinten im Nacken,
kroch nach vorne und dehnte meine Lippen zu einem Lächeln. Ms
Green war auf mich aufmerksam geworden! Ms Green fand mich
begabt! Ich saß da und starrte auf den lila Zettel, bis mich das unan-
genehme Gefühl überkam, dass noch andere Augen auf dem Papier
ruhten. Ich spähte nach links und sah gerade noch, dass Sandy Fire-
stone, die neben mir saß, auf Ms Greens Zettel starrte.
82/254

Sobald sie meinen Blick bemerkte, schossen Sandys Augen zu
Boden, als suchte sie arglos nach einem hinuntergefallenen Stift. Nun
spähte ich auf Sandys Aufsatz und dort prangte wie ein offen
stehendes Maul ein großes rotes C.
Sandy sah auf und merkte, dass ich auf ihren Aufsatz schaute. Sie
riss ihn an sich, schob ihn in ihren Ordner und knallte den Deckel zu.
An diesem Tag fingen die ganzen Probleme an. Probleme, die fast
mein Leben zerstörten. Probleme, die mich finster hatten werden
lassen. Probleme, die gerächt sein wollen.
83/254
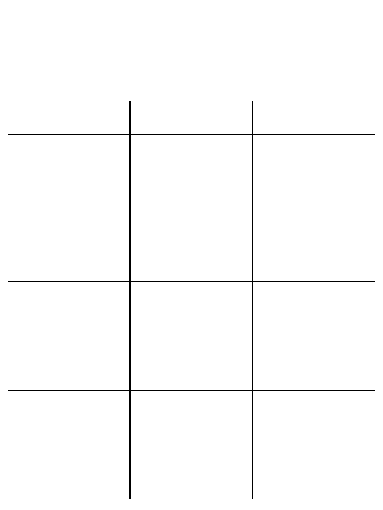
15
Art der Rache
Pro
Kontra
Im Gang ein Be-
inchen
stellen
und
hinfliegen
lassen
Peinlich,
aber
kriegen zu wenig
Leute mit
Nicht besonders
clever, weil es
körperliche Ge-
walt ist. Kann
dafür
Unter-
richtsauschluss
kriegen
Ein Foto von ihr
mit fiesem Text
posten
Halbwegs
peinlich
Müsste ein Foto
auftreiben, und
sehen das über-
haupt genügend
Leute?
Einen
ihrer
schlechten Auf-
sätze unter die
Leute bringen
Könnte ich in
Englisch klauen
Nicht besonders
peinlich – wer
schert sich um
schlechte
Schulnoten?

Die ganze Englischstunde über arbeitete ich an meiner Rache-Pro-
und-Kontra-Liste. Weil meine Rache so richtig erniedrigend sein
sollte, weil alle sie mitbekommen mussten und weil Sandy gleich wis-
sen sollte, dass ich dahintersteckte, war die Sache nicht so leicht aus-
zubrüten. Außerdem konnte ich gar keinen klaren Gedanken fassen,
denn mein Herz schlug wie rasend. Am Ende der Stunde war ich zu
keinem Ergebnis gekommen. Alle standen auf und schlurften aus
dem Klassenzimmer. Mandy trat heimlich gegen meinen Stuhl.
»Pass bloß auf, Emo«, raunte sie.
In der Mittagspause wartete ich an meinem Spind auf Drake, der
seine Bücher verstaute. Als er endlich im Gang auf mich zukam,
wurde ich Zeugin einer kleinen Szene. An einer anderen Spindreihe
stand eine Gruppe Mädchen zusammen. Drake wollte an ihnen
vorbei, aber eines der Mädchen schubste ein anderes so heftig, dass
ihr das Buch aus der Hand fiel und sie gegen Drake stolperte. Drake
erschrak zunächst, aber dann lächelte er das Mädchen charmant an
und hob ihr Buch auf. Danach ging er weiter und die Mädchen kich-
erten los wie kleine Vulkane, aus denen sich pinkfarbener Zuckerguss
entlud.
»Hallo«, sagte Drake, als er meinen Spind erreicht hatte.
Über seine Schulter hinweg sah ich, dass die Mädchen ihn immer
noch angafften und unser Zusammentreffen gebannt beobachteten.
Drake schien gar nicht zu bemerken, dass er Publikum hatte.
»Hallo«, grüßte ich zurück, schloss meinen Spind und machte
mich mit Drake auf in Richtung Picknickwiese. Mit einem kurzen
Blick über die Schulter stellte ich fest, dass die Mädchen uns noch
immer hinterherstarrten.
85/254

Während wir aßen, legte sich eine grüblerische Stille über uns. Wir
kauten träge auf unseren Sandwiches herum, wie Pferde, die Gras
malmen.
»Spielst du heute nicht Basketball?«, fragte ich, als ich sah, dass
sich ein paar Spieler auf dem Spielfeld sammelten und Drake sich
nicht von der Stelle rührte.
»Keinen Bock«, murmelte er und kaute weiter.
»Ich muss nachsitzen«, sagte ich.
»Kein Wunder, heute ist einfach alles Scheiße.« Bei dem Wort
Scheiße flog ein Stückchen Thunfischsandwich aus seinem Mund und
landete auf meinem Ärmel. Es sprengte die dicke Luft und wir
mussten beide lachen. Mit einer Serviette wischte Drake meinen
Ärmel ab.
»Möchtet ihr vielleicht Tickets für den Schulball kaufen?«, flötete
in diesem Moment eine hohe Stimme. Ich drehte mich um und sah
ein Mädchen in Jeans und Hershey-High-Sweatshirt, das von den
Picknicktischen herüberkam. Sie hatte ein weiteres Mädchen im Sch-
lepptau, das eine Metalldose mit Geld in der Hand hatte. »Er ist am
zweiten Oktober.«
»Nein danke«, antwortete Drake höflich. Ich schüttelte nur den
Kopf und schickte die engagierten Schülerinnen damit weiter.
»Bist du am zweiten Oktober denn überhaupt noch hier?«, fragte
ich und tat alles, um nicht übermäßig interessiert daran zu klingen,
wann er nach New York zurückging.
»Keine Ahnung. Meine Eltern haben schon in beiden Schulen an-
gerufen – ich stehe immer noch bloß auf der Warteliste. Ich habe
aber sowieso keine so große Lust mehr zurückzugehen. Auf der an-
deren Seite gibt es hier auch nicht viel, was mich hält.« Er legte sich
86/254

ins Gras und schob die Hände unter seinen Kopf, während die ander-
en Jungs zu spielen anfingen.
Ich schob den Rest meines Sandwiches in die Tüte zurück, denn
der Appetit war mir vergangen.
87/254

16
»Na, wieder mal da, Celia?« Ms Edgar, die Schulbibliothekarin be-
grüßte Drake und mich sehr herzlich. Ich hatte Drake gebeten, am
Dienstag früher loszugehen, weil ich mir ein neues Buch holen wollte.
Ich hatte Angst, mit dem Lesepensum, das ich mir vorgenommen
hatte, in Rückstand zu geraten. Und ich brauchte Lektüre fürs
Nachsitzen.
Nachsitzen. Das war das erste Wort, das mir an diesem Morgen
beim Aufwachen in den Kopf gekommen war. Zum Glück hatte Mom
Spätschicht gehabt und ich hatte ihr am Montagabend beim Essen
nichts davon sagen müssen. Außerdem erzählte sie mir ja auch nichts
von Simon aus dem Krankenhaus. Und einen Brief, in dem die Eltern
in die Sprechstunde gebeten wurden, gab es erst beim zweiten
Nachsitzen.
»Guten Morgen«, grüßte ich Ms Edgar und versuchte, nicht zu fin-
ster zu klingen. Ich hatte einen schwarzen Minirock an und meine
Springerstiefel, dazu lila gestreifte Strumpfhosen. Stiefel und
Kapuzenjacke wurden irgendwie zu meiner Schuluniform.
Drake wirkte verschlafen und seine Haare waren nicht gestylt. Auf
dem Weg zur Schule hatte er kaum gesprochen. Sobald wir jedoch
die Bibliothek betraten, flüsterte er: »Ich habe gestern Abend noch
versucht, ihn zu kontaktieren. Er hat mich aber als Freund gelöscht.«
Drake brauchte mir nicht zu erzählen, wer er war. Seine Augen waren
total traurig.

Wir gingen an den Regalen mit den Sachbüchern vorbei, bis wir zu
den Naturwissenschaften kamen. Auf der Suche nach einem interess-
anten Thema glitt mein Blick über Bücher über Planeten, das Nuk-
learzeitalter und Biodome – eine Art Ökomuseum.
»Vielleicht … ändert er seine Meinung ja noch mal«, wandte ich
wenig überzeugend ein.
»Vielleicht«, erwiderte Drake, aber er klang nicht sehr
zuversichtlich.
Dann bog er nach links ab und verschwand zwischen zwei
Regalreihen. Ich entschied mich irgendwann für ein Buch aus der
Gartenabteilung mit dem Titel ›Das Reich der Regenwürmer‹ und
ging zur Ausleihtheke, um es registrieren zu lassen.
Drake hatte sich auf der anderen Seite des Raums in den schmalen
Gang zwischen den Regalen »Philosophie« und »Psychologie« ver-
drückt. Er hockte auf seinen Fersen und studierte die Buchrücken.
Während ich darauf wartete, dass Ms Edgar den Barcode meines
Buchs einscannte, kam er mit einem dicken Exemplar in einem
glänzenden rot-weißen Schutzumschlag an und knallte es auf die
Theke. Es hieß ›Lebe deinen Traum!‹
***
Der rosa Zettel mit der Anweisung zum Nachsitzen wurde während
des Englischunterrichts für mich abgegeben. Immer wenn so ein
Wisch auftaucht, geht ein Raunen durch die Klasse und alle drehen
sich nach der Person um, die ihn bekommt. Als Sandy Firestone mich
jetzt anglotzte, sagte sie laut genug, dass alle Schüler es hören kon-
nten, Mr Pearson erstaunlicherweise aber nicht: »Damit wird das
Nachsitzen ein Stück stranger!« Unterdrücktes Gelächter wogte
durch das Klassenzimmer und ließ mein Blut gerinnen.
89/254
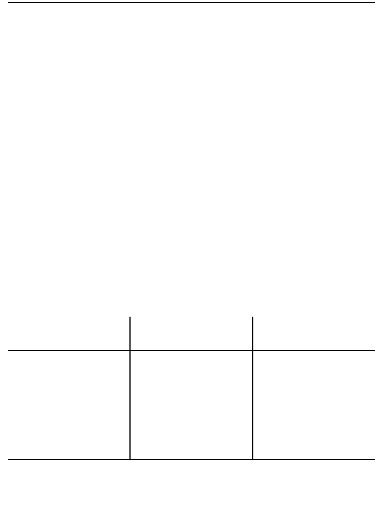
***
In der Grundschule sagten unsere Lehrer: »Nächstes Jahr sollt ihr
alle auf die weiterführende Schule kommen. Aber eine solche Faul-
heit wie hier könnt ihr euch dort nicht leisten!« In der achten Klasse
war es das gleiche. »Ihr wisst schon, dass ihr mit dieser schludrigen
Arbeitsweise in der Highschool nicht durchkommen werdet, das
kann ich euch sagen!«
Irgendwann hatte ich einen solchen Horror vor der Highschool,
dass ich mir ein Jahrbuch der Hershey High kaufte, um mich ein bis-
schen vorzubereiten. Für einen Highschool-Neuling ist ein Jahrbuch
so etwas wie ein Cliquen-Katalog. Man blättert durch und stellt sich
sein Leben in allen möglichen Clübchen und Gruppen vor. Ich hatte
versucht, mich in der Theater-AG und im Debattier-Club zu sehen, es
war mir aber nicht gelungen.
Ich zückte meine Kladde und ergänzte meine Liste um weitere
Rachepläne, während Mr Pearson von der Herausforderung faselte,
in Dialektform zu schreiben.
Art der Rache
Pro
Kontra
Juckpulver hin-
ten in ihr Shirt
schütten
Juckt und tut vi-
elleicht weh
Ich
muss
sie
ablenken, damit
sie nichts merkt;
ist nicht richtig
erniedrigend
90/254
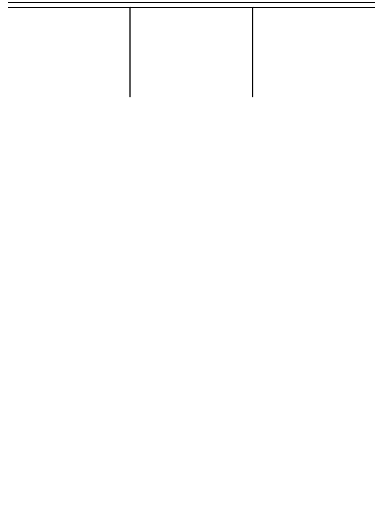
Geschmolzene
Schokolade
in
ihre
Jack-
entasche stecken
Eine
Riesensauerei
Fliege
wahr-
scheinlich
auf;
nicht
peinlich
genug
Eine Unterrichtsstunde reihte sich an die andere und die Zeit bis zum
letzten Gong war zäh wie Kaugummi.
»Vielen Dank, dass Sie heute Abend zu meiner Lesung in die
Carnegie Hall gekommen sind«, sagte Drake mit aufgesetzt hoher
Stimme, als wir gemeinsam in die Mittagspause gingen. »Mein neuer
Gedichtband hat den Titel ›Rosa Wisch‹ und basiert auf Er-
fahrungen, die ich an einer repressiven Schule im ländlichen
Pennsylvania gemacht habe. Dort wurde ich gezwungen, gemeinsam
mit den örtlichen Grobianen eine barbarische Haft, Nachsitzen
genannt …«
»Drake!«, sagte da eine Stimme hinter uns so durchdringend, dass
wir beide zusammenfuhren. Mr Scott, der Sportlehrer und Basket-
balltrainer an der Hershey High, trat auf uns zu. »Drake«, sagte er
noch einmal, mit dem einzigen Schallpegel, der Trainern zur Verfü-
gung steht: laut nämlich. »Hast du schon mal ans nächste Schuljahr
gedacht? Ich denke, wenn du weiterhin so gute Sprungwürfe lieferst,
kannst du es durchaus in die Schulmannschaft schaffen. Na, Cindy,
wie geht’s?«, fügte er mit einem Blick auf mich hinzu.
Ich starrte ihn finster an.
Trainer Scott verfolgt immer während der Mittagspause die Spiele.
Er hatte Drake also in Aktion gesehen.
»Hallo, Mr Scott«, antwortete Drake und zuckte die Schultern.
»Nächstes Jahr bin ich wieder in New York. Vielleicht sogar schon
91/254

nächsten Monat.« Als Drake das sagte, klang er nicht besonders
glücklich oder überzeugt.
»Na, für den Fall, dass du doch länger bleibst, können wir dich vi-
elleicht schon dieses Jahr ins Team aufnehmen«, erklärte der Train-
er. »Es kann nämlich sein, dass ich einen Spieler verliere.« Den let-
zten Satz sagte er mit vorgehaltener Hand, wie ein Geheimnis, aber
seine Lautstärke drosselte er keineswegs. Er schlug Drake dröhnend
auf die Schulter und ging rasch davon, bevor Drake protestieren
konnte.
Drake sah mich kopfschüttelnd an. »Los, Cindy«, sagte er und zog
mich weiter.
Nach der letzten Stunde verabschiedete ich mich von Drake und
trottete bedrückt zum Nachsitzen.
Die Beschreibung auf dem pinkfarbenen Zettel wies mir meinen
betrüblichen Weg zum richtigen Raum. KLASSENZIMMER/
NACHSITZEN stand auf dem Türschild. Ich holte tief Luft und
öffnete die Tür.
***
Es war ein ganz normales Klassenzimmer. Ein grauhaariger Mann
mit spitzem Kinn saß an einem Pult, nahm meinen Zettel entgegen
und zeigte auf einen Tisch in der Fensterreihe. Zwei genervte Schüler
einer höheren Klasse hingen hinten im Klassenzimmer auf ihren
Stühlen, ihre langen Beine ragten in den Gang. Ich setzte mich,
schlug die Beine übereinander und hoffte, klein und brav zu wirken.
Wenige Sekunden später ging die Tür erneut auf, und wenn ich
einen Kaugummi im Mund gehabt hätte, ich hätte ihn vor Schreck
verschluckt. Clock kam herein. Sein schwarzer Trenchcoat wehte
hinter ihm her wie ein Umhang. Er warf seinen rosa Zettel auf das
92/254

Pult des grauhaarigen Lehrers, ohne ihn anzusehen, und ließ sich am
Tisch neben mir nieder, als hätten wir uns hier verabredet.
»Was ist denn jetzt los, Emo? Hast du Nachsitzen gekriegt, weil du
deinen Freund im Gang angebaggert hast?«, fragte er, das Gesicht
ganz nah an meinem. Sein Atem roch nach einer Mischung aus Chips
und Zahnpasta.
»Ausgeschlossen, Daniel«, protestierte der grauhaarige Mann und
erhob sich. »Sonnenbrille runter, und dann setzt du dich bitte hier an
diesen Tisch.« Er zeigte auf einen Platz zwei Reihen von mir entfernt.
Mit beiden Händen stemmte sich Clock von seinem Tisch in die
Höhe. Er polterte durch den Gang und ließ sich mit der gleichen
Dramatik am angewiesenen Tisch nieder.
Der Lehrer mit dem spitzen Kinn verdrehte die Augen. »Okay, die
halbe Stunde Nachsitzen beginnt jetzt. Kein Essen, keine Briefchen,
keine Handys, kein Kaugummi, kein Früher-gehen-Wollen, keine
Fragen, keine Laptops, keine Zeitschriften. Ihr könnt zwei Bücher
und ein Heft auf dem Tisch liegen haben. Und los.«
Clock war wohl ziemlich regelmäßig hier, denn er sprach die An-
weisungen des Lehrers lautlos mit. Der bemerkte es aber nicht. Oder
es war ihm egal. Er setzte sich wieder an sein Pult und tat, was Lehr-
er so tun, wenn sie gezwungen sind, länger in der Schule zu bleiben.
Die beiden Jungen in der letzten Reihe befanden sich offenbar in ein-
er Art Halbschlaf, wenn nicht sogar im Koma. Sie machten keine An-
stalten, irgendwelche Bücher herauszuholen.
Clock begann mir Zeichen zu machen. Er gestikulierte wild herum,
aber ich wusste nicht, ob er mich bewegen wollte, mit ihm aus dem
Nachsitzen zu fliehen, oder ob er irgendwelche sexuellen Sch-
weinereien andeutete. Wie auch immer – ich sah weg und versuchte
ihn zu ignorieren.
93/254
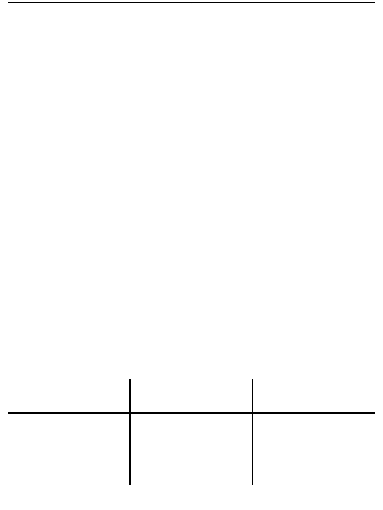
Ich holte meinen Bibliotheksband und mein Notizbuch aus meiner
Tasche.
Die Regenwürmer bilden die größte Gruppe in der Ordnung der
Wenigborster (Oligochaeta) und gehören zum Stamm der Ringel-
würmer (Annelida). Regenwürmer spielen eine wesentliche Rolle
bei der Umwandlung organischer Substanzen in nährstoffhalti-
gen Humus und tragen somit zur Erhöhung der Bodenfrucht-
barkeit bei.
Ich versuchte mich auf meine Lektüre zu konzentrieren, aber meine
Gedanken stahlen sich immer wieder aus dem Reich der Regen-
würmer davon. Wie hatte ich Mandy nur vor unserem Lehrer so
beschimpfen können? Ich hörte geradezu, wie Sandy und Mandy
lachten und sich gegenseitig beglückwünschten, dass es ihnen gelun-
gen war, mir ein Nachsitzen zu verpassen. Wieder einmal hatte ich
sie triumphieren lassen! Warum ließ ich zu, dass mich meine Fre-
undschaft mit Drake von meiner eigentlichen Absicht, dem eigent-
lichen Grund, warum ich Tag für Tag in die Schule ging, ablenkte?
Ich brauchte einen Plan, eine List, ein präzises Drehbuch für meine
Rache!
Ich schlug meine Kladde auf und setzte mein Brainstorming fort.
Art der Rache
Pro
Kontra
Blaue Farbe in
ihre
Shampoo-
flasche füllen
Zwar
kein
dauerhafter
Schaden,
aber
Schuss
kann
nach hinten los-
gehen, wenn sie
94/254
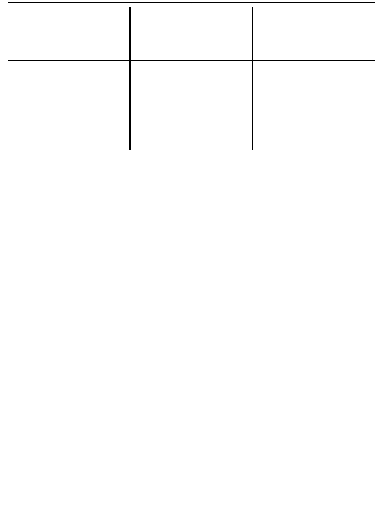
für
alle
Welt
unübersehbar
cool
damit
aussieht
Gerücht
ver-
breiten, sie sei
mit
Clock
zusammen
SEHR peinlich
Nicht
sehr
glaubwürdig,
würde sich nicht
durchsetzen
Meine Rache sollte ein Akt der ausgleichenden Gerechtigkeit sein
und das wiedergutmachen, was Sandy und Mandy mir in der achten
Klasse angetan hatten. Die ganze Schule sollte merken, dass Sandy
nichts weiter war als eine erbärmliche soziale Aufsteigerin, die kein-
en Funken Coolness zu bieten hatte. Aber es wollte einfach nicht
klick machen. Und so schrieb ich wieder mal ein Gedicht.
HERSHEY HIGH ALS KÖRPER
Der Gong pumpt wie ein müder Herzschlag
Schüler durch die Gänge, deine Adern.
Deine Cafeteria knurrt und deine Türen schließen sich
nachts, wenn du schläfst, wie Augenlider.
Wovon träumst du, Highschool?
Träumst du, du wärst ein Krankenhaus,
das uns mit seinen Bücher-Monitoren am Leben hält?
Dein Basketballspielfeld wäre die Notaufnahme?
Wenn ich im Korridor stolpere,
verteilen sich meine Bücher über den Boden wie Kotze,
du wünschst, du könntest deine Arme aus Mörtel
95/254

aus der Erde recken und mir aufhelfen.
Aber du kannst mir nicht helfen. Niemand kann das.
96/254

17
Als das Nachsitzen vorbei war, ging ich allein nach Hause. So wird es
sich anfühlen, wenn Drake weg ist, dachte ich. Einsam. Das Haus
war leer, als ich die Tür öffnete, und über allem lag eine dicke Schicht
Stille. Ich erledigte meine Hausaufgaben, nur den Aufsatz über ›We
Real Cool‹ für Mr Pearson schob ich auf. Ich hatte zu dem Thema
schon ein Gedicht geschrieben. Damit hätte er zufrieden sein sollen.
Als ich am Mittwochmorgen zu unserem Treffpunkt im Park kam,
sah ich mit Schrecken, dass Drake schon da war. Er saß auf der
Schaukel und hatte ein Buch im Schoß. Sein Kopf lehnte gegen die
Kette, sein Skateboard lag auf dem Boden.
»Hallo«, sagte ich und stellte mich neben die Schaukel.
Er fuhr auf. »Whoa«, machte er und sah mich an. »Ich glaube, ich
bin eingeschlafen.«
»Weißt du nicht, dass der Kaffee am Morgen die wichtigste
Mahlzeit des Tages ist?«
»Ich habe letzte Nacht kaum geschlafen.« Er schlug sein Buch zu.
»Weil ich so lange gelesen habe.«
Ich sah, dass es das Buch mit dem weiß-roten Umschlag war, das
er sich aus der Bücherei geliehen hatte.
Drake stand auf, gähnte und reckte die Arme weit über den Kopf.
»Meine Mom sagt, ich darf nicht mehr mit dir zusammen zur Schule
gehen, nachdem du jetzt straffällig geworden bist.«

»Zum Glück lebt sie in einem anderen Bundesstaat«, gab ich
zurück. »Sie wird es also nicht mitbekommen.«
Obwohl er müde war, wirkte Drake so glücklich, wie ich ihn seit
seiner Rückkehr aus New York nicht mehr gesehen hatte.
»Hast du was von Japhy gehört?«, erkundigte ich mich, als wir
Richtung Schule gingen.
»Ich habe ihm zwei E-Mails und fünf SMS geschickt und einmal
versucht anzurufen, und er hat kein einziges Mal reagiert«, antwor-
tete Drake und ein Schatten huschte über sein Gesicht. »Aber ich bin
optimistischer«, fuhr er geheimnisvoll fort. »Kommst du nach der
Schule zu mir?«
»Kann nicht. Meine Mutter hat heute frei. Sie arbeitet so viel, und
wenn sie freihat, sagt sie, will sie den Nachmittag mit mir
verbringen.«
»Und morgen?«
»Klar.«
»Ich will was mit dir bereden.«
»Was denn?«
»Sag ich dir dann.«
***
An diesem Morgen spießte ich im Englischunterricht hinter Sandy
mit meinem spitzen Bleistift jedes einzelne blonde Haar auf, das auf
meinen Tisch fiel. Ich ignorierte dabei Mr Pearsons Ausführungen
zum Thema »verantwortungsbewusstes Lernen« und widmete mich
wieder meinem Brainstorming.
Art der Rache
Pro
Kontra
98/254
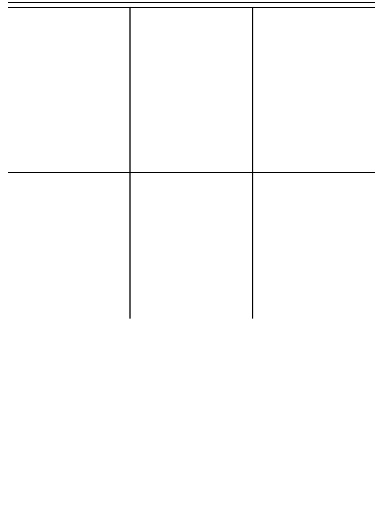
Durch den Lüf-
tungsschlitz
Drogen in ihren
Spind
werfen
und dem Direkt-
or erzählen, dass
sie eine Dealerin
ist
Selbst wenn alle
davon erfahren
– ist nicht so
richtig
erniedrigend
Wo
bekommt
man Drogen?
Klassen-
arbeitslösungen
in ihr Notizbuch
schmuggeln und
sie
beschuldi-
gen,
dass
sie
bescheißt
Durchaus pein-
lich & könnte sie
echt in Schwi-
erigkeiten
bringen
Ich gelte als Pet-
ze & woher soll
ich
überhaupt
die
Lösungen
kriegen?
Erst als ich nach dem Unterricht bei meinem Spind auf Drake war-
tete, zog an diesem ansonsten ruhigen Mittwoch Sturm auf. Drake
kam den Gang entlang und an seinem Arm hing Sandy wie eine Boa
constrictor. Ich wusste zwar, dass sie gemeinsam Spanisch hatten,
aber seit ich in der vergangenen Woche beobachtet hatte, wie sie
miteinander flüsterten, hatte ich sie nicht mehr zusammen gesehen.
Jetzt kamen sie im Gleichschritt und einander tief in die Augen
blickend auf mich zu.
Das schwarze Loch in meiner Brust öffnete sich. Ich bekam einen
Geschmack in den Mund, als hätte ich gerade eine Batterie geküsst.
99/254

Ich riss mich von ihrem Anblick los und stierte auf das Mathebuch,
das in meinem Spind lag.
»Hallo, Hermine«, sagte Drake aufgekratzt. »Versuchst du wieder
mal, mit deinem Wissen einen bösen Fluch zu knacken?«
Ich drehte mich um. Im Hoheitsgebiet meines Spinds stand Drake,
eingehakt bei der Wölfin im Schafspelz namens Sandy. Es gelang mir
nicht schnell genug, meine Finsternis herbeizubeschwören, und so
konnte ich die beiden nur anstarren.
Ȇbrigens, ich kann heute nicht mit dir nach Hause gehen, weil ich
mit Sandy noch Spanischhausaufgaben machen muss«, sagte Drake
wie nebenbei. Er machte seinen Arm von ihrem los und schob seine
Hand in die Hosentasche. Sandy tat es ihm widerstrebend nach.
»Hi, Celia«, sagte sie mit einem Grinsen.
»Alles klar, Drake«, erwiderte ich und ignorierte Sandy. »Aber es
ist nicht so, dass du dich bei mir abmelden musst.«
Drake fiel vor Verblüffung die Kinnlade herunter. »Ach so, ja«,
sagte er schließlich. »Ich wollte nur … dass du Bescheid weißt. Wir
sehen uns dann.«
Sie gingen den Gang hinunter in Richtung Haupteingang. »Tschüs,
Celia«, rief Sandy noch, ohne sich nach mir umzudrehen.
Ich starrte in meinen Spind und betete, dass ich genügend Fin-
sternis besaß, um nicht in der Schule loszuheulen. Ich kniff die Au-
gen zu und versuchte, meinen Herzschlag zu beruhigen. In diesem
Moment spürte ich eine Hand auf meiner Schulter.
»Ist es okay, wenn ich dich später anrufe?«, fragte Drake. »Da gibt
es etwas, das ich wirklich gern mit dir besprechen möchte.«
Ich drehte mich ein wenig um und sah, dass er allein war. Sandy
stand am Ende des Flurs. Er war noch mal zurückgekommen, um mit
mir zu reden.
100/254

Ich zuckte die Schultern und starrte wieder auf mein Mathebuch.
»Wie du willst.« Ich weinte nicht.
»Okay, dann rufe ich dich nachher an«, sagte Drake und ging
davon.
101/254

18
Zu Hause angekommen, winkte ich Mom, die am Telefon war, kurz
zu und ging in mein Zimmer. Mein Herz drohte, gleich aus meiner
Brust zu springen. Offenbar plante Sandy, mir Drake auszuspannen,
mir das Einzige zu nehmen, das ich hatte. So viel war klar. Aber was
war mit Drake?
War er wirklich so naiv? Glaubte er tatsächlich, dass es Sandy nur
um eine Arbeitsgemeinschaft in Spanisch ging? Aber normalerweise
hakt man sich doch nicht gleich bei jedem unter, mit dem man Span-
ischhausaufgaben macht! Wahrscheinlich würde Drake nicht länger
als einen Monat an der Schule bleiben. Aber vielleicht wollte er in der
Zeit trotzdem coolere Leute kennenlernen. Und vielleicht überlegte
er, nachdem die Sache mit Japhy nun vorbei war, doch hierzubleiben
und sich einer angesagteren Clique anzuschließen. Ob er jetzt gerade
irgendwo mit Sandy zusammensaß und ihr alles von Japhy erzählte,
ihr sein Coming-out gestand, sich ihr anvertraute?
Ich lief hin und her in meinem Zimmer – soweit das Chaos dies
eben zuließ. Drei Schritte, umdrehen, drei Schritte, umdrehen. Dann
zog ich mein Notizbuch aus meinem Rucksack und warf mich aufs
Bett. Ich kritzelte weitere Rachepläne aufs Papier und kümmerte
mich dieses Mal nicht um die Pros und Kontras.
Art der Rache
Pro
Kontra
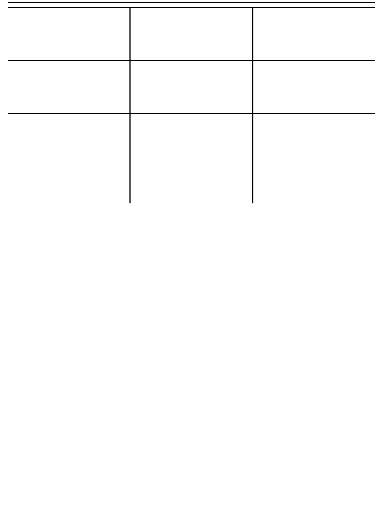
Abführmittel im
Mittagessen
Tote Katzen in
ihrem Spind
Beim Schulball
einen
Eimer
Farbe über ihren
Kopf kippen
»Celia?«, hallte Moms Stimme durch die Diele.
»Ja?«, rief ich zurück.
»Kommst du bitte und hilfst mir mit dem Abendessen?«
»Ich kann gerade nicht.«
»Du hast nachher genug Zeit zum Essen, also wirst du auch genug
Zeit haben, mir jetzt beim Kochen zu helfen.«
Ich schlug mein Notizbuch zu und stapfte in die Küche.
»Kümmerst du dich bitte um die Soße, bis ich draußen im Garten
den Schlauch abgedreht habe? Gestern habe ich ihn vergessen«,
sagte sie und reichte mir den Kochlöffel.
»Typisch«, murmelte ich.
»Was meinst du?«
»Nichts.«
Genervt rührte ich mit dem Kochlöffel im Topf herum, sodass
Spritzer der dünnen Soße zischend auf dem Herd landeten. Kaum
hatte meine Mutter die Fliegengittertür geöffnet und war im Garten
103/254

verschwunden, klingelte im Esszimmer das Telefon. Ich ließ den
Kochlöffel in der Soße treiben und rannte hin.
»Drake?«
»Äh, hallo. Ist … Gina da?« Die Stimme klang verwirrt. Es war der
Mann, der schon einmal angerufen hatte. Simon.
Ich spähte durch das Fenster in den Garten und sah, wie meine
Mutter den Hahn des Gartenschlauchs zudrehte. Dann knallte ich
den Hörer auf die Gabel. Pech gehabt, Simon! Danach nahm ich den
Hörer wieder ab, vergewisserte mich, dass das Freizeichen zu hören
war, und legte ihn neben das Telefon. Wer jetzt anrief, bekam das Be-
setztzeichen. Ich hatte keine Lust auf einen Anruf von Simon. Und
auch nicht von Drake. Wenn er Sandy so gern mag, dann soll er sie
doch behalten!, dachte ich finster.
Ich schloss die Esszimmertür und rettete die Soße vor dem Ver-
brennen. Als meine Mom wieder durch die Fliegentür trat, rührte ich
energisch um.
»Der Boden ist ein bisschen matschig, aber immerhin hat es keine
Überschwemmung gegeben.« Sie strich sich mit dem Handrücken
das Haar aus der Stirn. »Hat das Telefon geklingelt?«
»Ja«, rühr, rühr, rühr, »es war«, rasch eine Lüge ausdenken,
»mein Freund Drake.«
»Der neue Freund. Ein Junge. Sollte ich mehr wissen?«
»Er ist einfach nur ein Freund. Nichts Besonderes.«
Mom sah mich an, während sie am Spülbecken ihre Hände wusch.
»Ich finde, Freunde sind immer etwas Besonderes«, sagte sie. Seit
Mom im Juli mit ihrer Therapie angefangen hat, gibt sie öfter so
bekloppte Sprüche von sich.
***
104/254

Nach dem Essen erklärte ich meiner Mutter, ich hätte noch
Hausaufgaben zu machen, und verschwand in meinem Zimmer. Kurz
darauf hatte sie wohl gemerkt, dass der Hörer neben dem Telefon
lag, denn ich hörte sie sprechen. Hoffentlich nicht mit Simon, der ihr
verriet, dass ich aufgelegt hatte! In meinem Posteingang waren keine
neuen E-Mails, und so war ich gezwungen, mich mit Mathe abzu-
lenken. Über eine Stunde lag ich auf dem Bett und meine Gedanken
pendelten zwischen Hausaufgaben und Racheplänen hin und her.
Ob es Sandy gelungen war, Drake auf ihre Seite zu ziehen? Wie
lautete der Satz des Pythagoras gleich noch mal? Ob sie irgendwann
einmal genug davon hatte, mein Leben zu ruinieren? Zeichne ein
gleichschenkeliges Dreieck. Ob mir irgendwann eine richtig gute Idee
kam, wie ich ihres ruinieren konnte? Wie berechnet man einen Kreis-
durchmesser? Irgendwann legte ich den Kopf auf mein Kissen und
war eine Sekunde später weg. Ich lag immer noch in Klamotten auf
meinem Bett, als mich ein Geräusch am Fenster aufschreckte.
Keuchend setzte ich mich auf. Im Blumenbeet unter meinem Fen-
ster stand jemand und sah zu mir herein. Es war Drake. Der Wecker
auf meinem Nachttischchen zeigte 22 Uhr 32. Ich stand auf und rieb
mir die Augen.
»Weißt du, dass es immer die Mörder sind, die im Blumenbeet
stehen und ans Fenster klopfen?«, zischte ich Drake durch das Flie-
gengitter zu, nachdem ich das Fenster geöffnet hatte.
»Oder die Zombies«, entgegnete er und stützte sich mit den Ellbo-
gen auf das Fensterbrett. »Ich habe ungefähr zweitausend Mal an-
gerufen. Schon mal was von der Anklopf-Funktion gehört?«
»Darauf reagiert Mom nie«, erklärte ich und erwähnte nicht weit-
er, dass der Hörer neben dem Telefon gelegen hatte.
105/254

Ich musterte ihn, wie er behutsam zwischen den Chrysanthemen
meiner Mutter stand. Ich war misstrauisch, weil er mit Sandy geredet
hatte, worüber auch immer. Aber ich freute mich auch, ihn zu sehen.
Ich öffnete das Fliegengitter und reichte ihm eine Hand, um ihm
hereinzuhelfen.
»Ich wollte so spät nicht mehr läuten, wegen deiner Mutter«, sagte
Drake, sobald er im Zimmer war, und ließ sich auf mein Bett
plumpsen. »Aber ich konnte nicht mehr bis morgen warten.«
»Ach.« Konnte er es nicht mehr erwarten, mir zu berichten, dass er
eine neue gute Freundin namens Sandy Firestone hatte?
»Ich konnte nicht mehr warten, dir … davon zu erzählen«, sagte er
und holte das Buch mit dem rot-weißen Umschlag, das er sich aus
der Bücherei entliehen hatte, aus seinem Rucksack.
»Du liest ein Buch?«, fragte ich einigermaßen desinteressiert.
»Es ist nicht einfach ein Buch, Celia«, entgegnete Drake und
strahlte wie ein Glühwürmchen. »Dieses Buch ändert dein Leben.«
Ich ging zur Tür und lauschte, ob meine Mutter noch wach war. Bei
ihren verrückten Arbeitsplänen ging sie zu unregelmäßigen Zeiten
schlafen. Ich wusste nicht, ob ich Schwierigkeiten bekommen würde,
wenn sie merkte, dass ich um diese Zeit noch Besuch von einem Jun-
gen hatte. Bislang hatte noch nie ein Junge an mein Fenster geklopft,
weder am Tag noch in der Nacht.
Ich hörte nichts und ging zu meinem Bett zurück, wo Drake mit
dem Buch saß. Ich setzte mich und er reichte es mir. In metallisch
blauen Buchstaben prangte der Titel auf dem Cover: ›Lebe deinen
Traum!‹
Nachdem mein Vater ausgezogen war, hatte meine Mutter den
Sommer über jede Menge Ratgeber gelesen. Ich war also an die »Du
schaffst es!«-Sprache gewöhnt und reagierte zunehmend allergisch
106/254
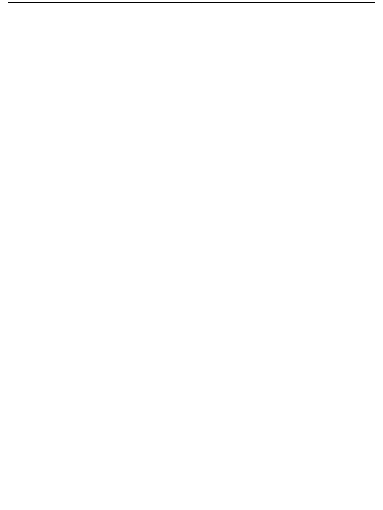
auf diese Art von Büchern. Es fiel mir äußerst schwer, nicht die Au-
gen zu verdrehen, wenn bei mir zu Hause von »positivem Denken«
die Rede war.
»Als ich aus New York zurückkam, war ich erst einmal sehr
traurig«, sagte Drake. Er zog seine Schuhe aus und warf sie in die
Ecke meines Zimmers, wo sich schon meine Schuhe stapelten. »Ich
dachte, alles wäre vorbei. Ich hatte keine Hoffnung mehr.«
»Du sprichst von gestern?«, wandte ich ein, aber Drake überhörte
den Sarkasmus in meiner Bemerkung. Ich warf das Buch neben mich
aufs Bett.
»Ja. Gestern.« Er machte eine Geste, als hätte ich ein gutes Argu-
ment vorgebracht. »Ich war total fertig und deprimiert. Ich habe
überhaupt nicht mehr gesehen, was wirklich wichtig ist.« Er schlug
die Beine übereinander und sah mich an. Ich wich seinem Blick aus,
starrte stattdessen auf meinen Computer. »Ich weiß, dass das für
dich wahrscheinlich ziemlich schräg klingt, oder spooky, typisch New
York eben, aber versprich mir, dass du es dir wenigstens anhörst!«
»Glaubst du etwa, wir Landeier können mit was Abgehobenem
nichts anfangen?«, sagte ich zu meinem Computerbildschirm.
»Was? Nein, Celia.« Drake nahm meine Hände und drehte mich zu
sich um. »Ich meine, ich weiß ja, dass das vielleicht komisch klingt,
aber ich muss dir unbedingt davon erzählen.«
Dass Drake so darauf brannte, mir etwas zu sagen, stimmte mich
etwas milder. Vielleicht war die Sache mit Sandy tatsächlich bedeu-
tungslos. Vielleicht ging es doch nur um eine Hausaufgabe in Span-
isch und ich hatte komplett überreagiert.
»Das Buch ist … ich weiß nicht, es spricht mich einfach an«, sagte
Drake. Er nahm es wieder in die Hand und drehte und wendete es
ein paarmal. »Es … es steht zwar nichts drin, was ich nicht schon
107/254

weiß, aber alles ist in einer Weise geschrieben, dass ich es echt ver-
stehe. Hör dir nur mal die Einleitung an. Dann kannst du ja
entscheiden, ob du die Übungen mit mir machen willst. Versprich
mir nur, dass du offen drangehst, okay?«
»Drake, ich muss dich etwas fragen.« Ich hielt es nicht mehr aus.
Ich musste wissen, was er und Sandy zusammen gemacht hatten.
»Ich weiß … ich weiß, dass du Fragen hast, aber lass mich zuerst
die Einleitung vorlesen. Bitte.«
»Aber da gibt es etwas, das ich wirklich wissen muss …«
»Nur die Einleitung, mehr will ich ja gar nicht.«
Widerwillig setzte ich mich ans andere Ende meines Bettes und
legte die Beine übereinander. Drake schlug das Buch auf, als
entsiegelte er ein Pharaonengrab. Ich schloss die Augen und ver-
suchte, offen dranzugehen, oder was auch immer.
Einleitung: Der Traum als Mittel und Ziel
Die meisten Menschen belassen es dabei, sich mit den Umständen,
in denen sie leben, zu arrangieren. Sie glauben, nicht mehr er-
reichen zu können, als die äußere Situation zulässt. Hallo, ich bin
Buddy Strong und in meinem Buch ›Lebe deinen Traum!‹ werde
ich dir zeigen, wie deine schönsten Träume wahr werden können!
In den folgenden sechs Kapiteln wirst du erkennen lernen, wovon
du überhaupt träumst und wie sich deine Träume realisieren
lassen. Ich werde dich auf dieser geheimnisvollen und gleichzeitig
lebensnahen Reise begleiten – dorthin, wo du dein Dasein gestal-
ten kannst. Du wirst alles bekommen, wonach du dich sehnst,
wenn du nur deinen Traum lebst!
108/254

Drake hob den Kopf und lächelte. Er sah aus wie ein Kind in einer
Zaubervorstellung. »Und?«, fragte er, während er das Buch schloss.
Ich fand, es klang genauso wie ›Lebenskrisen bewältigen‹ und ›In
der Mitte des Lebens: Was wirklich zählt‹ – Bücher, die Mom auf
dem Couchtisch liegen hatte. Aber Drake sah so viel glücklicher aus
als in den vergangenen beiden Tagen, und darüber war ich froh.
»Klingt … cool«, brachte ich hervor, obwohl es finster in mir war.
»Okay, dann les ich noch ein bisschen weiter.« Er schlug das Buch
wieder auf und blätterte ein paar Seiten vor. »Das ist die erste
Aufgabe.«
»Warte mal, ich muss dich wirklich was fragen.«
»Okay, was denn?«
Jetzt, wo er mir zuhörte, fühlte ich mich plötzlich unbehaglich und
verletzlich. Es konnte vereinnahmend und klammernd wirken, wenn
ich mich nach Sandy erkundigte. »Hast du die Hausaufgaben in
Erdkunde gemacht?«
»Ja, während ich versucht habe, dich anzurufen. Kannst du abs-
chreiben«, antwortete er herablassend. »Darf ich jetzt weiter
vorlesen?«
Ich nickte.
Kapitel eins: Sprich über deine Träume!
Wenn du deine Träume wahr werden lassen willst, dann besteht
der erste Schritt darin, sie auszusprechen. Viel zu oft formulieren
wir unsere Träume nur in einer Art innerem Monolog. Und ohne
es zu merken, liefern wir uns dann dauernd Argumente, warum
etwas nicht funktionieren kann. Das erste Kapitel wird dir helfen,
dir selbst und anderen zu vermitteln, warum es sehr wohl funk-
tionieren wird!
109/254
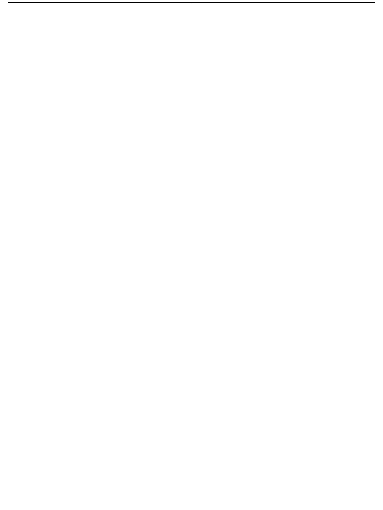
Bevor du deine Träume visualisieren kannst, musst du sie formu-
lieren. Die erste Aufgabe ist daher einfach: Erzähl anderen von
deinem Traum, und zwar so lebendig und klar wie nur möglich.
Mit lauter, fester Stimme.
Drake sah wieder zu mir. »Als ich mit ›Lebe deinen Traum!‹ ange-
fangen habe, merkte ich, dass etwas mit mir passierte. Bislang kam
es mir vor, als wäre die Sache mit Japhy in die Hose gegangen. Aber
wenn ich’s mir genau überlege, dann hat er mich doch geküsst. Das
war echt! Vielleicht hat er einfach Angst zuzugeben, dass er sich zu
mir hingezogen fühlt. Was in unserer schwulenfeindlichen Gesell-
schaft total verständlich ist.« Während er redete, rutschte Drake auf
meinem Bett hin und her. Dann stand er auf und ging zum Fenster.
»Für viele Leute ist das Coming-out echt schwer.«
Ich wollte Drake wirklich zuhören und mich für sein Buch und
seine Geschichte mit Japhy interessieren. Aber die Finsternis in mir
hatte mich fest im Griff. Ich hielt es nicht länger aus.
»Wie läuft’s mit eurer Spanischhausaufgabe?«, platzte ich heraus.
»Oh, äh, die Spanischhausaufgabe … Ich muss dir was sagen.«
Drake starrte noch immer zum Fenster hinaus. »Diese Sandy ist seit
der ersten Stunde meine Partnerin in der Dialoggruppe und wir
haben schon viel geredet«, erzählte er. »Auf Spanisch. Also Fragen
wie ¿Cómo está usted?. So in der Art. Aber dann fing sie an, mir an-
dere Fragen zu stellen. Wie lange ich in Hershey bleibe, ob ich in
New York eine Freundin habe und ob ich jedes Wochenende nach
Hause fahre.«
Allein die Vorstellung, dass Sandy sich mit Drake unterhalten
hatte, machte mich so wütend, dass ich meine Hände zu Fäusten
ballte.
110/254

»Ich bin in Spanisch krass schlecht und ich kenne sie kaum, also
war ich ziemlich kurz angebunden: Einen Monat. Keine Freundin.
Keine Wochenenden mehr zu Hause. Aber heute nach der Schule, als
wir an unserem Essay über Barcelona gearbeitet haben, sagte sie:
›Drake, du bist doch neu an der Schule und hast noch keine Freunde
hier. Und deshalb dachte ich, es wäre schön, wenn du mit mir zum
Schulball gehen würdest. Du könntest eine Menge neuer Leute
kennenlernen und hättest wenigstens eine gute Erinnerung an Her-
shey.‹ Ist das nicht superkomisch?«, schloss Drake und drehte sich
zu mir um.
Vielleicht bin ich nicht witzig genug, aber ich fand das kein bis-
schen komisch. Sandy lud Drake zum Schulball ein! Sandy sagte zu
Drake, er solle wenigstens eine gute Erinnerung an Hershey haben.
Ich war so fassungslos, dass ich fast ohnmächtig geworden und vom
Bett gefallen wäre.
»Ich hatte ja schon gesagt, dass ich am Wochenende in Hershey
bin und dass ich keine Freundin habe. Ich hatte also keine Ausrede.«
Der Tunnel um mich herum wurde immer enger. Drake hatte
zugesagt? Würde er mir gleich erzählen, dass er tatsächlich mit mein-
er Erzfeindin zum Schulball ging?
»Ich hoffe, du bist jetzt nicht sauer, aber ich habe ihr gesagt, dass
ich nicht mit ihr zum Ball gehen kann, weil ich schon mit dir gehe.«
Ich saß auf meinem Bett und war noch bei Bewusstsein. Mein Kopf
schlug nicht auf dem Teppich auf.
»Ich weiß, es ist doof, dich als Ausrede zu benutzen. Vielleicht
wolltest du ja jemand anderen fragen. Oder du hasst langweilige
Schulbälle. Wir müssen auch nicht hingehen«, schloss Drake. »Es
war nur das Einzige, was mir noch eingefallen ist.«
111/254
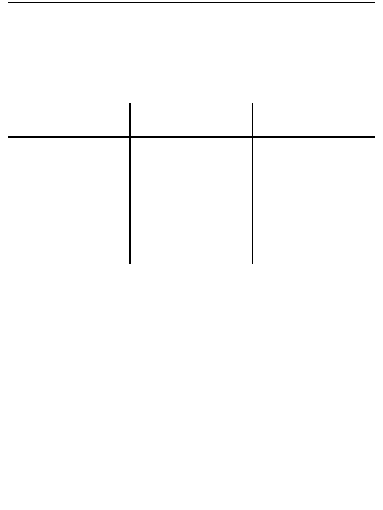
Mein Hirn versuchte zu folgen. Das war keine schlechte Nachricht.
Im Gegenteil, das war die beste Nachricht überhaupt! Nicht nur, dass
Drake nicht an Sandy interessiert war und weder mit ihr befreundet
sein noch mit ihr zum Schulball gehen wollte, er hatte mir auch noch
die perfekte Kulisse für meine Rache geliefert!
Art der Rache
Pro
Kontra
In der Schule
herumerzählen,
dass Drake nicht
mit Sandy zum
Schulball
geht,
sondern mit mir
Erniedrigend &
alle kriegen es
mit; zeigt Sandy
und allen ander-
en,
dass
ich
cooler bin als sie
»Bist du sauer?«, fragte Drake.
»Nein, Quatsch.«
»Lesen wir weiter?« Er hob das Buch in die Höhe.
»Ja«, antwortete ich und meine Stimme klang so weit entfernt, als
säße ich in einem Zeppelin, der gerade über unser Haus schwebte.
»Super!«, sagte Drake und setzte sich neben mich aufs Bett.
»Buddy Strong empfiehlt, mit der ersten Aufgabe anzufangen, sobald
man diese Anleitung gelesen hat. Wir müssen uns also jetzt unsere
Träume erzählen. Und mach dir keine Sorgen, wenn du noch nicht
weißt, was du dir wünschst. Trau deinem Unterbewusstsein. Es wird
schon damit herausrücken, wovon du träumst, okay?«
Ich nickte.
112/254

»Ich zähle bis drei und dann sagen wir beide gleichzeitig, was wir
uns am allermeisten wünschen, okay?«
Ich nickte wieder.
»Bereit?«
Drittes Nicken.
»Eins … zwei … drei.« Und Drake fügte hinzu: »Dass ich mit Japhy
zusammenkomme.«
Ich nahm die erstbeste Lüge, die mein Unterbewusstsein hervor-
brachte. »Dass ich eine erfolgreiche Dichterin werde«, sagte ich. In
meinem Bewusstsein aber war es ein ganz anderer Traum, den ich
laut und deutlich formulierte: Mich endlich rächen zu können!
113/254

19
Der nächste Tag war ein Donnerstag. Wir gingen jetzt seit zwei
Wochen auf die Highschool, aber es fühlte sich an, als wären es schon
zwei Jahre. Auf dem Schulweg lief ich leichtfüßig neben Drake her,
noch immer berauscht von der guten Nachricht zum Thema Sandy.
Ich malte mir gerade aus, wie ich beim Schulball Rache nahm, als
Drake mir ein Geschenk überreichte – eine Bestärkung meines
Traums für meinen Spind. Er hatte in Comic-Art ein Bild von mir
gezeichnet, als Autorenfoto in einer Buchklappe. Und darunter
stand:
Celia Door - Bestseller-Dichterin
»In Kapitel drei empfiehlt Buddy Strong, sich selbst Mut zuzus-
prechen«, erzählte Drake und rollte langsam auf seinem Skateboard
den Gehsteig entlang. »Wir sind bald so weit.«
Inzwischen wusste ich, dass man Phrasen wie »Ich schaffe das!«
oder »Ich bin kreativ!« Mutmacher oder Bestärkungen nennt. Als
mein Vater nach Atlanta gezogen war, ging meine Mom zu einem
Therapeuten, der ihr zu solchen Bestärkungen riet. Daraufhin klebte
Mom solche Ermutigungszettel an die Badezimmerwand und jedes
Mal, wenn ich mir die Zähne putzte, las ich »Ich bin liebenswert«
oder »Alles wird gut«. Es wurden immer mehr, bis ich mich beim
Kämmen mit einem winzigen Viereck begnügen musste, das am
Spiegel noch frei war.

»Sieht mir total ähnlich«, stellte ich fest.
»Ja, ich zeichne echt gern. Gerade sitze ich an einem Comic. Er
heißt ›BlackJack‹.«
»Und worum geht’s da?«
»Ein Junge namens Jack schreibt gerade an der Highschool einen
Mathetest, als er merkt, dass er die Fähigkeit besitzt, Gedanken zu
lesen. Hals über Kopf fährt er nach Monte Carlo, wo er im Casino
Karten spielt, die Gedanken seiner Mitspieler liest und Millionen
gewinnt. Aber das Geld macht ihn nicht glücklich. Er beschließt, mit
dem vielen Geld und seinen Fähigkeiten den Kampf gegen die
Kriminalität aufzunehmen. Jack kämpft gegen seine eigenen Dämon-
en an, denn seine ganze Familie ist bei einem Bootsunfall gestorben,
nur er wurde an die Küste gespült.«
Ich hielt die Zeichnung wie ein kostbares Stück alter Kunst in
meinen Händen. »Ich sollte dir auch so etwas machen.«
»Ich bin nicht sicher, ob ich schon so weit bin, dass ich eine Zeich-
nung von Japhy und mir an meinem Spind hängen haben möchte«,
entgegnete Drake und verdrehte die Augen. »Warum müssen
Heteros eigentlich kein Coming-out durchmachen? Ich wünschte,
jeder würde mal erfahren, wie es sich anfühlt, wenn man vor aller
Welt so eine peinliche Erklärung darüber abgeben muss, zu wem
man sich hingezogen fühlt. Wenn Japhy und ich zusammenkommen,
dann gibt es einen Grund, darüber zu reden. Ich sage lieber: ›Hey,
hört mal alle her, das hier ist mein Freund‹ als: ›Hey, hört mal alle
her, ich bin schwul, hat jemand Lust, mit mir auszugehen?‹«
»Wenn Japhy schwul ist, dann braucht er wohl noch etwas Zeit bis
zu seinem Coming-out. Bist du sicher, dass ihr wirklich gleich ein
Paar werden wollt?«, fragte ich.
115/254

Drake stoppte sein Skateboard. Wir waren nur noch einen
Häuserblock von der Schule entfernt. Er sah mich ungläubig an.
»Warum sagst du so was?«
»Na ja, es ist ja nicht so besonders gut gelaufen, als du versucht
hast, ihm zu sagen …«
»Celia, ich will solche negativen Gedanken nicht in meinem Leben
haben!«
»Ich meine ja nur, realistisch betrachtet … findest du nicht …«
»Realistisch! Wer die Träume anderer Leute kaputtmacht, indem
er sie als unrealistisch bezeichnet, ist ein Traumkiller, sagt Buddy
Strong. Ich hätte nie gedacht, dass du mein Traumkiller bist.« Drake
sah mich an, als hätte er mich dabei ertappt, wie ich einen Sack
Welpen ertränke.
»Ich meine ja nur, dass es gut wäre, wenn man es zwar versucht,
aber trotzdem vernünftig bleibt …«
»Ich will nicht vernünftig sein! Buddy Strong warnt seine Leser
genau davor: dass andere Menschen versuchen werden, die Seile
ihres Heißluftballons festzuhalten.« Drake schüttelte den Kopf und
schob sein Skateboard wieder an.
»Sorry, ich wollte dir nur helfen, nicht unvernünftig zu sein.«
»Jetzt bin ich also auch noch unvernünftig«, schnaubte Drake.
»Vergiss einfach, dass ich dir überhaupt von dem Buch erzählt
habe!« Er stieß sich energisch ab und war schon einen halben Block
weiter, bevor ich ihm mit ein paar lahmen Schritten zu folgen
versuchte.
»Warte, Drake!«, rief ich, aber er war schon in einer Gruppe von
Schülern untergetaucht, die Richtung Schultor drängte.
Es war wohl der ungünstigste Moment, in dem Clock auftauchen
konnte.
116/254

»Liebeskummer?«, hörte ich seine Stimme von hinten. Ich wir-
belte herum und sah mir selbst in seiner verspiegelten Sonnenbrille
entgegen. Sein dunkles Haar reichte bis zu seinen Schultern und
strich über den Kragen seines Trenchcoats.
Mürrisch funkelte ich mich in den Brillengläsern an. »Geh du doch
zum Zirkus, du Freak, und verschwinde endlich aus meinem Leben.«
»Immer mit der Ruhe, Emo, ich wollte dir etwas geben, das du ver-
loren hast. Von deinem Freund?« Clock hielt die Zeichnung in der
Hand, die Drake mir geschenkt hatte. Ich hatte sie wohl verloren, als
ich ihm hinterhergelaufen war. »Hier steht, du bist eine Bestseller-
Dichterin. Ich wette, du hast echt Tiefe.«
Das Wort »Tiefe« raunte er nur und ich wurde krebsrot im
Gesicht. Ich wollte ihm das Papier entreißen, aber er wich mir aus.
»Das gehört mir!«, schrie ich.
»Eine krass gute Werbung für dich als Bestseller-Dichterin«, spot-
tete er. »Ich werd’s aufheben, vielleicht ist es eines Tages mal was
wert, wenn du berühmt bist.« Er wedelte mit dem Papier vor meiner
Nase herum, als würde er mit einer Feder ein Kätzchen ärgern.
»Gib her!«, fauchte ich und griff erneut danach.
In diesem Moment hob er die Arme über den Kopf, sodass ich ge-
gen ihn knallte, als ich ihm das Papier abzunehmen versuchte.
»Hey, nicht grapschen! Ich dachte, du hast einen Freund!«, rief er
laut. Ich trat zurück und sah mich um. Sämtliche Schülerinnen und
Schüler, die Richtung Schule gingen, starrten uns an. Hektisch zog
ich meine Kapuze auf und schlang die Arme um meinen Körper.
In diesem Moment streckte Clock mir die Zeichnung entgegen. Ich
griff so heftig danach, dass sie auseinanderriss. Wütend schnappte
ich nach der anderen Hälfte. »Ich hasse dich!«, knurrte ich. Dann
drehte ich mich um und stapfte davon.
117/254

***
Die ganze erste Schulstunde über hatte ich nicht die geringste
Chance, mich auf den Unterricht zu konzentrieren. Mal hatte ich
Fantasien im Kopf, wie ich Clock umbringen wollte, dann wieder war
ich vollkommen verwirrt wegen Drake. Sandy Firestone fehlte. Zu-
mindest musste ich also nicht noch mit der Herausforderung umge-
hen, sie so nah vor mir zu haben, dass ich ihre Sexuallockstoffe
riechen konnte. Mandy war zwar da, aber sie bemühte sich eifrig, so
zu tun, als existierte ich nicht – was mir nur recht war.
Ich hatte gehofft, mich den Vormittag über daran weiden zu
können, dass Drake Sandy hatte abblitzen lassen. Aber wenn er nicht
mehr mit mir sprach – spielte das dann überhaupt noch eine Rolle?
»Celia, wann bekomme ich deinen überarbeiteten Aufsatz?«,
erkundigte sich Mr Pearson vor der ganzen Klasse. »Ich hatte ihn
gestern erwartet.«
»Morgen«, murmelte ich und spürte, dass alle mich ansahen.
»Nimm die Kapuze ab und sprich deutlich! Wann kann ich mit
deinem Aufsatz rechnen?«
Ich zog die Kapuze herunter. »MOR-GEN.«
»Gut. Ich erwarte, dass du dein Versprechen hältst. Sprechen wir
jetzt über das Thema der Moral in ›Wer die Nachtigall stört‹. Greg,
bitte.«
***
Noch bevor es zur ersten Pause gongte, hatte ich meine eigene moral-
ische Entscheidung getroffen. Ich wollte alles tun, um mich wieder
mit Drake zu vertragen. Selbst wenn das bedeutete, mir heilende
Kristalle um den Hals zu hängen und Buddy Strongs Namen zu
118/254

preisen, während ich um ein Lagerfeuer herumhüpfte und dabei eine
Ausgabe von ›Lebe deinen Traum!‹ auf dem Kopf balancierte. Die
Stunde hatte ich genutzt, um ein Gedicht zu schreiben.
SCHWUR
Wenn die Eier dieses eine Mal noch heil bleiben,
den Gehsteig nicht mit gelben Flecken überziehen,
nicht in den Kaffee und auf meine weißen Schuhe tropfen,
dann werde ich die Einkaufstüte auf dem Weg
nach Hause nie mehr durch die Luft schwingen
und dazu singen und durch die Pfützen springen,
so lange, bis die Tasche gegen mein Bein schlägt
und ich das leise Knacken höre.
Drake sah ich erst in Erdkunde wieder. Er saß bereits auf seinem
Platz zwei Reihen vor mir, als ich ins Klassenzimmer kam, und dre-
hte sich nicht mal um. Während der ganzen Abhandlung über die
Plattentektonik konnte ich darüber nachdenken, ob er noch mein
Freund war. Als es gongte, schleppte ich mich zu seinem Tisch. »Tut
mir leid, wenn ich ein Traumkiller war.«
Drake stopfte seine Bücher in seinen Rucksack und sah mich ernst
an. »Du bist die einzige Freundin, die ich in Hershey habe.« Das Blut
wich aus meinem Körper und wurde durch flüssiges Silber ersetzt.
Wir waren noch Freunde! Er sah auf seine Hände und dann wieder
zu mir. Seine Augen waren feucht und die Augenbrauen hatte er fest
zusammengezogen. »Hältst du mich für verrückt, weil ich daran
glaube, irgendwann mit Japhy zusammenzukommen?«
Mein Herz flatterte heftig in meiner Brust.
119/254

Ich hob drei Finger zum Schwur. »Ich halte dich nicht für verrückt
und werde dir nie wieder deine Träume kaputtmachen.«
Er stand auf. Wir legten einander die Arme um die Schultern und
verließen gemeinsam das Klassenzimmer. Unsere Rucksäcke stießen
gegeneinander, als wir uns durch die Tür quetschten, ohne einander
loszulassen.
120/254

20
Kapitel zwei: Plane dein Glück!
Glückwunsch! Du hast deinem Traum eine Stimme gegeben. Und
jetzt, nachdem du laut ausgesprochen hast, was du verwirklichen
willst, solltest du dich für den Moment rüsten, in dem dein Traum
wahr wird. Vergiss nicht: Das Glück kommt zu denen, die
vorbereitet sind.
Stell eine Liste mit Dingen zusammen, die du gleich heute in An-
griff nehmen kannst und die du für den Moment brauchst, in dem
sich deine größten Hoffnungen erfüllen. Wenn dein Traum zum
Beispiel eine Weltreise ist, dann beantrage einen Reisepass. Wenn
es dein Traum ist, viel Geld zu verdienen, eröffne ein Extra-
Bankkonto dafür. Leg deine Liste nach strategischen Gesicht-
spunkten an und mach dich daran, sie abzuarbeiten.
In der Mittagspause überließ Drake mir sein Exemplar von ›Lebe
deinen Traum!‹ damit ich mit dem zweiten Kapitel anfangen konnte.
Es war ein heißer Septembertag. Dank der globalen Erwärmung wird
es in Pennsylvania immer häufiger möglich, draußen zu essen. Wenn
wir so weitermachen und unbekümmert fossile Brennstoffe ver-
brauchen, können wir vielleicht irgendwann in den Weihnachtsferien
Poolpartys feiern.

»Ich habe schon mal angefangen«, sagte Drake. »Sorry, wenn ich
dir jetzt voraus bin.« Er zog einen Zettel aus der Hosentasche und
reichte ihn mir.
Drakes Plan, mit Japhy zusammenzukommen
1. Mehr Sport machen (Skateboard, Basketball)
2. Neue Klamotten kaufen. Neuer Haarschnitt?
3. Bücher zum Thema Coming-out lesen. Mich auf
"das Gespräch" vorbereiten
4. Mom und Dad bitten, am nächsten Wochen-
ende seine Familie zum Abendessen einzuladen
Ich musste gut überlegen, was ich sagte. Ich durfte auf keinen Fall
wieder zur Traumkillerin werden. »Willst du am Wochenende mit
ihm sprechen?«
»Er meldet sich nicht bei mir, aber wenn meine Eltern seine Eltern
einladen, dann werden sie ihn mitbringen. An diesem Wochenende
packe ich es noch nicht, mit ihm zu reden. Ich brauche noch eine
Woche. Und wenn ich es dann hinkriege, mit ihm allein zu sein, dann
kann er mich nicht einfach ignorieren.« Drake stand auf. »Ich geh
Basketball spielen. Schreib du so lange deine Liste!«
Drake schob den Zettel wieder in seine Hosentasche, während ich
eine neue Seite meines Notizbuchs aufschlug und in großen Buch-
staben, damit er es auch ja lesen konnte, schrieb:
Celias Plan, eine Dichterin zu werden
122/254

Lässig schlenderte Drake auf das Spielfeld. Er ließ sich nicht an-
merken, wie scharf er darauf war, mitzuspielen. In der Pubertät ver-
ändern sich Jungs genauso wie Mädchen. Dabei geht es nicht nur um
körperliche Veränderungen, sondern auch um ihre Persönlichkeit. Ir-
gendwann zwischen der sechsten und neunten Klasse kann man
förmlich riechen, wie das Testosteron ihr Gehirn auffrisst. Und beim
Basketball in der Mittagspause kann man dieses hormonelle Phäno-
men bestens beobachten. Nur zehn Jungs können mitspielen, also
gibt es ein ziemliches Gerangel um die Plätze. Deshalb wird gewählt.
Zunächst treten zwei Jungs als Kapitäne vor. Meistens gehören sie
schon der Schulmannschaft an und sind in ihrer Position unange-
fochten. Sie wählen jeweils vier Spieler.
Ein Schüler aus der Schulmannschaft hat Drake erzählt, dass
Trainer Scott sie aufgefordert hat, in der Mittagspause zu spielen,
damit sie noch mehr Training haben. Deshalb wollen sie gewählt
werden. Auch Joey Gaskill ist jeden Tag da. Er stolziert über das
Feld, von seiner Hüfte baumelt eine Kette, die am Portemonnaie in
seiner Hosentasche befestigt ist. Seit unserem Zusammenstoß an
meinem Spind hat er nicht mehr mit mir gesprochen, aber er starrt
mich immer an, wenn wir uns im Gang sehen.
Drake kommt oft überhaupt erst zum Spielfeld, wenn die Kapitäne
schon feststehen. Während gewählt wird, bleibt er meistens im Hin-
tergrund und gibt sich lässig und gelangweilt, dabei ist er aber immer
unter den ersten drei oder vier Jungen, die gewählt werden. An
diesem Tag suchte sich Clay Applewhite, ein Star in der Schul-
mannschaft, Drake sogar als Ersten aus. Als Clay auf ihn zeigte,
verzog Drake keine Miene. Er lief auch nicht zu seinem Kapitän, wie
das die anderen taten. Er sah nur auf, als wäre er bei einem
123/254

interessanten Gedankengang gestört worden, und schlenderte dann
zu Clay hinüber.
Ich war froh, dass Drake mich allein ließ. So konnte ich mich
meinem wahren Plan widmen. Rache nehmen ist eine diffizile Kunst,
etwa wie ein Bankraub. Da schreibt man ja auch nicht nur eine For-
derung auf einen Zettel und marschiert in die Bank rein. Man muss
wissen, wie man einen Safe knackt, man braucht eine Skimütze und
das Fluchtfahrzeug muss vollgetankt sein.
Nachdem ich nun die perfekte Idee hatte, wie ich Sandy demütigen
konnte, musste ich mir überlegen, wie ich den Schülern der Hershey
High die Nachricht vermittelte. Ich konnte mich ja nicht in der Cafet-
eria auf einen Stuhl stellen und schreien: »Könnt ihr mal alle her-
hören? Drake hat Sandy abblitzen lassen. Er geht nicht mit ihr zum
Schulball!« Stattdessen musste ich dafür sorgen, dass eine Schlag-
zeile daraus wurde, dass es Klatsch und Tratsch gab, der sich wie ein
Virus ausbreitete. Dafür brauchte es einen perfekten Plan, den die
anderen aber nicht durchschauen durften.
Celias Plan, Gerüchte zu verbreiten
1. Unterhalte dich leise mit Drake darüber, dass
du mit ihm zum Ball gehst, aber so, dass andere
Mädchen es mitkriegen
2. Erzähl einer Mitschülerin davon und bitte sie, es
auf keinen Fall weiterzuerzählen
3. Schreib es auf einen Zettel und lass ihn „aus
Versehen” irgendwo liegen
4. Schreib es an die Klowand
124/254

Eine Unruhe auf dem Basketballfeld unterbrach meine Intrigen-
planung. Ich hob den Blick und sah, wie Joey Gaskill umfiel wie ein
Mehlsack. Gleichzeitig dribbelte Drake über das Feld, ohne dass ihn
jemand deckte. Ungehindert schlängelte er sich zwischen den Spiel-
ern hindurch, als würde er durch einen Park mit Statuen laufen, und
schloss mit einem astreinen Korbleger. Die Mädchen, die um das
Feld herum im Gras saßen, jubelten. Drake strahlte und klatschte die
anderen Jungs seiner Mannschaft ab.
Ich jubelte auch. Denn je erfolgreicher Drake in der Schule war,
umso süßer würde meine Rache werden.
125/254

21
Am Freitagmorgen war Sandy wieder in der Schule. Als ich zum Eng-
lischunterricht kam, saßen sie und Mandy schon auf ihren Plätzen.
Ich schlich mich an wie ein Panther, der sich zwei dicken trägen
Kaninchen nähert. Es lag nur an mir, wann und wie ich mit der
Pranke zuschlug.
Eine ganz unbekannte Leichtigkeit überkam mich. Noch vor dem
Unterrichtsbeginn zog ich meine Kapuze herunter und schrieb sogar
mit, was Mr Pearson erzählte. Als wir über den Aufbau von
Geschichten sprachen, meldete ich mich zweimal zu Wort. Jedes Mal,
wenn ich etwas sagte, schien Sandy zusammenzuzucken, als würde
sie mit einer Nadel gepikst. Sie trommelte mit ihren manikürten
Fingernägeln auf den Tisch, bis Mr Pearson sagte: »Sandy, hör auf
damit.«
Als es gongte, bat Mr Pearson mich zu sich nach vorn. »Ich habe
mich gefreut, dass du heute mitgearbeitet hast, Celia. Aber ich habe
immer noch keinen Aufsatz von dir bekommen.«
Es war nicht so, dass ich den Aufsatz vergessen hatte. Ich hatte nur
einfach keine Lust, ihn zu schreiben. Ich hatte das Gedicht abgegeben
und fand, dass das genug war.
»Dann geben Sie mir eben ein F!«, erwiderte ich schulterzuckend.
»Aber mit einem F kann dir der Kurs vielleicht nicht angerechnet
werden. Wegen eines Aufsatzes?«

»Ich habe ja das Gedicht geschrieben, aber das war Ihnen nicht gut
genug.«
»Ein Gedicht ist nun mal kein Aufsatz. So einfach ist das. Bislang
war ich großzügig, weil du ja immerhin etwas abgegeben hast. Aber
es genügt mir nicht. Ich will am Montag etwas auf meinem Schreibt-
isch haben.«
Wieder zuckte ich die Schultern.
»Und das da reicht mir nicht als Antwort«, fuhr er fort.
»Okay«, brachte ich heraus. Ich schlurfte aus dem Klassenzimmer
und zog mir die Kapuze auf den Kopf.
***
In der Mittagspause quasselte Drake wieder über ›Lebe deinen
Traum!‹. »Am Wochenende gehe ich in die Stadtbibliothek und hole
mir ein paar SLBT-Bücher«, sagte er leise, nachdem er sicher sein
konnte, dass niemand in der Nähe war. »In der Schule will ich sie
lieber nicht ausleihen.«
»SLBT?«
»Schwul, lesbisch, bisexuell, transsexuell«, erklärte er. »Ich habe
sie schon online vorbestellt. Außerdem müssen wir mit Kapitel drei
weitermachen. Kommst du nach der Schule?«
»Geht nicht. Mom hat frei«, sagte ich.
»Oh, es geht los mit Wählen.« Drake lief zum Basketballfeld. Ich
fand, dass er schlanker aussah, seit er das Buch entdeckt hatte, als
wäre er ein gutes Stück gewachsen. Unseren Nachhauseweg schafften
wir in Rekordzeit.
***
127/254

»Hallo, mein Maikäfer. Ich bin hier!«, rief meine Mutter aus der
Küche, als ich ins Wohnzimmer kam. Ich schob mich durch die Sch-
wingtür. Sie saß am Küchentisch und war vor lauter Papier kaum zu
sehen. Es waren ungefähr sieben Stapel Briefe, Umschläge, Hefter
und Versandtaschen. Aber weil der Tisch rund ist, waren die Stapel
zu einer riesigen Pyramide zusammengerutscht.
»Na?«, sagte sie, legte ein Blatt Papier auf einen Haufen und griff
nach ihrer Kaffeetasse. »Wie war’s in der Schule?«
»Okay«, antwortete ich. »Was machst du?«
»Ach, ich bringe nur meinen Finanzkram in Ordnung«, wiegelte
sie ab, als hätte sie ihr Konto überzogen und ich hätte sie dabei
ertappt.
Ich muss sie wohl mit einem gewissen Zweifel angesehen haben.
»Na ja«, sie wickelte eine ihrer wilden Locken um ihren Finger,
»was finanzielle Dinge angeht, darin war dein Dad immer besser.«
Sie hatte sich einen Stift hinter das Ohr geklemmt und ihre Lesebrille
aufgesetzt. Jetzt nahm sie ein Papier zur Hand, legte es aber gleich
wieder beiseite. »Das ist eben jetzt meine Herausforderung. Ich muss
es einfach lernen«, sagte sie in dem kläglichen Versuch, optimistisch
zu klingen. »Ach, und Celia«, fügte sie hinzu und blätterte in einem
der verrutschten Stapel. »Es macht dir doch nichts aus, wenn wir das
Jahresticket für den Hershey Park kündigen, oder?«
Der Hershey Park ist die Hauptattraktion unserer Stadt. Es gibt
eine Achterbahn und Wasserrutschen und Zuckerwatte und natürlich
Schokolade. Seit ich laufen kann, hatten wir ein Jahresticket. Allerd-
ings sagte Dad immer, es sei eigentlich eher für Mom als für mich.
Als ich noch sehr klein war, fuhr sie Achterbahn, während Dad und
ich Milchshakes tranken und auf sie warteten. Auch als ich schon
groß genug war, um mitzufahren, fand sie das immer aufregender als
128/254

ich. Dad wartete währenddessen wieder auf uns, hielt Moms
Handtasche und unsere Jacken.
»Es ist ganz schön viel Geld, und ich dachte, du bist jetzt wahr-
scheinlich ohnehin zu alt dafür, oder?«, fragte Mom und riss mich
aus meiner Erinnerung. Sie redete mit mir, sah dabei aber auf die
Rechnungen.
»Ja, ja«, antwortete ich und spürte, wie die Finsternis in mir auf-
stieg. »Klar, ich bin zu alt.«
»Wir müssen einfach ein bisschen kürzertreten«, sagte sie und
tippte mit ihrem Stift Zahlen in ihre Rechenmaschine. »Das ist doch
was für kleine Kinder, nicht wahr? Und du bist sowieso nie gerne
Achterbahn gefahren.«
»Ich checke meine E-Mails«, murmelte ich.
»Okay«, erwiderte Mom und griff nach dem nächsten Papier. »Oh,
jetzt fällt’s mir wieder ein!« Sie sah auf und schlug sich an die Stirn.
»Ich wollte fürs Abendessen ja ein Hühnchen aus dem Gefriers-
chrank nehmen. Das mache ich jetzt schnell.« Sie sprang auf.
Ich verdrückte mich und ging in mein Zimmer. Das altbekannte
schwarze Loch in meiner Brust machte sich bemerkbar. Wenn das
Schwarze-Loch-Gefühl kommt, dann wird alles Licht aufgesogen und
verschwindet an einem dunklen Ort in meinem Inneren. Ich wusste
nicht, warum der Verlust des Jahrestickets für den Hershey Park das
finstere Gefühl in mir aufbrachte. Ich kann nicht sagen, dass ich
wirklich glaubte, mein Dad käme jemals aus Atlanta zurück und wir
würden wieder Milchshake zusammen trinken und Achterbahn
fahren und eine Familie sein. Aber auf das Ticket zu verzichten hatte
etwas so Endgültiges, als würden wir damit die Chance abschreiben,
dass es passieren könnte.
129/254
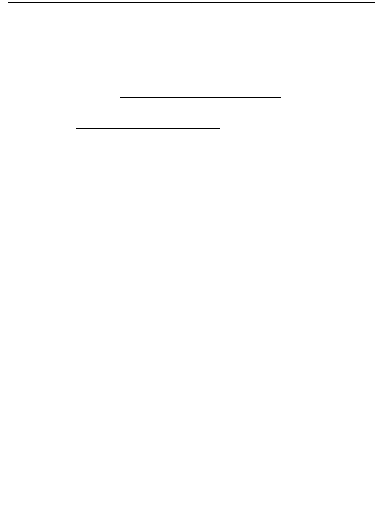
Ich schloss meine Zimmertür, öffnete das E-Mail-Programm und
hoffte, irgendwie Ablenkung zu finden. Da Freitag war, hatte ich eine
Mail von meinem Dad.
Betreff: Hallo Celia
Von: James Door (jdoor@cocacolacompany.com)
Gesendet: Freitag, 17. September 09:53
An: Celia (celia@celiadiefinstere.com)
Hallo Schnecke,
gestern Abend habe ich mich in der Stadt nach Buchläden
umgesehen. Einer wird dir ganz bestimmt gefallen. Er heißt Out-
write. Sie laden Autoren ein, die aus ihren Büchern vorlesen. Ich
kann es kaum erwarten, bis du mich an Weihnachten besuchen
kommst.
Bitte erinnere deine Mutter daran, dass die Rohre im Keller noch
vor Einbruch des Winters isoliert werden müssen.
Liebe Grüße,
Dad
Das Urteil darüber, wem ich die Schuld an der Trennung gebe, ist
noch nicht gesprochen. Auf der einen Seite scheint es ziemlich klar,
dass meine Mom diejenige war, die »Zeit brauchte« oder »sich über
die Dinge klar werden musste« oder wie auch immer der neueste
nebulöse Ausdruck dafür lautete, dass sie meinen Vater nicht mehr
hier haben wollte. Auf der anderen Seite ist er derjenige, der sich ein-
en Job in einem anderen Bundesstaat gesucht, zwölf Kisten mit
seinem Kram gepackt und uns im Stich gelassen hat. Das ist im Ver-
gleich zu dem Wunsch meiner Mutter, keine weiteren Kinder zu krie-
gen, eine noch deutlichere Absage an die Familie. Auf der anderen
Seite hätte Mom mit ihm gehen und die Familie zusammenhalten
130/254
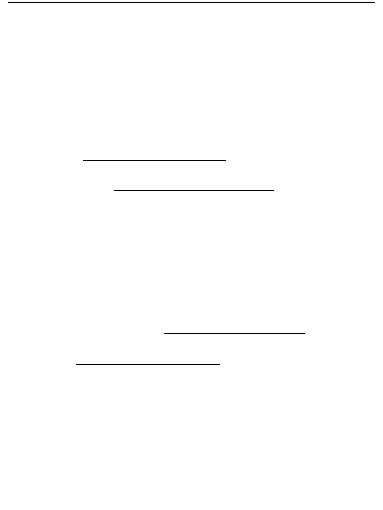
können. Zumindest hätte sie erlauben können, dass ich mitging, und
mir so das Elend meines Außenseiterdaseins in dieser mit
Schokolade überzogenen Stadt erspart.
An den meisten Tagen wusste ich nicht, auf wen ich wütend sein
sollte.
Ich schrieb meinem Dad eine Antwort.
AW: Hallo Celia
Von: Celia (celia@celiadiefinstere.com)
Gesendet: Freitag, 17. September 16:27
An: James Door (jdoor@cocacolacompany.com)
hi dad,
du hast doch gesagt, ihr macht eine trennung auf probe. wie
steht es mit dem probieren?
celia
Ich hatte auch eine E-Mail von Dora bekommen:
AW: Freunde
Von: Dorathea Eberhardt (deberhardt@berkeley.edu)
Gesendet: Freitag, 17. September 10:39
An: Celia (celia@celiadiefinstere.com)
hallo celia die finstere,
es ist echt schwer, sich von dem drama, wenn eltern sich
trennen, nicht total auffressen zu lassen, vor allem dann, wenn
man das einzige kind ist. meine eltern haben mich jahrelang
hingehalten, sie haben sich getrennt und sind wieder zusam-
mengekommen. meistens haben sie um weihnachten herum von
versöhnung geredet, aber wenn dann das neue Jahr da war,
haben sie sich wieder gehasst.
131/254

ich kenne hier in berkeley jede menge leute, die »queer« sind,
was im vergleich zu »schwul« ein neutralerer ausdruck ist. das
wort »schwul« klingt so binär, als gäbe es einen an-und-aus-
schalter und man ist entweder schwul oder nicht. der mensch ist
aber in seiner sexualität ein sehr komplexes wesen und es gibt
ganz unterschiedliche möglichkeiten, wie sich unsere vorlieben
und unsere sexuelle identität äußern können.
wie geht’s dir im ersten jahr an der highschool? versprich mir,
dass du dir deine kreativität nicht kaputtmachen lässt. das
amerikanische bildungssystem ist immer stärker daran in-
teressiert, alles, aber auch alles abprüfbar zu machen, und weni-
ger daran, kreatives oder kritisches denken zu fördern. das
haben wir in einem kurs über soziale gerechtigkeit gelernt.
wehre dich dagegen!
d.
Als ich acht war und Dora dreizehn, kam sie mit meiner Tante und
meinem Onkel an Weihnachten zu Besuch. Im Sommer davor hatte
sie an einem Feriencamp zum Thema »Kunst als soziale Bewegung«
teilgenommen, was sie politisch sehr geprägt hat. Sie schnitt sich die
Haare kurz und fing an, als modisches Statement Krawatten zu tra-
gen. Dora ist von Natur aus sehr hübsch, sodass selbst ein schlechtes
Styling gut an ihr aussieht.
Ich stand damals auf Barbies. Ich besaß eine Sammlung von fün-
fundzwanzig Puppen und außerdem ein Barbie-Haus, einen Barbie-
Lieferwagen, ein Barbie-Auto, unzählige Behältnisse für Barbie-
Kleider und eine tragbare Barbie-Kleiderkammer. Stundenlang saß
ich in meinem Zimmer und spielte damit. Alle Puppen hatten ihre ei-
gene Geschichte und sie hatten viel miteinander erlebt. Oft ging es in
ihren Gesprächen darum, dass es zu wenig Kens gab.
132/254

Zu Weihnachten schenkten mir meine Eltern drei neue Barbies.
Eine war ein Strandmädchen, das mit den Füßen in Flipflops schlüp-
fen konnte und vier verschiedene Badeanzüge hatte. Die zweite trug
Ballkleider und ging in die Oper. Sie war mit einem Opernglas und
mit einer Nerzstola ausgestattet. Die dritte Barbie war eine
Geschäftsfrau im Hosenanzug. Sie kam mit Schreibtisch und Büros-
tuhl. Als wir am Weihnachtsmorgen unsere Geschenke ausgepackt
hatten, gingen Dora und ich in mein Zimmer.
Dora hatte sich zu Weihnachten nur Bücher gewünscht. Sie konnte
ihre Geschenke also übereinanderstapeln. Ich hatte meine neuen
Barbies auf meinem Bett abgelegt. »Schau genau hin, Celia!«, sagte
Dora und zeigte auf den Berg aus Kunsthaar und Plastikkörpern.
»Schau, wie die Gesellschaft ihren Kindern Geschlechterstereotypen
aufzwingt!«
Ich schaute hin. Und ich sah nur Barbies.
»Wenn du ein Junge wärst, dann hätten sie dir einen
Spielzeuglaster und eine Rennbahn geschenkt. Aber du bist ein Mäd-
chen und deshalb gehen sie davon aus, dass du ein Puppenhaus
magst und dass du gern mit Puppen spielst und sie an- und
ausziehst.«
»Aber ich spiele wirklich gern mit …«, versuchte ich zu sagen, aber
Dora unterbrach mich.
»Celia, ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns positionieren«, erklärte
sie und beschloss, dass wir alle Barbies, die alten genau wie die
neuen, in einer Schachtel ganz hinten in meinem Schrank verstauten.
(Eigentlich wollte sie, dass wir sie zusammenpackten und verschenk-
ten, aber ich konnte sie noch auf den Schrank herunterhandeln.) Es
war echt viel verlangt, vor allem, weil ein Teil der Barbies nagelneu
war, aber Dora schien diese Sache sehr wichtig zu sein, und sie war
133/254

die einzige Verwandte, die wenigstens annähernd so alt war wie ich.
Sie wirkte auf mich so viel klüger, dass ich nachgab.
Am Abend zum Weihnachtsessen trugen wir beide dann Klamot-
ten, die sie für »geschlechtsneutral« hielt, also eine Jeans und ein
weißes T-Shirt. Meine Mutter hatte Braten und Kartoffelpüree
gekocht. Als frisch erklärte Vegetarierin aß Dora aber nur ein
getoastetes Käse-Sandwich und ein paar Karottensticks. Sie sah mich
immer wieder eindringlich an und stupste mich schließlich unter
dem Tisch.
»Ich hab’s mir überlegt«, verkündete ich. Die ganze Familie starrte
mich an, als ich zu meiner Erklärung anhob, die wir zusammen geübt
hatten. »Ich habe beschlossen, dass ich nicht mehr mit Barbies
spielen möchte.« Ich versuchte, überzeugt zu klingen.
Die Erwachsenen am Tisch warfen sich besorgte Blicke zu. Mein
Onkel stieß einen unüberhörbaren tiefen Seufzer aus und schob sich
eine Gabel Kartoffelpüree in den Mund. Meine Tante sah ihn einen
Moment lang an. Dann sah sie zu meinen Eltern. Meine Mutter er-
widerte ihren Blick, als würden sie telepathisch kommunizieren.
Die Luft im Raum war dick wie Schokoladensirup. Als Kind hat
man oft das Gefühl, dass die Erwachsenen ein großes Geheimnis
miteinander teilen. Und deshalb führen sie sich manchmal ziemlich
komisch auf, obwohl es keinen echten Anlass gibt. Mir war klar, dass
ich etwas Entscheidendes gesagt hatte, aber eigentlich wusste ich
nicht, was.
»Also gut, Celia«, sagte mein Vater mit einer Stimme, die seiner
Rolle als Familienoberhaupt gerecht wurde. »In Ordnung. Wir wer-
den dir keine Puppen mehr kaufen. Gibt es etwas anderes, das du
stattdessen gerne hättest?«
134/254

Mein Vater war extrem freundlich, als er das sagte. Er schien über-
haupt nicht verärgert darüber zu sein, dass er mir gerade drei Barbies
geschenkt hatte, die ich plötzlich nicht mehr wollte.
Jetzt wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Ich hatte eine politische
Erklärung darüber abgegeben, dass ich nicht mehr mit Puppen
spielen würde, aber ich wusste nicht, womit ich sonst spielen sollte.
Ich sah Dora an, aber sie wich meinem Blick aus. Sie biss in ihr Sand-
wich und tat ganz unschuldig.
»Ähm«, sagte ich und suchte verzweifelt nach Worten. »Eine Ren-
nbahn?«, murmelte ich schließlich.
Mein Onkel lachte laut auf. Dabei spuckte er sogar ein bisschen
Kartoffelpüree auf den Tisch. Mit einem Blick brachte meine Tante
ihn zum Schweigen. »Na fein, Celia, ich kaufe dir gern eine Renn-
bahn«, sagte sie.
»Ja, mein kleiner Maikäfer«, stimmte meine Mutter zu. »Wir
kaufen dir genau das Spielzeug, das du gerne haben möchtest.«
Und dann standen sie und meine Tante auf und fingen an, den
Tisch abzuräumen.
Am nächsten Tag flog Dora zurück nach Oregon und ich holte die
Schachtel wieder aus dem Schrank. Meine Eltern sprachen nie mehr
darüber und zu meinem nächsten Geburtstag schenkten sie mir ein
Barbie-Cabrio.
135/254

22
Man braucht nur einen einzigen Freund und plötzlich ist an einem
Wochenende alles möglich. Am Samstagmorgen aß ich zum Früh-
stück meine Cornflakes und las in meinem Regenwürmerbuch.
Meine Mutter war bereits zur Arbeit im Krankenhaus.
***
»Oh, hallo, Liebes«, sagte die Frau, die bei Drake zu Hause die Tür
öffnete. »Du musst Cecilia sein.« Drakes Großmutter trug eine
schwarze Hose und eine schwarze Seidenbluse. Ein schmaler gelber
Schal lag um ihren Hals und reichte bis über ihre Taille. Sie war an-
ders als alle Großmütter, die ich je gesehen hatte. Die Mutter meiner
Mom ist gestorben, als ich noch klein war, und die Mutter meines
Dad trug immer Kleidung mit Motiven der Jahreszeit. Sie besaß zum
Beispiel eine beeindruckende Sammlung von Pullovern mit
Schneemännern.
»Äh … ich heiße Celia«, sagte ich schüchtern.
»Ach ja, natürlich.« Sie nahm mich an der Hand und zog mich ins
Haus. »Hast du Hunger?«
»Ich habe zu Hause Cornflakes gegessen.«
Das Haus war blitzblank, aber trotzdem gemütlich. Ihr Einrich-
tungsgeschmack war offenbar in einer Zeit stehen geblieben, als lind-
grüne Sofas und Lampenschirme mit Fransen in Mode waren. Der
Teppich im Wohnzimmer war so dick, dass ich es für ausgeschlossen

hielt, auch nur einen Schritt darauf zu hören, und sei es von einem
dicken Mann mit schweren Stiefeln. Auf jeder Oberfläche stand ein
Kristallgefäß mit allerlei Bonbons.
»Ich bin so froh, dass Drake hier in Hershey eine Freundin gefun-
den hat. Er braucht doch jemanden, mit dem er seine Zeit verbringen
kann – nicht nur mit einer alten Dame, was?« Sie stieß mich mit dem
Ellbogen in die Seite, als hätte sie einen Witz gemacht. Dann sah sie
mich einen Moment lang mit hochgezogenen Augenbrauen an. Of-
fenbar erwartete sie, dass ich etwas dazu sagte. Ich schob meine
Hände in die Taschen meiner Kapuzenjacke.
Dann tauchte Drake auf. In der einen Hand hielt er seinen Ruck-
sack, in der anderen ›Lebe deinen Traum!‹. Ich überlegte, ob er an
diesem Morgen schon darin gelesen hatte. »Wir gehen zur
Stadtbücherei, Gran«, sagte er, gab seiner Großmutter einen Kuss auf
die Wange und mir ein Zeichen, ihm zur Tür zu folgen.
»Komm klüger wieder nach Hause«, rief sie ihm nach.
»Wir haben ganz schön viel zu tun.« Drake öffnete das Garagentor
und holte sein Fahrrad heraus. Meines stand in der Einfahrt. »Zuerst
zur Bücherei und dann zu dir nach Hause. Wir müssen uns an die
Traumcollage machen.«
»Traumcollage?«
»Kapitel drei«, sagte Drake nur. »Ich habe alles, was wir
brauchen.«
Weil Drake seine Bücher vorbestellt hatte, brauchten wir in der
Bücherei nur ein paar Minuten, um sie abzuholen. Trotzdem grüßten
mich zwei der Bibliothekarinnen. Irgendwie war ich stolz, dass Drake
und ich gemeinsam in der Bücherei waren. Es war, als würde ich ihn
meinen Freunden vorstellen.
137/254

»Ich habe auch nach anderen Büchern von Buddy gesucht«,
erzählte Drake. »Aber ich glaube, das ist das einzige, das er ges-
chrieben hat.«
Aha, dachte ich, jetzt nennt er den Autor schon beim Vornamen.
Wir fuhren mit den Fahrrädern zu mir nach Hause. Drake warnte
mich, dass es beim Basteln der Traumcollagen eine ziemliche Sauerei
geben könnte, und so beschlossen wir, in den Keller zu gehen. Unser
Keller ist nichts weiter als ein großer betonierter Raum. Der Warm-
wasserkessel befindet sich darin, eine Waschmaschine und ein
Trockner sowie ein Waschbecken. Eine Tür führt in den Garten
hinaus. In den letzten beiden Wochen, bevor Dad nach Atlanta gezo-
gen ist, hat er hier unten geschlafen. Deshalb gab es auch noch einen
Teppich, einen Futon, eine Lampe mit einem Glasfuß und einen alten
Fernseher, der auf einem Couchtisch stand.
»Nette Höhle«, sagte Drake und drehte sich einmal rundum. »Der
Raum hat Potenzial.«
Obwohl draußen noch angenehme Temperaturen herrschten, war
es im Keller kühl und es roch nach feuchten Handtüchern. Wir breit-
eten unser Material auf dem Couchtisch aus: alte Zeitschriften, Kleb-
stoff, Scheren und ein großes Stück Pappe. Drake holte ›Lebe deinen
Traum!‹ aus dem Rucksack und blätterte durch die Seiten, die voller
Eselsohren waren. Während der letzten Male, als Drake aus dem
Buch vorgelesen hatte, war seine Stimme ganz ernst geworden, als
würde er etwas Religiöses lesen. Heute war es nicht anders.
Kapitel drei: Sehen
Die meisten Menschen sagen: »Sehen ist glauben«, aber ich sage:
»Glauben ist sehen«! In der Regel wollen die Leute handfeste Be-
weise sehen, bevor sie glauben, dass etwas möglich ist. Aber ich
138/254

kann zum Beispiel Elektrizität nicht sehen und glaube trotzdem,
dass meine Lampe leuchtet, wenn ich sie anknipse. Außergewöhn-
liche Menschen erlauben sich, das scheinbar Unmögliche zu
träumen!
Fang mit einer Traumcollage an! Lass dich von deiner Kreativität
leiten und wähle Bilder aus, die deine Traumzukunft herauf-
beschwören. Du willst ein Traumhaus? Kleb ein Foto von einem
Haus auf deinen Karton! Du willst starke Muskeln? Ein Foto dav-
on aufs Bild! Gestalte deine Collage, so schön du kannst. Sie ist
dein Traum!
Buddy Strong verwendete in seinen Texten jede Menge Aus-
rufezeichen. Ich glaube nicht, dass jemand ein besonders guter Autor
ist, wenn er exzessiv viele Ausrufezeichen verwendet. Aber ich ver-
mute mal, das ist Buddys künstlerische Freiheit.
»Okay, fangen wir an!«, sagte Drake, als wäre aus dem vorherge-
henden Psychogelaber eine klare und direkte Arbeitsanleitung
hervorgegangen.
»Womit?«
Drake sah mich an, als wäre ich der Dorftrottel. »Mit Fotos aus-
schneiden und sie auf den Karton kleben«, sagte er und reichte mir
eine Schere und ein paar Zeitschriften. Ich fügte mich Drakes An-
weisung und fing an, durch die Seiten zu blättern. Ich entdeckte eine
Werbeanzeige für Nagellack mit fünfzig lackierten Fingernägeln und
Werbung für einen Vinylbodenbelag. Danach folgte eine zweiseitige
medizinische Warnung vor Collagenspritzen, eine Anzeige für Mund-
wasser und eine Fotoserie über Regenmäntel. Nichts auf diesen
Seiten setzte eine inspirierende Vision meiner Zukunft in Gang. Ich
schlug die Zeitschrift zu und legte sie neben mich auf den Futon.
139/254

»Was gibt’s Neues von BlackJack?«, fragte ich und hoffte, Drake
ein wenig abzulenken.
»Er fängt einen Diamantenschmuggler.«
»Wie kommst du denn auf Diamantenschmuggler?«
»Eine internationale Terrorgruppe wird von den Einkünften ille-
galer Diamantengeschäfte finanziert«, antwortete er, wirkte aber un-
aufmerksam. »Terrorismus ist im Moment unter den Comiczeich-
nern ein ganz großes Thema.«
»Kämpft Superman jetzt gegen Terroristen?«
»Wen interessiert das schon?« Drake verdrehte die Augen. »Su-
perman ist doch langweilig. Ich mache mir sowieso nicht mehr so viel
aus BlackJack. ›Lebe deinen Traum!‹ ist mir viel wichtiger.«
Drake drehte das Foto um, das er ausgeschnitten hatte, und fuhr
mit dem Kleberoller in gleichmäßigen Kreisen über die Rückseite.
Dann legte er es auf den dicken Pappkarton und strich es fest. Es
zeigte die Skyline von Manhattan.
»New York«, sagte ich und versuchte nicht allzu enttäuscht über
sein erstes Foto zu klingen.
»Richtig«, erwiderte Drake fröhlich, »das ist der erste Teil meines
Traums. Na ja, dieser Teil ist ja eigentlich schon Wirklichkeit ge-
worden. In vier Wochen bin ich wieder dort.«
»Oh. Hast du einen Platz bekommen?« Drake hatte nichts davon
erwähnt.
»Noch nicht. Noch ist an keiner Schule jemand zurückgetreten.
Mein Vater meint, es sieht ziemlich schlecht aus. Aber gegen Optim-
ismus haben Zweifel keine Chance. Mir bleiben immer noch zwei
Wochen und ich habe ein gutes Gefühl.«
Ich war mir ziemlich sicher, dass Drake mit der Kraft des Optimis-
mus hier Buddy Strong zitierte.
140/254

»Und wenn du nirgends aufgenommen wirst? Bleibst du dann
hier?«
»Na ja, an meine alte Schule kann ich auf keinen Fall zurück. Dort
gibt es Metalldetektoren und man wird jeden Morgen auf Waffen
durchsucht. Die Schule ist ganz bestimmt nicht dafür bekannt, be-
sonders schwulenfreundlich zu sein. Für mich zählt nur die Kunst-
schule, alles andere hat keine Bedeutung.«
»Keine Bedeutung?« Für Drake hatte Hershey also keine
Bedeutung.
Er sah mich an. »Sorry, idiotisch, so was zu sagen. Ich habe nur ge-
meint, ich gehöre nach New York, zusammen mit Japhy.«
Mein Herz rauschte abwärts wie in einem Fahrstuhl. Es ist so
leicht, sich an das Glück zu gewöhnen, und so schwer, nicht zu ver-
gessen, dass es nur vorübergehend ist. Ich schnappte mir erneut die
Zeitschrift und blätterte darin herum, betrachtete Parfümwerbung
und Fotos von superleckeren Torten.
»Ich habe heute das Gedicht über den Wal fertig geschrieben«,
sagte ich und riss das Foto eines Aquariums heraus.
»Ah, echt?«, erwiderte Drake. »Ist dir ein guter Schluss
eingefallen?«
Ich hatte Drake erzählt, dass der Schluss eines Gedichts immer das
Schwierigste ist und dass ich bei diesem Gedicht echt damit kämpfte.
»Ich hatte beschlossen, das Gedicht mit einem Homophon zu
beenden. Ein Homophon ist ein Wort, das genau gleich klingt wie ein
anderes, das aber unterschiedlich geschrieben wird und eine andere
Bedeutung hat«, erklärte ich. »Ich wollte also mein Gedicht, das von
einem Wal handelt, mit Wahl beenden.«
»Homophon?«, prustete Drake. »Hallo, Homo Phon … hier spricht
Drake«, näselte er, worüber ich so lachen musste, dass ich ein
141/254

Geräusch wie ein Schnarchen von mir gab. Und darüber mussten wir
dann beide lachen.
Als wir uns schließlich wieder beruhigt hatten, legte ich mich auf
den Futon und starrte an die Decke.
»Wenn du nach New York zurückgehst, kommst du dann mal zu
Besuch? An Weihnachten oder so?«
»An Weihnachten fliegen wir immer nach Florida und besuchen
meine andere Großmutter. Im Sommer kommen wir nach Hershey.«
»Im Sommer bin ich in Atlanta«, erwiderte ich. »Und über Weih-
nachten auch, glaube ich. Und in den Osterferien.«
Es war unvorstellbar, dass ich von nun an alle Ferien in Atlanta
verbringen würde.
»Und an den Wochenenden?«, schlug Drake vor.
»Ja, das könnte gehen.«
Wir schwiegen eine Weile. Ich glaube, es dämmerte uns beiden,
dass wir uns nicht mehr oft sehen würden, wenn Drake erst wieder in
New York war. »Machst du dir Gedanken, ob du in der neuen Schule
Freunde findest?«
Drake war immer noch mit seinem Klebstoff beschäftigt. »Nein, ei-
gentlich nicht. Japhy wird mein Freund sein und in der Kunstschule
gibt es sicher viele coole Leute. Das wird bestimmt nicht schwer.«
Drake war so zuversichtlich. Ich hätte alles dafür gegeben, es auch
zu sein. Er war so sicher, dass er und Japhy zusammenkommen
würden, obwohl Japhy nicht mal seine E-Mails beantwortete. Es
hörte sich nach einem langen Elend an, aber ich konnte nichts sagen.
Ich hatte mir geschworen, ihn in seinem Wunsch zu unterstützen.
Außerdem hatten sie sich geküsst. Vielleicht kamen sie wirklich
zusammen.
142/254

»Wir müssen ein paar Freunde für dich finden, bevor ich
weggehe«, meinte Drake. »Wie wär’s mit diesem Clock? Er mag
dich.«
»Clock!« Ich setzte mich auf. »Der mag mich nicht. Der hasst
mich!«
Drake sah mich ungläubig an. »Heteros wissen einfach nicht, wie
sie Mädchen zeigen sollen, dass sie an ihnen interessiert sind.«
»Aber er ist einfach schrecklich«, wandte ich ein, und eine komis-
che Mischung aus verschiedenen Gefühlen rumorte in meinem
Bauch. »Findest du nicht?«
»Nein. Ich finde ihn irgendwie cool. Er hat was Besonderes.«
»Ich glaube nicht, dass mich überhaupt irgendein Junge mag«,
sagte ich und schlug die Beine übereinander.
Drake legte seine Schere weg und sah mich an. »Kapierst du wirk-
lich nicht, wie hübsch du bist?«
»Ich bin blass und habe kaum Busen und …«
»Celia«, fiel Drake mir ins Wort. »Du machst dich gerade selber
schlecht.« Er stand auf, nahm meine Hände und zog mich vom Futon
hoch. Dann führte er mich zum Waschbecken, über dem ein Spiegel
hing.
»Sieh dich an!«, sagte er zu meinem leicht verzerrten Spiegelbild.
Ich wandte meinen Blick von Drake und sah mich an. Drake zog
meine Kapuze herunter und streifte vorsichtig das Haargummi von
meinem Pferdeschwanz. Er arrangierte meine dunklen Haare um
mein Gesicht und um meine Brille. Dann schob er meine einge-
sunkenen Schultern zurück und zwang mich, aufrecht zu stehen.
Ich erwarte nicht, dass demnächst eine Model-Agentur anruft,
aber die Art und Weise, wie Drake mich im Spiegel musterte, be-
wirkte, dass ich selbst mit anderen Augen hinsah. Ich war überrascht,
143/254

wie ähnlich ich meiner Mutter war. Während ich so dastand, seine
Hände auf meinen Schultern, fühlte ich mich plötzlich wie eine ganz
andere Celia. Gemeinsam starrten wir unser Spiegelbild an, das uns
wiederum anstarrte. Und Drake beugte sich vor und flüsterte mir ins
Ohr: »Sehen.«
144/254

23
Wir machten unsere Traumcollagen fertig und beschlossen, sie im
Keller aufzubewahren. Ich wollte nicht, dass meine Mutter von mein-
en unterbewussten Träumen erfuhr, und auch Drake war nicht
gerade begeistert von dem Gedanken, dass seine Großmutter
Genaueres über ihn herausfand. Drakes Traumcollage zeigte die
Skyline von Manhattan, zwei Männer, die einander an den Händen
hielten, und eine Feuerleiter. Darüber stand DAS IST MEIN TRAUM.
Dazu hatte er alle möglichen Dinge jeweils paarweise aufgeklebt: ein
Paar Socken, Handschuhe und zwei Kaffeebecher, die sich am Hen-
kel berührten. Das Ganze sah echt super aus. Meine Collage war
dagegen ein wildes Durcheinander aus Büchern, einem Backsteinge-
bäude, in dem eine Bücherei untergebracht war, Buchstaben, die ich
zu dem Wort POESIE zusammengeklebt hatte, und, aus keinem
nachvollziehbaren Grund, einem kleinen Hund. »Das weiß allein
mein Unterbewusstsein«, erklärte ich Drake, als er sich nach dem
Hund erkundigte.
***
»Ich gehe zu Drake«, sagte ich zu meiner Mutter, als ich am Sonntag-
morgen in die Küche trat. Sie saß im Bademantel am Küchentisch
und trank Kaffee. Nach der doppelten Schicht vom Samstag sah sie
noch ziemlich müde aus.
»Was macht ihr denn?«, fragte sie.

»Ach, irgendwas.«
»Ich würde auch gern irgendwas tun. Ich komme überhaupt nicht
mehr zu irgendwas«, sagte sie sarkastisch. »Ich habe heute
Spätschicht und muss um zwei los.« Sie nippte an ihrem Kaffee und
sah in die Zeitung, die aufgeschlagen vor ihr lag. »Kochst du dir sel-
ber Abendessen?«
»Klar«, sagte ich und hatte ein komisches Gefühl. Mir fiel wieder
ein, dass ich für den Hershey Park jetzt zu alt war. Und da war noch
etwas, über das ich nachgedacht hatte, seit ich mit Drake zusammen
die Traumcollagen gebastelt hatte. »Muss ich wirklich über Weih-
nachten nach Atlanta?«, fragte ich, nahm mir einen Apfel aus dem
Obstkorb und biss hinein.
»Na ja, wir haben den Flug noch nicht gebucht, aber das war Teil
der Übereinkunft zwischen deinem Dad und mir«, antwortete Mom
und warf mir einen ernsten Blick zu. »Möchtest du denn deinen Dad
nicht sehen?«
Das schwarze Loch tauchte auf. »Doch.« Ich biss noch einmal in
meinen Apfel. »Aber warum kommt er nicht einfach nach Hause?
Sein Zeug ist ja noch zur Hälfte hier. Und habt ihr nicht gesagt, es sei
eine Trennung auf Probe?«
»Sprich bitte nicht mit vollem Mund, Celia. Das wäre unter Um-
ständen auch eine Möglichkeit.« Sie sah in ihren Kaffeebecher, den
sie in beiden Händen hielt. »Dein Vater und ich werden darüber re-
den und sehen, ob das zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine gute Idee
ist.«
Eine Wut, die mir nur allzu vertraut war, stieg in mir auf. »Ihr
führt also ein Gespräch unter vier Augen und gebt das Urteil dann an
mich weiter. Vergesst mal bloß nicht irgendwann, mich zu
146/254

informieren«, brauste ich auf. Ich öffnete den Mülleimer und warf
den nur halb gegessenen Apfel hinein.
»Celia, du wirfst Essen weg! Außerdem kommt das in den Biomüll.
Das weißt du genau«, sagte meine Mom und erhob sich, um den Ap-
fel wieder aus dem Mülleimer zu klauben.
»Iiiih.« Ich drehte mich um, drückte energisch die Schwingtür auf
und war schon im Esszimmer.
»Einen Moment!«, rief meine Mutter, als ich schon an der Haustür
stand. Ich fasste den Türknauf und drehte mich nicht zu ihr um.
»Ich möchte, dass du spätestens um sieben zu Hause bist«, sagte
sie. »Du musst noch deine Hausaufgaben machen. Ich werde
anrufen.«
»Sonst noch was?«, sagte ich.
»Viel Spaß«, erwiderte sie in freundlichem Ton.
Ich öffnete die Tür und ging.
***
Ich fuhr mit dem Fahrrad zu Drake. Um zehn Uhr war ich dort. Wir
wollten zum Einkaufszentrum und neue Klamotten für Drake kaufen.
Das war Teil seines Selbstverwirklichungsprogramms und seines
Plans, mit Japhy zusammenzukommen. Ich bin nicht sehr oft im
Einkaufszentrum. Manchmal bietet meine Mom mir an, gemeinsam
shoppen zu gehen, aber ich kaufe meine Klamotten lieber in Second-
handläden. Ich will nämlich auf keinen Fall eine Jeans tragen, die ir-
gendein anderes Mädchen in der Schule auch hat.
Für unseren Einkaufstrip hatte ich eine grüne Armee-Hose angezo-
gen, die ich bis zu den Knöcheln hochgekrempelt hatte, und dazu ein
rot-weiß gestreiftes T-Shirt. Auf den Pferdeschwanz hatte ich
147/254

verzichtet. Nachdem Drake und ich gestern in den Spiegel gesehen
hatten, hatte ich beschlossen, meine Haare offen zu tragen.
Drake kam mir schon in der Einfahrt entgegen. »Ach nee, hier hat
wohl jemand die Farben entdeckt«, sagte er, nachdem er mich von
oben bis unten gemustert hatte.
Wir radelten zum Einkaufszentrum. Es war ein ganzes Stück weiter
als zur Stadtbibliothek. Während wir unsere Fahrräder anschlossen,
fing es an zu nieseln. Wir hatten es gerade bis zu einem Kosmetik-
laden geschafft, als wir zwei Mitschüler entdeckten. Vanessa Beale
aus meinem Französischkurs und Damian Poole, der schon lange mit
mir zur Schule geht, standen vor einem Parfümtester.
Drake zerrte mich hinter einen Ständer mit Handtaschen, sodass
sie uns nicht sehen konnten. Er hielt eine lilafarbene Kunstleder-
tasche vor unsere Gesichter. »Glaubst du, die sind ein Pärchen?«
»Ich hab sie noch nie zusammen gesehen.«
»Komm, wir schleichen ihnen nach«, schlug Drake vor.
Wir folgten Vanessa und Damian in sicherem Abstand durch die
Gänge des Einkaufszentrums, blieben immer wieder stehen und
taten so, als würden wir Schaufenster anschauen. Je einer von uns
beobachtete die beiden, während der andere vorgab, sich eine Blu-
menvase oder den Schmuck in einer Vitrine anzusehen.
»Sie bleiben am Saftstand stehen«, berichtete Drake von seiner
Position vor dem Schaufenster eines Schuhladens, während ich mir
ein verrücktes Paar Schuhe ansah. »Scheint so, als würden sie über
den Preis verhandeln. Wie peinlich!« Ich spähte in ihre Richtung,
aber Drake ermahnte mich: »Nicht hinschauen!«, und so ließ ich den
Schuh aus Versehen fallen und bückte mich, um ihn wieder
aufzuheben.
148/254

»Okay«, raunte Drake und seine Lippen bewegten sich kaum. »Sie
bestellen etwas und … ja, er bezahlt für sie beide. Es ist definitiv ein
Date.«
Dass von den Jungen erwartet wird zu bezahlen, wenn sie sich mit
einem Mädchen am Saftstand verabredet haben, gehört wirklich der
Vergangenheit an. Das war vielleicht in den Fünfzigerjahren des let-
zten Jahrhunderts so. Jetzt, nachdem meine Eltern sich getrennt
haben, schickt mein Dad jeden Monat Geld für mich. Als wir das let-
zte Mal zu dritt essen gegangen sind, bevor mein Dad ausgezogen ist,
haben sich meine Eltern die Rechnung geteilt.
»Würdest du für Japhy bezahlen, wenn ihr zusammen ausgeht?«,
wollte ich von Drake wissen und folgte ihm in einen Hot-Topic-
Laden. Die Verfolgung von Damian und Vanessa hatten wir
aufgegeben, als sie im Kino verschwunden waren.
»In Manhattan gibt es eigentlich gar keine Einkaufszentren«,
erklärte Drake. »Aber wenn Japhy und ich irgendwann mal zusam-
men ausgehen, dann werden wir uns gegenseitig zu jeder Menge
Drinks einladen.«
Wir wühlten in einem Korb mit Netzstrümpfen und nietenbeschla-
genen Armbändern.
»Würdest du Japhy darin gefallen?«, fragte ich und zog ein
ärmelloses T-Shirt hervor, das aus lauter Reißverschlüssen bestand.
»Nur, wenn ich das dazu anhätte«, erwiderte Drake und griff nach
metallic-lilafarbenen Stiefeln mit gelben Sohlen.
»Kann ich euch helfen?«, erkundigte sich in diesem Moment eine
junge Verkäuferin mit gelangweilter Stimme. Mit ihrem blauen Lip-
penstift und dem dicken Eyeliner sah sie aus wie Kleopatra.
Wir schüttelten den Kopf und sie ging zurück zur Kasse, um mit
zwei Kolleginnen zu plaudern.
149/254
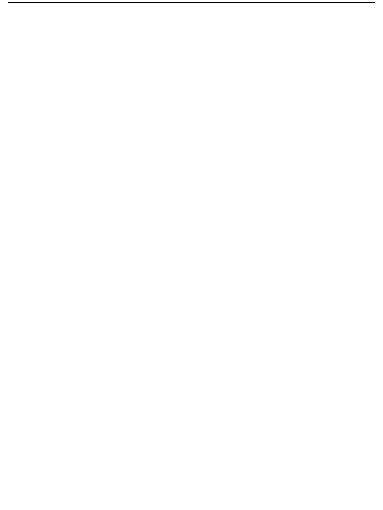
»Habt ihr den Film mit den außerirdischen Zombies gesehen?«,
fragte die eine.
Drake und ich schlenderten zu den Körben mit Schmuck und Lip-
penstiften neben der Kasse.
»Der Film war total bescheuert«, sagte die zweite.
»Ich weiß, alles wird jetzt auf Zombie gemacht. Der Film war so
schwul«, meinte die Verkäuferin.
»Wie bitte?«, schaltete ich mich ein.
Die drei sahen mich an, als wäre ich gerade im Restaurant an ihren
eigens reservierten Tisch getreten und hätte gefragt, ob ich mich
dazusetzen könne.
»Wir reden nur über den Film mit den außerirdischen Zombies«,
antwortete die Verkäuferin herablassend.
»Aber wie haben Sie den Film genannt?«, fragte ich und merkte,
wie es Drake neben mir unbehaglich zumute wurde und er ein paar
Schritte wegging.
»Ich sagte, der Film war dumm und man muss ihn nicht gesehen
haben.«
»Aber Sie haben nicht ›dumm‹ gesagt«, korrigierte ich sie und
meine Stimme wurde lauter. »Sie haben gesagt, der Film sei
›schwul‹.«
»Ach so, ja, ich hab das nicht so gemeint.«
»Nein, Sie haben ›schwul‹ als ein anderes Wort für ›dumm‹ oder
›langweilig‹ benutzt.«
»Das machen doch alle«, mischte sich eines der anderen Mädchen
ein. »Sie hat es nicht so gemeint. Sie hat kein Problem mit
Schwulen.«
»Na, wenn Sie kein Problem mit Schwulen haben, warum ver-
wenden Sie dann nicht ein anderes Wort, das niemanden beleidigt?«
150/254

Die Verkäuferin kniff ihre stark geschminkten Augen zusammen
und musterte mich. Ihre blauen Lippen öffneten sich wie bei einem
exotischen Fisch. In diesem Moment kam eine Frau aus dem Lager,
die offenbar ein kleines Stück älter und vielleicht die Filialleiterin des
Geschäfts war. Die Verkäuferin sah zu ihr hinüber.
»Entschuldigen Sie, Miss«, sagte sie mit ihrer gelangweilten
Stimme, ohne mich anzusehen. »Kann ich Ihnen sonst noch irgend-
wie behilflich sein?«
»Nein danke«, antwortete ich und ließ die billigen Ohrringe, die
ich in der Hand gehalten hatte, zurück in den Korb fallen. Dann dre-
hte ich mich um und verließ mit Drake im Schlepptau den Laden.
»Unglaublich – dass du das wirklich gemacht hast!«, rief Drake
aus, sobald wir wieder durch die Gänge des Einkaufszentrums liefen.
Ich zuckte die Schultern. »Kann man nicht einfach sagen, dass ein
Film schlecht war?«
Drake blieb abrupt stehen und seine Turnschuhe quietschten auf
dem glänzenden Fußboden. Er sah mir ins Gesicht. Dann griff er
nach meiner Hand und kniete nieder. Die andere Hand legte er auf
seine Brust, als würde er mir hier vor einem Handyladen und mitten
im Einkaufszentrum einen Heiratsantrag machen. »Celia Door, willst
du meine beste Freundin sein?«
Ein ganzer Rosengarten erblühte in meiner Brust. Die Rosen wur-
den so voll, wie es voller nicht ging, und begannen, ihre Blütenblätter
abzuwerfen, sodass sie in einer zarten Brise zwischen meinen Rippen
herumwirbelten. Zuerst sagte ich nichts, weil ich wissen wollte, wie
lange Worte im Raum schweben konnten. Beste Freundin. Beste Fre-
undin. Beste Freundin!
151/254

»Ja, ich will«, sagte ich schließlich und tat so, als hätte ich einen
Brautstrauß in der Hand. Ich schloss die Augen und warf ihn hinter
mich auf den Gang.
»Das nenne ich Liebe«, sagte der Verkäufer im Handyladen und
applaudierte. Drake stand auf und wir verbeugten uns. »Und?
Welchen Anbieter habt ihr beiden?«
Drake lachte, nahm mich an der Hand und zog mich weg. »Komm,
lass uns ein paar Klamotten kaufen und dann lade ich dich am Saft-
stand auf einen Saft ein.«
Er steuerte ein Sportgeschäft an. Wir lachten immer noch über den
Handyverkäufer, als mich ein echter Schock aus meinem Glück riss.
Neben einem Vertreter des anderen Geschlechts war eine Person
Richtung Saftstand unterwegs, von der ich im Traum nicht gedacht
hätte, sie hier im Einkaufszentrum anzutreffen.
Schneller als eine zubeißende Schlange schnappte ich Drakes Hand
und zog ihn in das nächstbeste Versteck. Es war ein Geschäft für Un-
terwäsche und wir duckten uns hinter ein Regal mit Spitzen-BHs. Ich
atmete heftig und hatte Mühe, meinen Puls zu beruhigen. »Da ist
meine Mom«, flüsterte ich.
»Deine Mom? Spioniert sie dir etwa nach?«
»Sie weiß nicht, dass ich hier bin.«
»Dann geht sie also einfach nur einkaufen.«
»Mit einem Typen?« Mir war zum Heulen zumute. »Sie geht mit
einem Typen einkaufen?«
»Oh«, meinte Drake. »Na ja, aber deine Eltern sind doch getrennt,
oder?«
»Es ist eine Trennung auf Probe.«
152/254

»Ja, klar, auf Probe!« Drake versuchte, um einen Wühltisch herum
auf den Gang hinauszuspähen. »Einige Eltern meiner Freunde haben
sich auch auf Probe getrennt.«
»Was willst du damit sagen?«
»Weiß doch jeder, dass das nur eine Phrase ist. Sie wollen einfach
nicht gleich von Scheidung reden. Also machen sie es in Etappen.
Trennung auf Probe, richtige Trennung, Scheidung«, erklärte er
nüchtern, während er noch immer aus dem Laden spähte.
Das schwarze Loch in mir begann sich aufzutun. Drake drehte sich
nach mir um und sah mein Gesicht.
»Oh, Scheiße. Na ja, also manche Leute kommen auch wieder
zusammen. Wahrscheinlich sogar viele«, berichtigte er sich.
»Kann ich euch beiden irgendwie helfen?« Eine zierliche Frau mit
grellblonden Strähnchen starrte uns durch die BHs hindurch an.
»Nein«, flüsterte ich finster.
Drake spähte noch einmal um die Ecke und prüfte, ob die Luft rein
war. Dann flohen wir so schnell wie möglich aus dem
Einkaufszentrum.
153/254

24
Eines muss ich hier mal glasklar machen: Ich schreibe KEINE
Liebesgedichte. Wann immer eine Mitschülerin ein Gedicht schreibt,
für den Englischunterricht oder für die Schülerzeitung, dann handelt
es davon, wie sehr sie ihren perfekten Freund liebt oder wie sehr sie
ihren unperfekten Exfreund hasst. Bei solchen Gedichten möchte ich
am liebsten kotzen. Im Geiste der Frauenbewegung schwöre ich,
Celia die Finstere, dass ich niemals Liebesgedichte schreiben werde!
Außerdem folgt hier eine Liste von acht Wörtern, die man beim
Schreiben von Gedichten niemals verwenden sollte: Liebe, Seele,
Herz, Traum, traurig/Traurigkeit, Schmerz, schrecklich und auf
überhaupt gar keinen Fall: schön. Schön wird in Gedichten einfach
viel zu häufig verwendet, sodass es seinen Sinn verloren hat.
Diese Wörter sind meine »Niemals-Wörter«. Eine Woche vor Be-
ginn der neunten Klasse habe ich sie mit einem Eddingstift auf die
lavendelfarbenen Wände in meinem Zimmer geschrieben, um
sicherzugehen, dass ich nicht aus Versehen darauf zurückgreife.
Während ich schrieb, kam meine Mom herein. Ich kniete gerade in
Sweatshirt, kariertem Wollrock und Kniestrümpfen auf meinem
Schreibtisch.
Die Wörter Liebe und Seele hatte ich bereits in zehn Zentimeter
großen Buchstaben fertig und war nun mitten im Wort Herz. Nor-
malerweise klopft meine Mutter an, aber an dem Tag kam sie mit
einem Stapel frischer Wäsche in den Händen einfach so herein.

Ich ließ mich auf die Fersen sinken und war mir total sicher, dass
sie gleich losschimpfen würde. Was normale Eltern ja wohl tun
würden.
Stattdessen seufzte sie nur tief. Der Seufzer schien von ganz unten,
sozusagen von ihren Zehen her aufzusteigen. »Celia, ich möchte
nicht, dass du an deine Zimmerwand schreibst«, sagte sie schließlich.
Seit meine Mutter zur Therapie geht, höre ich sie förmlich bis zehn
zählen, wenn sie wütend ist. »Wenn du das dringende Bedürfnis
dazu hast, kannst du im Keller an die Wände schreiben.«
Warum ich diese »Niemals-Wörter« niemals verwende, liegt
daran, dass jedermann sie verwendet. Und Gedichte müssen einz-
igartig klingen, so einzigartig wie der Mensch, der sie schreibt. Wann
immer ich drauf und dran bin, eines meiner »Niemals-Wörter« zu
schreiben, versuche ich ein anderes, interessanteres Wort an diese
Stelle zu setzen. Wenn ich zum Beispiel sagen will:
Der Regen macht mich traurig,
schreibe ich stattdessen:
Der Regen hat alle Farbe aus meinem Tag gewaschen.
Als wir mit unseren Fahrrädern vom Einkaufszentrum nach Hause
fuhren, regnete es.
»Alles in Ordnung?«, rief Drake, der neben mir fuhr, unter seiner
Kapuze zu mir herüber.
»Nein«, rief ich zurück. Meine Hände und Füße fühlten sich taub
an, aber immerhin bluteten sie nicht sichtbar. Das war schon mal ein
gutes Zeichen.
»Wirst du sie fragen?«
155/254
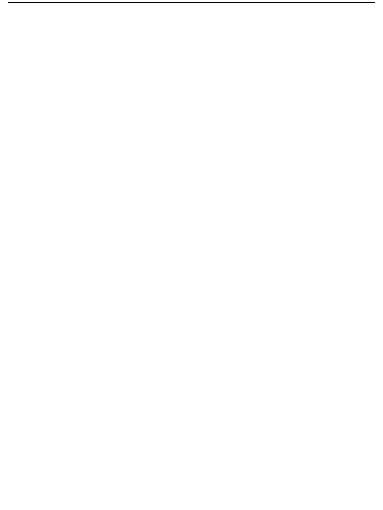
»Weiß nicht.«
Drake zeigte auf eine überdachte Bushaltestelle neben der Fahr-
bahn. Wir fuhren heran, stiegen ab und lehnten die Räder gegen die
Wand. Dann stellten wir uns unter und lauschten dem Regen, der auf
das Dach prasselte.
»Ich war ein Idiot, dass ich das vorhin gesagt habe«, meinte Drake
und strich sich die nassen Haare aus der Stirn. »Es gibt wirklich viele
Menschen, die sich trennen und dann wieder zusammenkommen.«
»Nein, du hast schon recht, ich …« Es gelang mir nicht, den Satz zu
Ende zu sprechen.
»Celia, ich glaube, du musst dich echt dahinterklemmen, deinen
Traum zu verwirklichen. Je mehr Energie du in dich selbst investi-
erst, desto weniger Gedanken machst du dir darüber, was deine El-
tern tun.« Drake legte eine Hand auf meinen Arm. »Du träumst dav-
on, eine berühmte Dichterin zu werden. Das ist es, was zählt. Ver-
sprich mir, dass du noch heute mit deiner Liste anfängst!«
Eine Woge aus schlechtem Gewissen durchströmte mich. Endlich
hatte ich einen besten Freund und ich log ihn an, was meine tiefsten
Wünsche betraf. Aber ich hatte mich schon zu sehr verstrickt. Was,
wenn ich ihm jetzt die Wahrheit gestand und er dann nicht mehr
mein bester Freund sein wollte? Außerdem ging er ja bald weg. War-
um also sollte ich die Zeit, die uns noch blieb, aufs Spiel setzen? »Du
hast recht, ich sollte mich um meinen Traum kümmern.«
»Heute Abend?«
»Heute Abend. Versprochen.«
***
Als ich in unser leeres Haus zurückkehrte, regnete es immer noch ein
wenig. Drake und ich hatten den Platzregen abgewartet, bevor wir
156/254

unsere Fahrt fortgesetzt hatten. Ich zog meine nassen Schuhe und
meine Jacke aus und durchwanderte die Wohnung, das Schlafzim-
mer, die Küche, das Wohnzimmer. Es fiel mir schwer, weder an
meinen Vater zu denken, daran, wie still es ohne ihn war, noch an
meine Mutter und was sie im Einkaufszentrum gemacht hatte.
Stattdessen hielt ich mich an Drakes Ratschlag und richtete meine
Gedanken auf meinen Traum.
In der Schule hatte ich eine Pseudoliste dazu angelegt, wie ich eine
berühmte Dichterin werden könnte. Ich musste daran weiter-
arbeiten, damit Drake mir glaubte. Der erste Punkt auf der To-do-
Liste meines vorgeblichen Traums hieß, eines meiner Gedichte bei
»Nexus«, der Schülerzeitung, einzureichen. Ich hörte also auf, nervös
herumzulaufen, schob eine Tiefkühlpizza in den Ofen, ging in mein
Zimmer und fuhr den Computer hoch. Ich loggte mich auf »Nexus«
ein und schickte mein Gedicht über Wale hin.
WALE SIND KEINE FISCHE,
SONDERN SÄUGETIERE
wenn eine walmutter ein junges gebiert,
kontrahiert ihr rücken bis hin zur schwanzflosse,
blut sendet einen valentinsgruß an die haie,
der ozean ist ihr krankenhaus.
sie nutzt ihren körper, um das junge zum atmen
an die wasseroberfläche zu halten.
denn sein atemloch hat keine andere wahl.
Dann checkte ich meine E-Mails. Leider war eine Nachricht meines
Vaters eingegangen.
157/254
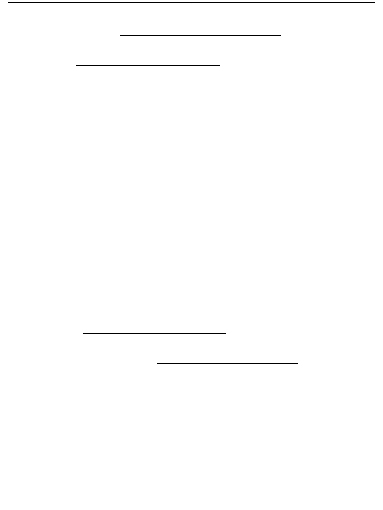
Betreff: Hallo Celia
Von: James Door (jdoor@cocacolacompany.com)
Gesendet: Sonntag, 19. September 11:39
An: Celia (celia@celiadiefinstere.com)
Hallo, meine Schnecke,
ich bin froh, dass du wegen unserer Trennung auf Probe
nachfragst. Aber ich glaube, wir sollten lieber darüber reden,
wenn wir uns sehen. Ich rufe deine Mom an und schaue, ob wir
ein Wochenende vereinbaren können, an dem ich nach Hershey
komme.
Bis dahin sollst du wissen, dass es mir hier in Atlanta gut geht.
Ich hoffe, dir und Mom geht es auch gut. Ich vermisse dich,
meine Schnecke.
Hab dich lieb, Dad
Seine Mail bestätigte meinen schrecklichsten Verdacht, vor allem der
Teil, in dem er schrieb, dass es ihm in Atlanta gut ging. Ich antwor-
tete nicht und schrieb stattdessen an Dora.
Betreff: Eltern
Von: Celia (celia@celiadiefinstere.com)
Gesendet: Sonntag, 19. September 18:59
An: Dorathea Eberhardt (deberhardt@berkeley.edu)
d,
habe meine mutter im einkaufszentrum mit einem anderen mann
gesehen. heißt das, sie ist mit ihm zusammen? und wenn ja,
heißt das, sie geht fremd, wo sie doch nur auf probe getrennt
sind? vielleicht unternehmen sie ja einfach nur so etwas mitein-
ander. geht sie damit schon fremd, oder muss man den anderen
zumindest richtig küssen? und wenn es dad in Atlanta gut geht
158/254

und es ihm egal ist, ob sie sich mit einem anderen mann trifft –
ist das dann auch fremdgehen?
c
Als die Pizza fertig war, nahm ich sie mit in mein Zimmer, machte
meine Hausaufgaben in Mathe und Erdkunde und schlief dann ein.
An meinen Aufsatz für Mr Pearson dachte ich nicht mal mehr.
159/254

25
»Wusstest du, dass die Schwulenbewegung in New York begonnen
hat?« Es war Montagmorgen und Drake fuhr auf dem Weg zur
Schule auf seinem Skateboard neben mir her. Er trug enge Jeans und
eine hellgrüne Kapuzenjacke mit weißem Reißverschluss und weißen
Kordeln. Ich hatte meinen karierten Wollrock und einen blauen
Pullover an, dazu meine schwarze Kapuzenjacke und Handschuhe
mit abgeschnittenen Fingern. Es war die dritte Septemberwoche und
die Luft roch schon ziemlich herbstlich.
»Die Polizei hat die Homosexuellen in Greenwich Village schik-
aniert, bis in einer Bar namens Stonewall Krawall ausgebrochen ist.
Danach haben sich die Schwulen und Lesben organisiert und eine
bessere Behandlung gefordert. Vielleicht können Japhy und ich mal
hingehen.«
Bei jedem Spalt im Gehsteig, über den Drake fuhr, gab sein Skate-
board ein ratterndes Geräusch von sich. »In dem Buch, das ich mir
ausgeliehen habe, steht, dass die Leute im Durchschnitt mit sechzehn
ihr Coming-out haben«, fuhr Drake fort, »und dass viele nicht gleich
darüber sprechen, sondern den richtigen Moment dafür abwarten.«
»Hast du auch schon etwas darin gefunden, das dir bei deinem Ge-
spräch mit Japhy hilft?«, fragte ich.
»Noch nicht«, sagte Drake und schwieg dann eine Weile. »Aber ich
werde auf jeden Fall mit ihm reden.«

Als wir die Schule erreicht hatten, zog ich mir die Kapuze herunter
und schwebte in die erste Stunde. Mir war, als hätte ich in den letzten
Tagen einen richtigen Panzer entwickelt. Ich hatte einen besten Fre-
und und befand mich auf einer Art Highway Richtung Rache.
Solange ich in der Schule war, fiel es mir leichter, die Ängste weg-
zuschieben, die ich seit der Begegnung mit meiner Mutter im
Einkaufszentrum hatte. Außerdem erforderte die Verwirklichung
meines Traums meine ganze Aufmerksamkeit.
Anmutig glitt ich auf meinen Platz. Sandy und Mandy flüsterten
über den Gang hinweg. Mr Pearson begann den Unterricht mit einem
kurzen Vortrag über die richtige Verwendung von Präpositionen und
ließ uns dann eine kurze Zusammenfassung des Textes schreiben,
den wir als Hausaufgabe gelesen hatten. Schnell brachte ich einige
Zeilen zu Papier und holte dann meine Kladde heraus, um ein Gedi-
cht über Drake fertig zu schreiben. Ich war so vertieft, dass ich nicht
bemerkte, wie Sandy aufstand und nach vorne zu Mr Pearsons Pult
ging. Ich bemerkte allerdings sehr wohl, dass Mr Pearson plötzlich
neben mir stand.
»Dein Heft, bitte«, sagte er und streckte seine Hand aus.
Ich schlug die Kladde zu und griff nach meinem Rucksack.
»Ich meinte nicht, dass du dein Heft wegstecken sollst, sondern
dass du es mir geben sollst.« Er schnippte kurz mit den Fingern und
streckte seine Hand erneut aus.
Mein Mund wurde trocken und meine Hände zitterten. Nicht mein
Notizbuch mit den Gedichten! Alles andere, aber das nicht!
»Tut mir leid. Aber ich hab es ja schon weggesteckt«, stammelte
ich.
161/254

»Ich sagte nicht, entschuldige dich, ich sagte, du sollst mir dein
Heft geben.« Er klang wie ein Monarch, der sich über seinen Unter-
tanen ärgert.
Ich saß da wie eine Eisskulptur. Ich blinzelte noch nicht einmal.
»Celia?«
Kaum fähig, meinen Arm zu bewegen, reichte ich ihm die Kladde.
»Ich werde dieses Heft so lange behalten, bis du deinen Aufsatz
über ›We Real Cool‹ geschrieben hast. Und weil inzwischen eine gan-
ze Woche vergangen ist, lieferst du mir anstatt drei sogar fünf Seiten,
zweizeilig getippt, in 12-Punkt-Schrift.« Er stolzierte zu seinem Pult
zurück, zog die große Schublade auf, warf meine Kladde hinein und
schob die Schublade energisch wieder zu. Dann setzte er sich, als
hätte er nicht gerade mein Herz in ein Konservenglas gestopft und
den Deckel zugeschraubt.
Ich konnte weder atmen noch denken. Aber ich bin sicher, mein
Mund stand offen, als Sandy und Mandy mir ihre Köpfe zuwandten.
Sie taten nichts weiter, als mich anzulächeln.
***
»Der Typ ist ein Monster«, meinte Drake, als ich ihm in der Mittags-
pause von Mr Pearson erzählte. »Totaler Napoleon-Komplex.«
Ich hielt mein Sandwich auf dem Schoß und war nicht in der Lage
zu essen. Ich spürte die Sonne im Nacken, machte mir aber nicht die
Mühe, meine Kapuze aufzusetzen. Alles fühlte sich wie taub an.
»Glaubst du, er wird darin lesen?«, fragte Drake.
Vielleicht war ich doch noch nicht ganz gefühllos, denn dieser
Gedanke versetzte mir einen heftigen Stich.
»Kommst du klar, wenn ich Basketball spiele?«, fragte er
vorsichtig.
162/254
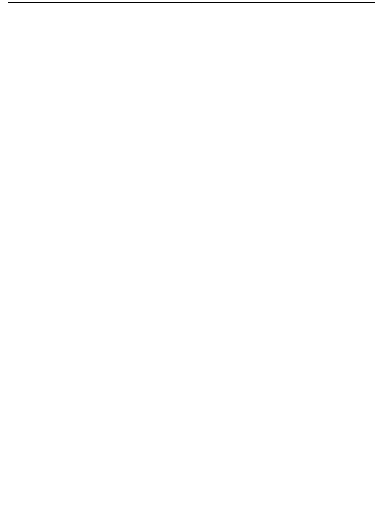
Ich nickte langsam und legte meine Habseligkeiten wie einen
Schutzwall um mich, während Drake zum Basketballfeld ging. Da es
unwahrscheinlich war, dass ich noch etwas essen würde, wickelte ich
mein Sandwich wieder ein. Sandy hatte offenbar nur darauf gewartet,
dass Drake mich allein ließ, denn wenige Augenblicke nachdem das
Spiel begonnen hatte, stakste sie mit Mandy auf ihren hohen Ab-
sätzen durchs Gras. Ich sah sie kommen, hatte aber keine Kladde,
hinter der ich mich hätte verstecken können.
»Es ist so erbärmlich, wie sie ihm überallhin folgt.« Mandy ver-
suchte noch nicht einmal zu verbergen, über wen sie sprach.
»Er hat mir erzählt, dass er nach New York zurückgeht«, sagte
Sandy. »Was macht sie denn dann?«
»Meine Mutter sagt, ihr Dad ist ausgezogen«, sagte Mandy. »Kein
Wunder.«
Das war zu viel! Dass sie von meinem Vater sprachen, war in etwa
so, wie wenn in einem Boxkampf Baseballschläger ins Spiel kommen.
Ich schnappte mir meinen Rucksack und sprang auf. Drakes Sachen
ließ ich einfach im Gras liegen. Ich peilte die nächstgelegene Tür des
Schulgebäudes an, steuerte um Gruppen von Schülern herum und
lief, so schnell es ging, zur Toilette. In der ersten freien Kabine ließ
ich meinen Rucksack zu Boden plumpsen, zog den Ärmel meines
Pullovers über die Hand und stopfte sie mir in den Mund, damit
niemand mein Schluchzen hörte.
Ich hatte gedacht, mein Panzer wäre dick genug, dass Sandy mir
nichts mehr anhaben konnte, dass meine Finsternis mich vor ihr
schützte. Ich lehnte meinen Kopf gegen das kühle Metall der Kabin-
enwand und weinte so sehr, dass kaum Tränen flossen. Ich schlug
mit einer Hand gegen die Wand und trat mit einem Fuß dagegen.
Eine furchtbare Wut zog sich wie ein Ausschlag über meinen Körper.
163/254

Schließlich atmete ich ein paarmal tief durch und zog meinen Ed-
dingstift aus dem Rucksack. Und während ich mir noch die Tränen
von den Wangen wischte, schrieb ich auf die Toilettenwand:
Sandy F. wollte mit Drake B. zum Schulball gehen.
Aber er hat NEIN gesagt.
Es war Zeit, den Rachefeldzug zu starten.
164/254

26
Nach der Schule blieb mir nichts anderes übrig, als mit dem Aufsatz
für Mr Pearson anzufangen. Mom hatte wieder Spätschicht. Ich
musste mir also keine Sorgen darüber machen, wie ich ihr nach dem
Vorfall im Einkaufszentrum begegnen würde. Trotzdem schien es
mir unmöglich, mich so lange zu konzentrieren, dass ich fünf Seiten
vollschreiben konnte. Aber mir blieb keine andere Wahl. Ohne meine
Kladde würde ich nicht überleben. Ich setzte mich an den Computer
und schwafelte irgendetwas über ›We Real Cool‹ zusammen, aber
meine Gedanken kehrten immer wieder in die Schule zurück.
Bis zum Ende der Mittagspause war ich in jeder Mädchentoilette
gewesen und hatte die beiden Sätze in jede Kabine geschrieben. Jetzt
konnte ich nur hoffen, dass das Gerücht irgendwie in Umlauf kam.
Ich tippte zwei Seiten darüber herunter, wie die Dichterin Reim und
Metrum verwendete, um das Thema der Entfremdung der Jugend zu
zeigen, bla, bla, bla, aber es war vollkommen aussichtslos, fünf Seiten
vollzukriegen.
Während ich an meinem Aufsatz arbeitete, kam eine E-Mail von
Dora.
AW: Eltern
Von: Dorathea Eberhardt (deberhardt@berkeley.edu)
Gesendet: Montag, 20. September 17:57
An: Celia (celia@celiadiefinstere.com)

celia,
eltern machen alles mögliche, wenn sie versuchen, »sich zu find-
en«. weißt du noch, wie meine mutter sich nach der scheidung
alyce
genannt
hat
statt
alice?
sie
wollte
ihren
»Hausfrauennamen« gegen einen »Künstlernamen« eintauschen,
sagte sie damals. inzwischen verbringt sie ihre gesamte zeit mit
ihren ölfarben auf dem dachboden. mein dad trägt seine midlife-
crisis wie eine ehrenplakette zur schau: blonde freundin, sport-
wagen, wohnung in los angeles, das ganze programm. wir haben
zurzeit überhaupt keinen kontakt. solange er seine männlichen
privilegien
nicht
zugibt,
kann
ich
mich
mit ihm
nicht
auseinandersetzen.
vielleicht verbringt deine mom einfach zeit mit anderen
menschen, weil sie herausfinden will, wer sie ist. wenn du mich
fragst, dann konzentriere dich auf dich selbst. versuch, dir keine
sorgen darüber zu machen, was sie tun. so bin ich damit
klargekommen.
d
Ich warf mich auf mein Bett und versuchte, mir meine Eltern als zwei
einzelne Menschen vorzustellen und mein Leben als etwas, das nicht
an ihre Entscheidungen gebunden war. Ich stellte mir meinen Dad in
Atlanta mit einer blonden Freundin und einem Sportwagen vor und
meine Mutter mit einem Freund namens Simon. Es gelang mir sogar,
mir ein Bild davon zu machen, wie sie beide ihr eigenes Leben lebten.
Das Problem war nur, dass ich nicht wusste, wo mein Platz darin
war. Meine Gedanken drehten sich im Kreis und der Magen tat mir
weh.
Drake und Dora gaben mir denselben Rat: Vergiss deine Eltern,
konzentriere dich auf deinen Traum! Ich beschloss, meine Mom
nicht nach dem Typen im Einkaufszentrum zu fragen. In Wahrheit
166/254

war ich mir nämlich nicht sicher, ob ich hören wollte, was sie viel-
leicht antworten würde.
***
Als ich ins Bett ging, war mein Aufsatz immer noch nur zweieinhalb
Seiten lang. Dennoch nahm ich ihn am nächsten Morgen mit zum
Unterricht. Ich stellte meinen Rucksack neben meinen Stuhl, nahm
den Ausdruck aus meinem Ordner und ging damit zu Mr Pearsons
Pult. Ich versuchte, nicht allzu finster zu wirken. »Ich hab fast die
Hälfte. Wenn ich mein Notizbuch zurückhaben könnte, würde ich
den Aufsatz heute Abend fertig schreiben. Versprochen.«
»Ich freue mich, dass du endlich mit deinem Aufsatz angefangen
hast.« Mr Pearson schob seinen Stuhl zurück und schlug die Beine
übereinander. »Allerdings bist du eine Woche zu spät dran und
außerdem hattest du ihn mir für gestern versprochen. Ich möchte die
vollständige Fassung haben. Erst dann kann ich dir dein Notizbuch
zurückgeben. Es ist mir nicht entgangen, wie sehr es deine
Aufmerksamkeit bindet.«
In der Tasche meiner Kapuzenjacke ballte sich meine linke Hand
zur Faust.
»Aber ursprünglich sollten es doch nur drei Seiten sein …«
»Die Antwort lautet Nein. Und um ehrlich zu sein: Wenn ich
gewusst hätte, dass es eine solche Bedeutung für dich hat, hätte ich
dir das Heft schon früher weggenommen. Jetzt setz dich wieder hin.«
Ich drehte mich um und schlurfte an meinen Platz zurück. Sandy
und Mandy grinsten, als hätten sie einen Schönheitswettbewerb ge-
wonnen. In meiner Brust schlug ein Hammer auf ein und denselben
Nagel: Rache, Rache, Rache.
167/254

Vor der dritten Stunde traf ich mich mit Drake am Spind und wir
gingen gemeinsam zum Erdkunderaum.
»Dann wollen wir jetzt einmal die Wahrheit herausfinden über die
Biosphäre«, machte Drake unseren Lehrer, Mr Diaz, nach.
Wir kamen an einem der Plakate vorbei, auf denen der Schulball
angekündigt wurde.
»Hey, Drake«, sagte ich und räusperte mich geräuschvoll, während
wir uns durch eine Schar von Schülern und Schülerinnen drängten.
»Hast du eigentlich schon deinen Anzug für den Ball gekauft?«
Drake blieb so unvermittelt stehen, dass ein Mädchen mit ihm
zusammenstieß. Er sah sich um und trat dann nahe an mich heran.
»Willst du da wirklich hin?«, fragte er. »Zu Saftbowle, billigen
Kleidern und Leuten, die du hasst und die in der Sporthalle zu
schlechter Musik tanzen?«
»Klingt schrecklich«, flüsterte ich, »aber Sandy hast du gesagt,
dass du hingehst. Wenn wir nicht dabei sind, weiß sie, dass du gelo-
gen hast.« Mein Plan drohte zu platzen! Plötzlich wollte ich nicht
mehr, dass die anderen uns über den Ball reden hörten.
»Stimmt schon, aber ich bin nächste Woche weg und sehe sie nie
wieder. Es war nur eine Ausrede«, erwiderte Drake schulterzuckend.
»Wen kümmert es schon, wenn Sandy mitkriegt, dass ich gelogen
habe?«
Ich musste schnellstens meine Taktik ändern. »Es wird wahr-
scheinlich todlangweilig, aber so ein Ball kann eine äußerst frucht-
bare Erfahrung sein«, flüsterte ich. »Wir gehen aus Scheiß hin! Wir
tun so, als wären wir Forscher, die amerikanische Teenager
beobachten.«
»Ist mit fruchtbar vielleicht das gemeint, was ich mir gerade so
denke?«, fragte Drake anzüglich. Dann bemerkte er meinen
168/254

Gesichtsausdruck. »Okay«, sagte er. »Gehen wir eben hin. Es ist
mein letztes Wochenende in Hershey. Es wird bestimmt cool, mit dir
abzuhängen. Aus Scheiß … oder wie auch immer.«
»Nächstes Wochenende kaufe ich mir mein Kleid«, sagte ich mit
fester Stimme und blickte mich unmerklich um.
Drake sah mich fragend an und öffnete die Tür zum
Klassenzimmer.
***
Als Drake in der Mittagspause wie gewohnt Basketball spielte, saß ich
im Gras und dachte mir einen kleinen Briefwechsel aus. Damit es so
aussah, als stammte er von zwei verschiedenen Personen, schrieb ich
die Antworten mit der linken Hand.
muss dir was erzählen.
WAS DENN?
sandy f. wollte mit diesem heißen skateboard-typen
zum schulball und er hat sie abblitzen lassen
MEHR!
stattdessen geht er mit diesem mädchen mit der
kapuzenjacke
Ich faltete das Papier zusammen und zerknüllte es ein wenig, damit
es so aussah, als wäre das Briefchen ein paarmal gelesen worden.
Dann stand ich auf und ging zum Mülleimer, um die Alufolie meines
Sandwiches wegzuwerfen. Auf dem Weg dorthin »verlor« ich den
Zettel im Gras. Ich ging zu meinem Platz zurück und setzte meine
169/254

Sonnenbrille auf. Drake war total auf das Spiel konzentriert und
machte wie gewöhnlich jede Menge Punkte für seine Mannschaft.
Ich behielt den Zettel im Auge wie einen Dollarschein, der an eine
Schnur gebunden ist, und wartete darauf, dass ein neugieriger
Passant ihn aufhob. Ein Paar Schuhe nach dem anderen marschierte
bis zum Ende der Pause an dem Zettel vorbei, einige traten sogar da-
rauf. Aber kein einziger Schuh blieb stehen, damit sein Besitzer sich
bücken und den Zettel inspizieren konnte. Als es schließlich gongte,
hob ich das Papier selbst auf. Im Gang hab ich es noch einmal fallen
lassen, aber niemand biss an. Meine Briefchen-Idee verlief im Sand.
***
»In Kapitel vier vergleicht Buddy unsere Träume mit Tigern. Er sagt,
dass man die richtige Falle auslegen und sich dann auf die Lauer le-
gen und warten muss«, erklärte Drake, während er auf dem Nach-
hauseweg sein Skateboard neben mir anschob. »Er meint, das ist
wohl effektiver, als einen Tiger zu jagen.«
»Klar«, sagte ich, war aber nicht in der Laune, mir eine Lektion
zum Thema Geduld reinzuziehen. Bis zum Schulball waren es nur
noch eineinhalb Wochen. Niemand schien mein Gerücht verbreiten
zu wollen und mein Begleiter hatte keine richtige Lust hinzugehen.
Aber ich konnte nicht einfach nur dasitzen und warten, dass sich
meine Rache von selbst vollzog.
Ehrlich gesagt hatte ich auch keine Lust, zum Ball zu gehen. Die
Aussicht, mit meinen Mitschülern bei Saftbowle und Salzbrezeln her-
umzustehen, klang wie Folter. Es sollte nur jeder denken, dass Drake
und ich zusammen hingingen. Sonst würde mein Plan nicht
funktionieren.
170/254

»Gestern Abend habe ich mit meinen Eltern telefoniert und ihnen
gesagt, dass sie Japhy und seine Eltern für Samstag einladen sollen.«
Drake war irgendwie abwesend und schien eher mit den Bäumen zu
sprechen als mit mir. Ich trottete neben ihm her und versuchte, alles
zu verstehen. »Mein Dad hat gesagt, am Wochenende sprechen wir
über Plan B – für den Fall, dass ich an keiner Kunstschule aufgenom-
men werde. Wie soll ich ihm nur klarmachen, dass es nichts nützt,
wenn man zweifelt. Ich müsste ihn dazu bringen, Buddys Buch zu
lesen, dann würde er mich verstehen. Vielleicht nehme ich es mit
nach New York.«
»Bleibst du vielleicht doch in Hershey?«, fragte ich und zog nervös
an den Riemen meines Rucksacks.
»Daran will ich im Moment nicht einmal denken!«, erwiderte er
und fuhr mit seinem Skateboard ein elegantes großes S. »Vier Tage
habe ich noch, um mir zu überlegen, was ich Japhy sagen werde. In
einem der Bücher, die ich ausgeliehen habe, heißt es, dass homo-
sexuelle Jugendliche doppelt so häufig drogen- und alkoholgefährdet
sind wie andere. Glaubst du, dass Japhy deshalb an dem Abend et-
was trinken wollte? Weil er nicht akzeptieren kann, wie er ist?«
Ich hatte immer mehr das Gefühl, Drake in seiner Theorie über
Japhy bestärken zu müssen. »Vielleicht«, antwortete ich vage. »Kön-
nte sein.«
Ich war mir aber nicht einmal sicher, ob Drake mich überhaupt ge-
hört hatte. »Du willst also wirklich zum Schulball gehen?«, wechselte
er das Thema.
»Ja«, log ich unbeholfen. »Will ich wirklich.«
»Okay, aber ich ziehe keinen Anzug an. Chucks und eine schmale
Krawatte, das muss reichen. Japhy wird schon verstehen, dass wir
beide einfach nur Kumpel sind.«
171/254

***
Obwohl meine Mutter wieder Spätschicht hatte, schlug ich Drakes
Einladung, noch ins Wäldchen mitzukommen, aus. Ich zwang mich,
nach Hause zu gehen und drei weitere Seiten über die metaphorische
Bedeutung herauszuwürgen, die der Besuch eines Billardsalons
hatte, anstatt in die Highschool zu gehen. Bis zum frühen Abend
begann sich der Schreck darüber, dass mein Notizbuch noch immer
beschlagnahmt war, zu verflüchtigen. Dafür wuchs der dringende
Wunsch, Rache zu üben, mit jeder Minute. Es wurde Zeit, die Sache
zum Laufen zu bringen. Die Tage vergingen, ohne dass etwas
passierte.
Am Mittwochmorgen marschierte ich in den Englischunterricht,
stellte meinen Rucksack ab und ging tapfer nach vorn zu Mr Pearson.
Ich warf ihm meinen Aufsatz auf den Tisch, fünf Seiten, links oben in
der Ecke zusammengeheftet. Er sah von seinem Computer auf und
musterte mich über den Rand seiner Brille hinweg. Dann blätterte er
die Seiten durch, las irgendwo in der Mitte ein paar Sätze und öffnete
schließlich seine Schreibtischschublade, in der mein Notizbuch
schlief. Er wollte es mir schon zurückgeben, da hielt er noch einmal
inne. Er nahm seine Brille ab und sah mich eindringlich an. »Ich
weiß sehr wohl, dass du intelligent bist und gerne schreibst«, sagte
er. »Deine Beiträge im Unterricht, wenn du denn welche ablieferst,
sind einleuchtend und gut formuliert. Aber du bemühst dich nicht.
Warum strengst du dich nicht ein bisschen mehr an?«
Ich hatte mein Notizbuch so gut wie zurück. Meine Hände waren
drauf und dran, es einfach zu schnappen, ohne dass mein Kopf seine
Einwilligung dazu gegeben hatte.
»Keine Ahnung«, sagte ich wenig überzeugend.
172/254

»Kannst du mir versprechen, dass du dich von jetzt an anstrengen
wirst?«
»Ja.« Klar. Natürlich. Alles. Notizbuch. Zurück. Sofort!
»Also, dann«, sagte er und drückte es mir in meine gierigen
Klauen.
Während ich an Sandy und Mandy vorbeiging, hielt ich mein Not-
izbuch fest in der Hand und verstaute es schließlich in meinem Ruck-
sack. Den ganzen Unterricht über hatte ich ein Bein darauf liegen.
Nach der Stunde ging ich zu meinem Spind, um mein Französis-
chbuch zu holen. Erfreut stellte ich fest, dass Becky Shapiro ebenfalls
zu ihrem Spind gekommen war. Becky gehörte nicht nur zu den
wenigen Menschen, denen ich an der Schule einigermaßen vertrauen
konnte, sie war auch das jüngste Opfer von Sandys Boshaftigkeit.
»Hallo, Becky«, sagte ich mit süßer Stimme und gab meinen Code
ein.
»Hi, Celia«, antwortete sie und lachte nervös.
»Weißt du, was mir diese Woche passiert ist?« Ich sah sie nicht an,
während ich mein Französischbuch unter dem Mathebuch hervorzog.
»Was denn?« Becky kam näher heran. Sie lehnte sich gegen die
Spindtür.
»Drake Berlin hat mich gefragt, ob ich mit ihm zum Schulball
gehe«, flüsterte ich und beugte mich dabei zu ihr.
»Oh!« Becky strahlte. »Ich habe euch zusammen gesehen. Er ist so
süß!« Sie klatschte in die Hände, während sie ihre Bücher unter ein-
en Arm geklemmt hielt.
»Nur eins ist blöd«, fuhr ich fort, immer noch im Flüsterton. Becky
sah sich im Gang um und kam noch näher. »Sandy Firestone hat
Drake zuerst gefragt und er hat abgelehnt. Er hat mir gesagt, er
173/254

würde niemals mit jemandem hingehen, der …«, ich machte eine
Pause, »… so uncool ist.«
Beckys Augen funkelten wie Diamanten. »Sie ist wirklich nicht
cool«, sagte sie entschieden. »Nicht die Bohne.«
»Aber versprich mir, dass du mit niemandem darüber sprichst«,
bat ich sie. »Ich würde mich echt scheiße fühlen, wenn es rauskäme.«
»Versprochen«, erwiderte Becky und schloss die Tür ihres Spinds.
Dann gingen wir beide zum Unterricht.
***
»Mom und Dad haben Japhys Familie zum Abendessen eingeladen«,
berichtete Drake in der Mittagspause. »Aber sie haben noch keine
Antwort bekommen.«
Ich saß im Gras, in meinem Schoß lag mein Notizbuch. Bedächtig
strich ich mit der Hand über den Einband.
»Buddy sagt, es gibt immer Gründe, die Verwirklichung seiner
Träume aufzuschieben. ›Die einzige Möglichkeit, seinen Traum zu
leben, ist, den Traum selbst zum einzigen Grund zu erklären‹«, zit-
ierte er. Ich hatte allmählich genug von Buddy Strongs unsinnigen
Mantras. Aber Drake schien das halbe Buch auswendig gelernt zu
haben.
Ich wusste nicht, ob Becky Shapiro das Hamsterrad der Gerüchte
schon in Gang gebracht hatte. Aber ich wusste, dass die sicherste
Möglichkeit, ein Gerücht in die Welt zu setzen, darin besteht, je-
manden zu bitten, etwas für sich zu behalten. Im Moment kam Drake
und mir allerdings nicht mehr Aufmerksamkeit zu als sonst. Er
spielte Basketball und ich saß im Gras und schrieb ein Gedicht zu
Ende, das ich am Montag begonnen hatte. Sandy und Mandy ließen
sich nicht blicken.
174/254

***
Am Mittwochabend aß ich mit meiner Mom zusammen. Wir hatten
Spaghetti gekocht und uns zum Essen vor den Fernseher gesetzt.
Vom Einkaufszentrum sagte ich keinen Mucks.
175/254

27
Am Donnerstagmorgen öffnete ich vor der ersten Stunde gerade
meinen Spind, als Becky Shapiro auftauchte. Ich bemerkte sie, als sie
ihren Code eingab. »Hast du schon ein Kleid für den Ball?«, fragte sie
freundlich.
»Ich werde jetzt am Wochenende danach schauen«, sagte ich mit
einem schwachen Lächeln. Obwohl ich Becky nicht besonders gut
kannte, hatte ich plötzlich ein schlechtes Gewissen, weil ich sie an-
gelogen hatte.
»Ich wollte dir nur sagen, dass ich niemandem erzählen werde,
was du mir gestern erzählt hast«, flüsterte sie und schenkte mir ein
aufrichtiges Lächeln. Offenbar war sie stolz, mein Vertrauen zu
besitzen.
»Oh … danke, Becky«, antwortete ich und hatte Mühe, meine Ent-
täuschung zu verbergen. Ich musste mich wohl an ein paar fiesere
Leute heranmachen.
Der Ball sollte am Samstag in einer Woche stattfinden, und mein
Gerücht weigerte sich standhaft, sich zu verbreiten. Irgendwie
musste ich jetzt Ernst machen. Der Countdown lief.
Ich ging in den Englischraum und wollte mich gerade setzen, als
Mr Pearson mich nach vorne rief. Zögernd ging ich zu ihm. »Sehr
gut, Celia«, sagte er und reichte mir meinen Aufsatz. »Das bestätigt
meinen Verdacht, dass du in Englisch nicht alles gibst, was in dir
steckt. In Zukunft erwarte ich mehr Beteiligung am Unterricht und

eine fristgerechte Abgabe der Hausaufgaben«, sagte er bestimmt.
»Für die Verspätung habe ich Punkte abgezogen, aber es ist immer
noch ein A minus.« Er lächelte nicht, sondern entließ mich, indem er
sich wieder seinem Computer zuwandte.
Als ich mich zur Klasse umdrehte, sah ich Sandy und Mandy hinter
vorgehaltenen Händen tuscheln und immer wieder Blicke auf mich
werfen. Meinen Aufsatz hielt ich fest in der Hand. Dies war nicht der
richtige Augenblick, um mich über ein A minus zu freuen. Meine
Rache erforderte meine gesamte Konzentration. Noch eine Woche!
Ich musste den Tiger im Auge behalten, wie Buddy Strong es aus-
drücken würde. Ich ging zurück zu meinem Platz und setzte mich.
»Okay, bitte nehmt etwas zu schreiben heraus und ein Blatt Papier
für einen kleinen Test über unsere gestrige Lektüre, das letzte Kapitel
von ›Wer die Nachtigall stört‹.«
Wie die ganze Klasse stöhnten auch Sandy und Mandy, während
sie ihre Tische leer räumten. Ich nahm ein Blatt Papier aus meinem
Rucksack.
Mandy drehte sich um und griff nach ihrer Tasche, die über ihrer
Stuhllehne hing, um einen Stift herauszuholen. Als sie die Tasche
wieder zurückhängen wollte, verfing sich einer der Henkel an der
Ecke ihres Tisches. Lippenstift und Schminkpinsel, Kajal und Lip-
penbalsam, ihr Geldbeutel und die Schlüssel – einfach alles verteilte
sich auf dem Fußboden. Ihr Handy rutschte über das Linoleum und
blieb direkt vor meinem Schuh liegen.
Ohne lange nachzudenken, stellte ich meinen rechten Fuß sorgsam
vor meinen linken und verbarg auf diese Weise das Handy zwischen
meinen Schuhen.
Mandy und Sandy drehten sich beide um und bückten sich, um
alles wieder aufzuheben. »So«, sagte in diesem Moment Mr Pearson,
177/254

»der Fünf-Minuten-Test beginnt.« Er knipste den Projektor an und
an der Wand erschienen zehn Fragen zum Ende des Romans.
»Scheiße.« Mandy suchte immer noch hektisch ihre Sachen
zusammen und stopfte sie in ihre Tasche zurück.
»Du Spast.« Sandy schüttelte den Kopf, während sie Mandys Lip-
penstift und Pinsel in deren Tasche fallen ließ und Mandy diese da-
raufhin wieder über die Stuhllehne hängte. Dann drehten sich beide
um und widmeten sich dem Test.
Mein Herz raste. Zweifellos hatte das Schicksal bei diesem Vorfall
seine Hand im Spiel gehabt. Das musste ein Zeichen sein! Die
Gezeiten wechselten und trieben meine Rache unter vollen Segeln
hinaus auf die hohe See.
Ich behielt Sandy und Mandy im Auge, um sicher zu sein, dass sie
sich auf ihren Test konzentrierten, und zog behutsam die Füße mit
dem Handy dazwischen heran. Sobald das Handy neben meinem
Rucksack lag, griff ich an meinen Knöchel und tat, als müsste ich
mich kratzen. Dabei hob ich das Telefon unauffällig auf und steckte
es in meine Jackentasche. Anschließend beantwortete ich die zehn
Fragen in zwei Minuten.
»Ja, Celia?«, sagte Mr Pearson, als ich die Hand hob.
»Kann ich bitte zur Toilette gehen? Ich bin mit dem Test fertig.«
Mr Pearson nickte und ich unternahm die gewaltige Anstrengung,
lässig aus dem Klassenzimmer zu gehen. Ich schlurfte geradezu
hinaus, denn nur so konnte ich verhindern zu rennen. Mit einer
Hand umklammerte ich das Handy in meiner Tasche. Tief durchat-
men!, sagte ich mir. Tief durchatmen!
Auf der Toilette vergewisserte ich mich, dass außer mir niemand
da war, und schloss mich in einer Kabine ein. Ich klappte das Handy
auf, schaltete es ein und konnte nur beten, dass es kein Passwort
178/254

hatte. Das Display leuchtete auf, es vibrierte einmal, und dann er-
schien ein Foto von Sandy und Mandy in Badeanzügen am Strand.
Kein Passwort also. Ich träumte nicht. Ich hielt Amanda Hewtons
Telefon in der Hand!
Ich musste ein bisschen herumprobieren, bevor es mir gelang, eine
SMS zu schreiben. Gleichzeitig durfte ich nicht allzu lange vom Un-
terricht wegbleiben, ohne Verdacht zu erwecken. Ich tippte also, so
schnell ich konnte, mit beiden Daumen.
neuester klatsch: sandy f bei drake b für sball abgeblitzt. d findet
s uncool & geht mit celia d
Dann wählte ich alle Namen aus, die mir in Mandys Adressbuch
bekannt vorkamen, von Mitschülerinnen bis hin zu Jungs aus der
Basketballmannschaft. Es war ziemlich eindeutig, dass Mandy an Be-
liebtheit zugelegt hatte. Ich wählte sogar einige Namen aus, die ich
nicht kannte. Nach einigen Minuten hatte ich die SMS an über hun-
dert Leute geschrieben. Und das Beste daran war, dass alle glauben
würden, sie stammte von Mandy, der zukünftigen Exfreundin von
Sandy Firestone!
Ich habe noch nie geraucht, aber jetzt hatte ich den unstillbaren
Wunsch, mir eine Zigarette anzustecken. Diesen Moment galt es aus-
zukosten, eine Erfahrung, die eines langen Gedichtes würdig war –
und das zukünftige Außenseiter beim Schulfest vortragen würden.
Ich war David, der Goliath besiegte. Ich war der einsame Krieger. Ich
verließ die Toiletten und trat den Rückweg zum Klassenzimmer an.
In meinem Kopf dröhnte Opernmusik, meine Füße bewegten sich in
Zeitlupe. Ich hatte gerade das Schwert aus der Scheide gezogen.
***
179/254

Die Englischstunde verging, als hätte sich nicht soeben auf der Mäd-
chentoilette ein bedeutsames Ereignis abgespielt. Mr Pearson be-
sprach die Antworten zum Test. Ich war ziemlich sicher, dass ich ihn
bestanden hatte, trotz meiner Ablenkung. Auch Sandy und Mandy
wirkten erstaunlich zufrieden dafür, dass sie so gestresst gewesen
waren. Na, freut euch, dachte ich. Irgendwie hatte ich das Gefühl,
dass ihre Zufriedenheit nur bis zum nächsten Gong reichen würde,
nämlich bis zu dem Moment, in dem die Schüler in der Pause auf
dem Gang ihre Handys einschalteten.
Mit der Hand in meiner Jackentasche saß ich da und wusste, dass
ich noch einmal auf den Kompass schauen musste, bevor ich den
dunklen Wald hinter mir hatte. Als der Gong schließlich erklang,
standen alle auf. Es erwischte mich fast auf dem falschen Fuß, dass
Sandy und Mandy es so eilig hatten, das Klassenzimmer zu verlassen.
Aber sie kamen nicht schnell genug hinaus. An der Tür gab es einen
Engpass, weil zu viele Schüler auf einmal hindurchdrängten, und so
hatte ich genug Zeit, mich hinter Mandy zu stellen und ihr das Tele-
fon in die Tasche zu schieben. Das perfekte Verbrechen!
Draußen auf dem Flur folgte ich Sandy und Mandy zum nächsten
Klassenzimmer. Sie gingen schnell und sahen sich immer wieder um,
als ahnten sie die Katastrophe, die sich gleich ereignen würde. Ich
blieb vor dem Französischraum stehen, lehnte mich gegen eine Säule
und sah zu, wie die Schüler durch die Gänge drängten und schoben.
Ich schloss die Augen und lauschte zwischen all den Stimmen und
dem Tumult auf die Telefone, die sich meldeten, auf das Piepsen, das
Zwitschern und was es sonst noch für Klingeltöne gibt, wenn eine
SMS eingeht; auf das Gelächter und das wiederholte »O Gott, hast du
sie auch gekriegt?«. Es klang wie in einem künstlichen Wald, in dem
180/254

elektronische Vögel sangen. Es war das lieblichste Geräusch, das ich
je vernommen hatte.
In diesem Moment hörte ich Sandy Firestones Stimme. »He, was
zum Teufel ist denn das?« Ich öffnete die Augen und sah, wie Sandy
die Hand in die Schulter ihrer Freundin krallte. Die beiden standen
vor Mandys Spind und sahen auf das Handy, das ihnen ein weiteres
Mädchen entgegenhielt.
»Aber schau doch mal auf die Zeit«, verteidigte sich Mandy. »Das
war ich nicht! Als diese SMS gesendet worden ist, saß ich in Englisch
neben dir.«
Das war für mich das Stichwort zu verschwinden. Ich lief ins
Klassenzimmer und unterhielt mich in meiner Dialoggruppe fröhlich
mit Liz und Vanessa, während ich im Kopf immer wieder den
Wortwechsel zwischen Sandy und Mandy durchging. Im Stillen ver-
suchte ich »He, was zum Teufel ist denn das?« ins Französische zu
übersetzen. Es heißt ja immer, Rache sei süß, aber ich würde sie eher
als herzhaft beschreiben, mit einem Hauch Schärfe, wie ein richtig
gutes Curry.
Auch nach der Stunde labte ich mich noch an jenem be-
rauschenden Gericht, als ich auf dem Weg zum Erdkundeunterricht
Drake traf. »Hattest du heute schon Spanisch mit Sandy?« Ich kon-
nte mir die Frage nicht verkneifen, versuchte aber, lässig zu klingen.
»Sie war nicht da«, antwortete Drake abwesend. »Ich habe immer
noch keine Antwort von meinen Eltern wegen der Einladung am
Wochenende. Kannst du dir vorstellen, warum das so lange dauert?«
»Sie war nicht da?«
»Wer?«
»Sandy.«
»Nein. Warum?«
181/254

»Oh, das ist seltsam. Heute früh war sie nämlich da«, antwortete
ich. Ob sie so sauer war wegen der SMS, dass sie nach Hause gegan-
gen war?
»Wie ungezogen! Sie hat wohl geschwänzt«, feixte Drake. »Aber
wenn du dir Gedanken machst um sie und den Schulball, dann sag
ich ihr einfach, dass ich schon früher nach New York zurückgehe.«
»Aber ich habe die Tickets doch schon gekauft«, log ich. »Jetzt
müssen wir auch hingehen.«
»Na gut. Wenn der Ball am Samstag ist, dann fahre ich eben am
Sonntag nach New York«, meinte Drake mit einem Nicken und
öffnete die Tür zum Klassenzimmer.
Im Unterricht versuchte ich mich auf den Pazifischen Feuerring
und die schrecklichen Erdbeben zu konzentrieren, die sich entlang
des Rings ereigneten. Dabei gab mir das Beben, das sich in meinem
Inneren abspielte, schon genug zu denken. Die aufgestaute Spannung
drohte zu explodieren. Die Erleichterung, die die Erde nach einem
Beben der Stärke neun empfinden musste, war bestimmt fantastisch.
Ich konnte es kaum erwarten, dass endlich Mittagspause war und ich
wieder das Piepsen und Klingeln hörte. Ich warf einen Blick auf
Drake zwei Reihen vor mir und grinste. Ich hatte einen besten Fre-
und und ich nahm endlich Rache. Hätte mir etwas Besseres passieren
können? Als es schließlich gongte, schob ich mein Erdkundebuch in
meinen Rucksack und stand auf. In diesem Moment bemerkte ich et-
was, das mir zuvor nicht aufgefallen war. Dazu war ich zu aufgeregt
und zu abgelenkt gewesen.
»Ich kann mein Notizbuch nicht finden«, erklärte ich, als Drake an
meinen Tisch trat. Ich durchsuchte meinen ganzen Rucksack.
»Wahrscheinlich hast du es in deinem Spind liegen lassen«, ant-
wortete er ungerührt, »oder in Französisch.«
182/254

Ich fing an, meinen Rucksack Stück für Stück auszuräumen.
Nichts. Hektisch drehte ich ihn um und schüttete den kompletten In-
halt auf den Tisch. Erdkundebuch, ›Wer die Nachtigall stört‹, zwei
Hefte, Stifte, Pflaster, ein Klebestift. Keine Kladde.
»Geht bitte hinaus«, forderte uns Mr Diaz auf. »In der Mittags-
pause schreiben hier einige Schüler einen Test nach.«
Meine Hände zitterten, während ich all meinen Krempel wieder im
Rucksack verstaute. Keine Panik, versuchte ich mich zu beruhigen.
Noch nicht.
»Wir treffen uns draußen auf der Wiese«, sagte ich zu Drake und
rannte hinaus, Richtung Französischraum. Bei jedem Schritt stieß ich
ein kleines Stoßgebet aus. Auf dem Flur standen Schüler in Gruppen
vor einem Plakat, wahrscheinlich einer Aufforderung, sich an den
Vorbereitungen zum Schulball zu beteiligen.
Ich platzte in den Französischraum. »Ich glaube, ich habe mein
Notizbuch hier …«
»Celia«, unterbrach mich Ms Arnold. »Je ne comprends pas. En
français.«
Ich kratzte mich am Kopf, zwang mein Hirn, auf der Stelle französ-
isch zu denken. »J’ai … verloren … mon journal de poesie, et je pense
que j’ai … vergessen … ici«, brachte ich reichlich erbärmlich hervor.
Mademoiselle Arnold sah sich um und zuckte die Schultern. »Je
n’ai pas localisé un journal, mais …«
Unhöflicherweise wartete ich nicht ab, bis sie ihren Satz zu Ende
gesprochen hatte, sondern raste sofort zurück zu Mr Pearson. Ich
betete, dass er mich über den Rand seiner Brille hinweg ansehen und
mich ermahnen würde, nicht so vergesslich zu sein – und mir dann
mein Notizbuch zurückgab.
183/254
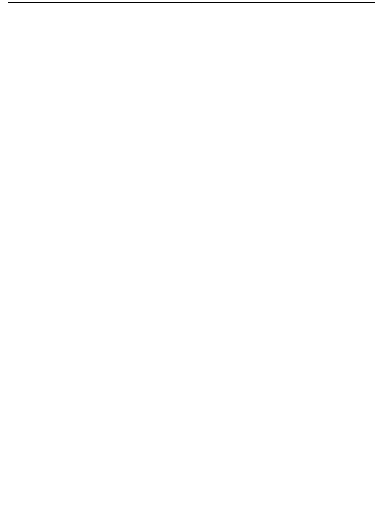
Auf dem Weg zum Englischraum aber stach mir der Anschlag ins
Auge, den meine Mitschüler anstarrten. Es war kein Plakat für den
Schulball. Es war überhaupt kein Plakat. Es war eine Fotokopie auf
knallgelbem Papier, und unzählige dieser Anschläge klebten den gan-
zen Gang entlang, im Abstand von etwa fünf Metern, an den
Wänden. Was darauf stand, sechs Zeilen lang und in meiner Hands-
chrift geschrieben, war mir so vertraut, dass mir auf der Stelle
schlecht wurde. Ich zwang mich, hinzulaufen und riss die erstbeste
Kopie, die ich zu greifen bekam, von der Wand. Am oberen Rand
stand:
Ein Gedicht aus dem tiefschürfenden und bedeutenden
Werk von Emo Celia D.
Und dann folgte mein Gedicht:
Seit Drake mir damals im Wäldchen gestand,
während die Blätter der Schwerkraft zu Boden folgten,
dass er Jungs statt Mädchen mag, ist es einfacher,
ihn zu lieben. Ihn zu lieben fühlt sich an wie zählen oder
telefonieren. Wie alles, das nicht anstrengt. Ich bin
wie ein Blatt, das nichts weiter tun muss als fallen.
Die verschnörkelte Schrift über dem Gedicht erkannte ich sofort. Sie
quälte mich immerhin schon seit der achten Klasse. Ich rief mir ins
Gedächtnis, wie ich vor Mr Pearsons Pult stand und das A minus
bekam, während mein Rucksack unbeaufsichtigt neben meinem
Stuhl lag. Ich erinnerte mich an den seltsam zufriedenen Ausdruck,
der nach dem Test auf Sandys Gesicht lag, und daran, dass sie in
Spanisch gefehlt hatte. Während ich mich für so clever gehalten und
184/254

Mandys Telefon geklaut hatte, hatten sie mir meine Kladde
weggenommen.
»Ich bin wie ein Blatt, das nichts weiter tun muss als fallen«, zit-
ierte ein Stück weiter den Gang hinunter ein Junge mit gekünstelt
hoher Stimme. Die anderen Jungs um ihn herum lachten. Das
schwarze Loch in meiner Brust wuchs mit alarmierender
Geschwindigkeit. Ich hatte das Gefühl, gleich auf Nimmerwiederse-
hen komplett hineingesogen zu werden. Das knallgelbe Papier in
meiner Hand bebte, während mich die Leute im Vorübergehen
anrempelten.
Irgendetwas in mir gab auf. Finster zu sein, hatte mich nicht
geschützt. Und mein Rachefeldzug hatte mir nichts genützt, er hatte
nicht mal funktioniert. Jetzt würden alle über das Gedicht reden und
nicht über die SMS, würden über Drake herziehen anstatt über
Sandy. Und ich war die gleiche alte Celia, über die man sich lustig
machen und lästern konnte. Der einzige Unterschied zur Situation in
der Achten war, dass es mir gelungen war, auch noch Drake mit in
den Abgrund zu ziehen. Endlich einmal hatte ich einen besten Fre-
und gehabt – und ich verriet ihn vor der ganzen Schule. Ich hatte
ihm versprochen, niemandem zu erzählen, dass er schwul war, und
jetzt wussten es alle. Ich schmolz dahin wie ein Stück Butter. Bald
würde von mir nichts weiter übrig sein als eine fettige Pfütze.
In diesem Moment legten sich zwei Hände auf meine Schultern
und eine tiefe Stimme raunte mir ins Ohr: »Du gehst nach links und
ich nach rechts.« Die Hände schoben mich zur Wand, zu den Kopien.
Ich drehte mich um und sah Clock einen gelben Zettel abreißen und
ihn auf einen Stapel legen, den er schon im Arm hatte. Fassungslos
sah ich zu, wie er von einer Kopie zur nächsten lief und ein paar
Schüler zur Seite stieß, die mein Gedicht lesen wollten. »Oh, wie
185/254

schockierend«, sagte er höhnisch, »wir leben in einer kleinen Stadt
und kennen keine Schwulen.« Und er riss das Blatt vor ihren Augen
herab.
Als hätte mir jemand Riechsalz unter die Nase gehalten, erwachte
ich plötzlich wieder zum Leben. Ich drehte mich um, lief den Gang
links hinab und riss dabei wütend die Zettel von der Wand.
»Entschuldigung«, sagte ich und stieß die Leute grob zur Seite. »Ich
sammle nur mein geistiges Eigentum ein.« Wie alte Luftschlangen
riss ich meine Gedichte herunter. »Und ich werde gegen jede
Copyright-Verletzung vorgehen«, bellte ich, bevor ich in den näch-
sten Gang stapfte, der ebenfalls voller Zettel hing.
Ich riss noch ungefähr zwanzig Kopien von den Wänden, bevor ich
das erste Mal an Drake dachte. Ob er die Zettel gesehen hatte? Oder
noch schlimmer: Was, wenn er sie nicht gesehen hatte und
ahnungslos im Gras saß und sein Sandwich aß – bevor er jeden Au-
genblick gedemütigt werden konnte? Ich riss drei weitere Kopien
herunter, dann lief ich hinaus zu den Picknicktischen.
Von überall schallten mir Bemerkungen entgegen. »Ist sie das?«,
fragte ein Schüler der oberen Klassen und zeigte auf mich. »Ich folge
auch der Schwerkraft«, schrie ein anderer. Und es gab jede Menge
Gelächter. Ich wollte nur so schnell wie möglich zu Drake und ihm
erklären, was geschehen war, ihm von dem Gedicht erzählen, bevor
er es an der Wand sah. Als ich zu unserem Stammplatz im Gras kam,
musste ich zu meinem Unglück aber feststellen, dass Drake bereits
mit den anderen Jungen auf dem Basketballfeld stand.
Ich blieb am Rand des Spielfelds stehen und flehte innerlich um
telepathische Kräfte. Ich wollte nicht auf ihn zustürzen und vor allen
anderen mit ihm sprechen. Wenn ich die Sache weiter dramatisierte,
würde alles nur noch schlimmer werden.
186/254
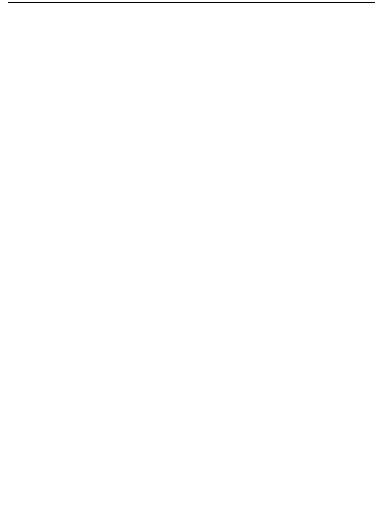
Sie wählten gerade die Mannschaften. Drake wirkte völlig in
Gedanken versunken, aber ich konnte nicht beurteilen, ob es seine
übliche Zurückhaltung den anderen Jungs gegenüber war oder ob er
darüber nachdachte, wie sehr er mich hasste, weil ich vor der ganzen
Schule sein Schwulsein ausgeplaudert hatte. Ob er noch Basketball
spielen würde, wenn er schon davon erfahren hatte? Versuchte er,
cool zu bleiben und sich ungerührt zu geben, oder hatte er keinen
Schimmer, was in den Gängen hing?
Clay wählte Drake in seine Mannschaft. Auch Joey Gaskill, der als
Letzter für die gegnerische Mannschaft gewählt wurde, wirkte
abwesend.
Das Spiel begann und ich stand hilflos am Spielfeldrand. Drake
spielte noch besser als sonst, war aggressiver. Wenn er einen Spieler
deckte, hielten seine Augen den Ellbogen der Gegner stand und seine
Hände schlugen mit aller Kraft nach dem Ball. Wie die Seesterne
breiteten sich die schlaksigen Körper der Spieler auf dem Platz aus.
Die Offensive setzte ihre Speere ein, während die Defensive ihre
Schilder dagegenhielt. Sobald ein Spieler der gegnerischen
Mannschaft den Ball ergattert hatte, wechselten sie die Formation
und stürmten in die entgegengesetzte Richtung des Spielfelds.
Drake deckte Greg Baker, einen Schüler aus der Zehnten, der in
der Schulmannschaft spielte. Drake vereitelte Gregs Versuche, einen
Korb zu werfen. Sooft Drake aber einen Korbleger in Angriff nahm,
verhielt sich der Ball wie ein Magnet. Er ging nie daneben. Drake
warf zehn Körbe, bevor einer der anderen Spieler einen einzigen
Punkt gemacht hatte.
Es gab mehr Zuschauer als je zuvor bei einem Pausenspiel. Ein
Promiskandal der Marke Hershey High trug sich soeben auf dem
Basketballfeld zu. »Er spielt gar nicht wie ein Schwuler«, hörte ich
187/254
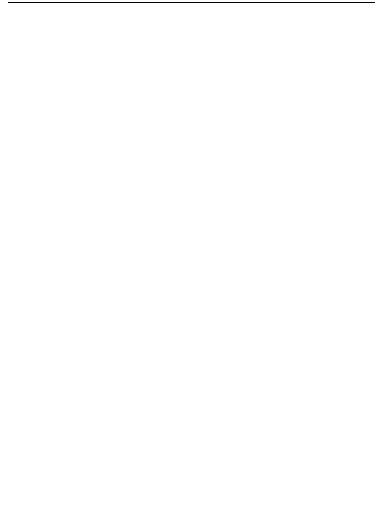
einen Jungen in meiner Nähe sagen. Ich versuchte, unbeteiligt zu
wirken.
Bei den Menschen folgt ein Mensch dem anderen ohne nachzuden-
ken, wie die berühmten Lemminge, die von der Klippe springen. Es
ist übrigens ein Missverständnis, dass Lemminge Selbstmord bege-
hen, indem sie sich in Massen von den Klippen stürzen. Das habe ich
in einem Buch aus der Bibliothek gelesen. Es heißt ›Legenden aus
dem Tierreich‹. In Wahrheit ist es so, dass die Lemminge in großen
Gruppen unterwegs sind. Wenn sie sich einer Klippe nähern, ver-
suchen diejenigen, die vorne an der Kante sind, stehen zu bleiben.
Aber die anderen drängen nach und schubsen die vorderen über die
Klippe und damit in den Tod.
Während immer mehr Leute das Spiel verfolgten, wuchs die Span-
nung auf dem Feld. Ein paar anderen Spielern gelangen ebenfalls
Korbleger. Aber Drake schien plötzlich zwei Köpfe größer zu sein als
sonst. Ich zog so heftig an meinen Rucksackriemen, dass das Nylon
Striemen an meinen Händen hinterließ. Ich schwitzte und mein Herz
raste. Ich war geradezu mit Drake auf dem Platz. Von Mandy oder
Sandy fehlte allerdings jede Spur, obwohl ich mit den Augen den
ganzen Rasen absuchte. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte,
wenn sie auftauchten.
Joey Gaskill hatte so gut wie verloren. Er hatte weder Körbe ge-
worfen noch dem Gegner den Ball abgenommen. Sein T-Shirt war
von den Achseln her von Schweiß durchnässt. Jetzt warf ihm einer
seiner Spieler den Ball zu, und Joey rannte beeindruckend schnell in
Richtung Korb, gefolgt von dem Jungen, der ihn decken sollte. Auch
Drake und Greg waren ihm auf den Fersen. Vier Paar Schuhe käm-
pften um den engen Raum unter dem Korb. Die Spieler bildeten eine
Art Halbkreis und sahen zum Korb hinauf. Joey sprang ab, ein Knie
188/254

weit hochgezogen, und setzte zu einem Korbleger an. Auch Joeys
Gegner und Greg und Drake sprangen hoch und stiegen synchron in
die Höhe. Es sah fast wie ein Ballett aus, wenn es nicht von so viel
Geächze begleitet gewesen wäre.
In dem Moment, als Joey den Ball losließ, damit er in einem per-
fekten Bogen im Korb landete, kam Drakes Hand dazwischen. Sie
fälschte den Weg des Balls ab und lenkte ihn ins Aus. Während-
dessen landeten die Spieler auf dem Boden, und Drake und Joey ver-
hakten sich im Sturz ineinander.
Obwohl er auf dem Spielfeld eher langsam war, rappelte Joey sich
schnell auf und war als Erster wieder auf den Beinen. »Runter von
mir, du schwule Sau!«, brüllte er und schleuderte Drake die Worte
geradezu ins Gesicht. Es wurde absolut still. Die Worte sprengten die
Luft wie ein Feuerwerk. Wie ein riesiges Feuerwerk.
Drake schüttelte den Kopf, als versuchte er, Spinnweben im
Gesicht loszuwerden. Ich sah, wie er die Menge der Zuschauer tax-
ierte. Im nächsten Moment war er auf den Beinen und holte mit
seinem Arm aus wie mit einer Abrissbirne. Unter voller Wucht
landete seine Faust in Joeys Gesicht.
Mit einem dumpfen Geräusch ging Joey zu Boden. Aber das be-
friedigte den Dämon, der von Drake Besitz ergriffen hatte, noch
nicht. Er warf sich auf Joey und schlug noch zweimal mit der Faust
auf ihn ein, bevor andere Jungs dazukamen und ihn wegzogen.
Ein Aufschrei ging durch die blutrünstige Menge. »Schlagt euch,
schlagt euch, schlagt euch!«, skandierte sie. Ich spürte die Erregung
rund um mich herum. Das Basketballspiel war in einen Boxkampf
gemündet. Mit dem ersten Faustschlag waren die Leute, die bislang
auf der Wiese gesessen hatten, aufgesprungen. Niemand wollte ris-
kieren, in der nächsten Schulstunde nach Einzelheiten des Kampfes
189/254

gefragt zu werden und nichts zu wissen. Nach dem zweiten Schlag
stürmten die Leute das Spielfeld, in der Hoffnung, das Opfer aus
nächster Nähe sehen zu können.
Ich musste Drake da rausholen! Ich griff nach meinem Rucksack
und schob mich durch die aufgebrachte Menge. Alles drängte und
schob. Vor lauter schlaksigen Jungs um mich herum konnte ich das
Spielfeld nicht mehr sehen. Die Menge war wie Treibsand. Ich nahm
alle Kraft zusammen und bahnte mir einen Weg hindurch.
Ich durchbrach den inneren Kreis gerade in dem Moment, als
Direktor Foster, Trainer Scott und Mr Pearson Drake und Joey
voneinander trennen konnten und sie zum Schulgebäude brachten,
die Arme auf den Rücken gedreht.
Und ich stand mitten in einer Meute von blasierten, desinteressier-
ten, geilen, gemeinen, oberflächlichen Teenagern und musste zuse-
hen, wie der Beste von uns abgeführt wurde, um ins Verhör genom-
men zu werden.
190/254

28
Schadenfreude bedeutet, sich am Missgeschick oder Unglück eines
anderen Menschen zu weiden. Es ist der Kick, den wir spüren, wenn
wir in Klatschblättern lesen, dass ein Promigirl wegen Trunkenheit
am Steuer verknackt worden ist. Wir wollen das Polizeifoto sehen,
den schamvollen Blick, die dunklen Ringe um die Augen. Manchmal
bebt eine Highschool geradezu vor Schadenfreude.
Kaum hatten die Lehrer Drake und Joey mitgenommen, gongte es
zur nächsten Unterrichtsstunde und die Menge löste sich auf. End-
lich konnte ich wieder atmen. Ich war drauf und dran, wegzulaufen,
das Schulgelände zu verlassen, anstatt ins Gebäude zurückzugehen.
Aber Drake war dort drinnen und ich wollte ihn nicht im Stich lassen.
Ich zog mir die Kapuze über den Kopf, öffnete die Tür und warf mich
in den Kampf.
Auf dem Gang bemerkte ich, dass die Kopien meines Gedichts ver-
schwunden waren. Clock hatte sie offenbar allesamt abgerissen. Ich
ging direkt zum Geschichtsunterricht, ohne vorher mein Buch aus
dem Spind zu holen. Das würde mir eine Strafpredigt von Mr Fish
einbringen, aber eine Strafpredigt war im Moment nicht mein
größtes Problem.
Ich spürte die Schadenfreude um mich herum wie ein Surren.
Überall hörte ich Drakes und Joeys Namen. Sie waren in aller
Munde. Zwei Jungs spielten den Kampf für ein paar Mädchen noch
einmal nach. Die Atmosphäre hatte etwas von einem Rummelplatz,

die Häme der Schüler und Schülerinnen war mit Händen zu greifen.
Die Köpfe fuhren herum, wenn ich vorbeiging. Alle starrten mich an.
Es gelang mir, das Klassenzimmer genau in dem Moment zu betre-
ten, als es zum zweiten Mal gongte. Ich setzte mich auf meinen Platz
und niemand konnte mehr mit mir sprechen. Mein Herz pochte so
laut in meinen Ohren, dass ich fast nichts verstand, als Mr Fish mit
dem Unterricht begann. Eine Stimme in meinem Kopf versuchte zu
klären, was eigentlich gerade geschehen war, aber Mr Fish übertönte
sie immer wieder.
»Okay, Leute, Ruhe bitte«, dröhnte er. »Schlagt eure Bücher auf
Seite dreiundvierzig auf und lest das Kapitel über die Französische
Revolution weiter. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es in der Mit-
tagspause einige Aufregung gab, aber wir sind trotzdem hier, um et-
was zu lernen.«
Als Mr Fish bemerkte, dass ich ohne Buch im Unterricht saß, warf
er mir einen missbilligenden Blick zu, lieh mir dann aber ein Buch
aus dem Klassenbestand. Ich schlug es auf und versuchte, den ersten
Absatz zu lesen. Selbst nach der versuchten Flucht der königlichen
Familie war Kaiser Leopold von Habsburg, Bruder von Marie An-
toinette … Ich musste den ersten Satz etwa zwanzigmal lesen. Die
Wörter sahen einfach nicht wie Wörter aus. Sie ergaben keinen Sinn.
»So, Leute«, sagte Mr Fish nach einer Weile. »Wir bilden jetzt zwei
Diskussionsgruppen.«
O nein!, schrie die Stimme in meinem Kopf. Zu welcher Gruppe ich
auch gehörte, über die Französische Revolution würde dort mit Sich-
erheit nicht diskutiert werden. Stattdessen würde es um das Gedicht
und um die Schlägerei gehen. Wahrscheinlich wäre ich in meiner
ganzen Highschool-Laufbahn nie mehr so gefragt.
192/254

Meine Hand schoss in die Höhe, bevor ich überhaupt erwogen
hatte, sie zu heben.
»Bitte, Celia«, rief Mr Fish mich auf.
»Ich müsste mal zur Schulkrankenschwester«, sagte ich.
»Und aus welchem Grund?«, seufzte Mr Fish.
»Das kann ich nicht sagen«, antwortete ich so ernst wie möglich.
Ein paar Leute kicherten. Alle Schüler durchschauen es, wenn je-
mand nur so tut, als wäre er krank. Seltsam, dass Erwachsene es
nicht merken. Mr Fish ließ mich gehen.
Der Gang vor dem Klassenzimmer war leer. Nirgends waren
Schüler oder Lehrer zu sehen. Ich hatte keine Ahnung, wohin jetzt –
aber ganz bestimmt nicht zur Schulkrankenschwester! Ich zog mir
die Kapuze über den Kopf, klammerte mich an meine Rucksackrie-
men und beschloss, zum Direktor zu gehen.
Gerade als ich um die Ecke in den Hauptgang bog, sah ich Drakes
Großmutter. Sie ging Richtung Sekretariat. Rasch machte ich einen
Schritt zurück, bevor sie mich bemerkte. Sie war in Eile, ihre Schuhe
klickten über den Boden. Ich wartete, bis ich nichts mehr hörte, und
spähte dann wieder um die Ecke. Es überraschte mich nicht, dass die
Schule Drakes Großmutter angerufen hatte. Eine Schlägerei war ein
schwerwiegender Verstoß. Wahrscheinlich hatten sie auch seine El-
tern kontaktiert.
Ein Schüler kam um die Ecke, ging an mir vorbei. Wenn ich noch
länger dastand, riskierte ich, dass weitere Schüler mich sahen, oder,
was schlimmer war, ein Lehrer. Ich musste eine Entscheidung fällen.
Ich hatte nicht die Absicht, in den Geschichtsunterricht zurück-
zukehren und meine Mitschüler noch zwei Stunden zu ertragen.
Drake konnte ich auch nicht erreichen, solange er beim Direktor war.
193/254

Und so tat ich das Einzige, was mir übrig blieb. Ich drehte mich um,
lief zu einem Seitenausgang und trat ins Freie.
Meine Stiefel dröhnten auf dem Asphalt, während ich den ver-
trauten Weg von der Schule nach Hause ging. Ich rechnete mir aus,
dass Drake, wenn sie schon seine Großmutter angerufen hatten, Un-
terrichtsausschluss bekam. Wir wissen alle, wie eine Schlägerei in der
Schule bestraft wird. Mit Unterrichtsausschluss. Das Wort klingt
schrecklich. Nach Nicht-mehr-dazu-gehören, nach Außenseiter. Ich
musste unbedingt mit Drake sprechen, ihm erzählen, wie alles
passiert war, ich musste ihm helfen, musste irgendetwas tun. Ich
beschloss, zu ihm nach Hause zu gehen und dort auf ihn zu warten.
Während ich die zwanzig Blocks entlangmarschierte, drehten sich
meine Gedanken immer wieder darum, wie es wohl inzwischen in der
Schule weiterging. Sprachen alle über das Gedicht, die Schlägerei,
über Drake oder mich? Interessierte sich nur die Neunte dafür oder
die ganze Schule? Mir fiel wieder ein, was in der Achten passiert war,
als Sandy die Sache mit dem BUCH eingefädelt hatte. Aber das durfte
ich nicht wieder an mich heranlassen, und auf keinen Fall durfte ich
einfach zusehen, wie es nun Drake traf. Meinetwegen.
Das Auto von Drakes Großmutter stand bereits in der Einfahrt, sie
waren also einen anderen Weg gekommen, denn ich hatte sie nicht
an mir vorbeifahren sehen. Ich stand auf dem Gehsteig vor dem
Haus, als Drakes Großmutter die Tür öffnete.
»Hallo, Celia«, sagte sie, aber nicht mit ihrer »Schön-dass-du-da-
bist«-Stimme. »Tut mir leid, aber Drake hat jetzt keine Zeit für dich.
Er hat Hausarrest. Und ich habe den Computer gesperrt. Er wird also
auch keine E-Mails beantworten.« Sie schaffte es tatsächlich, das
Versenden von E-Mails unheilvoll klingen zu lassen. »Und das hier
194/254

habe ich an mich genommen.« Sie hielt Drakes Handy in die Höhe.
»Solltest du nicht eigentlich in der Schule sein?«
»Geht es ihm gut?«, fragte ich und überhörte die Frage nach der
Schule.
»Pfff«, machte sie, begleitet von einer ratlosen Geste mit den
Händen. »Geht es jemandem gut, der seinen Mitschüler verprügelt
und ihm die Nase bricht?« Joey Gaskills Nase war also gebrochen.
»Würden Sie ihm ausrichten, dass ich hier war?«, fragte ich und
versuchte dabei, so wenig finster wie möglich zu klingen.
»Ja, das mach ich. Und wenn du nicht in die Schule zurückgehst,
dann solltest du besser nach Hause gehen«, sagte sie und hob warn-
end den Finger.
Ich machte mich auf den Heimweg. Das war mal wieder typisch für
Erwachsene! Wenn etwas Schreckliches passiert ist und es nichts
Wichtigeres gibt, als mit dem besten Freund zu reden, bestrafen sie
dich, indem sie dich nicht mit ihm reden lassen.
Voller Hoffnung sah ich zu Drakes Fenster, meine Gedanken dre-
hten sich wie ein Riesenrad. Dann ging ich ein Stück weg und blieb
zwei Häuser weiter wieder stehen. Das Nachbarhaus von Drakes
Großmutter hatte einen Holzzaun, aber das, vor dem ich jetzt stand,
nicht. Weder Menschen noch irgendwelche Hunde waren zu sehen.
Ich duckte mich und rannte am Holzzaun entlang nach hinten zum
Wäldchen. Von dort lief ich in einem Bogen zur Rückseite des Hauses
von Drakes Großmutter, das ja, wie unser Haus auch, nur aus dem
Erdgeschoss bestand. Ich kauerte mich hinter einen Busch, um
herauszufinden, ob Drakes Großmutter noch draußen war. Ich kon-
nte sie nirgends entdecken, und so schlich ich mich an der Hauswand
entlang, bis ich vor Drakes Fenster stand. Ich hob ein Kieselsteinchen
auf und warf es gegen die Scheibe.
195/254

Keine Reaktion.
Ich warf einen etwas größeren Stein. Der Vorhang wurde zurück-
geschoben und Drakes Gesicht erschien. Ich riskierte ein Winken. Er
sah zu mir, schob den Vorhang aber wieder zu. Ich griff nach einem
noch größeren Stein und zielte schon auf die Scheibe, als das Fenster
aufging. Drake beugte sich heraus. »Warte!«, flüsterte er und zog den
Kopf wieder zurück.
Ich wartete hinter dem Busch und überlegte, wie ich Drake alles
erklären sollte. Wenn er es nicht schon wusste, musste ich ihm von
dem Gedicht erzählen. Mein Magen schien sich zu verknoten. Nach
einigen Minuten ging das Fenster wieder auf und Drake sah heraus.
»Ich habe gerade mit meinen Eltern telefoniert«, flüsterte er gereizt.
»Gibt es Schwierigkeiten?«, fragte ich.
»Meinst du das ernst? Logisch gibt es Schwierigkeiten!« Ein
Sonnenstrahl fiel auf Drakes Gesicht und ich bemerkte einen Bluter-
guss über seinem rechten Auge. Joey hatte auch mindestens ein Mal
getroffen.
»Und? Wie haben sie reagiert?«, fragte ich weiter und schob auf,
was ich zu sagen hatte.
»Sie machen sich eher Sorgen, als dass sie sauer sind. Ich habe
mich sonst noch nie geprügelt. Trotzdem – ich habe Hausarrest …
und ich bin von der Schule geflogen.« Sein Kopf verschwand und
tauchte kurz darauf wieder auf. »Ich dachte, ich hätte Gran gehört.«
»Hör zu, ich habe ein Gedicht geschrieben …«, setzte ich endlich
an, aber er unterbrach mich.
»Du meinst das Gedicht, das mich vor der ganzen Schule geoutet
hat? Ja, ich weiß inzwischen ziemlich genau, was drinsteht. Hüb-
sches Bild mit den Blättern«, flüsterte er sarkastisch. »Es war einfach
196/254

super, über den Flur zu laufen und die Leute davorstehen zu sehen.
Das war echt geil.« Er wusste es also. Seine Stimme bebte vor Wut.
»Das Notizbuch, in das ich meine Gedichte schreibe … es ist mir
gestohlen worden …«, versuchte ich fortzufahren.
»Es ist mir verdammt noch mal vollkommen egal, ob es gestohlen
worden ist. Wer schreibt denn ein Gedicht darüber, dass ich schwul
bin, bringt es in die Schule mit und lässt es dann herumliegen? Das
ist entweder bescheuert oder … einfach nur … bescheuert!« Er
fuchtelte mit einer Hand in der Luft herum, während er sich mit der
anderen am Fensterbrett festklammerte.
»Es lag nicht herum, es war in meinem Rucksack. Drake, ich hätte
doch niemals …«
»Er hat mich vor der ganzen Schule eine schwule Sau genannt.«
»Du hast also schon von dem Gedicht gewusst und bist trotzdem
Basketballspielen gegangen?«
»Was hätte ich denn machen sollen? Mich auf dem Klo verstecken?
Mich vor Scham verkriechen? Ich schäme mich nicht.« Drake fuhr
sich mit der Hand durch die Haare.
Ich schwieg bedrückt. »Es tut mir so leid«, brachte ich schließlich
hervor.
»Meine Eltern wollen nicht, dass ich am Wochenende nach New
York komme.« Er seufzte tief. »Stattdessen kommen sie nach Her-
shey, um mit Direktor Foster zu sprechen. Mom versucht, einen Tag
freizukriegen.«
»Aber du wolltest am Wochenende doch mit Japhy sprechen.«
»Wem sagst du das! Und weißt du, was ich tun werde? Ich werde
nach New York fahren«, sagte Drake, schlug mit der Hand auf das
Fensterbrett und sah sich dann nervös um. »Ich muss mit Japhy
sprechen. Er ist der einzige Mensch, der mich verstehen kann.«
197/254
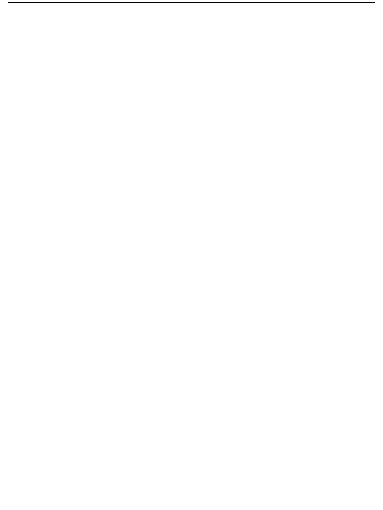
Drake strich sich mit dem Handrücken über die Stirn und stöhnte,
als er den Bluterguss berührte. »Autsch, verdammt! Wenn wir uns
treffen, braucht er mir nur ins Gesicht zu sehen. Dann weiß er, wie
heftig das Coming-out ist. Dann wird er wissen, dass ich sein Verhal-
ten verstehe.«
Ein paar Häuser weiter fing ein Hund an zu bellen. Ich versuchte,
mich noch besser hinter dem Busch zu verstecken. »Vielleicht darfst
du nächstes Wochenende fahren«, versuchte ich ihn zu beruhigen.
»Aber es geht um das richtige Timing, Celia. Träume werden reif
wie Obst und man kann sie nicht einfach am Baum verrotten lassen«,
entgegnete er. Vielleicht glaubte er Buddy in diesem Punkt nicht
wirklich, aber er zitierte ihn zumindest. »In der Schule geoutet zu
werden, die Schlägerei. Das sind Zeichen! Ich muss jetzt einfach mit
Japhy sprechen. Ich kann nicht länger warten.«
»Und wenn deine Eltern ihre Pläne doch noch ändern?«
»Ich kann nicht riskieren, sie erst um Erlaubnis zu fragen.«
»Es tut mir so, so leid, Drake«, sagte ich leise, überwältigt von
Schuldgefühlen. Ich drückte mich in den Busch und tat alles, um
nicht zu weinen. Einen Moment herrschte Schweigen.
»Komm doch mit.«
Ich erbebte.
»Ich fahre noch heute Nacht nach New York, bevor sie morgen
hierherkommen. Ich kriege Schwierigkeiten, ich weiß, aber die habe
ich ja auch so schon. Komm mit!«, sagte er noch einmal.
»Wenn ich morgen schwänze, kriege ich Unterrichtsausschluss«
war der erste von zehn Gründen, der mir einfiel, warum ich Drake
nicht begleiten sollte.
»Ich habe auch schon Unterrichtsausschluss gekriegt. Es gibt
Schlimmeres.«
198/254

»Meine Mutter flippt aus …«
»Wir hauen ja nicht ab. Sobald wir in New York sind, rufen wir
deine Mutter an. Wir können bei mir zu Hause übernachten. Ich
habe meine eigenen Schlüssel. Wir sind zu keinem Zeitpunkt in
Gefahr.«
»Und wenn meine Mom und deine Gran am Morgen aufwachen
und uns bei der Polizei vermisst melden?«
»Wir können ja eine Nachricht hinterlassen, die sie finden, wenn
wir schon unterwegs sind und sie uns nicht mehr aufhalten können.«
Drake lehnte sich noch weiter aus dem Fenster und stützte sich mit
beiden Händen auf dem Fensterbrett ab. Die Augen waren rot und
blutunterlaufen, seine Nase lief. Ich spürte förmlich, wie sein Gesicht
schmerzte.
»Wir brauchen Geld«, wandte ich ein.
»Zum Zugfahren habe ich immer Moms Kreditkarte. Ich kann
auch dein Ticket bezahlen.«
»Ich … ich weiß nicht.«
»Man muss mutig sein, wenn man sich seine Träume erfüllen will
…« Er riss den Kopf herum und verschwand im Zimmer. Als er kurz
darauf wieder ans Fenster trat, sagte er: »Das Telefon. Wahrschein-
lich meine Eltern. Komm um zwölf heute Nacht hierher! Gran geht
um neun Uhr schlafen und nimmt ihr Hörgerät heraus. Du kannst
also einfach gegen die Fensterscheibe klopfen«, flüsterte er schnell.
»Ich hab mir den Fahrplan angesehen. Wir können mit dem Bus bis
Harrisburg fahren und von dort weiter mit dem Zug um fünf Uhr
früh. Ich komme, Gran«, rief er über die Schulter ins Haus. Dann
warf er mir noch einen Blick zu. »Zwölf Uhr … bitte komm!« Er
schloss das Fenster und zog die Vorhänge zu.
Ich ließ mich seufzend in den Busch sinken.
199/254

Dann atmete ich ein paarmal tief durch, schlich mich wieder an der
Hauswand entlang und durch den Nachbargarten zurück zur Straße.
Es war immer noch eine Stunde bis Schulschluss, und ich musste die
Zeit im Park überbrücken, damit ich nicht zu früh zu Hause
aufkreuzte. Ich setzte mich auf die Schaukel, dachte darüber nach,
wie es wäre, nach New York zu fahren, und wünschte, ich hätte mein
Notizbuch bei mir gehabt, um mich zu trösten. Bei dem Gedanken,
dass Sandy und Mandy darin lasen, bekam ich Gänsehaut.
Seit dem Schuljahresbeginn vor zwei Wochen hatte ich mich ziem-
lich danebenbenommen. Ich hatte Hausaufgaben nicht gemacht,
hatte nachsitzen müssen, hatte ein Handy gestohlen und eine SMS
gefälscht. Und jetzt schwänzte ich sogar den Nachmittagsunterricht.
Aber all das war nichts im Vergleich dazu, ohne Erlaubnis meiner
Mutter nach New York zu fahren. Damit erreichte ich einen neuen
Grad von Danebenbenehmen.
Während die Schaukel vor- und zurückschwang, überlegte ich,
welche Möglichkeiten ich hatte. Wenn ich fuhr, würde ich richtig
Probleme kriegen. Aber ich stand schwer in Drakes Schuld, nachdem
ich ihn vor der ganzen Schule geoutet hatte. Andererseits hatte Drake
vor, nach New York zurückzuziehen, und ich wäre hier ohne besten
Freund, würde von der Schule fliegen und müsste mit meinen stock-
sauren Eltern klarkommen. Andererseits war es mir eigentlich egal,
wenn ich Hausarrest bekam, nachdem Drake weg war. Dann hatte
ich sowieso niemanden mehr, mit dem ich abhängen konnte. Ich
schaukelte vor und zurück und mein Hirn schwappte mit.
Als ich schließlich genug Zeit damit verbracht hatte, mich ganz ver-
rückt zu machen, und trotzdem noch keine Entscheidung gefällt
hatte, ging ich nach Hause.
200/254

***
Das Auto meiner Mutter parkte in der Einfahrt. Ich wusste, dass sie
Nachtschicht hatte und noch eine ganze Weile zu Hause sein würde.
Ich bereitete mich also auf einen Eltern-Small-Talk vor. Hoffentlich
war noch nicht aufgeflogen, dass ich die letzten drei Stunden
geschwänzt hatte. Immerhin kontrollierte nicht jeder Lehrer die An-
wesenheit. Als ich die Haustür öffnete, stand meine Mutter an der
Garderobe.
»Oh, hallo, mein Maikäfer«, sagte sie. »Wie kalt ist es denn
draußen? Ich habe gerade überlegt, welchen Mantel ich anziehen
soll.«
»Äh, mittel«, sagte ich ausweichend und ließ meinen Rucksack zu
Boden fallen. So weit, so gut. In diesem Moment merkte ich, dass wir
nicht allein waren. Auf dem Sofa saß ein Mann mit blonden Haaren
und Hornbrille. Er erhob sich, als ich ins Zimmer trat. »Celia«, sagte
meine Mutter fröhlich. »Das ist Simon, mein Bekannter aus dem
Krankenhaus. Simon, das ist meine Tochter Celia.«
Simon streckte mir die Hand entgegen und lächelte mich breit an.
Ich lächelte nicht zurück und schüttelte auch seine Hand nicht. Es
war der Typ vom Einkaufszentrum.
»Ist er ein Date, Mom?«, fragte ich mit finsterer Stimme.
»Celia!«, fuhr meine Mutter mich an. »Sei nicht unverschämt!
Kann ich dich kurz in der Küche sprechen, bitte?«
Ich folgte ihr in die Küche und verschränkte die Arme vor der
Brust.
»Das war echt ungezogen, Celia. Simon ist der erste Freund, den
ich im Krankenhaus kennengelernt habe, und du stellst mich total
bloß.«
201/254

Mir fiel ein, dass die Leute immer noch glaubten, Drake sei mein
Freund, obwohl er nur ein Freund war. »Ist er schwul?«, fragte ich.
»Nein«, antwortete sie und seufzte. »Schluss jetzt mit deinen un-
verschämten Fragen! Er ist ein Freund und mehr musst du nicht wis-
sen. Simon und ich gehen zusammen essen und danach ins Kino, be-
vor ich zur Nachtschicht muss. Ich dachte, du hast vielleicht Lust
mitzukommen.«
Ich spürte, wie sich in meinem Inneren etwas verfestigte, wie
Wasser etwa, das dann die offizielle Bezeichnung Eis trägt. Über
meinem Kopf schwebte eine Entscheidung, während ich durch die
Tür trat, und in diesem Moment fällte ich sie. »Ich habe noch Massen
von Hausaufgaben zu machen. Ich bleibe lieber zu Hause«, erwiderte
ich.
Mom sah mich an. »Bist du sicher? Ich mache mir ein bisschen
Sorgen, dass ich dich zu oft allein essen lasse. Wir gehen zu ›Difari
Pizza‹. Da bist du doch gern.«
»Ja, klingt gut, aber ich muss noch einen längeren Aufsatz
schreiben«, sagte ich wie beiläufig. »Ich mache mir ein Sandwich.«
»Okay«, lenkte sie ein. »Aber um zehn bist du im Bett.
Spätestens.«
»Ich wollte nicht unverschämt sein«, sagte ich lächelnd. »Sorry.«
»Okay, Celia. Nett, dass du das sagst.« Sie tätschelte meinen Arm
und sah mich komisch an.
Ich begleitete sie ins Wohnzimmer. »Tschüs, Simon«, sagte ich
und winkte. »Viel Spaß!«
»Tschüs, Celia«, antwortete er, erhob sich von der Couch und
winkte zurück.
»Schönen Abend, Maikäfer«, sagte meine Mutter und schlüpfte in
ihren Mantel. »Wir sehen uns morgen früh.«
202/254

»Ich muss früh los, weil ich vor dem Unterricht noch in die Biblio-
thek will. Vielleicht bin ich schon weg, wenn du zurückkommst.«
»Okay.« Mom und Simon verließen das Haus.
Ich ging in mein Zimmer und packte meine Sachen für New York.
203/254

29
Ich fing damit an, Socken und Unterwäsche in eine Reisetasche zu
stopfen. Dazu schwarze Leggings, schwarze T-Shirts, zwei schwarze
Röcke und eine zusätzliche Kapuzenjacke. Außerdem legte ich das
Buch dazu, das ich gerade begonnen hatte. ›Eine wie Alaska‹ von
John Green. Ich fand eine nagelneue Kladde, die, auch wenn es mir
schwerfiel, mein neues Notizbuch werden sollte. Der Gedanke, dass
Sandy und Mandy meine Gedichte lasen, brachte mein Knochenmark
erneut zum Kochen. Aber weiteres Sinnen auf Vergeltung konnte ich
mir im Moment nicht leisten. Mein glorreicher Rachefeldzug hatte
mir genau fünfzig Minuten Befriedigung beschert, dann hatte Sandy
mir etwas weit Schlimmeres angetan. Und dieses Mal hatte sie es
nicht nur auf mich abgesehen, auch Drake war ihre Zielscheibe ge-
worden. Statt eine weitere Granate zu werfen, musste ich mich jetzt
sozusagen den Verletzten zuwenden.
Ich ging an meinen Computer. Obwohl ich mich von meinen
beiden Elternteilen ziemlich im Stich gelassen fühlte, wollte ich
nicht, dass sie sich Sorgen machten und vielleicht dachten, ich sei
von einer Straßenbande oder einer polygamen Sekte entführt
worden. Ich überlegte, wem ich von meinem Plan erzählen könnte,
ohne etwas zu riskieren.
Betreff: Unter uns
Von: Celia (celia@celiadiefinstere.com)
Gesendet: Donnerstag, 23. September 16:05

An: Dorathea Eberhardt (deberhardt@berkeley.edu)
liebe dora,
aus einem wichtigen grund, den ich jetzt nicht lange erklären
kann, nur ganz kurz: ich muss ein, zwei tage fort. ich begebe
mich nicht in Gefahr. und ich gehe nicht allein, sondern mit
einem freund.
ich frage mom und dad nicht um erlaubnis, aber ich will nicht,
dass sie sich sorgen machen. kannst du bis morgen vormittag
zehn Uhr warten und ihnen dann sagen, dass alles in Ordnung ist
und dass ich mich bei ihnen melde? ich kann nicht verraten, wo-
hin ich gehe, ich kann nur sagen, dass es sein muss.
DANKE!
celia
Ich stand vom Schreibtisch auf und ließ mich auf mein Bett
plumpsen. Bis ich bei Drake sein sollte, blieben noch sieben Stunden.
Ich schrieb eine Liste, was ich tun musste: Sandwiches vorbereiten,
Geld auftreiben, duschen, ausruhen, versuchen, keine Panik zu krie-
gen. Alles gelang mir, bis auf die letzten beiden Punkte. Ich war viel
zu nervös, um mich hinzulegen. Dafür fiel mir ein, dass meine Mom
für den Notfall etwas Geld im Gefrierfach aufbewahrte. Sollte das
Haus abbrennen, wäre der Kühlschrank vielleicht noch in Ordnung.
Man stelle sich vor, ein Bauernhof brennt bis auf die Grundmauern
ab, aber wenigstens die Milch im Stall ist noch kalt! Ich wischte die
feinen Eiskristalle von insgesamt dreihundert Dollar und versteckte
sie in mehreren Depots an meinem Körper. Die nächsten qualvollen
Stunden verbrachte ich damit, an die Decke zu starren und auf die
Uhr zu schauen, bis es endlich Viertel vor zwölf war.
Ich nahm meine Reisetasche und verließ das Haus. So kurz vor
Mitternacht verwandelten sich die säuberlich gepflegten Gehsteige
205/254

unserer Gegend mit ihren glatten Platten aus cremefarbenem Beton
in einen unheimlichen Laufsteg. Horrorfilmregisseure wissen, dass
es nichts Gruseligeres gibt als übertriebene Perfektion. Die Laternen
erhellten in absolut regelmäßigen Abständen Teile der Straße und in
einigen Häusern flackerten die Fernseher wie Stroboskope. Ich war
noch nie allein um Mitternacht auf der Straße gewesen. Mit jedem
Schritt, den ich von zu Hause wegging, überkam mich das Gefühl, ein
bisschen weniger meinen Eltern zu gehören und mehr mir selbst.
Ich schlich mich wieder am Zaun des Nachbarn entlang in Drakes
Garten. Anstatt aber Kieselsteine zu werfen, klopfte ich an die Fen-
sterscheibe. Drake öffnete das Fenster, lehnte sich heraus und
umarmte mich, wofür er sich halb aus dem Fenster hängen musste.
»Ich wusste, dass du kommst«, flüsterte er. Trotz der Dunkelheit
konnte ich sehen, dass der Bluterguss auf seiner Wange noch dunkler
geworden war.
Ich reichte ihm meine Tasche und er half mir, aufs Fensterbrett zu
klettern. Zum Glück hatte das Haus Ziegelmauern, und es war nicht
allzu schwer, an ihnen Halt zu finden.
»Mein erster Einbruch«, sagte ich, als ich unversehrt in Drakes
Zimmer stand und mir den Schmutz von Rock und Jacke klopfte.
»Na ja, die meisten Einbrecher bekommen keine Hilfestellung«,
gab Drake zurück. Dann fasste er mich plötzlich an den Armen und
sah mir fest in die Augen. »Wie heißt das fünfte Kapitel in ›Lebe
deinen Traum!‹?«
»Äh, keine Ahnung«, antwortete ich und fühlte mich unter seinem
Blick ein wenig unbehaglich.
»Furchtlosigkeit«, sagte Drake. »Und der erste Absatz lautet so.«
Drake schloss die Augen, als ließe er einen Geist durch sich sprechen,
und zitierte:
206/254

»Kapitel fünf: Furchtlosigkeit
Seien Sie ein Traumkämpfer! Wer seine Träume leben möchte,
muss mit Mut durch die Welt gehen. An dieser Stelle hört das
Träumen auf und das Handeln fängt an.«
»Der Bus nach Harrisburg fährt um zwei Uhr früh ab und kommt so
um vier an«, sagte er dann und holte einen Zugfahrplan aus der
Schublade. »Der Zug nach New York fährt erst um fünf. Wir haben
also etwas Aufenthalt. Ich bringe Spielkarten mit. Unsere Fahrkarten
kaufen wir dort am Bahnhof. Der erste Zug am Morgen ist immer
ziemlich leer, auch freitags, wir kriegen also auf jeden Fall einen
Platz. Meine Eltern kommen um zehn hier an.«
Drake steckte den Fahrplan in seinen Rucksack, der am Bett
lehnte. Auf dem Bett lag, aufgeschlagen, ›Lebe deinen Traum!‹. Ich
war das erste Mal in Drakes Zimmer, das ehrlich gesagt nicht nach
der Bude eines Vierzehnjährigen aussah. Aber es war ja auch nur das
Gästezimmer seiner Großmutter, das er bewohnbar zu machen ver-
suchte. Der Teppich war türkisblau und die Wände waren dunkelrot
tapeziert. Vor den Fenstern hingen schwere Vorhänge. Es gab zwei
große Schränke und einen mannshohen Spiegel. In der Ecke stand
ein Gestell mit einer handgenähten Patchworkdecke. Die einzigen
Anzeichen dafür, dass ein Jugendlicher hier wohnte, waren ein Paar
Turnschuhe, das Skateboard neben der Tür und ein paar Hefte auf
dem Schreibtisch. Wieder einmal wurde mir bewusst, dass Drake nur
zu Besuch in Hershey war.
»Wenn ich nur irgendwas für mein Auge tun könnte«, sagte Drake
und betrachtete sein blaues Auge im Spiegel. Dort, wo Joeys Faust
getroffen hatte, war der Abdruck jedes einzelnen Fingerknöchels zu
erkennen.
207/254

»Hat es sehr wehgetan?«, fragte ich.
»Weniger, als man denkt.« Drake sah immer noch in den Spiegel.
»Das viele Adrenalin macht den Körper fast taub. Jetzt ist es eigent-
lich schlimmer.«
»Und wie lange dauert dein Unterrichtsausschluss?«, fragte ich
weiter und ließ mich neben Drakes Rucksack aufs Bett fallen.
»Drei Tage«, antwortete er. »Die Schule kriegt also gar nicht mit,
dass ich nicht da bin. Aber Großmutter wird es merken, wenn sie
mich zum Frühstück ruft. Sobald sie mitkriegt, was los ist, wird sie
meine Mom anrufen.«
»Wenn meine Mom von der Nachtschicht kommt, wird sie denken,
ich bin in der Schule.«
»Dann sind wir also schon fast in New York, bevor hier irgendet-
was in Gang kommt.«
»Wird Japhy nicht in der Schule sein? Wie willst du dich mit ihm
treffen?«
»Darüber habe ich auch schon nachgedacht.« Drake wandte sich
vom Spiegel ab und sah mich an. »Ich bin mir nicht sicher, ob es
besser ist, zu seiner Schule zu gehen und ihn dort vor dem Klingeln
abzupassen, oder ob ich mir die Zeit um die Ohren schlagen soll und
warte, bis die Schule aus ist, um dann zu Hause mit ihm zu reden.
Seine Eltern würden mich bestimmt hereinlassen. Und dann bleibt
ihm gar nichts anderes übrig, als mit mir zu sprechen. Aber vielleicht
ist es ihm auch unangenehm, wenn seine Eltern da sind. Ich weiß
nicht.« Ein Schatten huschte über Drakes Gesicht. »Na ja, Buddy
kann mir bestimmt einen Rat geben. Ich werde im Zug weiterlesen.«
Er nahm das Buch vom Bett und stopfte es in seinen Rucksack.
***
208/254

Schließlich hatte Drake fertig gepackt. Er stellte sich in die Mitte des
Zimmers und drehte sich im Kreis, als wollte er sich alle vier Wände
gut einprägen. Dann schnappte er sich seinen Rucksack. »Okay,
Celia, dann lass uns mal verschwinden. Durchs Fenster.«
Das Haus durchs Fenster zu verlassen war schwieriger, als herein-
zukommen. Ich setzte mich erst auf das Fensterbrett und sprang von
dort aus ins Gras, ohne mir die Knöchel zu verstauchen.
Drake warf mir unser Gepäck zu und schwang dann seine langen
Beine über den Sims. Er fand Halt auf einem Ziegelstein, hielt sich
mit einer Hand am Fensterrahmen fest und zog das Fenster mit der
anderen so weit wie möglich zu. Dann sprang auch er ins Gras. Wie
die Einbrecher im Fernsehen schlichen wir zur Straße. Unser Plan
war, zu Fuß zum Busbahnhof zu gehen. Ein Taxi konnten wir ja
schlecht rufen. Um uns von den größeren Straßen fernzuhalten,
schlängelten wir uns auf Umwegen durch die Nachbarschaft.
Die Luft war kalt, und mir wurde klar, dass bald Winter wurde.
Eine Weile liefen wir schweigend weiter und kamen an allen fünf
Haustypen vorbei. Der Nachteil einer auf dem Reißbrett geplanten
Stadt ist, dass es kaum Überraschungen gibt. Wer als Hausei-
gentümer eine Terrasse anbaut oder eine Garage für zwei Autos, gilt
schon als Querdenker. In Hershey wollen selbst die Häuser nicht aus
der Reihe tanzen. Irgendwann erreichten wir die Hauptstraße, und
immer wenn sich ein Auto näherte, duckten wir uns hinter einen ge-
parkten Wagen.
Als mir meine Tasche allmählich schwer wurde, bot Drake an, sie
zu tragen. Aber ich lehnte ab und hängte sie stattdessen über die an-
dere Schulter. Ich fing an zu bereuen, dass ich keine Turnschuhe an-
hatte, sondern Stiefel. »Was willst du Japhy sagen, wenn du ihn
siehst?«
209/254

»Das versuche ich mir immer wieder vorzustellen«, antwortete
Drake, der ausnahmsweise neben mir hergehen musste, nachdem er
sein Skateboard im Haus seiner Großmutter zurückgelassen hatte.
»Ich glaube, wenn er mich mit meinem blauen Auge sieht, muss ich
nicht mehr viel erklären. Ich bin sicher, er weiß es einfach. Buddy
sagt: ›Dein Traum sucht genauso nach dir, wie du nach deinem
Traum suchst.‹«
Wir bogen von der Hauptstraße ab und gleich darauf sah ich die
Neonlichter des Busbahnhofes durch die Dunkelheit funkeln.
Busbahnhöfe sind nicht gerade anheimelnde Orte, schon gar nicht
mitten in der Nacht. Es war kurz vor zwei Uhr früh, als wir ankamen.
Der Servicebeamte schenkte uns einen kurzen Blick, schien dann
aber nicht weiter an uns interessiert. Ich glaube, Menschen, die an
einem Busbahnhof arbeiten, gehören zu den Leuten, die man am
wenigsten überraschen kann. Selbst als wir unsere Fahrkarten zum
Erwachsenentarif kauften und schworen, dass wir bereits sechzehn
seien, wirkte der Mann gelangweilt, als wüsste er genau, dass wir lo-
gen, und als hätte er nur die Lust verloren, sich darum zu scheren.
Zum Warten setzten wir uns in die an einer langen Metallstange
befestigten orangefarbenen Plastikschalen. Ich konnte sie mir auch
als Mobiliar im Besucherraum eines Gefängnisses vorstellen. Die
Neonleuchten flackerten. Ich rechnete schon damit, dass jeden Au-
genblick die Polizei die Wartehalle betrat. »Hier sind sie«, würde der
Servicemensch sagen und auf uns zeigen. »Mir war sofort klar, dass
das Mädchen keine sechzehn ist.« Aber nichts geschah. Stattdessen
kündigte er die Ankunft des Busses nach Harrisburg an. Zusammen
mit zehn weiteren Fahrgästen stiegen wir ein.
Drake und ich setzten uns in eine der mittleren Reihen. Die Sitze
waren mit einem schweren, teppichartigen Stoff bezogen und über
210/254

den Sitzen schwebte die Gepäckablage. Die Fenster waren so breit
wie meine ausgebreiteten Arme, aber draußen gab es außer Straßen-
laternen, Neonreklamen und Dunkelheit nichts zu sehen. Ich war
noch nie ohne meine Eltern irgendwo hingefahren. Irgendwie fühlte
ich mich, als würde ein großes Abenteuer beginnen, etwa so, als
würde ich in einem Comic auf ein Piratenschiff springen. Anderer-
seits fühlte ich mich aber auch, als hätte ein Raufbold eine Linie in
den Straßenstaub gezogen und mich aufgefordert, sie zu überqueren.
Und tatsächlich war ich einfach hinübergegangen, ohne mir etwas
dabei zu denken, und hatte mich vor ihm aufgebaut. Dieser Augen-
blick sollte mir lebhaft im Gedächtnis bleiben! An jede Einzelheit
wollte ich mich später erinnern können! Aber kaum hatte der Bus
den Motor angeworfen, schlief ich ein. Als ich die Augen wieder
öffnete, sah ich die roten Ziegelsteine des Bahnhofs von Harrisburg.
Drake hielt meine Hand, als wir über den Bahnhofsvorplatz gingen
und durch die hohen Glastüren das Gebäude betraten, das aus einer
einzigen großen Halle besteht – einer Wartehalle für Riesen. An den
Wänden aus poliertem Holz standen lange Sitzbänke, und von der
Decke, die von den Armen der weißen Säulen getragen zu werden
schien, hingen Kronleuchter mit weißen Lampen.
Dafür, dass es noch nicht ganz vier Uhr früh war, ging es schon
ziemlich geschäftig zu. »Das sind Pendler nach New York und Wash-
ington«, flüsterte Drake, als hätte er meine Gedanken gehört.
Mit Drakes Kreditkarte kauften wir unsere Fahrkarten und setzten
uns dann auf eine der glatten, blank gewetzten Bänke. Es war noch
eine ganze Stunde bis zur Abfahrt, und so schlugen wir die Beine
übereinander und spielten Quartett, was auch geht, wenn man über-
haupt nicht geschlafen hat.
211/254

»Hast du eine Zwei?«, fragte ich, als wir gerade die zweite Runde
spielten.
»Ja«, sagte Drake und reichte mir sogar zwei Karten. Es schien
ihm überhaupt nichts auszumachen, dass er sie hergeben musste.
»Und Dreien?«
»Jetzt weiß also jeder in der Schule über mich Bescheid«, stellte er
fest.
Seine Bemerkung traf mich wie ein Blitzschlag. »Es tut mir echt
leid – das mit dem Gedicht.«
»Bestimmt war es Joey, der es aufgehängt hat, oder? Er hatte mich
ohnehin auf dem Kieker.« Drake schüttelte den Kopf. »Aber wie ist
er an dein Notizbuch gekommen?« Drake blickte in seine Karten.
»Aus«, sagte er dann.
»Es war Sandy.«
»Sandy?« Drake sah mich überrascht an. »Aber wir haben doch
miteinander Spanisch gemacht. Und nur wegen des Balls? Das ist so
krass!«
»Es geht nicht nur um den Ball«, erwiderte ich. Das schwarze Loch
in meiner Brust wurde riesengroß. Die Karten in meiner Hand zitter-
ten. »Sandy hat es auf dich abgesehen, weil du mit mir befreundet
bist, und sie disst mich schon die ganze Zeit. Seit die Schule wieder
begonnen hat, versuche ich, mich dafür an ihr zu rächen.« Meine
Stimme klang hoch und dünn. Ich hatte es mit Drake zu so viel geb-
racht: Freundin, beste Freundin, geheime Verbündete. Und jetzt
hauten wir sogar gemeinsam ab. Ich hatte viel zu lange gezögert,
mich ihm anzuvertrauen, ihm die Geschichte zu erzählen, die ich
noch niemandem erzählt hatte. »Ich will mich für etwas rächen, das
sie mir in der Achten angetan hat.«
212/254

Und dann erzählte ich Drake endlich die Geschichte mit dem
BUCH.
213/254

30
Seit dem Tag, an dem ich den Zettel von Ms Green bekommen hatte
– den Zettel, auf dem sie mir sagte, ich hätte Talent zum Schreiben –,
war ich aufrechter durch die Welt gegangen. Ich hatte mich wie an
einem Ort gefühlt, wo ich niemanden kannte, und plötzlich rief je-
mand meinen Namen und winkte mir zu. Es war im Mai gewesen,
einen Monat nachdem Ruth aus der Schule genommen worden war
und zwei Wochen nachdem meine Eltern ihre Trennung auf Probe
verkündet hatten. Mein Vater schlief im Keller und meine Mutter
arbeitete ununterbrochen. Ms Greens kleine Mitteilung war so ziem-
lich das Einzige, was gut war.
Nachdem Ruth weg war, aß ich in der Mittagspause immer allein
und so schnell ich konnte und verbrachte die restliche Zeit in der
Bibliothek. Am Anfang ging ich noch nicht einmal in die Cafeteria,
ich blieb einfach bei meinem Spind stehen und aß, bis mich eines
Tages ein Lehrer ermahnte. Kaum eine Woche nachdem ich die Notiz
von Ms Green bekommen hatte, saß ich wieder einmal allein mit
meinem Sandwich in der Cafeteria, als Sandy und Mandy hereinka-
men und sich zu mir setzten. Sie fragten nicht einmal. Sie bezogen
einfach Posten neben mir wie streunende Katzen an einem Müllcon-
tainer und beschnüffelten mich von oben bis unten.
Einen verrückten Moment lang dachte ich, sie wollten sich mit mir
anfreunden, sie hätten bemerkt, dass ich allein war, und wollten
mich einladen, in ihre Clique zu kommen. Sandy fing zu reden an:

»Celia, wir haben beschlossen, uns heute zu dir zu setzen, weil wir dir
helfen wollen.« Sie faltete die Hände auf dem Tisch, als hielte sie eine
Ansprache, und sah mich mit aufgesetzter Freundlichkeit an. Mandy
schien ein Kichern unterdrücken zu müssen, aber Sandy wirkte ernst
und entschlossen. Sie packten ihr Mittagessen aus, während ich in
mein Sandwich biss. Ich sagte keinen Ton.
»Gestern Abend haben wir uns zusammengesetzt«, fuhr Mandy
fort, während sie die Folie von ihrem Joghurtbecher abzog und
darüberleckte. »Wir haben ein paar Punkte aufgeschrieben, die du
ändern musst, bevor du in die Highschool gehst.« Sie stellte den
Becher ab, nahm einen großen Umschlag aus ihrer Tasche und
reichte ihn mir. »Unsere Befürchtung ist nämlich, dass du, wenn wir
uns jetzt nicht um dich kümmern, auf ewig so bleibst.« Mandy
öffnete ihre Diät-Cola und beobachtete mich aufmerksam, als verfol-
gte sie eine Soap im Fernsehen.
Sandy fixierte mich nüchtern. »Wir sind hier, um dir zu helfen,
Celia«, fügte sie leise hinzu. »Wir haben uns schon um eine ganze
Reihe Leute gekümmert.«
Ich öffnete den Umschlag und zog ein rosafarbenes Blatt Papier
heraus. Oben auf der Seite hatte jemand mit übertrieben schnörkeli-
ger Schrift geschrieben:
Dinge, die Celia ändern muss
Während ich noch darauf starrte, sagte Sandy: »Am besten liest du
es laut vor. Das ist wahrscheinlich am hilfreichsten.« Sie klang wie
eine Schulpsychologin, für die mein Wohlergehen an erster Stelle
stand.
Und ich tat genau das, was ich immer tat, bevor ich die Finsternis
in mein Leben gelassen hatte. Ich gehorchte, wenn jemand mir etwas
befahl. Also las ich vor.
215/254

Dinge, die Celia ändern muss
1. Die Haare. Alle drei Wochen schneiden lassen
(wir empfehlen Stufen) und jeden Tag gut
durchbürsten. Außerdem brauchst du ein
Pflegeprodukt, das deine Haare glättet.
2. Die Kleider. Läden, in denen du einkaufen soll-
test: Bruno & Basso, Mode Celeb, Hotheads.
Läden, in denen du nicht einkaufen solltest: die
Nachbarschaftshilfe.
3. Deine Freunde. Du musst versuchen, noch vor
Schuljahresende ein paar Freundinnen zu find-
en. Auch wenn du nicht die ganze Highschool
über mit ihnen befreundet bleibst, du brauchst
eine Clique für den Anfang. Wir empfehlen
Becky Shapiro, Denise Bailey und Sarah Ellis.
(Und: keine religiösen Spinner, bitte.)
4. Dein Verhalten. Du musst aufhören, dich bei
Lehrern einzuschmeicheln. In der Highschool
sind Arschkriecher absolut unbeliebt. Hör auf,
dich im Englischunterricht als Überflieger zu
geben.
Hochachtungsvoll,
Sandy & Mandy
216/254

Sie hatten beide unterschrieben, als ginge es um die Unabhängigkeit-
serklärung. Ohne sie anzusehen, faltete ich das Papier zusammen.
Ich hätte sonst die Tränen nicht zurückhalten können, die sich ihren
Weg an die Oberfläche bahnten.
»Willst du uns vielleicht etwas sagen? Wir haben eine Menge Zeit
investiert, um dir zu helfen.« Sandy klang, als hätten sie ein großes
Opfer gebracht oder als hätten sie gerade eine Überraschungsparty
für mich organisiert und ich hätte versäumt, überrascht zu sein.
Ich wollte, dass sie verschwanden. Mir fiel wieder ein, wie Sandy
Becky Shapiro auf dem Klo geraten hatte, eine Diät zu machen. Ich
wusste, dass Sandy von mir erwartete, mich zu bedanken, und dass
die Sache damit beendet wäre. Ich wusste, dass mein Dank für sie der
Spaß des Tages wäre und ihnen später am Telefon etwas zu lachen
gab. Vielleicht dachten sie ja wirklich, dass sie Dank verdient hätten,
und glaubten tatsächlich, dass ihre Ratschläge mir halfen.
Aber ich bedankte mich nicht. Stattdessen sah ich von einer zur
anderen, beschwor dann den Geist Holden Caulfields aus ›Der
Fänger im Roggen‹ herauf und sagte: »Verpisst euch!«
Sandy wurde knallrot. Sie sah aus, als wollte sie mir jeden Augen-
blick mit ihrem rot lackierten Fingernagel ihre Initialen in die Wange
ritzen. Stattdessen aber setzte sie das Lächeln einer Schönheit-
skönigin auf. »Das wirst du noch bereuen«, knurrte sie.
Sandy starrte mich unverwandt an, während sie systematisch ihr
Mittagessen zusammenräumte, alles in die Papiertüte schob und auf-
stand. Mandy sah aus, als wäre sie bei einer Fuchsjagd und jemand
hätte gerade die Hunde freigelassen. Sie schnappte sich ihren
Joghurt und die Diät-Cola. Ich hatte keine Ahnung, was ich soeben
über mir heraufbeschworen hatte, aber die Angst, die sich in meinen
Zehen bildete, wandelte sich auf ihrem Weg in mein Gehirn
217/254

allmählich in blanken Horror. Ich wusste nicht, was diese beiden
Mädchen mir antun wollten, aber ich ahnte, dass es brutal werden
würde.
An diesem Tag geschah nichts weiter. Im Englischunterricht stierte
Sandy mich ununterbrochen an, sodass ich mich nicht meldete, ob-
wohl Ms Green mich auffordernd ansah, als sie uns nach unserer
Meinung zu ›Von Mäusen und Menschen‹ fragte. Ms Green warf mir
einen fragenden Blick zu, als ich nicht antwortete, sagte aber nichts.
Aber am nächsten Tag fing alles an. In Physik sah ich das kleine
Notizbuch zum ersten Mal. Offenbar hatte Mandy es in Umlauf geb-
racht. Verstohlen wurde es unter den Tischen von einem zum ander-
en gereicht. Meinen Tisch ließen sie aus, aber ich sah, wie es kur-
sierte. Es war ein rosafarbenes Notizbuch mit Spiralbindung.
In jeder Stunde, die ich an diesem Vormittag hatte, wanderte das
Buch im Klassenzimmer herum wie ein Grippevirus. Jedes Mal,
wenn ein Lehrer sich umdrehte, wurde ein weiterer Tisch angesteckt
und am Schluss der Stunde waren alle krank. Mittags nahm ich mir
kaum fünf Minuten Zeit und aß, so schnell ich konnte, bevor ich in
die Bibliothek hastete.
Am Nachmittag ging es genauso weiter: Das Buch wurde an je-
manden weitergereicht und er oder sie schlug es neugierig auf und
las die erste Seite. Als Nächstes huschte der Blick zu mir. Dann blät-
terte er oder sie die Seiten durch, schrieb schließlich etwas hinein
und gab das Notizbuch weiter. Ein paar Leute lasen nur und
schrieben nichts, wie Becky Shapiro zum Beispiel. Aber es gab genü-
gend andere.
Ich tat, als würde ich nicht merken, dass die anderen mich bei den
Spinden anstarrten oder lachten, wenn ich im Gang an ihnen vorbei-
ging. Ich wünschte mir so sehr, jemanden zu haben, mit dem ich
218/254

über das ominöse Notizbuch reden könnte, aber ich hatte einfach
keine Freunde. Zum Direktor wollte ich nicht gehen. Die Strafe fürs
Petzen würde wahrscheinlich noch schlimmer ausfallen als das, was
ohnehin schon passierte.
Nach der Schule ging ich allein nach Hause. Da sah ich sie plötz-
lich! Nur einen Block von der Schule entfernt standen Mandy und
Sandy auf dem Gehsteig. Sie wirkten vollkommen entspannt, wie je-
mand, der auf einen Smoothie wartete, um damit an den Strand zu
gehen. In Wirklichkeit hatten sie vor, mein Leben zu zerstören. Ich
sah das Notizbuch bereits aus zehn Metern Entfernung. Mandy hielt
es locker in der Hand, wedelte damit herum wie mit einem Hun-
deknochen, der mich dazu bringen sollte, schneller zu ihr zu kom-
men. Ich überlegte noch, ob ich umdrehen oder auf die andere
Straßenseite wechseln sollte. Aber warum dem Unvermeidlichen aus-
weichen? Ich ging also weiter.
»Hi, Celia«, zwitscherte Sandy, als ich nah genug und ihrem Spott
ausgeliefert war. »Wir haben ein Geschenk für dich.«
»Die ganze Klasse hat dazu beigetragen«, fügte Mandy hinzu.
Sie sahen beide sehr hübsch aus, mit ihren langen Beinen unter
ihren Röcken und Flipflops an den Füßen. Das Haar hatten sie zu
Pferdeschwänzen zusammengebunden, die ihnen wie Samtstränge
über den Rücken hingen. Es war ein heißer Tag kurz vor Schul-
jahresende. Ich fragte mich, warum es ihnen nicht genügte, hübsch
und beliebt zu sein. Warum mussten sie mir das antun?
Ich ging weiter, bis ich unmittelbar vor ihnen stand, eine Verbre-
cherin vor Gericht. Und den Urteilsspruch kannte ich bereits.
»Du wolltest uns ja nicht glauben«, sagte Sandy, »und deshalb
haben wir die anderen Schüler und Schülerinnen um ihre Vorschläge
gebeten, was du an dir ändern solltest.«
219/254

»Auf diese Weise erfährst du, was die anderen in Wahrheit von dir
halten«, sagte Mandy verschwörerisch, als würde sie mir die Lösun-
gen für einen Mathetest anbieten.
Mittlerweile war schon so viel passiert, dass ich jetzt auch nicht
mehr einknicken wollte. »Ihr könnt mich mal«, sagte ich mit aus-
drucksloser Miene. Sie sollten auf keinen Fall merken, wie es mir
ging.
»Das würde dir so passen, du Lesbe«, erwiderte Mandy und ließ
das Notizbuch vor meinen Füßen auf den Gehsteig fallen. Dann
schoben mich die beiden zur Seite und ließen mich stehen.
»Manche Menschen wollen sich einfach nicht helfen lassen«,
seufzte Sandy noch, als sie davonstaksten und ihre Flipflops gegen
ihre Fußsohlen schlugen wie Kriegstrommeln.
Mir blieb nichts anderes übrig, als das Notizbuch vom Boden
aufzuheben. Ich wollte schließlich nicht riskieren, dass jemand an-
ders es fand. Wenn ich es an mich nahm, konnte ich es immerhin
verbrennen oder in den Müllcontainer werfen oder im Papierschred-
der meiner Eltern vernichten. Ich hob es also mit spitzen Fingern
auf, stopfte es in meinen Rucksack und sah mich um. Sandy und
Mandy hatten sich ebenfalls umgedreht und beobachteten mich
lachend.
Zu Hause saß ich allein in meinem Zimmer. Meine Mutter war
schon unterwegs zur Spätschicht und mein Vater war noch nicht von
der Arbeit zurück. Die beiden schienen sich so gut es ging aus dem
Weg zu gehen. Der eine kam erst, wenn der andere schon weg war.
Ich nahm das BUCH aus meinem Rucksack und legte es auf meinen
Schreibtisch. Dort blieb es dann und starrte mich an.
Ich sagte mir, dass es eine absolut schlechte Idee war, hineinzuse-
hen, dass alles, was darin stand, mich verletzen würde. Aber
220/254

gleichzeitig wusste ich auch, worauf Mandy und Sandy spekuliert
hatten, als sie mir das Buch untergeschoben hatten: Ich konnte nicht
widerstehen. Ich musste herausfinden, was drinstand!
Es begann mit den »Tipps«, die Mandy und Sandy mir schon
gegeben hatten. »Dinge, die Celia ändern muss« und danach die fünf
Punkte. Sie hatten den Zettel eingeklebt.
Ab der nächsten Seite folgten dann neue Einträge. Sie waren in un-
terschiedlichen Handschriften und in verschiedenen Farben ges-
chrieben, wie die Unterschriften im Schuljahrbuch. Aber die Verfass-
er blieben hier allesamt anonym.
Such dir Freunde, die keine Fundamentalisten sind.
Celia soll sich die Beine rasieren, bevor sie Shorts anzieht. Alles
andere ist widerlich!
Sie sollte Klamotten tragen, die ihr passen. Ihre Jeans sind immer
zu kurz, und sie trägt noch dieselben T-Shirts, die sie schon in der
Sechsten hatte.
Ich sage nur eins: Haltung!
Schau dir mal an, wie man die Beine übereinanderschlägt, wenn
man sich hinsetzt.
Wann kriegst du endlich einen Busen?
(Jemand hatte einen Pfeil zu dieser Bemerkung gemacht und
»Wichser« drangeschrieben.)
Celia muss sich einfach anpassen.
221/254

Sie sollte Sport treiben, wie andere hässliche Mädchen auch.
Hoffnungslos. Wenn ich Celia wäre, würde ich mich umbringen.
Ich schloss das Buch und dachte an die Geschichte, die wir zu Beginn
des Schuljahrs in Englisch gelesen hatten, ›Der Untergang des
Hauses Usher‹ von Edgar Allan Poe. Darin bekommt das Haus der
Familie einen Riss und dieser Riss wird immer breiter, bis das Haus
einstürzt. Genau so fühlte ich mich. Als gäbe es in mir einen Riss.
Und ich spürte, wie ich in zwei Teile zerfiel.
Abends um sechs kam mein Dad nach Hause und fing sofort an,
Kisten zu packen. Ich sollte ihm helfen, aber ich wollte mein Zimmer
nicht verlassen. Das ganze Wochenende verbrachte ich kaum Zeit mit
meinen Eltern. Ich las ›Hüter der Erinnerung‹ von Lois Lowry und
versuchte so zu tun, als führte ich ein anderes Leben. Meine Eltern
wollten mit mir reden, aber ich hatte meine Lippen versiegelt und
dieses Siegel ließ sich nicht so leicht brechen.
Am Montagmorgen gab ich vor, Bauchschmerzen zu haben. Am
Dienstag war es Migräne. Am Mittwoch sagte meine Mutter: »Okay,
wenn du nicht zur Schule gehst, dann müssen wir zum Arzt.«
Ich lenkte ein und ging zur Schule.
Damals habe ich gelernt, wie man finster wird. Ich sah die Lehrer
und meine Mitschüler griesgrämig an und meldete mich nicht mehr.
Wenn die anderen lachten oder sich flüsternd über das BUCH unter-
hielten, tat ich so, als würde ich nichts hören. Wann immer es mög-
lich war, zog ich meine Kapuze auf und ließ mir die Haare ins Gesicht
hängen.
Die einzige Lehrerin, die anscheinend etwas mitbekam, war Ms
Green. »Kannst du nach dem Unterricht bitte noch einen Moment
dableiben, Celia?«, forderte sie mich auf. Es war eine Woche
222/254

nachdem ich das BUCH bekommen hatte. Sie wartete, bis alle ander-
en das Klassenzimmer verlassen hatten, und setzte sich dann an den
Tisch neben mir. »Du beteiligst dich nicht mehr wie sonst am Unter-
richt. Und irgendwie kommst du mir ein bisschen traurig vor. De-
shalb habe ich gestern bei dir zu Hause angerufen. Deine Mom hat
mir von der Trennung erzählt. Atlanta ist weit weg, was?«
»Äh, ja, ziemlich«, sagte ich, obwohl ich keine Ahnung hatte.
»Ich wollte dir etwas geben.« Ms Green ging zu ihrem Pult, holte
ein in braunes Papier gewickeltes Päckchen und reichte es mir. »Ich
dachte, das könnte dir helfen.«
Ich packte das Päckchen aus und hielt ein blaues Buch in Händen.
Es hatte cremefarbene leere Blätter und auf dem Buchrücken stand
in dicken Buchstaben Gedichte.
»Manchmal hilft es gegen die Traurigkeit, wenn man schreibt«,
sagte sie und legte freundlich ihre Hand auf meinen Arm. »Man kann
ausdrücken, was einen tief im Inneren beschäftigt.«
In den darauffolgenden Wochen versuchte ich ein paarmal, ein
Gedicht zu schreiben. Ich nahm das Buch mit in die Mittagspause
und in die Bibliothek. Ich saß einfach nur davor und dachte, wie
sauber und rein die Seiten waren. Und keine meiner Ideen schien
bedeutsam genug, um diese Reinheit zu zerstören. Manchmal fiel mir
eine einzelne Zeile oder ein Ausdruck ein, aber dann fand ich gleich,
es klang dumm oder abgedroschen, wie etwas, das ich schon hun-
dertmal gehört hatte. Was, wenn ich meine Gefühle zu Papier brachte
und sie klangen nur erbärmlich? Das wäre noch schlimmer, als
traurig zu sein. Bestimmt hatte Ms Green sich in mir getäuscht.
Schließlich ging das Schuljahr Mitte Juni zu Ende und ich hoffte,
endlich wieder atmen zu können. Dann aber, Mitte Juli, zog mein
Dad nach Atlanta. In dem Monat dazwischen versuchte ich zuerst,
223/254

meine Eltern zu ignorieren. Danach schrie ich sie an, bat höflich und
zuletzt bettelte ich. Ich bettelte, dass wir alle zusammen nach Atlanta
ziehen sollten. Als das nicht half, bettelte ich, allein mit meinem
Vater mitgehen zu dürfen. Sie gaben nicht nach. Meine Mutter best-
and darauf, dass ich in Hershey und bei ihr blieb. Während dieser
ganzen Zeit weinte ich nicht ein einziges Mal. Nicht einmal, als das
Taxi kam, um meinen Vater zum Flughafen zu bringen, und er mich
umarmte und flüsterte: »Meine kleine Schnecke, ich verlasse zwar
Hershey, aber ich verlasse nicht dich. Der Job, den ich bekommen
habe, ist sehr gut. Ich will, dass es uns allen besser geht. Ich hab dich
lieb.«
Vielleicht hätte eine Träne den Beton, der sich zwischen mir und
der Welt um mich herum verfestigte, noch zerbröckeln können. Ich
sagte nur: »Tschüs.«
In diesen Monaten wurde es nie richtig Sommer. Bestimmt war es
so heiß wie jedes Jahr, aber in meiner Erinnerung blieb es im Juni
und Juli kalt. Ich verbrachte viel Zeit damit, das BUCH anzustarren.
Ich schlug es zwar nie mehr auf, aber die Sätze darin hallten zwis-
chen den Wänden meines Schädels wie ein Echo in einer Schlucht.
Vor allem die Formulierung »würde ich mich umbringen«. Wohin
ich auch ging, der Satz verfolgte mich. Er fing an, eine brauchbare Al-
ternative für alles zu werden. Etwa so: »Ich könnte duschen gehen,
aber ich könnte mich auch umbringen.« Oder: »Ich könnte mir Früh-
stück machen, aber ich könnte mich auch umbringen.« Der Riss in
mir wurde immer breiter. Ich hörte auf, E-Mails an Dora zu
schreiben. Und dann hörte ich auf zu lesen.
Meine Mom merkte, dass etwas nicht stimmte, aber sie sagte nur
Sätze wie: »Ich weiß, mein Maikäfer, für mich ist es ohne deinen Dad
224/254

auch schwer, aber es geht nun mal nicht anders. Irgendwann wird
alles wieder gut.« Sie ging zu einem Therapeuten und las Ratgeber.
Am 20. Juli, einen Tag vor meinem vierzehnten Geburtstag, gab
ich schließlich auf. Meine Kindheit war vorüber, mein Dad war aus-
gezogen, ich hatte die achte Klasse hinter mir und alle hassten mich.
In der Neunten, in der Highschool, würde es genauso weitergehen.
Ich kam zu dem Schluss, dass stimmte, was in dem BUCH stand. Ich
kam zu dem Schluss, dass ich mich besser umbringen sollte.
Es war ein Dienstag und meine Mutter arbeitete zwei Schichten
hintereinander. Den ganzen Tag überlegte ich, wie ich es tun sollte.
Ich hatte gehört, dass manche Menschen Schlaftabletten schluckten.
Aber wir hatten keine Schlaftabletten im Haus. Wir hatten auch
keine Garage. Auf eine Kohlenmonoxid-Vergiftung konnte ich es also
nicht anlegen. Außerdem war meine Mutter mit dem Auto unter-
wegs. Eine Waffe besaßen wir auch nicht, und der Gedanke, mich zu
erhängen, schreckte mich ab. Zuletzt beschloss ich, mir in der Bade-
wanne die Pulsadern aufzuschneiden.
Ich fing an, zusammenzusuchen, was ich brauchte. Die einzigen
Kerzen, die ich fand, waren die winzigen Dinger für Geburtstag-
skuchen. Ich steckte sie in die Erde einer Aloepflanze. Bei den Rasier-
utensilien meiner Mutter fand ich eine neue Rasierklinge und im
Schränkchen unter dem Waschbecken Badeschaum. Ich holte den
Radiowecker aus meinem Zimmer, damit ich Musik hören konnte.
Ein bisschen klassische Musik wäre ganz nett, dachte ich.
In meinem Zimmer zog ich mich aus und schlüpfte in den Bade-
mantel. Ich war nicht unbedingt traurig und auch nicht aufgewühlt.
Ich war erleichtert. Erleichtert darüber, dass mich nichts mehr küm-
mern musste, dass ich nicht mehr in die Schule gehen musste, dass
ich nicht zusehen musste, wie meine Familie auseinanderbrach. Ich
225/254

ließ Wasser in die Wanne laufen und gab Schaumbad dazu. Ich wollte
es so sauber wie möglich haben.
Aber als ich auf dem Wannenrand saß und ins Wasser blickte,
durchzuckte mich plötzlich etwas. Es hatte damit zu tun, wie das
Licht auf die Rasierklinge fiel. Es war kein klarer Gedanke, eher ein
Gefühl, das in Worten zu mir drang. Ich konnte den Satz einfach
nicht mehr abschütteln: »Wie ein Spiegel reflektierte die Rasi-
erklinge den Himmel.«
Ich kam zu dem Schluss, dass ich diesen Satz aufschreiben sollte.
Schließlich würde ich nie mehr Gelegenheit dazu haben! In meinem
Zimmer suchte ich nach einem Blatt Papier, da fiel mir das Buch ein,
das Ms Green mir geschenkt hatte. Ich durchstöberte meinen
Schreibtisch danach. Schließlich fand ich es in der untersten
Schublade. Es war immer noch leer. Ich schlug den Buchdeckel auf
und schrieb die erste Strophe meines ersten Gedichts hinein.
Als ich mit meinen Zeilen zufrieden war, ging ich zurück ins Bad
und prüfte die Temperatur des Badewassers. Es hatte so lange
gedauert, bis ich das Buch gefunden und die erste Strophe hineinges-
chrieben hatte, dass das Wasser nur noch lauwarm war. Und wieder
fiel mir etwas ein. Ich ging zurück in mein Zimmer und schrieb. Als
ich das Gedicht zu Ende geschrieben hatte, fügte ich noch einen Titel
hinzu.
DER TAG, AN DEM ICH MICH FAST UMGEBRACHT HÄTTE
Es war Nachmittag und wie ein Spiegel
reflektierte die Rasierklinge den Himmel. Die Handtücher
waren weiß wie die Badewanne und meine Handgelenke
waren weiß wie die Handtücher.
226/254

Das Badewasser wurde lauwarm.
Der Nachmittag ging in den Spätnachmittag über
und ich holte die Seile aus Luft ein
in meine Lunge wie ein Matrose. Die Rasierklinge
reflektierte den Sonnenuntergang.
Das Badewasser wurde kalt.
Die Handtücher waren weiß wie die Badewanne
und meine Handgelenke waren weiß wie die Handtücher.
Ich zog den Stöpsel aus der Wanne und stellte mich schließlich unter
die Dusche. An diesem Abend dachte ich über den Titel nach, den
Mandy und Sandy dem BUCH gegeben hatten: Dinge, die Celia
ändern muss. Ich beschloss, dass es wirklich einiges gab, was ich
ändern musste, bevor das neue Schuljahr begann. Und ich beschloss
zudem, dass ich diejenige sein würde, die entschied, welche Dinge
dies waren.
Am nächsten Morgen wachte ich auf, hatte meinen vierzehnten
Geburtstag und ließ die Finsternis in mein Leben. Von da an war ich
Celia die Finstere.
227/254

31
Drake hatte die Hände vor der Brust gefaltet, als betete er. Seine aus-
gestreckten Zeigefinger lagen auf seinen Lippen. Eine ganze Weile
gab er keinen Mucks von sich.
»Warum hast du mir nichts davon gesagt?«, fragte er schließlich,
ohne die Finger von seinen Lippen zu nehmen.
»Ich hatte Angst, dass du mich nicht mehr magst, wenn du
mitkriegst, was für eine Außenseiterin ich bin.«
»Aber von der Sache mit dem Buch wusste ich schon.«
»Was?«
»Sandy hat mir in der zweiten Schulwoche in Spanisch davon
erzählt, in unserer Dialoggruppe. Allerdings hat sie nicht gesagt, dass
sie dahintersteckte. Im Gegenteil, sie hat so getan, als hätte sie
Mitleid mit dir, weil du keine Freunde hast. Sie hatte uns zusammen
gesehen und wollte mich warnen. Mit dir befreundet zu sein, könnte
meinen sozialen Tod in Hershey bedeuten«, berichtete Drake und
verdrehte die Augen.
»Und warum hast du mich nie danach gefragt?«
»Ich dachte, dass du mir schon davon erzählen wirst, wenn du
bereit dazu bist. Deshalb habe ich gewartet. Aber ich bin überrascht,
wie lange du gebraucht hast, mir zu vertrauen.«
Ich hatte meinem besten Freund ein schreckliches Geheimnis
vorenthalten. Und jetzt stellte sich heraus, dass er die ganze Zeit dav-
on gewusst hatte!

»Das andere hätte ich allerdings nie vermutet«, fuhr Drake fort.
»Das … mit der Badewanne.«
»Tja«, sagte ich und sah auf das glänzende Holz der Sitzbank. Es
war mir wirklich schwergefallen, ihm zu erzählen, dass ich mir etwas
hatte antun wollen. Das schwarze Loch in meiner Brust lag offen da,
aber immerhin wurde es nicht größer. Ich hatte das Gefühl, dass
Drake es auch sah.
Unsere Blicke trafen sich. Seine braunen Augen sahen mich sanft
an. Es war wie die Rast an einem heißen Tag. In diesem Moment be-
merkte ich etwas hinter seiner linken Schulter. Eine Frau kam auf
uns zu.
Aber sie ging nicht einfach, sie lief und winkte. Mit jedem Schritt
wurde sie klarer erkennbar, wie ein Foto im Entwicklerbad. Ich kan-
nte die Frau nicht, aber sie winkte eindeutig zu uns herüber. Sie war
elegant gekleidet, trug eine braune Hose, einen schwarzen Mantel
und Schuhe mit hohen Absätzen. Und sie zerrte einen Koffer hinter
sich her wie einen widerspenstigen Hund.
Ich drehte mich um, weil ich dachte, sie winkte jemandem in un-
serer Nähe zu. Drake drehte sich ebenfalls um. Er wollte sehen, was
meine Aufmerksamkeit auf sich zog.
»Mom?«, rief er im selben Moment überrascht aus und sprang auf.
Erwischt! Sie hatten uns abgefangen und wir waren noch nicht ein-
mal aus Pennsylvania hinausgekommen! Aber wie hatten sie davon
erfahren? Ich war Drakes Mom zwar noch nie begegnet, aber ich
wusste natürlich, wie Eltern generell sind, und deshalb stellte ich
mich auf einen Anschiss ein.
Sie lief noch ein paar Schritte, dann ließ sie ihren Koffer stehen.
»Hi, mein Liebling«, sagte sie, zog Drake an sich und drückte ihn.
Drake hing schlaff wie eine Stoffpuppe in ihren Armen. »Alles in
229/254

Ordnung? Tut es sehr weh? Zeig mir dein Auge.« Sie fasste ihn beim
Kinn, um seinen Bluterguss besser betrachten zu können. »Na, in
einer Woche wird man kaum mehr etwas sehen. Ich hatte es mir viel
schlimmer vorgestellt.« Dann drehte sie sich um. »David!«, rief sie
einem Mann in Jeans und Hemd und mit einer großen Ledertasche
in der Hand zu. »Hier.«
Sie wandte sich wieder an uns. »Ich habe deiner Großmutter doch
gesagt, dass wir uns einen Mietwagen nehmen«, sagte sie und
streckte ihre Arme aus, um auch mich zu umarmen. »Du bist sicher
Celia! Ich freue mich, dich kennenzulernen. Aber müsstest du nicht
zu Hause sein und zur Schule gehen? Wo ist denn Gran, Drake?«
Drakes Mutter sah suchend in alle Richtungen, während der Mann in
Jeans und Hemd zu uns herüberkam.
»Hallo, mein Junge«, begrüßte er Drake freundlich und nahm ihn
in den Arm. »Tut uns leid, dass du so früh aus den Federn musstest.
Dabei haben wir Mom gesagt, dass sie uns nicht abholen soll, damit
ihr ausschlafen könnt.« Drake war wieder völlig reglos und erwiderte
die Umarmung nicht. »Celia, vermute ich mal. Hallo«, sagte der
Mann freundlich zu mir und hielt mir die Hand hin. »Ich bin Drakes
Dad.«
Weder Drake noch ich brachten ein Wort heraus. Wir saßen da wie
zwei Kaninchen vor der Schlange. Wie erstarrt.
»Und Gran wartet wohl im Auto, Liebling?«, erkundigte sich
Drakes Mutter. Sie klang ein wenig verunsichert. Dann sah sie ihren
Sohn genauer an. »Was ist los?«
Im selben Moment sah ich die Erkenntnis über Drakes Gesicht
huschen und auch mir wurde klar, was Sache war. Sie ahnten nicht,
dass sie uns erwischt hatten!
230/254

»Ihr solltet doch um zehn ankommen.« Drake klang, als erwachte
er gerade aus einer Ohnmacht.
»Alle anderen Züge waren ausgebucht. Und wir wollten rechtzeitig
da sein, um mit deinem Direktor zu sprechen. Das muss Gran dir
doch gesagt haben.«
»Wo ist Gran denn nun?«, hakte Drakes Mom noch einmal nach,
jetzt eindringlicher.
»Aber ich muss dieses Wochenende nach New York«, erwiderte
Drake leise, wie zu sich selbst.
»Wovon redest du denn da?«, antwortete sein Dad in aller Ruhe.
»Wir haben doch gesagt, dass wir nach Hershey kommen.«
»Ich fahre aber trotzdem hin, ob nun mit oder ohne euch.« Drake
klang fast schon hysterisch. Er trat ein paar Schritte zurück.
»Aber was willst du denn in New York?«, fragte sein Vater und
machte seinerseits wiederum einen Schritt auf Drake zu.
»Japhy sollte doch zu uns kommen. Und ich muss mit ihm reden.«
Drake schien den Tränen nahe zu sein.
»Liebling«, wandte seine Mutter ein, »Japhy und seine Eltern
können an diesem Wochenende nicht, selbst wenn wir zu Hause
wären. Japhys Mutter hat Vorstellung und Japhy fährt übers
Wochenende mit seiner Freundin und deren Familie weg.«
»Mit seiner Freundin …« Drakes Stimme verklang zu einem
Flüstern.
»Drake, was geht hier eigentlich vor?«, fragte sein Vater jetzt ener-
gisch. »Wir waren nicht mit Gran und dir hier verabredet. Wir haben
einen Mietwagen reserviert.«
»Wo ist Gran denn nun?«, fragte seine Mom jetzt zum dritten Mal.
»Sie ist nicht hier.« Drake klang besiegt. »Celia und ich waren auf
dem Weg nach New York.«
231/254

»Allein?«, bellte Drakes Vater. »Das hätte Gran niemals erlaubt.
Was zum Teufel ist hier los?«
»Ich wollte nach New York, um Japhy zu treffen.« Drakes Arme
hingen wie leblose Schläuche an ihm herab. »Ich habe mich in ihn
verliebt.«
Alles schwieg. Drakes Eltern starrten ihren Sohn so besorgt an,
dass ihre Mienen fast wie Theatermasken wirkten. Dann sahen sie
einander an. Mit einer langsamen Bewegung schloss Drakes Mutter
Drake in die Arme und Drakes Vater kam dazu und umarmte beide
gleichzeitig. Sie schienen miteinander zu verschmelzen, ein Knäuel
aus Umarmungen mit Drake in der Mitte. Beide Eltern sprachen leise
auf ihren Sohn ein, aber ich konnte nicht hören, was sie sagten.
Als sie einander losließen, hatten alle drei irgendwie gerötete Au-
gen. »Ich schlage vor, wir holen jetzt den Mietwagen«, sagte Drakes
Vater, sobald sie sich wieder gefasst hatten. »Und dann fahren wir
nach Hershey.«
232/254

32
Kaum saß ich auf dem Rücksitz, war ich schon eingeschlafen. Ich
wachte erst wieder auf, als Drakes Mom mein Bein tätschelte. »Wach
auf, Celia«, sagte sie freundlich. »Drakes Großmutter hat deine Mom
angerufen. Sie wartet auf dich. Sie haben wohl beide versucht, uns zu
erreichen, aber im Zug hatten wir keinen Empfang. Alle haben sich
große Sorgen gemacht.«
Mein Kopf lag auf Drakes Schulter und sein Kopf lehnte gegen die
Scheibe. Das Auto parkte vor unserem Haus. Okay, es war Zeit, die
Suppe auszulöffeln.
Ich holte meinen Rucksack aus dem Kofferraum und verab-
schiedete mich von Drakes Eltern, dann schlurfte ich beklommen
Richtung Haustür. Ich war zu müde, um mich irgendwie finster zu
fühlen. Ich stand auf der Veranda vor dem Haus und kramte nach
meinem Schlüssel, als die Tür aufgerissen wurde. Mom stand vor mir
wie eine wütende Medusa. Ihre Locken wogten wie Schlangen um
den Kopf und ihr Blick war bereit, mich in Stein zu verwandeln. Rote
Linien durchzogen das Weiße ihrer Augen wie feine Blitze.
»Mach, dass du reinkommst«, sagte sie und zeigte ins Innere des
Hauses. Dabei riss sie den Arm so heftig hoch, dass ich dachte, sie
würde sich gleich die Schulter auskugeln. Sie winkte Drakes Eltern
zu, dann schloss sie die Haustür.
»Es reicht, Celia! Ich bin fix und fertig!«

Es war so klar, dass ich nicht zu Wort kommen würde. Darum ver-
suchte ich es nicht einmal.
Kleinlaut trottete ich zur Couch und sank hinein. Meinen Rucksack
ließ ich einfach auf den Boden fallen. Wenn ich doch nur winzig
genug gewesen wäre, um mich unter einem Sofakissen zu
verkriechen! Mom lief im Zimmer auf und ab.
»Dora hat mich im Krankenhaus angerufen und mir gesagt, dass
du abhauen wolltest. Ich habe versucht, dich zu erreichen, und als du
nicht ans Telefon gegangen bist, bin ich voller Panik nach Hause ge-
fahren. Ich habe alle möglichen Leute angerufen – deinen Dad,
Drakes Großmutter, die Polizei. Du kannst dir gar nicht vorstellen,
welche Sorgen wir uns alle gemacht haben.« Ihre Augen glommen
vor Wut. Wie Glühlampen oder Brenneisen. Fast hätte sie mir durch
ihren Blick eine Brandverletzung zugefügt.
Ich sagte nichts.
»Celia!« Mein Name fiel wie ein Stein aus ihrem Mund. »Hast du
das getan, weil du denkst, ich hätte einen Freund?«
»Nein«, antwortete ich mit einem Schulterzucken.
»Diese Antwort reicht mir nicht«, erwiderte sie. »Und Schul-
terzucken, Kann sein oder Keine Ahnung ebenso wenig. Ich weiß,
dass die Trennung für dich sehr schwer ist, und seit dein Vater aus-
gezogen ist, habe ich mich wirklich bemüht, verständnisvoll zu sein
und dich in Ruhe zu lassen. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, was ich
noch tun soll. Findest du es so schrecklich, mit mir zusammenzu-
wohnen?« Sie ließ sich in den Sessel fallen und schlug ihre Hände
vors Gesicht. »Ist es das? Sag etwas!«, verlangte sie.
Es tat mir weh, meine Mutter so verzweifelt zu sehen, aber ich bra-
chte es nicht fertig, sie zu trösten. »Ich hab ’ne ganze Menge gesagt.
Ich habe dich angebettelt, dass du mich nach Atlanta ziehen lässt. Ich
234/254

habe Dad angebettelt, hierzubleiben. Aber es ist ja völlig egal, was ich
sage. Ihr hört einfach nicht zu.«
»Ich dachte, du würdest dich allmählich daran gewöhnen.« Sie
schlug die Hände auf ihre Schenkel. »Aber du versuchst es noch nicht
einmal.«
»Ich hasse es, hier leben zu müssen«, sagte ich genauso erbittert
wie sie. »In der Schule werde ich gedisst. Ist dir vielleicht aufgefallen,
dass ich vor Drake überhaupt keine Freunde hatte? Es ist nicht so,
dass ich mich einfach nur für Dad entschieden hatte. Ich wollte hier
weg und du hältst mich gefangen.« Ich spürte den tiefen Riss in mir
mehr als deutlich.
Meine Mutter richtete sich auf. »Deine Mitschüler dissen dich?«
Und in diesem Moment brach die Woge über mir zusammen. Ich
öffnete den Mund, wollte etwas sagen, und fing stattdessen zu wein-
en an.
Auf Lateinisch heißen Tränen lacrimae, was ich in einem Buch mit
dem Titel ›Ebbe und Flut: Die Wasserwege im menschlichen Körper‹
gelesen habe. Unsere Tränen werden von den Tränendrüsen gebildet,
und die Stelle im Auge, wo sie sich sammeln, heißt Tränensee. Der
Damm dieses Sees war gebrochen und der Fußboden in unserem
Wohnzimmer wurde überflutet. Ich schluchzte so heftig, dass ich
kaum noch atmen konnte. All der Schmerz, den mir Sandy und das
BUCH und Dads Auszug zugefügt hatten, war wieder so gegenwärtig,
als wäre alles gerade eben und nicht schon vor Monaten passiert.
Meine Mutter setzte sich zu mir auf die Couch, legte einen Arm um
mich und fing ebenfalls zu weinen an.
Nach einer Weile stand sie auf und holte eine Schachtel
Taschentücher vom Couchtisch. Dann strich sie mir die Haare aus
dem Gesicht.
235/254

»Wirst du dich wieder mit Dad vertragen?«, fragte ich, während
ich mir die Nase putzte.
Sie sah mich lange an, schniefte leise. »Ich glaube nicht, mein
Maikäfer.«
Mein Herz ballte sich zusammen wie ein großes Knäuel Fäden. Ich
dachte an meinen Dad in Atlanta und daran, wie es wäre, bei ihm zu
leben.
»Du solltest ein bisschen schlafen«, sagte meine Mutter. »Die
Schule vergessen wir für heute.«
Ich nahm meinen Rucksack mit und ging in mein Zimmer.
»Er ist nicht mein Freund«, rief sie mir nach. »Simon ist einfach
ein Freund, der erste, den ich kennengelernt habe, seit ich wieder
Single bin.«
Dass man einen Freund braucht, das konnte ich nur zu gut
verstehen.
Bis ich schließlich im Bett lag, war es fast neun Uhr. Ich hatte nicht
einmal meine Klamotten ausgezogen. In der Schule lief in diesem Au-
genblick der Unterricht, als gäbe es auf der ganzen Welt nichts
Wichtigeres. Ich ließ meinen Kopf auf das Kissen sinken. Und schlief.
Ohne zu träumen.
236/254

33
Bei Dunkelheit aufzuwachen ist ein komisches Gefühl. Im ersten Mo-
ment wusste ich überhaupt nicht, was los war. Wurde die Sonne vom
nuklearen Niederschlag einer Bombe verdunkelt, die detoniert war,
während ich geschlafen hatte? Oder war einfach Nacht? Die
Leuchtziffern meines Weckers zeigten 19 Uhr 34 an, wie an einem
ganz normalen Freitagabend im September.
Ich war noch nicht bereit, meiner Mutter wieder gegenüberzutre-
ten. Und so blieb ich noch eine Weile im Dunkeln liegen und fragte
mich, wie es wohl weitergehen würde. Ob mein Dad in Atlanta und
wir für immer in Hershey blieben? Ob Drake mit seinen Eltern nach
New York zurückfuhr? Was würde passieren, wenn ich wieder in die
Schule ging? Was, wenn mein Freund Drake eine supergute, aber
kurze Unterbrechung in meinem ansonsten einsamen Außenseiter-
leben blieb?
Irgendwann schälte ich mich aus meinem Bett und verließ mein
Zimmer. In der Küche holte meine Mom gerade eine selbst gemachte
Pizza aus dem Ofen und stellte sie zum Abkühlen auf ein Brett. Mein
Lieblingsessen.
»Ich wollte dich gerade rufen«, sagte sie, als sie mich in der Tür
stehen sah.
Der Tisch war mit Deckchen, Tellern und Gabeln gedeckt, der
Rechnungsstapel war weggeräumt. Mir wurde bewusst, dass es sehr
lange her war, seit wir uns das letzte Mal zum Abendessen zusammen

an diesen Tisch gesetzt hatten. Aber die beiden Teller, statt der drei,
markierten eine Lücke.
»Danke, Mom«, sagte ich und merkte, wie die Tränen
zurückkamen.
»Ich habe mit Dad telefoniert, während du geschlafen hast«, sagte
sie. »Er wollte nicht, dass ich dich wecke. Du kannst ihm morgen
eine E-Mail schreiben, meinte er. Wir haben beschlossen, dass du die
nächsten beiden Wochen Hausarrest hast. Deinen Computer wirst du
nur einschalten, um Hausaufgaben zu machen und E-Mails an un-
sere Verwandten zu schicken. Und das ist schon ein mehr als freund-
liches Zugeständnis. Dein Dad wird nächstes Wochenende zu Besuch
kommen, dann können wir über alles reden, auch darüber, wo du
wohnen willst.«
»Okay«, antwortete ich und versuchte, nicht allzu finster zu klin-
gen. Nächstes Wochenende wollte Dad also kommen. An Drakes let-
ztem Wochenende in Hershey! Und an dem Wochenende, an dem
der Schulball stattfand. Es hatte Zeiten gegeben, da hatte ich keinen
anderen Wunsch, als sagen zu dürfen, wo ich leben wollte. Jetzt war
es mir nicht mehr so wichtig, ob ich in Hershey oder Atlanta wohnte,
denn Drake würde weder hier noch dort sein.
»Ich habe mit deinem Direktor gesprochen. Er hat mir von deinem
Gedicht erzählt, das in der ganzen Schule aushing, und wovon es
handelte. Ist das der Grund, warum du mit Drake nach New York
wolltest?«
Ich spürte meine Augen wieder feucht werden. »Mom, ich habe vor
der ganzen Schule ausgeplaudert, dass er schwul ist.« Ich wischte mir
die ersten beiden Tränen von der Wange, aber weitere kamen nach.
»Und dabei hatte ich ihm versprochen, es niemandem zu verraten.«
238/254

»Aber Liebling. Das hast du doch auch nicht getan. Derjenige, der
das Gedicht aufgehängt hat, ist dafür verantwortlich, wer auch im-
mer es war.« Sie zog mich in ihre Arme. »Ich wünschte, du hättest
mir davon erzählt. Am Montagmorgen werden wir mit Direktor
Foster über alles sprechen. Aber für den Augenblick hast du erst ein-
mal zwei Tage Unterrichtsausschluss bekommen, weil du geschwänzt
hast.«
»Okay«, murmelte ich an Moms Schulter. Es war so ein schönes
Gefühl in ihren Armen.
Mom und ich saßen lange am Tisch und redeten. Nicht über die
Schule oder Drake oder meine Flucht nach New York mitten in der
Nacht. Und auch über den Unterrichtsausschluss verlor sie kein Wort
mehr. Wir redeten über Bücher, die wir mochten, und über Filme,
die wir sehen wollten. Sie erzählte mir Geschichten aus dem
Krankenhaus, von Kolleginnen und von Dingen, die die kleinen Pa-
tienten auf ihrer Station angestellt hatten.
Nach dem Essen half ich ihr beim Abwasch. Wir waren gerade fer-
tig, als sich meine Mutter plötzlich an die Stirn schlug.
»Oh, ich hab etwas vergessen«, sagte sie. Sie ging zur Garderobe
und hob eine Papiertüte vom Boden auf. »Das hat jemand für dich
auf der Veranda abgestellt«, erklärte sie. »Ich hab’s gefunden,
während du geschlafen hast.«
»Danke.« Nervös nahm ich die Tüte entgegen und zog mich damit
in mein Zimmer zurück. Ich schloss die Tür und setzte mich auf mein
Bett. Dann öffnete ich die Tüte. Sie enthielt meine schwarz-weiße
Kladde, die Sandy gestohlen hatte, und einen Brief.
Emo …
239/254

hab dein Notizbuch aus Sandys Spind befreit. Frag
nicht, wie. Unterrichtsausschluss ist nur ein anderes
Wort für Freiheit.
Clock
Woher wusste Clock, dass ich Unterrichtsausschluss bekommen
hatte? Ein Prickeln kroch von meinen Fingern bis in meine Zehen
hinunter und Erleichterung durchflutete meinen Körper. Ich drückte
mein Notizbuch an mich, als wäre es ein Freund, den ich seit
Ewigkeiten nicht mehr gesehen hatte.
Ich stand auf, ging zu meinem Schreibtisch und zog die Schublade
rechts unten auf. Unter all dem Papier und Krimskrams, den ein-
zelnen Stiften, Radiergummis und Golfbällen lag es. Das BUCH. Es
wirkte kleiner und leichter, als ich es in Erinnerung hatte. Ich knipste
die Lampe an und schlug es auf. Dinge, die Celia ändern muss stand
da. Obwohl mir eine Stimme in meinem Kopf davon abriet, fing ich
an zu lesen. Haarpflege, Klamotten, Freunde, Haltung. Ich las die
Ratschläge, die besagten, dass ich meine Haare bürsten, in besseren
Läden einkaufen und mir Freunde suchen solle. Ich wartete darauf,
dass sich das altbekannte schwarze Loch in meiner Brust öffnete und
dass aus dem hartschaligen Kern in meinem Magen ein Baum er-
wuchs, der mir mit seinen Wurzeln und Ästen die Luft abschnürte.
Ich wartete darauf, dass mein Hals eng und meine Zunge schwer
wurden und dass mich ein Schwindel überkam.
Aber etwas ganz anderes geschah.
Ich las die Liste und dieses Mal wurde mir nicht schlecht. Ich hatte
nicht das Gefühl, in Tränen ausbrechen zu müssen, noch wollte ich
mich in Luft auflösen. Ehrlich gesagt empfand ich so gut wie
240/254

überhaupt nichts. Selbst der dumpfe Schmerz des Abscheus stellte
sich nicht ein. Fast hätte ich ihn vermisst! Stattdessen merkte ich,
dass mich das Buch und was diese albernen Mädchen von mir hiel-
ten, nicht mehr so kümmerten wie früher. Die Mädchen und Jungs
an der Hershey Highschool waren wahrscheinlich einfach nicht cool
genug, um mich zu verstehen. Es war mir egal, ob mich die ganze
Schule oder meinetwegen auch die ganze Welt zur Außenseiterin ab-
stempelte. Mich interessierte einzig und allein Drake. Und die Frage,
ob er ging oder blieb.
Ich warf das Buch beiseite und legte mich wieder auf mein Bett.
Ich rief mir noch einmal in Erinnerung, wie ich im Badezimmer das
Wasser in die Wanne gelassen hatte und Badeschaum dazugab, wie
ich die Rasierklinge meiner Mutter bereitgelegt hatte. Wollte ich
damals wirklich sterben? Wenn ich gestorben wäre, dann hätte ich
Drake nicht kennengelernt. Und ich hätte kein einziges Gedicht ges-
chrieben. Vielleicht kam ja noch jede Menge Gutes nach und ich
wusste nur noch nicht, was es sein würde?
Irgendetwas hatte sich seit jenem Tag verändert. Ich hatte etwas
Starkes in mir, wie ein Planet mit einem Kern aus Eisen. Ich konnte
diese Kraft spüren, feuerflüssig und brodelnd. Ich schlug meine
Arme fest um mein Kissen und schlief ein.
241/254
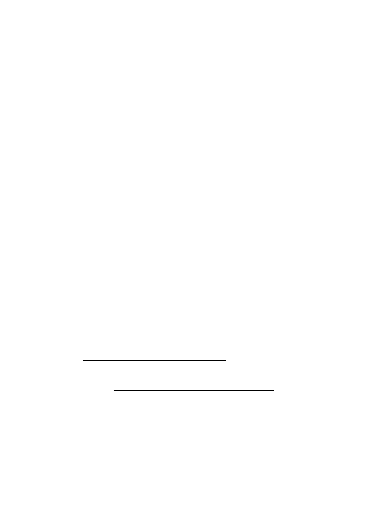
34
Der nächste Tag war ein Samstag. Allmählich ging der September
dem Ende zu. Laub sammelte sich in Haufen um den Briefkasten im
Vorgarten und entlang der Hauswände. Auf den Eingangsstufen vor
den Nachbarhäusern tauchten wie von Zauberhand Kürbisse auf. Der
Herbst war eingezogen in Hershey.
Mom war bei der Arbeit, hatte mir aber eine Liste mit Aufgaben
hinterlassen:
1. Wäsche waschen
2. Um vier Lasagne in den Ofen schieben
3. E-Mail an deinen Vater schreiben!
Ich fing mit der E-Mail an Dad an.
Betreff: Es tut mir leid
Von: Celia (celia@celiadiefinstere.com)
Gesendet: Samstag 25. September 9:27
An: James Door (jdoor@cocacolacompany.com)
hi dad,
es tut mir leid, dass ich abgehauen bin, ohne zu sagen, wohin.
ich wollte euch keine sorgen bereiten. In der schule lief es echt
schlecht und es sind noch ein paar andere sachen passiert, die
ich dir erzählen möchte. können wir reden, wenn du nächstes
wochenende nach hause kommst?
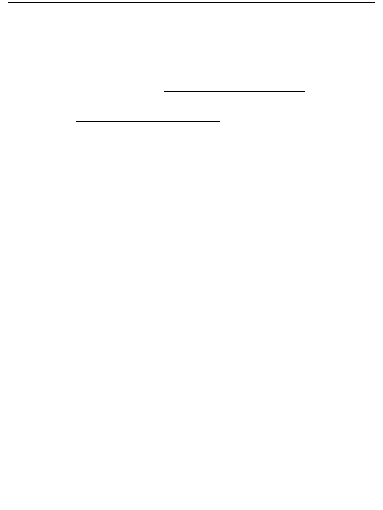
celia
In meinem Posteingang wartete eine E-Mail von Dora.
Betreff: aufgetaucht
Von: Dorathea Eberhardt (deberhardt@berkeley.edu)
Gesendet: Freitag 24.9., 8.45
An: Celia (celia@celiadiefinstere.com)
celia,
als ich deine e-mail bekam, war ich hin- und hergerissen. ich
halte es für sehr wichtig, geheimnisse zu wahren, aber es ist
auch gefährlich, mit vierzehn allein unterwegs zu sein. also habe
ich weißen salbei angezündet und gesungen, bis ich wusste, was
ich tun sollte. nach zwei stunden meditation habe ich versucht zu
imaginieren, wo du bist. ich sah dich von nebel umgeben in ein
flugzeug steigen.
zuerst hatte das flugzeug probleme abzuheben und die flugbeg-
leiter öffneten die fenster und warfen schokoriegel heraus, bis
das flugzeug leicht genug war. als das flugzeug dann an höhe
gewann, sah ich, wie dir leichter ums herz wurde. schließlich
tanzte das flugzeug durch den wolkenlosen himmel.
es war wirklich eine sehr schöne vision, aber ich spürte
trotzdem, dass ich deine mom anrufen musste. zwei stunden
später rief sie mich zurück und sagte, dass du wieder auf-
getaucht warst. ich habe übrigens auch dein krafttier imaginiert,
aber ich glaube, man soll jemand anderem dessen krafttier nicht
verraten, bis er oder sie es selbst imaginiert.
lauf nicht wieder weg. vergiss nie, dass du ganz besonders bist.
d
243/254
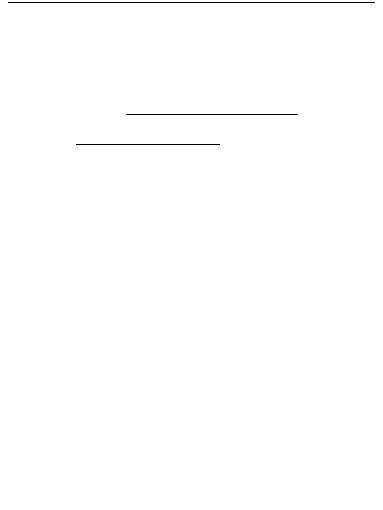
Das war mit Sicherheit die seltsamste E-Mail, die ich je von Dora
bekommen hatte. Aber wie hätte ich darüber urteilen wollen? Ich
selbst hatte in den letzten Monaten jede Menge Seltsames getan.
Es gab noch eine zweite E-Mail.
Betreff: Gedichte für die Schülerzeitung
Von: Tara Flowers (redaktion@hersheymagazin.org)
Gesendet: Freitag, 24. September 09:21
An: Celia (celia@celiadiefinstere.com)
Liebe Celia,
der Redaktion unserer Schülerzeitung Nexus hat das Gedicht,
das du eingereicht hast (»wale sind keine fische, sondern säu-
getiere«) sehr gut gefallen. Außerdem haben wir das Gedicht
»Seit Drake mir damals im Wäldchen gestand« an den Wänden
hängen sehen und fanden es umwerfend! Wir möchten dich
gerne einladen, für unsere nächste Ausgabe, die Ende Oktober
erscheint, weitere drei bis fünf Gedichte einzureichen. Das
Thema lautet »Bittersüß«.
Außerdem bieten wir jeden Donnerstag nach dem Unterricht ein-
en kleinen Schreibzirkel in Mr Pearsons Klassenzimmer an. Willst
du nicht auch kommen und mit schreiben? Wir würden uns sehr
freuen, dich bei uns zu sehen.
Mit herzlichen Grüßen
Tara & Warren
Redaktion Nexus
Ich wurde ganz schwindelig. Die Redaktionsmitglieder hatten mein
Gedicht an den Wänden gesehen und es hatte ihnen gefallen! Sie
luden mich zu ihrem Schreibzirkel ein! Ich kannte Tara und Warren
nicht. Waren sie wie Drake und ich? War es möglich, dass wir nicht
allein waren?
244/254

Ich dachte gerade über diese alles umstürzende Möglichkeit nach,
als in der Küche das Telefon klingelte. Es war Drake. Unser Gespräch
verlief so:
Drake: »Kannst du raus?«
Ich: »Ich habe zwei Wochen Hausarrest.«
Drake: »Ich fahre morgen nach New York.«
Mein Herz sackte mir in die Hose. Morgen? Morgen! »Gib mir fünf
Minuten!«, sagte ich.
»Wir sehen uns im Wäldchen.«
Ich wusste nicht, ob Drakes Eltern und seine Großmutter zu Hause
waren, aber ich wollte unter keinen Umständen, dass sie mich sahen
und meiner Mom erzählten, dass ich mich schon jetzt nicht an mein-
en Hausarrest hielt. Darum ging ich nicht ganz bis zum Haus von
Drakes Großmutter, sondern schlich wie üblich den kleinen Pfad
hinter dem Zaun entlang durch den Nachbarsgarten. Drake lief
gerade über den Rasen und zog sich den Reißverschluss seiner Jacke
zu. Wir trafen uns bei den ersten Bäumen.
Bevor ich ein Wort sagen konnte, hatte er die Arme um mich
gelegt. Er drückte mich so fest, dass ich fast keine Luft mehr bekam.
»Dramph«, sagte ich in seine Jacke hinein.
»Was?« Er lockerte seine Umarmung ein wenig.
»Drake«, sagte ich etwas deutlicher. »Ich kriege keine Luft!«
»Oh, entschuldige.« Er nahm seine Arme weg und meine Lungen
füllten sich wieder.
»Lass uns noch ein Stück weiter vom Haus weggehen.« Er nahm
meine Hand und führte mich tiefer in das Wäldchen hinein. Auf den
vereinzelten Grasflecken reckten ein paar Herbstzeitlose tapfer ihre
Köpfe, sonst aber kam man sich vor wie in einem Raum, in dem die
245/254

milden Temperaturen gehaust hatten, bevor sie plötzlich auf und
davon gegangen waren. Wir gingen zu unserem Baumstamm.
Drake setzte sich und sah mich an. »Nachdem wir dich abgeliefert
hatten, habe ich meinen Eltern alles erzählt. Wir sind noch nicht ein-
mal ins Haus gegangen. Wir blieben einfach im Auto sitzen und
haben geredet. Ich habe ihnen alles über Japhy erzählt, über die
Schlägerei in der Schule und dein Gedicht an den Wänden. Ich habe
ihnen sogar ›Lebe deinen Traum!‹ gezeigt.«
»Und? Wie haben sie reagiert?«, fragte ich, obwohl mich eigentlich
nur interessierte, ob Drake für immer wegging.
»Mein Dad meinte, dass man sich einige Träume im Leben tat-
sächlich erfüllen kann, wenn man fleißig dafür arbeitet, und dass es
hilft, positiv zu denken und gut zu planen. Nur: Man kann
niemanden zwingen, einen zu lieben. Japhy mag schwul sein oder
auch nicht. Aber wenn er schwul ist, muss er selbst entscheiden, ob
und wann er es anderen Leuten sagt.«
»Findest du, dass er recht hat?«, fragte ich.
»Ja. Und ich glaube, tief in meinem Inneren habe ich es die ganze
Zeit gewusst. Durch Buddys Buch habe ich mich nur irgendwie bess-
er gefühlt. Ich dachte, ich hätte Kontrolle über mein Coming-out und
über meine Zuneigung zu Japhy. Aber als ›Lebe deinen Traum!‹ da
auf dem Armaturenbrett lag, sah es so lächerlich aus«, schloss er.
Hier draußen unter den Bäumen kam mir Drake plötzlich weniger
glanzvoll vor. Er wirkte wie ein ganz normaler geknickter
Vierzehnjähriger. Der Bluterguss unter seinem Auge war etwas heller
als am Tag zuvor, so wie gebräunte Haut am Ende des Sommers
wieder blasser wird.
»Meine Eltern waren wirklich verärgert über das, was in der
Schule passiert ist … dass dein Gedicht ausgehängt wurde und die
246/254

Schlägerei. Nachdem wir alles beredet hatten, ließen sie mich aus-
steigen und fuhren zur Schule, um mit Direktor Foster zu sprechen.
Ich ging ins Haus und legte mich schlafen.«
»Haben sie dich von der Schule genommen? Fährst du deswegen
nach New York zurück.«
»Nein. Direktor Foster wusste über die Sache mit dem Gedicht
schon Bescheid, bevor meine Eltern zu ihm kamen. Sie haben
erzählt, dass er wegen des Vorfalls auch ziemlich sauer war. Er will
alles aufklären lassen. Man nimmt die Sache sehr ernst und wertet
sie als einen schweren Fall von Diskriminierung. Für die Prügelei
habe ich drei Tag Unterrichtsausschluss bekommen, weil ich zuerst
zugeschlagen habe. Aber Foster hat meinen Eltern versichert, dass
mir in Zukunft an dieser Schule bestimmt nichts mehr angetan
würde.«
»In Zukunft? Du willst doch nach New York zurück …«, wandte ich
ein.
»Meine Eltern haben in beiden Kunstschulen noch einmal an-
gerufen. Das war der andere Grund, warum sie mit Direktor Foster
sprechen wollten. Ich bin immer noch auf der Warteliste und nichts
tut sich. Meine Mom meint, wir sollten akzeptieren, dass ich weder
auf der einen noch auf der anderen Schule angenommen werde und
dass wir eine Entscheidung fällen müssen. Sie sind hergekommen,
um mit mir und Gran und mit der Schule zu besprechen, ob ich
während der ganzen Neunten in Hershey bleibe.«
»Aber am Telefon hast du doch gesagt …«
»Ich fahre morgen nach New York, um mein Zeug zu holen. Ich
wollte dich sehen, bevor ich drei Tage weg bin. Ich habe mich
entschieden, hierzubleiben.«
247/254

Mein Herz breitete seine Flügel aus und flog Endlosschleifen über
die Baumwipfel. Es flog Kreise und landete immer wieder auf dem
Baumstamm. Drake blieb hier! Das ganze Schuljahr!
»Ich habe keine Lust auf die Schule in unserem Bezirk in New
York. Und nachdem ich hier schon geoutet bin, muss ich es wenig-
stens nicht noch mal neuen Leuten erzählen.« Er sah mich böse an,
aber nur zum Spaß. »Es ist allerdings nur bis zum Ende des Schul-
jahrs«, fügte er rasch hinzu. »Nächstes Jahr will ich wirklich auf eine
Kunstschule.«
Mein Herz schwebte noch immer über unseren Köpfen.
»Aber wirst du dich an der Schule noch wohlfühlen, nach allem,
was passiert ist?«
»In einem meiner Ratgeber gibt es ein ganzes Kapitel darüber, was
man tun kann, wenn man von anderen geoutet wird. Dort steht auch,
dass es für manche Leute ein Albtraum ist, für andere aber eine Er-
leichterung. Irgendwie fühle ich mich ja auch erleichtert. Mom und
Dad wollen mir helfen, eine Strategie zu entwickeln, wie ich mich
verhalten kann. Und Direktor Foster hat seine Hilfe ebenfalls
zugesichert. Alle sind stolz, dass ich wiederkomme.«
Ein Stück über uns saß eine Krähe im Baum und krächzte. Drake
sah hinauf.
»Die Schule sagt also, dass das Aufhängen des Plakats eine
Diskriminierung war? Wissen sie schon, dass Sandy und Mandy
dahinterstecken?«
»Meine Eltern haben Direktor Foster zwar von Sandy erzählt, aber
sie haben keine Beweise. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht.«
Das war natürlich überhaupt nicht der Rachefeldzug, den ich mir
vorgestellt hatte!
Drakes Großmutter rief von der Terrasse.
248/254

»Ich komme, Gran.«
Hand in Hand gingen wir durch das Wäldchen zurück. Den ersten
Monat der neunten Klasse hatten wir gemeinsam durchgestanden.
Die Zukunft war eine weite Landschaft und wir waren ohne
Landkarte und Kompass unterwegs. Als wir den Rand des Wäldchens
erreicht hatten, fiel es mir schwer, Drakes Hand loszulassen.
Hinter einer großen Eiche umarmten wir uns, dann trat Drake
unter dem Blätterbaldachin hervor und ging über den Rasen zum
Haus seiner Großmutter. Ich drehte mich um, nahm die Abkürzung
über den Rasen der Nachbarn und lief am Zaun entlang zurück zur
Straße.
249/254

35
Es ist Mittwochmorgen und ich erwarte Drake an unserem üblichen
Treffpunkt, bei den Schaukeln im Park. Es ist so weit, dass wir die
Ruhe und die Schwerelosigkeit unserer Zeit des Unterricht-
sausschlusses zurücklassen und wieder in die laute, durch Sch-
werkraft bestimmte Atmosphäre der Highschool eintauchen. Meine
Hoffnung ist nur, dass wir beim Wiedereintritt nicht verbrennen.
Seit unserem geheimen Treffen habe ich Drake nicht mehr gese-
hen, aber ich weiß, dass er kommen wird. Ich vertraue ihm.
Ich habe meine schwarze Kapuzenjacke, einen schwarzen Rock,
schwarze Strumpfhosen und schwarze Stiefel an. Kann sein, dass ich
immer noch für den Kampf gekleidet bin. Aber ich bin nicht mehr
finster. Ich fühle mich unglaublich hell und leicht, als könnte ich aus
meinen Schuhen heraus und über die Schule hinweg schweben und
mich von der Brise dahintreiben lassen.
Heute nach der Schule werde ich mich nicht mit Drake im Wäld-
chen treffen, sondern zusammen mit meiner Mom ins Büro von
Direktor Foster gehen. Auch Mandy und Sandy werden mit ihren El-
tern da sein. Die Schule hatte den Vorschlag gemacht, nachdem
meine Mutter und ich am Montag bei Direktor Foster waren und ich
ihm die ganze Geschichte erzählt habe. Ich zeigte ihm das BUCH, das
Sandy und Mandy in der Achten gemacht hatten, aber ich gab auch
zu, dass ich Mandys Telefon gestohlen und Lügen über Sandy an die
Toilettenwände geschrieben hatte. Die Schule nimmt Mobbing sehr

ernst. Es sieht also so aus, als müssten wir alle unseren Preis zahlen.
Aber die ganze Geschichte zu erzählen war für mich trotzdem so, als
hätte ich die Tür eines dunklen Raums aufgestoßen und die Sonne in
jeden Winkel strahlen lassen.
Ich habe fünf Gedichte für unsere Schülerzeitung eingereicht und
will ab jetzt jeden Donnerstag nach der Schule den Schreibzirkel be-
suchen. Solange ich vom Unterricht ausgeschlossen war, haben mir
meine Lehrer die Hausaufgaben zugeschickt, sodass ich den Stoff
nacharbeiten konnte. Mr Pearson hat uns etwas schreiben lassen. Es
sollte um Milton S. Hershey gehen, den Gründer unserer Stadt. Die
literarische Form konnten wir frei wählen. Ich habe meinen Beitrag
als Gedicht geschrieben.
HERSHEY
Wer Schokolade auf Marmor ausstreicht,
braucht ein Thermometer, gefüllt mit Quecksilber.
Kakaobutter kann eine ganze Produktion zunichtemachen.
Quecksilber ist gefährlich. Fällt ein Thermometer herunter,
ist der ganze Laden kontaminiert. Quecksilber
dringt in die Zellen ein und kommt nicht wieder heraus.
Ein giftiger Fluss, der unter deiner Haut fließt.
Schokolade herzustellen ist gefährlich. Es ist aber auch
köstlich, lecker und süß, diejenige zu sein,
die den Spachtel ableckt und heimlich
einen Finger in die Schüssel taucht.
251/254

Informationen zum Buch
Wie rächt man sich am besten?
Rache – das ist Celias einziger Gedanke. Seit dieser unaussprechlich
schlimmen Sache, die Sandy Fireston ihr im letzten Schuljahr anget-
an hat, schmiedet Celia einen Racheplan nach dem anderen. Doch
ihr fällt einfach nichts ein, was nur annähernd fies und gemein genug
ist. Dann passiert etwas, womit Celia nie gerechnet hätte. Und plötz-
lich muss sie sich entscheiden, was ihr im Leben wirklich wichtig ist:
Rache oder Freundschaft?

Informationen zur Autorin/
Übersetzerin
Karen Finneyfrock ist wie ihre Heldin Celia eigentlich Lyrikautorin.
Sie lebt in Seattle, Washington, und gibt Kurse in Kreativem
Schreiben. Außerdem reist sie durch die Lande, um ihre Gedichte
vorzutragen. ›Ihr werdet schon sehen!‹ ist ihr erster Roman.
Friederike Zeininger arbeitet seit vielen Jahren als Übersetzerin und
Lektorin für verschiedene Verlage. Sie hat längere Zeit in Amerika
gelebt und die Gelegenheit genutzt, im Land herumzureisen.
Document Outline
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- Informationen zum Buch
- Informationen zur Autorin/Übersetzerin
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Grammatik sehen Arbeitsbuch Lösungen
osob-ref, ANALIZA KAREN HORNEY KONCEPCJI OSOBOWOŚĆI
15 Sozialformen im FSU – ihr Einsatz und ihre Vor und Nachteileid 16054
Karen Horney wykłady ostatnie+, Psychologia [autor eksperymentu więziennego], H, Horney
Ihr müsst stark sein-pl, Ksiegarnia, Jan Paweł II
so sehen uns ausländer JICG5FZQ32SYSTH2YC374LIUWJ2XQBFU2XNXP7A
Phraseologie im Kontext Ihre?kanntheit und ihr Verstaendnis
Grammatik sehen Arbeitsbuch Lösungen
Jawa, wyspa milosci Van der Zee Karen
Blixten Karen Pozegnanie z Afryka
Rachel Caine, Kerrie Hughes (ed) Chicks Kick Butt 02 Karen Chance [Dorina Basarab, Dhamphir] In
Robards Karen Dziecko Maggy
Robards Karen Żona senatora
Kingsbury Karen Cien wrzesniowego poranka
STRUKTURA OSOBOWOSCI NEUROTYCZNEJ WG KAREN HORNEY DLA GRUPY
0487 Templeton Karen Piękna i bogata
232 Leabo Karen Piaskowa dziewczyna
więcej podobnych podstron
