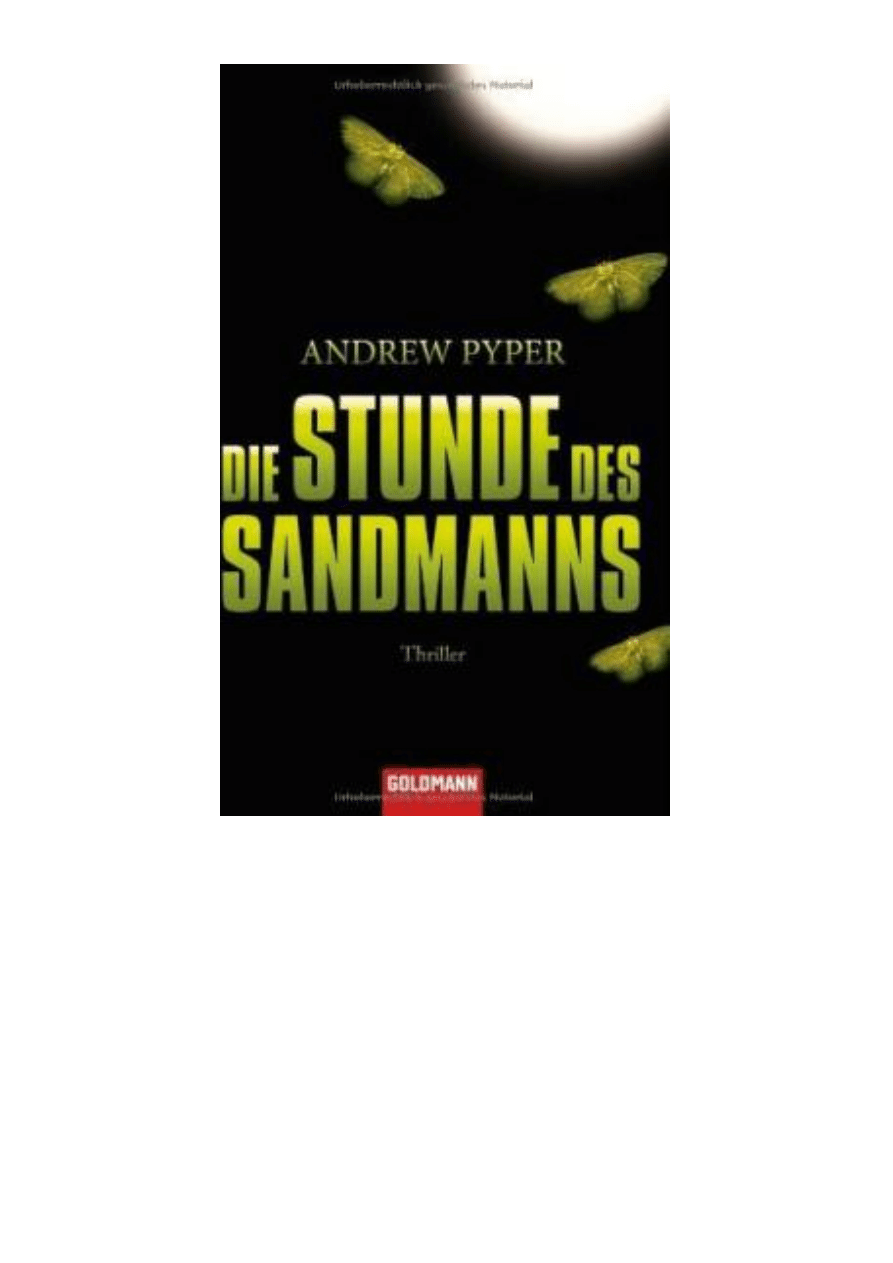

Buch
Als der alleinerziehende Vater und erfolglose Journalist Patrick Rush
einem Schreibzirkel beitritt, sieht er sich seinem Traum von einer Karriere
als Schriftsteller ein Stück näher gekommen. Besonders fasziniert ihn die
Geschichte seiner Kollegin Angela: Ein kleines Waisenmädchen wird vom
Sandmann verfolgt, der reihenweise Kinder umbringt. Wenig später wer-
den in Toronto innerhalb kurzer Zeit drei Leichen gefunden, die alle eines
gemeinsam haben: Der Mörder hat am Tatort eine Botschaft hinterlassen,
unterschrieben mit dem Pseudonym »Sandmann«. Patrick ahnt, dass es
einen Zusammenhang zwischen den realen Morden und Angelas unveröf-
fentlichter Geschichte geben muss. Handelt es sich bei dem Mörder um
jemanden, der das Manuskript gelesen hat? Noch bevor er mit Angela
sprechen kann, kommt diese bei einem mysteriösen Autounfall ums Le-
ben. Nun hält Patrick nichts mehr davon ab, die Horrorgeschichte unter
eigenem Namen zu veröffentlichen. Doch darauf hat der Sandmann nur
gewartet …
Autor
Andrew Pyper wurde 1968 in Stratford in der kanadischen Provinz Ontario
geboren. Er studierte Englische Literaturwissenschaften in Montreal und
Rechtswissenschaften in Toronto. Obwohl als Anwalt zugelassen, hat
Andrew Pyper nie in diesem Beruf gearbeitet, denn bereits sein erstes
Buch »Die Nachhilfestunde« wurde ein internationaler Bestseller und mit
dem Arthur Ellis Award für den besten Debütroman ausgezeichnet. An-
drew Pyper lebt in Toronto und schreibt momentan an dem Drehbuch zu
seinem vierten Roman »Die Stunde des Sandmanns«.
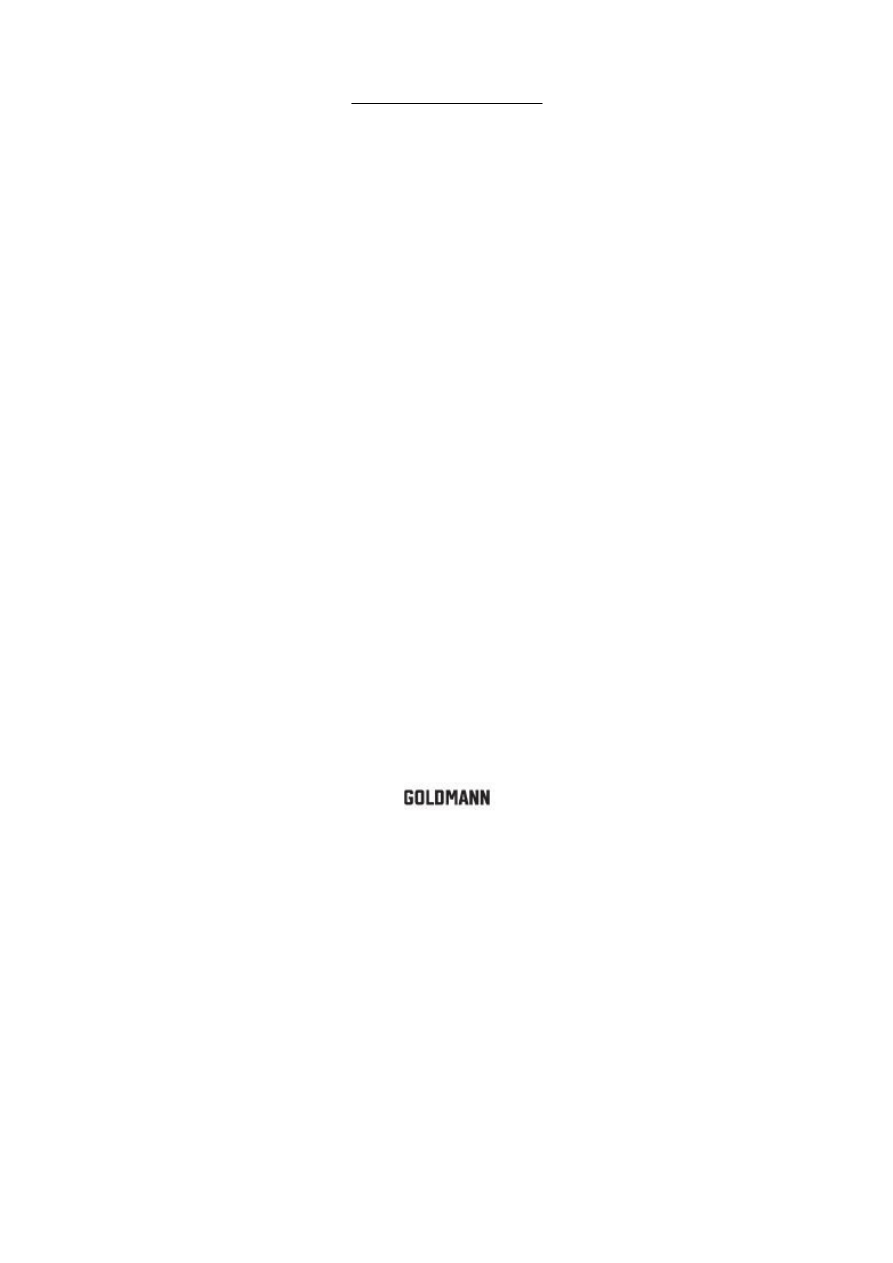
Andrew Pyper
Die Stunde
des Sandmanns
Roman
Aus dem Englischen
von Kristian Lutze
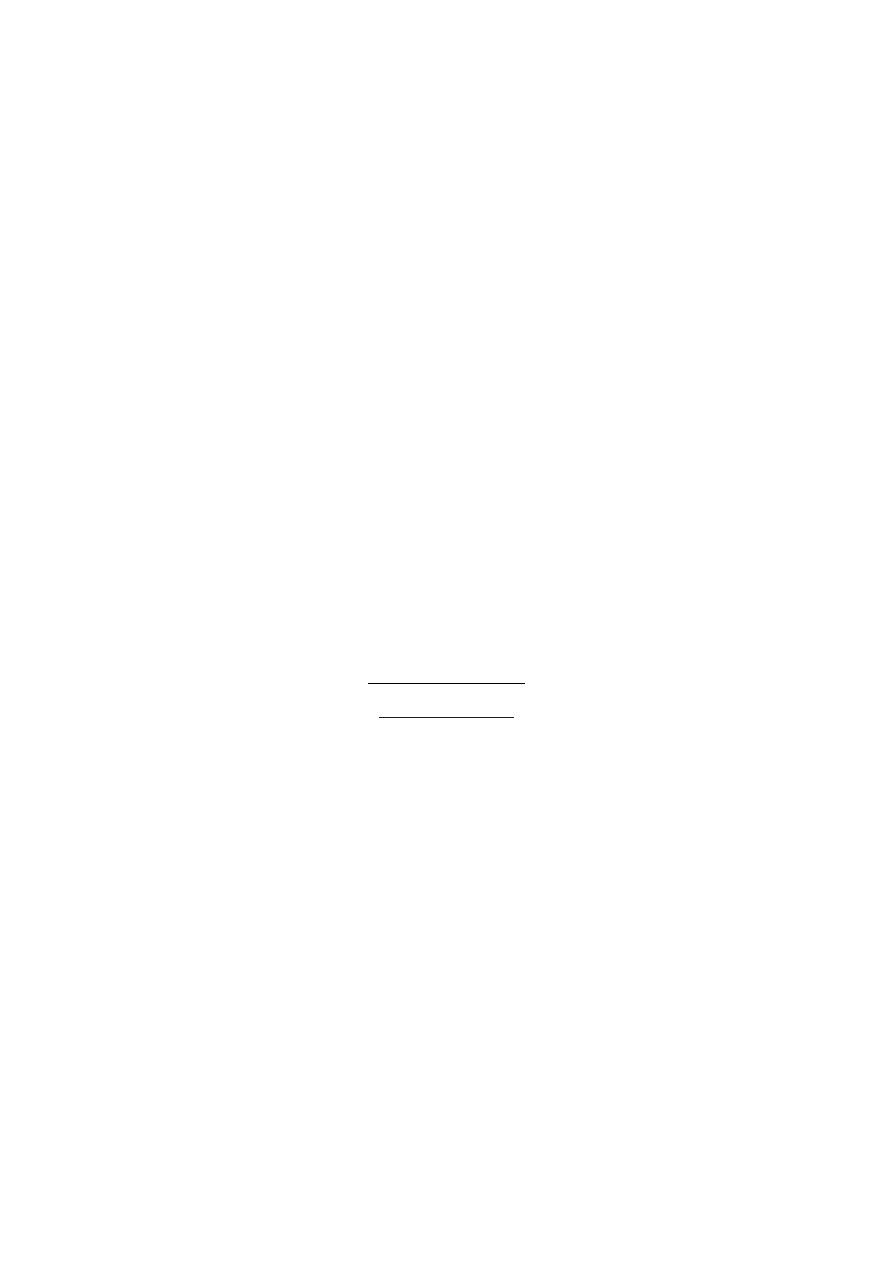
Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel »The Killing Circle«
bei HarperCollins Publishers, London.
Verlagsgruppe Random House
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung November 2009
Copyright © der Originalausgabe 2008 by Andrew Pyper
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2009
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlagfoto: © Harri/getty images
Redaktion: Martina Klüver
mb · Herstellung: Str.
eISBN : 978-3-641-03750-3
www.goldmann-verlag.de
www.randomhouse.de

Für Heidi

LABOR DAY, SEPTEMBER 2007
Ich wusste nicht, dass mein Sohn anhand der Sterne die
Himmelsrichtung bestimmen kann.
Südliche Krone. Leier. Delfin.
Sam hinterlässt Nasenabdrücke auf dem Beifahrerfenster,
während wir auf den Highways stadtauswärts fahren, er zählt
die Sternbilder auf und flüstert »Süden«, »Osten« oder »Nor-
den«, wenn ich abbiege.
»Wo hast du das gelernt?«
Er sieht mich genauso an wie neulich abends, als ich ihn
dabei ertappte, wie er vom Fenster seines Zimmers aus einen
Trupp Plastiksoldaten mit einer Schleuder auf das Dach des
Nachbarhauses katapultierte. »Ich bin ein Terrorist«, antwor-
tete er auf die Frage, was er da mache.
»Wo hab ich was gelernt?«
»Die Sternbilder.«
»In Büchern.«
»Was für Bücher?«
»Einfach Bücher.«
Ich weiß, dass ich von Sam nicht mehr erfahren werde. Das
liegt daran, dass wir beide Vielleser sind. Nicht unbedingt aus
Leidenschaft, sondern weil wir nicht anders können. Wir sind
von Natur aus Beobachter. Kritiker. Deuter. Wir lesen Bücher
(ich in letzter Zeit den späten, wütenden Philip Roth, Sam
Robinson Crusoe, in kleinen Häppchen als Gutenachtge-
schichte). Aber auch Comics, Reiseprospekte,
WC-Tür-Schmierereien, Bedienungsanleitungen, Rezepte auf

Cornflakes-Packungen. Egal, worum es sich handelt. Lesend
übersetzen wir die Welt in eine Sprache, die wir wenigstens
teilweise verstehen.
»Norden«, sagt Sam und wendet die Nase wieder der
Scheibe zu.
Beide spähen wir zu dem klobigen Schatten auf der Kuppe
des Hügels. Ein quadratischer Monolith ragt aus einem Mais-
feld in Ontario wie das letzte verbliebene Stück einer uralten
Mauer.
»Mus-tang Drive-in. Letz-te Vor-stellung. Lan-ge Film-
Nacht zum La-bor Day«, liest Sam, als wir an dem Schild
vorbeifahren.
Er beugt sich vor und betrachtet den Neon-Cowboy auf
einem bockenden Wildpferd, das Hinweisschild, das uns die
Abfahrt zum Mustang Drive-in anzeigt.
»Hier war ich schon mal«, sagt er.
»Daran kannst du dich erinnern?«
»An das Schild. Den Mann auf dem Pferd.«
»Damals warst du noch so klein.«
»Und was bin ich jetzt?«
»Jetzt bist du ein Bücher lesender, Sterne guckender junger
Mann.«
»Nein«, sagt er und verzieht das Gesicht. »Ich bin acht
Jahre alt. Und ich kann mich einfach an Sachen erinnern.«
Witwer und Sohn sind gemeinsam hergekommen, um die
letzte Vorstellung dieses Sommers in einem der letzten Auto-
kinos des Landes zu sehen. Das letzte der Letzten.
Tamara - Sams Mutter, meine Frau - ist acht Monate nach
Sams Geburt gestorben. Seitdem habe ich den praktischen
Nutzen von Kinobesuchen entdeckt. In einem dunklen Kino
(oder in diesem Fall auf einem dunklen Maisfeld) können
Sam und ich zu einer Vertrautheit finden, ohne miteinander
reden zu müssen. Es hat etwas sehr Männliches. Wie die Nä-

he, die Väter und Söhne beim Fliegenfischen oder beim An-
schauen von Baseballspielen erleben, wenn nicht viel zu tun
ist und man meist stumm nebeneinandersitzt.
Der Mann in dem Tickethäuschen stutzt, als er Sam auf
dem Beifahrersitz sieht. Der Hauptfilm des Abends - ein gru-
seliger Hollywood-Thriller, der gerade die letzten leicht ver-
dienten Dollars des Sommers einfährt - ist für Kinder nicht
freigegeben. Ich gebe dem Mann einen Geldschein, der den
Preis von zwei Eintrittskarten für Erwachsene mehr als ab-
deckt. Er zwinkert mir zu und winkt uns durch, ohne mir das
Wechselgeld auch nur anzubieten.
Es ist gerammelt voll. Der beste Platz, der noch frei ist,
liegt an der Seite, vor der kleinen Snackbar für Getränke und
Popcorn. Sam wollte es weiter hinten versuchen, aber ich
weiß, dass sich dort die Highschool-Kids versammeln. Gras
und eingeschmuggelter Whiskey, Jungs und Mädchen im
Teenageralter und all ihre heimlichen Abenteuer. Ich ziehe es
vor, bei den anderen, respektablen Zuschauern zu bleiben -
nicht aus Sorge um Sam, sondern weil ich den nostalgischen
Neid fürchte, den der Anblick dieser Eskapaden in mir wach-
ruft.
»Es fängt an!«, verkündet Sam, als das Flutlicht ausgeht.
Also muss ich unsere Stühle und den nach Mottenkugeln
riechenden Schlafsack im Licht der Werbung aus dem Kof-
ferraum holen. Ein Auge auf die Leinwand gerichtet, gehe ich
um den Wagen herum. Dies ist für mich der Höhepunkt: der
uralte Snackwerbespot. Ein tanzender Hotdog, ein anzüglich
schielender Milchshake, ein Chor aus Pommes. Und irgend-
wie bricht mir der Stepp tanzende Zwiebelring jedes Mal das
Herz.
Ich klappe erst Sams, dann meinen Stuhl auf, und wir ku-
scheln uns unter dem Schlafsack aneinander.

»Viel Spaß beim Haupt-film des A-bends!«, liest Sam von
der Leinwand ab.
Die in Reihen geparkten Wagen warten darauf, dass der
Himmel sich endgültig von Dunkelviolett zu Schwarz ver-
färbt. Rechts neben uns hupt es einmal - ein Minivan voller
ausgelassener Pfadfinder im Zuckerrausch -, was gedämpftes
Lachen aus den umliegenden Fahrzeugen provoziert. Aber all
die Geräusche klingen irgendwie nervös - der blökende
Warnruf und die hohle Heiterkeit der Antwort. Um diesen
Eindruck zu vertreiben, versuche ich selbst ein Lachen. Ein
Vaterlachen. Und nachdem es heraus ist, atme ich die ver-
traute Mischung aus Abgasen, Popcorn und verbrannten
Hamburgern ein. Und da ist noch etwas. Etwas wie Angst. So
schwach wie der Duft des Parfüms, den der vorherige Gast
auf dem Kopfkissen eines Motelzimmers hinterlassen hat.
Der Film fängt an. Die gruselige Einstiegsszene: eine
dunkle Gestalt verfolgt ihr Opfer über ein nächtliches Feld.
Aufblitzende Bilder einer verzweifelten Jagd. Rudernde Ar-
me, stampfende Stiefel und Schlüssel, die an einem Gürtel
klimpern. Gegenschnitte zwischen dem sicheren Schritt des
Mörders und dem panischen Rennen des anderen, ein Sturz,
Schluchzen und weiter auf allen vieren. Die kurze Aufnahme
einer Hand, von der Öl, feuchte Erde oder Blut tropft. Ein
Schrei in Nahaufnahme.
Es ist nicht klar, wer diese Person ist, dieses eineOpfer,
aber wir erkennen, dass sein Kampf aussichtslos ist. Es ist ein
Traum, den wir alle schon hatten; der, in dem unsere Beine
uns nicht tragen wollen und der Boden weich wird wie
schwarzer Sirup, der uns nach unten zieht. Und bei dem uns
der Tod auf den Fersen folgt. Gesichtslos und - natürlich -
unaufhaltsam.

Wir sind so nah an der Leinwand, dass ich mich ganz um-
drehen muss, um etwas anderes zu sehen. Augen, die mich
durch schlammverspritzte Windschutzscheiben betrachten.
Ich wende mich wieder nach vorn und lege den Kopf in
den Nacken. Das Himmelszelt, endlos und kalt an diesem
Herbstabend, lässt mich für einen Moment wieder atmen.
Dann bedrängen mich sogar die Sterne.
»Dad?«
Wegen meines Gezappels hat Sam sich zu mir gedreht. Ich
zwinge mich, wieder zu den Schauspielern auf der Leinwand
zu blicken. Es ist, als ob ihre Worte aus meinem Inneren kä-
men. Bald ist der Film nicht mehr irgendein Albtraum, son-
dern ein ganz bestimmter, den ich tausend Mal geträumt habe.
Ehe ich mich’s versehe, bin ich aufgestanden, sodass der
Schlafsack von meinen Knien rutscht.
Sam sieht zu mir hoch. Jetzt, wo sein Gesicht halb im
Schatten liegt, erkenne ich seine Mutter darin. Von ihr rühren
seine Freundlichkeit und seine Verletzlichkeit. Sie in seinen
Zügen zu sehen weckt das sonderbare Gefühl, jemanden zu
vermissen, der noch da ist.
»Willst du irgendwas?«, frage ich. »Pommes?«
Sam nickt. Und als ich ihm meine Hand hinstrecke, nimmt
er sie.
Wir schlurfen auf die Lichtquelle des Projektors zu. Ein
blauer Strahl, hin und wieder aufflackernde Streichhölzer,
wenn auf der Rückbank eines Wagens eine Zigarette ange-
zündet wird - dazu der matte Schein des abnehmenden
Monds. Und aus allen in die Autofenster gehängten Laut-
sprechern derselbe Dialog.
Er ist es.
Wovon redest du?

Das Wesen, das unter deinem Bett haust. Die Augen, die
dich nachts aus dem Kleiderschrank beobachten. Das Dunkel.
Das, wovor du dich am meisten fürchtest …
Jemand öffnet die Tür zur Snackbar, und ein Lichtstrahl
huscht über unsere Füße. Sam versucht, laufend mit ihm
Schritt zu halten, und spielt ein Spiel mit sich selbst: Wenn er
auf unbeleuchteten Kies tritt, wird er in eine andere Dimen-
sion katapultiert.
Das werden wir auch so. Die Snackbar stammt weder aus
Sams noch aus meiner Generation, sondern aus einer Zeit, in
der die Männer Krawatten trugen, wenn sie Cheeseburger
kauften. Die Poster an den Wänden zeigen strahlende Fami-
lien aus den Sechzigern, die aus ihren Heckflossen-Fords
steigen, um etwas Leckeres für ihre heißhungrigen, properen
Sprösslinge zu kaufen. Das reicht, um einem das Essen zu
vermiesen.
Aber eben nicht ganz.
Am Ende brauchen wir sogar ein Tablett, um darauf zwei
Maxi-Cola und die Schalen mit Pommes, Hotdogs in Folie
und Zwiebelringen zu verstauen, die so fettig sind, dass der
Pappteller, auf dem sie liegen, schon fast durchsichtig ist.
Aber bevor wir gehen, müssen wir bezahlen. Das Mädchen
an der Kasse spricht mit sich selbst. »Nie im Leben«, sagt sie
ungläubig. »Nie im Leben.« Erst jetzt fallen mir das Kabel in
ihrem Ohr und das kleine Headset unter ihrem Kinn auf.
»Echt?«
»Ich geh schon mal zu unserem Platz«, sagt Sam und fischt
einen Hotdog von dem Tablett.
»Aber pass auf die Autos auf.«
»Die parken, Dad.«
Er wirft mir ein mitleidiges Lächeln zu und rennt hinaus.
Nachdem ich bezahlt habe, sehe ich in der Dunkelheit erst
einmal gar nichts. Ein Pommes kullert aus seiner Schale und

wird von meinem Schuh zermalmt. Wo zum Teufel habe ich
geparkt? Schließlich erkenne ich es an dem Film, an dem
Winkel, aus dem ich ihn verfolgt habe. Noch ein Stück weiter
oben und ein bisschen zur Seite.
Und da steht er, mein uralter Toyota. Ein Auto, das ich in
der Tat ersetzen sollte, aber noch nicht weggeben kann. We-
gen des Lippenstifts und des Lidschattens, die Tamara im
Handschuhfach hat liegen lassen. Jedes Mal, wenn ich es öff-
ne, um meinen Fahrzeugschein herauszunehmen, fallen sie
mir in die Hand, und dann sitzt sie plötzlich neben mir auf
dem Beifahrersitz und klappt für letzte Retuschen die Son-
nenblende herunter. Egal, wohin wir fuhren, immer fragte sie
mich kurz vor dem Ziel: »Wie sehe ich aus?« Gut, antwortete
ich, und es war jedes Mal wahr.
Die Umrisse des Toyotas im Blick stolpere ich los, dane-
ben steht der Van mit den Pfadfindern. Sie sind jetzt still, ge-
bannt von dem spannenden Film.
Warum tut er das? Warum hat er uns nicht einfach umge-
bracht, als er die Gelegenheit dazu hatte?
Mir fällt das Tablett aus den Händen.
Nicht wegen des Films, sondern wegen dem, was ich vor
meinem Wagen sehe.
Da sind unsere Klappstühle und der Schlafsack.
Aber der Schlafsack liegt auf dem Boden, und beide Stühle
sind leer.
Ein paar der Kids aus dem Minivan schauen kichernd in
meine Richtung und zeigen auf das zu Boden gefallene Hot-
dog und die Extraportion Ketchup, die ich über meine Hose
gekleckert habe. Ich blicke in ihre Richtung. Was sie in mei-
nem Gesicht sehen, weiß ich nicht, aber sie schließen die
Schiebetür.
Ich laufe langsam die Gänge zwischen den Autos hinunter
und lasse meinen Blick sorgfältig in alle Richtungen schwei-

fen. Ich schaue durch diverse Fenster und bekomme einen
Ausschnitt des nordamerikanischen Freizeitverhaltens gebo-
ten - kiffende Jugendliche, gefräßige Erwachsene, Pärchen,
die es sich unter Decken auf der Ladefläche eines Pick-ups
bequem gemacht haben.
Aber kein Sam.
Zum ersten Mal kommt mir der Gedanke, die Polizei zu
rufen, aber es bleibt nur eine vage Idee. Sam ist seit höchstens
drei Minuten verschwunden. Er muss hier sein. Was passieren
könnte, passiert nicht. Es kann nicht sein. Es darf nicht sein.
»Sam!«
Irgendjemand stimmt in mein Rufen ein. Ein alarmierter
Dritter.
»Sam!«
Ich renne los, so schnell ich kann, dann wird mir klar, dass
ich es in diesem Tempo nicht bis zum Ende der Reihe schaffe,
und ich verlangsame meine Schritte zu einem Trab. Ein Mann
an die vierzig stolpert während des Hauptfilms zwischen den
geparkten Wagen herum und verdreht den Kopf in alle Rich-
tungen. Das erregt Aufsehen. Ein Teenager pfeift mir hinter-
her, und die Mädels, die sich mit ihm im Cabriolet seines Va-
ters auf den Vordersitzen drängen, winken mir spöttisch nach.
Ohne zu überlegen, winke ich zurück.
Als ich im Zickzack alle Gänge abgelaufen bin, gehe ich
außen herum und blicke auf die dunklen Felder. Hinter jeder
Reihe Mais könnte Sam in seinem Versteck darauf warten,
dass ich ihn finde. Die Vorstellung wird so konkret, dass ich
ihn ein paarmal tatsächlich sehe. Aber wenn ich stehen bleibe,
um genauer hinzusehen, ist er verschwunden.
Am Ende des Platzes ist das Licht von der Leinwand am
schwächsten. Alles ist in einen trüben Tiefseeschimmer ge-
taucht. Die Reihen mit Maispflanzen wirken breiter und
dunkler. Der Horizont wird nur vom Dach eines Farmhauses

unterbrochen. In den Fenstern brennt kein Licht. Ich blinzle,
um es genauer zu erkennen, aber mein Blickfeld verschwimmt
unter Tränen, die mich selbst überraschen.
Ich dachte, du wärst ein Geist.
Ich war auch ein Geist. Aber Geister sind machtlos. Es ist
besser, ein Monster zu sein. Die Art Monster, die man nicht
dafür hält, bis es zu spät ist.
Keuchend halte ich inne und stütze die Hände auf die Knie.
Panik befällt mich, schreckliche Fantasien. Bei wem er ist.
Was sie mit ihm machen werden. Oder schon machen. Und
dass er nie mehr zurückkommt.
Ich habe gesehen, wie jemand durchs Fenster geguckt hat.
Hast du gesehen, wer es war?
Ein Mann. Ein Schatten.
Ich bin schon auf dem Weg zurück zur Snackbar, als ich
sie sehe.
Eine Gestalt, die zwischen den Maispflanzen verschwindet,
so groß wie ich, wenn nicht größer. Erst ist sie da, dann nicht
mehr.
Ich versuche, die Reihen zwischen mir und der Stelle zu
zählen, wo die Gestalt in dem Feld verschwunden ist. Sieben?
Acht? Jedenfalls nicht mehr als zehn. Hinter der neunten Rei-
he laufe ich rechts querfeldein.
Die faserigen Blätter schlagen mir ins Gesicht, Stängel
brechen, als ich mich an ihnen vorbeidränge. Von außen sah
der Abstand zwischen den Reihen größer aus, aber in dem
Feld merke ich, dass ein Mann von meiner Größe in dem viel
zu engen Gang nicht vorwärtskommt, ohne ständig zu stol-
pern, behindert und geschnitten zu werden. Rennen ist das
kaum zu nennen, eher, als würde man von einem Schlund
verschluckt werden.
Wie kann die Gestalt, die ich gesehen habe, schneller sein
als ich? Die Frage lässt mich innehalten. Ich lege mich flach

auf den Boden und spähe zwischen den Stängeln hindurch.
Hier unten besteht das Licht aus grauem Himmelsstaub. Den
offenen Mund auf die Erde gepresst, ist mir, als hätte das
Mondlicht Geschmack angenommen. Mineralischer Schrot
aus Stahlspänen.
Ich konzentriere mich darauf, ganz still zu liegen.
Mir kommt der Gedanke, dass ich den Verstand verloren
habe, seit ich Sam zuletzt gesehen habe. Plötzlich auftretender
Wahnsinn. Das würde erklären, warum ich im Dunkeln durch
ein Maisfeld trample. Auf der Jagd nach etwas, das wahr-
scheinlich überhaupt nicht da gewesen ist.
Und dann ist es da.
Stiefel, die zum anderen Ende des Feldes rennen. Etwa
hundert Meter vor mir, ein paar Reihen weiter links.
Stöhnend rapple ich mich auf, ziehe mich mit den Händen
vorwärts und reiße dabei Maiskolben aus, die hinter mir auf
den Boden plumpsen wie die dumpfen Schritte eines Verfol-
gers.
Alle paar Meter blicke ich zu dem Farmhaus und schlage
mich schließlich ein paar Reihen nach links, um es direkt vor
mir zu haben. Als ob ich wüsste, dass die Gestalt dorthin
läuft. Als ob ich einen Plan hätte.
Wieder hebe ich den Kopf, um das Giebeldach anzuvisie-
ren, erblicke jedoch stattdessen die Gestalt, die von rechts
eine Bresche kreuzt. Eine huschende Bewegung zwischen den
seidigen Kolben, dunkler als die Nacht, die sich eng über das
Maisfeld spannt.
Ich stürze vorwärts und versuche blinzelnd, sie zwischen
den Reihen erneut auszumachen. Aber was suche ich eigent-
lich? Es ist weder Mann noch Frau. Keine Kleidung, keine
Kopfbedeckung, keine Haare erkennbar. Kein Gesicht. Eine
Vogelscheuche, die von ihrer Stange gesprungen ist.

Als ich laut rufe, meine ich nicht mehr Sam, sondern das
Wesen, das mit mir hier draußen ist.
»Bring ihn zurück! Bring ihn zurück!«
Es klingt nicht nach einer Drohung, nach einem Rachege-
löbnis, sondern einfach nur nach dem in Worte gefassten,
atemlosen Keuchen eines Vaters.
Plötzlich stolpere ich auf den Hof des Farmhauses. Auf
einer hoch gewucherten Wiese steht eine verrostete Schaukel.
Farbe blättert von den Fensterläden. Die Scheiben sind einge-
schlagen.
Ich gehe um das Haus herum. Kein parkender Wagen zu
sehen. Kein Anzeichen dafür, dass jemand hier war, seit ir-
gendeine schlechte Nachricht die Bewohner vertrieben hat.
Ich bleibe stehen und überlege, was ich tun soll. Im selben
Moment geben meine Beine nach. Ich sinke auf die Knie wie
ergriffen von dem dringenden Bedürfnis zu beten. Mit laut
pochendem Herzen lausche ich auf sich entfernende Schritte.
Nicht mal die Geräusche des Films dringen an mein Ohr. Ich
höre bloß das elektrische Summen der Grillen.
Sehen kann ich nur die Leinwand, dazwischen ein Meer
von Maiskolben, aber immer noch klar erkennbar. Und darauf
eine stumme Vorstellung des Grauens, die ungleich eleganter
und glaubwürdiger ist als mein eigener Horror.
Da geht es mir auf. Etwas, das ich niemals beweisen könn-
te, das aber trotzdem wahr ist.
Ich weiß, wer das getan hat, wer meinen Sohn geraubt hat.
Ich kenne seinen Namen.
Ich knie in dem hohen Gras des verlassenen Farmhofs und
starre in sein Gesicht, das sich zehn Meter hoch über den Fel-
dern erhebt. Stumm bewegt es die Lippen und spricht wie ein
Gott in die Nacht. Eine monströse Vergrößerung aus Licht auf
einer weißen Leinwand.

Die Rolle, die alle Schauspieler am liebsten spielen. Das
Böse.

ERSTER TEIL
Der Kensington-Kreis

1
VALENTINSTAG 2003
»Liebeskarten!«
Das ist Sam, mein vierjähriger Sohn, der in mein Zimmer
gerannt kommt und selbst gemalte Valentinskarten auf mein
Gesicht regnen lässt.
»Heute ist der Tag der Liebe«, bestätige ich und lüfte sein
T-Shirt, um ihm ein paar Furzküsse auf den Bauch zu drü-
cken.
»Wer ist dein Schatz, Daddy?«
»Ich nehme an, das müsste wohl deine Mami sein.«
»Aber sie ist nicht hier.«
»Das ist egal. Man kann auswählen, wen man will.«
»Wirklich?«
»Auf jeden Fall.«
Sam denkt darüber nach, während er die Karte faltet und
wieder aufklappt, sodass die Glitzersterne auf dem noch
feuchten Klebstoff hin und her gleiten.
»Und ist Emmie dein Schatz?«, frage ich ihn. Emmie ist
unser Kindermädchen. »Oder vielleicht jemand aus dem
Hort?«
Aber er überrascht mich. Wie so oft.
»Nein«, sagt er und präsentiert mir sein Herz aus Papier.
»Du.«
Tage wie diese, die unvermeidlichen kalendarischen Feste -
Weihnachten, Silvester, Vatertag, Muttertag -, sind schlimmer

als andere. Sie erinnern mich daran, wie einsam ich bin. Und
wie diese Einsamkeit sich im Laufe der Zeit immer tiefer in
mein Gewebe und meine Knochen gegraben hat. Eine Krank-
heit, die zwar nicht mehr akut ist, jederzeit aber wieder aus-
brechen kann.
In letzter Zeit hat sich jedoch etwas verändert. Die Leere
tritt noch mehr als bisher zutage, das volle, hohle Gewicht des
Verlusts. Ich dachte, ich hätte in den vergangenen dreieinhalb
Jahren getrauert. Aber vielleicht erwache ich gerade erst aus
meinem Schockzustand. Vielleicht kommt die eigentliche
Trauer noch.
Sam ist alles.
Diese eine Regel hilft nach wie vor. Aber in den Monaten
direkt nach Tamaras Tod war sie viel mehr als eine Orientie-
rung im Alltag. Sie hat mir geholfen zu überleben. Keine ein-
seitigen Bedürfnisse, kein Ich. Indem ich mir das Träumen
verbot, schaffte ich es, so gut wie nichts mehr zu fühlen - was
leichter war, als zu viel zu träumen und zu fühlen.
Aber womöglich war es ein Fehler, ein Irrtum zu glauben,
man käme auch ohne etwas Eigenes über die Runden. Wenn
Leben erfordert, nichts zu sein, lebt man irgendwann gar nicht
mehr.
Auf Tamaras letzte Tage will ich nicht eingehen, aber ich ge-
stehe jede Sorte von Fehlverhalten, Fehleinschätzungen und
Gesetzesverstößen meinerseits. Und ich bin durchaus bereit,
das Wesen der Erinnerung zu erkunden(wie es in schwülsti-
gen Klappentexten literarisch anspruchsvoller Strandlektüre
gern heißt), selbst wenn es mir tiefste Scham bereitet. Aber
ich werde nicht erzählen, wie es war, dem Leid meiner Frau
zuzusehen. Zuzusehen, wie sie gestorben ist.
Eins sage ich doch: Sie zu verlieren hat mir die Augen ge-
öffnet. All die ungezählten Stunden, die ich mich über ent-

täuschten Ehrgeiz, läppischen Ärger bei der Arbeit und ver-
meintlich schreiende Ungerechtigkeiten aufgeregt habe. All
die vergeudeten Chancen, etwas zu verändern, oder zu erken-
nen, dass ich mich hätte ändern können.
Als Tamara starb, war ich gerade einunddreißig geworden.
Noch nicht mal ein halbes Leben. Aber als sie mich verließ,
wurde grausam offensichtlich, wie vollkommen dieses Leben
hätte sein können. Wie vollkommen es gewesen war, wenn
ich es nur erkannt hätte.
Das Haus in der Euclid Avenue unweit der Ecke Queen Street
hatten wir als frisch verheiratetes Ehepaar noch vor der An-
kunft der Yoga-Studios, Hundert-Dollar-Coiffeure und Ero-
tik-Boutiquen gekauft. Die einzige Variante von Yoga, die
damals praktiziert wurde, waren die Verrenkungen der Pen-
ner, die in den Ladeneingängen schliefen, und das erotische
Angebot beschränkte sich auf eine halbe Stunde mit einer der
Damen, die auf hohen Absätzen an der Ecke standen. Ich hat-
te mir die Anzahlung für das Haus damals kaum leisten kön-
nen und kann es mir jetzt nicht leisten zu verkaufen. Wenn ich
in Innenstadtnähe wohnen bleiben möchte.
Und das möchte ich. Und sei es nur, weil ich gern zu Fuß
zur Arbeit gehe. Trotz der Annehmlichkeiten, die all das Geld
mit sich bringt, das neuerdings in die Gegend fließt, bekommt
man in der Queen Street als Fußgänger immer noch so einiges
geboten. Ein paar Punks, die vor dem Big Bop zwei sich an-
knurrende Mastiffs anfeuern. Ein Chor von
Mit-sich-selbst-Rednern, die ihre Medikamente nicht ge-
nommen haben. Der Typ, der mir jeden Morgen einen Block
lang folgt, mich bittet, ihm ein Prosciutto-Sandwich zu kaufen
(da ist er sehr präzise), und mich unerklärlicherweise Steve-o
nennt. Nicht zu erwähnen die Krankenwagen, die diejenigen

abtransportieren, die am Abend zuvor kein Bett im Obdach-
losenasyl mehr bekommen haben.
Jeder betont, wie sehr Toronto sich verändert. Immer neue
Bauprojekte, zunehmend mehr Menschen, die hier wohnen,
andere Methoden, Geld zu machen und auszugeben. Und im-
mer mehr Angst. Geschichten von willkürlicher Gewalt ma-
chen die Runde, von Überfällen auf Privathäuser, Schüssen
aus vorbeifahrenden Autos, wahllosen Angriffen. Aber es ist
nicht nur das. Es ist nicht die Gefahr, die schon immer von
irgendwelchen zwielichtigen Gestalten ausgegangen ist, son-
dern die Bedrohung durch potenziell jeden, sogar uns selbst.
Die Spannung ist inzwischen überall spürbar, eine Aggres-
sivität, aus unstillbaren Bedürfnissen geboren. Weil es mehr
zu holen gibt als früher, will man auch mehr haben. Und diese
Veränderung, die sich schnell und unkontrollierbar um uns
herum vollzieht, lässt Menschen ihre Nachbarn auf neue, bis-
her ungekannte Weise mustern. Als Absatzmarkt, demogra-
phische Gruppe, Zugriffspunkt.
Gemeinsam ist allen der Wunsch nach mehr. Aber das
Wünschen hat auch eine dunkle Seite. Menschen, die zuvor
bloß Fremde waren, können zu Konkurrenten werden.
Ich folge der Queen Street bis zur Spadina Avenue und gehe
in Richtung See bis zur Redaktion des National Star - »der
New York Times von Toronto«, wie es in einer besonders
misslungenen Werbekampagne hieß. Dort habe ich angefan-
gen. Ein wütender junger Mann ohne rechten Grund, wütend
zu sein, der rasch vom einfachen Redakteur zum jüngsten
redaktionseigenen Literaturkritiker aller Zeiten aufstieg. Mit
gnadenlos hohen Ansprüchen, gestützt von der Überzeugung,
dass all die literarischen Leuchten, die ich niedergemacht hat-
te, noch erkennen würden, dass ich sie zu Recht verrissen
hatte. Eines Tages würde ich selbst ein Buch schreiben.

Solange ich mich erinnern kann, hatte ich das Gefühl, dass
in mir etwas schlummert, das irgendwann einen Ausdruck
finden würde. Wahrscheinlich hat das alles mit meiner Kind-
heit zu tun, mit der Einsamkeit eines Einzelkindes, dessen
einzige Freunde oft Bücher waren. Und mit den Wochenen-
den, an denen ich mich zu Hause verkroch, wie eine Katze
zusammengerollt auf den sonnigen Flecken des Teppichs,
Greene, Leonard und Christie verschlang, über die unerreich-
baren James, Faulkner und Dostojewski grübelte und mich
fragte, wie sie es machten. Welten erschaffen.
Nie jedoch zweifelte ich daran, dass ich einer von ihnen
werden würde, wenn ich groß war. Nicht unbedingt ihres-
gleichen, aber befasst mit der gleichen edlen Tätigkeit. Ich
akzeptierte, dass ich vielleicht nicht von Anfang an gut sein
würde. Aber ich konnte die harte Arbeit spüren, die in meine
Lieblingsbücher geflossen war, und ich war bereit, Stück für
Stück dazuzulernen.
Rückblickend ist mir klar, dass die Idee vom Schreiben für
mich so etwas wie eine Religion gewesen sein muss. Totale
Hingabe und aufrichtige Offenbarung und trotz der Gottlo-
sigkeit nicht weniger heilig. Schließlich gab es die Aussicht
auf Erlösung. Die Möglichkeit, eine Geschichte zu schaffen,
die für mich sprach, die besser sein würde als ich. Zwingen-
der, geheimnisvoller, weiser. Als sie noch lebten, habe ich
wohl auch geglaubt, mit dem Schreiben eines Buches könnte
ich meine Eltern bei mir behalten. Und nachdem sie nicht
mehr da waren, drehte ich mein Glaubensbekenntnis einfach
um: Wenn ich ein Buch schrieb, das gut genug war, konnte
ich sie damit vielleicht zurückholen.
Aber es kam kein Buch.
Stattdessen schrieb ich mich nach dem Studium als freier
Mitarbeiter die Leiter der Kleinstadt-Gazetten und Spezial-
zeitschriften hoch (»Neuer Hund, neues Ich« für Der Tier-

freund und »Karotten oder Rote Beete: Die Wurzel des Pro-
blems« für Der natürliche Garten waren zwei Meisterwerke
ihres Genres). Nach meiner Hochzeit und der Anstellung beim
National Star dachte ich nicht mehr so oft an mein Buch und
häufiger an meine konkrete Zukunft. Kinder. Reisen. Aber der
nagende Gedanke, meine Bestimmung für private Annehm-
lichkeiten zu verraten, ließ sich nicht ganz unterdrücken. In
einer stillen Nische meiner Seele wartete ich immer noch. Auf
den ersten Satz. Auf einen Einstieg.
Aber es kam kein erster Satz.
Dann passierten zwei Dinge gleichzeitig, die seltsam ver-
bunden waren: Tamara wurde schwanger, und ich kündigte
mein Abonnement für die Sonntagsausgabe der New York
Times. Mit der Begründung, dass ich kaum Zeit fand, die ein-
zelnen Teile und Beilagen auseinanderzupflücken, geschwei-
ge denn sie zu lesen. Und nachdem nun ein Baby unterwegs
war, war es pure Verschwendung.
In Wahrheit ging es jedoch nicht darum, Zeit zu sparen
oder den Wald zu retten, sondern darum, dass ich an den
Punkt gekommen war, die Literaturseiten der Sonntags-Times
nicht mehr ohne körperliche Schmerzen aufschlagen zu kön-
nen. Die Verlage, die Autoren, die Titel, alle von Büchern, die
nicht meine waren.
Es tat weh. Nicht nur emotional, nicht bloß als Prügel für
mein Ego. Es tat weh wie Nierensteine oder der Tritt eines
Stollenschuhs in die Eier - unmittelbar, unbeschreiblich, all-
umfassend. Der Inhalt der Rezensionen spielte kaum eine
Rolle. Auch nur ansatzweise positive Kritiken konnte ich eh
nicht zu Ende lesen. Und die negativen Besprechungen er-
wiesen sich meist als untauglicher Balsam für meine Wunden.
Selbst höhnischste Verrisse und krasseste Polemiken über den
Niedergang eines Autors erinnerten lediglich daran, dass ihre
Opfer etwas geschaffen hatten, das anzupissen sich lohnte.

Oh, was hätte ich darum gegeben, mich an einem verregneten
Sonntag in meinem Bett zu verkriechen, weil die Times mich
verrissen hatte! Welch süßer Schmerz verglichen mit dem
langsamen Verbluten im Niemandsland, überhaupt Worte
geschaffen zu haben, die der Verachtung eines großen Blattes
würdig waren.
Dann kam Sam, und die schlimme Sehnsucht verschwand.
Ich war verliebt - in Tamara, in meinen Sohn, sogar in die
Welt, die ich vorher eigentlich nicht besonders gemocht hatte.
Ich hörte auf zu schreiben. Ich war zu beschäftigt mit Glück-
lichsein.
Acht Monate später war Tamara nicht mehr da.
Sam war ein Baby, zu jung, um sich an seine Mutter zu er-
innern. Ich musste die Erinnerung für uns beide bewahren.
Kurz darauf kehrte mein alter Glaube ans Schreiben zu-
rück. Ich begann, auf die Chance zu lauern, die eine wahre
Geschichte zu erzählen, welche die Toten zurückbringen
würde.
Die Degradierungen begannen nach meiner Rückkehr aus
dem unbezahlten Urlaub, den ich nach Tamaras Tod genom-
men hatte. Die anstehende Jahrtausendwende, erklärte man
uns, werde eine Ära neuer, »benutzerfreundlicher« Zeitungen
einläuten, welche im Wettbewerb mit Internet, Kabelfernse-
hen und einer immer schneller konsumierenden Leserschaft
bestehen müssten. Zu lange, anspruchsvolle Texte würden
von den Leuten bloß als Zeitverschwendung angesehen. Also
wandelte man das Feuilleton zur Unterhaltungsseite um, Ar-
tikel wurden gekürzt, um Platz für Promi-»News« und Fotos
von Filmstars mit Sonnenbrillen und Kaffeebechern in Han-
telgröße zu schaffen. In internen Rundmails wurden wir auf-
gefordert, unsere Texte nicht mehr an den Ansprüchen von
Erwachsenen auszurichten, welche Information und Analyse

erwarteten, sondern an denen von Halbwüchsigen mit Auf-
merksamkeits-Defizit-Syndrom.
Sagen wir einfach: Es waren keine guten Zeiten für die Li-
teraturseiten.
Nicht dass der Ruin meiner journalistischen Karriere über
Nacht gekommen wäre. Ich war in der Redaktionshierarchie
immer weiter nach unten gerutscht, vom literarischen Kolum-
nisten (schadenfrohe, sarkastische Verrisse von fast allem)
zum Unterhaltungsredakteur (Porträts von Starlets und Zu-
sammenfassungen der Einspielergebnisse an den Kinokassen
vom Wochenende), dann war ich ein paar Monate »Ju-
nior-Redakteur für Nachrufe« (der »Senior-Redakteur« war
fünf Jahre jünger als ich), bevor ich den unumstrittenen Tief-
punkt erreichte, zuständig für jede Art von Zeitungsmüll:
Fernsehkritiker. Ich versuchte, den zuständigen Redakteur zu
überreden, meinen Namen wenigstens mit dem Zusatz »Me-
dienkolumnist« zu versehen, aber als ich am darauffolgenden
Wochenende die TV-Beilage aufschlug, stellte ich fest, dass
ich nicht einmal mehr einen Namen hatte und ab sofort ein-
fach als »Die Couchkartoffel« firmierte.
Was durchaus zutreffend ist. Die hinter mir liegenden Mo-
nate beruflichen Niedergangs haben dazu geführt, dass ich
mehr und mehr Zeit auf diversen Sesseln und Matratzen zu-
gebracht habe: in meinem Bett, in dem ich jeden Morgen ein
bisschen länger liegen bleibe, auf dem Sessel in der Praxis
meines Therapeuten, von dem ich mich jedes Mal schweiß-
gebadet wieder erhebe, und auf dem Sofa im Keller, wo ich
mir im Schnelldurchlauf die Pilotfolgen hirnloser Sitcoms,
Krimiserien und Doku-Soaps angucke, die zusammenge-
nommen wie eine abstumpfende Droge wirken. Happy Pills,
wie man sie Psychiatriepatienten unter die Zunge schiebt.
Das alles ist natürlich keine Schande. Jedenfalls keine
größere als die meisten Sachen, die wir für Geld machen, da

es bei Rettet die Wale, Ein Brunnen für Afrika oder SOS Glo-
bale Erwärmung nur beklagenswert wenig bezahlte Jobs gibt.
Das Problem ist: Beinahe unbemerkt ist mein Kindheits-
traum zu mir zurückgekehrt wie ein irres Flüstern im Ohr. Ein
Fluch schwarzer Magie. Ein Versprechen des Teufels.
Wenn ich nur die richtigen Wörter in die richtige Reihen-
folge bringen könnte, wäre ich gerettet. Vielleicht könnte ich
meine Sehnsucht in Kunst verwandeln.
Ein langjähriger Kritiker hat unvermeidlich etwas Verbitter-
tes, denn die Profession ist im Grunde tägliche Erinnerung an
den eigenen zweitrangigen Status. Niemand startet mit dem
Ziel, Bücher zu besprechen, er will sie schreiben. Etwas an-
deres zu behaupten wäre so, als würde man versuchen, je-
mandem weiszumachen, man habe schon als Kind davon ge-
träumt, Jockeys zu wiegen, anstatt selbst Rennpferde zu rei-
ten.
Falls es eines Beweises bedarf, muss man nur das halbe
Dutzend Seelen betrachten, die an ihren Arbeitsplätzen um
meinen herum auf ihre Computer-Tastaturen einhacken und
zwischendurch ins Nichts starren. Gemeinsam sichten wir das
Strandgut, das die Wellen der Popkultur jeden Morgen he-
reinspülen: CDs, DVDs, Computerspiele, Filme, Zeitschrif-
ten. Sogar das Literaturressort, das jetzt nur noch eine einzige,
allseits ignorierte Seite in der Samstagsausgabe verantwortet.
Immer noch besser als der Platz, an den man mich gesteckt
hat.
Da wären wir. In einer Ecke ohne Fenster in Ta-
cker-Wurfweite. Ein Ressort, das die Kollegen wegen der
schwankenden Stapel schwarzer Videokassetten auf jeder
freien Stellfläche den Porno-Palast nennen. Und es ist Porno-
grafie. Es ist Fernsehen. Eine süchtig machende, schamvolle

Lust, von der wir offenbar alle nicht genug bekommen kön-
nen.
Auf meinem Stuhl steht ein Karton mit Neueingängen. Ich
ziehe das erste Angebot heraus - eine Reality-Show, bei der
Kandidatinnen in Bikinis lebendige Spinnen essen -, als Tim
Earheart, einer der Reporter, mir auf die Schulter klopft. Man
sollte es nicht meinen, aber Tim ist mein bester Freund hier.
Vielleicht sogar mein bester Freund überhaupt.
»Hast du irgendwas von Girls Gone Wild?«, fragt er und
kramt die Kassetten durch.
»Ich dachte, du wärst ein Dokumentarfilm-Liebhaber.«
»Meine Frau ist diese Woche weg. Vielleicht kommt sie
gar nicht mehr zurück.«
»Janice hat dich verlassen?«
»Sie hat spitzgekriegt, dass meine Quelle für die
Hell’s-Angels-Story letzte Woche die Mutter eines der Jungs
war«, sagt Tim mit einem traurigen Lächeln. »Sagen wir mal,
ich hab mit der Frau mehr undercover gearbeitet, als Janice
lieb war.«
Wenn es stimmt, dass seine aktuelle Ehefrau ihn verlassen
hat, wäre somit Tims dritte Ehe im Eimer. Er wird nächste
Woche sechsunddreißig.
»Tut mir leid für dich«, sage ich, aber er winkt ab.
»Gehen wir heute Abend einen trinken?«, fragt er und
schickt sich an, in die hektische Bedeutsamkeit der Nachrich-
tenredaktion zurückzukehren. »Warte. Heute ist Valentinstag,
oder? Hast du schon ein Date?«
»Ich hab keine Dates, Tim. Ich mache gar nichts.«
»Ist schon’ne Weile her.«
»So lang auch wieder nicht.«
»Es gibt Leute, die sagen würden, vier Jahre sind genug -«
»Drei.«

»Dann eben drei Jahre. Irgendwann musst du dich der Tat-
sache stellen, dass du noch hier bist, auch wenn Tamara nicht
mehr da ist.«
»Glaub mir, dem stelle ich mich jeden Tag.«
Tim nickt. Er hat in Kriegsgebieten gearbeitet. Er weiß,
wie Opfer aussehen.
»Darf ich dich was fragen?«, sagt er. »Meinst du, es ist zu
spät, um die neue Aushilfe aus der Personalabteilung auszu-
führen?«
Auf dem Nachhauseweg ist es wieder passiert.
Dieser Tage geschieht es immer häufiger, dass mir ganz
plötzlich die Tränen kommen - wenn ich auf einen Sprung in
den Laden an der Ecke gehe, bei der täglichen Zeilenproduk-
tion an meinem Schreibtisch oder in der Warteschlange vor
dem Kaffeeautomaten. So still und ohne jede Vorwarnung,
dass ich sie kaum bemerke.
Als ich heute nach Hause ging, ohne an etwas Bestimmtes
zu denken, ging es wieder los. Feuchte Rinnsale, die langsam
meine Wangen hinunterliefen.
Ein Reim spukt mir im Kopf herum, ein nicht besonders
tröstlicher Singsang, der mich nach Hause trägt.
Mir fehlt was
Mir fehlt was
Aber wen
Interessiert das?
Sam hat schon zu Abend gegessen, als ich zu Hause ankom-
me. Das Kindermädchen trocknet ihn gerade nach dem Baden
ab. Ein weiterer unwiederbringlicher Moment, den ich ver-
passt habe. Ich mag das abendliche Bad mit Sam mehr als
jede andere Stunde des Tages. Ein wenig Musik. Epische

Seeschlachten, ausgefochten mit Gummienten und alten
Zahnbürsten. Danach ins Bett und Gutenachtgeschichten.
»Ich nehme ihn«, erkläre ich Emmie, und sie löst das
Handtuch, das sie um ihn gewickelt hat. Er stürzt aus seinem
Kokon in meine Arme, ein schaumbedeckter Engel.
Ich ziehe ihm seinen Schlafanzug an und klappe das Buch
auf, an dem wir gerade sind. Bevor wir zu lesen anfangen,
betrachtet er mich eine Weile und legt seine Hand auf meine
Stirn.
»Was meinen Sie, Doc? Werde ich es schaffen?«
»Sie kommen durch«, sagt er.
»Aber es ist etwas Ernstes?«
»Ich weiß nicht. Ist es schlimm?«
»Nichts, was ich nicht in den Griff bekomme.«
»Ich will nicht, dass du traurig bist.«
»Manchmal vermisse ich deine Mom. Das ist alles. Es ist
normal.«
»Normal.«
»Mehr oder weniger.«
Sam schiebt die Lippen vor. Er weiß nicht, ob er mir mein
verkniffenes Lächeln glauben soll. Für ihn ist es nämlich
wichtig, dass es mir gutgeht. Und für ihn versuche ich, mich
am Riemen zu reißen. So gut ich kann.
Er gähnt, kuschelt sich enger an mich, legt seinen Kopf an
meinen Hals, um die Schwingungen der folgenden Worte zu
spüren, und zeigt mit dem Finger auf die Seite, die ich auf-
halte.
»Wo waren wir?«
Nachdem Sam eingeschlafen ist, geht es in mein Arbeitszim-
mer im Keller. Tamara hat es immer die Krypta genannt. Ein
wenig zu treffend, um richtig komisch zu sein. Ein Raum mit
niedriger Decke, den der Vorbesitzer zur Weinherstellung

benutzt hat. Bis heute kann ich einen Hauch von fermentierten
Trauben riechen und muss dann immer an Füße denken.
Hier schaue ich mir die Videos an, einen Notizblock auf
den Knien, die Fernbedienung in der Hand.
Schon nach drei Minuten von den Spinnen essenden Biki-
ni-Mädchen drücke ich auf Pause und ziehe eine Anzeige aus
der Tasche, die ich aus der heutigen Zeitung ausgeschnitten
habe.
Öffnen Sie Ihre Seele. Bringen Sie die in Ihnen schlum-
mernden Worte zu Papier in einem Intensiv-Workshop mit
Conrad White, Autor mehrerer Lyrikbände und Romane.
Wahrhaft schreiben. Die Wahrheit schreiben. Ich
habe
noch nie von Conrad White gehört, habe noch nie eine Auto-
ren-Werkstatt, einen Literaturkreis, Abendkurs oder ein
Schreibseminar besucht. Es ist Jahre her, dass ich überhaupt
versucht habe, etwas zu schreiben, wozu ich vertraglich nicht
verpflichtet war. Aber irgendetwas an diesem Tag - am Ge-
schmack der Luft in diesem Zimmer - signalisiert mir, dass
etwas auf mich zukommt. Oder schon da ist.
Ich wähle die Nummer unter der Anzeige. Als sich am an-
deren Ende ein Mann meldet und mich fragt, was er für mich
tun kann, antworte ich ohne Zögern.
»Ich will ein Buch schreiben«, sage ich.

2
Heutzutage lesen die Menschen weniger als früher. Wer die
Studien kennt, Kinder im Teenageralter hat oder schon mal in
einem Einkaufszentrum war, weiß das. Aber hier ist etwas,
das Sie vielleicht noch nicht wissen:
Je weniger die Leute lesen, desto mehr wollen sie schrei-
ben.
Schreib-Workshops - an Universitäten, in Bibliotheken,
Volkshochschulen, psychiatrischen Kliniken und Gefängnis-
sen - sind die wahre Wachstumsbranche der Printindustrie.
Nicht zu erwähnen die entsprechenden Zirkel nervöser Aspi-
ranten, die ihre fotokopierten Stapel verteilen. Jeder behaup-
tet, an ehrlichem Feedback interessiert zu sein, betet jedoch
insgeheim darum, allseits für brillant befunden zu werden.
Und jetzt bin ich einer von ihnen.
Die Adresse, die mir die Stimme am Telefon genannt hat,
liegt in Kensington Market. Die Treffen sollen in den nächs-
ten fünf Wochen jeweils dienstagabends stattfinden. Ich sei
der Letzte, der in die Gruppe aufgenommen werde, erfahre
ich. Das heißt, ich nannte es eine Gruppe, und die Stimme
verbesserte mich.
»Ich sehe es lieber als Kreis.«
»Gut. Und wie viele werden dort sein? In dem Kreis?«
»Nur sieben. Mehr würden der Konzentration schaden,
fürchte ich.«
Nach dem Auflegen wurde mir bewusst, dass Conrad
White - wenn er der Mann am Telefon gewesen war - mich

nicht nach meinem Namen gefragt hatte. Und ich merkte, dass
ich vergessen hatte zu fragen, ob ich zum ersten Treffen ir-
gendetwas mitbringen sollte - Stift, Notizblock, Bargeld für
den Sammelteller. Aber als ich die Nummer noch einmal an-
rief, klingelte es zehn Mal, ohne dass jemand abnahm. Ver-
mutlich sah Mr. White keinen Sinn mehr darin, nachdem er
genug Teilnehmer zusammenhatte.
Am nächsten Dienstag gehe ich, einen Schal um die Ohren
gewickelt, nach der Arbeit die Spadina Road hinunter. Trotz
der Kälte haben die meisten Händler in Chinatown ihre Waren
noch immer vor ihren Läden aufgebaut. Bok Choy, Stern-
frucht und Zitronengras mit einem Puder aus trockenem
Schnee. An der Dundas Street bricht ganz plötzlich die Däm-
merung herein. Der riesige Bildschirm auf der Dragon Mall
taucht die Straße in blauen Reklameglanz.
Ich gehe ein paar Blocks weiter nach Norden, vorbei an
den glutamatfreien Nudel-Imbissen und Schaufenstern von
Metzgern, in denen ganze Spanferkel an Haken hängen, das
Maul verblüfft aufgerissen. Dann ein Sprint über die vierspu-
rige Straße in die engen Marktgassen.
Kensington bedeutet für jeden etwas anderes, aber für mich
wirft ein Gang durch die Straßen hier jedes Mal die gleiche
Frage auf: Wie lange kann es noch dauern? Einige der Ge-
bäude werden bereits in »moderne Lofts zum Leben und
Arbeiten in einem Ambiente moderner Urbanität« umgewan-
delt, für Leute, die »das Abenteuer jenseits des Üblichen«
suchen. Ich ziehe ein winziges Diktafon aus der Tasche, das
ich immer bei mir trage (um besonders ätzende Sätze für
meine nächsten Fernsehkritiken festzuhalten), und lese die
Worte direkt von den Reklamewänden für das neuste Immo-
bilienprojekt ab. Einige Passanten sind ebenfalls stehen ge-
blieben, um das Angebot zu studieren. Aber als sie mich in

mein Diktafon flüstern hören, gehen sie weiter. Noch ein am-
bulanter Psychiatriepatient, den man höflich meiden sollte.
Ein Stück weiter heben alte portugiesische Fischhändler
Kabeljau und Tintenfische aus ihren Eisbetten und tragen sie
für die Nacht in die Kühlräume. Bald wird es auf der Straße
von mit Sicherheitsnadeln gepiercten Punks und Ganzjahres-
radlern wimmeln, die auf ein abendliches Schnäppchen lau-
ern. Oder sich einfach an einem der letzten Orte der Stadt
versammeln, an denen man gegen den Ansturm von gesichts-
loser Aufschickung, globalisierter Gleichförmigkeit und Geld
noch Widerstand spürt.
Und dann kommt mir mit einem beunruhigenden Schauder
der Gedanke, dass einige von den Leuten, die sich um mich
herum drängen, aus dem gleichen Grund hier sind wie ich.
Sie könnten Schriftsteller sein.
Die Adresse, an der das Treffen stattfinden soll, ist das Nach-
bargebäude von The Fukhouse, einer Bar, in der, wie ich
durch das schmutzige Fenster erkennen kann, jede Wand, alle
Tischflächen sowie Decke und Boden schwarz glänzend ge-
strichen sind. Oberhalb des Schildes flackern in den Fenstern
des ersten Stocks dicke Kerzen. Wenn ich die Hausnummer
richtig notiert habe, versammelt sich dort der Kensing-
ton-Kreis.
»Anarchisten«, sagt eine Stimme hinter mir.
Ich drehe mich um und sehe eine Frau in einer zu großen
Motorradlederjacke, die Schultern mit silbernen Nieten be-
schlagen. Sie scheint nicht zu merken, wie kalt es ist, denn
unter der Jacke trägt sie bloß den zerschlissenen Rock einer
Schuluniform und Netzstrümpfe. Und ein Raben-Tattoo auf
dem Handgelenk.
»Verzeihung?«

»Ich dachte bloß, ich warne dich besser«, sagt sie und zeigt
auf die Tür von The Fukhouse. »Das ist so eine Art anarchis-
tisches Clublokal. Und Anarchisten reagieren oft ungehalten
auf Menschen, die nicht zur Revolution gehören.«
»Das kann ich mir vorstellen.«
»Ist sowieso egal. Du kommst wegen des Kreises. Hab ich
recht?«
»Wie hast du das erraten?«
»Du siehst nervös aus.«
»Ich bin nervös.«
Sie mustert mich blinzelnd durch das Schneetreiben. Ich
komme mir vor wie am Zoll, wenn der Grenzbeamte meinen
Pass durch den Computer schiebt und ich warten muss, ob ich
durchgelassen oder verhaftet werde.
»Evelyn«, sagt sie schließlich.
»Patrick Rush. Freut mich, dich kennenzulernen.«
»Wirklich?«
Bevor ich entscheiden kann, ob das ein Scherz war, öffnet
sie die Tür und steigt die Treppe hinauf.
Der Raum ist so dunkel, dass ich im Eingang stehen bleibe
und nach Wänden, einem Lichtschalter oder dem Mädchen in
der Lederjacke taste. Klar erkennen kann ich nur die Kerzen,
deren Wachs auf zwei Fensterbänke tropft, und den Schnee
draußen, der so dicht fällt, dass es aussieht wie Rauschen im
Fernsehen. Ich bin Evelyn die Treppe hinaufgefolgt, aber jetzt
scheint sie in dem schwarzen Loch verschwunden zu sein, das
zwischen der Tür und den Fenstern klafft.
»Schön, dass Sie kommen konnten.«
Eine Männerstimme. Ich fahre herum und rutsche auf
meinen schneenassen Schuhen fast aus. Irgendjemand seufzt
geckenhaft. Im nächsten Moment wird mir klar, dass ich es
selber war.

»Wir sind hier«, sagt die Stimme.
Die dunkle Gestalt eines gebückten Mannes geht an mir
vorbei zu einem Kreis aus Stühlen in der Mitte des Raumes,
den ich erst jetzt sehe. Ich streife meine Schuhe ab und setze
mich auf einen der beiden freien Plätze.
»Wir warten nur noch auf einen weiteren Teilnehmer«,
sagt die Stimme, die ich jetzt als die Stimme vom Telefon
wiedererkenne. Conrad White, der mir unbekannte Schrift-
steller und Lyriker, nimmt auf dem Stuhl gegenüber Platz.
Der einlullende Klang seiner Stimme ruft das Gefühl wieder
wach, das ich empfunden habe, als ich ihm gegenüber zum
ersten Mal meinen Wunsch äußerte, ein Buch zu schreiben.
Danach war eine Pause entstanden, als versuchte er, die Tiefe
meines Verlangens zu ermessen. Als er weitersprach, notierte
ich die Details, die er nannte, ohne sie wirklich zu hören. Sei-
ne Worte schienen von einem völlig anderen Ort und aus
einer völlig anderen Zeit zu kommen.
Wir warten alle darauf, dass die Stimme wieder anhebt zu
sprechen. Falls tatsächlich sechs Teilnehmer versammelt sind,
sind wir still wie Puppen. Zu hören ist nur das leise Auf und
Ab unseres Atmens, mit dem wir den Dunst von Rotwein und
Weihrauch einsaugen, welcher vom Teppich aufsteigt.
»Ah, da ist er.«
Conrad White erhebt sich, um das letzte eintreffende Mit-
glied des Kreises zu begrüßen. Zunächst sehe ich nicht, wer es
ist. Aber als ein zweites Paar Füße entschlossen (und ohne
sich die Schuhe auszuziehen) vorwärtsstapft, spüre ich, wie
die anderen um mich herum auf ihren Stühlen schrumpfen.
Dann erkenne ich, warum.
Ein Riese mit hängenden Schultern tritt aus der Dunkelheit.
Zunächst scheint es, als hätte er keinen Kopf - und eine al-
berne Sekunde lang blicke ich auf seine Hände, um zu sehen,
ob er seinen eigenen Schädel mit sich herumträgt -, aber es ist

nur sein schwarzer Vollbart, der den größten Teil seines Ge-
sichts verdeckt. Nicht jedoch seine Augen. Das Weiße ist
deutlich zu sehen und starr.
»Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Mein Name
ist Conrad White«, sagt der alte Mann und nimmt wieder
Platz. Der bärtige Neuankömmling setzt sich auf den letzten
freien Stuhl - links neben mir. Das bewahrt mich zwar davor,
ihn weiter ansehen zu müssen, erlaubt mir nun jedoch, einen
Hauch seiner Kleidung zu erschnuppern, eine primitive Mi-
schung aus Holzkohle, Schweiß und gekochtem Fleisch.
»In den nächsten vier Wochen werde ich Ihr Helfer sein«,
fährt Conrad fort. »Ihr Führer. Vielleicht sogar Ihr Freund.
Aber eins werde ich nicht sein: Ihr Lehrer. Denn Schreiben,
wahres, wahrhaftiges Schreiben - und das, nehme ich an, ist
es, was wir alle anstreben - lässt sich nicht lehren.«
Conrad White blickt in die Runde, als wollte er jedem von
uns Gelegenheit geben, ihm zu widersprechen. Was niemand
tut.
Er fährt fort, die Regeln für die folgenden Treffen darzule-
gen. Jede Woche gibt es Hausaufgaben (»kleine Übungen, die
Ihnen helfen zu spüren, was Sie sehen«). Den größten Teil der
Sitzungen werden allerdings persönliche Lesungen aus dem
Werk ausmachen, an dem die einzelnen Teilnehmer gerade
arbeiten, gefolgt von Kommentaren der übrigen Mitglieder.
Vertrauen ist entscheidend. Kritik an sich, darauf weist er
ausdrücklich hin, ist nicht geduldet. Stattdessen wird es »Ge-
spräche« geben. Nicht unter uns, sondern »zwischen einem
Leser und den Wörtern auf dem Papier«. Als er das sagt, spü-
re ich, wie rechts von mir einige Köpfe bestätigend nicken.
Ich wende mich jedoch nach wie vor nicht in ihre Richtung.
Solange Conrad White spricht, kann ich aus irgendeinem
Grund nur ihn ansehen, und ich frage mich, ob es vielleicht
nicht nur Schüchternheit ist, die mein Blickfeld begrenzt.
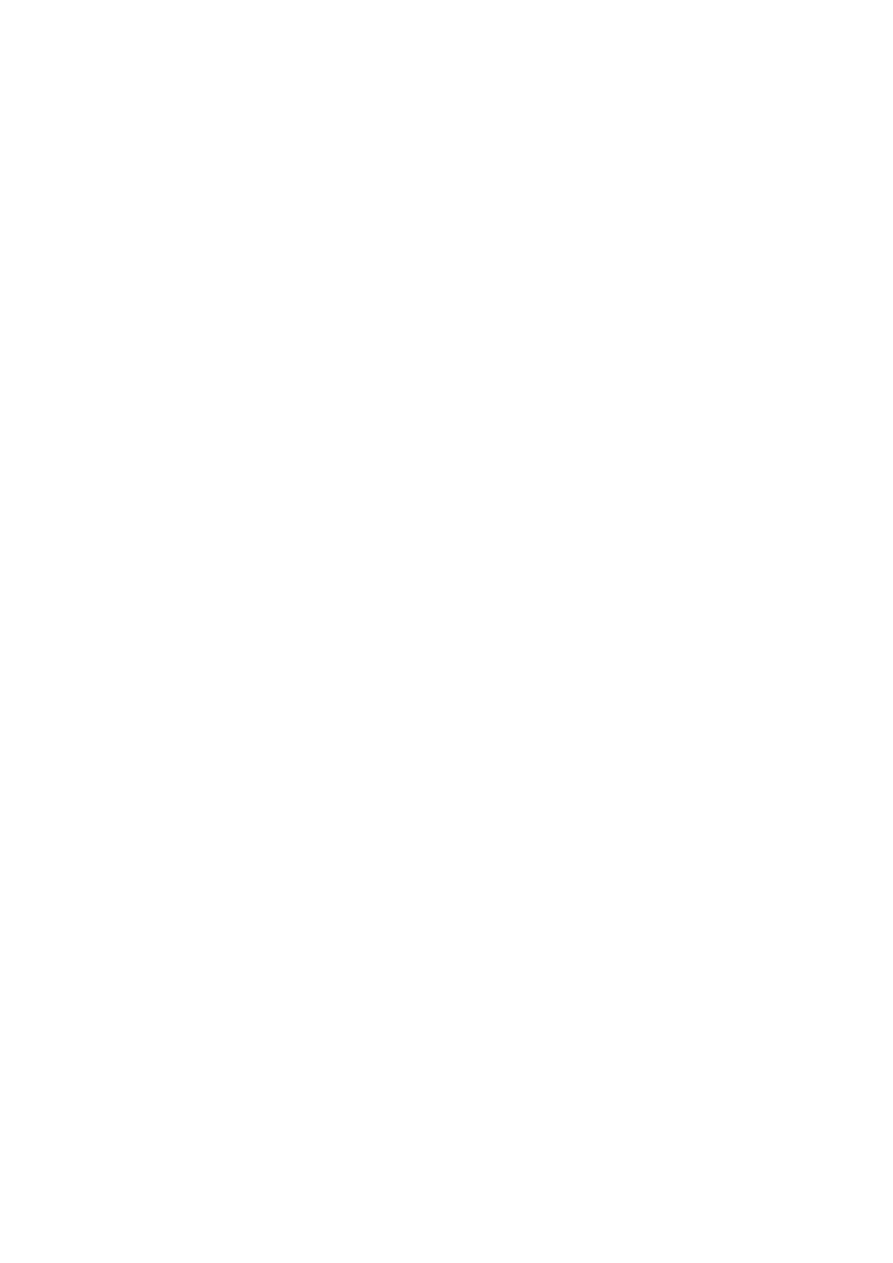
Vielleicht haben die Anordnung der Stühle, die Kerzen und
der Verzicht auf elektrisches Licht auch etwas gewollt Ok-
kultes. Und selbst wenn es kein Zauber ist, lösen seine Worte
auf jeden Fall eine Art Benommenheit aus. Ein Schwindelge-
fühl, das ich nicht abschütteln kann.
Als ich mich wieder konzentrieren kann, ist von Ehrlich-
keit die Rede. Wahrhaftigkeit ist unser aller oberstes Ziel,
nicht die meisterhafte Struktur oder der Stil. »Die Geschichte
ist alles«, sagt die Stimme. »Sie ist unser Glaube, unsere Bio-
grafie, unser Selbst. Nur durch die Geschichte können wir
hoffen, Erfahrungen zu machen, die nicht unsere eigenen
sind.«
In einem anderen Umfeld - einem Raum mit genug Licht,
um die Details der Gesichter zu erkennen, dem Summen einer
Klimaanlage, EXIT-Schildern über den Türen - wäre das
letzte Versprechen vielleicht ein bisschen dick aufgetragen
gewesen. Stattdessen sind wir ergriffen. Zumindest ich bin es.
Nun ist es Zeit für die obligatorische »Erzäh-
len-Sie-uns-ein-wenig-von-sich«-Runde, und ich habe
schreckliche Angst, dass Conrad bei mir beginnt. (»Hi. Ich
bin Patrick. Verwitwet, alleinerziehender Vater. Irgendwann
habe ich mal davon geträumt, Romane zu schreiben. Jetzt
bestreite ich meinen Lebensunterhalt mit Fernsehen.«) Doch
es kommt noch schlimmer, denn er wählt die Frau direkt
rechts neben mir aus, eine Person, die ich bis jetzt nur gero-
chen (teures Parfüm, maßgeschneiderte Lederhose), aber noch
nicht vollständig gesehen habe, was bedeutet, dass ich der
Letzte in der Runde bin. Die Schlussnummer.
Während die einzelnen Teilnehmer sprechen, spiele ich mit
dem Diktafon in der Außentasche meines Jacketts. Drücke auf
Aufnahme, Pause und dann wieder Aufnahme, sodass ein
wahllos zusammengeschnipselter Mitschnitt entsteht. Das
wird mir erst bewusst, als wir die halbe Runde schon hinter

uns haben, was mich jedoch nicht davon abhält, es weiter zu
tun.
Die gut riechende Frau stellt sich als Petra Dunn vor. Seit
drei Jahren geschieden und, nachdem ihr einziges Kind zum
Studium weggezogen ist, »meistens allein« in ihrem Einfami-
lienhaus in Rosedale. Sie nennt den Namen des Viertels bei-
nahe schuldbewusst, da sie weiß, dass diese Adresse für ein
Attribut spricht, das keinem von uns entgeht: Geld. Seitdem
verbringt Mrs. Dunn ihre Zeit mit Selbstvervollkommnung.
Joggen. Ehrenamtlicher Sozialarbeit. Abendkursen zu will-
kürlich gewählten Themen - amerikanische Geschichte vor
dem Bürgerkrieg, die großen europäischen Gemälde nach
1945, 20 klassische Romane des 20. Jahrhunderts. Aber sie
sei es überdrüssig geworden, in diesen Vorlesungen »ver-
schiedene Versionen meiner selbst zu treffen«, sagt sie, »Sit-
zengebliebene, Geschiedene, reifere Frauen«, die nicht nach
Erbauung streben, sondern danach, von einem der wenigen
jüngeren Männer eingeladen zu werden, die die entsprechen-
den Kurse abgrasen und von Petra »Oma-Jäger« genannt
werden. Mehr noch, sie hat ein stärker werdendes Bedürfnis
verspürt, eine Geschichte über das Leben zu schreiben, das sie
vielleicht geführt hätte, wenn sie als Barkeeperin im Weston
Country Club die Essenseinladung des älteren Herrn ausge-
schlagen hätte, der ihr Ehemann werden sollte. Ein ungelebtes
Leben, in dem sie irgendwann ihr Studium wieder aufge-
nommen hätte. Ein Leben mit unvorhersagbaren Freiheiten
statt der Ehe mit einem Mann, dessen großzügigen Umgang
mit seiner Platinum-Kreditkarte sie für den Charme eines
Gentlemans gehalten hatte. Eine Geschichte über »eine Frau
wie mich, aber nicht …«
An dieser Stelle hält Petra Dunn inne. Lange genug, dass
ich einen verstohlenen Blick auf ihr Gesicht werfen kann. Ich
erwarte eine Frau Mitte fünfzig, die verstummt ist, weil sie

mit den Tränen kämpft. Stattdessen erblicke ich eine strah-
lende Schönheit, kaum älter als vierzig. Und es sind nicht
Tränen, die ihr die Sprache verschlagen haben, es ist Wut.
»Ich möchte mir vorstellen, wer ich wirklich bin«, sagt sie
schließlich.
»Danke, Petra«, sagte Conrad White und klingt zufrieden
über diesen Auftakt. »Wer ist der Nächste?«
Das wäre Ivan. Sein kahles Haupt glänzt blass rosafarben.
Er zieht die Schultern zur Brust und ist zu schmächtig für das
karierte Arbeiterhemd, das er bis zum Hals zugeknöpft trägt.
Ein U-Bahn-Fahrer, ein Mann, der das Tageslicht zu selten
sieht. Einsam ist er auch. Er ist der Typ, der sein chronisches
Junggesellendasein, auch wenn er es nicht offen zugibt, in den
dunklen Ringen unter den Augen und dem resigniert ent-
schuldigenden Ton in der Stimme mit sich herumträgt. Ganz
zu schweigen von seiner Schüchternheit, die ihn daran hin-
dert, Blickkontakt mit einer der Frauen in der Runde herzu-
stellen.
Conrad White fragt ihn, was er hofft, im Laufe der anste-
henden Treffen zu erreichen, und Ivan denkt lange über seine
Antwort nach. »Wenn ich mit meinem Zug in einen Bahnhof
einfahre, sehe ich die Gesichter der Leute auf dem Bahnsteig
vorbeihuschen«, sagt er. »Ich möchte einfach versuchen, ei-
nige von ihnen festzuhalten. Sie in etwas verwandeln, das
mehr ist als bloß Fahrgäste jenseits der Scheibe, die ein- und
aussteigen. Ich möchte vollständige Menschen aus ihnen ma-
chen. Etwas, an das ich mich halten kann. Jemand.«
Sobald er fertig gesprochen hat, senkt Ivan den Kopf, als
fürchtete er, schon zu viel gesagt zu haben. Ich muss mich
zusammenreißen, um nicht zu ihm zu gehen und ihm brüder-
lich eine Hand auf die Schulter zu legen.
Dann fallen mir seine Hände auf. Riesenpranken, die auf
seinen Knien liegen, die Haut über die Knochen gespannt wie

altes Leder. Irgendwas an diesen Händen vertreibt jeden Ge-
danken daran, sich Ivan mehr als nötig zu nähern.
Der pummelige Kerl neben Ivan stellt sich als Len vor und
blickt grinsend in die Runde, als ob allein sein Name bereits
etwas Unartiges implizieren würde. »Was ich am Lesen
mag«, fährt er fort, »ist, dass man jemand anders sein kann
und Sachen machen, die man selbst nie machen würde. Wenn
man gut genug ist, kommt es einem ganz echt vor.«
Deshalb will Len schreiben. Er möchte verwandelt werden.
Ein großer Junge, der aussieht, als würde er lieber zu Hause
am Computer spielen; der Typ, dessen einzige Freunde virtu-
ell sind, andere Eingeschlossene, an die er einzeilige Bot-
schaften schickt, um sich zu erkundigen, wie man bei irgend-
einem Shoot-the-Zombie-Spiel das neunte Level erreicht. Wer
kann ihm verdenken, dass er jemand anders sein möchte?
Je länger Len über das Schreiben spricht, desto zappeliger
wird er, schiebt seine schweren Hüften auf die Stuhlkante vor
und reibt über die Armlehnen, als wollte er seine schweißnas-
sen Hände trocknen. Aber richtig aufgeregt wird er erst, als er
gesteht, dass Horror sein »großes Ding« ist. Romane und
Kurzgeschichten, aber vor allem Comics. Alles, was mit
»Untoten« zu tun hat. »Erscheinungen. Werwölfe, Vampire,
Dämonen, Poltergeister, Hexen. Ganz besonders Hexen. Fragt
mich nicht, warum.«
Len grinst wieder schräg in die Runde, was es schwer
macht, ihn nicht zu mögen. Er hat seine Leidenschaften so
schlicht und schamlos bekannt, dass ich ihn beinahe beneide.
Neben Lens nervöser Masse wirkt Angela klein wie ein
Kind. Diese Illusion rührt auch daher, dass sie auf dem größ-
ten Stuhl in der Runde sitzt, einem Ohrensessel, der so hoch
ist, dass ihre Schuhe kaum den Boden berühren. Ansonsten ist
an Angelas Erscheinung lediglich das Fehlen jeder markanten
Auffälligkeit bemerkenswert. Schon als ich versuche, sie im

Gedächtnis zu skizzieren, erkenne ich ihr Gesicht als eines,
das bereits nach wenigen Stunden schwer zu beschreiben sein
wird. Ihre Gesichtszüge scheinen sich mit jeder noch so klei-
nen Bewegung zu verändern, sodass sie wirkt wie ein leben-
des Phantombild, die Verkörperung eines Typs, nicht wie ein
Individuum.
Selbst was sie sagt, scheint im Raum zu verpuffen. Sie ist
noch neu in der Stadt, in die sie nach »einer Reihe verschie-
dener Orte im Westen« gekommen ist. Einzige Konstante in
ihrem Leben ist ihr Tagebuch. »Nur dass es kein richtiges
Tagebuch ist«, sagt sie und macht ein seltsam schnaubendes
Geräusch, das ein unterdrücktes Lachen sein könnte. »Das
meiste ist erfunden, manches aber auch nicht. Sodass es
eigentlich eher Fiktion als Tagebuch ist.«
Damit verstummt sie, rutscht zurück und lässt sich wieder
von ihrem Sessel verschlucken. Nachdem sie fertig ist, beob-
achte ich sie weiter. Und obwohl sie mit niemandem in der
Runde Blickkontakt hat, beschleicht mich das Gefühl, dass sie
jede Äußerung genauso bewusst registriert wie ich.
Als Nächste ist Evelyn dran. Der Kobold mit der aus-
druckslosen Miene. Sie studiert an der Universität und macht
bald ihren Abschluss, was mich ein wenig überrascht. Nicht
wegen ihrer Jugend. Es ist das Outfit. Sie sieht aus wie
Courtney Love, als sie sich in Kurt verliebte, und nicht wie
eine Stipendiatin, die sich nicht entscheiden kann, ob sie ihren
Doktor in Yale, Cornell oder Cambridge machen soll. Dann
folgt die Erklärung: Ihre geplante Dissertation ist eine Studie
über »Zerstückelung und weibliche Rache im Slasher-Film
der 1970er Jahre«. Ich kann mich noch gut genug an die Uni
erinnern, um zu wissen, dass solche Themen am besten von
den Kostümierten behandelt werden.
Damit haben wir uns zu dem verspäteten Riesen vorge-
arbeitet. Als Evelyn zu Ende gesprochen hat, verändern wir

für ihn subtil unsere Haltung. Es geht nicht um direkten
Blickkontakt, eher um eine Neuausrichtung unserer Antennen,
wie um ein schwaches Signal aufzufangen. Trotzdem können
bis auf mich alle im Kreis einen verstohlenen Blick riskieren.
Ich müsste mein Bein überschlagen und mich ihm zuwenden,
um ihm direkt ins Gesicht zu sehen. Und das möchte ich
nicht. Vielleicht liegt es nur an dem unvertrauten Raum, der
Verlegenheit, Fremden zu begegnen, mit denen man wenig
mehr gemein hat als eine Sehnsucht nach Selbstausdruck.
Aber der Mann, der links neben mir sitzt, strahlt eine andere
Dunkelheit aus als der Abend draußen. Ein sonderbares Feh-
len von Mitgefühl oder lesbarer Menschlichkeit. Trotz seiner
Größe scheint es, als wäre der Raum, den er einnimmt, nur
eine dichtere Form von Nichts.
»Und du?«, fragt Conrad White ihn. »Was führt dich in
unseren Kreis?«
Der Riese atmet pfeifend ein und wieder aus, wie ich auf
meinem Handrücken spüre.
»Ich wurde gerufen«, sagt er.
»›Gerufen‹ in dem Sinne, dass du deine Bestimmung ver-
folgst, nehme ich an? Oder ein Ruf im engeren Sinne des
Wortes?«
»In meinen Träumen.«
»Du wurdest in deinen Träumen hierhergerufen?«
»Manchmal -«, sagt der Mann, und es klingt wie der Be-
ginn eines vollkommen neuen Gedankens, »manchmal habe
ich Albträume.«
»Okay. Vielleicht möchtest du uns sagen, wie du heißt?«
»William«, sagt er ein wenig lauter. »Ich heiße William.«
Dann bin ich dran.
Ich sage laut meinen Namen. Der Klang dieser elementaren
Silben hilft mir, Stichpunkte einer Kurzbiografie von Patrick
Rush aneinanderzureihen. Vater eines schlauen kleinen Jun-

gen, der zu seinem Glück das Aussehen seiner Mutter geerbt
hat. Journalist, der immer das Gefühl hatte, dass seinem
Schreiben etwas fehlt. (Beinahe hätte ich »Leben« statt
»Schreiben« gesagt, ein Beinahe-Versprecher, der so verräte-
risch ist, wie man es sich vorstellen kann.) Ein Mann, der sich
nicht sicher ist, etwas zu sagen zu haben, jedoch jetzt glaubt,
es ein für alle Mal herausfinden zu müssen.
»Sehr gut«, sagt Conrad White hörbar erleichtert. »Ich
möchte euch für eure Offenheit danken. Euch allen. In Anbe-
tracht der Umstände finde ich es nur gerecht, dass auch ich
mit euch teile, wer ich bin.«
Conrad White erzählt uns, dass er vor Kurzem »aus dem
Exil zurückgekehrt« ist. Ein Romancier und Lyriker mit Ver-
leger in Toronto, kurz vor den kulturellen Eruptionen der spä-
ten Sechziger, in deren Nachfolge überhaupt erst eine lebens-
fähige Nationalliteratur entstand. Oder, wie Conrad White es
gemessen (aber nichtsdestoweniger bitter) formuliert: »In den
Tagen, als in diesem Land noch unabhängige Individuen ge-
schrieben haben, bevor Literatur ein Geschäft hinter ver-
schlossenen Türen und die Sache weniger Günstlinge, kurzum
tribalistisch wurde.« Er setzte sein Werk fort und fühlte sich
zunehmend als Außenseiter, während seine Zeitgenossen et-
was taten, das unter kanadischen Schriftstellern bis dahin un-
vorstellbar gewesen war: Sie wurden berühmt. Dieselben
Hippie-Dichter, die in seinen Seminaren an der University of
Toronto gesessen und in denselben Cafés gelesen hatten wie
er, wurden jetzt international veröffentlicht, traten als »pro-
minente Gäste« in CBS-Quiz-Shows auf und kassierten Sti-
pendien der Regierung.
Nicht so Conrad White. Er arbeitete an einem ganz anderen
Ungetüm. Einem Werk, das sich, wie er sehr wohl wusste,
nicht geschmeidig an die bevorzugten Themen und stilisti-
schen Moden seiner erfolgreichen Gefährten hielt. Ein Roman

»hässlicher Enthüllungen«, der sich nach seiner Veröffentli-
chung als noch kontroverser erwies, als er erwartet hatte. Die
Gemeinde der Schriftsteller (wie sie sich inzwischen sah)
kehrte ihm den Rücken. Obwohl er mit kritischen Gegenan-
griffen in allen Zeitschriften und Pamphleten antwortete, die
ihn druckten, machte ihn die Zurückweisung nicht einfach nur
wütend. Sie brach ihm das Herz und führte zu dem Ent-
schluss, im Ausland zu leben. Zunächst in England, bevor er
weiter nach Indien, Südostasien und Marokko zog. Erst im
vergangenen Jahr war er nach Toronto zurückgekehrt. Nun
leitete er Schreib-Workshops wie den unsrigen, um seine
Miete zu bezahlen.
»Ich sage ›Workshops‹, obwohl der Singular zutreffender
wäre«, erklärt Conrad White. »Denn dies ist mein erster.«
Draußen hat es aufgehört zu schneien. Unter unseren Fü-
ßen lassen die stampfenden Bässe aus den Lautsprechern im
Fukhouse die Scheiben in den Fensterrahmen zittern. Irgend-
wo in den Marktgassen schreit ein Verrückter.
Conrad White reicht eine Schale herum, um unseren wö-
chentlichen Beitrag einzusammeln. Dann gibt er uns eine
Aufgabe für die kommende Woche. Eine Seite eines Werkes,
an dem wir arbeiten. Es muss nichts Ausgefeiltes sein und
auch nicht unbedingt der Anfang. Einfach eine Seite von ir-
gendwas.
Damit ist die Klasse entlassen.
Ich taste nach meinen Schuhen neben der Tür. Auf dem
Weg hinaus sagt keiner ein Wort. Es ist, als wäre das, was
immer in der letzten Stunde mit uns passiert ist, nie gesche-
hen.
Ich mache mich auf den Heimweg, ohne mich noch einmal
nach den anderen umzusehen, fest davon überzeugt, dass ich
nicht wiederkommen werde. Aber schon, als ich das denke,
weiß ich, dass ich es doch tun werde. Ob der Kensing-

ton-Kreis mir nun helfen kann, meine Geschichte zu finden,
oder ob er selbst die Geschichte ist, ich muss wissen, wie es
ausgeht.

3
Mittwochmorgens hat Emmie frei, sodass ich zu Hause arbei-
te und selbst auf Sam aufpasse. Er ist zwar erst vier Jahre alt,
studiert aber am Frühstückstisch neben mir die Wirtschafts-,
Auslands- und Immobilienseiten der Zeitung. Obwohl er
praktisch kein Wort versteht, setzt er - genau wie sein alter
Herr - eine ernste Miene auf und leckt sich vor dem Umblät-
tern einer Seite den Daumen.
Ich gehe meinerseits den Anzeigenteil durch, um zu sehen,
ob Conrad Whites Anzeige weiter geschaltet ist, kann sie je-
doch nirgends entdecken. Vielleicht hat er entschieden, dass
er mit der einen Gruppe, die sich am Abend zuvor in seiner
Wohnung versammelt hat, ausgelastet ist.
Mit einem traurigen Seufzer schiebt Sam eine Sonderbei-
lage zu Investmentfonds beiseite.
»Dad? Darf ich fernsehen?«
»Zehn Minuten.«
Sam zieht sich vom Tisch zurück und schaltet einen japa-
nischen Zeichentrickfilm über einen Roboter-Laser-Krieg ein.
Ich will ihn gerade bitten, ein wenig leiser zu stellen, als eine
kurze Nachricht im Lokalteil meine Aufmerksamkeit erregt.
Eine Vermissten-Geschichte. Das Opfer (ist man ein »Op-
fer«, wenn man bloß vermisst wird?) ist eine gewisse Carol
Ulrich, die vermutlich gewaltsam von einem Spielplatz in der
Nähe verschleppt wurde. Zeugen der Entführung gibt es keine
- auch der Sohn der Frau, der zu der Zeit bei den Schaukeln
spielte, hat nichts gesehen. Anwohnern wird geraten, wach-

sam gegenüber Fremden zu sein, die »Personen belauern oder
sich anderweitig verdächtig benehmen«. Der Artikel endet mit
der ominösen Bemerkung eines Polizeisprechers, dass »der-
artige Vorfälle sich wiederholen könnten«.
Über unheimliche, aber traurig gewöhnliche Meldungen
dieser Art lese ich normalerweise hinweg. Aber es handelt
sich um unser Viertel und um den Spielplatz, auf den Sam
und ich auch gehen.
»Was machst du, Daddy?«
Sam steht neben mir. Dass auch ich stehe, überrascht mich
selbst. Ich blicke nach unten und sehe meine Hände am Griff
unserer Terrassenschiebetür.
»Ich schließe die Tür ab.«
»Aber diese Tür schließen wir nie ab.«
»Nicht?«
Ich blicke durch die Scheibe in unseren schneebedeckten
Garten. Auf der Suche nach Fußabdrücken.
»Die Sendung ist vorbei«, sagt Sam, zerrt an meinem Ho-
senbein und zeigt auf den Fernseher.
»Noch mal zehn Minuten.«
Während Sam losrennt, ziehe ich mein Diktafon aus der
Tasche.
»Notiz an mich selber«, flüstere ich. »Vorhängeschloss für
das hintere Gartentor kaufen.«
Es ist schon Wochenende, und die Dienstags-Deadline für
eine Seite aus dem nicht existierenden Werk, an dem ich ge-
rade arbeite, rückt näher. In der Woche habe ich ein paar An-
läufe unternommen, aber das Ambiente meiner Krypta zu
Hause und auch meines Kabäuschens in der Redaktion hat
jeden Anflug von Inspiration verscheucht. Ich muss die rich-
tige Umgebung finden. Einen eigenen Laptop.

Sobald Tamaras Schwester Stacey Sam abgeholt hat, um
mit ihm und seinen Cousins die Dinosaurier im Museum zu
besichtigen, gehe ich zu dem Starbucks um die Ecke. Es ist
ein sonniger Samstag, das heißt, nach Mittag wird die Queen
Street von bummelnden und gaffenden Passanten nur so
wimmeln. Aber es ist erst kurz nach zehn, und die Schlange
reicht noch nicht bis vor die Tür. Ich sichere mir einen Tisch,
klappe meinen Laptop auf und starre auf die neue Textdatei,
ein jungfräulich unberührter Bildschirm, wenn man von dem
blinkenden Cursor einmal absieht. Die Vorstellung, auch nur
ein Wort auf der Tastatur zu tippen, erscheint ähnlich grob,
wie hinauszugehen und auf eine Schneewehe zu pinkeln.
Außerdem erinnert mich das Geräusch der Kaffeemaschine an
einen Zahnarztbohrer und fängt an, mir auf die Nerven zu
gehen. Ganz zu schweigen von den Bestellungen, die sich die
Barista-Kids hinter dem Tresen gegenseitig zurufen. Wer
würde nicht den Kopf heben, um zu sehen, was für ein
Mensch einen Venti-Decaf-Cappuccino mit Mager- und So-
jamilch und einer zusätzlichen Portion Schlagsahne bestellt?
Ich packe meine Sachen und gehe zu der Bibliothek in der
Yonge Street. Der Eingangsbereich im Erdgeschoss ist wie
immer bevölkert von Obdachlosen, neu Zugezogenen und der
schrumpfenden Zahl von Seelen, die kein Handy besitzen und
telefonieren müssen. Durch Drehkreuze gelangt man in ein
Atrium, das sich über die Höhe der gesamten fünf Stockwerke
der Bibliothek erstreckt. Ich suche die leerste Ebene, wo ich
einen langen Arbeitstisch für mich alleine habe, und grüble
über ein einziges Wort, das vortreten und die anderen in die
Schlacht führen könnte.
Nichts.
Um mich herum stehen zehntausende von Bänden, von
denen jeder zehntausende gedruckter Wörter enthält, und

nicht eines von ihnen ist bereit, sich aus der Deckung zu wa-
gen, wenn ich es am nötigsten brauche.
Warum?
Die Sache ist die, ich weiß, warum.
Ich habe keine Geschichte zu erzählen.
Aber Conrad White hatte eine zu erzählen, vor langer Zeit.
Da ich ohnehin schon in einer Bibliothek bin, beschließe ich,
eine kleine Pause zu machen und ein bisschen zu recherchie-
ren. Über Mr. White, den Anführer des Kensington-Kreises.
Ich muss ein wenig graben, aber in einigen persönlichen
Erinnerungen und kulturgeschichtlichen Abhandlungen über
die 60er Jahre in Toronto wird er in Fußnoten erwähnt. Aus
altem Geldadel stammend, Unterricht an Privatschulen, Autor
eines Romans von umstrittener Qualität, später im Ausland
untergetaucht. Oder, wie es ein Kommentator spitz formulier-
te: »Mr. White ist für diejenigen, die seinen Namen überhaupt
noch kennen, wahrscheinlich eher wegen der Umstände in
Erinnerung geblieben, unter denen er sein Heimatland verlas-
sen hat, als wegen irgendeines Werkes, das er veröffentlicht
hat, solange er noch hier lebte.«
Faszinierend an der unvollständigen Biografie von Conrad
White sind die Andeutungen an dunklen Ecken. Üblicherwei-
se wird sein freiwilliges Exil der kritischen Rezeption seines
Buches Jarvis und Wellesley zugeschrieben, dem gebrochenen
inneren Monolog eines Mannes, der durch die Straßen der
Stadt streift auf der Suche nach einer Prostituierten, die seiner
Tochter ähnelt, die kurz zuvor bei einem Autounfall ums Le-
ben gekommen ist. Einer idealisierten Figur, die er das »voll-
kommene Mädchen« nennt. Soweit man weiß, hat Conrad
White seither nichts mehr geschrieben.
Biss bekommt diese Geschichte erst dadurch, dass die
Handlung von Jarvis und Wellesley Whites eigenes Leben
spiegelt. Vor dem Schreiben des Romans hatte er eine Toch-

ter verloren, sein einziges Kind. Und es gibt Hinweise darauf,
dass Whites Ausreise durch seine Beziehung zu einem sehr
realen minderjährigen Mädchen und eine drohende strafrecht-
liche wie zivilrechtliche Anklage beschleunigt wurde. Ein
literarischer Eremit und ein Perverser mit einem Faible für
junge Mädchen. Eine Kreuzung aus Thomas Pynchon und
Humbert Humbert.
Ich kehre an meinen Tisch zurück und sehe, dass der Bild-
schirm sich in den Ruhezustand versetzt hat. Er weiß genauso
gut wie ich, dass heute nichts geschrieben wird. Aber das
muss ja nicht heißen, dass man nicht etwas lesen kann.
Das Exemplar von Jarvis und Wellesley, das ich aus dem
Regal ziehe, ist seit mehr als vier Jahren nicht mehr ausgelie-
hen worden. Der Rücken bricht, als ich es aufschlage. Die
Seiten sind mürbe wie Kartoffelchips.
Zwei Stunden später stelle ich das Buch wieder an seinen
Platz.
Die Prosa ist ihrer Zeit voraus. Ein paar freizügige Sex-
szenen mit einem älteren Protagonisten und jungen Strich-
mädchen verleihen der Handlung eine gewisse schmutzige
Energie, wenngleich nur oberflächlich. Denn die ganze Zeit
ist die unausgesprochene Trauer greifbar, der Bericht über
einen Verlust, der durch die Schilderung seiner Auswirkungen
umso kraftvoller wirkt.
Den stärksten Eindruck jedoch hinterlässt das »vollkom-
mene Mädchen« des Protagonisten. Die Art, wie sie lebhaft
heraufbeschworen wird, mit nur wenigen oder ganz ohne spe-
zifische Details. Man weiß genau, wie sie aussieht, wie sie
sich verhält und was sie fühlt, obwohl sie nirgendwo auf den
Seiten zu finden ist.
Noch seltsamer aber ist die Gewissheit, dass ich ihr eines
Tages selber begegnen werde.

4
Der Dienstag bringt eine Kältewelle. Minus achtzehn Grad,
die sich bei dem schneidenden Wind doppelt so kalt anfühlen.
Die Plaudertasche im Radio warnt: Nur wenn es unbedingt
nötig ist, solle man das Haus verlassen. Mir kommt nicht zum
ersten Mal der Gedanke, dass man mich zu den dreißig Mil-
lionen zählen kann, die freiwillig in einem Land jährlicher
Plagen leben. Ein schwarzer Tod namens Winter, der sich
über uns alle senkt.
In der Kellerkrypta haue ich eine Kolumne über zwei neue
Mach-das-Beste-aus-deinem-Typ-Shows, einen Fernsehfilm
über einen Schönheitschirurgen und fünf (jawohl, fünf) neue
Serien hin, in denen ein Innenarchitekt in das Haus irgend-
welcher Leute einfällt und es nach dem Vorbild einer Flugha-
fen-Lounge umgestaltet. Nachdem das hinter mir liegt, mache
ich mich an die Hausaufgabe für unseren Kreis am Abend.
Am Ende des Tages habe ich mir ein paar hundert Wörter für
eine Einleitung abgerungen - Der Dienstag bringt eine Käl-
tewelle und so weiter. Das muss reichen.
Als ich oben Reste in der Mikrowelle aufwärme, kommt
Sam, um mir etwas aus der Zeitung von heute zu zeigen.
»Sieht sie nicht aus wie Mami?«
Er zeigt auf ein Foto von Carol Ulrich. Die Frau, die auf
einem Spielplatz in der Nachbarschaft entführt wurde, wäh-
rend ihr Kind schaukelte.
»Findest du?«, frage ich, nehme ihm die Zeitung aus der
Hand und tue, als wollte ich die Gesichtszüge der Frau stu-

dieren. Das gibt mir Gelegenheit, für eine Sekunde mein Ge-
sicht vor Sam zu verbergen. Er kennt das Aussehen seiner
Mutter nur von Fotos, aber er hat recht. Carol Ulrich und Ta-
mara könnten Schwestern sein.
»Ich erinnere mich an sie«, sagt Sam.
»Wirklich?«
»Aus dem Laden an der Ecke. Einmal stand sie auch in der
Schlange vor dem Geldautomaten.«
»So, so.«
Sam zieht die Zeitung weg und studiert mein Gesicht.
»Sie sehen gleich aus. Oder nicht?«
»Deine Mutter war schöner.«
Die Mikrowelle piept. Wir ignorieren es beide.
»War das die Frau … hat jemand ihr etwas getan?«
»Wo hast du das denn gehört?«
»Ich kann lesen, Dad.«
»Sie wird nur vermisst.«
»Warum hat jemand sie vermisst gemacht?«
Ich nehme Sam die Zeitung ab, falte sie zusammen und
klemme sie unter den Arm. Ein ungeschickter Zauberer, der
versucht, die schlechte Nachricht verschwinden zu lassen.
Conrad Whites Wohnung ist nicht heller, aber deutlich kälter
als in der vergangenen Woche. Evelyn hat ihre Jacke anbe-
halten, und wir anderen blicken zu unseren Mänteln, die wir
an die Haken neben der Tür gehängt haben. William ist der
Einzige, der die Kälte nicht zu bemerken scheint. Seine Arme
hängen aus den Ärmeln seines weißen T-Shirts, steif wie Ze-
mentrohre.
Auffällig ist auch, dass diesmal jeder aus unserem Kreis
gerüstet erschienen ist: eine Plastiktüte, ein Aktenordner, ein
zugeklebter Umschlag, zwei Mappen, ein Notizbuch mit Le-
dereinband und eine einzelne Büroklammer bergen die ersten

selbst geschriebenen Opfergaben. Unsere Werke zittern auf
unseren Schößen wie nervöse Katzen.
Conrad White heißt uns willkommen und erinnert uns an
die Arbeitsweise unseres Zirkels. Seine akzentlose Stimme im
Ohr, versuche ich, den älteren Mann, der zu uns spricht, mit
dem literarischen Provokateur von vor vierzig Jahren in Ein-
klang zu bringen. Wenn es Wut war, die ihn ins Exil getrieben
hat, kann ich davon heute in seinem Gesicht nichts mehr er-
kennen. Stattdessen sehe ich nur eine abgenutzte Traurigkeit,
zu der Wut vielleicht irgendwann wird, wenn sie sich früh
genug zeigt.
Der Spielplan für den heutigen Abend sieht vor, dass jeder
maximal fünfzehn Minuten aus den mitgebrachten Texten
liest, bevor die anderen Mitglieder jeweils weitere fünfzehn
Minuten Gelegenheit haben, diese zu kommentieren. Die Re-
aktionen auf den Text dürfen unterbrochen werden, der Vor-
trag selber nicht. Während wir den anderen zuhören, sollen
wir unseren Geist so weit wie möglich öffnen, damit wir ihre
Worte frei von Vergleichen mit zuvor Gehörtem oder Ge-
lesenem aufnehmen.
»Ihr seid die Kinder im Garten Eden«, erklärt Conrad
White uns. »Unschuldig, unberührt von Erfahrung, Vergan-
genheit oder Scham. Es gibt nur die Geschichte, die ihr mit-
gebracht habt. Und wir werden sie hören, als wäre es die ers-
te, die je erzählt worden ist.«
Damit geht es los.
Die ersten Vorträge beruhigen mich weitgehend. Mit jeder
neuen Stimme, die tastend ihre Wörter auslotet, werden die
Unsicherheiten bezüglich meines eigenen gequälten Ge-
schreibsels gelindert, aber nur ein wenig. Zur Halbzeit (als
Conrad White eine Zigarettenpause verkündet) ermutigt mich
die Gewissheit, dass unter uns weder unentdeckte Nabokovs,
Fitzgeralds oder Munros schlummern noch ein LeCarré, eine
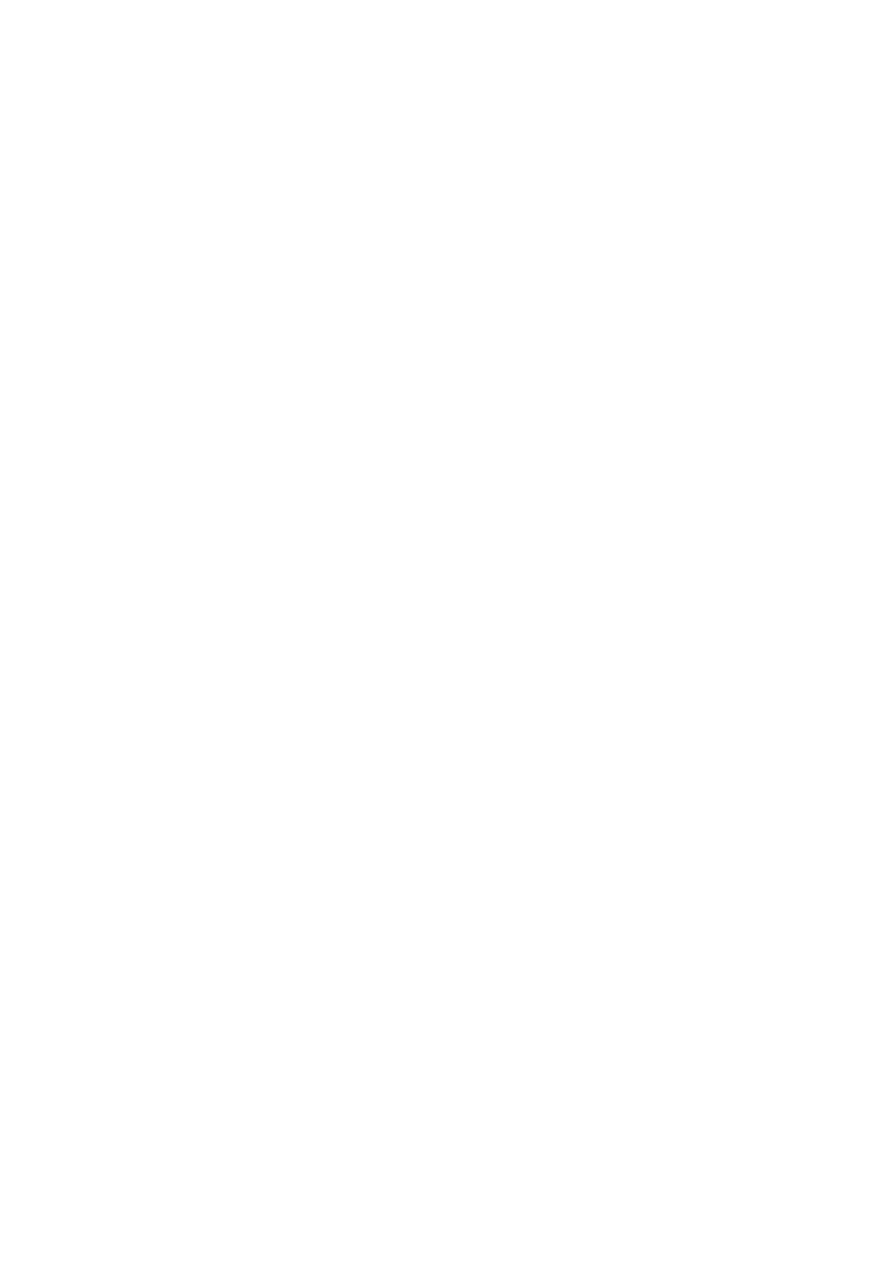
Rowling oder ein King. Auch thematisch gibt es kaum Über-
raschungen. Petra liest ein Stück Ehemann-Ehefrau-Dialog
irgendwo zwischen Wie das Leben so spielt und Wer hat
Angst vor Virginia Woolf?, der bestimmte verbale Grausam-
keiten so detailliert erfasst, dass er vermutlich direkt aus einer
Gedächtnisschleife stammt. Ivan, der U-Bahn-Fahrer, erzählt
die Geschichte eines Mannes, der aufwacht, sich in eine Ratte
verwandelt sieht und jetzt einen Weg in die Abwässerkanäle
unter der Stadt finden muss, weil er instinktiv weiß, dass sie
sein neues, verdrecktes, verseuchtes Zuhause sind. (Als ich
ihm danach zu seiner Umarbeitung von Kafka gratuliere, sieht
mich Ivan verständnislos an und sagt: »Verzeihung. Kafka?«)
Obwohl Len meint, dass nur der erste Absatz seiner geplanten
»epischen Horror-Trilogie« schon vortragsreif ist, scheint
seine Beschreibung einer Nacht, die nichts anderes ist als ein
langer Marsch durch das Wortfeld »dunkel«, schier endlos.
Evelyns Geschichte beginnt vielversprechend mit einer Stu-
dentin, die von ihrem Professor auf dem Fußboden gevögelt
wird und dabei daran denkt, wie ihr Vater ihr an dem See
beim Wochenendhaus der Familie beigebracht hat, Steine auf
dem Wasser titschen zu lassen.
In der Zigarettenpause stehen auch diejenigen, die sich
ihren Mantel nicht überziehen, auf, um sich zu strecken. Wir
schlurfen durch den Raum, ohne uns anzusehen, bemüht,
nicht als Erster ein Gespräch anzuknüpfen, während alle sich
gegenseitig verstohlen mustern. Und jede Bewegung von Wil-
liam registrieren, damit sie wissen, welche Ecke des Zimmers
es zu meiden gilt.
Im Laufe dieser verlegenen Minuten, den Blick der ande-
ren auf mir spürend, frage ich mich, wie mich die Mitglieder
des Kreises sehen. Mit größtem Wohlwollen, so wie ich mich
selbst an meinen besten Tagen, nehme ich an: ein charmant
zerknitterter, höflich-adretter Mensch der alten Schule. Oder

maximal kritisch so wie ich mich selbst an meinen schlimms-
ten Tagen: ein Zapper mit Schuppen, der gefährlich schnell
auf den Abgrund zusteuert. Außer Diskussion stehen die brei-
ten Schultern, die eine Illusion ehemaliger Sportlichkeit we-
cken. Und gute Zähne. Ein Satz elfenbeinfarbener Beißer, die
immer Eindruck machen, wenn sie einem Betrachter auf
Cheese-Schnappschüssen entgegenlächeln.
Nachdem die Raucher zurückgekehrt sind, beginnen wir
mit den verbliebenen Vorträgen.
Und ab da wird es ein wenig schwammig.
Ich muss meine Seite vorgelesen haben, denn ich kann
mich an Satzfetzen aus den Reaktionen der anderen erinnern.
(Evelyn fand, dass die Erzählung in der ersten Person »das
Gefühl des In-sich-eingesperrt-Seins des Helden« sehr gut
wiedergebe, während Petra einen »verborgenen Kummer«
entdeckte.) William bat darum, diesmal nichts vorlesen zu
müssen, zumindest glaube ich das, denn ich kann mich nur an
den Klang seiner Stimme, nicht jedoch an seine Worte erin-
nern. Ein langsames Mahlen, als ob Luft durch feuchten Sand
gepresst würde.
Alles, was mir aus der zweiten Hälfte des Treffens wirklich
in Erinnerung bleibt, ist Angela.
Als sie das rissige, in Leder gebundene Notizbuch auf
ihren Knien aufschlägt und langsam, spürbar zögernd hoch-
hebt, denke ich zunächst, dass sie jünger ist, als ich sie in der
vergangenen Woche geschätzt hatte.
Doch sobald sie zu lesen beginnt, schlägt der Eindruck von
Mädchenhaftigkeit in etwas anderes um. Es ist schwer, ihr
Gesicht zu beschreiben, sich daran zu erinnern, es zu sehen,
weil es gar kein Gesicht ist. Es ist eine Maske, die nie ganz
scharfe Züge annimmt - wie eine unfertige Skulptur, die man
zwar schon als Abbild eines Menschen erkennen kann, der
jedoch je nach Perspektive praktisch jeder sein könnte.

Dann gilt meine ganze Aufmerksamkeit dem, was sie liest.
Wir hören zu, ohne auf unseren Stühlen zu rutschen oder die
Beine übereinanderzuschlagen. Selbst unser Atmen hat sich
auf das Allernötigste beschränkt.
Es ist nicht stilistische Virtuosität, die uns fasziniert, denn
ihre Sprache ist schlicht wie die eines Kindes. Das Ganze
wirkt überhaupt wie ein sonderbares Märchen, das einen eine
Weile einlullt, um den Zauber dann mit der Andeutung lau-
ernder Bedrohung zu durchbrechen. Es ist die Stimme der
Jugend, die die letzte Kurve in die Welt erwachsener Ver-
derbtheit und reifen, faulen Begehrens nimmt.
Wie beim letzten Treffen habe ich die ganze Zeit mit dem
Aufnahmeknopf des Diktafons in meiner Tasche herumge-
spielt. Unbewusst, ein nervöser Tick. Jetzt drücke ich ihn he-
runter und lasse das Band laufen.
Sobald sie zu lesen beginnt, denke ich nur noch: Ich werde
nie wieder versuchen zu schreiben. Natürlich muss ich weiter
für die Zeitung arbeiten. Und ich kann mir jederzeit die eine
oder andere Seite abringen, um mich durch die nächsten vier
Treffen zu bluffen. Aber Angelas Geschichte verdunkelt jedes
kreative Licht, das vielleicht von innen geleuchtet hätte.
Es ist kein Neid, der mich dessen so sicher macht. Nicht
die Weigerung eines schlechten Sportsmanns, der nicht mehr
mitspielen will, wenn er nicht gewinnen kann. Ich weiß, dass
ich nicht noch einmal versuchen werde, etwas für den Kreis
zu schreiben, weil ich, bis Angelas Tagebuch zu Ende ist, nur
ein Leser bin.
Nach dem Treffen gehe ich mit Len im Fukhouse etwas trin-
ken. Das heißt, ich betrete den Laden unter Conrad Whites
Wohnung, und Len folgt mir auf dem Fuß. Als er sich setzt,
lässt er zwischen sich und mir zwei Barhocker frei, als wür-
den wir uns nicht kennen. Ein paar Minuten, nachdem der im
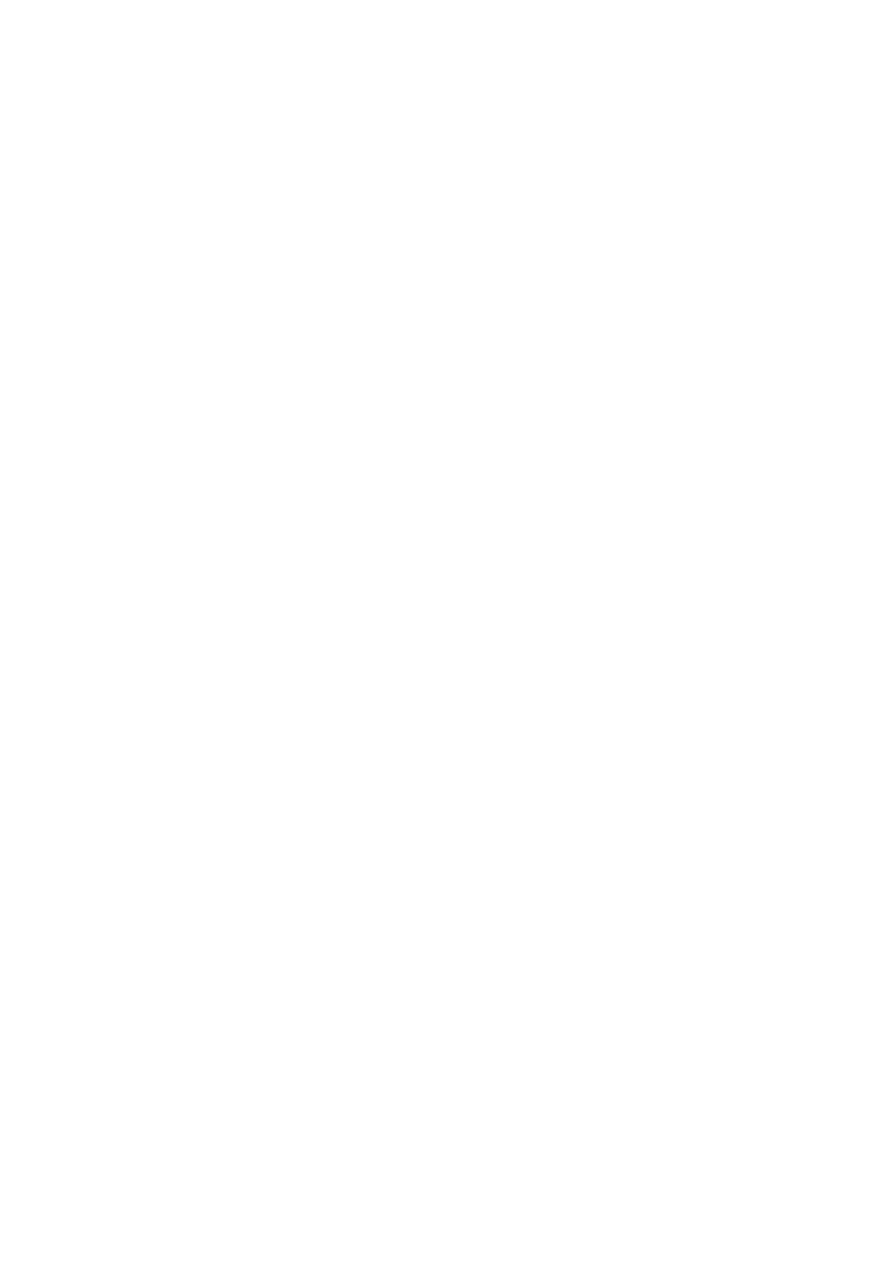
Gesicht tätowierte Barkeeper uns unsere Getränke gebracht
hat - Bier für mich, Orangensaft für Len -, wird der Abstand
einfach zu lächerlich.
»Gefällt dir der Kurs bis jetzt?«, frage ich ihn.
»O ja. Ich hab das Gefühl, es könnte einer der besten wer-
den.«
»Du hast schon andere Schreib-Workshops besucht?«
»Reichlich. Wirklich jede Menge.«
»Dann bist du ja ein alter Profi.«
»Aber ich hab noch nie was veröffentlicht. Nicht wie du.«
Das überrascht mich. Wie jedes Mal, wenn mich jemand
erkennt, bis mir einfällt, dass über meiner Fil-
me-der-Woche-Kolumne am Freitag ein winziges Foto neben
der Autorenzeile gedruckt wird. Ein pixeliertes Grinsen.
»Es gibt solche und solche Veröffentlichungen«, sage ich.
Ich denke, das war’s in etwa. Die Höflichkeit ist gewahrt
worden, mein Bier fast leer. Ich will gerade meinen Mantel
überwerfen und mich für den kalten Heimweg wappnen, als
Len seinerseits mit einer Frage herausrückt.
»Dieser Typ ist echt seltsam, findest du nicht?«
Er könnte Conrad White, Ivan, den Barkeeper mit der
Eidechsentätowierung auf der Wange oder den Führer der
freien Welt meinen, der im Fernseher über dem Tresen vor
Giftgaslieferungen in Aktenkoffern warnt, aber so ist es nicht.
»William ist schon ein ziemliches Kaliber.«
»Ich wette, er hat mal gesessen. Im Gefängnis, meine ich.«
»Würde mich nicht wundern.«
»Er macht mir ein bisschen Angst.« Len hebt den Blick
von seinem Orangensaft und sieht mich an. »Und was ist mit
dir?«
»Mit mir?«
»Ist er dir nicht unheimlich?«
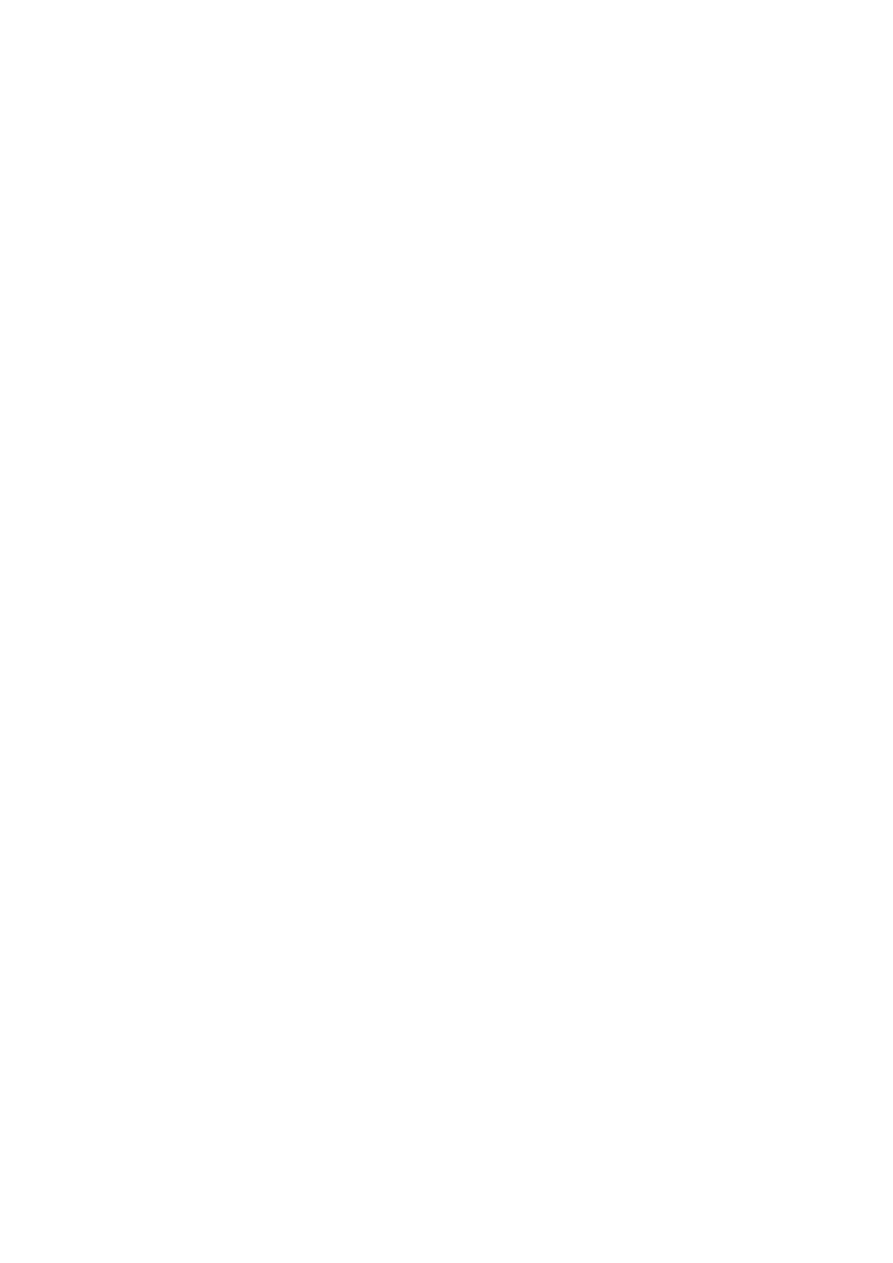
Ich könnte es zugeben. Und gegenüber einem anderen
Mann, den ich besser oder länger kenne, würde ich das auch
tun. Aber Len ist mir zu erpicht auf Gesellschaft, als dass ich
ihm jetzt schon mit Vertraulichkeiten entgegenkäme.
»Du solltest ihn in deine Geschichte einbauen.« Ich strei-
che einen Geldschein auf dem Tresen glatt, der ausreicht,
unsere beiden Getränke zu bezahlen. »Ich dachte, du magst
Horrorgeschichten.«
»Auf jeden Fall. Aber es ist ein Unterschied, ob man sich
schlimme Sachen ausdenkt oder schlimme Sachen macht.«
»Hoffentlich hast du recht. Sonst hätten einige von uns
echt ein Problem«, sage ich und klopfe Len im Gehen
freundschaftlich auf die Schulter. Der große Junge lächelt.
Und ich will verdammt sein, wenn ich nicht spüre, wie sich
auch auf meinem Gesicht ein Lächeln breitmacht.

5
Angelas Geschichte
Mitschrift der 1. Aufnahme
Es war einmal ein kleines Mädchen, das wurde verfolgt von
einem Geist. Es war ein schrecklicher Mann, der schreckliche
Dinge tut und sie in ihren Träumen besuchte. Und obwohl das
Mädchen nie Freunde hatte, wusste es, dass er nicht ihr
Freund war. Sie versuchte den anderen zu glauben, wenn sie
ihr sagten, dass es keine Geister gab. Doch so brav sie auch
war, sosehr sie auch betete, der schreckliche Mann kam und
bewies ihr, dass alle Wünsche und Gebete der Welt ihn nicht
wegwünschen oder -beten konnten. Deswegen musste das
Mädchen den Geist für sich behalten.
Die einzige Verbindung, die einzige Vertraulichkeit, die sie
sich erlaubte, war, ihm einen Namen zu geben.
Sandmann.
Jeder hat Eltern. Das wissen wir, so wie wir auch wissen, dass
wir eines Tages sterben müssen.
Aber es gab Zeiten, in denen das Mädchen glaubte, sie sei
die einzige Ausnahme von dieser angeblich eisernen Regel.
Zeiten, in denen sie sicher war, dass sie der einzige Mensch

auf Erden war, der weder Vater noch Mutter hatte. Sie war
einfach mitten in der Geschichte aufgetaucht, so wie der
schreckliche Mann, der schreckliche Dinge tut, einfach in ihre
Träume spaziert war. Das Mädchen war real, aber nur so, wie
die Figur einer Geschichte real ist. Wäre sie eine Figur aus
einer Geschichte, würde das erklären, warum sie keine Eltern
hatte, weil Figuren nicht geboren werden, sondern einfach
sind, zum Sein erweckt durch eine Laune des Autors.
Beinahe ebenso sehr wie der schreckliche Mann, der
schreckliche Dinge tut und der sie in ihren Träumen heim-
suchte, beunruhigte das Mädchen, dass sie nicht wusste, wer
ihr Autor war. Denn dann hätte sie wenigstens ihm die Schuld
geben können.
Auch Figuren aus Geschichten haben eine Vergangenheit.
Das Mädchen zum Beispiel war ein Waisenkind. Die Leute
sprachen nicht darüber, woher sie kam, und das Mädchen
fragte auch nie, und auf diese Weise blieb ihre Herkunft un-
gewiss. Anderen war sie genauso ein Rätsel wie sich selbst,
ein Problem, das gelöst werden musste.
Es gab Bücher, die das Mädchen gelesen hatte, in denen
Waisen wie sie zusammen mit anderen Waisen in Heimen
lebten. Und obwohl diese Heime häufig grausame Orte waren,
von denen man sich weg sehnte, wünschte das Mädchen sich,
sie könnte in einem solchen Heim leben, damit sie nicht mehr
die Einzige ihrer Art war. Stattdessen schickte man sie in
Pflegefamilien, die nicht sind wie Waisenheime in Büchern,
sondern einfach normale Familien mit Leuten, die dafür be-
zahlt werden, auf Kinder wie das Mädchen aufzupassen. Im
Alter von zehn war sie schon vier Mal umgezogen. Mit elf
noch zwei Mal mehr. Mit zwölf zog sie ein Jahr lang jeden
Monat um. Und der Sandmann folgte ihr überallhin. Er zeigte

ihr Dinge, die er tun würde, wenn er echt wäre, und tat diese
Dinge weiterhin in ihren Träumen.
Mit dreizehn wurde das Mädchen auf einen Bauernhof in
den dunklen Wäldern im Norden geschickt, so weit im Nor-
den, dass man meinen konnte, hier würde es gar keine Farmen
mehr geben. Ihre Pflegeeltern waren älter als alle, die sie bis
dahin gehabt hatte. Die Frau hieß Edra, der Mann Jacob. Sie
hatten keine eigenen Kinder, nur ihre karge Farm, die gerade
genug abwarf, um sie in den langen Wintern zu ernähren.
Vielleicht war das der Grund, warum sie so glücklich waren,
als das Mädchen zu ihnen kam. Sie war noch immer ein Rät-
sel, nach wie vor ein Problem. Aber Edra und Jacob liebten
sie mehr, als sie ein eigenes Kind geliebt hätten. Es war das
Leid, das das Mädchen gesehen hatte, das ihre Liebe weckte,
denn dem Land, das sie beackerten, mussten sie buchstäblich
jeden Bissen abringen. Edra und Jacob kannten das Leid und
hatten eine Ahnung davon, was es einem einsamen Mädchen
antun konnte.
Eine Zeit lang war das Mädchen glücklich oder näher da-
ran, als sie es je gewesen war. Die Güte, mit der ihre Pflege-
eltern sie behandelten, war ein Trost. Sie hatte ein Zuhause, in
dem sie vielleicht nicht nur Wochen, sondern Jahre leben
konnte. In der Stadt gab es eine Schule, zu der sie jeden Tag
mit dem Bus fuhr, und dort gab es Bücher zum Lesen und
Mitschüler, die vielleicht sogar eines Tages Freunde werden
würden. Eine Zeit lang war das Leben, wie sie sich ein nor-
males Leben vorgestellt hatte.
Ihre Zufriedenheit war so groß und beispiellos, dass sie den
schrecklichen Mann, der schreckliche Dinge tut, beinahe ver-
gessen hatte. Es war schon eine Weile her, dass er ihre nächt-
lichen Gedanken mit seiner Anwesenheit gestört hatte. Des-
halb war sie zutiefst erschrocken, als sie eines Nachmittags
von der Schule nach Hause kam und hörte, wie Edra und Ja-

cob von einem kleinen Mädchen aus der Stadt redeten, das
verschwunden war.
Es war dreizehn Jahre alt. Genauso alt wie sie. Eben hatte
es noch im Garten gespielt, im nächsten Moment war es ver-
schwunden. Die Polizei und freiwillige Suchtrupps hatten
überall gesucht, doch das Mädchen blieb drei Tage lang ver-
schwunden. Die Behörden mussten davon ausgehen, dass es
sich um ein Verbrechen handelte. Es gab keine Verdächtigen.
Die einzige Spur war ein Fremder, der bemerkt worden war,
als er nachts über die rissigen Gehsteige strich. Ein großer
Mann mit hängenden Schultern, eine Gestalt, die sich im
Schatten hielt. »Ein Mann ohne Gesicht«, hatte ein Zeuge ihn
beschrieben. Ein anderer meinte, es habe ausgesehen, als hätte
der Mann etwas gesucht, doch dies sei bloß ein flüchtiger
Eindruck gewesen. Darüber hinaus war nichts über ihn be-
kannt.
Aber das Mädchen wusste mehr. Die Kleine wusste, wer
die dunkle Gestalt war, obwohl sie sie nicht gesehen hatte. Sie
wusste, wer das andere Mädchen aus der Stadt verschleppt
hatte, das genauso alt war wie sie. Es war der Sandmann. Nur,
dass er jetzt die Grenzen ihrer Träume überschritten und die
reale Welt betreten hatte, wo er all die schrecklichen Dinge
tun konnte, die er tun wollte.
Und das Mädchen wusste noch etwas. Sie wusste, wonach
der Sandmann suchte, wenn er im Schatten der Nacht unter-
wegs war.
Er suchte nach ihr.

6
Schreibe über das, was du kennst.
Eine der elementaren Regeln für Schriftsteller, wenngleich
eine überflüssige, da die meisten sowieso zunächst zum Bio-
grafischen neigen. Die Einbildungskraft kommt später, wenn
sie sich überhaupt einstellt, nachdem alle Seiten des Fami-
lienfotoalbums durchgeblättert, Liebesziehungen obduziert,
Schlüsselmomente des Erwachsenwerdens und häusliche
Tragödien auf dem Papier wieder aufgewärmt worden sind. In
der Regel finden die Leute ihr eigenes Leben faszinierend
genug, um sich nie dem Problem stellen zu müssen, sich et-
was auszudenken. Der Kensington-Kreis bildet da keine Aus-
nahme. Evelyns Campus-Sexkapade, Petras Ende einer Ehe,
Ivans Verwandlung in eine Kanalratte. Ich bin neidisch auf
sie. Schreiben wäre so viel leichter, wenn ich des immer glei-
chen Gesichts im Spiegel nie überdrüssig würde.
Aber was ist, wenn man das Leben, das man kennt, nicht
besonders interessant findet? Real, ja. Und gezeichnet durch
sein Päckchen an Leid und Verlust, erlöst durch die Liebe
eines Sohnes, dessen Augen die gleiche Farbe haben wie die
seiner Mutter. Ich finde, mein Leben bietet einfach nicht ge-
nügend Material für einen Roman. Ich finde es schon an-
strengend genug, mich als der, der ich bin, einfach durchzu-
wurschteln, ohne auch noch den Helden spielen zu müssen.
So zumindest tröste ich mich, als mein Versuch, mir einen
Absatz für das nächste Treffen abzuringen, ergebnislos bleibt.
Ich esse an meinem Schreibtisch zu Mittag, knabbere an

einem Schinken-Käse-Sandwich aus der Kantine und tippe
wahllos auf der Tastatur meines Computers herum. Tim Ear-
heart kommt vorbei und wirft einen Blick über meine Schul-
ter. Er kann mit meinen literarischen Ambitionen rein gar
nichts anfangen (»Warum glaubst du, irgendjemand würde für
die Scheiße bezahlen, die du absonderst?«, war seine Art,
meine eigenen Zweifel prägnant zusammenzufassen, als ich
ihm anfangs von dem Schreibzirkel erzählte).
»Ich kann das ja nicht beurteilen«, meint er nun, »aber ich
bin mir nicht sicher, was das Ganze soll.«
Er hat recht. Im Laufe der nächsten eineinhalb Stunden
wird der Text auf dem Bildschirm bis auf einige wenige Sätze
zusammengestrichen.
Folgendes hat mir das gute alte
Schreib-über-das-was-du-kennst für heute eingebracht:
Nach dem Tod meiner Frau fing ich an, Stimmen zu hören.
Anfangs nur ihre. Dann auch andere, die ich nie zuvor ge-
hört hatte. Fremde. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe
das Gefühl, dass sie alle tot sind. Sie kommen vor dem
Einschlafen zu mir. Und das macht mir Angst. Nicht, dass
sie tot sind oder dass ich diese Stimmen höre, sondern dass
ich wach bin dabei.
Nachdem dieser Absatz brillanter Prosa geschafft ist, wende
ich mich der Couchkartoffel-Kolumne für die Wochenend-
ausgabe zu. Diese Woche steht eine schonungslose Attacke
auf die kanadische Ausgabe von American MegaStar!auf dem
Programm, einer Talent-Show, die in diesem wie in vierzehn
weiteren Ländern der absolute Quotenrenner ist. Weltweit
wird eine ganze Generation zu dem Glauben verleitet, sie ha-
be ein Recht auf Berühmtheit. Das ist Gift. Eine Lüge. Es ist
falsch. Und auch ein Ventil, mit dem meine Schrei-

ben-über-wasman-kennt-Frustration die Schleusen für
Schreiben-wie-die-Welt-vor-die-Hunde-geht öffnen kann, was
mir nie sonderlich schwergefallen ist.
Obwohl ich weiß, dass Canadian MegaStar!demselben
multinationalen Medienmogul gehört, der auch Eigentümer
der Zeitung ist, für die ich arbeite, und ungeachtet ominöser
Andeutungen des verantwortlichen Redakteurs, von besagtem
Medienmogul produzierten »Content« nicht »allzu kritisch«
zu behandeln, ziehe ich so richtig vom Leder und mache die
Sendung nieder, als wäre das Format an sich schon ein kultu-
reller Frevel. Diese Phrase schafft es sogar in meinen Ein-
stiegssatz. Nach dieser angemessenen Eröffnung geht es wei-
ter, gnadenlos übertrieben und verleumderisch, bis zu einem
hysterischen Schluss, der den Leser an der geistigen Gesund-
heit des Kolumnisten zweifeln lässt. Es ist persönlich.
Ich bleibe lange in der Redaktion (donnerstags sitze ich
immer mindestens bis Mitternacht am Computer, um die
Spalte mit den Fernsehtipps fertigzumachen) und frage mich
auf dem Heimweg, ob der heutige Tag womöglich der letzte
auf meinem aktuellen Posten war. Oder bei genauerem Nach-
denken der letzte auf irgendeinem Posten. Die Frage, wofür
ich sonst noch qualifiziert sein könnte, ist beinahe amüsant.
Die Vorstellung, einen eigenen Betrieb zu führen, hat mir
schon immer gefallen. Irgendwas, bei dem man den Mitarbei-
tern möglichst freie Hand lässt. Am besten automatisiert. Ein
Waschsalon. Oder eine Autowaschanlage.
Ich biege in meine Straße ein und spekuliere, wie viel we-
niger man verdienen würde, wenn man Zeitungen austrägt,
anstatt für sie zu schreiben, als mir gelbes Polizeiabsperrband
um das Haus gegenüber auffällt. Die vier Streifenwagen par-
ken vor dem Haus Nummer 147 der Nachbarfamilie und nicht
vor unserem Haus Nummer 146. Trotzdem renne ich den hal-
ben Block die Euclid Street hinunter, klingle, nachdem ich

zwei Mal den Schlüssel habe fallen lassen, und vergewissere
mich, dass mein Sohn bei Emmie in Sicherheit ist, bevor ich
wieder hinausgehe und den Polizisten, der den Verkehr Rich-
tung Queen Street umleitet, frage, was los ist.
»Einbruch«, sagt er, während er auf der Innenseite seiner
Wange herumkaut.
»Was wurde denn gestohlen?«
»Der Einbrecher hat nichts angerührt. Der Kleine war der
Einzige, der ihn gesehen hat.«
»Joseph. Mein Sohn spielt manchmal mit ihm.«
»Ach ja? Also, als Joseph vorhin aufgewacht ist, hat er ir-
gendeinen Mistkerl vor seinem Bett stehen sehen.«
»Konnte er ihn beschreiben?«
»Er konnte bloß sagen, dass der Typ ein Schatten war.«
»Ein Schatten?«
»Der Junge folgte ihm ins Wohnzimmer, wo er sich ans
Fenster stellte und auf die Straße blickte. Nach einer Weile ist
er dann durch die Haustür hinausgegangen, als wäre er der
Hausherr persönlich. Umkehren, Freundchen! Ja, Sie!«
Der Polizist entfernt sich, um ein Wort mit dem Fahrer
eines Geländewagens zu wechseln, der sich weigert, zur
Queen Street zurückzufahren. Das bietet mir Gelegenheit, bis
zum Vorgarten der Nachbarn weiterzugehen und mich an ihr
Wohnzimmerfenster zu lehnen. So habe ich denselben Blick,
den der Schatten jenseits der Scheibe gehabt haben muss.
Ich starre auf mein Haus.
Auf dessen Veranda jetzt Sam steht, neben Emmie, und zu
mir rüberblinzelt.
Ich lese die Lippen des Kindermädchens - Wink deinem
Daddy!-, und Sam hebt sein pummeliges Ärmchen zu einem
Gruß. Ich winke zurück und frage mich, ob er sehen kann, wie
heftig Daddy zittert.

Das nächste Treffen des Kreises findet in Petras Haus statt. In
der Woche zuvor hat sie uns netterweise eingeladen, aber als
ich vor ihrem Haus in Rosedale aus dem Taxi steige, sehe ich,
dass sie geradezu beleidigend bescheiden war, als sie ihre
Behausung als »nichts Besonderes« beschrieben hat. Das
Haus ist eine Villa. Es hat ein Kupferdach und einen terras-
senartig angelegten Garten, der selbst unter einer zentimeter-
dicken Schneedecke noch teuer aussieht, zwei passende Mer-
cedes-Coupés (ein rotes und ein schwarzes) stehen unter dem
Carport. Wenn das Petras Anteil ist, frage ich mich, wie viel
ihr Ehemann vor der Scheidung besaß.
An der Tür wird mein Mantel von einem silberhaarigen
Herrn entgegengenommen, dessen Anzug besser aussieht als
jeder, den ich je besessen habe. Ein Mann, der nicht nur eine
andere Gesellschaftsschicht, sondern ein anderes Jahrhundert
bedient. Mein erster waschechter Butler.
»Die Gruppe versammelt sich im Rosenzimmer«, sagt er
und führt mich über den Marmorfußboden zu einem tiefer
liegenden Wohnzimmer mit Ledersesseln und jeweils einem
eigenen Beistelltisch sowie einem prasselnden Feuer im offe-
nen Kamin. An der Tür erkundigt sich der Butler diskret, was
ich zu trinken wünsche, und tut das auf eine Art, die deutlich
macht, dass auch richtige Drinks im Angebot sind.
»Scotch?«, frage ich, und er nickt, als hätte meine Wahl
einen Verdacht bestätigt, den er auf den ersten Blick hatte.
Die meisten Mitglieder sind schon da. Conrad White hat
einen Sessel neben dem Kamin gewählt. Das orangefarbene
Flackern des Feuers verleiht ihm etwas Diabolisches, das
durch das kaum verhohlene Grinsen noch unterstrichen wird,
mit dem er die zusammenhanglose Sammlung von
Inuit-Skulpturen, grellen abstrakten Gemälden und Bücherre-
galen mit in Leder gebundenen »Klassikern« mustert. In die-
ser Kulisse von Reichtum wirken wir anderen wie Tagelöh-

ner, die sich heimlich eine Pause gönnen und die Kristallkel-
che mit beiden Händen festhalten, um nicht auf den Teppich
zu kleckern.
Len wirkt besonders fehl am Platz. Aber das liegt vielleicht
auch daran, dass er als Einziger redet.
»Ihr solltet kommen. Ihr alle. Was ist mit dir, Patrick?«
»Wohin soll ich kommen?«
»Zu der Open-Mike-Lesung, eine Party zur Präsentation
der neuen Literaturzeitschrift. Anschließend darf jeder, der
will, etwas vorlesen.«
»Ich weiß nicht, Len.«
»Komm schon. Dort kannst du abchecken, was da draußen
abgeht.«
»Gibt’s auch was zu trinken?«
»Bier zum halben Preis, wenn man die Zeitschrift kauft.«
»Na, das hört sich doch schon besser an.«
Bis auf William und Petra sind jetzt alle versammelt; Letz-
tere klappert auf hohen Absätzen zwischen Küche und Wohn-
zimmer hin und her, rührend besorgt, die Krabbenspieße
könnten verbrennen. Als unsere Gastgeberin endlich Platz
genommen hat, beschließt Conrad White, ohne William an-
zufangen. Wir anderen entspannen uns ein wenig. Ich nehme
an, keinem wäre es unlieb, wenn William sich neue kreative
Herausforderungen oder am besten gleich eine neue Postleit-
zahl gesucht hätte.
Ich bin als Erster dran, was mich erleichtert, denn je
schneller ich meine erbärmlichen paar Absätze hinter mich
bringe, desto eher kann ich mich dem vierfachen Single Malt
widmen, den Jeeves mir eingeschenkt hat.
Außerdem bin ich ohnehin nur aus einem einzigen Grund
hier.
Angela.

Sie enttäuscht mich nicht. Das sage ich, obwohl ich gar
nicht richtig zuhöre. Nachdem ich mein Diktafon eingeschal-
tet habe, achte ich weniger auf ihre Worte als auf die Art, wie
sie sie vorträgt. Ich habe die ganze Zeit angenommen, dass
Angela beim Vorlesen eine Stimme benutzt, die ganz anders
klingt als ihre eigene. Jetzt wird mir klar, dass ich eigentlich
keine Ahnung habe, wie ihre »echte« Stimme klingt und ob
sie sich von der unterscheiden würde, der ich im Augenblick
lausche. Sie hat in dem Kreis so wenig gesagt (ihre Kommen-
tare zu den anderen Lesungen beschränken sich meist auf ein
gemurmeltes »Es hat mir sehr gut gefallen«), dass es durchaus
sein könnte, dass sie diesen gleichzeitig unschuldigen wie
verdorbenen Kleinmädchen-Ton auch im alltäglichen Ge-
spräch verwendet.
Nachdem sie fertig ist, sagt eine Minute oder länger nie-
mand etwas. Das Feuer zischt wie ein punktierter Reifen. In
Lens Apfelsaftglas knackt ein Eiswürfel. Und von dem Mo-
ment an, in dem Angela ihr Notizbuch schließt, bis zu dem
Moment, in dem Conrad White den Kreis ermutigt, das Ge-
hörte zu kommentieren, sieht sie mich an.
Es ist mehr als bloßes Starren. Eine eingehende Betrach-
tung. Jedes Blinzeln markiert eine neue Beobachtung. Und ich
tue das Gleiche. Oder versuche es. In ihr Inneres zu blicken
und die Wahrheit vom Erfundenen zu unterscheiden. Und zu
ergründen, ob sie in mir irgendetwas Lohnenswertes entde-
cken kann. Etwas Mögenswertes.
»Wundervoll, Angela. Wahrhaft wundervoll«, sagt Conrad
White.
Alle heben den Kopf. Niemand hat unseren stummen
Blickwechsel bemerkt bis auf Conrad White selbst. Und Ivan.
Beide Männer rutschen peinlich berührt auf ihrem Sessel hin
und her, und ich erkenne sofort, was ihnen zu schaffen macht.

Ein Gedanke, der Einsamen wie uns häufiger kommt als jeder
andere.
Warum nicht ich?
Nach dem Treffen gehen wir hinaus in die kalte Nacht,
ohne dass einer von uns wüsste, welcher Weg aus den entmu-
tigend gewundenen Straßen und Sackgassen der Enklave hi-
nausführt. Ich sehe mich nach Angela um, doch sie muss
schon vor uns ihren Mantel entgegengenommen haben, denn
sie ist nirgends zu finden.
»Und wir sehen uns dann Dienstag, Patrick?«, fragt Len.
Ich sehe ihn an, als ob ich keine Ahnung hätte, wovon er re-
det. Und so ist es auch.
»Beim Open Mike?«
»Ach ja. Klar. Auf jeden Fall.«
»Dann schönen Abend noch«, sagt er und schlurft los in
die Richtung, die meiner Vermutung nach entgegengesetzt
zum Ausgang aus diesem Labyrinth liegt. Damit bleiben nur
Ivan und ich zurück.
»Ich weiß den Weg«, sagt Ivan.
»Kennst du dieses Viertel?«
»Nein«, sagt er und atmet langsam und gleichmäßig aus.
»Ich kann die U-Bahn-Züge hören.«
Ivan legt den Kopf in den Nacken und kneift die Augen zu,
als würde er das Thema eines Violinkonzertes genießen, ob-
wohl man lediglich das Rattern eines U-Bahn-Zuges hört, der
irgendwo im Tal aus einem Tunnel kommt.
»Komm mit«, sagt Ivan und macht sich auf den Weg zu
dem nächsten Tor in die Unterwelt.
Auf unserem Marsch durch Rosedales Villen-Labyrinth er-
zählt Ivan mir, dass er noch nie einen Selbstmörder überfah-
ren hat. Das können nur wenige U-Bahn-Fahrer mit so vielen
Dienstjahren von sich behaupten. Nicht ein einziges Mal hat

eine der Gestalten, die jenseits der gelben Markierung am
Bahnsteig standen, den widersinnigen Schritt nach vorn ge-
macht. Aber jedes Mal, wenn sein Zug aus dem Tunnel in
einen grell erleuchteten Bahnhof donnert, fragt sich Ivan, wer
es sein wird, der seine Bilanz ruiniert.
»Jeden Tag sehe ich Leute, die darüber nachdenken«, sagt
er, als wir die Brücke über die Gleise überqueren. »Ihre win-
zigen Bewegungen. Einen halben Schritt näher an die Kante,
jemand, der seinen Aktenkoffer abstellt oder mit den Armen
schwingt wie auf einem Sprungbrett. Sie machen sich bereit.
Manchmal kann man es auch nur in ihren Mienen lesen. Sie
betrachten den einfahrenden Zug, mein Gesicht hinter der
Scheibe, und plötzlich überkommt sie eine große Ruhe. Wie
einfach wäre es. Aber im nächsten Augenblick denken sie:
›Warum dieser Zug? Warum nicht warten, bis noch einer
kommt, der genauso gut ist?‹ Sie vergewissern sich, dass alles
stimmt. Ich kann sie hören, als würden sie mir direkt ins Ohr
flüstern.«
»Und dann überlegen sie es sich anders.«
»Manchmal«, sagt Ivan und spuckt über das Geländer auf
die Gleise. »Manchmal ist der nächste Zug auch der richtige.«
Wir stoßen auf die Yonge Street, die sich endlos nach
Norden erstreckt und an dieser Stelle die Head-Shops und
Touristen-Ramschläden der City schon hinter sich gelassen
hat. Ivan redet unaufgefordert weiter, auch als wir vor dem
Eingang der U-Bahn-Station stehen. Er spricht, ohne mich
direkt anzusehen, als hätte er seine Rede auswendig gelernt
und dürfte sich nicht ablenken lassen. Es bleibt mir nichts
anderes übrig, als seinen Kopf zu betrachten. Hutlos und kahl,
eine verwundbare Hautschicht, die an blau geäderten Roque-
fort-Käse erinnert.
Und was erzählt Ivan mir? Dinge, die ich mehr oder weni-
ger auch erraten hätte. Er ist der Sohn ukrainischer Einwan-

derer, sein Vater war ein jähzorniger Stahlkocher, seine Mut-
ter arbeitete schwarz als Näherin und flickte in ihrer Wohnung
über einem Metzgerladen in der Roncesvalles Avenue, in dem
heute Tee verkauft wird, die Kleidung der Arbeiter aus der
Nachbarschaft. Ivan war nie verheiratet und lebt allein in
einer Souterrainwohnung, in der er in seiner Freizeit schreibt.
Verschlungene Geschichten, die dem imaginierten Leben der
Menschen nachspüren, welche er unter der Stadt hin und her
kutschiert.
»Dies ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich unter Leu-
te gehe«, sagt er. Ich begreife nicht sofort, dass er von dem
Kreis redet. Von mir.
»Es ist schwer, in dieser Stadt neue Leute kennenzuler-
nen.«
»Das ist es nicht. Ich selbst habe mir die Gesellschaft an-
derer nicht gestattet.«
»Warum nicht?«
»Ich wurde einmal beschuldigt«, sagt er und sieht mich di-
rekt an. »Hat man dich je wegen irgendwas beschuldigt?«
Aus dem Nichts peitscht eine eisige Böe über die Straße
mit einem wütenden Heulen, das mir sofort Kopfschmerzen
bereitet.
Was ich für Schüchternheit gehalten habe, fällt von Ivan
ab. Er starrt mir ins Gesicht, das taub vor Kälte ist, weshalb
ich nicht weiß, zu welcher Miene meine Züge gefroren sind.
Ich weiß nur, dass in der ganzen Zeit, die wir nun schon hier
stehen, noch niemand aus der U-Bahn gekommen ist. Mit
einem Mal ist mir mehr als nur ein wenig unbehaglich.
»Ich schätze schon«, sage ich.
»Du schätzt schon.«
»Ich meine, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang -«
»Ich meine, dass man beschuldigt wird, jemandem etwas
getan zu haben.«

Ivan macht einen Schritt zurück. Er wollte ein normales
Gespräch mit jemandem führen, der ihm genauso normal er-
schienen war, aber irgendwo auf dem Weg hierher hat er die
Kontrolle verloren. Aber nicht Scham oder Schuldbewusstsein
umspielen seine Züge, sondern Wut. Auf mich, auf sich
selbst. Auf die ganze anklagende Welt.
»Ich mach mich besser auf den Heimweg«, murmelt er und
lehnt sich an die Tür des U-Bahn-Bahnhofs. Die wärmere
Luft aus dem Schacht strömt ächzend durch den Spalt. »Ich
kann dich umsonst mitnehmen, wenn du willst.«
»Nein danke. Ich gehe gern zu Fuß.«
»An einem Abend wie diesem?«
»Ich hab es nicht weit.«
»Ach ja? Wo wohnst du denn?«
»Ganz in der Nähe.«
Ich könnte Ivan erzählen, wo ich wohne, und beinahe tue
ich das auch. Aber stattdessen weise ich nur vage nach Wes-
ten.
Ivan nickt. Ich kann spüren, dass er mich bitten möchte,
den letzten Teil unseres Gesprächs für mich zu behalten. Aber
am Ende schlüpft er einfach durch die Tür und gleitet auf der
Rolltreppe stehend abwärts. Sein kahler Kopf folgt ihm wie
eine leere Denkblase in einem Comic.
Ich laufe weiter die Yonge Street hinauf bis zur Bloor Street,
folge ihr durch den Guc-
ci-Chanel-und-Cartier-Monopoly-Block und biege am Mu-
seum links ab. Über die Harbord Street komme ich auf den
Campus der Universität. Es herrscht kein Verkehr, ich bin
allein auf der Straße, was mich ermutigt, einer Angewohnheit
aus meiner Kindheit zu frönen. Selbstgespräche. Damals wa-
ren es ausführliche Unterhaltungen mit Figuren aus den Bü-
chern, die ich gerade las. Inzwischen beschränke ich mich auf

einzelne Satzfetzen, die mir im Gedächtnis haften geblieben
sind. Heute Abend aus Angelas Vortrag.
Schmutzige Hände.
Schon diese beiden Wörter machen mir Angst.
Furcht ließ sie die Stadt, die Welt, auf eine Art sehen, wie
sie sie nie zuvor gesehen hatten.
Ich versuche, diese Beschwörungen im verwehenden Dunst
meines beschlagenen Atems hinter mir zu lassen, und lenke
meine Gedanken auf reale Sorgen. Keinerlei nennenswerte
Schreibfortschritte. Der dünner werdende Faden, der mich in
meinem Job hält. Dunkle Ahnungen, die mich grübeln lassen:
Ist es das? Sind es Tage wie dieser, an denen man anfängt, in
ein Loch zu rutschen, aus dem man nicht mehr herauskommt?
Ein Geruch, den Chirurgen und Soldaten erkennen wür-
den.
Letzte Nacht ist Sam aus einem Albtraum erwacht. Ich bin
zu ihm gegangen und habe ihm das feuchte Haar aus der Stirn
gestrichen. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, fragte ich
ihn, wovon der Traum gehandelt hatte.
»Von einem Mann«, sagte er.
»Was für ein Mann?«
»Ein böser Mann.«
»Hier drin gibt es keinen bösen Mann. Ich würde keinen
Bösen hereinlassen.«
»Er ist nicht in diesem Haus. Er ist in dem Haus.«
Dabei richtete Sam sich auf und zeigte aus dem Fenster.
Sein Finger wies direkt auf das Haus gegenüber. Auf das
Fenster, an dem ein paar Abende zuvor ein Schatten gestan-
den und hinausgeblickt hatte.
»Hast du den bösen Mann gesehen, der dort war?«, fragte
ich ihn, aber er hörte in meiner Frage nur das Eingeständnis,
dass etwas, dessen Nichtexistenz ich ihm eben versichert hat-
te, doch real sein könnte, und wandte sich ab. Was nützten

leere väterliche Versprechen gegen den Schwarzen Mann?
Kommenden Albträumen würde er sich alleine stellen.
Die Vorhänge mit Blut tätowiert.
Auf meiner Abkürzung durch Chinatown fühle ich mich
endlich nicht mehr allein. Nicht wegen der anderen Fußgän-
ger, die mit gesenktem Kopf nach Hause stapfen, sondern
weil ich verfolgt werde.
Vorbei an den Karaoke-Bars in der Dundas Street und dann
idiotischerweise quer durch eine Reihe von Neubauprojekten
bis zur Queen Street. Dort höre ich die Schritte wie einen
Widerhall meiner eigenen. Im Lokalteil liest man häufig Be-
richte über Schießereien in exakt diesem Block, aber ich bin
sicher, was immer mich auch beschattet, es hat kein Interesse
an meiner Brieftasche. Es will sehen, was ich mache, wenn
ich mitbekomme, dass es da ist.
Und was mache ich?
Ich laufe.
Hals über Kopf renne ich los, obwohl ich völlig ungeeig-
nete Schuhe trage, sodass mir nach einem Block bereits die
Schienbeine wehtun. Ein jäher Schmerz schießt mir in den
Hinterkopf. Tränen brennen in meinen Augen, und meine
Lungenflügel knistern in meiner Brust wie zwei Plastiktüten.
Mut ist keine Frage des Willens, sondern der Kraft.
Ich folge der kleinen Straße auf der Rückseite der Läden in
der Queen Street. Der kürzeste Weg zu meinem Haus. Aber
eine dunkle Gasse. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich habe
gar nicht nachgedacht. Ich bin einfach nur losgelaufen. Vor-
bei an Mauern und Zäunen zum Schutz gegen Ratten und
Cracksüchtige. Kein Licht, das den Weg erhellt. Nur die
dunkleren Umrisse von Gebäuden und ein schwarzes Recht-
eck, wo die Gasse in die Straße mündet.
Ich bleibe nicht stehen. Ich sehe mich nicht um.
Nicht, bis ich stehen bleibe und mich umdrehe.

Unter der einzigen funktionierenden Laterne im ganzen
Block, einen Schneeballwurf nur von meinem eigenen Haus
entfernt. Im Zimmer meines Sohnes brennt Licht. Sam ist zu
lange aufgeblieben und hat noch heimlich gelesen. Und ich
will nur auf seiner Bettkante hocken, sein Buch zuklappen,
das Licht ausmachen und hören, wie er atmet.
Er ist mein Sohn.
Ich liebe meinen Sohn.
Ich würde mein Leben geben, um ihn zu beschützen.
Diese Gedanken kommen mir schnell und knapp wie zu-
ckende Blitze. Und noch ein weiterer.
Die Gasse ist leer.

7
Angelas Geschichte
Mitschrift der 2. Aufnahme
Das Mädchen erzählt niemandem, was es vom Sandmann und
den schrecklichen Dingen weiß, die er getan hat. Denn es
weiß im Grunde nichts über das vermisste Mädchen, nichts,
was es je beweisen könnte. Ganz zu schweigen davon, dass
man es nach einer solchen Äußerung ein für alle Mal für ver-
rückt hielte. Man würde sie Edra und Jacob wegnehmen und
an einen Ort bringen, weit schlimmer als jede Pflegefamilie
und jedes Waisenhaus.
Aber noch fürchterlicher als dieser Gedanke ist die Vor-
stellung, Edra und Jacob wehzutun. Die beiden haben sich
immer nur um ihr Wohlbefinden gesorgt. Dass sie an dunkle
Gestalten aus ihren Träumen glaubte, an ein Monster, das
vom dunkelsten aller Orte gekommen war, um sie zur Strecke
zu bringen, würde den beiden das Herz brechen. Das Mäd-
chen beschloss, Edra und Jacob um jeden Preis zu schützen.
In den nächsten paar Tagen schien es sogar zu funktionie-
ren. Das Mädchen tat, als wäre alles in Ordnung. Keine wei-
teren Kinder verschwanden. Seine Träume waren so rätselhaft
wie die aller anderen, ganz ohne schreckliche Männer, die

schreckliche Dinge tun. Es war, als wäre der gesichtslose
Fremde, der aus einem Albtraum ausgebrochen war, selbst
nur ein Albtraum und keinen Deut realer.
Dann erblickt ihn das Mädchen.
Nicht in einem Traum, sondern durch das Fenster ihres
Klassenzimmers. Sie hat am Pult gesessen über einem Ma-
the-Test. Multiplikation von Brüchen. Eine Gleichung, die
schwieriger ist als die anderen, lässt sie den Blick heben, um
den wirren Haufen übereinandergestapelter Zahlen in ihrem
Kopf zu sortieren. Sie sieht ihn sofort. Er steht im Schatten
der Ulme auf dem Schulhof. So groß wie der niedrigste Ast,
der, das weiß das Mädchen aus Erfahrung, zu hoch ist, um ihn
zu erklimmen, selbst wenn einer der Jungen mit einer Räu-
berleiter hilft. Das Gesicht des Sandmanns liegt in dem
Schattengitter, das die Blätter der Ulme werfen, doch das
Mädchen hat das Gefühl, dass er sie direkt ansieht. Und lä-
chelt.
Sie beugt sich wieder über ihre Aufgabe. In der Zeit, in der
sie den Blick von dem Blatt gewendet hat, haben sich die
Brüche verdoppelt, sodass die Zahlen nun ein verwirrendes
Durcheinander bilden.
Er wäre noch immer da, wenn sie gucken würde. Aber sie
guckt nicht.
Draußen erwacht ein Rasenmäher röhrend zum Leben.
Dem Mädchen stockt der Atem. Ein aufflackernder Schmerz.
Sie spürt, wie die Klingen des Mähers in ihre Seite schneiden
und sie halbieren, in einen Bruch verwandeln.
Als sie später auf der Heimfahrt in der letzten Reihe des
Schulbusses sitzt, versucht das Mädchen, sich daran zu erin-
nern, wie der Sandmann ausgesehen hat. Wie konnte sie er-
kennen, dass er gelächelt hat, ohne sein Gesicht zu sehen?
War das ein Detail, das sie hinzugedichtet hatte, nachdem der
Moment verflogen war? Hatte sie sich ihn nur ausgedacht, so

wie sie manchmal glaubte, ihr ganzes Leben sei erfunden?
War der schreckliche Mann, der schreckliche Dinge tut, ein
Produkt ihrer Fantasie?
Wie eine Antwort auf all ihre Fragen ist er da, als das
Mädchen aus dem Fenster des Schulbusses blickt. Er sitzt auf
einer Schaukel auf dem Spielplatz, die Beine ausgestreckt,
sodass seine Stiefel die Grasgrenze um den Sand berühren.
Ein Mann mit hängenden Schultern auf einer Kinderschaukel,
die ihn noch viel riesiger aussehen lässt.
Das Mädchen wendet sich den anderen Schülern in dem
Bus zu, aber keiner sieht aus dem Fenster. Alle lachen und
schießen mit Strohhalmen Papierkügelchen aufeinander. Für
einen Moment stockt dem Mädchen der Atem, wenn sie daran
denkt, wie wenig die anderen Kinder wissen. Von dem, was
sie erwartet und belauert. Wenn nicht der Sandmann, dann
irgendeine andere dunkle Gestalt.
Der Fahrer legt einen Gang ein, und der Bus fährt ruckelnd
los. Der Sandmann sitzt immer noch auf seiner Schaukel und
sieht ihnen nach. Selbst aus der Ferne kann das Mädchen sei-
ne Hände erkennen, die Finger, die die Ketten packen, ge-
schwollen und dick wie Würste. Schmutzige Hände.
Bevor der Bus in die Straße einbiegt, die aus der Stadt hi-
nausführt, blinzelt das Mädchen angestrengt und erkennt, dass
sie sich geirrt hat.
Nicht Schmutz verklebt die Falten und Härchen an den
Händen des Sandmanns. Es ist Blut.
Am nächsten Tag findet man das vermisste Mädchen. Bei den
Bäumen am Fluss jenseits des Friedhofs. Ein Ort, den die äl-
teren Kinder Old Grove nennen und der berühmt für seine
Busch-Partys ist. Nun und für alle Zeit bekannt als die Stelle,
an der man die Einzelteile eines Mädchens gefunden hat, das
noch zu jung für Busch-Partys war, vergraben unter einer

Schicht Blätter, als ob ihr Mörder am Schluss gelangweilt nur
noch eine Handvoll welkes Laub auf sie geworfen hatte, um
fertig zu werden.
Wegen des Leichenfundorts richtete sich der Verdacht der
Polizei auf die älteren Jungen an der Schule, die schon früher
Ärger hatten. Hatte einer von ihnen das Mädchen gekannt?
War er in sie verliebt gewesen und ihr nachgelaufen? Aber
selbst die größten Unruhestifter der Schule hatten nie etwas
Schlimmeres getan, als einen Schokoriegel mitgehen zu las-
sen oder an Halloween Eier gegen Fensterscheiben zu werfen.
Unvorstellbar, dass einer von ihnen das fragliche Verbrechen
begangen haben konnte.
Nachdem man das vermisste Mädchen gefunden hatte,
schlug das Gerede in der Stadt von Argwohn in Angst um.
Wer die schreckliche Tat begangen hatte, zählte weniger,
wichtiger war, dass nicht noch jemandem etwas Schreckliches
widerfuhr. Eine inoffizielle Ausgangssperre trat in Kraft. In
den Häusern brannte die ganze Nacht Licht. Gruppen von
Stadtbewohnern - Ärzte, Ladeninhaber, Händler und Säufer,
eine sonderbare Mischung von Leuten, die sich sonst nie mit-
einander abgegeben hatten - patrouillierten mit Taschenlam-
pen in den Straßen, und es hieß, dass einige unter ihren langen
Mänteln Schrotflinten verbargen. Sie hatten keine Ahnung,
wonach sie Ausschau halten sollten. Furcht ließ sie die Stadt,
die Welt, auf eine Art sehen, wie sie sie nie zuvor gesehen
hatten.
Das zweite Mädchen verschwand am selben Abend, an dem
das erste gefunden wurde. Während die Männer ihre Ta-
schenlampen auf Gärten, Kellertüren und Gebüsche richteten,
die Lichter in allen Häusern brannten und die meisten Be-
wohner lange aufblieben, weil sie nicht schlafen konnten,
wurde ein Mädchen im gleichen Alter kurz vor Morgengrauen
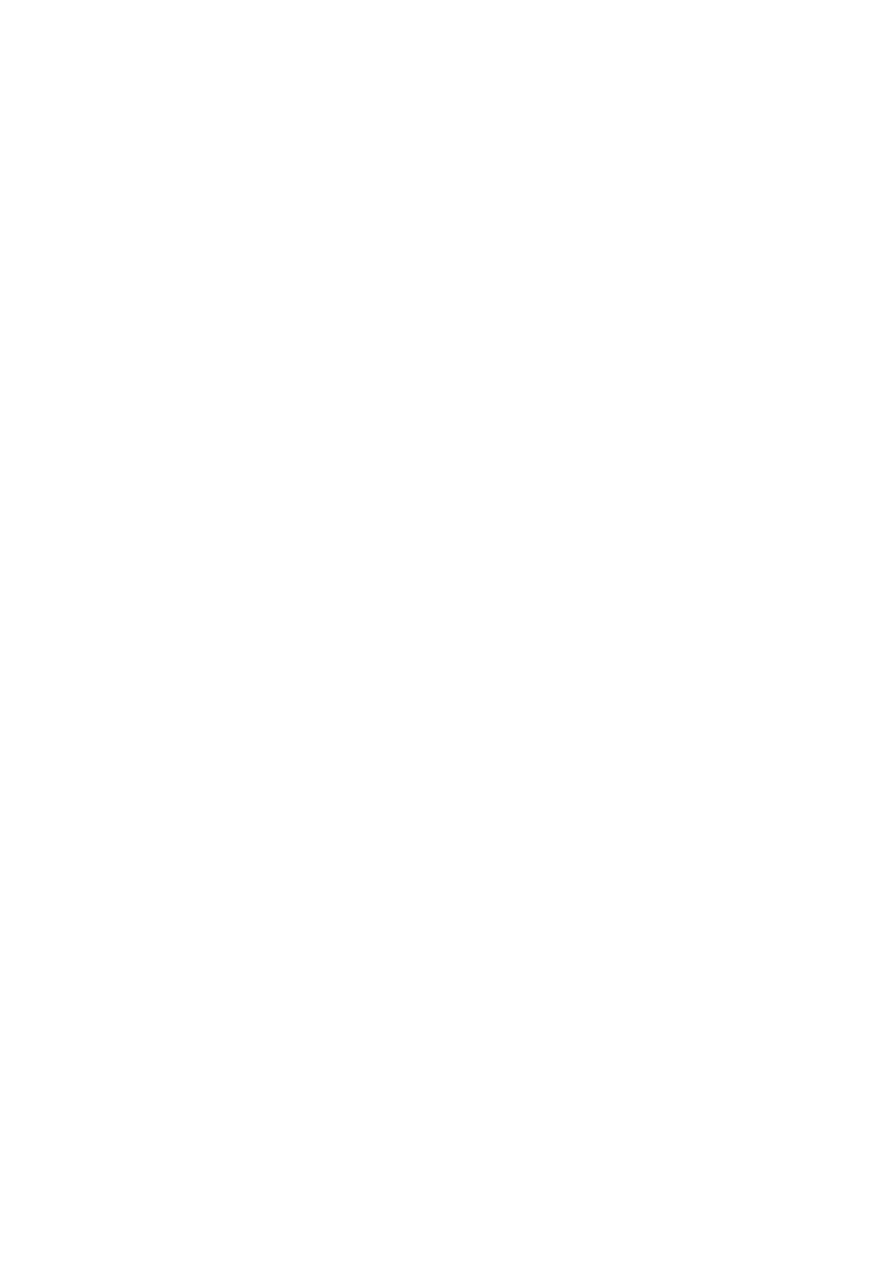
aus ihrem Bett verschleppt. Das Fenster im Erdgeschoss stand
offen. Um den niedergetrampelten Rosenstrauch entdeckte
man Fußabdrücke in der Erde. Das Laken lag auf dem Fuß-
boden. Die Vorhänge waren mit Blut tätowiert.
An jenem Tag blieb die Schule geschlossen. Nicht, weil die
Schüler zu Hause sicher gewesen wären. Die Entscheidung
wurde aus dem Instinkt heraus getroffen, alles, was bis dahin
als normal gegolten hatte, einzustellen, und sei es nur, um mit
der Abnormalität der Ereignisse Schritt zu halten. Edra und
Jacob waren trotzdem froh. Es war so spät im Jahr, dass die
(noch so magere) Ernte schon eingebracht war. Es gab keine
Dienstagsgottesdienste, und jetzt war auch noch die Schule
geschlossen. Das bedeutete, dass die beiden es sich leisten
konnten, mit ihrer Adoptivtochter, die sie nun ebenso sehr
schützen wie lieben wollten, im Haus zu bleiben.
Es war ein seltsamer Ferientag. Sie machten Bratäpfel,
spielten Karten, schürten ein Feuer, das sie eigentlich gar
nicht brauchten, nur um den Kirschholzgeruch im Haus zu
riechen. Im Laufe eines langen Tages schweiften die Gedan-
ken des Mädchens nur ein paarmal zu dem schrecklichen
Mann, der schreckliche Dinge tut. Sie warf lange verstohlene
Blicke auf Jacob und Edra und wagte es, das Wort Familie als
ein unsichtbares Band zu denken, das sie alle drei miteinander
verband.
In jener Nacht erwacht das Mädchen, als Steine gegen das
Fenster ihres Zimmers geworfen werden. Sie hört den ersten,
öffnet jedoch erst beim zweiten die Augen. Aus ihren Heim-
suchungen hat das Mädchen eine Regel abgeleitet: Einmal
könnte irgendwas sein. Mit dem zweiten Mal wird es real.
Schon als sie aus ihrem Bett aufsteht, um zum Fenster zu
gehen, ist sie sich bewusst, dass sie einen Fehler macht. Was
sie antreibt, ist auch nicht Neugier, sondern Pflichtgefühl. Sie

muss das Dunkel, das sie an diesen Ort gebracht hat, davon
abhalten, Edra und Jacob anzurühren. Es ist nicht ihre Schuld,
dass das Mädchen, das sie so liebevoll aufgenommen haben,
ihren schlimmsten Träumen freien Lauf gelassen hat. Sie dür-
fen nicht sehen, was es sich zu sehen anschickt.
Als das Mädchen auf nackten Füßen über die blanken Die-
len huscht, ächzt das ganze Haus, wie um sie zu warnen. Ihr
Zimmer ist klein, aber die Anstrengung, bis zum Fenster zu
gelangen, erschöpft sie. Mut, begreift sie, ist keine Frage des
Willens, sondern der Kraft.
Am Fenster angekommen klammert sie sich mit beiden
Händen an die Fensterbank, um ihr Gleichgewicht zu halten.
Über allem liegt die widerwärtige Stille, die einer Ohnmacht
vorausgeht. Sie zwingt sich, tief einzuatmen. Als sie hinaus-
blickt, fragt sie sich, ob ihr Herz stehen geblieben ist.
Der Sandmann steht unten im Hof. Als er sie sieht, wirft er
einen weiteren Stein gegen ihre Scheibe, eine Geste, die das
Mädchen aus alten Filmen kennt. Ein Verehrer, der seine
Ankunft zu einem nächtlichen Stelldichein ankündigt.
Sobald er sicher ist, dass sie ihn beobachtet, dreht er sich
um und geht zum Stall. Sein Gang ist von einer schlurfenden
Langsamkeit, die man als Reue missdeuten könnte. Aber das
Mädchen erkennt sie stattdessen als einen Ausdruck der
Selbstgewissheit, der Leichtigkeit, mit der er sich an seine
Taten macht. Das macht seine Bosheit so unberechenbar.
An der Stalltür bleibt er stehen. Sie steht so weit offen,
dass er hineinschlüpfen könnte, aber das tut er nicht. Er will
nur, dass sie sieht, dass er dort drinnen gewesen ist.
Ihr weiter den Rücken zuwendend, geht er um den Stall
herum und ist verschwunden.
Das Mädchen weiß, was es tun muss. Oder was es seinem
Willen nach tun soll.

Auf dem Weg die Treppe hinunter trägt sie ihre Schuhe in
der Hand, um keinen Lärm zu machen. In ihrer Eile vergisst
sie, sich einen Mantel überzuziehen, sodass die schneidende
Kälte durch ihren Baumwollschlafanzug dringt, als sie durch
die Hintertür auf den Hof tritt. Welke Blätter tanzen im Wind
eine Acht über den staubigen Boden, und das Rascheln über-
tönt ihre Schritte, als sie beinahe hastig zu dem Stall eilt.
Die noch tiefere Dunkelheit jenseits der Tür lässt sie inne-
halten. Sie kommt fast jeden Tag in den Stall (wo sie die
meisten ihrer Pflichten nach der Schule zu erledigen hat), so-
dass sie sich auch ohne Licht zwischen den Boxen und an
Haken hängenden Werkzeugen bewegen könnte. Aber ir-
gendetwas an dem Raum ist anders, auch wenn sie es zu-
nächst nicht erkennt. Es ist nichts, was sie sehen könnte - sie
kann es nur riechen.
Ein Hauch vom Geruch des Sandmanns hängt noch in der
Luft. Kräftiger als das Heu und der Kuhdung, auch wenn er
gar nicht mehr da ist. Sie muss husten und dann würgen. Ein
Geruch, den Chirurgen und Soldaten erkennen würden, dem
ein Mädchen wie sie jedoch aus keinem Grund je zuvor be-
gegnet sein könnte.
Sie kämpft gegen ihr Ekelgefühl an und geht auf die Box
am Ende des Stalls zu. Dorthin soll sie gehen. Das weiß sie,
als hätte er sie bei der Hand genommen und geführt.
Nachdem ihre Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt ha-
ben, kann sie dünne Fäden von Mondlicht ausmachen, die
durch die Ritzen fallen, und als sie das Tor der Box aufstößt,
ist es hell genug, um zu sehen.
Das Mädchen in der Box sieht aus wie sie. Wahrscheinlich
hat er es deswegen ausgesucht. Sie kannte das zweite ver-
misste Mädchen aus der Schule, aber ihr war nie aufgefallen,
wie ähnlich sie ihr mit ihren braunen Haaren und ihrem run-
den Gesicht sah. Einen Moment lang glaubt sie, es könne ihre

eigene zerstückelte Leiche sein, die vor ihr auf den bespritzten
Strohballen liegt. Dann wäre sie fortan auch ein Geist.
Das Mädchen fängt an zu graben, noch bevor sich in ihrem
Kopf so etwas wie ein Plan herauskristallisiert hat. Ein Loch
am Rand des Waldes, der an Jacobs karges Grundstück
grenzt, und so tief, wie es die harte Erde und die Zeit erlau-
ben. Ihr bleibt nicht einmal Gelegenheit, sich zu fürchten,
obwohl sie mehr als einmal überzeugt ist, dass etwas in dem
Leinensack, den sie aus dem Stall hierher geschleppt hat, sich
bewegt.
Selbst als sie den tropfenden Sack in das Loch stößt und
die Erde schaufelweise wieder dorthin zurückschippt, wo sie
hergekommen ist, streift sie nur flüchtig der Gedanke, dass sie
das alles tut, um sicherzugehen, dass nicht Jacob beschuldigt
wird. Denn das würde natürlich passieren, wenn man das
zweite Mädchen tot in seinem Stall finden würde. Der
schreckliche Mann, der schreckliche Dinge tut, hat sie zu die-
ser Entscheidung gezwungen, sodass es im Grunde gar keine
richtige Entscheidung war. Lieber ist sie die Komplizin des
Sandmanns, als dass sie zulässt, dass der Mann, der für sie
mehr als irgendjemand sonst ein Vater gewesen ist, zu Un-
recht für den Rest seiner Tage ins Gefängnis muss.
Als am Horizont der erste Bleistiftstrich der Dämmerung
erscheint, klopft sie mit dem Spaten den Hügel des Grabes des
zweiten Mädchens fest.
Das Grauen dieser Nacht wird sie später in unterschied-
lichster Gestalt heimsuchen. So viel weiß das Mädchen, denn
es kennt sich aus mit Träumen.
Doch weiß das Mädchen nicht, was der Sandmann von ihr
will. Er hat herausgefunden, wo sie lebt. Er könnte sie genau-
so leicht holen, wie er die anderen geholt hat. Aber von ihr
wünscht er sich etwas anderes. Und obwohl sie sich einzure-

den sucht, dass sie sich unmöglich vorstellen kann, was das
sein könnte, hat sie in Wahrheit doch eine Idee.

8
Zwei Tage nach dem Treffen in Petras Haus berichtet die
Morgenzeitung von einer weiteren vermissten Person. Ronald
Pevencey, 24, Frisör in einem der Avantgarde-Salons in der
Queen Street, war die ganze Woche nicht zur Arbeit erschie-
nen. Als man schließlich die Polizei alarmierte, fand sie die
Tür zu seiner Wohnung im ersten Stock angelehnt, aber keine
Spuren eines gewaltsamen Eindringens oder Kampfes. Daraus
schlossen die Ermittler haarscharf: Wer immer an seine Tür
geklopft hatte, war von Ronald hereingelassen worden.
Nicht nur sein unübliches Fernbleiben von der Arbeit,
sondern auch beunruhigende Bemerkungen, die Ronald kürz-
lich gegenüber einem Kollegen gemacht hatte, nähren öffent-
liche Befürchtungen eines weiteren Verbrechens. Offenbar
war Ronald in den vergangenen Wochen hier und da von
einer Gestalt beobachtet worden. Obwohl nicht bekannt war,
ob Ronald seinen Verfolger erkannt hatte, glaubte einer seiner
Kollegen, dass Ronald eine Vermutung hatte, die ihm eine
Heidenangst einjagte. »Er wollte darüber reden, aber ohne
darüber zu reden«, wie es sein Vertrauter formulierte.
In dem Artikel, der unter dem Namen meines alten Trink-
kumpans Tim Earheart erschienen ist, windet sich der Poli-
zeisprecher doppelt und dreifach, um jegliche Spekulationen
zu zerstreuen, man könne es mit einem Serienmörder zu tun
haben. Erstens gebe es keinerlei Hinweise darauf, dass Carol
Ulrich und Ronald Pevencey ermordet worden seien. Obwohl
keiner ein Motiv zur Flucht oder zum Selbstmord gehabt ha-
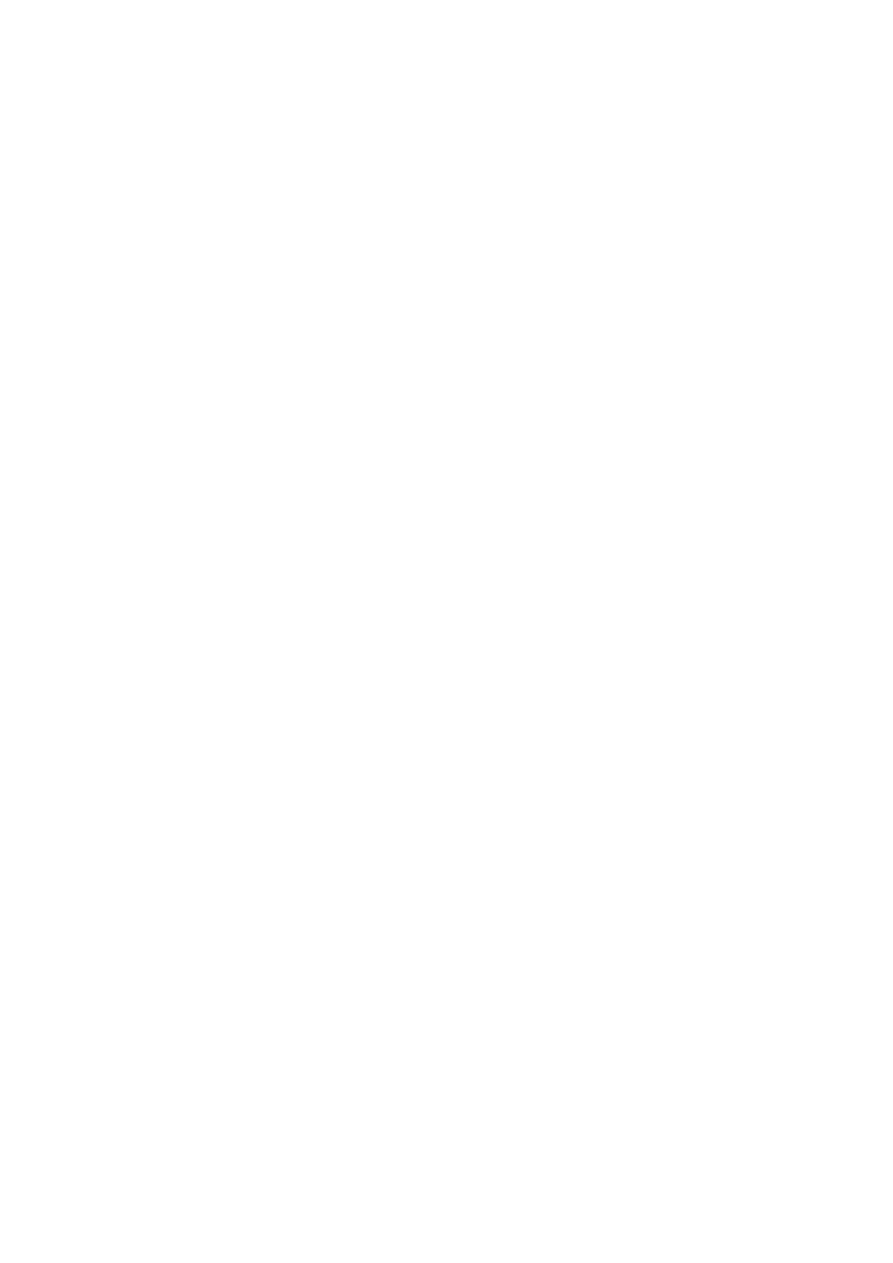
be, bestehe nach wie vor die Möglichkeit, dass sie einfach zu
einem spontanen Urlaub aufgebrochen seien. Postnatale De-
pression. Eine Crystal-Sause. Alles schon vorgekommen. Des
Weiteren wird darauf hingewiesen, dass keine Verbindung
zwischen den beiden Vermissten besteht. Ein Frisör und eine
Hausfrau. Unterschiedliches Alter, unterschiedliche Gesell-
schaftskreise. Carol hat nie einen Fuß in Ronalds Salon ge-
setzt. Einzige Gemeinsamkeit ist die Tatsache, dass sie nur
sechs Straßen voneinander entfernt wohnten. Sechs Straßen
von uns entfernt.
Wenn Ronald Pevencey und Carol Ulrich beide nicht mehr
leben, sind sie aller Wahrscheinlichkeit nach auf gleiche Art
zu Tode gekommen. Serienmörder arbeiten nach einem Mus-
ter, wie die Polizei zu betonen nicht müde wird. Ein Pro-
grammierfehler in der Software ihrer Psyche lässt sie wieder
und wieder verschiedene Versionen des gleichen Opfers aus-
wählen. In diesem Fall ist den beiden Vermissten jedoch nur
der Wohnort gemein.
Trotz alledem bin ich sicher, dass das, was die zwei ver-
folgt hat, in beiden Fällen dasselbe war. Ebenso, wie ich mir
sicher bin, dass keiner von ihnen noch lebt. Trotz der Erklä-
rungen der Psychologen und Kriminologen scheint mir Unbe-
rechenbarkeit zumindest manchmal ein ebenso wahrscheinli-
ches Motiv wie jedes andere. Vielleicht mag es der Täter so.
Wenn man nicht weiß, warum ein Mörder tut, was er tut,
macht ihn das nur bedrohlicher. Und schwerer zu fassen.
Aber es sind nicht die hypothetischen Motive des Killers,
die mich überzeugt haben. Ich glaube vielmehr, dass der
Schatten, der mir neulich abends auf dem Heimweg gefolgt
ist, derselbe ist, der auch Ronald Pevencey und Carol Ulrich
verfolgt hat. Der böse Mann aus den Albträumen meines
Sohnes, der jetzt auch in meinen eigenen vorkommt.

Ich gebe Emmie den Vormittag frei und bringe Sam selber
zum Hort. Alle hundert Schritte bleibe ich stehen und suche
die Straße nach dem Augenpaar ab, dessen Blicke ich auf uns
spüre. Sam fragt nicht, warum ich stehen bleibe. Er nimmt
einfach meine behandschuhte Hand in seinen Fäustling und
hält sie fest, selbst als wir in Blickweite seiner Freunde auf
dem eingezäunten Spielplatz kommen, zu der Stelle, an der er
normalerweise losrennen würde.
»Bis später«, sagt er. Ich will eigentlich das Gleiche erwi-
dern, aber stattdessen rutscht mir ein »Ich hab dich lieb« he-
raus. Sogar das lässt Sam heute zu.
»Ebenso«, sagt er und boxt mir gegen den Arm, bevor er
hinter den Türen des Horts verschwindet.
Auf dem Stuhl in meinem Büro wartet ein neuer Karton mit
Video-Kassetten. Noch mehr Kabel-TV-Freakshows, Partner-
tausch- und Amateur-Snuff-Videos mit Titeln wie Sturz in die
Tiefe!und Tödliche Tiere!.Aber wirklich beunruhigend ist,
was ich darunter finde. Eine Post-it-Notiz der Chefredakteu-
rin. Muss Sie sprechen. Es ist die längste Korrespondenz, die
ich je mit ihr hatte.
Das Büro der Chefredakteurin ist ein Glaskasten in der
Nachrichtenredaktion, in der Ecke, die am weitesten von
meinem Arbeitsplatz entfernt ist. Aber das ist nicht der Grund,
warum ich so selten Kontakt mit ihr habe. Sie ist eine Me-
mo-Schreiberin, Vorstandssitzungsteilnehmerin und Werbe-
kunden-Lunchpartnerin und keine echte Chefin, die für die
Mitarbeiter da ist. Sie ist jedoch so erfolgreich, dass Head-
hunter großer amerikanischer Fernsehsender Gerüchten zu-
folge versuchen, sie abzuwerben. Sie ist gerade mal acht-
undzwanzig.
Zurzeit jedoch ist sie außerdem diejenige, die beim Natio-
nal Star für das Heuern und Feuern verantwortlich ist. Und als

ich mich ihrem (angeblich kugelsicheren) Glaskasten nähere,
ist mir durchaus bewusst, dass sie mehr zu Letzterem neigt.
»Patrick. Setzen Sie sich«, sagt sie, und es klingt wie ein
Hundehalterkommando, dem ich unverzüglich gehorche. Sie
hebt den Zeigefinger, ohne mich anzusehen. Eine Geste, die
andeuten soll, dass sie mitten in einem Gedanken ist, dass sie
den halb fertigen Satz, an dem sie sitzt, unbedingt noch zu
Ende bringen möchte. Ich sehe zu, wie sie synergetischer
Einnahmenfluss eingibt und auf eine Taste tippt, worauf das
unvollendete Memo durch einen Bildschirmschoner mit tahi-
tischen Strandmotiven ersetzt wird.
»Ich bin sicher, Sie wissen, warum Sie hier sind«, sagt sie,
wendet sich mir zu und mustert mich kurz. Offenbar enttäu-
sche ich sie, wie erwartet.
»Nein, ehrlich gesagt nicht.«
»Es hat eine Beschwerde gegeben.«
»Von einem Leser?«
Die Chefredakteurin lächelt. »Nein, kein Leser. Eine rich-
tige, echte Beschwerde. Sehr echt sogar.«
»Von wie echt reden wir denn?«
Sie verdreht die Augen zur Decke, um anzudeuten, dass sie
einen Posten ganz oben auf der Leiter meint. So weit oben,
dass sie es nicht wagt, den Namen auszusprechen.
»Wir müssen den Gesamtkonzern im Blick behalten.
Unsere Marken. Und wenn eine dieser Marken durch eine
Tochter aus dem eigenen Haus unterminiert wird …« Sie lässt
den Gedanken unvollendet, als wären seine Konsequenzen zu
unappetitlich, um sie auch nur in Erwägung zu ziehen.
»Sie sprechen von der MegaStar!-Rezension.«
»Sie war äußerst ärgerlich. Die Leute waren bestürzt.«
»Sie wirken nicht sehr bestürzt.«
»Bin ich aber.«
»Das heißt, die Sache ist ernst.«

»Es gab Anrufe aus gewissen Büros, die ich nicht gern be-
komme.«
»Sollte ich meinen Anwalt anrufen?«
»Sie haben einen Anwalt?«
»Nein.«
Die Chefredakteurin streicht eine widerspenstige Strähne
aus der Stirn, eine knappe, aber dezidiert weibliche Geste, die
sie mir, wie ich zu meinem Bedauern gestehen muss, ein
bisschen sympathisch macht.
»Dann sind wir uns in der Sache einig?«
In Anbetracht des vorausgehenden Gespräches wäre diese
Frage komisch, wenn meine Antwort nicht Ja lauten würde.
Sie hat sich vollkommen klar ausgedrückt.
Auf dem Rückweg zu meinem Arbeitsplatz bleibe ich vor Tim
Earhearts Schreibtisch stehen. Ich hatte eigentlich nicht er-
wartet, ihn hier anzutreffen. Für gewöhnlich arbeitet er lieber
in dem stinkenden, schmierigen Bunker, der unter dem Na-
men Raucherzimmer firmiert. Tim sieht sich selbst nicht als
Raucher, obwohl er Zigaretten essen würde, wenn er sie nicht
rauchen könnte, vor allem im Wettlauf mit einer Deadline.
Und so müsste es eigentlich auch heute sein, bei all dem Ge-
rede von einem möglichen Serienmörder, der frei in der Stadt
herumläuft. Aber da sitzt er und wirft seine Reporterwerk-
zeuge - Stift, Notizblock, Diktafon und Digitalkamera - in den
Rucksack, den er, komplett mit Einschussloch, aus Afghanis-
tan mitgebracht hat. Eine Requisite, die ihm, wie er sagt, mehr
»Praktikantinnen-Action« eingebracht hat, als er bewältigen
kann.
»Hat sie dich gefeuert?«, fragt er. Das ist die erste Frage,
die jedem gestellt wird, der beim Verlassen des Büros der
Chefredakteurin gesehen wurde.
»Noch nicht. Wohin willst du?«

»Ward’s Island. Man hat einen der beiden Vermissten ge-
funden.«
»Wen?«
»Die Ulrich. Jedenfalls gut ein Dutzend Teile von ihr.
Verteilt über einen dreißig Meter breiten Strand.«
»O mein Gott.«
»Jawohl. Es ist ziemlich hässlich.«
»Weiß man schon, wer es war?«
»Im Augenblick heißt es, man würde allen Spuren nach-
gehen. Das bedeutet, sie haben keinen Schimmer.«
»Er hat sie zerstückelt?«
»Er. Sie.«
»Wer würde so etwas tun?«
»Jemand Böses.«
»Das ist doch Wahnsinn.«
»Oder auch nicht. Ich habe eben mit dem Profiler der Poli-
zei telefoniert. Er glaubt, dass sich hinter der Art, wie die
Leiche präsentiert wurde, ein Sinn verbirgt. Eine Art Bot-
schaft.«
»Und was will sie uns sagen?«
»Woher soll ich das verdammt noch mal wissen? ›Ich bin
hier‹, nehme ich an. ›Kommt und holt mich, ihr Arschlö-
cher.‹«
Tim wirft sich den Rucksack über die Schultern. Selbst
durch seine Pilotensonnenbrille kann man das aufgeregte
Glänzen in seinen Augen erkennen.
»Sie hat bei dir in der Nähe gewohnt, oder?«, fragt er.
»Sam hat sie erkannt. Sie hatte ein Kind in seinem Alter.
Sie sind auf denselben Spielplatz gegangen.«
»Unheimlich.«
»Kann man wohl sagen.«
»Ich nehme jetzt die Fähre. Möchtest du mitkommen?«
»Ich will dir den Spaß nicht verderben.«

»Könnte tolles Material für deinen Roman sein.«
»So ein Roman ist es nicht«, sage ich und frage mich, was
für einen Roman ich schreiben würde, wenn ich es je könnte.
Als ich um kurz nach fünf von der Arbeit aufbreche, hat der
Tag bereits seine winterliche Wendung zum Abend genom-
men. Die roten Bremslichter des sich bis zum Horizont er-
streckenden Staus auf der King Street sind die einzigen Farb-
kleckse in der Dämmerung. Die neuen Restaurants in den
ehemaligen Stofflagern sind bereits voller teuer gekleideter
Gäste, die jeder die Entsprechung meiner vierzehntägigen
Hypothekenrate hinblättern, um die exquisiten Kompositionen
eines über Nacht zum Star avancierten Kochs zu kosten. Und
was essen die Rush-Jungs heute Abend? Ein Sag Paneer und
ein Curry-Hähnchen Roti, mittelscharf, Sams Lieblingsgericht
vom Ghandi-Imbiss.
Diese Wahl des abendlichen Menüs führt jedoch dazu, dass
ich ihn sehe.
Im Ghandi herrscht der gewohnte Betrieb, Leute sitzen
entweder an einem der beiden Tische und essen aus Styro-
por-Schalen oder warten dicht gedrängt darauf, dass ihre
Nummer aufgerufen wird, damit sie die letzten paar Meter
nach Hause eilen können. Die Luft ist voller Dampf von den
auf dem Herd vor sich hin blubbernden Curry-Pfannen, den
ohne Deckel kochenden Kartoffeln und dem Atem der ver-
sammelten Gäste. Deshalb sind die Fenster zur Queen Street
beschlagen, Kondenswasser tropft von den Scheiben, sodass
die Passanten zu einer einzigen, sich ständig wandelnden
Form verschmelzen.
Meine Nummer wird aufgerufen. Nachdem ich mich von
der Seite zum Tresen vorgedrängt habe, löst Platzangst milde
Panik in meiner Brust aus. Einer dieser kurzen Bei-
nahe-Anfälle, mit denen ich auf meinem Weg durch die Stadt

ein paarmal am Tag zu kämpfen habe. Meistens gewinne ich,
indem ich mir sage, dass ich weitermachen muss. Einfach tun,
was als Nächstes anliegt - Essen bezahlen - und als Über-
nächstes - Tüte nehmen, umdrehen und zur Tür drängeln-, und
alles wird gut.
An der Tür bleibe ich stehen, um meine Handschuhe aus
der Manteltasche zu ziehen, sodass ich ein letztes Mal durch
die beschlagene Scheibe schauen kann.
Es ist nur ein dunkler Umriss unter anderen dunklen Um-
rissen, aber ich weiß, dass er es ist.
Er steht unbeweglich auf der anderen Straßenseite, wäh-
rend die anderen Passanten sich an ihm vorbeidrücken. Er
überragt alle.
Als ich die Tür aufstoße und die Straße plötzlich deutlich
vor mir sehe, dreht William mir den Rücken zu und reiht sich
in den Strom eiliger Fußgänger ein.
Ich habe sein Gesicht nicht deutlich gesehen. Nicht das
macht mich so sicher. Es ist seine Präsenz, eine bedrohliche
Energie, die er so intensiv ausstrahlt, dass ich ein paar Zenti-
meter zurückweiche und mich an der Tür abstützen muss.
Selbst als er schon um die nächste Ecke gebogen und außer
Sichtweite ist, stehe ich noch immer gegen die Tür gelehnt da,
als ob die Luft in schwarzes Wasser verwandelt worden wäre,
dessen schlammiges Gewicht mir den Atem raubt.
Jemand drückt von innen gegen die Tür, ich trete zur Seite
und murmele eine Entschuldigung. Um mich herum setzen
kriechende Autos und hastende Passanten ahnungslos ihren
Heimweg fort. Das liegt womöglich daran, dass er gar nicht
da war. Vielleicht eine Halluzination. Die Düsternis, die bru-
talen Neuigkeiten und mein leerer Magen haben mir einen
Streich gespielt.
Aber das sind bloß Erklärungen, die ich brauche, um meine
Beine wieder in Gang zu setzen. Denn das, was ich gerade

gesehen, gerade gefühlt habe, war kein Produkt meiner Fanta-
sie. Ich bin mir nicht mal sicher, dass ich Fantasie habe.
Es war William, der mich beobachtet hat, und das bedeutet,
William verfolgt mich.
Es gibt natürlich noch eine weitere Möglichkeit.
Eines Tages werde ich zurückschauen und erkennen, dass
der heutige Abend, vor dem Ghandi mit einer Plastiktüte mit
Essen in der Hand, der erste Schritt in den Wahnsinn war.
Sam und ich essen unser Mahl bei Kerzenlicht und gönnen
uns das gute Silber und die Weingläser, die Tamara und ich
zur Hochzeit bekamen, einfach so. Curry auf dem Teller, Bier
und Ginger-Ale in den Kristallkelchen. Wir reden über Dinge,
die ihn beschäftigen. Die Nachwuchsschläger, die seinen Hort
terrorisieren. Ein Kind, das auf dem Spielplatz eine allergi-
sche Reaktion hatte und dessen Gesicht »fett und rot gewor-
den ist wie ein Riesenpickel«, bevor es von einem Kranken-
wagen abtransportiert wurde.
Ich gebe mir alle Mühe, jede dieser Ängste abzufedern.
Aber gleichzeitig ringe ich mit meinen eigenen Albtraumbil-
dern. Der Warnschuss der Chefredakteurin. Das Bild von Ca-
rol Ulrich im Fernsehen, der Frau, die aussieht wie Tamara.
Teile von ihr, die man an dem Strand gefunden hat. Und von
diesen Gedanken komme ich auf die größeren weltpolitischen
Sorgen der Zeit. Die eingestürzten Türme. Schläferzellen,
Ausweichziele, und das aus afghanischen Höhlen abgegebene
Versprechen weiteren Ärgers. Unsere Ecke der Welt ist zu-
nehmend weniger sicher, je reicher sie wird.
Nach einer Weile erscheinen mir das, wovon Sam spricht,
und das, was mir dabei in den Sinn kommt, wie Aspekte der-
selben Beobachtung. Selbst hier, sagen wir. Selbst hier kann
das Böse dich finden.

Natürlich erzähle ich Sam nicht, dass ich auf dem Nach-
hauseweg William auf der Straße gesehen habe. Mir fällt auf,
dass ich ihm nicht nur William verschweige. Seit ich ange-
fangen habe, zu den Treffen bei Conrad White zu gehen, habe
ich den Kensington-Kreis aus seiner Welt herausgehalten. Es
würde Sam nicht interessieren. Die Dienstagabende, an denen
Emmie länger bleibt, weil Daddy ausgeht und irgendwelche
Erwachsenensachen macht, waren so harmlos, so langweilig,
dass es den Atem nicht lohnte, den es gebraucht hätte, es ihm
zu erklären.
Trotzdem ist es anstrengend, ein bestimmtes Thema unter
der Decke zu halten. Was in dem Schreibzirkel passiert, ist zu
einem Geheimnis geworden. Und wie die meisten Geheim-
nisse soll es ebenso sehr schützen wie vertuschen.

9
Am folgenden Dienstag komme ich früher, um Conrad White
für einen Moment unter vier Augen zu sprechen. Ich beginne
mit einer unwiderstehlichen Schmeichelei. Jedenfalls habe ich
es immer unwiderstehlich gefunden, auch wenn ich nur selten
in den Genuss kam.
»Ich bin froh, dass es dir gefallen hat«, sagt der alte Mann
zu meinem Lob von Jarvis und Wellesley. »Es hat mich eini-
ges gekostet.«
»Die Kontroverse.«
»Das auch, ja«, sagt er und sieht mich an, um abzuschät-
zen, wie viel ich möglicherweise weiß. »Es wäre eine Lüge,
zu behaupten, dass meine Verbannung mir keine Unannehm-
lichkeiten bereitet hätte. Aber ich dachte eher daran, was es
mich gekostet hat, das Ding überhaupt zu schreiben.«
»Es ist anstrengend. Der Prozess. Ich meine, er muss an-
strengend sein.«
»Nicht unbedingt. Das Buch ist mit der Leichtigkeit aus
mir herausgesprudelt, mit der man im Beichtstuhl seine Sün-
den bekennt. Und das war rückblickend mein Fehler. Ich hätte
etwas zurückhalten, für später aufbewahren sollen. Die kom-
plette Enthüllung unseres Ichs ist einer langen Karriere nicht
förderlich.«
Conrad White stellt die Stühle in dem gewohnten Kreis
auf. Selbst diese kleinere Aufgabe lässt ihn keuchen. Ich will
ihm helfen, aber er winkt ab.

»Ich schätze, in gewisser Weise ist man doch bestimmt
auch dankbar, da raus zu sein«, sage ich und erwarte bereit-
willige Zustimmung. Stattdessen versteift der alte Mann die
Knie, als würde er sich wappnen, einen Schlag einzustecken
oder auszuteilen.
»Wo raus?«
»Na ja, aus dem ganzen Spiel. Dem öffentlichen Urteil
ausgesetzt zu sein. Aufmerksamkeit/Nichtbeachtung,
Lob/Kritik. Was man Lohn und Preis des Ruhmes nennt.«
»Das ist ein Irrtum. Ich würde alles tun, um es wieder zu
haben. Genau wie du, vermute ich, alles tun würdest, um es zu
bekommen.«
Ich will widersprechen - wie kann er wissen, was ich will?
-, als er tief seufzt und sich wieder auf seinen Stuhl sinken
lässt.
»Und«, sagt er und zeigt mir seine nikotingelben Schnei-
dezähne, um einen Themenwechsel zu signalisieren. »Fandest
du unsere Treffen erbaulich?«
»Es war interessant.«
»Deinen Texten entnehme ich, dass du von Beruf Kritiker
bist.«
»Ich werde dafür bezahlt fernzusehen.«
»Und was hält dein unter Niveau beschäftigter, kritischer
Sachverstand von deinen Mitschülern?«
Conrad White verzieht die Mundwinkel zu einem richtigen
Lächeln. Seine Frage ist ein amüsantes Ausweichmanöver.
Und gleichzeitig ein Test.
»Eine bunte Mischung. Wie zu erwarten«, sage ich. »Ich
finde, es gibt ein paar durchaus verdienstvolle Stücke.«
»Ein paar?«
»Nein, nicht ein paar.«

Conrad White beugt sich vor. Sein Lächeln erlischt so
schlagartig, dass ich mir nicht mehr sicher bin, dass es über-
haupt da war.
»Man weiß nie, wer es haben könnte«, sagt er.
»Was?«
»Das, was dich Woche für Woche wieder hierhertreibt,
obwohl du kein bisschen daran glaubst, dass irgendetwas, was
ich oder einer der anderen sagen könnte, dir helfen wird. Der
Grund dafür, dass du jetzt hier sitzt.«
»Und der wäre?«
»Du willst wissen, ob sonst noch jemand so verstrickt ist
wie du.«
»Verzeihung. Ich fürchte, ich kann nicht folgen.«
»Worauf es ankommt, ist einzig und allein die Geschichte.
Und trotzdem schwafeln wir die meiste Zeit über Motive,
Symbole, den politischen Kontext oder strukturelle Spielerei-
en. Warum?« Das Lächeln des alten Mannes kehrt zurück.
»Ich glaube, das tun wir, um uns von den Unzulänglichkeiten
unserer eigenen Erzählung abzulenken. Wir vermeiden es,
über Geschichten als Geschichten zu sprechen, aus demselben
Grund, aus dem wir es vermeiden, über die Unvermeidlichkeit
des Todes nachzudenken. Es kann unangenehm sein. Es tut
weh.«
»Ich glaube, die Geschichte, die Angela erzählt, handelt
vom Tod.«
»Wie die meisten Geistergeschichten.«
»Wie viel davon wohl wahr ist?«
»Vielleicht solltest du dich eher fragen, wie viel du davon
zur Wahrheit gemacht hast.«
»Das liegt doch nicht an mir.«
»Nicht?«
»Es ist ihre Geschichte, nicht meine.«
»Das sagst du.«

»Wir sprechen über Angela.«
»Wirklich? Ich dachte, wir sprechen über dich.«
Es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, Conrad Whi-
te hätte mich damit nicht auf dem falschen Fuß erwischt. Na-
türlich liegt er richtig mit seiner Vermutung: Ich bin verstrickt
(wie er es nannte) in Angelas Geschichte. Doch letztlich
überrascht mich nicht die Intelligenz des Mannes, sondern
dass er mich, uns, seine zerlumpte Gruppe von Buchflücht-
lingen so sehr durchschaut hat. Er weiß, dass ich bei den
Treffen von Anfang an nur geblufft habe, genau wie er weiß,
dass Angela die Geschichte hat, »auf die es ankommt«. Für
Leute wie ihn und mich jedenfalls. Popcorn-Knabberer,
TV-Zapper, Taschenbuch-Verschlinger. Das hungrige Publi-
kum.
Es klopft. Conrad White erhebt sich. Ich höre, wie Len ihm
begeistert von einem Durchbruch in seiner Zom-
bie-Apokalypse erzählt (»Ich habe es in einem Gefängnis an-
gesiedelt, denn wenn die Toten sich erheben, sind die Gefan-
genen die Ersten, die zu Zombies werden, während die Ge-
sellschaft, die sie verurteilt hat, rein gar nichts dagegen tun
kann!«). Gefolgt von Ivan, der sich an den beiden vorbei-
drückt und sich mir gegenüber setzt. Ich nicke ihm zu, doch
seit unserem Gespräch vor der U-Bahn-Station tut er so, als
sähe er mich nicht. Damit bleibt mir, seine auf den Knien lie-
genden Hände zu betrachten. Zu groß für die Handgelenke,
mit denen sie verbunden sind, wirken sie wie von einem
komplett anderen Körper genommen, aus einem Grab geraubt.
Ein Eindruck, der mich an Ivans Schilderung erinnert, wie es
ist, beschuldigt zu werden, jemandem etwas getan zu haben.
Diese Hände könnten mühelos Schaden anrichten. Ganz für
sich allein.
Der Rest des Kreises trifft in einem Rutsch ein. Petra
nimmt auf dem Stuhl neben Len Platz und lauscht höflich

seinen Ausführungen darüber, wie man Untote enthauptet.
Angela schiebt sich an Evelyn und Conrad vorbei und setzt
sich neben mich. Wir lächeln uns zur Begrüßung zu, was mir
den bisher direktesten Blick in ihr Gesicht erlaubt. In dem
halbdunklen Raum wirken Gesichter oft schon auf einen Me-
ter Entfernung verzerrt, offen für Fehldeutungen. Nun jedoch
sehe ich sie mehr oder weniger so, wie sie ist. Was mir auf-
fällt, ist jedoch kein Aspekt ihrer Erscheinung, sondern die
entwaffnende Gewissheit, dass sie mich mit einer Genauigkeit
studiert, die alles übertrifft. Sie ist nicht verträumt oder
schüchtern. Sie arbeitet.
William kommt als Letzter. Ich zwinge mich, ihn länger als
nur flüchtig anzusehen, um meinen Verdacht, dass er es war,
der mich vor dem indischen Restaurant beobachtet hat, zu
bestätigen oder zu zerstreuen. Er hat auf jeden Fall die richti-
ge Größe. Trotzdem bin ich mir nicht sicher. Sein Bart ist
noch dichter geworden, sodass man die Konturen seines Ge-
sichtes nicht mehr ausmachen kann. Und anders als bei An-
gela enthüllt ein direkter Blick in seine Augen nichts. Wäh-
rend sie wach und rege ist, wirkt William leblos. Er strahlt
nicht mehr Mitgefühl aus als die Zombies in Lens Geschich-
ten.
William setzt sich, und wir rutschen alle ein paar Zentime-
ter von ihm weg, was jedem von uns auffällt. Der Instinkt, mit
dem sich die Herde über die Anwesenheit eines Wolfes ver-
ständigt.
Es ist unser vorletztes Treffen, deshalb will Conrad White
möglichst viele von unseren Texten durchnehmen. Wir be-
ginnen mit Ivan, der seine Rattenfigur in die Tunnel unter der
Stadt führt, wo sie die Menschen auf den Bahnsteigen mit
derselben Abscheu betrachtet wie diese das über die Gleise
huschende Ungeziefer. Evelyn lässt ihre Studentin nach der
Vögelei mit dem Professor zum Wochenendhaus der Familie

zurückkehren und nachts zu einer Insel schwimmen, nackt
und »vom Mondlicht getauft«. Petras Familiendrama endet
damit, dass ihre weibliche Hauptfigur einen mutigen Anruf
bei einem Scheidungsanwalt macht. Und ich setze meinen
Bericht eines frustrierten Fernsehkritikers eben so weit fort,
wie die Spielregeln es erfordern.
Dann kommt Angela. Nachdem ich das Diktafon einge-
schaltet habe, ist es, als würde ich ihre Lesung vor allem spü-
ren. Als ob ich in ihr wäre, gleichzeitig getrennt und ver-
schmolzen wie siamesische Zwillinge. Und diesmal ist da
auch noch etwas Neues, eine knisternde Spannung in dem
Raum, der uns trennt, die ich zum ersten Mal rein körperlich
deute. Eine buchstäbliche Anziehung. Ich möchte näher bei
ihrem Mund sein, möchte Wange an Wange mit ihr auf die
vollgeschriebenen Seiten blicken, von denen sie abliest. Es
kostet mich eine bewusste Anstrengung, mich nicht an sie zu
lehnen.
Nachdem sie geendet hat, ist William an der Reihe. Dies-
mal hat er tatsächlich etwas mitgebracht. Bald wünschen wir
alle, er hätte es nicht getan.
Mit seiner monotonen Stimme beginnt er seine Erzählung
von »dem Sommer, als etwas zerbrach« im Leben eines Jun-
gen, der »im ärmsten Viertel einer armen Stadt« aufwuchs.
Der Junge ohne Freunde mied sein Zuhause, wo sein Vater
trank und seine Mutter »im Schlafzimmer ihren ›Tagesjob‹
machte, wie sie es nannte«, und streifte durch die staubigen
Straßen, gelangweilt und wütend, als wäre er »unter etwas
Schwerem begraben, unter dem er nicht hervorkriechen
konnte«.
Eines Tages nahm der Junge die Katze des Nachbarn mit in
einen Schuppen am Ende eines leeren Hofes und häutete sie
bei lebendigem Leibe. Die Schreie des Tieres sind »das Ge-
räusch, das er machen würde, wenn er könnte. Aber er hat

noch nie in seinem Leben geweint. Es ist etwas, was ihm
fehlt. Ihm fehlt alles«. Nachdem er die Katze begraben hat,
lauscht der Junge, wie eine Frau nebenan abends den Namen
ihres Haustiers ruft, und erkennt, dass »das etwas war, was er
konnte, etwas, worin er gut war. Er konnte Sachen wegma-
chen«.
Der Rest der Geschichte erzählt in demselben gleichgülti-
gen Tonfall vom fortschreitenden Aufstieg des Jungen von
Katzen über Hunde zu einem Pferd in einem Stall am Rand
der Stadt, »weil er sehen wollte, ob es voll Klebstoff war,
denn er hatte gehört, dass man tote Pferde dazu verarbeitete«.
Schließlich verstößt Conrad White gegen seine eigene Re-
gel. Er unterbricht William mitten im Vortrag.
»Vielen Dank. Ich fürchte, die Zeit ist um«, lügt der alte
Mann und streicht mit zitternder Hand seine wenigen verblie-
benen Strähnen nach hinten. »Vielleicht können wir bei unse-
rem letzten Treffen auf Williams Text zurückkommen.«
William faltet seine Zettel zusammen und schiebt sie wie-
der in seine Jeanstasche. Er sieht die anderen an, die jetzt alle
aufstehen und ihm den Rücken zuwenden. Vielleicht bin ich
der Einzige, der sich nicht rührt. Und auch wenn ich nicht
sagen kann, dass ich in seinem Gesichtsausdruck irgendeine
Veränderung bemerke, spüre ich einfach, dass es William
war, der mich neulich abends von der anderen Straßenseite
aus angestarrt hat. Er hatte die gleiche grausame Ausstrahlung
wie jetzt. Eine Ruhe, die nicht von Zufriedenheit kündet,
sondern davon, dass ihm wie dem Jungen in seiner Geschichte
alles fehlt.
Nach dem Treffen erinnert Len mich an unseren Plan, bei
der Präsentation der neuen Literaturzeitschrift und dem Open
Mike in einer Kneipe in der College Street vorbeizuschauen.
Er schlurft mir ein paar Schritte voraus, um einen guten Platz

zu ergattern, und fragt mich auf dem Weg, ob mir irgendwas
zwischen Evelyn und Conrad White aufgefallen ist.
»Irgendwas?«
»Ich weiß nicht. Sie tuscheln ständig miteinander. Und
werfen sich Blicke zu.«
»Ist mir gar nicht aufgefallen.«
»Was glaubst du, bei wem sie gerade ist?«
»Du meinst …«
»Beantworte meine Frage.«
»Bei Conrad?«
»Das ist doch irgendwie krank.«
»Er ist mindestens vierzig Jahre älter als sie.«
»Ich hab’s dir gesagt.«
»Woher weißt du das?«
»Gar nicht. Aber was ist ein Schreibzirkel ohne einen klei-
nen Skandal?«
Der Open Mike findet in einem langen, holzgetäfelten Raum
über einem mexikanischen Restaurant statt, wo es nach Sä-
gemehl und aufgewärmten Bohnen riecht. An der Tür kaufen
Len und ich jeweils ein Exemplar des angebotenen Magazins
namens Brain Pudding und erwerben damit auch den
Bier-Rabatt.
»Ist ja nicht viel los hier.«
»Da draußen läuft ein Serienmörder frei herum«, sagt Len.
»Da bleiben die Leute gern mal zu Hause und bestellen eine
Pizza.«
»Wovon redest du?«
Len wirft mir einen verzweifelten
Lebst-du-hinter-dem-Mond-Blick zu.
»Der vermisste Frisör«, sagt er.
»Ronald Pevencey.«

»Die Polizei hat seine Leiche heute Nachmittag in einem
Müllcontainer in Chinatown gefunden. In Einzelteilen. Genau
wie die der Frau auf Ward’s Island. Deshalb nimmt man jetzt
an, dass es derselbe Typ war. Zwei sind eine Serie. Deshalb
Serienmörder. Und das ist schlecht fürs Geschäft.«
»Na, dann müssen wir uns alle Mühe geben, der Gastro-
nomie zu helfen«, sage ich und bestelle eine Runde.
Der Moderator des Abends bedankt sich für unser Kom-
men. Bevor die Bühne für jeden offensteht, hat er jedoch noch
eine besondere Ankündigung zu machen. Herzlichen Glück-
wunsch an eine der Autorinnen von Brain Pudding, Rosalind
Canon, ein unscheinbares Mädchen, das zwischen unschein-
baren Jungs in der ersten Reihe sitzt. Offenbar hat sie an die-
sem Vormittag erfahren, dass das Manuskript ihres ersten
Romans in New York zur Veröffentlichung angenommen
wurde. Ein regelrechter Bieterkrieg. Weltrechte verkauft. Plus
eine Option für die Verfilmung.
»Und als ob all das noch nicht reichen würde«, fährt er
fort, »hat sie heute auch noch Geburtstag! Herzlichen Glück-
wunsch zum Vierundzwanzigsten, Rosalind.«
Der Moderator tritt einen Schritt vom Mikro zurück, strahlt
Rosalind an und beginnt zu klatschen.
Und im nächsten Moment geschieht etwas sehr Interessan-
tes.
Der Luftdruck im Raum sinkt, es ist wie die plötzliche
Leere vor einem Gewitter. Außer dem Klatschen des Mo-
derators hört man nur unseren angehaltenen Atem, der jeden
Einzelnen von uns bloßstellt. Wir fühlen uns ertappt. Bei allen
Unterschieden, was Alter, Kleidung und Genre betrifft, so
träumt doch jeder von uns davon, Schriftsteller zu sein. Aber
im Augenblick wünschen wir uns noch mehr, Rosalind zu
sein. Ein plötzlich aufwallender, noch unbewusster Neid ist zu
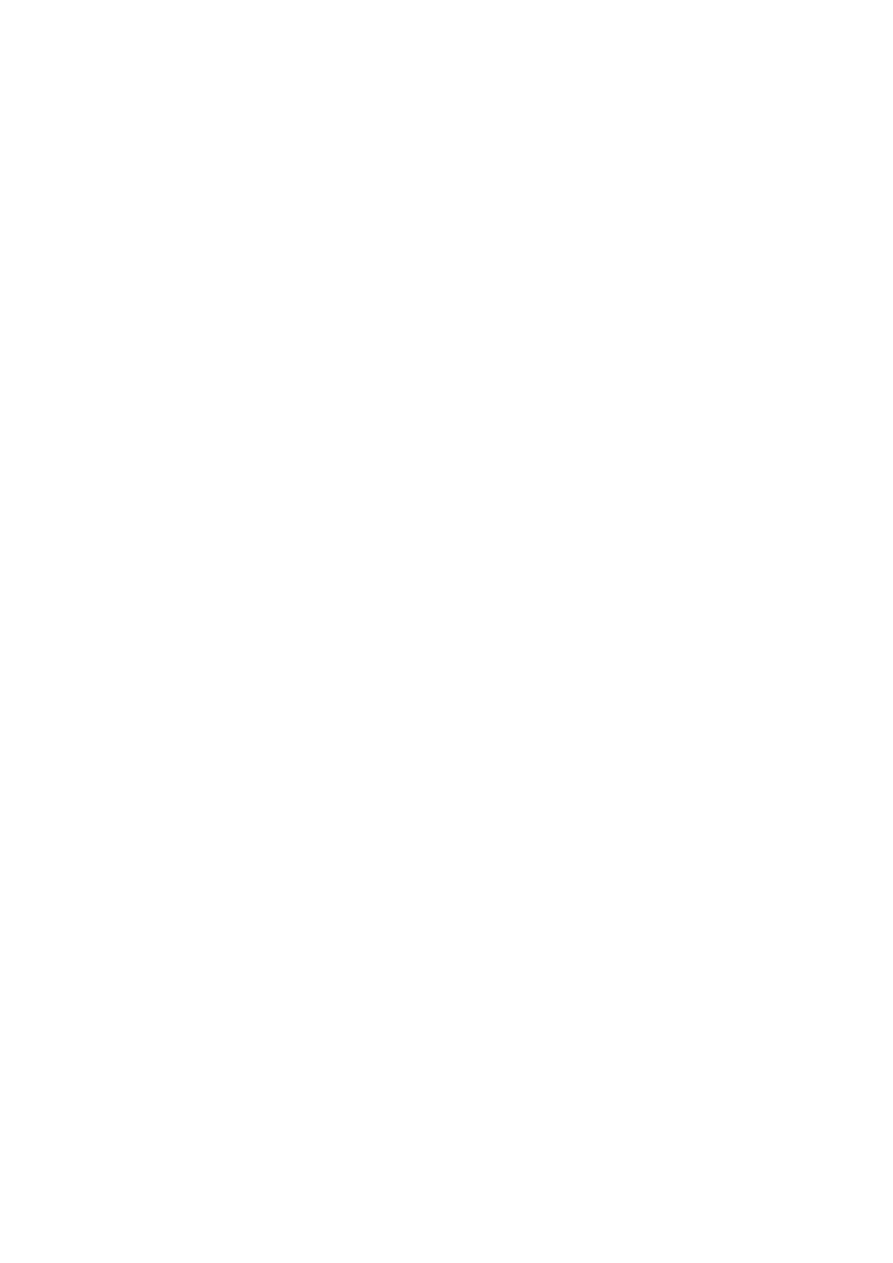
spüren, der stark genug ist, die ganze Atmosphäre zu vergif-
ten.
Erst als unsere Hände den erhaltenen Befehl endlich um-
setzen, stimmen wir in den Applaus ein. Johlen, Pfeifen und
herzliche Glückwünsche, denen man die Überwindung, die sie
gekostet haben, nie anmerken würde.
»Das ist super! Wow!«, sagt Len.
»Ja. So wow super, dass ich sie umbringen könnte.«
Ich winke dem Barkeeper. Fortan bestelle ich zu jedem
Bier einen Bourbon. Das entspannt mich ein wenig. Benom-
men lasse ich das folgende Geblähe von Gedichten, gleichge-
schlechtlichen Erotika und
Ich-hasse-meine-Eltern-Geschichten an mir vorüberziehen.
Manches gefällt mir sogar. Oder zumindest bewundere ich,
dass die Autoren hier sind, sich nicht zieren, wenn sie aufge-
rufen werden, die Sperrholztreppe hinaufsteigen und es raus-
lassen. Ob gut oder schlecht, sie haben etwas geschrieben.
Und das ist mehr, als ich von mir behaupten kann.
Irgendwann später wird Rosalind Canons Name über die
Lautsprecher aufgerufen. Sie war schon öfter bei solchen
Veranstaltungen. Sie weiß sogar, wie sie die Bühne betreten
muss: leicht nachlässig, als wäre sie mit den Gedanken wo-
anders oder würde über eine sehr viel bedeutendere Frage
grübeln als Wie sehe ich aus?
Während sie vor sich hin murmelt, beschließe ich, dass ich
nach ihrer Lesung nach Hause gehe. Der erste Schwall von
gutem Willen, der mit dem Alkohol gekommen ist, verfliegt
schon wieder, und ich weiß aus Erfahrung, dass bald nur noch
Bedauern und Selbstmitleid übrig sein werden. Nur noch
einen Drink für den Fall, dass der Killer da draußen mich als
sein nächstes Opfer ausgesucht hat. Ich würde es lieber nicht
kommen sehen. Was für eine Klinge muss man verwenden,
um zu tun, was er getan hat? Vielleicht irgendwas Elektri-

sches. Oder er ist unglaublich stark. Was hatte das Monster in
Angelas Geschichte so gern getan? Menschen in Brüche ver-
wandelt.
Ich will Len gerade sagen, dass ich gehe, als mich die Er-
kenntnis stutzen lässt, dass sich die Hälfte der im Raum An-
wesenden umgedreht hat und mich ansieht.
»Tut mir leid, dich zu wecken«, sagt Len, eine Hand auf
meinem Arm. »Aber du hast geschnarcht.«
Am nächsten Morgen kommt Tim Earheart in mein Kabäus-
chen beim National Star, um mir einen Kaffee zu bringen. Es
ist der vierte an diesem Tag, dabei ist es erst kurz nach zehn.
Aber ich brauche jede Hilfe, die ich kriegen kann. Nach den
vielen Bieren und nur unwesentlich weniger Wild Turkeys am
Abend zuvor bin ich noch ganz benebelt. Ich muss ein paar
Schlucke von der brühend heißen Brühe nehmen, bevor ich
Tims Lippen lesen kann.
»Gehen wir runter eine rauchen«, sagt er schon zum zwei-
ten Mal und sieht sich um, ob uns irgendjemand belauscht.
»Ich rauche nicht.«
»Du kannst eine von mir schnorren.«
»Ich hab aufgehört. Mehr oder weniger. Ich dachte, du
wüsstest -«
Tim hebt die Hand, und eine Sekunde lang bin ich sicher,
dass er mich ohrfeigen will. Stattdessen beugt er sich dicht an
mein Ohr.
»Was ich habe, ist nicht für den allgemeinen Verzehr be-
stimmt«, flüstert er und geht Richtung Treppenhaus.
Der Keller des National Star ist die exklusive Domäne
zweier Saurierarten: Raucher und Historiker. Hier unten wer-
den die präelektronischen Daten sowie dokumentarischer
Nippes gelagert, darunter, so habe ich gehört, auch der
Schrumpfkopf des Gründers der Zeitung. Neben recherchie-

renden Doktoranden sind die einzigen Menschen, die noch
hierherkommen, die letzten Nikotinsüchtigen, eine schwin-
dende Zahl selbst unter Reportern. Die Kids, die heutzutage
von der Journalistenschule kommen, haben eher eine Yoga-
matte und eine Flasche Evian dabei als eine Schachtel Kippen
und einen Flachmann.
Damit ist der Raucherraum einer der letzten Orte im Ge-
bäude geworden, an denen man hoffen kann, ein privates Ge-
spräch zu führen. Und tatsächlich, als ich die Tür hinter mir
schließe und spüre, wie mein Magen sich angesichts des kar-
zinogenen Gestanks zusammenzieht, bin ich mit Tim Earheart
alleine.
»Sie bringen es nicht. Sie bringen es verdammt noch mal
nicht«, sagt er buchstäblich rauchend. Graue Auspuffgase
steigen aus seiner Nase.
»Wer bringt was nicht?«
»Die Nachricht.«
Ich weiß, dass Tim so besessen ist, dass von einer Story die
Rede sein muss, wenn er sich dermaßen aufregt. Und im Au-
genblick arbeitet er an der Story von Carol Ulrich und Ronald
Pevencey.
»Er hat den Zettel in der Leiche hinterlassen«, fährt er fort.
»In einem Teil der Leiche. In ihrem Kopf, um genau zu sein.
Sorgfältig getippt für denjenigen, der die Leiche finden wür-
de.«
»Und du bist im Besitz dieser Nachricht?«
»Leider nicht. Aber einer der Bullen am Tatort hat mir er-
zählt, was draufstand. Das hätte er nicht tun dürfen, aber er
hat es getan.«
»Und das hast du den Anzugträgern vorgetragen.«
»Ich hatte erwartet, dass sie die Titelseite dafür räumen
würden. Wenn das nicht der Stoff ist, aus dem man Schlag-
zeilen macht, was dann? Aber die Polizei hat Wind von der

Sache bekommen und uns angebettelt, sie unter Verschluss zu
halten. Laufende Ermittlungen, Lebensgefahr, Gefährdung
einer möglichen Verhaftung, bla, bla, bla. Deshalb bringen sie
es nicht.«
»Steht drauf, von wem es ist?«
»Es ist nicht unterschrieben. Aber ich finde, es ist ziemlich
offensichtlich, dass es nur von dem Mörder stammen kann.«
Tim drückt seine Kippe mit dem Absatz aus und hat sofort
eine neue Fluppe im Mund.
»Was steht denn drauf?«
»Deswegen erzähle ich es dir ja. Ich hatte gehofft, dass du
ein wenig literarische Einsicht beitragen kannst.«
»Du sprichst von der Nachricht eines Serienmörders, nicht
von Finnegan’s Wake.«
Tim kommt einen Schritt näher. Rauch steigt aus seinen
Haaren auf.
»Es ist ein Gedicht«, sagt er.
Die Tür zum Raucherraum geht auf, und ein Lebenslängli-
cher aus der Sportredaktion kommt herein, wirft uns einen
abschätzigen Blick zu und zündet sich eine Zigarette an. Tim
deutet mir an, die Klappe zu halten. Als ich hinausgehen will,
fasst er meinen Arm und drückt mir etwas in die Hand.
»Ruf mich später an wegen der Leafs-Tickets«, sagt er.
Und zwinkert geheimnistuerisch.
Eine Visitenkarte. Tims Schrift eng gedrängt auf der Rück-
seite. An meinem Schreibtisch lese ich den Text mehrmals
durch, ehe ich ihn zu Konfettischnipseln zerreiße und in mei-
nen Altpapier-Korb werfe.
Ich bin der Grund, auf dem du stehst.
Ich such dich heim, wenn du durch dunkle Gassen
gehst.

Nichts ist so, wie es scheint, in meinem Reich.
Die Augen schließ und sieh mich - in deinem Traum so-
gleich.
Keine große Lyrik. Nur zwei Reimpaare von kinderliedartiger
Schlichtheit, die an den einlullenden Singsang von Schlaflie-
dern erinnert. Vielleicht ist das der Punkt. Angesichts des
gruseligen Kontexts, in dem das Gedicht gefunden wurde,
wirkt sein kindlicher Ton noch bedrohlicher. Die Sorte Text,
die einem nach einmaliger Lektüre ganz oder teilweise im
Kopf hängen bleibt. Ein Gedicht, das nicht bewundert werden,
sondern in Erinnerung bleiben will.
Und was sagt uns das über den Autor? Erstens: Wer immer
für die Tat an Carol Ulrich verantwortlich ist, hat auch diese
Zeilen geschrieben. Ein Akt des Zusammenfügens, ein Akt
der Zerstückelung. Schöpfer und Vernichter in einem. Jemand
Böses, wie Tim Earheart vermutet hatte.
Zweitens wollte der Täter, dass das Gedicht gelesen wird.
Er hätte es für sich behalten können, stattdessen hat er es bei
seinem Opfer hinterlegt. Ein Mörder, der sich - wie alle Au-
toren - ein Publikum für sein Werk wünscht. Der in uns Ge-
fühle wecken, zur genauen Betrachtung einladen will, die ich
seinem Gedicht in diesem Augenblick zuteilwerden lasse. Der
verstanden werden will.
Drittens: Auch wenn es nur ein vierzeiliges Liedchen ist,
gibt es Hinweise auf eine gewisse Intelligenz des Autors.
Dass ihm überhaupt der Gedanke an ein Gedicht gekommen
ist, hebt ihn bereits auf ein kreatives Niveau über den gemei-
nen Hinterhofschlachter. Und die Komposition selbst deutet
ein gewisses Talent an. Zum einen reimt es sich. Und der
Rhythmus ist nicht zufällig. Es ist so gut, dass es seine maka-
bre Wirkung wahrscheinlich auch erzielen würde, wenn das
Gedicht nicht neben einer Leiche deponiert worden wäre.

Und dann sind da die Worte selbst.
In der ersten Zeile wird die Absicht des Gedichtes darge-
legt: Der Dichter möchte sich vorstellen. Er ist der Grund, auf
dem wir stehen. Das heißt, er ist überall. Die nächste Zeile
etabliert das Wesen seiner Präsenz als bedrohlich, feindselig,
etwas, das uns heimsucht, wenn wir »durch dunkle Gassen«
gehen. Natürlich trifft die Erwähnung von Gassen bei mir
einen besonders wunden Punkt, da ich erst vor wenigen Tagen
durch eine gerannt bin, auf der Flucht vor etwas, das wahr-
scheinlich gar nicht da war. Aber »dunkle Gassen« gelten
gemeinhin als Orte, die man fürchten muss. Er will uns mit-
teilen, dass er derjenige ist, der dort auf uns wartet.
Die dritte Zeile führt einen Ton düsterer Wunderlichkeit
ein. Wo er zu Hause ist, ist »nichts so, wie es scheint«, doch
er kann auch der Boden sein, auf dem wir stehen. Gleichzeitig
real und illusionär. Jemand, der seine Gestalt verändert.
All das wird in der letzten Zeile des Gedichtes bekräftigt.
Wenn wir ihn sehen wollen, müssen wir uns nicht an Spuren
halten, die vielleicht hinterlassen wurden, sondern an unsere
Träume. Und diese Träume sind nicht bloß imaginär, sondern
»hier«, in der realen Welt. Wir sind alle ein Teil desselben
Traums, ob es uns gefällt oder nicht. Und es ist seiner.
Erst auf dem Heimweg kommt mir noch eine andere Inter-
pretation in den Sinn, wobei »in den Sinn kommen« vielleicht
nicht drastisch genug klingt. Genau genommen, haut es mich
beinahe um. Ich muss mich, den Kopf zwischen den Beinen,
auf die Bordsteinkante hocken, damit mir nicht komplett
schwarz vor Augen wird.
Als ich mich ein wenig wieder erholt habe, spreche ich in
mein Diktafon, noch immer im Rinnstein hockend und nur
Zentimeter von den vorbeifahrenden Autos entfernt.

ABSCHRIFT BANDAUFNAHME
12. März 2003
[Verkehrsgeräusche]
Ich bin der Grund, auf dem du stehst
Buchstäblich. Wer immer das Gedicht als Erster lesen
würde, musste auf Ward’s Island sein. Auf Sand. [Mur-
meln]
O Scheiße.
[Kinder im Hintergrund]
Guck dir den Penner an! Der legt sich noch … [Autohu-
pen]
… wenn er nicht aufpasst! [Gelächter im Hintergrund]
Die Augen schließ und sieh mich –
Okay. Um ihn zu erkennen, müssen wir träumen. Aber wer
schickt uns unsere Gedanken, während wir schlafen? [ge-
sungen]
Mr. Sandman, bring me a dream …
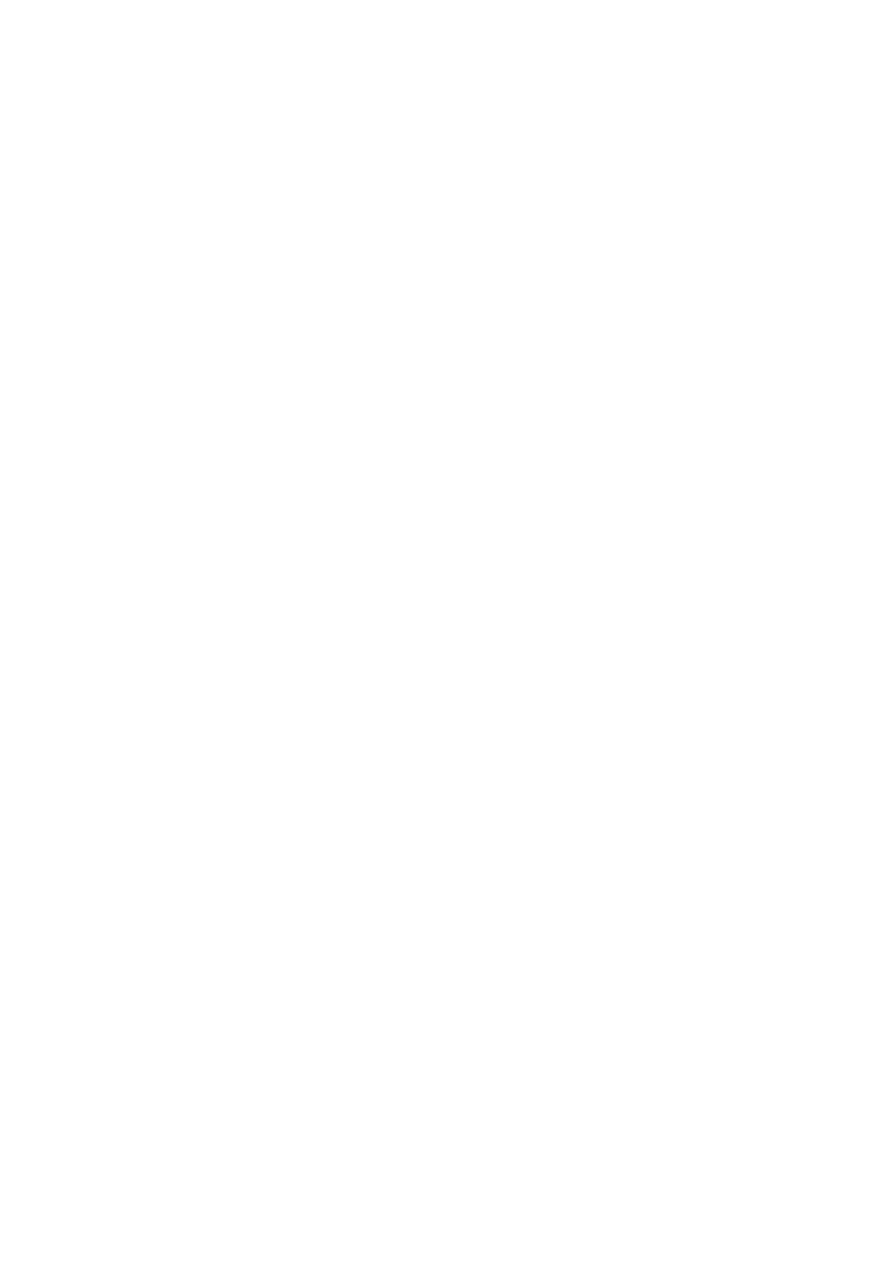
10
Angelas Geschichte
Mitschrift der 3. Aufnahme
In der nächsten Woche wurde die Schule wieder geöffnet,
obwohl das zweite Mädchen verschwunden blieb und keine
der Spuren zur Entdeckung des Urhebers dieser »abscheuli-
chen Verbrechen« führte, wie der Polizeichef der Stadt sie
nannte (was das Mädchen irgendwie an »Heu« erinnerte und
somit an das, was es im Stall gefunden hatte). Edra musste
sich in einem hundertsechzig Meilen entfernten Krankenhaus
operieren lassen. Die Gallenblase. Kein Grund zur Sorge, ver-
sicherte Jacob dem Mädchen. Edra würde auch ohne weiter-
leben können. Aber warum hat Gott uns dann überhaupt mit
einer Gallenblase ausgestattet?, fragte das Mädchen.
An einem Freitag wird Edra ins Krankenhaus gebracht,
Jacob und das Mädchen bleiben allein auf dem Bauernhof
zurück, bis Edra, wenn alles gut geht, am Sonntag wieder
nach Hause kommt. Der alte Mann und das Mädchen haben
das Wochenende für sich.
Auch wenn das Mädchen von der Aussicht auf Jakobs al-
leinige Aufmerksamkeit begeistert ist, bereitet es ihr Sorge,
dass sie nun nicht mehr zu dritt, sondern nur noch zu zweit

sind. Vielleicht hat das unsichtbare Band, das sie als Familie
verbunden hat, auch als Zauber oder Kraftfeld gedient, um
den schrecklichen Mann, der schreckliche Dinge tut, fernzu-
halten. Edras Fehlen könnte eine Tür öffnen. Um ihrer Pfle-
geeltern willen hat das Mädchen ein schändliches Geheimnis
bewahrt. Sie hat in der Nacht einen Menschen begraben und
die Albträume ertragen können. Aber sie ist nicht sicher, ob
sie die Tür vor dem Sandmann schließen kann, wenn sie erst
einmal geöffnet wäre.
Bald konnte man die Sorge in jedem Blick und jeder Geste
des Mädchens erkennen. Sosehr sie sich auch bemühte, ihre
Last zu verbergen, sie trug ihre Furcht wie einen Mantel. Ja-
cob kannte das Mädchen zu gut, um es nicht zu bemerken.
Und als er danach fragt, löst diese schlichte Frage eine Flut
von Tränen aus.
Sie erzählt ihm fast alles. Von dem schrecklichen Mann,
der schreckliche Dinge tut und der früher nur in ihren Träu-
men lebte, nun jedoch Gestalt in der realen Welt angenommen
hat. Und dass sie glaubt, dass dieser Mann die beiden Mäd-
chen aus der Stadt geholt hat, weil sie ihr ähnlich sehen und
genauso alt sind wie sie.
Sie erzählt ihm nicht, was sie im Stall gefunden und was
sie damit gemacht hat.
Nachdem das Mädchen fertig ist, sagt Jacob lange Zeit
nichts. Als er schließlich die Worte findet, nach denen er
sucht, erwartet das Mädchen, dass er ihr erklärt, dass das, was
sie berichtet hat, nicht sein kann. Aber er überrascht sie.
»Ich habe ihn auch gesehen«, sagt der alte Mann.
Das Mädchen kann es kaum glauben. Wie sah er aus? Wo
hat Jacob ihn gesehen?
»Ich könnte ihn dir genauso wenig beschreiben, wie ich
sagen könnte, welche Gestalt der Wind hat«, antwortet der
alte Mann. »Es ist etwas, das ich gespürt habe. Es streicht

ums Haus, als ob das, wonach es sucht, hier drinnen ist. Er
kann jedoch nicht eindringen. Noch nicht.«
Vielleicht sollte das Mädchen zu ihm gehen. Wenn der
Sandmann nur sie will, warum sollte sie riskieren, dass er
weiteren Mädchen etwas antut? Oder schlimmer noch - Jacob
und Edra.
»So darfst du nicht reden«, fleht Jacob sie an. »Niemals.
Verstanden? Solange ich lebe, wird er dich nicht bekommen.
Und wenn ich nicht mehr da bin, musst du ihm trotzdem wi-
derstehen. Versprich mir das.«
Das Mädchen verspricht es. Aber was bleibt ihnen zu tun?
Das Mädchen kann sich nicht vorstellen, wie sie gegen den
Sandmann kämpfen sollen. Wie kann man etwas töten, das
vielleicht schon tot ist?
»Ich weiß nicht, ob er noch lebt oder tot ist. Aber ich glau-
be, ich kann sagen, wer er ist.«
Jacob fasst das Mädchen fest an den Schultern, als wollte
er sie vor einem Sturz bewahren.
»Es ist dein Vater«, sagt er.
Nachdem Jacob sie nicht im Krankenhaus abgeholt hatte, fuhr
Edra am Sonntag mit einem Taxi nach Hause und fand das
Bauernhaus leer. Die Hintertür stand weit offen. Wenn je-
mand dort hereingekommen oder hinausgegangen war, ließ
sich das nicht mehr feststellen. In den vergangenen vierund-
zwanzig Stunden ist das ganze Land von einer neunzig Zen-
timeter dicken Schneeschicht bedeckt worden. Ein Schnee-
sturm, der den kommenden Winter ankündigt. Mögliche Spu-
ren sind längst zu breiten Schneewehen geworden.
Als die Polizei eintrifft, beschwört Edra sie panisch, das
Mädchen zu finden. Sie müssen nicht lange suchen. Es sitzt
zusammengekauert in der letzten Box des Stalls, blau gefroren
und mit glasigen Augen. Zitternd vor Unterkühlung, weil es

bei Temperaturen von unter minus zehn Grad die ganze Nacht
draußen zugebracht hat.
Man fragt das Mädchen, wo Jacob ist. Darauf fällt das
Mädchen in Ohnmacht. Man schätzt ihre Überlebenschancen
auf fünfzig zu fünfzig. Drei schwarze, erfrorene Zehen müs-
sen ihr abgenommen werden. Während sie schläft, werden
ihre Gehirnströme gemessen, um festzustellen, welche Re-
gionen möglicherweise dauerhaft geschädigt sind.
Aber das Mädchen stirbt nicht.
Als es am nächsten Tag wieder zu sich kommt, spricht es
mit niemandem außer mit Edra, und auch mit ihr nicht über
die Geschehnisse der vergangenen Tage. Edra schirmt das
Mädchen gegen die Fragen der anderen ab und stellt ihre
Sorge um ihren Mann hinter das Schutzbedürfnis des Mäd-
chens zurück. Die Polizei muss alleine nach Jacob suchen.
Nachdem feststeht, dass Jacobs Pick-up das ganze Wo-
chenende auf dem Hof geparkt war und es weder Spuren eines
Kampfes noch einen Abschiedsbrief gibt, konzentriert sich die
Suche der Polizei auf den Wald, der sich jenseits der Felder
fünfhundert Meilen weit über den Kanadischen Schild nach
Norden erstreckt.
Das Schneetreiben erschwert die Suche. Vom Hubschrau-
ber aus kann man kaum mehr als Bäume erkennen, die aus
einer weißen Decke ragen. Die Hunde, die Jacobs Fährte auf-
nehmen sollen, laufen einhundert Meter in den Wald, wo sie
bis zur Schnauze wimmernd im Schnee versinken und von
ihren Führern wieder herausgetragen werden müssen. Am
vierten Tag wird der Einsatz von einer Rettungsaktion zur
Beweissicherung heruntergestuft. Wenn man Jacob noch in
den endlosen Weiten des Waldes finden sollte, dann sicherlich
nicht mehr lebend.
Es bedarf zweier milder Wochen, bis der Schnee ge-
schmolzen ist und Jacobs Leiche freigelegt wird. Vier Meilen

von dem Bauernhof entfernt. Er liegt auf dem Bauch, beide
Arme zur Seite ausgebreitet. Außer den Schnittwunden und
Kratzern im Gesicht und an den Armen werden keine Verlet-
zungen festgestellt. Sie stammen von den Ästen, die er ren-
nend gestreift hat. Er trägt nur Socken an den Füßen und kei-
ne wetterfeste Kleidung (Stiefel und Mantel hat man im Haus
an ihrem üblichen Platz gefunden). Die Todesdiagnose lautet:
Tod durch Erfrieren nach einem Zusammenbruch infolge von
Erschöpfung. Der Gerichtsmediziner ist verblüfft, dass ein
Mann in Jacobs Alter überhaupt so weit gekommen ist. Ein
Vier-Meilen-Lauf im Schneesturm bei Nacht durch den Wald.
Dazu könne nur jemand in einem Zustand tödlicher Panik
fähig gewesen sein.
Aber die daraus folgenden Fragen konnten weder der Ge-
richtsmediziner noch die Kriminaltechniker von der Spuren-
sicherung beantworten. War Jacob vor etwas weg-oder auf
etwas zugelaufen? Wenn er der Verfolger war, welche Beute
hätte ihn, bekleidet, wie er war, beim ersten heftigen Schnee-
fall des Jahres in den Wald gelockt? Und wenn er der Ver-
folgte war, was hatte ihn genug erschreckt, so weit zu rennen,
dass er schließlich zu Boden gesunken und gestorben war,
ohne dass jemand Hand an ihn gelegt hätte?
Bei der Polizei ist man sich einig, wenn Jacob ermordet
worden ist, handelt es sich um das perfekte Verbrechen. Kein
Verdächtiger. Keine Zeugen. Keine Spuren, die der Schnee
nicht überdeckt hätte. Keine Tatwaffe außer der Kälte.
Nur das Mädchen wusste - oder könnte wissen -, was ge-
schehen war, als sie und Jacob allein auf dem Hof waren.
Aber wie oft man sie auch fragte, sie sprach nicht darüber.
Ein Schock, sagten die Ärzte. Ein extremes emotionales
Trauma. So etwas könne einem Kind die Zunge abschneiden
wie eine Klinge. Im Moment sei sie nutzlos, lautete ihr
Schluss. Man könne mit genauso viel Aussicht auf Erfolg statt

des armen Mädchens auch die Bäume im Wald befragen, was
sie gesehen hatten.
Das Mädchen hörte alles, was über sie gesagt wurde, ob-
wohl sie tat, als wäre sie taub. Sie entschied, dass es Dinge
gibt, über die man nicht sprechen kann. Aber sie wollte, was
sie wusste, in anderer Form festhalten. Sie würde es auf-
schreiben. Später, wenn sie älter und allein war, würde sie die
Wahrheit erzählen, und sei es nur sich selbst.
Hier auf den Seiten dieses Buches.
Sie weiß sogar schon, wie der Anfang lauten wird.
Es war einmal ein kleines Mädchen, das wurde verfolgt
von einem Geist...

11
»Stadt in Angst« lautet die Schlagzeile des National Star am
nächsten Tag, und das ist keine Übertreibung, zumindest was
mich betrifft. Der Artikel fasst die allgemeine Stimmungslage
zusammen, käut ansonsten aber nur bereits Bekanntes über
die beiden Opfer wider - keine Verbindung, keine bekannte
Verwicklung in Straftaten, keine Anzeichen für sexuelle Ge-
walt, keine fehlenden Wertsachen bei keiner der beiden Per-
sonen. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass ihr Mör-
der ein und derselbe ist. Es folgen Interviews mit Bewohnern
aus der Nachbarschaft, die zugeben, dass sie nicht mehr das
Haus verlassen wollen, »bis sie das kranke Schwein kriegen,
das so etwas machen würde«. Ich lese den Artikel bis zum
Ende, um zu sehen, ob das Gedicht erwähnt wird, das man bei
Carol Ulrichs Leiche gefunden hat, aber es sieht so aus, als
hätte Tim recht behalten. Die Redakteure haben es gekippt.
Als Letztes folgt eine Zusammenstellung der Aussagen
verschiedener Augenzeugen und anonymer Anrufer, die von
allem vielleicht am meisten beunruhigt. Ein gut gekleideter
Weißer mit Glatze, behauptet einer. Andere wollen zwei
Schwarze beobachtet haben - einen mit Goldzähnen und Rai-
ders-Mütze, der andere grauhaarig, freundlich, »Typ Denzel
Washington«. Zwei Männer mit Locken, »die Zwillinge sein
könnten«. Und eine ältere Portugiesin in schwarzer Trauer-
kleidung.
»Die Menschen sehen in jedem, der in der U-Bahn neben
ihnen sitzt, einen Mörder«, bemerkte ein Polizist.

Und warum auch nicht? Er könnte einer sein.
Der morgendliche Gang durch die Stadt in Angst bestätigt,
dass die Sorge in den drei Millionen auf ihrem Weg zur
Arbeit pochenden Herzen eine Schattierung dunkler geworden
ist. Wo mehrere Zeitungskästen nebeneinanderstehen, sieht
man, dass die Konkurrenz des National Starähnliche Panik-
mache-Geschichten bringt, das stets hysterische Boulevard-
blatt macht mit Fotos von Carol Ulrich und Ronald Pevencey
auf, darunter die Schlagzeile »Bist du der Nächste?«. Eine
Frage, über die man zwangsläufig nachdenkt. Jeder, der aus
den Straßenbahnen steigt oder aus den Ausgängen der
U-Bahn kommt, sieht die Titelseiten und darin sich selbst. Die
Fotos zeigen keine Gangster mit steinernem Blick oder Mit-
glieder einer Jugendgang (bei denen es einen nicht gewundert
hätte), sondern Gesichter von Menschen, deren oberstes Ziel
es ist, jeden Ärger zu vermeiden. Das ist die Sicherheit, auf
die die meisten von uns bauen: Wir gehören zur Mehrheit, die
keinen Ärger sucht. Gleichzeitig wissen wir alle, dass dies
eine zunehmend hohle Versicherung ist. Die Angst ist immer
da und sucht einen Weg an die Oberfläche.
Sosehr wir uns auch bemühen, nicht aufzufallen, manch-
mal findet der Sandmann uns doch.
Der Quotidian-Preis, liebevoll Dickie genannt, ist der am
zweithöchsten dotierte Literaturpreis des Landes. Die Ehrung
wurde von Richard »Dickie« Barnham gestiftet, einem pres-
byterianischen Pfarrer, der im Ruhestand zum begeisterten
Memoirenschreiber wurde und von den milden Verschroben-
heiten seines drolligen Pfarrhauses in Ontario erzählt. Im Jahr
vor seinem Tod kaufte er überdies ein Los, mit dem er zwölf
Millionen Dollar in der Lotterie gewann. Heute wird der Di-
ckie für ein Stück erzählender Literatur vergeben, das »das
häusliche Erbe des kanadischen Familienlebens am gelun-

gensten widerspiegelt«, was zur Auswahl von stillen, dezidiert
unglamourösen Gewinnern geführt hat, einer trübsinnigen
Parade stumpfer Farmer und Fischerswitwen.
Außerdem ist die Preisverleihung eines der großen Galaer-
eignisse der Saison. Eine Karte für den Dickie weist einen als
Mitglied der Elite des Landes aus, des Who’s Who der Coun-
try-Club-Wohltäter, TV-Gesichter und Konzernbarone. Der
Verleger des National Star hat sie noch nie versäumt. Das ist
einer der Gründe, warum jedes Jahr ein Foto des Siegers so-
wie eine atemlose Schilderung der Speisefolge einschließlich
der Abendkleider der Damen auf der Titelseite erscheinen.
Es ist die Sorte journalistischer Auftrag, für die ich nicht
mehr infrage komme. Selbst als ich noch literarischer Kolum-
nist war, hat die Zeitung lieber eines der Party-Girls aus der
Mode-&-Lifestyle-Redaktion geschickt, das nicht nur die an-
wesenden Prominenten, sondern auch die Designer kannte,
die die Garderoben kreiert hatten. Dieses Jahr hat sich die
vorgesehene Reporterin jedoch wenige Stunden vor dem
Event krankgemeldet. Die Chefredakteurin weilt in einem
ihrer Manager-Klöster außerhalb der Stadt, weshalb dem
Nachrichtenredakteur die Aufgabe zufiel, in letzter Minute
über eine Alternative zu entscheiden. Er hat mich gefragt, ob
ich den Auftrag erledigen könne. Ich habe angenommen.
Meine Presseakkreditierung erlaubt es mir, einen Gast
mitzubringen. Klug wäre es gewesen, alleine zu gehen, den
gewünschten Artikel zu schreiben und um Mitternacht im Bett
zu sein. Stattdessen rufe ich Len an.
»Du könntest irgendjemandem dein Manuskript zuste-
cken«, erkläre ich ihm.
»Meinst du?«
»Jeder Verleger der Stadt wird da sein.«

»Vielleicht besser bloß ein paar Kurzgeschichten«, ent-
scheidet er nach einem Moment. »Irgendwas, das unter meine
Jacke passt.«
Bis ich einen Frack geliehen und Len mit dem Taxi abge-
holt habe (der seinerseits einen Smoking trägt, jedoch offen-
sichtlich für jemanden gedacht, der kleiner und dreißig Pfund
leichter ist als Len), treffen wir gerade rechtzeitig im Royal
York ein, um die letzte halbe Stunde der Cocktail-Hour mit-
zukriegen.
»Guck mal!«, flüstert Len auf dem Weg in den Imperial
Room. »Da ist Grant Duguay!«
Mein Blick folgt seinem ausgestreckten Finger bis zum
Moderator des Abends. Dasselbe wachsgesichtige Katalog-
modell mit dem Lächeln eines Gebrauchtwagenverkäufers,
das auch Canadian MegaStar!präsentiert.
»Ja, das ist er.«
»Und da! Das ist Rosalind Canon!«
»Wer?«
Len sieht mich an, um sich zu vergewissern, dass ich es
ernst meine. »Die war bei der Präsentation von Brain Pud-
ding. Die Frau, die eine halbe Million für ihren ersten Roman
gekriegt hat.«
Ich bitte Len, sie mir zu zeigen. Und da ist sie, das un-
scheinbare Mädchen, das jetzt jedem Kulturbonzen und jeder
reichen Tussi die Hand schüttelt. Ich kann ihr immer gleich
ernsthaftes Danke als Antwort auf all die Glückwünsche von
ihren Lippen ablesen und wünschte, ich könnte das Gleiche zu
jemandem sagen. Ein Kellner wird reichen müssen.
»Danke«, sage ich und fische mit jeder Hand einen Martini
von seinem Tablett.
Wir nehmen am Pressetisch Platz, bevor die anderen
Lohnschreiber eintreffen. Das gibt mir Gelegenheit, eine der
beiden Weinflaschen auf dem Tisch zwischen meine Füße zu

klemmen, nur für den Fall, dass der Kellner später im Notfall
nicht erreichbar ist. Dann baut sich der MegaStar!-Typ hinter
dem Lesepult auf und erzählt etwas davon, dass das Lesen ihn
zu dem Menschen gemacht habe, der er heute ist, was eini-
germaßen glaubwürdig klingt, weil es für einen Analphabeten
schwierig wäre, vom Teleprompter abzulesen. Während das
Essen serviert wird, kommen alle nominierten Autoren nach-
einander auf die Bühne und reden über die Entstehung ihres
Werkes. Die Flasche zwischen meinen Füßen ist schon leer,
ehe das Karibu-Tatar abgeräumt wird.
Es ist absurd, und ich weiß es. Es ist oberflächlich, unbe-
gründet und spricht nicht für meinen Charakter. Denn ich ha-
be kein Buch veröffentlicht. Ich habe kein Buch geschrieben.
Ich habe nichts im Kopf, was man eines Tages zu einem Buch
machen könnte. Aber im Geiste umfassender und ehrlicher
Selbstoffenbarung beichte ich hier, was ich denke, als ich in
meinem kratzigen Frack im Imperial Room sitze und zusehe,
wie sich die Geehrten des Abends unter Wogen von Applaus
verbeugen.
Warum nicht ich?
Glück. Beziehungen. Vermarktbarkeit. Vielleicht haben sie
all das auf ihrer Seite. Aber da ist noch etwas anderes. Eine
zwingende Ordnung der Dinge, Anfang, Mitte und Ende einer
Geschichte. Und ich? Ich habe nur, was die meisten von uns
haben. Das chaotische Gestammel eines gelebten, unvoll-
endeten Lebens.
Um mich von derlei Gedanken abzulenken, beuge ich mich
zur Seite und trage Len das geheime Gedicht des Mörders vor.
Er starrt mich mit großen Augen an. Ermutigt skizziere ich
auch noch meine Interpretation der vier Zeilen, inklusive des
unwahrscheinlichen Hinweises auf die Identität des Autors.
»Du glaubst, es besteht ein Zusammenhang?«, fragt er und
wischt sich den Schweiß von der Oberlippe.

»Ich glaube, es ist eine Koinzidenz.«
»Warte, warte.« Len schiebt das vor ihm liegende Besteck
herum, als ob es die Gedanken in seinem Kopf repräsentieren
würde. »Wenn du recht hast, bedeutet das, dass derjenige, der
diese Taten begeht, entweder ein Mitglied unseres Kreises ist
oder Angelas Geschichte gelesen hat.«
»Nein, das bedeutet es nicht. Jeder kann sich der Sand-
mann nennen. Und in dem Gedicht nennt er gar keinen Na-
men. Es ist bloß eine Theorie.«
»Und meine Theorie lautet, dass es William ist.«
»Sachte. Es ist nicht -«
»Hallo! Ein Kind, das zum Spaß Katzen und Pferde aus-
nimmt? Er hat uns im Grunde erzählt, wozu er in der Lage
ist.«
»Es ist eine Geschichte, Len.«
»Manche Geschichten sind wahr.«
»Wenn das Schreiben über einen Serienmörder einen zum
Mordverdächtigen machen würde, gäb’ es im Umkreis von
zehn Blocks einhundert Freaks, mit denen die Polizei drin-
gend sprechen wollte.«
»Trotzdem. Trotzdem«, sagt Len und kaut auf seiner Lip-
pe. »Ich frage mich, was Angela davon halten würde, wenn
sie -«
»Du darfst es keinem erzählen.«
Len wirkt zutiefst betrübt. Da fällt ihm eine Horrorge-
schichte in den Schoß, und er darf nicht damit losrennen.
»Das ist mein Ernst, Len. Ich habe es dir nur erzählt, weil
-«
Warum habe ich es Len erzählt? Die Martinis haben ge-
holfen. Und vermutlich wollte ich ihn beeindrucken. Ich bin
Journalist bei einer echten Zeitung. Ich weiß Sachen. Aber vor
allem wollte ich den großen Spinner unterhalten, glaube ich.

»Weil ich glaube, dass man dir vertrauen kann«, beende
ich schließlich den Satz, auf den Len gewartet hat. Er wendet
den Blick ab, sichtlich gerührt von dem Kompliment.
Nach dem Dessert verkündet Mr. MegaStar!den Gewinner.
Und sobald ich den Namen notiert habe, bin ich weg.
»Ich muss los, Len. Die warten auf das Stück. Ich muss
schreiben wie der Blitz.«
Len beäugt meinen unangerührten Käsekuchen mit Ahorn-
sirup. »Isst du den noch?«
»Er gehört dir.«
Ich drücke Lens Schulter, als ich mich vom Tisch erhebe.
Er quittiert die Geste mit einem Lächeln, aber Fakt ist, hätte
ich seine Schulter nicht gepackt, wäre ich mit dem Gesicht
zuerst in einem vorbeischwebenden Tablett mit biberförmigen
Plätzchen gelandet.
Nachdem ich, unterstützt durch mehrere Manhattans von der
Library Bar, konzentriert ein paar Stunden auf der Tastatur
meines Laptops herumgeklappert habe, drücke ich auf Senden
und mache mich torkelnd auf den langen Heimweg. Es ist
nicht leicht. Meine Beine, die faulen Schlawiner, wollen nicht
tun, was ich ihnen sage, sondern winden Schnörkel umeinan-
der, sodass ich unvermittelt auf Parkuhren oder Mauern zu-
schwanke. Ich brauche eine halbe Stunde für zwei Blocks.
Wenigstens meine Arme scheinen noch zu funktionieren. Mit
dem einen umklammere ich einen Laternenpfahl, mit dem
anderen winke ich ein Taxi heran.
Trotz der Kälte kurble ich das Fenster herunter, während
der Wagen an den Nightclubs in der Richmond Street vorbei-
brettert, aus denen zu dieser späten Stunde verschwitzte Tele-
fonverkäufer, Verwaltungsassistentinnen und Einzelhandels-
sklaven strömen, die in die City gekommen sind, um ihren
halben Wochenlohn für Eintritt, Parkgebühren und ein halbes

Dutzend Wodka-Longdrinks auf den Kopf zu hauen. Ich hän-
ge den Ellbogen aus dem Fenster und lasse die kalte Luft
gegen mein Gesicht strömen, bis es taub ist. Schläfrigkeit
kriecht von meinen Füßen aufwärts.
Aber sie wird gleich wieder verscheucht durch die Stimme
des Nachrichtensprechers aus der Box hinter meinem Kopf.
Ich kurble das Fenster wieder hoch und höre, wie er von
einem dritten Opfer in der Mordserie berichtet, hinter der die
Polizei öffentlich auch weiterhin nicht das Werk eines Serien-
killers vermuten möchte. Die Leiche war wie die von Carol
Ulrich und Ronald Pevencey zerstückelt. Wieder eine Frau,
deren Namen die Ermittler noch nicht bekannt geben. Die
zusätzlich verwirrende Wendung besteht in diesem Fall darin,
dass die Frau erst am Vortag aus Vancouver in Toronto ein-
getroffen war. Keine bekannte Verbindung zu den beiden ers-
ten Opfern. Die Polizei muss sogar noch ermitteln, ob sie
überhaupt jemanden in der Stadt kannte.
Und dann, am Ende des Berichts, folgen die Details, die
mir das Blut in den Adern gefrieren lassen, als würde ich auf
den Dachgepäckträger geschnallt nach Hause fahren.
Die Leiche des Opfers wurde auf dem Spielplatz bei uns
um die Ecke gefunden. Der, zu dem ich immer mit Sam gehe.
Und nicht irgendwo auf dem Spielplatz, sondern in der
Sandkiste.
»Acht fuffzig«, sagt der Fahrer.
»Zu Hause. Genau. Jetzt muss ich Sie bezahlen.«
»So funktioniert das.«
Ich strecke mich stöhnend auf der Rückbank und zücke
meine Brieftasche, während der Fahrer mich darüber infor-
miert, dass die ganze Stadt verrückt geworden sei.
»Die Kids in der Schule haben Pistolen. Die Bullen kas-
sieren nebenbei. Und die Drogen? Die verkaufen Zeug, das

Leute in Roboter verwandelt. Roboter, die einem für ein Ta-
schengeld ein Messer in den Bauch rammen.«
»Ich weiß.«
»Und jetzt rennt dieser beschissene Irre rum und hackt in
drei Wochen drei Leute in Stücke. Drei Wochen! Macht der
keinen Urlaub oder was?«
Ich gebe dem Fahrer ein Stück Papier, das in der Dunkel-
heit und bei meiner von Manhattans vernebelten Sicht ebenso
gut ein Zwanzig-Dollar-Schein wie der Abholzettel der Rei-
nigung sein könnte. Was immer es ist, er wirkt zufrieden.
»Ich fahr schon seit acht Jahren nachts«, sagt er, als ich mit
der Schulter die Tür aufstoße und auf die Straße purzle. »Aber
ich hatte noch nie zuvor Angst.«
»Na, dann passen Sie auf sich auf.«
Der Fahrer mustert mich von oben bis unten. »Wie wär’s,
wenn Sie erst mal auf sich aufpassen.«
Ich sehe dem Taxi nach, bis seine Bremslichter verschwunden
sind. Schneeflocken scheinen im Licht der Laternen stillzu-
stehen.
Im nächsten Augenblick packt mich die Gewissheit, dass
ich mich nicht umdrehen darf. Nicht, wenn ich die Illusion
bewahren will, dass ich alleine bin. Also gehe ich auf meine
Haustür zu. Und bemerke, dass schon jemand vor mir diesen
Weg genommen hat.
Stiefelabdrücke mindestens zwei Größen größer als meine.
Sie führen über den handtuchbreiten Rasen im Vorgarten zu
dem schmalen Gang zwischen unserem Haus und dem Nach-
barhaus.
Zumindest glaube ich, dass das die Fährte ist, der ich folge.
Als ich wieder hinschaue, sind beide Abdrücke, meine und die
der Stiefel, schon wieder von puderigem Schnee bedeckt.
Ich bin der Grund, auf dem du stehst …

Ich könnte meinen Schlüssel aus der Tasche ziehen, die
Haustür aufschließen und meine Ängste hinter mir lassen.
Stattdessen treibt mich irgendetwas zu dem unbeleuchteten
Gang zwischen den beiden Häusern. Wenn dort eine Gefahr
lauert, ist es meine Aufgabe, mich ihr zu stellen. Egal, wie
unsicher ich auf den Beinen bin. Egal wie ängstlich.
Aber in dem Gang ist es stockdunkel. Sieben Meter über
mir ein schmaler Streifen Himmel, der einzige Spalt, durch
den das Licht der Stadt eindringen kann. Mein Herz schlägt so
schnell, dass es schmerzt. Ich taste mit den Händen an den
Mauern links und rechts entlang, um mich zu vergewissern,
dass sie sich nicht um mich zusammenschieben. Es sind nur
zehn Meter bis zu unserem Garten, aber es kommt mir drei-
mal so weit vor. Bergauf.
Und da ist außerdem das Gefühl, dass nur Augenblicke vor
mir jemand hier war.
Suche dich heim, wenn du durch dunkle Gassen gehst.
Als ich aus dem Gang herauskomme, drücke ich mich an
der Rückseite des Hauses entlang. Äste winterharter Pflanzen
ragen aus dem Schnee wie skelettierte Finger. Der alte Gar-
tenschuppen, den ich schon lange abreißen will, lehnt sich
Halt suchend gegen den Zaun auf der Rückseite des Gartens
so wie ich mich an die Mauer hinter mir.
Ich trete seitlich auf die Terrasse. Die Schiebetür ist ge-
schlossen. Im Wohnzimmer läuft der Fernseher. Eine Dauer-
werbesendung, in der die verblüffend vielseitige Nützlichkeit
eines Gemüsehobels demonstriert wird. Vielleicht liegt es am
Alkohol oder an den beruhigenden Bildern des Werbespots,
irgendetwas lässt mich jedenfalls einen Moment verharren
und mein eigenes, nur schwach beleuchtetes Heim betrachten.
Die nicht zueinanderpassenden Möbel, den abgewetzten Tep-
pich, die vollgestopften Bücherregale. Als wären sie die eines
anderen.

Aber das Zimmer ist nicht leer.
Sam. Er schläft mit einem Die-Fantastischen-Vier-Comic
im Schoß, die Hände noch auf dem Einband. Emmie hat ihn
aufbleiben lassen und wartet im Gästezimmer auf meine
Rückkehr. Ich betrachte meinen Sohn und sehe die Sorge in
seiner Pose, die Anzeichen seines Kampfes gegen den Schlaf.
Albträume. Und mein Herz tut noch einmal weh.
Ich nehme meine Hände von der Scheibe, trete zurück und
suche meinen Hausschlüssel. Ich finde ihn im selben Moment,
in dem mein Blick auf etwas fällt, das mein Herz stillstehen
lässt.
Über meinen prangt ein zweites Paar Handabdrücke auf
der Schiebetür, die ich erst erkenne, als ich einen Schritt zu-
rück mache und mein beschlagener Atem sie silbern einge-
froren hat. Zehn Fingerabdrücke und die verschmierten Spu-
ren zweier Handballen, gut zwei Zentimeter länger als meine,
wie ich feststelle, als ich meine eigenen Hände darauflege.
Er war hier.
Hat in mein Haus geblickt wie ich jetzt, hat abgeschätzt,
wie leicht es ist einzubrechen. Seine Augen haben meinen
schlafenden Sohn betrachtet.
Als ich mich diesmal von der Glastür löse, verschmiere ich
die Abdrücke des zweiten Händepaars. Die sonderbare
Schöpfung meines unkreativen Verstandes.
»Ich bin neugierig«, sagt die Chefredakteurin mit einer Mie-
ne, die echter Neugier recht nahekommt. »Was haben Sie sich
dabei gedacht, als Sie das geschrieben haben?«
Es ist der nächste Morgen. Die Chefredakteurin hat die Ti-
telseite des National Star auf ihrem Schreibtisch ausgebreitet.
Mein Name steht unter der Titelgeschichte. »Prächtige Prämie
für pedantischen Preisträger«.

»Sie meinen die Titelzeile?«, frage ich. »Ich hatte schon
immer eine Schwäche für Alliterationen.«
»Ich spreche von dem Artikel an sich.«
»Ich dachte wohl, man müsste ihn ein bisschen aufpep-
pen.«
Die Chefredakteurin blickt auf die Zeitung und liest ein
paar mit Textmarker unterstrichene Sätze vor. »›Die Präsenta-
tion wurde mehrfach von Hustenanfällen im Publikum unter-
brochen, das vermutlich an der von Verlogenheit dicken Luft
würgte.‹ ›Verdient hätten den Preis eigentlich die Juroren,
weil sie es geschafft haben, sämtliche Titel der Shortlist zu
lesen.‹< ›Dass ausgerechnet der Moderator einer unterirdi-
schen Fernsehshow die Tugenden des Lesens pries, hatte für
sich genommen schon mehr Ironie als die letzten zwölf Di-
ckie-Gewinner zusammen.‹ Und so weiter.«
Die Chefredakteurin hebt den Blick.
»Aufpeppen, Patrick?«
Ich suche nach einer Möglichkeit, mich zu entschuldigen.
Denn es tut mir leid. Und ich habe eine Handvoll guter Grün-
de, die mein ehrliches Bedauern stützen. Die Trauer, die sich
offenbar mehr und mehr in etwas anderes, Schlimmeres ver-
wandelt. Eine inoperable Schreibblockade. Ein Unhold, der
um mein Haus schleicht.
»Ich war in letzter Zeit nicht ganz ich selbst«, sage ich.
»Oh?«
»Ich habe das Gefühl, dass ich den Bezug zur Realität, den
Halt verliere. Aber das darf ich nicht zulassen. Ich habe einen
Sohn, und ich bin der einzige Mensch, der -«
»Dann könnte man das also«, unterbricht mich die Chef-
redakteurin und tippt mit dem Finger auf meinen Artikel, »als
einen Hilferuf interpretieren?«
»Ja, in gewisser Weise schon, denke ich.«
Die Chefredakteurin greift zum Telefon.

»Wen rufen Sie an?«
»Den Sicherheitsdienst.«
»Das wird nicht nötig sein.«
»Ich weiß, aber die Vorstellung, Sie hinausbegleiten zu
lassen, ist mir einfach angenehmer.«
»Das war’s dann?«
»Unbedingt.«
»Würde es etwas ändern, wenn ich sagen würde, dass es
mir leidtut?«
»Nicht im Geringsten.« Sie hebt den Finger, um mich zum
Schweigen zu bringen. »Könnten Sie bitte dafür sorgen, dass
Patrick Rush das Gebäude verlässt? Genau, er hat ab sofort
permanentes Hausverbot. Danke.«
Die Chefredakteurin legt auf und lächelt mich mit einem
Lächeln an, das eigentlich etwas anderes ist. Die gebleckten
Zähne, mit denen Hunde sich gegenseitig ihre Bereitschaft
zeigen, einander die Lunge aus dem Leib zu reißen.
»Und, Patrick, wie geht’s der Familie?«

12
Trotz der reichlich bemessenen Freizeit sind meine neuesten
Bemühungen für den Kreis auch nicht besser als die davor. In
vier Tagen Arbeitslosigkeit habe ich kaum mehr zustande
gebracht als eine auf ganze Sätze gestreckte Erledigungsliste.
Patrick holt die lange vergessenen Sachen aus der Reinigung.
Patrick macht sich zum Mittagessen eine Dosensuppe heiß.
Wenn ich es während des Krieges oder der Depression ansie-
deln und hunderttausend Wörter lang so weitermachen würde,
hätte ich eine reelle Chance auf den Dickie.
Trotzdem mache ich mich mit einem Gefühl aufgeregter
Erwartung auf den Weg nach Kensington. Der Winter deutet
erstmals seinen Rückzug an, ein beinahe klarer Märznachmit-
tag müht sich nach Kräften, die Temperatur über den Ge-
frierpunkt zu schieben. Und ein doppelter Espresso unterwegs
hat mir einen Schuss Hoffnung gegeben. Eine koffeinierte
Erinnerung daran, dass auch ich Grund zur Dankbarkeit habe.
Zum einen hat Sam meine Entlassung so gefasst aufge-
nommen, wie man es von einem Vierjährigen erwarten konn-
te. Er versteht nicht, was Geld ist. Oder Hypotheken. Oder die
Berufsaussichten für arbeitslose Schriftsteller. Aber er glaubt
offenbar, dass sein alter Dad noch ein paar Kaninchen aus
dem Hut zaubern kann, wenn er sich anstrengt.
Die andere gute Nachricht ist, dass ich mir meine Sand-
mann-Theorien leidlich erfolgreich ausgeredet habe. Seit ich
nichts mehr mit der Nachrichtenredaktion und Tim Earhearts
grausigen Knüllern zu tun habe, hat sich mein Verfolgungs-

wahn ein wenig gelegt. Meine Beweise für einen Zusammen-
hang zwischen Angelas Geschichte und den Morden an Carol
Ulrich, Ronald Pevencey und der namenlosen Frau aus Van-
couver machen im Licht des Tages wenig her. Ein überinter-
pretiertes vierzeiliges Gedicht. Leichen, die man an einem
Strand und in einer Sandkiste gefunden hat. Handabdrücke
auf einer Scheibe. Das ist alles. Sonderbare Details, die sich
nur mit arg strapazierter Logik verbinden lassen, und selbst
dann bleiben noch Fragen offen. Warum sollte jemand aus
dem Kensington-Kreis sich inspiriert fühlen, vollkommen
Fremde brutal zu ermorden? Und selbst wenn es einen Sand-
mann gibt, der aus den Seiten von Angelas Notizbuch he-
rausgetreten ist, was sollte er von mir wollen?
Heute Abend ist unser letztes Treffen. Wenn wir Conrad
Whites zugige Wohnung verlassen haben, werden wir wieder
unserer Wege gehen, mit der großen Stadt verschmelzen und
unseren Platz unter den uneingestandenen Romanciers, heim-
lichen Dichtern und verborgenen Chronisten einnehmen. Die
Absonderlichkeiten, die meine Träume belebt haben, seit ich
Angela zum ersten Mal ihre Geschichte von dem kleinen
Mädchen und dem Geist habe erzählen hören, werden ein
Ende finden. Und ich werde froh darüber sein. Ich mag eine
gute Gespenstergeschichte, genau wie jeder andere. Aber es
gibt einen Punkt, an dem man wieder aufwachen und in den
Alltag zurückkehren muss, in eine Welt, in der ein Schatten
nur ein Schatten ist und Dunkelheit nicht mehr als die Abwe-
senheit von Licht.
Wir lesen ein letztes Mal reihum, und zu meiner Überra-
schung ist so manches im Laufe der Zeit besser geworden als
das Ausgangsmaterial. Ivans Ratte beispielsweise ist nun eine
voll entwickelte Figur. Der Text verströmt eine Melancholie,
an die ich mich aus der ersten Runde nicht erinnere. Sogar

Lens Horrorgeschichten sind nach behutsamer Redaktion
nicht mehr ganz so ermüdend, weil ihr Autor gelernt hat, dass
nicht jedem Opfer eines Zombie-Angriffs das Gehirn aus dem
Schädel gekratzt werden muss, damit wir die Motivation der
Untoten begreifen.
Im Laufe des Abends beobachte ich Conrad White und su-
che nach Anzeichen, die seine Beziehung mit Evelyn bestäti-
gen könnten. Aber der alte Mann bedenkt sie bei ihrer Lesung
mit demselben gütigen Blick wie alle anderen. Vielleicht
funktioniert die Anziehung auch nur in eine Richtung. Evelyn
scheint mir ohnehin nicht sein Typ zu sein. Ich hatte mir das
»vollkommene Mädchen« aus Jarvis und Wellesley weicher
vorgestellt, verloren und unschuldig (selbst wenn diese Un-
schuld nur gespielt ist). Jemand, der weniger denkt und mehr
fühlt. Jemand wie Angela.
Wenn Conrad White im Laufe des Treffens einem Mitglied
des Kreises besondere Aufmerksamkeit widmet, dann ihr. Ich
glaube sogar, dass ich ihn einmal dabei erwische, wie er mit-
ten in Lens Lesung ihr Gesicht betrachtet, als sie ihm ihr Pro-
fil zuwendet, sodass er sie unbemerkt beobachten kann. Seine
Miene drückt jedoch kein Begehren aus. Angela hat etwas,
das er schon einmal gesehen oder sich zumindest ausgemalt
hat. Es hat ihn überrascht. Und vielleicht macht es ihm sogar
ein bisschen Angst.
Im nächsten Moment ertappt er mich dabei, wie ich ihn
beobachte.
Und in diesem Augenblick meine ich, es zu sehen, obwohl
ich mir bei dem Licht nicht sicher sein kann. Aber als sein
Blick mich streift, kommt mir die Idee, dass seine Welt eben-
so vom Sandmann besucht worden ist wie meine.
Als Angela an der Reihe ist, entschuldigt sie sich, dass sie
diese Woche nichts Neues mitgebracht hat. Wir anderen
stöhnen enttäuscht und klagen scherzhaft, dass wir nun nie

erfahren werden, wie Jacob gestorben ist, was wirklich ge-
schehen ist, als Edra im Krankenhaus war, und wer der
Sandmann ist. Conrad White fragt sie, ob sie ihre vorherigen
Entwürfe überarbeitet habe, und sie gesteht, dass sie keine
Zeit gefunden habe. Jedenfalls erklärt sie uns das. Wenn ich
raten müsste, würde ich vermuten, dass sie nie die Absicht
hatte, irgendwas zu redigieren. Sie ist nicht wegen irgend-
welcher redaktionellen Ratschläge hier, sondern um ihre Ge-
schichte mit anderen zu teilen. Ohne ein Publikum sind das
kleine Mädchen, Edra und Jacob sowie der schreckliche
Mann, der schreckliche Dinge tut, nur tote Wörter auf dem
Papier. Jetzt leben sie in uns.
Danach tun wir, was wir können - wiederholen bereits ge-
machte Bemerkungen, bitten um eine zweite Zigarettenpause
-, aber es bleibt trotzdem noch genug Zeit für Williams Text.
Er hat auf dem Stuhl bei der Tür gesessen, ein paar Schritte
hinter den anderen, sodass man ihn fast hätte übergehen kön-
nen. Aber nachdem Conrad White ihn aufgerufen hat, beugt er
sich vor, und seine Augen leuchten im Kerzenlicht auf, als
blickte er durch die Falten eines Samtvorhangs.
Sein Text ist wieder brutal, aber gnädig kurz. Eine weitere
Seite aus dem verlorenen Sommer eines Katzen häutenden
Jungen. Diesmal ist er dazu übergegangen, seiner Mutter
durch das Schlafzimmerfenster bei ihrem »Tagesjob« zuzu-
schauen. Er beobachtet, »was die Männer mit ihr machen, wie
sie, die Hose um die Knöchel, auf ihr liegen, und er sieht, dass
sie nur Tiere sind«. Der Junge empfindet keine Scham oder
Abscheu, sondern nur ein Gefühl von Klarheit, »die Entde-
ckung der Wahrheit. Einer Wahrheit, die durch eine wieder
und wieder erzählte Lüge verborgen war«. Wenn wir alle
Tiere sind, überlegt der Junge, welchen Unterschied macht es
dann, ob man die Kehle eines Hundes oder die eines der
Männer durchschneidet, die das Schlafzimmer seiner Mutter

besuchen? Und worin bestünde der Unterschied, wenn er sei-
ner Mutter das Gleiche antun würde?
Schon bald verlangt diese müßige Betrachtung nach prak-
tischer Umsetzung. Der Junge fühlt sich wie »ein Wissen-
schaftler, ein Entdecker von etwas, was nie zuvor jemand ge-
sehen oder gedacht hatte«. Aus der Annahme, dass wir alle
Wesen mit den gleichen Neigungen sind, würde folgen, dass
wir nicht mehr wert sind als die Ameisen, »für die wir einen
Schritt zur Seite gehen, um sie unter unseren Schuhen zu zer-
quetschen«. Er konnte es beweisen. Er musste nur etwas tun,
»das, wie man ihn gelehrt hatte, sehr, sehr böse war«. Wenn
er hinterher noch er selbst war, wenn sich in der Welt nichts
veränderte, hätte er recht. Die Aussicht »erfüllt ihn mit einer
Erregung, die, so vermutet er, die gleiche ist wie bei den an-
deren Jungen aus der Schule, wenn sie ein Mädchen geküsst
haben. Aber das hatte er überhaupt nicht im Sinn«.
William lehnt sich zurück, und das Licht in seinen Augen
erlischt wieder. So weit geht seine Geschichte. Ich soll als
Erster reagieren, und obwohl mir normalerweise immer mü-
helos eine nichtssagende Bemerkung einfällt, bin ich diesmal
um Worte verlegen.
»Für mich fühlt es sich sehr dicht an der Oberfläche an«,
bringe ich schließlich hervor.
»Was soll das heißen?«
»Das soll wohl heißen, es fühlt sich real an.«
»Wie fühlt sich real an?«
»So wie jetzt.«
»Was macht er?«, fragt eine Stimme, und wir alle wenden
uns Angela zu. Sie späht in das Dunkel, in dem William sitzt.
»Der Junge. Führt er sein … Experiment durch?«
Daraufhin macht William ein Geräusch, das gehört zu ha-
ben alle von uns sofort bedauern. Er lacht.

»Ich zeig dir meinen Schluss, wenn du mir deinen zeigst«,
sagt er.
Am Ende des Treffens schlägt Conrad White vor, dass wir
alle »in der nächstgelegenen Bierkneipe einkehren«, um
unsere Erfolge zu feiern. Wir entscheiden uns für Grossman’s
Tavern, eine Blues-Bar auf der Spadina Avenue, in der ich
seit meiner Studentenzeit nicht mehr war. Sie hat sich kaum
verändert. In einer Ecke jammt die Haus-Band vor sich hin,
und vor dem großen Fenster zur Straße ziehen die roten Strei-
fen der Straßenbahnen vorbei. Dort schieben wir ein paar Ti-
sche zusammen und bestellen mehrere Krüge Bier, alle ein
wenig nervös ob der Aussicht, nicht über unsere Geschichten,
sondern über uns selbst sprechen zu müssen, was bei allen
Ähnlichkeiten in den meisten Fällen trotzdem etwas ganz an-
deres ist.
Das Bier hilft. Genauso wie Williams Abwesenheit, der
vor Conrad Whites Haus in die entgegengesetzte Richtung
davongestapft ist. Es ist beinahe unvorstellbar, wie er sich in
einem geselligen Kontext benehmen würde, ob er das fade
Popcorn, das die Kellnerin bringt, essen würde und wie er die
kleinen Biergläser an die Lippen unter seinem Vollbart führen
würde. Noch unwägbarer ist jedoch, was er zu dem ersten
Thema beitragen würde, auf das wir zu sprechen kommen.
Die Morde.
Darüber sinne ich gerade nach, als Len meine Gedanken
stört und ein notengetreu nachgespieltes T-Bone-Walker-Solo
übertönt.
»Erzähl ihnen deine Theorie, Patrick.«
»Verzeihung?«
»Das Gedicht. Erzähl ihnen, was du mir erzählt hast. Über
den Sandmann.«

Der Kreis hat sich mir zugewandt. Und Len hüpft auf sei-
nem Stuhl auf und ab wie ein Affe zur Fütterungszeit.
»Das ist ein Geheimnis, Len.«
»Es war ein Geheimnis. Hast du die Zeitung heute Morgen
nicht gelesen? Ich dachte, du arbeitest da.«
»Nicht mehr.«
»Oh. Wow. Das ist echt schade. Ich mochte dein Couch-
kartoffel-Ding wirklich.«
»Ich bin gerührt.«
»Das Gedicht, das man bei der Leiche dieser Ulrich ge-
funden hat? Es wurde heute veröffentlicht.«
Seit man mir den Stuhl vor die Tür gesetzt hat, habe ich
keinen Blick mehr in den National Star geworfen, weshalb
ich auch Tim Earhearts Triumph nicht mitbekommen habe.
Das bedeutet, zwei Dinge sind ziemlich sicher. Erstens sitzt
mein Freund irgendwo da draußen und besäuft sich zur Feier
seiner Exklusiv-Story wie ein Stier. Und zweitens ist die
Polizei der Ergreifung des Mörders seit dem Tag, an dem sie
die Zeitung gebeten hat, das Gedicht zurückzuhalten, keinen
Schritt näher gekommen.
»Und? Was ist deine Sandmann-Theorie?«, fragt Petra und
sieht erst mich und dann Angela an, die mich mit beunruhi-
gender Festigkeit beobachtet.
»Ach, es ist nichts.«
»Los, komm. Sie ist gut!«, sagt Len.
Ich ziere mich weiter. Und dann beugt Angela sich vor,
legt ihre offene Hand auf den Tisch, wie um mich einzuladen,
meine hineinzulegen.
»Bitte, Patrick«, sagt sie. »Es würde uns sehr interessie-
ren.«
Also erzähle ich es ihr. Ihnen.
Gebrüllt in einer Kneipe klingt meine Sand-
mann-Interpretation noch alberner, doch alle im Kreis beugen

sich lauschend vor, eine fast lächerlich bunt gemischte Trup-
pe, bei deren Anblick sich ein in diesem Moment eintretender
Gast bestimmt fragen würde, was sie wohl verbindet. Dass sie
so absurd klingen, macht es mir leichter, meine Argumente
vorzutragen.
Das Problem ist, dass die anderen sie ernst nehmen. Ich
sehe, wie ich sie überzeuge, während ich das Ganze noch la-
chend abtue. In ihren Mienen kann man deutlich lesen, dass
sie in den vergangenen Wochen ähnliche Gedanken hatten.
Sie haben schon vorher an den Sandmann geglaubt.
Als ich fertig bin, entschuldige ich mich, um Sam anzuru-
fen, und erwische ihn, als Emmie ihn gerade ins Bett bringt.
(Ich wünsche ihm süße Träume, er wünscht sich zum Früh-
stück Pfannkuchen.) Als ich an unseren Tisch zurückkehre,
dreht sich das Gespräch um häusliche Sorgen (Petra kann
nicht fassen, wie viel der Klempner für den Austausch eines
Wasserhahns an ihrem Whirlpool verlangt hat) und Sport
(Ivan plädiert dafür, dass die Leafs den großen Russen ver-
kaufen, der nicht Schlittschuh laufen kann). Weitere Krüge
Bier und Zigaretten vor dem Lokal. Irgendwann bestelle ich
eine Runde Schnaps für alle und muss dann Angelas und Lens
Glas selber leeren, weil sie ihres beiseiteschiebt und er mich
daran erinnert, dass er nicht trinkt (was ich natürlich nicht
vergessen und die Gelegenheit nur genutzt hatte, elegant einen
Doppelten einzuschieben).
Aber ungeachtet des zusehends verschwommenen Verlaufs
des weiteren Abends gibt es Augenblicke, die erwähnt werden
wollen.
Irgendwann sitzen an einem Ende des Tisches nur noch
Len und ich, am anderen Conrad White und Evelyn. Die bei-
den tuscheln miteinander, fast Wange an Wange. Vielleicht
hatte Len doch recht. So würde sich ein Liebespaar nach ein
paar Drinks verhalten, oder? Und trotzdem haben die Ge-

heimnisse, die sie miteinander teilen, eine Schwere und
Ernsthaftigkeit, die keiner Form des Flirts entspricht, die ich
kenne. Nicht, dass ich ein Experte wäre.
Ich gieße mein Glas noch einmal voll und beobachte die
beiden, während sich Len vorbeugt, um mir seinerseits ein
Geheimnis zuzuflüstern.
»Ich bin gestern Abend verfolgt worden. Ich glaube, es
war, du weißt schon wer.«
»Du hast ihn gesehen?«
»Eher gespürt. Seinen … Hunger. Weißt du, was ich mei-
ne?«
»Ehrlich gesagt, nein.«
»Das glaube ich dir nicht.«
»Nicht? Nun, dann sag ich dir mal, was ich glaube. Du
nimmst meine Deutung des Gedichtes zu ernst. Es ist Unsinn.
Ich hab bloß rumgeblödelt.«
»Nein, das hast du nicht. Und ich weiß, was ich gespürt
habe. Er war es.«
»Er?«
»Der Schwarze Mann.«
»Sieh mich an, Len. Ich lache nicht.«
»Was immer es war, es war nicht wie du und ich.«
»Ich nehme an, du sprichst von William.«
»Ich habe vielleicht gedacht, dass es William ist, aber nur
weil es unterschiedliche Gestalt annehmen kann. Deswegen
gibt es auch keine Zeugen. Denk mal drüber nach. Wer weiß,
wie der Schwarze Mann aussieht? Niemand. Denn er ist je-
weils das, was du am meisten fürchtest.«
Ich muss zugeben, seine letzte Bemerkung beunruhigt
mich dermaßen, dass ich nicht sicher bin, ob ich meine Furcht
überspielen kann. Und was Len dann als Nächstes sagt, lässt
alle gespielte Gelassenheit endgültig von mir abfallen.
»Ich bin nicht der Einzige.«

»Du hast den anderen erzählt, was du mir gerade erzählt
hast?«
»Sie haben es mir erzählt.«
»Und?«
»Petra hat vor zwei Abenden jemanden in ihrem Garten
gesehen«, fährt er fort und rutscht noch näher, sodass jetzt
sogar Evelyn und Conrad White herüberschauen. »Und letzte
Woche hat Ivan seinen U-Bahn-Zug nach Betriebsschluss ins
Depot gefahren, alle Bahnhöfe waren geschlossen. Er saust
einfach durch, weil um die Zeit niemand dort unten sein dürf-
te. Aber an einem Bahnhof steht plötzlich jemand allein an
der Bahnsteigkante, als wollte er springen. Eigentlich kann er
gar nicht da sein, richtig? Alle Bahnhöfe werden nachts abge-
schlossen. Und der Typ ist auch nicht vom Sicherheitsdienst
oder trägt eine Leuchtweste wie die Gleisarbeiter. Als Ivan an
ihm vorbeifuhr, hat er versucht, sein Gesicht zu erkennen.
Und weißt du, was Ivan gesagt hat? Er hatte keins.«
»Du musst mal eine kleine Pause mit den Geschich-
ten-aus-der-Gruft -Comics einlegen«, sage ich mit einem
gezwungenen Lachen, als die anderen von draußen wieder
hereinkommen. Len will noch mehr sagen, aber ich nehme
eine Zigarette aus der Schachtel, die Evelyn auf dem Tisch
liegen gelassen hat, und gehe nach draußen, bevor er die Ge-
legenheit bekommt.
Erst als ich draußen mit zitternden Händen versuche, ein
Streichholz anzuzünden, erlaube ich mir, darüber nachzuden-
ken, was Lens Enthüllungen bedeuten könnten. Die erste
Möglichkeit ist, dass er verrückt ist. Die Alternative ist, dass
er die Wahrheit sagt. Im günstigsten Fall sehen wir wegen der
Sandmann-Geschichte alle Gespenster. Im schlimmsten Fall
ist er real.
Ich werde in meinen Sorgen von dem Gefühl unterbrochen,
nicht alleine zu sein. Es ist Petra. Sie steht hinter mir gleich

um die Ecke und spricht drängend in ein Handy. Offenbar ist
sie eben mit den anderen Rauchern nach draußen gegangen,
was an sich schon merkwürdig ist, weil sie nicht raucht. Und
jetzt steht sie in der Kälte, über die sie sich so häufig beklagt.
Und denkt, sie wäre alleine.
Und dann fährt ein Lincoln vor, einer aus der Flotte der
schwarzen Continentals, die durch die Straßen der Stadt gon-
deln und Bankbarone und Konzernprinzen zu ihren Chefbü-
ros, Restaurants, Geliebten, in die Oper und wieder nach
Hause chauffieren. Dieser Wagen jedoch ist für Petra ge-
kommen.
Sie klappt ihr Handy zu, und die hintere Tür wird von in-
nen geöffnet. Ein kurzer Blick auf schwarze Ledersitze und
einen Fahrer mit Schirmmütze am Steuer. Petra scheint kurz
mit dem Passagier auf der Rückbank zu sprechen. Sie zögert,
wirft einen Blick zurück zum Eingang des Grossman’s, bevor
sie erneut aus dem Wagen angesprochen wird. Dieses Mal
steigt sie ein. Die Limousine verschwindet blitzschnell in
einer Seitenstraße von Chinatown wie ein Hai, der einen klei-
neren Fisch verschluckt hat.
Was mich an Petras Abgang beschäftigt, ist die Tatsache,
dass sie sich nicht verabschiedet hat. Und die Art, wie sie in
den Lincoln gestiegen ist, als hätte sie keine Wahl.
Der Rest des letzten gemeinsamen Abends des Kensing-
ton-Kreises verläuft erwartungsgemäß. Weitere Drinks, wei-
terer unvermeidlicher Promi-Klatsch, sogar einige Empfeh-
lungen guter Bücher, die wir in letzter Zeit gelesen haben.
Nach und nach schrumpft der Kreis, weil wieder jemand ver-
kündet, dass er morgen früh aufstehen muss. Da ich unlängst
von meinen beruflichen Verpflichtungen befreit worden bin,
bleibe ich natürlich noch. Immer neue Bierkrüge werden ge-
bracht, die ich im Alleingang leere. Mein Abschied zieht sich

offen gestanden so lange hin, bis ich zuletzt überrascht fest-
stelle, dass nur noch Angela und ich übrig geblieben sind.
»Sieht so aus, als wären wir die Letzten«, sage ich und
biete ihr den Rest Bier aus meinem Krug an. Sie legt eine
Hand auf ihr Glas.
»Ich sollte auch los.«
»Warte. Ich wollte dich etwas fragen.«
Der Satz ist heraus, bevor ich weiß, was als Nächstes
kommt. Die plötzliche Intimität, neben Angela zu sitzen,
elektrisiert mich und verschlägt mir die Sprache.
»Deine Geschichte. Sie ist sehr … beeindruckend«, rede
ich weiter. »Ich meine, ich finde sie toll. Wirklich toll.«
»Das ist keine Frage.«
»Ich will nur Zeit schinden. Mein Therapeut sagt, alleine
zu trinken sei einer der ersten Warnhinweise auf Alkoholis-
mus. Das war natürlich meine letzte Sitzung bei ihm.«
»Darf ich dich etwas fragen, Patrick?«
»Schieß los.«
»Warum, glaubst du, warst du der Einzige in dem Kreis,
der keine Geschichte hatte?«
»Mangelnde Fantasie, nehme ich an.«
»Aber du hast doch dein eigenes Leben.«
»Ich weiß, es mag recht faszinierend erscheinen. Aber
glaub mir, hinter dem mysteriösen Äußeren bin ich eigentlich
Mr. Langweilig.«
»Niemand ist langweilig. Nicht, wenn man tief genug
bohrt.«
»Du hast gut reden.«
»Inwiefern?«
»Dein Tagebuch. Selbst wenn nur ein Zehntel davon wahr
ist, bist du mir meilenweit voraus.«
»Bei dir klingt es wie ein Wettbewerb.«

»Nun, das ist es doch auch, oder nicht?« Ich höre das
quietschende Selbstmitleid in meiner Stimme, das auch nach
einem Räuspern nicht verschwinden will. Aber jetzt bin ich
nicht mehr zu bremsen. »Den meisten großen Schriftstellern
ist irgendetwas passiert. Etwas Außergewöhnliches. Mir nicht.
Verlust, ja. Pech. Aber nichts Ungewöhnliches. Was wunder-
bar wäre, wenn man es sich zum Ziel gesetzt hat, einfach bloß
allen Ärger zu vermeiden. Aber was ist, wenn man Künstler
sein will? Nicht so gut.«
»Jeder hat ein Geheimnis.«
»Es gibt Ausnahmen.«
»Du hast keine Überraschung in dir, keine einzige unver-
mutete Wendung. Ist es das?«
»Genau. Man kriegt zu hundert Prozent, was man sieht.«
Es ist ein Blickduell. Angela sieht mir nicht bloß in die Au-
gen, sie ermisst die dahinter liegende Tiefgründigkeit.
»Ich glaube dir«, sagt sie schließlich und trinkt den letzten
Schluck Bier aus ihrem Glas. »Wollen wir hoffen, dass dir
irgendwann irgendwas passiert.«
Es ist spät. Die Band packt ihre Instrumente ein, der Bar-
keeper wirft ungeduldige Blicke in unsere Richtung. Aber
irgendetwas an Angelas verschleierter Eindringlichkeit lässt
mich verharren; die Andeutung, dass man mich und mein Le-
ben auch ganz anders sehen könnte. Sie fordert mich geradezu
heraus zu erraten, was das ist. Es erinnert mich daran, dass es
so vieles gibt, was ich wissen muss. Fragen, die mir, unge-
ahnt, seit dem ersten Treffen des Kensington-Kreises im Kopf
herumgehen. Am Ende bringe ich nur eine über die Lippen.
»Das kleine Mädchen in deinem Text. Bist das wirklich
du?«
Die Kellnerin nimmt unsere leeren Gläser weg, sprüht Es-
sigreiniger auf die Tischplatte und wischt sie ab. Angela steht
auf.

»Hattest du je den Traum vom Fallen?«, fragt sie. »Man
taumelt durch den Raum, rasend dem Boden entgegen, aber
man kann nicht aufwachen.«
»Ja.«
»Und bist diese fallende Person wirklich du?«
Angela lächelt beinahe.
Sie zieht ihren Mantel über, geht hinaus und am Fenster
vorbei, ohne noch einmal hineinzublicken. Von meinem Sitz-
platz kann man nur ihren Kopf und die Schultern sehen, so-
dass sie vor dem Hintergrund der nächtlichen Straße vorbei-
schwebt wie eine Erscheinung. Ein Mädchen, den Kopf ge-
senkt gegen den Wind, gleichzeitig deutlich sichtbar und
schattenhaft, sodass man sich, wenn sie verschwunden ist,
fragt, ob sie überhaupt da gewesen ist.
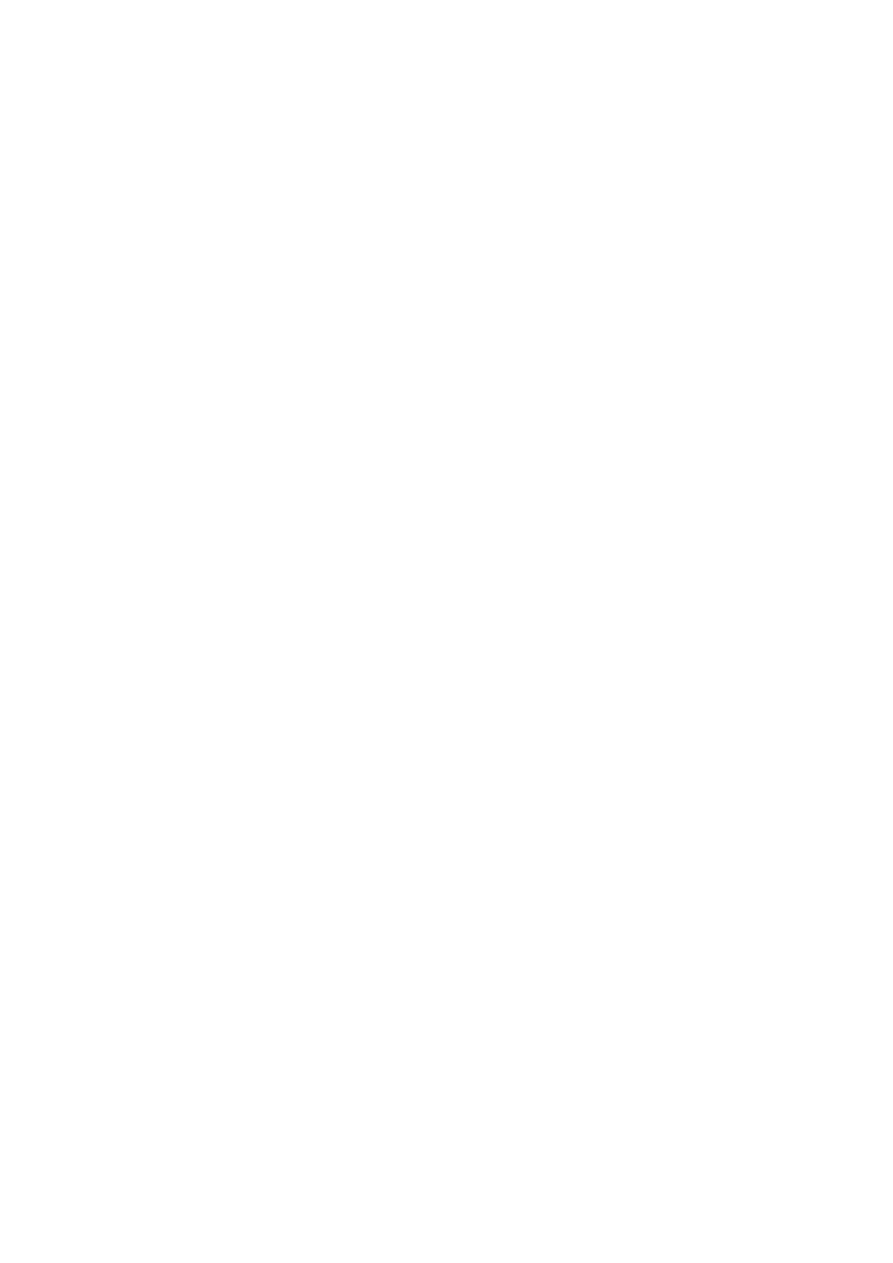
ZWEITER TEIL
Der Sandmann

13
MAI 2007, VICTORIA DAY WEEKEND
Es ist das vierte Interview in den letzten fünf Stunden, und ich
bin mir nicht sicher, ob das, was ich sage, noch irgendeinen
Sinn ergibt. Ein Mitarbeiter des New Yorker schreibt ein
mehrseitiges Porträt. Eine Film-Crew aus Schweden dreht
einen Dokumentarfilm. USA Today möchte einen »kleinen
Vorgeschmack« von meinem nächsten Buch.
»Ich bin im Ruhestand«, beharre ich, und der Reporter lä-
chelt, als wollte er sagen: Hey, schon kapiert. Wir Schreiber
dürfen unsere Karten nicht zu früh auf den Tisch legen.
Und jetzt ein Junge vom National Star, der einen hinterhäl-
tigen Angriff plant, wie ich in dem Moment erkenne, als er
mir gegenüber Platz nimmt und meinen Blick meidet. Ein
kraftloser Händedruck, glänzende Schweißtropfen über der
Oberlippe und auf den Wangen. Ich erinnere mich vage an ihn
- ein Redakteur, der immer empfindlich reagierte, wenn man
ihn auf seine Herkunft aus Swift Current ansprach.
»Nun«, sagt er und drückt auf den Aufnahmeknopf des
Diktafons, das er auf den Tisch gestellt hat. »Sie stehen mitt-
lerweile auf der Bestseller-Liste der Londoner Times. Sie ha-
ben einen Deal über eine Verfilmung mit Starbesetzung ab-
geschlossen. Und Sie standen sechs Wochen lang auf der Lis-
te der New York Times. War das von Anfang an der Plan?«
»Der Plan?«

»Inwieweit waren Sie sich der Marktfaktoren vorher be-
wusst?«
»Ich habe wirklich nicht über -«
»Das ist schon okay. Sie müssen sich nicht verteidigen. Ich
finde, Unterhaltungsliteratur sollte ihren Platz haben.«
»Das ist sehr großzügig von Ihnen.«
»Ich meine, Ihr Buch ist schließlich keine ernsthafte Lite-
ratur.«
»Selbstverständlich nicht. Ich würde Ernsthaftigkeit nicht
erkennen, wenn sie mich direkt auf den Mund küsst.«
Der Junge schnaubt und klappt seinen Notizblock zu.
»Glauben Sie wirklich, dass Sie all das verdient haben?
Glauben Sie, dass das, was Sie geleistet haben -«
Er macht eine Pause und wirft mein Buch auf den Tisch
wie ein Stück Scheiße, das er erst jetzt in seinen Händen be-
merkt hat. »Glauben Sie ehrlich, dass dieses Machwerk Lite-
raturist?«
Seine Lippen schmatzen weiter, auch wenn keine Worte
mehr kommen. Ich beobachte, wie er in dem Bemühen, die
gemeinste Beleidigung zu finden, die er mir an den Kopf
schmeißen könnte, die Stirn in dicke, rote Falten legt. Ich
hingegen blinzle, gebe vor, in meiner Erinnerung zu kramen,
und schnippe theatralisch mit den Fingern, als es mir einfällt.
»Swift Current.«
»Was?«
»Ich konnte den Akzent zunächst nicht einordnen. Aber
jetzt bin ich mir absolut sicher. Swift Current! War bestimmt
spannend, dort aufzuwachsen. Konfrontiert mit all der Kul-
tur.«
Eins muss ich dem Jungen lassen. Nachdem er hinausge-
stürmt ist, jedoch noch einmal zurückkehren muss, um sein
immer noch laufendes Diktafon einzupacken, das ich ihm
hinhalte, hat er so viel Anstand, sich zu bedanken.

Dabei hatte der Junge durchaus recht zu fragen, ob ich all das
für verdient halte. Denn die Antwort lautet Nein. Selbst als
die Pressefrau, die mit mir in einer Limousine von Interview
zu Buchladen zu Fernsehshow gondelt, mir und Sam frisches
Mineralwasser nachgießt, empfinde ich nur die Leere eines
Vampirs, eines Mannes, der Unsterblichkeit erlangt hat, aber
zu einem immensen Preis.
»Bist du nervös, Dad?«, fragt Sam.
Vor allem beschämt. Entehrt und voller Reue.
»Ein bisschen«, sage ich.
»Aber das ist deine letzte Lesung, oder?«
»Das ist richtig.«
»Wenn ich du wäre, wäre ich nervös.«
Wir beide betrachten das Toronto, das vor dem Fenster
vorbei gleitet, gleichermaßen fremd und vertraut. Eine nord-
amerikanische Allerweltsstadt wie viele andere, aber diese ist
zufällig mein Zuhause. Der Wagen rollt an einem Block mit
verglasten Apartments vorbei und weiter über die Gleise
Richtung Harbourfront, wo ich, Patrick Rush, in wenigen
Minuten aus meinem beschämend erfolgreichen ersten Roman
vorlesen soll.
Vor vier Jahren hat sich der Kensington-Kreis zum letzten
Mal versammelt. Damals war ich der einzige angehende
Schriftsteller unter uns, der keine Geschichte zu erzählen hat-
te. Ich habe danach nie wieder einen Schreib-Workshop be-
sucht. Mein Traum, einen Roman zu schreiben, war ein für
alle Mal ausgeträumt. Und ich war dankbar. Befreit. Wenn
einem die Last eines unerreichbaren Ziels von den Schultern
genommen wird, ist das ein Segen, das können Sie mir glau-
ben, auch wenn es zugegebenermaßen ein paar Narben hin-
terlässt.
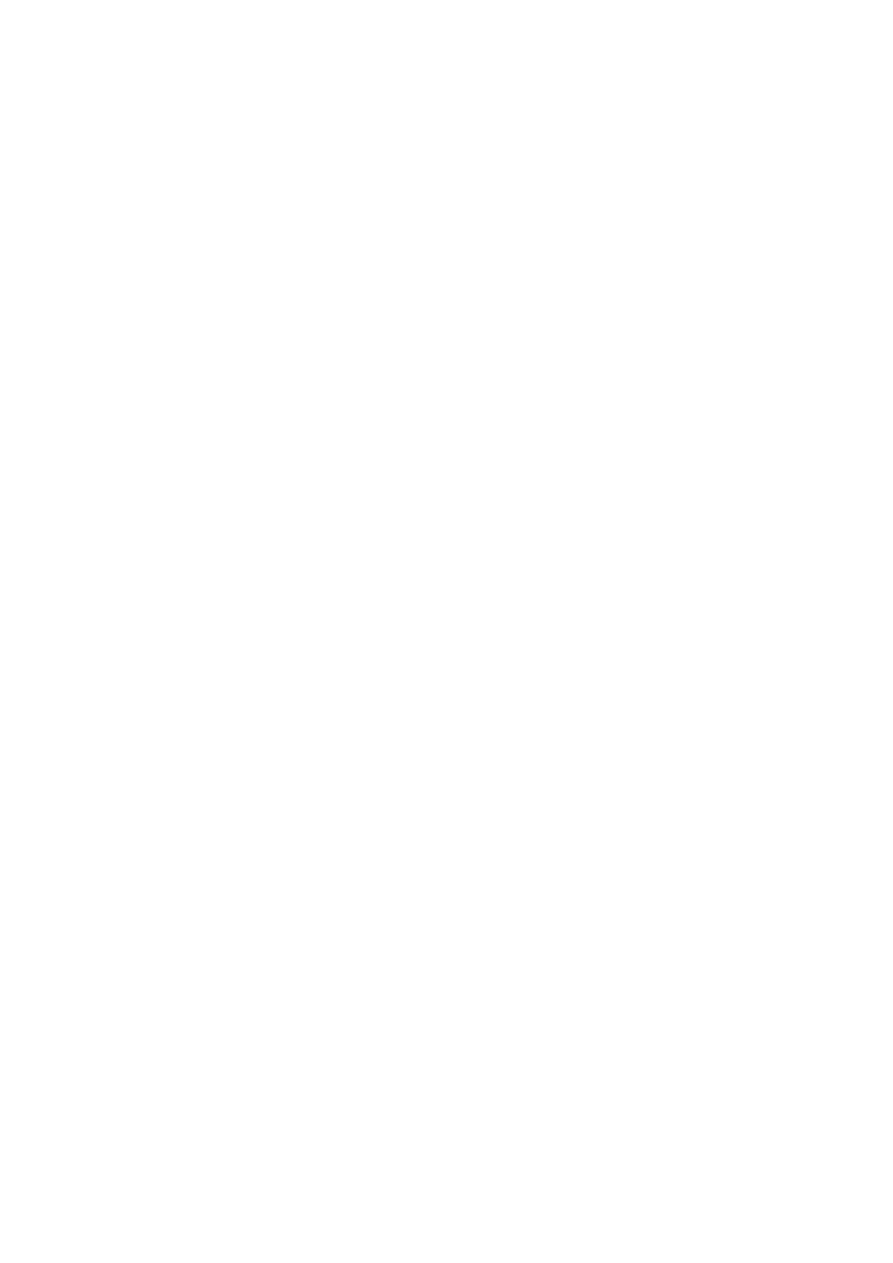
Trotzdem bin ich hier. Reise in Länder, in deren Sprachen
meine Wörter übersetzt worden sind. Ich speise und trinke mit
berühmten Schriftstellern - nein, Kollegen-, die ich schon seit
Langem bewundert habe. Ich werde gebeten, Buchbespre-
chungen für Publikationen zu schreiben, von denen ich zuvor
nur Werbebriefe bekommen habe. Die Art Durchbruch, die
man in seinem Selbstporträt für Vanity Fair nur »unwirklich«
nennen kann, wie ich es getan habe.
Und selbst bei meiner heutigen triumphalen Heimkehr, bei
der mir nichts, was ich mir hätte erträumen können, verwehrt
bleibt, weiß ich, dass nichts von all dem real ist.
»Wir sind fast da, Mr. Rush«, sagt die Pressefrau.
Sie wirkt besorgt. Immer häufiger versinke ich, wie sie
vermutlich glaubt, in nachdenkliche Momente der Kreativität
- die Grübeleien eines Künstlers eben. Vielleicht sollte ich es
ihr sagen. Vielleicht sollte ich hier im gepolsterten Beichtstuhl
einer Limousine reinen Tisch machen. Und das würde ich
vielleicht auch, wenn Sam nicht dabei wäre. Sonst würde ich
ihr sagen, dass mein Schweigen keine Stürme der Fantasie
verbirgt. In Wahrheit versuche ich nur, meine Scham lange
genug in Schach zu halten, um das nächste Lächeln, das
nächste Dankeschön, die nächste Signatur zu überstehen, in
einem Buch, das zwar meinen Namen trägt, aber eigentlich
gar nicht von mir ist.
Hinter der Bühne bekomme ich eine Flasche Wasser, eine
Schale Obst, eine Pinkelpause zugestanden. Man berichtet
mir, dass das Haus ausverkauft ist, und fragt, ob ich im An-
schluss an die Lesung noch Fragen aus dem Publikum beant-
worten möchte. Die Leute würden schrecklich gern wissen,
wie es ist, mit dem ersten Buch das zu erreichen, was ich er-
reicht habe. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich würde es
auch gern wissen.

Dann werde ich in die abgedunkelten Kulissen des Saals
geführt und flüsternd ermahnt, die Stufen zu beachten. In
einem Samtvorhang tut sich eine Öffnung auf, und ich trete
allein hindurch. In der ersten Reihe wartet mein leerer Platz.
Die Pressefrau sitzt neben Sam und winkt mir zu, als hätte sie
Angst, dass ich umkehre und hinausgehe.
Der Veranstalter der Lesereihe tritt ans Lesepult und dankt
den Unternehmen und großzügigen Spendern, die das Event
erst möglich gemacht haben. Dann trägt er seine Einführung
vor. Eine witzige Anekdote über ein kurzes Gespräch, das er
mit dem Autor des heutigen Abends vor wenigen Minuten
hinter der Bühne geführt hat. Ich lache mit allen anderen und
denke, wie schön es wäre, wenn der charmante Gast, den er
gerade beschrieben hat, tatsächlich existierte. Wenn er ich
sein könnte.
Und dann gerate ich wieder auf gefährliches Gelände. Ich
wünsche mir, Tamara wäre hier. Ein Klumpen Trauer, der mir
im Hals stecken bleibt, sodass ich keine Luft bekomme.
»Meine Damen und Herren, ohne weitere Vorrede freue
ich mich jetzt sehr, Ihnen Patrick Rush aus unserer Stadt To-
ronto zu präsentieren, der für Sie aus seinem sensationellen
Debütroman Der Sandmann lesen wird!«
Applaus. Ich hebe die Hände ins Scheinwerferlicht, um
gegen allzu viel Zuneigung zu protestieren. Gleichzeitig ringe
ich darum, mich nicht zu übergeben.
Schweigen. Ich räuspere mich. Rücke meine Brille zurecht.
Und fange an.
»Es war einmal ein Mädchen, das wurde verfolgt von
einem Geist …«

14
Ein schlichter Umschlag, abgestempelt in Toronto. Er enthält
einen Zeitungsausschnitt. Keine beigelegte Karte. Es ist ein
Artikel aus dem Whitley Register, dem lokalen Wochenblatt
einer Stadt im Norden von Ontario. Am zerklüfteten, wenig
bevölkerten Nordostufer des Lake Superior gelegen.
Der Artikel ist am Freitag, dem 24. August 2003, erschie-
nen.
ZWEI TOTE AUF DEM TRANSCANADA-HIGHWAY
Schriftsteller und Begleiterin sterben bei »rätselhaftem«
Autounfall
Von Carl Luben
Whitley, Ont. - Bei einem Unfall auf dem
Trans-Canada-Highway kamen zwei Personen ums Leben,
als ihr Wagen am frühen Dienstagmorgen in eine Felswand
raste. Die Unglücksstelle liegt etwa zwanzig Autominuten
von Whitley entfernt.
Conrad White (69) und Angela Whitmore (Alter unbe-
kannt) wurden vermutlich zwischen ein Uhr und drei Uhr
morgens getötet, als ihr Fahrzeug von der Fahrbahn abkam.
Miss Whitmores letzter Wohnsitz konnte noch nicht ermit-
telt werden, Mr. White lebte in Toronto. Was die beiden in
die Gegend von Whitley geführt hat, ist nicht bekannt.
Mr. White, Autor des bei Veröffentlichung 1972 heftig
umstrittenen Romans Jarvis und Wellesley, hatte mehrere

Jahrzehnte im Ausland gelebt und sich erst vor Kurzem
wieder in Kanada niedergelassen.
Bisher konnte die Polizei noch keinen Angehörigen von
Angela Whitmore erreichen, weil die gefundenen Papiere
keinerlei entsprechende Hinweise enthielten. Wer nähere
Angaben über Miss Whitmore machen kann, wird gebeten,
sich mit der Ontario Provincial Police in Whitley in Ver-
bindung zu setzen.
Die Klärung der genauen Unfallursache durch die Poli-
zei ist noch nicht abgeschlossen. »Es ist ein wenig rätsel-
haft«, erklärte Constable Dennis Peet am Unfallort. »Es
waren keine weiteren Fahrzeuge in den Unfall verwickelt,
es gibt keinerlei Brems- oder Schleuderspuren. Es ist also
unwahrscheinlich, dass der Wagen von der Straße abge-
kommen ist, als er einem entgegenkommenden Fahrzeug
oder Tier ausweichen wollte.«
Die Ermittler schätzen, dass der Wagen mit einer Ge-
schwindigkeit von mehr als 140 Stundenkilometern aufge-
prallt ist. Aufgrund des Tempos und des relativ geraden
Streckenabschnittes scheint auch die Möglichkeit ausge-
schlossen, dass Miss Whitmore am Steuer eingeschlafen
sein könnte.
»Bei solchen Unfällen weiß man nur, dass man es letzt-
endlich nie genau wissen wird«, sagte Constable Peet ab-
schließend.
Mein erster Gedanke nach der Lektüre galt nicht den beiden
Opfern, sondern der Frage, wer mir den Ausschnitt geschickt
haben könnte. Ich war mir ziemlich sicher, dass es jemand aus
dem Kreis sein musste, da meine Beziehung zu Angela und
Conrad White sonst kaum jemandem bekannt war. Aber wenn
es einer von ihnen war, wozu dann die Anonymität? Viel-
leicht wollte der Absender nur der Überbringer der schlechten

Nachrichten sein und nicht mehr. Petra etwa, die sich ver-
pflichtet fühlte, den anderen mitzuteilen, was sie erfahren
hatte, aber nicht wollte, dass irgendwelche Besucher vor ihrer
Haustür auftauchten. Oder Evelyn, die zu cool wäre, eine läp-
pische Bemerkung hinzuzufügen. Und dann war da noch der
klare Favorit: Len. Er hatte die Zeit, die obskuren Datenquel-
len zu durchforsten, die ihn über einen solchen Zwischenfall
informieren konnten, und fand wahrscheinlich, dass ein Um-
schlag ohne Absender der Botschaft etwas Geheimnisvolles
verlieh.
Aber wie alle Spekulationen über den Kreis führten auch
diese eher praktischen Erklärungen bald zu fantastischeren
Theorien. Genauer gesagt, zu William. Als er mir in den Sinn
kam, drängten sich die in dem Artikel aufgeworfenen, nach-
rangigen Fragen in den Vordergrund. Wieso waren Conrad
White und Angela überhaupt gemeinsam in der Wildnis jen-
seits von Whitley unterwegs? Und warum fuhr Angela
schneller als erlaubt? Mehr als sechzig Sachen über dem
Tempolimit. Plötzlich schien es denkbar, dass William nicht
nur Absender des Artikels war, sondern irgendwie auch Ver-
ursacher des Unfalls.
Erst als ich irgendwann später allein in meiner Krypta saß,
traf es mich mit unerwarteter Wucht, dass Conrad und Angela
tot waren. Ich ließ das drei Monate alte Time Magazine sinken
und spürte, wie mein Herz pochte und mir im Nacken der
Schweiß herunterlief. Panik, wie aus dem Nichts, mir die Luft
abschnürend, eine Attacke, wie ich sie seit Tamaras Tod
schon öfter erlitten war. Aber diesmal war es anders. Diesmal
galt mein Schock dem Verlust zweier Menschen, die ich
kaum gekannt hatte.
Moment. Letzteres stimmt nicht ganz.

Es war allein der Gedanke an Angela, der alle Luft aus
dem Raum zu saugen schien. Das Mädchen mit einer Ge-
schichte, deren Ende ich nun nie mehr erfahren würde.
Nach dem Abend in Grossman’s Tavern hörte der Mörder,
den ich für mich den Sandmann nannte, auf zu töten. Die
Polizei verhaftete keinen Tatverdächtigen für die Morde an
Carol Ulrich, Ronald Pevencey und der Frau aus Vancouver,
die als Jane Whirter identifiziert wurde. Obwohl für Hinweise
zur Ergreifung des Täters eine Belohnung von 50 000 Dollar
ausgesetzt wurde und die Polizei gelegentlich Pressemittei-
lungen herausgab, in denen behauptet wurde, dass man wei-
terhin mit beispiellosem Eifer an dem Fall arbeitete, mussten
die Behörden zugeben, dass man keine konkreten Spuren,
geschweige denn Tatverdächtige verfolgte. Man nahm an,
dass der Mörder weitergezogen war. Ein Mensch ohne Fami-
lie und Freunde, der sein Werk vermutlich andernorts fortset-
zen würde.
Trotzdem konnte ich den Gedanken, dass die Morde an Ul-
rich, Pevencey und Whirter in irgendeinem Zusammenhang
zu dem Kreis standen, lange nicht abschütteln. Natürlich ist
das häufig so, wenn bestimmte Dinge zufällig zusammentref-
fen. Wir verspüren die egozentrische Verlockung, größere
Tragödien mit uns und unserem Leben in Verbindung zu
bringen, damit wir das Gefühl haben, dass das, was wir ge-
macht haben, als die beiden Türme des World Trade Center
einstürzten, JFK erschossen wurde oder auf einem Spielplatz
um die Ecke ein Serienkiller mordete, letztendlich unsere
Geschichte ist.
All das weiß ich, trotzdem habe ich nie geglaubt, dass der
Sandmann schon mit seinem Werk fertig war. Der dunkle
Schatten, den ich manchmal am Rand meines Blickfelds aus-
machte, konnte nie einfach nichts, sondern musste immer das

Etwas sein, das in dem Moment bewusst meinen Weg kreuzte,
der lauernde Faden des Schicksals.
Einmal begegnete ich Ivan auf der Yonge Street. Er stand auf
dem Bürgersteig und blickte erst nach Norden und dann nach
Süden, als wäre er sich unsicher, in welche Richtung er gehen
sollte. Ich überquerte die Straße, um Hallo zu sagen, und er
starrte mich leeren Blickes an. Hinter ihm blinkte und blitzte
das grelle Vordach des Strip-Clubs Sansibar.
»Ivan«, sagte ich und fasste kurz seinen Ellbogen. Er sah
mich an wie einen verdeckten Ermittler. Jemanden, der ge-
kommen war, um ihn abzuholen, und den er schon lange er-
wartet hatte. »Ich bin’s. Patrick.«
»Patrick.«
»Aus dem Kreis. Dem Schreibzirkel.«
Ivan blickte über meine Schulter zum Eingang des Sansi-
bar.
»Lust auf einen Drink?«, fragte er.
Wir ließen das Tageslicht hinter uns und wählten einen
Tisch in der Ecke. Auf der Bühne probten die Nachmittags-
mädchen ihren Tanz an der Stange, rückten in den Rauch-
glasspiegeln ihre Implantate zurecht und rieben sich mit Ba-
byöl ein.
Ich übernahm die Unterhaltung. Fragte ihn nach seinen
Schreibfortschritten (er hatte »über ein paar Ideen gesessen«)
und seiner Arbeit (»dieselben Gleise, dieselben Tunnel«).
Danach entstand ein langes Schweigen, während ich darauf
wartete, dass Ivan mir die gleichen Fragen stellte. Aber das tat
er nicht. Zunächst nahm ich an, es handle sich um ein Symp-
tom von Strip-Bar-Schüchternheit, aber rückblickend gesehen
stimmt das nicht. Es war dieselbe Verlegenheit, die ich bei
meinem ersten Gespräch mit Ivan gespürt hatte, als er mir
erzählte, er sei einmal beschuldigt worden, jemandem etwas

getan zu haben. Seine Einsamkeit raubte ihm die Stimme.
U-Bahn-Züge fahren, in seiner Souterrain-Wohnung an die
Wände starren und für einen Table-Dance bezahlen. Nichts
davon erforderte es zu reden.
Ich entschuldigte mich, um auf die Toilette zu gehen, und
zu meinem Unbehagen folgte Ivan mir. Erst als wir nebenei-
nander vor dem Urinal standen, begann er zu sprechen.
Für gewöhnlich sind Unterhaltungen unter Männern, die
dabei ihren Schwanz in der Hand halten, streng auf bestimmte
Themen begrenzt. Der Vorbau der Barfrau oder das Match auf
der Großbildleinwand sind eine sichere Bank. Nicht hingegen
Ivans Geständnis, dass er sich nicht mehr getraut hatte, je-
mandem näherzukommen, seit man ihn vor vierzehn Jahren
beschuldigt hatte, seine Nichte getötet zu haben.
»Sie hieß Pam. Sie war die älteste Tochter meiner Schwes-
ter«, begann er. »Fünf Jahre alt. Der Vater hatte die Familie
im Jahr davor verlassen, der Drecksack. Meine Schwester
Julie arbeitete tagsüber, und weil ich meistens Nachtschicht
habe, bat sie mich manchmal, bei ihr zu Hause auf Pam auf-
zupassen. Das habe ich gerne getan. Sie war ein Kind, wie ich
es mir wünschte, wenn ich je selber Kinder haben sollte. Aber
das werde ich nicht. Jedenfalls war ich eines Tages wieder bei
Julie, und Pam fragt mich, ob sie irgendein Spielzeug aus dem
Keller holen darf. Ich sah ihr nach, wie sie den Flur hinunter
zur Treppe rannte, und dachte: Du siehst sie gerade zum letz-
ten Mal lebend. Ich meine, wenn man auf Kinder aufpasst,
denkt man so was ständig. Aber diesmal denke ich: Tja, das
war’s, die kleine Pam ist tot. Und der Gedanke bleibt ein paar
Sekunden länger als üblich. So lange, bis ich höre, wie sie auf
einer Stufe ins Stolpern gerät. Ich laufe zum oberen Treppen-
absatz und mache das Licht an, und da liegt sie auf dem Bo-
den. Blutend. Weil sie auf irgendwas gefallen ist. Eine Harke,
die jemand auf dem Boden liegen gelassen hatte. Eine wie

früher, weißt du? Wie ein Kamm, nur mit Metallzähnen, die
nach oben zeigen. Aber das ist noch nicht das Ende. Denn
Julie denkt, ich hab es getan. Meine einzige Verwandte. Die
Polizei ermittelt, kommt jedoch zu keinem Schluss, sie sind
argwöhnisch, müssen die Sache allerdings auf sich beruhen
lassen. Aber Julie hat seit dem Tag kein Wort mehr mit mir
gesprochen. Ich weiß nicht mal, wo sie jetzt wohnt. So geht
ein Leben zu Ende. Zwei Leben. Einfach so. Nur dass ich
noch hier bin.«
Er zieht seinen Reißverschluss hoch und geht hinaus, ohne
sich die Hände zu waschen.
Als ich an unseren Tisch zurückkam, bestellte Ivan gerade
eine weitere Runde. Ich erklärte der Kellnerin, dass ich genug
hätte.
»Wir sehen uns«, sagte ich zu Ivan. Aber sein Blick blieb
starr auf das schlüpfrige Geschehen auf der Bühne gerichtet.
Nach ein paar Schritten drehte ich mich noch einmal win-
kend um (eine Geste, von der ich hoffte, sie würde signalisie-
ren, dass ich zu einer anderen Verabredung eilen musste),
aber er saß immer noch da und starrte, wie mir jetzt auffiel,
nicht auf die Tänzerin, sondern an die Decke, ins Nichts,
während seine Hände kalt und weiß herunterhingen.
Len, dem ich als Einzigem meine Privatnummer gegeben hat-
te, rief einmal an. Er fragte, ob wir nicht ein bisschen »fach-
simpeln« wollten, und aus irgendeinem Grund sagte ich ja.
Vielleicht war ich einsamer, als ich dachte.
Wir verabredeten uns im Starbucks um die Ecke. Sobald
der große Junge hereintrampelte, wusste ich, dass es ein Feh-
ler war. Dabei lief es ganz gut. Wir sprachen über seine Be-
mühungen, den Horror aufzugeben und »etwas Seriöses« zu
schreiben. Er hatte seine Geschichten an Universitätszeitun-

gen und Magazine geschickt und fühlte sich von »ein paar
ziemlich guten Ablehnungsbriefen« ermutigt.
Bei derselben Gelegenheit teilte mir Len auch den Klatsch
über Petra mit. Ihr Exmann, Leonard Dunn, war wegen einer
ganzen Palette von Betrugsvergehen sowie Erpressung und
Wucher verhaftet worden. Es wurde sogar darüber spekuliert,
dass er Verbindungen zum organisierten Verbrechen hatte.
Len und ich scherzten, dass Petras Villa in Rosedale auf
einem Fundament von gewaschenem Geld stand, aber meinen
letzten Eindruck von Petra in einer Limousine, in die sie nur
widerwillig eingestiegen war, behielt ich für mich.
Das war so ziemlich alles. Keiner von uns erwähnte Wil-
liam, Angela oder einen der anderen (ich hatte noch nicht von
dem Unfall bei Whitley erfahren). Selbst das scheinbare Ende
der Karriere des Sandmanns wurde nur beiläufig gestreift. Mir
fiel auf, dass Len der polizeilichen Vermutung, dass wir nie
wieder von ihm hören sollten, ebenso wenig traute wie ich.
Als wir hinterher vor dem Café standen, versicherten Len
und ich uns gegenseitig, dass wir uns demnächst wieder tref-
fen müssten. Ich glaube, wir erkannten es beide als Verspre-
chen, das man besser nicht hält. Und so ergab es sich, dass wir
uns erst einige Jahre später und unter Umständen, die nichts
mit der Pflege einer zaghaften Freundschaft zu tun hatten,
wiedersehen sollten.
In Interviews habe ich wiederholt erklärt, dass ich mit dem
Schreiben von Der Sandmann erst begonnen hätte, nachdem
meine Abfindung durch den National Star aufgebraucht war,
aber das stimmt nicht ganz. Wenn Schreiben zumindest teil-
weise ein Unterfangen ist, das ausschließlich im Kopf und
fernab von Stiften und Tastaturen stattfindet, dann hatte ich
schon an dem Abend, an dem ich Angela zum letzten Mal sah,
begonnen, die Lücken in ihrer Geschichte zu füllen.

Selbst nach dem Ende unseres Schreibkreises und den lan-
gen, sorgenvollen Tagen, die folgten, sogar als die Bank be-
gann, mir erst Informationsschreiben bezüglich meines un-
ausgeglichenen Kontostands und später anwaltliche Andro-
hungen von Zwangsmaßnahmen zu schicken, gingen mir das
Waisenmädchen, Jacob, Edra und der schreckliche Mann, der
schreckliche Dinge tut, nicht aus dem Kopf. Ihre Vergangen-
heit, der Fortgang der Geschichte beschäftigten mich.
Ich kehrte zu Angelas Geschichte zurück, weil ich sie zum
Überleben brauchte. Um für meinen Sohn da zu sein, brauchte
ich eine fiktionale Horrorgeschichte als Alternative zu dem
realen Grauen, das auf uns zukam. Ich hatte Sam - aber ich
war alleine. Tamara war tot. Bald würde man uns das Haus
wegnehmen. Und Daddy den Verstand verlieren.
Sam durfte ich nichts von all dem erzählen. Und so kam
ich darauf, dass Der Sandmann mich retten könnte. Es gab
mir einen Zufluchtsort, etwas, das mir gehörte.
Aber das war ein Irrtum. Die Geschichte hat nie mir ge-
hört. Und sie konnte mich auch nicht retten.
Der Sandmann hatte seine eigenen Pläne. Er brauchte mich
nur, um ihn freizulassen.

15
Ich gebe zu, dass ich Angelas Geschichte gestohlen habe.
Aber sie war kein Roman. Selbst wenn ich ihre Figuren, ihren
Schauplatz und den Ausgangspunkt benutzt, ihren Ton imi-
tiert und sogar ganze Seiten ihrer aufgenommenen Lesung
kopiert habe, könnte man auf der Grundlage strikter Wörter-
zählung den Großteil von Der Sandmann guten Gewissens als
mein Werk bezeichnen.
Ich musste etliches hinzufügen, um ihr das notwendige
Gewicht für ein Buch zu geben. Was eben nötig war, um das,
was ich schon hatte, auszuwalzen, bis das Ergebnis auf meh-
rere hundert Seiten gestreckt war. Was das Buch trotzdem
noch brauchte, war genau das, was Angelas Geschichte nicht
lieferte. Ein Ende.
Nachdem ich monatelang Ideen auf Karteikarten gekritzelt
und die meisten wieder in den Papiermüll geworfen hatte,
schaffte ich es schließlich, mir ein paar eigene abschließende
Sätze aus den Fingern zu saugen, obwohl es sinnlos ist, hier
weiter darauf einzugehen.
Sagen wir einfach, ich habe mich entschieden, eine Ge-
spenstergeschichte daraus zu machen.
Ich wusste, dass es ein Plagiat war. Nicht einen Augenblick
lang habe ich gedacht, ich hätte genug selbst erfunden, als
dass man Der Sandmann aufrichtig mein Eigen nennen könn-
te. Was mein schlechtes Gewissen angesichts dieses Verge-
hens linderte, war die Tatsache, dass ich bloß damit herum-
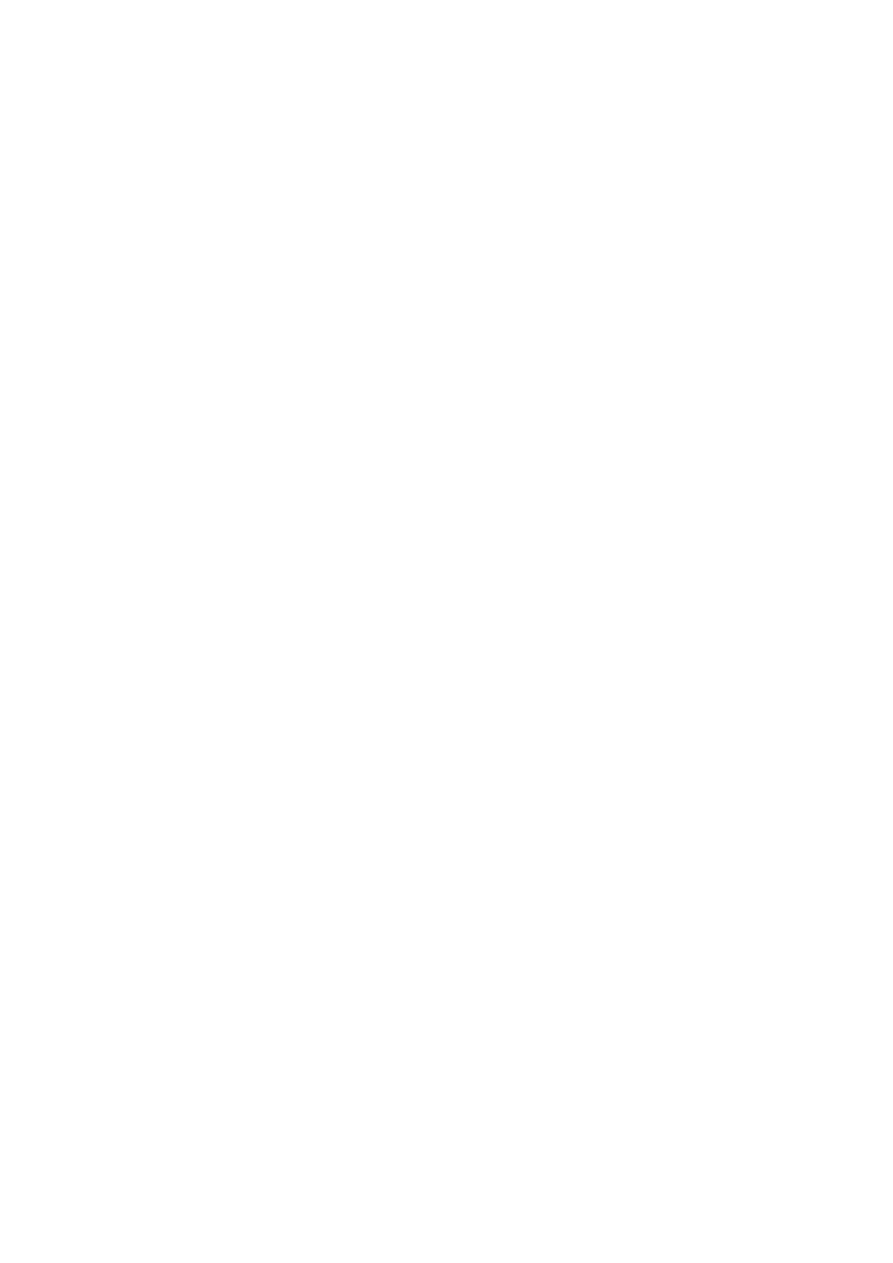
spielte. Es war eine Zerstreuung, sonst nichts. Eine Art The-
rapie in den Stunden, in denen Sam schlief, das Fernsehen den
üblichen Mist sendete und die Sätze meiner Lieblingsbücher
unleserlich vor meinen Augen verschwammen.
Selbst als das Werk fertig war, hatte ich nach wie vor keine
Pläne, mich als seinen alleinigen Autor zu präsentieren. Das
lag zum Teil daran, dass ich es nicht war. Aber es gab noch
einen anderen Grund.
Ich habe das Schreiben des Buches immer als eine Art
Kommunikation verstanden, einen Austausch zwischen An-
gela und mir. Ich habe Dutzende von Interviews mit echten
Schriftstellern gelesen, die sagen, dass sie beim Schreiben ein
einköpfiges Publikum im Sinn gehabt haben, einen idealen
Leser, der ihre Intentionen voll und ganz nachvollzieht. Das
war Angela für mich. Das zweite Augenpaar, das mir über die
Schulter blickte, während sich die Wörter auf dem Bildschirm
ausbreiteten. Während ich unsere Geistergeschichte schrieb,
war Angela das eine Phantom, das die ganze Zeit bei mir war.
Und dann fing ich an, mich zu sorgen, es wäre vielleicht
nicht gut. Unser Buch. Angelas und meins. Außer dass Ange-
la jetzt tot war.
Was würde ein anderer von dem halten, was wir gemein-
sam geschaffen hatten?
Doch selbst dies war noch nicht mein Ruin. Mein eigentli-
cher Fehler war es, die Geschichte auszudrucken, Briefum-
schläge zu kaufen, in die ich sie stecken konnte, und mir ein-
zureden, ich sei bloß neugierig, als ich sie, adressiert an die
wichtigsten Literaturagenten in New York, in den Briefkasten
warf.
Das war der Fehler.

16
Heute sage ich, was alle in meiner Position als Antwort auf
die nach Lesungen am häufigsten gestellte Frage sagen: Ich
wollte schon immer schreiben. Aber in meinem Fall entspricht
die Antwort nicht exakt der Wahrheit. Ich wollte schon immer
schreiben, ja, aber in erster Linie wollte ich schon immer
Schriftsteller sein. Nichts zählte, solange man nicht veröffent-
licht war. Ich sehnte mich danach, der eingeprägte Name auf
einem Buchrücken zu sein, zur Ritterschaft der Auserwählten
zu gehören, die in Buchläden und Bibliotheksregalen neben
ihren alphabetischen Nachbarn standen. Die Großen und Bei-
nahe-Großen, die Berühmten und die zu Unrecht Übersehe-
nen. Die Lebenden und die Toten.
Aber jetzt wollte ich nur noch raus.
Was mir damals so wichtig erschienen war, kam mir jetzt
vor wie eine List, etwas zu verkomplizieren, das ohne Einmi-
schung brutal simpel war: Das Leben ist beschissen, und am
Ende stirbst du sowieso, wie es auf T-Shirts immer hieß.
Ich würde mich mit meiner Vaterrolle zufriedengeben, mit
Grillen am Wochenende, Pauschalreisen ans Meer und ausge-
liehenen Western und Hitchcock-Filmen. Ich würde nicht
mehr das Bedürfnis verspüren, etwas sagen zu müssen, ein-
sam und wütend die betäubte Masse wachrütteln zu müssen.
Stattdessen würde ich mitten unter ihnen sein, mitten unter
meinen Konsumentenbrüdern und -schwestern. Die Suche war
abgeblasen.

Manchmal, wenn ich mit Sam spazieren gehe, ihm etwas
vorlese oder ihm ein Rührei mache, packt mich auf dem Weg,
mitten im Satz oder während das Ei stockt, eine geradezu
lähmende Liebe. Um seinetwillen versuche ich, mich in sol-
chen Momenten zusammenzureißen. Denn derlei Gefühlsaus-
brüche sind ihm zunehmend peinlich. Genau wie rührselige
Reden - was für ein perfekter kleiner Bursche und wie ähnlich
er seiner Mutter ist. Nicht, dass mich das abhalten würde.
Kein bisschen.
Seit der Veröffentlichung von Der Sandmann sind mir
solche Freuden versagt geblieben. All die Aufmerksamkeit für
den Erfolgserstlingsschriftsteller - Lesungen in Gemeindesä-
len, Vierzig-Sekunden-Interviews fürs Frühstücksradio (»Pat,
ich habe Ihr Buch regelrecht verschlungen, aber ich möchte
Sie heute fragen, wer ist Ihr Favorit für den Super Bowl?«),
sogar ein paar (höflich abgelehnte) Schlafzimmereinladungen
von Buchclub-Hostessen und Möchtegern-Sylvia-Plaths - war
mir vergällt, weil ich alleine war, meilenweit entfernt von
meinem Sohn.
Ich weiß noch, wie Sam mich an einem der Tiefpunkte der
Tour am Telefon gefragt hat: »Wo bist du, Dad?«
»In Kansas City.«
»Wo ist das?«
»Ich weiß nicht so genau. In Kansas vielleicht?«
»Der Zauberer von Oz.«
»Genau. Dorothy. Toto. Over the Rainbow.«
Danach schwiegen wir beide eine Weile.
»Dad?«
»Ja?«
»Weißt du noch, wie Dorothy dreimal die Absätze ihrer
Schuhe gegeneinandergeschlagen hat? Weißt du noch?Und
weißt du noch, was sie gesagt hat?«

Dass Der Sandmann nicht mein eigenes Buch war, machte
es nicht besser. Immer wenn eine enthusiastische Kritik, die
endlose Warteschlange bei einer Signierstunde oder der be-
geisterte Brief eines Highschool-Kids es mich beinahe ver-
gessen ließ, hörte ich Angelas Stimme, hörte, wie sie in Con-
rad Whites Wohnung aus ihrem Notizbuch vorlas, und jeder
Trost, den der Moment mir vielleicht gebracht hatte, war so-
fort wieder dahin.
Außerdem machte ich mir Sorgen, dass man mir auf die
Schliche kommen könnte. Obwohl ich seit der Veröffentli-
chung von Der Sandmann von keinem gehört hatte, war es
durchaus denkbar, dass ein Mitglied des Kensington-Kreises
darauf stoßen, das Quellenmaterial erkennen und sich an die
Presse wenden würde. Oder schlimmer noch, Evelyn oder Len
würden mit meinem Buch in der Hand vor der Tür stehen und
Schweigegeld verlangen. Oder, noch schlimmer: William.
Und ich würde zahlen, egal, wer es war. Ich hatte etwas Ver-
kehrtes getan. Das leugne ich nicht. Aber wenn es je ein Ver-
brechen ohne Opfer gegeben hat, dann dieses. Und damit ich
meine betrügerische, nichtsversprechende Schriftstellerkar-
riere nun still und leise hinter mir lassen konnte, mussten vier
Menschen ein Geheimnis wahren.
Als ich endlich nach Toronto zurückkehrte, ging ich in der
Krypta die Briefe durch, die sich auf meinem Schreibtisch
stapelten, in der Erwartung, dass mindestens einer der Um-
schläge einen Erpresserbrief enthielt. Aber es waren nur die
üblichen Rechnungen.
Das Leben kehrte zu seinem normalen Rhythmus zurück
oder zu dem, was für Sam und mich fortan normal sein würde.
Wir sahen uns eine Menge Filme an, gingen zum Essen aus
und saßen nebeneinander an der Bar. Eine Zeit lang war es
wie ein Urlaub, den sich keiner von uns gewünscht hatte.

Und die ganze Zeit wartete ich darauf, einem Mitglied des
Kreises zu begegnen. Toronto ist eine große Stadt, aber auch
nicht so groß, dass man den Menschen, die man am wenigsten
wiedersehen will, für immer aus dem Weg gehen kann. Ir-
gendwann würde ich erwischt werden.
Ich fing an, Baseballmützen und Sonnenbrillen zu tragen,
wohin ich auch ging. Ich nahm Nebenstraßen und mied
Blickkontakt. Es war, als würde ich wieder vom Sandmann
verfolgt. Jeder Schatten auf den Bürgersteigen der Stadt ein
Loch in der Erde, das nur darauf lauerte, mich zu verschlu-
cken. Und ich fragte mich unwillkürlich, was mich wohl
unten erwartete.

17
Ich hebe meinen Blick von der Seite und blinzle in die
Scheinwerfer. Staubpartikel kreisen wie Atome in den weißen
Strahlen. Falls dahinter Menschen sind, kann ich sie nicht
sehen. Vielleicht haben sie erfahren, dass ich nicht der bin,
der zu sein ich vorgebe, und den Saal voller Abscheu verlas-
sen. Vielleicht sind sie noch da und warten darauf, dass die
Polizei mir Handschellen anlegt.
Aber sie warten nur auf mich. Auf die Worte, die jede Zu-
hörerschaft von Angelas Geschichte braucht, um den Zauber
zu brechen, unter dem sie stand.
»Vielen Dank«, sage ich.
Ich nehme eine gelbe flatternde Bewegung wahr wie den
Flügelschlag eines Kolibris. Hunderte von Händen klatschen.
Sam steht an der Seite der Bühne und lächelt seinen Dad
erleichtert an.
Ich hebe ihn hoch und küsse ihn. »Es ist vorbei«, flüstere
ich. Und er küsst mich, obwohl Leute zusehen, zurück.
»Wir sollten uns zum Signiertisch begeben«, sagt die
Pressefrau und fasst meinen Ellenbogen.
Ich setze Sam ab, damit er von der wartenden Limousine
nach Hause gebracht werden kann, und lasse mich von der
Pressefrau durch eine Seitentür führen. Ein hell erleuchteter
Raum, an dessen anderem Ende nur ein Tisch mit einem Fül-
ler, einer Flasche Wasser und einer einzelnen Rose in einer
Vase steht. Zwei junge Männer hinter einer Registrierkasse.
Um sie herum schwankende Stapel von Der Sandmann. Ein

Cover, das ich schon tausend Mal angesehen habe, ein Name,
den ich mein Leben lang buchstabiert habe, und trotzdem
wirkt es so fremd, als würde ich zum ersten Mal damit kon-
frontiert.
Die Türen zum Saal stehen schon offen, als ich um die
Bänder herumgehe, die die Autogrammjäger in ordentliche
Reihen lenken, was mich immer an Vieh denken lässt, das
zum Schlachten geführt wird. In diesem Fall warte am ande-
ren Ende nur ich. Meine Miene zu einem spöttischen Grinsen
gefroren oder was immer von dem Ausdruck übrig geblieben
ist, der einmal als Lächeln begann.
Und da kommen sie. Keine Meute (es sind schließlich Le-
ser, die letzten Blumenrock, Cord und Jutetaschen tragenden
Verteidiger der Zivilisation), die aber nichtsdestoweniger
leicht übereifrig mit Ellenbogeneinsatz ein Buch erwerben,
mich signieren lassen und dann schnell rauslaufen, bevor auf
dem Parkplatz das Chaos ausbricht.
Wie würde sich diese Arbeit anfühlen, wenn dieses Buch
ganz und gar meins wäre? Verdammt angenehm, vermute ich.
Begegnungen zwischen zunehmend seltenen Vögeln, Autor
und Leser, die ihr gegenseitiges Engagement in einer Art
heimlichen Widerstands bekräftigen. Manchmal gibt es sogar
einen Flirt oder eine Ermutigung extra. Stattdessen besudle
ich nur fremdes Eigentum, viel mehr Vandale als Künstler.
Ich bin jetzt wirklich in Fahrt. Mit gesenktem Kopf blocke
ich jedes aufkeimende Gespräch ab. Ich will nur noch nach
Hause. Bevor Emmie Sam ins Bett gebracht hat. Vielleicht
bleibt sogar Zeit für eine Gutenachtgeschichte.
Ein weiteres Buch wird über den Tisch geschoben. Ich
schlage es auf und sitze mit gezücktem Stift da.
»Was immer du schreibst, speis mich nicht mit irgendei-
nem ›Alles Gute‹ ab.«

Eine Frauenstimme. Frech, spöttisch und noch etwas ande-
res. Oder vielleicht fehlt auch etwas. Die runde Fülle von
Worten, die nicht die Absicht haben zu verletzen.
Ich blicke auf. Das Buch fällt mit einem Seufzer zu.
Vor mir steht Angela, ein kannibalisches Lächeln im Ge-
sicht. Angela, aber eine andere Angela. Ein schickes Kostüm,
eine teure Frisur. Selbstbewusst, forsch und sexy. Angelas
ältere Schwester, die nicht bei einem Autounfall mit einem
geilen alten Romancier ums Leben gekommen ist und ohne-
hin nie verstehen konnte, warum man unbedingt einen Roman
schreiben wollte.
Du bist tot, sage ich beinahe.
»Und? Kein ›Wie läuft’s mit dem Schreiben?‹«, fragt die
lebendige Angela.
»Wie läuft’s mit dem Schreiben?«
»Nicht so gut wie bei dir offensichtlich.«
Die Pressefrau tritt beinahe unmerklich einen halben
Schritt näher an den Tisch. Die Frau hinter Angela drängt
vorwärts, hustet lauter als nötig und tippt mit ihrer Birken-
stock-Sandale auf den Boden.
Angela lächelt weiter, doch irgendetwas an ihrer Haltung
verändert sich. Ihr Lächeln erstarrt in den Mundwinkeln.
»Hast du -?«, setzt sie an und scheint dann den Faden zu
verlieren. Sie beugt sich noch näher. »Hast du einen von ih-
nen gesehen?«
»Ein paar. Hier und da.«
Angela bedenkt meine Antwort, als hätte ich sie vor ein
Rätsel gestellt. Die Frau hinter ihr macht einen ganzen Schritt
vorwärts. Ihr rot angelaufenes Gesicht ist nur noch wenige
Zentimeter von Angelas Schulter entfernt.
»Vielleicht möchten Sie sich nach der Signierstunde mit
Mr. Rush unterhalten?«, schlägt die Pressefrau so freundlich
vor, wie eine klare Warnung klingen kann.
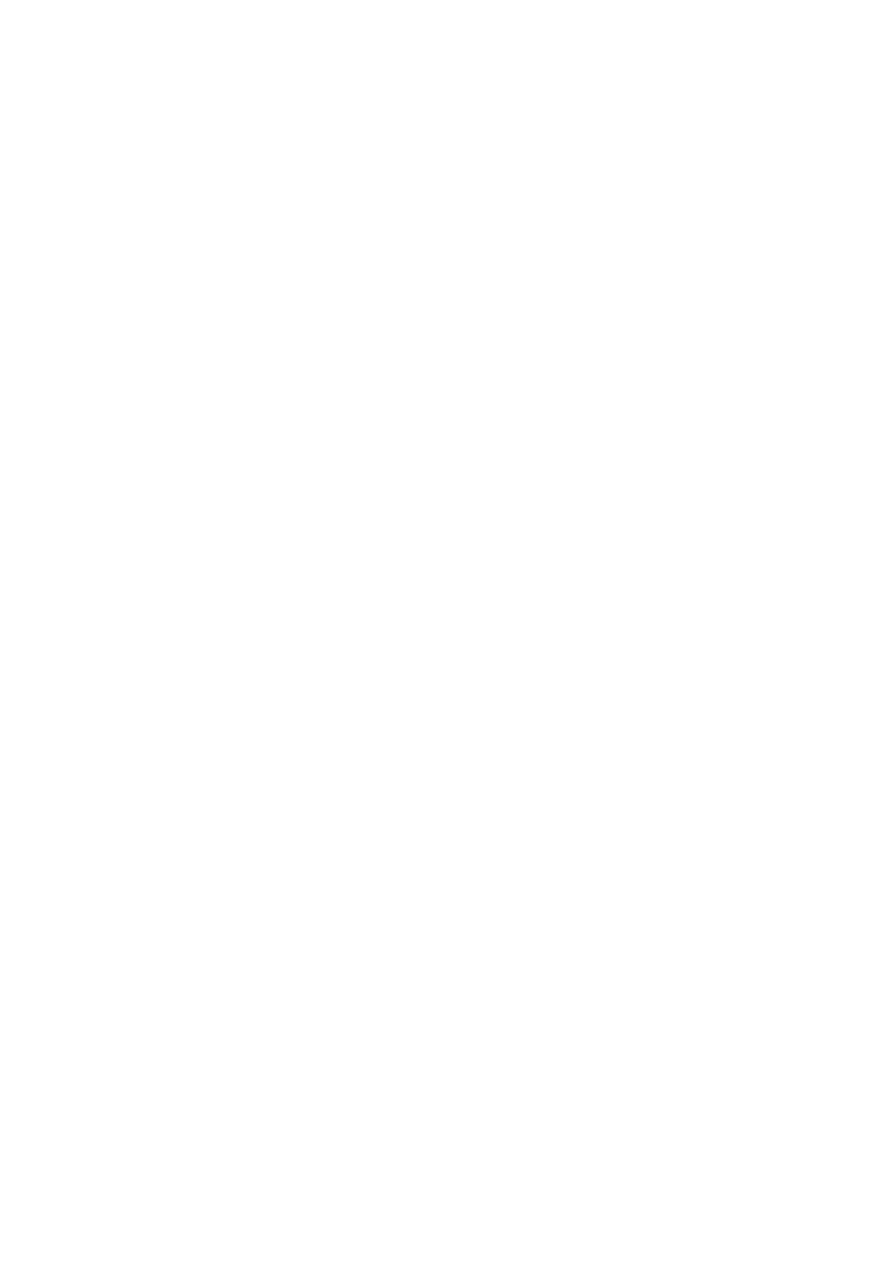
»Ich glaube -«, beginnt Angela neu. Ich frage mich, ob sie
sich innerlich auf irgendeinen Angriff vorbereitet. Ob sie
mich ohrfeigen oder mir eine gerichtliche Vorladung auf den
Tisch knallen will. Aber das ist es nicht. Ihre Worte offenba-
ren, dass sie nicht wütend ist. Sie hat Angst.
»Ich glaube, irgendwas … passiert.«
Die Pressefrau versucht, sich zwischen Angela und den
Tisch zu drängeln. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragt sie und
greift nach Angelas Arm. Aber Angela zuckt zurück, als
würde die Berührung durch einen anderen Menschen ihre
Haut verbrennen.
»Verzeihung. Oh. Verzeihung«, murmelt sie und schiebt
das Buch ein paar Zentimeter näher zu mir. »Ich sollte wohl
das hier signieren lassen.«
Mittlerweile ist die ganze Schlange zappelig geworden.
Die Frau hinter Angela ist neben sie getreten, ein rebellischer
Akt, der droht, eine zweite Schlange zu eröffnen. Aus Furcht
vor dem folgenden Chaos schlägt die Pressefrau das Buch für
mich auf der Titelseite auf.
»So«, sagt sie.
Ich signiere. Zunächst nur meine Unterschrift. Und als ich
dann erkenne, wie hoffnungslos unpersönlich das aussieht,
kritzele ich noch eine Widmung über meinen Namen.
Für die Lebenden Patrick Rush
»Ich hoffe, es gefällt dir«, sage ich und gebe Angela das Buch
zurück. Sie nimmt es entgegen, starrt mich jedoch weiter an.
Die Birkenstock-Frau hat genug gehört. Sie lässt ihr Ex-
emplar von einem Meter Höhe auf den Tisch krachen. Etliche
Wartende halten den Atem an.
Im selben Moment packt Angela mit der freien Hand die
Tischkante und flüstert so leise, dass ich mich aus meinem
Stuhl erheben muss, um sie zu verstehen.
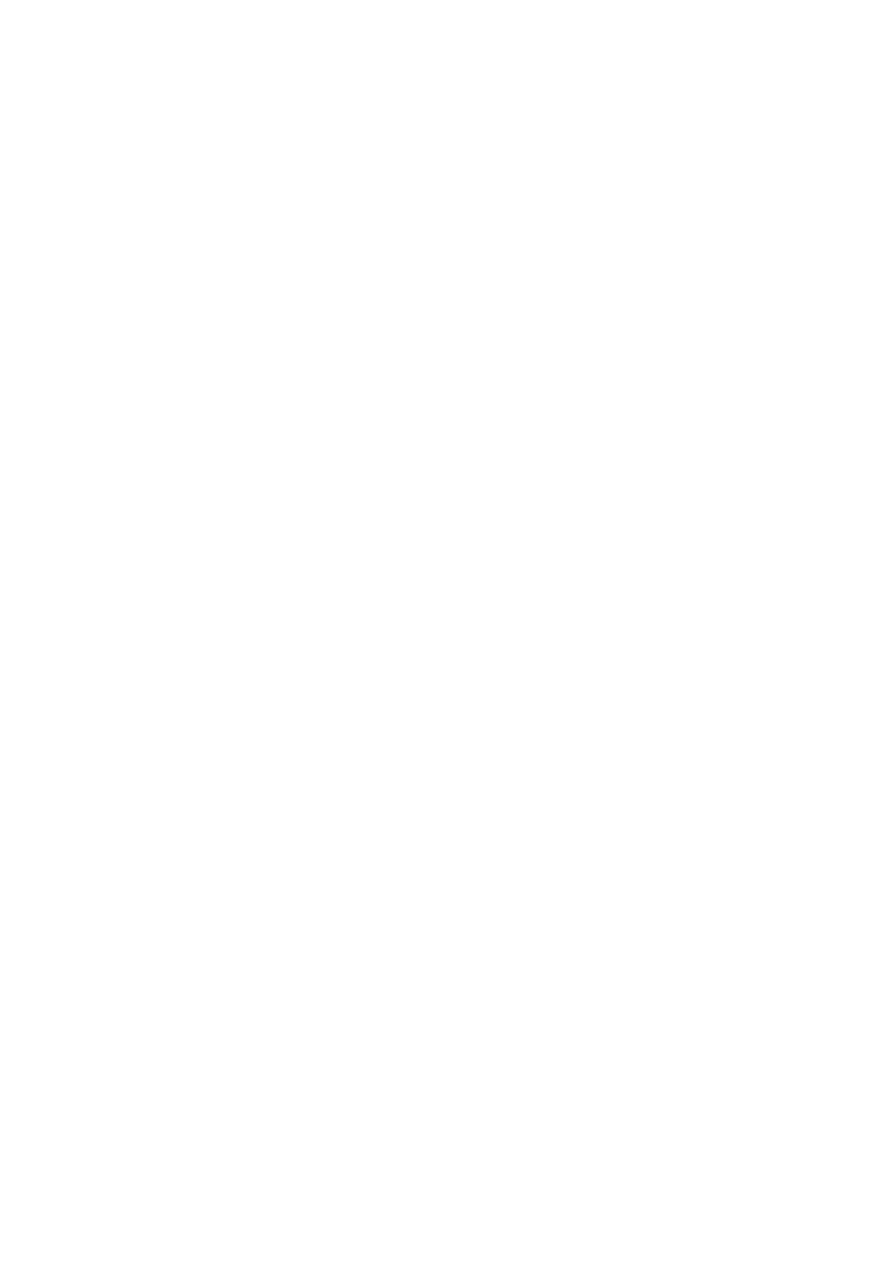
»Ich muss mit dir reden«, sagt sie und streckt mir ihre of-
fene Hand entgegen, sodass mir nichts anderes übrig bleibt,
als die Karte zu nehmen, die sie mir hinhält.
Dann drängt sie sich plötzlich an der Pressefrau vorbei, die
versucht, sie unauffällig in Richtung Ausgang zu bugsieren,
und verschwindet unsicheren Schrittes um die Ecke.
»Es hat mir gefallen«, sagt die Birkenstock-Frau, als meine
Hände wieder ruhig genug sind, ihr Exemplar aufzuschlagen.
»Aber das Ende war ein bisschen unglaubwürdig.«

DRITTER TEIL
Geschichten-Diebe

18
SOMMER 2007
Niemand würde behaupten, dass das Klima zu Torontos Vor-
zügen zählt. Jedenfalls nicht, wenn man Jahreszeiten schätzt,
wie sie normalerweise verstanden werden, als einen viertel-
jährlichen Wechsel. Stattdessen leidet die Stadt unter endlos
langen Monaten schwüler, äquatorialer Hitze und noch länge-
ren Monaten beißender Kälte, jeweils voneinander getrennt
durch drei angenehme Tage hintereinander, die Frühling be-
ziehungsweise Herbst heißen.
Heute Morgen etwa hat mich der Radiowecker mit Nach-
richten über den vierten Hitzealarm des Jahres geweckt, dabei
haben wir gerade mal die erste Juniwoche. In öffentlichen
Gebäuden wurden »Notfall-Abkühlungs-Center« eingerichtet,
wo Fußgänger bis zum Einbruch der Dunkelheit auf die küh-
len Marmorböden sinken können. Der Bevölkerung wurde
geraten, nicht nach draußen zu gehen, keine Sonne an die
Haut zu lassen, sich nicht zu bewegen und nicht zu atmen. All
das sind natürlich hohle Warnungen, da die Leute weiter
arbeiten und, schlimmer noch, zur Arbeit gelangen müssen.
Nachdem ich Sam im Hort abgegeben habe, gehe ich zurück
über die Queen Street. Schweiß läuft mir über die Brust, als
ich die Fahrgäste einer im Stau stehenden Straßenbahn an-
starre, die in verschiedenen Posen stillen Leidens erstarrt sind.
Ich nehme eine Querstraße Richtung College Street, vorbei
an den viktorianischen Doppelhaushälften, alle mit einem

kniehohen Zaun, der ihre Vorgärten schützt, die so klein sind,
dass man den Rasen mit einer Nagelschere mähen könnte. Ich
halte mich nach Möglichkeit im Schatten der Bäume. Aber es
ist nicht nur die Hitze, die meine Schritte verlangsamt: Ich bin
auf dem Weg zu meinem Treffen mit Angela.
Auf der Karte, die sie mir bei der Signierstunde in Har-
bourfront zugesteckt hat, standen nur eine handschriftlich no-
tierte Handynummer und ein eindringliches Ruf mich an. Ich
wollte es nicht tun. Das heißt, ich war mir bewusst, dass jeder
weitere Kontakt zu einer Frau, der ich strafbares Unrecht an-
getan hatte und die, wenn man Zeitungsberichten glauben
konnte, nicht mehr unter den Lebenden weilte, zu nichts Gu-
tem führen konnte.
Selbst als ich jetzt mit von der Hitze weichen Knien wie
ein Betrunkener zur Mittagszeit über den Bürgersteig torkle,
weiß ich nicht genau, warum ich doch angerufen habe. Es
muss derselbe Impuls gewesen sein, der mich die Aufnahme-
taste drücken ließ, als ich sie zum ersten Mal lesen hörte. Der
Grund, weshalb ich weiter zu den Treffen des Kreises ging,
obwohl sie offensichtlich nutzlos waren. Der uralte Fluch der
Neugierigen, der vorwitzigen Gaffer, der geborenen Leser.
Wir haben uns im Kalendar verabredet, einem Café mit Plät-
zen im Freien. Als ich jetzt den nur halb im Schatten der
Markise liegenden Tisch auswähle, wünschte ich, wir hätten
eine dunkle Kellerkneipe als Treffpunkt ausgewählt. Da ich
als Erster hier bin, nehme ich den weiter im Schatten liegen-
den Stuhl. Als die Sonne später weitergewandert ist und mei-
nen Kopf von der Seite mit Feuerlaserstrahlen bombardiert,
während der andere Platz komfortabel beschattet ist, werde
ich meinen Fehler erkennen. Im Moment jedoch bestelle ich
ein vorsätzlich spaßfreies Mineralwasser und gebe mich noch

der Illusion hin, die Ereignisse, die auf mich zurasen, unter
Kontrolle zu haben.
Als eine junge Frau kommt, mich entdeckt und mit einem
schüchternen Lächeln hinter ihrer verspiegelten Sonnenbrille
an meinen Tisch tritt, vermute ich zunächst, dass sie ein Fan
ist. Im Laufe der letzten Monate ist es schon hin und wieder
vorgekommen, dass Fremde mich auf Der Sandmann ange-
sprochen haben. Einige von ihnen gehen nicht wieder, son-
dern wollen mehr - die Einsamen, die Beschwipsten, die Ver-
rückten. Und ich versuche zu entscheiden, in welche Katego-
rie sie gehört, als sie sich an meinen Tisch setzt. Ich will ihr
sagen, tut mir leid, aber ich warte auf jemanden, als sich ir-
gendetwas in ihrem Gesicht verändert, eine zitternde An-
spannung über den Wangen, und ich erkenne, dass sie keine
Fremde ist.
»Ich schätze, wir haben uns noch nie bei Tageslicht gese-
hen«, sagt Angela und betrachtet mich. Ich wünschte, ich hät-
te ebenfalls eine Sonnenbrille mitgebracht.
»Stimmt.«
»Du siehst anders aus.«
»Das ist bloß der Hitzschlag.«
Sie wirft einen Blick auf mein Mineralwasser. »Nehmen
wir einen richtigen Drink?«
»Jetzt schon.«
Nachdem mein Wasser mit einem Schuss Wodka aufge-
peppt und Angela ein Glas Weißwein gebracht worden ist,
reden wir ein wenig darüber, wie wir die letzten Jahre ver-
bracht haben. Nach einer Reihe von Sekretärinnenjobs hatte
Angela beschlossen, etwas Dauerhafteres anzustreben, und an
einem Community College einen Abschluss in Rechtspflege
gemacht, der ihr einen Job in einer Kanzlei in der Bay Street
eingebracht hat. Ihrem Boss hat sie erzählt, sie müsse drin-
gend zum Zahnarzt.

»Deswegen kann ich mir auch ein paar davon genehmi-
gen«, sagt sie und führt das Weinglas an die Lippen. »Lach-
gas.«
Der Kellner kommt, um unsere Bestellung aufzunehmen.
Angela fragt nach einem bestimmten Salat, und ich nehme das
Gleiche (bei meinen Nerven kann ich sowieso nichts essen,
sondern nur trinken, sodass es relativ egal ist, was man mir als
Requisite vorsetzt). Als er wieder gegangen ist, sieht Angela
mich an. Derselbe prüfende Blick, bei dem ich sie ein paarmal
in dem Kreis ertappt habe. Ich stehe nicht auf und gehe nach
Hause, ich wende auch nicht mein Gesicht ab oder renne auf
die Herrentoilette, um meine Handgelenke unter kaltes Was-
ser zu halten (lauter Dinge, die ich gern tun würde). Sie weiß
schon zu viel. Mein Verbrechen natürlich. Aber auch andere
Dinge. Was hatte sie mir zugeflüstert, als sie aus dem Nichts
wieder auftauchte, auferweckt von den Toten?
Irgendwas passiert.
Aber eine Zeit lang lassen uns die Sonne, der seltene Luxus
eines Mahls im Freien am helllichten Tag und die erste Kan-
ten glättende Wirkung des Alkohols plaudern wie ein Pärchen
bei einem Blind Date, das viel besser läuft als erwartet. An-
gela scheint sogar regelrecht froh, hier zu sein. Wie eine aus
dem Gefängnis entflohene Strafgefangene, die nie geglaubt
hätte, so weit zu kommen.
Unsere Salate kommen. Aggressiv gesund aussehende
Nester aus Radicchio, Roter Beete und Kichererbsen, norma-
lerweise etwas, das ich mit einer Serviette zudecken würde,
vom Verzehr gar nicht zu reden. Aber die Illusion, nichts von
ihr befürchten zu müssen, hat mich unvermittelt hungrig ge-
macht. Ich stoße meine Gabel herab, und als sie auf halbem
Weg zu meinem Mund ist, spricht Angela die Worte aus, von
denen ich gedacht hätte, wir würden sie meiden.
»Ich habe dein Buch gelesen.«

Die Gabel sinkt wieder auf den Teller, und eine Kicher-
erbse sucht ihr Heil in der Flucht.
»Nun ja. Natürlich. Und ich vermute, du hast erkannt, dass
ich gewisse Elemente … geborgt habe.«
»Du hast meine Geschichte gestohlen.«
»Darüber lässt sich bis zu einem gewissen Punkt streiten.
Ich meine, die Handlung -«
»Patrick.«
»- musste noch erheblich erweitert werden, ganz zu
schweigen von der erforderlichen Einbildungskraft für -«
»Du hast meine Geschichte gestohlen.«
Diese Sonnenbrille. Sie hindert mich daran zu erkennen,
wie ernst es ihr ist. Ob ich mir jetzt lediglich gezischte Vor-
würfe anhören oder den Rest ihres Weins aus dem Gesicht
wischen muss oder Schlimmeres. Ein Messer, das meine
Hand an die Tischplatte nagelt. Die Erwähnung von Anwäl-
ten.
»Du hast recht. Ich habe deine Geschichte gestohlen.«
Das sage ich. Ich muss es sagen. Aber zu dem, was ich als
Nächstes sage, zwingt mich niemand. Es folgt mit dem un-
aufhaltsamen Zusammenbruch, der vollen Wucht der Kon-
frontation mit dem Menschen, dem ich Unrecht getan habe
und der kaum einen Meter entfernt sitzt.
»Ich wollte einfach ein Buch schreiben. Aber ich hatte kein
Buch. Und dann habe ich dich bei Conrad lesen hören, und es
hat mich nicht mehr losgelassen. Dein Tagebuch, deine No-
velle, was auch immer - es wurde zu einer Obsession. Der
Tod meiner Frau lag schon eine Weile zurück - Gott, das jetzt
auch noch -, und ich brauchte irgendwas. Ich brauchte Hilfe.
Also fing ich an zu schreiben. Und als ich dann von deinem
Autounfall erfahren habe, dachte ich … ich dachte, es wäre
mehr unsereals nur deine Geschichte. Aber das war falsch. Ich

habe mich in alldem geirrt. Und jetzt … jetzt? Jetzt tut es mir
bloß noch leid. Es tut mir wirklich sehr leid.«
Mittlerweile haben einige Gäste die Köpfe in unsere Rich-
tung gewandt und beobachten, wie ich mir mit einer Serviette
die Nase schnäuze, die ich unter dem Besteck auf dem Nach-
bartisch wegziehe.
»Weißt du was?«, sagt sie schließlich. »Eigentlich hat es
mir ganz gut gefallen.«
»Es hat dir gefallen?«
»Was es über dich gesagt hat. Dadurch bist du so viel inte-
ressanter geworden.«
»Durch das, was ich geschrieben habe.«
»Durch das, was du getan hast.«
Mein fragender Blick lässt Angela weitersprechen.
»In dem Kreis warst du der Einzige, der keine Geschichte
zu erzählen hatte. Die meisten Menschen glauben zumindest,
sie hätten eine Geschichte. Aber du bist die ganze Zeit davon
ausgegangen, dass du absolut nichts Romanfigurenhaftes an
dir hast. Und was machst du? Du stiehlst meine Geschichte.
Pappst ein Ende dran. Veröffentlichst sie. Und dann bedauerst
du das Ganze! Das ist beinahe tragisch!«
Sie nimmt den ersten Bissen von ihrem Salat. Als der
Kellner nach uns sieht (mit einem Blick falscher Fürsorge für
mich, den verwirrten Typen, der schon jetzt einen Sonnen-
brand auf der Stirn hat), bestellt Angela noch eine Runde für
uns beide. Rache, außergerichtliche Einigungen und öffentli-
che Demütigungen werden mit keinem Wort erwähnt. Sie isst
nur ihren Salat und trinkt ihren Wein, als wäre alles Notwen-
dige in der Sache gesagt.
Als sie fertig gegessen hat, lehnt sie sich zurück und mus-
tert mich von Neuem. Meine Anwesenheit scheint sie an ir-
gendetwas zu erinnern.

»Ich schätze, ich schulde dir umgekehrt auch eine Erklä-
rung«, sagt sie.
»Du schuldest mir gar nichts.«
»Nein, aber du hast es wahrscheinlich trotzdem verdient,
zu erfahren, wie es kommt, dass ich nicht tot bin.«
Sie erzählt mir, wie sie gehört hat, dass Conrad in Beglei-
tung eines Mädchens bei einem Autounfall ums Leben ge-
kommen sei, ein Mädchen, von dem man annahm, dass sie es
gewesen wäre. Angela hatte ihn zu der Zeit ein paarmal ge-
troffen (»Wir haben meinen Text noch einmal gründlich be-
sprochen«) und ihre Handtasche in seinem Wagen liegen las-
sen - mittels derer die Polizei das zweite Opfer identifiziert
hatte. Die Polizei ging der Sache nicht weiter nach und hatte
auch wenig Grund dazu. Die Frau in dem Auto hatte so
schlimme Verletzungen, dass ein Vergleich mit den Fotos in
Angelas Ausweisen ohnehin nicht mehr möglich war. Das
mutmaßliche Opfer Angela Whitmore war in den zurücklie-
genden Jahren häufig umgezogen, von Job zu Job, Küste zu
Küste und zurück, sodass die Behörden nicht überrascht wa-
ren, als sie keine aktuelle Adresse ermitteln konnten, weil die
Frau vermutlich keinen festen Wohnsitz gehabt hatte. Auch
ihre Beziehung zu Conrad White wurde nicht weiter unter-
sucht. Der alte Mann hatte bekanntermaßen die Gesellschaft
viel jüngerer Frauen gesucht. Aller Wahrscheinlichkeit nach
hatten Conrad und Angela sich gemeinsam auf eine Landpar-
tie, eine schmutzige Lolita-artige Odyssee gemacht, die auf
einem kurvenreichen, einsamen Highway schon in der ersten
Nacht ihr Ende gefunden hatte.
Nachdem sie mir all das berichtet hat, verändert sich An-
gelas Haltung. Sie schirmt ihr Gesicht von der Straße ab, ver-
steckt sich hinter ihren Haaren. Die spielerische Leichtigkeit,
mit der sie das Thema meines Geschichten-Diebstahls erst

aufgebracht und dann gleich wieder verworfen hat, ist einer
ängstlichen Starre gewichen.
»Wenn du es nicht warst, wer war dann mit ihm in dem
Wagen?«
Angela packt die Tischkante so fest mit beiden Händen,
dass ihre Fingerknöchel bleich werden.
»Niemand weiß es genau«, sagt sie. »Aber ich bin mir
ziemlich sicher, dass es Evelyn war.«
»Evelyn?«
»Die beiden waren oft zusammen in der Zeit, als der Kreis
sich getroffen hat. Und sie ist auch hinterher noch in seine
Wohnung gekommen.«
»Hast du sie beschattet?«
»Wenn überhaupt, hat sie mich beschattet.« Angela nimmt
ihr Weinglas, doch ihre Hände zittern so heftig, dass sie es
wieder auf den Tisch stellt, ohne einen Schluck zu trinken.
»Ich war manchmal auch da. Eine Zeit lang habe ich die
Aufmerksamkeit genossen. Dann wurde es nur noch sonder-
bar, und ich bin nicht mehr hingegangen. Aber davor kam
Evelyn oft vorbei. Ich bin dann meist nicht mehr lange ge-
blieben. Ich hatte das Gefühl, sie wollte mich nicht dabeiha-
ben.«
»Hattest du eine Ahnung, warum sie sich mit ihm trifft?«
»Nein, eigentlich nicht. Es kam mir vor, als hätten die bei-
den ein Geheimnis. Als ob sie gemeinsam an etwas arbeiten
würden.«
»Und deshalb glaubst du, dass das im Wagen ihre Leiche
war.«
»Ich hab noch ein bisschen weiterrecherchiert. Nach dem
ersten Bericht in der örtlichen Zeitung -«
»Der Ausschnitt, den du mir geschickt hast.«
Angela legt den Kopf zur Seite. »Ich hab dir gar nichts ge-
schickt.«

»Irgendjemand hat ihn mir geschickt. Ohne Absender.«
»So habe auch ich von der Sache erfahren.«
Unwillkürlich würde ich darüber gern mehr wissen - wenn
sie den Ausschnitt nicht geschickt hat, wer dann? -, aber wenn
ich sie noch weiter ablenke, macht sie vielleicht ganz dicht.
Sie sieht schon jetzt auf ihre Uhr und überlegt, wie lange sie
noch bleiben kann.
»Okay, du hast also weiterrecherchiert«, sage ich.
»Weil ich dachte, dass es Evelyn war, mir jedoch nicht si-
cher war. Und dann wurde in einem späteren Bericht erwähnt,
dass das einzige besondere Merkmal an der Leiche der Frau
eine Tätowierung sei. Ein Rabe.«
»Auf ihrem Handgelenk. Ich erinnere mich.«
»Ich weiß, ich hätte mich melden sollen. Evelyns Familie
sucht wahrscheinlich immer noch nach ihr.«
»Und warum hast du es nicht getan?«
»Ich glaube, anfangs habe ich es als Chance gesehen, mein
altes Ich, ich weiß nicht, zurückzulassen. Nochmals von vorne
anzufangen. Weißt du, was ich meine?«
»Es ist noch nicht zu spät. Du könntest es der Polizei jetzt
sagen. Reinen Tisch machen.«
»Das kann ich nicht.«
»Es ist schließlich nicht so, als hättest du ein Verbrechen
begangen.«
»Nicht deshalb.«
»Das verstehe ich nicht. Jemand stirbt - eine Bekannte von
dir stirbt mit deinem Namen auf dem Schild an ihrem Zeh,
und du lässt die Menschen, denen etwas an ihr liegt, mit der
Lüge leben, dass sie noch irgendwo da draußen sein könnte?
Dass Evelyn noch leben könnte? Ich möchte mich bestimmt
nicht moralisch über irgendjemanden erheben - du weißt, dass
ich das nicht kann. Aber was du machst, tut Menschen weh,
mit denen du nichts zu tun hast.«

Angela nimmt die Sonnenbrille ab. Ihre Blicke schießen
von einem Rand ihres Gesichtsfelds zum anderen. Bisher hat
ihre Stimme ihre Panik beinahe überdeckt, aber jetzt sind es
ihre Augen, die sie verraten.
»Nach dem Unfall habe ich verschiedene Namen ange-
nommen«, sagt sie. »Habe meinen Wohnort, mein Aussehen
und den Job gewechselt. Es war, als wäre ich verschwunden.
Und ich musste verschwinden.«
»Warum?«
»Weil ich gejagt wurde.«
Der Kellner, der uns in den vergangenen Minuten von der
anderen Seite der Terrasse beobachtet hat, kommt an unseren
Tisch und fragt, ob er uns Kaffee oder ein Dessert bringen
kann.
»Nur die Rechnung«, sagt Angela und reißt hektisch ihre
Handtasche auf.
»Bitte. Das geht auf mich«, sage ich abwinkend, und die
gewaltige Untertreibung dieser Geste in Anbetracht der Um-
stände entlockt mir ein ersticktes schuldbewusstes Lachen.
Aber Angela ist zu aufgewühlt, um mit einzustimmen.
»Hör zu, Patrick. Ich glaube nicht, dass ich dich noch ein-
mal treffen kann. Deshalb sage ich dir besser jetzt, was ich dir
sagen wollte.«
Sie blinzelt in die Sonne, die ihre Strahlen jetzt gleichmä-
ßig auf uns verteilt. Einen kurzen Moment lang frage ich
mich, ob sie, nachdem sie nun endlich dazu gekommen ist,
ihre ursprüngliche Botschaft vergessen hat. Aber das ist es
nicht, was sie zögern lässt. Sie sucht nur nach der schlichtes-
ten Art, es auszudrücken.
»Nimm dich in Acht.«
»Vor wem?«
»Zuvor hat er nur von ferne beobachtet. Aber jetzt … jetzt
ist es anders.«

Der Kellner bringt die Rechnung und bleibt stehen, bis ich
die Kreditkarte aus meiner Brieftasche gezückt und auf das
Tablett geworfen habe, bevor er widerwillig abzieht. Derweil
ist Angela aufgestanden.
»Warte. Nun warte doch einen Moment. Wer ist ›er‹?«
»Glaubst du wirklich, du bist der Einzige?«
»Was willst du mir sagen?«
»Der Sandmann«, antwortet sie und verschwindet wieder
hinter ihrer Sonnenbrille. »Er ist zurück.«

19
Am nächsten Morgen weigere ich mich, in Gedanken noch
einmal auf das Mittagessen mit Angela zurückzukommen,
außer um mich daran zu erinnern, dass sie offenbar keinerlei
Absichten hat, mich zu verklagen. Das ist gut. Und was die
anderen Sachen betrifft, gebe ich mir alle Mühe, sie zu ver-
drängen.
Das Leben braucht neue Rituale, neue Gewohnheiten, die
Sam und ich so lange wiederholen können, bis sie für die Ta-
ge, die kommen, einen Pfad markiert haben, dem wir folgen
können. Beginnend mit dem Essen. Statt der improvisierten
Mahlzeiten, von denen wir überlebt haben - Verlegen-
heits-Mitnahme-Menüs aus Schnellrestaurants, Suppen aus
der Dose vom Laden an der Ecke, Fruit Loops -, mache ich
mich mit Sam auf, richtige Vorräte anzulegen.
Wir fahren zu dem Supermarkt am Hafen, wo die alten
Lagerhäuser und Schuppen in Nachtclubs und Eigentums-
wohnungen umgewandelt werden. Hier gehen wir einkaufen
oder haben es früher zumindest immer getan. Es ist schon eine
Weile her.
Aber es ist noch alles da. Das zu Pyramiden gestapelte
Obst und Gemüse, warme Gerichte für die Mikrowelle, Gänge
voller Nahrungsmittel für all die, die nicht auf das Preisschild
schauen müssen. Sam und ich packen im Vorbeigehen Sachen
in unsere Körbe. Das Warenangebot ist gigantisch. Alles, was
das nordamerikanische Herz begehrt.

»Deswegen hasst uns der Rest der Welt«, erkläre ich Sam.
Er blickt zu mir auf und nickt, als hätten wir ein und densel-
ben Gedanken gehabt.
Später, nachdem unsere Einkäufe verstaut sind, wird mir
an meinem Schreibtisch in der Krypta bewusst, dass ich nichts
zu tun habe. Keinen Artikel, keinen angefangenen Roman,
keine Abgabefrist für eine Kritik. Bis zum Mittagessen bleibt
noch eine Stunde totzuschlagen, also schalte ich den Compu-
ter ein, um mich einem Moment virtueller Masturbation hin-
zugeben: Ich google mich selbst.
Und wie immer taucht als erster Treffer meine offizielle
Website auf. Auf der von der Marketingabteilung meines
Verlags gestalteten Seite www.patrick.rush.com gibt es auch
eine Seite für Kommentare, die ich gelegentlich anklicke. Die
Leute, die dort etwas schreiben, sind meistens Vertreter eines
von zwei extremen Lagern: glühender Fan oder mit Dreck
schmeißender Kritiker. Letzterer bevorzugt die Textgattung
sprudelnde Tirade in Großbuchstaben, die den Bildschirm ein
paar Stunden lang besudelt, ehe der Webmaster dazukommt,
sie zu löschen. Was mich jedoch heute Morgen erwartet,
alarmiert mich ungleich mehr.
Keine zusammenhanglosen Schmähungen, keine korin-
thenkackerischen Korrekturen oder Geld-zurück-Forderung.
Nur ein einziges anklagendes Wort.
Dieb.
Weiter hat der Absender nichts hinzugefügt. Angegeben ist
nur sein oder ihr User-Name: therealsandman.
Es könnte bloßer Zufall sein - die spezifische Beschuldi-
gung zeitgleich mit Angelas Überzeugung, dass der Sand-
mann zurückgekehrt ist, die durch den User-Namen angedeu-

tete Identität -, aber ich bin mir sicher, es ist jemand, der es
weiß.
Ich antworte sofort. Das erfordert das Anlegen eines eige-
nen User-Profils: braindead29.
Warum hast du Angst, deinen richtigen Namen zu benut-
zen?
Ich lese die Frage noch einmal durch und erkenne, dass sie
viel zu freundlich und verständlich formuliert ist. Ich versuche
mich an einer Übersetzung in Blog-Sprech:
Warum ham Arschloecher wie du Angst ihrn echten Na-
men zu nehmen???????
Schon besser.
Ich drücke auf Senden und lehne mich auf meinem Stuhl
zurück, zuversichtlich, dass therealsandman vor dieser direk-
ten Parade zurückweichen wird. Doch die Antwort erfolgt
binnen Sekunden.
Du hast noch keine Ahnung, was Angst ist.
Rückblickend hat es mich gar nicht so sehr überrascht, dass
Angela bei meiner Signierstunde aufgetaucht ist, obwohl das
in Anbetracht ihres Ablebens eigentlich unmöglich war. Viel-
leicht lag es daran, dass ich in den zurückliegenden Jahren so
viel über einen Geist geschrieben habe, dass ich mich schlicht
daran gewöhnt hatte, die Toten zu sehen.
Oder vielleicht auch nicht.
Während Sam am Nachmittag bei seinem Kin-
der-Kultursommer-Workshop in Trinity-Bellwoods mit Fin-
gerfarben malt, ein Theaterstück einstudiert oder ein Gedicht
schreibt, gehe ich in die Bloor Street, um mir ein Buch zu
kaufen. Vielleicht kann ich nicht mehr schreiben, aber das
sollte mich nicht davon abhalten zu lesen. Ich denke an ein

Sachbuch, etwas, das man bei einem Abendessen anbringen
kann (für den Fall, dass ich je zum Abendessen eingeladen
werde). Das Abschmelzen der Polkappen beispielsweise oder
der Aufstieg atomarer Schurkenstaaten. Leichte Lektüre.
Guten Mutes, mir durch die Begegnung mit therealsand-
man nicht völlig den Tag vermiesen zu lassen, steuere ich
Book City an. Die Stapel mit Neuerscheinungen und die
Kunden, die ein Buch aufschlagen, um die ersten paar Sätze
zu lesen, heben meine Laune. Ein Gefühl der Kameraderie
erfüllt mich. Hierher gehöre ich, zu den anonymen Schmö-
kernden. Und hierher darf ich vielleicht zurückkehren, wenn
ich wieder in meine Identität als bebrillter Schluffi schlüpfen
kann, anstatt jemand wie Angela zu sein, der glaubt, er würde
gejagt.
Ich habe mich beinahe selbst überzeugt, als ich ihn sehe.
Ich bin den neuen Romanen aus dem Weg gegangen und
schnurstracks zu dem Sachbücher-über-die-man-spricht-Tisch
im hinteren Teil gegangen. Ich nehme ein Buch, verberge
mein Gesicht hinter dem aufgeschlagenen Einband und er-
laube mir einen verstohlenen Blick durch den Laden. Sofort
fällt mir ein Mann ins Auge, der mein Buch in der Hand hält.
Er steht im Profil vor dem Schaufenster, im Hintergrund die
sonnenüberflutete Bloor Street, das Buch irgendwo in der
Mitte aufgeschlagen, und verzieht missbilligend das Gesicht.
Conrad White. Mein Schreiblehrer, der offenbar überhaupt
nicht glücklich über die veröffentlichten Ergebnisse seines
schlechtesten Schülers ist.
Er wendet den Kopf.
So abrupt, dass mich der Blick aus seinen hohlen Augen
sofort trifft. Seine aschfarbene Haut legt sich in tiefe Falten,
und er sieht mich so vorwurfsvoll an, dass er aussieht wie ein
knurrendes Tier.
Erst nach einem Moment fällt mir ein, dass er tot ist.

Und im selben Augenblick stoße ich mit der freien Hand
einen Stapel Bücher vom Tisch. Ein Haufen Reiseführer pur-
zelt zu Boden. Ich falle mit rudernden Armen hinterher und
versuche, mich auf den rutschigen Taschenbüchern wieder
aufzurichten.
»Mein Gott, haben Sie sich wehgetan?«, fragt ein Verkäu-
fer und eilt hinter der Registrierkasse hervor.
»Nein, alles okay. Ich bin bloß … tut mir leid wegen … ich
bezahle den Schaden …«, stammle ich und blicke zu der
Stelle, wo Conrad White gestanden hat.
Aber da ist niemand mehr. Das Buch, in dem er gelesen
hat, liegt schräg zuoberst auf dem Stapel.
Nachdem ich erkannt worden bin und die Einladung des Ver-
käufers abgelehnt habe, seinen in Arbeit befindlichen Roman
zu lesen (»Was ich wirklich brauche, sind Beziehungen, wis-
sen Sie?«), schleiche ich aus dem Laden in die widerliche
Hitze. Die ausländischen Studenten und Chardon-
nay-Althippies aus dem Viertel gehen an mir vorbei, während
ich mich verwirrt zu orientieren suche. In der Hand trage ich
eine Tüte mit meinem Ablass-Kauf, das erste Buch, das mir
neben der Kasse in die Hände fiel und das sich als leer und
unbetitelt erwies. Ein Notizbuch, das mir bei der Arbeit an
meinem nächsten Buch nützen würde, vermutete der Verkäu-
fer.
»Es wird kein weiteres Buch geben«, fuhr ich ihn an.
Auf meinem Weg in die Innenstadt, wo ich Sam abhole,
frage ich mich erneut, ob das Sehen von Gespenstern Symp-
tom einer ernsthafteren Störung ist. Unverarbeitete Trauer, die
deshalb zu einem ausgewachsenen psychotischen Zusam-
menbruch geführt hat. Akuter posttraumatischer Stress wo-
möglich (denn was sind der Verlust von Ehefrau und Job so-
wie die Besudelung der einzigen Ambition, wenn nicht ein

Trauma?). Vielleicht brauche ich Hilfe. Vielleicht ist es schon
zu spät.
Aber der alte Mann hatte so echt ausgesehen, fünf Meter
entfernt, ohne verschwommene Konturen oder spektrales
Schweben, wie man sie den meisten Erscheinungen zu-
schreibt. Es war Conrad White, tot und tot aussehend. Aber
trotzdem da.
Als ich den relativ kühlen Schatten der Bäume in Trini-
ty-Bellwoods erreiche, habe ich einen Entschluss gefasst.
Wenn meine geistige Gesundheit sich schon verabschiedet, ist
es meine Aufgabe, dies für mich zu behalten. Sam hat schon
einen Elternteil verloren. Ein verrückter Vater, der auf ihn
aufpasst, ist immer noch besser als gar keiner.
Von jenseits des provisorischen Zauns, der um das Kin-
der-Kultursommer-Lager auf dem Spielplatz errichtet ist, be-
obachte ich Sam, der auf dem Pilotensitz eines aus Holzresten
gebastelten Flugzeugs ein Buch liest. Er hebt den Blick von
den Seiten und sieht in meine Richtung. Ich winke, aber er
winkt nicht zurück. Ich bin sicher, dass er mich gesehen hat,
und frage mich einen Moment lang verwirrt, ob es wirklich
Sam ist. Und dann fällt mir wieder ein, dass mein Sohn lang-
sam in das Alter kommt, wo die eigenen Eltern peinlich wer-
den. Er will nicht, dass die anderen Kinder sehen, dass sein
Vater mit einer doofen Büchertüte in der Hand dasteht und
winkt.
Aber auf dem Nachhauseweg kommt er mit einer anderen
Erklärung. Sam hat nicht gewunken, weil ihn von der anderen
Seite des Zauns ein fremder Mann angestarrt hat.
»Das war ich.«
»Nicht du, Daddy. Dich habe ich gesehen. Der andere
Mann. Hinter dir.«
»Hinter mir war niemand.«
»Hast du geguckt?«

»Was willst du zum Abendessen?«
»Hast du? Hast du ihn geseh-«
»Wir haben zu Hause Hühnchen, Lasagne, diese fertigen
Tacos. Los. Nenn mir das Gift deiner Wahl.«
»Okay. Hamburger. Zum Mitnehmen.«
»Aber wir haben doch heute Morgen die ganzen Lebens-
mittel gekauft.«
»Du hast gefragt, was ich haben möchte.«
Nach dem Essen höre ich den Anrufbeantworter ab. Drei
Telefonverkäufer, ein Anrufer, der gleich wieder aufgelegt
hat, zwei vollkommen Fremde, die fragen, ob ich ihre Manu-
skripte an meinen Agenten weitergeleitet habe, und Tim Ear-
heart, der wissen will, ob »der große Schriftsteller« Lust hat,
»irgendwann mal einen saufen zu gehen«. Außerdem Petra
Dunn aus dem Kreis, die geschiedene Gattin aus Rosedale.
Sie sagt, es täte ihr leid und sie wolle nicht aufdringlich sein,
meint jedoch, es wäre wichtig. Wir müssten uns unbedingt
unterhalten.
Ich notiere ihre Nummer und beschließe, heute Abend
nicht mehr zurückzurufen. Ein Rückzug ins Bett scheint mir
das Beste. Sam gute Nacht sagen, ein paar Absätze von ir-
gendwas überfliegen und, wenn alles gut läuft, in einen
traumlosen Schlaf sinken. Das Problem ist, dass ich am
Nachmittag kein Buch zum Lesen gekauft habe, sondern eins
zum Schreiben.
Vielleicht breche ich damit ein mir selbst gegebenes Ver-
sprechen, aber ich denke mir, es kann keinen großen Schaden
anrichten, sich ein paar Notizen zu machen. Ich nehme No-
tizbuch und Stift mit ins Bett und beginne zu schreiben.
Stichpunkte, die die Ereignisse abdecken, seit Angela bei der
Signierstunde aufgetaucht ist. Danach gehe ich zum Anfang
des Kreises zurück, zu meiner ersten Begegnung mit der Ge-

schichte des Sandmanns und der Zeit der Morde vor vier Jah-
ren. Ich schreibe eigentlich gar nicht, sondern trage nur Fak-
ten und Eindrücke zusammen. Wenn ich die Götter erzürnt
habe, weil ich eine Geschichte gestohlen habe, kann doch
zumindest diese ungeschönte Chronik meines eigenen Lebens
kein Vergehen sein.
Aber selbst in diesem Punkt irre ich.
Ein Geräusch aus dem Erdgeschoss.
Etwas, das mich aus diesem Zwischenzustand weckt, bei
dem man eindöst, ohne sich dessen bewusst zu sein. Ein
Klappern, gefolgt von einem winzigen Widerhall, der bestä-
tigt, dass sein Urheber so schwer ist, dass man die üblichen
Verdächtigen in puncto seltsame nächtliche Geräusche aus-
schließen kann, ächzende Bodendielen oder Mäuse hinter den
Wänden. Zuerst denke ich, es war ein Vogel, der die durch-
sichtige Schiebetür zur Terrasse mit dem Nachthimmel ver-
wechselt hat. Und es hätte auch ein Vogel sein können, wenn
da nicht das folgende Geräusch wäre. Das schrille Kratzen
von Fingernägeln auf Glas.
Ich ziehe Boxershorts und T-Shirt an, die zerknüllt neben
dem Bett liegen, und sehe nach Sam. Er schläft fest. Ich ziehe
seine Tür zu und schlurfe zum Treppenabsatz. Man hört nur
das übliche Ächzen und Seufzen eines alten Hauses und, mei-
lenweit entfernt, leises Donnergrollen.
Im Erdgeschoss kann ich keine Spuren eines Eindringlings
entdecken, aber warum auch? Wenn jemand sich mit der Ab-
sicht, uns etwas anzutun, gewaltsam Zutritt zum Haus ver-
schafft hat, wäre es wenig sinnvoll, unterwegs Beistelltische
umzustoßen oder den Spiegel im Flur zu zertrümmern. Trotz-
dem beruhigt es mich, Sams Spielplatz-Schuhe ordentlich
nebeneinander auf der Fußmatte stehen zu sehen, die Stapel
von Briefumschlägen auf der untersten Treppenstufe, die am
Morgen in den Briefkasten geworfen werden sollen. Welches

Böse könnte stark genug sein, diese Talismane zu überwin-
den?
Ich gehe, so leise ich kann, ins Wohnzimmer auf der
Rückseite des Hauses. Ich sehe den verschmierten Abdruck
auf der Glastür zur Terrasse. Es hat angefangen zu regnen,
Tropfen träge und dick wie Öl, ein leises Trommeln auf dem
Dach.
Dann leuchtet der Regen mit einem Mal silbern.
Irgendetwas im Garten hat den Bewegungsmelder ausge-
löst, den ich letzte Woche habe einbauen lassen. Nicht der
Regen (das Gerät ist so eingestellt, dass es nicht darauf re-
agiert) oder sich bewegende Zweige (es ist windstill). Etwas,
das groß genug ist, um erfasst zu werden, als es sich von
einem Ende des Grundstücks zum anderen bewegt. Etwas, das
ich nicht sehen kann.
Ich renne in die Küche, ziehe eine Schere aus dem Messer-
block, die ich kampfbereit hochhalte, während ich zur Terras-
sentür zurückeile. Das Licht geht wieder aus, bevor ich da bin.
Nur drei Sekunden Helligkeit. Warum habe ich dem Mann,
der die Anlage eingebaut hat, erklärt, er solle den Timer auf
drei Sekunden einstellen? Das reicht doch nicht einmal, um
die Aufmerksamkeit eines Waschbären zu wecken, ge-
schweige denn, einen Einbruch zu vereiteln. Aber jetzt fällt es
mir wieder ein: Ich wollte nicht, dass die Nachbarn geweckt
werden. Dass das genau der Zweck einer solchen Anlage ist,
muss mir zu dem Zeitpunkt entfallen sein.
Ich schließe die Terrassentür auf, schiebe sie auf und stoße
die Schere in die Luft, als wollte ich sie in einen Leib aus
Dunkelheit rammen.
Draußen lässt der strömende Regen mein T-Shirt sofort an
meiner Haut kleben. Ich gehe weiter auf die Terrasse. An
ihrem Rand komme ich in Reichweite der Bewegungsmelder,
und die Scheinwerfer flammen auf. Der Garten erstrahlt

plötzlich taghell, sodass alles aus dem matten Grau taucht und
in scharf umrissenen Konturen sichtbar wird - der vertrockne-
te Rasen, die von Unkraut überwucherten Blumenbeete ent-
lang des Zauns und der Gartenschuppen in der Ecke. Sonst
nichts. Nichts Ungewöhnliches.
Drei Sekunden später geht das Licht wieder aus. Der Gar-
ten dehnt sich in der Dunkelheit.
Ich schwenke einen Arm über dem Kopf, um den Bewe-
gungsmelder erneut zu aktivieren. Alles, wie es war. Ein
Vorhang aus Regen. Die blassen Umrisse der Nachbarhäuser.
Ich habe meine Pflicht getan. Zwei Uhr nachts und alles in
Ordnung. Zeit, wieder hineinzugehen, sich abzutrocknen und
Schäfchen zu zählen.
Aber das tue ich nicht.
Eher abwesend hebe ich noch einmal den Arm und recke
die Schere in die Luft. Und noch einmal geht das Licht an.
Und fällt auf jemanden, der im Garten steht.
Ein Mann, neben dem Schuppen, mit dem Rücken zum
Zaun, das Gesicht von den herabhängenden Ästen der Weide
im Nachbargarten verdeckt, die Arme locker neben dem Kör-
per und an ihrem Ende die faltigen Handschuhe seiner Hände.
Das Licht geht aus.
Ich würde es niemals über mich bringen, erneut den Arm
zu recken, wenn es nicht für Sam wäre, meinen Sohn, der
oben in seinem Bett schläft und sich darauf verlässt, dass ich
den Schwarzen Mann fernhalte. Der Gedanke an Sam lässt
das Licht wieder angehen.
Aber der Garten ist leer. Bloß dasselbe traurige quadrati-
sche Grundstück wie zuvor, ein vernachlässigter Garten und
ein Schuppen mit Spinnweben vor den Fenstern. Und nie-
mand, der am hinteren Zaun lehnt. Wenn er überhaupt da war,
der schreckliche Mann, der schreckliche Dinge tut.

20
Nach dem Mittagessen mit Angela, der Begegnung mit einem
Geist, der mein Buch las, und der Sichtung eines Monsters in
meinem eigenen Garten sollte man meinen, ich hätte längst
meine Sachen gepackt und mich mit Sam in eine andere Zeit-
zone bewegt. Stattdessen haben mir die Ereignisse der letzten
paar Tage die Antwort auf eine uralte Frage geliefert: Warum
kehren Leute in Horrorfilmen immer noch einmal in das
Geisterhaus zurück, selbst wenn das Publikum zur Leinwand
ruft: Lauf! Fahr los, und halt nicht an!?Es liegt daran, dass
man nicht weiß, dass man in einem Horrorfilm ist, bis es zu
spät ist. Selbst wenn die Regeln, die das Unmögliche vom
Möglichen trennen, aufzuweichen beginnen, will man einfach
nicht glauben, dass man nur eine weitere Ziffer in der Zahl
der Gesamtopfer ist, sondern wähnt sich als der Held, der das
Rätsel löst und überlebt. Niemand lebt sein Leben, als wäre er
nur in einer grausamen Statistenrolle besetzt.
Außerdem ist es in meinem Fall nicht das Haus, in dem es
spukt. Ich bin es selber.
Als ich Petra zurückrief, klang sie, als könnte sie sich nicht
daran erinnern, wer ich bin.
»Patrick Rush«, wiederholte ich. »Aus dem Schreibkreis.
Du hast mich angerufen.«
»Ach ja. Ich hab mich gefragt, ob du vielleicht später am
Nachmittag vorbeikommen könntest.«
»Ich wüsste schon ganz gern, worum es geht.«

»Sagen wir um fünf?«
»Hör mal, ich weiß nicht -«
»Super! Bis später dann!«
Und damit legte sie auf.
Ich weiß, wie es sich anhört, wenn jemand so tut, als würde
er oder sie mit einem anderen telefonieren (ich bin schließlich
mit Tim Earheart befreundet, gewiss einem der Besten, wenn
es darum geht, mehrere Affären gleichzeitig zu haben). Aber
welchen Grund sollte Petra haben, meine Identität vor der
Person zu verbergen, mit der sie gerade im Zimmer war?
Als ich aus dem U-Bahnhof Rosedale komme, erinnere ich
mich an mein Gespräch mit Ivan am selben Ort. Ich frage
mich, ob er immer noch Züge fährt, immer noch über seine
imaginäre Verwandlung schreibt, immer noch allein ist. Er
könnte im Führerhäuschen des Zuges gesessen haben, mit
dem ich gekommen bin. Der Gedanke daran lässt mir in der
heißen Sonne einen kalten Schauer über den Rücken laufen.
Nicht notwendigerweise der Gedanke an Ivan selbst als viel-
mehr die Frage, wie weit Ivan und Len noch sein können,
wenn schon Angela und jetzt Petra mich aufgespürt haben.
Und wenn die beiden am Weg auf mich warten, warum dann
nicht auch William?
»Patrick?«
Ich drehe mich um und sehe Petra auf der Stelle joggen,
brandneue Laufschuhe, das Haar unter einer Yankees-Kappe
nach hinten gebunden.
»Ich sollte dich warnen, mit meiner Kondition steht es
nicht zum Besten.«
»Sorry«, sagt sie und hört auf zu hüpfen. »Ich gehe um
diese Zeit normalerweise laufen, deshalb dachte ich mir, ich
hole dich gleich hier ab.«
»Wir gehen nicht zu dir?«
»Besser nicht.«

Sie sieht mich flehend an, als bestünde die Möglichkeit,
dass ich ihre Bitte nicht nur abschlagen, sondern sie am Arm
packen und mit Gewalt nach Hause zerren könnte. Ich habe
diesen Gesichtsausdruck schon anderswo gesehen, allerdings
nicht bei geschiedenen Damen der Gesellschaft, sondern in
den verschwollenen Gesichtern von Frauen vor den Obdach-
losenasylen in der Innenstadt. Frauen, die jeden Mann um
Hilfe anflehen, letztlich aber wissen, dass es zwecklos ist.
»Wohin möchtest du gehen?«
»Runter in die Rosedale Ravine. Dort jogge ich immer«,
sagt sie. »Im Schatten ist es kühler.«
»Und wir sind unter uns.«
»Ja. Wir sind unter uns.«
Ich mache ihr ein Zeichen voranzugehen, und sie überquert
die Brücke über die Gleise. Dabei blickt sie sich alle paar
Meter um. Wir sind aus jeder Richtung gut zu sehen - für die
Leute, die aus dem U-Bahnhof kommen, den Verkehr auf der
Yonge Street und aus den von Ästen verdeckten Fenstern der
Villen am Hang der Schlucht. Petra beschleunigt ihre Schritte.
Als sie sich hinter der Brücke ins Gebüsch schlägt und
einem zugewachsenen Trampelpfad folgt, verliere ich sie für
ein paar Minuten aus den Augen. Aber als ich mich durch
wilde Himbeersträucher bis ins Tal durchgeschlagen habe,
wartet sie dort auf mich.
»Ich habe mich noch gar nicht für dein Kommen bedankt«,
sagt sie.
»Es klang so, als hätte ich keine Wahl.«
»Es geht nicht nur um mich.«
Petra geht den Pfad weiter hinunter, bis die Bäume dichter
werden und die Schlucht sich öffnet. Als wir so weit gekom-
men sind, dass man in alle Richtungen hundert Meter weit
keinen Menschen sieht, bleibt Petra stehen und wendet sich

mir mit erregter Miene zu, als hätte sie nicht erwartet, dass ich
ihr tatsächlich folge.
»Ich habe nicht viel Zeit«, sagt sie. »Mein Tagesablauf ist
ziemlich eng geplant. Und Abweichungen fallen auf.«
»Wem?«
»Bekannten von mir«, erwidert sie vage.
Petra stemmt die Hände in die Hüfte, beugt sich leicht vor
und atmet tief durch, als wäre sie am Ende und nicht am Be-
ginn ihres Laufes.
»Ein Mann hat mich beobachtet«, sagt sie schließlich.
»Weißt du, wer es ist?«
»Dieselbe Person, die uns alle beobachtet.«
»Uns?«
»Den Kreis. Oder zumindest einige Mitglieder. Len, Ivan,
Angela.«
»Du hast mit ihnen gesprochen?«
»Len hat mich angerufen. Er hat mir von den anderen er-
zählt.«
Unser Gespräch dauert jetzt noch nicht einmal eine Minute,
doch es kommt mir viel länger vor. Das liegt an der Anstren-
gung, die es mich kostet, meine Überraschung zu verbergen.
»Ich nehme an, du glaubst, es wäre der Sandmann«, sage
ich bemüht skeptisch.
»Der Gedanke ist mir gekommen, ja.«
»Das ist doch verrückt.«
»Willst du sagen, du hättest ihn nicht gesehen?«
»Ich will sagen, ich hab ihn gesehen. Das ist ja das Ver-
rückte.«
Petra wirft erneut einen wachsamen Blick auf den Pfad. Ich
sehe, wie sie rechnet, wie viel Zeit ihr bleibt, ehe sie ver-
schwitzt ihre Haustür öffnen sollte.
»Ich nehme an, du hast mein Buch gelesen«, sage ich.
»Dein Buch?«

»Okay. Das Buch mit meinem Namen auf dem Umschlag.«
»Ich habe es gesehen und im Laden ein paarmal in die
Hand genommen. Aber ich wollte es nicht in meiner Nähe
haben.«
Petra wirkt mit einem Mal verloren. Nun ist es an mir, et-
was zu sagen, das sie noch hier hält.
»Wer saß in der Limousine, die dich an dem Abend vor
dem Grossman’s abgeholt hat?«
»Ich glaube nicht, dass dich das was angeht.«
»Eigentlich nicht. Bis du mir erzählt hast, dass wir beide
von derselben Person verfolgt werden.«
Einen Moment lang bin ich sicher, dass Petra mich einfach
stehen lässt. Stattdessen trifft sie eine Entscheidung, die sie
noch einen Schritt näher treten lässt.
»Bei seinen Geschäften musste mein Exmann gelegentlich
eher unkonventionelle Verbindungen und Praktiken pflegen.«
»Nach deinem Haus auf dem Hügel zu urteilen, scheint es
sich ja für ihn rentiert zu haben.«
»Es rentiert sich noch immer.«
»Und wer war der Mann in der Limousine?«
»Das war Roman. Roman Gaborek. Der Geschäftspartner
meines Mannes. Der ehemalige Geschäftspartner.«
»Ein Freund von dir?«
»Er ist mein Freund. Oder so was in der Richtung. Für ihn
habe ich meinen Mann verlassen. Aber das weiß mein Mann
nicht. Wenn Leonard erfahren würde, dass ich mit Roman
zusammen bin, wäre das schlecht für alle.«
»Einer von der eifersüchtigen Sorte.«
»Leonard lässt nicht so schnell locker.«
»Dann ist er vielleicht derjenige, den du in der Nähe deines
Hauses gesehen hast.«
»Das könnte sein. Und manchmal war er es auch. Aber ich
glaube, im Moment reden wir von jemand anderem.«

»Wieso?«
»Weil dieser Mann … ist nicht ganz echt.«
Irgendwo hinter uns huscht etwas durch das Unterholz. Das
Geräusch lässt Petra mit ausgestreckten Händen einen Satz
zurück machen. Selbst als sie erkennt, dass niemand dort ist,
bleibt sie weiter angespannt.
»Wenn es der Sandmann ist, warum jetzt?«, frage ich.
»Was hat ihn zurückgebracht?«
»Was glaubst du denn?«
»Mein Buch.«
»Deins. Ihrs. Wessen auch immer.«
Wie auf ein Signal, das nur sie hören kann, dreht Petra sich
um und beginnt, den Pfad hinunter tiefer in den feuchten
Schatten der Schlucht zu laufen. Zunächst ist es ein leichter
Trab, bevor sie mit rudernden Armen Tempo aufnimmt. Als
sie um die nächste Ecke verschwindet, rennt sie, so schnell sie
kann.
Das Orange am Himmel einer Smog-Alarm-Dämmerung ist
blauer Dunkelheit gewichen. Eine Stunde, in der die Rock-
und Anzugträger sicher in ihren klimatisierten Eigentums-
wohnungen eingeschlossen sind und all die anderen, gegen
Sonnenschein Allergischen aus den Schatten der Müllcontai-
ner und verpissten Ecken gekrochen kommen. Schon an guten
Tagen sind die vier Blocks der Queen Street bis zu meinem
Haus vorwiegend von den Gestörten und Süchtigen bevölkert,
aber heute Abend treiben sich noch mehr von der Sorte herum
als üblich. Das sind die Besucher. Auch obdachlose Junkies
können Sommertouristen sein, die mal auschecken, was es mit
dem ganzen Gerede von der großen Stadt auf sich hat. Eine
zahnlose Schönheit, die mich torkelnd anrempelt, nimmt be-
sonderen Anstoß daran, dass ich ihre Bitte um Kleingeld ab-
schlage. »Aber ich bin im Urlaub«, protestiert sie.

Damit sind wir schon zwei. Ich arbeite jedenfalls bestimmt
nicht mehr. Nach Abschluss meiner Sandmann-Lesereise
reichten meine Pläne nicht weiter als bis zu einem Rückzug
aus dem Schriftstellerberuf, aus jedem aktiven Tun. Aber das
war vielleicht ein Fehler. Vielleicht hat der Müßiggang der
vergangenen Wochen einen Raum geöffnet, in den un-
erwünschte Elemente eindringen können. Wie soll ich die
Rückkehr des Kensington-Kreises in mein Leben sonst erklä-
ren?
Ich habe natürlich einen Job. Einen einzigen Zweck, dem
ich mich verpflichtet habe, als Tamara starb: Sam großzuzie-
hen. Ein guter Vater zu sein. Meine wenigen guten Seiten mit
ihm zu teilen und die zahllosen Mängel zu verbergen.
Aber jetzt hat sich meine einzige Verantwortung verändert:
Ich muss meinen Sohn nicht mehr vordringlich nähren, ich
muss ihn beschützen. Wenn es etwas Schreckliches gibt, das
mein schreckliches Buch in die Welt gebracht hat, ist der
Urlaub vorbei. Ich habe jetzt die gleiche Aufgabe wie das
Mädchen aus Angelas Geschichte, das versucht hat, die Be-
drohung von den einzigen Menschen fernzuhalten, die es
liebte. Ich muss sichergehen, dass es, wenn es uns heimsucht,
nur mich und nicht ihn anrührt.
Als ich in die Euclid Street einbiege, habe ich wieder das Ge-
fühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Diesmal ist es kein Poli-
zeiabsperrband, kein Verfolger, der mich bis zu meiner Haus-
tür hetzt. Aber ein schwindeliges Zögern, ein plötzlich auf-
wallender Ekel. Ein Gefühl, das ich zunehmend mit der Ah-
nung verbinde, in seiner Nähe zu sein.
Wo ist Sam?
Er ist mit Emmie zu Hause. Sam geht es gut.
Und warum renne ich dann? Habe den Schlüssel aus der
Tasche gezogen und halte ihn gezückt in der geballten Faust?

Und warum steht, als mein Haus in Sicht kommt, ein Mann
am Fenster zum Vorgarten?
Er sieht mich und bleibt stehen. Beobachtet, wie ich den
Schlüssel ins Schloss schiebe und die Haustür öffne.
Der vordere Flur ist dunkel. Er hat das Licht nicht ange-
macht. Das brauchte er nicht. Er wusste, wohin er wollte.
Ich komme um die Ecke ins Esszimmer mit dem Fenster
zur Straße. Das Zimmer ist leer. Nichts, wohinter man sich
verstecken könnte. Ich gehe zurück in den Flur und überprüfe
den hinteren Teil des Hauses. Die Küchenschubladen sind
geschlossen, die Arbeitsflächen unberührt. Auch das Wohn-
zimmer sieht aus wie immer.
Ich will gerade nach oben gehen, als ein Luftzug meine
Aufmerksamkeit auf die Schiebetür lenkt. Sie steht offen. Von
hier muss sich der Eindringling Zutritt verschafft haben.
Aber das heißt nicht, dass er das Haus auch auf demselben
Weg wieder verlassen hat. Es heißt nicht, dass er nicht noch
hier sein kann.
»Sam?«
Ich nehme drei Stufen auf einmal. Knalle gegen die Wand,
als ich auf dem oberen Treppenabsatz ausrutsche. Stoße mit
der Schulter die Tür zu seinem Zimmer auf.
»Sam!«
Noch bevor ich nachsehe, ob er im Bett liegt, blicke ich
zum Fenster. Die Vorhänge mit Blut tätowiert. Aber es ist
geschlossen, das Bett ordentlich gemacht, so wie er es am
Morgen zurückgelassen hat.
Dann fällt es mir wieder ein. Er ist bei seinem Freund Jo-
seph gegenüber. Eine Geburtstagsparty. Sam ist nicht hier,
weil er nicht hier sein soll.
Ich gehe über den Flur und schnappe mir das Telefon. Jo-
sephs Mutter geht dran.

»Ich wollte bloß … die Tür zum Garten … könnten Sie
bitte Sam ans Telefon holen?«
Eine halbe Minute vergeht. Irgendwas stimmt nicht. Es
fehlt nur noch, dass Josephs Mutter wieder ans Telefon
kommt und sagt: Das ist komisch. Als ich das letzte Mal nach
ihnen gesehen habe, war er noch zusammen mit den anderen.
»Dad?«
»Sam?«
»Was ist los?«
»Bist du im Haus?«
»Da ist das Telefon.«
»Ja, klar.«
»Wo bist du?«
»Zu Hause. Da war … ich hab vergessen … O Gott …«
»Kann ich jetzt Schluss machen?«
»Ich komm dich abholen, wenn die Party vorbei ist, okay?«
»Ich bin gegenüber.«
»Ich hol dich trotzdem ab.«
»Na, klar.«
»Tschüss dann.«
»Tschüss.«
Wer immer am Fenster gestanden hatte, hatte diesmal das
richtige Haus erwischt. Aber den falschen Abend.
Glück. Wer hätte gedacht, dass nach all meinen unverdien-
ten Lorbeeren und Teufelspakten noch welches für mich übrig
ist? Aber Sam lebt. Isst Kuchen und albert im Keller des
Nachbarn herum.
Trotzdem wird es Zeit, Hilfe zu suchen. Nicht von der
psychiatrischen Variante (obwohl auch das zunehmend un-
vermeidlich erscheint), sondern von den Gesetzeshütern. Es
bleibt kein Platz mehr für Spekulationen, ob der Sandmann
real ist oder nicht. Jemand war in meinem Haus. Und deshalb
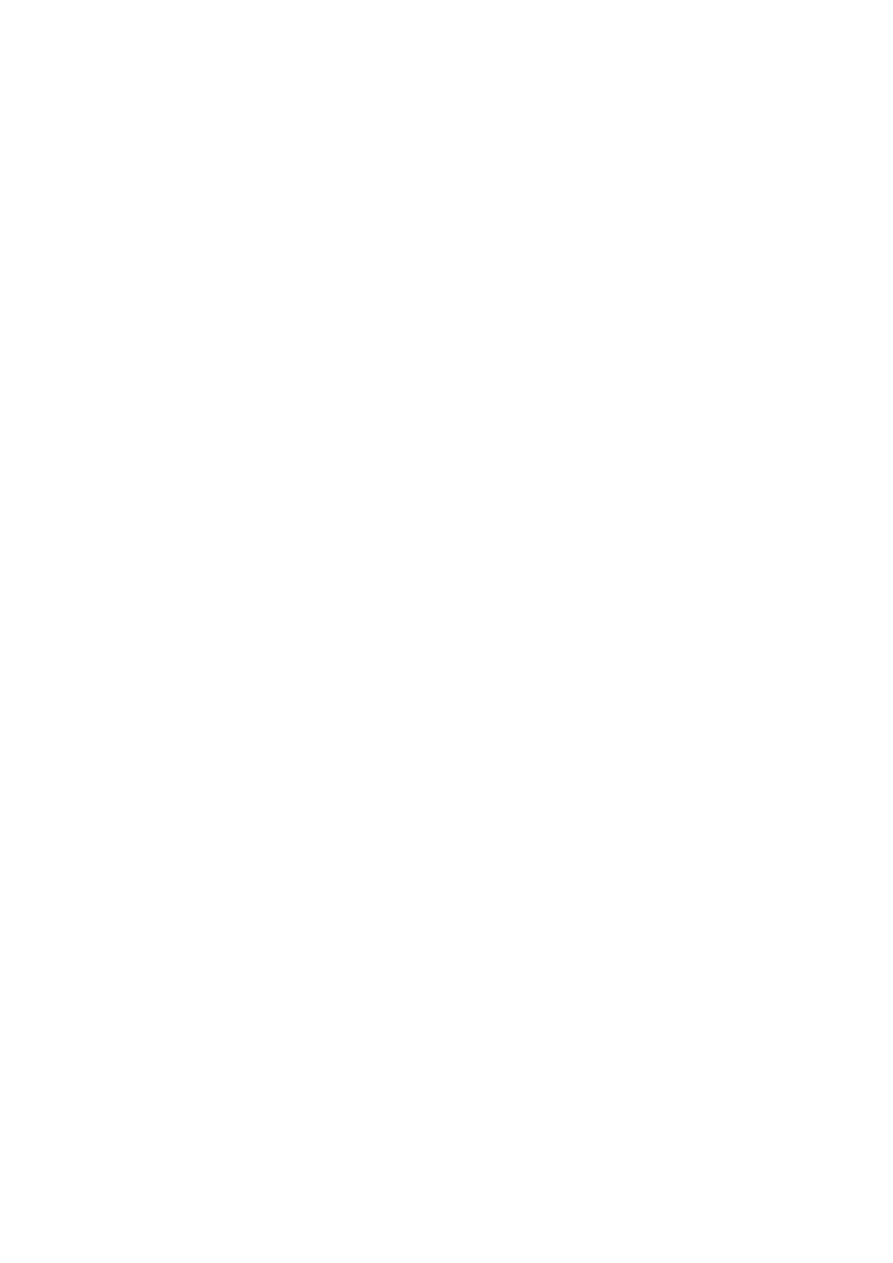
ist es nun an der Zeit, die Typen mit den Dienstmarken und
den Pistolen hinzuzuziehen.
Aber bevor ich erneut zum Telefon greifen kann, klingelt
es. Ich blicke auf und sehe, dass die Vorhänge in meinem
Schlafzimmer offen sind, weil ich sie am Morgen aufgerissen
habe, um das Licht hereinzulassen. Aber am Abend und bei
brennender Nachttischlampe bin ich für jeden von der Straße
aus zu sehen.
Das Telefon klingelt weiter.
Wenn ich im Begriff stehe, mit dem schrecklichen Mann,
der schreckliche Dinge tut, zu sprechen, dann frage ich mich,
was er mir mitteilen will.
»Hallo?«
»Mr. Rush?«
Irgendein Akzent.
»Wenn es um ein verdammtes Manuskript geht, kann ich
Ihnen nicht helfen. Wenn Sie dann jetzt so freundlich wären,
sich Ihr kostbares -«
»Ich habe eine schlechte Nachricht für Sie, Mr. Rush.«
»Wer ist da? Ich weiß nämlich, dass er sicher ist, okay?
Wenn Sie mir also -«
»Ich glaube, hier liegt eine Verwechslung -«
»- drohen wollen, rufe ich die Polizei. Hören Sie mich?«
»Mr. Rush - Patrick - bitte. Hier ist Detective Ian Ramsey
von der Polizei Toronto. Ich rufe wegen Ihrer Freundin Petra
Dunn an.«
Ein schottischer Zungenschlag. Er verrät den Einwanderer,
der den größten Teil seines Lebens hier verbracht, jedoch den
Akzent seines Heimatlands noch nicht ganz abgelegt hat. Da-
von bin ich einen Augenblick lang abgelenkt, sodass ich, als
er die nächsten Worte sagt, immer noch versuche zu raten, ob
er wohl eher aus der Ecke von Edinburgh oder Glasgow
kommt.

»Wir nehmen an, sie wurde ermordet, Mr. Rush«, sagt er.

21
Als die Polizei eintrifft, tut sie es in Gestalt eines einzelnen
Mannes, eines groß gewachsenen zivilen Ermittlers mit hell-
grünen Augen, die andeuten, dass man ihn nicht allzu ernst
nehmen muss. Ein Schnauzer, der wirkt wie ein nachträgli-
cher Einfall, ein obligatorisches Accessoire, ohne das er sich
wohler fühlen würde. Ich bin noch nie einem echten Detective
begegnet und versuche, gleichzeitig vorsichtig und gelassen
zu sein. Aber sein offenes Gesicht und die Tatsache, dass ich
überraschenderweise ein paar Zentimeter breiter bin als er
(ich hatte einen Klotz von Beschuldigungen erwartet), gibt
mir sofort das Gefühl, dass dieser Mann keinen wirklichen
Schaden anrichten kann.
»Ich komme wegen des Mordes«, sagt er mit routiniertem
Bedauern, so wie jemand in einem Schutzanzug vor der Tür
stehen und sagen würde: Ich komme wegen der Kakerlaken.
Ich strecke den Arm aus, um ihn hineinzubitten, und er
marschiert an mir vorbei direkt ins Wohnzimmer, so wie viel-
leicht ein alter Freund eintreten würde, der vertraut genug ist,
direkt zur Bar zu gehen und noch vor dem ersten Hallo einen
Drink hinunterzustürzen.
Als ich ihm folge, hat Detective Ramsey sich jedoch nicht
an der Bar bedient, sondern steht, die Hände hinter dem Rü-
cken gefaltet, in der Mitte des Raumes. Er macht mir ein Zei-
chen, Platz zu nehmen - ich wähle einen schäbigen Sessel -,
während er selbst stehen bleibt, womit ich, selbst auf der Ses-
selkante hockend, den Gewichtsvorteil einbüße, den ich kurz

innehatte. Etwa eine Minute scheine ich kaum von Interesse
für ihn. Er sieht sich um, als würde jede Zeitschrift und jedes
Stückchen Zierrat auf dem Kaminsims direkt mit ihm kom-
munizieren und er allen Gelegenheit geben wolle zu sprechen.
»Sind Sie verheiratet, Mr. Rush?«
»Meine Frau ist vor sieben Jahren gestorben.«
»Das tut mir leid.«
»Und selbst?«
Er hebt die Hand und präsentiert seinen goldenen Ehering.
»Seit zwanzig Jahren. Ich sag meiner Frau immer, heutzutage
sitzt man nicht mal für Totschlag so lange.«
Ich versuche ein Lächeln, aber er erwartet offenbar gar
keins.
»Irgendjemand hat mir erzählt, Sie sind Schriftsteller.«
»Nicht mehr«, sage ich.
»Sie satteln um?«
»Das habe ich noch nicht entschieden.«
»Ich hab immer gedacht, Schreiben kommt dem perfekten
Leben schon verdammt nahe. Kein Chef, freie Zeiteinteilung.
Man muss sich bloß irgendwas ausdenken. Eigentlich gar
keine richtige Arbeit.«
»Bei Ihnen hört es sich leichter an, als es ist.«
»Was ist denn so schwierig daran?«
»Alles. Besonders, sich etwas auszudenken.«
»Es ist wohl so ähnlich wie Lügen, stelle ich mir vor.«
Er tritt vor das Bücherregal, liest nickend einige Titel,
scheint jedoch keinen zu kennen.
»Ich bin selbst auch ein ziemlich eifriger Leser«, sagt er.
»Eigentlich nur Krimis. Auf den ganzen
Sinn-des-Lebens-Kram hab ich irgendwie keinen Bock.« De-
tective Ramsey dreht sich zu mir um und verzieht missbilli-
gend das Gesicht. »Darf ich fragen, was Sie so komisch fin-
den?«

»Sie sind ein Detective, der nur Krimis liest.«
»Und?«
»Das ist irgendwie ironisch, schätze ich.«
»Ach ja?«
»Vielleicht auch nicht.«
Er wendet sich dem Regal zu und zieht mein Buch heraus.
»Was ist es?«, fragt er.
»Verzeihung?«
»Was für eine Art Buch ist es?«
»Ich weiß nie recht, was ich darauf antworten soll.«
»Warum nicht?«
»Es lässt sich keiner Kategorie zuordnen.«
Detective Ramsey schlägt die Rückenklappe auf und be-
trachtet das Autorenfoto. Ich, knurrig, nachdenklich und
grafisch bearbeitet.
»Der Titel ist ein ziemlicher Zufall«, sagt er.
»Ja?«
»Die Morde des Sandmanns vor ein paar Jahren. Ich habe
damals die Ermittlungen geleitet.«
»Wirklich.«
»Die Welt ist klein, was?«
»Ich nehme an, irgendwie war der Titel schon von den da-
maligen Ereignissen inspiriert.«
»Inspiriert?«
»Nicht dass die Taten des Mörders inspirierend gewesen
sind. Ich meine nur in dem Sinn, dass er mir die Idee geliefert
hat.«
»Die Idee wofür?«
»Für den Titel. Das war alles, worüber ich gesprochen ha-
be.« Sein Blick wandert tiefer, und ich frage mich, ob ich
einen Flecken auf dem Hemd habe. Dann merke ich, dass er
meine Hände betrachtet, und unterdrücke den Impuls, sie in
die Hosentaschen zu stecken.

Ramsey hebt den Blick wieder und wiegt mein Buch in der
Hand, als wollte er dessen literarischen Wert nach Kilogramm
bemessen.
»Was dagegen, wenn ich es mir mal ausleihe?«
»Behalten Sie es. Ich habe noch jede Menge im Keller.«
»Oh? Und was haben Sie da unten sonst noch?«
Erst das Lachen, das er sich mit kurzer Verzögerung er-
laubt, deutet an, dass er scherzt. Eigentlich könnte man alles,
was er in seinem halb unterdrückten Dialekt sagt, als trocke-
nen Scherz auffassen. Aber dessen bin ich mir jetzt nicht mehr
so sicher.
»Ich muss mit Ihnen Ihren Tag mit Mrs. Dunn durchge-
hen«, sagt er, legt das Buch auf einen Beistelltisch und zieht
einen Notizblock aus der Jackentasche.
»Es war kein Tag. Wir haben maximal zwanzig Minuten
miteinander verbracht.«
»Dann Ihre zwanzig Minuten. Fangen wir einfach mit
denen an.«
Ich erzähle ihm, dass Petra am Abend zuvor eine Nachricht
auf meinem Anrufbeantworter hinterlassen und mich um ein
persönliches Gespräch gebeten hat. Am Morgen habe ich zu-
rückgerufen, und wir haben uns um fünf Uhr bei ihr zu Hause
verabredet. Als ich aus der U-Bahn kam, stand sie in Jog-
ging-Klamotten und Yankees-Kappe da. Sie wollte mich of-
fenbar nicht mit zu sich nach Hause nehmen und führte mich
stattdessen in die Rosedale Ravine. Dort berichtete sie mir
von ihren Befürchtungen bezüglich eines Mannes, der sie of-
fenbar verfolgte. Jedenfalls hatte sie jemanden nachts vor
ihrem Haus gesehen. Sie hatte Angst und wollte wissen, ob
auch ich von einem Schatten verfolgt wurde.
»Und wurden Sie?«, fragt Detective Ramsey.
Beim Erzählen jeder Geschichte gibt es einen Punkt, wo
der Autor sein eigener Redakteur wird. Bei der Schilderung
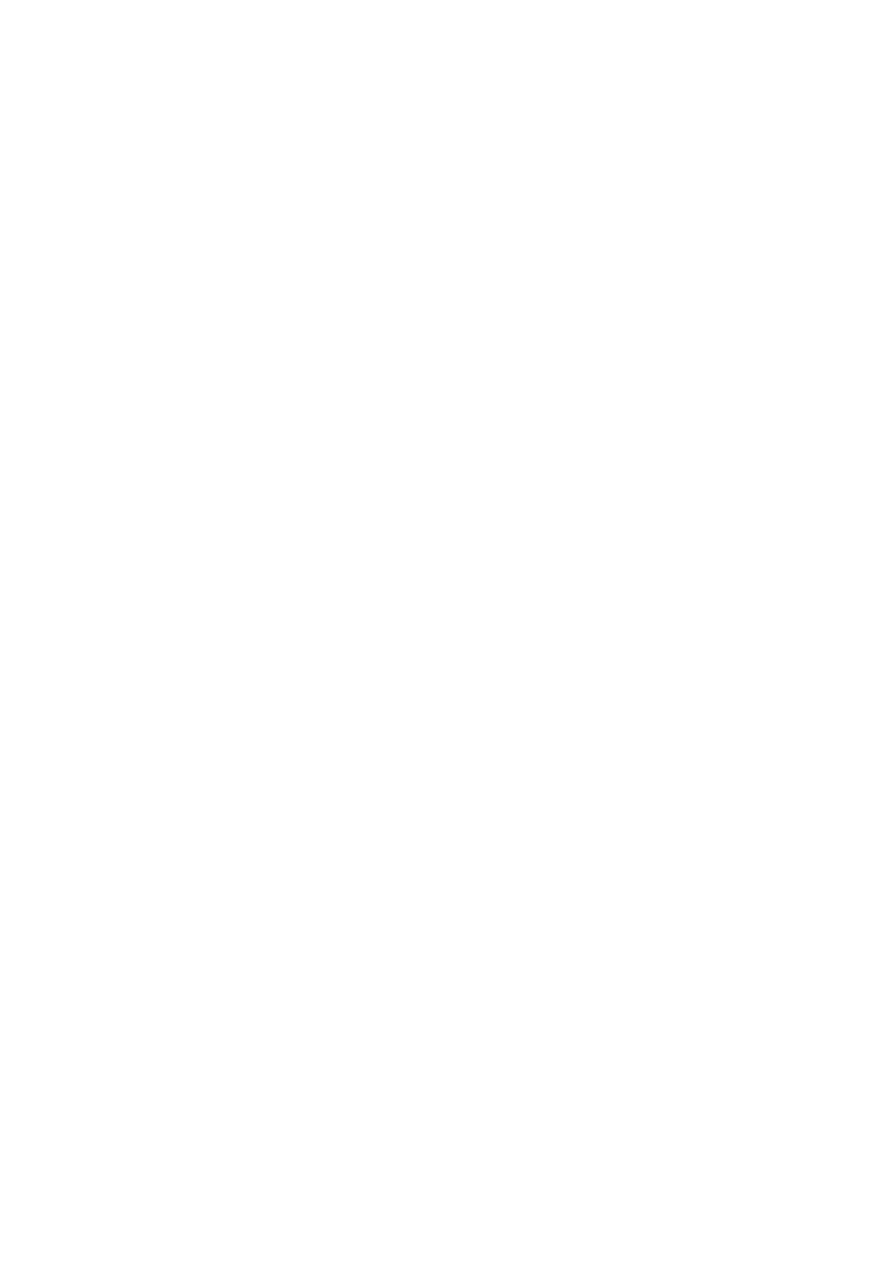
eines Geschehens wird nie alles erwähnt, kein Bericht ist um-
fassend. Auch der Ehebrecher, der mit seinem Gewissen nicht
leben kann, klammert den Duft des Parfüms der Geliebten aus
seinem Geständnis aus. Nationen im Krieg geben Opferzahlen
an, aber keine Statistiken über fehlende Arme und Beine.
Ursache dieser Lücken muss gar nicht unbedingt die Absicht
zu täuschen sein, im Sinne von aktiver Verzerrung der Fakten.
Meistens geht es nur darum, zur Essenz einer Sache zu kom-
men, ohne unnötigen Schmerz zuzufügen. So kann man
gleichzeitig wahrhaftig sein und trotzdem Geheimnisse wah-
ren.
So rechtfertige ich hinterher, dass ich Detective Ramsey
erkläre: Nein, ich bin nicht verfolgt worden und habe nicht die
leiseste Ahnung, wovon Petra gesprochen hat. Schon als ich
diesen Weg einschlage, weiß ich, dass es der falsche ist. Denn
letztlich kann nur die Polizei meine und Sams Sicherheit ge-
währleisten. Aber aus irgendeinem Grund bin ich davon
überzeugt, dass eine derartige Enthüllung uns nur zu den
nächsten Opfern machen würde. Wenn mich der Sandmann so
eng beschattet, wie es sich anfühlt, werde ich nach seinen
Regeln spielen und nicht nach denen des Gesetzes.
Ganz zu schweigen davon, dass ich das Gefühl bekomme,
ich könnte als Verdächtiger für den Mord an Petra gelten.
Glauben Sie mir: In solchen Fällen rät einem der Instinkt,
zunächst mal hinter dem Berg zu halten und später herauszu-
finden, ob das eine gute Idee war.
»Warum hat sie dann Sie angerufen?«
»Vermutlich weil wir in einem Schreibkreis zusammen
waren. Vor Jahren. Sie meinte einen Zusammenhang zu er-
kennen zwischen dem Zirkel, meinem Buch und ihren Be-
fürchtungen, verfolgt zu werden. Es war alles ziemlich vage.«
»Vage«, wiederholt Ramsey und hält inne, um dem Wort
nachzusinnen. »Erzählen Sie mir von diesem Kreis.«

Das tue ich. Ich nenne sämtliche Namen und die wenigen
Kontaktdaten, die ich habe. Erneut entscheide ich mich, ein
paar Dinge auszulassen. Mein Treffen mit Angela zum Bei-
spiel.
»Ich möchte nur noch mal den zeitlichen Ablauf mit Ihnen
durchgehen«, sagt er. »Sie haben Mrs. Dunn gegen fünf Uhr
getroffen. Richtig?«
»Kurz vor fünf, ja.«
»Und zwanzig Minuten später haben Sie sich in der
Schlucht von ihr verabschiedet.«
»Plus/minus ein paar Minuten.«
»Und anschließend sind Sie nach Hause gegangen?«
»Ja.«
»Haben Sie mit irgendjemandem gesprochen oder unter-
wegs irgendwo Halt gemacht?«
»Ich habe in Kensington Market ein Bier getrunken.«
»Wo genau?«
»Im Fukhouse. Das ist eine Punk-Kneipe.«
»So sehen Sie gar nicht aus.«
»Sie lag zufällig auf dem Weg.«
»Würde jemand aus dem Fukhouse Sie wiedererkennen?«
»Vielleicht der Barkeeper. Wie Sie schon sagten, ich sehe
nicht so aus.«
»Wann sind Sie nach Hause gekommen?«
»Am Abend. Irgendwann nach neun schätzungsweise.«
»Das war, als Sie Ihre Nachbarin angerufen haben, um
nach Ihrem Sohn zu fragen.«
»Ja.«
»Hatten Sie irgendeinen besonderen Grund, sich um das
Wohlergehen Ihres Sohnes zu sorgen?«
Er stand in meinem Fenster.

»Ich bin Witwer, Detective. Sam ist die einzige Familie,
die mir geblieben ist. Ich mache mir nie keine Sorgen um
ihn.«
Er blinzelt.
»Das war aber ein langer Spaziergang«, meint er dann.
»Selbst mit ein paar Drinks unterwegs.«
»Ich nehme mir gern Zeit.«
»Vielleicht interessiert es Sie, dass Mrs. Dunn irgendwann
zwischen dem Treffen mit Ihnen und acht Uhr verschwunden
ist. Das ergibt einen ungeklärten Zeitraum von circa zweiein-
halb Stunden.«
»Verschwunden? Ich dachte, Sie hätten gesagt, sie wäre
ermordet worden.«
»Ich sagte, das nehmen wir an.«
Wie konnte ich den Typen so falsch einschätzen? Sein
schottischer Akzent und sein drolliges Gebaren haben mich
glauben lassen, dass man mir keinen von den harten Jungs
vorbeigeschickt hatte. Und dass man mich deshalb nicht
ernsthaft verdächtigen würde. Aber jetzt erkenne ich, dass
Ramsey ein harter Junge ist.
»Kennen Sie irgendjemanden, der ein Motiv haben könnte,
Ihrer Freundin etwas anzutun?«, fragt er abwesend. »Außer
ihrem Schatten?«
»Ich bin nicht ihr Freund. War nicht ihr Freund. Ich kannte
sie kaum.«
»Nicht ihr Freund«, wiederholt er kritzelnd.
»Was ein Motiv betrifft, habe ich keine Ahnung. Ich mei-
ne, sie hat ihre Scheidung erwähnt und dass sie sich mit einem
Geschäftspartner ihres Exmannes trifft. Das Ganze hörte sich
irgendwie delikat an.«
»Das haben Sie alles in den zwanzig Minuten in der
Schlucht besprochen?«
»Es war eigentlich nicht viel mehr als ein Name.«

»Und was für ein Name wäre das?«
»Roman. So hieß der Freund. Roman Soundso. Petra
machte sich Sorgen, dass ihr Exmann von dieser Beziehung
erfahren könnte.«
»Roman Gaborek.«
»So hieß er.«
»Hat Ihre Freundin erwähnt, dass sowohl Mr. Gaborek als
auch Mr. Dunn führende Gestalten des organisierten Verbre-
chens in dieser Stadt sind?«
»Sie hat es angedeutet.«
»Angedeutet. Sie hat es angedeutet.«
»Genau.«
»Es ist seltsam«, sagt er und klappt seinen Notizblock zu.
»Wenn die Leute etwas hören, wie Sie es gerade gehört ha-
ben, wollen sie meistens wissen, wie die Tat begangen wurde.
Aber Sie haben mich noch gar nicht danach gefragt.«
»Gewalt behagt mir nicht besonders.«
»Dann ist es ja gut, dass Sie nicht gefragt haben. Denn
Mrs. Dunn wurde erhebliche Gewalt zugefügt.«
»Ich dachte, es gebe keine Leiche.«
»Aber was von ihrem Körper zurückgeblieben ist - nun, es
deutet auf gewisse Praktiken hin, die mich an vor vier Jahren
erinnert haben. Wissen Sie noch?«
Jemand, der in diesem Augenblick ins Zimmer käme,
könnte fälschlicherweise glauben, in Detective Ramseys
Miene so etwas wie Triumph über Momente wie diesen zu
lesen. Aber ich erkenne, dass es keine Befriedigung, sondern
Wut ist, eine Wut, die als ihr Gegenteil zu bemänteln er im
Laufe der Jahre gelernt hat.
»Nun, das wär’s«, sagt er. Ich stehe auf und strecke ihm
meine Hand hin. Als er sie schließlich ergreift, ist sein Griff
gnadenlos.
»Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen.«

»Wenn nicht, kommt das vielleicht noch.«
Ramsey geht zur Haustür, und ich folge in einigem Ab-
stand, weil ich es plötzlich gar nicht erwarten kann, die Tür
hinter ihm ins Schloss fallen zu hören.
»Nur noch eins. Die Kappe, die Mrs. Dunn getragen hat,
als Sie sie getroffen haben …«
»Ja?«
»Von welchem Team war die noch mal?«
»Von den Yankees. Warum?«
»Ach, nichts. Man hat bloß keine Kappe gefunden, weder
von den Yankees noch von sonst wem.«
Er öffnet die Tür und tritt hinaus. Bevor er sie hinter sich
schließt, wirft er mir noch ein Lächeln zu, das er sich bis zum
Ende aufgespart hat.
Am nächsten Morgen beschäftigt mich ein komischer Gedan-
ke: Ich werde noch einmal berühmt sein. Wenn sie mich ab-
holen kommen und ich auf wackeligen Beinen vom Streifen-
wagen in den Gerichtssaal stolpere, werden Kameras surren
und Reporter mich für die Abendnachrichten um einen kna-
ckigen Spruch vom Unhold des Tages anflehen.
Dann springt der Radiowecker an. Und wieder geht mir
diese Szene durch den Kopf.
Die Morgennachrichten berichten, dass Petra Dunn, fünf-
undvierzig, am Abend zuvor in der Rosedale Ravine ver-
schleppt wurde. Spuren am Tatort deuten auf ein Gewaltver-
brechen hin. Zurzeit befragt die Polizei eine Reihe von »wich-
tigen Zeugen« im Zusammenhang mit dem Fall.
Ein wichtiger Zeuge, das bin ich. Gestern Morgen bin ich
als arbeitsloser Pseudo-Schriftsteller aufgestanden, und nur
vierundzwanzig Stunden später wache ich als Hauptverdäch-
tiger in einem Mordfall auf. Aber damit hört es nicht auf.
Denn wenn Detective Ian Ramsey glaubt, ich hätte die arme

Petra Dunn abgemurkst, folgt daraus logisch, dass ich vor vier
Jahren auch Carol Ulrich, Ronald Pevencey und Jane Whirter
ermordet habe.
Vielleicht hatte Angela recht. Der Sandmann ist zurückge-
kommen. Und nach allem, was man vermuten kann, bin ich
es.
»Dad?«
Sam steht in meiner Schlafzimmertür.
»Ich hab bloß schlecht geträumt«, sage ich.
»Aber du bist wach.«
Er hat recht. Ich bin wach.
Nachdem ich mich geduscht und rasiert habe, bringe ich Sam
als Erstes zu Stacey, Tamaras Schwester in St. Catharines.
Auf der einstündigen Fahrt versuche ich ihm, so gut ich kann,
zu erklären, warum mich am Abend zuvor ein Polizist besucht
hat, um mit mir zu reden, und warum es das Beste ist, wenn
wir beide uns für eine Weile trennen. Ich erkläre ihm, dass
Menschen manchmal in etwas verwickelt werden, mit dem sie
nichts zu tun haben, wofür sie jedoch trotzdem Rede und
Antwort stehen müssen.
»Ausschlussverfahren«, sagt Sam.
»Sozusagen, ja.«
»Aber ich dachte, es heißt ›unschuldig bis zum Beweis des
Gegenteils‹?«
»Das gilt nur vor Gericht.«
»Hat es etwas mit deinem Buch zu tun?«
»Indirekt, ja.«
»Ich mochte dein Buch nie.«
Natürlich hat er es gelesen. Verbotenerweise, aber wie
sollte er den einzigen Beitrag seines Vaters zu unserem
Buchregal nicht gelesen haben? Ich weiß nicht, wie viel er
davon verstanden hat - ein schlaues Kind, aber trotzdem erst

acht Jahre alt -, aber offenbar hat er den entscheidenden Punkt
begriffen. Der Sandmann aus Der Sandmann ist echt.
Als ich wieder zu Hause bin, hinterlasse ich eine Nachricht
auf Angelas Anrufbeantworter, in der ich sie bitte, sich so
schnell wie möglich zu melden.
Während ich auf ihren Rückruf warte, überlege ich, wie
viele Mitglieder des Kreises bereits Kontakt miteinander auf-
genommen haben. Nach dem Abend im Grossman’s war ich
einfach davon ausgegangen, dass wir alle unserer eigenen
Wege gehen würden. Aber vielleicht sind Beziehungen ge-
knüpft worden, von denen ich zu der Zeit keine Ahnung hatte.
Liebende, Rivalen, Künstler und ihre Musen. Leidenschaften,
die schon die grausamsten Taten heraufbeschworen haben.
Um die Zeit totzuschlagen, schaue ich erneut auf der
Kommentar-Seite von www.patrick.rush.com vorbei. Wieder
sind es vor allem zwanghafte Leser, die die Feinheiten der
diversen Handlungslinien von Der Sandmann diskutieren,
Unstimmigkeiten aufdecken und divergierende persönliche
Eindrücke von dem Autor zum Besten geben (»Er hat mein
Buch signiert und gefragt, ob ich auch schreibe. Und das TUE
ich! Es war, als hätte er MEINE GEDANKEN GELESEN!!«
vs. »Ich habe PR neulich tatsächlich auf der Straße gesehen,
wo er (vergeblich) versuchte, auszusehen wie ein ›normaler
Typ‹, indem er eine Tüte mit Lebensmitteln schleppte (!?), der
blöde Wichtigtuer!«).
Ich will mich gerade wieder ausloggen, als der Cursor den
jüngsten Eintrag des Tages findet. Ein weiteres Bulletin von
therealsandman:
Angela ruft mich zurück. Sie muss heute Abend länger
arbeiten, hat jedoch später Zeit. Aus irgendeinem Grund be-
stehe ich darauf, dass wir uns bei ihr treffen (worauf sie sich
widerwillig einlässt). Als sie aufgelegt hat, wird mir klar, dass

ich sehen muss, wo sie lebt, um mich zu vergewissern, dass
sie real ist.
Ich soll um acht bei Angela sein, was mir Zeit gibt, die
einzige andere Nummer anzurufen, die ich außer ihrer von
einem Mitglied des Kreises habe. Die von Len.
»Die Polizei ist gerade wieder gegangen«, sagt er, ohne
sich mit einem Hallo aufzuhalten, als läge unsere letzte
Unterhaltung nicht Jahre, sondern nur Tage zurück. »Hast du
gehört, was mit Petra passiert ist?«
»Hab ich. Hieß der Mann, mit dem du geredet hast, Ram-
sey?«
»Ich war so erschrocken, dass ich nicht richtig zugehört
habe. So ein komischer Typ.«
»Ja?«
»Sonderbar-komisch und witzig-komisch gleichzeitig.«
»Das ist er.«
Ich würde zu Lens Wohnung in Parkdale laufen, aber die
Hitzewelle hat den Temperaturrekord gebrochen, den sie erst
am Vortag selbst aufgestellt hat, sodass ich den Toyota nehme
und mit heruntergelassenen Fenstern über die King Street
nach Westen fahre. Ich biege links in Richtung des Sees ab
und komme in ein Viertel mit stattlichen Häusern, die schon
seit Langem vor allem heruntergekommene Pensionen beher-
bergen. Lens Haus sieht sogar noch schlimmer aus als die
anderen. Die Farbe blättert von der Veranda, die Fenster zur
Straße sind mit Flaggen, Alufolie oder Mülltüten verhängt,
die als Jalousien dienen.
Len haust in der Dachwohnung. Der Seiteneingang des
Hauses ist wie angekündigt offen, und ich steige die schmale
Treppe hinauf, durch Schwaden von Haschischqualm und den
ätzenden Gestank von gekochten Suppenknochen und Ter-
pentin, der durch die Türritzen dringt.

Vor dem letzten Absatz blicke ich auf und sehe, dass Len
mich oben erwartet. Der große Trampel steht vorgebeugt im
Türrahmen, verschwitzt, aber ansonsten sichtlich erleichtert,
mich zu sehen.
»Du bist’s«, sagt er.
»Hast du jemand anderen erwartet?«
»Der Gedanke hat mich gestreift.«
Lens Wohnung besteht aus einem einzigen Raum, mit
einem kleinen Tresen mit Kochplatte und Minikühlschrank in
einer Ecke und einer Matratze auf dem Boden. Natürliches
Licht fällt nur durch zwei Fenster in Buchgröße herein, eines
zur Straße hinaus, das andere Richtung Hof. Wegen der stei-
len Dachschrägen zu beiden Seiten des Balkens, der den
Raum teilt, kann Len nur in der Mitte des Zimmers aufrecht
stehen. An der Wand kleben vor Feuchtigkeit wellige Film-
poster. Der Exorzist. Suspiria. Die Nacht der lebenden Toten.
Auf dem Fußboden liegt Wäsche verstreut, die nach einem
Kampf zwischen Deodorant und alten Socken riecht.
»Setz dich«, fordert Len mich auf und hebt einen Stapel
Taschenbücher von einem Klappstuhl. Damit bleibt ihm nur,
sich im Schneidersitz auf den Boden zu hocken. Ein überhitz-
ter Junge, der sich aufs Geschichtenerzählen freut.
»Und wie ist es dir ergangen?«
»Ganz okay. Ich schreibe nicht viel. Ich kann seit einer
Weile nicht mehr klar denken. Es ist schwer, Gespensterge-
schichten zu schreiben, wenn man in einer lebt.«
Oberhalb von Lens Schulter entdecke ich auf einem aus
Milchkästen selbst gebauten Regal mein Buch. Der Einband
ist abgegriffen und von fettigen Fingerabdrücken verschmiert.
»Ich konnte eine Woche nicht schlafen, nachdem ich es
zum ersten Mal gelesen hatte«, sagt Len, der meinem Blick
gefolgt ist.
»Tut mir leid.«

»Das muss dir nicht leidtun. Die besten Teile waren eh
nicht von dir.«
»Da will ich nicht widersprechen.«
Len blickt zur Tür, als wollte er sich vergewissern, dass sie
abgeschlossen ist. Er wirkt so verstört und nervös, dass mit
einem Mal deutlich wird, dass er schon viel länger hier oben
vor sich hin kocht, als ihm gutgetan hat.
»Wann warst du zum letzten Mal draußen?«
»Ich geh nicht mehr so gern raus«, sagt er. »Kennst du das
Gefühl, beobachtet zu werden, aber wenn du dich umdrehst,
ist niemand da? Das hab ich jetzt dauernd.«
»Hast du Ramsey davon erzählt?«
»Nein. Es ist ein Geheimnis. Ein Geheimagen-
ten-Geheimnis. Wer es ausplaudert, ist tot.«
»Ich weiß, was du meinst.«
»Er hat nach dir gefragt.«
»Was wollte er wissen?«
»Ob du was mit Petra hattest. Was ich von dir halte.«
Ich lasse Len nicht aus den Augen, während er überlegt,
was er offenbaren soll. Er wirkt nicht wie ein Mann, der allzu
viel Druck aushält, also gebe ich mir alle Mühe, ihn streng
anzublicken.
»Ich hab ihm erzählt, du wärst mein Freund«, sagt er
schließlich.
»Das ist alles?«
»Mehr kann ich wirklich nicht sagen.«
»Abgesehen davon, dass mein Buch eigentlich gar nicht
mein Buch ist.«
»Abgesehen davon, ja.«
»Und?«
»Und ich habe es ihm nicht erzählt.«
»Mit wem hast du sonst noch gesprochen?«

»Petra hat angerufen. Angela auch. Sie hat von Conrads
Unfall erzählt. Sogar Ivan ist vorbeigekommen, vorgestern
erst. Und alle haben sie panische Angst.«
»William nicht?«
»Soll das ein Witz sein? An dem Tag, an dem der Typ
mich besuchen kommt, ist es Zeit umzuziehen.«
Unvermittelt setzt mir die drückende Hitze in dem Raum
zu. Es gibt nicht mal annähernd genug Luft für zwei Lungen,
und Len kriegt ohnehin die meiste ab, weil er keucht wie ein
überfütterter Golden Retriever.
»Angela hat dir von Conrads Unfall erzählt?«
»Das sagte ich doch.«
»Aber hat sie dir auch erzählt, dass noch jemand mit im
Wagen saß, als er starb?«
»Saß noch jemand im Wagen?«
»Nein. Niemand«, sage ich und stoße mir den Kopf an der
Decke, als ich aufstehe. »Tut mir leid, aber ich bin schon spät
dran für eine weitere Verabredung.«
»Mit wem?«
»Mit Angela, ehrlich gesagt.«
»Sie muss echt sauer auf dich sein.«
»Offenbar hat sie beschlossen, die Sache auf sich beruhen
zu lassen.«
Len kratzt sich die paar Stellen an seinem Kinn, wo ihm
Bartstoppeln wachsen.
»Ich möchte dir etwas zeigen«, sagt er.
Len entfaltet seine Beine und wälzt sich zu dem Milchkis-
tenregal. Mit dicken Fingern gräbt er sich durch Stapel von
Comics und wühlt in den Trümmern umgestürzter Bücher-
türme. Als er gefunden hat, was er sucht, ist sein T-Shirt dun-
kel vor Schweiß.
Auf allen vieren kriecht er zu mir und reicht mir ein Buch.
Ein literarisches Magazin, von dem ich schon gehört habe,

The Tarragon Review. Eine von Dutzenden obskurer Publika-
tionen, die Kurzgeschichten und Gedichte für eine maximal
zweistellige Leserschaft veröffentlichen.
»Bist du da drin?«, frage ich, weil ich annehme, dass Len
mit seiner ersten Veröffentlichung angeben will.
»Guck dir mal das Inhaltsverzeichnis an.«
Ich lese jeden Titel und Autor auf der Liste. Nichts klingt
irgendwie bekannt.
»Lies noch mal«, drängt Sam mich. »Die Namen.«
Beim zweiten Durchgang fällt es mir auf. Eine Kurzge-
schichte mit dem Titel »Der U-Bahn-Fahrer«. Geschrieben
von einer gewissen Evelyn Sanderman.
»San-der-man. Sand-man. Verstehst du?«
»Willst du behaupten, dass Evelyn das geschrieben hat?«
»Guck mal hinten«, sagt Len. »Die Angaben zu den Auto-
ren.«
Auf der letzten Seite des Buches sind Kurzbiografien der
Autoren des Bandes neben jeweils einem Schwarzweißfoto
abgedruckt. Zu Evelyn Sanderman findet sich folgender Ein-
trag:
Evelyn reist gerne und ist fasziniert vom Leben anderer
Menschen. »Für das Schreiben gibt es keine bessere Re-
cherche, als Fremden nahezukommen«, erklärt sie uns.
Diese Geschichte ist Evelyns erste Veröffentlichung.
Daneben ist ein Foto von Angela.
»Wann wurde das gedruckt?«
»Letztes Jahr.«
»Und warum hast du es?«
»Ich abonniere alles«, sagt er. »Ich verfolge gern, wer wo
veröffentlicht wird. Es nährt meinen Neid, nehme ich an. An

manchen Morgen ist es das Einzige, was mich aus dem Bett
treibt.«
Len kniet jetzt vor mir, benommen von der Hitze, verwirrt
von dem seltenen Besuch eines menschlichen Wesens, mit
dem er eine unvermutete Wendung in seinem Leben verbin-
det.
»Kann ich das mal ausleihen?«
»Nimm mit. Ich will es sowieso irgendwie aus dem Haus
haben«, sagt Len, und seine Augen leuchten von einer narko-
tischen Angstattacke.
»Der U-Bahn-Fahrer« ist gut. Der Kritiker in mir besteht da-
rauf, das gleich vorneweg festzustellen. Eine vollkommen
andere Stimme als die, die Angelas Tagebuchgeschichte er-
zählt hat. Diesmal wirkt der Erzählton auf eine gruselige Art
betäubt, ein Mann, der sich durch eine städtische Umgebung
voller Menschen bewegt, unbemerkt und nebelhaft wie ein
Phantom. Aber es gibt auch Momente herzzerreißender Ver-
zweiflung, die durch die Oberfläche brechen. Kein bisschen
Angelas Stimme oder sonst eine fiktionale Schöpfung im en-
geren Sinne. Das liegt daran, dass es die Stimme eines realen
Menschen ist. Ivans.
Wie der Titel bereits andeutet, handelt »Der
U-Bahn-Fahrer« von einem Tag im Leben eines namenlosen
Mannes, der tagsüber mit einem Zug durch die unterirdischen
Tunnel rast und abends an chronisch unfertigen Geschichten
herumschreibt. Was mich jedoch wirklich überrascht, die
Enthüllung, die mich vor Lens Pension auf dem Fahrersitz
meines Toyotas zittern lässt, ist nicht die unverhohlene An-
leihe bei der Biografie, die Ivan uns bei den Treffen des Ken-
sington-Kreises vorgetragen hat, sondern der private Hinter-
grund, das tragische Geheimnis, das er, so hatte ich zumindest
angenommen, nur mit mir geteilt hatte.

An manchen Stellen der Erzählung grübelt die Ivan-Figur
über den unglücklichen (oder auch nicht) Sturz seiner Nichte
auf der Kellertreppe seiner Schwester. Dasselbe Ereignis, das
er mir in der Toilette des Sansibar erzählt hat. Sogar manche
Details bis hin zu den Worten (soweit ich mich an sie erinne-
re) finden ihren Weg in Angelas Text.
Sie hieß Pam … Ich sah ihr nach, wie sie den Flur hinunter
zur Treppe rannte, und dachte: Du siehst sie gerade zum
letzten Mal lebend … Eine wie früher. Wie ein Kamm, nur
mit Metallzähnen … So geht ein Leben zu Ende. Zwei Le-
ben. Einfach so.
Sie muss ebenfalls von Ivans Geheimnis erfahren haben. Er
hat es ihr erzählt. Und sie hat es benutzt. Hat ihn benutzt.
Zu der Adresse hat Angela mir eine Code-Nummer für ihre
Wohnung genannt, die sich in einem der hohen, aber ansons-
ten nichtssagenden Türme befindet, die wie Unkraut um das
Baseballstadion gesprossen sind. Ansonsten hätte ich nie ge-
wusst, wo ich klingeln soll, da ihre Nummer nicht neben dem
Namen Angela Whitmore, sondern neben dem von Pam Tur-
genov steht. Ivans toter Nichte.
Nachdem sie mir aufgedrückt hat, nehme ich den Fahr-
stuhl, und mit jedem der nacheinander auf der Anzeigetafel
aufleuchtenden einundzwanzig Stockwerke wächst meine
Wut. Vor meinen Augen sehe ich Funken sprühen.
Sie ist eine Lügnerin.
Eine Bedrohung für mich.
Für Sam.
Und dann:
Es lag nicht an mir. Es war nicht mein Buch. Sie hat mir
mein altes Leben weggenommen.

Nie zuvor war ich so wütend. Obwohl Wut wenig mit dem
zu tun zu haben scheint, was ich im Moment empfinde. Wut
ist zu weich, eine Stimmung unter anderen. Dies ist körper-
lich: eine elektrische Spannung, die sich knisternd aus meiner
Brust entlädt. Eine saubere Trennung zwischen dem denken-
den und dem handelnden Ich.
Angela hat die Tür offen gelassen. Das merke ich, als ich
dagegentrete und die Klinke gegen den Putz der Innenwand
knallt.
Mein handelndes Ich stürzt sich auf sie.
Mein denkendes Ich registriert die billigen Möbel, die gar-
dinenlosen Panoramafenster mit Blick nach Westen über den
See, die Eisenbahngleise und die sich bis zum Horizont er-
streckende Stadt. Darüber die Hitzeglocke des Tages.
Vielleicht hat Angela etwas gesagt, bevor ich mit ihr zu-
sammenpralle, aber es hat keinen Eindruck auf mich gemacht.
Jetzt dringt jedenfalls kein Wort mehr über ihre Lippen. Das
liegt daran, dass ich ihren Hals gepackt habe und mit den
Daumen zudrücke. Etwas Weiches unter ihrer Haut gibt nach.
Ich schreie sie an mit einer Stimme, die nicht meine ist.
Ich weiß nicht, was du willst. Ich weiß nicht, wer du bist.
Es ist mir auch egal. Denn wenn ich den Typen, von dem du
mich beschatten lässt, noch einmal irgendwo in der Nähe
meines Hauses oder meines Sohnes sehe, bringe ich dich ver-
dammt noch mal um.
Ihr Körper zuckt.
Hast du das verstanden? Ich bringe dich verdammt noch
mal um.
Dabei halte ich weiter Angelas Kehle gepackt und spüre,
wie ihr Körper nachgibt. Ich bringe sie schon jetzt um. Ich bin
neugierig zu sehen, wie sich das Ende ankündigen wird. Eine
letzte Zuckung? Eine plötzliche Starre?
Du bist es.

Ich lasse sie los. Das heißt, ich muss sie losgelassen haben,
denn sie versucht offenbar, etwas zu sagen.
»Ich dachte, du wärst zu … schlicht. Aber genau das sind
die Leute, die so etwas machen, oder? Ein unbeschriebenes
Blatt.«
»Ich bin es nicht.«
»Du wusstest gerade gar nicht, was du tust. Du warst eine
andere Person. Vielleicht hat diese andere Person Petra getö-
tet.«
Angela steht mühsam auf und bewegt sich zum Fenster,
ohne den Blick von meinen Händen zu wenden.
»Ich bin derjenige, der verfolgt wird«, sage ich.
»Du hättest mich beinahe erwürgt!«
»Weil du in meinem Leben rumpfuschst. Meinen Sohn be-
drohst.«
»Leck mich.«
Die Erschöpfung trifft uns beide gleichzeitig. Unsere Füße
trippeln unsicher, als ob wir im Sturm an Deck eines Schiffes
stehen würden.
»Sag mir nur eins. Wenn du so unschuldig bist, warum
versteckst du dich dann hinter einem anderen Namen?«
»Um ihm aus dem Weg zu gehen.«
Sie erzählt, wie sie ihn von Zeit zu Zeit gesehen hat. Seit
der Kensington-Kreis aufgehört hat, sich zu treffen. Jemand,
der auf der anderen Straßenseite des Gebäudes auftauchte, in
dem sie arbeitete, durch die Fenster der Wohnungen blickte,
in denen sie im Laufe der Jahre gewohnt hatte, oder durch die
Scheibe eines Restaurants, in dem sie gerade aß. Er blieb im-
mer im Schatten. Gesichtslos.
Es war der Sandmann, der sie gezwungen hat, ihren Na-
men, ihr Aussehen und ihren Arbeitsplatz zu wechseln, bis sie
von Conrad Whites und Evelyns Unfall erfuhr. Danach wurde
es sehr viel leichter zu verschwinden.
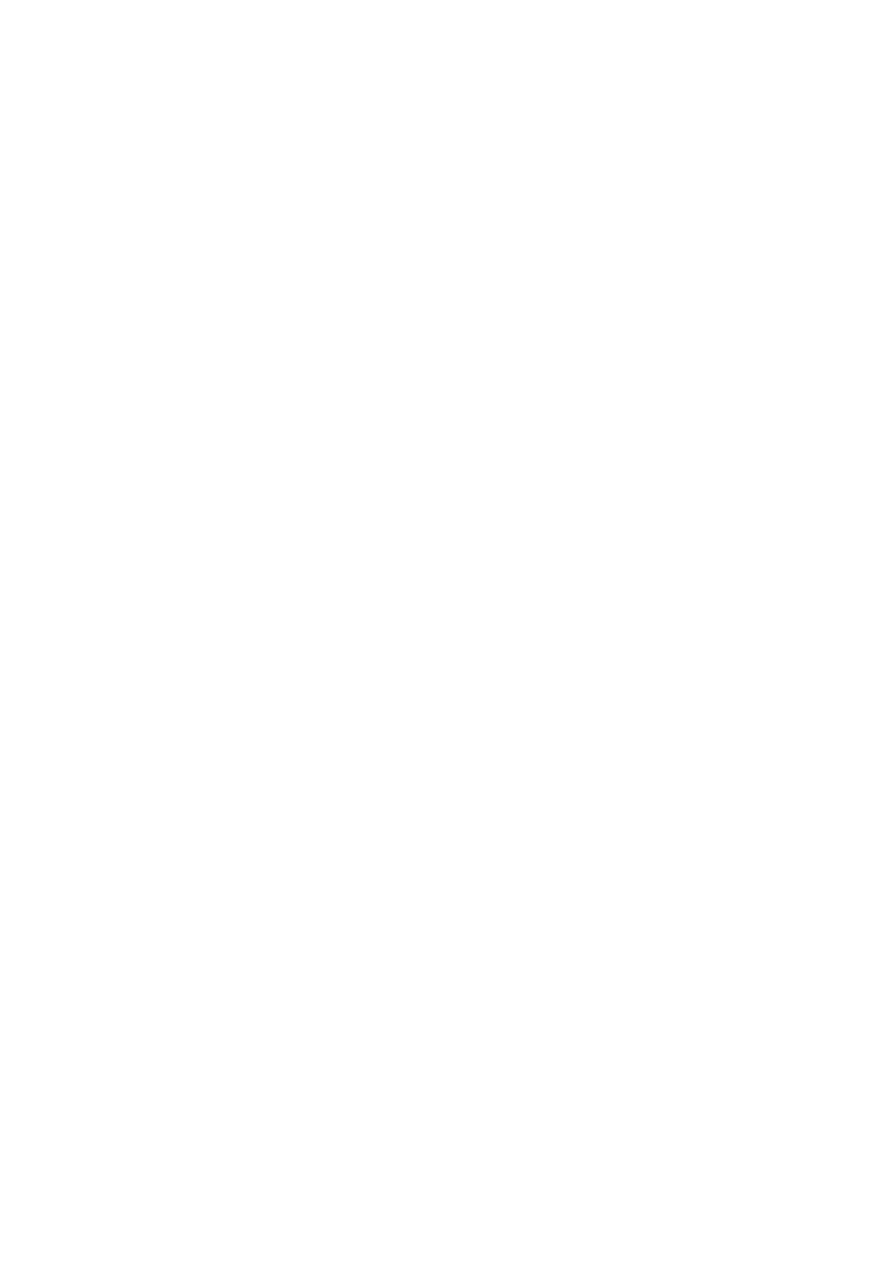
»Und zu dem Verschwinden gehörte wohl auch, Geschich-
ten unter Pseudonymen zu veröffentlichen?«
»Pseudonyme?«
»Evelyn Sanderman. Pam Turgenov. Wer bist du sonst
noch gewesen?«
Angela verschränkt die Arme. »›Der U-Bahn-Fahrer‹.«
»Eine wirklich gute Geschichte. Wenn auch nicht komplett
von dir.«
»Genau wie bei dir, und dir ging es nur um Anerkennung.«
»Das ist nicht wahr.«
»Nicht?«
»Ich habe es getan, um etwas zu haben, was meins ist.«
»Auch wenn es nicht deins war.«
»Ja. Auch wenn es nicht meins war.«
»Das interessiert mich überhaupt nicht.«
»Was dann?«
»Menschen«, sagt sie. »Ich interessiere mich für Men-
schen.«
Angela war davon überzeugt, dass er sie irgendwann fin-
den würde, egal wie oft sie ihr Leben änderte oder eigene
Werke unter fremden Namen verschickte. Und vor Kurzem,
an dem Tag, an dem sie mit mir Mittag essen war, entdeckte
sie, als sie zu ihrem in einer Tiefgarage geparkten Wagen zu-
rückkehrte, auf der Windschutzscheibe eine mit Lippenstift
geschriebene Botschaft. Mit ihrem Lippenstift. Gestohlen aus
ihrem Badezimmer.
»Er war hier drinnen?«
»Und er will, dass ich es weiß. Dass er jederzeit zurück-
kommen kann.«
»Und was stand auf deiner Windschutzscheibe?«
»Du gehörst mir.«
Zunächst glaubte sie, dass er ihr mit dieser Überwachung
nur drohen wollte. Sie nahm an, es würde ihm Vergnügen

bereiten, zu wissen, dass ihr Leben auf bloße Nervenreflexe,
auf die nervösen Überlebensinstinkte von Ungeziefer redu-
ziert war. Aber jetzt denkt sie, dass mehr dahintersteckt: Die
Spuren, die er hinterlässt, werden eines Tages dazu dienen, ihr
die Schuld in die Schuhe zu schieben. Irgendwann wird ir-
gendwas hängen bleiben. Wie ich hat sie begonnen, sich als
Verdächtige anstatt als Opfer zu sehen.
Wie um diesen Gedanken zu bestätigen, blicke ich über
Angelas Schulter und bemerke etwas auf der Anrichte in der
Küche. Angela dreht sich um und sieht es auch.
»Woher hast du das?«, frage ich.
»Ich habe es heute Morgen gefunden. Es steckte in meinem
Briefkasten.«
»Es ist eine Yankees-Kappe.«
»Vermutlich wieder eine seiner Botschaften. Obwohl ich
nicht verstehe, was sie bedeuten soll. Alles in Ordnung? Du
siehst aus, als würdest du ohnmächtig werden.«
Ich packe mit beiden Händen eine Stuhllehne, um mich
aufrecht zu halten. Der Raum und die Stadt vor dem Fenster
schwanken hin und her.
»Diese Kappe«, sage ich, »ist dieselbe, die Petra getragen
hat, als sie verschwunden ist.«
Angela sieht mich stumm an mit einem Ausdruck, der ihre
Unschuld sicherer bestätigt als jedes wortreiche Leugnen.
Auch bei den Vorstellungen der größten Schauspieler schim-
mern an den Rändern Spuren der Künstlichkeit durch - sie
machen ein Drama dramatisch, das kleine bisschen Extra, um
auch die Zuschauer auf den billigen Plätzen zu erreichen.
Aber die Miene, die Angela mir zeigt, ist so verwirrt, so jen-
seits möglichen Kalküls, dass sie jeden Rest von Argwohn
tilgt, den ich noch gehegt habe.
»Alles wird gut«, sage ich und mache einen Schritt auf sie
zu.

»Wer macht das?«
»Ich weiß es nicht.«
»Warum wir?«
»Ich weiß es nicht.«
Am Himmel verblassen die letzten matten Streifen der
Dämmerung, und die Stadt nimmt eine aufdringliche Kon-
kretheit an, Straßen, Dächer und Reklametafeln bekommen
schärfere Konturen. Wir wenden uns schweigend zum Fens-
ter. Und denken beide dasselbe.
Er ist dort draußen.
Das Gittermuster des zähflüssigen Verkehrs, die schlei-
chenden Straßenbahnen und die Fußgänger, die stillzustehen
scheinen.
Er ist einer von ihnen.
Ich werde wach vom Widerschein der digitalen Reklametafeln
am Seeufer, der blau, rot und gelb über die Zimmerdecke
huscht. Lichter des Geldes.
Ich richte mich auf, lehne mich an das Kopfbrett und sehe
Angela beim Schlafen zu. Ihr Körper ist reglos zusammenge-
rollt wie der eines Kindes. Seit Tamaras Tod war ich nicht
mehr mit einer Frau zusammen, und es ist merkwürdig - viel-
leicht die merkwürdigste aller merkwürdigen Enthüllungen
dieses Tages -, dass es Angelas Haar ist, das ich aus ihrem
Gesicht streiche, während sie weiterschläft.
Von Zeit zu Zeit beobachte ich sie, aber nicht wie ein
Liebhaber in der Nacht seine Geliebte. Ich blicke auf ihre Ge-
stalt, als wäre ich nicht anwesend. Ein Zeuge der Unterwelt,
ein Geist.
Allerdings ein Geist, der auf die Toilette muss. Ich schlage
die Decke zurück und rutsche zum Fußende des Bettes. An-
gelas nackte Füße hängen seitlich über den Rand, blass und
blau geädert.

Ich will mich gerade von der Matratze erheben, als mich
etwas stutzen lässt. Drei fehlende Zehen an einem Fuß. Der
kleine Zeh und die beiden daneben sind bloß verheilte Stum-
pen, die dem Fuß eine unnatürliche Rundung geben, ein An-
blick, der eine Welle des Ekels in mir auslöst, die ich bis in
meine Zehen spüre, als ich sie auf den Boden setze.
Angela mag unter beliebig vielen Namen firmieren, aber
die fehlenden Glieder an ihrem Fuß binden sie fest an eine
Identität. Das kleine Mädchen in ihrer Geschichte, dem die-
selben Zehen erfroren sind, als sie in der Scheune übernach-
tete, während ihr Pflegevater im Wald verschwand.
Das Mädchen mit dem unaussprechlichen Geheimnis.
Das Mädchen, das neben mir schläft.

22
Es lässt sich wahrscheinlich nur schwer nachvollziehen, aber
ich frage Angela nicht, ob sie tatsächlich die erwachsene Ver-
sion des kleines Mädchens aus ihrem Tagebuch des Grauens
ist, weil ich nicht will, dass sie mich für einen naiven Leser
hält. Die Annahme, dass fehlende Zehen beweisen, das
Schicksal des Mädchens des Sandmanns sei autobiografisch
und keine Fiktion - eine Fiktion, die wie alle Geschichten
zwangsläufig ein Flickenteppich aus gelebtem wie erfunde-
nem Leben ist -, würde mich als primitiven Fan der untersten
Reihen der True-Crime-Regale entlarven, einen prosaischen
Simpel, der von seinen Taschenbüchern und Popcorn-Filmen
das Versprechen verlangt: Nach einer wahren Geschichte! Die
Garantie der Fantasielosigkeit.
Und warum kümmert es mich, dass sie diesen Eindruck
bekommen könnte? Zum einen aus Stolz. Als Autor mag ich
ein Scharlatan sein, aber ich bin immer noch ein guter Leser.
Ich weiß sehr wohl, dass es dummes Gerede ist, Verbindungs-
linien zwischen dem Leben einer Autorin und ihren Figuren
ziehen zu wollen.
Das und ein weiterer Grund lassen mich meine Frage nach
erfrorenen Zehen für mich behalten, als ich aus ihrem Schlaf-
zimmer in die Küche komme, wo Angela mir einen Kaffee
eingießt: Ich bin einsam.
»Gut geschlafen?«, fragt sie und schiebt mir einen Becher
mit dem Aufdruck World Class Bitchüber den Tisch.
»Ja. Aber ich hab schlecht geträumt.«

»Wie schlecht?«
»Normal schlecht.«
»Ich auch. Deswegen bin ich schon auf. Außerdem muss
ich in weniger als einer Stunde bei der Arbeit sein.«
Ich hatte vergessen, dass sie einen Job hat. Ich hatte ver-
gessen, dass irgendjemand einen Job hat. Eine weitere
Nebenwirkung des Schriftstellerlebens. Man fängt an zu
glauben, jeder könne es sich leisten, den ganzen Tag zu Hause
vor sich hin zu wurschteln, auf den Briefträger zu warten und
so zu tun, als wäre aus dem Fenster zu schauen und zu über-
legen, was man in die Mikrowelle werfen soll, eine Form von
Meditation.
»Wegen letzter Nacht«, setze ich an. »Ich wollte dir sagen,
wie sehr -«
»Ich denke, du solltest mit ein paar von den anderen re-
den.«
»Den anderen?«
»Aus dem Kreis.«
Angela hält ihren Kaffeebecher in beiden Händen und
wärmt sie gegen den kühlen Luftzug der Klimaanlage.
»Das ist komisch. Ich wollte etwas über uns sagen. Etwas
Nettes.«
»Das ganze Morgen-danach-Ding ist wohl nicht meine
Stärke.«
»Das heißt, es gab andere. Andere Morgen.«
»Ja, Patrick. Es gab andere Morgen.«
Ich trinke lässig einen Schluck von dem brühend heißen
Kaffee. Nachdem die Verbrennung in meinem Hals zu einem
schmerzhaften Pochen abgeklungen ist, frage ich, warum sie
will, dass ich mit den anderen spreche.
»Um herauszufinden, was sie wissen. Ob sie auf dieselbe
Weise … verstrickt sind wie wir.«

Ich nicke und nicke immer weiter. Das liegt an dem Wort,
das sie eben benutzt hat. Verstrickt. Dasselbe Wort, das Con-
rad White verwendet hat, als er mich nach meiner Meinung zu
Angelas Geschichte fragte. Du willst wissen, ob sonst noch
jemand so verstrickt ist wie du.
»Wie kam es eigentlich, dass du deine Handtasche in Con-
rads Wagen liegen gelassen hast?«
»Das hab ich dir doch erzählt. Wir haben uns zu der Zeit
ein paarmal gesehen.«
»Gesehen oder gesehen?«
»Er hat sich dafür interessiert, wer ich bin.«
Und wer bist du, frage ich beinahe, bremse mich jedoch
rechtzeitig mit einem weiteren mandelnverbrühenden Schluck
Kaffee.
»Hast du sein Buch gelesen?«
»Jarvis und Wellesley? Klar«, sagt sie. »Warum?«
»Ich glaube, dass er in dir das gesehen hat, wonach die Fi-
gur in seinem Roman gesucht hat.«
»Seine tote Tochter.«
»Das vollkommene Mädchen.«
»Hat er dir das erzählt?«
»Dann hab ich also recht.«
»Es ist nicht falsch.«
Angela erzählt mir, dass Conrad sie nach ihren Treffen
manchmal nach Hause gefahren habe. Zunächst sprachen sie
über die üblichen literarischen Themen wie Lieblingsbücher
(Der Prozess für Conrad, Der Magus für Angela), Arbeits-
techniken, Schreibblockaden. Aber bald lenkte Conrad ihr
Gespräch auf den Ursprung von Angelas Geschichte. Er fragte
nach ihrer Kindheit, nach ihren Jugendfreundinnen und wo
ihre Eltern jetzt lebten. Irgendetwas an der zielgerichteten Art
seiner Fragen löste bei Angela einen Abwehrreflex aus, so-

dass ihre Antworten absichtsvoll immer vager wurden, je
mehr er sie bedrängte. Das machte ihn wütend.
»Es schien nicht nur neugierig, sondern verzweifelt«, sagt
Angela und steckt Handy und Schlüssel in ihre Handtasche.
»War er in dich verliebt?«
»In gewisser Weise vielleicht schon. Nicht wie ein Lieb-
haber, sondern irgendwie unheimlich, weißt du? Aber das war
nicht der Grund, warum er all diese Fragen gestellt hat.«
Sie verstummt. Es gefällt ihr nicht, wohin diese Gedanken
sie führen.
»Ich glaube, er hatte Angst«, sagt sie.
»Angst wovor?«
»Vor dem, wovor wir auch Angst haben.«
»Und er -«
»Er dachte, es hätte etwas mit meiner Geschichte zu tun.«
Ich folge Angela zur Tür und ziehe mir auf dem Weg mei-
ne Armbanduhr, Socken und Schuhe an.
»Hatte er Kontakt mit dem Sandmann - oder mit jeman-
dem, den er für den Sandmann hielt? Zu der Zeit gab es doch
diese Mordserie. Vielleicht hat er Verbindungen gezogen oder
Zusammenhänge erkannt, an die keiner von uns gedacht hat.«
»Vielleicht«, sagt Angela. »Vielleicht war er aber auch nur
ein verwirrter, menschenscheuer Sonderling, der sich selbst
verrückt und aus nichts eine Riesensache gemacht hat.«
Im Aufzug nach unten frage ich sie, wen wir ihrer Meinung
nach als Ersten aus dem Kreis aufsuchen sollten.
»Wir?«
»Ich dachte, du hättest gesagt, es könne nützlich sein he-
rauszufinden, was die anderen wissen.«
»Aber ich kann sie doch nicht danach fragen.«
»Warum nicht?«
»Wem hat er die Yankees-Kappe geschickt?«

Die Fahrstuhltür öffnet sich. Draußen hat die drückende
Hitze schimmernde Dunstschichten entstehen lassen.
»Kann ich dich anrufen?«, frage ich.
»Erst mal nicht.«
»Warum nicht?«
»Du gehörst mir. Schon vergessen?«, sagt sie und öffnet
die Tür zu der brennenden Welt. »Ich glaube nicht, dass es
ihm gefallen würde, wenn er mitkriegt, dass ich dir gehöre.«
Man sollte nicht meinen, dass man, gefangen in einem Netz
von Intrigen(wer hätte geahnt, dass diese Phrase einmal meine
Situation beschreiben würde?) so viel freie Zeit haben kann.
Glauben Sie mir, wenn man keiner geregelten Arbeit nach-
geht, gibt es selbst an Tagen, wo einem tausend Sachen durch
den Kopf gehen, Phasen der Leere. Man kommt schließlich
nicht umhin, ganz banale Dinge zu tun: Mahlzeiten nachzu-
holen, zur Toilette zu sprinten, ausgiebig zu duschen. Dann ist
da noch die zu erledigende Post, der überquellende Wäsche-
korb, der Zahnarzttermin. Man kann Mordverdächtiger oder
potenzielles Opfer eines Serienmörders sein und seine Zeit
trotzdem noch mit der tränenreichen letzten halben Stunde
von Dr. Phil verschwenden.
In jenen brütenden Julitagen gibt es jedoch auch ein paar
Aktivitäten, denen ich so regelmäßig nachgehe, dass ich nicht
jede Wiederholung registriere. Die erste ist mein Tagebuch.
Nachdem ich anfangs nur verstohlene Notizen vor dem Ein-
schlafen gemacht habe, trage ich es inzwischen überall bei
mir, halte Gesprächsfetzen und das Wo und Wann meines
Lebens fest. Bei erneuter Lektüre ist es ein zunehmend un-
strukturiertes Dokument, das mit mehreren Seiten ordentlich
untereinandergeschriebener Punkte beginnt, jedoch schnell zu
einem bunten Sammelsurium wird. Nachrichten an Sam sind
darunter, skizzenhafte Zeichnungen von Petra und Detective

Ramsey (ein Porträt von Angela versuche ich erst gar nicht,
weil ich nicht wüsste, mit welcher Linie ich anfangen sollte)
und sogar ein Brief an den Sandmann, in dem ich ihn bitte,
meinen Sohn zu verschonen, wenn er mich schon unbedingt
in sein Nichts-istso-wie-es-scheint-Reich entführen muss.
Später kommt mir der Gedanke, dass dieses Tagebuch, wenn
alles vorbei ist, die Art Dokument sein könnte, die die Be-
hauptung stützt, dass der arme alte Patrick sich längst verirrt
hatte, bevor der Schatten ihn erwischte. Denn was bedeutet
Zurechnungsfähigkeit anderes, als die Grenze zwischen Fik-
tion und Realität zu bewachen?
Meine andere tägliche Gewohnheit ist ein Anruf bei Sam,
um zu fragen, wie es ihm geht. Meistens spielt er mit Staceys
Kindern im Garten (sie haben einen Swimmingpool, für uns
Stadtmäuse ein unvorstellbarer vorstädtischer Luxus), ist auf
einem Zeltausflug mit Übernachtung (statt des krea-
tiv-gestalterischen Sommerkursus, zu dem ich ihn geschickt
habe) oder mit sonst irgendeiner gesunden Sommeraktivität
beschäftigt, die ich schon längst mit ihm unternehmen wollte,
meistens dann aber doch unterlassen habe, um ihn stattdessen
mit einem Buch oder einer Kinokarte zu bestechen. Mit ande-
ren Worten, selbst wenn ich anrufe, komme ich nicht dazu,
ihn zu sprechen. Immerhin gibt es mir Gelegenheit, Stacey
noch einmal für alles zu danken, ihr zu versichern, dass ich
Sam abholen komme, sobald ich »ein paar Dinge geregelt
habe«, und sie zu bitten, ihm zu sagen, dass ich angerufen
habe.
Da kann man mal sehen: Selbst ein Mann, der sich in
einem Netz von Intrigen verfangen hat, wehrt sich mit allem,
was ihm bleibt, gegen das Unvermeidliche. Er klammert sich
an die Form, die das Leben hatte, bevor er sich verheddert hat,
obwohl er kaum etwas anderes tun kann, als darauf zu warten,

dass die Spinne seinen Kampf spürt und entscheidet, genug,
das ist genug für diese Fliege. Es wird Zeit.
Seit wir uns in der Lobby ihres Apartmentgebäudes vonei-
nander verabschiedet haben und ungeachtet ihrer Bitte, es
nicht zu tun, habe ich ein paarmal bei Angela angerufen und
mir ein paar faule Ausreden abgeholt. (»Bei der Arbeit ist
diese Woche wirklich die Hölle los.« - »Ich weiß nicht, ich
bin einfach so müde.«) Ich erkläre ihr, dass ich sie sehen
muss. Dass ich sie vermisse.
»Ich weiß nicht, ob ich das kann«, sagt sie.
»Wir können einfach bloß reden.«
»Worüber würden wir denn reden?«
»Es müsste ja nicht über … schlimme Sachen sein.«
»Aber etwas anderes gibt es nicht.«
Sie fährt fort, mir zu erklären, dass sie weitere Zeichen von
»ihm« erhalten hat. Als ich sie frage, worin diese Botschaften
bestehen, verstummt sie. Man hört ihren Atem in ihrem zuge-
schnürten Hals.
»Wenn wir zusammenbleiben, könnten wir uns vielleicht
gegenseitig beschützen«, schlage ich vor.
»Das glaubst du doch selbst nicht.«
»Ich hab gesagt, vielleicht.«
»Ich glaube, er will, dass wir uns voneinander fernhalten.
Dass jeder von uns seiner eigenen Wege geht.«
»Und wenn wir nicht mitspielen -«
»- wird er uns trennen. Oder uns noch Schlimmeres antun.
Wir müssen nach seinen Regeln spielen.«
Das hat bis jetzt ja auch so viel gebracht, will ich einwen-
den. Zusammen mit einer Frage, die mir zu spät einfällt: Was
will dieser Mensch eigentlich von uns?Wenn es darum geht,
dass Patrick Rush tiefstes Bedauern darüber empfindet, seinen
Namen auf dem Titel eines geklauten Romans benutzt zu ha-
ben, ist seine Mission erfüllt. Mea culpa. Und wenn er wieder

dazu übergehen will, wahllose Morde zu begehen, werde ich
ihm ganz bestimmt nicht im Wege stehen.
Wahllose Morde.
Dieses Rätsel beschäftigt mich in der folgenden Stunde.
Vergraben in meiner Kellerkrypta skizziere ich die wenigen
Verbindungen, die ich herstellen kann, in meinem Tagebuch.
Carol Ulrich.
Ronald Pevencey.
Jane Whirter.
Und jetzt Petra Dunn.
Sie haben überhaupt nichts gemeinsam. Aber in seiner
Vorstellung muss es einen Zusammenhang geben. Für den
Sandmann waren sie keineswegs wahllos. Man muss bloß
denken wie ein Psychopath.
Nun, sage ich mir. Ich bin Schriftsteller im Ruhestand. Das
kann so schwierig nicht sein.
In den vier Jahren seit dem Ende des Kensington-Kreises sind
unzählige neue Schreibgruppen entstanden. Sie werden in
Bibliotheken, Buchläden und Cafés abgehalten, in Suchtkli-
niken, Synagogen, Yoga-Aschrams und bei den Anonymen
Alkoholikern. Die Zahl der Schreibwerkstätten, Workshops
und literarischen Stammtische ist grenzenlos. Und ich melde
mich bei allen an. Oder zumindest bei so vielen, wie ich kann.
Nicht, um zu lernen oder mich auszutauschen, sondern um die
Schritte zurückzuverfolgen, die mich hierher geführt haben.
Die Reise, die alle Mörder aus Leidenschaft antreten müssen:
eine Rückkehr an den Ort des Verbrechens.
Da Sam sicher bei Stacey ist, kann ich für den drückend
heißen Rest der Woche frei von einem Zirkel zum anderen
hüpfen. Und während ich via Expressway oder per U-Bahn zu
den verschiedenen Versammlungen uptown, downtown oder

außerhalb sause, stelle ich überall dieselben Fragen. Und
manchmal bekomme ich auch Antworten.
»Sagen euch diese Namen irgendwas?«, frage ich meine
Zirkelgenossen und nenne Vornamen (und, sofern bekannt,
auch Nachnamen) jedes Mitglieds des Kensington-Kreises.
Am Ende der Woche hat sich mein Verdacht bestätigt.
In einem Keller in Little Italy erfahre ich, dass William vor
einigen Jahren eine Zeit lang regelmäßiger Teilnehmer einer
Gruppe war, die ihn bereits auffordern wollte, nicht mehr zu
kommen (weil die Kindheitsgeschichten eines Tiere häuten-
den, psychopathischen Jungen einfach zu unerträglich waren),
ehe er von sich aus plötzlich nicht mehr erschien. In etwa das
Gleiche habe ich in einem Café in Scarborough, einer öffent-
lichen Bibliothek in Lawrence Park und einer Schwulenknei-
pe in der Jarvis Street gehört: Ein großer, unheimlicher Mann
mit einer allzu realistischen Horrorgeschichte schließt sich
einem Schreibclub an und verschwindet dann.
Und das ist noch nicht alles.
Ich habe in den Zirkeln auch andere Namen erwähnt. Na-
men von Menschen, die ich nie kennengelernt habe, die für
mich jedoch äußerst wichtig sind. Carol Ulrich. Ronald Pe-
vencey. (Jane Whirter habe ich ausgelassen, weil sie vor
ihrem Tod mehr als zwanzig Jahre in Vancouver gelebt hatte.)
Namen, die einige der Befragten kannten. Aber nicht nur, weil
Ulrich und Pevencey zur ersten Serie von Opfern des Sand-
manns gehörten. Man erinnerte sich an sie, weil sie beide frü-
her einmal Mitglieder in einem der Schreibzirkel der Stadt
gewesen waren.
Damit habe ich etwas, das die Polizei, wenn man Zei-
tungsberichten glauben kann, nicht hat: eine Verbindung zwi-
schen den »wahllosen« Opfern des Sandmanns. Sie haben
geschrieben. Und das hat sie aus irgendeinem Grund das Le-
ben gekostet.

23
Auf dem Nachhauseweg durch die Stadt halte ich mein Handy
ans Ohr und tue so, als würde ich mit jemandem sprechen.
Das mache ich nicht zum ersten Mal. Wenn man lange genug
der einzige Fußgänger ist, der nicht telefoniert, bekommt man
irgendwann das Gefühl zu verschwinden. Man muss simsen,
Kontakt halten, neue Nachrichten abrufen. Die Schnellwahl
zum Sinn des Seins.
Als ich diesmal per Fernabfrage den Anrufbeantworter zu
Hause abhöre, vernehme ich überrascht eine bekannte Stim-
me. Ivan.
»Ich hatte eine … Begegnung.«
Eine Pause, die so lange dauert, als hätte er vergessen auf-
zulegen. Dann fällt es ihm ein.
Klick.
Eine Begegnung.
Ich rufe die hinterlassene Nummer an, während ich an
einer Gruppe giggelnder Frauen vorbeikomme, die vor dem
Schaufenster eines Sexshops stehen und an die Scheibe klop-
fen. (»Was ist das, Brenda?« »Weiß nicht. Schätze, man
steckt es irgendwohin, wo die Sonne nie hinscheint.«)
Ivan nimmt nach dem ersten Klingeln ab.
»Patrick?«
»Du hast eine Nachricht hinterlassen -«
»U-Bahn-Station Museum. Morgen. Bahnsteig in südlicher
Richtung. Zehn Uhr.«
Klick.

Ohne es angestrebt zu haben, bin ich jetzt wie all die ande-
ren Millionen, die auf den Bürgersteigen und Straßen an mir
vorbeiströmen. Ich habe Pläne fürs Wochenende.
Unmittelbar nach meiner Heimkehr klopft es an der Haustür.
»Ich habe Ihr Buch ausgelesen. Sehr interessant«, sagt De-
tective Ramsey, der wieder an mir vorbei ins Wohnzimmer
marschiert, als würde mir das Haus nur auf dem Papier gehö-
ren, um noch verlogener hinzuzufügen: »Ich kann es kaum
erwarten zu lesen, was Sie als Nächstes schreiben.«
»Ich schreibe nicht mehr.«
»Tatsächlich?«
»Sind Sie wirklich hier, um über mein Buch zu sprechen?«
»Es ist eine Ermittlung. Irgendwas müssen wir schließlich
in die Akten schreiben.«
Bei jedem Gespräch, das nach dem Prinzip Vorwurf und
Erwiderung strukturiert ist - Begegnungen mit Steuerprüfern,
Nachbarn, die verärgert über das Laub sind, das ein Baum in
ihren Garten abwirft -, gibt es einen Punkt, an dem man die
Wendung zum Hässlichen entweder nehmen oder meiden
kann. Das ist der Punkt, den Ramsey und ich erreicht haben.
Und ich habe beschlossen, dass ich den Mann nicht mag.
»Wissen Sie was?«, sage ich. »Vielleicht steckt doch noch
ein Buch in mir. Ehrlich gesagt inspirieren Sie mich gerade zu
einer Figur.«
»Oh? Und was für eine Figur ist es?«
»Mit Makeln natürlich. Ein neugieriger Ermittler, der
schlau ist, aber nicht so schlau, wie er denkt. Sein Geheimnis
ist, dass er Schriftsteller sein möchte. Krimis sind das Einzige,
was er liest. Er würde sich gern selbst einen ausdenken, wenn
er nicht so damit beschäftigt wäre, richtige Verbrechen zu
lösen.«

Zu behaupten, dass sich Ramseys Miene verfinstert, wäre
eine Untertreibung. Er versteift den Körper zur Pose eines
Kneipenschlägers, und ich kann die klare Antwort auf meine
frühere Frage erkennen. Auf jeden Fall mehr Glasgow als
Edinburgh.
»Eine komische Figur«, sagt er.
»Ich glaube schon.«
»Da irren Sie sich.«
»Sie meinen, er ist nicht komisch?«
»Ich meine, es wäre ein Fehler, ihn auszulachen.«
Er wirft mir einen Blick zu, der sich nur schwer beschrei-
ben, sondern sich am ehesten in seiner Wirkung erfassen lässt.
In mir weckt er vor allem den Wunsch, zur Tür zu rennen.
»Was sagt man, wenn man einem Schriftsteller Glück
wünscht?«, fragt er und geht an mir vorbei. »Hals- und Bein-
bruch?«
»Meistens bloß: ›Lass dich von den Schweinen nicht
unterkriegen. ‹«
»Das gilt auch für meinen Beruf.«
Man hört, wie die Haustür mit einem Ruck zugezogen
wird. Das Haus wartet eine ganze Minute, bevor es sein
Seufzen und Ticken wiederaufnimmt.
Als ich mich später frage, warum ich Ramsey nicht erzählt
habe, was ich über die erste Runde von Opfern des Sand-
manns herausbekommen habe - dass sie nämlich alle Mitglie-
der eines Schreibzirkels waren und William bei einigen dieser
Treffen auftauchte -, wird mir eines klar: Es lag nicht daran,
dass ich den Typ nicht mag oder mich diese Information noch
weiter in Gefahr gebracht hätte. Ich habe es ihm nicht erzählt,
weil mir in dem Moment, in dem Ramsey mir einen Blick auf
seine dunklere Seite gewährte, ein Gedanke kam.
Vielleicht ist er es.

Der Verdacht gründet sich auf kaum mehr als eine auffla-
ckernde Intuition, aber nachdem er gegangen ist, kann ich ihn
mit einer Reihe plausibler Details untermauern. Erstens hat
Ramsey die Ermittlungen der ersten Sandmann-Morde gelei-
tet. So hatte er nicht nur Zugang zu den Tatorten und damit
die Gelegenheit, Beweismaterial zu manipulieren, sondern
auch zu Kollegen und den Medien, eine bequeme Art, mögli-
che Fehler zu kaschieren (obwohl er garantiert nur wenige
gemacht hat). Zweitens ist da seine körperliche Statur: in etwa
so groß wie der Sandmann und zweifelsohne kräftig genug,
um einen Menschen zu schlachten.
Andererseits könnte das Ganze auch ein Produkt meines
fortschreitenden Wahnsinns sein. Den Detective verdächti-
gen?
Man muss nicht vom Sandmann verfolgt werden, um über-
all nur noch Verbrechen und Verbrecher zu sehen. Alles, was
man getan hat, die Entscheidungen, die man getroffen hat, die
Möglichkeiten, die einem offenstanden - all das war einmal
die eigene Geschichte. Dann kommen Diebe und stehlen sie.
Und man stellt sich die Frage: Wer war’s?
Die erste Äußerung von Angst. Von Versagen.
Ramsey bleibt jedoch nicht meine letzte Gesellschaft an die-
sem Abend. Vielmehr gehe ich noch mit einem Freund auf
einen Drink aus - obwohl sich das sehr viel normaler anhört,
als es ist. Denn ich trinke mit Len. Und er hat mich gebeten zu
kommen, um mir eine »total abgedrehte Idee« über Angela
vorzutragen.
Wir verabreden uns im Paddock, einem alten Gewölbe
südlich der Queen Street. Als der Barkeeper kommt, bestelle
ich einen Bourbon Sour und höre überrascht, wie Len das
Gleiche verlangt.

»Ich wusste gar nicht, dass du mit dem Trinken angefangen
hast.«
»Hab ich auch nicht.«
»Du hättest auch einen Saft oder so bestellen können.«
»Ich will keine Aufmerksamkeit erregen«, sagt er und sieht
sich um. »Und es ist wichtig, dass ich an einem Ort mit dir
rede, den ich normalerweise nicht aufsuchen würde.«
»Warum?«
»Damit sie uns nicht sieht.«
Nachdem unsere Drinks gebracht worden sind, erzählt er
mir, dass Angela ihn vor einigen Tagen in seiner Wohnung
besucht hat. Sie sah sich in seiner Dachkammer um und be-
gutachtete die Bücherregale. Sie bemerkte Der Sandmann,
erwähnte es jedoch mit keinem Wort. Len konnte nicht umhin
zu bemerken, dass sie ein »nettes - weißt du, ein sexy nettes
Parfüm« aufgelegt hatte. Und sie trug eine Bluse, bei der sei-
nem Eindruck nach ein paar Knöpfe fehlten.
»Wann genau war das?«
»Am Mittwoch. Warum?«
»Nur so.«
Mittwoch. Zwei Tage, nachdem Angela mir erklärt hatte,
dass wir uns nicht mehr treffen sollten. Und dann besucht sie
Len - den zu vorzeitiger Glatzköpfigkeit neigenden, nach
Pappe riechenden großen Jungen Len. Ich denke nur kurz da-
rüber nach, und mein Glas ist leer. Ich stürze auch Lens Drink
hinunter und hebe die Hand, um eine neue Runde zu bestel-
len.
Len berichtet, dass sie sich zunächst nur mit ihm unterhal-
ten habe, wie sie es vielleicht bei einem Treffen des Kreises
getan hätte, wenn sie dort je mit ihm gesprochen hätte. Ein
Gespräch unter Autoren. An was er gerade arbeitet, wem er
seine Sachen geschickt hat, Bücher, die sie in letzter Zeit ge-
lesen haben.

»Hast du sie danach gefragt, warum sie unter einem fal-
schen Namen veröffentlicht hat?«
»Dazu bin ich gar nicht gekommen.«
»Ich dachte, ihr hättet nur rumgesessen und geredet?«
»Haben wir auch. Aber dann wurde es sonderbar.«
Sonderbar wurde es, als Angela sich vorbeugte, eine Hand
auf sein Knie legte und ihm gestand, dass sie, sollte sie je eine
Geschichte über ihn schreiben, schon wisse, welchen Titel sie
ihr geben würde.
»›Die Jungfrau‹«, sagt Len. »Also frage ich: ›Wieso wür-
dest du sie so nennen?‹ Und sie sagt: ›Weil du noch nie mit
einem Mädchen zusammen warst, oder, Len?‹ Und dann hat
sie mich geküsst.«
»Sie hat dich geküsst? Wohin?«
»Auf den Mund.«
»Und was dann?«
»Ich weiß nicht. Ich nehme an, ich hab mich irgendwie
gewehrt. Sie weggestoßen oder so.«
»Warum?«
»Weil sie mich nicht richtig geküsst hat. Es war eher so, als
wollte sie sich über mich lustig machen.«
»Woher wusstest du das?«
»So hat es sich angefühlt.«
Ich drücke Len ein Glas in die Hand und dränge ihn, etwas
zu trinken. Das tut er. Er nimmt einen großen Schluck. Ge-
folgt von einem noch größeren.
»Willkommen in der wunderbaren Welt der Alko-
hol-Therapie«, sage ich.
»Es fühlt sich warm an.«
»Es wird immer noch wärmer.«
Er wischt sich mit dem Hemdsärmel die Augen. Ich würde
eine Hand auf seine Schulter legen, um ihn zu trösten, aber
die Wahrheit ist, dass ich ihn auch jetzt nicht anfassen will.

Stattdessen schenke ich ihm Zeit. Als er so weit ist, erzählt er,
dass Angela, nachdem sie ihn zu Ende geküsst hatte, meinte,
er müsse ihren Kuss gar nicht erwidern. Sie wisse auch so
schon alles, was sie wissen müsse.
»Worüber?«
»Über mich.«
»Was wollte sie über dich wissen?«
»Alles, was sie brauchte, um ihre Version von mir zu
schreiben.«
»Sie schreibt eine Geschichte basierend auf deiner Person?
›Die Jungfrau‹?«
»Ich glaube, sie schreibt Geschichten über uns alle«, sagt
Len und beugt sich noch näher. »Aber ich bin als Nächster
dran.«
»Als Figur in ihrer Geschichte.«
»Nein. Mit dem Sterben.«
Len geht es nicht gut. Die Tatsache tritt nun deutlich zuta-
ge. Er ist nicht bloß ein weiterer Comic-Spinner, einer der
halb Unsichtbaren, einer der Typen mit Mundgeruch, die man
zu ignorieren versucht, wenn sie hinter einem am Bankauto-
maten stehen und einem über die Schulter spähen. Er ist
krank. Aber da wir an einem Ort sind, an dem weitere Cock-
tails erhältlich sind, falls es kritisch werden sollte, denke ich
mir, es kann nicht schaden, ihn noch ein bisschen weiter zu
stupsen.
»Warum dann nicht ich? Warum bin ich nicht als Nächster
dran?«
»Du warst der Einzige, der keine Geschichte hatte«, ant-
wortet Len, leert sein Glas und knallt es unabsichtlich laut auf
die Bar.
»Hat sie das zu dir gesagt?«
»Es war ziemlich offensichtlich.«

Len legt seine Hand auf meine und drückt sie auf den la-
ckierten Tresen, und ich lasse es zu. Ich lasse ihn auch noch
einmal so nahe an mich herankommen, dass er mir beinahe
ins Ohr flüstert.
»Sie ist nicht die, die sie zu sein vorgibt«, sagt er.
Ich versuche, mich loszureißen, aber sein Griff ist kräfti-
ger, als ich ihm zugetraut hatte.
»Ich meine nicht bloß, dass sie psychotisch ist«, redet Len
unvermittelt lauter weiter. In meinem Rücken hört man Stühle
quietschen und die Pause in den Gesprächen der anderen
Gäste, die sich zu dem aufgeregten Typ in der Ecke umge-
dreht haben. »Ich meine, dass sie kein menschliches Wesen
ist.«
»Herrgott noch mal, Len.«
»In mittelalterlichen Legenden gibt es einen Namen für ein
weibliches Wesen, das andere Wesen im Schlaf verzehrt, bis
diese irgendwann völlig ausgelaugt sind oder sterben.«
»Ein Sukkubus.«
»Genau.«
»Jessesmaria.«
»Eine Hexe, die die Gestalt einer Verführerin annimmt.«
»Beruhige dich. Hier. Nimm noch einen Schluck -«
»Normalerweise will ein Sukkubus den Samen schlafender
Männer stehlen - ihre Lebenskraft. Aber in diesem Fall ist es
anders. Sie stiehlt Geschichten.«
»Willst du sagen, dass wir einen Pflock in ihr Herz treiben
sollen? Sie mit einer silbernen Kugel erschießen?«
»Ich meine es ernst. Und je eher du es auch ernst nimmst,
desto länger lebst du vielleicht.«
Len meint es ernst. Das kann die ganze Kneipe sehen. Sie
beobachtet, wie er aufsteht und die Kühnheit, die ihn für we-
nige Augenblicke gepackt hatte, sofort von ihm abfällt.

»Es gibt Begierden, die sind so scheußlich, dass sie nie be-
friedigt werden«, sagt er und scheint nach einem weiteren
Gedanken zu suchen. Aber wenn in seinem Kopf etwas war,
ist es jetzt verschwunden. Ich bin fertig, sagen seine hängen-
den Schultern und sein gesenkter Kopf, als er geht. Mehr
schaffe ich nicht.
Mein Freitag neigt sich seinem von Bourbon gemilderten
Ende entgegen. Aber auch wenn ich mir selber versichere,
dass Lens Theorien so verdreht sind wie eh und je, kann ich
den Gedanken nicht abschütteln, dass ich Len nie wiedersehen
werde.

24
Obwohl ich früh genug zu meinem Treffen mit Ivan aufbre-
che, sorgt am Ende die schon um neun Uhr hoch am Himmel
stehende, gnadenlose Sonne dafür, dass ich zu spät komme.
Zweimal muss ich im Schatten stehen bleiben, um gegen den
Schwindel anzukämpfen, der mich überfällt, weil ich mich in
einer Luft vorwärtsbewege, die alte Menschen umbringt und
bei Jüngeren den Absatz von Asthma-Inhalatoren ankurbelt.
Als ich an der alten Fassade des Royal Ontario Museum ent-
lang schleiche, ist es mir schon egal, ob Ivan mich im Unter-
grund erwartet oder nicht. Ich will nur noch aus der Sonne
raus.
Aber unten ist es auch nicht viel besser. Eine Treppe tiefer
ist die Luft noch beinahe genauso warm, während aus der
Tiefe die Bremsen der Züge quietschen. Was mache ich
überhaupt hier? Warum will ich wissen, was Ivan gemeint hat,
als er von einer »Begegnung« sprach? Klug wäre es, auf der
Stelle um- und nicht nur Ivan, sondern allen den Rücken zu
kehren. Soll irgendjemand anders das Rätsel des Sandmanns
entwirren und sich dafür wie Carol Ulrich, Petra und die an-
deren belohnen lassen.
Aber ich bin nicht klug und besonnen. Und auf der Roll-
treppe nach unten wird mir auch klar, warum: Ich will den
Tag retten. Entehrter Autor, gefeuerter Kritiker, zurückge-
wiesener Liebhaber - all das, ja. Trotzdem gibt es vielleicht
noch eine Chance auf Vergebung, eine umfassende Begnadi-
gung, nach der ich wieder in die Welt zurückkehren darf.

In diesem Augenblick fällt mir der Mann auf der Rolltrep-
pe in der Gegenrichtung auf.
Er packt mit beiden Händen den Handlauf aus Gummi, das
Gesicht unter der hochgeschlagenen Kapuze seines Sweat-
shirts verborgen. Wenn er aufrecht stehen würde, wäre er
groß. Aber das tut er nicht.
Er gleitet vorbei, und ich fahre weiter nach unten.
Es ist nicht sein Anblick, der mich stutzen lässt, sondern
sein Geruch, der in der Luft zurückbleibt. Ein Hauch von
Kompost. Etwas Muffiges, das einem entgegenweht, wenn
man einen nicht angeschlossenen Kühlschrank öffnet.
Ich bin dieser Haut schon einmal so nahe gekommen, dass
ich den Geruch wiedererkenne. Ich habe sogar einmal ver-
sucht, ihn zu beschreiben.
Holzkohle, Schweiß und gekochtes Fleisch.
William.
Als ich mich umdrehe, verschwindet er gerade um eine
Ecke. Die Ausgangstür öffnet sich quietschend und fällt wie-
der zu.
Ich versuche verzweifelt, gegen die Fahrtrichtung der Roll-
treppe nach oben zu laufen - für zwei Schritte aufwärts fahre
ich einen abwärts -, gebe jedoch auf halber Strecke auf, als
eine Mutter mit Kinderwagen die oberste Stufe betritt und
mich böse anschaut. Noch so ein Irrer, sagt ihr Gesicht. Wann
räumt endlich jemand auf in dieser Stadt?
Als ich am Fahrkartenschalter auf die Herausgabe meines
Wechselgelds warte, fällt mir zum ersten Mal auf, dass unten
Schlimmeres im Gange sein könnte als das, was ich gerade
gesehen habe. Unzusammenhängende Rufe - Nicht berühren!
Hilfe … Irgendjemand! - dringen vom Bahnsteig nach oben.
Hysterisches Kinderkreischen mit Echo. Der Schrei einer
Frau.

Als ich mich durch das Drehkreuz dränge, greift gerade ein
Bahnsteigwärter zum Telefon und bedeutet mir winkend zu-
rückzubleiben. Ohne ihn zu beachten, gehe ich weiter und
sehe, wie man der Frau mit dem Kinderwagen erklärt, dass sie
den Bahnsteig nicht betreten dürfe. Sie will wissen, warum.
Der Bahnsteigwärter erklärt es ihr. Was immer es ist, lässt sie
abrupt herumfahren. Ihre Absätze klappern ein SOS auf den
Marmorboden, als sie hinauseilt.
Die Stimmen, die ich von oben gehört habe, werden auf
dem Weg abwärts zum Bahnsteig lauter. Erwachsene Stim-
men haben sich unter das Kindergeschrei gemischt. Mittler-
weile sind sogar ein, zwei offizielle Befehlsgeber an Ort und
Stelle - Zurücktreten! Alle ein Stück zurück!Dazu das zuneh-
mend panische Omeingott von Müttern, die mit ihren Kindern
einen Museumsbesuch machen wollen und offenbar erst jetzt
aus der U-Bahn steigen. Schuhe schrammen aneinander,
grunzend und keuchend wird um einen Platz auf enger wer-
dendem Raum gekämpft. Menschliches Vieh.
Auf dem Bahnsteig geselle ich mich zu ihnen, der Einzige,
der von oben kommt, während alle anderen hektisch in Rich-
tung der Ausgänge drängen.
Dann sehe ich, warum.
Der U-Bahn-Zug in südlicher Richtung ist zu zwei Dritteln
in den Bahnhof eingefahren. Die Türen sind offen, die Wag-
gons mittlerweile komplett leer. Männer in orangefarbenen
Leuchtwesten drängen durch die Menge, um die Tür der vor-
deren Fahrerkabine zu öffnen. Kurz darauf steigt der Fahrer
aus, fasst mit zitternden Händen sein Gesicht und bewegt die
Lippen, ohne dass ein Laut aus seiner Kehle dringt.
Ein Unfall, der sich gerade ereignet hat. Und wenn man die
Kinder gesehen hat, die sich von ihren Müttern losgerissen
und über die Bahnsteigkante gespäht haben, ist auch klar, was
für eine Art Unfall. Ein Selbstmörder. Und nicht nur das rate

ich richtig, noch bevor ich mich nach vorn dränge, um selbst
einen Blick zu riskieren. Ich weiß sogar, wer gesprungen ist.
Eine der geläufigsten Arten, menschliche Erfahrung zu
messen, ist zu zählen, wie häufig man etwas gesehen oder
getan hat: Mit wie vielen Personen hat man geschlafen, wie
viele Länder hat man besucht, wie viele Krankheiten erlitten
und überlebt? Oder eben, wie viele Tote hat man außer bei
Aufbahrungen und im Fernsehen gesehen? Bis zum heutigen
Tag war meine Bilanz lächerlich: bloß zwei. Tamara natür-
lich. Und meine Großmutter auf dem Boden ihrer Kochnische
im Altenheim, denselben Ausdruck von Verärgerung im Ge-
sicht, den sie immer schon gehabt hatte.
Aber das mache ich jetzt wett. Ich spähe über die Bahn-
steigkante und habe an der Todesfront aufgeholt.
Unvergesslich daran, Ivans Körper auf den Gleisen zu se-
hen, ist nicht die Tatsache, dass es jemand ist, den ich kenne,
auch nicht, dass Teile von ihm noch vorne am Zug kleben
oder dass sein Gesicht im Gegensatz zu seinem übrigen Leib
relativ unversehrt wirkt. Es ist vielmehr der Umstand, dass er
noch nicht ganz tot ist. Sein Unterkiefer bewegt sich auf und
ab.
Ivan sagt etwas, das ich verstehe. Nicht, dass ich ihn hören
könnte. Ich verstehe es, denn er weiß, dass ich über ihm stehe.
Und sein auf- und zuklappender Mund will mir sagen, dass er
gestoßen wurde.
Er erstarrt, bevor ein uniformierter Polizist mich von der
Bahnsteigkante wegzerrt. Zunächst glaube ich, er will mich
verhaften. In meinem Kopf höre ich so deutlich einen Wort-
wechsel, dass ich nur noch darauf warte, die ersten Worte aus
dem Mund des Beamten zu vernehmen:
- Kennen Sie diesen Mann?- Ja.- In welcher Beziehung
standen Sie zu ihm? - Wir wollten beide Schriftsteller
werden. Und wir wurden beide gejagt.- Gejagt? Steve!

Komm mal hier rüber!Gejagt von wem?- Er hat verschie-
dene Namen. Mein persönlicher Favorit ist: der schreckli-
che Mann, der schreckliche Dinge tut.
Aber der Polizist sagt nur: Bitte treten Sie zur Seite, Sir. Und
das tue ich. Ich stürze zur Treppe.
Ich reihe mich unter die Fahrgäste auf der Rolltreppe nach
oben ein, abwärts fahren nur weitere Polizisten und zwei Not-
ärzte, die so entspannt plaudern, dass sie vermutlich schon
erfahren haben, dass sich dieser Einsatz erledigt hat.
Bei den Drehkreuzen am Ausgang fragen Detectives, ob
irgendjemand gesehen hat, was geschehen ist, und eine oder
zwei Personen aus der erschütterten Menge bleiben stehen,
um eine Aussage zu machen. Ich gehe weiter die letzte Treppe
bis zur Straße hinauf, wo die brütende Hitze mir beinahe
willkommen ist, ein Weckruf des Unbehagens.
Ich gehe zum Uni-Campus und halte mich im Schatten der
Bäume entlang des Philosopher’s Walk. Ich verdränge be-
wusst jeden Gedanken außer dem, nach Hause zu kommen.
Bis dahin werde ich all meine Reserven brauchen, um einfach
nur weiterzumachen.
Und ich mache weiter: erst Bourbon, dann Wodka mit Tonic
und schließlich der Rotwein, der als Appetitanreger fürs
Abendessen gedacht ist, jedoch am Ende das Abendessen er-
setzt. Ich verbringe einen ganzen Nachmittag heftig trinkend
und zappend vor dem Fernseher, aber es gelingt mir nur teil-
weise, die aufblitzenden Bilder von Ivans letzten Sekunden zu
verdrängen.
Und ich mache mir so meine Gedanken: Wenn Ivan gesto-
ßen wurde und es William war, der mir auf der Rolltreppe
entgegenkam, muss William Ivan getötet haben. Wer sonst?
Andererseits war ich ebenfalls dort. Hatte Ivan vielleicht auch

William zu dem Treffen mit mir eingeladen? Durchaus mög-
lich. Trotz allem ist es wahrscheinlicher, dass die Person, von
der Ivan mir erzählen wollte, ihm zum U-Bahnhof Museum
gefolgt ist und wegen meiner Verspätung als Erster zur Stelle
war. Wenn es der Sandmann war, hat er mich wahrscheinlich
auf der Rolltreppe gesehen. Und das bedeutet, ich komme ihm
näher. Seiner Identität.
Eine wirklich unglückliche Wendung nimmt der Abend
jedoch, als ich beginne, die verschiedenen Single Malts zu
probieren, die ich für besondere Anlässe aufbewahrt habe.
Nun, heute war schließlich kein gewöhnlicher Tag, oder
nicht? Jedes Mal, wenn ich die Augen schließe, bei jedem
Blinzeln sehe ich Ivans Körper auf den Gleisen liegen und
stelle mir vor, wie es sich anfühlen wird, wenn ich an der
Reihe bin.
Was ich brauche, ist Gesellschaft. Und das führt zu meiner
zweiten unklugen Entscheidung: Ich rufe Angela an. Als ich
nur ihren Anrufbeantworter erreiche, rufe ich noch einmal an.
Und dann verbringe ich ein paar Stunden damit, hinter den
diversen Flaschen Scotch mit unaussprechlichen Namen auf
meinem Schreibtisch mit der freien Hand Angelas Kurzwahl
zu drücken und jedes Mal, wenn sie wieder nicht abnimmt,
neue Entschuldigungen für alles Mögliche vorzutragen.
Als Regentropfen an mein Kellerfenster klopfen, beschlie-
ße ich, zu ihrem Haus zu laufen. Über die Front Street und
vorbei am Kongresszentrum, wo etliche hundert Jugendliche
auf dem Bürgersteig zusammengekauert campieren, um am
nächsten Morgen Erster in der Schlange für die Auditions zu
Canadian MegaStar!zu sein. Sie hocken zitternd und haarlos
wie Chihuahua-Welpen im Regen, und ich rufe ihnen im
Vorbeigehen Aufmunterungen zu (»Geht wieder nach Hause!
Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren!«). Sie antworten
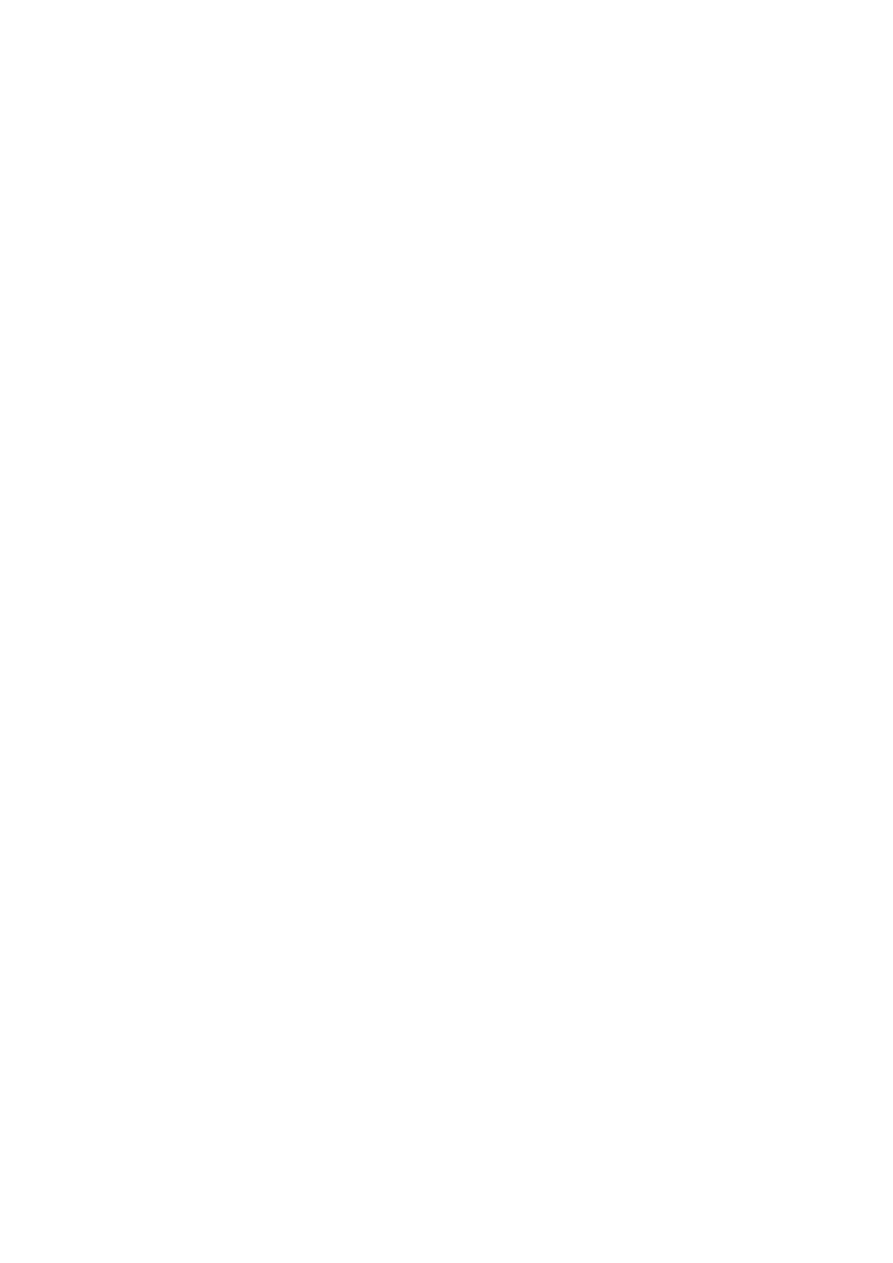
mit einem Stöhnen wie verwundete Soldaten, zurückgelassene
Opfer auf dem Schlachtfeld des Ruhmes.
Weiter vorbei an der Union Station, wo ich regengeschützt
durch den Tunnel unter den Gleisen stolpere. Als ich das an-
dere Ende erreiche, hat der Niederschlag sich jedoch in etwas
Heftigeres verwandelt; es ist, als würde der Inhalt des Onta-
riosees über der Stadt ausgekippt. Deshalb sehe ich gar nichts,
als ich möglicherweise auf dem Bürgersteig, vielleicht aber
auch mitten auf der Straße weitergehe. Ich weiß nur, dass ich,
als der Regenguss endlich eine Pause einlegt und ich die Au-
gen öffnen kann, vor mir als Erstes die Umrisse der Gar-
diner-Expressway-Überführung sehe. Und darunter die Ge-
stalt eines Mannes, der Schutz vor dem Regen sucht und mich
anstarrt.
Als ich auf ihn zulaufe, rührt er sich zunächst nicht, son-
dern beobachtet mich nur, als wäre er neugierig, was ich vor-
habe. Vielleicht will er auch, dass ich komme. Seine Haltung -
lässig, die Arme verschränkt - strahlt etwas aus, das mir bei
seinen bisherigen Erscheinungen nicht aufgefallen ist. Seine
zuvor nur dunkel bedrohliche Präsenz wirkt irgendwie milder.
Als ich in Rufweite bin, läuft er Richtung See davon. Seine
Schritte sind länger und sicherer als meine, aber von einer
trägen Müdigkeit, sodass ich ihn weiter im Blick behalte.
»Du warst es!«
Rufe ich. Schreie ich. Ein betrunkener Irrer unter all den
anderen betrunkenen Irren, die unter dem Expressway hausen
und mich vorbeilaufen sehen.
»Du warst es!«
Die Gestalt verlangsamt ihre Schritte. Sie rudert mit den
Armen, als wollte sie umkehren, mich angreifen, sprechen.
Aber dann entscheidet sie sich dagegen und läuft Tempo auf-
nehmend los. Die Stiefel knallen in einer Schrittfrequenz auf

das feuchte Pflaster, mit der ich selbst im Traum nicht mit-
halten könnte.
Als ich stehen bleibe und den Beleg für meine vorwiegend
sitzende Lebensweise auf meine Schuhe spucke, sehe ich, wie
er um die Ecke eines Apartmentturms am Hafen verschwin-
det. Oder zwischen einer Reihe geparkter Autos auf dem
Parkplatz gegenüber. Oder vielleicht auch in dem aufgewühl-
ten Wasser des Sees selbst.
Jedenfalls bin jetzt nur noch ich hier. Ich und der Regen.
Als ich wieder gleichzeitig atmen und aufrecht stehen kann,
gehe ich zu Angelas Adresse weiter, die nur ein paar Blocks
entfernt liegt. Ich halte ihre Klingel gedrückt, bis der Wach-
mann vor die Tür kommt und mich auffordert zu verschwin-
den. Als ich mich weigere, wendet er einen sauberen Raus-
schmeißergriff an, meiner Erfahrung nach der Klassiker: Er
packt mit einer Hand meinen Hemdkragen, mit der anderen
meinen Gürtel, tritt die Tür auf und wirft mich wie einen
überfüllten Müllsack auf den gepflegten Rasen vor dem Haus.
Es regnet immer noch. Die Tropfen spülen das Blut von
meinen Händen, als ich tastend überprüfe, ob meine Lippe
geplatzt ist.
Heute Nacht gibt es nichts mehr für mich zu tun. Jetzt ist es
an der Zeit nachzudenken. Herauszubekommen, was hinter
alldem steckt.
Das Problem ist nur, dass ich zum zweiten Mal an diesem
Tag vor einem Rätsel stehe. Schon auf die erste Frage weiß
ich keine Antwort: War es William, der vor mir weggelaufen
ist? Habe ich ihm den Geruch des Manns in der U-Bahn und
die Haltung der Gestalt unter dem Expressway zugeschrieben,
weil ich mich tatsächlich daran erinnert habe oder weil ich ihn
von Anfang an in Verdacht hatte? Würde ich ihn letztlich in
jedem Fremden erkennen, dem ich begegne?

Und als Nächstes eine zusätzlich verwirrende Überlegung:
Wenn es tatsächlich William war, den ich heute Nacht gese-
hen habe, war er auch die Person, die an meinem Wohnzim-
merfenster gestanden hat, der Mörder unbekannter Schrift-
steller, der geisterhafte Schurke aus Angelas Tagebuch? Viel-
leicht gehört zu jedem dieser Verbrechen ein anderes Unge-
heuer. Vielleicht ist der Sandmann nur einer der Namen, den
alle Agenten des Unheimlichen verwenden. Der Sandmann,
der Schwarze Mann, der Sukkubus, der Teufel.
Ich ermahne mich, mich auf bekannte Tatsachen zu be-
schränken. Aber was ist schon bekannt? Ivan ist tot. Petra
wird vermisst. Conrad White - und wenn man Angela glauben
kann, Evelyn - ebenfalls tot.
Und das, was uns verbindet, ist der Kreis. Oder vielleicht
auch etwas Grundsätzlicheres. Ein gemeinsames Spielfeld,
auf dem sich selbst in einer Millionenstadt wie dieser nur ein
paar wenige Mitspieler bewegen, die letzten wahren Ge-
schichtengläubigen. Diejenigen, die den Sandmann nicht nur
am Rand ihres Lebens haben stehen sehen, sondern ihn he-
reingebeten haben.
Wie nicht anders zu erwarten, geht es mir am nächsten Tag
sauschlecht. Ich habe einen schweren Kater und zeige acht der
neun primären Symptome eines toxischen Schocks auf. Als
ich am Nachmittag in die Notaufnahme gehe, erwische ich
einen Assistenzarzt, der piksend und stechend und mit viel O
Mist, tut mir leid meine Lippe näht. Doch was das Ganze
richtig schlimm macht, ist das vorherrschende Gefühl, dass
meine bisherigen Sorgen berechtigt waren. Vielleicht leide ich
unter Verfolgungswahn. Aber nichts spricht dagegen, dass
Paranoiker auch manchmal recht haben können.
Auf dem Rückweg vom Krankenhaus fahre ich noch ein-
mal bei Angela vorbei. Sie antwortet nach wie vor nicht, und

mit einem Mal kommt mir der Gedanke, dass derjenige, den
ich gestern Nacht gesehen habe, sei es nun William oder ein
anderer, vielleicht auch Angela besucht hat.
Ich rufe bei ihrer Arbeit an, wo mir die Empfangssekretärin
erklärt, dass sie die ganze Woche noch nicht da gewesen sei.
Len geht auch nicht ans Telefon. Das sind alle Spuren, die ich
habe. Sowie meine Überzeugung, dass Angela sich inzwi-
schen bestimmt bei mir zurückgemeldet hätte, wenn sie dazu
in der Lage wäre, und sei es nur, um mir zu sagen, dass ich
aufhören soll, sie mit meinen Trauerkloß-Botschaften zu be-
lästigen.
Sie versteckt sich. Sie ist jetzt bei ihm. Sie ist tot.
Was immer davon der Wahrheit entspricht, es ist jetzt an
mir allein, sie zu finden.
Als ich am späteren Nachmittag aus der Stadt fahre, blicke ich
immer wieder in den Rückspiegel, um zu sehen, ob ich ver-
folgt werde. Aber wenn man in dem selbstmörderischen Ge-
dränge über den Queen Elizabeth Way nach Westen fährt, wo
jeder Wagen vergeblich um ein paar Zentimeter Vorsprung
kämpft, ist es unmöglich, nicht verfolgt zu werden. Trotzdem
scheint ein Fahrzeug hartnäckiger an mir zu kleben als andere,
ein schwarzer Lincoln Continental, der nicht zulässt, dass ich
mich davonschleiche, wenn sich einmal eine Lücke in der
rechten Spur auftut. Das beweist zunächst nichts, außer dass
er die gleiche Idee hat wie ich, nämlich vorwärtszukommen.
Das schräg einfallende Sonnenlicht verhindert, dass ich einen
klaren Blick auf das Gesicht des Fahrers bekomme, doch das
Gleiche ließe sich von beinahe jedem hinter mir drängelnden
Wagen behaupten.
Doch als fünfundvierzig Minuten später die erste Ausfahrt
für St. Catharines in Sicht kommt, ist der Continental immer
noch hinter mir. Ich warte bis zur letzten Sekunde, bevor ich

auf die Spur der Ausfahrt schwenke. Zunächst hat es den An-
schein, als wollte die schwarze Limousine mir folgen, denn
sie schert schleudernd von der linken auf die mittlere Spur.
Aber am Ende der Ausfahrt sehe ich, wie der Continental auf
dem Highway kleiner wird. Wenn er mich wirklich verfolgt
hat, weiß der Fahrer jetzt schlimmstenfalls, wo ich abgefahren
bin, aber nicht, wohin die Fahrt geht.
Und die Fahrt geht zu Sam.
Er sieht gut aus. Braun gebrannt, die Knie vom Toben auf-
geschürft. Irgendwie ist er in den letzten Wochen ein Jahr
älter geworden.
»Fahre ich mit dir zurück?«, fragt er, als wir im Wohn-
zimmer alleine sind und den Disney-Film auf dem Großbild-
fernseher angehalten haben.
»Ich fürchte nicht.«
»Wann dann?«
»In einer Woche. Vielleicht zwei.«
»In einer Woche?«
»Ich dachte, du hättest hier Spaß.«
»Es ist okay. Es ist bloß - ich vermisse dich.«
»Jede Wette, dass ich dich mehr vermisse.«
»Und warum kann ich dann nicht mit nach Hause kom-
men?«
»Weil dort etwas vor sich geht, was erst geregelt werden
muss. Und ich möchte, dass du sicher bist.«
»Bist du sicher?«
»Du musst mir vertrauen. Kannst du das noch ein kleines
bisschen länger?«
Sam nickt. Und man muss ihn sich nur ansehen: Er ver-
traut mir. Obwohl mich das nicht überraschen sollte - ich bin
schließlich sein Vater -, trifft mich das Gewicht dieser Ver-
antwortung. Es ist ein Geschenk, wenn sich einem ein anderer
so anvertraut, ein Geschenk, das jederzeit - und ganz einfach -

wieder zurückgenommen werden kann. Das lese ich deutlich
in dem mit Sommersprossen gesprenkelten Gesicht meines
Sohnes: Wenn das Vertrauen einmal weg ist, bekommt man
es nie wieder. Man glaubt es vielleicht. Aber es geht nicht.
Als ich Sam später ins Bett bringe, frage ich ihn, ob ich
ihm aus einem der Bücher vorlesen soll, die ich ihm mitge-
bracht habe. Er schüttelt den Kopf.
»Soll ich dir was anderes besorgen? Nächstes Mal gehen
wir in den Buchladen und toben uns richtig aus.«
»Nein.«
»Was ist das Problem? Bist du zu alt, um noch vorgelesen
zu bekommen?«
»Ich lese überhaupt keine Bücher mehr.«
Es gibt tausend Dinge, die ein Kind seinen Eltern erklären
kann, die schmerzhafter sind. Aber in diesem schlichten Satz,
geäußert in der Dunkelheit eines kargen Raumes, der nach
anderen Kindern riecht, liegt großer Ernst, ja Grausamkeit.
»Warum nicht?«
»Ich mag sie nicht.«
»Du magst keine Geschichten?«
»Ihretwegen hast du mich hierhergebracht. Stimmt’s?«
Ich bestreite es. Ich erkläre ihm, dass Geschichten infor-
mieren, Menschen beeinflussen und provozieren, aber nie-
mandem wirklich wehtun können. Aber als ich ihm einen Gu-
tenachtkuss gebe und die Tür einen Spalt aufstehen lasse,
wissen wir beide, dass er recht hat. Das Unwirkliche ist von
der Seite gesprungen, um unser Leben zu überschatten. Und
bis man es bewegen kann, dorthin zurückzukehren, wo es
hingehört, muss Sam hierbleiben, im Schein des Nachtlichts
wach liegen und seinen Schlaf frei von allen Träumen halten
bis auf den, in dem sein Vater wiederkommt, um ihn mit nach
Hause zu nehmen.
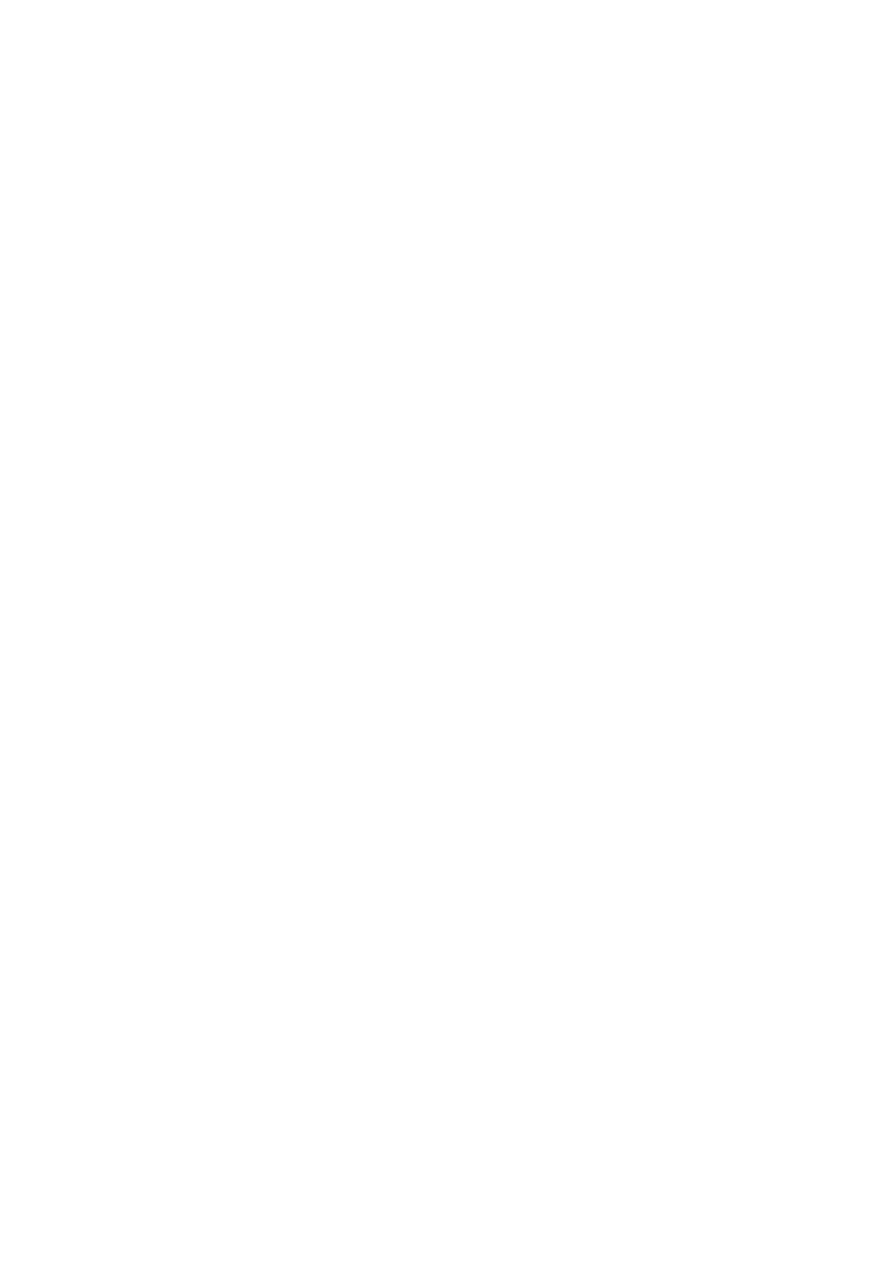
Nach Einbruch der Dunkelheit fahre ich zurück nach Toronto.
Wo sich der Highway an das südliche Ufer des Sees schmiegt,
kann man durch die Lücken zwischen den alten Motels und
eingezäunten Obstgärten über dem Wasser die Skyline der
Stadt sehen. Früher fand ich sie glamourös, sah in den Säulen
aus Licht eine erotische Einladung. Es war die Andeutung von
endlosen Möglichkeiten, von Gefahren, die mir gefiel, und ich
war stolz darauf, damit verbunden zu sein, und sei es nur
durch die gemeinsame Adresse.
Heute Abend hat der Anblick der Türme in der Ferne eine
andere Wirkung. Sie sehen aus wie eine Armee von Außerir-
dischen, im Mondschein glänzende Ungeheuer aus einem
dunklen Meer, deren Lichter allein von Begehren gespeist
werden. Unerwidert und unstillbar. Ein schreckliches Verlan-
gen, das sich von allem nährt, was sich dareinfügt, besessen
zu werden.
Ich lasse die Weingegend südlich von Toronto hinter mir,
fahre durch kleine Schlafstädte, dann durch die ineinander
übergehenden Vorstädte am Nordufer vor der letzten Kurve
ins Licht. Ab hier wird man von der Stadt verschlungen: Es
gab eine Zeit, in der ich sie schön fand und in ihr das betö-
rende Versprechen des Erfolgs gesehen habe. Und das tue ich
immer noch. Aber jetzt weiß ich, dass jedes Versprechen auch
eine Lüge sein kann, je nachdem, ob es gehalten wird oder
nicht.

25
Tim Earheart ruft wieder an, um sich auf einen Drink zu ver-
abreden.
»Gott, tut mir leid«, erkläre ich ihm, als mir die unerwi-
derten E-Mails und Nachrichten auf meinem Anrufbeantwor-
ter wieder einfallen, die er hinterlassen hat. »In letzter Zeit
ging alles ein bisschen drunter und drüber. Vielleicht morgen
-«
»Das ist nicht direkt ein privater Anruf, Patrick.«
»Was denn? Geschäftlich?«
»Ja. Es ist geschäftlich.«
Wir treffen uns in der Bar eines der Bankentürme, die Tim
bevorzugt frequentiert, seit er mit seiner Ernennung zum
»Special Investigative Reporter« eine Gehaltserhöhung be-
kommen hat (»Was warst du denn vorher?« »Weiß nicht.
Aber auf jeden Fall nicht special.«). Ganz zu schweigen von
der Entlastung seines Einkommens, seit seine zweite Frau
»einen Idioten gefunden hat, der den ganzen Plunder bezahlt,
an den sie sich gewöhnt hat«. Dieses Lokal stehe für den
neuen Tim Earheart, erklärt er mir. Er mag das Leder, die
Halogen-Spots, das Flair von Karriere und Aufstieg, das
Zwanzig-Dollar-Martinis haben.
»Bloß hier zu sein weist dich schon als erfolgreich aus«,
erklärt Tim mir, rollt verführerisch einen Geldschein zusam-
men und steckt ihn in das Trinkgeldglas des Garderobenmäd-
chens.
»Erfolgreich worin?«

»Das ist ja das Schöne. Es spielt keine Rolle. Die Details
kann man später klären.«
Bei der ersten Runde erzählt Tim mir ein paar Geschichten
von Frauen, die er hier aufgegabelt hat. Klassischer Earheart,
der mich ihn vermissen lässt. Unsere Kameradschaft. Was ist
bloß daraus geworden?
Als wollte er der Illusion von zwei Freunden, die sorgen-
frei einen Cocktail genießen, ein Ende bereiten, räuspert sich
Tim bei der Ankunft der zweiten Runde Martinis, zieht einen
Zettel aus der Tasche und schiebt ihn mir auf dem Tresen zu.
»Was ist das?«
»Lies es.«
»Hast du das geschrieben?«
»Lies es einfach.«
Es ist Sünde, sagt die Kirche, meine Taten böser Wahn.
Doch mein Werk ist erst vollendet, wenn ich’s dir hab an-
getan.
In der Hölle werd’ ich schmoren, von den Flammen aufge-
zehrt.
Doch bis dahin sollt ihr wissen: Der Sandmann ist zurück-
gekehrt.
»Woher hast du das?«
»Es wurde an die Zeitung geschickt. An mich, um genau zu
sein.«
»Du glaubst, dass er es ist?«
»Der Stil passt jedenfalls.«
»Vom Namen ganz zu schweigen.«
Tim beobachtet mich, um zu sehen, wie die düstere Ent-
hüllung wirkt. Oder um zu ermessen, wie viele Jahre ich ge-
altert bin, seit er mich zum letzten Mal gesehen hat. Ich weiß,
ich sehe nicht gut aus. Aber wenn ein sauber rasierter, Fit-
ness-Studio-trainierter Freund einen betrachtet wie ein Be-

statter eine Leiche, macht einen das doch unwillkürlich ner-
vös.
»Wirst du es drucken?«, frage ich.
»Ich würde schon gerne.«
»Aber sie lassen dich nicht.«
»Diesmal liegt die Entscheidung bei mir.«
»Und?«
»Und? Es gibt keine Story.«
»›Die Rückkehr des Sandmanns‹. Für mich hört sich das an
wie eine Schlagzeile.«
»Aber er bekennt sich nicht zu bestimmten Morden. Es
scheint mir ziemlich sinnlos, die Öffentlichkeit nur auf der
Grundlage eines miesen Limericks in Angst und Schrecken zu
versetzen.«
»Es ist kein Limerick.«
»Du bist der Fachmann.«
Es gibt natürlich Opfer. Conrad und Evelyn. Ivan, ein
scheinbarer Selbstmord unter »verdächtigen Umständen«, wie
Polizeireporter und Krimiautoren das nennen. Ganz zu
schweigen von Petra - und jetzt auch noch Angela -, die ver-
misst werden. Aber das Einzige, was alle miteinander verbin-
det, ist der Kensington-Kreis, und wenn Tim Earheart den
bisher noch nicht entdeckt hat, werde ich es ihm bestimmt
nicht auf die Nase binden.
»Es gibt allerdings einen Kontext, in dem ich das Gedicht
drucken würde«, sinniert Tim laut. »Dafür bräuchte ich natür-
lich eine Reaktion.«
»Eine Reaktion?«
»Von dir. Einen Kommentar, wie sich der internationale
Bestseller-Autor bei dem Gedanken fühlt, durch seinen Ro-
man psychopathische Nachahmer inspiriert zu haben. Das
könnte ich bringen.«
»Willst du mich verarschen?«

»Ich dachte bloß, es wäre vielleicht ganz witzig.«
»Dass ich die Verantwortung für eine neue Generation von
Serienmördern übernehme? Ja, das ist unbedingt amüsant.
Das wäre ein echter Brüller.«
Ich schätze, das war’s in etwa. Tim ist wegen einer Story
gekommen, die er nicht gekriegt hat, und nun muss der Na-
tional Star nur noch die Rechnung begleichen. Wir beenden
das Ganze mit Geplauder über die neuesten Redaktionsskan-
dale und -gerüchte. Wir schlagen nur Zeit tot, aber in mir
weckt es eine Sehnsucht nach den Tagen gehässigen Journa-
listenklatsches, an denen ich es gewesen wäre, der Tim erzählt
hat, dass der Chef der Bildreaktion an Wochenenden gern
Frauenkleider trägt.
Aber wie sich herausstellt, sind wir noch nicht ganz fertig
mit der Angelegenheit, deretwegen Tim mich hierhergebeten
hat.
»Ganz inoffiziell«, sagt er und verlangt mit einem erhobe-
nen Finger die Rechnung, »was hältst du von der ganzen
Sandmann-Geschichte? Ich meine, irgendjemand benutzt den
Namen des Schurken aus deinem Roman.«
»Ich fühle mich für gar nichts verantwortlich, wenn du da-
rauf hinauswillst.«
»Nein, das meine ich gar nicht.«
»Was meinst du denn?«
»Was weißt du?«
»Nur das, was ich in den Zeitungen lese.«
»Hat er Kontakt mit dir aufgenommen?«
»Nein.«
»Ich wette, du hast eine Theorie.«
»Weißt du was, Tim?«, setze ich an, rutsche von meinem
Barhocker und stelle überrascht fest, wie unsicher ich auf den
Beinen bin. »Die Sache ist die: Ich habe ein Buch geschrie-
ben. Und ich bedauere es. Wirklich.«

Tim streckt eine Hand aus, um mich zu stützen, aber ich
mache einen Schritt zurück. Ich sollte jetzt gehen. Doch als
ich sehe, wie Tim Earheart, vormals als Journalist meines-
gleichen, mich mitleidig ansieht, lege ich noch ein paar wei-
tere Worte nach.
»Ich versuche bloß zu überleben. Verstehst du? Wenn du
also noch mal drittklassige Lyrik von irgendwelchen Spinnern
oder Psychopathen erhältst, komm nicht zu mir.«
»Herrgott, Patrick. Es tut mir leid.«
»Es tut dir leid? Nein, das ist meine Abteilung. Leidtun ist
mein Ding.«
Meine Arme gleiten in die Ärmel meiner Jacke. Wie aus
dem Nichts ist, Gott segne sie, das Garderobenmädchen auf-
getaucht, um mich für die Kühle des Abends anzukleiden. Sie
bedenkt mich mit einem mitleidigen Blick und streicht mei-
nen Kragen im Nacken glatt, ein Moment, der beweist, dass es
noch Trost gibt auf dieser Welt, obwohl man manchmal nicht
weiß, woher er kommen soll. Ich könnte sie küssen. Vielleicht
hat Tim Earheart das schon getan.
Ich nehme ein Taxi nach Hause, lasse mich von dem Fahrer
jedoch ein paar Blocks vorher absetzen, um das letzte Stück
zu Fuß zu gehen. Als ich beschwipst nach Hause stolpere,
kreisen meine Gedanken um eine Idee: Vielleicht sind die
Schreihälse, Amokschützen und Mondsüchtigen auf den
Straßen der City bloß Visionen dessen, was uns allen bevor-
steht. Eine Stadt in Angst. Ja. Und wir hatten recht, uns immer
mehr zu fürchten - wir haben uns bloß vor dem Falschen ge-
fürchtet. Es wird nicht irgendeine verheerende böse Kraft
sein, die uns zu Fall bringen wird, der Abbau der Ozon-
schicht, der Einschlag eines Kometen oder die Schmutzige
Bombe, sondern der fortschreitende Wahnsinn. Warum? Weil
die Welt immer mehr zum Verrücktwerden ist. Irgendwann

werden die Tore der Irrenanstalten aufgebrochen. Und wir
werden es sein, die hinaustreten.
Oder vielleicht auch nur ich. Denn ein weiteres Mal bin ich
der Ansicht, verfolgt zu werden. Irgendwo zwischen dem
einen und dem anderen Sexshop höre ich die schweren
Schritte eines hinter mir Gehenden.
Vorbei an dem Prager Deli (»Czech Us Out!«) und dem
Secondhand-Plattenladen bleibt er mir im Nacken, ohne den
Rhythmus seiner Schritte zu verändern. Ich sollte losrennen.
Ein unvermittelt angezogener Sprint, der mir vielleicht die
paar Meter Vorsprung verschafft, die ich brauche, um eine
Chance zu haben. Aber ich bin plötzlich viel zu müde.
Ich biege in den dunklen Abschnitt der Euclid Street ein,
gehe geradewegs zu dem Fleck mit den bloß liegenden
Baumwurzeln, der mein Vorgarten ist. Als ich mich schließ-
lich umdrehe, tue ich es mit der Resignation einer Beute, der
keine Zuflucht mehr bleibt.
»Ich hab Neuigkeiten«, sagt Ramsey mit einem angedeute-
ten Grinsen.
»Und Sie hätten nicht anrufen können?«
»Die Leute sagen, wenn jemand direkt vor mir steht, wäre
ich besser.«
»Besser worin?«
Er macht einen Schritt nach vorn, bleibt jedoch im Schat-
ten der Laterne, sodass ich nur seine blitzenden Zähne sehe.
»Len Innes wurde als vermisst gemeldet.«
»Vermisst? Wie?«
»Das ist ja die Sache bei Vermissten. Man weißes nicht.«
»Mein Gott.«
»Wann haben Sie zuletzt mit ihm gesprochen?«
»Ich weiß nicht. Ist eine Weile her.«
»Und was war Gegenstand Ihrer Unterhaltung?«
»Nicht viel.«

»Also bloß ein Plausch unter Freunden?«
»Glauben Sie, ich hätte Len ermordet?«
»Bisher wird er lediglich vermisst.«
»Ich weiß gar nichts.«
»Sicher doch.«
»Macht Ihnen das Spaß? Diese alberne Colum-
bo-Katz-und-Maus-Scheiße?«
»Da meldet sich wohl der Kritiker in Ihnen.«
»Ich bin aus der Branche ausgestiegen.«
»Müßiggang.«
»Müßiggang wäre nett. Aber Sie kommen ja ständig vorbei
und beschuldigen mich, irgendwelche Leute ermordet zu ha-
ben. So was kann Pläne für einen friedlichen Ruhestand schon
ziemlich stören.«
»Wissen Sie was: Ihre Pläne für einen friedlichen Ruhe-
stand sind mir scheißegal.«
»Aber ich glaube auch nicht, dass Sie mich für einen Mör-
der halten.«
»Da könnten Sie sich irren.«
»Dann verhaften Sie mich. Tun Sie irgendwas. Oder ver-
schwinden Sie von meinem Grundstück.«
Irgendetwas in Detective Ramseys Gesicht verändert sich.
Nicht in seinem Ausdruck - der bleibt verbissen amüsiert -,
sondern in seinem Gesicht selbst. Die straff über die Knochen
gespannte Haut lässt etwas Animalisches dahinter erkennen.
Hier ist ein Geschöpf, frei von den Fesseln der Loyalität und
des Mitgefühls, frei von der Idee, die Menschheit als eine
Unternehmung zu sehen, die langfristig eine Chance hat. All
das macht ihn wahrscheinlich zu einem mehr als kompetenten
Ermittler der finstersten menschlichen Vergehen. Aber viel-
leicht befähigt es ihn auch, diese Taten selbst zu begehen.
»Wie geht’s Sam?«
»Verzeihung?«

»Ihrem Sohn. Wie geht es ihm?«
»Gut.«
»Sein Daddy ist ziemlich spät unterwegs und lässt den
kleinen Burschen allein.«
»Sie wissen, dass er nicht im Haus ist.«
»Weiß ich das?«
»Sam ist sicher.«
»Tatsächlich? Denn überall, wo Sie hingehen, wird es zu-
nehmend weniger sicher.«
Ich wende mich ab und warte darauf, dass er eine letzte
Bemerkung ablässt, aber während ich die Tür aufschließe, das
Haus betrete und die Tür hinter mir zumache, höre ich von
ihm kein weiteres Wort.
Was nicht bedeutet, dass er weg wäre.
Ohne das Licht anzumachen, spähe ich aus dem Fenster.
Ramsey steht unter dem dunklen Bogen des Ahornbaums im
Vorgarten. Unbeweglich wie eine Statue und doch unbe-
streitbar lebendig, die Luft um ihn strömt in und aus seiner
Lunge, als würde er sie nicht nur einatmen, sondern bean-
spruchen. Er gehört zum Reich der Nacht, der weiter werden-
den Kluft zwischen dem, was bekanntermaßen existiert, und
dem, was es nicht geben kann.
Ivan gehört auch zum Reich der Nacht, aber am nächsten
Abend sehe ich ihn in der Fressmeile des Eaton Center auf
dem Weg zur U-Bahn-Station Dundas Street. All das ist selt-
sam, weil ich Einkaufszentren hasse und ihre Fressmeilen
noch mehr. Ich denke sogar noch, sonderbar, dass ich hier
bin, als Ivan an meinem Tisch vorbeischlendert. Noch son-
derbarer ist, dass er tot ist.
Als ich Conrad White in dem Buchladen durch Der Sand-
mann blättern sah, obwohl auch er schon nicht mehr unter uns
weilte, lief es mir kalt den Rücken herunter. Aber als ich jetzt

Ivan durch die Menge der Touristen und Einheimischen lau-
fen sehe, die wie ich nichts Besseres zu tun haben, werde ich
augenblicklich von einer lähmenden Panik erfasst. Denn er ist
aus einem Grund hier, der mir nicht gefallen wird. Das sagt
Ivan mir mit der verblüffenden, unphantomhaften Realität
seiner Erscheinung, der Art, wie er sich umdreht und mich aus
seinen leeren Augenhöhlen ansieht. Er ist hier, um mir etwas
zu zeigen.
Und ich folge ihm. Ich drängle mich in der Schlange vor
dem Fahrkartenschalter der U-Bahn vor und schiebe mich,
begleitet von verständlichen Arschloch-Rufen in meinem Rü-
cken, durch das Drehkreuz. Ivan mag tot sein, aber er bewegt
sich schneller, als ich ihn lebend je habe laufen sehen. Er
gleitet an den anderen Passagieren vorbei und hüpft auf die
Rolltreppe, sodass ich zwei Stufen auf einmal nehmen muss,
um mit ihm mitzuhalten.
Auf dem Bahnsteig glaube ich schon, ihn verloren zu ha-
ben. Das heißt, ich bin plötzlich sicher, dass er gar nicht da
war. Du hast nicht geschlafen, versuche ich, mir einzureden.
Du stehst unter Stress, du siehst Gespenster.
Ivan löst sich aus der Menge am anderen Ende des Bahn-
steigs, als der Zug donnernd einfährt. Ich dränge in seine
Richtung, obwohl ich sicher bin, dass er die letzten Sekunden
seines Lebens noch einmal nachspielen und auf die Gleise
springen wird, bevor der Fahrer die Bremse betätigen kann.
Aber er springt nicht. Er schaut in meine Richtung. Sein
Blick findet über Köpfe, Baseballkappen und Turbane hinweg
den meinen, in seinem Gesicht ein Ausdruck, wie er ihn bei
allen Treffen des Kreises getragen hat, aber irgendwie inten-
siver. Und ich erkenne, was ihn im Innern bewegt und viel-
leicht schon die ganze Zeit bewegt hat. Sehnsucht. Nach je-
mandem, mit dem er reden kann. Nach Vergebung.

Die Türen der Waggons gehen auf. Alle bis auf Ivan treten
zur Seite, um die Fahrgäste aussteigen zu lassen, und sie ge-
hen um ihn herum, sodass er der Erste ist, der in den Zug ein-
steigt. Die Menge folgt ihm, drängt sich Schulter an Schulter
durch die Türen. Als ich endlich von Ivans Blick befreit bin,
stehe ich als Einziger auf dem Bahnsteig, während die Türen
des Zuges sich schließen. Ich will mich im letzten Moment in
einen Waggon drängen - ein Klopfen an die Scheibe, das die
Passagiere mit einem höhnischen Grinsen quittieren -, aber es
ist zu spät.
Ich trete einen Schritt zurück und versuche, Ivan im Zug zu
entdecken. Und da sitzt er am Fenster und starrt mich mit
einem Blick wütender Eifersucht an. Petra sitzt hinter ihm,
Evelyn ein paar Reihen weiter zurück. All die Toten des Ken-
sington-Kreises drücken ihre Nase an die Scheibe, böswillige
Ovale inmitten gleichgültiger Passagiere.
Als der Zug die Bremsen löst und Fahrt aufnimmt, werden
ihre Gesichter flach und verschwimmen. Der Waggon, in dem
sie sitzen, wird vom Schlund des Tunnels verschluckt. Die
Gesichter des Kensington-Kreises zusammen mit denen der
lebendigen Pendler, Glückssucher und wütenden Kämpfer.
Wenn ich nicht wüsste, wer wer ist, würde ich womöglich
sagen, dass sie alle tot sind.

26
Als ich am Morgen aufwache, hockt William an meinem Bett.
Er sitzt gebeugt und den Kopf zur Seite gelegt da wie ein
besorgter Freund, der Wache hält. Sogar seine Miene - nach
wie vor halb verborgen hinter einem dichten Vollbart wie eine
Ofenbürste - könnte man als mitfühlend missdeuten, Augen,
die mit stiller Intensität auf mich herabblicken. Aber das ist
nur ein erster Eindruck. Und der ist falsch.
William hebt die Hände, und Erde rieselt klumpenweise
auf die Bettdecke. Von seinen rissigen Fingernägeln tropft
eine Flüssigkeit. Seine Hände greifen nach mir.
Ich versuche, mich aufzurichten, doch ein Gewicht auf
meinen Beinen lähmt mich. Ich kann nur zusehen.
Seine Hände werden mich umbringen. Sie werden die
schrecklichsten Dinge tun, nicht er. Jedenfalls scheinen mir
das seine aufgeplatzten Lippen sagen zu wollen. Er ist ein
Werkzeug des Todes, aber selbst auch tot.
Ich notiere dies - den ersten Schreck des Tages - in meinem
Tagebuch, das mittlerweile nachts neben meinem Bett liegt.
Eine Chronik tatsächlicher Ereignisse und Traumtagebuch in
einem. Wahrscheinlich hätte ich zwei verschiedene Notizbü-
cher verwenden sollen, aber mittlerweile haben sich so viele
Korridore zwischen meiner Wach- und meiner Traumwelt
aufgetan, dass es im Grunde egal ist.
Zum Beispiel die Baseballmütze.

Ich bin mit meiner morgendlichen Routine von Kaffeeko-
chen und Müslimachen beschäftigt, als sie mir zum ersten
Mal auffällt. Und auch dann dauert es noch einen Moment,
bis ich begreife, was ich sehe. Eine Yankees-Mütze. Auf dem
Couchtisch im Wohnzimmer.
Ich rieche daran; in den Fasern klebt noch der Duft von
Petras Shampoo. Die Glasschiebetür ist geschlossen, aber
unabgeschlossen. Und die Vorhänge, die ich meiner Erinne-
rung nach am Abend zuvor definitiv zugezogen habe, sind
offen.
Ich kann dich sehen.
Nachdem ich die Vorhänge zugezogen, die Terrassentür
abgeschlossen und sämtliche Türen und Fenster in Keller und
Erdgeschoss kontrolliert habe, widme ich mich wieder Petras
Kappe und betrachte sie, als ob ein Hinweis aufgestickt wäre.
Petra, von der man annimmt, dass sie tot ist, hat sie getra-
gen. Dann wurde sie bei Angela hinterlegt, die jetzt ver-
schwunden ist. Und nun liegt sie bei mir.
Du könntest es gewesen sein.
Ramsey glaubt schon jetzt (mit gewisser Berechtigung),
dass ich etwas mit Petras Tod und vielleicht auch den Morden
von vor einigen Jahren zu tun habe. Wenn er die Baseball-
mütze in meinem Besitz fände, wäre das ein mehr als hinrei-
chender Grund, mich zu verhaften. Das erste konkrete Indiz,
das mich mit einem der Morde in Verbindung bringt. Der
Sandmann will, dass ich es in Händen halte und weiß, wie es
sich anfühlt. Dass ich weiß, was man mir antun kann, ohne
mich zu berühren.
Es ist Sünde, sagt die Kirche, meine Taten böser Wahn.
Doch mein Werk ist erst vollendet, wenn ich’s dir hab an-
getan.

Die Yankees-Kappe ist eine Verheißung dessen, was noch
kommt, eine Demonstration der Macht, eine Signatur. Aber es
ist auch ein Spiel.
Hab dich. Bin ganz nah.
Meine nächste Erinnerung ist, dass man mich auffordert, die
Räume des National Star zu verlassen. Die Lobby, um genau
zu sein. Weiter komme ich nicht, bevor ich bei meinem Ver-
such, mich an der Rezeption vorbeizuschleichen, aufgehalten
werde. Ich werde nach meinem Anliegen gefragt - ein Über-
raschungsbesuch bei meinem alten Freund Tim Earheart -,
und der Typ hinter der Sicherheitsschleuse gibt meinen Na-
men in den Computer ein, worauf eine Warnung aufleuchtet.
Oder, seinen geröteten Wangen, dem Telefonhörer am Ohr
und den Fingern auf der Notruftaste nach zu urteilen, gleich
mehrere Warnungen.
»Sagen Sie Tim Earheart einfach, dass ich unten warte«,
erkläre ich dem Wachmann, dessen gequältes Gesicht andeu-
tet, dass ich zwar nicht in der Position bin, irgendwelche For-
derungen zu stellen, er jedoch ernsthaften Ärger bekommen
würde, sollte er gezwungen sein, seinen Schlagstock gegen
mich einzusetzen.
»Tun Sie, was er sagt«, fordert ihn eine Frauenstimme hin-
ter mir auf. Ich drehe mich um und sehe die Chefredakteurin,
die mich mit einem tödlichen Lächeln bedenkt. Sie ist nicht
mehr Chefredakteurin, sondern mittlerweile die jüngste He-
rausgeberin in der Geschichte der Zeitung. »Er soll kurz Hallo
sagen und dann seiner Wege ziehen.«
Sie lächelt weiter. Wenn es echt wäre, wäre ich schon halb
verliebt in sie. Aber man kann ihre Miene unmöglich mit
einem Ausdruck von Warmherzigkeit verwechseln. Schon so
weiche ich mit jedem Schritt zurück, den sie näher kommt.

»Immer nett, einen ehemaligen Angestellten durch die Tür
hinausgehen zu sehen«, sagt sie.
Als ich durch die Drehtür in die Hitze trudle, sehe ich Tim
Earheart mit einem Wird nicht wieder vorkommen auf den
Lippen an der Chefredakteurin vorbeihasten.
»Zweimal kann man nicht gefeuert werden, weißt du. Oder
willst du, dass ich auch noch gefeuert werde?«, sagt Tim, fasst
meinen Arm und zerrt mich von dem Gebäude weg. Durch die
Glastür erkenne ich, dass die Chefredakteurin nach wie vor in
der Lobby steht, die Hände auf ihren schlanken, durchtrai-
nierten Hüften.
Ich folge Tim über die Front Street zu einem schmalen
Grasstreifen zwischen dem Bürgersteig und dem Zaun, der
Fußgänger davon abhält, auf die Gleise des tiefer liegenden
Bahnhofs Union Station zu gelangen.
»Ich arbeite«, sagt Tim. »Nicht jeder von uns ist Schrift-
steller.«
»Dann mache ich es kurz.«
»Je kürzer, desto besser.«
»Kannst du auf Behördendateien zugreifen?«
»Kommt drauf an, auf welche.«
»Jugendamt. Pflegeunterbringung. Wer immer für Vor-
mundschaften zuständig ist.«
Er steckt eine Zigarette in den Mund, macht jedoch keine
Anstalten, sie anzuzünden. »Wer fragt?«
»Ich suche jemanden.«
»Jemanden, den ich kenne?«
»Ich kenne sie. Nicht gut, aber ich kenne sie.«
»Ein Kind?«
»Inzwischen ist sie erwachsen.«
»Warum rufst du sie dann nicht an?«
»Ich weiß nicht, wo sie ist.«

Tim Earheart mustert mich zum ersten Mal eingehender,
und ich spüre, dass das, was ich als Nächstes sage, über den
weiteren Verlauf dieses Gespräches entscheiden wird. Ich
möchte Tim hineinziehen, ohne ihn zu verwickeln.
»Willst du die jetzt anstecken oder nicht?«
Tim nimmt die unangezündete Zigarette aus dem Mund
und wirft sie über den Zaun. »Wie heißt sie?«
»Angela Whitmore. Aber das ist vielleicht nur der Name
ihrer Adoptiveltern. Wahrscheinlich nicht. Ich meine, es ist
der Name, unter dem ich sie kenne, aber der ist möglicher-
weise falsch.«
»Einen Adoptionsfall zu verfolgen, ohne den Namen des
Kindes zu kennen - das läuft nicht.«
»Ich glaube, es war keine freiwillige Adoption.«
»Inwiefern?«
»Sie wurde ihren leiblichen Eltern weggenommen. Inter-
vention der Jugendfürsorge. Ich kenne die Einzelheiten nicht.
Es war eine dieser Situationen, in denen der Staat handeln
musste.«
»Das ist zumindest etwas.«
Ich berichte ihm alle anderen möglicherweise hilfreichen
Details, die ich kenne, was nicht viele sind. Angelas ungefäh-
res Alter (Ende zwanzig, Anfang dreißig), ihre berufliche
Ausbildung (Rechtspflegerin), ihr möglicher akademischer
Hintergrund (wahrscheinlich Literatur, Sprache, Kreatives
Schreiben). Am Ende lasse ich mehr weg, als ich ihm erzähle:
Ihr fiktives Tagebuch und meinen Diebstahl seines wesentli-
chen Inhalts, unsere gemeinsame Nacht und die Entdeckung
der fehlenden Zehen. Vielleicht später, sage ich mir. Viel-
leicht werde ich ihn, wenn alles gut geht, in die ganze Ge-
schichte einweihen.
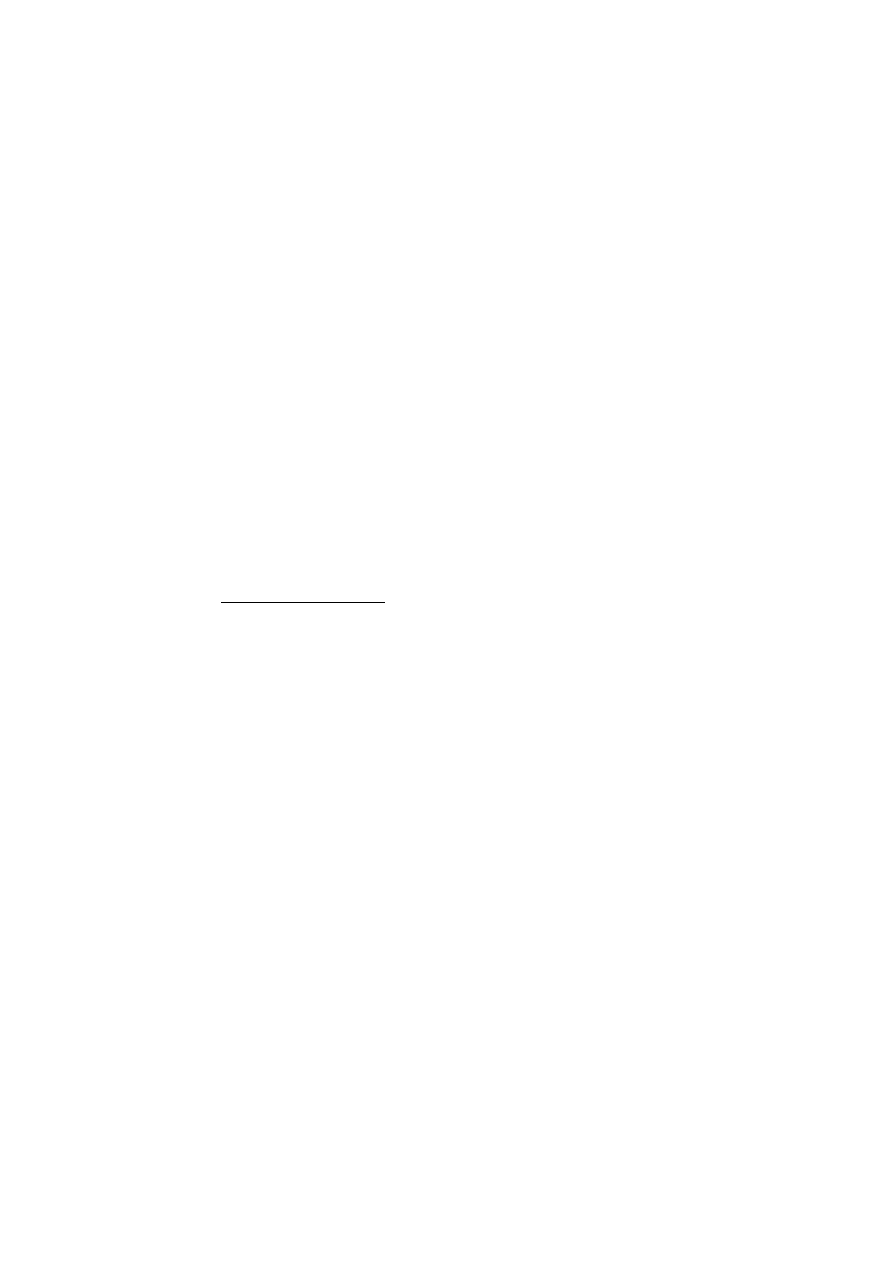
»Eine Frage«, sagt Tim, als ich ihm dankbar die Hand
drücke und nach einem Taxi auf der Front Street Ausschau
halte.
»Du willst wissen, warum ich das herausfinden will.«
»Nein. Ich will wissen, was für mich dabei drin ist.«
»Nichts. Außer einer Story.«
»Eine Zeitungs-Story oder eine
Mir-ist-neulich-was-Komisches-passiert-Story?«
»Nur eine Frauen-Probleme-Story«, erkläre ich ihm mit
einem verlegenen Kopfschütteln. Eine Geste, die Tim Earhe-
art verstehen wird, ohne dass ich ins Details gehen muss.
Unter uns bringt ein Zug einen neuen Schwung Pendler,
Shopper und Ticketbesitzer für das Baseballspiel in die Stadt.
Tim und ich blicken hinab, um die einzelnen Gesichter hinter
den Fenstern auszumachen, aber sie sind ein bisschen zu weit
weg und bewegen sich ein wenig zu schnell, um mehr zu er-
kennen als eine lange Reihe von Silhouetten.
»Ich muss zurück«, sagt Tim und schickt sich an, die Stra-
ße zu überqueren.
»Ich auch«, erwidere ich, und obwohl wir uns beide fragen,
zurück zu was?, ist er höflich genug, es für sich zu behalten.
Die erste Mail auf der Kommentarseite von
www.patrick.rush.com stammt von therealsandman:
Hoffe, mein Geschenk hat dir gefallen.
Zur Aufheiterung
ruft Detective Ramsey an. Er hat herausgefunden, dass Evelyn
seit mehr als vier Jahren weder von ihrer Familie noch von
Freunden gesehen worden ist.
»Mittlerweile sind das ganz schön viele Vermisste aus
Ihrer Gruppe«, stellt er fest. »Macht Ihnen das Sorgen?«
Ist es verboten, im Gespräch mit einem Mordermittler ein-
fach aufzulegen, wenn er einem eine Frage gestellt hat? Falls

dem so ist, kann Ramsey es auf die Liste der Tatvorwürfe
setzen, die er gegen mich zusammenträgt.
Das Telefon klingelt erneut.
»Das ist Belästigung.«
»Hast du wieder vergessen, deine Tabletten zu nehmen?«
»Tim. Ich dachte, es wäre jemand anders.«
»Noch mehr Frauen-Probleme?«
»Schön wär’s, aber nein.«
»Dein Herz gehört Angela Whitmore. Ist es das?«
Im Hintergrund höre ich das Rascheln von Papier.
»Du hast sie gefunden«, sage ich.
»Nicht die Person an sich. Aber einen Haufen interessantes
Hintergrundmaterial. Zum einen hattest du recht damit, dass
das Jugendamt sie ihren leiblichen Eltern weggenommen hat.
›Akute massive Vernachlässigung‹, heißt es in den Akten.
Unterernährung, elementare hygienische Mängel. ›Anzeichen
von körperlicher und seelischer Misshandlung.‹ Klingt
schlimmer als das übliche Junkie-Mutter-Szenario.«
»Die Mutter war süchtig?«
»Mehrere gerichtlich angeordnete Entzugskuren. Und
Überraschung: Keine hat funktioniert.«
»Hast du auch einen Namen?«
»Die Mutter heißt Michelle Carruthers. Das heißt, Whit-
more ist entweder ein angenommener Name oder der Name
ihrer späteren Adoptiveltern.«
»Was ist mit dem Vater?«
»Nach Aktenlage gibt es keinen Vater.«
»Und Michelle Carruthers sieht sich die Radieschen ver-
mutlich schon lange von unten an.«
»Vor einem Jahr jedenfalls noch nicht. Da hat sie nämlich
beantragt, dass man ihr die Identität von Angelas Adoptivel-
tern mitteilt, was natürlich abgelehnt wurde.«
»Ohne Quatsch.«

»Fünfundzwanzig Jahre später wacht sie in einem Trai-
ler-Park am Lake Huron auf und fragt sich: ›Hey, was ist aus
meinem Kind geworden?‹«
»Stand in deiner Akte auch, wo Angela gelandet ist?«
»Die Unterlagen der Adoptiveltern werden getrennt von
den Akten aufbewahrt, zu denen ich Zugang hatte. Diesbe-
züglich sind die Behörden sehr pingelig.«
»Das heißt, du weißt es nicht.«
»Ich habe nebenbei noch einen Job, Patrick.«
»Tut mir leid.«
»Willst du, dass ich an der Sache dranbleibe? Wer weiß,
wenn ich noch ein paar Rädchen schmiere -«
»Nein, nein. Das war eigentlich alles, was ich wissen woll-
te. Danke.«
»Hör mal, ich stecke meine Nase ja normalerweise nicht in
die persönlichen Angelegenheiten meiner Freunde, aber ich
würde sagen, bei ihrem Stammbaum ist deine Angela viel-
leicht nicht der ideale Wiedereinstieg in die romantische Lie-
be.«
»Ich wusste wohl noch nie, was gut für mich ist.«
»Tamara war gut für dich.«
»Ja, das war sie«, sage ich, und bei der Erwähnung des
Namens meiner Frau schnürt mir etwas den Hals zu, das Tim
nicht hören soll. »Ich halt dich auf dem Laufenden, Tim. Und
noch mal vielen Dank.«
Ich lege auf. Aber noch bevor ich mir Bourbon in einen
Kaffeebecher gieße (weil die Gläser alle zu klein aussehen),
bevor ich auch nur anfangen kann, die Neuigkeit von Angelas
vaterloser Vergangenheit zu verdauen, kommt mir der Ge-
danke, dass ich, wenn Tim Earheart so besorgt um mich ist,
wie er geklungen hat, in üblerer Verfassung bin, als ich dach-
te.

Natürlich schlage ich Michelle Carruthers nach. Und natürlich
finde ich sie nach ein paar Google-Suchen und Telefonaten im
Ausschlussverfahren - die Adresse einer Wohnanlage in Hilly
Haven, eines »Wohnmobil-Parks« am Lake Huron. Und na-
türlich fahre ich noch am selben Tag hin, um sie zu besuchen,
ohne einen Schimmer, was ich von ihr will oder wie sie mir
helfen könnte, selbst wenn ich es wüsste.
Hilly Haven ist nicht hügelig, und wovor die paar dürren
Pappeln und eingestürzten Schneezäune um das Gelände Zu-
flucht bieten könnten, lässt sich auch nur schwer erraten. Die
ganze Anlage sieht aus wie eine Unfallstelle, die nicht ge-
räumt ist: ein paar Dutzend Wohnmobile in Reihen, einige
dicht beieinander, andere auf unkrautüberwucherten Doppel-
plätzen für sich, alle mit der Rückfront zum See.
Michelle Carruthers’ Behausung ist die kleinste, ein
Wohnwagen von der Sorte, wie man sie vor dreißig Jahre an
Kombis gekoppelt hat. Als ich an die Seitentür klopfe und von
drinnen eine gedämpfte Begrüßung vernehme (»Wer zum
Teufel?«), frage ich mich, ob ich Angelas Mutter bewegen
kann, nach draußen zu kommen. Es scheint unmöglich, dass
der Caravan genug Platz für uns beide bietet.
Aber als die Tür aufgeht, erkenne ich, dass die gebückt im
Türrahmen stehende Frau ihr mobiles Heim aller Wahrschein-
lichkeit nach nicht verlassen wird. Ihre Haut ist wie Papier.
Sie trägt eine Sauerstoffmaske, die dazugehörige Flasche steht
auf Rädern neben ihr.
»Entschuldigen Sie die Störung. Mein Name ist Patrick
Rush«, sage ich und strecke meine Hand aus, die sie mit ihren
kalten Fingern eher zu wiegen als zu schütteln scheint. »Ich
suche Angela.«
»Angela?«
»Ihre Tochter, Ma’am.«
»Ich weiß, wer sie ist, verdammt noch mal.«

»Ich wollte bloß -«
»Sind Sie ihr Ehemann oder so was? Ist sie Ihnen wegge-
laufen?«
»Ich bin ein Freund. Ich glaube, dass sie möglicherweise
Probleme hat. Deswegen bin ich hier. Wenn ich sie finde,
kann ich ihr vielleicht helfen.«
Nach circa einer Minute reiflicher Überlegung stößt sie die
Wohnwagentür auf, zieht sich die Sauerstoffmaske vom Ge-
sicht und lässt sie wie eine Kette um ihren Hals baumeln.
»Kommen Sie lieber aus der Sonne«, sagt sie.
Aber drinnen ist es noch heißer als draußen. Und keines-
wegs größer, als ich befürchtet hatte. Die Küchenzeile riecht
nach Spaghetti aus der Dose. Das Wohnzimmer wird von
einem riesigen Fernseher in einer Ecke und einer altmodi-
schen Kompaktanlage mit Schallplattenspieler und Radio in
der anderen beherrscht. Hinter einem halb zugezogenen Vor-
hang am Ende des Raumes verbirgt sich die zerwühlte Prit-
sche, auf der sie schläft. Für einen Luftzug sorgt nur der Ven-
tilator, der auf einem Stapel LPs steht und bei den geschlos-
senen Fenstern auch nicht mehr vermag, als mir flüsternd
heiße Luft ins Gesicht zu blasen.
»Setzen Sie sich«, sagt Mrs. Carruthers und lässt sich auf
einen Sessel fallen. Damit bleibt mir nur der Klappstuhl, und
obwohl er ganz bis an die Wand geschoben ist, streifen meine
Knie die ihren, als ich mich hineinzwänge.
»Ich bin interessiert an möglichen Hintergrundinformatio-
nen, die -«
»Moment. Einen Moment mal«, sagt sie und verschränkt
die Hände hinter dem Kopf, was mir einen unvorteilhaften
Blick auf ihre Achselhöhlen eröffnet. »Wie haben Sie mich
gefunden?«
»Ich bin Reporter. Das heißt, ich war Reporter. Wir haben
Zugang zu Informationen, die andere Leute nicht haben.«

»Wurden Sie gefeuert oder haben Sie gekündigt?«
»Verzeihung?«
»Sie sagten, dass Sie Reporter waren. Das ist die Vergan-
genheitsform, richtig?«
»Ich wurde gefeuert. Aber es war nur zum Besten.«
»Es ist alles zum Besten.«
»Soweit ich weiß, wurde Angela als Kind der Fürsorge
unterstellt«, fahre ich fort.
»Sie meinen, man hat sie mir weggenommen? Ja.«
»Das muss schwer für Sie gewesen sein.«
»Ich kann mich kaum daran erinnern. Ich war damals …
ziemlich beschäftigt.«
Sie zeigt mir ihre Zähne, ein Spannen der Lippen, das eher
wie die Reaktion auf den Befehl eines Zahnarztes wirkt als
wie ein Lächeln.
»Ich bin nicht so alt, wie ich aussehe«, sagt sie. »Aber das
heißt nicht, dass ich noch viel Zeit übrig hätte. Also fängt man
an zurückzublicken und denkt: ›Jetzt kann ich an der Scheiße
auch nichts mehr ändern.‹«
»Und ist es Ihnen gelungen, Kontakt zu ihr aufzunehmen?«
»Nee. Ich bin aus dem Spiel. Was ich sehr wohl kapiere,
wissen Sie?«
Sie beugt sich so weit vor, dass der Schein der Leselampe
hinter ihr auf ihr Gesicht fällt, ein Ensemble von vorzeitigen
Falten und Eiterpickeln.
»Wie war sie?«, frage ich. »Als sie klein war.«
Sie tastet mit der Hand über ihre Brust und greift nach der
Sauerstoffmaske. »Sie war unschuldig.«
»Sind das nicht alle Kinder?«
»Das sage ich ja. Sie war einfach ein Kind wie alle ande-
ren.«
»Das ist die Vergangenheitsform.«
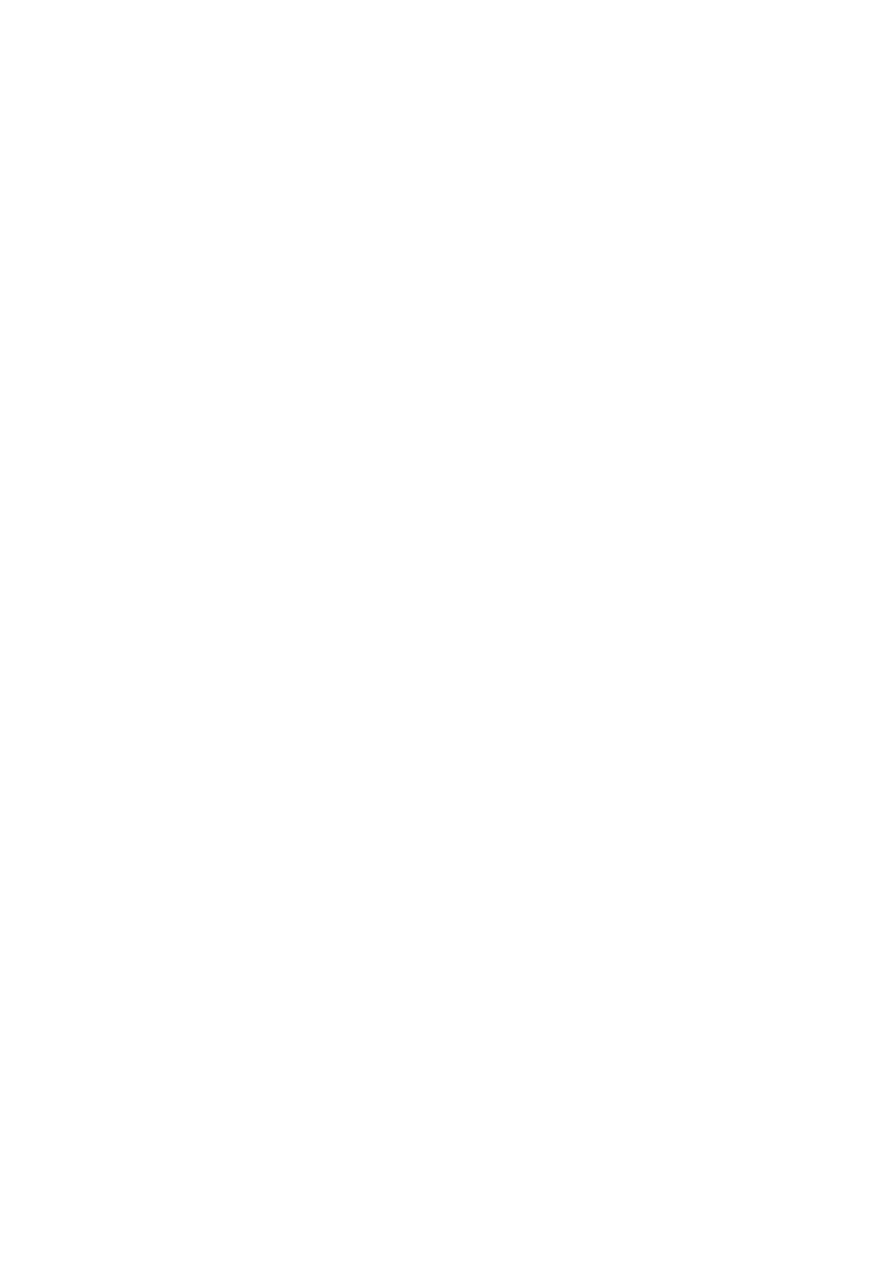
Sie drückt sich die Maske ins Gesicht und nimmt einen
Atemzug. Das beschlagene Plastik verdeckt alle ihre Züge bis
auf die Augen, die mich anblinzeln, bevor ihr Blick glasig
wird.
»Sie hat gelitten«, sagt sie.
»Wie?«
»Einsamkeit. Sie wurde allein gelassen. Ich war jedenfalls
garantiert nicht in der Verfassung, mich um sie zu kümmern.«
»Sie hat gern gelesen.«
»Sie hat gern geschrieben. Tagebücher. Stapelweise.«
»Worüber?«
»Woher soll ich das wissen? Ich war bloß froh, dass sie ir-
gendwas hatte.«
Sie zerrt sich die Sauerstoffmaske vom Gesicht, und ich
sehe, dass sie nicht mehr lange durchhält. Nur aufrecht zu
sitzen und sich zu erinnern treibt ihr den Schweiß auf die
Wangen.
»Angelas Vater«, sage ich und blicke zur Tür.
»Ich hab seit siebenundzwanzig Jahren nicht mehr mit dem
Dreckskerl gesprochen.«
»Wissen Sie, wo er ist?«
»Suchen Sie in den Gefängnissen. Ich hoffe zumindest,
dass er dort ist.«
»Was hat er getan?«
»Was hat er nicht getan?«
»War er gewalttätig?«
»Es war etwas, das er nicht kontrollieren konnte und dann
nicht mehr kontrollieren wollte. Wissen Sie, was ich meine?«
»Erzählen Sie es mir.«
»Was er getan hat … was er … was er seinen eigenen …«,
sagt sie hustend und ringt nach Luft, die zu schnappen den
Rest des Tages in Anspruch nehmen wird. »Es ist etwas, wo-
rüber ich nicht mal reden möchte.«

»Es ist aber wichtig.«
»Wie könnte irgendwas, was mit dem Mann zu tun hat, je
wichtig sein?«
»Es könnte mir helfen, Ihre Tochter zu finden.«
Sie blickt zu mir auf, und ich erkenne, dass sie keine Kraft
mehr übrig hat. Aber sie ist immer noch eine Mutter. Auch in
ihr und selbst jetzt noch schlummert der nutzlose Wunsch, es
wäre anders gewesen.
»Ermordet«, sagt sie und beißt die Zähne so fest aufeinan-
der, dass ich das Knirschen höre. »Kleine Kinder. Mädchen.
Er hat kleine Mädchen ermordet.«
Bevor ich Michelle Carruthers’ Wohnwagen verließ und von
der Sonne geblendet zu meinem Toyota stolperte, hatte sie
mir den Namen von Angelas Vater genannt - Raymond Mull
-, der mir sofort irgendwie bekannt vorkam, obwohl ich erst
zurück nach Toronto fahren und mich in meiner Krypta an
den Computer setzen musste, um mich daran zu erinnern,
woher und warum.
Angelas Mutter hatte recht. Raymond Mull war ein Mäd-
chenmörder. Er wurde wegen der Tötung von zwei Mädchen
angeklagt, zwei Dreizehnjährigen, die vor beinahe zwei Jahr-
zehnten verschwanden. Etwa so alt, wie Angela damals ge-
wesen sein muss, wenn sie heute dreißig ist.
Und was folgt daraus? Vielleicht gar nichts. Vielleicht aber
auch alles.
Wenn Angela eine dreizehnjährige Zeitgenossin der er-
mordeten Mädchen war, stützt das (zusammen mit ihren feh-
lenden Zehen) die Deutung, dass sie tatsächlich die Erzählerin
der Tagebuchgeschichte ist. Und bei ihrer Beziehung zu
Raymond Mull kann man weiter davon ausgehen, dass er die
direkte Inspiration für den Sandmann war. In ihrer Geschichte
lässt sie ihren Pflegevater Jacob diesen Verdacht sogar äu-

ßern. Und es scheint durchaus wahrscheinlich, dass Raymond
Mull das reale Vorbild des schrecklichen Mannes war, der
schreckliche Dinge tut.
Was ich als Nächstes entdecke, deutet allerdings darauf
hin, dass ich nicht das erste Mitglied des Kensington-Kreises
bin, das auf diese Information gestoßen ist.
Eine Suche im Datenarchiv des National Star, für das ich
noch immer ein Passwort besitze, fördert Dutzende von Arti-
keln über Raymond Mulls Prozess zutage. Es gibt auch Fotos
von ihm: Vollbart, eng zusammenliegende Augen, aber an-
sonsten ein Gesicht bar jeden Ausdrucks.
Nach den ersten Berichten über Raymond Mulls Prozess zu
urteilen, schien seine Verurteilung eine ausgemachte Sache zu
sein. Das Beweismaterial der Staatsanwaltschaft umfasste
Werkzeuge - Sägen, Bohrer, Jagdmesser -, die man in seinem
Hotelzimmer gefunden hatte. Außerdem war er von Zeugen
als der Mann identifiziert worden, der sich in den vergange-
nen Wochen in dem fraglichen Gebiet aufgehalten hatte,
Schülern von der Schule nach Hause gefolgt war und vor dem
Gemischtwarenladen herumgelungert hatte, in dem die Kinder
Süßigkeiten kauften. Die lange Liste seiner vorherigen Ver-
urteilungen sprach nicht für seinen Charakter.
Aber nichts von alldem konnte verhindern, dass der Pro-
zess mit einem Freispruch endete. An den Werkzeugen fand
man keine Blutspuren, anhand derer man eine DNA-Probe
nehmen und sie mit der DNA der Opfer vergleichen konnte.
Die Polizei argumentierte, das läge nur daran, dass Mull die
Werkzeuge sorgfältig gereinigt habe, und es gäbe auch ohne
Blutspuren genug Indizien, die ihn mit den Verbrechen in
Verbindung brächten. Aber in diesem Punkt war das Gericht
anderer Meinung. Ohne einen einzigen Zeugen aufzurufen,
beantragte die Verteidigung eine Einstellung des Verfahrens,
weil die Staatsanwaltschaft keinen glaubhaften Beweis für die

Täterschaft des Angeklagten vorgelegt habe. Damit blieb der
Staatsanwaltschaft nur noch, Mull für Verstöße gegen Be-
währungsauflagen festzunageln, was sie auch tat. Das Urteil
lautete neun Monate.
Was bedeutet, Raymond Mull ist, vorausgesetzt, er wurde
in den vergangenen achtzehn Jahren nicht zu weiteren Haft-
strafen verurteilt, ein freier Mann.
Noch verblüffter jedoch lese ich den Namen des Ortes, in
dem die Morde begangen wurden. Whitley, Ontario. Derselbe
Ort, an dem Conrad White und Evelyn mit ihrem Wagen vom
Highway abgekommen sind.
Es könnte bloß ein Zufall sein, aber das glaube ich nicht.
Evelyns und Conrad Whites gemeinsame Neugier hatte sie zu
Raymond Mull und nach Whitley geführt. Damit waren sie
die ganze Zeit von Mai bis Dezember beschäftigt gewesen,
während ich angenommen hatte, sie hätten nur eine Leh-
rer-Schülerin-Affäre.
Wenn das stimmt, wird die Möglichkeit, dass es sich bei
Conrads und Evelyns Unfall tatsächlich um einen solchen
gehandelt hat, zusehends unwahrscheinlicher. Sie sind in eine
Felswand gerast. Aber was veranlasste sie dazu? Und wovor
waren sie mit der Geschwindigkeit auf der Flucht? Selbst die
Polizei fand den Unfall »rätselhaft«. Eine mögliche Lösung
wäre, dass es sich um einen Doppelmord gehandelt hat. Und
dass ihr Mörder Raymond Mull war.
Angelas Vater. Der echte Sandmann.

27
Sam ruft mich an.
Ich habe den ganzen Tag in der Krypta gesessen, mit
Unterbrechungen in mein Tagebuch geschrieben und immer
wieder Angelas Nummer angerufen, als würde Beharrlichkeit
ausreichen, um die Toten zurückzubringen. Ich versuche es
sogar bei Len, dessen Anrufbeantworter die unheimliche Kla-
viermusik aus Halloween spielt.
Alle sind verschwunden oder vermisst. Ich auch. Deswe-
gen bin ich überrascht, als das Telefon klingelt.
»Dad?«
»Was gibt’s?«
»Kommst du mich heute besuchen?«
»Heute nicht.«
»Wovor hast du Angst, Dad?«
»Ich hab keine Angst.«
»Wovor hast du Angst?«
»Ich möchte nicht, dass man dir wehtut für etwas, das ich
getan habe«, sage ich schließlich. »Du bist es. Du bist alles,
was ich habe. Es gibt für mich nichts Wichtigeres, als sicher-
zugehen, dass ich es nicht noch einmal vermassle.«
»Was hast du denn getan?«
»Ich habe etwas gestohlen.«
»Kannst du es nicht zurückgeben?«
»Es ist zu spät.«
»Wie bei etwas … Verderblichem.«
»Richtig. Genau so.«

Wenn man die Vergangenheit eines anderen nimmt und als
seine eigene verwendet, kann man sie nicht mehr zurückge-
ben. Sie ist angestoßen. Verderblich. Wenn man die Ge-
schichte eines anderen nimmt, kann es gut passieren, dass er
sie nicht zurückhaben will.
An diesem Abend weiß ich schon, dass etwas nicht stimmt,
noch bevor ich den Toyota hinter dem Haus parke. Das Gar-
tentor ist angelehnt. Dabei erinnere ich mich, es vor einer
Woche mit einem Vorhängeschloss gesichert zu haben. Die
Hände am Steuer, bleibe ich ein paar Minuten sitzen. Ein
Luftzug stößt das Tor noch einen Spalt weiter auf. Selbst im
Dunkeln kann ich die blassen Markierungen sehen, wo das
Schloss mit einem Brecheisen aufgestemmt wurde.
Es ist blinde Wut, die mich an der Rückseite von zwei
Nachbarhäusern entlang auf die Straße laufen lässt. Das Blut
rauscht in meinen Ohren, als ich meine Haustür aufschließe
und dagegentrete.
Ich renne nach oben, stürze blindlings in jedes Zimmer,
ohne meine Schritte zu dämpfen oder ein Licht anzumachen.
Keine Anzeichen dafür, dass etwas gestohlen oder ange-
rührt wurde. Oder hinterlassen.
Unten das gleiche Bild. Alle Türen verschlossen, alle
Fenster intakt. Wer immer sich die Mühe gemacht hat, das
Gartentor aufzustemmen, wurde offenbar auf dem Weg zum
Haus gestört. Oder er wollte gar nichts ins Haus.
Ich ziehe die Vorhänge im Wohnzimmer auf und betrachte
die Glasschiebetür. Das Licht einer einzelnen Birne erleuchtet
den schiefen Gartenschuppen. Überraschung. Zum einen, weil
ich so lange nicht mehr abends dort draußen war, dass ich die
Birne längst vergessen hatte. Und zum anderen, weil das Licht
noch nicht gebrannt hat, als ich vor kaum mehr als fünf Mi-
nuten meinen Wagen dort geparkt habe.
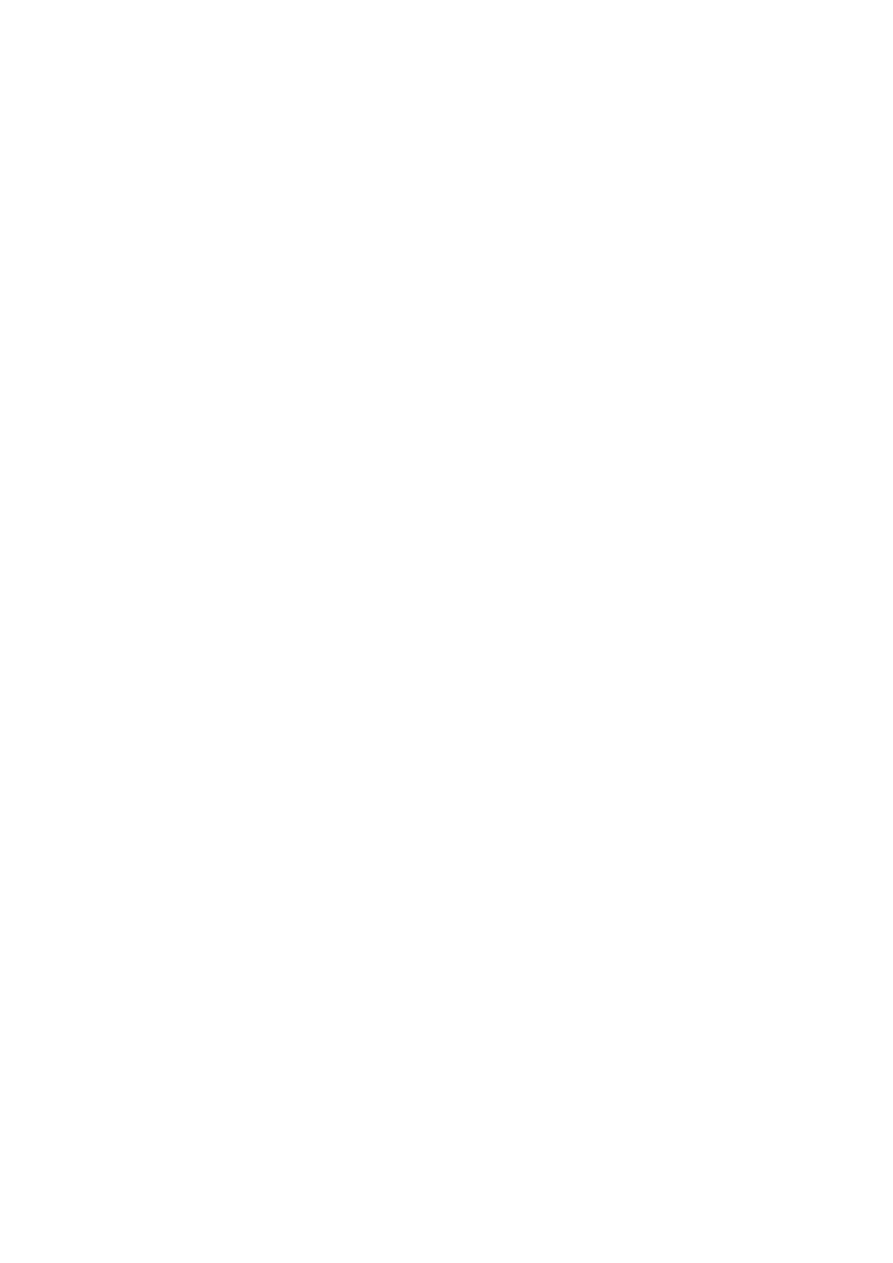
Ich gehe in den Keller und wühle in einer Ecke mit alten
Sportsachen, bis ich gefunden habe, wonach ich suche. Einen
Baseballschläger, der gut in der Hand liegt, schwer, aber ge-
eignet, mit dem ersten Schwung die entscheidende Wucht zu
entwickeln. Danach kann ich mir, wenn alles gutgeht, Zeit
lassen.
Ich öffne die Schiebetür und stapfe über den ungemähten
Rasen. Die Tür des Schuppens steht einladend offen.
Das Schuppenfenster ist klein, nicht viel mehr als einen
halben Quadratmeter groß, die Scheibe trübe von Spinnwe-
ben. Ich versuche hineinzublicken, kann aber nur Regale und
Haken an der Wand erkennen sowie unbenutzte Gartengeräte
und ungeöffnete Verpackungen. Das Museum eines geschei-
terten Handwerkers.
Ich gehe zur Tür und hebe den Schläger in Schulterhöhe.
Einen Moment lang wirken der Verkehrslärm und das
Summen der Klimaanlagen gedämpft. Ich bin ganz allein. Ein
Mann, der mit erhobenem Baseballschläger in seinem Garten
steht und den Fuß hebt, um die Tür des Schuppens einzutre-
ten.
Sie fliegt auf, schlägt gegen die Wand und schwingt wieder
zu.
Trotzdem bleibt genug Zeit für einen flüchtigen Blick. Der
alte Rasenmäher, den ich in diesem Jahr noch nicht benutzt
habe. Der Sunshine-Girl-Kalender von 1999, den Tim Earhe-
art mir geschenkt hat. Rote Farbkleckse auf dem Boden. Pe-
tra.
Dann: keine rote Farbe, sondern Blut.
Und nicht Petra, sondern Petras Leiche.
Was hat er benutzt?
Das ist mein erster Gedanke, als ich Petras Überreste auf
dem Boden meines Schuppens sehe. Kann man das mit einem
Messer hinkriegen? Einem Bohrer? Könntest du das auch?

Hat er sie in einer Gefriertruhe aufbewahrt?Auch das
denke ich. Frisch genug sieht sie aus.
Aber das ist nur der Schock, der aus mir spricht. Das bin
nicht ich.
Ich starre sie an. Unvertraute helle Rottöne und diverse
Blauschattierungen, Farben, die normalerweise im Körper
eines Menschen verborgen sind. Ich setze mich auf einen
Farbeimer und tue das Gleiche, was ich getan habe, als ich
ihre Yankees-Kappe auf meinem Couchtisch entdeckte,
nachdem sie von Angelas Apartment in mein Haus gelangt
war. Ich habe sie bloß angesehen. Lange genug, dass aus
Morgen Nachmittag wurde und ein Gewitter vorüberzog. Und
die ganze Zeit stellte ich mir die gleiche Frage wie jetzt: Was
macht man mit im eigenen Haus hinterlassenen Indizien, die
einen für den Rest des Lebens ins Gefängnis bringen könnten?
Es gibt die Möglichkeit, begleitet von einem teuren Anwalt
zur Polizei zu gehen, ihnen die ganze Geschichte zu erzählen
und zu hoffen, dass sie es genauso sehen wie man selbst.
Diese Möglichkeit steht mir in meinem Fall jedoch nicht of-
fen. Nicht bei all den rätselhaften Vorkommnissen, die selbst
mich grübeln lassen, ob ich es war.
Die zweite Möglichkeit wäre, Hilfe zu rekrutieren. Einen
Freund anrufen, um sich bei ihm einen guten Rat zu holen
oder um sich mit dem Wagen über die Grenze fahren zu las-
sen. Aber wen würde ich anrufen? Tim Earheart? Schwer vor-
stellbar, dass er der Versuchung widerstehen könnte, die Mit-
schrift meines Anrufs auf der Titelseite der Zeitung von mor-
gen zu drucken.
Am Ende macht man dann vielleicht das, was ich getan
habe: Ich ziehe Gärtnerhandschuhe an, wische mit einem
feuchten Handtuch die Fingerabdrücke von der Yan-
kees-Kappe, schneide sie in Streifen und stopfe sie in den
Müll.

Das Gleiche mache ich mit Petras Leiche.
Aber nicht sofort, sondern erst nach ein paar Stunden, in
denen ich, den Kopf zwischen den Knien, dahocke und tief
durchatme. Eine Zigarette aus der Notfall-Schachtel in dem
Blumentopf rauche und trocken auf den Komposthaufen
würge. Es ist nicht leicht, einen Entschluss wie diesen zu fas-
sen. Aber das ist noch gar nichts. Die Entscheidung ist ein
Kinderspiel verglichen mit ihrer Umsetzung.
Oder der Vorbereitung darauf.
Endlich kann ich das Wissen, das ich mir als Couchkartof-
fel in hunderten Stunden Forensiker-TV-Krimis angeeignet
habe, einmal nutzbringend anwenden: Wie verwischt man bei
der Beseitigung einer Leiche am besten seine Spuren?
Ich beginne damit, mich nackt auszuziehen (die Kleider,
die ich beim Betreten des Schuppens getragen habe, verbren-
ne ich später zur Sicherheit). Nach dem Zerschneiden packe
ich jedes kleinere Teil in mehrere Mülltüten. Trocken und
luftdicht. Die kleineren Pakete stopfe ich in einen großen
Müllsack für Gartenabfälle.
Nachdem ich fertig bin, schneide ich mir Nägel und Haare
und rasiere mich. Ich dusche und schrubbe dann jeden Qua-
dratzentimeter meiner Haut mit Putzmitteln, die man eigent-
lich nur in der Küche verwenden sollte. Im Bad bringe ich
sogar Domestos zum Einsatz.
Und dann mache ich das Ganze noch einmal. Und noch
einmal.
Woran erinnere ich mich jetzt, nur Minuten nachdem ich
mit allem fertig bin? An das eine oder andere natürlich. Die
Schutzwände in meinem Gehirn geben bereits nach. Zweifel-
los werden sie nicht halten. Nicht für immer und nie ganz
dicht. Aber wenn man das Schlimmste in Schach hält, kann
man sich überraschenderweise immer noch einen Drink ein-

gießen, sich im Spiegel anschauen und an den eigenen Namen
erinnern.
Sagen wir einfach, das Zerschneiden einer Baseballkappe
und das Zerlegen einer Leiche sind zwei verschiedene Dinge.
Was die benötigten Werkzeuge betrifft, die aufzuwendende
Zeit und die Spuren, die bleiben. Es ist einfach etwas anderes.
Nachdem ich geschrubbt, geputzt und meine Zehenabdrü-
cke auf dem Betonboden abgewischt habe, bleiben immer
noch sechs große Müllsäcke für Gartenabfälle.
Ich rauche die restlichen Zigaretten in der Packung.
Heute ist Abholtag. Der Mülllaster kommt in meiner Straße
immer ziemlich früh, meistens um kurz nach acht. In etwas
mehr als einer Stunde. Die Müllmänner, die in unserem Vier-
tel arbeiten, sind es schon gewohnt, mich barfuß und in Bo-
xershorts durch den Garten rennen zu sehen. Meist schaffe ich
es noch in letzter Sekunde, die Säcke mit Gartenabfällen an
den Straßenrand zu tragen. Sie hören sich jedes Mal meine
Entschuldigung an und haben nichts dagegen, wenn ich die
Säcke gleich selbst auf den Laster werfe. Wenn ich fertig bin,
drücken sie auf einen Knopf, worauf der Kompost zusam-
mengepresst wird, damit der Schlucker des LKW ihn auf-
nehmen kann. Dann ist er verschwunden.
Und heute werden sie Petra mitnehmen.

28
Vermutlich sind es die Schuldgefühle über das, was ich im
Schuppen gemacht habe, die wachsende Sorge, entdeckt zu
werden - keine Ahnung, warum, aber am nächsten Tag ver-
schanze ich mich zu Hause und bestrafe mich mit der steten
Anwendung der grausamsten häuslichen Folter: Ich gucke
Fernsehen.
Nicht, dass ich es nicht erst mit Lesen versucht hätte. Ich
habe an den ersten Seiten des neuesten Philip Roth ge-
schnuppert (zu scharfzüngig), wahllos ein paar Häppchen
Borges geschmökert (zu fantastisch), es noch einmal mit Pa-
tricia Highsmith probiert (zu sehr wie das wirkliche Leben
oder zumindest wie mein wirkliches Leben). Wahrscheinlich
werde ich nie wieder lesen. Ich komme mir vor wie der von
Burgess Meredith gespielte Bücherwurm in der Folge von
Twilight Zone, in der er entdeckt, dass er der letzte Mensch
auf Erden ist, und sich darauf freut, endlich all die Meister-
werke der Literatur zu lesen, die er noch vor sich hat. Er setzt
sich auf die Stufen der Bibliothek und verliert dabei seine
Brille, die in tausend Scherben zerbricht. Eine Nerd-Vision
der Hölle. Und so geht meine.
Seit ich dafür kein Geld mehr bekomme, habe ich mich
nicht mehr den ganzen Tag vor die Glotze gehockt, beginnend
mit den Wiedergeborenen Christen am frühen Morgen, ge-
folgt von Nachmittags-Talkshows und Autopsien zur besten
Abendsendezeit, abgerundet von seelenlosen Stunden mit
Wunder-Diät-Tabletten, Telefonsex-Nummern und Dauer-

werbesendungen, wie man schnell reich werden kann. Nicht
das Leben eines Menschen, der schreibt oder sogar über Bü-
cher schreibt, sondern das eines ungebildeten Simulanten, der
zu Unrecht glaubt, er hätte etwas Besseres verdient. Kein
Wunder, dass sein Leben, als es beschließt, romanhaft zu
werden, kein großer Ideenroman, sondern eine Chronik von
Mord und Verdächtigungen wird. Die Sorte Buch, die tatsäch-
lich zu lesen ich mir immer zu fein vorgekommen war und die
ich dafür jetzt durchleben muss. Ein blutiger Thriller.
Positiv zu vermerken ist jedoch, dass ich offenbar davon-
gekommen bin. Keine Anrufe von der Stadtreinigung, die
nach blau angelaufenen Gliedmaßen fragt, die sich durch
meine Kompostsäcke gebohrt haben, keine Beschwerden von
Nachbarn, weil ich mitten in der Nacht mit der Kreissäge he-
rumgelärmt habe. Eines Tages wird Petra auftauchen,
zwangsläufig. Aber nicht gestern und nicht heute. Und selbst
wenn sie in einer Woche, einem Jahr oder einem halben Le-
ben gefunden wird, gibt es keine Indizien, die sie mit mir in
Verbindung bringen. Wahrscheinlich bin ich dann ohnehin
nicht mehr da. Wenn es das Ziel des Sandmanns war, alle
Mitglieder des Kensington-Kreises nacheinander umzubrin-
gen, ist er beinahe fertig. Ich würde Geld darauf wetten, dass
ich als Einziger noch lebe. Und er hat bereits klargemacht,
dass er weiß, wo ich wohne.
Und so sitze ich jetzt hier unten in der Krypta und warte
auf ihn, schaue immer wieder zum Kellerfenster und denke
bei jeder hungrigen, streunenden Katze und jeder Hambur-
gerverpackung, die von einem Windstoß in den Vorgarten
geweht wird, dass es seine Stiefel sind, die vorbeistapfen. Er
wartet, dass ich nach draußen komme, und wenn ich mich
weigere, wird er mich hier drinnen holen. Ich werde nicht
hören, wie er eintritt. Er wird mich in diesem Sessel vorfin-

den, die Fernbedienung in der Hand. Und dann wird er tun,
was er tun wird.
Ich frage mich, ob er sich mir vorher zu erkennen geben
wird. Auf einmal dringt lauter Lärm zu mir: Es klingelt an der
Tür, die beschwingten ersten Takte von Happy Days; das Ta-
gebuch, in dem ich gekritzelt habe, fällt zu Boden. Es ist
Morgen. Sandfarbenes Licht fällt durch die Kellerfenster.
Ich muss wach sein. Kann man im Schlaf riechen, wie
schlecht man riecht?
Es klingelt erneut. Auf dem Weg die Treppe hinauf stopfe
ich das Hemd in die Hose, während ich mich frage, warum ich
mir die Mühe gebe, für den Sandmann präsentabel auszuse-
hen. Denn er hat entschieden, dass er seinen Auftritt so ma-
chen will. Er kommt nicht in der Nacht zu mir, sondern an
einem müden Julimorgen, an dem Wolken die Hitzeglocke
über der Stadt festhalten wie eine schützende Wolldecke.
Ich erkenne die Umrisse eines großen, langarmigen Man-
nes, der vor dem Fenster in der Haustür steht. Und die erneute
musikalische Aufforderung der Klingel reicht aus, dass ich die
Tür aufschließe und die Klinke herunterdrücke.
Ramsey begrüßt mich mit seinem typischen, leicht fiesen
Lächeln. Er ist gut gelaunt.
»Möchten Sie einen Kaffee?«
»Ich versuche, meinen Konsum einzuschränken«, sagt er,
»aber ich glaube, ich nehme trotzdem einen.«
Ich gebe ihm einen Kaffee und warne ihn, dass er heiß ist.
Doch er packt den Becher mit beiden Händen und nimmt
einen gierigen Schluck.
»Für mich kann er gar nicht heiß genug sein«, meint er.
Mittlerweile ist Ramsey an die Terrassentür getreten und
schaut in den Tag hinaus. Dann senkt er den Blick vom Him-
mel zu dem Schuppen im Garten. Er tut das so demonstrativ,
dass ich nur vermuten kann, er möchte, dass ich es bemerke.

»Legen Sie mir Handschellen an oder gehen wir einfach
so?«
»Sie glauben, ich wäre hier, um Sie zu verhaften?«
»Ja.«
»Ich dachte, wir wären Freunde.«
»Was tun Sie hier? Ich wollte mir nämlich eigentlich gera-
de ein paar wichtige Wiederholungen von Beverly Hillbillies
ansehen.«
»Ich bin hier, um Ihnen zu berichten, dass wir ihn gefun-
den haben«, sagt er.
»Sie haben ihn gefunden?«
»Er wurde heute Morgen verhaftet.«
»Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht folgen.«
»Der Sandmann«, sagt Ramsey. »Der Bursche, der die an-
deren Mitglieder aus Ihrem Schreibzirkel umgebracht hat. Wir
haben ihn.«
Ich lehne inzwischen an der Kühlschranktür, um aufrecht
stehen zu bleiben.
»Wer ist es?«
»Das wissen Sie nicht?«
»Ich hatte jeden in Verdacht. Sogar Sie.«
»Meiner Erfahrung nach ist die erste Vermutung in der
Regel die richtige.«
»William.«
»Glückwunsch.«
»Und jetzt haben Sie ihn?«
»Er wird am späten Vormittag dem Haftrichter vorgeführt.
Deswegen muss ich auch jeden Moment los. Ich bin bei der
Verlesung der Tatvorwürfe immer gern anwesend.«
Ich schätze, danach muss ich Ramsey weitere Fragen ge-
stellt haben, denn er beginnt zu erzählen. Von den Beweisen,
die er gegen William hat. Williams Hintergrund, seinem Vor-
strafenregister, seinen Tarnnamen. Von den blutbespritzten
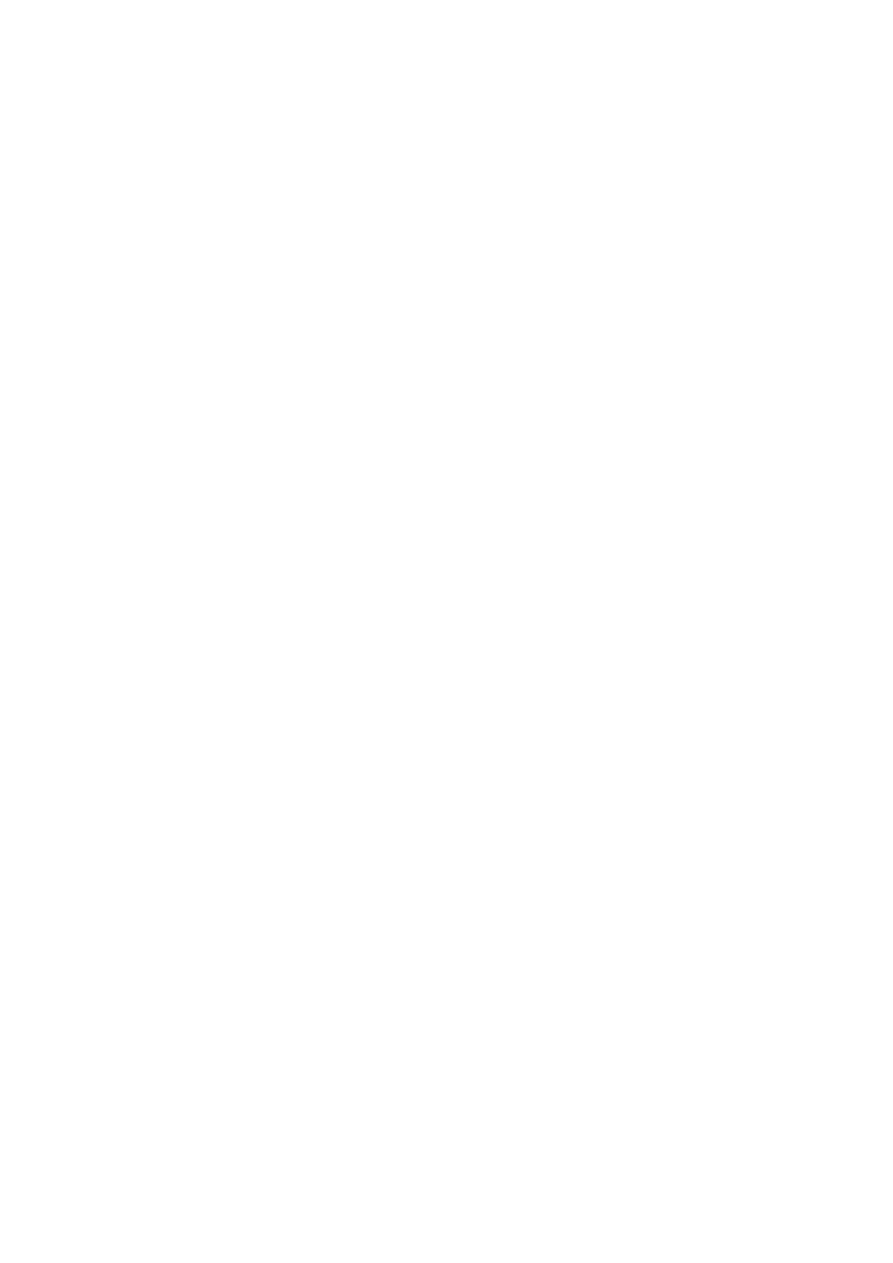
Werkzeugen in seinem gemieteten Zimmer. Seiner Mitglied-
schaft nicht nur im Kensington-Kreis, sondern davor auch in
anderen Schreibzirkeln, denen Carol Ulrich, Ronald Pevencey
und Jane Whirter angehört hatten. Dass die Polizei die Suche
nach Angela, Petra und Len fortsetzen und auch sie finden
wird, jedenfalls ihre Überreste, denn Ramsey hasst nichts
mehr als eine unvollständige Akte.
»Ich habe nie wirklich geglaubt, dass Sie es waren«, sagt er
jetzt. »Aber Sie waren in diesem Kreis. Und Sie waren derje-
nige mit dem Roman, der genauso hieß, wie sich der Mörder
nannte. Es war eigenartig. Die Beweise sprechen jedoch für
sich. Sie haben ihn nur als Material benutzt, oder? Ein Parasit
- wenn Sie das Wort entschuldigen. Aber das sind Sie. So
einer sind Sie.«
Ramsey sieht auf die Uhr. Für den Gerichtstermin ist er
immer noch früh dran - die Küchenuhr zeigt gerade 8.45 Uhr
an -, aber er tut so, als hätte er es eilig. Der Spaß im Hause
Rush ist vorbei.
Er marschiert zur Haustür, und ich folge ihm. Und obwohl
er sich mit der Selbstgewissheit eines Mannes bewegt, der
wieder einmal recht behalten hat, wird mir mit einem eisigen
Prickeln klar, dass der Triumph in Wahrheit meiner ist. Nie-
mand hat Petra gefunden. Und selbst wenn man sie finden
sollte, wird man mein Handwerk William zuschreiben. Und
Ramsey hat mir den Gefallen getan, den Sandmann zu
schnappen, bevor er Gelegenheit hatte, mich zu besuchen.
Auf halbem Weg zur Straße dreht er sich noch einmal um.
»Sie sollten hoffen, dass wir auch eine Verurteilung kriegen«,
sagt er.
Ich wusste, dass es William war. Das heißt, nur er konnte es
sein. Und trotzdem hatte ich beinahe von Beginn an ange-
nommen, dass der Sandmann nicht das Pseudonym eines

Mörders war, sondern ein real existierendes Wesen, für das es
keinen richtigen Namen gab. Abgespalten von der Mensch-
lichkeit nicht nur durch seine Taten, sondern schon durch sei-
ne Natur. Ein Ungeheuer.
Das war der Reiz von Angelas Geschichte.
Als psychologisches Profil ist William ein Klassiker. Ein
Kind, das im zarten Alter von sechs Jahren in rascher Folge
beide Eltern verloren hatte - die Mutter starb an MS, der Vater
erlitt einen Infarkt - und den Rest seiner Jugend von einer
Tante oder einem Onkel zum nächsten verschickt wurde, von
einer Präriestadt in die andere. »Niemand hat nach ihm gese-
hen«, wie Ramsey sich ausdrückte. »Oder sie haben sich Mü-
he gegeben, in die andere Richtung zu schauen.«
Tatsache ist, dass der kleine Will schon früh ein Schulhof-
tyrann ohne Freunde war, jedenfalls seit Pädagogen und Psy-
chologen begannen, Akten über ihn anzulegen. Ein Leh-
rer-Schläger, Fenster-Einschmeißer, Spielplatz-Quälgeist, ehe
seine offensichtlichen kriminellen Talente zum Vorschein
kamen. Die Zerstückelung von Haustieren aus der Nachbar-
schaft, Diebstähle, Einbrüche, Körperverletzungen. Ein gra-
dueller Aufstieg von Kavaliersdelikten zu brutaler Gewalt.
Ein paar Jahre nach Beendigung der Highschool ver-
schwand William von der Bildfläche. Keine neuen Straftaten,
keine bekannte Adresse. Soweit die Polizei wusste, hatte er
sich für den Großteil seines dritten Lebensjahrzehnts in den
raueren Ecken diverser Städte im Westen herumgetrieben,
Zimmer in den vergessensten Vierteln von Winnipeg, Port-
land, Lethbridge und Spokane gemietet, sich mit Jobs über
Wasser gehalten und seine Freizeit mit finsteren Betätigungen
zugebracht.
Denn dorthin, wohin William ging, zog sich auch die Spur
von Vermissten. Eine scheinbar wahllose Folge von Männern
und Frauen, die über keinerlei gemeinsame Eigenschaften

oder Hintergrund verfügten bis auf die Tatsache, dass ein
großer, bärtiger Einzelgänger um die Zeit, als sie verschwun-
den waren, eine Weile in ihrer Stadt gelebt hatte. »Das könnte
Zufall sein«, räumte Ramsey ein. »Aber das glaube ich keine
Sekunde lang. Nicht nach dem, was wir gefunden haben.«
Und was hatte die Polizei in Williams Zimmer über einem
bankrotten Schlachterladen im East End gefunden? Die Aus-
stattung für einen neuen Metzgerladen. Beile, Sägen, Spezial-
drahtschneider, zum großen Teil mit getrocknetem Blut ver-
krustet, dessen DNA im Moment im Labor untersucht wurde.
Aber in Anbetracht verschiedener anderer persönlicher
Gegenstände, die man in Williams Badewanne, in Küchen-
schränken und sogar am Fußende seines Bettes gefunden hatte
- Carol Ulrichs Handtasche, Ronald Pevenceys Tagebuch -,
gilt es als sicher, dass die Laboruntersuchung beweisen wird,
dass die Werkzeuge benutzt wurden, um alle drei zu entsor-
gen.
Außerdem hat man Geschichtenbücher gefunden, selbst
gebastelt mit Buchdeckeln aus Pappe, in denen die zusam-
menhanglose Geschichte eines Schattens erzählt wird, der
durch die Nacht geistert und gelegentlich Halt macht, um
wildfremde Menschen zu metzeln, die ihm ins Auge gefallen
sind. Geschrieben in Williams Handschrift. Und der Name
des Protagonisten?
»Lassen Sie mich raten«, hatte ich Ramsey unterbrochen.
»Der Sandmann?«
»Ist das nicht eine Urheberrechtsverletzung?«
»Es gibt keinen Rechtsschutz für Titel, nur für den Inhalt.«
»Wirklich schade. Ich dachte, ich hätte vielleicht ein wei-
teres Vergehen, für das ich ihn drankriegen kann.«
Die Polizei hat ihren Mann. Und ihr Mann ist ein Mann. Er
hat nichts Übernatürliches an sich außer jener schwarzen Ma-
gie, die einen Menschen in die Lage versetzt zu töten. Aus

keinem anderen Grund als der Lust, es zu tun. Der Sandmann
ist ein Geschöpf der Fantasie. Aber hier ist das Fantastische
nicht erforderlich, das ist es nie. Man braucht nur seinen
Nullachtfünfzehn-Zerstückelungskünstler: das ungeliebte
Kind, den Welthasser, den gnadenlosen Psychopathen, wie
man sie auf der Vermischtes-Seite jeder Zeitung findet. Es
gibt sie reichlich.
Ich sollte erleichtert sein. Und das bin ich. Sam kann wie-
der nach Hause kommen. Wir können uns daranmachen, uns
ein neues Leben zu schaffen.
Was bleibt ist die Frage des einzigen Überlebenden: Wa-
rum ich? Irgendjemand muss die Geschichte erzählen, nehme
ich an.
Und diesmal ist es nicht Angelas, sie ist nicht gestohlen. Es
ist meine.
Am nächsten Tag ist Williams Kautionsanhörung, und ob-
wohl ich sofort nach St. Catharines fahren und Sam abholen
will, hält mich ein ernüchterndes Maß an Furcht zurück.
Wenn es dem Anwalt des Mannes, der sich der Sandmann
nennt, irgendwie gelingt, ihn am Nachmittag frei zu bekom-
men, weiß ich, wen er wahrscheinlich als Ersten besuchen
wird. Im Moment ist Sam sicher. Und ein weiterer Tag der
Trennung ist der Preis dafür, dass es so bleibt.
Trotzdem scheint der Augenblick nach irgendeiner Art der
Feier zu verlangen.
Ich muss aus dem Haus.
Raus aufs Land.
Am Horizont ragt das Schild für Hilly Haven als einsame
Unterbrechung der flachen Felder auf. Ich fahre durch das Tor
auf die Anlage und frage mich, wie ich Angelas Mutter sagen
soll, dass ihre Tochter Angela wahrscheinlich tot ist. Vermut-

lich muss ich mir um die genaue Wortwahl keine allzu großen
Gedanken machen. Michelle Carruthers ist daran gewöhnt,
schlechte Nachrichten zu empfangen. Sie wird es wissen, ehe
ich ihr auch nur die Hälfte erzählt habe.
Ich parke auf dem Kiesweg vor dem Wohnwagen, dankbar
für die Wolken, die einen Schleier über einige der eher depri-
mierenden Details von Hilly Haven breiten, räderlose Dreirä-
der und skalpierte Puppen, fleckige Unterwäsche, die an Wä-
scheleinen flattert.
»Niemand zu Hause.«
Bevor ich klopfe, drehe ich mich um und sehe eine Frau,
die zu alt ist für die Zöpfe, die bis zu den beiden schokolade-
verschmierten Kindern an ihren Händen reichen. Keines trägt
ein T-Shirt, das groß genug wäre, das Bäuchlein zu bedecken,
das über den Bund ihrer Trainingshosen quillt.
»Kommt Michelle bald zurück?«
»Nicht bald.«
»Alles in Ordnung mit ihr?«
»Sind Sie ein Freund von ihr?«
Ein Bulle. So muss ich für sie aussehen. Hilly Haven be-
kommt bestimmt regelmäßig Besuch von irgendwelchen zivi-
len Ermittlern, die an die Blechtüren klopfen.
»Mein Name ist Patrick Rush. Ich war ein Freund ihrer
Tochter. Ich fürchte, sie ist in Schwierigkeiten geraten.«
»Schwierigkeiten?«, fragt die Frau und lässt die Hände
ihrer schokoladeverschmierten Kinder los.
»Eine Privatangelegenheit.«
»Sie meinen, sie ist auch tot?«
»Verzeihung?«
»Michelle ist letzte Woche gestorben.«
»Oh, verstehe.«
»Die Ärzte wussten nicht, was genau sie dahingerafft hat.
Aber bei ihr hätte es alles sein können.«
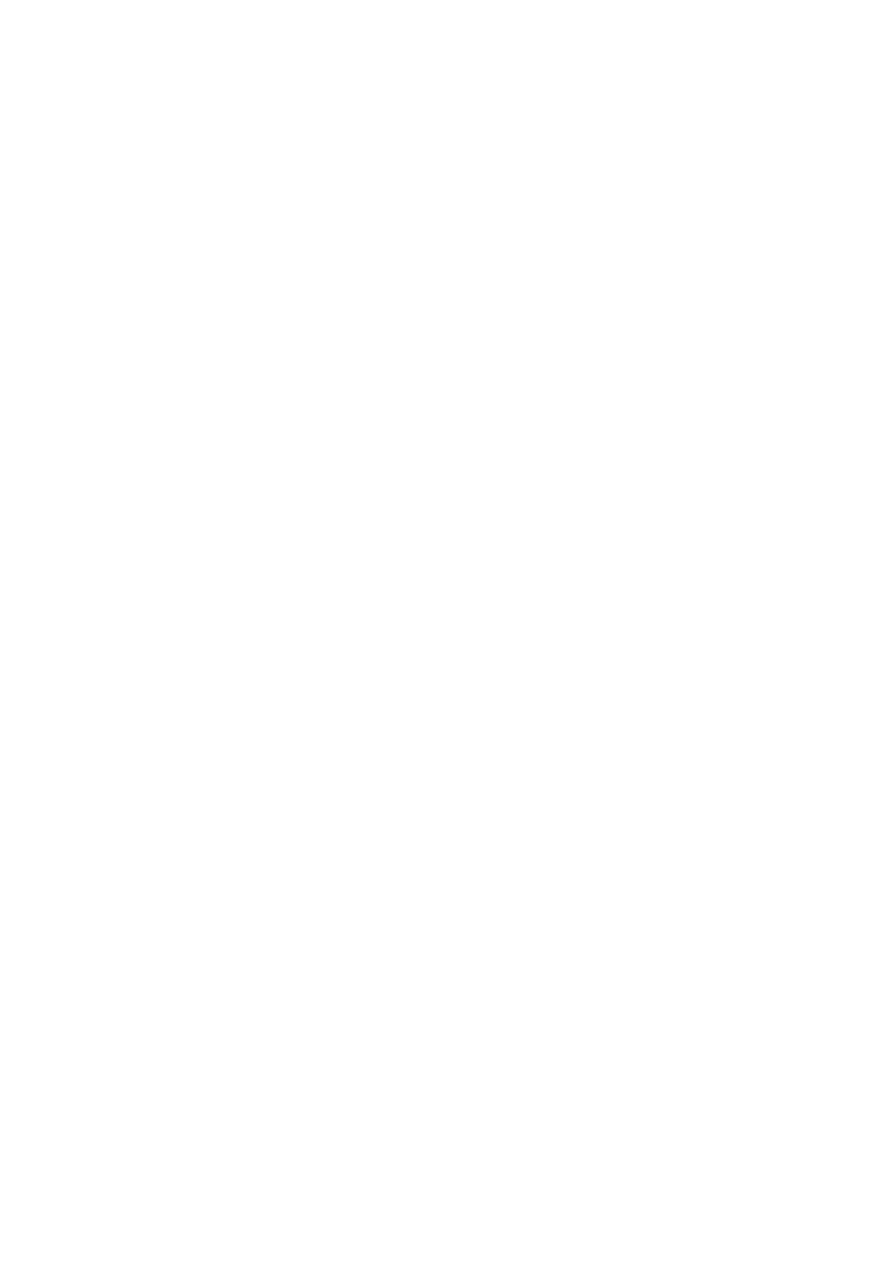
Mehr gibt es nicht zu sagen. Doch die drei einfach stehen
lassen, ohne ein weiteres Wort zum Wagen gehen und weg-
fahren will ich irgendwie auch nicht. Wenn das kleinere der
beiden Kinder mir nicht seine schwarze Zunge rausgestreckt
hätte, wäre mir womöglich gar keine Frage eingefallen.
»Ist sie schon bestattet worden?«
»Zwei Tage nach ihrem Tod. Ein paar von hier waren die
Einzigen, die gekommen sind. Und der Sohn.«
»Der Sohn?«
»Wir haben jedenfalls alle gedacht, dass er es sein muss.«
»Wie hieß er denn?«
»Hab nicht gefragt.«
»Wie sah er aus?«
»Ziemlich groß, wirkte nicht wie der Typ, der es besonders
mag, wenn man ihn zu lange anguckt. Als ob er zwar da sein
wollte, aber ohne dass jemand es weiß.«
Ich steige die Zementtreppe zu dem Wohnwagen hinunter.
Hinter einer Wolkenbank taucht die Mittagssonne auf.
»Wann war die Beerdigung?«
»Letzte Woche. Das hab ich doch gesagt.«
»An welchem Tag?«
»Donnerstag, glaube ich.«
Donnerstag. Zwei Tage vor Williams Verhaftung. Ziemlich
groß.
»Ich sollte dann wohl besser wieder los«, sage ich. Aber
als ich an der Frau vorbeigehen will, fasst sie mit der Hand
meinen Arm und hält mich zurück.
»Irgendjemand sollte diesen Sohn suchen, wenn seine
Schwester gestorben ist.«
»Ich lasse es ihn wissen.«
»Dann kennen Sie ihn? Wir hatten also recht? Es war Mi-
chelles Junge?«

»Sie wissen ja, wie Familien sind«, sage ich vage, aber die
Frau scheint mich zu verstehen. Jedenfalls antwortet sie mit
einem Nicken, das ihre Kinder, den Wohnwagen von Angelas
Mutter, die glühende Sonne und ganz Hilly Haven einbezieht.
»O ja«, sagt sie. »Voller Überraschungen.«
Zu Hause erwartet mich eine Nachricht von Tim Earheart. Er
will sich mit mir treffen und sehen, wie es mir geht. Aber
schon als ich seinen Anruf erwidere und mich mit ihm in einer
Bar in der Nähe seines neuen Hauses in Cabbagetown verab-
rede, weiß ich, dass er von Williams Verhaftung gehört hat
und herausfinden will, was ich über die Sache weiß. Das war
von Anfang an Tims Auftrag. Und nachdem nun der letzte
Akt beginnt - das öffentliche Reinigungsritual, das jedes
Strafverfahren bedeutet -, will er den Vorsprung abzapfen,
den er gegenüber der Konkurrenz hat.
Tim denkt, ich weiß etwas. Und solange sich nichts Lukra-
tiveres auftut, fragt er weiter, was es ist. Trotzdem klammere
ich mich nach wie vor an die Möglichkeit, einer Entlarvung
zu entgehen. Sicher, wenn es zu einem großen Prozess gegen
William kommt, werde ich als Zeuge aufgerufen. Aber wenn
die Staatsanwaltschaft gar nicht so tief bohren muss oder -
besser noch - William sich für schuldig erklärt, muss niemand
erfahren, dass der Autor von Der Sandmann einmal in einem
Schreibkurs mit dem echten Sandmann war. Noch habe ich
eine Chance. Wenn man Tim davon abhalten kann, den Pa-
trick-Rush-Aspekt der Geschichte weiterzuverfolgen.
»Wie gefällt dir dein neues Haus?«, frage ich ihn, als die
erste Runde gebracht wird.
»Es ist eine Investition. Außerdem denke ich daran, in ab-
sehbarer Zeit eine Familie zu gründen.«
»Hör auf. Das schafft mich.«
»Ich muss nur noch jemanden kennenlernen.«

»Hast du nicht schon genug kennengelernt?«
»Sie ist irgendwo da draußen. Genau wie deine Angela.«
Ich nicke und versuche, in Tims Miene zu lesen, ob er et-
was über Angelas Verschwinden weiß, das ich nicht weiß.
»Muss seltsam sein«, sinniert Tim. »So dicht an der ganzen
William-Feld-Geschichte dran zu sein.«
»Ich war nicht so nah dran.«
»Dein Buch hätte die Biografie des Typen sein können.«
»Das ist übertrieben.«
»Und dann der Titel. Schon schwer zu glauben, dass das
alles Zufall war.«
»Die Polizei fand es nicht so schwer.«
»Haben sie mit dir geredet?«
»Ein Detective ist vorbeigekommen und hat mir ein paar
Fragen gestellt.«
»Ramsey.«
»Ja, ich glaube, so hieß er.«
»Und was hast du ihm erzählt?«
»Was ich dir auch erzähle. Es ist ein Roman. Es ist alles
erfunden. Ich bin bloß froh, dass es vorbei ist.«
Tim verschluckt sich an dem Bier, das er aus der Flasche
getrunken hat. »Vorbei? Für mich nicht. Das ist meine Ge-
schichte. Ich werde für die kommenden Monate über Mr.
Felds Prozess berichten. Und das könnte verdammt zäh wer-
den, wenn ich nicht durch eine Seitentür rankomme.«
Er hat die Hände flach auf den Tresen gelegt und sieht mir
in die Augen.
»Ich wünschte, ich könnte dir helfen«, sage ich und rülpse,
was ihn ein paar Zentimeter zurückweichen lässt. »Aber ich
weiß absolut nichts über William Feld, was nicht jeder, der
deinen Artikel in der Zeitung von heute gelesen hat, auch
weiß.«

Ich werde nie erfahren, ob Tim mir glaubt oder nicht. Doch
sei es, weil er denkt, ich hätte die Wahrheit gesagt, oder weil
er mir einen letzten Freundschaftsdienst erweisen will, er lässt
mich vom Haken.
»Arbeitest du an was Neuem?«
»Ich hatte gedacht, dass ich vielleicht zum Journalismus
zurückkehre. Ich wäre auch bereit, etwas Neues zu probieren.
Horoskope, Kleinanzeigen, Kreuzworträtsel«, sage ich.
»Meinst du, die Chefredakteurin würde mich wieder einstel-
len?«
O ja. Darüber müssen wir beide herzlich lachen.
Am nächsten Morgen fahre ich nach St. Catharines. Ich habe
alle möglichen Geschenke bei mir (einen Plasmafernseher für
Stacey und ihren Mann, iPods und ein Tolkien-Sammler-Set
für die Kinder), aber mit Absicht nichts für Sam. Unser
gegenseitiges Geschenk ist die Wiedervereinigung an sich.
Sam darf entscheiden, wie wir den Rest des Sommers ver-
bringen. Wir werden uns in unserem Tempo und ausschließ-
lich nach unseren eigenen Regeln wieder zurückarbeiten zu
dem, was wir waren.
Auf der Rückfahrt spiele ich bewusst herunter, wie schwie-
rig die letzten Wochen ohne ihn waren. Und gut eine Stunde
lang unterhält er mich mit Anekdoten darüber, wie doof seine
Cousins sind und wie gut er schwimmen gelernt hat. Auch er
gibt sich Mühe, es mir leichter zu machen.
Irgendwo in der Gegend von Oakville, als vor dem Fenster
niedrige Bürogebäude und Steakhouse-Ketten-Filialen vor-
beifliegen, entscheidet Sam, dass er es mir jetzt zumuten
kann, zur Sache zu kommen.
»Du musst es mir erzählen, Dad.«
»Ich weiß.«
»Es muss auch nicht jetzt sein.«

»Okay.«
»Aber irgendwann.«
»Das bin ich dir schuldig.«
»Es geht nicht um schuldig.«
Sam wendet sich mir zu, und es ist kein achtjähriger Junge,
der mich ansieht, sondern ein junger Mann, der überrascht ist,
dass sein Vater nicht erkennen kann, was doch offensichtlich
sein sollte.
»Wenn du es mir nicht erzählst, bist du der Einzige, der es
weiß«, sagt er.
Der August glänzt mit eitel Sonnenschein und einer verlässli-
chen allnachmittäglichen Brise vom See. Der leichte Wind
vertreibt den Smog nach Norden und befreit die Stadt von
dem orangen Dunst, der im Juli in der Luft gehangen hatte.
Sam und ich nutzen das gute Wetter und machen lange Spa-
ziergänge, gehen in T-Shirts und Flip-Flops Mittag essen,
radeln auf den Wanderwegen in Don Valley und streichen in
der Galerie mit den Händen über Skulpturen von Henry Moo-
re, wenn die Wachmänner nicht hingucken. Wir unternehmen
bücherlastige Picknicks in Trinity-Bellwoods und verschlin-
gen im Schatten Robinson Crusoe(Sam) und Abbitte (ich).
Aber selbst diese glücklichen Tage sind nicht frei von
Geistern. Ein Anruf kurz vor Mitternacht, der klingt, als käme
er aus einer Kneipe.
»Patrick?«
»Wer ist da?«
»Ich bin’s, Len.«
»Wo bist du?«
»Im Fukhouse?«
»Warum?«
»Ich weiß nicht genau. Ich nehme an, es hat irgendwie eine
sentimentale Bedeutung für mich.«
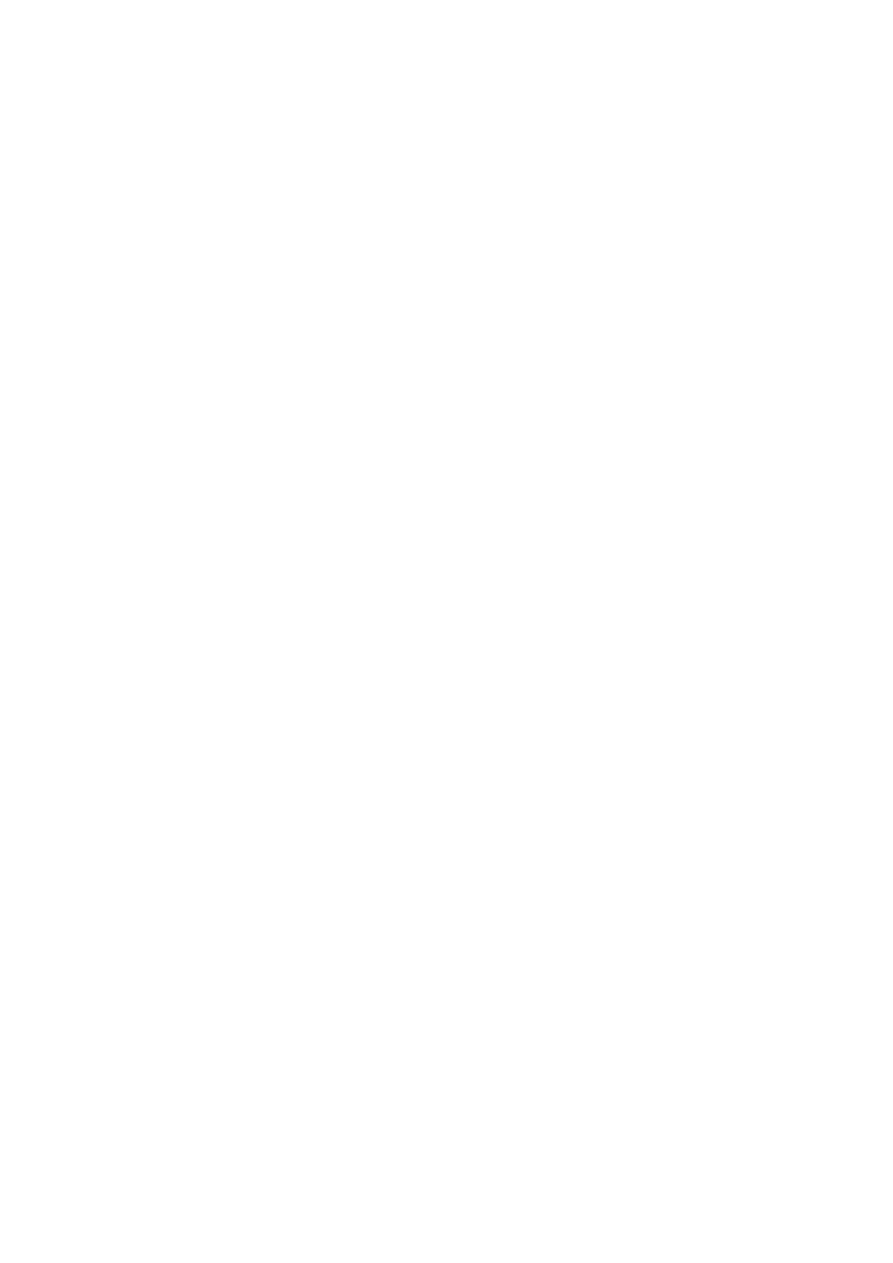
»Das hört sich vielleicht blöd an, aber ich muss dich das
fragen«, sage ich und kneife die Augen zu, bevor ich die
Nachttischlampe anmache. »Du bist nicht tot, oder?«
»Nein«, antwortet Len nach kurzem Nachdenken. »Ich
glaube nicht.«
»Wo bist du gewesen?«
»Ich hab einfach irgendwie alles hinter mir gelassen und
bin rumgezogen, hab ein Zimmer nach dem anderen ange-
mietet. Eine Zeit lang war es ziemlich verdreht.«
»Allerdings.«
»Aber jetzt haben sie ihn.«
»Ja, jetzt haben sie ihn.«
Er seufzt in den Hörer, ein feuchtes Pfeifen, das mir verrät,
dass Len sich, ehe ich es gerade für ihn bestätigt habe, nicht
ganz sicher war, ob es vorbei ist oder nicht.
»Weißt du, was komisch ist?«, fährt er fort. »Ich wollte
gerade sagen, dann kann ich ja jetzt nach Hause gehen, aber
ich habe keine Ahnung, wo das ist. Mein alter Vermieter hat
all meine Bücher und Comics weggeschmissen.«
»Du kannst immer wieder von vorn anfangen.«
»Was?«
»Mit Sammeln.«
»Ja. Klar.«
Im Hintergrund klirren Scherben, als hätte jemand ein
Schnapsglas gegen die Wand geworfen.
»Schwer was los da heute Abend?«
»Es ist okay«, sagt Len nervös. »Hey, machst du gerade
irgendwas?«
»Ich wollte eigentlich gerade ins Bett gehen.«
»Ist es schon so spät? Ich wollte dich fragen, ob du Lust
hast herzukommen. Um zu feiern.«
»Heute Abend nicht.«
»Ein anderes Mal.«
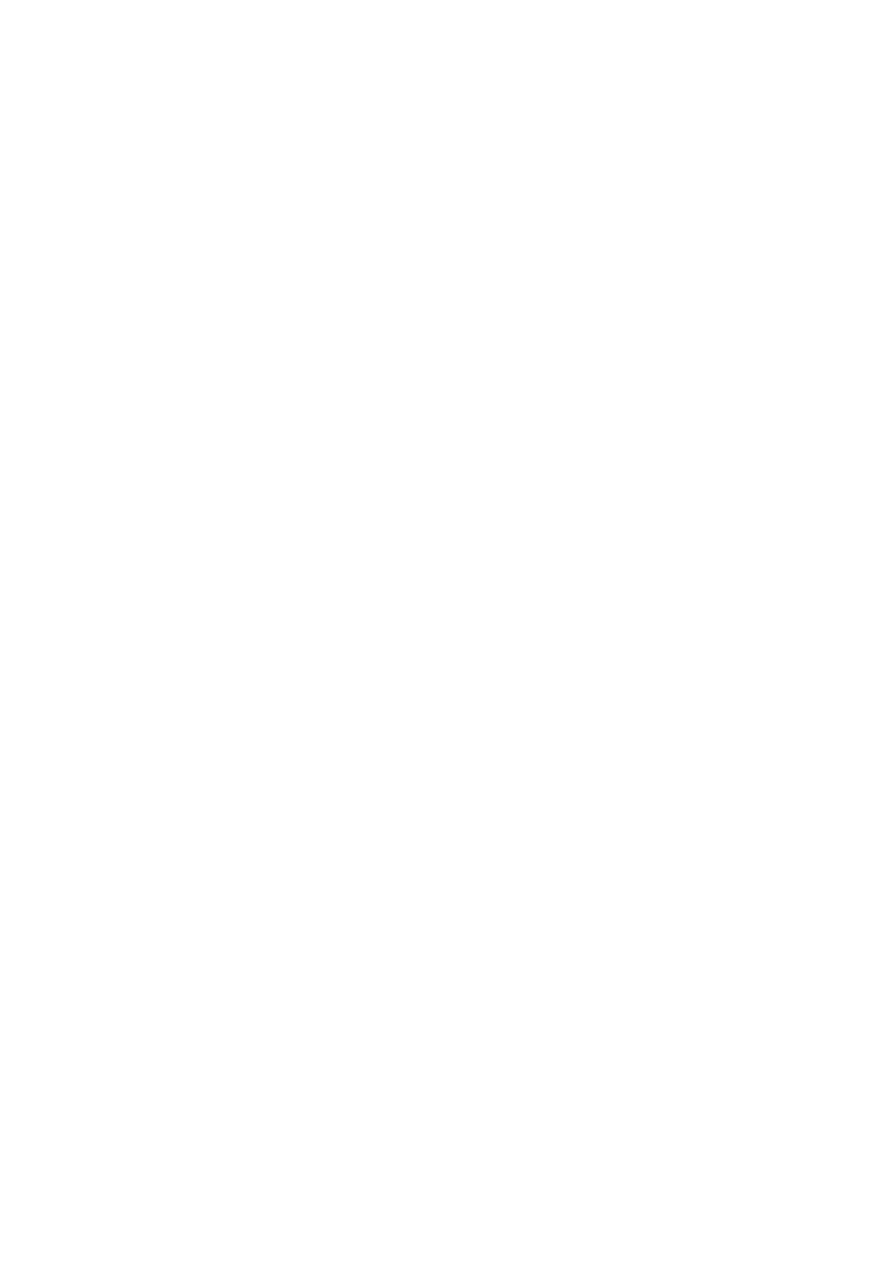
Das scheint es in etwa gewesen zu sein. Aber Len bleibt
noch dran, und die Einsamkeit kriecht durch die Leitung wie
ein unsichtbares Gewicht.
»Ich nehme an, wir sind die Einzigen, die noch leben«, sagt
er schließlich.
»Was ist mit Angela?«
»Du glaubst, sie könnte noch am Leben sein?«
»Nein.«
»Ich auch nicht.«
»Na, dann auf uns, Len. Auf die Lebenden.«
»Auf die Lebenden«, wiederholt er und klingt, als wäre er
nicht ganz sicher, wer das sein könnte.
Das andere Phantom, das mir im August begegnet, ist eben-
falls nicht tot, könnte es aber genauso gut sein.
Ich sehe ihn eines Nachmittags auf dem Heimweg vom
Laden an der Ecke, Sam packt mit einer Hand meinen Dau-
men und schiebt mit der anderen ein Eis am Stiel in den
Mund. Vater und Sohn, die sich im Sommer auf einer Straße
im Viertel an der Hand fassen, frei und unbeschwert.
Wir kommen an dem punkigen Frisörsalon an der Ecke
vorbei - der Laden, wo einst Ronald Pevencey geschnitten
und gefärbt hat -, als etwa zwanzig Meter vor uns ein
schwarzer Van am Straßenrand hält. Obwohl auf diesem Ab-
schnitt der Queen Street den ganzen Tag Lieferwagen stop-
pen, erregt irgendetwas an diesem Wagen meine Aufmerk-
samkeit. Nicht irgendein Detail, sondern der vollständige
Mangel an Details: kein Firmenname auf den Türen, keine
Aufkleber, kein hinteres Nummernschild. Selbst der schwarze
Lack ist so alt, dass sein Glanz zum matten Grau einer Tafel
verblichen ist.
Als der Van nur noch wenige Schritte entfernt ist, werde
ich langsamer. Weder Fahrer- noch Beifahrertür sind geöffnet

worden, und die Außenspiegel sind in einem Winkel ausge-
richtet, der es mir unmöglich macht zu erkennen, wer vorne
drinsitzt. Aber es ist das Heck des Wagens, das irgendwie
bedrohlich wirkt. Die beiden Fenster sind staubblind und mit
Streifen von etwas anderem überzogen. Getrocknete
Schmierspuren vom oberen bis zum unteren Rand der Schei-
be. Regen. Oder Lösungsmittel, das von Arbeitshandschuhen
gewischt wurde. Oder nackte Hände, die bei dem Versuch,
das Glas aufzukratzen, aufgeplatzt sind.
»Warum bleiben wir stehen, Dad?«
Ich überlege, was ich antworten soll - Es ist ein so schöner
Tag, und ich hab mir gedacht, lass uns kehrtmachen und
einen Umweg nach Hause nehmen-, als ich ihn sehe. William,
der sein Gesicht an die Heckscheibe des Vans presst.
Ich ziehe Sam an mich. Sein Eis am Stiel fällt auf den
Bürgersteig.
Niemand sieht William außer mir.
Und selbst ich kann William nicht sehen. Er sitzt irgendwo
in einer Einzelzelle und wartet auf sein Urteil. Weil es keinen
Prozess geben wird. Jetzt nicht mehr. Nicht, nachdem er sich
erst vor wenigen Tagen schuldig bekannt und eingewilligt hat,
ein schriftliches Geständnis zu unterschreiben. Nun bleibt nur
noch festzulegen, wie viele Male lebenslänglich er absitzen
muss.
Deshalb ist es nicht William, der die Zunge an die Scheibe
drückt und den Mund zu einem stummen Schrei aufgerissen
hat. Aber ich weiche trotzdem taumelnd zurück, bis ich gegen
die Schaufensterscheibe des Frisörsalons pralle.
Was mir an dem Van Angst macht, ist nicht William, son-
dern der Gedanke an das Grauen, das darin stattgefunden hat.
Dinge, die selbst William erschrecken würden. Und sein Ge-
sicht zeigt es. Nie zuvor hat es - hinter dem Vollbart verbor-
gen und mit seinen harten dunklen Augen - etwas anderes als

eine verhüllte Drohung ausgedrückt, doch jetzt ist es von pa-
nischer Furcht verzerrt.
Der Auspuff des Vans stößt eine Abgaswolke aus. Als sie
sich verzogen hat, ist William nicht mehr da. Aber der kreis-
runde Fleck, den seine Zunge auf der Scheibe hinterlassen hat,
ist noch da und war es von Anfang an.
Mit einem Ruck fädelt sich der Wagen wieder in den flie-
ßenden Verkehr ein. Einen halben Block weiter biegt er ab
und ist verschwunden.
Sam schiebt die klebrigen Reste seines geschmolzenen Ei-
ses mit den Schuhen an die Häuserwand und nimmt meine
Hand, um mich nach Hause zu führen. Er fragt nicht, was ich
glaube, gesehen zu haben. Das muss er auch nicht. Es ist wie
bei dem Mann, der sich im Kleiderschrank im Schlafzimmer
versteckt. Man muss sich nur weiterhin an die Dinge halten,
die real sind, dann kann er einem nichts tun.

29
Der Sommer endet mit einer Folge perfekter Tage, als wollte
er sich für seine vorherigen Zumutungen entschuldigen. Eine
Woche mit blauem Himmel und Abenden mit frischer Luft
mit einem Hauch von Grillaroma. Nicht nur die besonders
heimgesuchten Rushs, sondern alle, die grinsend durch die
Straßen der Stadt schlendern, sehen die Welt in einem neuen
Licht, das die Probleme lösbarer erscheinen lässt. Alle wün-
schen sich, es würde für immer so weitergehen.
Und dann ist plötzlich das Labor-Day-Wochenende da,
gleich Anfang September. Über Nacht hat sich eine herbstli-
che Kühle in die Luft geschlichen, und die Blätter tauschen
die Hälfte ihres Grüns gegen Gold. Jetzt oder nie, sagt uns der
kreidige Geschmack von Schulanfang. Wenn du den Sommer
ein letztes Mal genießen willst, dann jetzt.
So entscheiden Sam und ich, zu der Kino-Nacht im Mus-
tang Drive-in zu fahren. Die letzte Vorstellung des Jahres in
einem Autokino, zu dem Tamara und ich immer gefahren
sind, eine Flasche Weißwein unter dem Sitz versteckt, um
rumzuknutschen wie die Teenager. Für Sam ist die Attraktion,
was er trotz meiner wiederholten Korrektur »Dads Film«
nennt.
»Norden«, sagt Sam, die Nase an die Scheibe gepresst, als
ich von der Zufahrtsstraße abbiege und mich in die Schlange
vor der Kasse einreihe.
Ich wusste nicht, dass mein Sohn anhand der Sterne die
Himmelsrichtung bestimmen kann.

»Guck mal«, sage ich und zeige auf die Rückseite der
Leinwand auf dem Hügel. Eine Leuchtreklame mit einem
Cowboy auf einem bockenden Bronco vor dem Hintergrund
von Maisfeldern. Darüber der Titel des Hauptfilms des
Abends.
»Der Sandmann«, liest Sam laut.
Ich habe ihn schon gesehen. Sam ist vielleicht noch nicht
alt genug für bestimmte Aspekte der »für Jugendliche unge-
eigneten« Thematik (so die Meinung der Freiwilligen Selbst-
kontrolle, deren Altersempfehlung pingelig vor »Gewaltdar-
stellungen und Andeutungen anstößiger Sexualität« warnt).
Aber wenn der Typ am Kassenhäuschen bereit ist, uns für das
Eintrittsgeld für zwei Erwachsene reinzulassen, steht uns
nichts mehr im Wege.
Wir parken an der Seite, vor der Snackbar, packen die
Klappstühle aus dem Kofferraum des Toyotas und legen uns
gegen die Kälte einen Schlafsack über die Beine.
Obwohl Der Sandmann auf meinem Roman basiert, be-
schränkt sich meine Beteiligung an der Produktion auf die
schuldbewusste Entgegennahme eines Schecks. Ich war zur
Premiere in Los Angeles vor ein paar Wochen eingeladen,
habe jedoch abgelehnt. Die PR-Leute des Studios riefen an,
um mich umzustimmen, weil man meine Nichtteilnahme als
»Ausdruck kreativer Bedenken gegenüber dem Projekt«
missverstehen könne. Ich versicherte ihnen, dass ich über
keinerlei Kreativität verfüge, aufgrund derer ich Bedenken
haben könne. Im Gegenzug zu meiner Versicherung, mich
öffentlich nicht zu äußern, schickten sie mir Champagner und
eine Vorab-Kopie auf DVD.
Neulich habe ich sie eingeworfen, den Schampus entkorkt,
mich für die nächsten eineinhalb Stunden in die Krypta ge-
setzt und direkt aus der Flasche getrunken. Er war nicht
schlecht. Der Champagner, meine ich. Der Film selbst hat

etwas absolut Packendes, was vor allem an dem hektischen
Schnitt und dem Techno-Soundtrack liegt, die die Stadt, in der
der Film gedreht wurde (Toronto übrigens, aber ein Toronto,
das aussehen soll wie New York), wie high auf Meth wirken
lassen.
Was seltsam an dem Film ist und mich auch ein wenig da-
ran stört, ist nicht seine wie auch immer geartete Qualität,
sondern dass er so anders ist als die Wirklichkeit. Anders als
Angela. Ihre Stimme. Das fehlt in der Hollywood-Version
vollständig, obwohl das nicht die Schuld der Drehbuchauto-
ren, Schauspieler und Produzenten ist. Wie hätten sie wissen
können, wie es war, in Conrad Whites von Kerzen erleuchte-
ter Wohnung zu sitzen und zuzuhören, wie Angela aus den am
Rand mit Kritzeleien verzierten Seiten ihres Tagebuchs vor-
las? Und hätte es etwas geändert, selbst wenn sie dabei gewe-
sen wären? Ein Film erzählt eine Geschichte, aber seine Welt
ist statisch. Jede Kulisse, jede Geste und jedes Bild sind sorg-
fältig festgelegt, die Erzählung hermetisch abgeriegelt. Bei
einem Film kann man nicht erschaffen, was man in sich sieht.
Aber genau das hat Angelas Stimme getan. Sie hat einen nach
innen eingeladen.
»Es fängt an!«, verkündet Sam, als das Flutlicht ausgeht.
Und den Rest kennen Sie.
Sie wissen, womit all das begonnen hat. Die Geschichte
des Mannes, der im Autokino seinen Sohn verloren hat.
»Verloren«, sage ich, weil die Polizei und die Zeitungen es so
nannten, als wäre Sam eine fallen gelassene Brieftasche. Me-
dienberichte weisen jedes Mal ausdrücklich darauf hin, dass
man am Ort des Geschehens keinerlei Spuren für ein Verbre-
chen gefunden habe. Ich weiß nicht, ob das die allgemeine
Sprachregelung ist oder ob sie meiner Schilderung, wie ich
einen Schatten durch ein Maisfeld gejagt habe, keinen Glau-
ben schenken.

Wie dieser Labor Day für mich ausgeht, wissen Sie schon.
Aber wenn man in der Mitte anfängt, muss man gewisse As-
pekte auslassen, Bedeutungsnuancen, die beim ersten Mal
keinen Sinn ergeben hätten. Etwa, wie verstörend es für mich
war, Der Sandmann auf einer riesigen Leinwand unter nächt-
lichen Sternen zu sehen. Wie irgendetwas an der überdimen-
sionierten Handlung versuchte, mir zu sagen: Nimm deinen
Sohn und geh. Wie man versuchte, mich zu warnen.
Wovon redest du?
Das Wesen, das unter deinem Bett haust. Die Augen, die
dich nachts aus dem Kleiderschrank beobachten. Die Dun-
kelheit. Das, wovor du dich am meisten fürchtest …
Ich kann jeweils immer nur für ein paar Sekunden zur
Leinwand schauen. Die Schauspieler richten ihre Sätze direkt
an mich, ihre Gesichter blicken mit den klassischen Masken
von »Angst«, »Entschlossenheit« oder »Sorge« auf mich he-
rab. Ich habe mich geirrt. Filme sind keine starre Welt. Diese
Figuren, die Handlung auf dieser Leinwand - alles drängt hi-
naus.
»Willst du irgendwas?«, frage ich Sam. »Kartoffelkroket-
ten?«
Und er fasst meine Hand und lässt sie erst wieder los, als
der Mann an der Kasse zu lange braucht.
Dann laufe ich zwischen den Reihen geparkter Wagen und
versuche, mir einzureden, dass das, von dem ich weiß, dass es
passiert, nicht passiert. Aber es funktioniert nicht. Denn der
Sandmann ist hier. Nicht William, der meilenweit entfernt in
einer Zelle sitzt. Nicht Ramsey. Nicht Len oder Conrad Whi-
te. Auch nicht Raymond Mull.
Es ist der Sandmann, der in das Maisfeld rennt und sich
kurz sehen lässt, damit ich ihm folgen kann. Genau das wollte
er. Es gab ihm die Zeit, die er zum Verschwinden brauchte,
indem er dafür sorgte, dass ich in die entgegengesetzte Rich-

tung lief, während Sam im Kofferraum eines Wagens in einer
der hinteren Reihen versteckt wurde. Oder vielleicht war Sam
sogar die ganze Zeit in dem Auto neben meinem.
Ich habe den Sandmann gejagt. Aber der hatte Sam gar
nicht.
Als ich das verlassene Farmhaus am anderen Ende des
Feldes erreicht habe, ist es vorbei. Ich kann bloß dastehen und
von Weitem auf die Leinwand starren.
Der schreckliche Mann, der schreckliche Dinge tut, ist
nicht William. Es ist nicht einmal ein Mann. Es ist ein Mäd-
chen. Das Mädchen, dessen Gesicht jetzt von der Leinwand
des Autokinos auf mich herabblickt, das in Conrad Whites
Wohnung aus ihrem Tagebuch vorgelesen hat, dem mehrere
erfrorene Zehen fehlen. Ein Mädchen, das erwachsen gewor-
den ist und verschiedene Namen angenommen hat. Verschie-
dene Leben gestohlen hat.
Mein Fehler war es, zu glauben, dass der Böse in meiner
Geschichte derselbe war wie in ihrer. Aber das Monster, das
mir das Einzige geraubt hat, was mir noch geblieben war, ist
nicht der Sandmann. Es ist seine Schöpferin.

VIERTER TEIL
Der schreckliche Mann,
der schreckliche Dinge tut

30
Natürlich wird eine Suche eingeleitet. Ein Vater verliert im
Kino seinen Sohn in der Zeit, als er kurz weg ist, um Hotdogs
und Zwiebelringe zu kaufen - das ist der Traum jedes Ferien-
wochenend-Nachrichtenredakteurs. Am frühen Morgen jenes
Sonntags - noch bevor nach der abgebrochenen Filmnacht die
Dämmerung anbricht - weckt ein Fernsehsender einen »Ver-
missten-Experten« und nimmt ein Interview auf, in dem wir
daran erinnert werden, dass »in einem Fall wie diesem die
ersten vierundzwanzig Stunden von entscheidender Bedeu-
tung sind«. Selbst die leitenden Polizeibeamten hinter den
Mikrofonen der ersten Pressekonferenz des Tages sind nicht
immun gegen den Nervenkitzel eines Rennens gegen die Zeit,
vor allem wenn es um ein Kind geht. Es ist wie im Fernsehen.
Es ist im Fernsehen.
Dort sitzt der Chief der Ontario Provincial Police, starrt
direkt in die Kameras und gelobt, alle verfügbaren Kräfte
einzusetzen, um den »kleinen Sam« zu finden, und bis dahin
»wird keiner von uns schlafen, das kann ich Ihnen versi-
chern«. Es gibt Aufnahmen von Freiwilligen aus der Gegend,
die durch die Felder um das Autokino stapfen und nach Spu-
ren oder Leichenteilen suchen. Und da ist der Vater, die Haut
fleckig und schwammig wie Haferschleim, der roboterhaft um
die sichere Rückkehr seines Sohnes fleht. So, denkt sich die
Leserschaft der Couchkartoffel, sieht also ein Schriftsteller
aus.

Er sieht verdächtig aus. Selbst für mich. Eine wenig über-
zeugende Vorspiegelung elterlicher Sorge - nicht genug Pa-
nik, die Stimme leer, als hätte er schon zu trauern begonnen.
In der Krypta betrachte ich ungläubig eine Endlosschleife
meiner selbst auf allen Nachrichtensendern. So fühle ich mich
nicht. Das bin ich überhaupt nicht. Hier, der Bursche, der in
seine Hände schluchzt, ein Whiskeyglas gegen die getäfelte
Wand wirft, um zu verhindern, dass er etwas hineingießt, und
sich eine Minute später an den Scherben die Füße schneidet,
als er aufsteht, um zum fünften Mal in dieser Stunde bei der
Polizei nachzufragen, das ist Ihr Mann.
Offenbar denkt die Polizei das auch. Sie kommen noch
einmal vorbei, »um Details durchzugehen«, und obwohl sie
mir erneut die Dienste eines »Familien-Krisen-Beraters« an-
bieten, spüre ich, wie ihr anfängliches Mitgefühl auszutrock-
nen beginnt. Sie stellen immer weniger Fragen über die Ge-
stalt, die ich in den hinteren Reihen des Autokinos gesehen
habe, und immer mehr Fragen über meinen emotionalen Zu-
stand in den vergangenen Jahren. Erst der Krebstod meiner
Frau. Dann die schmutzige Geschichte der Wil-
liam-Feld-Morde, bei der die Polizei, wie es einer der Ermitt-
ler ausdrückte, mich »ziemlich weit oben auf der Liste für die
ganze Chose« hatte. Und all die anderen seltsamen Verbin-
dungen: Mein Sohn wird bei einer Vorführung eines Films
entführt, der auf meinem Buch basiert, in dem eine schatten-
hafte Gestalt das Leben von Kindern raubt. »Ich meine, so
was kann man nicht schreiben«, erklärt mir ein anderer Poli-
zist. »Andererseits haben Sie’s ja getan.«
Am Sonntagabend schlagen sie mir vor, einen Anwalt an-
zurufen. Als ich erkläre, dass das nicht notwendig sei, sehen
sie mich an, als wäre das genau das, was ein schuldiger
Dreckskerl sagen würde. Dort draußen in der Nacht ist die
Suche nach meinem Sohn noch in vollem Gange, aber hier im
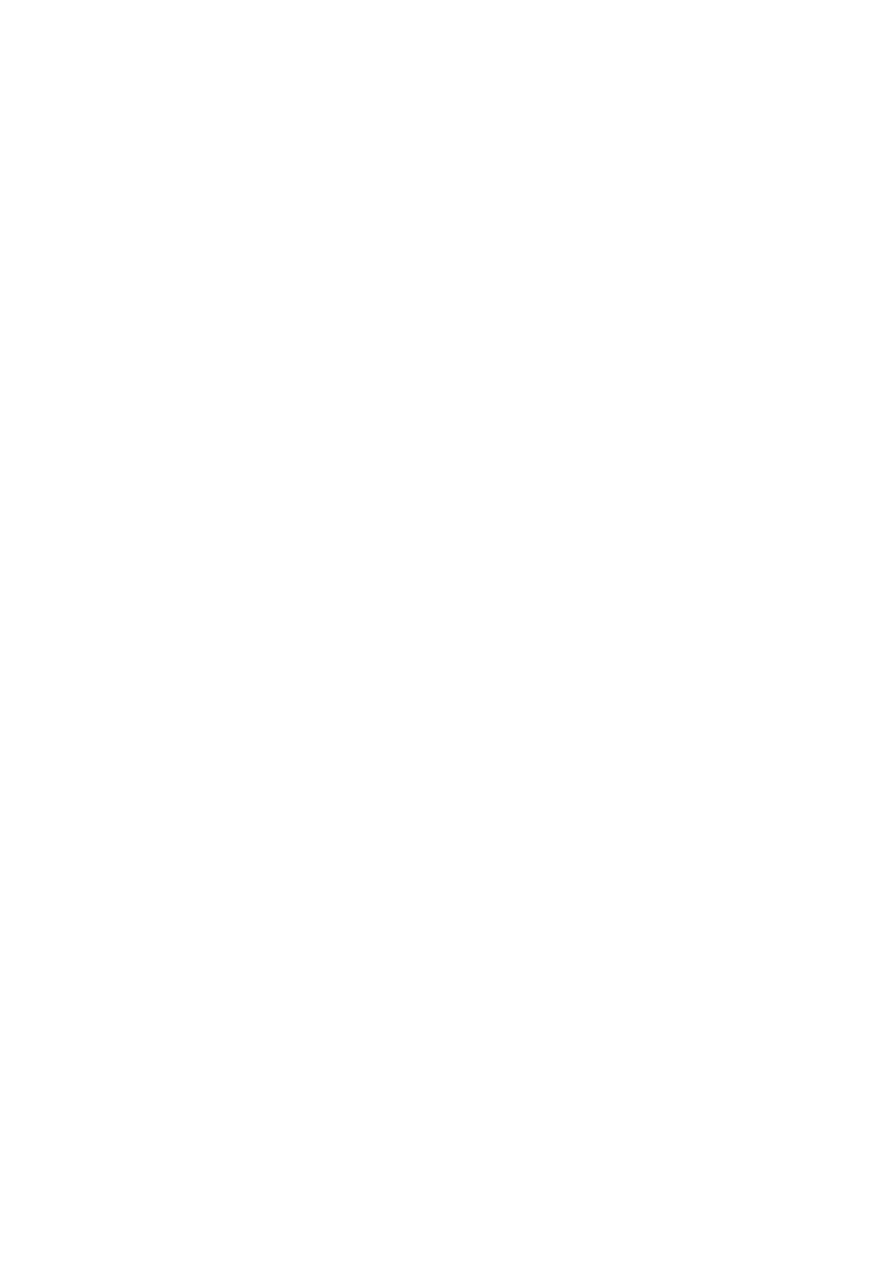
Haus des Vaters in der Euclid Street haben sie bereits den
Mann gefunden, nach dem sie suchen, und müssen jetzt nur
darauf warten, dass er zusammenbricht. Das tun Typen wie
ich immer irgendwann.
Mit meiner Erlaubnis hören sie alle meine Telefongesprä-
che mit. Für den Fall, dass eine Lösegeldforderung eingeht,
heißt es, aber ich erkenne, dass es wahrscheinlich eher um das
Sammeln von Beweismaterial geht. Eine Nachricht von einem
Komplizen. Ein mitternächtliches Geständnis.
Und ich kann es ihnen nicht verdenken. In solchen Fällen
sind die Eltern immer die Hauptverdächtigen. Statistisch ge-
sehen sind Schatten bloß Schatten. Gefahr geht in der Regel
von denen aus, die man am besten kennt.
Aber es gibt immer Ausnahmen. Es gibt immer einen
Sandmann. Und wenn er zuschlägt, darf man nicht überrascht
sein, wenn man der Einzige ist, der glaubt, dass er es war.
In den ersten vierundzwanzig Stunden bleibt keine Zeit zu
leiden. Ich gebe dieselben Antworten auf die immer gleichen
Fragen, führe vollkommen Fremde im Haus herum und zeige
ihnen, wo alles ist. Und da ist außerdem eine nette Frau, die
mir vor der Pressekonferenz den Kragen richtet und die
Zahnpasta aus den Mundwinkeln wischt.
Am Ende machen diese Ablenkungen jedoch alles nur
noch schlimmer. In meinem Fall passiert das am zweiten Tag,
nachdem ich noch benommen von den Tabletten aufwache
und - ein Bein in der Hose, das andere nicht - unter der Last
der Fakten auf dem Boden des Schlafzimmers zusammenbre-
che. Die Wahrheit traf ihn wie ein Schlag. Mir war nie klar,
wie wörtlich man dieses Klischee nehmen kann. Die Wahrheit
schickt mich flach auf die Holzdielen, wo ich die Wollmäuse
unter dem Bett betrachte und mit beiden Händen meinen Hin-
terkopf nach Blut abtaste.

Sam ist verschwunden.
Sie werden ihn nicht finden.
Ich bin der Einzige, der eine Chance hat, ihn zurückzuho-
len.
Ich bin mir keineswegs sicher, dass ich es ohne diesen
letzten Gedanken geschafft hätte, mich zu Ende anzukleiden,
was gut ist, denn zunächst muss ich mich mit der Presse aus-
einandersetzen. Ein verstohlener Blick durch die Vorhänge
zeigt mehrere Fernsehübertragungswagen, vor denen mit
Haarspray gestylte Korrespondenten ernste Mienen üben, so-
wie einen Haufen übernächtigter Reporter diverser Zeitungen,
die sich gegenseitig schmutzige Witze erzählen und Zigaret-
tenkippen in den Vorgarten der Nachbarn schnippen. Wenn
das Leben weitergehen soll - oder auch nur die brüchige Si-
mulation eines Lebens, die mir übrig bleibt -, muss ich sie so
weit zufriedenstellen, dass sie mich bis zu ihrer nächsten
Deadline in Ruhe lassen.
Ich entscheide, dass ich am besten ein Exklusiv-Interview
gebe, und es ist ein Reflex, der mich veranlasst, dafür den
National Star auszuwählen. Und wen führt der Mitarbeiter der
Polizeipressestelle herein? Den Jungen aus Swift Current.
»Jetzt sind Sie also bei den richtigen Nachrichten gelan-
det?«, frage ich ihn, und trotz seiner störrisch verbissenen
Miene erlaubt er sich ein Lächeln darüber, dass ich ihn wie-
dererkannt habe.
»Die schönen Künste haben keine Zukunft.«
»Da haben Sie recht.«
»Stellen Sie sich vor: Ich bin befördert worden.«
»Die Chefredakteurin weiß Talent zu erkennen.«
»Das alles ist bestimmt sehr schwer für Sie«, beginnt er. So
fangen sie alle an. Die Polizisten, die Psychologen, die Kar-
tengrüße, die Schreiberlinge. Gott sei Dank für das Fernsehen.

Ich antworte mit einem eigenen fernsehtauglichen Text
darüber, dass man optimistisch bleiben müsse, und bitte jeden,
der etwas über meinen Sohn weiß, sich zu melden. Der Junge
aus Swift Current stellt die unvermeidliche Anschlussfrage.
»Was denken Sie über die Koinzidenz mit Ihrem Roman?«
»Das hat nichts miteinander zu tun.«
»Aber ist es nicht verblüffend, dass -«
»Wir sind fertig.«
»Verzeihung?«
Ich strecke die Hand aus und stoppe sein Aufnahmegerät.
»Das Interview ist beendet. Und erinnern Sie die Geier vor
der Tür daran, dass Sie der Einzige sind, der heute ein Aas
erwischt.«
Es funktioniert. Einige Stunden später sind die Übertra-
gungswagen samt der aufgeregten Journalisten abgezogen, die
jetzt den National Star zitieren müssen, wenn sie einen
Kommentar von Patrick Rush haben wollen. Sogar die Polizei
hat meine Bitte um ein wenig Privatsphäre respektiert. Sie
schicken einen Sozialarbeiter vorbei, der mit mir Wache hält
für den Fall, dass Sam plötzlich zur Tür hereinspaziert. Das
gibt mir Gelegenheit, das Haus zu verlassen.
Ich laufe zur Dundas Street und weiter in östlicher Rich-
tung durch die sich immer weiter erstreckenden Ausläufer von
Chinatown. Ehe ich ahne, wohin ich gehe, stehe ich vor dem
Fukhouse. Anarchisten. Das hat Evelyn mir an dem Abend
erklärt, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Jetzt frage
ich mich: Können Anarchisten Versammlungen abhalten und
immer noch Anarchisten sein? Andererseits, wenn nicht die
Gesetzlosen flexiblen Umgang mit den Regeln pflegen, wer
dann?
In Conrad Whites alter Wohnung geht ein Licht an. Hinter
den dünnen Vorhängen bewegen sich zwei Schatten, vermut-
lich bei der Verrichtung irgendeiner häuslichen Pflicht, ob-

wohl es eher wie ein Tanz scheint. Die beiden Gestalten um-
kreisen sich, fassen sich kurz an den Händen, bevor sie ei-
nander in entgegengesetzte Ecken des Zimmers wirbeln.
Die Glühbirne erlischt. Der Raum war nur so kurz erleuch-
tet, dass ich zweifle, ob die Schatten überhaupt da waren.
Noch mehr Gespenster. Evelyn und Conrad bei einem post-
humen Walzer.
Aber ich lebe noch. Und mein Sohn auch. Er muss noch
leben. Es ist sinnlos, weiter Gespenster zu sehen. Sie haben
mir nichts Neues zu sagen. Den Lebenden bleibt nur, das
Rätsel an der Stelle aufzugreifen, wo die Toten es zurückge-
lassen haben.
»Das ist also wirklich Ihre Stammkneipe«, erklärt eine Stim-
me hinter mir. Ich drehe mich um, und im Halbdunkel des
Fukhouse grinst mir Ramsey entgegen. »Ich hätte gedacht, Sie
mögen es etwas gediegener.«
»Die Getränke sind billig.«
»Sollten sie auch sein«, meint er mit einem Blick durch das
Lokal. »Darf ich Sie auf einen Drink einladen?«
»Sie dürfen mich auf zwei Drinks einladen.«
Ramsey bestellt Bourbon und Bier zum Nachspülen. Ers-
teren kippen wir sofort herunter.
»Ich habe gerade bei Ihnen zu Hause vorbeigeschaut«, sagt
er.
»Und ich war nicht da.«
»Ein kleiner Spaziergang, was?«
»Das wissen Sie doch. Sie sind mir hierher gefolgt.«
»Ich bin Polizist.« Ramsey zuckt die Achseln. »Alte Ge-
wohnheit.«
Eine Weile starren wir vor uns hin. Unsere Köpfe bewegen
sich nur ganz wenig in dem verschmierten Spiegel hinter den
Gin-, Whiskey- und Rumflaschen.

»Schreckliche Sache«, sagt Ramsey schließlich. »Das mit
Ihrem Jungen.«
Ich versuche, die Ernsthaftigkeit in seiner Stimme und dem
bedauernden Kopfschütteln zu ermessen. Scheint echt zu sein.
Andererseits wäre es nicht das erste Mal, dass ich mich in
Ramsey täusche. Vielleicht habe ich ihn nie richtig einge-
schätzt.
»Man hat mir versichert, dass Ihre besten Leute an dem
Fall arbeiten«, sage ich.
»Dann finden sie ihn bestimmt.«
»Ich habe das Gefühl, ich sollte ihnen beim Suchen hel-
fen.«
»Warum machen Sie das nicht?«
»Man hat mir gesagt, ich soll zu Hause bleiben.«
»Das stelle ich mir schwer vor, wenn Sie glauben, dass er
dort draußen ist.«
»Ich weiß es.«
»Sie wissen es?«
»Sam lebt. Und ich bin derjenige, der ihn finden wird.«
»Klingt, als hätten Sie eine Spur.«
»Wenn dem so wäre, würde ich es Ihnen erzählen?« »Sie
könnten. Wenn Sie reinen Tisch machen wollten.«
»Reinen Tisch?«
»Ein Zeichen des guten Willens. Ohne können die Leute
auf falsche Gedanken kommen.«
Er hatte mich. Einen Moment lang habe ich geglaubt,
Ramsey könnte tatsächlich Mitgefühl mit einem Vater auf-
bringen, der seinen Sohn verloren hat. Aber Ramsey ist ganz
automatisch argwöhnisch. Das gehört zu seinem Beruf.
»Ich würde Sam nie etwas antun.«
»Das sagt auch niemand.«

»Nein, gesagt hat es niemand. Aber wenn Sie mir gegen-
über nicht aufrichtig sind, warum sollte ich Ihnen gegenüber
aufrichtig sein?«
»Wie gesagt, Sie könnten reinen Tisch machen.«
»Für mich ist er rein genug.«
Ich steuere die Tür an, ein wenig unsicher auf den Beinen
von dem Bourbon und dem Adrenalinstoß, der damit einher-
geht, wenn man private Offenbarungen laut ausspricht. Aber
als Ramsey den Mund aufmacht, um mir noch etwas zum
Abschied mitzugeben, schaffe ich es trotzdem, ihm zuvorzu-
kommen.
»Sie haben Ihren Sandmann gefunden«, rufe ich und stoße
mit beiden Händen die Schwingtür auf. »Jetzt bin ich dran.«
Vielleicht beschattet Ramsey mich immer noch, aber das ist
mir egal. Ich tue nichts Verbotenes. Ich laufe nur herum und
flüstere laut Fragen vor mich hin. Fragen, die mich bei einem
langen Nachtspaziergang nach Osten aus meinem Schockzu-
stand herausführen.
Die erste lautet: Woher wusste Sams Entführer, dass wir an
jenem Abend ins Autokino fahren wollten? Soweit ich mich
erinnere, hatte ich mit niemandem darüber gesprochen. Hatte
Sam etwas gesagt? Vielleicht. Eine Spielplatz-Prahlerei, die
irgendjemand mitgehört hatte (»Ich geh mit meinem Dad
heute Abend seinen Film gucken!«), oder etwas, das er sei-
nem Freund Joseph gegenüber erwähnt hat. Aber das ist un-
wahrscheinlich, da Sam und die Kids im Park nicht zum
Tratschen neigen, alles Jungen in einem Alter, in dem die
wichtigste Kommunikationsform das Rollenspiel ist: Soldaten
mit Maschinenpistolen oder Roboter, die aus den Augenhöh-
len Laserstrahlen abfeuern.

Sehr viel naheliegender ist es, dass wir verfolgt wurden.
Von einem schwarzen Van, der ständig die Spur wechselte,
um uns auf unserem Weg aus der Stadt im Blick zu behalten.
Und warum gehe ich damit nicht zur Polizei? Ein paarmal
hätte ich ihnen beinahe von Angela erzählt, aber ich habe
mich aus rationalen und intuitiven Erwägungen zurückgehal-
ten. Rational betrachtet habe ich keinen Beweis dafür, dass sie
es war. Außerdem ist »Angela« tot. Ich muss die Entsorgung
von Petras Leiche vertuschen. Und im Augenblick bin ich der
Hauptverdächtige im Fall von Sams Verschwinden. Nach
längerem Nachdenken glaube ich, dass Angela wahrscheinlich
gegen jeden aus dem Kreis etwas in der Hand hatte, was die-
ser geheim halten wollte. Auf diese Weise konnte sie so lange
unter dem Radar hindurchfliegen.
Aber was mich wirklich davon abhält, ihren Namen zu er-
wähnen, ist ein Bauchgefühl, die Gewissheit, dass ich es nicht
tun soll. Wenn Angela - oder wer auch immer meinen Sohn in
seiner Gewalt hat - denkt, dass ich der Polizei alles erzähle,
was ich weiß, ist es vorbei. Ich kann Sam nur finden, indem
ich die Geschichte bis zum Ende verfolge.
Ehe ich michs versehe, pflückt die aufgehende Sonne
Sterne vom Himmel. Ich bin bis nach Toronto Beaches ge-
laufen und durch eine der Seitenstraßen auf den Boardwalk
gelangt. Nur ein paar frühmorgendliche Jogger sind unter-
wegs, an den Picknick-Tischen schnarchen Schläfer, die Ein-
samen und die Gehetzten wie ich. Ich ziehe die Schuhe aus.
Der Sand ist kalt unter meinen nackten Füßen, aber als ich
einen ersten ängstlichen Schritt in die Wellen mache, ist das
Wasser körperwarm, aufgeheizt von der Hitzewelle des
Sommers.
Irgendwas berührt meine Haut - eine Fliege, eine Papier-
verpackung, die von einer Böe vom Strand aufgewirbelt wur-
de -, und ich blicke nach unten und erwarte Sam an meiner

Seite. Die Tatsache, dass er weg ist, beherrscht meine Gedan-
ken, und trotzdem erlebe ich in jeder wachen Stunde des Ta-
ges mehrmals die Illusion, dass er da ist. Er ist nicht da, aber
er sollte da sein. Sollte meine Hand fassen und weiter ins
Wasser hinausgehen. Mich fragen, ob er ganz reingehen darf,
und mir sagen, dass ich keine Angst haben muss.
Der Morgen lässt die flachen Werbetafeln und Baukräne
im Westen in hässlicher Detailliertheit erstrahlen, sodass ich
den Blick wieder aufs Wasser wende. Aber der See könnte
ebenso gut auch etwas künstlich Geschaffenes sein, die Ober-
fläche hauchdünn und zerknittert wie Aluminiumfolie.
Das denke ich, als ich mich auf den Rückweg mache: Es
gibt keinen Ort, der nicht verändert, neu erfunden oder he-
rausgeputzt wurde. Orte existieren nicht mehr wie früher,
schlicht und überzeugend. Die virtuelle Realität ist die einzige
Realität, die uns geblieben ist.
Na und? Wenn ich Sam zurückbekomme, kann der Rest
der Welt seine wiederaufbereiteten Mythen und seine kunst-
vollen Imitationen behalten. Mir ist es egal, ob noch irgend-
was wirklich ist. Ich brauche bloß ihn.

31
Um Sam zu finden, muss ich Angela finden. Aber jemanden
zu finden, der gar nicht existiert, ist keine einfache Aufgabe
für einen arbeitslosen Fernsehkritiker. Was würde Tim Ear-
heart oder Ramsey an meiner Stelle tun? Mit dem anfangen,
was auf dem Tisch liegt. Das ist nicht viel. Angelas Name
(falsch), ihr Alter (plus oder minus fünf Jahre), ihr veröffent-
lichtes Werk (gestohlen aus den autobiografischen Erzählun-
gen anderer). Dann kenne ich noch ihr Aussehen (besonders
empfänglich für das Spiel von Licht und Schatten: Als sie aus
ihrem Tagebuch vorlas, war sie eine ganz andere als die, die
mir in ihrem Bett die Ohren zugehalten hat, um ihre Geräu-
sche zu dämpfen - als müsste sie mich und nicht ihre Nach-
barn vor der Ruhestörung schützen). Für jemanden, der sich
eine so entscheidende Rolle in meinem Leben angemaßt hat,
hat Angela mir erstaunlich viel genommen und praktisch
nichts von sich zurückgelassen.
Eine Spur, die mir bleibt, führt mich zu ihrem Apartment-
haus, wo ich im einundzwanzigsten Stock Teile von ihr gese-
hen und berührt habe, die rückblickend gegen die Theorie
sprechen, dass Angela nie etwas anderes war als ein Geschöpf
meiner Fantasie. Meine Bemühungen, mich an die Berührung
ihrer Haut zu erinnern, fördern nur eine Allerweltsimpression
zutage, einen verschwommenen Softporno. Die nackte Angela
kommt aus zu großer Ferne zu mir, unglaubhaft makellos und
in bläulichem Glanz.

Wenn dem so ist - wenn ich in dem, was ich für unsere
einzige gemeinsame Nacht gehalten habe, nicht mit Angela
zusammen war -, ist es vielleicht gar nicht ihre Schuld. Viel-
leicht bin ich der Psycho. Es gibt keine Angela, weil es nie
eine Angela gab. Das würde bedeuten, dass nicht sie diejenige
ist, die Sam etwas Schreckliches angetan hat. Sondern ich.
»Hey, Sie«, sagt der Mann, der mich beim letzten Mal
rausgeschmissen hat. Aber jetzt betrachtet er mich mit dem
klinischen Blick eines Arztes, der einen Patienten mustert.
»Sagen Sie es mir. Nur unter uns. Flüstern Sie es mir ins Ohr,
wenn Sie wollen.«
»Ja?«
»Was ist Ihr Problem?«
»Ich suche jemanden.«
»Sie haben ihn gefunden.«
»Nicht Sie. Einen Mieter.«
»Wenn ihm die Wohnung gehört, ist er kein Mieter.«
»Was denn?«
»Eigentümer.«
»Dann suche ich einen Eigentümer. Genauer gesagt, eine
Eigentümerin.«
»Klingeln Sie.«
»Sie ist nicht da. Oder antwortet nicht.«
»Wenn ich gewusst hätte, dass Sie es sind, hätte ich auch
nicht geantwortet.«
Er hat seine Hände von seinem Gürtel gelöst, und seine
Ruhe lässt sicher darauf schließen, dass er mich schlagen
wird. Meiner Erfahrung nach gibt es, bevor man einen Schlag
ins Gesicht bekommt, immer einen Moment, in dem man es
kommen sieht, ohne es recht zu glauben. Da kommt es, denkt
man, und dann: Nein, das würde er nicht tun. Und dann tut er
es.
»Sie hat meinen Sohn.«

Der Wachmann mustert mich über seine pockennarbigen
Wangen. »Scheidung?«
»So ähnlich.«
»Rufen Sie Ihren Anwalt an wie alle anderen auch.«
»Das ist nichts, was man per Anwalt regeln kann, wenn Sie
wissen, was ich meine.«
Offenbar weiß er das. Er lässt seine Faust wieder sinken
und fischt mit der anderen Hand nach den Schlüsseln in seiner
Hosentasche.
»Ich sag Ihnen, was in den Unterlagen steht«, sagt er und
führt mich durch die Lobby in ein kleines Büro, wo der
Weihnachtsbaum aufbewahrt wird. »Aber wenn ich Sie noch
mal hier sehe, stopfe ich Sie in den Müllschlucker.«
Ich sage ihm, er soll die Datei unter dem Namen Pam Tur-
genov aufrufen.
»Ich dachte, Sie sagten, ihr Name wäre Angela.«
»Sie lügt.«
»Das tun sie meistens.«
Er ruft die Datei mit Angelas/Pams Daten auf. Finanz-
unterlagen, die von der Immobiliengesellschaft gespeichert
wurden. Darlehens- und Kaufvertrag lauten auf den Namen
Pam Turgenov, aber das Konto weist seit einiger Zeit Rück-
stände auf. Für das Apartment 2108 wurden seit drei Monaten
keine Nebenkosten bezahlt, die Bank hat das Konto gesperrt.
»Wir haben sie auch gesucht«, sagt der Wachmann. »Aber
so, wie es aussieht, war sie schon eine ganze Weile nicht mehr
hier. Seit dem Einbruch jedenfalls nicht.«
»Dem Einbruch?«
»Die haben bloß Billigschmuck und ein paar persönliche
Sachen mitgenommen. Aber den Fernseher dagelassen.«
Persönliche Sachen. Wie Petras Yankees-Kappe. Damit sie
in mein Haus gelangen konnte.

»Ich wechsle diese Woche die Schlösser aus«, sagt der
Wachmann.
»Das spielt keine Rolle. Sie kommt nicht zurück.«
»Aber ihr ganzer Müll steht noch oben.«
»Glauben Sie mir.«
»Aber sie hat Ihr Kind.«
»Ich werde sie finden.«
Ich muss überzeugend klingen, denn der Wachmann nickt
mir soldatisch zu. »Wenn Sie sie sehen«, sagt er, als er mich
zur Tür bringt, »sagen Sie ihr, dass ich den Fernseher behal-
te.«
Von dem Apartment laufe ich direkt die Bay Street hinauf zu
den goldenen und silbernen Bürotürmen auf der anderen Seite
der Gleise. Das dauert eine Weile. Ich bin damit beschäftigt,
zu verarbeiten, was eigentlich keine Überraschung sein sollte,
mich jedoch trotzdem unvorbereitet trifft: Angela hat es nicht
nur versäumt, den Behörden zu melden, dass Evelyn hinter
dem Steuer des Wagens saß, in dem sie zusammen mit Con-
rad White gegen eine Felswand gerast ist. Sie hat den Unfall
aller Wahrscheinlichkeit nach selbst herbeigeführt. Angela hat
die beiden mit einer Spur von Brotkrumen nach Norden ge-
lockt. Mehr noch, sie muss dort gewesen sein. Um sich zu
vergewissern, dass der Job gründlich erledigt wurde. Und um
ihre und Evelyns Handtaschen auszutauschen.
So hat Angela es geschafft, durch alle Raster zu schlüpfen
und weiterzuleben. Sie hat sich verschwinden lassen und ist
eine andere geworden. Und als die Schulden sich unter Pam
Turgenovs zunehmend schlechter beleumundetem Namen
anzuhäufen begannen, ist sie wieder verschwunden.
Dieser Verdacht erhärtet sich weiter in den Büros der
Kanzlei, für die Angela angeblich als Rechtshelferin gearbei-
tet hat. Dieses Mal entscheide ich mich gleich für eine Tar-

nung - ihr sitzengelassener Liebhaber, der ich unter anderem
wohl auch bin. Damit wecke ich bei dem Mädchen am Emp-
fang genug Mitgefühl, um zu erfahren, dass eine Pam Turge-
nov in der Tat eine Weile hier gearbeitet hat, allerdings nicht
als Rechtspflegerin, sondern als Aushilfe.
»Ich habe sie eigentlich nie richtig kennengelernt«, sagt die
Empfangssekretärin traurig, als wäre das eines der Dinge, die
sie im Leben am meisten bedauert. »Sie war ständig in ir-
gendein Buch vertieft. Als wollte sie sagen: Lass mich in Ru-
he, ich bin beschäftigt.«
»Wissen Sie noch, was sie gelesen hat?«
Die Empfangssekretärin betrachtet ihre Nägel auf der Su-
che nach einer Antwort. »Wenn ich es mir recht überlege, hat
sie eigentlich gar nicht gelesen. Sie hat geschrieben.«
»Wie lange ist es her, dass sie hier aufgehört hat?«
»Schon eine Weile. Monate. Sie war wahrscheinlich nur
ein paar Wochen bei uns.«
»Wissen Sie, wohin sie danach gegangen ist? Vielleicht zu
einer anderen Firma?«
»Deswegen heißen sie Aushilfen.« Die Empfangssekretärin
zuckt die Achseln. »Sie kommen und gehen.«
Als ich ihr die Blumen schenke, die ich mitgebracht habe
(»Ist Pam heute hier? Ich wollte ihr zum Geburtstag gratulie-
ren«), werde ich mit einem errötenden Dankeschön belohnt.
»Wenn ich sie zufällig treffe, was soll ich sagen, wer sie
besucht hat?«
»Versuchen Sie es mit Conrad. Oder Len. Oder Ivan.«
Erst als die Fahrstuhltür sich schon fast wieder geschlossen
hat, hebt die Empfangssekretärin, nachdem sie alle Namen
pflichtschuldig notiert hat, fragend den Blick.
Dämmerung, dieser rosafarbene Schimmer über der Stadt.
Gelegentlich eine unvermutet schöne Nebenwirkung der

Umweltverschmutzung. Sekunden, nachdem die Sonne hinter
die Dächer gesunken ist, spürt man die Kühle. Ich wandere
ohne guten Grund in östliche Richtung. Oder aus keinem bes-
seren Grund, als dem aus dem Weg zu gehen, was mich zu
Hause erwartet: Nachrichten der Polizei, dass man noch nichts
gefunden hat. Vielleicht sogar der Junge vom National Star,
der in meinem Vorgarten campiert, in seinem Rucksack ein
Exemplar von Der Sandmann, die Seiten mit zahllosen
Post-its markiert. Da lasse ich mich lieber weiter durch die
dunkler werdenden Straßen treiben.
Aber um diese Tageszeit, im Zwielicht der Dämmerung,
sieht man Dinge.
Wie den schwarzen Van, der langsam an mir vorbeifährt,
am Steuer ein Schatten. Die Konturen des Kopfes und die
behandschuhten Hände gehören zu der Gestalt, die ich durch
die Maisfelder um das Autokino verfolgt habe.
Als ich dem Wagen hinterherlaufe - und wieder bemerke,
dass das Nummernschild entfernt worden ist -, beschleunigt
der Van und verschwindet um die nächste Ecke.
Ohne auf den Verkehr zu achten, überquere ich die Straße.
Ein Kombi kommt quietschend zum Stehen, sein Kühlergrill
streift meine Hüfte, und ich taumle gegen einen Transporter.
Doch meine Füße tragen mich weiter, bis ich den gegenüber-
liegenden Bürgersteig erreicht habe. Hinter mir höre ich Hu-
pen und wütende Rufe, aber ich biege um dieselbe Ecke, um
die der Van verschwunden ist, und mit einem Mal sind alle
Geräusche verschluckt. Wenn ein Mann in meinem Alter und
Zustand einhundert Meter gelaufen ist, hört er nur noch seinen
eigenen Atem. Und sein Herz. Sein ungeprüftes Herz.
Der Transporter ist verschwunden, aber ich renne weiter.
Und dann taucht er wieder auf.
Sein Schatten gleitet vor mir an den Mauern entlang und
biegt auf das Gelände der alten Goode-

rham-&-Worts-Destillerie ab. Lange viktorianische Mietska-
sernen aus Backstein mit Schornsteinen wie Ausrufezeichen,
eingezwängt zwischen dem Expressway und einem Neubau-
gebiet. Ein Bild wie aus dem London von Dickens.
Die Historie verlangsamt meine Schritte. Wenn man in
diesen Kopfsteinpflastergassen schneller als im normalen
Gehtempo läuft, endet das als ein Tanz auf Zehenspitzen.
Tagsüber laden offene Türen zu beiden Seiten zum Besuch
von Galerien und Cafés ein, aber jetzt ist alles geschlossen.
Ich bin ganz allein in der Fußgängerzone zusammen mit dem,
der mich hierher geführt hat.
Und da ist er. Verschwindet in einer engen Gasse, aber so
langsam, als wartete er, dass ich ihn einhole.
Zwischen zwei leer stehenden Gebäuden vor mir ist es völ-
lig dunkel, sodass ich nur das Auf und Ab seines Kopfes vor
dem blassen Backstein ausmachen kann. Und dann bleibt er
ganz stehen.
Noch ein Stückchen weiter, scheint sein geneigter Kopf zu
sagen. Du bist fast da.
Eigentlich will ich direkt auf ihn zustürzen, aber meine
Kraft reicht nicht mehr für einen Sprint. Als ich an die Stelle
komme, wo er gestanden hat, stolpere ich über etwas auf dem
Boden, schwer, aber nachgiebig. Ein Sandsack.
Das lässt ihm mehr als genug Zeit. Der schwarze Van war-
tet auf dem Parkplatz. Meine erhobenen Hände verblassen im
Schein seiner erlöschenden Bremslichter von Rot zu Rosa, als
er einen Gang einlegt und davonrollt.
Ich weiche zurück und falle beinahe ein zweites Mal über
den Sandsack. Nur dass ich diesmal die Zeit habe zu bemer-
ken, dass es gar kein Sandsack ist.
Es ist eine Leiche, mehr oder weniger. Eher weniger.
An die Wand gelehnt wie ein schlafender Betrunkener.
Ohne Beine. Ohne Arme, ohne Nase, ohne Augen. Ein in sei-

ne Teile zerlegter und auf dem Kopfsteinpflaster ausgebreite-
ter Mensch. Eine humane Anthologie.
Ich bin dankbar, dass es so dunkel ist, auch wenn ich im-
mer noch genug sehe. Und was ich nicht sehe, ergänzt meine
Fantasie in Erinnerung an die Nacht mit Petra in meinem
Schuppen.
Zeit zu verschwinden. Irgendjemand wird ihn am Morgen
entdecken. Weiter hier herumzulungern würde nichts bringen,
außer der Gefahr, gesehen zu werden.
Trotzdem verharre ich noch eine Minute an Ort und Stelle.
Weil es auf der Welt plötzlich keinen Sauerstoff mehr zu ge-
ben scheint. Und weil der Mann, der vor meinen Füßen ver-
streut liegt, einmal ein Freund war.
Wir waren die Letzten. Deshalb weiß ich, dass es Len ist,
noch bevor ich mit der Schuhspitze die Brieftasche neben der
geschlossenen Hand des Toten aufstoße und blinzelnd den
Namen auf dem Führerschein lese. Wenn man nicht wüsste,
was ich weiß, würde man das grinsende Gesicht auf dem Foto
nicht mit dieser Leiche in Verbindung bringen - sie hat keine
Identität mehr, weil alles, was diesen Menschen einmal aus-
machte, weggeschnitten wurde. Wahrscheinlich war das von
Anfang an Angelas Lektion: Wenn man einem Menschen
seine Geschichte raubt, bleibt nicht mehr übrig als Blut, Haut
und Knochen. Der Körper ist wertlos. Entscheidend ist, was er
tut. Welche Lügen und Wahrheiten er erzählt.
Am nächsten Morgen bin ich in den Nachrichten. Man ver-
wendet noch einmal meine aufgezeichnete Erklärung vom
ersten Tag nach Sams Verschwinden. Seither habe ich mich
den Kameras verweigert, womit ich mich nur noch mehr ver-
dächtig gemacht habe. Doch eine flehende Bitte um Sams
sichere Rückkehr wird die Person, von der ich jetzt weiß, dass
sie ihn hat, ohnehin nicht beeindrucken.

Ein paar der Ermittler kommen vorbei, um mich auf den
neusten Stand der diversen Suchaktionen zu bringen, aber ihre
Blicke geben ihre Zweifel offen preis. Im Namen der Gründ-
lichkeit fragen sie erneut, ob ich ihnen wirklich alles erzählt
habe. Und nachdem ich einige Details wiederholt habe, war-
ten sie darauf, dass ich weiterrede. Es ist okay, scheinen ihre
Gesichter, die schon alles gesehen haben, mir sagen zu wol-
len. Erzähl uns einfach, was du getan hast. Wir werden dich
nicht verurteilen.
Sobald die Tür hinter ihnen ins Schloss gefallen ist, fange
ich an zu packen.
Vor der Abfahrt rufe ich von einem Münztelefon um die
Ecke Tim Earheart an. Mir kommt der Gedanke, dass er der
einzige Mensch auf der Welt ist, von dem ich mich verab-
schieden sollte. Aber auch das bleibt mir verwehrt. Er ist nicht
zu Hause, sodass ich nur irgendwelchen Unsinn auf seinen
Anrufbeantworter stottern kann. Ich erinnere mich bloß noch
daran, dass ich einen lahmen Witz gemacht (»Wenn man nur
einen Namen als Kurzwahl gespeichert hat, weiß man, dass
man nicht genug unter Leute kommt.«) und ihn gebeten habe,
sich »um Sam zu kümmern, falls Sam jemanden brauchen
sollte, der sich um ihn kümmert«. Die Sorte mit erstickter
Stimme hinterlassene Nachricht, von der man sich gleich nach
dem Auflegen wünscht, sie wieder löschen zu können.
Danach mache ich ein letztes Mal zu Hause Halt und über-
lege, ob es sonst noch etwas zu regeln gibt. Ich betrachte die
Reihe von Kinderbüchern, für die Sam mittlerweile zu alt ist,
und denke: Hier haben einmal ein Vater und ein Sohn ge-
wohnt. Aber die Vergangenheitsform raubt dem Gedanken
jedes Leben. In jedem leeren Haus haben einmal Menschen
gelebt, aber deshalb erscheint es einem nicht weniger leer.

32
Whitley, Ontario, ist eins jener öden Käffer an der zweispuri-
gen Straße, die sich am Nordufer des Lake Superior entlang-
schlängelt. Heute kennt man es, wenn überhaupt, nur noch als
einen Stopp zum Tanken oder einen Ort, wo man ein feuchtes,
muffiges Motelzimmer finden kann, um einen Schneesturm
auszusitzen. Noch eine halbe Tagesfahrt weiter im Norden als
die entlegensten Ferienhäuser, liegt es in einer Landschaft, die
die meisten Menschen nur im Abstrakten lokalisieren können
- auf Landkarten oder in der Fantasie. Eine Tür, die sich zu
einem der letzten weißen Flecken auf diesem Planeten öffnet.
Die Fahrt quält die Vier-Zylinder-Maschine des Toyotas.
Nördlich von Sault Ste. Marie verliert sich der
Trans-Canada-Highway in endlosen, verschlungenen Umfah-
rungen jedes Sumpfes, Hügels und jeder kleinen Bucht, so-
dass die vierhundert Meilen bis Thunder Bay sportliches
Lenkradkurbeln und Bremsentreten erfordern. Dabei sind es
nicht die ächzenden Aufstiege, die so mühevoll sind, sondern
der auf sie folgende freie Fall, der den Wagen alle fünf Minu-
ten hilflos auf eine Felswand zuschlingern lässt, sodass jede
Kurve bei knirschend eingelegtem Gang und einem geflüster-
ten O Scheiße eine Sache von Leben und Tod ist.
Obwohl der Fahrer hinter mir solche Probleme offenbar
nicht hat.
Auf einem der raren geraden Streckenabschnitte entdecke
ich im letzten Licht des Nachmittags in der Ferne eine
schwarze Limousine. Es könnte der Continental sein, den ich

auf der Fahrt zu Sam in St. Catharines gesehen habe. Jedes
Mal, wenn ich bremse, um ihn besser sehen zu können,
bremst er auch oder hält ganz am Straßenrand, jedenfalls zeigt
er sich nur, solange ich zügig weiterfahre. Als sich später die
Kronen der Bäume über der Straße wölben und jeden Schim-
mer des silbernen Monds verdecken, sind seine zwinkernden
Scheinwerfer immer noch da.
In einer der zahlreichen Kurven dieser Straße haben Eve-
lyn und Conrad White ihr Ende gefunden. Und wahrschein-
lich war es ein Wagen wie der, der mir folgt, welcher sie ge-
drängt hat, zu schnell zu fahren. Vielleicht war es genau der-
selbe Continental. Derselbe Fahrer.
Wer immer am Steuer sitzt, will offenbar nicht meinen
Tod, jedenfalls noch nicht. Er will sich vergewissern, dass ich
in die richtige Richtung fahre. Hier oben hat man nur zwei
Alternativen: geradeaus oder zurück. Und eines davon ist ab-
solut keine Option.
Irgendwann nach Mitternacht erreiche ich Whitley. Die Stadt
selbst verbirgt sich vor dem Highway hinter einer Reihe von
Bäumen, als würde sie sich schämen. Eine Bowling-Bahn,
zwei Gebrauchtwagenhändler, eine Kneipe, deren Fenster mit
Sperrholz vernagelt sind. Alles hat geschlossen. Sogar die
Laternen sind für die Nacht ausgeschaltet worden, falls sie
überhaupt je gebrannt haben sollten.
Aber der Fernseher an der Rezeption des Sportman’s Motel
funktioniert einwandfrei. Das gibt den Ausschlag: Das trauri-
ge Flimmern, das mir signalisiert, dass außer mir noch jemand
in Whitley wach sein könnte. (Ich frage mich, wann der Ma-
nager zum letzten Mal das NO vor dem VACANCY-Schild
anschalten musste, auf dem ein Jäger mit einem Gewehr in
der einen und einer toten Gans in der anderen Hand abgebil-
det ist.)

Der Typ am Empfangstresen guckt Canadian MegaStar!
und schüttelt den Kopf über ein Mädchen aus Saskatoon, das
eine Melodie von Barry Manilow verstümmelt.
»Ist das zu fassen?«, sagt er und gibt mir die Zimmer-
schlüssel, ohne den Blick vom Bildschirm zu wenden. »Was
denken sich die Leute dabei?«
»Sie wollen berühmt sein.«
»Na, die wird garantiert berühmt. Berühmt für ihren fetten
Arsch und eine Stimme wie ein ersticktes Huhn.«
Er schüttelt erneut den Kopf, schnaubt, verschränkt die
Arme und lässt sich tiefer in den Stuhl sinken, der quietschend
nachgibt. Aber er schaltet nicht um.
Das Zimmer riecht nach Rum und benutzten Kondomen. Um
den Geruch zu vertreiben, gieße ich das Shampoo aus einer
der kleinen Flaschen im Bad auf dem Teppich aus und reibe
es mit den Schuhen in den Flor. Dabei ist mir, als würde ich
draußen den Continental vorbeifahren sehen. Als ich die Tür
aufreiße, setzt er bereits zurück. Die Kälte presst wie eine
Faust gegen meine Brust und hält mich fest, mein beschlage-
ner Atem schwebt wie ein grauer Heiligenschein über meinem
Kopf. Es wäre ohnehin zwecklos, einem Wagen nachzulau-
fen, der Richtung Highway davonsaust.
Ob er in dem Wagen gesessen hat oder nicht, ich weiß,
dass er hier ist. Als ich auf das Pflaster vor dem Sportman’s
Motel spucke, habe ich den Geschmack im Mund, der mit der
Präsenz des Sandmanns verbunden ist. Er ist hier. Und das
bedeutet, Angela ist auch hier.
Abgesehen von den Resten der Donut-Lieferung vom Vortag
im Hugga Mugga gibt es das einzige Frühstück, das man in
Whitley bekommen kann, im Lucky Seven Chinese BBQ. Die
Eier schmecken nach Frühlingsrollen, der Toast nach Wan

Tan, aber bei meinem Hunger bekomme ich selbst dieses
Zeug hinunter. Und als ich von meinem Teller aufblicke, sitzt
mir Sam gegenüber. Mit besorgter Miene. Besorgt nicht um
sich, sondern um mich.
Du bist kein Geist. Das ist nur meine Sehnsucht. Du lebst.
»Noch einen Schluck Kaffee?«
Ich hebe den Blick zu der Kellnerin. Als ich ihn wieder
senke, ist Sam verschwunden.
Auf dem Bürgersteig blicke ich Whitleys Main Street hi-
nunter und stelle mir vor, wie Angelas Vater sie auf der Suche
nach ihr abgelaufen ist. Genau wie ich. Raymond Mull ist
meine einzige Verbindung zu den Spuren, die sie möglicher-
weise hinterlassen hat. Ich muss die Farm finden, wo er sie
besucht hat, und dafür muss ich Edra finden, Angelas Pfle-
gemutter. In dem Tagebuch lautete ihr Nachname Stark, aber
wahrscheinlich hieß sie in Wirklichkeit anders.
Ich beschließe, meine Suche in der Redaktion des Whitley
Register zu beginnen. Obwohl es auf dem Schild heißt, dass
ab neun Uhr geöffnet ist, stehe ich um Viertel vor zehn immer
noch vor verschlossenen Türen, sodass mir nichts anderes
übrig bleibt, als mich auf die Eingangstreppe zu setzen und zu
wünschen, ich hätte mir im Lucky Seven Zigaretten gekauft.
Aus vorbeifahrenden Pick-ups werde ich unverhohlen ange-
starrt, tue jedoch so, als würde ich es nicht bemerken, sondern
schlage den Kragen meines Mantels gegen die auffrischende
Brise hoch.
Hier im Norden ist der Herbst schon einen Monat weiter,
sodass das Laub der Bäume bereits alle Farbe verloren hat.
Schuljahresanfangsmüll verstopft die Abflüsse: orangefarbene
Blätter und Red-Bull-Dosen. Abfall, der bald vom Schnee
begraben sein wird, um im Frühling fermentiert und weich
wieder zum Vorschein zu kommen. Genau wie Jacob Starks

Leiche, nachdem er ohne Schuhe in den Wald hinausgelaufen
war.
Als eine Frau in einer karierten Jagdjacke vorfährt, fürchte
ich schon, dass sie mich auffordern wird zu verschwinden.
Ihre herabgezogenen Mundwinkel und ihre kräftigen Schul-
tern deuten auf eine gewisse Erfahrung in diesen Dingen hin.
Deshalb platze ich auch gleich mit meinem Anliegen heraus,
als sie sich, die Hände in die Hüften gestemmt, vor mir auf-
baut.
»Ich mache eine Recherche und hatte gehofft, Sie könnten
mir vielleicht helfen.«
»Eine Recherche? Worüber denn? Die Geschichte der
Whitley Whippers?«
»Verzeihung?«
»Sie sprechen mit der Sportredakteurin des Register, nicht
mit dem Archivar. Wenn wir einen Archivar hätten.«
»Gibt es in der Nachrichtenredaktion vielleicht jemanden,
mit dem ich sprechen könnte?«
»Die Nachrichtenredaktion bin ich auch. Dazu Unterhal-
tung, Wirtschaft und Garten-Ratgeber. Hin und wieder auch
ein bisschen Anzeigenverkauf, wenn ich dazu komme.«
Sie streckt ihre behandschuhte Hand aus, die ich zunächst
schüttle, um mich dann an ihr hochzuziehen.
»Patrick Rush«, sage ich.
»Jane Tanner. Vertretende Chefredakteurin. Der Chef-
redakteur ist verstorben.«
»Das tut mir leid.«
»Das muss es nicht. Das ist drei Jahre her. Und er war ein
mieser Dreckskerl.«
Jane Tanner schließt auf, lässt mich herein und bietet mir
einen Kaffee aus einer Kanne an, die über Nacht auf der
Wärmeplatte gestanden hat.

»Und was recherchieren Sie in Whitley? Was über die Mi-
nen hier, oder geht es um ein Verbrechen?«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Das ist alles, was wir hier oben haben. Ein paar schlechte
Menschen und ein paar Löcher im Boden.«
»Nun, um ehrlich zu sein, Sie haben recht. Ich recherchiere
über die Raymond-Mull-Morde von vor ein paar Jahren.«
Jane Tanner lässt ihren Becher sinken. »Vor achtzehn Jah-
ren.«
»Ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht die Zeitungen aus
der Zeit durchsehen könnte. Ihr Archiv ist leider noch nicht
online verfügbar.«
»Noch nicht. Das gefällt mir. Noch nicht.«
Ich erwarte Fragen. Ein Fremder taucht auf und fragt nach
dem Schlimmsten, was in dieser nicht ganz diesseitigen und
nicht ganz jenseitigen Stadt je passiert ist. Aber Jane Tanner
führt mich einfach in den Keller, wo schimmelnde Stapel des
Register jeden zu begraben drohen, der ihnen zu nahe kommt.
»Viel Spaß«, sagt sie und geht wieder die Treppe hinauf.
Achtzehn Jahre. Ich beginne mit den Zeitungen neben den
Gartengeräten und arbeite mich bis zu den kaputten Schreib-
maschinen vor. Die Ausgaben vom Herbst 1989 lagern neben
der Heizung, sodass ich aufpassen muss, mich nicht zu ver-
brennen, als ich sie herausziehe. Als ich einen Armvoll zu-
sammengesammelt habe, kippe ich die Rattenköttel aus einer
leeren Milchkiste, setze mich und fange an zu lesen.
Er war hier. Während Raymond Mulls Kinderentführungs-
serie war das Whitley Register eine wöchentliche Gedenkaus-
gabe mit trauernden Familienmitgliedern, Nachrichten von
erfolglosen Polizeiermittlungen und empörten Kommentaren,
die die Wiedereinführung der Todesstrafe forderten. Aber es
sind die Schulfotos der lächelnden Opfer, die seine Taten un-
denkbar erscheinen lassen. Zuerst Laney Pelle. Dann Tess

Warner. Und zuletzt Ursula Lyle, die man nie gefunden hat,
weil Angela, wenn man ihrem Tagebuch glauben darf, sie in
dem Waldstück der Starks hat verschwinden lassen.
Raymund Mull hatte nichts zu sagen, nachdem man ihn in
einem Motel am Straßenrand zwanzig Meilen weiter nördlich
gefasst und bei ihm - wie bei William - Äxte, Bügelsägen und
Handschuhe gefunden hatte. Das einzige Bild von ihm im
Register zeigt einen Mann in der grauen Arbeitshose und
passenden Reißverschlussjacke eines Mechanikers, er hat
leblose Augen, aber ein unsicheres Grinsen im Gesicht, als
würde es ihn überraschen, dass nur er allein den trockenen
Witz in alldem erkennen kann.
Ich gehe rückwärts die Wochen vor Mulls Verhaftung
durch auf der Suche nach Artikeln über Jacob Starks myste-
riösen Tod und seine traumatisierte Adoptivtochter, die man
halb erfroren im Stall gefunden hatte, aber als ich auf eine
Erwähnung des Zwischenfalls stoße, gibt es bemerkenswerte
Abweichungen von dem Bericht in Angelas Tagebuch. Jacob
Stark hieß in Wirklichkeit David Percy. Und obwohl man
seine Leiche unter den von Angela beschriebenen ungewöhn-
lichen Umständen gefunden hat - begraben vom ersten
Schneesturm des Winters, mit Kratzspuren nach seinem pani-
schen Sprint durch den Wald -, wird nirgendwo eine Angela,
eine Tochter, ein Mädchen erwähnt, das sich weigerte, ihr
Geheimnis zu teilen. Und da ist noch etwas: David Percy war
blind.
Was im Register ebenfalls fehlt, ist eine genaue Ortsangabe
zur Percy-Farm. Sie wird eigentlich gar nicht als Farm be-
zeichnet, sondern einfach als »Haus der Percys außerhalb von
Whitley«. Im Telefonbuch nachzusehen wird mir auch kaum
etwas nutzen. Marion (nicht Edra) Percy lebt höchstwahr-
scheinlich nicht mehr. Und wer weiß, ob die Farm heute
überhaupt noch bewirtschaftet wird.

Ich lasse die letzte Ausgabe des Register auf den Stapel
sinken und denke: Vielleicht war’s das. Vielleicht endet es
hier, in einem Keller voller Spinnweben, wo sich ein Mann
die Augen reibt, wenn er an seine fehlerhaften Instinkte und
seine dummen Fehler denkt.
Sam ist nicht hier. Er war nie hier. Und nach der Zeit, die
ich vergeudet habe, könnte sie längst überall und nirgends
sein. Mit ihm.
Vielleicht war dieser Augenblick von Anfang an Angelas
Pointe: Mich glauben zu lassen, dass in Whitley alles beant-
wortet werden würde, um mich dann herausfinden zu lassen,
dass sie nie hier gelebt, nie ein Mädchen ihres Alters vergra-
ben hat und nie vom Sandmann hinausgelockt worden ist. Es
war eine Geschichte, mehr nicht.
»Tut mir leid, das zu sagen«, meint Jane Tanner, die am
Fuß der Treppe auftaucht, »aber Sie sehen aus, als hätten Sie
nicht gefunden, wonach Sie suchen.«
»Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht.«
»Ich kann mit einem gewissen Bedauern behaupten, mein
ganzes Leben lang hier gelebt zu haben. Vielleicht kann ich
Ihnen helfen.«
»David Percy.«
»Ich dachte, Sie recherchieren über Mull.«
»Ich hatte die Idee, es könnte ein Zusammenhang be-
stehen.«
»Da wären Sie nicht der Einzige. Damals wurde jede ver-
misste Katze und jeder verlorene Autoschlüssel Raymond
Mull zugeschrieben.«
»Hatte er ein Kind? Percy, meine ich.«
»Es gab ein Mädchen.«
»Das Kind der Percys?«
»Adoptiert. Niemand kannte sie besonders gut, weil sie auf
der Farm draußen wohnte und nicht lange hier war.«

»Warum haben Sie sie in der Zeitung nicht erwähnt?«
»Um sie zu schützen.«
»Wovor?«
»Vor was immer auf der Suche nach ihr war.«
»Man nahm also an, dass Mull den alten Mann in den
Wald getrieben hat.«
»Wer sonst? Alle gingen davon aus, dass er es gewesen
sein musste.«
»Und dass er Percys Tochter wollte?«
»Sie hatte das richtige Alter. Und sie hatte offensichtlich
ein traumatisches Erlebnis hinter sich.«
»Sie hat sich vor ihm versteckt. Im Stall.«
Jane Tanner bleibt unter einer von der Kellerdecke hän-
genden Glühbirne direkt vor mir stehen.
»Woher wissen Sie das?«
»Es ist bloß eine Geschichte, die ich gehört habe.«
»Sie meinen, bloß eine Geschichte, die Sie geschrieben
haben.«
»Sie haben mein Buch gelesen?«
»Selbstverständlich. Ehemaliger Journalist avanciert zum
erfolgreichen Romanschriftsteller. Sie haben Schwein gehabt.
Sie waren einer von uns.«
Sie fragt, ob ich hier bin, um die wahren Hintergründe des
Percy-Falls zu erfahren, mehr als die Versatzstücke, die ich
für Der Sandmann benutzt habe. Und ich ermutige sie nach
Kräften in ihrem Missverständnis und erzähle ihr, dass ich an
einem Artikel arbeite. Eine Hintergrundreportage über den
Ursprung von Fiktionen.
»Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen?«, bietet sie
wenig überzeugend an, während ihre Körpersprache mich
auffordert, vor ihr die Treppe hinaufzusteigen.
»Wahrscheinlich nicht. Sieht so aus, als käme ich hier nicht
viel weiter.«

»So ist das nun mal mit Sachen, die vergangen sind. Meis-
tens wollen sie nicht noch mal aufgewühlt werden.«
Ich will gerade an ihr vorbeigehen, als Jane Tanner über-
raschend eine Hand auf meinen Arm legt.
»Das mit Ihrem Jungen tut mir leid«, sagt sie.
»Danke.«
»Sie sind doch nicht seinetwegen nach Whitley gekom-
men, oder?«
»Ich habe Ihnen erzählt, warum ich hier bin.«
»Ja, das haben Sie.«
Sie bleibt im Keller stehen, auch als ich schon den oberen
Treppenabsatz erreicht habe.
»Ich nehme an, Sie haben schon mit ihr gesprochen?«, ruft
sie mir nach.
Ich drehe mich um. Diese Frau kennt Angela?
»Sie ist hier?«
»Soweit ich weiß, lebt sie noch. Ein Stück die Straße hi-
nauf. In einem Pflegeheim namens Spruce Lodge.«
»Ich fürchte, ich verstehe nicht.«
»Marion Percy. Vielleicht kann sie Ihnen sagen, was an der
Geschichte dran ist, die Sie gehört haben.«
Wie so häufig in Pflegeheimen lassen auch die Bewohner von
Spruce Lodge nur wenig Pflege erkennen. Niemand fragt am
Eingang, wer ich bin, die Flure scheinen bis auf ein paar Roll-
stühle samt ihren zusammengesackten Insassen leer, als wären
sie unterwegs zu einem Ziel stehen geblieben und könnten
sich jetzt nicht mehr daran erinnern, wohin es eigentlich ge-
hen sollte.
Im Gesellschaftsraum beleuchtet grelles Neonlicht ein gu-
tes Dutzend Puzzle-Spieler und Kinn-Zitterer. An der Wand
hängt nur eine angeklebte Anleitung für das Heim-
lich-Manöver, sollte einer der Heimbewohner sich ernsthaft

beim Essen verschlucken und vor dem Erstickungstod gerettet
werden müssen. Der Einzige, der mich bemerkt, ist ein Bur-
sche, der mit der Hand in der Hose neben dem Trinkbrunnen
steht. Er zieht die Hand heraus und winkt mir zu.
»Suchen Sie jemanden?«, fragt mich eine Schwester,
nachdem ich mindestens fünf Minuten in der Tür gestanden
habe.
»Marion Percy.«
»Sind Sie ein Verwandter?«
»Nein.«
»Dann kommen Sie bestimmt von der Kirche.«
»Ist Mrs. Percy hier?«
Die Schwester ist gerade erst warm geworden - sie sieht in
etwa genauso einsam aus wie alle anderen Bewohner von
Spruce Lodge auch -, aber sie erkennt, dass ich nicht in Plau-
derstimmung bin. Sie zeigt auf eine Frau, die allein am einzi-
gen Fenster des Zimmers sitzt. »Das da drüben ist Maid Ma-
rion.«
Wer weiß, wie alt sie ist. Marion Percy hat die Achtziger
hinter sich gelassen und einen Punkt erreicht, an dem kein
numerischer Ausdruck ihres Alters der erstaunlichen Tatsache
gerecht wird, dass sie noch hier ist, ein blinzelndes, Tem-
po-Taschentuch-umklammerndes Wesen. Eine lebende
Leugnung der mittleren Lebenserwartung, die in den dichten
Wald auf der Rückseite von Spruce Lodge starrt.
»Mrs. Percy?«
Zunächst bin ich mir nicht sicher, ob sie mich gehört hat.
Das liegt daran, wie sie den Kopf wendet. Mit einem Zucken,
das eine Weile braucht, um zu einer bewussten Bewegung zu
werden.
»Sie sind neu«, sagt sie.
»Ich bin ein Besucher.«
»Kein Arzt?«

»Nein.«
»Schade. Die könnten einen neuen Arzt brauchen.«
Vielleicht lächelt sie. Jedenfalls sehe ich ihre Zähne.
»Ich kenne Ihre Tochter«, sage ich und beobachte, welche
Wirkung diese Erklärung auf sie hat, aber ihre Miene bleibt
unverändert. Eine wächserne Steifheit, die für sich schon eine
Reaktion sein könnte.
»Oh?«, sagt sie schließlich.
»Wir waren befreundet.«
»Aber jetzt nicht mehr.«
»Wir haben uns eine Weile nicht gesehen.«
»Nun, hier ist sie nicht, falls Sie das gedacht haben.«
»War sie hier?«
Das Lächeln - wenn es ein Lächeln war - erstirbt.
»Sind Sie ein Polizist?«, fragt sie.
»Bloß ein Freund.«
»Das sagten Sie, ja.«
»Ich wollte nicht schnüffeln.«
»Das haben Sie auch nicht. Aber Sie wollten gerade damit
anfangen, würde ich sagen.«
»Ich bin hier, um zu fragen, was mit Ihrem Mann passiert
ist.«
Sie sieht mich an, als hätte sie nicht gehört, was mich
zwingt, ein wenig lauter fortzufahren.
»Sein Unfall.«
»Sein Unfall?« Sie berührt meine Hand. »Würden Sie aus
Versehen vier Meilen halb nackt durch einen Schneesturm
laufen?«
Sie lässt ihre Hand wieder in den Schoß sinken. Ich trete
zwischen sie und das Fenster, aber sie blickt einfach durch
mich hindurch und betrachtet das kleine Quadrat der Welt vor
dem Fenster, das sie sich so genau eingeprägt hat, dass sie es
nicht mehr anschauen muss, um es zu sehen.

»Glauben Sie, er wurde in den Wald getrieben? Mrs. Per-
cy? Bitte?«
»Ich bin alt. Warum fragen Sie mich das?«
»Ich kenne Ihre Tochter, Ma’am. Ich wollte bloß wissen -«
»Aber es geht nicht um sie. Oder?«
»Nein.«
»Worum dann?«
»Um meinen Sohn.«
»Ihren Sohn?«
»Er ist verschwunden.«
Vielleicht ist es das Schnauben, mit dem ich meine eigenen
Gefühle zurückzuhalten versuche - Tränen, die mir ganz jäh
in die Augen schießen -, jedenfalls richtet sie sich gerade auf.
Ihre Fingerknöchel sind weiß und hart wie Quarz.
»Sie suchen ihn.«
»Ja.«
Sie nickt und saugt die Unterlippe ein. »Was haben Sie
mich gefragt?«
»Nach Ihrem Mann. Haben Sie vielleicht irgendwann ge-
dacht, dass er in den Wald gejagt wurde?«
»Er hätte sie nie allein gelassen. Es sei denn, er hat ge-
glaubt, sie so zu retten.«
»Angela.«
»Ihre Freundin«, sagt sie, und ihr Blick umwölkt sich.
»Unsere Tochter.«
Mrs. Percy berichtet mir, dass ihr Mann ihr vor seinem Tod
- und bevor sie ins Krankenhaus ging, um sich die Gallenblase
entfernen zu lassen - gestanden hatte, Stimmen zu hören. Da-
vid Percy glaubte, dass jemand ins Haus kam und ihn quälte,
ihn mit einem Messer ritzte und Möbel verstellte, sodass er
darüber stolpern musste. Außerdem spürte er eine Präsenz, die
ihn von draußen beobachtete und wartete. Er hatte Angst, den

Verstand zu verlieren. Als Marion heimkam, war ihr Mann
verschwunden. Und Angela redete nicht.
»Glauben Sie, dass sie es gewesen sein könnte?«
»Verzeihung?«
»Was Ihren Mann in den Wald getrieben hat. Hätte es Ihre
Tochter sein können?«
Die alte Frau kräuselt die Nase. »Sie war noch ein Kind.«
»Trotzdem, wer sonst könnte -«
»Unser Kind.«
Marion Percy mag alt sein, aber sie ist offensichtlich mehr
als in der Lage, ihre Linie zu verteidigen. In diesem Fall ist es
die Frage nach einer Beteiligung ihrer Adoptivtochter an den
Ereignissen jener Nacht, die für sie alles verändert hat. Sie hat
Ahnungen, was passiert sein könnte. Aber das heißt nicht,
dass sie bereit ist, sie zu teilen.
»Kommt sie Sie je besuchen?«
Mrs. Percy blinzelt mich durch die verschmierten Gläser
ihrer Bifokalbrille an. »Wer sind Sie?«
»Ich heiße Patrick Rush.«
»Und Sie sagen, dass Sie unser Mädchen kennen?«
»Ja, Ma’am. Das tue ich.«
Sie nickt, und ich erwarte, dass sie mich nach Angelas
Aufenthaltsort und ihrem Wohlbefinden fragt, danach, was ihr
in der Zwischenzeit widerfahren ist. Aber ihr Blick schweift
wieder aus dem Fenster.
»Was ist mit Ihrer Farm passiert?«, frage ich. »Nachdem
Sie sie nicht mehr bewirtschaften konnten?«
»Die Natur hat sie zurückerobert. Nicht, dass wir ihr je viel
abgerungen hätten. Da konnte man nichts anderes als Felsen
und Bäume anbauen. Ein Schlammloch hat David es immer
genannt.«
»Wem gehört es jetzt?«
»Ihr.«

»Angela?«
»Deshalb hat man Kinder. Ohne sie gibt es niemanden, der
sagen kann, dass man überhaupt da war.«

33
Ich breche direkt von der Spruce Lodge zur Percy-Farm auf.
Das Licht des Nachmittags lässt erste Anzeichen von Kapitu-
lation erkennen. Laut Marion Percy liegt der Hof nur »ein
paar Meilen außerhalb der Stadt«, aber zwischendurch frage
ich mich immer wieder, ob die alte Frau mich vorsätzlich in
die Irre geschickt hat. Ihre Wegbeschreibung kommt gänzlich
ohne Straßennamen oder Zahlen aus, sie fußt ausschließlich
auf Landmarken (»an der steinernen Kirche rechts«) und sub-
jektiven Entfernungsangaben (»ein ordentliches Stück«, »eine
gute Weile geradeaus«). Nach einer Stunde zerknülle ich den
Zettel mit meinen Notizen und werfe ihn auf die Rückbank.
Damit bin ich allein auf meinen Instinkt angewiesen, mit
dessen Hilfe ich schließlich auf einer Privatstraße lande, die
auf beiden Seiten mit dichtem Gestrüpp überwuchert ist, das
an den Seiten des Wagens kratzt. »Sie werden keine Farm,
kein Haus oder irgendwas erkennen, was darauf hindeuten
könnte, dass dort je ein Mensch gelebt hat«, so hat Marion
Percy die Einfahrt zu ihrem Grundstück beschrieben. So weit
sind die Kriterien jedenfalls erfüllt.
Der Abend tritt in jene ausgedehnte Phase der Dämmerung
ein, wie sie im hohen Norden typisch ist. Ganz, ganz langsam
nur wird es dunkel. Ich schalte die Scheinwerfer an. Die knor-
rigen Bäume leuchten kurz orangefarben auf, bevor sie den
Außenspiegel des Toyotas abbrechen. Der Weg geht weiter,
ohne auf irgendwelche Spuren menschlicher Behausung hin-
zuweisen. Kein Zaun, kein Tor, keine rostenden Geräte im

Unterholz. Ich irre mich: Das ist gar kein richtiger Weg, er
führt nirgendwohin. Aber er ist auch zu eng, um zu wenden,
und zu sumpfig, um die ganze Strecke rückwärtszufahren. Ich
kann nur hoffen, dass er am anderen Ende in irgendeine Stra-
ße mündet.
Ich schalte das Radio ein und bekomme als Erstes den
Wetterbericht zu hören: Der erste Sturm des Winters zieht
auf. In der Nacht wird im ganzen Land heftiger Schneefall
erwartet, der bis zu vierzig Zentimeter hoch liegen bleiben
soll. Die nächtlichen Tiefstwerte liegen bei minus zwanzig
Grad. Nicht alle Straßen werden befahrbar sein. Wer nicht
unbedingt unterwegs sein muss, sollte für die Dauer des
Sturms zu Hause bleiben.
Zu spät für mich.
Die sich ausbreitende Kälte jenseits der Scheiben weckt
neue Fantasien, wo Sam stecken könnte. Drinnen oder
draußen? Gefesselt, mit einer Kapuze über dem Kopf? Hat
man ihm zu essen gegeben? Kann er ein Licht sehen? Ist ihm
kalt?
Lebt er noch?
Nein. Diesen Gedanken werde ich nicht zulassen.
Ich muss handeln, weitermachen, denn das allein kann
mich vielleicht zu Sam führen. Mir bleibt nichts anderes üb-
rig, als umzukehren. Also trete ich auf die Bremse, lege den
Rückwärtsgang ein, drehe mich um und schaue, wie ich auf
dem Weg, den ich gekommen bin, zurückschlittern kann.
Aber als ich den Kopf kurz wende, tut sich vor mir plötz-
lich eine Lichtung auf.
Ich lege wieder den Vorwärtsgang ein und steuere auf die
letzten über den Weg hängenden Äste zu. Es gibt einen Knall,
als einer von ihnen gegen die Windschutzscheibe schlägt und
sie mit einem Spinnennetz von Rissen überzieht. Ich halte das
Gaspedal weiter durchgedrückt, und der Wagen schlingert
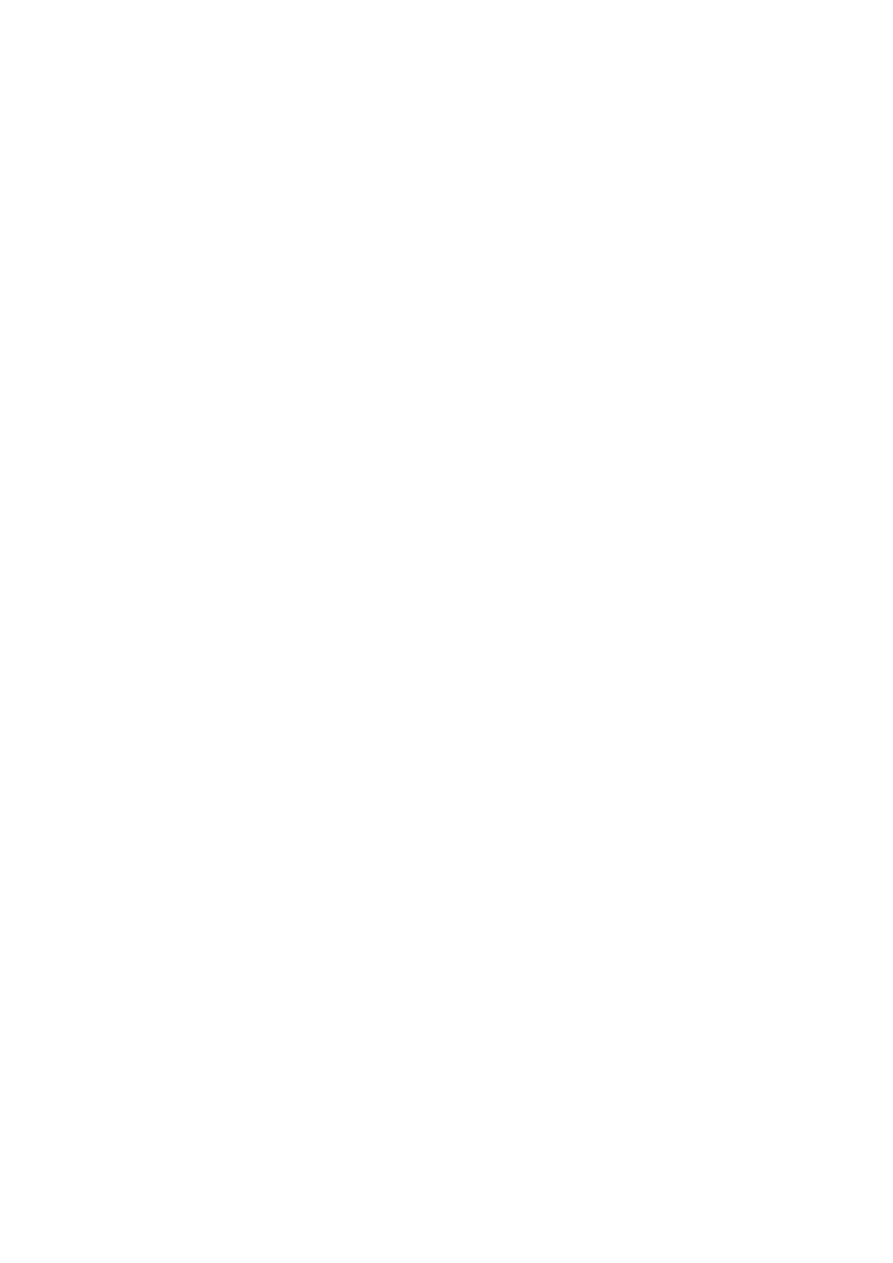
seitlich in den Schlamm, wo die Räder etwa dreißig Zentime-
ter tief stecken bleiben.
Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Denn ich bin da.
Ein viereckiges Farmhaus aus rotem Backstein, berankt
von blattlosem Wein. Daneben ein windschiefer Stall und
jenseits davon eine freie Fläche, die einst Ackerboden war,
jetzt aber eher eine Wiese ist - oder wie immer man ein Stück
Land auf halbem Weg zurück in seinen Urzustand nennt.
Ich steige aus und betrachte den Hof, als wäre es ein Ort
aus meiner eigenen Erinnerung. Er sieht nicht genauso aus,
wie ich ihn mir vorgestellt habe, als ich Angela lesen hörte, ist
aber trotzdem augenblicklich wiedererkennbar. Die guss-
eiserne Wetterfahne auf dem Dach des Farmhauses, die ver-
bogene Schaukel im Garten, der wackelige Holzzaun, der
vergeblich versucht, den ehemaligen Gemüsegarten gegen das
wuchernde Gestrüpp des angrenzenden Waldes zu schützen.
Ich gehe auf das Haus zu. Erste Flocken fallen träge und
gerade wie Zigarettenasche. Ich strecke die Arme aus und
sehe, dass sich auf meinem Mantel und meinen Schuhen
schon eine dünne weiße Schicht gebildet hat, die mich zu
einem Gespenst macht.
Ein elektrisches Kribbeln wandert aus der Erde durch meine
Beine nach oben. Gibt es das Gegenteil eines heiligen Bo-
dens? Vermutlich konservieren bestimmte Felder und Höfe in
Polen und Frankreich eine ähnliche Energie, die im Boden
festgehaltene Erinnerung an das Grauen, das sich dort abge-
spielt hat. Ich weiß, das sind nur meine eigenen dunklen Ah-
nungen, aber als ich meinen Fuß auf die erste Stufe zu dem
Farmhaus setze, ergreift die Geschichte dieses Ortes von mir
Besitz.
Ich blicke mit herausgestreckter Zunge himmelwärts und
esse Schnee wie ein Kind. Doch eigentlich will ich sehen, ob

jemand am rechten Fenster im ersten Stock steht, wo einst die
junge Angela gestanden und zu ihrem Vater hinabgeblickt hat.
Die Tür steht einen Spalt offen. Irgendetwas hält mich da-
von ab, die Klinke mit bloßen Händen zu berühren, also stoße
ich die Tür mit der Schulter so weit auf, dass ich eintreten
kann. In dem Luftzug rascheln welkes Laub und Mäusedreck
über den Boden. Aber der Gestank des Hauses ist stärker. Ein
Geruch nach verstopften Abflussrohren. Zusammen mit etwas
Süßlicherem, Lebendigerem.
Ein Geruch, den Chirurgen und Soldaten erkennen wür-
den.
»Sam?«
Meine Stimme lässt das Haus verstummen. Es war schon
still, als ich hereinkam, aber jetzt ist irgendeine zuvor unbe-
merkte Aktivität eingestellt worden. Putz und Bodendielen
verharren in der Spannung eines angehaltenen Atemzuges.
Ich versuche, die Haustür offen stehen zu lassen, aber sie
hängt so schräg in den Angeln, dass sie immer wieder zu-
schwingt. Obwohl es draußen noch nicht ganz dunkel ist und
die verbliebenen Vorhänge in Fetzen vor den Fenstern hän-
gen, sammeln sich in den Ecken, hinter jeder Tür und am En-
de des Flures Schatten. Es ist schwer, sich das Haus von der
Sonne durchflutet vorzustellen. Schlimme Dinge sind hier
geschehen.
Im Erdgeschoss gehen zwei Räume von einem engen Flur
ab, der direkt zur Küche auf der Rückseite des Hauses führt.
Nach ein paar Schritten liegt links ein Wohnzimmer, rechts
ein Esszimmer, die beide zu klein für ihre Funktion erschei-
nen, selbst ohne Menschen und die Mehrzahl der Möbel. Im
Wohnzimmer stoße ich auf Spuren eines Besuchs: drei Holz-
stühle und auf dem Boden dazwischen eine zerbrochene
Whiskeyflasche. Der Kamin und ein Teil der Wand sind ruß-
schwarz, auf dem Rost lehnen verkohlte Scheite aneinander.

Ich bücke mich und berühre sie. Kalt wie der Schnee, der sich
auf dem Sims sammelt.
Als ich in den Flur zurückkehre, ist es noch dunkler ge-
worden, sodass ich ihm halb blind und mit den Händen an den
Wänden entlangtastend folge. Diesen Weg muss auch David
Percy in der letzten Nacht seines Lebens genommen haben.
Alt und ohne Augenlicht, gequält von dem, was er für einen
dämonischen Eindringling hielt.
Ich drehe mich um und sehe, dass die Haustür offen steht
und mit einer Böe wieder zuschwingt. Nur der Wind. Aber
solche Gedanken muss David Percy auch gehabt haben. Er-
klärungen, die nicht ganz ausreichten, seinen Verstand beiei-
nanderzuhalten.
Auf dem Weg nach oben wird der Geruch stärker. Wärmer,
feuchter. Jeder Schritt ein Kampf gegen die Übelkeit.
Irgendetwas ist hier passiert.
Und nicht nur vor achtzehn Jahren.
Irgendetwas ist heute hier passiert.
Auf dem oberen Treppenabsatz erkenne ich, dass ich recht
hatte.
Blut. Eine Spur von münzengroßen Kreisen, die zu dem
Zimmer auf der Vorderseite des Hauses führen. Zu Angelas
Zimmer.
Plötzlich sehe ich das Buch.
Es liegt aufgeschlagen auf dem Treppenabsatz, der Rücken
gebrochen, wie um die Seite zu markieren. Ich erkenne den
Titel, bevor ich nahe genug herangekommen bin, um die
Buchstaben auf dem Umschlag zu lesen. Ich weiß, was es ist,
noch bevor ich mir das spröde Papier unter die Augen halte
und erkenne, dass es ein Taschenbuch aus meinem eigenen
Bücherregal ist, das ich Sam für den Stapel auf seinem Nacht-
tisch gegeben habe. Robinson Crusoe. Das Buch, das er im

Autokino bei sich hatte an dem Abend, als er verschwunden
ist.
»Sam?«, rufe ich noch einmal laut, als könnte ich ihn mit
schierer Willenskraft zum Antworten zwingen. Aber man hört
nur das Ächzen des Bodens, als mir das Buch aus den Händen
fällt und ich mit schlurfenden Schritten auf die halb geöffnete
Tür des vorderen Zimmers zugehe.
Als ich sie auftrete, entweicht der Geruch.
Ein Einzelbett mit Hasen-Bildern auf dem Kopfbrett. Ein
Holzpult. Tieraufkleber - ein grinsendes Stinktier und eine
glucksende Giraffe - auf dem gesprungenen Spiegel der
Kommode. Und überall Blut. Die Spuren verlaufen im Zick-
zack durch das Zimmer wie von einer Ketchup-Spritzflasche
verteilt. Weniger die Spuren eines Gemetzels als die eines
Kampfes. Etwas halb Begonnenes und dann Unterbrochenes.
Oder halb erledigt und anderswo beendet.
Dann fallen mir die Ketten auf der Matratze ins Auge, vier
Stück, verbunden mit den Bettpfosten und mit einem kleinen
Metallring am Ende. Fesseln.
Ich weiß nicht genau, was ich in den folgenden Augenbli-
cken tue. Vielleicht ist auch gar keine Zeit verstrichen. Ich
weiß nur, dass ich die Blutspuren nachzeichne und einen Fin-
ger durch den verrosteten Kettenring stecke. Alles ist still.
Alles fällt von mir ab.
Und dann höre ich es.
Leise, aber deutlich genug aus der Ferne. Von irgendwo
aus dem Wald jenseits der Felder.
Eine Stimme, die mich ruft.
Der Schneefall hat in der letzten Stunde zugenommen. Der
Wind weht mir die Flocken in die Augen. Meine Beine
scheinen zu wissen, wohin sie gehen. Hinaus in die gefrore-
nen Furchen des verlassenen Feldes.

Sam ruft nicht noch einmal nach mir, als ich Richtung
Wald stolpere. Aber das hält mich nicht davon ab, ihn zu hö-
ren.
Daddy!
Daddy, nicht Dad. So hat er mich genannt, als er klein war,
bevor er die zweite Silbe vor einigen Jahren zugunsten der
erwachseneren Form gestrichen hat. Jetzt fällt er nur noch in
die kindlichere Variante zurück, wenn er sich wehgetan hat.
Oder Angst hat.
Ich erreiche die Bäume. Endgültige Dunkelheit tritt im
selben Moment ein, in dem die nackten Äste über meinem
Kopf auch das Mondlicht verdecken. Auf dem relativ ebenen
Boden komme ich schneller voran als auf den Ackerfurchen,
dafür gibt es mehr Hindernisse. Zweige, Stumpen, die aus
dem Schnee ragen, um gegen meine Schienbeine zu stoßen.
Verborgene Felsen.
Als ich mir mit der Hand über die Augen wische, spüre ich
feuchtes Blut. Ein Schnitt.
Der Wetterbericht hatte recht. Nicht nur, was den Schnee-
sturm betrifft, sondern auch bezüglich der eisigen Tempera-
turen. Es ist so kalt, dass die Nasenlöcher zufrieren und sich
die Haut über den Wangen spannt, als könnte gleich der
Knochen durchstoßen.
Ich bleibe stehen und versuche mir einzureden, dass ich
den Weg bestimme, den ich nehme, dass die Kälte und die
Panik nicht allen Sauerstoff in der Luft gefriergetrocknet ha-
ben. Wo ist Norden? Wenn er hier draußen ist, ist er dort. Und
nur Sam wüsste, wie man wieder herauskommt. Er könnte es
an den Sternen erkennen. Bei Unterbrechungen des Schnee-
gestöbers kann ich einige der helleren Sternbilder erkennen,
aber ich habe nicht zugehört, als Sam versuchte, mir zu erklä-
ren, wie sie einem den Weg weisen können. Bei dem Gedan-
ken, dass ich vielleicht nie mehr Gelegenheit bekomme, mir

das von meinem Sohn beibringen zu lassen, beuge ich mich
gekrümmt nach vorn und übergebe mich auf die weichen
Schneewehen.
Sams laut gerufener Name verliert sich im Sturm. Jedes
Mal, wenn ich im Kopf bis zwanzig gezählt habe, ist die
Schneeschicht zwei Zentimeter höher geworden. In den klei-
nen, zugefrorenen Bächen reicht sie mir schon bis an die
Knie.
Ich kämpfe jetzt weniger gegen die Kälte als gegen mein
Verlangen an, mich an die nächste Kiefer zu lehnen und ein-
zuschlafen. Ein kleines Nickerchen. Ich weiß, es wäre ein
Schlaf der ewigen Art. Aber so hat David Percy diese Welt
verlassen. Und wer will behaupten, dass ich mehr Grund habe
zu leben als er? Ein Paar Narren, die dachten, dass sie allein
mit guten Absichten durchkommen würden.
Ich bücke mich, um mich an einer gemütlichen Stelle ein-
zukuscheln, als ich ihn sehe. Einen menschlichen Körper, der
auf einer Lichtung vor mir an einem Baum lehnt.
»Sam.«
Diesmal flüstere ich seinen Namen, doch es ist lauter als
jeder Schrei.
Aber als ich näher komme, sehe ich, dass die Gestalt zu
groß ist, um Sam zu sein, und dass sie, wer immer es sein
mag, schon länger gefroren ist. Aber nicht erfroren. So ist
dieser Mann nicht zu Tode gekommen. Vereistes Blut hat sich
in seinem Schoß gesammelt. Steife Hände sind auf die offe-
nen Wunden gepresst. Er ist an den Stamm gefesselt mit
Draht, der sich bei den letzten Anstrengungen, sich zu be-
freien, tief in seinen Körper geschnitten hat.
Das Kinn des Toten ist auf seine Brust gesunken. Ich hebe
seinen Kopf, sodass seine leblosen, aber noch offenen Augen
zu mir aufblicken.

Es ist seltsam, etwas anderes als trocken ironische Groß-
spurigkeit in Ramseys Gesicht zu entdecken, doch davon ist
jetzt nichts zu sehen. Die Selbstgewissheit, die er sich in all
den Jahren seines Lebens bewahrt hatte, ist zu einer Maske
des Grauens erstarrt.
Was immer man ihm in Angelas Zimmer angetan hat, es
hat gedauert. Und dann wurde er hierhergebracht. Er wusste,
was auf ihn zukam, und hat sich trotzdem an die Möglichkeit
geklammert zu entkommen. Machten das die Detektive in den
Krimis nicht so? Auf eine Chance in letzter Minute warten,
selbst wenn die Lage völlig aussichtslos schien?
Ich rapple mich wieder auf die Füße. Ramsey ist schon
halb begraben, in einer halben Stunde würde niemand mehr
ahnen, dass er dort ist.
Es gibt keinen Grund weiterzulaufen, aber ich tue es trotz-
dem. Sam ist nicht hier draußen, wenn er es je war. Wahr-
scheinlich kam das, was ich gehört habe, aus meinem eigenen
Kopf, oder es war Ramsey, den man mit einer Drahtschlinge
um den Hals auf die richtige Tonhöhe getrimmt hat. Es ist
egal. Es geht nur noch um eins: die Bestimmung von Anfang,
Mitte und Ende. Geschichten mögen Symmetrien, und mein
Schicksal ist es, David Percys letzte Minuten noch einmal zu
durchleben. Ich laufe nur noch weiter, um den Ort zu sehen,
an dem sie mich irgendwann finden werden.
Vielleicht ist es hier. Auf dem offenen Feld der Percys.
Ohne Absicht bin ich zu der Stelle zurückgekehrt, von der ich
aufgebrochen war.
Ein einzelnes Licht leuchtet in dem Schneetreiben, die
Birne über der Veranda der Farm.
Jemand ist zu Hause.
Ich falle auf die Knie. Ein Schatten auf der anderen Seite
des Feldes lässt sich Zeit, um zu mir zu gelangen. Eine Dun-
kelheit auf dem Weg, mich ganz zu verschlingen. Hinter dem

Schatten kommt eine kleinere Gestalt aus dem Haus und sieht
zu.
Irgendwas an den beiden gibt einem das Gefühl, dass sie
schon immer hier waren. Nicht nur heute. Sie haben alle Zeit
der Welt.

34
Werfen Schatten Schatten?
Feuerschein an einer Decke mit rissigem Putz. Nuancen
von Dunkelheit schieben sich gegenseitig beiseite. Abblät-
ternde Farbe, die düster belebt wirkt wie gekrümmte Finger,
die nach mir greifen.
Zufällige Verbindungen, Mini-Halluzinationen. Mehr
nicht, das ist mir bewusst. Krankenhauszimmergedanken.
Nur dass ich nicht in einem Krankenhaus bin.
Nein, frag nicht. Lass es auf sich beruhen - beobachte, wie
die Schatten Schatten werfen. Frag nicht.
Wo bin ich?
Jetzt habe ich es doch getan. Eine Frage wie diese kann
man nicht verdrängen, wenn sie erst einmal heraus ist. Es ist
die erste Information, auf der wir bestehen, wenn wir aufwa-
chen.
Das bedeutet, ich bin wach. Das bedeutet, ich bin am Le-
ben.
Einmal Ohnmacht und zurück.
Jedenfalls gibt es eine Lücke, die ich mir nicht anders er-
klären kann. Als ich weg war, ist das schüchterne Feuer im
Kamin geschürt worden und der Schneesturm hat sich abge-
schwächt, sodass die Flocken jetzt nur noch rieseln wie Fe-
dern nach einer Kissenschlacht. Und obwohl es zuvor schon
unvorstellbar kalt war, ist es dort, wohin die Wärme des Feu-
ers nicht reicht - wo meine blau gefrorene linke Hand liegt, im

Gegensatz zur rechten, die rosig glänzt -, noch ein paar Grade
kälter geworden.
Einen Moment lang überlege ich, ob dies ein ganz anderes
Farmhaus sein könnte, ein anderes leeres Wohnzimmer mit
Fenstern, aus denen man in das nächtliche Dunkel blickt wie
aus einem Minenschacht. Aber zu meinen Füßen liegt die
zerbrochene Whiskeyflasche. Und der Stuhl, auf dem ich sit-
ze, fühlt sich an wie der, der mir aufgefallen ist, als ich einen
Blick in das Wohnzimmer der Percys geworfen habe. Ge-
splittert, aber mit vier Beinen fest auf dem Boden stehend.
Und ich darauf festgebunden.
Ketten um die Handgelenke, die meine Arme flach auf die
Lehnen drücken und meine Knöchel aneinanderfesseln. Ein
schmerzhaftes Joch im Nacken. Ich kann nicht erkennen, wie
der Stuhl im Boden befestigt ist, aber da er sich nicht bewegt,
egal, wie ich mich bewege, muss er festgeschraubt sein.
Ich trage meine Kleider, aber keinen Mantel und an den
Füßen nur Socken. Vermutlich, damit die Ketten besser um
Brust und Beine passen, aber es macht mich verwundbarer
gegenüber der Kälte. Ohne das Feuer werde ich es nicht lange
schaffen. Selbst jetzt spüre ich, wie der Schweiß auf meiner
Oberlippe gefriert und die eisige Luft in den Augen sticht.
Meine Kraft ist verbraucht. Viel hatte ich ohnehin nie. Und
am Rande meines Blickfelds tanzen kribbelnd die schwarzen
Punkte der Bewusstlosigkeit und lauern auf ihre Chance, mich
unter sich zu begraben.
Aber ich muss es versuchen. Ich kann nichts anderes tun,
als es zu versuchen.
Ich überlege mir, dass ich die Ketten am besten gliedweise
einzeln teste, um zu sehen, ob eine von ihnen nachgibt. Die
dafür erforderliche Konzentration - erst dieses Handgelenk,
dann diesen Fuß, dann jenen Fuß zu bewegen - beweist, dass
mein Verstand so geschwächt ist wie der Rest. Und auch

wenn ich hier und da ein paar Zentimeter ziehen kann, lässt
nichts darauf schließen, dass es an irgendeiner Stelle noch
mehr Spiel gäbe. Wenn ich je aus dem Stuhl herauskomme,
dann jedenfalls nicht auf die sanfte Tour.
Mit einer wahnwitzigen Anspannung aller Muskeln werfe
ich meinen Körper vor und zurück und versuche, den Stuhl
umzukippen. Tritte und Schläge, die ins Leere gehen.
Als ich fertig bin, sitze ich nach wie vor an Ort und Stelle.
Aber jetzt habe ich den schwarzen Punkten Tür und Tor ge-
öffnet. Mit einer Welle von Übelkeit übermannt mich der
Schlaf, hüllt alles in dichten Nebel.
Ich kann meine Augen nicht öffnen. Womöglich bin ich er-
blindet. Aber irgendwo im Haus bewegt sich etwas. Es ist
mehr ein Spüren der Schwingungen als Geräusche. Hören wie
die Gehörlosen.
Schwere Schritte auf dem Flur im ersten Stock. Und etwas
Leichteres, Metallisches. Das Klappern von Töpfen und Be-
steck in der Küche.
Ich versuche erneut aufzustehen. Es funktioniert nicht. Und
diesmal tut es weh.
»Wer ist da?«, rufe ich oder versuche es zumindest, aber es
kommt nur als ein trockenes Röcheln heraus, ein Rascheln
wie beim Umblättern einer Zeitung.
Trotzdem verstummen die Geräusche für einen Moment.
Hat man mich gehört? Die schwarzen Punkte sammeln sich
wieder.
Wo ist mein Sohn?
Das kommt irgendwie über meine Lippen. Ein gebrochener
Schrei, der durch das Haus dringt.
Nachdem das letzte Echo verklungen ist, vergeht eine gan-
ze Minute. Man hört nur das Klopfen des Windes an der
Fensterscheibe.

Und dann heben die Geräusche wieder an. Stiefeltritte auf
Bodendielen, Kochgeklapper. Aber niemand antwortet. Nie-
mand nimmt zur Kenntnis, dass im Vorderzimmer ein Mensch
erfriert. Ein Vater, der nur den einen Wunsch hat: herauszu-
finden, ob sein Sohn hier ist. Und der seinen Namen rufen
würde, wenn er es könnte.
Eine Gestalt steht jenseits des Türrahmens mit einer Kerze in
einer Teetasse. Ein wildes Spiel von bleichem Licht und
Schatten. Ein kurzer Blick auf Stiefel mit Fellbesatz, ein
Wollbarett, die hervortretenden Sehnen an ihrem weißen Hals.
Sie tritt nicht vor, hält vielmehr die Kerze zur Seite, sodass
ihr Schein nicht direkt in ihr Gesicht fällt. Eine Pose wie auf
einem schauerromantischen Porträt.
Tu ihm nichts.
Als meine Lippen sich weigern, die Worte zu bilden, ver-
suche ich, ihr die Nachricht wortlos zu vermitteln. Aber ich
bin nicht der Erste, der sie anfleht. Sie weiß, worum die Men-
schen am Ende betteln.
Bitte nicht.
Ich ringe nach Luft, und als ich sie schließlich einsauge, ist
der Flur leer.
Als ich das nächste Mal aufwache, ist sie wieder da.
Sie steht in der Ecke, immer noch tief in die Dunkelheit
zurückgezogen, als wäre sie zu schüchtern, daraus hervorzu-
treten. Aber das ist es nicht. Sie beobachtet lieber, statt selbst
beobachtet zu werden.
Ich mache einen Satz auf sie zu - doch die Ketten bremsen
die Bewegung zu einem Zucken, wie bei einem heftigen
Schluckauf.

Im Kamin spuckt ein heruntergebranntes Feuer letzte Fun-
ken. Draußen herrscht eine schwarze Klarheit, wie sie mit den
tiefsten Minusgraden einhergeht.
»Wo ist er?« Meine Stimme ist ein trockenes Rascheln, als
würde man eine Zwiebel schälen. »Wo ist Sam?«
»Nicht hier.«
»Bring ihn zu mir.«
»Er ist nicht hier.«
»Lebt er?«
Die Frage streicht über sie hinweg.
Ich versuche ein weiteres Mal, mich aus dem Stuhl zu er-
heben.
»Lass mich laufen.«
»Du weißt, dass du hier nie mehr rauskommst.«
»Ich wünschte, ich hätte dich in den Arsch gefickt.«
»Das passt nicht zu deiner Figur.«
»Ich bin keine Figur.«
»Das kommt auf die Perspektive an.«
»Willst du meine Perspektive hören? Du? Du bist eine lee-
re, talentlose Hexe. Du bist nichts.«
»Das wird dir auch nicht helfen.«
»Verletze ich deine Gefühle?«
»Es wird eine lange Nacht. Und Wut verbraucht so viel
Kraft.«
»Wie kommt es dann, dass du noch stehst?«
»Ich?«, fragt sie. »Ich bin nicht wütend.«
Angela kommt auf mich zu. Der Boden ächzt, als müsste er
das Gewicht eines Riesen tragen. Der Luftzug der Bewegung
streicht über mein Gesicht wie eine federleichte Brise.
»Sie werden dich finden«, sage ich.
»Wirklich?«
»Die Polizei. Sie werden mich suchen. Und Ramsey. Sie
wissen, wohin wir wollten.«

Sie hat sich zum Feuer gebeugt und legt frische Scheite
übereinander, im Grunde kaum mehr als dicke Äste. Die ver-
eiste Rinde zischt in den Flammen.
»Hierher kommt niemand«, sagt sie.
Allein ihr Nacken ist entblößt. Sie hat das Haar hochge-
steckt, und nur ein paar lose Strähnen kräuseln sich am Kra-
gen ihres Parkas. Ich starre auf diesen Punkt, als könnte ich
sie auf diese Weise näher locken. Wenn sie unvorsichtig nah
genug kommt, könnte ich meine Zähne in ihren Hals schla-
gen.
Entscheidend ist, dass sie nicht weggeht.
»So ist David Percy gestorben, nicht wahr? Du hast mit
ihm das Gleiche gemacht wie mit mir.«
»Was habe ich gemacht?«
»Du hast ihm vorgemacht, dass du dort draußen warst.
Einem blinden Mann, der glaubte, sein Kind verloren zu ha-
ben. Er wurde nicht von einem Geist oder dem Sandmann
gejagt. Er ist in den Wald gerannt, um dich zu suchen.«
»Vielleicht hättest du deinen Roman so enden lassen sol-
len.«
»Aber so ist es gewesen.«
»Du bist blinder, als es der alte Mann je war.«
»An welchem Punkt irre ich mich?«
»Es geht nicht ums Töten. Jedenfalls nicht für mich.«
»Erzähl es mir.«
Angela legt das Brecheisen beiseite, mit dem sie das Feuer
geschürt hat, und sieht mich an.
»Es geht darum, in den Kopf eines anderen Menschen zu
kommen in dem Moment, wo alles bloßgelegt ist«, sagt sie.
»Du glaubst, das hier wäre Recherche?«
»Es ist mehr als das. Es ist Stoff. Wir beide haben mehr
gemeinsam, als du ahnst. Zum Beispiel das Problem, sich aus
nichts etwas auszudenken.«

»Das verstehe ich nicht.«
»Wir wollten beide Bücher schreiben. Und dies ist meins.
Das Leben, das ich lebe. Die Leben, die ich nehme. Alles
fließt in meinen Roman ein. Ein Roman, der eigentlich gar
kein Roman ist, weil in gewisser Weise jedes Wort wahr ist.«
»Eine Autobiografie.«
»Nicht direkt. Ich werde die Geschichte nicht aus meiner
Perspektive erzählen. Ich weiß noch nicht, aus welcher. Ich
muss die richtige Stimme noch finden.«
»Das heißt, du klaust dein Buch genauso wie ich.«
»Ich klaue nicht, ich stelle zusammen.«
»Hast du schon einen Titel?«
»Der Todeszirkel. Gefällt er dir?«
»Ehrlich gesagt nicht besonders. Aber ich bin vermutlich
voreingenommen. Was nicht verwunderlich ist in Anbetracht
der Tatsache, dass du mich töten wirst, nur um ein weiteres
Kapitel zu beenden. Genau wie die anderen.«
Angela stürzt sich mit überraschender Heftigkeit auf mich.
Anstatt mich ihr mit den Resten meines Zornes entgegenzu-
stemmen, weiche ich instinktiv zurück. Sie packt meine Haa-
re. Die Fesseln schrammen hörbar an meinen Gelenken.
»Ich habe niemanden getötet«, sagt sie.
Ich wache wieder auf und stelle ein weiteres Mal fest, dass die
Vorstellung, in einem Geisterhaus an einen Stuhl gefesselt zu
sein, kein Albtraum ist.
Sie hat Sam.
Ich werde sterben, wenn das Feuer erlischt.
Ich kann diesen Ort nicht verlassen.
Die Hoffnung, dass ich freigelassen werde, weil ich der
Erzähler dieser Geschichte bin und der Erzähler nie in seiner
eigenen Geschichte stirbt: noch so eine Lüge.

Ich schließe die Augen und versuche, wieder einzuschla-
fen. Aber was immer es ist, was mich den nächsten Atemzug
anhalten lässt, Schlaf ist es ganz bestimmt nicht.
Sie sitzt auf einem Stuhl gut drei Meter entfernt, vielleicht
weiter. Da es im schwächer werdenden Schein des Feuers
sonst nichts anzuschauen gibt, kein Möbelstück oder Bild an
der Wand, ragt sie hoch auf, wo sie andernfalls vielleicht
schrumpfen würde. Ich habe nie gedacht, dass sie groß ist.
Aber das ist sie. Sie ist alles, was es gibt.
Sie blickt aus dem Fenster und tippt mit den Absätzen auf
den Boden. Ein Schulmädchen, das an der Bushaltestelle un-
geduldig wird.
»Kein Wunder, dass du so verkorkst bist. Mit jemandem
wie Raymond Mull als Vater.«
Angela wendet mir den Blick zu, ein matter Glanz von In-
teresse schimmert in ihren schwarzen Pupillen.
»Was weißt du von ihm?«
»Dass er dir wehgetan hat. Was hast du dabei empfun-
den?«
»Was hast du dabei empfunden?«
»Es würde eine Menge erklären.«
»Wie es kam, dass ich schon in so zartem Alter ein so bö-
ses Mädchen war? Wie ich einen blinden alten Mann an den
Punkt treiben konnte, dass er im Schneesturm in den Wald
gelaufen ist?«
»Warum du keine Persönlichkeit hast.«
»Ich habe jede Menge Persönlichkeiten.«
Sie steht auf und blickt auf einen bestimmten Punkt am
nächtlichen Horizont.
»Weißt du was? Du tust mir beinahe leid.«
»Künstler genießen gewisse Privilegien«, sagt sie. »Sie
nehmen auch gewisse Opfer auf sich.«

»Klingt wie etwas, das Conrad White sagen würde.«
»Ich glaube, er hat es gesagt.«
»Damals, als er dir erklärt hat, dass du sein vollkommenes
Mädchen bist? Seine wiedergekehrte tote Tochter?«
»Menschen sehen in mir, was sie sehen wollen.«
»Ein Spiegel.«
»Manchmal. Manchmal ist es auch jemand anders. Ein
Zwilling. Ein Geliebter. Jemand, den sie verloren haben. Oder
gerne wären.«
»Was habe ich in dir gesehen?«
»Du? Das ist leicht. Du hast deine Muse gesehen.«
Angela legt ein paar neue dürre Äste auf die Flammen.
»Kein besonders großer Holzstapel«, stelle ich fest.
»Es reicht.«
»Du bleibst nicht lange?«
Sie ignoriert die Frage.
»Wie hast du es alleine geschafft?«, versuche ich es erneut.
»Was?«
»Was mit einigen der Leichen angestellt wurde - die sind
ziemlich schwer.«
»Du musst es ja wissen.«
Ich verdränge, so gut ich kann, die Bilder von Petra in
meinem Schuppen. »Hast du mich beobachtet?«
»Ich habe immer zugeschaut. Aber das - war unerwartet.«
»War es William? Hast du ihn überredet, dir zu helfen?«
»Ich habe ihn ermutigt, seine Mitmenschen genau zu be-
trachten.«
»Aber er hat nicht die anderen aus dem Kreis umgebracht.
Oder Carol Ulrich, Pevencey. Die früheren Opfer.«
»Du hast Jane Whirter vergessen.«
»Ja. Warum ist sie nach Toronto gekommen?«
»Ich habe sie eingeladen. Sie hatte einen Verdacht. Und ich
auch - das war zumindest das, was ich ihr gesagt habe.«
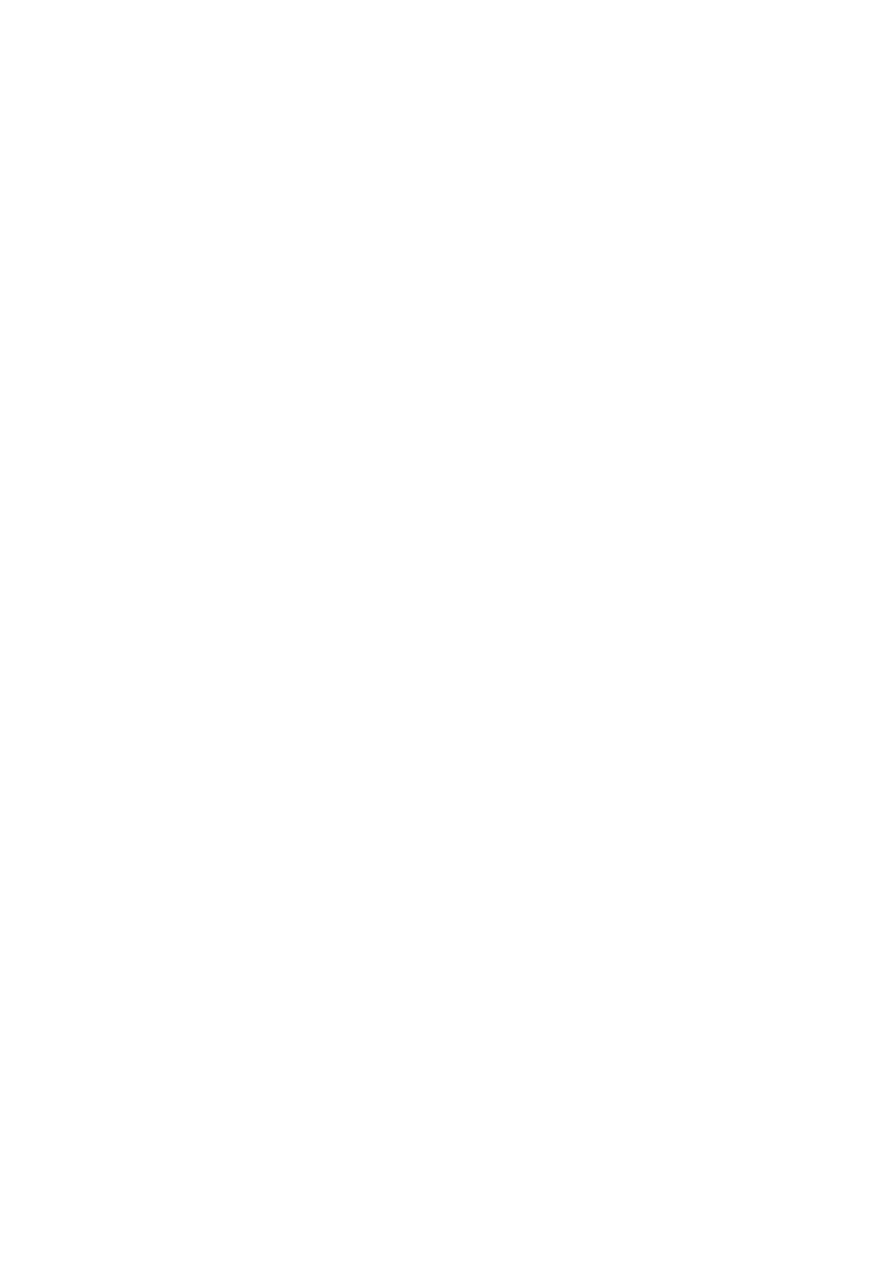
Mein Kinn sackt auf meine Brust, und ich schrecke mit
einem leisen Stöhnen wieder hoch.
»Du hast die blutigen Werkzeuge in seiner Wohnung de-
poniert«, sage ich. »In Williams Wohnung.«
»Die Polizei brauchte ein Monster. Jetzt haben sie eins.«
»Aber das falsche.«
»Hast du gehört, dass er seine Unschuld beteuert?«
»Warum tut er es nicht?«
»Ich habe ihn vom Gegenteil überzeugt.«
Angela tritt vom Kamin zurück und geht zur anderen Seite
des Raumes. Ihre Schultern sind eingesunken, ihr Haar ist
nach ein paar Tagen ohne Wasser fettig. Das Mädchen war
schwer beschäftigt. Und sie ist wieder ein Mädchen. In ihrer
Erschöpfung sind die Jahre, die hinzugekommen sind, seit sie
in Conrad Whites Wohnung zum ersten Mal ihr Tagebuch
aufgeschlagen hat, von ihr abgefallen und entblößen eine Fi-
gur, die ein wenig verloren wirkt, unsicher, wo sie ist und was
sie hierher geführt hat. Das ist natürlich eine Illusion. Noch
ein Fehler, der zu weiteren Fehlern führt. Vielleicht ist sie
mehr als alles andere eine Sammlung von Fehldeutungen.
»Warum Ramsey?«, frage ich, und sie dreht sich halb um.
»Meine Tätigkeit erfordert manchmal Improvisation.«
»Sie werden ihn suchen.«
»Nein, das werden sie nicht.«
»Warum nicht?«
»Ich habe mit ihm gesprochen. Und er - er hat mir versi-
chert, dass er aus eigenem Antrieb hierher gekommen ist.
Niemand weiß, wohin er wollte, weil er dich verfolgt hat.«
»Und du glaubst nicht, dass er dir irgendwelchen Mist er-
zählt hat?«
»In seiner Lage wäre lügen höchst unwahrscheinlich ge-
wesen.«

»Du bist nicht besonders schlau, weißt du«, rufe ich ihr
hustend nach, als sie in Richtung Flur schlendert. »Du hältst
dich vielleicht für eine Art Künstlerin. Aber das bist du nicht.
Du bist der letzte Dreck.«
Angela bleibt stehen, außerhalb des Feuerscheins, nur noch
ein Schatten, der mich mit seiner Fähigkeit zu sprechen über-
rascht.
»Du bist ein Plagiator, Patrick«, sagt sie. »Was ich mache,
ist wenigstens originell.«
Als ich hochschrecke, glaube ich zunächst, ein Geräusch hätte
mich geweckt, aber das ist es nicht. Es ist Licht. Zwei weiße
Streifen, die sich durch die Dunkelheit draußen schieben und
heller werden, umrahmt von einem immer breiteren Halb-
schatten aus Schnee.
Angela ist bei mir. Sie steht am Fenster und wippt auf den
Fersen.
»Wer ist das?«
»Die Frage ist schwerer zu beantworten, als du ahnst«, sagt
sie.
»Der Sandmann.«
»Aber das könnte jeder sein.«
»Nicht jeder. Er hat Petra und Len getötet. Er hat Conrad
und Evelyn von der Straße gedrängt. Er hat Ivan auf die Glei-
se gestoßen.«
»Das ist nicht mal eine Vermutung.«
Sie wendet sich vom Fenster ab. Die Scheinwerfer draußen
machen einen Schwenk, sodass die Seite des Fahrzeugs
sichtbar wird. Ein schwarzer Van. Der Van, den ich in der
Queen Street gesehen habe. Der Van, der davongefahren ist,
als ich Lens Leiche gefunden habe.
»Ich nehme an, ich werde ihn schon bald treffen«, sage ich.
»Möchtest du?«

»Nichts würde mir mehr gefallen, als den Mann deiner
Träume kennenzulernen.«
Angela kichert mit gespielter Verlegenheit. »So ist es
nicht.«
Der kindliche Klang ihrer Stimme erinnert mich daran,
dass all das, was sie zu dem gemacht hat, was immer sie jetzt
auch sein mag, geschehen ist, als sie klein war. Deshalb lässt
sich ihr Alter so schwer schätzen, und darum hat sie selbst im
Bett nur erwachsen gespielt. Ein Teil von ihr gehört der Ver-
gangenheit, weil ein Teil von ihr hier gestorben ist.
»Egal, wozu dein Vater dich zwingt, es ist nicht deine
Schuld.«
»Danke. Du hast mir eine große Last von den Schultern
genommen.«
»Wenn du mich laufen lässt, könnte ich dir helfen.«
»Mir helfen?«
»Zeig mir, wo Sam ist, und wir könnten alle zusammen
fliehen. Oder unserer Wege gehen. Ich würde dafür sorgen,
dass dein Vater dir nie wieder etwas tun kann. Wir wären si-
cher.«
»Ich bin sicher.«
»Angela, bitte. Du musst das nicht weiter tun. Nicht für
ihn.«
»Stattdessen könnte ich mit dir zusammen sein? Deine Er-
satzfrau? Deine Co-Autorin?«
Die Tür des Vans fällt quietschend zu. Die Nachlässigkeit
eines Handwerkers. Wenig später hört man schwere Schritte
auf der Veranda.
Ich bin der Grund, auf dem du stehst.
Die Tür geht auf. Schnee wird von den Stiefeln getreten,
dann die paar Schritte den Flur hinunter bis zum Wohnzim-
mer.

Der Schatten eines Riesen. Derselbe Schatten, der auf mich
zugekommen ist, als ich in dem Feld zusammengebrochen
bin, aber drinnen wirkt er seltsam vertraut. Die Umrisse eines
Mannes, den ich schon einmal gesehen habe.
»Ich möchte dir meinen Bruder vorstellen«, sagt sie.
Die Gestalt tritt zögernd an den Rand des Feuerscheins, die
behandschuhten Hände über dem Bauch gefaltet. Und grinst
ein zitterndes, gummilippiges Grinsen, als vesuchte er ver-
geblich, es zu unterdrücken.
»Len?«
»Unter dem Namen kanntest du ihn«, sagt Angela und tritt
behutsam an seine Seite, ohne ihn zu berühren. »Die Jungfrau
Len. Aber wie ich war er im Laufe der Jahre unter verschie-
denen Namen bekannt. In verschiedenen Inkarnationen.«
»Aber ich habe dich gesehen. In der Gasse.«
»Du hast gesehen, was du zu sehen glaubtest«, sagt Len,
und sein Grinsen wird breiter. »Darauf haben wir gezählt.
Darauf haben wir immer gezählt.«
»O Gott.«
»Alles in Ordnung.«
»O Gott.«
Der Raum schwankt. Nein, nicht der Raum, sondern ich.
Ich mache eine zappelnde Bewegung. Wie ein Fisch im
Aquarium.
»Ich seh mich mal oben um«, sagt Angela zu ihm.
Len nickt. Als sie an ihm vorbei in den Flur geht, streift sie
seine Nylonjacke, ein Geräusch wie von Aluminiumfolie, die
mit einem Messer glatt gestrichen wird.
»Das warst du«, sage ich. »Bei Michelle Carruthers’ Be-
erdigung. Mull war auch dein Vater.«
»Soweit wir es wissen.«
»Und du wurdest genau wie deine Schwester in Pflege ge-
geben.«

»Geteilte Erfahrungen können einen machtvollen Bund
zwischen Menschen schmieden.«
»Ihr habt euch also gedacht, ihr nehmt das Leben anderer
Menschen, um damit eures zu ersetzen.«
»Zu einfach. Viel zu einfach.«
Len spuckt auf den Boden und betrachtet fasziniert den
weißen Schleim auf den Dielen. In seinem Blick erkenne ich
die Leere, die sterile Gleichgültigkeit.
»Du bist ein guter Schauspieler.«
»Ich bin nicht Len«, sagt er und macht einen bedrohlichen
Schritt in den Raum. »Falls du das meinst.«
»Len war jemand. Eine Rolle, aber mit einer Persönlich-
keit. Während du gar nichts bist.«
»Versuchst du, mich zu beleidigen?«
»Selbst wenn, es würde nicht funktionieren. In dir gibt es
nichts, was man verletzen kann. Genau wie bei deiner
Schwester.«
»Angela ist eine Künstlerin.«
»Und du der König von ›Nichts ist, wie es scheint‹.«
»Nein.«
»Der Sandmann.«
»Nein.«
»Wer ist es dann?«
»Der, vor dem du am meisten Angst hast.«
Len zieht die Handschuhe aus und stopft sie in die Tasche.
Seine großen Hände sind mit schwarzen Linien überzogen.
Schmutzige Hände.
»Wo ist mein Sohn?«
»Das ist ein Geheimnis.«
»Du wirst ihm wehtun, nicht wahr? Du hast ihm schon
wehgetan.«
»Aber, aber, du solltest dich nicht so aufregen.«

»Er ist bloß ein Kind. Welchen Unterschied macht das für
dich?«
»Wir waren alle einmal Kinder.«
Ich schlucke eine Welle der Übelkeit herunter. Meine
Kehle brennt.
»Du warst es«, sage ich. »Du hast die Mädchen in Whitley
verschleppt.«
»Das war vor meiner Zeit.«
»Wer dann?«
»Das war er.«
»Mull? Bist du sicher, dass nicht du deine kleine Schwester
beschattet hast? Dass nicht du es warst, der sie wollte?«
»Ich habe sie beschützt.«
»Wie?«
»Indem ich dafür gesorgt habe, dass Daddy wegging.«
»Du hast ihn getötet?«
»Wir mussten uns eine neue Welt erschaffen«, sagt er und
zeigt mir die abgeschliffenen Stumpen seiner Zähne. »Und
darin war für ihn kein Platz.«
Len beobachtet, wie meine Augen sich nach innen verdre-
hen.
»Ich fühle mich nicht besonders«, sage ich.
»Das ist die Austrocknung des Körpers.«
»Kann ich einen Schluck Wasser haben?«
»Das ist gut. Das ist witzig.«
Er tritt ans Feuer, hebt einen Ast hoch und überlegt, ihn in
die Flammen zu werfen, bevor er ihn nach einem Moment
zurück auf den Stapel vor dem Kamin legt.
Oben öffnet und schließt Angela Türen und packt Sachen
in eine Tasche. Wenn ich die Zimmer richtig mitgezählt habe,
ist sie beinahe fertig.

»Wer war es?«, frage ich. Ich merke, dass ich mich über-
geben muss, aber mir bleibt nur noch wenig Zeit. »Die Lei-
che, die ich für dich gehalten habe.«
Len bleibt direkt vor mir stehen, entfaltet die Hände und
lässt sie neben dem Körper baumeln.
»Beim National Star müsste demnächst eine Stelle frei
werden«, sagt er.
Und dann übergebe ich mich. Ein schmerzhaftes Würgen,
ein Schwall Galle ergießt sich auf den Fußboden.
Angela taucht mit einem Seesack im Flur auf. Schwarze
Flecken sickern durch den Stoff. Sie wechselt einen Blick mit
Len.
»Ich glaube, es wird Zeit«, sagt sie.
Sie wendet sich zum Gehen, bleibt noch einmal stehen,
kommt auf mich zu, schiebt eine Hand in meine Tasche und
zieht das Diktafon heraus.
»Ich habe noch andere Bänder«, sage ich.
»Jetzt haben wir sie alle.«
»Es gibt Kopien.«
»Nein, gibt es nicht. Und deine Tagebücher haben wir
auch. Das letzte hast du im Handschuhfach liegen lassen.«
Angela fragt Len, ob er die Küche überprüft hat, und er
gibt mit gesenktem Kopf zu, es vergessen zu haben. Sie sieht
auf die Uhr und gibt ihm zwei Minuten.
Er macht sich gehorsam auf den Weg, während Angela
sich in die Tür lehnt und an mir vorbei aus dem Fenster
schaut. Als ob ich gar nicht da wäre. Schon tot.
»Du irrst dich in mir«, sage ich, und das unerwartet fol-
gende Lachen lässt warme Spucke über mein Kinn sickern.
»Ach ja?«
»Du kennst noch nicht meine ganze Geschichte.«
»Die Stimme der Verzweiflung.«
»Es ist die Wahrheit.«

»Ich weiß alles, was ich über dich wissen muss.«
»Nein, weißt du nicht. Es gibt ein Geheimnis, das ich so
lange bewahrt habe, dass ich mich oft selbst kaum daran er-
innere. Etwas, das alles verändert.«
»Das ist wirklich jammerschade«, sagt sie, aber sie hat den
Blick auf mich gerichtet.
»Ich bin der Letzte aus dem Kreis. Und ohne wird etwas
fehlen. Dein Buch wird eine Lücke haben. Weil Mr. Langwei-
lig nicht der ist, für den du ihn hältst. Die Figur hat einen
Bruch.«
In der Küche zieht Len eine Besteckschublade zu weit auf,
sodass sie samt Messern und Gabeln scheppernd zu Boden
fällt. Laut fluchend bückt er sich, um sie aufzuheben.
Angela kommt näher.
»Dann rede weiter«, sagt sie.
»Versprich mir, dass Sam nichts passiert, wenn ich es dir
erzähle.«
»Ich hab dir doch gesagt, ich würde nie -«
»Ich weiß, dass du das nicht bist. Mord ist nicht deine Ab-
teilung. Es ist seine.«
»Vielleicht ist es schon geschehen.«
»Vielleicht. Und wenn nicht, wird er es tun. Um Sam zum
Schweigen zu bringen oder um ihn zu bestrafen oder einfach
weil es das ist, was er macht.«
»Und du meinst, dein kleines Geheimnis könnte ihn auf-
halten?«
»Nein, aber vielleicht du.«
»Warum sollte ich etwas für die Lüge eines Toten tun?«
»Weil es keine Lüge ist.«
»Woher soll ich das wissen?«
»Du wirst es erkennen, wenn du es hörst.«
Am Ende des Flures schiebt Len eine Schublade zu und
reibt sich die Hände, um sie zu wärmen.

»Gut«, sagt sie und kann ihr Interesse nicht verhehlen. »Ich
höre zu.«
Also erzähle ich es ihr. In einem gedrängten Flüstern, ohne
Punkt und Komma, knapp und ungeschönt. Nicht was ich
erzähle, beweist, dass es wahr ist. Es ist meine Stimme, die
bricht, sobald ich ansetze, ein dünner Ton, der im Laufe der
Erzählung immer dünner wird.
Ich erzähle Angela, wie ich Tamara getötet habe. Meine
Frau. Und wie uns das beide zu Mördern macht.
Es war keine Beihilfe zum Selbstmord, nicht die Ausfüh-
rung eines gemeinsam gefassten Plans. Es war allein meine
Idee. Das muss ganz klar sein. Aber obwohl sie schlief, als ich
ihr die Spritze in den Arm drückte, glaube ich, dass Tamara,
als sie aufwachte und sah, was ich machte, dankbar war und
begriff, dass ich es aus Liebe tat. Denn das tati ch. Vielleicht
war es falsch im Sinne bestimmter Gesetze oder Götter, viel-
leicht hat es mir für den Rest meines Lebens friedlichen
Schlaf und schuldlose Träume geraubt, vielleicht ist es die
Ursache für die völlig unerwarteten Tränenausbrüche in den
letzten Jahren - vielleicht habe ich es zu früh getan -, aber ich
wollte sie nur von den Schmerzen erlösen, die sie litt, und den
viel schlimmeren, die noch kommen würden. Ich wollte so
viel Mut beweisen wie sie, wenn sie ihre weißen Lippen zu
einem Lächeln spannte, wann immer Sam in ihrer Nähe war.
Der Krebs hatte die Vorarbeit geleistet. Er war der Schurke,
der sich in ihr Zimmer geschlichen hat, ohne das Licht anzu-
machen, nicht ich.
Aber diese Gedanken haben das, was ich getan habe, nicht
leichter gemacht. Das, was ich jetzt zum ersten Mal mit einem
anderen geteilt habe. Mit Angela, die zusieht, wie die Worte
in grauen Wölkchen beschlagenen Atems verwehen.
Len taucht wieder in der Tür auf und atmet tief ein, als
wollte er einen Duft in der Luft genießen.

»Fertig«, sagt er.
Angela wendet sich ihm zu, und nichts - gar nichts - in
ihrem Ausdruck deutet darauf hin, dass sie gerade etwas
Überraschendes gehört hat. Sie ist gut darin, Dinge zu ver-
bergen. Vielleicht hat sie aber auch nichts zu verbergen, weil
sie entschieden hat, dass das Gehörte nicht viel mehr als der
Bluff eines Mannes war, der sein Blatt überreizt hat. Der leere
Blick, den sie mir zuwirft, als sie Len zur Tür folgt, lässt sich
unmöglich deuten.
Ich höre, wie sie das Haus verlassen. Len bleibt noch ein-
mal stehen, um einen letzten Blick in den Flur zu werfen.
Beim Hinausgehen zieht er die Tür nur halb zu. Der Wind
fährt seufzend durchs Haus, traurig, sie gehen zu sehen.

35
Seit Stunden habe ich kein Gefühl mehr in den Beinen. Ich
hatte gehofft, dass das einer der Vorzüge des Todes durch
Erfrieren sein würde - zumindest der Schmerz bleibt auf ein
Minimum beschränkt. Doch anscheinend habe ich mich geirrt.
Der Körper lässt ein Gefühl nicht so leicht los, selbst wenn es
nur noch das Gefühl ist, in Flammen zu stehen. Erfrierungen.
Klingt nach Kälte, nicht wahr? Aber versuchen Sie mal, einen
Eiswürfel in der Hand zu halten. Es ist nur am Anfang kalt.
Danach brennt es.
Das Schreien hilft. Meine Stimme kämpft gegen die Dun-
kelheit an, die näher rückt, weil die Flammen im Kamin klei-
ner werden. Und selbst jetzt noch habe ich die Vorstellung,
dass mich vielleicht jemand hören könnte. Vielleicht hat An-
gela einen deus ex machina mit in die Handlung eingebaut -
einen freundlichen Nachbarn? Einen örtlichen Polizisten? Der
zur Tür hereinkommt und mich zum Sportman’s Motel fährt,
wo mich eine heiße Dusche und ein doppelter Whiskey er-
warten. Und ich werde durch meine Erfahrungen geläutert
sein, der Mann, den sie als Empfänger ihrer grausamen Liebe
erwählt hat. Ihr Lieblingsbuch war schließlich Der Magus.
Aber dies ist kein Buch.
Ich atme ein und heule erneut laut auf, als ich plötzlich das
Radio höre.
Es muss die ganze Zeit gelaufen sein, seit ich zuletzt auf-
gewacht bin, aber der Sender ist nur schwach eingestellt, so-
dass das Signal von Zeit zu Zeit ganz verstummt. Doch jetzt
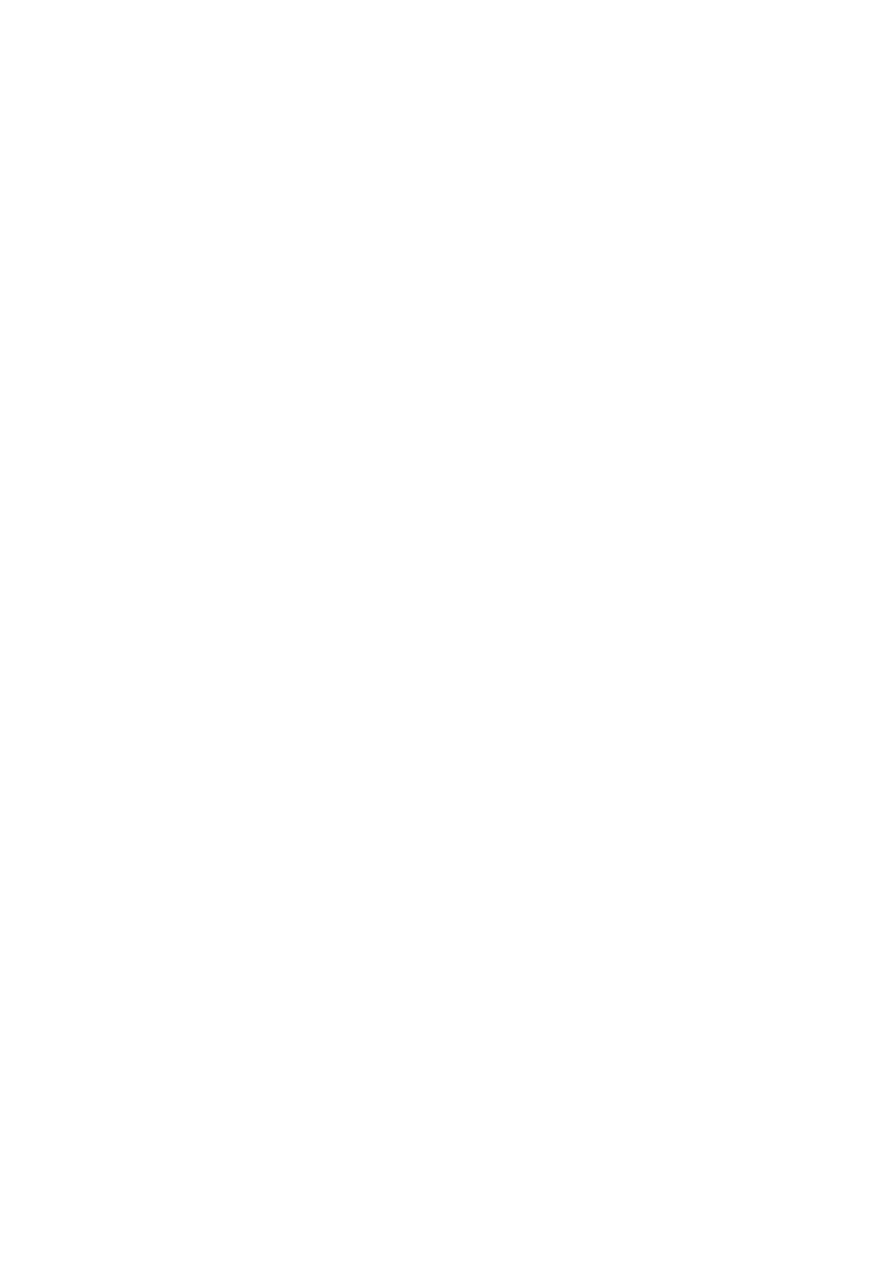
hat es seine Frequenz wiedergefunden, und die letzten Takte
von »Raindrops Keep Falling on My Head« verklingen im
Dunkel.
Es ist ein altes Transistorradio vor meinen Füßen. Die he-
rausgezogene Antenne schwankt im kühlen Luftzug. Ein
kleines blaues Licht an der Senderskala lässt den Boden im
näheren Umkreis schimmern wie einen flachen Swimming-
pool.
Der Moderator meldet sich mit der Information, dass ich
Whitleys Easy-Listening-Sender lausche (»Die sanftesten
Klänge nördlich des Lake Superior«). Es folgen: Perry Como,
Streisand, die Carpenters. »Und drücken Sie Ihren Schatz ein
wenig fester«, sagt der DJ mit hörbarem Augenzwinkern,
»denn als Nächstes kommt ein Evergreen - von Paul Anka!«
Ich frage mich, ob Angela das Radio zum Trost oder als
zusätzliche Bestrafung angelassen hat? Easy Listening? Viel-
leicht war es der einzige Sender, den sie gefunden hat. Viel-
leicht steckt in der Wahl aber auch eine Botschaft. Weich-
ei-Musik, um einen Mann ohne Fantasie ins Jenseits zu schi-
cken.
And they call it puppy love. But I guess they’ll never know
…
Das Feuer ist kaum mehr als ein Haufen zischender Glut;
rote Sterne, die vor schwarzem Stein funkeln. Bald wird es
kalt und völlig erloschen sein. Und der zusammengesunkene
Mann daneben ein Schatten.
Ich habe es ihr erzählt.
Der Gedanke trifft mich wie ein Stich in die Brust, gefolgt
von dem zitternden Bemühen, tief Luft zu holen. Ich schnaube
durch die Nase, und Blut spritzt über meine Hose.
Ich habe ihr die Geschichte erzählt. Es war kein Traum.
Ich habe es ihr erzählt.

Zwischen einer Reminiszenz an Jefferson Airplane und
»Careless Whisper« vermeldet das Radio zwei entmutigende
Nachrichten: Es ist 3:42 Uhr, und die Außentemperatur be-
trägt minus neunzehn Grad. Ich hatte mich an die Hoffnung
geklammert, es vielleicht bis zum Morgen zu schaffen, und
sei es nur, um die Eisblumen an den Fenstern und die Kontu-
ren der kahlen Äste dahinter zu sehen. Aber offenbar soll mir
auch dieser kleine Trost verwehrt bleiben.
Als Nächster erklingt Engelbert Humperdinck. Den Namen
fand ich schon immer toll.
Please release me. Let me go …
Es folgen die Nachrichten. Die zweite Meldung (nach den
täglichen Opferzahlen aus dem Nahen Osten) ist brandaktuell,
und ich konzentriere mich erst nach der Hälfte auf den von
der Antenne des Radios nur bruchstückhaft aufgefangenen
Bericht.
»Der Sohn des Schriftstellers … einer Straßenecke in Dry-
den, Ontario … in ein örtliches Krankenhaus gebracht und auf
mögliche … zurzeit unbekannt … scheint unversehrt, obwohl
es im Augenblick noch keine offizielle Stellungnahme über
seine Aussagen bezüglich der Identität seiner Entführer …
offenbar ebenfalls vermisst und deshalb nicht erreichbar für
eine … unbestätigte erste Berichte, dass der Junge Informa-
tionen nennen konnte, die zur Auffindung seines Vaters …
keine weiteren Fragen beantworten, bis sie den Hinweisen
nachgegangen … Sport: Die Leafs kassieren erneut eine
knappe Niederlage …«
Ein weiterer Bericht über den neuesten Stand der Entwick-
lungen wird für dreißig Minuten später angekündigt. Damit
habe ich etwas, wofür es sich lohnt, weiterzuatmen und gegen
den Schlaf anzukämpfen, der kein Schlaf ist. Verrauschte
Versionen von »Everybody Plays the Fool« und »Someday
We’ll Be Together« mitzusummen.

Dann kommen wieder Nachrichten. Diesmal ist der Emp-
fang gut genug, um die Fakten mitzubekommen.
Sam Rush, der Sohn des Bestseller-Autors, wurde allein in
einem Wohngebiet von Dryden herumirrend aufgegriffen, der
nächsten Ortschaft am Trans-Canada-Highway nach Whitley.
Ersten Berichten zufolge ist er bei guter Gesundheit und hat
gegenüber der Polizei eine Aussage gemacht, die helfen
könnte, seinen Vater zu finden, der vor Kurzem ebenfalls als
vermisst gemeldet wurde. Die Polizei versucht zurzeit, ein
Farmhaus zu lokalisieren, in dem der Junge festgehalten wor-
den ist. Dabei stützt sie sich auf geografische Angaben, die
der Junge anhand von Sternbildern über die Lage des Hauses
machen konnte. Im Moment gibt es keine Hinweise auf die
Identität der Entführer, da der Junge bislang noch keine ge-
nauen Personenbeschreibungen machen konnte. Die Polizei
rät jedoch, Kinder in den kommenden Tagen vorsichtshalber
nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Es wurde allerdings versi-
chert, dass die Ermittlungen im Fall Rush ab sofort oberste
Priorität hätten. Ein Sprecher der Polizei betonte ausdrücklich,
dass es ungeachtet der Aussagen des Jungen keine Hinweise
darauf gebe, dass zwischen Sam Rushs Entführung und dem
Verschwinden seines Vaters ein Zusammenhang bestehe.
Ramsey wird nicht erwähnt. Auch nichts über Tim Earhe-
art, obwohl die Polizei ihn mittlerweile identifiziert haben
müsste. Bald werden sie anfangen, Verbindungen zu ziehen.
Aber Angela und Len werden sie nicht finden. Da bin ich mir
sicher. Sie sind verschwunden und werden nicht zurückkom-
men. Mit anderen Namen und Gesichtern werden sie über
Grenzen schlüpfen und sich dabei häuten. Und irgendwann
werden sie sich irgendwo einem anderen Kreis anschließen.
Und jemand wird wieder anfangen, an den Sandmann zu
glauben.

Der Empfang des Radios wird schwächer. Die Batterien
waren von Anfang an ziemlich hinüber. Sie wollte, dass ich
die Nachrichten höre, damit ich es weiß. Aber danach sollte
wieder Stille einkehren.
Und so ist es mit einem letzten Rauschen gekommen.
Draußen ist der Wind vollständig abgeflaut. Schneewehen
drängen gegen die Mauern wie sich brechende Wellen, aber
selbst das Haus scheint den Atem anzuhalten.
Sam lebt.
Mit dieser Tatsache, diesem schmerzstillenden Wissen
kann ich loslassen.
Ich habe mich heftiger gewehrt, als ich ahnte. Um für ihn
da zu sein. Nur für den Fall, dass er seinen Weg aus dem
Sturm hierhergefunden hätte. Stattdessen ist er weit weg in
der Obhut anderer. Ich wünschte, es wären meine Arme, die
ihn halten, mein Trost, der ihn in den Schlaf wiegt. Aber egal.
Wir hatten unsere Gutenachtgeschichten. Und er kann sich an
meine Stimme klammern.
Gute Nacht, mein Sohn. Träume süß.
Vielleicht finden sie mich. Vielleicht sogar noch, bevor
mein Atem in meiner Brust kristallisiert ist. Im Radio haben
sie gesagt, dass man nach mir sucht und dabei der Beschrei-
bung folgt, die Sam ihnen gegeben hat, dem Norden, Westen
und Osten, die er von den Sternen abgelesen hat. Wahrschein-
lich wird es zu spät sein. Aber selbst jetzt, während ich mich
dem Unvermeidlichen füge, kämpfe ich darum, am Leben zu
bleiben, an diesem Augenblick festzuhalten. Um eine weitere
Minute. Um die Chance, das Morgengrauen zu erleben. Um
die Möglichkeit, Sam noch einmal zu sehen.
Es bleibt sogar Zeit, von Rache zu träumen. Für den Plan,
das Haus in der Euclid Street zu verkaufen, Toronto zu ver-
lassen und mit Sam irgendwo ganz anders hinzugehen. Dann,
tausend Meilen entfernt, werde ich mich ans Werk machen,

Angela das Einzige zu nehmen, was ihr vielleicht etwas be-
deutet. Den Todeszirkel. Wenn ich es hier rausschaffe,
schreibe ich es vielleicht sogar selbst. Ich stoße ihr einen
Dolch ins Herz. Ich stehle das Buch zurück, dass sie aus den
Geschichten der Toten zusammengestellt hat.
Aber das sind nur Schlummergedanken. Die Schwerelo-
sigkeit vor dem Aufprall. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten, so
kommt es mir vor, erstrebe ich gar nichts, suche nichts. Kein
Neid, keine unerwiderte Bewunderung, kein hohles Verlan-
gen, wahrgenommen zu werden. Keine Angst.
Letzte Gedanken?
Da ist die Idee, dass ich noch ein wenig zu strampeln, viel-
leicht noch eine Lehre zu ziehen habe, wie man sie am Ende
von Romanen findet. Etwas Erbauliches und Erhebendes. Ich
bin sicher, mir würde etwas einfallen, wenn ich die Zeit hätte,
aber die habe ich nicht. Denn hier kommt es: eine Wolldecke,
die über meine Schultern und meinen Kopf gezogen wird.
Dunkelheit, die jegliches Licht erstickt. Aber bevor sie mich
übermannt, überrasche ich mich selbst mit einem Lachen.
Eine schreckliche, zitternde, hustende Heiterkeit, ein gespens-
tischer Laut, der in den leeren Räumen des Farmhauses wi-
derhallt. Das Gelächter eines Mannes ohne Geschichte, der
erkennt, dass das, was ihn hierhergeführt hat, vielleicht eine
gute gewesen wäre, wenn es nur ein Gegenüber gäbe, einen
geneigten Leser, dem er sie erzählen könnte.

Danksagung
Mein Dank gilt allen, die diesem Buch - und mir beim
Schreiben - geholfen haben - sei es als Zuhörer, Fragensteller,
Lektoren oder Freunde: Maya Mavjee, Julia Wisdom, John
Parsley, Peter Joseph, Anne O’Brien, Anne McDermid, Mar-
tha Magor, Vanessa Matthews, Sally Riley, Lesley Thorne,
Brent Sherman und Sean Kane.
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Hohlbein, Wolfgang Nemesis 5 Die Stunde des Wolfs
Einfuhrung in die Linguistik des Deustchen Morphologie
Die 100 des Jahrhunderts Komponisten
Einführung in die Linguistik des Deutschen Semantik
Die Leiden des jungen Werthers
Die Leiden des jungen Werthers Interpretation
Die Leiden des jungen Werthers Interpretation 2
Die Germania des Tacitus Deutsch von will Vesper (1906)
Die Erotik des Mannes
Blish, James Die Tochter des Giganten
Charmed 20 Die Saat des Bösen Torsten Dewi
Monroe, Robert A Über die Schwelle des Irdischen hinaus
Cloutier, Daniel Cubuyata Die Rueckkehr des Propheten
Rainer Maria Rilke Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (Auszug) 2
Goethe Die Leiden des jungen Werther
Cassandra Clare, Maureen Johnson Die Chroniken des Magnus Bane 02 Die Flucht der Königin
Meyer, Kai Sieben Siegel 03 Die Katakomben Des Damiano
Morgan, Sarah Gestohlene Stunden des Gluecks
więcej podobnych podstron