

FRANCIS DURBRIDGE
Die Brille
EAST OF ALGIERS
Kriminalroman
Wilhelm Goldmann Verlag

Die Hauptpersonen
Paul Temple
Steve Temple
David Foster
Tony Wyse
Simone Lalange
Judy Wincott
Sam Leyland
Pierre Rostand
Audry Bryce
Horst Schultz
Patrick O'Halloran
Szoltan Gupte
Schriftsteller
seine Frau
Angestellte einer Erdölgesellschaft
Reisebekanntschaft der Temples
Mitglieder verschiedener
Gangsterbanden
Nachtlokalbesitzer
Fremdenführer
Kunsthändler
Der Roman spielt in Paris, Nizza, Algier und Tunis.
1. Auflage Mai 1967 - 1.-15. Tsd.
2. Auflage November 1968- 16.-25. Tsd.
3. Auflage Januar 1974 - 26.-37. Tsd.
4. Auflage Mai 1981 - 35.-43. Tsd.
Made in Germany 1981
© der Originalausgabe 1959 by Paul Temple
© der deutschsprachigen Ausgabe 1967 by Wilhelm Goldmann Verlag, München
Aus dem Englischen übertragen von Peter Th. Clemens
Herausgegeben von Friedrich A. Hofschuster
Umschlagentwurf: Atelier Adolf & Angelika Bachmann, München
Umschlagfoto: Richard Canntown, Stuttgart
Satz: Presse-Druck, Augsburg
Druck: Mohndruck Graphische Betriebe GmbH, Gütersloh
Krimi 2287
Lektorat: Friedrich A. Hofschuster - Herstellung: Hany Heiß
ISBN 3-442-02287-8
}
}

4
1
»Pardon, Monsieur, ist dieser Stuhl besetzt?«
»Leider ja.«
Es geschah schon zum zehntenmal, daß ein ent-
täuschter Franzose sich abwandte, als ich meine
rechte Hand besitzerisch auf den Stuhl legte, den ich
für Steve, meine Frau, freihielt. Es war zur Aperitif-
stunde, und die Tische aller Cafés beiderseits der
Champs-Elysees waren besetzt. Die neun Herren, die
von mir gehindert worden waren, sich auf Steves Platz
niederzulassen, hatten anderswo Stühle gefunden und
beobachteten mich nicht ohne Argwohn. Aus ihren
Mienen war zu schließen, daß sie zu glauben began-
nen, die von mir erwartete Person sei ein Gebilde
meiner Phantasie. Steve selbst hatte mir versichert, bis
um zwölf Uhr würde sie ihre Einkäufe mit Leichtig-
keit erledigt haben. Also hatten wir uns um zwölf im
Café Fouquet verabredet. Aber inzwischen war es
leider schon zwanzig Minuten vor eins.
Glücklicherweise war das Wetter schön, und die
Zeit verging recht angenehm. Der Arc de Triomphe
stand lichtgrau gegen einen blauen Himmel, und die
Sonne schien warm genug, um die meisten Gäste zu
verlocken, lieber an den ins Freie gestellten Tischchen
zu sitzen als im schattigen Inneren des Cafés. Was
sich vor meinen Augen abspielte, glich einer unter-
haltsamen Show. Die hübschen Pariser Mädchen in
ihrer Frühjahrsgarderobe waren sich der vielen

5
Männeraugen wohl bewußt, von denen sie beobachtet
wurden, während sie mit selbstsicherer Eleganz auf
dem breiten Gehsteig vorüberspazierten. Immer
wieder stoppten da und dort Taxis an der Bordschwel-
le, um ihre Fahrgäste in eins der vielen Cafés zu
entlassen. Auf der mittleren Fahrbahn der breiten
Prachtstraße rasten Autos in sechs Reihen nebenein-
ander dahin. Jedesmal, wenn die Verkehrsampeln auf
Rot wechselten, kreischten ihre Reifen bei den
erbarmungslosen Bremsmanövern. Und eine halbe
Minute später, beim Lichtwechsel auf Grün, heulten
die Motoren beim Schnellstart auf, als sei jeder Fahrer
bemüht, das kurze Wettrennen bis zur nächsten
Straßenkreuzung zu gewinnen.
Ich bestellte eben den zweiten Martini, als an der
Bordschwelle vor mir ein Kleintaxi stoppte. Der
Fahrer öffnete die Tür, und ein Paar schlanker nylon-
bestrumpfter Beine schwang sich auf den Gehsteig.
Zwar erkannte ich diese Beine, aber ich war zunächst
außerstande, mehr von ihrer Eigentümerin zu sehen,
denn diese blieb noch hinter der Menge Päckchen und
Kartons verborgen, die sie vor sich her durch die
schmale Tür zu schwenken versuchte. Der Fahrer, der
eilfertig ausgestiegen war, nahm sich der zwei größten
Kartons an. Nun endlich wurde auch Steve im ganzen
sichtbar. Sie lächelte mir zu und erklärte dem Fahrer,
daß ich das Fahrgeld bezahlen würde.
»Darling«, begrüßte sie mich, »nicht ein Sou ist mir
übriggeblieben. Aber ich habe einige der wundervol-

6
len Läden entdeckt! Wahrhaftig, nirgendwo sonst auf
der Welt gibt es so etwas wie die Rue St. Honoré! Oh,
Darling - das ist Judy Wincott. Sie wird mit uns einen
Aperitif trinken.«
Ich hatte undeutlich wahrgenommen, daß hinter
Steve noch eine zweite weibliche Gestalt dem Taxi
entstiegen war. Doch die Sache mit dem Fahrer und
dem Bezahlen und den Paketen und der ganzen
Wirkung von Steves Ankunft hatte meine Aufmerk-
samkeit von ihr abgelenkt. Nun wandte ich mich ihr
zu, um sie zu begrüßen. Sie war ein knapp mittelgro-
ßes Mädchen, etwa Anfang Zwanzig. Man konnte sie
als gutaussehend bezeichnen. Jedenfalls war sie ein
moderner Typ, dem man auf Titelseitenfotos und
ganzseitigen Werbeanzeigen häufig genug begegnet,
aber sehr sympathisch fand ich sie nicht. Sie wirkte
irgendwie aggressiv. Oder vielleicht intelligent und
unerhört praktisch. Ich habe nichts gegen intelligente
Frauen. Ich meine nur, daß sie es lieber nicht so sehr
zeigen sollten.
»Oh, Mr. Temple«, sagte sie, während ich sie und
Steve durch das Gewirr der Tischchen und Stühlchen
lotste und dabei die beiden größten Kartons über den
Köpfen der anderen Gäste dahinbalancierte, »oh, Mr.
Temple, ich hoffe, Sie nehmen mir nicht übel, daß ich
die Gelegenheit nutze, Sie kennenzulernen. Ist es
wirklich wahr, daß Ihre Romane auf tatsächlichen
Vorkommnissen beruhen, mit denen Sie zu tun
hatten?«

7
»Ja, es ist wirklich wahr«, erwiderte ich etwas ge-
quält. »Nehmen Sie Platz, Miss Wincott. Ich werde
versuchen, noch ein Stühlchen zu bekommen.«
Steve hatte sich schon hingesetzt und gruppierte
ihre Einkäufe rings um ihre Füße. Miss Wincott ließ
sich auf meinem Stühlchen nieder. Ich stellte die
beiden Kartons ab und winkte dem Kellner, ein drittes
Stühlchen an unseren Tisch zu bringen.
Miss Wincott blickte zu mir empor, als erwarte sie
irgendwelche umwerfenden Offenbarungen zu hören,
und sagte: »Oh, es ist verblüffend, sich vorzustellen,
daß solche Sachen wirklich passieren!« Ihre etwas
schrille Stimme hatte einen leichten, aber unüberhör-
baren amerikanischen Akzent.
»Was Sie in den Büchern lesen«, entgegnete ich,
»ist nicht so außergewöhnlich. Mein Kummer ist, daß
ich über die verblüffendsten Fälle nicht schreiben
kann. Keiner würde mir glauben.«
»Ach, tun Sie es doch einmal«, gurrte Judy Wincott
mit betörendem Lächeln. »Ich würde Ihnen auf jeden
Fall glauben!«
Der Kellner kam mit einem eisernen Hocker, und
dann saßen wir zu dritt recht beengt um den kleinen
Tisch.
»Miss Wincott war sehr hilfsbereit«, erklärte Steve,
nachdem ich die Getränke bestellt hatte. »Es wäre mir
niemals gelungen, die gewünschten Schuhe zu finden,
wenn sie mich nicht zu Chisos Schuhbar geführt
hätte.«

8
»Sie kennen Paris gut, Miss Wincott?« fragte ich.
»Oh, längst nicht so gut, wie ich möchte. Aber ich
kenne die wichtigsten Straßen. Ich war schon einige
Male mit meinem Vater hier. Er kommt jedes Jahr
nach Europa, um alte Bilder aufzuspüren und antike
Möbel und andere Sachen dieser Art. Er ist Benjamin
Wincott, der Antiquitätenhändler, wissen Sie. Er hat
ein sehr bedeutendes Geschäft in New York. Viel-
leicht haben Sie davon schon gehört?«
»Nein, ich fürchte, ich habe noch nicht davon ge-
hört.«
»Es ist weithin bekannt«, versicherte Miss Wincott
selbstzufrieden. »Natürlich muß Dad viel reisen. Es ist
nicht gut, sich auf anderer Leute Urteil zu verlassen,
wenn so viel Geld auf dem Spiel steht. Außerdem hat
Dad einen geradezu verblüffenden Instinkt für wirk-
lich wertvolle Dinge. Es gibt nur wenige Länder auf
dieser Erde, die er noch nicht besucht hat. Wir hatten
eben einen kleinen Abstecher nach Tunis gemacht,
um eine Sammlung seltener alter Bernstein-
schmuckstücke zu kaufen. Mrs. Temple erzählte mir,
daß Sie beide beabsichtigen, in einem oder zwei
Tagen selbst nach Tunis zu reisen.«
Ich tauschte einen heimlichen Blick mit Steve und
fand meinen Argwohn bestätigt, daß Miss Wincott
uns mehr aus eigenem Entschluß mit ihrer Gegenwart
beglückte; Steves Einladung war wohl nur eine
unumgängliche Höflichkeit gewesen.
»Ja«, gab ich zu. »Wir werden auch nach Tunis

9
reisen, nachdem wir uns Algier ein wenig angesehen
haben.«
»Um Stoff für einen Roman zu sammeln?« fragte
Judy Wincott eifrig.
»Das ist nicht der eigentliche Grund der Reise.
Aber man kann ja nie wissen.«
Der Kellner brachte die bestellten Gläser. Judy
Wincott bekam einen Champagnercocktail. Ich mußte
ein leichtes Gruseln unterdrücken, als ich die Hand
sah, mit der sie ihr Glas ergriff. Ihre Fingernägel
ragten mindestens anderthalb Zentimeter über die
Fingerkuppen hinaus, ganz spitz gefeilt und blutrot
lackiert. Sie nahm einen Schluck, dann lachte sie leise
vor sich hin, als sei ihr eine amüsante Erinnerung
gekommen.
»Oh«, sagte sie, »ich erlebte weiß Gott eine ver-
drehte Zeit in Tunis! Hören Sie, ich überlege, ob Sie
vielleicht einen jungen Mann treffen können, den ich
während dieser paar Tage recht gut kennenlernte. Sein
Name ist David Foster. Er arbeitet für die Trans-
Afrika-Öl-Company.«
Sie blickte mich fragend an. Da ich kein Hellseher
bin, konnte ich ihr nicht sagen, ob ich diesen Mr.
Foster treffen würde oder nicht. Es interessierte mich
auch nicht. Doch ich brannte darauf, Steve endlich zu
fragen, was sie eigentlich in diesem Berg Pakete hatte.
Ich zuckte die Achseln und murmelte: »Nun, Tunis
ist eine ziemlich große Stadt, habe ich mir sagen
lassen.«

10
»Das stimmt!« bestätigte Miss Wincott fröhlich.
»Ach, wenn ich daran denke, wie David und ich sie an
unserem letzten Abend förmlich auf den Kopf gestellt
haben! Die verdrehtesten Sachen passierten...«
Judy Wincott gehörte zweifellos zu der Sorte, die
sich nicht aufhalten läßt. Da saßen wir nun an einem
zauberhaften Frühlingstag in der kultiviertesten Stadt
der Welt an deren berühmtester Straße und waren
dazu verdammt, das einfältige Geplapper eines
egoistischen Kindes anzuhören. Der lange Schluck,
den ich von meinem Martini nahm, schmeckte bitter.
»Ach, Sie werden es kaum glauben«, fuhr sie mun-
ter fort. »Aber als wir uns schließlich gegen Morgen
vor meinem Hotel voneinander verabschieden woll-
ten, stellte David plötzlich fest, daß er seine Brille
verloren hatte! Wirklich, er war so aufgedreht, daß er
es erst vor der Hoteltür merkte! Nun, wir klapperten
noch einmal alle Lokale ab, in denen wir gewesen
waren, und suchten gründlich. Kein Erfolg. Auch am
Nachmittag, als Dad und ich nach Paris abflogen,
hatte der arme Dave seine Brille noch nicht wiederge-
funden. Und wissen Sie, wo sie dann auftauchte?«
Judy Wincott starrte zuerst Steve erwartungsvoll
an, dann mich. Natürlich wußte keiner von uns die
Antwort.
»Verraten Sie es uns«, schlug ich vor.
»Na, das war zu komisch! Als der Zollbeamte auf
dem Flughafen Orly meinen Koffer durchsuchte, fand
er sie in meiner Abendtasche!«

11
Steve und ich lachten höflich, wenn auch etwas
mühsam. Miss Wincott ließ ein herzliches Gelächter
ertönen, hielt aber plötzlich inne. Sie hatte, wie es
schien, eine Erleuchtung gehabt.
»Wissen Sie, das nenne ich einen glücklichen Zu-
fall!« jauchzte sie. »Daß Sie nach Tunis wollen,
meine ich! Könnten Sie nicht Davids Brille mitneh-
men, bitte? Ich hoffe, Sie verübeln mir diese Frage
nicht?«
»Natürlich könnten wir sie mitnehmen«, sagte ich.
»Aber ich vermute, sie käme viel schneller nach
Tunis, wenn Sie sie mit der Post schicken. Wir
werden jedenfalls nicht vor Donnerstag dort sein.«
»Nein, mit der Post schicken kann ich sie nicht.
David hat mich in seinem Telegramm ausdrücklich
darum gebeten; Die Brille könne beschädigt werden
oder verlorengehen. Und Davy, dieses arme Lämm-
chen, ist völlig hilflos ohne sie.«
Vermutlich war es die Vision eines hilflosen
Lämmchens, die mein Herz erweichte. Außerdem
bedachte mich Steve mit einem zustimmenden Blick.
Ich willigte also ein.
»Oh, fein!« flötete Miss Wincott und genoß den
Rest ihres Champagnercocktails. »So bliebe nur noch
die Frage, wann und wohin ich Ihnen die Brille
überbringen soll. In welchem Hotel wohnen Sie?«
»Wir wohnen dieses Mal nicht in einem Hotel«,
entgegnete Steve. »Freunde von uns, die zur Zeit
verreist sind, haben uns ihre Wohnung überlassen -

12
gleich dort um die Ecke in der Avenue Georges V.
Wir werden heute abend zu Hause sein. Wollen Sie
nicht um sieben Uhr kommen und einen Cocktail mit
uns trinken? Es ist Nummer neunundachtzig.«
»Ach nein.« Jetzt, da sie erreicht hatte, was sie
wollte, spielte Miss Wincott die Scheue. »Bestimmt
haben Sie schon genug von mir gesehen. Ich will
lieber nur für einen winzigen Augenblick hinauf-
kommen, um die Brille abzugeben.«
Erleichtert bemerkte ich, daß sie ihre Handschuhe
vom Tisch nahm und weitere Anzeichen für einen
alsbaldigen Aufbruch zu erkennen gab. Um zu
verhindern, daß sie ihren Vorsatz womöglich wieder
ändere, stand ich auf und rückte mein Stühlchen unter
den Tisch, damit sie ungehindert passieren könne. Ihre
Abschiedsworte waren hastig, aber überschwenglich.
Wir sahen ihr nach, wie sie sich durch die Fußgänger-
scharen auf dem Gehsteig schlängelte, ein Taxi
herbeiwinkte, einstieg und im Davonfahren zu uns
zurücksah.
»Merkwürdig, was für Bekanntschaften du manch-
mal machst«, sagte ich zu Steve.
»Nun, sie zu einem Aperitif einzuladen war das
mindeste, was ich tun konnte. Ich war absolut verlo-
ren in den Galeries Lafayette, als sie sich wie ein
rettender Engel zu mir gesellte. Sie opferte über eine
Stunde, um mich zu den besten Läden zu führen. Als
ich ihr meinen Namen sagte, war sie direkt rührend
daran interessiert, dich kennenzulernen.«

13
»Ich kann nicht behaupten, daß an Miss Wincott
etwas Rührendes ist. Ich würde sagen, daß alles, was
sie tut, der Förderung ihrer eigenen Interessen dient.«
»Aber bei ihrer Sorge, den armen David Foster
wieder in den Besitz seiner Brille gelangen zu lassen,
zeigte sie sehr nette Seiten.«
»Das mag sein«, gab ich widerwillig zu. »Doch nun
trink aus, Steve. Um ein Uhr sind wir mit den Chate-
lets verabredet, und vorher müssen wir noch alle deine
Pakete hinauf in die Wohnung bringen.«
Wir lunchten mit den Chatelets gut, aber ziemlich
zeitraubend. Danach besichtigten wir die Gemälde-
ausstellung in der Orangerie und saßen dann noch ein
gutes Weilchen in einem reizenden kleinen Café. So
wurde es fast sieben Uhr, ehe wir zu der Wohnung in
der Avenue Georges V. zurückkehrten. An Judy
Wincott dachte ich überhaupt nicht mehr. Ich stand
am Waschbecken im Badezimmer und ließ mir zur
Erfrischung kaltes Wasser über den Kopf laufen, als
die Türklingel ertönte. Leicht erschrocken trocknete
und kämmte ich mir in aller Eile das Haar und ging,
um die Tür aufzumachen.
»Aaah«, sagte ich, als ich sah, wer da war. »Treten
Sie ein, Miss Wincott. Wir wollten uns eben Cocktails
mixen.«
Judy Wincott war rot im Gesicht und rang nach
Atem, als wäre sie alle vier Treppen heraufgerannt.
Sie trug noch dieselbe Kleidung wie bei unserer
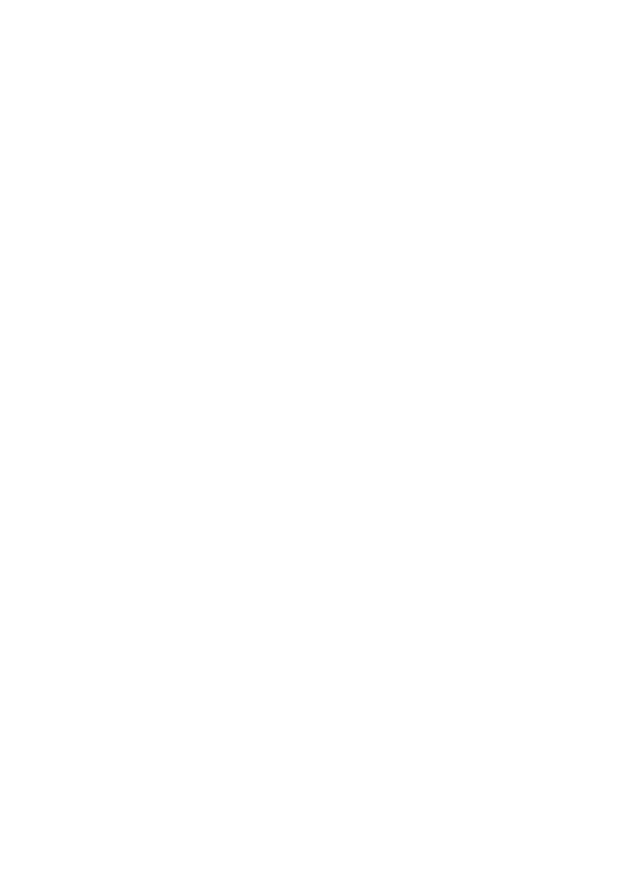
14
Begegnung im Café Fouquet und sah nicht so aus, als
hätte sie inzwischen auch nur Zeit genug gehabt, ihr
Make-up zu erneuern.
»Oh, danke. Ich kann aber nicht bleiben«, entgeg-
nete sie atemlos. »Dad und ich gehen zum Dinner in
die Botschaft, und ich habe mein Taxi unten warten
lassen. Hier ist die Brille. Ein Zettel mit Davids
Adresse liegt im Etui. Ich habe ihm telegrafiert, daß
Sie am Donnerstag in Tunis eintreffen, und ihn
gebeten, Sie bei dem Flugzeug aus Algier zu erwar-
ten.«
Sie war schon wieder fort, als Steve durch die
Schiebetür des Speisezimmers in die Diele kam,
bekleidet mit einem zauberhaften Abendkleid, das sie
am Vormittag erworben hatte.
»Oh, ist sie schon wieder weg?«
»Dinner mit Dad in der Botschaft und ein warten-
des Taxi«, erklärte ich und betrachtete das Brillenetui.
Es war mit Leder überzogen und trug weder Namen
noch Adresse eines Optikers. Als ich es öffnete,
rutschte mir ein gefaltetes Blatt Papier entgegen, ein
kleiner Briefbogen des Hotels Bedford in Paris mit
drei flüssig geschriebenen kurzen Zeilen:
David Foster
c/o Trans-Afrika-Öl, Tunis
von Judy
Die Brille war ein wuchtiges Exemplar - ein sehr
starkes und dickes Schildpattgestell mit breiten
Bügeln und großen Gläsern. Ich setzte sie versuchs-

15
weise auf und mir wurde sofort schwindlig. Die
Linsen waren so extrem stark und scharf, daß vor
meinen Augen alles verschwamm. Als ich sie schnell
wieder absetzte, hörte ich Steve fröhlich lachen.
»Oh, du solltest wirklich eine Brille tragen«, sagte
sie etwas unlogisch. »Du siehst damit ungemein
gelehrt aus.«
»Dieser David Foster muß äußerst kurzsichtig sein.
Kein Wunder, daß er um seine Brille jammert. Ohne
sie dürfte er sich fast blind fühlen.
Steve und ich flogen am nächsten Nachmittag nach
Nizza. Natürlich hätten wir direkt nach Algier fliegen
können, aber Steve neigt dazu, bei längeren Flügen in
großer Höhe Kopfweh zu bekommen. Außerdem
haben wir beide eine besondere Schwäche für die
Côte d'Azur und sind dankbar für jeden Vorwand,
dort einen oder zwei Tage verbringen zu können.
Wir hatten uns in einem Hotel angemeldet, das wir
schon kannten, nicht weit entfernt vom weltberühmten
›Negresco‹ an der Promenade des Anglais gelegen. Es
ist ein kleines, aber sehr luxuriöses Hotel mit übli-
cherweise makelloser Bedienung. An diesem Nach-
mittag jedoch waren zehn oder zwölf Gäste gleichzei-
tig eingetroffen, was den Empfangschef etwas durch-
einandergebracht zu haben schien.
Einer der uniformierten Pagen beförderte uns und
unser Gepäck im Lift zur ersten Etage hinauf, die in
Wirklichkeit die zweite war, weil es hier ein besonde-

16
res ›Hochparterre« gab. Noch ehe wir in den Korridor
einbogen, an dem unser Zimmer lag, hörten wir das
metallische Klappern eines Schlüssels, der nicht in
das Schloß zu passen schien, an dem er probiert
wurde. Als wir um die Ecke kamen, erblickten wir
einen anderen Pagen, der neben einem sehr englisch
aussehenden Gast stand und sich vergeblich bemühte,
die Tür von Nummer 12 zu öffnen, dem Zimmer
neben unserem. Einen Moment später erging es
unserem Pagen an der Tür von Nummer 11 genauso -
der Schlüssel, den ihm der Empfangschef mitgegeben
hatte, paßte nicht ins Schloß.
Plötzlich schob der englisch aussehende Gast sei-
nen Pagen zur Seite, zog den Schlüssel aus der Tür
von Nummer 12, kam damit zu unserer Nummer 11,
schob unseren Pagen zur Seite und tauschte die
Schlüssel aus. Dann drehte er den Schlüssel, und siehe
da, sogleich ließ unsere Tür sich öffnen. Der Gast
warf mir einen etwas unsicheren Blick zu und sagte in
entsetzlichem Französisch: »Pardong, Mushoor, vous
avez mon clef.«
»Nicht mein Fehler«, antwortete ich auf englisch.
»Der Empfangschef scheint sich geirrt zu haben.«
Der andere Gast stutzte und äußerte erleichtert:
»Oh, Sie sind Engländer? Nun, dann ist es gut. Einen
Moment lang dachte ich, jemand hätte sich einen
dummen Scherz erlaubt. Und solche Art Sachen mag
Sam Leyland nicht.«
Aus Lancashire und stolz darauf, dachte ich. Seine

17
Stimme war tief und kräftig, und seine Kleidung paßte
dazu. Er trug einen etwas zu auffallend karierten
Anzug, zweifellos Maßarbeit, weil solche Bauchgrö-
ßen nicht fertig zu haben sind. Seine Schuhe waren
fast gelb, aber sehr sauber geputzt und merkwürdig
klein im Vergleich zu seiner Große und Breite. Er
prunkte mit einer Seidenkrawatte, auf der das hand-
gemalte Bild einer Ballettänzerin zu sehen war, und
mit einer leicht verwelkten Rose im Knopfloch. Sein
Gesicht war rötlich und aufgedunsen, seine Schädel-
wölbung kahl und sein Nasenbein eingeknickt,
vielleicht infolge Kollision mit einem Laternenpfahl
oder einem Geschäftspartner. Ich hielt ihn für einen
jener Firmendirektoren, die trotz unzureichender
Begabung auf rätselhafte Weise genug Geld machen,
um viel zu reisen und den Nimbus des Union Jack in
die Spielkasinos des Kontinents zu tragen.
»Ich glaube nicht, daß es absichtlich geschehen
ist«, beruhigte ich ihn. »Ich kenne dieses Hotel und
weiß, daß der Service hier sonst recht gut ist.«
»Das sollte er auch«, erwiderte der Engländer. »Die
Preise sind hoch genug. Und wenn es jemanden gibt,
der etwas haben will für sein Geld, dann ist es Sam
Leyland!«
Da ich mir von einer Fortsetzung der Unterhaltung
nichts versprach, nickte ich ihm zu und folgte Steve,
die sich inzwischen in unser Zimmer zurückgezogen
hatte.

18
Es war uns beschieden, Sam Leyland am selben
Abend noch einmal zu begegnen.
Wir kehrten nach einem besonders guten Essen
gegen halb elf in unser Hotel zurück. Da der Lift
irgendwen zur obersten Etage beförderte, entschieden
wir, daß es uns nicht umbringen würde, die Treppe zu
benutzen. Über die ärgerliche Stimme, die wir schon
kurz nach Passieren des Hochparterres vernahmen,
konnte es keinen Zweifel geben. Wir waren also nicht
überrascht, als wir im ersten Stock um die Korridor-
ecke bogen und Sam Leyland sahen. Er stand an der
offenen Tür seines Zimmers, die Fäuste in die Hüften
gestemmt, und schimpfte aus Leibeskräften auf ein
völlig verschüchtertes Zimmermädchen ein. Dabei
bediente er sich einer Art Privatsprache, halb Englisch
und halb Französisch, die das Mädchen begreiflicher-
weise nicht verstand.
Als er uns kommen sah, zuckte er die Achseln und
wandte sich verächtlich von dem Mädchen ab, das
sofort davonhuschte, um am Ende des Korridors
hinter einer Tür zu verschwinden.
»Ich wußte ja, daß hier irgendeine Sauerei im Gan-
ge ist!« dröhnte Sam Leyland, als er uns wuchtig
entgegenstapfte. »Und jemand wird dafür bezahlen
müssen, so wahr ich Sam Leyland heiße!«
»Was ist denn los? Hat man Ihren Schlüssel wieder
vertauscht?«
Seine Augen waren wie die eines wütenden Ebers,
klein und glitzernd, aber ohne Verstand. Er machte

19
Armbewegungen, als wünsche er etwas zu erklären
und könne die passenden Worte nicht finden. Schließ-
lich atmete er tief ein und aus und knurrte: »Kommen
Sie und sehen Sie sich das mal an!«
Er führte uns zur Tür seines Zimmers. Sie stand,
wie gesagt, offen. Der Schlüssel steckte außen im
Schloß. Die Aufmachung des Zimmers glich der des
unsrigen - zart fliederfarbene Wände, dunkelblaue
Vorhänge, schwarzgrauer Teppich von Wand zu
Wand, moderne, hellgebeizte Möbel. Der einzige
Unterschied bestand darin, daß Leylands Zimmer statt
des Doppelbettes ein Einzelbett enthielt und sich in
unbeschreiblicher Unordnung befand.
»Alle Wetter, welch ein Durcheinander!« rief ich
aus. »Nicht schwer zu raten, daß Sie einen uner-
wünschten Besucher hatten.«
Leylands Antwort war ein gedämpftes Knurren. Ich
konnte ihm den Zorn nachfühlen. Alle Schubladen
waren geöffnet und auf den Fußboden entleert wor-
den. Das Bettzeug war vom Bett gerissen. Die Kanten
der Matratze hatte man aufgeschlitzt, ebenso die
Daunendecke und die Kissen, so daß überall lose
Federn herumlagen. Leylands Koffer waren derart
gründlich durchwühlt worden, daß ihr Stoffutter nur
noch aus Fetzen bestand. Selbst sein elektrischer
Rasierapparat war auseinandergebrochen und das
dazu gehörende Lederetui zerschlitzt. Der Eindruck,
den der Schauplatz dieser Barbarei machte, war
bedrückend.

20
»Das ist ja grauenhaft«, seufzte Steve. »Es muß ein
Dieb gewesen sein. Hatten Sie denn etwas Wertvolles
hier, Mr. Leyland?«
Zum erstenmal blitzte so etwas wie Belustigung im
Gesicht des Engländers auf. Er klopfte auf die Wöl-
bung der linken Brustseite seines Jacketts und blinzel-
te Steve zu.
»Meine Wertsachen stecken alle sicher hier drin-
nen. Sam Leyland läßt es nicht darauf ankommen.
Das Wertvollste, was dieser Schurke erbeutet haben
kann, würde ein Paar Manschettenknöpfe von Wool-
worth sein, Kaufpreis sechs Shilling fünfzig. Was
mich so wütend macht, ist die Unordnung, die er
angerichtet hat. Na, das Hotel wird mir ein anderes
Zimmer geben müssen.«
Plötzlich fühlte ich, wie Steves Finger sich in mei-
nen rechten Arm krallten.
»Paul! Die Brillantbrosche, die du mir zum Ge-
burtstag geschenkt hast! Ich habe sie in der Schublade
meines Ankleidetisches gelassen.«
Durchaus davon überzeugt, daß ich unser Zimmer
in ähnlich chaotischem Zustand vorfinden würde,
fingerte ich nervös den Schlüssel ins Schloß, machte
die Tür auf und tastete nach dem Lichtschalter. Steve
seufzte erleichtert, als das Licht anging und sie sah,
daß unser Zimmer noch genauso war, wie wir es
verlassen hatten. Das Telefon fing an zu klingeln, aber
sie ignorierte es, drängte sich an mir vorbei zu ihrem
Ankleidetisch, griff in die Schublade, suchte ein

21
wenig darin herum und hielt selig lächelnd die glit-
zernde Brosche in die Höhe.
»Gott sei Dank, daß er sie nicht gefunden hat!«
»Steve!« mahnte ich. »Wie oft habe ich dir geraten,
Wertgegenstände nicht im Hotelzimmern zu lassen?«
»Ach, Darling, ich wollte es ja nicht. Hättest du mir
nicht ständig gesagt, ich müßte mich beeilen, dann
würde ich es bestimmt nicht vergessen haben.«
Da es keine passende Antwort auf Bemerkungen
dieser Art gibt, durchquerte ich das Zimmer, setzte
mich auf die Kante des Bettes und nahm den Telefon-
hörer ans Ohr.
»Hallo? Hier Temple.«
»Monsieur Temple? Ich bedaure, Sie stören zu
müssen, Monsieur. Aber hier ist ein Polizeiinspektor
und wünscht unverzüglich mit Ihnen zu sprechen.«
Es war die Stimme des Nachtportiers.
»Ein Polizeiinspektor? Sagte er, weshalb?« Ich
hegte die etwas überspannte Hoffnung, der Hoteldieb
wäre bereits erwischt, was der Polizei von Nizza
meine besondere Hochachtung eingetragen hätte.
»Nein, Monsieur. Aber er sagte, es sei sehr, sehr
dringend. Und er müsse Sie unverzüglich sehen.«
Ich nahm mir die Zeit, eine Zigarette anzuzünden
und Steve zu informieren, ehe ich die Treppe wieder
hinabging. Als ich das Foyer erreichte, sah ich den
Nachtportier einem Mann zunicken, der in einem der
Sessel saß, nun aber sofort aufstand und mir entge-
genkam.

22
Er war sehr klein, höchstens einsfünfundsechzig.
Ein dunkler Typ, drahtig, bemerkenswert elegant in
Aussehen und Kleidung, mit glatt zurückgebürstetem
schwarzem Haar, makellos weißem Kragen, ebensol-
chen Manschetten und blinkend sauberen Schuhen.
Sein Kopf wirkte im Verhältnis zu seiner Gestalt
etwas zu groß; seine Augen blitzten außerordentlich
lebhaft. Alles in allem genommen, hätte er für einen
Musiker gelten können.
»Mr. Temple?« fragte er, und ich merkte sofort, daß
er gutes Englisch sprechen würde.
»Ja.«
Er zeigte mir seinen Ausweis und sagte dabei: »In-
spektor Mirabel von der Kriminalpolizei. Ich möchte
mit Ihnen ein paar Worte unter vier Augen sprechen.«
Er dirigierte mich in ein kleines Zimmer, das nor-
malerweise nur von solchen Hotelgästen benutzt
wurde, die darauf bestanden, zum Frühstück herunter-
zukommen. Die Stühle waren alle hart und geradleh-
nig, und als wir einander gegenüber an einem unge-
deckten Tisch Platz nahmen, erschien mir die ganze
Situation sehr offiziell und unfreundlich. Mirabels Art
und Ton bekräftigten diesen Eindruck. Er klappte ein
kleines Notizbuch auf und legte es vor sich auf den
Tisch, sah aber nicht hinein. Seine Augen blieben
ernst und aufmerksam auf mich gerichtet.
»Mr. Temple, ist es richtig, daß Sie heute nachmit-
tag um zwei Uhr zwanzig mit dem Flugzeug aus Paris
hier eingetroffen sind?«

23
»Ja.«
»Und in Paris wohnten Sie in der Avenue Georges
V, Nummer neunundachtzig?«
»Ja. Freunde von uns überließen uns ihre Wohnung
für ein paar Tage.«
»Wurden Sie dort von einer Miss Wincott be-
sucht?«
»Ja«, antwortete ich, verwundert über diese uner-
wartete Frage. »Miss Wincott war allerdings kaum
anderthalb Minuten in der Wohnung oder, richtiger
gesagt, in deren Diele. Sie kam nur, um ein Päckchen
abzugeben, und ging sofort wieder.«
Im stillen sagte ich mir, daß meine instinktive Ab-
neigung gegen Judy Wincott berechtigt gewesen war;
dieses Mädchen bedeutete Unannehmlichkeiten.
»Wie gut kennen Sie Miss Wincott? Bitte sagen Sie
mir, welcher Art Ihre Beziehungen zu ihr waren.«
»Äußerst oberflächlich. Ich lernte Miss Wincott
erst gestern kennen. Sie hatte sich meiner Frau mit
Einkaufsratschlägen gefällig gezeigt. Daraufhin lud
meine Frau sie ein, mit uns einen Aperitif zu trinken.«
»Das war gestern abend?«
»Nein, gestern gegen Mittag. Dabei wurde verein-
bart, daß sie abends um sieben zu uns in die Wohnung
kommen würde.«
»Und das tat sie? Erinnern Sie sich an die genaue
Zeit?«
»Ja. Meine Frau und ich kamen kurz vor sieben
zurück. Und Miss Wincott erschien ungefähr fünf

24
Minuten später.«
Mirabel machte sich eine Notiz. Ich wurde immer
neugieriger, wodurch Judy Wincott das Interesse der
Polizei erweckt haben mochte, hielt es aber für besser,
noch keine Fragen zu stellen.
»Gab sie Ihnen irgendeine Adresse?« erkundigte
sich Mirabel.
»Sie erwähnte beiläufig, sie wohne im Hotel Bed-
ford zusammen mit ihrem Vater.«
»Mit ihrem Vater?« Mirabel blickte überrascht auf.
»Er ist Benjamin Wincott, ein bekannter Antiquitä-
tenhändler aus New York. Die Amerikanische Bot-
schaft wird Ihnen mehr über ihn sagen können als ich.
Wie Miss Wincott erwähnte, waren sie und ihr Vater
gestern abend dort eingeladen.«
Mirabel blickte mich einen Moment lang an. Dabei
umspielte ein kaum merkliches Lächeln seine Mund-
winkel.
»Sie sprachen von einem Päckchen, Mr. Temple.
Bitte sagen Sie mir, was es enthielt.«
»Oh, es handelt sich nur um ein Etui mit einer Bril-
le. Miss Wincott bat mich, die Brille für einen Freund
von ihr nach Tunis mitzunehmen.«
Ich gab Mirabel einen kurzen Abriß der Geschichte,
die Judy Wincott mir erzählt hatte. Als ich damit zu
Ende war, sagte er: »Ich möchte diese Brille sehen.
Würden Sie sie mir zeigen, bitte?«
»Gewiß. Ich habe sie hier.«
Ich zog das Etui aus meiner Brusttasche und reichte

25
es Mirabel hinüber. Er nahm die Brille heraus und
drehte sie langsam zwischen seinen schlanken Fingern
hin und her. Dann betrachtete er die Notiz auf dem
kleinen Briefbogen des Hotels Bedford, und ich sah,
wie seine Augenbrauen sich zusammenschoben.
Schließlich balancierte er das Etui in der linken Hand,
als wünsche er das Gewicht abzuschätzen.
»Ich möchte diese Gegenstände ins Polizeipräsidi-
um mitnehmen, um sie von Sachverständigen untersu-
chen zu lassen«, sagte er. »Hätten Sie etwas dage-
gen?«
»Keineswegs. Aber werde ich sie zurückbekom-
men? Ich fühle mich irgendwie verpflichtet.«
»Ich gebe Ihnen eine Quittung«, erklärte Mirabel
steif. »Falls sich kein gegenteiliger Anlaß ergibt,
werden Sie die Sachen morgen früh zurückerhalten.«
»Ich danke Ihnen. Darf ich fragen - ist Miss Win-
cott irgendwie in Schwierigkeiten geraten?«
Mirabel sah mich lange an, sein Ausdruck wirkte
seltsam.
»Schwierigkeiten?« wiederholte er. »Nun, ich
glaube nicht, daß man sagen könnte, sie befände sich
in Schwierigkeiten. Ihre Leiche wurde heute nachmit-
tag von der Portiersfrau in einer der Abfalltonnen
hinter dem Haus gefunden, in dem Sie wohnten. Sie
ist in den Rücken geschossen worden und war ver-
mutlich sofort tot. Nach den Feststellungen des
Polizeiarztes entspricht die Todeszeit ungefähr der
von Ihnen genannten Zeit, zu der Miss Wincott Sie

26
verließ.«
Ich sagte nichts. Ich wußte, daß Mirabel mich auf-
merksam beobachtete, während meine Gedanken
zurückeilten zum Café Fouquet und unserer nicht
ganz erfreulichen Zufallsbekanntschaft. Mörder
wissen für gewöhnlich, was sie tun und warum sie es
tun. Aber die Opfer, die sie sich erwählen, geben
einem manchmal Rätsel auf. Ich hätte mir vorstellen
können, daß Judy Wincott von einem verärgerten
Anbeter geohrfeigt, daß sie gesellschaftlich geächtet
oder vielleicht sogar wegen Trunkenheit von der
Polizei festgenommen werden könnte. Daß jemand sie
ermorden könnte, hatte ich mir nie träumen lassen.
»Sie sind überrascht?« fragte Mirabel.
»Natürlich! Miss Wincott verließ mich gestern
abend, um ihren Vater zu treffen und mit ihm in der
Amerikanischen Botschaft zu essen. Sollte es mir da
normal erscheinen, daß ihre Leiche heute in einer
Abfalltonne gefunden wird? Haben Sie eine Vermu-
tung, wer es getan haben könnte und warum?«
Mirabel schüttelte den Kopf und sagte: »Der Täter
hinterließ keine Spuren. Bis jetzt haben wir uns darauf
beschränken müssen, herauszufinden, wen sie gestern
besucht hat und warum.«
»Sicher hat ihr Vater die Polizei verständigt, als sie
gestern abend ausblieb. Aber ich bin verwundert, daß
der Fahrer des wartenden Taxis nicht angefangen hat,
nach seinem verschwundenen Fahrgast zu suchen.«
Wieder umspielte ein kaum merkliches Lächeln

27
Mirabels Mund. Offenbar war ich der Gegenstand
seiner Belustigung.
»Die Pariser Polizei«, sagte er, »hat über alle Aus-
länder recherchiert, die zur Zeit in Pariser Hotels
wohnen. Einen Benjamin Wincott gibt es nicht unter
ihnen. Auch die Amerikanische Botschaft weiß nichts
über ihn.«
»Wurde auch beim Hotel Bedford nachgefragt?«
»Die Pariser Polizei hat bei allen Hotels nachge-
fragt. In keinem ist jemand namens Wincott regi-
striert.«
Steve und ich sprachen noch lange, nachdem wir
uns zu Bett gelegt hatten. Sie zeigte sich sehr betrof-
fen über die Vorstellung, daß Judy Wincott praktisch
unmittelbar nach Verlassen unserer Wohnung ange-
griffen und getötet worden war.
»Vielleicht wären wir doch irgendwie imstande
gewesen, es zu verhindern, Paul. Es muß ein Raub-
überfall gewesen sein - meinst du nicht auch?«
»Möglich. Andererseits glaube ich, daß ein Dieb
eher einen Totschläger oder ein Messer benutzt
hätte.«
Steve erschauderte und flüsterte: »Ich bin froh, dich
neben mir zu haben, Paul. Auf dem Kontinent scheint
es eine Menge Verbrecher zu geben. Eben erst die
Sache im Zimmer nebenan, und nun die Nachricht
von diesem Mord...«
Mitternacht war längst vorbei, als wir beschlossen,

28
nun endlich zu schlafen, und das Licht ausknipsten.
Ich glaubte, eben erst eingeschlafen zu sein, als ich
spürte, daß Steve vorsichtig meine linke Schulter
schüttelte. Ich machte die Augen auf, sah das Mond-
licht an der Wand gegenüber unseren Betten und
mußte mir einen Moment lang überlegen, wo wir
eigentlich waren.
»Paul, hör doch!« Steves Worte waren ein alarmie-
rendes Flüstern. »Im Zimmer nebenan geht irgend
etwas sehr Merkwürdiges vor!«
Ich setzte mich im Bett auf und lauschte. Tatsäch-
lich ertönten dort drüben irgendwelche schleifenden
und bumsenden Geräusche, als würde ein verhältnis-
mäßig schwerer Gegenstand teils gezogen, teils
mühsam getragen und dann wieder abgesetzt. Außer-
dem glaubte ich jenseits der Wand heftiges Atmen
und gelegentliches Keuchen zu hören. Schließlich
ertönte ein besonders lautes Bumsen gegen die
Trennwand, gefolgt von einigen leiseren Geräuschen
und dem verstohlenen Zumachen einer Tür.
»Es ist Sam Leylands Zimmer«, flüsterte Steve.
»Ich dachte, er wollte sich ein anderes Zimmer geben
lassen.«
Wir saßen etwa eine Minute lang lauschend im
Dunkeln. Die Geräusche hatten aufgehört, jenseits der
Wand herrschte jetzt unheilvolle Stille. Auf einmal
klickte es neben mir, und Steves Nachttischlampe
erhellte unser Zimmer. Ich schwang die Füße aus dem
Bett und langte nach meinem Hausmantel.
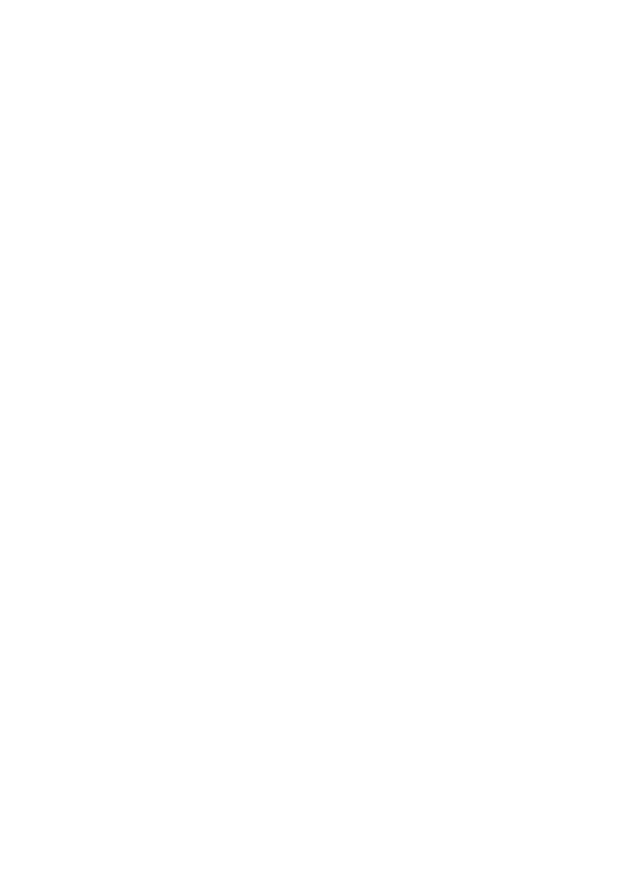
29
»Die Sache kommt mir faul vor. Ich will nachse-
hen, was dort passiert ist.«
»Ich gehe mit«, sagte Steve entschlossen und war
schon dabei, sich ihren Hausmantel anzuziehen.
Wir rissen unsere Tür auf und sausten so schnell in
den Korridor hinaus, daß wir mit einem jungen Mann
zusammenstießen, der in diesem Moment an unserer
Tür vorbeikam. Auch er trug einen Hausmantel und
war anscheinend genau wie wir aus dem Schlaf
geschreckt worden.
»Tut mir leid«, sagte ich, erinnerte mich dann, daß
wir in Frankreich waren, und fügte hastig hinzu:
»Pardon.«
»Schon gut«, erwiderte der junge Mann. »Ich bin
auch Engländer. Ich habe ein Zimmer im Hochparter-
re und bin heraufgekommen, um zu sehen, was dieser
Tumult zu bedeuten hat. Aber wenn es nur eine kleine
Auseinandersetzung zwischen Ihnen beiden war -«
Er sah aus wie eine Art Idol reiferer Frauen - groß,
schlank, gut gewachsen, den blauseidenen Hausman-
tel eng um die schmale Taille gegürtet. Seine Stimme
klang gebildet und angenehm; sein langsames und
leises Sprechen schien einen ehemaligen Oxfortstu-
denten zu verraten. Seine Augen, vornehmlich auf
Steve gerichtet, verpaßten offenbar nichts.
»Das waren wir nicht«, entgegnete Steve schnell.
»Ich bin davon aufgewacht, und mein Mann wollte
eben nachsehen. Es kam aus diesem Zimmer.«
Sie wies auf die Tür von Nummer 12. Der junge

30
Mann trat an die Tür und klopfte zögernd.
Nachdem er ein zweites Mal geklopft hatte, ohne
Antwort zu erhalten, schlug er wenig begeistert vor:
»Vielleicht sollten wir einbrechen?«
Aus einem Augenwinkel sah ich, daß Steve sich
plötzlich bückte und etwas vom Boden aufnahm.
»Versuchen Sie zuerst die Türklinke«, riet ich dem
jungen Mann.
Er drückte die Klinke herunter, und die Tür öffnete
sich in den stockdunklen Raum. Die Korridorbeleuch-
tung hinter uns warf eine Lichtbahn auf den Boden, in
der unser beider verlängerte Schatten sich ausnahmen
wie groteske Ungeheuer. Jemand hatte die Fenster-
vorhänge dicht geschlossen; das indirekte Licht vom
Korridor ließ den übrigen Raum nur noch dunkler
erscheinen. Einen Moment lang standen wir da wie
gebannt, dann tastete der junge Mann nach dem
Schalter und knipste die Zimmerbeleuchtung an.
Das Zimmer zeigte noch denselben chaotischen
Zustand wie vorhin, aber Sam Leylands Besitztümer
waren inzwischen hinausgebracht worden. Außer den
geschlossenen Fenstervorhängen gab es noch einen
Unterschied: Auch die Türen des großen Wand-
schrankes waren jetzt geschlossen.
»Niemand hier«, sagte der junge Mann. »Aber
welch ein Durcheinander! Ich denke, wir sollten die
Hotelverwaltung informieren.«
»Warten Sie einen Moment«, erwiderte ich.
Ich dachte an das heftige Bumsen gegen die

31
Trennwand, das uns aus den Betten gejagt hatte. Es
mußte irgendwie mit dem Wandschrank zu tun gehabt
haben. Ich ging zu dem Schrank, drehte den kleinen
Schlüssel und öffnete die beiden breiten Türen. Hinter
mir hörte ich Steve den Atem anhalten. Der junge
Mann gab einen unterdrückten Ausruf von sich. - Die
Leiche lag auf dem Boden des Schrankes, anschei-
nend schnell und achtlos hingeworfen. Es war die
Leiche einer jungen, weiblichen Person, mit Klei-
dungsstücken, die ich wiedererkannte. Ihre Handge-
lenke waren zusammengebunden, in ihrem Mund
steckte ein Knebel. Ich hob einen Moment lang ihr
Gesicht. Ihr Körper war noch warm, aber hinter
diesen entsetzt aufgerissenen, starren Augen konnte
kein Leben mehr sein. Ich vermutete, daß man sie
gewaltsam in dieses Zimmer geschleppt und dann mit
einem aufgeschlitzten Bettkissen erstickt hatte. Kein
rühmliches Verbrechen.
»Sieh nicht her, Steve«, warnte ich und richtete
mich auf, um ihr den Blick zu verwehren. Aber sie
hatte bereits genug gesehen und wandte sich entsetzt
ab. Ich schloß die Schranktüren und begegnete dem
Blick des jungen Mannes, der zitternd und mit kalk-
weißem Gesicht dastand.
»Sie sollten lieber hinuntergehen, um die Hotel-
verwaltung und die Polizei zu verständigen«, sagte ich
zu ihm. »Ich werde hier warten.«
Er schien glücklich, gehen zu dürfen, und ent-
schwand ohne ein Wort. Steve, die bessere Nerven

32
besitzt als die meisten Frauen, hatte sich schnell
wieder gefaßt.
»Paul«, flüsterte sie, »ich habe gesehen, wer es ist.
Ich kann mich nicht irren bei diesem Haar und dieser
Kleidung. Aber wie kann es sein, daß Judy Wincott,
heute nachmittag in Paris tot aufgefunden, jetzt hier
noch einmal ermordet worden ist?«
Ich antwortete nicht. Eine Bewegung der Fenster-
vorhänge hatte meine Aufmerksamkeit erregt. Und ich
war mir der Tatsache bewußt, daß wir knapp andert-
halb Minuten, nachdem der Mörder sein Werk vollen-
det hatte, in dieses Zimmer gekommen waren.
Ich schob Steve zurück, eilte hinüber zu den Vor-
hängen und riß sie schnell zur Seite.
Vor mir stand ein breiter Fensterflügel weit offen,
und die schwache Seebrise, die die Vorhänge bewegt
hatte, fächelte mein Gesicht. Das grünliche Licht einer
Straßenlaterne ließ breite Mauersimse und giebelarti-
ge Vorsprünge über den Hochparterrefenstern erken-
nen. Unten auf der Straße, ein ganzes Stück entfernt,
fegte ein Straßenkehrer mit seinem langen Besen
Abfälle zusammen. Von irgendwo kam ein feiner
Duft frisch gebackenen Brotes herübergeweht.
Ich drehte mich zu Steve um.
»Dies muß der Weg sein, auf dem er entkommen
ist. Wir können ihn nur knapp verfehlt haben. Viel-
leicht hat er sogar noch draußen auf dem Sims gestan-
den und uns beobachtet, als wir die Schranktüren
öffneten...«

33
2
Viel Schlaf war uns in dieser Nacht nicht beschie-
den. Die Polizei schickte Inspektor Mirabel, dieses
Mal mit einem halben Dutzend Mitarbeiter. Kein
Wunder, daß die Morgendämmerung den Himmel
erhellte, ehe unsere Vernehmungen abgeschlossen
waren und wir die Erlaubnis erhielten, uns in unser
Zimmer zurückzuziehen.
Schon gegen zehn Uhr wurden wir durch das
Summen des Haustelefons wieder geweckt. Ob wir im
Zimmer frühstücken wollten? Ja, natürlich.
Zehn Minuten später brachte man uns auf zwei
Tabletts das Frühstück an die Betten. Kaum hatten wir
es verzehrt, als das Telefon abermals ertönte. Mirabel
war gekommen und verlangte mich zu sprechen.
»Ich nehme jetzt sowieso mein Bad«, erklärte Ste-
ve. »Du kannst ihm also vorschlagen heraufzukom-
men.«
»Ich bin noch nicht angezogen«, sagte ich ins Tele-
fon. »Würde es Ihnen etwas ausmachen, in unser
Zimmer zu kommen? Falls Sie es lieber nicht möch-
ten, werde ich mich anziehen und in zehn Minuten
unten sein.«
Mirabel entschied sich fürs Heraufkommen, Kaum
eine Minute später war er an der Tür. Er hatte Zeit
gefunden, sich zu rasieren und ein frisches Hemd
anzuziehen. Schmuck wie er war, wirkte er etwas fehl
am Platz in unserem unaufgeräumten Schlafzimmer.

34
Ich rückte einen Sessel für ihn zurecht und bot ihm
eine Zigarette an, die er aber ablehnte. Dennoch
schien mir sein Verhalten freundlicher als bei unseren
bisherigen Begegnungen.
»Sind Sie irgendwie weitergekommen?« fragte ich
höflich interessiert.
»Ich habe Zeit gehabt, mich mit unseren Londoner
Kollegen in Verbindung zu setzen und einige Aus-
künfte über Sie zu erhalten. Man sagte mir, daß Sie
zwar die merkwürdige Begabung besitzen, irgendwie
in jede nur denkbare Art Unheil verwickelt zu werden,
bisher aber noch nie solches Unheil verursacht
haben.«
Ich mußte lachen, da ich mir vorstellte, wie mein
Freund Vosper, Chefinspektor bei Scotland Yard, sich
gewunden haben mochte, als er diese Formulierung
von sich gab.
»Also bin ich aus Ihrer Liste verdächtiger Personen
gestrichen?«
»Gewiß«, bestätigte Mirabel und lächelte. »Es dürf-
te Sie interessieren, zu hören, daß wir das Rätsel von
der zweimal ermordeten Frau gelöst haben. Die in der
Abfalltonne gefundene Tote war nicht Judy Wincott,
sondern eine gewisse Diana Simmonds, ebenfalls
Amerikanerin. Der anfängliche Irrtum ist entschuld-
bar, da in Diana Simmonds Handtasche als einziges
Papier ein an Judy Wincott gerichteter Brief gefunden
wurde. Außerdem waren beide Frauen einander recht
ähnlich und auch fast gleich gekleidet, so daß die

35
brave Portiersfrau in der Toten sogleich Miss Judy
Wincott zu erkennen glaubte, die am Abend zuvor
nach Ihrer Wohnung gefragt hatte.«
Aus Mirabels Miene war zu schließen, daß er wil-
lens sei, dieses Thema hiermit als erledigt zu betrach-
ten. Ich hatte erwartet, daß er noch viele weitere
Fragen an mich richten und mir damit Gelegenheit
geben würde, auch meinerseits einige Fragen zu
stellen. Aber er beschränkte sich nunmehr darauf, aus
seiner Brusttasche einen in Seidenpapier gewickelten
Gegenstand zu ziehen.
»Ich gebe Ihnen, wie versprochen, hiermit die Bril-
le zurück«, sagte er. »Allerdings ohne das Etui.
Unsere Fachleute haben es nahezu in seine Grundbe-
standteile zerlegt.«
»Konnten Sie irgend etwas finden?«
Mirabel schüttelte den Kopf. »Nichts.«
»Auch die Brille ist untersucht worden?«
»Ja, natürlich. Nur ist nichts Ungewöhnliches an
ihr. Eine teure Brille mit extrem starken Linsen, doch
in unserem Sinne völlig uninteressant.«
Er wickelte die Brille aus dem Seidenpapier und
betrachtete sie noch einmal, ehe er sie mir überreichte.
Dabei kommentierte er: »Echtes Schildpatt. Zu
durchsichtig, um irgend etwas zu verbergen. Und die
Linsen - nun, in ihnen kann auch nichts versteckt
sein.«
Ich nahm die Brille zögernd entgegen und murmel-
te: »Ich kann mir nicht helfen, ich bin skeptisch. Alles

36
Durcheinander scheint mit dem Moment begonnen zu
haben, als diese Brille in meine Hände kam.«
»Sie können beruhigt sein, Mr. Temple. Falls an
dieser Brille etwas Abnormales wäre, hätten unsere
Fachleute es entdeckt.«
Mirabel stand auf, zupfte sein Jackett glatt und
äußerte weltmännisch höflich: »Ich bedauere, daß Ihre
Gattin und Sie auf so unerfreuliche Art gestört wur-
den, und bin Ihnen dankbar für die erwiesene Zusam-
menarbeit.«
Er streckte mir seine rechte Hand hin.
Ȇbermitteln Sie Ihrer Gattin meine Empfehlun-
gen. Ich hoffe, daß Sie eine gute Reise nach Tunis und
dort angenehme Ferientage haben werden.«
»Wir dürfen also weiterreisen?« fragte ich, noch
verwundert, daß Mirabel uns so leicht ziehen ließ.
»Sie wünschen nicht, daß wir bei der Leichenschau
anwesend sind?«
»Das wird nicht nötig sein«, versicherte Mirabel.
»Sie dürfen Ihre Reise fortsetzen, damit Mr. David
Foster recht bald seine Brille zurückbekommt - die er,
wie ich annehme, geradezu schmerzlich vermissen
muß.«
Ich hatte mich zugleich mit Mirabel erhoben, wollte
ihn aber noch immer nicht gehen lassen.
»Gestatten Sie, Inspektor, daß ich Sie etwas frage?«
Er zuckte unverbindlich die Achseln, wartete aber
auf meine Frage.
»Wissen Sie Genaueres über die Frau, die in der

37
Avenue Georges V. ermordet wurde?«
»Wir haben einiges über sie in Erfahrung ge-
bracht«, erwiderte Mirabel bereitwillig. »Sie führte, je
nach Bedarf, verschiedene Namen, nannte sich jedoch
meistens Lydia Maresse. Sie war der Interpol als
Mitglied internationaler Verbrecherbanden bekannt.«
»Gibt es Anhaltspunkte für das Motiv ihrer Ermor-
dung?«
»Keine.«
Ich zögerte einen Moment lang, etwas verwirrt
durch Mirabels unübersehbare Ironie. Dann sagte ich:
»Inspektor, bestimmt ist Ihnen nicht entgangen, daß
zwischen diesen beiden Morden irgendeine Verbin-
dung bestehen muß, zumal in Diana Simmonds' alias
Lydia Maresses Handtasche ein an Judy Wincott
gerichteter Brief gefunden wurde. Außerdem muß
Ihnen aufgefallen sein, wie merkwürdig es ist, daß
meine Frau und ich bei beiden Morden in nächster
Nähe waren.«
Mirabel hob die Augenbrauen und studierte seine
tadellos manikürten Fingernägel, während er erwider-
te: »Keine dieser Tatsachen ist uns entgangen, Mr.
Temple. Um so mehr sind wir befriedigt, daß Sie
weder mit dem einen noch mit dem anderen Verbre-
chen zu tun hatten.«
Er lächelte, reichte mir noch einmal die Hand und
ging zur Tür.
Steve und ich hatten nun einen halben Tag totzu-

38
schlagen. Wir hatten wieder für einen Nachmittags-
flug gebucht, diesmal nach Algier. Steves größter
Wunsch für unsere freien Stunden war, möglichst weit
fort von dem verwünschten Hotel, möglichst viel
reine, frische Luft zu schöpfen. Von früher her
wußten wir, wo man kleine Segelboote mieten kann.
Da Segeln ein Sport ist, dem wir beide huldigen,
befanden wir uns gegen halb zwölf in einem hübschen
kleinen Boot schon ziemlich weit draußen auf dem
Meer.
Für eine Stunde genossen wir die Illusion, nicht
von neugierigen Augen beobachtet zu werden. Vom
Meer aus gesehen ist Nizza besonders hübsch - die
lange Strandpromenade, die weißen Häuser mit ihren
lustig-bunten Sonnenmarkisen, dahinter die maleri-
schen Hügelketten.
Eine Anzahl anderer Boote tummelte sich in der
Bucht. Schnelle Motorboote zogen Wasserskiläufer
hinter sich her. Segeljachten der unterschiedlichsten
Größen, zum Teil mit farbigen Segeln, belebten das
Bild. Das Wasser war nicht rauh, doch wehte genug
Wind, um das Segeln zu einer Tätigkeit zu machen,
die etwas Kraft und viel Aufmerksamkeit erforderte.
Ab und zu dröhnten, ziemlich niedrig, Flugzeuge über
uns hinweg, die vom Flughafen Nizza aufgestiegen
waren oder dort landen wollten.
Der Wind zerzauste Steves Haar, und ich freute
mich zu sehen, daß etwas Farbe in ihre bleichen
Wangen zurückkehrte. Wir hatten eben gewendet und
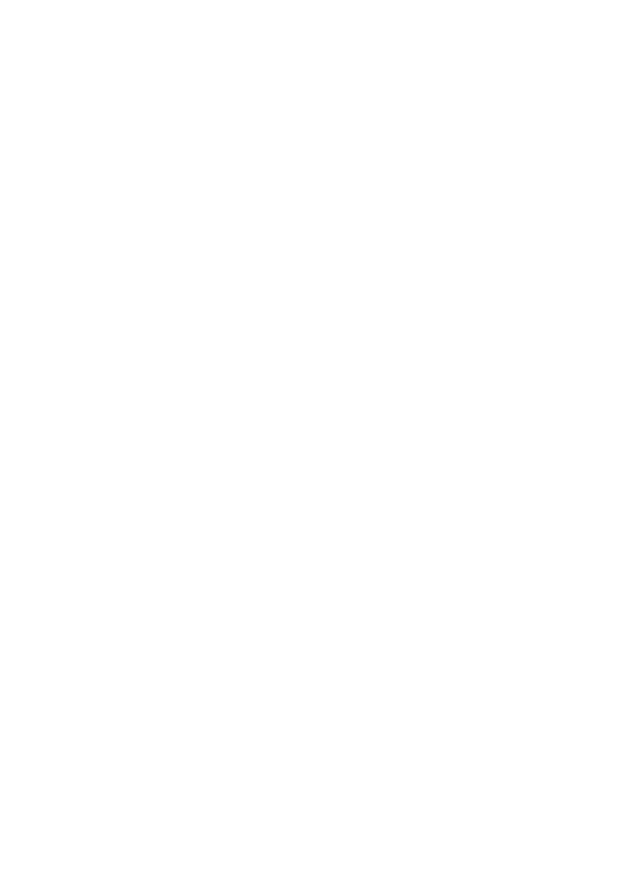
39
saßen auf der Reling, um den Winddruck auszubalan-
cieren, als sie auf eins der Motorboote zeigte, das, im
Gegensatz zu den anderen, seit einiger Zeit immer in
unserer Nähe manövriert hatte.
»Der Insasse scheint sich für uns zu interessieren«,
rief sie mir laut genug zu, um das Zischen des Gisch-
tes und die anderen Geräusche des Wassers zu über-
tönen. »Ich glaube, er beobachtet uns durch ein
Fernglas.«
Ich hielt sekundenlang Ausschau nach dem Motor-
boot, dann Lachte ich Steve zu. Sie ist eine sehr
hübsche Frau, aber außerordentlich bescheiden, und
bringt es einfach nicht über sich, das merkliche
Interesse eines anderen Mannes in Beziehung zu ihrer
eigenen Attraktivität zu setzen. In der blauen Hose
und der scharlachroten Hemdbluse, die sie bei unserer
Segelpartie trug, bildete sie wahrscheinlich das Ziel
für mehr als ein Paar Augen.
Eine plötzliche Bö drückte unser Boot so gefährlich
auf die Seite, daß wir uns weit hinauslehnen mußten,
um zu verhindern, daß das Segel ins Wasser geriet. Es
war eine unerfreuliche Situation, und wir brauchten
eine arbeitsreiche Minute, um das Boot wieder unter
Kontrolle zu bekommen. Unser Segel verbarg das
kreuzende Motorboot vor unseren Blicken, bis ich
endgültig Kurs auf das Ufer genommen hatte. Die
Geräusche von Wind und Wasser waren so laut, daß
wir nichts von dem Motorgeräusch hörten. Als ich
schließlich das kraftvolle Brummen vernahm, dachte

40
ich, es sei nur wieder eins der startenden Flugzeuge.
Steves Ausruf lenkte meine Aufmerksamkeit nach
Steuerbord: Ȁndre den Kurs, Paul! Er kommt direkt
auf uns zu!«
Ich blickte auf und sah das Motorboot höchstens
siebzig oder achtzig Meter entfernt. Seine Maschine
schien mit voller Kraft zu laufen, denn sein Bug ragte
schräg aus dem Wasser empor und warf hohe schäu-
mende Wellen auf. Sein Tempo, von vorn gesehen
schlecht zu schätzen, mochte vielleicht fünfzig
Kilometer betragen. Bei seinem jetzigen Kurs mußte
es uns unweigerlich rammen.
Es war aussichtslos, durch Schreien die Aufmerk-
samkeit des Mannes am Steuer zu erwecken. Er hätte
uns nicht gehört. Und der Bug seines Bootes war so
hoch erhoben, daß ich bezweifelte, ob er uns über-
haupt sehen könne.
Ich warf die Ruderpinne herum und duckte mich,
um die Spiere unseres Großsegels nicht an den Kopf
zu bekommen. Unser Boot beschrieb eine Wendung
von neunzig Grad, verlor sofort alle Fahrt und wiegte
sich dümpelnd auf dem Wasser - eine hilflose, unbe-
wegliche Beute für das Motorboot, das auf uns zukam
wie ein niederstoßender Falke.
Als es auf etwa zwanzig Meter heran war, packte
ich Steve bei der Hand und schrie: »Springen!«
Hand in Hand sprangen wir ins Meer, so weit wir
nur konnten. Beim Auftauchen hörten wir hinter uns
das Krachen und Splittern von Holz. Das starke

41
Motorboot hatte unsere kleine Jolle buchstäblich in
zwei Teile zerschnitten, die sofort abzusacken began-
nen. Im nächsten Moment traf uns die hohe schäu-
mende Bugwelle und drückte uns unter Wasser. Die
ganze Zeit hielt ich Steves linke Hand fest in meiner
rechten.
Als wir unsere Köpfe wieder über Wasser brachten
und Atem schöpften, klang das Brummen des Motor-
bootes schon ziemlich weit entfernt. Dann hob mich
eine Welle, und ich sah das Boot mit hoher Ge-
schwindigkeit in Richtung Monte Carlo entschwin-
den.
Das größte Wrackstück, das ich entdecken konnte,
war der untere Teil des Mastes mit den beiden daran
hängenden Rettungsringen. Ohne einander loszulas-
sen, paddelten wir darauf zu, bis wir es erreichten und
uns an den Rettungsringen festhalten konnten.
Sobald Steve wieder einigermaßen normal atmen
konnte, fragte sie ironisch: »Nun, behauptest du
immer noch, daß der Mann in dem Motorboot nur an
meiner Figur interessiert war?«
Ich hielt es für besser, die Antwort schuldig zu
bleiben.
Während wir an unserem Stück Mast im Spiel der
Wellen auf und nieder wippten, schien mir die Küste
unendlich weit entfernt. Keins der anderen Boote
hatte den Unfall bemerkt, und von unserer Jolle war
nicht genug übriggeblieben, um Aufmerksamkeit zu
erregen. Glücklicherweise war die Wassertemperatur

42
durchaus erträglich. Ich dachte, daß wir es ohne
weiteres bis gegen Abend aushalten könnten, und
während dieser Stunden würde bestimmt irgendein
Boot nahe genug herankommen, um uns zu bemerken.
Indessen dauerte es kaum zwanzig Minuten, bis
man uns fand. Ein ziemlich langsames, aber offenbar
sicheres Fischerboot tuckerte direkt auf uns zu. Als es
sich bis auf vierzig oder fünfzig Meter genähert hatte,
fing ich allerdings an, mich zu fragen, ob wir darauf
überhaupt Platz finden würden. Jedenfalls schien es,
als befinde sich annähernd die halbe Bevölkerung von
Nizza an Bord, um unsere Rettung mitzuerleben.
So zahlreiche eifrige Helfer griffen zu, um uns aus
dem Wasser zu ziehen, daß uns beinahe die Arme
ausgerissen wurden. Einige besonders beflissene
Retter waren auch gar zu gerne bereit gewesen,
künstliche Beatmung an Steve zu versuchen.
»Doucement, doucement! Faites place pour ma-
dame!«
Mein Französisch klang ziemlich echt. Doch leider
verrät sich fast jeder Engländer durch die etwas
schleppende Art der Sprache. So wunderte es mich
nicht, einen englischen Zuruf zu hören. Ich blickte
umher und sah den jungen Mann, der letzte Nacht bei
der Entdeckung von Judy Wincotts Leiche anwesend
war. Sein Name war, wie ich nun wußte, Tony Wyse.
Er schien bei Besatzung und Passagieren des Bootes
als Leiter der Rettungsaktion zu gelten; jedenfalls
wurde dank seiner Anweisungen etwas Platz für uns

43
gemacht, während hilfreiche Hände trockene Pullover
und Decken um unsere nassen Körper schlangen.
»Glücklicher Zufall, daß ich sah, wie es passierte«,
erklärte uns Tony Wyse, als er sein Feuerzeug an die
Zigaretten hielt, die wir von ihm angenommen hatten.
»Ich segle selber recht gern und beobachtete Ihr Boot
durch eins der Münzfernrohre auf der Promenade.«
»Sie haben es also gesehen!« rief ich aus. »Das ist
gut! Ich möchte den Eigentümer dieses Motorbootes
erwischen! Das Segelboot ist ein völliger Verlust, und
irgendwer wird dafür bezahlen müssen!«
»Oh, darum brauchen Sie sich keine Sorgen zu
machen«, beschwichtigte Wyse leichthin. »Alle diese
Leihboote sind ausreichend versichert.«
Seine Tageskleidung war ebenso individuell wie
seine Nachtgewandung. Er prunkte mit einer rehbrau-
nen Flanellhose, dazu passenden Wildledersandalen,
einem dieser farbenfrohen, diagonal gestreiften
spanischen Hemden, die man über der Hose trägt, und
einem seidenen Halstuch - letzteres natürlich mehr der
Eleganz als der Wärme wegen.
»Der Kerl tat es absichtlich!« äußerte Steve ziem-
lich wild. »Ich weiß, daß er uns vorher genau beo-
bachtet hat! Wären wir nicht ins Wasser gesprungen,
hätte der Zusammenstoß uns getötet! Und ich sage dir,
Paul, das alles kommt nur durch diese verwünschte -«
»Bestimmt war es nur ein unglücklicher Zufall«,
unterbrach ich sie schnell und wandte mich an Wyse:
»Wie erschien es Ihnen?«

44
Wyse machte eine elegante Handbewegung und
erwiderte: »Schwer zu sagen, ob er Ihr Boot gesehen
hat oder nicht. Aber ich würde ernstlich kaum behaup-
ten wollen, daß er Ihr Boot absichtlich überrannt hat.
Nein, das würde ich kaum wollen. Übrigens wissen
Sie wohl auch gar nicht, wer es gewesen ist? Oder?«
Er sprach im Ton eines guten Onkels, der ein er-
schrockenes Kind beruhigen möchte.
»Warum aber -«, begann Steve.
»Nein, natürlich nicht«, warf ich hastig ein und
versuchte Steves Protest durch ein verstohlenes
Zwinkern zu stoppen. »Es war ganz offensichtlich
einer dieser unglücklichen Zufälle. Doch sind wir
Ihnen deswegen nicht weniger dankbar, daß Sie uns
so prompt zu Hilfe kamen. Welch eine gütige Fügung,
daß Sie gerade durch ein Fernrohr schauten. Nun sieht
es so aus, als können wir das Nachmittagsflugzeug
nach Algier doch noch erreichen.«
»Oh, Sie fliegen heute nachmittag nach Algier?«
fragte Wyse, breit lächelnd und den Blick tröstend auf
Steves Gesicht gerichtet. »Das ist aber wirklich nett!
Ich selbst werde auch in dem Flugzeug nach Algier
sein.«
Wir erreichten das Flugzeug buchstäblich in letzter
Minute. Es hatte ziemlich lange gedauert, mit dem
Bootsverleiher ins reine zu kommen. Danach konnten
wir unsere Sachen nur noch auf gut Glück in unsere
Koffer werfen, unseren Lunch in Rekordzeit hinun-
terwürgen und mit einem Taxi zum Flugplatz jagen.

45
Die anderen Passagiere waren bereits in die große
Air-France-Maschine geleitet worden. Eine Boden-
stewardeß brachte uns in einer Art Laufschritt auf das
Rollfeld, fast so schnell, wie der Elektrokarren unsere
Koffer dorthin fuhr. Unmittelbar nachdem wir die
Maschine bestiegen hatten, wurde die Einstiegtreppe
fortgeschoben und die Tür geschlossen.
Unsere vorbestellten Plätze befanden sich etwa in
der Mitte des langen Rumpfes - zwei einander gege-
nüberliegende Sitze am Fenster. Das Flugzeug war
höchstens zu einem Drittel besetzt, aber ausgerechnet
auf dem Platz neben dem von Steve hatte sich eine
aparte weibliche Erscheinung niedergelassen, deren
Alter ich zwischen zweiundzwanzig und siebenund-
zwanzig schätzte. Daß sie Französin war, schien vom
ersten Moment an klar. Höflich lächelnd zog sie die
Beine an, um uns passieren zu lassen. Da ich im
Mittelgang wartete, bis Steve ihren Platz sicher
erreicht hatte, konnte ich sehen, wie die beiden
Frauen, beide lächelnd, beide liebenswürdig, wach-
sam abwägende Blicke tauschten.
Der Kontrast zwischen ihnen war beträchtlich.
Steve ist dunkelhaarig und begnügt sich meistens mit
sparsamem Make-up. Die Französin hatte aschblondes
Haar, schimmernd und so makellos frisiert, als wäre
sie erst am Vormittag beim Coiffeur gewesen. Ihre
Wimpern waren zu lang, um echt zu sein, ihre Finger-
nägel korallenrot lackiert und ihre Lippen mit einem
dazu passenden Lippenstift getönt. Aber es gab nichts

46
Billiges oder Auffallendes an ihrer Erscheinung. Man
mußte sie als eine von Natur aus sehr hübsche Person
anerkennen, die große Sorgfalt und guten Geschmack
für ihre Schönheit aufwendete.
In Luftreisen allerdings schien sie unerfahren zu
sein. Denn als das Signal zum Anlegen der Sicher-
heitsgurte aufleuchtete, hantierte sie so ratlos mit
ihrem Gurt, daß er sich mit dem von Steve verhedder-
te. Steve half ihr beim Anschnallen.
Die Französin zeigte ein reizendes Lächeln, suchte
ihre Englischkenntnisse zusammen und flüsterte: »Oh,
ich danken Sie sehr viel.« Dann lachte sie leise und
ein bißchen verlegen.
»Ach, nichts zu danken«, antwortete Steve freund-
lich. »Sie sind nicht an Luftreisen gewöhnt?«
»Bitte?«
»Ich meinte: Sie sind noch nicht oft im Flugzeug
gereist?«
Die Französin schüttelte den Kopf - behutsam, um
die Frisur nicht zu gefährden - und erläuterte: »Oh,
manchmal schon. Doch seit einige Jahr nicht mehr.«
Das Flugzeug schwenkte auf Kurs zur Startbahn ein
und begann schneller zu rollen. Eine ermutigend
lächelnde Stewardeß ging den Mittelgang hinunter
und ermahnte die Passagiere, ihre Zigaretten oder
Zigarren oder Pfeifen auszumachen; gleichzeitig
überzeugte sie sich, ob jeder seinen Sicherheitsgurt
angelegt hatte.
Die Französin beugte sich nach vorn und beobach-

47
tete durch das Fenster, wie draußen der Erdboden
immer schneller vorbeihuschte. Ich wußte, daß Steve
sie ablenken wollte, indem sie eine kleine Unterhal-
tung begann.
»Bleiben Sie in Algier, oder reisen Sie weiter?«
»Ich will nach Tunis. Über Nacht muß ich natürlich
in Algier bleiben, weil ich erst morgen weiterfliegen
kann.«
»Genauso machen wir es auch. Wir werden morgen
also wieder Reisegefährten sein.«
»Ja? Oh, wie hübsch. Ich sah Sie vergangene Nacht
im Hotel, als die Polizei alle Hotelgäste vernahm.«
»Ach, Sie haben auch dort gewohnt?«
»Ja. Oh, wie sehr - äh - desagreable muß es für Sie
gewesen sein, das arme Mädchen so zu finden.«
»Gewiß«, bekannte Steve, »das war es - sehr unan-
genehm.«
»Wie schrecklich, zu denken, daß Sie im nächsten
Zimmer waren, als ein Mörder sein Verbrechen
verübte.«
Nun, da die Unterhaltung in Gang gekommen, ver-
besserte sich das Englisch unserer Nachbarin. Sie
schien sehr interessiert an Einzelheiten über Judy
Wincotts Ermordung und begann Steve mit Fragen
zuzusetzen.
»Denken Sie, daß es ein Versuch war, die Polizei
glauben zu machen, Sie und Ihr Gatte hätten die Tat
begangen?«
Steve warf mir einen etwas verwirrten Blick zu, ehe

48
sie antwortete: »Lieber Himmel, nein, das denke ich
nicht.«
»Aber ist es nicht eine Tatsache, daß Sie, wäre der
andere Monsieur nicht zugegen gewesen, hätten
geraten können in eine sehr, sehr unerfreuliche
Situation?«
»Nun, wahrscheinlich wären wir -«, begann Steve.
»Oh«, warf die Französin eifrig ein, »ich allerdings
denke, daß sie ermordet wurde, ehe man sie in jenes
Zimmer brachte.«
»Aber warum«, fragte Steve verwundert, »warum
machte dann der Mörder so viel Geräusch, als er die
Leiche in den Wandschrank legte?«
»Nun«, entgegnete die Französin versonnen, »viel-
leicht wollte er, daß sie tun sollten, genau was Sie
taten - in das Zimmer gehen, wo die Leiche lag.«
Das Flugzeug hatte die Startbahn erreicht. Das
Dröhnen der Motoren schnitt jede weitere Unterhal-
tung ab. Die Stewardeß hatte sich auf ihrem Sitz am
rückwärtigen Kabinenende angeschnallt. Das Flug-
zeug begann in schnell zunehmendem Tempo über die
Startbahn zu rasen. Die Französin neigte ihren Kopf
zurück gegen die Sitzlehne. Ich sah, wie sie zwei-
oder dreimal schluckte, aber das war alles, was sie an
Nervosität zu erkennen gab.
Nach wenigen Augenblicken erhob sich das Flug-
zeug vom Boden. Das Rumpeln hörte auf, unsere
Vorwärtsbewegung wurde seidenweich. Schon war
das Meer unter uns. Es sank schnell zurück, als das

49
Flugzeug stieg und Kurs auf die nordafrikanische
Küste nahm. Die Leuchttafeln mit dem Rauchverbot
erloschen; von überallher ertönte das Klicken der
Verschlüsse, als die Passagiere ihre Sicherheitsgurte
lösten.
Sobald sie von ihrem Gurt befreit war, öffnete die
Französin ihre Handtasche, holte ein goldenes Ziga-
rettenetui heraus, bot uns Zigaretten an, steckte ihre
eigene Zigarette in eine elegante Spitze, griff noch-
mals in die Handtasche und brachte ein Briefchen
Zündhölzer zum Vorschein. Die Hülle des Briefchens
war dunkelblau und trug die in Gold aufgedruckten
Initialen S.L.
Sie riß ein Hölzchen an und hielt es zunächst Steve
hin und dann mir. Ich sah, wie meine Frau sehr
neugierig auf das Zündbolzbriefchen guckte. Zuletzt
zündete die Französin ihre eigene Zigarette an.
»Ihnen gefallen meine Zündhölzchen?« fragte sie
nach dem ersten Zug; sie hatte also Steves neugieri-
gen Blick auch bemerkt und lächelte. »Ich lasse sie
mir eigens anfertigen. Ein billiges Vergnügen, es
kostet nicht viel. Das sind meine Initialen. Simone
Lalange. Sehr hübsch, nicht wahr?«
Ich hielt Steves betont liebenswürdige Bejahung für
etwas verkrampft und war enttäuscht, daß sie die
Unterhaltung nicht fortsetzte. Ihr Ausdruck hatte sich
verändert; sie sah mich so merkwürdig an, daß ich
fürchtete, sie habe mit beginnender Luftkrankheit zu
kämpfen.

50
Ich lehnte mich zu ihr hinüber und fragte besorgt:
»Fühlst du dich ganz wohl, Steve?«
»Ach, danke. Eigentlich ja. Aber ich glaube, ich
könnte einen Brandy brauchen, um meinen Magen zu
beruhigen. Wir haben unseren Lunch wirklich in
Weltrekordzeit verschlungen.«
»Im Heck dieser Maschine ist eine kleine Bar. Wol-
len wir hingehen und etwas trinken?«
»Oh, gerne.«
Bisher hatte noch niemand daran gedacht, die Bar
aufzusuchen; wir hatten das kleine Abteil also für uns.
»Paul«, flüsterte Steve mir zu, sobald der Steward
unsere Getränke gebracht und sich wieder hinter
seinen winzigen Tresen zurückgezogen hatte, »Paul,
erinnerst du dich daran, wie wir letzte Nacht vor jener
Zimmertür standen, kurz bevor wir die Leiche ent-
deckten?«
»Ja, genau.«
»Nun, ich bemerkte etwas auf dem Boden des Kor-
ridors und hob es auf. Es war ein leeres Zündholz-
briefchen.«
»Ich sah, daß du dich bücktest, und wunderte mich,
was dir hinuntergefallen sein könnte. Inzwischen hatte
ich es völlig vergessen.«
»Ich auch. Aber jetzt weiß ich es wieder genau. Das
Briefchen hatte eine blaue Hülle mit den Initialen
S.L.«
Ich blickte instinktiv durch die offene Tür zu den
Sitzen, die wir eben verlassen hatten.

51
»Du hast das Zündbolzbriefchen dieser Simone
Lalange gesehen«, fuhr Steve fort. »Es stimmt haar-
genau mit dem überein, das ich gefunden habe.«
»Warum hast du der Polizei nicht von deinem Fund
erzählt? Er könnte sehr wichtig sein.«
»Ach, ich hatte die ganze Sache völlig vergessen.
Das gefundene Briefchen ist noch in der Tasche
meines Hausmantels.«
»Nun, vielleicht ist es auch nicht so sehr wichtig«,
versuchte ich Steve zu beruhigen. »Man mag Made-
moiselle Lalange das Zimmer gezeigt haben, ehe es an
Mr. Leyland vermietet wurde. Oder sie hat das
Briefchen fortgeworfen, als sie zufällig den Korridor
entlangging. Oder es war überhaupt nicht ihr Brief-
chen. Sam Leyland hat dieselben Initialen. Und
Geschäfte, in denen man solche Spezialanfertigungen
machen lassen kann, gibt es auch in England. Viel-
leicht stammte das gefundene Briefchen also von Sam
Leyland.«
»Vielleicht«, entgegnete Steve zweifelnd. »Aber
hast du nicht gehört, was sie über den Mord sagte? Sie
scheint mehr Theorien zu haben als sonst jemand.«
»Nun, wenn du wirklich Argwohn gegen sie hegst,
würde ich dir raten, etwas freundlicher zu ihr zu sein.
Sie dürfte sich dann offener geben, als wenn du ihr die
kalte Schulter zeigst.«
»Habe ich ihr die kalte Schulter gezeigt?«
»Ja. Du wurdest stumm wie eine Auster, als sie dir
Feuer für deine Zigarette reichte. Ich kann mir nicht

52
vorstellen, daß sie in diese Sache verwickelt ist. Aber
ich denke, du solltest sie ein bißchen hofieren. Auf
jeden Fall wäre sie eine attraktive Bekanntschaft für
die Familie.«
Steves Blick hatte das Glitzern eines Dolches in
sich.
»Ich weiß ja, daß du alle meine Theorien für sehr
belustigend hältst«, sagte sie nicht ohne Würde. »Aber
ich bin überzeugt, daß eine höchst fragwürdige Sache
im Gange ist und daß diese Sache mit der verwünsch-
ten Brille zu tun hat. Der Brille wegen wurden Judy
Wincott und diese Diana Simmonds ermordet, der
Brille wegen sollten wir beide heute vormittag auf den
Grund des Meeres geschickt werden. Irgendwer ist
entschlossen, zu verhindern, daß wir sie David Foster
übergeben.«
»Während du entschlossen bist, uns keinesfalls
daran hindern zu lassen?«
»Zum erstenmal richtig«, antwortete Steve kriege-
risch und zeigte den energischen Ausdruck, den sie
immer zeigt, wenn sie etwas unbedingt will.
Das Flugzeug hatte seine Flughöhe erreicht und zog
nun waagerecht dahin. Ich stellte mein Glas auf unser
niedriges Tischchen und blickte Steve vergnügt an.
»Wenn diese Brille so unerhört wichtig ist, bin ich
froh, daß du dich um sie kümmern willst. Ich hoffe
doch, du hast sie noch?«
»Natürlich. Sie ist hier in meiner Handtasche.«
Sie machte die Handtasche auf, um es mir zu be-

53
weisen. Eine Sekunde später wühlte sie fieberhaft in
der Kollektion teils nützlicher, teils überflüssiger
Dinge, die sie darin spazierenträgt. Dann zog sie die
Hand heraus und klappte die Tasche zu.
»Sie ist weg! Jemand muß sie aus meiner Tasche
genommen haben, seit wir im Flugzeug sind. Sie war
noch da, als wir unsere Flugscheine vorzeigten. Diese
Französin -! Ich weiß, daß sie -«
Steve wollte sich erheben, aber ich hielt sie zurück
und klopfte mit der anderen Hand auf meine Brustta-
sche, in der die Brille sicher hinter dem Taschentuch
verborgen war.
»Ich hielt es für weise, dich von dieser Verantwor-
tung zu befreien. Hast du vergessen, daß dir seit
Beginn unserer Ehe drei Handtaschen verlorengegan-
gen sind, die ich dir geschenkt hatte?«
Sie betrachtete mich nun mit unverhohlener Abnei-
gung.
»Bisweilen erweckst du den Eindruck, als seist du
der Loyalität einer anständigen Frau nicht würdig«,
erklärte sie in ihrem verächtlichsten Ton und verließ
die Bar.
Ich sollte nicht lange allein in der Bar bleiben.
Entweder durch Zufall oder weil er Steve hatte
hinausgehen sehen, erschien nach wenigen Augen-
blicken Tony Wyse. Er begrüßte mich herzlich und
setzte sich, nachdem er einen Brandy mit Soda bestellt
hatte, an mein Tischchen. Für die Reise trug er einen

54
eleganten dunkelgrauen Anzug, dunkelgraue Wildle-
derschuhe und, zu einem beigefarbenen Seidenhemd,
eine dunkelgrau und schwarz gemusterte Krawatte.
Nach den Ereignissen der letzten Nacht und der
Rettungsaktion an diesem Vormittag schien er mich
als eine Art lange vermißten Bruder zu betrachten.
»Eins verwirrt mich, Temple. Als Sie letzte Nacht
die Schranktüren öffneten und uns den gräßlichen
Anblick des ermordeten Mädchens enthüllten, reagier-
te Ihre Frau auf eine Art, die mich sehr nachdenklich
machte. Sie schien sofort zu wissen, wer die Ermorde-
te war.« Wyse spielte mit seinem Glas, beobachtete
mich aber genau, als er hinzufügte: »War sie eine
Freundin von Ihnen beiden?«
»Das eigentlich nicht. Wir sind ihr zwar in Paris
begegnet, aber nur ganz flüchtig.«
»In Paris?« Diese Neuigkeit schien ihn zu überra-
schen.
»Ja. Eine Zufallsbekanntschaft. Sie war meiner
Frau mit Einkaufsratschlägen behilflich. Daraufhin
luden wir sie zu einem Aperitif ein.«
»Haben Sie das der Polizei gesagt?«
»Natürlich. Glauben Sie, ich hätte versucht, etwas
zu verschweigen?«
»Nein, wahrhaftig nicht!« Wyse nahm einen
Schluck aus seinem Glas und bemühte sich, seinen
Charme, der vorübergehend etwas verblichen war,
wieder strahlen zu lassen. »Ich bedauere, so neugierig
gewirkt zu haben. Aber es ist doch begreiflich, daß

55
man viel über einen Mord nachdenkt, wenn man
sozusagen über das Opfer stolperte, als es noch warm
war.«
»Ich fürchte, ich kann Ihnen dazu nichts Neues
sagen.«
Wyse schien den Wink zu verstehen und wechselte
das Thema.«
»Ist dies Ihre erste Reise nach Nordafrika?«
»Ja.«
»Vielleicht kann ich Ihnen irgendwie behilflich
sein? Ich kenne Algier und Tunis ziemlich gut. Ich
empfände es als Auszeichnung, wenn Sie mir erlau-
ben würden, Sie und Ihre Gattin zu einigen Sehens-
würdigkeiten zu führen.«
Ich hatte das Gefühl, daß mir ein ganzer Tag von
Wyses Allerweltsgeschwätz ziemlich auf die Nerven
gehen würde, und entgegnete höflich lächelnd: »Oh,
das ist außerordentlich nett von Ihnen. Aber wir
hoffen in Algier und Tunis Freunde zu treffen. -
Fliegen Sie geschäftlich dorthin?«
»Ja. Ich arbeite für Freeman und Bailey - die Inge-
nieursfirma, wissen Sie. Wir haben viel mit der Trans-
Afrika-Öl-Company zu tun.«
»Mit der Trans-Afrika-Öl? Vielleicht kennen Sie
einen Bekannten von mir, der bei dieser Firma
arbeitet? David Foster ist sein Name.«
»David Foster?« Wyse wiederholte den Namen
nachdenklich. »Nein, ich kann nicht sagen, daß ich
ihn kenne. Wissen Sie, ich komme soviel herum, daß

56
ich von jeder Niederlassung nur ganz wenige kenne.«
»Sind Sie Ingenieur?«
»Kein ausgebildeter Ingenieur, obwohl ich natür-
lich gewisse Kenntnisse habe. Ich bin in der Abtei-
lung, die sich mit der Herstellung neuer und der
Pflege bestehender Beziehungen befaßt. Praktisch
also immer unterwegs, könnte man sagen.«
Er lächelte herzerwärmend, aber ich spürte, daß er,
so gerne er fragte, selbst nicht gerne auf Fragen
antwortete. Kurz darauf entschuldigte er sich, bezahlte
sein Getränk und entschwand.
Die Bar wurde allmählich voller, und ich fand, daß
ich meinen Platz für jemand anders frei machen sollte.
Ich schickte mich eben an aufzustehen, als mich der
sanfte Druck einer Hand auf meine rechte Schulter
stoppte.
Leicht verwundert blickte ich auf die Hand hinab.
Sie war fett und weiß, mit Grübchen an den Finger-
knöcheln. Hinter der schneeweißen Seidenmanschette
war der schwarze Stoffärmel eines sehr teuren Anzugs
zu sehen. Mein Blick wanderte weiter, bis er die
gesamte Erscheinung des Mannes erfaßt hatte, der nun
neben mir Platz nahm.
Ich konnte ihn auf Anhieb nicht leiden. Das schwe-
re süßliche Parfüm, das er benutzte, legte die Vermu-
tung nahe, daß sein eigener Körpergeruch stark und
unangenehm sei. Seine Augen waren klein und
verschlagen, seine dicken Lippen lasterhaft. Er hatte
eine Stirnglatze, aber sein öliges Nackenhaar ringelte

57
sich über den Kragen hinab.
»Einen Moment, bitte. Sie sind Mr. Temple, nicht
wahr?«
Er sprach mir unangenehm dicht ins Gesicht und
mit wispernden Tönen.
»Der bin ich. Aber ich glaube nicht, daß ich das
Vergnügen habe, Sie zu kennen.«
»Wahrscheinlich nicht«, bestätigte der feiste Mann.
»Mein Name ist Constantin, Blanys Constantin. Und
Sie sind also Mr. Paul Temple?«
Ich hielt es für überflüssig, darauf zu antworten.
Der Steward kam, um Constantin nach seinen Wün-
schen zu fragen, aber jener winkte ihn ungeduldig
fort.
»Sie waren letzte Nacht in Nizza, Mr. Temple, und
wohnten in dem Hotel, in dem Judy Wincott umge-
bracht wurde?«
»Ja. Die Zeitungen haben eine gute Geschichte
daraus gemacht.«
»Keine ganz vollständige Geschichte, Mr. Temple.
Nirgendwo war zu lesen, daß Sie Miss Wincott bereits
in Paris getroffen hatten.«
»Wahrscheinlich wurde dies nicht als mitteilens-
wert erachtet.«
»Andere Leute mögen es trotzdem als sehr interes-
sant erachten - meinen Sie das nicht auch, Mr. Tem-
ple? Insbesondere solche Leute, die den Grund für
Miss Wincotts Besuch in Ihrer Wohnung in der
Avenue Georges V. kennen.«

58
Der Mann war noch näher gerückt und wisperte mir
jetzt fast direkt ins Ohr. Da ich in einer Ecke saß,
konnte ich nicht ausweichen, falls ich nicht Gewalt
anwenden wollte.
Er fuhr fort: »Sie sagten der Polizei nicht, daß Miss
Wincott Ihnen ein sehr wertvolles Dokument anver-
traute. Das haben Sie verschwiegen - nicht wahr, Mr.
Temple?«
Ich fühlte Ärger in mir aufwallen, gab es aber nicht
zu erkennen, sondern erwiderte ruhig: »Ich habe der
Polizei nichts dergleichen gesagt, weil es absolut
unwahr gewesen wäre.«
»Ei, ei«, hauchte er mir ins Ohr, »Sie und ich wis-
sen das besser.«
»Wenn Sie die Wahrheit hören wollen, bitte. Miss
Wincott bat mich lediglich, einem Mr. David Foster,
der in Tunis lebt, eine Brille zu überbringen. Miss
Wincott hatte zufällig erfahren, daß meine Frau und
ich nach Tunis wollen.«
Constantin blinzelte mehrmals sehr hastig und
schien irgendwie außer Fassung geraten. Doch dann
ging er gleich wieder zum Angriff über.
»Man hat Sie zum Narren gehalten, Mr. Temple. Es
gibt keinen David Foster. Und diese Brille wird Ihnen
nur Schwierigkeiten bringen.«
»Mr. Constantin, ich denke, Sie sind es, der sich
hier zum Narren macht. Es ist eine ganz normale
Brille, ohne jedes Geheimnis. Das hat die Polizei
festgestellt. Erwiesen ist auch, daß sie mit dem Mord

59
an Miss Wincott nicht in Verbindung gebracht werden
kann.«
»Nichtsdestoweniger« - Constantin spähte unruhig
umher, um sich zu vergewissern, daß niemand lausch-
te -, »nichtsdestoweniger werde ich Ihnen eintausend
Pfund geben, wenn Sie mir diese Brille überlassen.«
Ich begann zu lachen und schüttelte den Kopf, aber
Constantin rückte mir so auf den Leib, daß er mich
mit seinem Wanst regelrecht in die Ecke drückte.
»Fünftausend Pfund!« zischte er mir ins Ohr. Und
dann, fast ohne Pause: »Zehntausend! Ich kann soviel
zahlen, glauben Sie mir! Sie erhalten Ihr Geld, wenn
wir in Algier ankommen!«
»Mr. Constantin, Sie verschwenden Ihre Zeit«,
sagte ich grob und stieß ihn beiseite, so daß ich
endlich aufstehen konnte.
»Nein«, rief er mir halblaut nach, als ich die Bar
verließ, »Sie sind es, der seine Zeit verschwendet. Ich
sage Ihnen, Sie werden Ihren David Foster niemals
finden!«

60
3
Als ich zu unseren Sitzen zurückkehrte, fand ich,
daß Steve der Französin ihren Fensterplatz geopfert
hatte. Aber Mademoiselle Lalange war, vermutlich
ermüdet vom Anblick des eintönig ruhigen Meeres, in
Schlaf gesunken. Ich winkte Steve, auf meinen Platz
hinüberzuwechseln, und setzte mich auf den leeren
Sitz daneben. Außer uns dreien war niemand weiter in
der unmittelbaren Nähe.
»Du hattest recht«, raunte ich Steve zu. »Diese
Brille hat irgendeine eigentümliche Bedeutung. Ich
kann mir nicht vorstellen, wieso. Aber es gibt Leute,
die viel Geld dafür bezahlen wollen. Und wo es um
viel Geld geht, sind häufig genug auch Mordmotive
vorhanden.«
Ich erzählte ihr von meiner Begegnung mit Con-
stantin und dem märchenhaften Angebot, das dieser
Mann mir gemacht hatte. Steve nickte, ohne den Blick
von der schlafenden Französin zu wenden. Sie schien
meinen Bericht nur als eine Bestätigung dessen zu
empfinden, was sie längst gewußt hatte.
»Der Anlaß für die Ermordung dieser beiden Mäd-
chen steckt in deiner Brusttasche«, antwortete sie
milde. Ȇbrigens habe ich auch etwas Interessantes
entdeckt. Ich hatte« - sie wies auf die schlafende
Französin - »eine nette Unterhaltung mit ihr. Sie hat
mir praktisch ihre ganze Lebensgeschichte erzählt.
Ahnst du, was sich herausstellte? Sie reist nach Tunis,

61
weil sie Freunde bei der Trans-Afrika-Öl hat. Ein
merkwürdiger Zufall, nicht wahr?«
»Kennt sie David Foster?«
»Ich fragte sie. Aber sie sagte nein, sie kenne bis
jetzt nur die Namen von drei oder vier Leuten in der
Firma.«
Wir beide betrachteten das schlafende Mädchen
und stellten uns im stillen wahrscheinlich dieselbe
Frage: Was hatte Simone Lalange in der vorigen
Nacht - falls das leere Zündholzbriefchen von ihr
stammte - bei der Tür von Nummer 12 zu tun gehabt?
Der Rest des Fluges verlief ereignislos. Weder
Constantin noch Wyse kamen wieder in unsere Nähe.
Simone Lalange allerdings wachte nach einem
Weilchen auf und erwies sich dann als recht unterhalt-
same Reisegefährtin. Sie widmete ihre Aufmerksam-
keit hauptsächlich mir und entwickelte dabei beachtli-
chen Charme. Mit stillem Vergnügen nahm ich die
kleinen Doppelsinnigkeiten zur Kenntnis, die sich
nach und nach in Steves anscheinend harmlose
Bemerkungen schlichen. Am Ende war ich aber doch
irgendwie erleichert, als die afrikanische Küste in
Sicht kam und unser Flugzeug bald darauf zur Lan-
dung ansetzte.
Die Air France hatte für die meisten Fluggäste
Zimmer im Hotel Aletti gebucht, dem modernsten
Hotel von Algier, mit wunderbarem Blick auf den
Hafen. In dem Bus, der uns zum Hotel brachte, fuhren

62
auch Simone Lalange und Tony Wyse. Constantin
war mir gleich nach der Landung aus den Augen
geraten. Entweder hatte er beim Flughafen Freunde
getroffen oder ein privates Beförderungsmittel
vorgezogen.
Der Empfangschef im Hotel ließ uns die üblichen
Anmeldeformulare ausfüllen. Als er meins entgegen-
nahm, hob er die Augenbrauen und sagte: »Mr.
Temple? Wir hatten einen Telefonanruf für Sie. Vor
einer halben Stunde fragte ein Herr, ob Sie bereits
eingetroffen wären.«
»Seltsam«, raunte ich Steve zu. »Ich kenne nie-
manden in Algier und habe doch auch niemanden
benachrichtigt, daß wir kommen.« Ich wandte mich an
den Empfangschef: »Nannte er einen Namen?«
»Non, Monsieur. Er sagte, er würde Sie später wie-
der anrufen.«
Unser Zimmer erwies sich als ein Prachtraum mit
sehr schönem Ausblick auf den Hafen. Aber zuerst
mußten wir uns um unsere Kleidung kümmern, die
wir in Nizza so hastig und lieblos in die Koffer
geworfen hatten. Während wir dabei waren, sie in den
großen Schrank zu hängen, sagte Steve: »Ach, Paul,
ich wünschte, du würdest diese Brille an einem
sicheren Ort deponieren.«
»Traust du mir nicht zu, daß ich sie gut genug ver-
wahren kann?«
»Das ist es nicht. Wenn dieser Mann Constantin sie

63
so dringend haben will, daß er zehntausend Pfund
dafür geboten hat, könnte er leicht versuchen, sie dir
gewaltsam abnehmen zu lassen. Du selbst sagtest,
daß, wenn es um viel Geld geht, häufig genug auch
Mordmotive vorhanden sind. Warum bittest du nicht
die Hotelverwaltung, die Brille in ihren Safe zu
schließen?«
Ich war mit meinen Toilette- und Rasierutensilien
auf dem Weg in das kleine Badezimmer.
»Du kannst doch nicht im Ernst von mir erwarten«,
entgegnete ich, »daß ich die Hotelverwaltung bitte,
eine ganz gewöhnliche Brille in ihren Safe zu schlie-
ßen. Man würde mich für übergeschnappt halten.
Außerdem könnte es bloß Aufmerksamkeit erregen.«
»Es kann keine ganz gewöhnliche Brille sein«,
widersprach Steve. »Sie muß einen sehr hohen Wert
haben - für diesen David Foster und für andere.«
»Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen,
wieso. Die französische Polizei ist sehr gewissenhaft,
und du darfst überzeugt sein, daß sie diese Brille
peinlich genau untersucht hat.«
Aus dem Bad wieder in das Zimmer zurückkeh-
rend, holte ich die Brille aus meiner Brusttasche und
legte sie auf den Schreibtisch beim Fenster. Steve
stand neben mir; wir beide sahen auf die Brille hinab.
Es war schwer, sich etwas Harmloseres vorzustellen.
Sie erinnerte mich irgendwie an den gütigsten Schul-
lehrer, den ich in meiner Kindheit gehabt hatte; ich
mußte an süßlichen Pfeifentabaksrauch denken, an die

64
Lederrücken alter Lehrbücher und an das vertraute
Rasseln des alten Rasenmähers auf der Kricketwiese
vor unseren Klassenfenstern. Aber seitdem diese
Brille in meine Hände gekommen war, hatten brutale
Morde zwei Menschenleben ausgelöscht, hatte ein
gemeiner Versuch stattgefunden, Steve und mich zu
ertränken, hatte ein völlig Fremder mir zehntausend
Pfund angeboten, wenn ich ihm die Brille überließe.
»Ich begreife deine Haltung nicht, Paul.« Steves
Ton verriet, daß sie meine Nachdenklichkeit mißdeu-
tete. »Du willst es einfach nicht ernst nehmen.«
Ich legte ihr einen Arm um die Schultern.
»Ich nehme es ernst, Steve. Ich glaube durchaus,
daß an dieser Brille ein finsteres, wahrscheinlich
tödliches Geheimnis hängt. Aber ich habe einem jetzt
toten Mädchen mein Wort gegeben, sie ihrem Eigen-
tümer abzuliefern. Das will ich so schnell wie möglich
hinter mich bringen. Und dann, Steve, werden wir
unsere Ferien unbeschwert genießen.«
Steve beantwortete mein Lächeln nicht. Ihr Blick
war düster, als sie sagte: »Angenommen, Constantin
hat recht, und du wirst David Foster nicht finden?
Vielleicht existiert überhaupt kein David Foster?«
»Wenn sich das herausstellt, werde ich die Brille
wieder nach Frankreich mitnehmen und der dortigen
Polizei übergeben. Dennoch denke ich, daß David
Foster existiert - auch wenn er vielleicht unter einem
anderen Namen bekannt ist. Es wäre durchaus mög-
lich, daß wir ihn schon getroffen haben.«

65
»Du meinst, er könnte Tony Wyse sein? Warum
hatte er dich dann nicht einfach gebeten, ihm sein
Eigentum auszuhändigen? Aber ich glaube nicht an
diese Theorie. Ich bezweifle, daß Mr. Wyses Sehkraft
so geschwächt ist.«
Es war kennzeichnend für meine Gefühle, daß ich,
als plötzlich das Telefon schnarrte, die Brille schnell
in meine Brusttasche steckte und hinter dem Taschen-
tuch verbarg. Erst dann nahm ich den Hörer ab.
»Hallo?«
»Ist dort Mr. Temple?«
»Ja. Wer spricht dort?«
»David Foster. Ich erfuhr, daß Sie meine Brille
haben, und hielt es für richtig, Sie anzurufen, um zu
vereinbaren, wie ich sie von Ihnen erhalten kann.«
»Oh, Mr. Foster?« Ich wiederholte den Namen, um
Steve einen Wink zu geben. Sie stellte sich neben
mich und drückte ein Ohr an die Außenseite des
Hörers. »Ich habe nicht erwartet, von Ihnen zu hören,
ehe wir nach Tunis kämen.«
»Ach ja, freilich. Wissen Sie, ich bin geschäftlich
für ein paar Tage nach Algier gekommen. Judy
telegrafierte mir, daß Sie über Algier nach Tunis
reisen würden. Ich dachte, ich könnte Ihnen weitere
Mühen ersparen, wenn ich mir die Brille gleich hier
von Ihnen geben ließe.«
»Gewiß. Ich nehme ja an, Sie kommen ohne die
Brille schwer zurecht.«
»Oh -?« Die Stimme klang unsicher. »Bitte, wie

66
meinen Sie das?«
»Nun, ich denke, daß es für Sie, als einen so kurz-
sichtigen Menschen, schwierig ist, zu lesen - und
ähnliches.«
»Ach so, ja. Natürlich.« Der Anrufer lachte nervös.
»Ja, ich - äh - ich stolpere fortwährend über alles
mögliche, und so weiter. Eine schreckliche Plage.
Nicht zuletzt, weil ich fast mit Sicherheit immer in
den falschen Omnibus steige. Ha, ha, ha. Treffe ich
Sie im Hotel an, wenn ich jetzt direkt hinkomme?«
»Ja. Wie lange würden Sie brauchen?«
»Nicht lange. Ich bin in der Villa Negra -«, die
Stimme verstummte plötzlich. Ich legte eine Hand
über die Sprechöffnung und sah zu Steve.
»Wir scheinen getrennt worden zu sein.«
Steve sagte: »Mir scheint es eher, als habe er genau
dasselbe getan wie du - die Hand über die Sprechöff-
nung gelegt. Aber was -«
Ich winkte Steve zu schweigen, denn die Stimme
im Telefon meldete sich wieder: »Sind Sie noch da?«
»Ja.«
»Ich werde in etwa zwanzig Minuten im Hotel sein.
Würden Sie in der Eingangshalle auf mich warten?«
»Ja. Fragen Sie am Empfang nach mir.«
»Gut. Übrigens - wie geht es Judy?«
»Judy Wincott? Ich fürchte, da habe ich schlechte
Nachrichten für Sie. Aber darüber nachher, wenn wir
uns treffen.«
»Schlechte Nachrichten?«

67
»Leider ja. Bis nachher also, Mr. Foster.«
Es war zweiundzwanzig Minuten nach sieben, als
ich auflegte. Kurz vor halb acht erschienen Steve und
ich in der Halle und baten den Mann am Empfang,
dem erwarteten Besucher zu zeigen, wo wir säßen.
Um halb neun fragte ich zum drittenmal am Emp-
fang nach, aber niemand hatte sich nach uns erkun-
digt, niemand hatte telefoniert.
»Noch immer nichts«, sagte ich zu Steve, als ich
wieder zu ihr kam. »Ich fürchte, unser Vogel wird
nicht erscheinen.«
»Ich hatte den Eindruck, als sei euer Telefonge-
spräch etwas merkwürdig gewesen. Kann es dein
Freund Constantin gewesen sein?«
»Nein. Constantins Stimme hätte ich unter allen
Umständen erkannt. Vielleicht hat David Foster
wieder den falschen Bus genommen.«
»Es gibt wohl keine Möglichkeit, den Anruf zu-
rückzuverfolgen?«
»Er erwähnte die Villa Negra. Aber das schien ihm
versehentlich herausgeschlüpft zu sein. Vielleicht
kann man uns am Empfang helfen.«
Die drei Männer an der Rezeption waren anfangs
merkwürdig zurückhaltend und skeptisch. Erst als ich
ihnen sagte, dann müsse ich mich eben an die Polizei
wenden, änderte sich ihr Verhalten. Adreßbücher und
Stadtpläne wurden aus verschiedenen Schubladen
geholt. Nach wenigen Minuten zeigte einer der
Hotelangestellten auf einen Stadtplan und begann zu

68
erklären.
Die Villa Negra war ein ziemlich großes Haus an
einer kleinen Bucht westlich der Stadt, ungefähr
fünfzehn Autominuten vom Hotel entfernt.
»Können Sie uns ein Taxi besorgen?« fragte ich.
»Das wird nicht nötig sein, Monsieur. Drei, vier
Taxis warten ständig vor dem Hotel.« Ein Page wurde
herbeigewinkt. »Führe Monsieur zu einem Taxi.«
»Aber unser Dinner?« fragte Steve, als ich ihr mit-
teilte, wohin wir fahren wollten. »Ich muß gestehen,
daß ich schon seit einer halben Stunde ziemlich
Hunger habe.«
»Leider werden wir damit noch ein wenig warten
müssen. Zuerst die Villa Negra. Ich denke, wir
werden mit besserem Appetit essen, wenn wir Mr.
Foster gefunden und ihm seine Brille zurückgegeben
haben.«
Der Taxifahrer kannte den betreffenden Vorort von
Algier nicht gut genug, um uns auf kürzestem Wege
zur Villa Negra zu bringen. Er mußte einigemal
fragen und stoppte schließlich unterhalb eines weißen,
etwas vernachlässigt aussehenden Gebäudes, das auf
einem Hügel abseits der Straße stand.
Das Gittertor, das er gefunden hatte, war zu schmal
für ein Auto, und der Weg dahinter schien eher eine
Art Pfad zu sein.
»Na ja«, murmelte der Fahrer und rückte sich seine
Mütze ins Genick. »Vielleicht ist dies bloß der

69
Hintereingang.«
»Genügt uns«, sagte ich zu ihm und stieg aus.
»Wieviel schulde ich Ihnen?«
Der erste Teil des Weges ließ sich leicht an. Die
Steigung war mäßig, und wir schritten munter aus,
obwohl der Pfad von Gras überwuchert war und die
Dornen der Brombeerbüsche links und rechts unsere
Kleidung bedrohten. Natürlich war es längst dunkel
geworden, aber das starke Licht hinter den hohen
Parterrefenstern der Villa erhellte indirekt auch den
Weg.
Die Villa mußte ehedem ein vornehmes Wohnhaus
gewesen sein. Sie hatte einen gewiß großartigen
Ausblick auf das Meer und besaß eine offenbar
ringsherum führende Terrasse. Der Pfad wurde steiler
und endete schließlich in engen Kehren.
Als wir uns dem Ende des Pfades zu nähern schie-
nen, flüsterte Steve: »Ich möchte nur hoffen, daß der
echte David Foster wirklich hier wohnt.«
Gleich darauf machten wir halt, da plötzlich aus
einem Zimmer des Hauses wütendes Schimpfen
ertönte, so laut, daß es trotz der geschlossenen Glastü-
ren unangenehm deutlich zu hören war. Auf einmal
kam, die Arme zum Schutz über den Kopf erhoben,
die Gestalt eines Mannes durch das Glas einer Fen-
stertür gesprungen. Fast gleichzeitig mit dem Klirren
des Glases ertönte ein Schuß und sofort noch einer.
Der Mann stieß einen Schmerzensschrei aus.
Wir sahen ihn geduckt über die Terrasse der kurzen

70
steinernen Treppe entgegen wanken, die zu dem Pfad
hinabführte, auf dem wir standen. Am Kopf der
Treppe blieb er eine Sekunde lang stehen, um Atem
ringend, vor Schmerz gekrümmt. Dann stolperte und
taumelte er die Stufen hinab. Da er nun im Schatten
war, sahen wir ihn nicht mehr, konnten aber sein
Keuchen und Stöhnen hören, als er näher kam.
Oben beim Haus war eine der Türen geöffnet wor-
den, und zwei Männer hatten sich vorsichtig ins Freie
gewagt. Durch die Dunkelheit getäuscht, begannen sie
suchend die verkehrte Seite der Terrasse entlangzu-
laufen.
Der fliehende Mann war ganz dicht vor uns, ehe er
uns bemerkte. Er kam so gekrümmt daher, daß ihm
unsere Gegenwart erst bewußt wurde, als er unsere
Füße sah. Er blieb erschrocken stehen und richtete
sich mit großer Schwierigkeit halb auf. Seine Ellbo-
gen, Unterarme und Hände waren von dem zersplitter-
ten Glas verletzt und bluteten. Auch über das Gesicht
rann ihm Blut. Aber das Schlimmste war der Schuß,
den er in den Rücken bekommen hatte.
Er taumelte schrecklich, als er zu erkennen ver-
suchte, ob wir Freunde oder Feinde seien. Ich griff
nach einem seiner Arme, um ihn zu stützen. Meines
Erachtens konnte er nur überleben, wenn er sich sofort
niederlegen und möglichst reglos auf das Eintreffen
eines Arztes warten würde.
»Keine Angst haben«, sagte ich beruhigend.
»Wer sind Sie?« keuchte er argwöhnisch. »Was tun

71
Sie hier?«
Seine Stimme kam mir bekannt vor. Ich fragte:
»Sind Sie der Mann, der mich vorhin im Hotel Aletti
angerufen hat? Ist Ihr Name David Foster?«
Er wischte sich über die Stirn, damit ihm das Blut
nicht in die Augen liefe. Wenn ich ihn nicht festgehal-
ten hätte, wäre er gefallen. Seine Kräfte schwanden
schnell.
»Sie sind Temple«, ächzte er. Um ihn nicht loszu-
lassen, mußte ich mich niederbeugen, denn jetzt sank
er vor Schwäche auf die Knie. »Ach, ich wünschte,
ich hätte zu Ihnen kommen können, aber -«
Seine Stimme versagte, und sein Gesicht verzerrte
sich vor Schmerz.
Steve, die das Haus und die Terrasse beobachtet
hatte, flüsterte warnend: »Vorsicht, Paul! Ich glaube,
sie kommen jetzt hierher!«
»Sind Sie David Foster?« raunte ich dem Verwun-
deten dringlich zu.
»Nein. Aber ich habe Sie angerufen. Er wollte es
so.«
»Wer?«
Von der Terrasse ertönten eilige Schritte und ein
Ruf. Der Verwundete klammerte sich angstvoll an mir
fest, als die Schatten zweier Gestalten am oberen
Ende der Treppe erschienen und stehenblieben, als
hielten sie Ausschau. Die eine Gestalt war sehr groß
und schlank, die andere kurz, breit und affenähnlich.
»O Gott!« flüsterte der Verwundete heiser. »Lassen

72
Sie diese Bestien nicht wieder über mich kommen!«
Ich sah voll Entsetzen die Blutpfütze, die sich seit-
lich von ihm am Boden bildete. Er verlor beängsti-
gend viel Blut aus der Wunde, von der ich nur wußte,
daß sie irgendwo in seinem Rücken war.
»Nur ruhig«, versuchte ich ihn zu ermutigen. »Wir
werden Sie beschützen.«
»Paul!« flüsterte Steve mir zu. »Die beiden sind zur
anderen Seite des Hauses hinübergelaufen. Aber ich
bin sicher, daß sie zurückkommen werden.«
Der Verwundete hörte Steves Worte und machte
eine furchtbare Anstrengung, wenigstens seinen
Oberkörper aufzurichten.
»Temple, was auch geschehen mag« - seine Stim-
me war kaum noch zu hören -, »was auch geschehen
mag, geben Sie ihnen die Brille nicht!«
Es war sein letzter Willensakt. Er kippte vornüber,
ein totes Gewicht in meinen Händen. Ich ließ ihn
behutsam zu Boden gleiten und drehte ihn auf den
Rücken. Von der Terrasse her hörte ich Schritte an der
anderen Seite des Hauses entlanglaufen. Ich nahm die
Brille aus meiner Brusttasche und reichte sie Steve.
»Hier, nimm das. Und geh zurück zu dem Gittertor,
durch das wir hereingekommen sind. Warte dort auf
mich - zwischen irgendwelchen Sträuchern versteckt,
falls du das für besser hältst. Sollte ich binnen einer
halben Stunde nicht gekommen sein, benachrichtige
auf schnellstem Wege die Polizei von dem, was hier
geschehen ist.«

73
»Paul«, begann sie, »ich verlasse dich nicht -«
»Du gehst«, knurrte ich. »Begreifst du denn nicht,
daß du im Moment die einzige Sicherheit bist, die ich
habe?« Ich legte ihr eine Hand auf den Arm und fügte
freundlicher hinzu: »Bitte tu, was ich dir sage.«
»Gott schütze dich«, flüsterte sie, als sie die Brille
nahm. »Ich glaube, ich höre die beiden zurückkom-
men.« Eine Sekunde später - war sie hinter der
nächsten Biegung des Pfades verschwunden.
Ich kniete mich zu dem verwundeten Mann. Viel-
leicht war er noch zu retten, wenn es mir gelang,
einen weiteren Blutverlust zu verhindern. Er trug
keine Jacke, nur ein dünnes Hemd und eine leichte
Hose. Seine Füße waren nackt. Ohne auf die Schritte
zu achten, die die Treppe herunterkamen, drehte ich
ihn auf die Vorderseite. Er ließ es willenlos geschehen
und gab keinen Laut von sich.
Sein Rücken war von den Schultern abwärts mit
Blut besudelt. Vermutlich war er schwer geprügelt
worden, ehe man auf ihn geschossen hatte. Ich riß sein
Hemd entzwei und sah die Einschußöffnung, aus der
das Blut pulste. Als ich mein zusammengelegtes
Taschentuch daraufdrückte, traf mich der Lichtkegel
einer starken Taschenlampe. Die näher kommenden
Schritte machten halt. Einen Moment lang herrschte
bedrohliche Stille.
»Wer sind Sie? Was machen Sie da?«
Die Stimme war hart und befehlsgewohnt; ihr
Französisch klang akzentfrei.

74
»Dieser Mann braucht schnellstens ärztliche Hilfe«,
erwiderte ich auf englisch. »Haben Sie ein Telefon im
Haus?«
»Zum Teufel, ich fragte, wer Sie sind!« Jetzt sprach
er englisch, mit einer Spur von amerikanischem
Akzent. »Was tun Sie auf meinem Grundstück? Falls
dieser Kerl ein Freund von Ihnen ist -« Der Lichtkegel
wurde auf den Verwundeten gerichtet, der mir er-
schreckend still vorkam. Ich fühlte nach seinem Puls.
Da rührte sich nichts mehr.
»Er ist niemandes Freund mehr. Er ist tot.«
Ich stand auf und versuchte mir die Hände an mei-
nem Taschentuch abzuwischen. Der kleinere der
beiden Männer trat in den Lichtkegel. Er war ein
breitschultriger, aber buckliger Araber mit unnatürlich
langen Armen und riesigen Händen. Ohne die gering-
ste Anstrengung drehte er den Toten wieder auf den
Rücken und starrte ihm in die Augen.
»C'est vrai«, murmelte er dem Mann mit der Ta-
schenlampe zu. »Il est mort.«
Ohne es zu sehen, hatte ich gespürt, daß dieselbe
Waffe, aus der der Mann am Boden den tödlichen
Schuß erhalten hatte, auf mich gerichtet war, seit der
Lichtkegel der Lampe mich beleuchtete. Ich wußte,
daß ich ein durchaus unerwünschter Zeuge des
Vorfalls war und daß es für den Mann mit der Waffe
die einfachste Lösung dargestellt hätte, mich zu
erschießen und dann im Meer verschwinden zu lassen,
sicher mit ein paar Steinen beschwert. Ich fand, daß es

75
an der Zeit wäre, mich vorzustellen.
»Mein Name ist Temple«, begann ich. »Ich kam
hierher, weil mir diese Adresse von einem Mr. David
Foster genannt wurde.«
»Sie sind Temple?« Der Lichtkegel wurde wieder
auf mein Gesicht gerichtet. »Ich bin Colonel Rostand,
der Eigentümer dieses Hauses. Ich bedauere, daß
Ihnen ein so unfreundliches Willkommen zuteil
wurde. Dieser Mann brach in mein Haus ein. Aber
glücklicherweise ertappten wir ihn auf frischer Tat. Er
riß sich los und versuchte zu entfliehen. Ich schickte
einen Schuß hinter ihm her - um ihn zu erschrecken
und zu vertreiben, versteht sich. Ich hatte gewiß nicht
die Absicht, ihn zu verletzen.«
»Zwei Schüsse«, berichtigte ich. »Und ich bin
überrascht zu hören, daß er sich losriß. Nach seiner
oberen Rückenpartie zu urteilen, ist er schwer geprü-
gelt worden.«
»Nun«, erwiderte Rostand, »ich fürchte, mein Hel-
fer hier ist gelegentlich ein wenig impulsiv.«
Der Bucklige beobachtete mich auf seltsam hungri-
ge Art; die riesigen Hände baumelten ihm dabei in
Wadenhöhe herum. Seine Stirn war so widernatürlich
flach, und seine Oberkieferzähne ragten so tierisch
über seine Unterlippe hinaus, daß ich unwillkürlich an
einen Orang-Utan denken mußte.
Rostand schwenkte den Lichtkegel seiner Stablam-
pe von mir fort und wandte sich dem Haus zu.
»Natürlich muß ich die Polizei anrufen und ihr

76
melden, daß ich einen Mann erschossen habe«, sagte
er. »Sie kommen bitte mit mir ins Haus, Mr. Temple.
Ich werde Sie dort mit Mr. Foster bekannt machen.«
»Er ist also da?«
»Ja, natürlich. Er wartet auf Sie, um seine Brille in
Empfang zu nehmen.«
Als ich mich in Bewegung setzte, um Rostand zu
folgen, wartete der Araber, bis ich an ihm vorüber
war, und trottete dann hinter mir drein. Wie ein gut
abgerichteter Schäferhund, der auch die wortlosen
Wünsche seines Herrn spürt, hatte er begriffen, daß
mir nicht erlaubt werden durfte zu entkommen.
Wir betraten das Haus durch die beschädigte Glas-
tür, deren beide Flügel jetzt weit offenstanden. Der
erste Raum war ein großer Salon mit so altmodischer
Einrichtung, daß er an ›die gute Stube um die Zeit der
Jahrhundertwende‹ in einem provinziellen Heimatmu-
seum erinnerte. Rostand führte mich weiter in einen
kleineren Raum, dessen Wände hinter Regalen voll
verstaubter Bücher versteckt waren.
»Wenn Sie mich für eine Minute entschuldigen
möchten, werde ich jetzt mit der Polizei telefonieren.
Sandro sorgt inzwischen für Ihr Wohlergehen.«
Er nickte dem Buckligen bedeutsam zu, ging wie-
der hinaus und machte die Tür hinter sich zu.
Sandros Sorge für mein Wohlergehen beschränkte
sich darauf, daß er mit dem Rücken zur Tür Aufstel-
lung nahm, seine unglaublich langen Affenarme
baumeln ließ und mich anstarrte. Um seinen wenig

77
sympathischen Blick zu vermeiden, wandte ich mich
dem nächsten Bücherregal zu und nahm auf gut Glück
einen Band heraus. Es war Pierre de Marivaux'
Komödie ›Die unaufrichtigen Geständnisse‹.
Ich hatte nicht ganz die Hälfte der ersten Szene
gelesen, als Rostand zurückkehrte, jetzt ganz Joviali-
tät und pensionierter Armeeoffizier. Er war lang und
hager, mit sehr aufrechter Haltung, braunem
Schnauzbart und kleiner unmoderner Nickelbrille.
Seine Hände befanden sich ständig in Bewegung.
»Die Polizei kommt«, versicherte er mir mit biede-
rem Lächeln. »Der Beamte, mit dem ich sprach,
konnte den Mann nach meiner Beschreibung als einen
gesuchten Einbrecher erkennen. Foster habe ich
gesagt, daß Sie hier sind. Er wird in einer Minute
unten sein.«
Er wandte sich an den Araber und sagte ihm barsch
in Französisch, daß er jetzt gehen könne.
Ohne ein Wort ging Sandro hinaus. Er hatte die Tür
hinter sich bereits halb zugemacht, als er sie schnell
wieder aufmachte, um einen anderen Mann eintreten
zu lassen.
»Ah, Foster«, sagte Rostand liebenswürdig zu dem
Ankömmling, »hier ist Ihr sehnlich erwarteter Freund
Mr. Temple.«
Der andere Mann blieb wie angewurzelt in der
offenen Tür stehen, ohne seine bereits zur Begrüßung
ausgestreckte rechte Hand sinken zu lassen, und
glotzte mich an. Ich starrte ebenfalls.

78
»Das also ist David Foster?« fragte ich Rostand.
»Habe ich es nicht eben gesagt?« fragte Rostand
ungeduldig zurück, offenbar verwirrt durch unser
beider Verhalten.
»Nun, Mr. Foster«, äußerte ich höflich, »ich finde
ja, Sie hätten sich schon in Nizza vorstellen können.
Aber vielleicht hatten Sie dort noch keinen Bedarf an
Ihrer Brille. Mir jedenfalls schien es, als sei an Ihrer
Sehkraft nichts auszusetzen.«
Der Mann, der sich in Nizza fortwährend als Sam
Leyland bezeichnet hatte, zuckte betreten die Achseln
und murmelte Rostand vorwurfsvoll zu: »Colonel, Sie
hätten mich aber auch warnen können.«
»Warnen? Wovor?«
»Daß dies derselbe Bursche ist, dem ich schon in
Nizza begegnet bin.«
Rostand machte einen letzten Versuch, den An-
schein zu wahren, indem er würdevoll zu mir sagte:
»Ich weiß nicht, wie er sich in Nizza nannte, Mr.
Temple, und warum er es für nötig hielt, sich nicht
unter seinem richtigen Namen vorzustellen. Aber ich
gebe Ihnen mein Offiziersehrenwort, daß er David
Foster ist. Wenn Sie ihm nun freundlicherweise seine
Brille übergeben würden, könnte ich Sandro befehlen,
Sie sogleich in Ihr Hotel zurückzufahren, damit Sie
nicht erst in die langwierigen Formalitäten mit der
Polizei verwickelt werden.«
Sam Leyland starrte mich so eindringlich an, als
wolle er mich beschwören, zu tun, wie Rostand gesagt
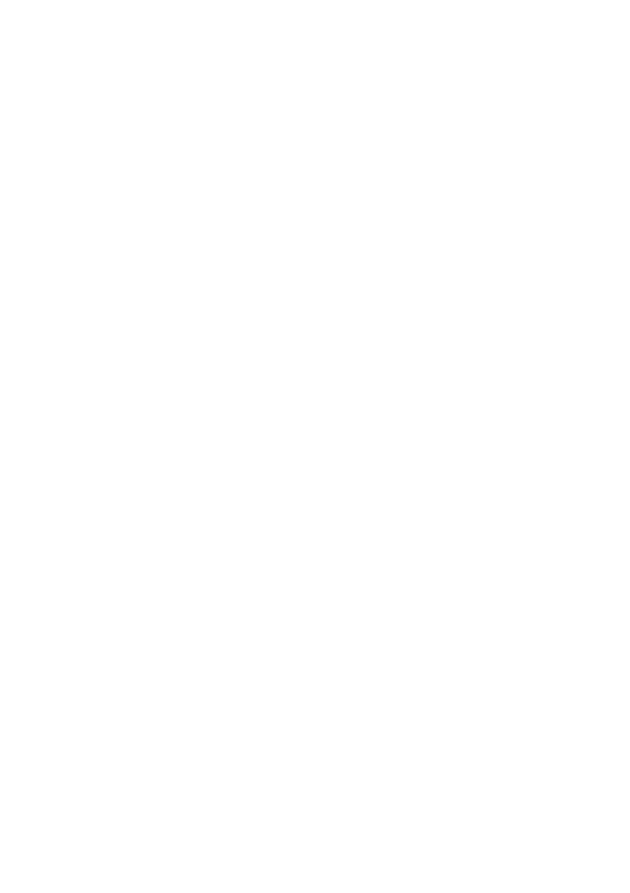
79
hatte, um dann zu meinem eigenen Wohl schleunigst
aus diesem Haus zu verschwinden. Aber ich schüttelte
den Kopf.
»Tut mir leid, Colonel Rostand. Ich kann Ihrem
Vorschlag nicht folgen. Erstens glaube ich nicht, daß
dieser Mann David Foster ist. Zweitens glaube ich
nicht, daß der Mann, den Sie erschossen haben, ein
gesuchter Einbrecher war. Ich glaube vielmehr, daß er
es war, der mich zwanzig Minuten nach sieben im
Hotel Aletti anrief und sich als David Foster ausgab.
Er versprach, ins Hotel zu kommen. Aber er kam
nicht. Warum nicht? Hatte Sandros Impulsivität ihn
ungeeignet gemacht, vor anderen Leuten zu erschei-
nen?«
Wie durch Zauberei hatte Rostand plötzlich eine
Pistole in der Hand. Die joviale Pose des pensionier-
ten Armeeoffiziers war von ihm abgefallen.
»Schön, Temple«, knurrte er, »Sie haben es selbst
gewollt.«
Er pfiff wie nach einem Hund. Daraufhin kam San-
dro hereingestürmt, sah, daß Rostand mich mit der
Pistole in Schach hielt, und handelte unverzüglich.
Wegen der auf mich gerichteten Waffe und in Erinne-
rung an die jammervolle Gestalt draußen auf dem
Pfad verspürte ich keine Lust, Widerstand zu leisten.
Viel hätte ich in Sandros Griff sowieso nicht tun
können. Mit übermenschlicher Kraft zog er mir die
Arme hinter den Rücken und hielt meine beiden
Handgelenke mit einer seiner Riesenpranken so fest,

80
als steckten sie in einer stählernen Fessel. Seinen
anderen Arm warf er mir von hinten um den Hals und
drückte meinen Kopf zurück - so gewaltsam, daß er
mir fast die Luft abschnitt. Es konnte keinen Zweifel
geben, daß Sandro ungemein impulsiv war.
»Los, Leyland!« kommandierte Rostand. »Durch-
suchen!«
Leyland kam herbei - nicht allzu begeistert, wie es
schien - und griff sorgfältig in alle meine Taschen.
Als er damit fertig war, wandte er sich unglücklich an
Rostand: »Er hat sie nicht bei sich.«
»Diese Mühe hätten Sie -«, begann ich, aber Sandro
verstärkte den Druck auf meinen Kehlkopf, und der
Satz endete in einem Gurgeln.
»Laß ihn sprechen!« fuhr Rostand den Araber auf
französisch an. Sandros Griff wurde sogleich lockerer.
Ich holte Luft und erklärte: »Ich wollte Ihnen nur
sagen, Sie hätten Sam diese Mühe ersparen können.
Ich habe die Brille nicht bei mir.«
Rostand nickte ganz vernünftig und erwiderte:
»Das war zu erwarten. Aber wir haben Sie, und das ist
beinah genausogut. Ich weiß, daß Sandro enttäuscht
sein wird, wenn Sie mir jetzt sagen, wo die Brille zu
finden ist. Ich habe ihm heute abend nämlich schon
einmal den Spaß verdorben, einem Mann das Genick
zu brechen. Aber es könnte uns viel Umstände
ersparen -«
»Sie glauben doch wohl nicht«, warf ich ein, »daß
ich hierher gekommen bin, ohne irgendwelche
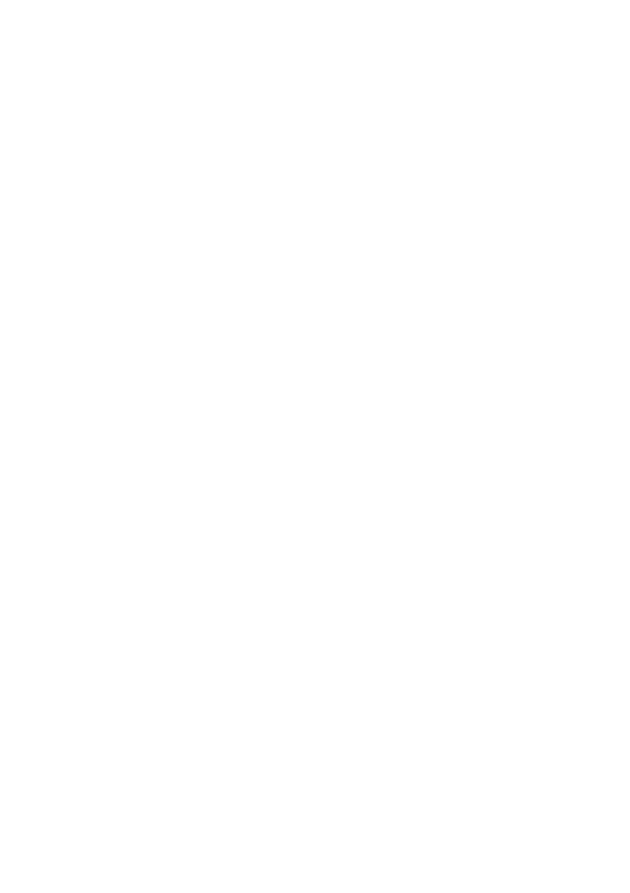
81
Sicherheitsmaßnahmen zu treffen? Wenn ich binnen
einer halben Stunde nicht wieder in meinem Hotel
bin, erfährt die Polizei schnellstens und sehr genau,
wo ich bin.«
Wieder nickte Rostand, als erkenne er den geglück-
ten Schlag seines Golfpartners an, und sagte recht
verbindlich: »Vielleicht bluffen Sie, vielleicht auch
nicht. Ich glaube, großzügig sein zu dürfen. Mögli-
cherweise gelangen wir doch noch zu einem geschäft-
lichen Arrangement.«
»Aber zuerst sagen Sie Ihrem Araber, daß er mich
loslassen soll.«
Rostand gab den entsprechenden Befehl auf franzö-
sisch und fügte hinzu, Sandro wisse ja, was er jetzt zu
tun habe.
Sandros Hände gaben meinen Hals und meine
Handgelenke frei. Ich fühlte mich weit weniger
unglücklich, als ich Sandro hinausgehen und die Tür
hinter sich zumachen hörte.
»Also, Mr. Temple. Ich weiß nicht, welches Inter-
esse Sie an dieser Sache haben oder weshalb Sie sich
hartnäckig weigern sollten, Fosters Brille herauszuge-
ben. Aber jeder Mann hat seinen Preis. Ich werde
Ihnen fünftausend Pfund in britischen Banknoten
zahlen, sobald Sie mir die Brille übergeben.«
»Ihr Angebot imponiert mir nicht«, erwiderte ich.
»Mr. Constantin war großzügiger. Er offerierte
zehntausend Pfund.«
Zum erstenmal schien Rostand die Fassung zu ver-

82
lieren.
»Constantin?« Sein Blick irrte von mir zu Leyland
und kehrte einen Moment später zu mir zurück. Die
Hand mit der Pistole spannte sich. »Haben Sie die
Brille etwa an Constantin verkauft?«
Hätte ich ja gesagt, dann wäre es mit mir vorbei
gewesen. Rostand hätte kein Interesse mehr gehabt,
mich am Leben zu lassen. Im Gegenteil. Andererseits
wollte ich mich weder seinen Drohungen beugen noch
seinen Vorschlag annehmen. Ich schätzte, daß kaum
mehr als zehn oder zwölf Minuten vergangen waren,
seit Steve und ich uns getrennt hatten. Wenn Steve
meine Instruktionen befolgte, würde es - vorausge-
setzt, sie fände in der Nähe ein Telefon - noch minde-
stens dreißig bis vierzig Minuten dauern, ehe die
Polizei hier sein könnte. Ich bezweifelte, daß ich
imstande sein würde, das Spiel so lange hinauszuzie-
hen, aber einen Versuch war es wert.
»Colonel, Sie sagten, daß jeder Mann seinen Preis
hat. Nun gut. Aber meiner ist ziemlich hoch. Ich muß
bekennen, daß ich Constantins Angebot zugestimmt
habe. Sollten Sie jedoch mehr anlegen wollen, sagen
wir zwölftausendfünfhundert, dann -«
»Also haben Sie die Brille noch«, unterbrach Ros-
tand schnell.
»Nicht buchstäblich«, schränkte ich ein. »Sie ist im
Moment unterwegs. Aber ich denke, ich kann sie
zurückhalten lassen, ehe sie zu Constantin kommt.«
»Sie lügen!« zischte Rostand. »Ich bin nicht der

83
Narr, für den Sie mich halten! Sie haben kein Angebot
von Constantin! Und das einzige Angebot, das Sie
von mir noch bekommen, ist eine Kugel in Ihr Ge-
därm! Sagen Sie mir jetzt schnell die Wahrheit, oder
Sie kriegen dieselbe Behandlung wie Thompson! Sie
haben selbst gesehen, wie er verreckte! Ihnen bleiben
fünf Sekunden, bis ich den Abzug drücke! Eins -«
Ich zweifelte nicht daran, daß Rostand seine Dro-
hung wahrmachen würde. Der Ausdruck seiner Augen
verriet genug.
»Zwei.«
Leyland hatte sich in eine Ecke zurückgezogen und
wartete bedrückt. Wahrscheinlich hatte er die Sache
mit Thompson miterlebt und fühlte sich elend bei der
Aussicht, noch einen Mann sterben zu sehen.
»Drei.«
Das Nächstliegende wäre jetzt gewesen, eine Lüge
zu erzählen. Aber dazu war ich angesichts dieser
Bedrohung außerstande. Es heißt, daß ein Mann auf
dem Totenbett nur die Wahrheit sagt. Das kann ich
nach meinen Erfahrungen in der Villa Negra bestäti-
gen. Die Versuchung war groß, Rostand von Steve zu
erzählen, die kaum zweihundert Schritte weit entfernt
hinter irgendeinem Strauch hockte, mit der Brille in
ihrer Handtasche. Ich preßte meine Lippen zusammen
und hoffte inständig, daß Rostands Nerven nicht
durchhalten würden.
»Vier.«
Im selben Augenblick, als dieses Wort ertönte,

84
begann im Zimmer nebenan das Telefon zu läuten.
Vielleicht war es nur eine Fehlverbindung. Aber das
Läuten genügte, um Rostand zu stoppen. Ich habe
schon oft bewundert, wie stark die Macht eines
läutenden Telefons ist.
»Sieh nach, wer es ist!« fauchte Rostand.
Leyland trampelte eilfertig hinaus, offenbar froh,
der Szene einstweilen zu entrinnen. Die Tür klappte
hinter ihm zu, schnappte aber nicht ein. Immerhin war
seine Stimme jetzt nur als Gemurmel zu hören.
Rostand hielt die Pistole nach wie vor auf mich
gerichtet, verringerte aber seine Entfernung zu mir, da
er sich in einer Art Halbkreis der Tür näherte, um
besser zu erlauschen, was Leyland sprach. Schließlich
waren nur noch etwa zwei Meter zwischen uns.
Das Telefongespräch dauerte nicht lange. Dann
hörte ich Leyland schnell über den knarrenden alten
Parkettboden herbeikommen. Als er die Tür mit
einem Ruck aufmachte, mußte Rostand etwas auswei-
chen. Dadurch verringerte sich die Entfernung zwi-
schen uns noch ein bißchen.
»Es war Constantin!« berichtete Leyland erregt.
»Temple muß die Wahrheit gesagt haben. Constantin
hat die Brille und läßt bestellen, daß er bereit ist,
Kaufangebote zu hören, aber -«
Diese unerwartete Neuigkeit verführte Rostand zu
einem Fehler. Seine rechte Hand mit der Pistole
schwankte, als er überrascht zu Leyland sah. Ich
fühlte, daß es meine einzige Chance war und daß ich

85
sie nützen mußte.
Ich sprang und riß dabei wie ein Fußballer den
rechten Fuß in die Höhe. Der Stoß traf Rostands
rechte Hand und schickte die Pistole in hohem Bogen
durch die Luft. Beim Aufsprung mußte ich mich
ducken, um mein Gleichgewicht zu wahren. Als ich
mich aufrichtete, sah ich Rostands Faust zum Schlag
erhoben. Ich kam ihm zuvor, indem ich meinen
rechten Ellenbogen mit aller Kraft unter sein Kinn
stieß. Ich hörte seine Kinnbacken knacken und seine
Zähne knirschen. Sein Kopf ruckte nach hinten.
Im Augenblick hatte ich keine weitere Zeit für ihn.
Leyland kam auf mich zu, und nun wußte ich auf
einmal, woher er seine eingeknickte Nase hatte. Er
bewegte sich wie ein alter Schwergewichtsboxer, der
aus einer Ecke herbeistapft, um dem Gegner den K. o.
zu verpassen.
Ich erwischte Leyland mit einem Schlag unter der
Gürtellinie, für den englische Boxsportfans mich
Stück um Stück auseinandergenommen hätten.
Als Leyland zu Boden ging wie ein Zweizentner-
mehlsack, riskierte ich einen Blick auf Rostand. Er
hielt sich mit beiden Händen sein Kinn, fing aber eben
an, zu der Pistole zu stolpern, die vor einem der
Bücherregale lag. Ich war schneller da und beförderte
das Ding mit einem Tritt außer Reichweite und
Rostand für einige Zeit ins Reich der Träume.
Leyland stöhnte noch und zeigte ein schmerzver-
zerrtes Gesicht. Ich fühlte kein Bedauern. Meine

86
Hauptsorge war, daß Sandro den Tumult gehört haben
könnte und zurückkäme. Ich hatte Eile, und die
Erinnerung an Thompson verhärtete mein Herz.
Leyland kam mühsam auf die Beine. Als ich mich
näherte, versuchte er nach mir zu schlagen. Ich wich
aus und benutzte seinen eigenen Schwung, um seinen
Schlagarm mit einem Fesselgriff abzufangen. Er jaulte
und begann auf den Zehenspitzen zu tanzen.
»Sie werden jetzt ein bißchen erzählen müssen«,
sagte ich zu ihm. »Und ich rate Ihnen, meine Fragen
schnell zu beantworten.«
Um ihn aufzumuntern, verstärkte ich den Druck
meines Griffes ein wenig. Er wollte schier in die Luft
gehen.
Ich fragte: »Warum ist Rostand so scharf auf die
Brille? Wieviel ist sie ihm wert?«
»Weiß nicht, warum er sie will«, ächzte Leyland.
»Das hat er mir nie erzählt. Er sagte nur, ein Freund
von ihm hätte eine Spezialbrille verloren und würde
dem, der sie wiederbringt, viertausend Pfund bezah-
len.«
»Und Sie wollten sich dieses Geld verdienen. Er-
schien Ihnen die Sache nicht irgendwie faul?«
»Klar. Aber Rostand gab mir einen Vorschuß von
tausend Pfund. Was sollte ich da viel fragen? Sir,
drücken Sie nicht so stark auf meinen Arm! Ich
erzähle Ihnen doch die Wahrheit!«
»Kann ich das wissen?« erwiderte ich, verminderte
aber den Druck ein wenig.

87
»Ich ahnte nicht, daß es sich zu solcher scheußli-
chen Sache entwickeln würde«, fuhr Leyland hastig
fort. »Mord und alles das. Ich hatte nichts zu schaffen
mit dem, was heute abend hier passierte. Das kann ich
beschwören!«
»Vielleicht. Trotzdem bleiben Sie ein Mittäter. -
Was haben Sie in Nizza gemacht?«
Leyland wollte nicht heraus mit der Sprache, und
ich mußte den Druck wieder etwas verstärken.
»Auuuu, ich erzähl's ja schon! Rostand sagte mir,
daß eine gewisse Judy Wincott dann und wann in
einem gewissen Hotel wäre und daß sie höchstwahr-
scheinlich die Brille hätte. Ich sollte nur herausfinden,
wo ihr Zimmer lag -«
»Sie wußten also, daß Judy Wincott nach Nizza
kommen würde?«
»Ja, durch Rostand. Aber gesehen habe ich sie nie.
Das schwöre ich! Als ich hörte, daß sie ermordet
worden war, wurde mir so mulmig, daß ich am
liebsten abgesprungen wäre. Aber von den tausend
Pfund Vorschuß fehlte schon zuviel.«
Ich fand, daß ich Leyland glauben könnte. Er war
ein Gauner, gewiß. Doch erinnerte ich mich an den
beschwörenden Blick, den er mir zugeworfen hatte,
als Rostand mir eine Gelegenheit anbot, frei aus dem
Haus zu gehen.
»Sam«, sagte ich, »Sie haben sich da wirklich eine
scharfe Suppe eingebrockt und werden sie auslöffeln
müssen. Aber was ist nun mit David Foster? Kennen

88
Sie ihn? Haben Sie ihn je gesehen?«
Leyland schüttelte den Kopf.
»Rostand sprach öfter von ihm, doch zu sehen
kriegte ich ihn nie. Dachte mir schon, vielleicht wäre
es bloß ein Deckname.«
»Das ist möglich. Alles in allem wissen Sie also
nicht viel?«
»Nein. Und doch zuviel für mein Seelenheil«, klag-
te Leyland jämmerlich. »Ich wünschte, ich hätte
diesen Rostand nie gesehen!«
»Wie lange kennen Sie ihn?«
»Knapp einen Monat. Lernte ihn in Tunis durch
einen - äh - einen Geschäftsfreund kennen.«
Ich hätte noch viel zu fragen gehabt. Aber Rostand
begann sich zu bewegen, und ich fürchtete ständig,
daß Sandro zurückkommen könnte.
»Eine letzte Frage. Sagte Constantin, von wo aus er
telefonierte?«
»Nein. Er sagte nur, Rostand könnte ihn im Nacht-
club ›El Passaro‹ treffen, wenn er Lust hätte, über
Geschäfte zu sprechen.«
»Kennen Sie diesen Nachtclub?«
»Nein. Ich habe nur davon gehört.«
Rostand ächzte und spuckte. Ich bugsierte Leyland,
der keinen Widerstand versuchte, in eine Art Abstell-
raum am Ende des Bibliothekszimmers und schloß die
Tür hinter ihm zu.
Die Pistole stieß ich außer Sicht unter ein schweres
Bücherregal. Dann schlüpfte ich aus der Bibliothek in

89
den großen Salon. Alle Lichter waren noch einge-
schaltet, aber von Sandro zeigte sich nichts. Ich trat
durch die offene Glastür hinaus in die merklich kühler
gewordene Nachtluft.
Als ich die Stelle erreichte, an der ich mich von
Steve getrennt hatte, blieb ich einen Moment lang
stehen. Ich sah die dunkle, feuchte Stelle, wo Thomp-
son gelegen hatte, aber seine Leiche war verschwun-
den. Das konnte nur Sandros Werk gewesen sein. Und
da Sandro nicht ins Haus zurückgekehrt war, mußte er
den Weg zum Gittertor eingeschlagen haben, in
dessen Nähe Steve wartete.
So schnell ich konnte, eilte ich zu dem Tor. Zu
sehen war dort niemand.
»Steve!« rief ich leise. Dann etwas lauter nochmals:
»Steve!«
Ein Schatten bewegte sich zwischen den Büschen
und kam herbei.
»Paul! Gott sei Dank, daß du da bist. Ich fürchtete
schon, meine Uhr ginge nicht mehr richtig. Es kann
doch nicht erst zweiundzwanzig Minuten her sein, daß
wir uns trennten? Was ist geschehen?«
»Das erzähle ich dir später. Hast du die Brille
noch?«
Steve nickte und berührte ihre Handtasche.
»Besser, du gibst sie mir wieder«, sagte ich. »Diese
Brille ist Dynamit für jeden, der sie bei sich hat.«
Sie gab mir die Brille, und ich steckte das ver-
wünschte Ding wieder in meine Brusttasche.

90
»Ist jemand hier vorbeigekommen, während du
gewartet hast?«
»Ja.« Steve schüttelte sich bei der Erinnerung. »Ein
furchtbar buckliger Araber. Er trug etwas über der
Schulter. Ich glaube, es war eine Leiche.«
»Es war die Leiche des Mannes, der durch die
Glastür sprang. Wohin ist der Araber gegangen?«
Steve deutete zu einem Gittertor auf der anderen
Seite der schmalen Straße - einem genauen Gegen-
stück zu dem Tor, neben dem wir standen. Offenbar
lag hinter dem anderen Tor ein Privatweg zum Strand.
»Und er ist noch nicht zurückgekommen? Ich frage
mich, was er dort unten zu tun hat. Wenn es ihm
gelingt, die Leiche verschwinden zu lassen, wird
meine Aussage, daß hier ein Mord verübt wurde,
gegen das Wort von drei Schurken stehen. Hättest du
etwas dagegen, hier noch ein wenig zu warten?«
»Allein? Ja, sehr viel!« Steves Antwort klang äu-
ßerst entschieden. »Ich hätte beinah vor Schreck
aufgeschrien, als du so schnell und lautlos auftauch-
test und anfingst, hinter die Büsche zu gucken. Wenn
du dort drüben hineingehst, komme ich mit.«
»Gut«, stimmte ich nach kurzem Überlegen zu.
»Aber du bleibst hinter mir und machst kein Ge-
räusch.«
Das Tor quietschte zum Gotterbarmen, als ich es
öffnete. Ich winkte Steve, es offenstehen zu lassen.
Vom Strand her konnten wir schon das gleichmäßige
Plätschern kleiner Wellen hören. Aber irgendwo in

91
der Nähe mußte ein Tümpel sein, in dem Frösche
quakten. Das Quaken verstummte plötzlich, als wir
vorüberschlichen. Die jähe Stille war unwirklich.
Hinter einer scharfen Biegung des abfallenden Pfa-
des kam der Strand in Sicht. Es war eine halbmond-
förmige Miniaturbucht mit ziemlich schrägem Ufer.
Die steinerne Mole am entfernten Ende hatte zwei
Aufgaben: Ihr ins Wasser hinausgebauter längerer
Teil war als Schutz für Boote gedacht, während der an
Land gelegene kürzere Teil das Fundament eines
kleinen Holzhauses darstellte. Zur Zeit war kein Boot
da, und die Fenster des Hauses lagen im Dunkeln.
Nirgendwo bewegte sich etwas.
Nahe der Stelle, wo die Mole sich ins Wasser hi-
nausschob, entdeckte ich am Strand ein dunkles
klumpiges Gebilde, dessen Formen mir etwas merk-
würdig erschienen. Ich bat Steve zu warten und ging
vorsichtig näher. Schließlich erkannte ich, daß mein
erster Eindruck stimmte. Das Gebilde war ein auf dem
Sand liegender Mann.
Er bewegte sich nicht. Aber er lebte. Seine eigen-
tümlich röchelnden Schnarchtöne verrieten, daß er
bewußtlos geschlagen worden war. Und der Buckel
offenbarte seine Identität.
Trotz der Dunkelheit sah ich die schwere Beule an
seiner rechten Schläfe und hatte den Eindruck, daß er
noch eine gute Weile bewußtlos bleiben würde.
Ich ließ ihn, wo er lag, winkte Steve herbei und
näherte mich mit ihr dem Holzhaus. Die Fensterläden

92
waren zu, und die Tür war verschlossen. Im Licht
meiner Taschenlampe untersuchte ich das Schloß. Ich
holte einen Streifen Zelluloid aus meiner Brieftasche
und hatte das Schloß nach einer halben Minute offen.
Der Lichtstrahl meiner Taschenlampe reichte knapp
bis zur Mitte des ziemlich großen Wohnzimmers, in
das die Tür sich direkt öffnete. Die Zimmerbeleuch-
tung wagte ich nicht anzuknipsen, denn irgendwo
mochte jemand lauern, der nicht zu erkennen brauch-
te, wer wir waren. Ich ging vorsichtig bis zur Mitte
des Zimmers und leuchtete überall herum, aber zu
entdecken war hier niemand. Eine Tür am entfernten
Ende des Zimmers stand offen; sie führte in ein
kleines Zimmer, das - nach den beiden einfachen
Betten zu urteilen - als Schlafraum diente.
Zum Zubettgehen war es eigentlich noch etwas zu
früh. Doch das erste, was ich beim Betreten des
Raumes erspähte, war eine Gestalt in dem Bett an der
gegenüberliegenden Wand. Mein Instinkt riet mir,
umzukehren und zu verschwinden, ehe die Gestalt
erwachen und mich bemerken würde. Aber meine
Neugier trieb mich näher und führte schließlich sogar
dazu, daß ich die Bettdecke zurückschlug.
Zuerst dachte ich, ich hätte Thompson gefunden.
Doch der Mann, der mir den Rücken zuwandte, war
vollständig bekleidet, auch sein Jackett hatte er noch
an. Außerdem war er entschieden beleibter als
Thompson. Ich drehte ihn auf den Rücken, und der
Lichtstrahl meiner Taschenlampe traf den Handgriff

93
des Messers, das ihm dicht unter dem Herzen zwi-
schen den Rippen steckte. Dies mußte das Werk eines
berufsmäßigen Killers sein. Ich richtete den Licht-
strahl auf das Gesicht des Mannes.
»Constantin!«
Ich war so verblüfft, daß ich den Namen laut aus-
sprach. Nach der Körpertemperatur zu urteilen und
unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die Bett-
decke eine gewisse Menge Wärme bewahrt haben
mußte, war der Mann schon einige Zeit tot.
Wer aber hatte dann bei Rostand angerufen und ein
Zusammentreffen im Nachtclub ›El Passaro‹ verein-
bart? Wer hatte Constantin getötet und Sandro be-
wußtlos geschlagen? Und was war aus Thompsons
Leiche geworden?
Steve, die bei der Haustür gewartet hatte, um den
Strand zu beobachten, kam jetzt zur Schlafzimmertür.
»Hast du gerufen, Paul? Übrigens glaube ich, daß
der Araber bald aufwachen wird. Ich habe eben
gesehen, daß er sich etwas bewegte.«
Ich hatte die Taschenlampe ausgeknipst, um Steve
den Anblick der Leiche zu ersparen, und flüsterte:
»Steve, ich denke, wir sollten die erwiesene Gast-
freundschaft nicht überfordern. Laß uns von hier
fortgehen, solange wir es noch können.«
Wir mußten ein gutes Stück laufen, ehe wir eine
Hauptstraße erreichten - ich fand also genügend Zeit,
Steve von allem zu erzählen, was geschehen war, seit

94
wir uns getrennt hatten.
»Wenn Constantins Telefonanruf dir das Leben
gerettet hat«, sagte Steve, »dann tut es mir leid, daß
dieser Mann getötet wurde - egal, was für ein Lump er
gewesen sein mag.«
»Aber er kann gar nicht angerufen haben«, entgeg-
nete ich. »Zu dieser Zeit, als der Anruf kam, muß er
schon ein ganzes Weilchen tot gewesen sein.«
»Demnach hat sein Mörder bei Rostand angerufen.
Und wer er auch sei - er wird in diesem Nachtclub
warten.«
»Was uns beide natürlich veranlaßt, dem Nachtclub
einen Besuch abzustatten.«
»Ich frage mich nur«, wandte Steve ein, »wie der
Kerl diese Verabredung vorschlagen kann, da er die
Brille gar nicht hat. Sie steckt doch in deiner Brustta-
sche.«
»Bestimmt hat er eine ähnliche Brille und beabsich-
tigt, Rostand zu begaunern. Rein äußerlich ist es ja
eine Brille wie viele andere auch.« Ich nahm Steve
beim Arm und begann mit ihr zu rennen. »Komm! Da
ist ein Bus, der zum Hafen fährt. Wir können ihn noch
erwischen.«

95
4
Es war fast elf, als wir wieder im Hotel Aletti ein-
trafen. Gegessen hatten wir noch nicht. Mein Magen
knurrte bisweilen, und Steve mußte vor Hunger
fortwährend gähnen.
Ungeachtet der etwas hektisch gewordenen Situati-
on bestand sie darauf, sich umzuziehen und ihr Make-
up zu erneuern, ehe sie vor die Augen der anderen
Gäste im ›El Passaro‹ träte. Ich schlug ihr vor, schon
zu unserem Zimmer hinaufzufahren, während ich
selbst noch mit dem Mann am Empfang reden wollte.
Glücklicherweise war es derselbe Hotelangestellte,
mit dem ich vorhin schon gesprochen hatte.
Er beantwortete meine Frage, ehe ich sie äußern
konnte.
»Hat Monsieur Constantin Sie gefunden, Monsi-
eur?«
Ich starrte ihn verblüfft an. »War er hier?«
»Ja, Monsieur. Er behauptete, es sei für ihn sehr
wichtig, Sie zu finden. Ich sagte ihm, Sie seien zur
Villa Negra gefahren.«
»War das bald nach unserem Aufbruch?«
»Ja, Monsieur. Kaum zwei Minuten später. Ich
hoffe, er hat Sie gefunden.«
»Nun, sagen wir - ich habe ihn gefunden. Auf jeden
Fall besten Dank.«
»Gern geschehen, Monsieur.«
Im Lift überlegte ich. Constantin war uns also zur

96
Villa Negra gefolgt und hatte seinerseits auch wieder
einen Verfolger gehabt - den Mann, der ihm das
Messer zwischen die Rippen stieß und ihn dann in
dem kleinen Haus versteckte. Dank der Ortsunkun-
digkeit unseres Taxifahrers, seiner mehrmaligen
Fragerei nach dem Weg und der dadurch entstandenen
Verzögerung mußte Constantin mit seinem ›Schatten‹
ein Weilchen früher als wir bei der Villa Negra
eingetroffen und wahrscheinlich gleich durch das
verkehrte Gittertor dirigiert worden sein. Sicher war
er schon tot gewesen, als wir unser Taxi verließen.
Daß irgendwo in der schmalen Straße ein anderes
Auto gestanden hätte, konnte ich mich nicht erin-
nern...
»Vierte Etage, Monsieur.«
Der kleine Liftboy lächelte und trat zur Seite, um
mich hinauszudienern.
Steve war bereits im Hausmantel;, aus dem Bade-
zimmer kam das Rauschen des einlaufenden Bade-
wassers. Sie nahm ihr Abendkleid mit und machte
hinter sich die Tür zu, damit ich ungestört mit der
Polizei telefonieren könnte.
Der Kriminalinspektor vom Dienst, den ich erreich-
te, war ein gewisser Flambeau. Als ich mich vorstell-
te, ergab sich, daß er meinen Namen kannte. Wie es
schien, hatte er irgendwann eine Begegnung mit Sir
Graham Forbes von Scotland Yard gehabt; erstaunli-
cherweise war er sogar darauf verfallen, ein Buch von
mir zu lesen - um sein Englisch zu vervollkommnen,

97
wie er liebenswürdig erklärte.
Ich gab ihm eine kurze Zusammenfassung der Si-
tuation und verhieß ihm, daß seine Männer, wenn sie
sehr schnell wären, eine oder vielleicht zwei Leichen
bei der Villa Negra finden würden.
»Außerdem dürfte es sich lohnen, ein Motorboot
mit Suchscheinwerfer zu der kleinen Bucht unterhalb
der Villa Negra zu schicken. Ich habe die Ahnung,
daß dort in der Nähe ein treibendes Boot zu finden ist.
Daß Ihre Leute viel von Rostand oder Leyland sehen
werden, bezweifle ich. Aber warnen Sie sie vor einem
buckligen Araber. Er ist gefährlich.«
»Wir werden unser Bestes tun«, versicherte Flam-
beau. »Der Mann, der sich Ihnen gegenüber Rostand
nannte, ist mir nicht unbekannt. Wir beobachten ihn,
seit er die Villa Negra gemietet hat. Er ist als interna-
tionaler Gauner bekannt. Aber wir wußten nicht,
womit er sich zur Zeit beschäftigt. - Werden Sie
nachher noch zum Polizeipräsidium kommen, bitte?«
»Ich denke, es könnte zweckmäßiger sein, wenn
wir uns im ›El Passaro‹ träfen. Wäre es Ihnen mög-
lich, dorthin zu kommen?«
»Eine ausgezeichnete Idee, Mr. Temple. Zumal es
meine Behörde sein wird, die etwaige Unkosten
bezahlen muß. Dieser Nachtclub ist mit Abstand das
teuerste Lokal in Algier.«
Dieses Mal gab unser Fahrtziel dem Taxichauffeur
keinen Anlaß zum Zweifeln.
»›El Passaro‹?« wiederholte er und schaltete seine

98
Taxameteruhr ein. »Sehr wohl, Monsieur.«
»Sie kennen es?«
»Selbstverständlich, Monsieur. Oben am le Bardo.«
Wir setzten uns in den Fond, und das Taxi schnurr-
te los. Schon nach wenigen Minuten jagten wir die
Straße hinauf, die die Hügel außerhalb von Algier
erklimmt. Die Lichter des Hafens sanken rechts von
uns zurück. Die Häuserzeilen machten luxuriösen
Villen in umgitterten Gärten Platz.
Ich lehnte mich nach vorn, um mit dem Fahrer zu
sprechen.
»Das ›El Passaro‹ ist ein gutes Lokal, hörte ich?«
»Ja, und das exklusivste in Algier«, sagte der Fah-
rer. »Dieser Bursche Schultz hat wirklich etwas
daraus gemacht. Eins muß man den Deutschen lassen.
Wenn sie etwas tun, dann gründlich.«
»Schultz - ist das der Eigentümer?«
»Ja. Man erzählt sich, er wurde während des Krie-
ges in der Wüste gefangengenommen, entfloh schon
auf dem Transport und lebte dann jahrelang bei den
Arabern. Jetzt hat er vier solcher Lokale - hier, in
Oran, in Constantine und in Tunis. Muß eine Menge
Geld damit machen. Das ›El Passaro‹ wurde erst vor
sechs Monaten eröffnet. Die Leute sagen, hinsichtlich
der Aufmachung hätte es nicht seinesgleichen.«
»Ich hoffe, man kann dort auch essen«, ließ Steve
sich sehnsuchtsvoll vernehmen.
Das ›El Passaro‹ residierte in einem Haus, das frü-

99
her der Wohnsitz eines reichen arabischen Kaufmanns
gewesen war. Das Gebäude war von prächtig gehalte-
nen Gärten umgeben, die Schultz mit Flutlichtanlagen
versehen hatte. Die Reihen modernster amerikani-
scher, deutscher, französischer und italienischer Autos
beiderseits der Zufahrt gaben Zeugnis von dem
Wohlstand der Gäste. Sobald unser Taxi vor dem
strahlend erleuchteten Eingang hielt, wurde die Tür
von einem dunkelhäutigen Jungen geöffnet. Er trug
einen weißen Seidenturban und über seinen Pluderho-
sen einen dreiviertellangen himmelblauen Seidenman-
tel.
Schon im Garderobenraum fühlten wir uns von
einer Art Haremsfluidum angehaucht. Die Gardero-
bieren trugen Gesichtsschleier und Pluderhosen und
hatten nackte Bäuche - Gott sei Dank erfreulich
schlanke. Ich wurde meinen Hut an einen Prachtkerl
in traditioneller Tuareggewandung los. Schultz hatte
wirklich Ernst gemacht mit seiner Arabische-Nächte-
Atmosphäre.
Dicke Orientteppiche bedeckten die Stufen, die
hinab zu dem saalartigen Raum führten, aus dem die
träumerischen Klänge eines Tangoorchesters ertönten.
Im übrigen war dieser Raum beinah so dunkel wie ein
Kino während der Vorstellung. Rot verhüllte elektri-
sche Leuchtkörper, ein paar Brennölflämmchen in
zierlichen Messinglampen, da und dort die bläuliche
Flamme der Wärmeschüssel eines servierenden
Kellners - das waren die Lichtquellen, die uns viele,

100
viele dichtbesetzte Tische und die wogende Masse
tanzender Paare auf der Tanzfläche mehr ahnen ließen
als zeigten. Die Gäste sprachen sehr gedämpft. Zu
sagen, die Stimmung wäre intim, hätte als phantasie-
lose Untertreibung gelten müssen.
Der Empfangschef, der am oberen Ende der kurzen
Treppe stand, trug den für seinesgleichen traditionel-
len Frack mit weißer Schleife. Er begrüßte mich mit
höflichem Lächeln, schüttelte aber bedauernd den
Kopf, als ich nach einem Tisch für zwei Personen
fragte.
»Es tut mir aufrichtig leid, Monsieur. Alle Tische
sind vergeben. Ich kann Ihnen nicht helfen.«
»Hat Monsieur Constantin einen Tisch reservieren
lassen? Er würde nichts dagegen haben, wenn wir
seinen Tisch mit ihm teilten.«
»Monsieur Constantin? Sind Sie ein Freund von
ihm?« Der Empfangschef betrachtete mich genauer,
um sich darüber klarzuwerden, ob er mich schon
früher gesehen habe. »Bitte, warten Sie einen Mo-
ment, Monsieur.«
Er eilte von dannen, im Zickzack zwischen den
Tischen hindurch, offensichtlich auf einen Mann
zusteuernd, der neben der Tanzfläche stand und den
tanzenden Paaren zuschaute. Sie wechselten ein paar
Worte, sahen herüber und setzten sich zu mir in
Bewegung. Nach der Art, wie der Empfangschef
devot hinterdrein ging, schätzte ich, daß der andere
Mann Schultz sein müsse.

101
Er war ein großer, blonder Mann, der sich wie ein
Athlet bewegte. Seine Augen strahlten blau. Seine
Haut war sonnengebräunt und glatt, doch schien es
mir, als sei er ein gut Teil älter, als er wirkte. Seine
Kleidung war von nobler Eleganz. Ich fand, daß ihn -
mindestens auf den ersten Blick - ein Nimbus von
Vertrauenswürdigkeit und Charakterstärke umgab.
»Sie fragten nach einem Monsieur Constantin, Sir?
Ich fürchte, daß niemand dieses Namens einen Tisch
bestellt hat. Ich würde Ihnen gerne helfen. Doch wie
Sie sehen, sind wir voll besetzt.«
Sein Englisch war bemerkenswert gut und doch
nicht ganz frei von der kleinen Härte, die manchen
Deutschen verrät, wenn er unsere Sprache spricht.
»Hm, vielleicht gibt es eine Bar, an der wir etwas
trinken könnten? Ich habe vereinbart, hier einen
Freund zu treffen.«
Anstatt zu antworten, wandte Schultz sich halb zur
Seite und vollführte eine elegante Verbeugung. Der
Empfangschef tat es ihm nach. Steve war aus dem
Garderobenraum gekommen. Ich mußte mir jetzt
eingestehen, daß die Zeit, die sie mit dem Wechseln
ihrer Kleidung verbracht hatte, nicht verschwendet
war. Mit ihren langen Ohrringen, der an ihrem Dekol-
lete blitzenden Brillantbrosche und dem raschelnden,
engtaillierten Abendkleid sah sie zugleich jugendlich
und vornehm aus.
»Madame«, sagte Schultz mit leicht veränderter
Stimme, »ich bedauere, daß ich Sie einen Moment
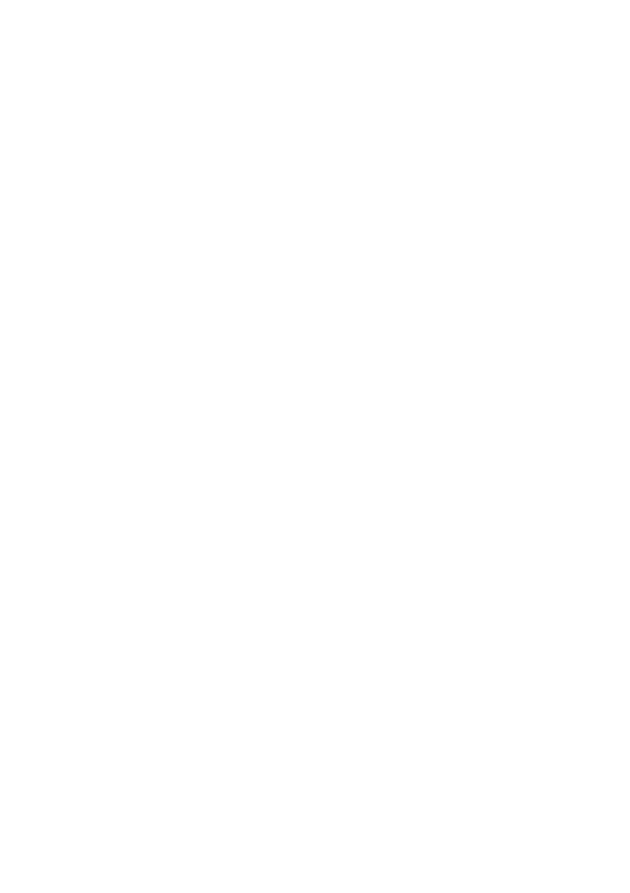
102
lang warten lassen muß, bis wir einen Tisch finden
können.«
Steve lächelte ihm verzeihend zu und sah, während
er davonging, über meine Schulter. Ihr Blick wurde
von einem Mann aufgefangen, der an einem nicht
allzu weit entfernten Tisch saß und uns nun zuwinkte.
»Das ist doch Tony Wyse«, sagte sie zu mir. »Ich
glaube, er bittet uns an seinen Tisch.«
Es war Tony Wyse. Wir nahmen an seinem Tisch
Platz; der vierte Stuhl blieb leer.
»Welch ein glücklicher Zufall!« Wyse strahlte uns
freudig an.
»Aber natürlich - jeder kommt ins ›El Passaro‹.
Wirklich jeder! Ich habe schon in Paris davon gehört.
- Kellner, noch eine Flasche Champagner.«
»Es war nett von Ihnen, uns zu erlösen«, sagte Ste-
ve. »Ich hoffe nur, wir stören Ihre Gesellschaft nicht.«
»Oh, keineswegs«, antwortete Wyse und sah auf
seine Uhr. »Ich begann bereits einen Anflug von
Einsamkeit zu verspüren. Mein Gast scheint nicht zu
kommen.«
Das Tanzorchester beendete seine Nummer mit
einem langen Akkord, und die Tanzpaare fingen
zögernd an, die Tanzfläche zu verlassen. Dann ratterte
der Trommler einen Wirbel, ein Scheinwerfer flamm-
te auf, und in die Mitte des Parketts trat Schultz.
»Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles - ich stelle
Ihnen Yatasha vor, ungekrönte Königin der Oase
Ouhir.«
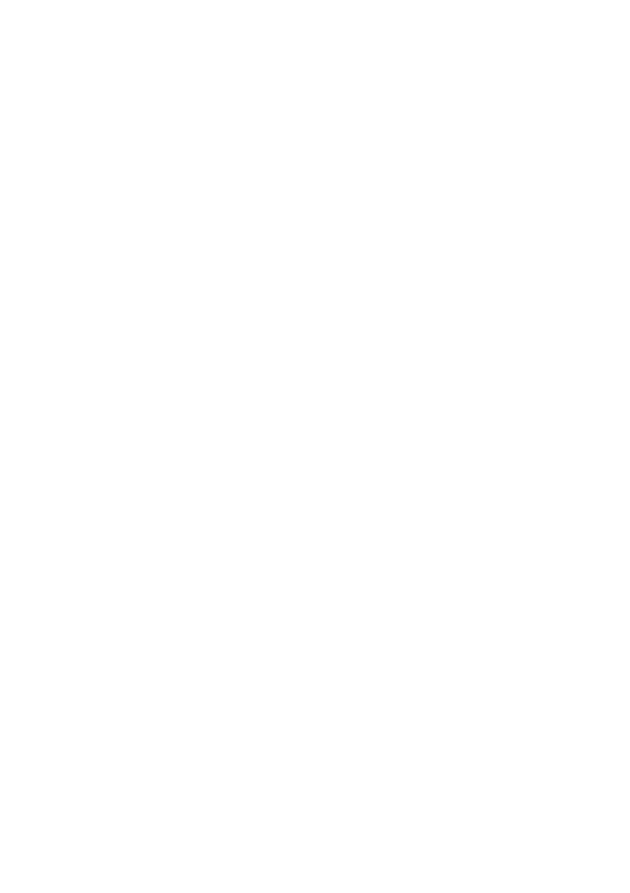
103
Männlicher Applaus ertönte, allerdings nicht allzu
leidenschaftlich. Am rückwärtigen Ende des Raumes
erkletterten einige Herren reiferen Alters, vermutlich
französische Geschäftsreisende, ihre Stühle, um
besseren Ausblick zu haben. Während ein verborge-
nes Viermannorchester arabische Melodien zu spielen
begann, kam ein dunkelhäutiges Mädchen auf die
Tanzfläche gewirbelt, mit verschleiertem Gesicht und
einer an Taille und Fußknöcheln befestigten Pluder-
hose aus dünnem, fast durchsichtigem Stoff. Zehn
Minuten lang wirbelte sie herum, drehte und wand
sich und ließ dabei Hüften und Schultern mit unglaub-
licher Geschwindigkeit vibrieren. Es war eine seltsa-
me Mischung von Barbarei und Kunst, irgendwie
erregend. Als sie schließlich wie erschöpft zu Boden
sank, übrigens sehr graziös, fielen drei der reiferen
Herren im Hintergrund von ihren Stühlen, weil sie
sich gar zu waghalsig nach vorn geneigt hatten, um
alles ganz genau zu sehen.
Als der Applaus verebbte, bemerkte ich, daß ein
Kellner den leeren Stuhl an unserem Tisch zurück-
rückte. Ein Mädchen in weißem Abendkleid, mit
einem hauchdünnen Schal um die Schultern, kam
zwischen den benachbarten Tischen hindurch auf uns
zu. Ich sah, daß Wyse aufstand, und tat mechanisch
dasselbe. Das Mädchen hob den Kopf; ihr aschblon-
des Haar schimmerte im Lichtreflex des Scheinwer-
fers. Sie streckte Wyse ihre rechte Hand entgegen.
Wyse verbeugte sich und Hauchte einen Kuß darauf.

104
»Simone«, sagte er, »ich denke, Sie kennen Mr.
und Mrs. Temple bereits.«
Simone Lalange schien leicht enttäuscht darüber,
daß sie Wyse nicht für sich allein haben würde.
Nachdem wir uns alle gesetzt hatten, herrschte einen
Moment lang ein etwas betretenes Schweigen. Um es
zu überbrücken, äußerte Steve ganz harmlos: »Ich
wußte nicht, daß Sie beide so gut miteinander bekannt
sind.«
»Oh, es ist zwar eine neue Freundschaft«, erklärte
Wyse fast pedantisch, »aber eine sehr schnell reifen-
de. Mademoiselle Lalange und ich haben viele
gemeinsame Interessen entdeckt.«
Sie lächelten sich an, und damit schien die Konver-
sation wieder ins Stocken kommen zu wollen. Ich
dachte daran, Steve um einen Tanz zu bitten, damit
die beiden ungestört Händchen halten könnten. Aber
auf einmal raunte mir eine Stimme ins Ohr: »Sind Sie
Mr. Temple, Sir?«
Es war Schultz. Ich bejahte.
»Monsieur Flambeau ist hier und möchte Sie spre-
chen«, sagte Schultz diskret.
Ich entschuldigte mich bei den anderen und folgte
Schultz durch den Saal und über eine kurze Treppe
hinauf zu einer Art Empore, an der hinter schweren
Vorhängen einige kleine Nischen für vertrauliche
Unterredungen lagen. In einer von ihnen wartete
Flambeau auf mich.
Ehe Schultz uns verließ, fragte ich ihn, ob er mir
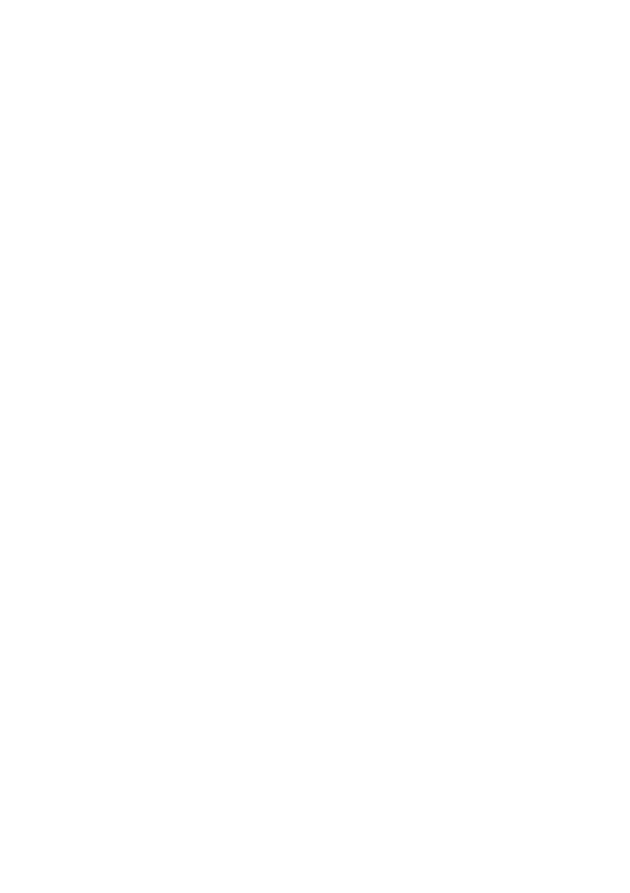
105
einen Gefallen tun würde.
»Jederzeit zu Ihren Diensten, Sir.«
»Können Sie versuchen festzustellen, ob jemand
namens Constantin hier diniert?«
»Ich werde tun, was ich kann, Sir.«
Schultz verbeugte sich mit leicht ironischer Dienst-
beflissenheit und entschwand. Ich wandte mich
Flambeau zu, um ihm die Hand zu schütteln.
»Ich bedauere, daß Sie ein Weilchen auf mich war-
ten mußten, Mr. Temple. Aber ich hielt es für richtig,
selbst zur Villa Negra mitzufahren.«
Flambeau gefiel mir vom ersten Moment an. Er war
noch verhältnismäßig jung und sehr intelligent.
Seinem Typ nach hätte er eher Stabsoffizier als
Kriminalbeamter sein können. Groß, schlank, unauf-
fällig elegant gekleidet, schien er die Welt mit leicht
belustigter Duldsamkeit zu betrachten.
Ich fragte: »Hatten Sie etwas Glück?«
»So-so. Ihr Vorschlag mit dem Boot war gut. Die
Besatzung fand ein treibendes Kanu mit der Leiche
eines dürftig bekleideten Mannes darin. Zweifellos
handelt es sich um Ihren Thompson, aber seine wahre
Identität müssen wir noch feststellen.«
»Und was ist mit dem anderen Ermordeten? Dem,
der völlig bekleidet in dem Bett lag?«
»Gefunden haben wir ihn, ja. Da er uns nicht be-
kannt ist, habe ich seine Beschreibung an die Interpol
in Paris durchgeben lassen. Vielleicht erfahren wir
von dort einiges über ihn.«

106
»Einen seiner Namen kann ich Ihnen sagen. Im
Flugzeug nannte er sich Constantin - wenigstens mir
gegenüber.«
»Er war im Flugzeug mit Ihnen?« fragte Flambeau
schnell. »Sahen Sie ihn auch schon in Nizza? Wohnte
er im selben Hotel?«
»Ah, Monsieur Flambeau, ich sehe, Sie haben mei-
ne Anmeldung im Hotel Aletti studiert. Oder sollte
Ihnen Inspektor Mirabel einige Vorausinformationen
übermittelt haben?«
Flambeau errötete kaum merklich, und ich fand ihn
noch sympathischer, weil ich sah, daß er noch verle-
gen werden konnte.
»Wir stehen ohnehin in ständiger Verbindung mit-
einander«, erwiderte er ruhig und nicht ohne Würde.
»Um auf die Villa Negra zurückzukommen: Rostand
und seine zwei Komplicen haben wir nicht erwischt.
Sie sind aus der Villa verschwunden, ohne etwas
Persönliches zu hinterlassen.«
»Das überrascht mich nicht. Ich hatte den Eindruck,
daß sie dort nur kampieren. Es war interessant, vorhin
zu hören, daß Sie bereits ein Auge auf Rostand
hatten.«
»Ja, wir haben ihn beobachtet, seit er vor einigen
Wochen hier auftauchte und die Villa mietete. Er war
früher in alle möglichen Sachen verwickelt und ist
mehrfach vorbestraft, unter anderem auch als Heirats-
schwindler. Hier hatte er sich bisher nichts zuschulden
kommen lassen - das heißt, soviel uns bekannt wurde.
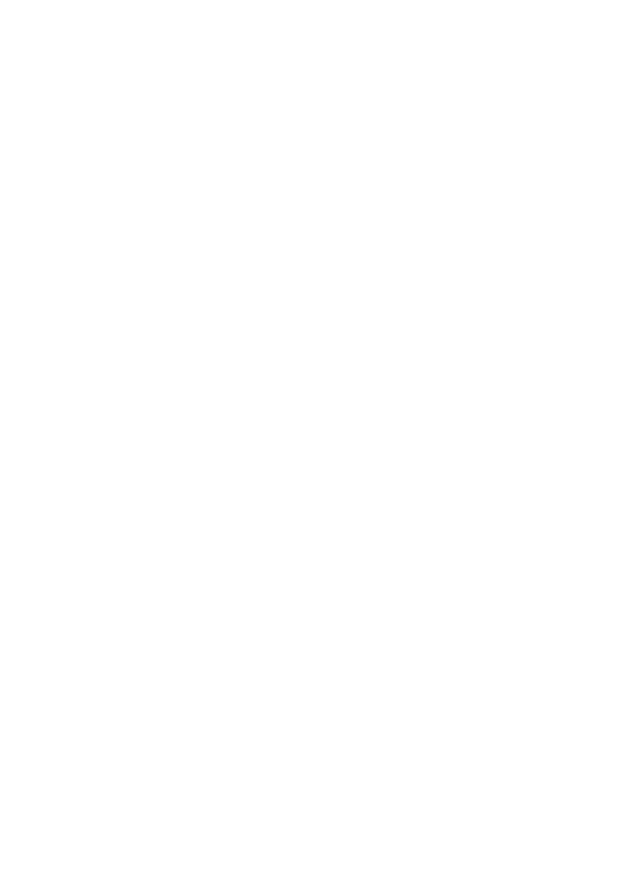
107
Jetzt haben wir den ersten unmittelbaren Beweis für
seine kriminellen Unternehmungen. - Würden Sie nun
bitte so freundlich sein, mir zu erzählen, warum Sie
zur Villa Negra gingen? Und wie ist die ganze Ge-
schichte über die Brille?« Ich gab Flambeau eine
umfassende Schilderung aller bisherigen Ereignisse.
Als ich auf meinen Besuch in der Villa Negra zu
sprechen kam, bat er um eine genaue Beschreibung
der Personen, die ich dort getroffen hatte, und steno-
grafierte dann eifrig mit.
»Besten Dank«, sagte er schließlich. »Ihre Angaben
werden uns eine gute Hilfe sein. Ich glaube nicht, daß
wir Mühe haben sollten, Rostand und seine Kompli-
cen zu verhaften -«
Er hielt plötzlich inne und machte eine warnende
Handbewegung. Schultz war die Treppe wieder
heraufgekommen und näherte sich unserer Nische.
»Sir«, sagte er beim Eintreten, »ich bedauere, Sie
enttäuschen zu müssen. Soweit es sich feststellen ließ,
ist niemand namens Constantin in unserem Lokal
anwesend.«
»Nun, auf jeden Fall vielen Dank.«
»Oh, nichts zu danken, Sir.«
Schultz wollte wieder gehen, aber Flambeau hielt
ihn zurück: »Einen Moment bitte, Monsieur Schultz.
Wie ich hörte, sind Sie mit Colonel Rostand be-
kannt?«
Ich blickte überrascht zu Schultz hinauf; Flambeau

108
hatte mir hiervon nichts gesagt. Schultz lächelte noch,
aber seine Augen wirkten wachsam.
»Colonel Rostand? Ja, er hat mich bei einer oder
zwei Gelegenheiten in die Villa Negra eingeladen. Ich
bin diesen Einladungen gefolgt, denn er ist ein sehr
guter Kunde meines Hauses.«
»Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?«
Schultz überlegte einen Moment lang und antworte-
te: »Vor einer Woche, ungefähr.«
»Heute abend nicht?«
»Nein.«
»Sie haben heute abend auch keine Nachricht von
ihm erhalten?«
»Entschuldigen Sie, Inspektor. Darf ich den Grund
für alle diese Fragen über Colonel Rostand erfahren?«
»Er wird von der Polizei gesucht«, sagte Flambeau
kurz. »Und ich weise Sie darauf hin, daß Sie, falls er
kommt oder Sie ihn anderswo sehen, unverzüglich die
Polizei benachrichtigen müssen.«
»Aber selbstverständlich.« Schultz wirkte schok-
kiert und überrascht von der Neuigkeit. »Welches
Verbrechens wird der Colonel beschuldigt?«
»Mord«, erwiderte Flambeau.
Jetzt sah Schultz ihn eher belustigt als überrascht
an.
»Aber, Inspektor Flambeau! Das kann ich von Co-
lonel Rostand einfach nicht glauben!«
»Glauben Sie es oder glauben Sie es nicht«, gab
Flambeau zurück. »Auf jeden Fall denken Sie bitte

109
daran, daß jeder, der uns Informationen vorenthält, als
Komplice gilt.«
Er nickte, um Schultz zu zeigen, daß das Gespräch
beendet sei. Schultz machte eine kleine Verbeugung,
nun wieder mit seinem leicht ironischen Lächeln, und
ging hinaus.
»Ich bin sehr gespannt, diese Brille zu sehen«, sag-
te Flambeau, als wir wieder allein waren. »Haben Sie
sie bei sich?«
Wieder einmal zog ich die Brille heraus und über-
reichte sie.
»Nichts Bemerkenswertes daran«, äußerte Flam-
beau, als er sie mir nach gründlicher Betrachtung
zurückgab. »Ich kann mir nicht vorstellen, daß
zwischen der Brille und diesen Verbrechen irgendein
Zusammenhang besteht.«
»Vielleicht nicht. Und doch werde ich sehr glück-
lich sein, wenn ich sie aus der Hand geben kann. Wir
fliegen morgen nach Tunis weiter. Und ich möchte
Ihnen versichern: Das erste, was ich dort tue, wird
sein, den richtigen Mr. David Foster zu finden.«
Als ich an unseren Tisch zurückkehrte, fand ich
Simone Lalange allein dort sitzen. Tony Wyse, als
Gentleman, hatte beschlossen, daß er auch Steve auf
das Tanzparkett führen müsse. Ich entdeckte die
beiden nahe dem Orchester, beim Tanzen fröhlich
lachend über irgendeinen Scherz, den vermutlich
Wyse gemacht hatte, und offenbar sehr einig mitein-
ander.

110
Das mindeste, was ich tun konnte, war nun, Simone
Lalange um einen Tanz zu bitten. Sie schenkte mir ihr
verwirrendes Lächeln und erklärte sich begeistert
einverstanden.
Sicher wäre mir beim Tanzen wohler gewesen,
hätte ich nicht das Gefühl gehabt, daß Steves Blicke
mich etwas zu häufig streiften. Denn Simone Lalan-
ges Art zu tanzen war kein konventioneller Kontakt
von Hand zu Hand. Sie schmiegte sich eng an mich,
und als ihr Haar einmal zufällig mein Kinn streifte,
atmete ich einen zarten Parfümduft, der an Lotustei-
che und Tannennadelrauch erinnerte. Jeder Versuch,
eine höfliche Tanzunterhaltung zu führen, erübrigte
sich. Das hier war eine intime, geheime Sensation, die
mehr und tieferes Einverständnis als banales Wortge-
plänkel voraussetzte.
Bei einer Gelegenheit beugte Simone ihren Ober-
körper plötzlich zurück und schien nach meiner
Brusttasche zu spähen.
Als die Musik endete, löste sie sich mit merklichem
Zögern von mir. Dann begannen wir, hintereinander
gehend, im Zickzackkurs zwischen den Tischen
hindurch zu unserem Tisch zurückzukehren. Kurz
bevor wir ihn erreichten, rempelten zwei Kellner, aus
verschiedenen Richtungen kommend, schwer zusam-
men. Einer von ihnen hob seine rechte Faust, schlug
zu und schickte den anderen unter erheblichem
Geklirr und Getöse zu Boden. Eine Frau schrie auf.
Simone fuhr herum und klammerte sich an mir fest.
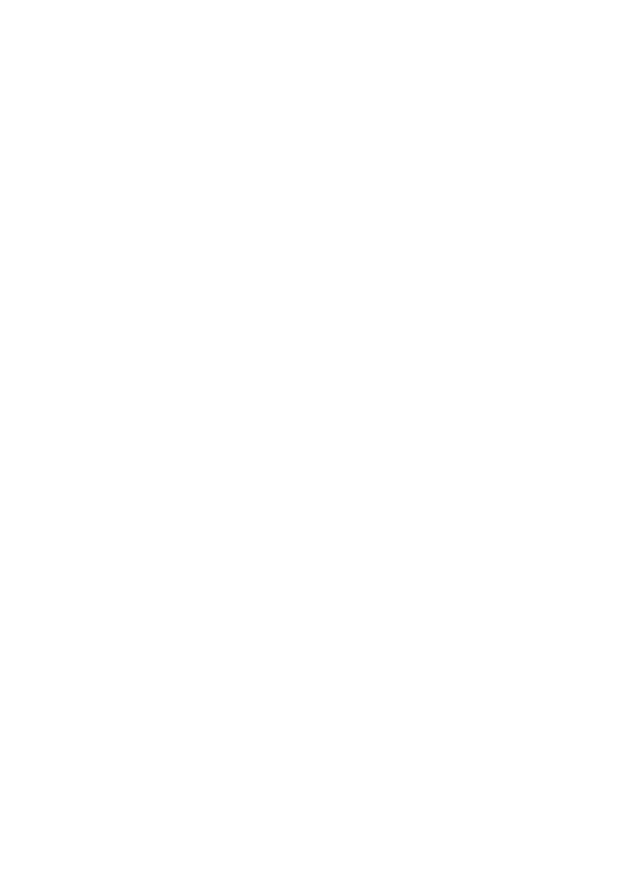
111
In diesem Moment erlosch die elektrische Beleuch-
tung. Die paar flackernden Öllämpchen gaben so
wenig Licht, daß fast völlige Finsternis herrschte. Ich
fühlte rings um mich ein heftiges Gedränge, aber
nichts mehr von Simone Lalange. Dann traf irgend
etwas Schweres meine Brust und warf mich um.
Instinktiv griff ich nach meiner Brusttasche.
Die Brille war schon weg!
Fieberhaft suchte ich auf Händen und Knien am
Boden herum, handelte mir aber nur schmerzende
Tritte auf die Finger ein. Verschiedene Frauen fingen
an zu schreien. Mehrfaches Krachen und Klirren
verriet, daß einige Tische umgeworfen worden waren.
Den ganzen Lärm übertönte eine kräftige Männer-
stimme, die alle bat, Ruhe zu bewahren.
Dann flammte die elektrische Beleuchtung wieder
auf, jetzt verstärkt durch einen riesigen Kronleuchter
in der Mitte der Saaldecke.
Schultz war auf das Orchesterpodium gesprungen.
»Kein Grund zur Aufregung!« rief er. »Es war nur
eine durchgebrannte Sicherung!«
Er gab den Musikern ein Zeichen, und der Dirigent
hob seinen Taktstock für die nächste Melodie. Die
Gäste begannen, zum Teil etwas geniert, ihre Plätze
wieder einzunehmen; Kellner lasen die Trümmer des
zu Boden gefallenen Geschirrs auf. Meine Suche nach
der Brille war sinnlos; sie konnte mir nicht einfach
aus der Tasche gefallen sein.
Steve, Tony Wyse und Simone Lalange versam-

112
melten sich, über den Zwischenfall lachend und
scherzend, um unseren Tisch. Steve erkannte an
meiner Miene, daß irgend etwas danebengegangen
war, und kam schnell an meine Seite.
»Was ist geschehen, Paul?«
»Die Brille ist weg! Jemand muß sie mir aus der
Tasche gezogen haben, als das Licht ausging!«
»Bist du sicher, daß du sie nicht mehr hast?«
»Natürlich!« Ich schlug demonstrativ auf die leere
Brusttasche. »Vielleicht ist Flambeau noch da. Dann
könnten wir die Ausgänge sperren lassen.«
»Was ist denn?« fragte Wyse. »Haben Sie etwas
verloren?«
»Ja«, antwortete Steve. »Mein Mann vermißt eine
Brille.«
Auf der anderen Seite des Tisches steckte Simone
Lalange ihr Spiegelchen wieder in die Handtasche,
nachdem sie ihre Frisur und ihr Make-up kontrolliert
hatte.
»Wir könnten den Dirigenten um eine Durchsage
bitten«, tröstete Wyse. »Sicher wird jemand die Brille
finden. Vermissen Sie sonst nichts? Das plötzliche
Ausgehen des Lichts kann ein Trick von Taschendie-
ben gewesen sein.«
»Oh, meine Handtasche!« stöhnte Steve. »Be-
stimmt habe ich sie an meinem Platz auf dem Tisch
liegengelassen, und jetzt ist sie nicht mehr da!«
Wyse zog Steves Stuhl zurück, um sich unter den
Tisch zu bücken. Aber das brauchte er gar nicht.

113
»Hier ist sie ja«, sagte er erfreut und hob die kleine
schwarze Handtasche vom Sitz des Stuhles. »Aber
schauen Sie lieber nach, ob irgend etwas daraus
fehlt.«
Steve nahm die Tasche dankbar lächelnd entgegen,
öffnete sie, sah hinein und hob merkwürdig langsam
den Blick. Ihr Ausdruck war sehr verwirrt, als sie die
Brille aus der Tasche zog und mir überreichte.
»Echt Frau!« lachte Wyse. »Sie muß dieses Ding
die ganze Zeit über in ihrer Handtasche gehabt
haben!«
»Nun, Paul, noch fünf Minuten, und wir sind da!
Hoffentlich erwartet uns der richtige David Foster am
Flughafen!«
Ich sah zu Steve, die mir gegenüber auf ihrem Platz
am Flugzeugfenster saß, kühl und nobel in einem
eleganten weißen Complet, und bewunderte wieder
einmal ihre Fähigkeit, nach einer abenteuerlichen
Nacht so frisch und hübsch auszusehen.
Unser Flugzeug schwebte über den luxuriösen Vor-
ort Sidi bou Said dem Flughafen El Aouina entgegen,
der einige Meilen außerhalb von Tunis liegt. Viele der
Passagiere waren schon auf dem Flug von Nizza nach
Algier unsere Reisegefährten gewesen; von denen, die
jetzt fehlten, war mir nur Constantin in deutlicher
Erinnerung. Wyse und Simone Lalange saßen weiter
vorn in der langen Kabine nebeneinander.
Seit dem Zwischenfall im ›El Passaro‹ hatte ich

114
Mademoiselle Lalange mit wesentlich intensiverem
Interesse beobachtet. Für sie wäre es beim Erlöschen
der Lichter leichter als für jemand anders gewesen,
mir die kostbare Brille wegzunehmen. Aber wenn sie
es getan hatte - weshalb sollte sie dann das eben
gestohlene Objekt gleich wieder in Steves Handtasche
manipuliert haben? Natürlich hatten wir beide, Steve
und ich, an die Möglichkeit einer Vertauschung
gedacht. Ich war aber so vorsichtig gewesen, auf der
Innenseite einer der Linsen einen klaren Daumenab-
druck anzubringen, und hatte nach der Rückkehr in
unser Hotel einwandfrei festgestellt, daß der Abdruck
noch vorhanden und daß es auch wirklich mein
eigener Abdruck war. Bei einer flüchtigen Betrach-
tung wäre er selbst in hellem Licht kaum zu entdecken
gewesen, und die Möglichkeit einer Fälschung schied
begreiflicherweise völlig aus.
Die tunesische Paß- und Zollkontrolle wurde un-
gemein bürokratisch gehandhabt. Tony Wyse brachte
es fertig, durch sein Reden und Auftreten die Beamten
gegen sich einzunehmen. Daraufhin untersuchten sie
jeden einzelnen Gegenstand in seinem Gepäck mit
äußerster Sorgfalt und bestanden sogar darauf, daß er
seine Taschen leerte. Als wir schließlich aus den
Kontrollräumen kamen, ging ich zu den Benachrichti-
gungstafeln für eintreffende Reisende. Leider war dort
keine Botschaft für uns. Auch schien niemand aus der
Stadt gekommen zu sein, um uns in Empfang zu
nehmen.

115
Ich sah, wie Tony Wyse sich etwas betrübt von
Simone Lalange verabschiedete. Sie wünschte ein
Taxi für sich allein, ohne Begleitung durch Mister
Wyse. Er half ihr beim Einsteigen, machte die Tür
hinter ihr zu und sah dem davonrollenden Taxi ein
paar Sekunden lang nach. Dann winkte er ein Taxi für
sich selbst herbei.
Steve und ich warteten eine Viertelstunde, um Da-
vid Foster, falls er da war, jede Chance zu geben, uns
zu treffen. Dadurch verpaßten wir den kostenlosen
Flughafenbus zur Stadt und mußten schließlich
ebenfalls ein Taxi nehmen.
Wir hatten eine kleine Suite im Hotel Concorde auf
der Avenue Jules Favre bestellt. An der Rezeption ließ
ich mir ein Telefonbuch geben, um die Trans-Afrika-
Öl-Company herauszusuchen.
»Da haben wir sie ja«, sagte ich zu Steve und wies
auf die Eintragung. »Bitte, schreib die Telefonnum-
mer für mich auf.«
In Tunis dauert die allgemeine Mittagsruhe bis vier
Uhr. Also mußte ich mich in Geduld fassen. Es wäre
reine Zeitverschwendung gewesen, irgendein Büro
vorher anzurufen.
Fünf Minuten nach vier machte ich meinen Anruf.
Die unpersönliche Stimme einer Vermittlerin meldete
sich: »Trans-Afrika-Öl-Company.«
»Ich möchte Mr. Foster sprechen, bitte. Mr. David
Foster.«
»Ich verbinde.«

116
Ich hörte mehrfaches Klicken, dann ein Rufzeichen,
schließlich eine schläfrige Männerstimme: »Forster.«
»Mein Name ist Temple«, sagte ich. »Ich nehme
an, Sie haben von Judy Wincott eine Nachricht über
mich erhalten. Ich möchte nun eine Verabredung tref -«
»Judy - wer?«
Die Stimme am anderen Ende der Leitung klang
sehr ärgerlich. Es schien, als sei ihr Eigentümer eben
aus süßem Büroschlummer aufgeschreckt und könne
durchaus nicht leiden, was er da hörte.
»Judy Wincott. Ich traf sie zufällig in Paris. Sie bat
mich, Ihnen Ihre Brille zu überbringen.«
»Hören Sie«, fauchte die Stimme. »Soll das ein
Spaß sein? Ich habe nie von einer Judy Wincott
gehört. Und die einzige Brille, die ich habe, sitzt mir
fest auf der Nase.«
»Aber Sie sind David Foster?«
»Ich bin Daniel Forster, mit einem ›r‹ hinter dem
›o‹. Und wenn Sie nun so freundlich sein würden, aus
der Leitung zu gehen -«
»Einen Moment«, sagte ich schnell, ehe er auflegen
konnte. »Die Sache ist ziemlich wichtig. Gibt es in
Ihrer Firma einen Mann namens David Foster?«
»Nein«, erwiderte Mr. Forster nachdrücklich.
»Wenn wir so einen hätten, wüßte ich es. Ich bin der
Personalchef.«

117
5
»Na«, sagte ich, als ich den Hörer auflegte, »das
war's also.«
»Kein David Foster?«
»Kein David Foster. Der einzige, den ich erreichen
konnte, war ein Mr. Daniel Forster.«
»Aber das ist beinah derselbe Name, Paul. Kann
Judy Wincott sich nicht geirrt haben?«
»Judy Wincott vielleicht. Aber nicht Daniel Forster.
Eine Judy Wincott kennt er nicht, und die einzige
Brille, die er hat, sitzt ihm fest auf der Nase. Ich bin
sicher, er hat mit dieser Sache nichts zu tun.«
»Kann es sein, daß man irgendwie mit seinem Na-
men operiert, ohne daß er davon weiß?«
»Das kommt mir unwahrscheinlich vor. Ich nehme
an, der ähnliche Name ist reiner Zufall - soweit man
es Zufall nennen kann, daß eine so große Firma wie
die Trans-Afrika-Öl einen Angestellten mit einem so
verwechselbar ähnlichen Namen wie David Foster
hat.«
»Wer und wo ist dann der richtige David Foster?«
»Ich vermute, den gibt es gar nicht.«
»Du meinst, die ganze Geschichte war erfunden?«
»Vielleicht. Möglich wäre allerdings auch, daß
David Foster inzwischen tot ist. Anscheinend ist hier
ein sorgfältig ausgeklügelter krummer Plan irgendwie
geplatzt. Und wir sind die zwei Dummen, die das
Baby in Verwahrung genommen haben.«

118
»Unter ›Baby‹ verstehst du die Brille? Was wirst du
nun damit machen? Einem nicht existierenden Eigen-
tümer kannst du sie ja kaum zurückgeben.«
Ich nahm ein Paar in Algier gekaufte Bastschuhe
aus dem Schuhschränkchen und setzte mich auf das
Sofa, um sie gegen die ledernen Halbschuhe auszu-
tauschen, die ich an den Füßen hatte.
»Ich denke, am korrektesten wäre es, sie als herren-
losen Gegenstand bei der Polizei abzugeben. Aber das
ginge mir irgendwie gegen den Strich. Überleg nur,
wie viele seltsame Leute in unser Leben getreten sind,
seit wir die Brille haben. Sam Leyland, Tony Wyse,
Constantin, Colonel Rostand, nicht zu vergessen der
einzigartige Sandro -«
»Und Simone Lalange«, erinnerte mich Steve mit
dunklem Blick. »Tu nicht, als hättest du sie verges-
sen.«
»Hab' ich auch nicht. Du ließest mir bloß keine
Zeit, zu ihr zu kommen.«
»Was ich auch nie erlauben würde, solange ich
etwas dagegen tun kann«, warnte Steve. Wir lachten
beide.
Ich stand auf und bewegte versuchsweise die Ze-
hen. Meine Füße fühlten sich wohl in den neuen
leichten und bequemen Schuhen.
»Weißt du, Steve«, sagte ich, »mir ist manchmal,
als würden wir von einem unsichtbaren Reisezirkus
begleitet und als hätte das ganze Zirkuspersonal, so
eifrig es auch vorgibt, anderweitig beschäftigt zu sein,

119
in Wirklichkeit nur eine einzige Sache im Sinn - diese
Brille. Nein, ich werde das Prachtstück behalten.
Mich interessiert, wer der nächste Bewerber um
unsere Freundschaft sein mag.«
Ich stellte mich vor den großen Spiegel, um meine
neuen Schuhe zu bewundern. Steve kam herbei und
beguckte über meine Schulter hinweg unser gemein-
sames Spiegelbild.
»Ich denke, du mußt sehr vorsichtig sein, Paul.
Diese Leute sind entschlossen, sich gegenseitig
umzubringen. Wenn du zuviel riskierst, kommen sie
auf den Gedanken, auch dich umzubringen. Ich
wünschte, Darling, du würdest wenigstens darauf
verzichten, die Brille mit dir herumzutragen.«
Ich drehte mich um und sah ihr in die Augen.
»Ich glaube, für eine Weile wird sich nichts ereig-
nen, Steve. In Algier hat man einen plumpen Versuch
gemacht, mich zu überzeugen, daß ich die Brille
herzugeben hatte. Bestimmt wird ein neuer und
besserer Versuch hier in Tunis gemacht werden. Doch
das braucht Zeit, weil es vorbereitet werden muß. Und
ich verspreche dir, daß ich morgen früh, sobald die
Banken öffnen, die Brille bei der hiesigen Filiale von
Lloyds Bank deponieren werde.«
Ich beklopfte zärtlich meine Brusttasche. Trotz
meines leichten Anzugs zeichnete sich äußerlich
nichts von der Brille ab. Ich hatte ein zurechtgeschnit-
tenes Stück Pappe so in die Tasche gesteckt, daß es
die Brille zugleich verbarg und schützte.
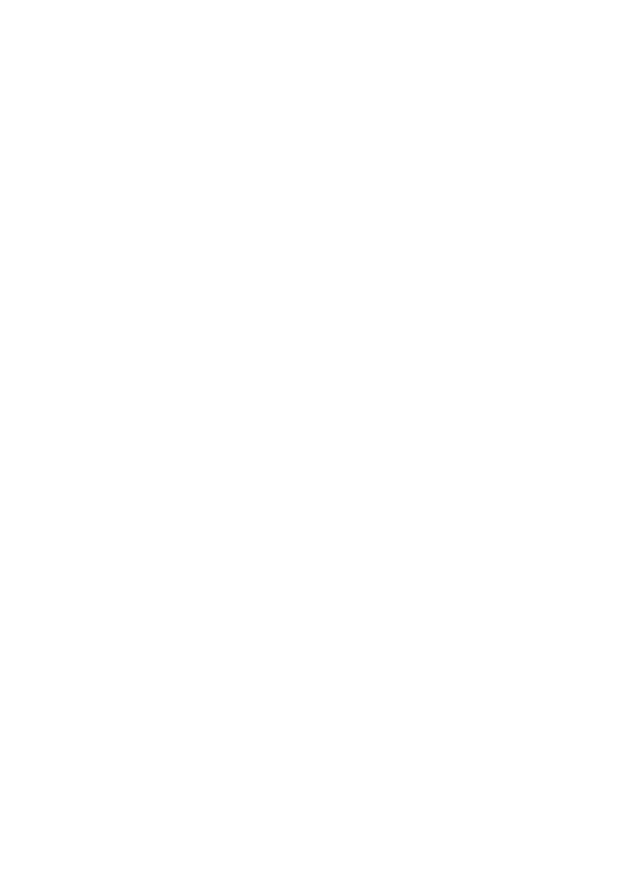
120
»Nun«, sagte ich, »wenn du fertig bist, Steve -«
»Wenn ich fertig bin?« echote sie. »Ich warte seit
fünf Minuten. Wer ist es denn, der seine neuen
Schuhe im Spiegel bewundert?«
Ich schob sie lachend in den Korridor hinaus und
schloß die Zimmertür hinter uns ab.
»Wohin gehen wir?« fragte sie.
»Da wir eigentlich hierhergekommen sind, um
etwas von Tunis zu sehen, wollen wir mit einem
kleinen Bummel durch die umliegenden Straßen
beginnen.«
Unsere Avenue Jules Favre, die während der Sie-
stazeit recht still gewesen war, hatte jetzt schon
wieder lebhaften Betrieb. Wir überquerten den
Fahrdamm vor dem Hotel, um auf der Mittelprome-
nade unter dem Schatten von zwei Reihen stattlicher
Bäume dahinzuspazieren. Eine bunte Schar von
Straßenhändlern wollte Stadtpläne, Postkarten,
Reiseandenken, Füllfederhalter, frische Austern,
gesponnenen Zucker und noch vielerlei anderes an
uns verhökern. Wir hielten an einem Zeitungsstand,
um einige Abendzeitungen zu kaufen, beobachteten
interessiert, wie drei glutäugige Araberjungen einen
Laternenmast erkletterten, um ihr papierenes Modell-
flugzeug zu bergen, das in einem Baum hängenge-
blieben war, riskierten Gesundheit und das Leben bei
einer nochmaligen Überquerung der Fahrbahn und
begannen einen Schaufensterbummel durch die
Avenue de Rome.

121
Beim Weitergehen nach der dritten oder vierten
Schaufensterbesichtigung raunte ich Steve zu: »Wir
werden beobachtet.«
Sie hütete sich, sich neugierig umzudrehen. Da wir
Arm in Arm gingen, merkte ich aber, daß ihre Haltung
sich unwillkürlich versteifte.
»Schon?«
»Vielleicht ist er ein gewöhnlicher Taschendieb,
wie sie immer in der Nähe großer Hotels auf Gele-
genheiten lauern. Wir wollen ihm die Chance geben,
näher heranzukommen.«
»Wie sieht er aus?«
»Könnte ein Landsmann sein. Oder wenigstens ein
Ire. Etwa einsfünfundsechzig groß, um die Fünfzig,
bartlos, grauer Fischgrätmusteranzug, der ihm zwei
Nummern zu weit sein dürfte, mattgrüner Filzhut.«
Wir machten bei der nächsten Ecke eine Wendung
nach rechts, die uns um den Block herum zurück zum
Hotel bringen mußte, und blieben auf unserem Weg
auch weiterhin bei jedem Schaufenster stehen, das uns
interessierte. Unser Verfolger war weit davon ent-
fernt, ein Meister seines Fachs zu sein; jedesmal,
wenn wir stehenblieben, geriet er in Verlegenheit, wo
er ein Versteck finden oder wie er sich ganz unauffäl-
lig verhalten konnte.
Unser Hotel hatte eine Bar mit separatem Eingang
von der Straße. Wir machten davor halt, als seien wir
noch unentschlossen, ob wir hineingehen sollten; aus
einem Augenwinkel sah ich, wie unser Verfolger uns

122
beobachtete. Als wir eintraten, hegte ich keinen
Zweifel, daß er nun wußte, wo er uns finden könnte,
falls er dies wollte.
Die Bar war noch ziemlich leer. Eine kleine Musik-
anlage ließ dezente Melodien ertönen. Der arabische
Barmann, bekleidet mit makellos weißer Nylonjacke,
mixte Cocktails für zwei südfranzösische Geschäfts-
leute, die fast so orientalisch aussahen wie echte
Araber. Wir erkletterten Hocker an der Bar und
bestellten Martinis.
Der Barmann hatte sie noch nicht serviert, als ich
durch den Spiegel über der Bar unseren kleinen
Verfolger hereinkommen sah.
Er machte keine Umstände, sondern kam stracks
zur Bar marschiert, erklomm den Hocker neben mir
und nickte dem Barmann zu.
»'n soir, Achmed. Un Scotch avec Seltz, s'il vous
plait.«
Nachdem er sein Sprüchlein in gräßlichem Franzö-
sisch aufgesagt hatte, drehte er sein etwas ungewa-
schen wirkendes Gesicht zu mir, lächelte wohlwollend
und fügte auf englisch hinzu: »Aber ein Wetterchen
haben wir heut - direkt zum Verlieben, eh?«
Seine Stimme klang etwas gequetscht, und sein
Atem hatte ein unleugbares Whiskyaroma. Dem
Akzent nach war er wirklich ein Ire.
»Angenehm mild für die Jahreszeit«, pflichtete ich
höflich bei; ich hatte gelesen, daß der frühe April in
Tunis schon tropisch heiße Tage bringen könnte.
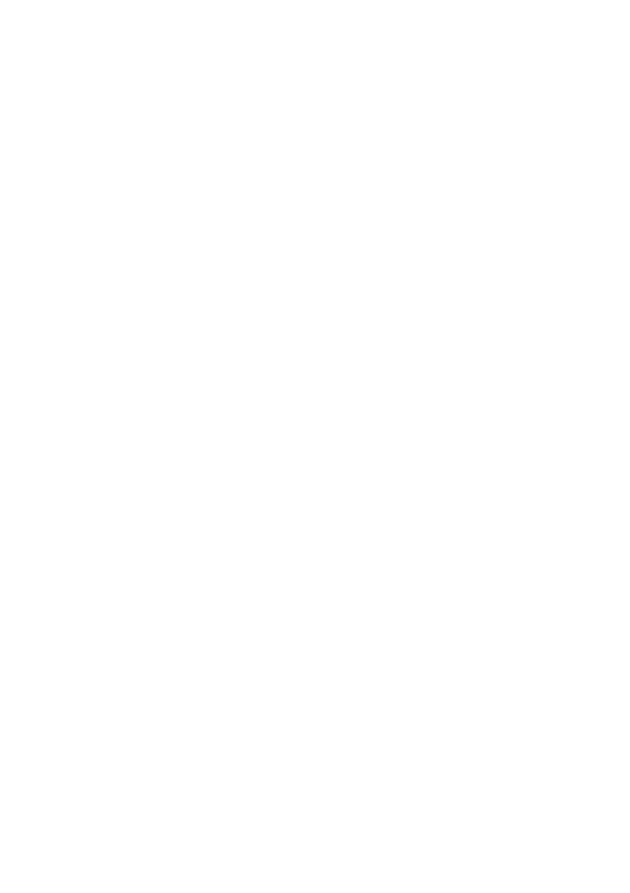
123
»Zur Erholung hier, die Herrschaften?«
»Ja. Wir suchten eine Gegend, in der es noch nicht
von Touristen wimmelt.«
Er nickte mehrmals, was eine Anerkennung der
Weisheit meiner Absicht zu bedeuten schien. Sein
weiß und blau gestreiftes Hemd war nicht allzu
sauber; die rot-gold-grün karierte Krawatte sollte
wohl, obschon selbst etwas fleckig, die Aufmerksam-
keit davon ablenken. Er behielt seinen Hut auf, keck
zur Seite geschoben, die Krempe vorn herunterge-
klappt, um wenigstens eines seiner geröteten Trinker-
augen zu beschatten. Er hatte sich an diesem Morgen
nicht rasiert und offenbar seit Jahren nicht gewagt,
seine Zähne von einem Zahnarzt anschauen zu lassen
- jedenfalls waren sie bräunlich von Nikotin und
wiesen einige Lücken auf. Was mir Kopfzerbrechen
machte, war sein Anzug; ich konnte mir nicht vorstel-
len, daß jemand einen um zwei Nummern zu großen
Anzug wählen würde, und kam im stillen zu dem
Schluß, die Hitze von Tunis habe diesen Mann
allmählich schrumpfen lassen.
»Ja, da haben Sie sich das richtige Reiseziel ausge-
sucht! Wundervolle Stadt, dieses Tunis! Aber Sie
werden genau überlegen müssen, wo Sie hingehen.
Bei Dunkelheit durch die Eingeborenenviertel wan-
dern würde ich Ihnen dringend abraten. Schon man-
chen, der etwas von den ›Arabischen Nächten‹ sehen
wollte, fand man am nächsten Morgen -«
Er hielt inne, stieß ein fauchendes Geräusch aus

124
und zog sich einen gestreckten Finger über die Kehle.
»Sie leben hier?« fragte ich.
»O'Halloran ist mein Name«, erklärte er unvermit-
telt und bot mir seine nikotinfleckige Rechte. »Die
Lady ist gewiß Ihre Gattin?«
Da ich bejahte, ließ er sich vom Stuhl gleiten, ha-
stete an mir vorbei und begann Steve die Hand zu
schütteln. Steve sah von der Höhe ihres Barhockers
etwas verdutzt auf ihn hinab.
»Ist sie nicht eine bildschöne Frau?« rief er voll
Begeisterung. Steve versuchte, ihre Hand wegzuzie-
hen, aber der kleine Ire wollte durchaus nicht loslas-
sen. Ich paßte scharf auf, ob er vielleicht Anstalten
machen würde, ihr einen Ring oder die Armbanduhr
abzuziehen oder in ihrer Handtasche zu angeln.
»Sagen Sie mir bloß nicht, da wäre kein irisches Feuer
in Ihren Augen, Madam!« jubelte er und staunte über
Steves energisches Kopfschütteln. »Nein, da sei
keins? Ah, Madam, das kann ich einfach nicht glau-
ben. - Danke sehr, Achmed. Merci. Nein, nicht soviel
Sodawasser. - Entschuldigen Sie, Sir, wenn ich einen
langen Arm mache, ha, ha, ha. Also auf Ihre Gesund-
heit und erfreuliche Ferientage in Tunis. - Aaah, das
tut gut! Möchten Sie eine amerikanische Zigarette?«
Er schmatzte und holte ein verdrücktes Päckchen
Camel-Zigaretten aus der Hosentasche. Steve und ich
lehnten dankend ab. O'Halloran befeuchtete sich die
Lippen, steckte eine Zigarette dazwischen, rollte sie
hin und her, bis sie feucht genug war, und setzte sie

125
mit einem Zündholz in Brand, das er sehr routiniert an
seinem Hosenboden anriß. Er blies das Flämmchen
aus, ohne die Zigarette aus dem Mund zu nehmen,
und inhalierte mindestens dreißig Sekunden lang.
Dann begann er wieder zu sprechen, aber der Rauch
kam erst gegen Ende der folgenden Passage zum
Vorschein.
»Ist es nicht seltsam, wie der Zufall spielt? Hier
sitzen Sie vor Ihren Drinks und fragen sich, wie um
alles auf der Welt Sie Ihren Weg durch diese fremde
Stadt finden sollen. Und wer kommt da herein?
Ausgerechnet ich - in ganz Tunis der beste Mann, der
Ihnen helfen kann! Ja! Ist das nicht seltsam?«
»Sie wollen damit sagen«, erkundigte sich Steve
mit einer Stimme, die vor unterdrücktem Lachen nicht
ganz sicher war, »Sie wollen damit sagen, daß Sie ein
Fremdenführer sind, Mr. O'Halloran?«
»Ein Fremdenführer, Gnädigste? Sagen wir lieber:
der Fremdenführer! Ich kenne Tunis wie den Rücken
meiner Hand!« O'Halloran sah dramatisch einen
Moment lang auf den Rücken seiner Rechten, dann
steckte er sie schnell in seine Jackettasche. »Hier,
werfen Sie einen Blick darauf!«
Er zückte eine abgewetzte Brieftasche, prall gefüllt
mit Geschäftskarten, Zeitungsausschnitten, Briefen
und sogar einigen Geldscheinen. Vorsichtig angelte er
darin nach einem ausgeschnittenen Zeitungsfoto, das
viele, viele Jahre alt sein mußte; es war vergilbt und
begann sich am Knick aufzulösen. Ich wußte, daß

126
O'Hallorans Augen auf mich gerichtet waren, als ich
es betrachtete. Es zeigte eine Gruppe wohlhabender
Amerikaner neben einem Charterflugzeug. Mitten
unter ihnen war, wie ein Maskottäffchen, Mr. O'Hal-
loran zu sehen, damals noch im Lenz seines Lebens.
»Der Bund amerikanischer Bierbrauer! Die Gent-
lemen erwählten mich zu ihrem offiziellen Fremden-
führer für die ganzen drei Tage ihrer Anwesenheit in
Tunis!«
»Eine wertvolle Urkunde, Mr. O'Halloran. - Schau,
Darling, das ist Mr. O'Halloran mit dem Bund ameri-
kanischer Bierbrauer.«
»Oh, und diese Ähnlichkeit!« äußerte Steve
Schicksals ergeben, während sie das Foto betrachtete.
»Ich bin glücklich, daß es Ihnen gefällt. Und
nun...«
Mit gleicher Vorsicht zückte O'Halloran eine Ge-
schäftskarte und überreichte sie Steve, die sie dann an
mich weitergab:
Haus künstlerischer Raritäten
Szoltan Gupte, Kunsthändler
227, Avenue Mirabar
Tunis
Amerikanische und englische Besucher willkom-
men Tel. 18 75 92
Darunter stand in zittrigen Buchstaben geschrieben:
Patrick O'Halloran, Spezialvertreter.
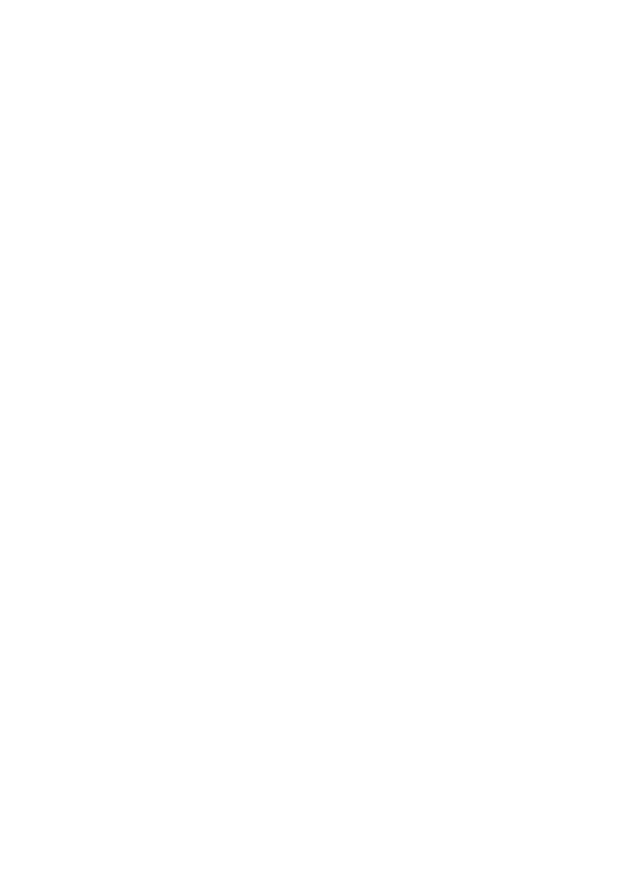
127
»Es ist einen Besuch wohl wert«, versicherte uns
der kleine Ire mit plötzlichem Ernst. »Bestimmt
werden Sie es lohnend finden. Ich selbst kann Sie
dorthin führen. Wann würde Ihnen eine Besichtigung
recht sein?«
»Nun, Mr. O'Halloran, unsere Pläne liegen noch
nicht fest. Zunächst möchten wir uns ein wenig auf
eigene Faust umsehen. Später wollen wir dann gerne
auf Ihre Dienste zurückkommen. Wie können wir Sie
erreichen?«
»Rufen Sie einfach diese Nummer an. Und erinnern
Sie sich - ob Tag oder Nacht, Patrick O'Halloran steht
zu Ihren Diensten. ›Haus künstlerischer Raritäten‹ -
vergessen Sie es nicht! Ich an Ihrer Stelle würde mit
der Besichtigung nicht zu lange zögern. Und wenn Sie
mich nun bitte entschuldigen würden? Ich werde von
Touristen erwartet, denen ich die Kasbah zeigen soll.«
O'Halloran schwenkte seinen Hut, wodurch ein
Schopf überraschend jugendlicher Locken enthüllt
wurde, beglückte uns mit seinem wohlwollenden
Lächeln und entschwand wie ein eiliges Kaninchen.
Er hatte sich nicht damit aufgehalten, seinen Drink zu
bezahlen.
Sobald er fort war, platzten wir los vor Lachen.
»Hätte ich ihn nicht mit eigenen Augen gesehen,
würde ich nicht glauben, daß es so etwas gibt«, sagte
Steve. »Er ist ja eine Type wie vom Possentheater!«
Sie steckte O'Hallorans Karte in die Handtasche. »Das
darf ich nicht verlieren. Hast du bemerkt, Paul, wie

128
sehr ihm an unserem Besuch in diesem ›Haus künstle-
rischer Raritäten‹ gelegen ist? Meinst du nicht, daß
irgend etwas dahintersteckt?«
»Durchaus möglich. Wir werden O'Halloran ein
bißchen schmoren lassen. Wir wollen warten, bis er
sich von selbst wieder zeigt. Ich vermute, das wird
schon bald sein.«
Die Bar begann sich allmählich zu füllen; sie schien
ein beliebter Treffpunkt zu sein. Die meisten Gäste
nahmen an kleinen Tischen Platz, während Steve und
ich noch immer weithin sichtbar an der Theke saßen.
O'Halloran war nicht ganz das gewesen, was ich
erwartet hatte. Aber ich glaubte zu fühlen, daß jemand
anwesend war, der auf eine Gelegenheit wartete, mit
mir zu sprechen.
»Steve«, schlug ich vor, »möchtest du nicht hinauf-
gehen und anfangen, dich umzuziehen? Ich bleibe
noch ein wenig hier sitzen. Vielleicht erscheint
jemand, den wir kennen.«
Sie warf mir einen etwas merkwürdigen Blick zu,
befolgte aber den Wink und ließ sich von ihrem
Barhocker gleiten.
»In einem Viertelstündchen komme ich auch hin-
auf. - Achmed, bitte noch einen Martini.«
Ich hatte recht mit dem Gefühl, daß ein bestimmter
junger Mann die Gelegenheit ergreifen würde, mit mir
zu sprechen. Sobald Steve durch die Tür zum Hotel-
foyer entschwunden war, kam er von seinem Tisch-
chen herbei und stellte sich vor. Er war geschäftlich in

129
London gewesen, zu einer Zeit, als ich mit Sir Gra-
ham Forbes von Scotland Yard an einem Mordfall
arbeitete, der Schlagzeilen machte; er hatte damals in
den Zeitungen Fotos von mir gesehen und mich nun
wiedererkannt. Da er sich als ein sehr gebildeter und
liebenswürdiger junger Franzose erwies, waren wir
bald in eine lebhafte Erörterung der Möglichkeiten
vertieft, die internationale Verbrecher von Witz und
Format aus der Verwendung moderner Verkehrsmit-
tel, eigener Funkanlagen und anderer technischer
Neuerungen zu ziehen vermögen.
Wir hatten etwa sieben oder acht Minuten lang
recht angeregt gesprochen, als ich durch die Tür zum
Hotelfoyer eine Frau sehr eilig in die Bar kommen
sah. Sie war ziemlich groß und das, was man ansehn-
lich nennt. Ihre Kleidung war betont seriös, aber gut
geschneidert und von jener Art Eleganz, die häufig bei
ernsthaft arbeitenden und verantwortungsbewußten
Chefsekretärinnen führender Männer des Bankwesens
oder der Industrie zu finden ist. Ich schätzte sie auf
etwa dreißig.
Sie schaute nervös umher, bis ihr Blick mein
Tweedjackett traf, das mich als mutmaßlichen Eng-
länder charakterisierte. Dann kam sie, einen besorgten
Ausdruck auf dem Gesicht, rasch auf mich zu.
»Entschuldigen Sie, Sir. Sind Sie zufällig Mr.
Temple?«
Ihr Akzent klang amerikanisch.
»Ja, mein Name ist Temple.«

130
»Gott sei Dank, daß ich Sie gefunden habe, Mr.
Temple. Verzeihen Sie, daß ich mich so aufdränge...«
Sie sah zu meinem Gesprächspartner, der wohler-
zogen von seinem Barhocker geglitten war und nun
dastand - bereit, sich vorzustellen.
»Ist irgend etwas nicht in Ordnung?« fragte ich.
»Es handelt sich um Ihre Frau. Ich fürchte, sie hatte
einen häßlichen Schock. Aber jetzt geht es ihr wieder
gut - seien Sie unbesorgt. Ich habe ihr ein leichtes
Beruhigungsmittel gegeben. Ich hätte sie nicht
verlassen, aber sie bestand darauf, daß ich in die Bar
gehen und Sie benachrichtigen sollte -«
»Entschuldigen Sie mich bitte«, sagte ich über die
Schulter zu dem jungen Franzosen, der mich entgei-
stert ansah, und eilte mit der Frau ins Foyer.
»Zum Hotelpersonal gehören Sie doch nicht?«
fragte ich sie, während wir auf den Lift warteten.
»Nein. Ich bewohne das Zimmer neben Ihrer Suite,
Mr. Temple. Ich wollte eben anfangen, mich für den
Abend umzuziehen, als ich Ihre Frau schreien hörte -«
»Schreien?«
Der Lift war endlich ins Parterre zurückgekehrt.
Wir stiegen ein. Sobald die Tür sich geschlossen
hatte, drückte ich auf den Knopf für die dritte Etage,
und die Liftkabine begann ihre ruckelnde Aufwärts-
fahrt.
»Natürlich eilte ich sofort hinüber. Ihre Frau lag auf
dem Bett und wehrte sich gegen einen Mann, der ihr
ein Kissen über das Gesicht drückte -«

131
»Um Himmels willen! Weiter!«
»Nun, das ist eigentlich schon alles. Sobald er mich
bemerkte, jagte er zur Balkontür und verschwand
nach draußen. Ich habe nicht versucht, ihm zu folgen.
Ich war zu besorgt um Ihre Frau. Sie rang um Atem -«
»Und dann haben Sie sie allein in diesem Zimmer
gelassen?« unterbrach ich sie ärgerlich.
Die Amerikanerin sah mich vorwurfsvoll an.
»Natürlich habe ich mich überzeugt, daß niemand
mehr auf dem Balkon war, Mr. Temple. Dann habe
ich die Balkontür verriegelt und die Zimmertür hinter
mir abgeschlossen. Hier ist der Schlüssel.«
»Ich bitte um Entschuldigung. Sie werden verste-
hen, daß ich ziemlich entsetzt war, als Sie sagten -«
»Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Mr.
Temple.« Eine Hand legte sich begütigend auf meinen
linken Unterarm; durch den Ärmelstoff fühlte ich den
leichten Druck verläßlicher Finger. »Sie hatte einen
entsetzlichen Schock. - Übrigens, mein Name ist
Bryce. Miss Audry Bryce.«
Die Liftkabine stoppte, die Tür rollte zur Seite. Wir
stiegen aus und eilten, Miss Bryce mit dem Schlüssel
voran, zur Tür der Suite. Miss Bryce schloß auf und
trat zurück, um mich zuerst hineingehen zu lassen.
Steve lag auf dem Bett, hob aber den Kopf, als sie
mich sah.
Sie hatte ein gerötetes Gesicht und zitterte noch.
Miss Bryce blieb taktvoll im Hintergrund, während
ich mich überzeugte, daß Steve glücklicherweise

132
weiter nichts passiert war. Nach einer halben Minute
hüstelte Miss Bryce, um an ihr Vorhandensein zu
erinnern, und sagte: »Ich glaube, ich werde jetzt
gehen. Den Zimmerschlüssel habe ich auf der Innen-
seite ins Schloß gesteckt.«
»O bitte, gehen Sie noch nicht«, entgegnete Steve.
»Paul, Miss Bryce war sehr gut zu mir. Ich weiß nicht,
was hätte geschehen können, wenn sie nicht so schnell
zu Hilfe gekommen wäre. Aber ich fürchte, im ersten
Moment bin ich dann beinah hysterisch geworden.«
»Miss Bryce, wir sind Ihnen aufrichtig dankbar«,
beteuerte ich. »Möchten Sie nicht mit uns zu Abend
essen? Es würde uns beide sehr freuen.«
»So nett es von Ihnen gemeint ist, Mr. Temple -
leider bin ich für den Abend schon verabredet. Aber
vielleicht finden wir an einem der nächsten Tage
Gelegenheit, uns mal zu treffen.«
»Das hoffe ich sehr. Und nochmals Dank, Miss
Bryce.«
Sobald sich die Tür hinter ihr geschlossen hatte,
setzte Steve sich auf und schwang die Beine vom
Bett.
»Paul, ahnst du, wer der Mann war?«
»Nein. Wie könnte ich das?«
»Sam Leyland!«
»Sam Leyland? Erzähl mir genau, was geschah.«
Ich setzte mich auf den Bettrand und zog Steves
Kopf an meine Brust.
»Also, ich kam herauf, schloß die Tür auf, trat ein

133
und machte die Tür wieder zu - ganz mechanisch und
ohne mir dabei etwas zu denken, du kennst das ja.
Plötzlich sprang hinter den Betten ein Mann hoch,
stürzte sich auf mich und preßte mir eine Hand über
den Mund. Ich biß kräftig hinein, und er ließ mich los.
Da schrie ich um Hilfe und sah, daß es Sam Leyland
war. Er packte mich gleich wieder und stieß mich auf
das Bett. Oh, Paul, und als er mir das Kissen übers
Gesicht drückte, mußte ich an Judy Wincott den-
ken...«
»Ich wünschte, ich hätte Sam in der Villa Negra
etwas nachhaltiger außer Betrieb gesetzt! Hast du eine
Idee, was er hier tat? Durchwühlt sieht das Zimmer
nicht aus.«
»Vielleicht habe ich ihn überrascht, ehe er anfangen
konnte. Oder er hatte wirklich vor, mich zu erstik-
ken.«
Ich stand auf, öffnete die Balkontür und trat hinaus.
Unser Balkon war natürlich leer. Aber es handelte
sich um einen sogenannten Etagenbalkon, der, nur
durch niedere Trennwände unterteilt, um das ganze
Hotel lief.
»Nein, Steve«, sagte ich, als ich in das Zimmer
zurückkehrte, »ich glaube nicht, daß er dir etwas
antun wollte. Das Kissen sollte wohl nur verhindern,
daß du weiter um Hilfe riefest.«
»Du meinst also, er war wegen der Brille hier?
Bilden diese Leute sich ein, wir ließen die Brille
einfach in einem Hotelzimmer herumliegen - nach

134
allem, was geschehen ist?«
»Wahrscheinlich halten Sie uns für dümmer, als wir
sind. Aber sag, mein Schatz, wie fühlst du dich?
Möchtest du einen Brandy oder irgend etwas anderes
dieser Art?«
Steve schüttelte den Kopf.
»Ach, danke, ich fühle mich ganz wohl.«
»Was hieltest du davon, wenn wir uns das Dinner
hier oben servieren ließen?«
»Nein, das würde mir nicht gefallen. Ich möchte so
schnell wie möglich hier hinaus und viel gute, frische
Abendluft atmen.«
»Das dürfte ein seltener Artikel in Tunis sein. Aber
ich glaube, ich weiß das nächstbeste Ding.«
Als Steve sich umgezogen hatte, fuhren wir hinun-
ter, verließen das Hotel und gingen zum nächsten
Halteplatz für Pferdedroschken. Ein arabischer
Kutscher, der aussah, als sei er einhundertundelf Jahre
alt, kletterte von seinem Kutschbock, um uns mit
orientalischer Höflichkeit in das ledergepolsterte
offene Fahrgastabteil seiner Kalesche zu helfen.
»Monsieur, Sie wollen Kasbah besuchen? Altstadt
von Tunis?«
»Fahren Sie, wohin Sie wollen«, sagte ich. »Aber
Ihr Pferd muß Kraft genug behalten, um uns heute
noch hierher zurückzubringen.«
Die Peitsche knallte über dem Kopf des Pferdes,
und wir zuckelten los. Der Abend senkte sich hernie-
der, und eine angenehme Brise umfächelte unsere

135
Wangen.
In der nächsten Stunde versuchten wir, eingelullt
vom rhythmischen Klipp-Klapp der Hufe, alles zu
vergessen, was mit Mord und Gewalttat zusammen-
hing, und uns als ganz normale Touristen zu fühlen.
Unser Kutscher schien mit uns seine gewohnte
Routinerundfahrt zu machen, und ich war froh, daß in
den Straßen, durch die wir kamen, niemand Notiz von
uns zu nehmen schien. Der Himmel verwandelte sich
in tiefdunkles Blau, und im Osten blinkten schon die
ersten Sterne. Wir fuhren über heitere Boulevards mit
dichtbesetzten Caféhaustischchen auf den Gehsteigen.
Dann und wann wies unser Kutscher mit der Peitsche
auf die Fragmente einer Mauer oder eines Torbogens,
um uns moderne Reisende daran zu erinnern, daß die
alten Römer auch schon hiergewesen waren.
Schließlich kamen wir in die engen Gassen des
Araberviertels. Sogleich begann eine Schar schreien-
der Araberjungen hinter der Droschke herzulaufen.
Der Kutscher vertrieb sie mit der Peitsche. Die dicht
beieinanderstehenden Häuser ragten dunkel zu beiden
Seiten auf. Nur wenige Europäer waren in diesen
Gassen zu sehen. Auf den Vortreppen und neben
dunklen Eingängen hockten Araber in ihren wallen-
den Gewändern. Frauen mit Gesichtsschleiern, die nur
die Augen sehen ließen, drückten sich gegen die
Häuserwände, um uns vorbeizulassen. Im Vorbeifah-
ren warfen wir flüchtige Blicke in überfüllte und
wenig einladende Arabercafés, hin und wieder hörten

136
wir Bruchstücke eigentümlich monotoner Gesänge.
Einmal gerieten wir unversehens in die Nähe einer
heftigen Straßenschlägerei. Unser Kutscher trieb das
Pferd mit der Peitsche an und brachte uns sicher aus
dem Getümmel. Die ganze Zeit, während wir durch
das Araberviertel fuhren, hatte ich die Empfindung,
daß ständig Hunderte von Augen auf uns gerichtet
waren, teils gleichgültig, teils feindselig, teils berech-
nend. Aus der Art, wie Steve sich an mich schmiegte,
erkannte ich, daß sie es auch empfand.
Es war eine Erleichterung, als wir in eine breite
Straße einbogen und in den modernen Teil der Stadt
zurückkehrten.
Ich bezahlte den Kutscher an derselben Stelle, von
der wir gestartet waren. In Erinnerung an die Schläge-
rei gab ich ihm ein gutes Trinkgeld, was ihn veranlaß-
te, den Segen Allahs auf unsere Häupter herabzufle-
hen.
»Was macht dein Appetit, Darling?« fragte ich
Steve, als wir uns dem Hotel näherten.
»Oh, ich glaube, ich bin jetzt ziemlich hungrig,
obwohl mir etwas seltsam im Magen wurde, als wir
die Messerstecherei sahen.«
»Dann schlage ich vor, daß wir direkt in den Spei-
sesaal gehen. Oder möchtest du vielleicht zuerst noch
einmal hinauf?«
»Nein. Ich bin bereit für den Speisesaal - falls es dir
nichts ausmacht, neben einer Frau mit ungepuderter
Nase zu sitzen.«

137
Ich fragte einen Pagen nach dem Weg zum Speise-
saal, aber ein herbeieilender Mann in Cut und gestreif-
ter Hose hielt uns auf.
»Mr. Temple!« Seine Stimme war dringlich und
derart auf Flüstertöne gestimmt, als übermittle er eine
ganz geheime Botschaft. »Kommissar Renouk wartet
auf Sie! Ich wußte nicht, wo Sie zu finden wären. Er
ist sehr ungeduldig geworden. Wenn es Ihnen nichts
ausmacht, Mr. Temple - er wartet in meinem Büro.«
»Kommissar Renouk? Von der Polizei?«
»Sogar vom Polizeipräsidium.«
»Will er nur mich sprechen oder auch meine Frau?«
»Nur Sie, Mr. Temple.«
»Sie sind der Hoteldirektor?«
»Für die Nachtschicht, ja.«
»Sie sprechen ein ausgezeichnetes Englisch.«
Der kleine Mann versuchte gleichzeitig geschmei-
chelt und bescheiden auszusehen.
»Mr. Temple sind zu gütig.«
»Ich übergebe meine Frau Ihrer persönlichen Für-
sorge während der Zeit, in der ich mit dem Kommis-
sar spreche.«
Der Direktor legte sich eine Hand auf den Magen,
die andere auf den Rücken und verbeugte sich tief.
»Entzückt, Madam. - Und nun, Mr. Temple, diesen
Weg, wenn ich bitten darf. Der Kommissar ist bereits
sehr ungeduldig.«
Der Mann, den ich im Büro des Direktors vorfand,
hatte es vermocht, den kleinen Raum mit einer

138
Atmosphäre aus Argwohn und Drohung zu erfüllen.
Sein Gesicht war bleich, seine Augenbrauen sehr
schwarz und buschig, sein Mund dünn und an einer
Seite nach unten gezogen.
»Nehmen Sie Platz, bitte«, sagte er schroff. »Ihr
Name ist Paul Temple?«
»Ja.«
»Ihre Nationalität?«
»Britisch.«
»Ich bitte um Ihren Paß.«
Ich reichte ihm meinen Paß. Er blätterte sorgfältig
einige Minuten lang darin herum, ehe er ihn mir
zurückgab.
»Der Zweck Ihres hiesigen Aufenthaltes?«
»Erholung, Vergnügen. Alles, was man Tourismus
nennt.«
»So. Sie sind nicht hierhergekommen, um einen
gewissen Patrick O'Halloran zu treffen?«
»Keineswegs. Ich ahnte nicht -«
»Aber Sie hatten heute abend um sechs Uhr eine
Verabredung mit ihm? In der Bar dieses Hotels?«
»Das war keine Verabredung. Er ist uns dorthin
gefolgt.«
»Wie lange kennen Sie diesen Patrick O'Halloran?«
Ich sah auf meine Uhr und sagte: »Etwas über zwei
Stunden. Vor heute abend habe ich ihn nie gesehen.«
»Sie behaupten, er sei kein Freund von Ihnen? Im-
merhin wurden Sie in sehr angeregter Unterhaltung
mit ihm beobachtet.«

139
»Oh, Sie haben mit Achmed gesprochen! Warum
alle diese Fragen, Kommissar? Hat O'Halloran
jemandes Geldbörse gestohlen?«
»Ich bitte, nicht zu ulken, Mr. Temple. Dies ist eine
sehr ernste Angelegenheit. Wenn Sie nicht die Wahr-
heit sagen und mir Ihre volle Unterstützung zusichern
wollen -«
»Monsieur le Commissaire«, unterbrach ich,
»selbstverständlich bin ich dazu bereit, wenn Sie mir
erklären würden, welchen Zweck dieses Verhör
verfolgt? Was hat O'Halloran getan?«
Renouk richtete seine dunklen Augen scharf auf
mich, um meine Reaktion zu beobachten.
»Heute abend um halb sieben wurde im Arabervier-
tel ein männlicher Leichnam gefunden. Wir haben ihn
als Patrick O'Halloran identifiziert. Wir glauben, Sie
waren der letzte, der ihn lebendig gesehen hat.«
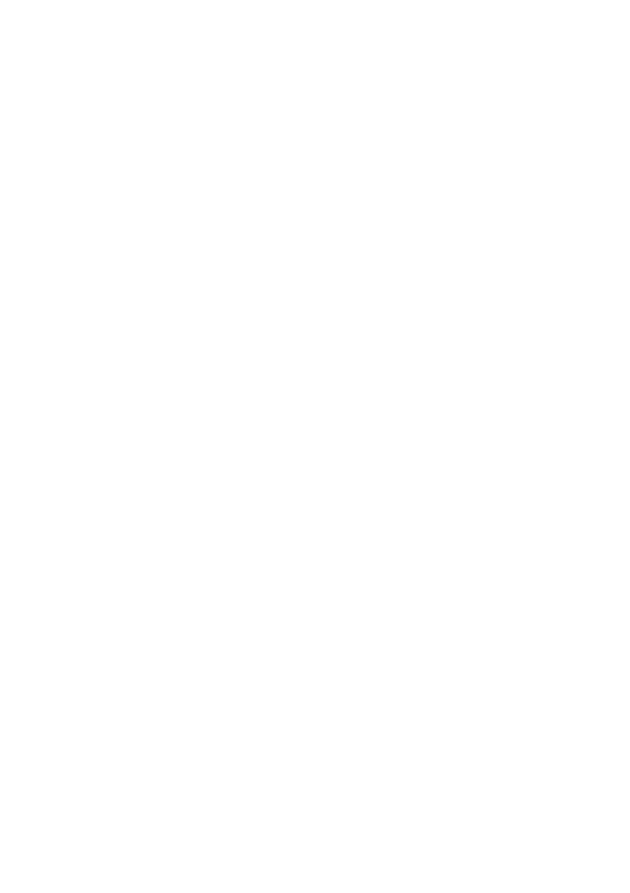
140
6
Das Dinner schmeckte uns nicht recht an diesem
Abend. Wir hatten in unserer Umgebung, weiß Gott,
schon manchen plötzlichen und gewaltsamen Todes-
fall erlebt. Aber das Schicksal des kleinen Mr. O'Hal-
loran rührte uns ganz eigenartig an. Wir fühlten echtes
Bedauern bei dem Gedanken, daß diese nasale Whis-
kystimme nun für immer verstummt war.
»Ich hatte ja gleich das Gefühl, er hinge irgendwie
mit der Brille zusammen«, erinnerte Steve.
»Nun, weißt du, mein Schatz, die Tatsache, daß ein
Mann im Araberviertel von Tunis getötet wird,
bedeutet noch nicht, daß er mit dieser Sache zu tun
hatte.«
»Es ist zuviel, um ein bloßer Zufall zu sein. Da ist
ein Mann, den du für einen Taschendieb hältst. Er
forciert ein kurzes Gespräch mit uns, und eine Stunde
später findet man ihn tot.«
»Ja, da hast du recht, Steve. Das ist merkwürdig.«
»Weißt du noch, wie dringend er uns einen Besuch
in diesem ›Haus künstlerischer Raritäten‹ empfahl?«
Steve holte die Geschäftskarte, die O'Halloran uns
übergeben hatte, aus ihrer Handtasche und studierte
sie. Dabei bemerkte ich auf der Rückseite der Karte
eine Zeichnung.
»Schau dir einmal die andere Seite an, Steve.«
Sie drehte die Karte um, sah mich an und reichte
sie mir schweigend hinüber. Die Zeichnung auf der

141
Rückseite, recht linkisch ausgeführt, stellte eine Brille
mit dicker Hornfassung dar.
»Da haben wir den Zusammenhang. Vielleicht hat
O'Halloran nicht mal gewußt, was es damit auf sich
hat. Aber zweifellos gehört dieser Szoltan Gupte zu
der verbreiteten Gilde leidenschaftlicher Brillenlieb-
haber. Ich frage mich, ob wir ihn schon unter einem
anderen Namen kennen?«
Wir aßen unseren Geflügelsalat schweigend. Als
der Kellner kam und uns zum Auswählen der Haupt-
gerichte die lange Speisekarte präsentieren wollte,
schüttelten wir beide den Kopf.
»Für mich nur noch Kaffee, Paul. Aber laß dich
dadurch nicht abhalten -«
»Ich nehme auch nur Kaffee. Aber wir wollen ihn
draußen auf der Terrasse trinken. Dort ist es luftiger.«
»Sehr wohl, Monsieur. Sehr wohl, Madame.«
Während der Kellner mit seiner Serviette den Tisch
abwedelte, gingen wir hinaus auf die Terrasse, die den
kleinen Garten des Hotels überblickte - eine hübsche
Anlage mit steinernen Bodenplatten und hölzernen
Tischen und Stühlen und modernen Hollywoodschau-
keln. Jetzt, in der Dunkelheit, blinkten viele kleine
bunte Lichter von den Ästen der Bäume. Neben einer
marmornen Tanzfläche spielte eine Dreimannkapelle
schwüle Melodien, aber niemand tanzte.
Während wir nach einem geeigneten Tisch Aus-
schau hielten, hörten wir eine Stimme hinter uns:
»Hallo, Mr. Temple, Mrs. Temple!«

142
Miss Audry Bryces Abendverabredung schien nicht
lange gedauert zu haben. Wenn alle ihre Verabredun-
gen so kurz verliefen, brauchte man sich nicht zu
wundern, daß sie noch Miss war. Sie saß auf einer
bunten Hollywoodschaukel, die langen, wohlgeform-
ten Beine über einander geschlagen.
»Wollen Sie nicht bei mir Platz nehmen?« rief sie
aus.
»O danke, sehr gerne«, antwortete Steve.
Wir gingen zu dem Tisch. Die nächste Minute war
erfüllt von Begrüßungsworten und dem Zurechtrücken
einer zweiten Hollywoodschaukel für Steve. Ich
begnügte mich mit einem Stuhl. Audry Bryce hatte
ihren Kaffee bereits getrunken. So bestellte ich, als
unsere Kaffees kamen, Likör für uns alle drei.
»Sie fühlen sich jetzt wieder besser, nicht wahr,
Mrs. Temple?«
»O danke, viel besser. Wir unternahmen eine hüb-
sche Droschkenfahrt durch die interessantesten Teile
von Tunis.«
»Ach, diese alten Pferdedroschken! Putzige Dinger,
finden Sie nicht? Mir gefällt Tunis ja außergewöhn-
lich gut. Ich wollte ursprünglich nur eine Woche
bleiben und bin nun schon fast einen ganzen Monat
da. Diese faszinierende Mischung, wissen Sie, der
Osten mit dem Westen, und alle diese hübschen
kleinen Läden im Araberviertel. Bestimmt haben Sie
schon gehört, daß Tunis berühmt ist für seine Par-
füms? Es soll geheime Herstellungsrezepte geben, die

143
nur in einer Familie bleiben und vom Vater auf den
Sohn übergehen. Außerdem macht man hier reizende
Sachen aus Leder.«
»So etwas beabsichtigen wir zu kaufen«, warf ich
ein. »Uns wurde ein Geschäft in der Avenue Mirabar
empfohlen. Kennen Sie es vielleicht? ›Haus künstleri-
scher Raritäten‹ nennt es sich.«
Audry Bryce zog die Augenbrauen zusammen und
machte eine wegwerfende Handbewegung.
»Nein, ich kenne es nicht«, sagte sie verächtlich.
»Aber ich würde Ihnen nicht raten hinzugehen. Mir
gefällt dieser kleine aufdringliche Ire nicht, der dafür
Reklame macht. Sicher hat er auch mit Ihnen gespro-
chen. Er belästigt ja alle neueintreffenden Gäste,
dieser O'Harrigan oder wie er heißt.«
»O'Halloran.«
»Richtig, O'Halloran.« Miss Bryce wandte sich an
Steve: »Beachten Sie seine Empfehlungen nicht, Mrs.
Temple. Er ist nur ein kleiner Anreißer, dem an Ihrem
Geld liegt. Außerdem trinkt er zuviel. Als er mich zu
beschwatzen versuchte, roch er schon um neun Uhr
morgens nach Whisky. Ich weiß ja nicht, wie Sie dazu
stehen, aber ich finde das einfach indiskutabel, und -«
»Er ist heute abend ermordet worden«, warf ich ein.
»Vorhin war ein Kriminalbeamter hier, um Einzelhei-
ten über unser Gespräch mit O'Halloran in der Bar zu
führen. Ich bin überrascht, daß er nicht auch Sie
gefragt hat.«
Miss Bryces Redestrom war wie abgeschnitten.

144
Sekundenlang zeigte sie ein erschrockenes, nicht eben
intelligentes Gesicht. Dann stammelte sie: »Ermordet?
Aber das - das ist doch unmöglich!«
»Wieso unmöglich? Tunis ist eine recht gewalttäti-
ge Stadt. Wir wissen das gut genug - nicht wahr,
Steve?«
Steve lächelte matt. Ich beobachtete, wie Audry
Bryce um Fassung rang.
»Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, warum
jemand diesen unbedeutenden kleinen Mann ermordet
haben sollte. Doch wohl kaum, um ihn zu berauben?«
»Das würde ich auch nicht annehmen. Es sei denn,
O'Halloran war ein Dieb, der etwas Wertvolles
gestohlen und damit die Habgier eines anderen
Gauners erweckt hatte.«
Miss Bryce schien über diese Vorstellung entsetzt.
Sie griff nach ihrem Glas Benediktine und nahm einen
hastigen Schluck daraus.
»Das ist ja schrecklich! Welch ein Abend! Zuerst
der brutale Überfall auf Mrs. Temple und dann der
Mord an diesem armen kleinen Mann! Ich bin sicher,
daß ich heute nacht kein Auge schließen kann!«
Während sie sprach, hatte sie angefangen, ihre
Habseligkeiten zusammenzuraffen - ein Abendtäsch-
chen, eine Chiffonstola, einen amerikanischen Roman
mit auffallendem Einband.
»Nun müssen Sie mich bitte entschuldigen. Ich
habe einer Freundin versprochen, sie bis um zehn Uhr
anzurufen.«

145
Ich stand auf, während sie sich verabschiedete,
dann setzte ich mich zu Steve auf die Hollywood-
schaukel und zündete mir eine der kleinen Zigarren
an, die ich auf unserem Nachmittagsspaziergang
gekauft hatte. Steve blickte dem emporsteigenden
Rauchwölkchen nach.
»Paul, du warst etwas hart mit Miss Bryce. Ich
fürchte, du hast sie verscheucht.«
»Miss Bryce ist so leicht zu durchschauen wie eine
Flasche Selterswasser. Wenn sie eine harmlose
amerikanische Touristin sein will, dann sind wir beide
Don Quichotte und Sancho Pansa.«
»Was hat sie, deiner Meinung nach, im Sinn?«
»Wie Sherlock Holmes zu sagen pflegte: ›Ich habe
eine Vermutung.‹ Wir werden es schon herausfinden.
- Möchtest du tanzen? Jetzt sind einige Paare auf der
Tanzfläche.«
»Nein. Laß uns still hier sitzen bleiben.« Sie schob
ihren linken Arm unter meinen rechten. »Genieße
deine Zigarre. Ich sehe gerne den Rauchkringeln zu.«
Auf unserem Weg zum Lift fragte ich an der Re-
zeption nach dem Direktor. Beim Verlassen seines
Büros zupfte er sich eine Serviette vom Kragen und
ließ sie, leicht verlegen, in seiner Hosentasche ver-
schwinden; leider hatten wir ihn beim Abendessen
gestört.
»Ich wollte Sie nur eins fragen. Wie lange wohnt
Miss Bryce schon hier?«

146
»Die amerikanische Lady? Zwei Wochen, Mr.
Temple. Sie ist eine gute Bekannte von Ihnen, nicht
wahr?«
Ich bejahte dies etwas vage, aber der Direktor
strahlte trotzdem.
»Gefällt Ihnen Ihre Suite, Mr. Temple?«
»Ja, sie ist sehr hübsch.«
»Miss Bryce sagte, Sie legen Wert auf gute Aus-
sicht, und diese würde Sie entzücken. Es war etwas
schwierig, Ihnen die Suite neben der von Miss Bryce
zu geben. Aber Miss Bryce ist stets sehr großzügig
zum Personal, und daher haben wir -«
»Sie legte Ihnen nahe, uns diese Suite zu geben?«
»Aber gewiß Mr. Tempel. Und wir versuchen im-
mer, den Wünschen unserer Gäste zu entsprechen.«
»Das ist nett von Ihnen. Vielen Dank. Und gute
Nacht.«
»Gute Nacht, Mr. Temple, gute Nacht, Mrs. Tem-
ple. Angenehme Ruhe.«
Während wir auf den Lift warteten, raunte ich Steve
zu: »Er liebt sehr viel Knoblauch in seinem Essen.«
Sie nickte lächelnd.
Im Lift fragte ich sie: »Ist dir aufgefallen, daß wir
seit unserer Ankunft in Tunis nichts von Tony Wyse
oder Simone Lalange gesehen haben?«
»Sehnst du dich nach der aschblonden Simone?«
»Nicht unbedingt. Ich überlege nur, ob ihre und
Tony Wyses Pflichten mit der Landung des Flugzeu-
ges in El Aouina endeten und von Patrick O'Halloran

147
und Audry Bryce übernommen wurden?«
Die Wände des Hotels hatten so viel Sonnenwärme
aufgesogen, daß dank der geschlossenen Balkontür
die Luft in unserem Schlafzimmer unangenehm
drückend war. Wegen der Mücken, Fliegen und
Nachtschmetterlinge konnten wir aber die Balkontür
nicht öffnen, solange wir Licht im Zimmer hatten.
Und nachher, als wir in unseren Betten lagen, wollten
wir sie auch nicht offenstehen haben, weil ja der
Balkon um das ganze Hotel lief und es keineswegs
sicher war, daß niemand auf diesem Weg bei uns
einzudringen gedachte. Obwohl wir uns nur mit den
Laken zudeckten, konnten wir nicht richtig einschla-
fen. Wir fielen wohl dann und wann in einen kurzen
Schlummer, wachten aber immer wieder auf und
hatten den Eindruck, als schleiche die Zeit unerträg-
lich langsam dahin.
Gegen drei Uhr hörte ich Steve aus dem Bett auf-
stehen und die Balkontür öffnen, um etwas frische
Luft zu haben. Eine Minute später war sie wieder da
und schüttelte mich an der Schulter.
»Wach auf, Paul«, flüsterte sie. »Nebenan, in Au-
dry Bryces Zimmer, geht irgend etwas vor.«
Ich brauchte nicht erst wach zu werden, richtig
geschlafen hatte ich sowieso nicht. »Was denn?
Hoffentlich doch kein neuer Erstickungsversuch?«
»Nein, Stimmen. Bei ihr ist ein Mann.«
»Oh, Steve«, seufzte ich und ließ mich wieder nie-

148
dersinken.
»Nein, Paul. Sei ernst. Komm und höre.«
»Gut. Aber du darfst nicht mit hinaus. Höchstens
bis zur Balkontür.«
Steve fügte sich etwas zögernd und blieb in der
Dunkelheit des Zimmers nahe der Tür, während ich
vorsichtig auf den mondbeglänzten Balkon hinaus-
ging. Ein Fenster des Nachbarzimmers stand offen;
ich sah das Licht durch eine dichte Mückengardine
schimmern und konnte das Gemurmel einer Männer-
stimme und einer Frauenstimme hören, aber nicht
verstehen, was gesagt wurde. Nach dem Tonfall
glaubte ich zu erkennen, daß sie englisch sprachen.
Nach einigen Minuten hörte das Gemurmel auf. Ich
wollte es schon wagen, über die Trennwand hinweg
auf den anderen Balkon zu klettern, als ich den
Schatten einer Frau auf die Mückengardine des
offenen Fensters fallen sah.
Gleich danach ertönte, gedämpft und doch gut zu
verstehen, Audry Bryces Stimme ganz in der Nähe
des Fensters.
»Jedenfalls hättest du mich wissen lassen können,
daß er getötet wurde. Angenommen, ich hätte mich
verraten? Dann wäre all die gute Arbeit umsonst
gewesen, die Sam und ich am Spätnachmittag gelei-
stet haben.«
Der Schatten bekam plötzlich andere Konturen;
wahrscheinlich war der Mann zu Audry Bryce getre-
ten und hatte ihr die Hände auf die Schulter gelegt.

149
»Wie hätte ich es dich wissen lassen können, Che-
rie, wenn ich es selbst nicht wußte? Und ich bin
sicher, daß du dich nicht verraten hast. Dafür bist du
viel zu klug. Aber komm jetzt fort vom Fenster. Wir
wollen doch unsere Nachbarn nicht stören.«
Die Schatten verschwanden von der Gardine. Im
selben Moment schwang ich mich lautlos über die
Trennwand. Die beiden waren jetzt weiter hinten im
Zimmer. Unter dem offenen Fenster hockend, konnte
ich das meiste verstehen, was sie sprachen.
Ich hörte den Mann sagen: »...hab' ohnehin nicht
erwartet, daß sie dumm genug wären, die Brille im
Schlafzimmer zu lassen. Weißt du, wer von den
beiden sie bei sich hat?«
»Er. Seine Brusttasche hat eine leichte Wölbung,
die nicht vom Taschentuch herrühren kann. Und er
selbst trägt keine Brille.«
»Hm. Dachte mir, daß er es wäre. Wenn er bloß
nicht auf so verflixt gutem Fuß mit der Polizei stünde.
Aber warte nur, unsere Zeit kommt. Wir werden einen
Weg finden. Allerdings darf es nicht mehr lange
dauern.«
»Die Temples müssen ja argwöhnisch sein. Dieser
Narr Leyland! Wie kann er bloß den Schlüssel im
Schloß überhört haben? Du mußt ihn feuern, Pierre.
Er ist ein schrecklicher Patzer.«
»Er hat seinen Nutzen«, antwortete Pierre. »Er mag
dumm sein, aber er ist zuverlässig. Er hat nicht
Verstand genug, um mich zu hintergehen, und das

150
honoriere ich ihm.«
»Solange ich keine Jobs mehr mit ihm zusammen
erledigen muß -«
»Brauchst du auch nicht. Dein Job ist, freundlich
mit den Temples zu sein.«
»Oh, im Freundlichsein bin ich gut! Du solltest das
wissen, Pierre!« Audry Bryces Stimme hatte einen
merkwürdig sinnlichen Klang bekommen. »Du mußt
doch nicht gleich wieder fort - nein, Liebling? Wir
haben so wenig Gelegenheit, allein zu sein.«
»Nein, ich muß nicht gleich wieder fort«, entgegne-
te Pierre etwas heiser. Ich hörte Seide rascheln und
ein leises Ächzen der Sprungfeder. Da eine sachliche,
interessierende Konversation nun kaum noch zu
erwarten war, kehrte ich auf unseren Balkon zurück.
Steve empfing mich mit der gespannten Frage:
»Konntest du etwas hören? Hast du die Stimmen
erkannt?«
»Audry Bryce natürlich, obwohl sie ganz und gar
nicht mehr wie die einer korrekten amerikanischen
Touristin klang. Und die andere Stimme werde ich bis
an mein Lebensende nicht vergessen. Sie gehört
Rostand!«
»Rostand? Oh, er ist also in Tunis! Konntest du
verstehen, was sie sprachen?«
Ich machte unsere Balkontür vorsichtshalber zu,
ehe ich die erlauschte Unterhaltung wiederholte, und
schloß mit den Worten: »Dank Audry Bryces liebe-
voller Mühe um unsere Unterbringung haben wir also

151
recht nützliche Informationen erhalten.«
»Welche meinst du im besonderen?«
»Daß mehr als eine Bande an der Brille interessiert
ist. Rostand und seine Leute wußten nichts von
O'Halloran oder wenigstens nicht, worauf er aus war.
Das hatte ich bereits vermutet. Es enthält die einzige
Erklärung für alle die Morde.«
»Ja, ich verstehe. Wenn einer der Jagdhunde der
Beute zu nahe kommt, beißen die anderen ihn tot.«
»Genau.«
»Und was wird, wenn nur noch ein Jagdhund übrig
ist?«
»Bis dahin wird noch einige Zeit vergehen. An
diesem Rennen sind sehr viele Jagdhunde beteiligt.«
»Und alles wegen einer gewöhnlichen Brille. Das
macht die Sache so phantastisch. Ich wünschte, Paul,
du fändest bald heraus, warum.«
Sie blickte mich so gespannt an, als sei ich ein Au-
tomat, in den sie eine kleine Münze geworfen hätte,
um dafür ein Kartellen zu erhalten, das ihre Zukunft
voraussagte. Ich lachte leise.
»Für gewöhnlich ist es umgekehrt, Steve. Da bittest
du mich, den Fall aufzugeben und das Durcheinander
zu meiden.«
»Ich weiß. Aber dieses Mal bin ich so neugierig,
daß ich es kaum ertragen kann. Außerdem habe ich
endlich einmal nicht das Gefühl, es könnte dir etwas
Ernstliches passieren.«
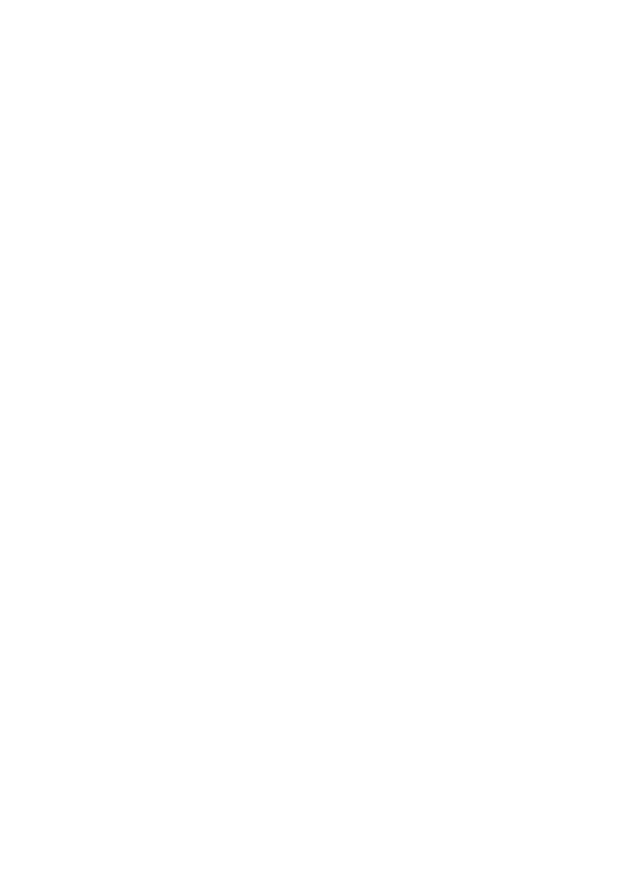
152
Nach dieser unruhigen Nacht schliefen wir ziemlich
lange. Ich bestellte telefonisch das Frühstück in unser
Zimmer. Ehe es heraufgebracht wurde, blieb mir Zeit
genug zum Duschen und Rasieren. Steve frühstückte
schrecklich verschlafen im Bett und gähnte dabei so
häufig und hingebungsvoll, als würde sie am liebsten
bis mittags liegenbleiben. Ich entschloß mich daher,
allein zur Bank zu gehen, wickelte die Brille in einige
Bogen Seidenpapier und tat das Päckchen in einen
Briefumschlag, den ich dann in die Tasche steckte.
Nachdem ich die Jalousie vor der Balkontür herunter-
gelassen und verriegelt hatte, bat ich Steve, für einen
Moment aus dem Bett zu kommen und hinter mir die
Zimmertür abzuschließen.
»Und mache für niemanden auf«, schärfte ich ihr
ein. »Ich bleibe nicht lange fort - eine halbe Stunde
vielleicht.«
Wie sich herausstellte, sollte es bedeutend länger
dauern, bis ich mein Vorhaben ausgeführt hatte. Auf
dem Weg zur Filiale von Lloyds Bank lockte mich das
Schaufenster eines Optikers an. Da ich mich verge-
wissert hatte, daß ich nicht verfolgt oder beobachtet
wurde, betrat ich, ohne zu zögern, das Geschäft.
Ein langer ausgemergelter Mann mit spärlichem
weißem Haar hockte hinter einer Glaswand an einem
Arbeitstisch, eine Optikerlupe ins linke Auge ge-
klemmt, und untersuchte etwas.
Bei meinem Erscheinen stand er mühsam auf und
kam mit winzigen Schritten hinter seinen Ladentisch.

153
»Ich möchte ein Brillenetui kaufen«, sagte ich.
»Sehschärfeuntersuchung?« krächzte er und ver-
drehte seltsam die Augen. Da er sich gleichzeitig die
rechte Hand hinters Ohr hielt, begriff ich, daß er sehr
schwerhörig war.
Aus irgendeinem unerfindlichen Grund antwortete
ich sehr laut: »Ja, bitte.«
Er blickte etwas glücklicher drein und begab sich
zu einer Kabine mit den bekannten Buchstabentafeln
und sonstigen Utensilien für eine Sehschärfeprüfung.
»Diesen Weg, bitte, Sir.«
Er knipste die Beleuchtung in der Kabine an und
zog einen dunklen Vorhang herunter, der uns von der
Außenwelt abschloß. Ich mußte die Reihen verschie-
dener Buchstaben von den Tafeln ablesen und zum
Schluß auf den leuchtendroten Punkt und die zwei
parallelen Linien gucken, die sich so schrecklich
gerne vereinen möchten.
»Ja«, erklärte er ernst, als die Prozedur vorüber
war, »Sie hätten es sehr nötig, eine Brille zu tragen.«
»Ich habe befürchtet, daß Sie dies sagen würden«,
antwortete ich traurig, obwohl glücklicherweise an
meiner Sehschärfe nichts auszusetzen ist.
»Es wird einige Tage dauern, sie anzufertigen.
Können Sie, nun, sagen wir, am Dienstag wieder-
kommen?«
»Ich fürchte, nein. Ich bin nur auf der Durchreise
hier, aber mir war in Paris sehr empfohlen worden,
Sie zu konsultieren. Stellen Sie mir bitte das Brillen-

154
rezept aus.«
Er brauchte eine Minute, um es zu begreifen, war
dann aber sehr geschmeichelt über die Empfehlung
aus Paris und schrieb einige Zahlen auf einen Notiz-
zettel mit Firmenaufdruck. Als er mir den Zettel
überreichte, lächelte er sogar.
»Wieviel schulde ich Ihnen?«
»Zwei tunesische Dinar.«
»Sehr wohlfeil für diesen Preis«, lobte ich und
meinte es auch. »Ich werde Sie ebenfalls weiteremp-
fehlen.«
Nun war er so glücklich, daß er zur Tür mitkam
und mich hinausdienerte.
Beim Betreten der Filiale von Lloyds Bank war
mir, als sei das ganze Tunis eine Illusion, die in dem
Moment versank, als ich dieses Portal durchschritt.
Die Filiale hatte eine undefinierbar englische Atmo-
sphäre und erinnerte mich sehr stark an die Londoner
Filiale von Lloyds, bei der ich Kunde bin. Der rundli-
che, lächelnde Mann im korrekten grauen Cut, der
mich durch sein Schalterfenster begrüßte, gab mir ein
Gefühl vollkommener Geborgenheit, und als ich ihm
erklärte, ich sei in London ein Kunde von Lloyds, war
er ohne weiteres bereit, mein Päckchen in die Stahl-
kammer zu nehmen.
Mir war beträchtlich leichter zumute, als ich wieder
auf die Straße hinaustrat. Die schwache Wölbung
meiner Brusttasche, von der ich nun befreit war, hatte

155
für mich nach und nach die Bedeutung einer Zeit-
bombe bekommen, die jeden Moment explodieren
konnte.
Ich ließ mich von einem Taxi zum Hotel fahren. Ich
hatte Steve gesagt, daß ich in einer halben Stunde
wieder da wäre, aber mittlerweile war fast eine Stunde
vergangen. Im Hotelfoyer hielt ich die Augen offen,
entdeckte jedoch weder Audry Bryce noch irgendei-
nen Mann, der die geringste Ähnlichkeit mit Rostand
gehabt hätte.
Als ich an die Tür unserer Suite klopfte, blieb alles
still. Ich versuchte die Türklinke, und die Tür ging
auf.
»Steve!«
Keine Antwort aus dem Badezimmer. Dann be-
merkte ich ein Blatt Papier auf dem Tisch.
›Mochte nicht länger warten. Gehe mir tunesische
Lederpantoffel kaufen. Treffe dich um elf auf der
Hotelterrasse.‹
»Nicht ganz richtig«, murmelte ich und sah auf die
Uhr. Drei Minuten vor elf.
Ich verließ das Zimmer und ließ den Schlüssel an
der Innenseite der Tür stecken. Falls jemand unsere
Sachen zu durchsuchen wünschte, würde es für alle
Betroffenen angenehmer sein, wenn das Türschloß
nicht erst aufgebrochen werden mußte.
Im Vorbeigehen klopfte ich an Audry Bryces Tür.
Niemand antwortete. Da ich eben im Lift die Gesell-
schaft einer unverschleierten, vielleicht fünfzehnjähri-

156
gen Araberin genossen hatte, die entwickelter war als
manche Engländerin von Anfang Zwanzig und mich
unangenehm herausfordernd anstarrte, benutzte ich
dieses Mal lieber die Treppe zum Hotelfoyer.
»Haben Sie meine Frau hereinkommen sehen?«
fragte ich den Mann am Empfang.
»Nein, Mr. Temple. Mrs. Temple ist noch nicht
zurück.«
»Sie sahen sie also fortgehen?«
»Ja, Mr. Temple. Vor etwa zwanzig Minuten.«
»War sie allein?«
»Ja, Mr. Temple.«
Unmittelbar neben mir wurde eine schwere Akten-
mappe recht nachdrücklich auf den Empfangstisch
gestellt, und eine Männerstimme sagte in steifem
Französisch: »Ich glaube, Sie haben eine Anmeldung
für mich. Der Name ist Schultz.«
Ich schaute zur Seite und erblickte das blonde
Haupt und die athletischen Schultern des Nachtclub-
besitzers aus Algier.
»Hallo«, sagte ich auf englisch, »Sie scheinen he-
rumzukommen.«
»Pardon, Monsieur?«
»Vielleicht erinnern Sie sich nicht an mich. Ich traf
Sie neulich abends in Ihrem Club in Algier.«
»Entschuldigen Sie«, erwiderte Schultz, jetzt auf
englisch. »Ich habe so viele Gäste, ich kann mich
unmöglich an jeden erinnern.«
»Sicher erinnern Sie sich an den Polizeiinspektor,

157
der Interesse für Ihren Freund, den Colonel Rostand,
bekundete.«
»Ich glaube, Sie wünschten jemanden zu finden -
einen Mr. Constantin. Hatten Sie Erfolg?«
»Nein. Leider fand ich ihn damals nicht und habe
ihn seither nicht mehr gesehen. Ein Jammer, da ich
gehofft hatte, wir könnten sehr einträgliche Geschäfte
miteinander machen.«
Schultz nickte flüchtig und murmelte, das Gesicht
schon halb dem Empfangschef zugewandt: »Ent-
schuldigen Sie mich, bitte. Es war sehr nett, Sie
wiederzusehen.«
»Sie haben auch hier einen Club, nicht wahr?«
fragte ich beharrlich. »Ich möchte meine Frau dorthin
führen. Wie heißt Ihr Club?«
»›Le Trou du Diable‹ - ›Die Teufelshöhle‹, Sir. Er
ist draußen in Sidi bou Said.«
»Vielleicht sehe ich Sie dann dort.«
Schultz zuckte unverbindlich die Achseln und
nahm keine weitere Notiz von mir.
Die Hotelterrasse erfreute sich um diese Tageszeit
nur weniger Besucher, obwohl sie schattig und
verhältnismäßig kühl war. Steve hatte sich noch nicht
eingestellt. Ich wählte einen Tisch, von dem ich zu der
Tür sehen konnte, durch die sie kommen würde.
Nachdem ich einen schwarzen Kaffee und ein Glas
Eiswasser bestellt hatte, zündete ich mir die zweite
Zigarette des Tages an.
Ich drückte den Rest der Zigarette in den Aschen-

158
becher, als ein Erstrahlen lebhafter Farben meinen
Blick auf die Tür zum Hotelfoyer lenkte. Dort stand
Simone Lalange in der Haltung einer Ballerina und
schaute umher. Sie trug eine purpurrote Bluse und
einen weiten weißen Rock. Ihre Arme und Schultern
waren bronzefarben. Sie sah mich, winkte flüchtig
und kam mit graziöser Eleganz zu meinem Tisch. Ihre
Taille war sehr schlank; ihr Rock bewegte sich
anmutig im Rhythmus ihrer Schritte.
Ich stand auf, um sie zu begrüßen, aber sie ließ sich
uneingeladen in ein Sesselchen neben dem meinen
sinken.
»Welche Freude, Ihnen wieder zu begegnen!« rief
sie aus, anscheinend völlig aufrichtig. »Mrs. Temple
ist nicht hier?«
»Ich warte eben auf sie. Sie ist einkaufen gegangen.
Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Kaffee oder
einen Aperitif?«
Sie spitzte nachdenklich die Lippen.
»Vielleicht einen Fruchtsaft. Orange, wenn man das
hier hat.«
Ich winkte dem Kellner und bestellte. Simone La-
lange lehnte lächelnd ab, als ich ihr eine Zigarette
anbot, und nahm das goldene Etui aus ihrer Handta-
sche.
»Ich bevorzuge meine eigenen.«
Ich sah zu, wie sie eine ihrer Zigaretten in der ele-
ganten Spitze befestigte und die Spitze zwischen die
Lippen nahm. Feuer reichte ich ihr nicht. Ich wollte

159
die Initialen auf ihrem Zündholzbriefchen sehen. Sie
warf das Briefchen nach dem Anzünden achtlos auf
den Tisch, wo es mit den Initialen S.L. nach oben
liegenblieb. Als ich aufblickte, fand ich ihre Augen
ironisch auf mich gerichtet. Sie war in der Tat eine
sehr attraktive Frau und sich dessen durchaus bewußt.
»Gefällt es Ihnen in Tunis, Mr. Temple?«
»Abgesehen von zwei kleineren Pannen recht gut,
danke sehr. Ich bin überrascht, Tony Wyse nicht bei
Ihnen zu sehen.«
»Oh, er?« Simone zuckte ein wenig die Schultern.
»Er ist ein ganz netter Junge, aber er kann einem
zuviel werden. Ich ließ ihn lieblos abblitzen, wie man
so sagt.«
»Er erbot sich, uns Tunis zu zeigen, doch haben wir
ihn noch gar nicht gesehen. Wissen Sie, wo er
wohnt?«
»Er sagte, er würde im Hotel Mimosa wohnen. Ich
nehme an, er hat geschäftlich viel zu tun. Das dürfte
der Grund sein, weshalb er sich noch nicht sehen
ließ.«
»Ich denke, wir werden ohne ihn auskommen«,
entgegnete ich leichthin. »Wir haben uns die Dienste
eines Fremdenführers gesichert - eines Mr. Patrick
O'Halloran.«
Simone Lalange lehnte sich zurück, da ihr der
Kellner den Orangensaft servierte. Sie hatte nicht das
geringste Interesse an meiner Mitteilung gezeigt.
Nicht einmal ihre langen künstlichen Augenwimpern

160
waren in Bewegung geraten.
Ich sagte: »Ich sah Mr. Schultz, als er hier im Hotel
eintraf. Sind Sie ihm zufällig begegnet, als Sie
kamen?«
Der Trinkhalm des eisbeschlagenen Glases war
bereits zwischen ihren Lippen. Sie blickte mich aus
unschuldigen Augen an.
»Mr. Schultz? Wer ist das? Sollte ich ihn kennen?«
»Der Eigentümer des ›El Passaro‹. Haben Sie unse-
ren Tanz dort vergessen?«
Das war eine Bemerkung, die Steve mir gewiß
mehr als einmal vorgehalten hätte. Simone warf mir
einen Seitenblick zu. Sie war sehr verführerisch, als
sie so lässig dasaß und mit sanft gespitzten Lippen
durch ihren Strohhalm trank.
Dann neigte sie sich nach vorn, um das halbgeleerte
Glas auf den Tisch zu setzen, und antwortete: »Ich
habe das nicht vergessen. Ich frage mich, ob wir nicht
eines Tages wieder miteinander tanzen können. Es
war so kurz - finden Sie das nicht auch?«
»Simone«, sagte ich und hoffte, daß meine Stimme
nicht zu eindringlich klang. »Als damals die Lichter
ausgingen - haben Sie da die Brille aus meiner
Brusttasche gezogen und dann in die Handtasche
meiner Frau gesteckt?«
Simones klingendes Lachen ließ alle Gäste in unse-
re Richtung schauen.
»Das trauen Sie mir zu? Weshalb sollte ich etwas
so Albernes getan haben?«

161
»Das weiß ich nicht. Ich hatte gehofft, vielleicht
würden Sie es mir sagen.«
»Oh, glauben Sie, ich versuche Unklarheiten zwi-
schen einem Mann und seiner Frau zu stiften?«
»Nein, das glaube ich nicht.«
»Mr. Temple, warum sehen Sie fortwährend auf
Ihre Uhr? Langweile ich Sie so sehr?«
»Entschuldigen Sie bitte. Es ist nur, weil meine
Frau angekündigt hat, sie würde um elf Uhr hier sein,
und jetzt ist es schon Viertel vor zwölf.«
»Nun, eine Frau vergißt manchmal die Zeit, wenn
sie Einkäufe macht. Ich will versuchen, Sie sehr gut
zu unterhalten, bis Ihre Frau kommt.«
Das tat sie während der nächsten Viertelstunde
wirklich. Es ist äußerst amüsant, sich von einer so
reizvollen und obendrein intelligenten Frau, die in
diesen Künsten erfahren ist, mit neckendem Geplau-
der die Zeit vertreiben zu lassen. Trotz meiner Unruhe
über Steves Ausbleiben mußte ich Simones Voll-
kommenheit bewundern. Schließlich schenkte sie mir
ein etwas schiefes Lächeln und rüstete sich zum
Gehen.
»Unsere Unterhaltung hat mir Freude gemacht. Ich
denke, Mrs. Temple ist eine glückliche Frau.«
»Warum meinen Sie das?«
»Weil sie einen so unerschütterlich getreuen Mann
hat.«
Ich versuchte in meinem Abschiedslächeln anzu-
deuten, daß ich wünschte, manches hätte anders sein

162
können. Es war fünf nach zwölf, als Simone im Hotel
verschwand. Meine Unruhe wuchs. Steve konnte sich
dreißig oder sogar fünfundvierzig Minuten verspäten,
aber niemals über eine Stunde.
Ich wußte plötzlich, wohin sie gegangen sein mochte.
Nachdem ich am Empfang die Nachricht hinterlassen
hatte, sie möge in unserer Suite auf mich warten, falls
sie käme, solange ich fort sei, eilte ich hinaus auf die
Straße und nahm mir ein eben freigewordenes Taxi.
»Fahren Sie mich zum ›Haus künstlerischer Raritä-
ten‹, Avenue Mirabar, Nummer zwei-zwei-sieben.«

163
7
Die Avenue Mirabar erwies sich als locker bebaute,
lange Straße, am Rand des Araberviertels. Das ›Haus
künstlerischer Raritäten‹ stand an einer Ecke, von wo
eine schmale, lärmerfüllte Gasse sich in das Gewirr
winziger Straßen verlor, das wir am vorigen Abend
bei unserer Droschkenfahrt mit neugierigen, aber
nicht allzu entzückten Blicken gestreift hatten. Es war
eine mit der Patina des Exotischen überhauchte
Altwarenhandlung, vollgestopft mit Krimskrams von
überallher zwischen Timbuktu und Stratford upon
Avon. Ich ließ das Taxi warten, während ich zu der
Glastür ging und hineinspähte, im stillen hoffend, ich
würde Steve sehen, eifrig mit einem eingeborenen
Handelsmann feilschend, um einen Preisnachlaß von
zwanzig Prozent für irgendeinen ziemlich zwecklosen
Gegenstand zu erkämpfen. Aber das Geschäft war leer
von Kunden und Verkaufspersonal. Entmutigt machte
ich die Tür auf. Über mir ertönte ein kleines Glocken-
spiel. Fast unmittelbar danach teilte sich ein Perlen-
vorhang im Hintergrund des Ladens, und ein Mann
erschien, von dem ich instinktiv wußte, daß er Szoltan
Gupte wäre, was sich übrigens schnell als richtig
erwies.
Er wirkte wie ein anthropologisches Kuriosum. Auf
den ersten Blick hielt ich ihn für einen Ägypter, dann
für einen Inder, schließlich für einen Perser. Tatsäch-
lich war er, wie ich später erfuhr, halb Türke, halb

164
Armenier. Im übrigen sprach er fließend ein Dutzend
Sprachen. Englisch war eine davon. Er warf mir einen
unangenehm verschlagenen Blick zu und erkannte
sofort meine Nationalität.
»Guten Morgen, Sir. Wünschen Sie irgend etwas
Spezielles zu sehen?«
»Eigentlich bin ich hierhergekommen, um meine
Frau zu finden. War heute vormittag eine Engländerin
hier? Ich weiß leider nicht, was sie angehabt haben
könnte, aber sie ist dunkelhaarig und dürfte sich für
tunesische Lederpantoffeln interessiert haben...«
Szoltan Gupte schüttelte, bereits während ich
sprach, mehrmals entschieden den Kopf.
»Leider hat mir heute vormittag noch keine engli-
sche Lady die Ehre gegeben, Sir. Möchten Sie sich ein
wenig umschauen, während Sie warten?«
In Guptes Art lag irgend etwas Reserviertes, als
wisse er, daß dies nur ein Eröffnungsgeplänkel wäre.
Ich beschloß direkt zur Sache zu kommen, holte die
Karte heraus, die O'Halloran uns gegeben hatte, und
überreichte sie Gupte, wobei ich die Rückseite wie
aus Versehen nach oben drehte.
»Ein Mann, der sich als Ihr Spezialvertreter be-
zeichnete, empfahl uns den Besuch Ihres Geschäfts.
Sein Name steht auf der Karte.«
Szoltan Gupte zeigte keine Überraschung. Er besah
sich nur die Zeichnung auf der Rückseite der Karte
und steckte die Karte ein.
»Ihr Name ist Temple?«

165
»Ja.«
Er nickte, spitzte die Lippen und studierte eine
halbe Sekunde lang mein Gesicht. Dann drehte er sich
um und machte eine einladende Handbewegung.
»Kommen Sie hier entlang, bitte. Ein Freund von
Ihnen ist da.«
Er ging mir voraus hinter den Ladentisch und hielt
den Perlenvorhang für mich offen. Ich habe grund-
sätzlich etwas dagegen, an einem fremden Mann
vorbei einen unbekannten Durchgang zu passieren,
denn dies ist eine der einfachsten Methoden, einen
Schlag auf den Hinterkopf zu beziehen. Aber Steves
Sicherheit galt mir mehr als meine eigene. Ich
schlüpfte durch den Perlenvorhang und kam in einen
engen Korridor. Dumpfe Luft schlug mir entgegen.
»Die Tür geradeaus.«
Ich ging zur Tür und öffnete sie. Sie führte in ein
mit fabelhaftem orientalischem Luxus ausgestattetes
Zimmer. Die Wände waren mit schwerer, kostbarer
Seide bespannt. Den Boden bedeckten prachtvolle
persische und ägyptische Teppiche. Wunderbar
gemusterte, edle Kelims und farbenfrohe Kissen
schmückten die Diwane. Die Möbel aus feinem Holz
waren von fast viktorianischem Pomp. Räucherkerzen
erfüllten die Luft mit schwerem süßlichem Geruch.
Der Mann, der mir aus einem Sessel im Hinter-
grund des Zimmers entgegenblickte, paßte nicht in
dieses Milieu, aber seine Lebensgeister schienen in
keiner Weise gedämpft.

166
»Ah, da sind Sie nun endlich! Ich hätte Sie beinah
als Niete abgeschrieben.«
Es dauerte einige Sekunden, bis ich meine Stimme
wiederfand. Hinter mir hörte ich Szoltan Gupte leise
lachen, als er behutsam die Zimmertür schloß.
»O'Halloran! Ich hielt Sie für tot. Die Polizei sagte
mir, Sie wären ermordet worden. Anfänglich glaubte
ich sogar, man hielt mich für den Mörder.«
O'Halloran knallte die flachen Hände auf seine
Oberschenkel und krümmte sich vor Lachen.
»Bring dem Gentleman ein Glas, Freund!« sagte er
zu Gupte, nachdem er wieder zu Atem gekommen
war. »Das muß begossen werden!«
Gupte öffnete die Tür eines Wandschranks, der
etliche Reihen verschiedenartiger Flaschen enthielt,
und holte ein Glas heraus. Die Whiskyflasche und ein
Sodasiphon standen bereits auf einem Tischchen in
O'Hallorans Reichweite. Übrigens trug der kleine Ire
jetzt einen recht gut passenden Anzug, wie ich
verwundert feststellte.
O'Halloran, der meinen erstaunten Blick bemerkte,
sagte amüsiert: »Sie finden, daß ich erheblich besser
gekleidet bin als gestern - nicht wahr, Mr. Temple?
Na, wenn Sie je den Wunsch haben, zu verschwinden,
könnte ich Ihnen hier in Tunis nur empfehlen, sich
›ermorden‹ zu lassen. Dazu besorgen Sie sich einfach
eine Leiche von ungefähr der richtigen Größe, Gestalt,
Haut- und Haarfarbe, versehen sie mit Ihrer Kleidung
und Ihrer Brieftasche, und den Rest erledigt, der

167
Himmel segne sie, die löbliche Polizei.«
»Sagen Sie, wieviel«, unterbrach Szoltan Guptes
ruhige Stimme.
»Nur wenig Whisky und die doppelte Menge So-
dawasser«, entgegnete ich und wandte mich wieder an
O'Halloran.
»Ich nehme an, es ist nicht schwer, im Arabervier-
tel eine Leiche zu bekommen - nach dem zu urteilen,
was ich gestern abend dort sah.«
»Zwei für einen Penny«, bestätigte O'Halloran
glücklich. »Und wenn Sie dann ins Leben zurückzu-
kehren wünschen, brauchen Sie nur zur Polizei zu
gehen und zu sagen, Sie seien beraubt worden.«
Mich interessierte sehr, was O'Halloran zu diesem
komplizierten Manöver veranlaßt hatte, doch zuerst
mußte ich ihn etwas anderes fragen.
»O'Halloran, wissen Sie etwas über den gegenwär-
tigen Aufenthalt meiner Frau? Ich habe guten Grund
zu der Annahme, daß sie beabsichtigte, heute vormit-
tag hierherzukommen.«
»Wie könnte ich etwas darüber wissen, da ich die-
ses Zimmer seit gestern abend nicht verlassen habe?
War sie in deinem Geschäft, Freund Szoltan?«
»Ich habe Mr. Temple bereits gesagt, daß seine
Frau nicht hier war.«
»Vielleicht kommt sie noch«, meinte O'Halloran
und verließ das Thema. »Warum setzen Sie sich nicht,
Mr. Temple? Ich denke, Sie haben Anspruch auf eine
Erklärung von mir.«

168
Szoltan Gupte schob einen Sessel für mich zurecht.
Ich setzte mich, lehnte aber eine Zigarette ab, die er
mir anbot.
O'Halloran sagte: »Ich wollte Sie gerne hierher-
kommen lassen, Mr. Temple, weil Sie etwas haben,
was ich von Ihnen erhalten möchte, ohne daß jemand
anders davon erfährt.«
»Und was wäre das?«
»Ich denke, Sie wissen es bereits. Es ist die Brille,
die einem gewissen Mr. David Foster gehört.«
»Ach so.«
O'Halloran war völlig offen.
»Haben Sie sie bei sich, Mr. Temple?«
»Ich muß Sie enttäuschen, Mr. O'Halloran.«
»Aber sie befindet sich noch in Ihrem Besitz?«
»Ich weiß, wo sie ist, und daß niemand außer mir
sie bekommen kann. Warum sind Sie daran interes-
siert?«
»Weil ich sie so gerne ihrem rechtmäßigen Eigen-
tümer übergeben möchte.«
O'Halloran blickte mich sehnsüchtig an und drehte
dabei sein Whiskyglas zwischen den Handflächen.
Szoltan Gupte hatte sich in die Nähe der Tür zurück-
gezogen.
»Warum bemüht sich dieser Mr. David Foster nicht
selbst zu mir, um seine Brille abzuholen?«
»Ach, ach, ach!« jammerte O'Halloran. »Das ist ja
das Kreuz bei der Sache! Sie wundern sich natürlich,
warum Sie Foster nie gesehen haben, warum er Sie

169
nicht beim Flughafen erwartet hat - nicht wahr?«
»Ja, darüber wundere ich mich.«
»Nun, die Erklärung ist einfach. Ich darf mich rüh-
men, David Fosters vertrautester Freund zu sein, und
kann Ihnen alles darüber sagen. Die betrübliche
Tatsache ist, daß er von der Polizei gesucht wird.«
O'Halloran machte diese Offenbarung mit beinah
ehrfurchtsvoller Stimme, um sie besonders glaubwür-
dig klingen zu lassen.
Anscheinend gelang es mir nicht, eine gewisse
Skepsis aus meinem Blick zu verbannen. Jedenfalls
fügte O'Halloran schnell und in wahrhaft beschwö-
renden Tönen hinzu: »Ja, von der Polizei wird der
arme David gesucht! Und dazu wegen einer Sache,
mit der er überhaupt nichts zu tun hatte! Sie können
ermessen, was das bedeutet, Mr. Temple! Insbesonde-
re für einen Mann, der so rührig und vielbeschäftigt
ist wie er und jetzt untätig in einem Zimmer versteckt
sitzen muß, denn sobald er auch nur die Nase zur Tür
hinaussteckt, würde die Polizei ihn fassen! Er könnte
sich die Zeit mit Lesen vertreiben, werden Sie sagen,
könnte sein Wissen erweitern. Aber wie soll er lesen,
wenn er seine Brille nicht hat? Möchten Sie mir das
verraten? Ohne die Brille ist er blind wie ein Maul-
wurf, der arme Dave! Ein jammervoller Anblick, das
kann ich Ihnen sagen!«
Patrick O'Halloran war von seiner Deklamation
weit ergriffener als ich. In seinen Augen schimmerten
echte Tränen. Ich leerte mein Glas und stand auf.

170
»Sie müssen sich etwas Besseres einfallen lassen,
Mr. O'Halloran. Ich glaube Ihnen kein Wort.«
Wenn Blicke töten könnten, wäre ich jetzt unter
dem Blick des kleinen Iren leblos zu Boden gesunken.
»Bah!« fauchte er. »Manche Leute haben keinen
Anstand im Leibe!«
Szoltan Gupte kam langsam und geräuschlos her-
bei. Er hatte die ganze Zeit lächelnd zugehört.
»Pat liebt seine kleinen Scherze, Mr. Temple. Ich
denke, im Grunde genommen verstehen wir einander
recht gut. Sie sagen, Sie hätten die Brille nicht bei
sich?«
»Wie könnte ich sie mit mir herumtragen, wenn sie
zehntausend Pfund wert ist?«
O'Halloran sprang auf und ließ dabei sein leeres
Whiskyglas zu Boden fallen.
»Zehntausend Pfund? Wie kommen Sie denn dar-
auf?«
»Dieses Angebot hat mir ein Monsieur Constantin
gemacht.«
O'Halloran und Gupte wechselten einen Blick.
»Sie kennen ihn also?« fragte ich.
»Ich hörte von ihm«, gab Gupte vorsichtig zu.
»Hörten Sie auch, daß er ermordet wurde? Ich mei-
ne, richtig ermordet - nicht so, wie unser Freund
Halloran. Ich habe seine Leiche gesehen.«
»Davon weiß ich nichts.« Die einzige Veränderung
an Szoltan Gupte war, daß er etwas schneller zu
atmen begann und daß Schweißtröpfchen auf seiner

171
Stirn erschienen. »Wann ist das geschehen?«
»Vorgestern abend, in Algier.«
»Weiß die Polizei, wer es getan hat?«
»Ja. Es war ein Mann, bekannt als Colonel Ros-
tand, unterstützt von einem Komplicen namens Sam
Leyland.«
»Rostand, sagten Sie? Wie war der andere Name?«
»Sam Leyland, ein englischer Name. Kennen Sie
ihn nicht?«
»Nein.« Gupte schüttelte den Kopf. »Diesen Colo-
nel Rostand auch nicht. Ist er ein Franzose?«
»Vielleicht Franzose, vielleicht Amerikaner. Er
spricht beide Sprachen.«
Gupte wandte sich an O'Halloran: »Sagen dir diese
Namen etwas, Pat?«
O'Halloran schüttelte den Kopf. Er grollte mir
noch. Szoltan Gupte schien nachzudenken. Ich war
sicher, daß er mir gleich einen Vorschlag machen
würde, und wartete.
Da sagte er auch schon: »Wenn wir Ihnen den rich-
tigen David Foster vorstellen würden, Mr. Temple,
nehme ich an, daß Sie bereit wären, ihm die Brille zu
übergeben. Wie hoch ist Ihr Preis hierfür?«
»Warum sollte ich einen Preis haben? Sofern er
seine Identität beweisen kann, bekommt er seine
Brille, und es kostet ihn keinen Penny.«
»Je eher wir dies arrangieren können, um so besser
also!« Gupte rieb sich die Hände und starrte suggestiv
zu O'Halloran.

172
In diesem Moment erklang aus dem Laden das
Glockenspiel über der Eingangstür. Gupte entschul-
digte sich und ging hinaus.
»Wie wär's mit heute abend, Mr. Temple?« fragte
O'Halloran. »Hätten Sie Zeit?«
»Etwas früher wäre mir lieber.«
»Das ist unmöglich, fürchte ich. Wir müssen bis zur
Dunkelheit warten. Oder kurz davor.«
»Also etwa sieben Uhr. Wo soll ich Sie treffen?«
O'Halloran überlegte. »Kennen Sie Khérédine?«
»Die schmale Landzunge vor der inneren Bucht
von Tunis?«
»Ja. Wo die Docks und die Anlegestellen der Schif-
fe sind. Dort hat ein Mann namens Durant einen
Bootsplatz. Sein Haus liegt neben dem Hotel du Port.
Ich werde Sie heute abend um sieben Uhr dort erwar-
ten, verläßlich.«
Szoltan Gupte kam wieder herein.
»Es ist Ihr Taxifahrer, Mr. Temple. Er weiß nicht,
ob er noch warten soll.«
»Sagen Sie ihm bitte, ich käme gleich. - Ist nun
alles klar, O'Halloran? Keine Verschwindetricks
mehr?«
»Bei allem, was mir heilig ist! Oh, und Mr. Temple -«
Ich blieb an der Tür stehen und blickte zurück.
O'Halloran grinste mir verschwörerisch zu und
murmelte: »Sie verraten aber der Polizei nichts davon,
daß ich nicht ermordet worden bin - ja? Wir mögen
uns gegenseitig nicht, ich und die Polizei. Ich habe

173
meinen kleinen Spaß daran, wenn sie sich ein wenig
zum Narren macht.«
»Keine Sorge, O'Halloran. Soweit es mich betrifft,
sind Sie ein totes Kaninchen.«
Als ich durch den Korridor ging, hörte ich hinter
mir sein beglücktes Gekicher.
Es war Viertel vor zwei, als ich unser Hotel wieder
betrat. Vier Stunden waren vergangen, seit ich Steve
zuletzt gesehen hatte.
Der Mann am Empfang zeigte einen etwas ironi-
schen Ausdruck, als er mein sorgenvolles Gesicht
bemerkte. Offenbar hielt er mich für einen Gatten, der
seine Frau bei einem Nebenbuhler wähnt.
»Ist Mrs. Temple zurückgekommen?«
»Nein, Mr. Temple.«
»Sind Sie dessen sicher?«
»Ja, Mr. Temple. Durch das Foyer ist Mrs. Temple
jedenfalls nicht gekommen. Ich habe den Portier und
die Pagen beauftragt, Mrs. Temple zur Rezeption zu
bitten.«
»War auch sonst keine Nachricht?«
»Doch, Mr. Temple. Kommissar Renouk telefonier-
te. Sie möchten sich bitte mit ihm in Verbindung
setzen, sobald Sie zurückkämen.«
»Aber keine Nachricht von Mrs. Temple?«
»Leider nichts von Mrs. Temple. Gar nichts.«
»Vielleicht ist sie in unserer Suite«, sagte ich und
wollte mich abwenden.

174
»Ihr Schlüssel, Mr. Temple«, mahnte der Emp-
fangsportier.
»Den habe ich doch in der Tür gelassen.«
»Das Zimmermädchen brachte ihn herunter, nach-
dem es Ihre Suite aufgeräumt hatte, Mr. Temple.«
Er gab mir den Schlüssel. Obwohl dies bestätigte,
daß Steve nicht zurückgekommen war, fuhr ich zu
unserer Suite hinauf. Die Betten waren gemacht, die
Teppiche abgekehrt, alles war untadelig aufgeräumt,
nicht einmal der Zettel mit Steves Nachricht hatte
Gnade vor den Augen des pflichtbewußten Zimmer-
mädchens gefunden. Im übrigen hegte ich kaum
Zweifel, daß die Nachricht echt gewesen war; nie-
mand hier im Hotel hätte Steves vertraute Handschrift
so vollendet fälschen können. Sie hatte also das Hotel
aus eigenem Entschluß verlassen; was immer ihr
zugestoßen sein mochte, es mußte außerhalb des
Hotels geschehen sein.
Die Suite war schrecklich leer ohne Steve. Hätte ich
bloß darauf verzichtet, allein zu Lloyds Bank zu
gehen...
Ich stoppte diesen Gedankengang abrupt. Dadurch,
daß ich anfing, mich selbst zu tadeln, war nichts
ungeschehen zu machen. Mehr denn je galt es jetzt,
klar zu denken. Appetit hatte ich begreiflicherweise
nicht, aber in psychischer wie in physischer Hinsicht
mochten mir schwere Belastungen bevorstehen, denen
ich lieber nicht mit leerem Magen begegnen sollte. Ich
fuhr also hinab ins Foyer, ging in den um diese Stunde

175
kaum noch besetzten Speisesaal und bestellte mir ein
Omelett mit Ragoutfüllung.
Während ich auf das Essen wartete, versuchte ich
meine Gedanken zu ordnen. Natürlich war es möglich,
daß Steve einen Unfall gehabt hatte oder plötzlich
erkrankt war. Aber das konnte ich nicht recht glauben;
sie trug ihren Paß bei sich, und gegebenenfalls wäre
es der Polizei oder einem Krankenhaus mittlerweile
bestimmt gelungen, das Hotel zu benachrichtigen. Die
offensichtliche Erklärung war, daß man sie irgendwo
als Geisel festhielt, um mich zur Herausgabe der
Brille zu bewegen. Aber warum hatte ich dann noch
keine Drohbotschaft erhalten? Ich mußte plötzlich
daran denken, daß ich zu Steve gesagt hatte, ich
würde O'Halloran schmoren lassen. Jetzt saß ich
selbst wie auf glühenden Kohlen.
Wer mochte Steves Entführung organisiert haben?
Ich glaubte ziemlich sicher zu sein, daß Szoltan Gupte
und O'Halloran nichts davon wußten. Dennoch
blieben genug andere Möglichkeiten. Rostand,
Leyland und Audry Bryce bildeten eine sehr verdäch-
tige Dreiergruppe. Leyland hatte bereits einen Über-
fall auf Steve verübt, und zu welchen Gewalttätigkei-
ten Rostand fähig war, wußte ich sehr gut. Aber diese
Gruppe hätte sicher Audry Bryce als Lockvogel
benutzt, und dieser gegenüber wäre Steve zweifellos
äußerst argwöhnisch gewesen.
Dann waren da Simone Lalange und Tony Wyse.
Letzterer hatte sich hier außer Sicht gehalten, und ich
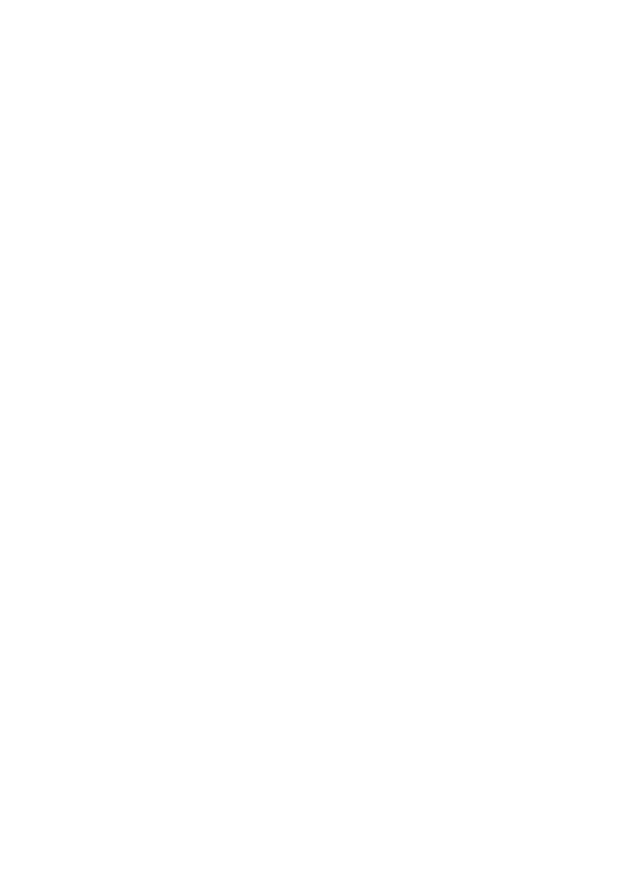
176
argwöhnte fast von Anfang an, daß er nichts Gutes im
Schilde führte. Simone war vorhin bestimmt aus
wohlberechneten Gründen auf der Hotelterrasse
erschienen. Zu dieser Zeit mußte Steve sich längst in
den Händen der Entführer befunden haben. Warum
aber hatte Simone Lalange nicht die Gelegenheit
benutzt, um den Handel zu eröffnen?
Schließlich war da noch Schultz, dessen Ankunft
im Hotel zeitlich mit Steves Verschwinden zusam-
menfiel. Vermutlich brachten ihn seine Geschäfte
regelmäßig nach Tunis, aber warum stieg er hier in
einem Hotel ab, wenn er im Vorort Sidi bou Said
einen eigenen Club hatte? Sicher bedeutete dies, daß
er mit zu Rostands Gruppe gehörte und im Hotel
Concorde Wohnung genommen hatte, um eine
Begegnung mit dem angeblichen Colonel zu tarnen -
wahrscheinlich in Audry Bryces Zimmer.
Wer immer Steve entführt haben mochte - der Um-
riß der Sache war klar. Ich hatte die Brille, die andere
Seite hatte das Teuerste, das ich auf Erden besaß.
Früher oder später würden die anderen mir den
Vorschlag zuspielen, daß wir ein Tauschgeschäft
machen könnten. Das war der Gedanke, den ich in den
kommenden Stunden allem anderen voranstellen
mußte. Solange ich die Brille hatte, würde Steve kein
Haar gekrümmt werden. Und da der Weg zu Steve
über eine Lösung des Rätsels führte, mußte ich
fortfahren, jedem Hinweis zu folgen, der sich bieten
mochte.

177
Ich unterdrückte die Versuchung, auf die Straße zu
rennen, um Taxifahrer und Ladenbesitzer nach Steve
zu fragen; das hätte mich doch nur in eine Sackgasse
geführt.
Mein Omelett schlang ich achtlos hinunter. Das
Glas Wein, das der Kellner mir eingeschenkt hatte,
blieb unberührt; statt dessen leerte ich ein kleines Glas
Eiswasser. Ich war der letzte Gast, der den Speisesaal
verließ.
Da ich in unserem Etagenkorridor niemanden sah,
klopfte ich laut an Audry Bryces Tür. Noch immer
keine Antwort. In unserer Suite verschloß ich hinter
mir die Tür und trat hinaus auf den Balkon. Ein
zufällig emporblickender Straßenpassant hätte beo-
bachten können, wie ich mich über die Trennwand
schwang und die Nachbarsuite betrat. Sie war kleiner
als unsere, enthielt nur ein Einzelbett und erwies sich
als ebenfalls makellos aufgeräumt. Ich verriegelte die
Tür von innen und durchforschte systematisch Audry
Bryces Besitztümer. Sie war offenbar gut geschult -
nirgendwo ließ sich auch nur das kleinste Stück
Papier finden. Als einzig Bemerkenswertes stellte ich
fest, daß die meisten ihrer Kleidungsstücke in einem
Pariser Modesalon geschneidert und daß die freien
Stellen der eingenähten Herstelleretiketts mit dem
handgeschriebenen Namen ›Mme. Audry Leather‹
versehen waren.
Ich entriegelte die Tür wieder, ehe ich auf dem
Weg, den ich gekommen war, in unsere Suite zurück-

178
kehrte. Dort setzte ich mich auf mein Bett, griff zum
Telefon und bat die Vermittlerin um eine Verbindung
mit Kommissar Renouks Büro im Polizeipräsidium.
Als ein Sergeant sich meldete, nannte ich meinen
Namen und verlangte Renouk zu sprechen.
»Monsieur le Commissaire ist zur Zeit nicht hier,
Mr. Temple. Er hat sich zum Essen begeben.«
Da meine Uhr Viertel vor drei zeigte, wollte ich
mich über diese ausgedehnte Mittagspause wundern,
doch fiel mir die geheiligte tunesische Siesta ein, und
ich fragte: »Wann erwarten Sie ihn zurück?«
»Gegen vier Uhr, Mr. Temple. Vielleicht -«
»Hinterläßt er nicht für etwaige dringende Angele-
genheiten eine Telefonnummer?«
»Doch, Mr. Temple, aber -«
»Dann rufen Sie ihn sofort an, und sagen Sie ihm,
daß ich ihn um drei Uhr in seinem Büro sprechen
möchte. Haben Sie mich verstanden?«
»Das - das kann ich nicht tun, Mr. Temple«, begann
der Sergeant zu stammeln. »Es ist nämlich -«
»Tun Sie, wie ich gesagt habe«, unterbrach ich und
legte energisch auf.
Als ich Punkt drei Uhr in einem Taxi beim Haupt-
eingang des Polizeipräsidiums vorfuhr, stand dort eine
lange, makellos polierte schwarze Citroen-Limousine
mit einem Fahrer am Steuer.
In der Eingangshalle empfing mich ein uniformier-
ter Polizist mit der Frage: »Sind Sie Mr. Temple?«
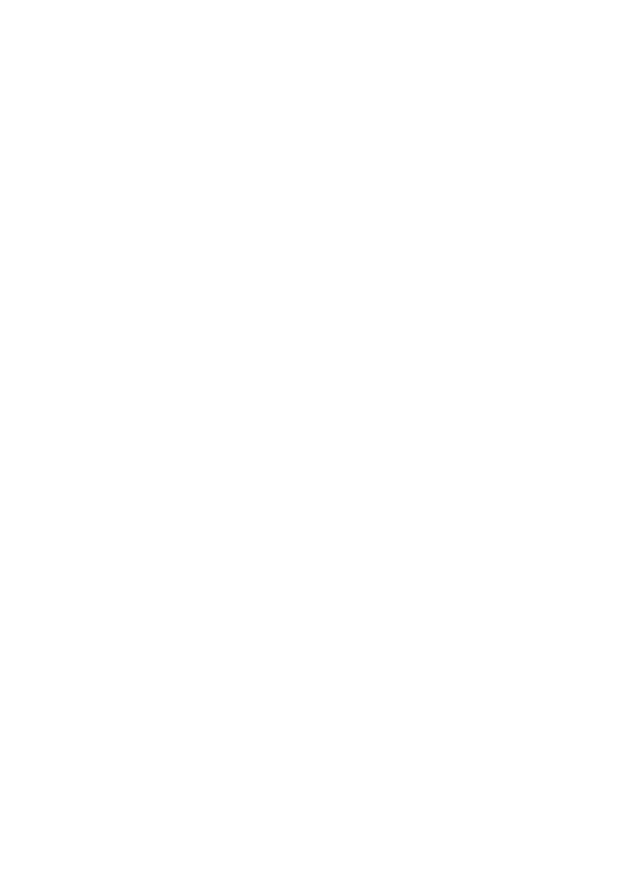
179
»Ja. Und ich wünsche Kommissar Renouk zu spre-
chen.«
»Monsieur le Commissaire hat sein Auto geschickt.
Steigen Sie ein, und der Fahrer wird Sie zu ihm
bringen, Mr. Temple.«
»Das ist sehr entgegenkommend. Ich danke Ihnen.«
Der Polizei-Citroen brachte mich mit beängstigen-
der Geschwindigkeit zu einer gartenumgebenen Villa
in einem nordöstlichen Vorort von Tunis. Ein arabi-
scher Diener in weißem Gewand öffnete mir die Tür.
»Monsieur le Commissaire erwartet Sie«, erklärte
er und geleitete mich zu einem jenseits der Vordiele
gelegenen Zimmer.
Da alle Fensterblenden geschlossen waren, fühlte
ich mich beim Eintreten blind wie ein Kinobesucher,
der erst nach Beginn des Films in den Saal kommt.
Außerdem glaubte ich durch dicke Wolken Zigarren-
rauch zu schwimmen. Nach und nach gewöhnten sich
meine Augen an das Dämmerlicht, und da mir von
irgendwoher ein »Ah, Mr. Temple!« entgegenklang,
entdeckte ich auch Renouk.
Er nahm seine Siesta ernst. In einen leichten Haus-
mantel gehüllt, das Hemd am Hals geöffnet und ohne
Krawatte, ruhte er auf einem Diwan. Auf dem Tisch-
chen daneben bemerkte ich ein kleines Likörglas. Er
stand nicht auf, winkte mich aber in einen Sessel.
»Nehmen Sie Platz, Mr. Temple, nehmen Sie Platz.
Wie ich sehe, hat man Ihnen bestellt, daß ich Sie im
Hotel zu erreichen versuchte. Möchten Sie einen sehr

180
guten Magenlikör? Nein? Dann vielleicht eine aroma-
tische kleine Verdauungszigarre? - Ja, bitte, rauchen
Sie eine Zigarette, wenn Sie das lieber mögen.«
Irgend etwas mußte geschehen sein, denn Renouk
war mir jetzt viel besser gewogen. Ich sollte bald
erfahren, warum.
»Seit wir uns zuletzt sahen, erhielt ich einige Nach-
richten von meinen Kollegen in Algier, Nizza und Paris.
Auch habe ich mit der Interpol in Paris gesprochen.«
»Sie wissen nun also alles über die seltsame Sache,
in die meine Frau und ich unwissentlich verwickelt
wurden?«
»Nun, es wäre übertrieben zu sagen, ich wüßte alles
darüber. Aber ich weiß genug, um Ihnen verraten zu
können, daß es sich um einen sehr ernsten Fall
handelt. Wirklich sehr ernst. Hohe Werte stehen auf
dem Spiel, und Sie und Ihre Frau sind in großer
Gefahr.«
»Das brauchen Sie mir nicht zu sagen. Meine Frau
verließ unser Hotel zwischen zehn und elf heute
vormittag und ist bisher nicht zurückgekehrt. Meines
Erachtens hat man sie gekidnappt.«
Renouk zuckte immerhin so erschrocken zusam-
men, daß die lange Asche seiner Zigarre zu Boden
fiel. Seine schwarzen Augenbrauen hoben sich um
Daumenbreite.
»Gekidnappt? Haben Sie irgendwelche Drohungen
erhalten?«
»Bis jetzt nicht. Ich wollte Sie bitten zu veranlas-

181
sen, daß in den Krankenhäusern nachgefragt wird. Ich
meine, für den Fall, daß -«
»Selbstverständlich«, unterbrach Renouk. »Obwohl
ich mir keinen Erfolg davon verspreche. Ich habe
erwartet, daß so etwas geschehen würde.« Er stand
auf, zog seinen Hausmantel zurecht und fuhr fort:
»Den erwähnten Nachrichten entnahm ich, daß sich in
Ihrem Besitz eine Brille befindet, mit der es eine
besondere Bewandtnis zu haben scheint.«
»Tatsache ist, daß wir nichts als Unannehmlichkei-
ten hatten, seitdem uns diese Brille übergeben wurde.
Aber Ihre Kollegen in Nizza und in Algier schienen
überzeugt, daß an der Brille nichts Besonderes wäre.«
»Diese Ansicht ist revidiert worden. Die Brille soll
nochmals untersucht werden. Daher möchte ich Sie
bitten, sie mir zu übergeben.«
»Leider habe ich sie nicht bei mir«, sagte ich zum
zweitenmal an diesem Tag.
»Dann werden sie wohl so freundlich sein, sie zu
holen. Mein Fahrer bringt Sie zu Ihrem Hotel.«
»Die Brille ist nicht im Hotel«, begann ich und hielt
inne. Renouk erschien mir plötzlich als zumindest
indirekte Gefahrenquelle. Wenn ich die Brille fortgä-
be, würde mir nichts bleiben, was ich für Steves
Sicherheit und Leben in die Waagschale werfen
konnte. Die Brille war jetzt für mich das wichtigste
Ding auf der Welt.
Ich fügte in bedauerndem Ton hinzu: »Sie ist mir
heute vormittag gestohlen worden.«

182
»Gestohlen!« wiederholte Renouk entsetzt. »Wie
konnten Sie das zulassen?«
»Nun, die Polizei hat mir mehrmals versichert, daß
die Brille nichts mit den Morden zu tun hätte, und das
habe ich natürlich geglaubt. Ich vermute, ein gewöhn-
licher Taschendieb hat sie mir entwendet, als ich
heute durch eine sehr belebte Straße ging.«
Renouk murmelte einen arabischen Fluch, sah mich
bitterböse an und knirschte: »Das ist eine sehr ernste
Entwicklung, Mr. Temple. Sagen Sie mir ganz
bestimmt die Wahrheit?«
»Wie könnte ich Sie belügen, Monsieur le Com-
missaire? Ich brauche doch Ihre Hilfe, um meine Frau
wiederzufinden.«
»Das stimmt«, pflichtete Renouk bei. »Wir fahren
sofort zum Polizeipräsidium. Entschuldigen Sie mich
für zwei Minuten, bis ich meine Uniform angezogen
habe.«
Im Polizeipräsidium beauftragte Renouk einen
Beamten, sofort Nachfrage bei allen Krankenhäusern
und Polizeistationen zu halten. Ich hatte Gelegenheit,
ihn in voller Aktion zu bewundern. Er gab eine
Unmenge Befehle und brüllte seinen Untergebenen
mit großer Lautstärke Anweisungen zu, aber mir
schien es nicht so, als ob er den Fall fest im Griff
habe. Ich war froh, ihm auf der Fahrt nicht zuviel
erzählt zu haben. Diese Situation mußte mit Glacé-
handschuhen angefaßt werden.

183
Die Nachfragen bei den Krankenhäusern und Poli-
zeistationen brachten kein Ergebnis.
»Aber machen Sie sich keine Sorgen, Mr. Temple.
Wenn Sie mir eine Beschreibung Ihrer Gattin geben
wollen, sorge ich dafür, daß jeder uniformierte
Polizist und jeder Kriminalbeamte in Tunis Ausschau
nach ihr hält. Wer weiß, ob die Beschreibung nicht
eine Erinnerung bei einigen unserer Leute wachruft.
Noch besser wäre es natürlich, wenn Sie eine Fotografie
hätten.«
Glücklicherweise hatte ich in meiner Brieftasche
einen sehr guten, aus geringer Entfernung aufgenom-
menen Schnappschuß von Steve. Ich gab ihn Renouk,
der ihn interessiert betrachtete und dann zu mir sah.
»Ich kann Ihre Besorgnis verstehen, Mr. Temple.
Sie haben eine sehr reizvolle Frau.«
Ich wollte nicht gerne länger als unbedingt nötig
aus dem Hotel fort sein. Renouk war so nett, mich in
seinem eigenen Auto hinfahren zu lassen. Er mahnte
mich nochmals, unbesorgt zu sein, und ich selbst
wußte auch, daß ich nur dann von Nutzen für Steve
sein würde, wenn ich einen klaren Kopf behielt.
Am Empfang war jetzt ein anderer Hotelangestell-
ter, aber er gab mir dieselbe Antwort. Keine Nach-
richt. Ich verspürte plötzliche Lust, eine der großen
Ziervasen des Hotelfoyers gegen den nächsten Mar-
morpfeiler zu schmettern. Dies war ein Nervenkrieg.
Steves Entführer wollten mich in Ungewißheit lassen,
bis ich dicht vor dem Überschnappen stand. Da sie

184
mich wahrscheinlich beobachten ließen, würde ich nur
in ihre Hände spielen, wenn ich mir anmerken ließ,
daß meine Nerven versagten.
»- das heißt, abgesehen von dem Telegramm aus
Paris für Sie, Mr. Temple.«
Erst als ich meinen Namen hörte, begriff ich, daß
der Hotelangestellte noch zu mir sprach, und streckte
eine Hand nach dem Telegrammkuvert aus, das er mir
über den Empfangstisch reichte. In unerträglicher
Spannung riß ich das Kuvert auf. Dies konnte es sein -
aber warum aus Paris? Immerhin sah ich mit einiger
Befriedigung, daß meine Hände ganz ruhig waren, als
ich das Telegramm entfaltete. Es war um zwei Uhr
nachmittags in Paris aufgegeben worden.
›Eintreffe Tunis heute spätabends. Versuche Sie im
Hotel zu erreichen. Forbes‹
Ich starrte verblüfft auf den Text. Was brachte mei-
nen alten Freund von Scotland Yard in diesem
kritischen Moment nach Tunis? Er war schon vor
Wochen aus London verschwunden, und wir, Steve
und ich, hatten an die offizielle Version geglaubt, daß
er überarbeitet sei und auf ärztliches Geheiß einige
Zeit ausspannen müsse. Aber wenn es so war, wes-
halb kam er dann so Hals über Kopf nach Tunis? Und
woher, um alles in der Welt, wußte er, daß wir im
Hotel Concorde wohnten? Nun, ich würde die Ant-
wort noch an diesem Abend erfahren. Und das
Telegramm bedeutete auf alle Fälle, daß ich in dieser
feindseligen und geheimnisvollen Stadt einen starken

185
Verbündeten haben würde.
»Hoffentlich keine schlechte Neuigkeit?«
Audry Bryce. Glücklicherweise hatte ich das Tele-
grammformular inzwischen schon wieder so weit
zusammengefaltet, daß sie keine Gelegenheit hatte,
über meine Schulter hinweg den Inhalt zu lesen. Ich
wandte mich um und begrüßte sie mit einem Lächeln,
das so frei und offen war wie ihr eigenes.
»O danke, nein. Nur eine Nachricht von einem
meiner alten Freunde von Scotland Yard.«
Sie nahm dies, wie ein cleverer Boxer einen Schlag
nimmt, den er hat kommen sehen.
»Mrs. Temple ist nicht hier?«
Mir klang diese Frage so, als kenne Audry Bryce
die Antwort ohnehin.
»Nein, sie macht Einkäufe. Sie wissen ja, wie Frau-
en dabei die Zeit vergessen können. Würden Sie
meine Einladung zum Tee annehmen? Ich hätte gerne
Gesellschaft.«
»Oh, sehr nett von Ihnen, Mr. Temple. Ja, ich neh-
me gerne an.«
Sie war wieder völlig in ihre Rolle als harmlose
amerikanische Touristin zurückgekehrt. Heiter
plaudernd wie vertraute alte Bekannte, schlenderten
wir auf die Terrasse hinaus. Als der Tee kam, fragte
ich, ob sie ›Hausmütterchen‹ spielen würde, und wir
kicherten gemeinsam über den alten Scherz.
»Übrigens«, erkundigte ich mich, »wie geht es
Pierre? Ich bin überrascht, daß er nicht bei Ihnen ist.«

186
Der Deckel der Teekanne fiel mit erheblichem
Krach auf meine Tasse und warf sie um, woraufhin
sich ein Teestrom über den Tisch ergoß. Ein Kellner
eilte herbei und opferte seine schneeweiße Serviette,
um Audry Bryces Rock abzutupfen. Das gab ihr
einige Sekunden Zeit, damit sie ihre Fassung zurück-
gewinnen konnte.
»Wer ist Pierre?« fragte sie mich, als die Ordnung
auf unserem Tisch wiederhergestellt war. »Ich erinnere
mich nicht, jemanden dieses Namens zu kennen.«
»Mein Irrtum. Vielleicht verwechselte ich ihn mit
jemandem gleichen Namens - oder umgekehrt.«
»Was meinen Sie nun damit wieder?«
»Derselbe Mann mit einem anderen Namen«, sagte
ich und lächelte sie strahlend an.
»Das widerspricht sich selbst«, entgegnete sie, aber
nicht eben überzeugend.
Ich nahm einen Schluck Tee. Er war wenig aroma-
tisch und ziemlich lau, doch das machte mir nichts.
Ich fing an zu verstehen, warum Katzen es so faszi-
nierend finden, mit Mäusen zu spielen.
»Wir haben Ihren Tip über feine Ledersachen be-
folgt, Miss Bryce.«
»Oh, gut. Konnten Sie finden, was Sie haben wollten?«
»Ich denke, ja. Ich glaube, es ist Ihre Spezialität.«
Ihre Hand, mit der sie die Tasse an die Lippen heben
wollte, machte in halber Höhe halt.
»Meine Spezialität? Wieso?«
»Alles, was mit Leder - in unserer Sprache ›leather‹ -

187
zu tun hat.«
Sie war jetzt voller Sorge und in der Defensive.
Dieses Mal verschüttete sie ihren Tee nicht, aber die
Tasse wurde sehr hastig und mit viel zuviel Geräusch
wieder auf die Untertasse gesetzt, und das dann
folgende Anzünden einer Zigarette schien ungewöhn-
liche Umstände zu machen.
»Der erwähnte Pierre«, sagte ich leichthin. »Natür-
lich begreife ich nun, daß Sie ihn nicht kennen. Aber
es ist eine interessante Geschichte. Er ist in Dinge
verstrickt, die wir beide als ziemlich düstere Angele-
genheiten bezeichnen würden, und die Polizei beo-
bachtet ihn seit geraumer Zeit. Wie die meisten seiner
Art ist er gar zu selbstsicher und überheblich. Er
scheint nicht wahrhaben zu wollen, daß er sich schon
manche Blöße gegeben hat. Vor allem hat er den
bösen Fehler gemacht, Morde zu begehen, und wie
man weiß, ist es heutzutage sehr schwierig, damit
davonzukommen. Durch die Einrichtung der Interpol
ist die polizeiliche Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen Ländern jetzt verblüffend gut.«
Ich sah meine Tischgenossin an. Die selbstsichere
Maske war gefallen, ihr Gesicht zeigte eine erschreckende
Blässe. Ihr Blick war starr auf den Tisch gerichtet. Die
Hand mit der Zigarette zitterte. Sie begann mir ein
bißchen leid zu tun - bis ich wieder an Steve dachte.
»Ja«, fuhr ich fort, »die Polizei ist bereit, Pierre zu
verhaften, wann immer sie es wünscht. Sie will nur
noch herausfinden, wer alles zu seinen Komplicen

188
gehört. Mancher von diesen dürfte bisher nicht
bedacht haben, daß Pierre wegen mehrfachen Mordes
vor Gericht kommen wird, aber sie alle müssen darauf
gefaßt sein, der Beihilfe zu diesen Morden angeklagt
zu werden. Übrigens, benutzt man hier in Tunesien
noch die Guillotine? Oder hat die neue Verwaltung
eine andere Methode eingeführt?«
Die Frau, die sich Audry Bryce nannte, warf ihre
Zigarette zu Boden, trat darauf und sagte mit heiserer,
veränderter Stimme: »Ich glaube, ich habe nun alles
hingenommen, was ich hinnehmen konnte.«
Dann stand sie auf und ging in das Hotel.
Ich blieb zunächst noch sitzen und rauchte. Nach
einigen Minuten kam ein Page auf die Terrasse
hinaus, schaute eifrig umher und rief dabei: »Telefon-
anruf für Mr. Temple!«
Als er bemerkte, daß ich eine Hand hob, kam er
eilends zu meinem Tisch und wiederholte: »Sie
werden am Telefon verlangt, Mr. Temple.«
»Ich komme sofort. Warte einen Moment.«
Ich riß eine Seite aus meinem Notizbuch und
schrieb darauf: »Vielleicht wären Sie froh, auf Seiten
der Polizei einen Freund zu haben. Können wir uns
darüber unterhalten?«
Ich faltete das Blatt zusammen, verklebte es mit
einer Briefmarke, drückte es, gemeinsam mit einem
kleinen tunesischen Geldschein, in die Hand des
Pagen und sagte: »Bring den Zettel der Dame in der
Suite drei-sieben-eins, aber laß niemanden sehen, daß

189
du ihn ihr gibst. Falls sie nicht allein ist, erfinde
irgendeine Entschuldigung und warte bis später.«
Der Page, so jung er war, zwinkerte mir zweideutig
zu, steckte das Geld und den Zettel ein und sauste los.
Der Telefonanruf war von Tony Wyse.
»Lange nicht gesehen«, sagte er, nachdem er seinen
Namen genannt hatte. »Tut mir leid, daß ich Sie noch
nicht aufsuchen konnte. Aber ich war geschäftlich
sehr stark in Anspruch genommen. Haben Sie die
Sehenswürdigkeiten von Tunis schon genossen?«
»Oh, wir hatten bisher eine recht ereignisreiche Zeit.«
»Das freut mich. Wissen Sie, ich überlege mir, ob
ich nicht Sie und Mrs. Temple für heute abend zum
Dinner bitten dürfte?«
»Sehr liebenswürdig von Ihnen, Mr. Wyse. Ich
fürchte nur, meiner Frau ist etwas zugestoßen. Sie
verließ das Hotel heute vormittag gegen elf Uhr und
ist bis jetzt nicht zurückgekehrt.«
»Was?« Am anderen Ende der Leitung entstand
beklommenes Schweigen. Nach einer Sekunde hörte
ich Wyse stöhnen: »Guter Gott!« Meine Mitteilung
schien ihn getroffen zu haben wie ein Donnerschlag.
Jedenfalls verging fast eine halbe Minute, bis ich ihn
nervös fragen hörte: »Was haben Sie unternommen?
Haben Sie die Polizei in Kenntnis gesetzt?«
»Ja. Ich habe es der Polizei gesagt. Man hat alle
Krankenhäuser abgeklappert. Kein Erfolg.«
»Das ist ja schrecklich. Hören Sie, Mr. Temple, ich
möchte Sie sehen. Sind Sie dort, wenn ich unverzüg-

190
lich in Ihr Hotel komme?«
Ich sah auf meine Uhr. Allmählich wurde es Zeit
für mich, an den Aufbruch zu meiner Verabredung
mit O'Halloran zu denken.
»Nein. Ich muß sehr bald fortgehen. Ich habe eine
unaufschiebbare Verabredung.«
»Nun, wollen wir nicht auf jeden Fall heute abend
zusammen essen, selbst wenn Sie allein sind?«
»Ja, wenn ich irgend kann. Wo können wir uns
treffen?«
»Im Hotel Tunesia. Es liegt in Sidi bou Said. Mit
einem Taxi sind Sie in einer Viertelstunde dort.
Wollen wir sagen um acht Uhr?«
»Ich werde mein Bestes tun.«
»Fein. Bis dann, also.«
Ich rauchte mehr Zigaretten als sonst. Beim Verlas-
sen der Telefonzelle zündete ich mir wieder eine an
und blieb dann stehen, um die Leute zu beobachten,
die im Hotelfoyer saßen oder standen oder es durch-
querten. Dabei überlegte ich, ob ich irgend etwas
versäumt hatte zu tun, was nach Lage der Dinge hätte
getan werden müssen. Nochmals beim Empfang zu
fragen, ob eine Nachricht für mich gekommen sei,
wäre witzlos gewesen, denn die Hotelbediensteten
hatten längst bemerkt, daß ich auf der anderen Seite
des Foyers neben den Telefonzellen stand. Über sechs
Stunden war es jetzt her, daß ich Steve zuletzt gese-
hen hatte - und noch immer keine Nachricht. War
irgend etwas ganz schlecht gegangen? Hatte sie bei

191
irgendeiner Gelegenheit handgreiflichen Widerstand
geleistet? War sie dabei getötet worden?
Plötzlich überfiel mich ein neuer Gedanke. Hatte
man sie nicht entführt, um mich zu erpressen, sondern
um durch sie herauszufinden, wieviel wir wußten?
Hatten gewisse Leute den größten Teil dieser mehr als
sechs Stunden mit dem Versuch verbracht, durch
Quälereien und Folterungen von ihr Dinge zu erfah-
ren, die sie gar nicht wußte?
Einen Moment lang sah ich rote Nebel vor meinen
Augen und ballte die Fäuste. Dann fand ich mich doch
wieder dabei, zum Empfangstisch zu gehen, wie einen
Süchtigen, der unbedingt wieder ein kleines Quantum
seines unentbehrlich gewordenen Rauschgiftes haben
will. Vielleicht war während der letzten Minuten eine
Nachricht gekommen.
Der Page, dem ich den Zettel für Audry Bryce ge-
geben hatte, huschte herbei und berührte meinen
Ellbogen, als ich mich erfolglos wieder vom Emp-
fangstisch abwandte.
»Ich erwischte sie gerade noch, als sie in ein Taxi
steigen wollte«, raunte er. »Niemand hat mich gese-
hen. Ich soll Ihnen das hier geben.«
Es war mein eigener Notizzettel. Unter meine Zei-
len war gekritzelt: ›Um Mitternacht in Ihrer Suite. Ich
werde kommen.‹
Der Page wartete hoffnungsvoll. Ich gab ihm einen
kleinen Geldschein und sagte: »Hol mir ein Taxi.«

192
8
Khérédine, auf einer Landzunge vor der inneren
Bucht von Tunis gelegen, erwies sich als ein kurioses
Gemisch aus Badestrand, luxuriösem Wohnviertel
und Schiffahrtsanlagen nebst allem Drum und Dran.
Mein Fahrer wußte, wo das Hotel du Port zu finden
war, und brachte mich ohne Umwege in eine ziemlich
düstere Straße mit Häusern auf der einen Seite und
dem düsteren Wasser auf der anderen. Hier waren
Werften und Reparaturanlagen für kleinere Schiffe
und viele Bootsliegeplätze. Das Hotel du Port, ein
wenig einladendes älteres Haus, beherbergte in
seinem Erdgeschoß eine Kneipe, in der ich Werftar-
beiter an der Bar und um einige Billardtische ver-
sammelt sah. Durch die offene Tür drang Akkorde-
onmusik ins Freie.
Als mein Taxi davongefahren war, fühlte ich mich
unangenehm allein in einem sehr fremden Teil dieser
Welt. Die Sonne war untergegangen, rasch gefolgt
von intensiver Dunkelheit. Der Mond ließ sich noch
nicht blicken. Nach Süden zu war der Himmel durch
die Lichter der Stadt Tunis erhellt. Daneben funkelten
Sterne. Kleine Wellen plätscherten gegen die im
Wasser liegenden Boote und die Pfeiler der zahlrei-
chen Stege.
Ich hatte versäumt, O'Halloran zu fragen, auf wel-
cher Seite des Hotels Durants Haus stände, doch wäre
diese Information ohnehin unnötig gewesen, da das

193
Hotel an einer Straßenecke lag. Das Nachbarhaus
diente ganz offensichtlich teils Wohn-, teils geschäft-
lichen Zwecken. Durants Firmenaufschrift war auf die
Erdgeschoßfenster gemalt. Da das Haus nach der
Straße zu nur einen Eingang besaß, ging ich die paar
Stufen der Vortreppe hinauf und läutete die Türklin-
gel, wobei ich mich neugierig fragte, ob ich endlich
dieses Mal dem geheimnisumwitterten David Foster
begegnen sollte - und, falls nicht, wen der pfiffige
O'Halloran gedungen haben mochte, einen glaubwür-
digen David Foster zu spielen.
Mein Klingeln wurde von einer schlampigen älte-
ren Frau schimpfend beantwortet, die eine Schürze
um den Leib gebunden und ihre Ärmel bis an die
Ellbogen aufgerollt hatte. Ihre Hände waren so naß
von Seifenlauge, daß sie sich einige Haarsträhnen mit
dem linken Unterarm aus dem Gesicht streichen
mußte.
»Das Büro ist geschlossen, Monsieur.«
»Ich habe mit einem Mr. O'Halloran verabredet, ihn
um sieben Uhr hier zu treffen. Ist er schon da?«
»Wie war der Name?«
»O'Halloran«, wiederholte ich und merkte, daß die
französischen Ohren dieser Frau es eher für einen
arabischen als einen irischen Namen zu halten schie-
nen.
Sie schüttelte den Kopf und sagte: »Niemand mit
solchem Namen ist hier.«
»Aber es ist das Haus von Monsieur Durant?«

194
»Ja, es ist Monsieur Durants Haus.«
»Würden Sie ihm bitte sagen, daß ich hier bin?
Mein Name ist Temple. Ich nehme an, er erwartet
mich.«
»Tem - pel. Ja, aber er ist vor einem Weilchen fort-
gegangen. Ist es dringend?«
»Sehr dringend sogar.«
»Ich will versuchen, ihn zu finden«, entgegnete sie
mit resignierendem Achselzucken. »Sie können hier
warten.«
Sie trocknete sich die Hände an einer Ecke ihrer
Schürze, öffnete die Tür eines der Erdgeschoßräume,
knipste das Licht an, machte hinter mir die Tür wieder
zu und ging. Ich konnte hören, wie sie die Haustür
schloß und die Stufen der Vortreppe hinablief.
Durants Büro war ein Durcheinander von Papier-
stapeln, Aktendeckeln und Lichtpausen. Auf den
Aktenschränken, den Regalen und stellenweise auch
auf dem Fußboden lag dicker Staub. Alle vorhande-
nen Aschenbecher waren übervoll. Die starke nackte
Glühbirne, die von der Mitte der Decke herabhing,
warf ein erbarmungsloses Licht auf diese Gefilde fast
vollendeter Unordnung. Da ich mir sagte, daß ich
infolge der gardinenlosen Fenster für jedermann auf
der Straße deutlich sichtbar sein müsse, solange ich
stand, setzte ich mich lieber hin. Dann zündete ich mir
eine meiner eigenen Zigaretten an und hoffte, sie
würde den unangenehmen Duft kalten Gauloise-
Rauches ein wenig mildern.

195
Nach zehn Minuten wuchs in mir die Überzeugung,
daß ich zum Narren gehalten wurde und O'Halloran
niemals die Absicht gehabt hatte, hier zu erscheinen.
Sinnlos vertrödelte ich die Zeit in diesem schäbigen
Büro, während in eben dieser Minute irgendeine
Nachricht über Steve im Hotel Concorde eintreffen
mochte. Ich war doch in Szoltan Guptes Raritäten-
kramladen ziemlich sicher gewesen, daß weder Gupte
noch O'Halloran etwas über Steves Verbleib wußten.
Weshalb also saß ich hier herum?
Als ich mich erheben wollte, um fortzugehen, hörte
ich Schritte über die Straße näher kommen und
erkannte die Stimme der Frau mit der Schürze. In
ihrer Begleitung war ein Mann. Die beiden redeten
sehr lebhaft miteinander.
Überfließend von Entschuldigungen kam Durant in
das Büro gehastet. Er sei zum Hafenbüro gerufen
worden, erklärte er, und habe nicht auf die Zeit
geachtet. Er war einer jener Franzosen, auf die das
Klima Nordafrikas und die dortigen Lebensgewohn-
heiten schlechte Auswirkungen haben. Er war feist
und schlaff geworden und hatte ein unnatürlich rotes
Gesicht. Vermutlich trank er zuviel. Er sah wie ein
Mann von Anfang Sechzig aus, war aber tatsächlich,
wie ich später erfuhr, erst Ende Vierzig.
»Sie haben mich erwartet?«
»Ja, ich erhielt Nachricht von Monsieur Szoltan
Gupte. Ich hoffe, Sie erwähnen meine Verspätung
nicht, Mr. Temple. Jemand wie Monsieur Gupte soll

196
nicht denken, ich täte nicht mein Bestes. Wenn Sie
nun bitte mit mir zum Bootssteg kommen wollen,
rudere ich Sie hinaus zu der Jacht.«
»Die Jacht? Befinden sich O'Halloran und Szoltan
Gupte dort?«
Durant nötigte mich förmlich aus dem Haus. Er
schien sehr beflissen, wenigstens etwas von dem
Zeitverlust wieder aufzuholen.
»Ich weiß nicht, ob Monsieur Szoltan Gupte dort
ist, Mr. Temple. Ich stelle keine Fragen. Ich tue nur,
was er mir sagt.«
»Wie lange wird es dauern, zu der Jacht zu ru-
dern?«
»Nicht lange, Mr. Temple. Vielleicht fünf Minu-
ten.«
Da ich nun einmal hier war, wollte ich diese Sache
auch zu Ende bringen. Ich sagte: »Machen Sie so
schnell Sie können. Ich habe nicht viel Zeit.«
Ich fand es recht seltsam, daß dieser Franzose sich
gegenüber einem Altwarenhändler aus dem Araber-
viertel so unterwürfig zeigte. Er lotste mich in sol-
chem Tempo durch ein Gewirr von Schuppen und
Holzstapeln, daß ich keine Gelegenheit fand, ihm
Fragen zu stellen. Schließlich kamen wir auf einen
schmalen Steg, an dem einige Ruderboote vertäut
lagen. Durant wählte eins der kleineren davon aus und
half mir beim Einsteigen.
»Für gewöhnlich mache ich selbst so etwas ja
nicht«, erklärte er, als er zu rudern begann. »Aber

197
meine Leute sind alle schon fort, und da es für Monsi-
eur Gupte ist -«
»Ist er ein sehr bedeutender Mann?« warf ich ein.
»Monsieur Szoltan Gupte? Wissen Sie nicht, daß er
einer der reichsten Männer von Tunis ist? Es heißt, er
hat mehrere Millionen.«
»Betreibt er noch andere Geschäfte als seinen Anti-
quitätenladen?«
»Darüber weiß ich nichts, Mr. Temple. Ich stelle
keine Fragen. Er bezahlt mich gut, und das genügt
mir.«
Wir schienen schon auf dem richtigen Kurs zu sein.
Jedenfalls konnte ich in einiger Entfernung die
Umrisse einer offenbar verankerten großen Motor-
jacht wahrnehmen.
»Kennen Sie einen Mr. David Foster?«
»Das ist ein englischer Name, nicht wahr? Nein, ich
kenne keinen Mr. Foster.«
»Haben Sie heute abend schon jemanden zur Jacht
hinübergerudert?«
»Nein, Mr. Temple. Es ist zu früh. Für gewöhnlich
kommen die Herren erst gegen zehn, elf Uhr.
Manchmal auch erst um Mitternacht.«
»Aber Sie kennen Mr. O'Halloran, einen Freund
von Szoltan Gupte? Ein kleiner Ire mit Zahnlücken.«
»Freilich kannte ich ihn, Mr. Temple. Erst vor vier
Tagen habe ich ihn zur Jacht hinübergerudert. Sehr
traurige Sache. Sie haben es ja in der Zeitung gelesen,
nicht wahr? Diese Morde in Tunis nehmen überhand.«
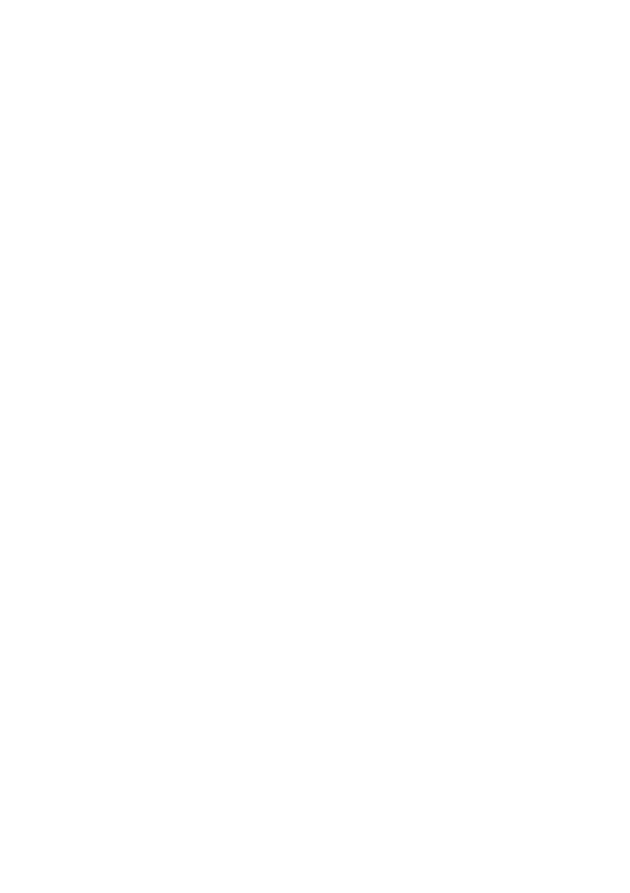
198
Nach kaum fünf Minuten waren wir dicht bei der
Jacht. Sie hatte keine Lichter gesetzt; nichts ließ
erkennen, daß jemand an Bord wäre. Durant rief
hinüber, um unser Kommen anzukündigen. Niemand
antwortete.
»Ich denke, wir sind zu früh daran«, sagte er.
»Noch ist niemand da. Besser, wir kehren um.«
»Da hängt ein Fallreep aus. Rudern Sie heran, und
ich werde einen Blick an Bord tun.«
»Oh, ich gehe nie an Bord«, versicherte Durant
hastig.
»Sollen Sie auch nicht. Aber da wir nun einmal hier
sind, möchte ich mich überzeugen, ob Szoltan Gupte
auf mich wartet. Halten Sie das nicht für richtig?«
Durant zuckte zweifelnd die Achseln, manövrierte
aber, wenn auch mit dem Ausdruck eines Mannes, der
keine Verantwortung für das trägt, was zu tun er
genötigt wird, sein Boot an das Fallreep der Jacht und
half mir sogar beim Hinübersteigen.
Es war ein ziemlich großes Motorboot, ungefähr
fünfzehn Meter lang. Obwohl für das offene Meer
gebaut, war es durch entsprechende Veränderungen zu
einem luxuriösen Hausboot umgestaltet worden. Fast
die ganze Deckslänge war mit Kajütaufbauten verse-
hen, die nur Platz für einen schmalen Rundgang
ließen.
Ich fand eine unverschlossene Kajüte. Mit Hilfe
meiner kleinen Taschenlampe entdeckte ich die
Lichtschalter und knipste sie alle an. Der größte Teil

199
der Deckskajüte wurde von einer Art Clubraum
eingenommen. Am entfernten Ende war eine Bar; an
den Wänden standen Sofas, vor jedem der Sofas ein
niedriger Tisch und an jedem der Tische zwei oder
drei Polstersessel. Dazwischen blieb noch Platz für
eine kleine Tanzfläche. Die Beleuchtung war ge-
dämpft. Einige Sekunden, nachdem ich sie angeknipst
hatte, begann ein Plattenspieler einen Tango zu
spielen.
Eine eigene Treppe verband diesen Raum mit dem
Unterdeck. Ich knipste auch hier das Licht an, ging
die Treppe hinab und gelangte in einen Korridor mit
Kabinen an den Seiten. Ich inspizierte die Kabinen
eine nach der anderen. Jede von ihnen enthielt eine
bequeme Schlafcouch, ein flaches, eingebautes
Kleiderspind, einen Ankleidetisch mit Spiegel und ein
Waschbecken mit fließendem Wasser. Nur die Kabine
am rückwärtigen Ende des Korridors zeigte Spuren
von ständiger Benutzung. Sie war doppelt so groß wie
die anderen und als Wohn-Schlafzimmer eingerichtet.
Einige charakteristische Dinge ließen erkennen, daß
sie von einem Mann benutzt wurde, der daran ge-
wöhnt war, weiblichen Besuch zu empfangen.
Zigarettenrauch hing noch ziemlich frisch in der
Luft. Und ein schwacher Parfümduft ließ mich an
jemanden denken, dem ich erst vor kurzem begegnet
war.
Ein gradlehniger Stuhl stand in der Mitte des Rau-
mes. Auf dem Teppich ringsum lagen einige Zigaret-

200
tenstummel. Eine der kleinen Armlehnen des Stuhles
war abgebrochen. Auf dem Tisch lag ein Stück
kräftiger Schnur, das an den Enden zusammengekno-
tet, aber eine Handbreit davon entfernt mit einem
Messer durchschnitten worden war. Der Hausmantel
eines Mannes lag unordentlich hingeworfen auf der
Schlafcouch. Die dazugehörende seidene Kordel fand
ich in einiger Entfernung auf dem Boden. Ich bückte
mich danach, rollte sie auf und steckte sie mir in die
Hosentasche.
Hinweise auf die Identität des Kabinenbenutzers
waren bei meiner begreiflicherweise flüchtigen Suche
nicht zu entdecken. Aber zwischen den Platten eines
kleinen Klapptisches fand ich einen genauen Stadt-
plan von Tunis. Darauf hatte jemand einen roten Kreis
um unser Hotel Concorde gemalt; von diesem Kreis
ausgehende rote Linien zeigten die beiden Wege, die
Steve und ich bei unserem Schaufensterbummel und
bei unserer Droschkenfahrt genommen hatten. Mein
Weg zu dem Optiker und zur Filiale von Lloyds Bank
war jedoch ebensowenig eingezeichnet wie der Kurs
meiner Taxe zum ›Haus künstlerischer Raritäten‹.
Dafür war aber dieses Haus selbst von einem roten
Kreis umgeben, ebenso eine Straßenecke an der
Avenue de Rome und verschiedene andere Punkte, die
mir nichts besagten.
Ich faltete den Plan und steckte ihn zu mir.
Die brutale Szene, die vor kurzem in dieser Kabine
abgerollt war, hatte ihren fatalen Eindruck so klar in

201
der Atmosphäre hinterlassen, wie ein Bild sich auf
einem Filmnegativ abzeichnet. Ich hatte das Gefühl,
als beginne die Zeit knapp zu werden. Hinter mir die
Lichter ausknipsend, kehrte ich an Deck und in
Durants Boot zurück.
Durant schien froh, von der Jacht fortzukommen,
und ruderte aus Leibeskräften los.
»Wie spät war es, als Sie von Szoltan Gupte Ihre
Anweisungen bekamen?« fragte ich ihn.
»Gegen zwei Uhr heute nachmittag.«
»Halten Sie es nicht für merkwürdig, daß er diese
Anweisungen gab, aber selbst nicht zur Stelle war?«
»Weiß nicht«, antwortete Durant etwas atemlos
vom hastigen Rudern. »Weiß nur, daß er mir sagte,
ich hätte heute abend um sieben einen Mr. Temple zur
Jacht zu rudern.«
Eins der Ruder stieß an einen im Wasser treibenden
Gegenstand, und Durant geriet aus dem Takt. Er
schwenkte das betreffende Ruder hoch, um von dem
Gegenstand wegzukommen. Da das Boot im eigenen
Schwung vorwärtsglitt, wollte er gleich weiterrudern.
»Warten Sie einen Moment«, sagte ich. »Konnten
Sie sehen, was da im Wasser war?«
»Nein.«
»Ich glaube, es war eine Leiche. Eine Frauenlei-
che.«
Die Zeit schien dahinzuschleichen, während Durant
sein Boot wendete. Ich hatte nur einen flüchtigen
Blick auf das treibende Etwas erhascht, bezweifelte

202
aber nicht, daß es ein menschlicher Körper gewesen
war.
»Dort schwimmt es!« rief Durant und manövrierte
das Boot auf die Stelle zu.
Eine dunkle Masse, etwa wie eine kleine Welle, die
einige ineinander verflochtene Seetangpflanzen mit
sich führt, erhob sich ganz wenig über die Oberfläche
des Wassers und sank wieder zurück. Ich lehnte mich
weit über die Bootswand und glaubte einen Kopf mit
hinterdreintreibendem langem Haar zu erkennen.
»Vorsicht, oder wir werden kentern!« rief Durant.
»Sitzen Sie lieber still, bis wir näher heran sind.«
Wahrscheinlich hatte er schon manchmal treibende
Wasserleichen gefunden und ahnte nicht, worum es
ging. Er brachte sein Boot sehr geschickt näher heran,
zog plötzlich die Ruder ein und langte über Bord.
»Hab' sie gepackt. Wer weiß, wie lange die schon
schwimmt. Sie haben eine Taschenlampe, nicht
wahr?«
Durant gab sich große Mühe, den Kopf der Leiche
über Wasser zu heben. Mir wurde verwünscht flau im
Magen, als das Licht der Taschenlampe aufflammte.
Das Boot legte sich stark nach einer Seite. Dann
keuchte Durant: »Kann es nicht schaffen!«
Er ließ los, und die Leiche sank zurück ins Wasser.
Für den Bruchteil einer Sekunde geriet ihr Gesicht in
den Lichtstrahl meiner Taschenlampe. Ich erkannte
die verzerrten Züge von Audry Bryce.

203
Der Abstecher nach Khérédine war weniger zeit-
raubend verlaufen, als ich geschätzt hatte. Zehn
Minuten nach acht betrat ich wieder das Hotel Con-
corde. Obwohl es unvermeidlich war, daß ich mich
bei meiner Verabredung mit Tony Wyse sehr verspä-
ten würde, mußte ich im Hotel Nachfrage halten, ehe
ich irgend etwas anderes unternahm - das verstand
sich von selbst.
Während Durant mich zu seinem Landungssteg
zurückruderte, hatte ich mich von meinem Schock
über die Leiche im Wasser erholt und ihn nicht
merken lassen, daß ich die Tote kannte. Er hatte es
übernommen, die Polizei zu benachrichtigen, und mir
versprochen, nichts von meiner Anwesenheit zu
erwähnen. Ich war dann von Khérédine mit einem
Vorortzug in die Stadt gefahren, was nicht länger
dauerte als eine Taxifahrt.
»Mrs. Temple ist noch nicht wiedergekommen«,
sagte mir der Mann am Empfang, noch ehe ich meine
Frage stellen konnte. »Sie ist wirklich schon sehr
lange fort, Mr. Temple. Haben Sie daran gedacht, die
Polizei zu verständigen?«
»Ja, das ist längst geschehen. Die Polizei tut alles,
was sie kann. Hören Sie, ich bin zum Essen im Hotel
Tunesia in Sidi bou Said verabredet. Versprechen Sie
mir, mich dort anzurufen, sobald eine Nachricht
kommt?«
»Ja, das werde ich gerne tun, Mr. Temple.«
Dieser Hotelbedienstete war wesentlich teilnahms-

204
voller als sein Kollege und zeigte in Ausdruck und
Verhalten echte Besorgnis.
Ich hatte bemerkt, daß eine Telefonistin in dem
Büro hinter dem Anmeldetisch ein Gespräch ange-
nommen und dabei mehrfach zu mir hingesehen hatte.
Jetzt kam sie nach vorn gelaufen und meldete: »Je-
mand im Polizeipräsidium möchte mit Mr. Temple
sprechen.«
»Legen Sie das Gespräch auf Kabine eins«, sagte
der Empfangschef. »Bitte, Mr. Temple, nehmen Sie
die erste Kabine von links.«
Auf dem kurzen Weg zum Telefon beseelten mich
wilde Hoffnungen und quälende Befürchtungen. Noch
ehe die Kabinentür hinter mir richtig zu war, hatte ich
den Hörer am Ohr und meldete mich: »Hier Paul
Temple.«
»Mr. Temple, Sie werden aus dem Polizeipräsidium
verlangt. Einen Moment, bitte.«
Ich wartete ungeduldig, die Finger meiner freien
Hand trommelten nervös gegen die Kabinenwand.
»Hallo, Temple. Sind Sie da?«
Ein Irrtum über diese Stimme, die schon unzähli-
gemal zu mir gesprochen hatte, war unmöglich.
»Sir Graham Forbes! Gott sei Dank, daß Sie ge-
kommen sind.«
»Vor einer kleinen halben Stunde. Ich bin im Poli-
zeipräsidium bei Renouk. Temple, es tat mir sehr leid,
die Nachricht über Steve zu hören.«
»Recht unerfreulich, nicht wahr?«

205
»Ja. Aber die hiesige Polizei tut, was sie kann. Es
ist nur eine Frage der Zeit, bis sie Steve finden wird.«
»Ich hoffe, Sie haben recht, Sir Graham. Aber ich
muß gestehen, daß ich furchtbare Sorgen habe. Ist es
möglich, daß Sie gleich herkommen?«
»Leider nicht. Ich muß hier einige dringende Ange-
legenheiten erledigen. Aber etwas später am Abend
möchte ich Sie sehen. Werden Sie da sein, wenn ich
gegen elf Uhr komme?«
»Ja, ich werde hier sein. Und übrigens, Sir Graham -«
»Ja?«
»Was führt Sie ausgerechnet jetzt nach Tunis?«
Ich hörte ihn leise lachen. Dann äußerte er: »Wol-
len wir einfach sagen, ich bin wegen einer ganz
besonderen Brille hier?«
Ehe ich noch etwas fragen konnte, legte er auf.
Es war bezeichnend für meine Sinneswandlung,
daß ich kein Verlangen spürte, den auf der Jacht
gefundenen Stadtplan sogleich an Renouk zu übermit-
teln. Ich bat an der Rezeption um ein etwas größeres
Kuvert, tat den Stadtplan hinein, klebte das Kuvert zu
und bat den freundlichen Hotelbediensteten, es in
seiner Geldschublade so aufzubewahren, daß ich es
jederzeit zurückbekommen könnte.
Dann verließ ich das Hotel und nahm draußen ein
Taxi nach Sidi bou Said.
Während mich das Taxi in schneller Fahrt nord-
wärts brachte, überlegte ich, daß Tony Wyse sozusa-
gen der letzte Pfeil in meinem Köcher wäre. Aus

206
irgendeinem obskuren Grund hatten Szoltan Gupte
und O'Halloran sich gescheut, das mit mir vereinbarte
Zusammentreffen einzuhalten. Ich hatte das Gefühl,
daß ich, wenn ich jetzt hinkäme, das ›Haus künstleri-
scher Raritäten‹ verschlossen und mit heruntergelas-
senen Rolläden vorfinden würde. Vielleicht hatte
Renouk gefolgert, daß Steves Verschwinden eine
Folge seines Zusammentreffens mit uns wäre; viel-
leicht hatte die dann einsetzende Aktivität der Polizei
das Paar Gupte und O'Halloran bewogen, einstweilen
innezuhalten. Ich wünschte, ich hätte aus meinem
Gespräch mit Audry Bryce schnellere Folgerungen
gezogen. Ihre Ankündigung, um Mitternacht zu mir
ins Hotelzimmer zu kommen, mochte ein Köder für
eine Falle gewesen sein. Aber ich nahm eher an, daß
ich sie wirklich in Schrecken versetzt und daß sie sich
impulsiv entschlossen hatte, meinen Rat zu befolgen
und auf die richtige Seite hinüberzuwechseln. Jemand
hatte gespürt, daß sie zusammenklappen würde, und
hatte dafür gesorgt, daß sie nichts mehr ausplaudern
konnte.
Das Hotel Tunesia lag auf einem Hochplateau, das
ziemlich weit ins Meer hinausragte. Gleich hinter den
Gebäuden senkte sich der Grund steil zum schmalen
Strand hinab. Von der vorgebauten Terrasse konnten
die Gäste einen herrlichen Ausblick bis nach Karthago
auf der einen Seite und bis nach Tunis auf der anderen
Seite genießen.
Ein eleganter Flur führte am Speisesaaleingang

207
vorbei zu der von sanftem Flutlicht erhellten Terrasse,
auf der ich eine Anzahl Gäste mit ihren Aperitifs
sitzen sah. Mitten in diesem Flur sprach ein blonder,
breitschultriger Mann mit dem äußerst ehrerbietigen
Oberkellner.
»Haben Sie einen Zweipersonentisch für mich?«
hörte ich ihn fragen. »Ich werde heute abend mit
einem amerikanischen Freund speisen. Wissen Sie
zufällig, ob ein Mr. Vandenberg bereits eingetroffen
ist?«
»Aber ja, Monsieur!« Der Oberkellner gestikulierte
mit seiner Speisekarte zur Terrasse. »Mr. Vandenberg
ist bereits eingetroffen. Er erwartet Sie auf der Terras-
se.«
»Gut. Ich werde zu ihm gehen, sobald ich dem
Weinkellner meine Bestellung gegeben habe.«
Ich wartete, bis Schultz durch den Eingang zum
Speisesaal entschwunden war. Er hatte nichts von
meiner Anwesenheit im Flur bemerkt.
»Mr. Anthony Wyse ist gewiß schon da?« fragte
ich den Oberkellner.
»Habe ich die Ehre mit Mr. Temple?«
»Ja.«
»Mr. Wyse trug mir auf, Ihnen zu sagen, daß er in
der Terrassenbar ist, Mr. Temple. Am linken Ende der
Terrasse, Sir.«
Im Augenblick, als ich auf die Terrasse hinaustrat,
beschloß ich, später einmal mit Steve wieder nach
Tunis zu kommen, eigens, um einige Zeit im Hotel

208
Tunesia zu wohnen und die Abende auf dieser Terras-
se zu verbringen. Es war eine fast vollendete Anlage.
Die Terrasse schien in samtene Dunkelheit gehüllt,
eine kleine Oase von liebenswürdigstem Luxus der
kultivierten französischen Art. Bezaubernd. Aber
momentan konnte ich mich dieser Schönheit nicht
widmen; ich war zu sehr von der grimmigen Wirk-
lichkeit in Anspruch genommen.
Auf meinem Weg über die Terrasse bemerkte ich
einen Mann, der allein an einem Tischchen saß. Seine
Augen, die auf die Tür gerichtet waren, als ich
hinauskam, hatten sich eigentümlich schnell abge-
wendet. Ich sah seine auffallend tief angesetzten
Ohren und seinen nicht weniger auffallend betonten
Hinterkopf. Seine Maskierung war gut, doch diese
beiden charakteristischen Einzelheiten verrieten ihn.
Er hatte jetzt ziemlich langes, strähniges graues Haar
und die blasse Gesichtsfarbe eines amerikanischen
Geschäftsmannes, der an Magengeschwüren leidet.
Auf der Nase saß ihm eine Brille mit moderner
schmaler Fassung. Ein hellgrauer, breitrandiger Hut
lag, wo Herrenhüte in Amerika unfeinerweise oftmals
liegen, nämlich auf dem Tisch. Sein Anzug war ganz
offensichtlich amerikanischer Herkunft.
Ich blieb stehen und legte eine Hand auf die Lehne
seines Sesselchens.
»Guten Abend, Colonel Rostand. Wie nett, Sie
wiederzusehen!«
Der alte Gentleman drehte mir sein trauriges, sor-

209
genzerfurchtes Gesicht zu und beäugte mich mit
milder Mißbilligung. Das machte er wirklich sehr gut.
»Ich fürchte, Sie irren sich, junger Mann. Mein
Name ist Vandenberg, Henry O. Vandenberg.«
Der Akzent war amerikanisch, und der Tonfall dem
von Audry Bryces ungesehenem nächtlichem Besu-
cher recht ähnlich. Mich amüsierte, daß er bei gewis-
sen Buchstaben noch immer ein wenig lispelte; ein
kräftiger Biß auf die eigene Zunge, hervorgerufen von
einem Ellbogenstoß unter das Kinn, verheilt eben
doch nicht so schnell.
»Tut mir leid, Sir«, entschuldigte ich mich. »Es war
ein dummer Irrtum, sicher nur dadurch entstanden,
daß ich etwas habe, was ich diesem Colonel Rostand
sehr gerne zurückgeben möchte.«
»Oh?«
Hinter den Brillengläsern leuchtete einiges Interes-
se auf.
»Ja, ich bin sicher, daß er sehr bekümmert sein
wird, wenn er merkt, daß er es vergessen hat.«
»Freilich, das wäre schlimm. Was haben Sie denn
gefunden?«
Rostand hatte seine Neugier nicht zügeln können.
Ich griff in die Tasche und brachte die zusammenge-
rollte seidene Hausmantelkordel zum Vorschein.
»Mit dieser Kordel wurde heute abend auf einer vor
Khérédine liegenden Jacht eine Frau namens Audry
Bryce erdrosselt und nachher ins Meer geworfen.«
Vielleicht hätte ich nichts sagen und ihm die Kordel

210
nur zeigen sollen. Er schien ein wenig in sich zusam-
menzusinken, als ich die Kordel herausholte, aber
meine kurze Erläuterung gab ihm Zeit, sich zu sam-
meln. Er schob sein Sesselchen zurück und stand auf.
»Junger Mann«, sagte er verstimmt, »ich weiß
nicht, wer Sie sind. Aber wenn Sie diese Art von
Scherzen lieben, haben Sie sich diesmal den verkehr-
ten Mann ausgesucht.«
Er wandte mir den Rücken und strebte dem Aus-
gang zu. Obwohl er sich etwas gebeugt hielt, konnte
er seine beträchtliche Lange nicht verbergen.
Ich stand noch mit der Kordel in der Hand und sah
ihn durch die Tür zum Flur entschwinden, als Schultz
aus der Tür kam, die vom Speisesaal direkt auf die
Terrasse führte. Er bemerkte mich sofort, kniff die
Augen zusammen und lächelte.
»Guten Abend, Mr. Temple.« Er sprach auch jetzt
wieder mit leicht ironischem Unterton. »Sie sind ohne
Ihre charmante Frau?«
»Nur heute abend«, entgegnete ich kurz. »Es über-
rascht mich, daß Sie nicht im ›Trou du Diable‹ sind.«
»Ich bin hier zum Dinner eingeladen, Mr. Temple.
So etwas kommt manchmal auch bei uns Clubbesit-
zern vor, wissen Sie.«
»Von dem reichen Amerikaner Mr. Vandenberg?«
»So ist es. Woher wissen Sie das?«
»Sollten wir ihn nicht bei seinem richtigen Namen
nennen? Colonel Rostand?«
Schultz zeigte einen übertrieben bestürzten Aus-

211
druck und spreizte beschwörend die Hände.
»Immer dieses Gerede von Colonel Rostand, Mr.
Temple! Ich glaube, Sie haben so etwas wie einen
kleinen Rostand-Komplex. Ich versichere Ihnen, Mr.
Vandenberg ist hier sehr gut bekannt.«
»Das freut mich für Sie, Mr. Schultz. Colonel Ros-
tand wird nämlich auch hier von der Polizei gesucht.«
»Übrigens, da wir von der Polizei sprechen« -
Schultz offerierte mir aus seinem goldenen Etui eine
Zigarette und zündete sich, nachdem ich abgelehnt
hatte, selbst eine an -, »ja, da wir gerade von der
Polizei sprechen. Inspektor Flambeau erzählte mir
eine höchst merkwürdige Geschichte: daß Sie gebeten
worden sind, einem gewissen David Foster eine Brille
zu überbringen, und daß Monsieur Constantin Ihnen
zehntausend Pfund für diese Brille geboten hat. Ist das
wahr?«
»Ja, das ist wahr.«
»Haben Sie denn eine Idee«, fragte Schultz kopf-
schüttelnd, »warum eine Brille einen so unangemes-
sen hohen Wert besitzen und das Interesse so vieler
Leute erwecken kann?«
»Ja, ich habe eine Idee. Und da so viele Leute in-
teressiert sind, Mr. Schultz, frage ich mich, ob Sie
vielleicht auch dazu gehören?«
Schultz schüttelte abermals den Kopf und lächelte
still belustigt.
»Warum sollte ich interessiert sein, Mr. Temple?
Über meine Sehkraft ist nicht zu klagen. Aber wenn

212
Sie mich jetzt entschuldigen möchten - ich möchte
meinen Gastgeber finden.«
Nachdem Schultz im Speisesaal verschwunden war,
setzte ich meinen Weg zur Bar fort, wo ich Wyse
damit beschäftigt fand, so trübselig in die Bläschen
seines Champagnercocktails zu starren, als habe er
aller Hoffnung entsagt, mich hier noch erscheinen zu
sehen. Seine Miene erhellte sich, als er mich erblickte,
aber es schien ihn zu beunruhigen, daß ich allein war.
»Noch keine Nachricht von Ihrer Frau? Oh, das ist
schrecklich, schrecklich.«
Er war so ehrlich bekümmert, daß es mir das Herz
erwärmte. »Wie kann jemand wünschen, Mrs. Temple
etwas anzutun?« In diesem Moment entschloß ich
mich, es darauf ankommen zu lassen und Tony Wyse
ins Vertrauen zu ziehen. Mit der Art Schattenboxen,
wie ich es bei Rostand und Schultz versucht hatte,
kam ich nirgendwohin.
»Suchen wir uns einen Tisch, wo wir sprechen
können«, schlug ich vor. »Ich werde Ihnen alles
erzählen.«
»Ich habe einen Tisch im Speisesaal bestellt. Wir
können sofort hineingehen, wenn es Ihnen recht ist.«
Ich hatte eigentlich keinen Appetit, aber Wyse nö-
tigte mich, ein ausgewählt gutes Dinner zu verzehren,
was sich am Ende als recht nützlich erwies, denn ich
sollte noch jede einzelne Kalorie brauchen, ehe jene
lange Nacht vorüber war.
Während wir aßen, erzählte ich ihm fast die ganze

213
Geschichte: Wie wir Judy Wincott in Paris getroffen
hatten; mein Versprechen, die Brille zu überbringen;
die Serie von Morden, die sich an unsere Fersen
geheftet hatte - in Paris, Nizza, Algier und hier in
Tunis. Er hörte sehr aufmerksam zu, unterbrach mich
nur selten mit einer kurzen Frage und erschien mir
jetzt weit weniger als der oberflächliche Playboy wie
bisher.
»Eine ganz ungewöhnliche Geschichte«, sagte er,
als ich geendet hatte. »Sie scheinen tatsächlich in eine
sogenannte dicke Sache hineingeraten zu sein. Aber
wie, um alles auf der Welt, kann eine Brille genug
Wert haben, um fünf Morde zu rechtfertigen?«
»Ich wäre ziemlich erleichtert, wenn ich Ihnen das
verraten könnte.«
»Es scheint sich hier um mehrere Banden zu han-
deln. Ich meine, Rostand und Schultz müssen Hand in
Hand mit Leyland und der nun erdrosselten Audry
Bryce gearbeitet haben. Constantin könnte ein Einzel-
gänger gewesen sein - falls er nicht mit Szoltan Gupte
und O'Halloran zusammenhing. Das Wichtigste für
Sie ist, zu wissen, welche Gruppe Steve gekidnappt
hat - oh, Entschuldigung, ich meine Mrs. Temple.«
»Sie haben eine Person ausgelassen.«
»Ach, wen denn?«
»Simone Lalange. Sie hat eine Art, ab und zu auf-
zutauchen, die nicht rein zufällig sein kann. Wo
würden Sie sie einordnen?«
»Simone?« Wyse blickte sehr jungenhaft und be-

214
kümmert drein. »Sie glauben doch nicht ernstlich, daß
Simone in alles das verwickelt ist?«
»Ich vergaß, Ihnen zu erzählen, daß Steve, unmit-
telbar bevor wir Judy Wincott ermordet in dem
Wandschrank fanden, vor der Zimmertür ein leeres
Zündholzbriefchen mit den aufgedruckten Initialen S.
L. vom Korridorboden aufgelesen hat. Genau solche
Zündholzbriefchen führt Simone Lalange bei sich.«
»Ach, das hat nichts zu bedeuten«, rief Wyse er-
leichtert aus. »Sie selbst erzählte mir, daß sie dieses
Zimmer abgelehnt hat, weil es keinen Baderaum
besitzt. Wahrscheinlich hat sie das leere Briefchen
verloren oder achtlos fortgeworfen, als man ihr das
Zimmer zeigte.«
»Dennoch«, beharrte ich, »dürfte an Mademoiselle
Lalange mehr sein, als man auf den ersten Blick
sieht.«
»Mr. Temple«, widersprach Wyse, »ich glaube,
hier sind Sie auf dem Holzweg.« Er drückte seine
Zigarette etwas zu schwungvoll in den Aschenbecher.
»Ich wünschte, ich könnte Ihnen helfen. Gibt es nichts
mehr, was Sie mir noch nicht erzählt haben? Furcht-
bar schade, daß Sie diese Brille nicht bei sich haben.
Ich würde viel darum geben, wenn ich sie sehen
könnte.«
»Würden Sie das? Was halten Sie von einem Lunch
mit meiner Frau und mir, morgen im Hotel Concorde?
Dann werde ich sie Ihnen zeigen. Wir könnten auch
Simone Lalange einladen.«

215
»Eine gute Idee«, begann Wyse begeistert. Dann
zögerte er. »Aber Sie sagten, mit Ihrer Frau. Ange-
nommen, Mrs. Temple...«
»Angenommen, ich habe sie bis dahin nicht gefun-
den? In diesem Fall würde ich Ihnen die Brille nicht
zeigen können. Wenn die Entführer bis morgen früh
keinen Vorschlag gemacht haben, werde ich die Brille
in hunderttausend winzige Stückchen zerschlagen.
Und wenn es Ihnen nichts ausmacht, möchte ich jetzt
zurück ins Hotel.«
»Ich habe ein Auto draußen«, sagte Wyse und
winkte dem Kellner. »Ich fahre Sie in die Stadt.«
Wahrscheinlich hätte ich Wyses Auto unter all den
Wagen auf dem Hotelparkplatz auch dann herausge-
funden, wenn ich allein auf die Suche gegangen wäre.
Es war ein kleiner englischer MG-Zweisitzer von
erschreckend grellgrüner Farbe.
Wyse entfernte mit geschickten Fingern die Lein-
wandplane, die die beiden engen Sitze schützte.
»Etwas frische Luft wird Sie doch nicht stören? Ich
kann natürlich auch das Verdeck hochklappen, wenn
Sie es möchten.«
»Mir ist frische Luft schon recht«, entgegnete ich
und zwängte meine Beine nicht ganz mühelos in den
dafür vorgesehenen schmalen Raum.
Kiesbröckchen wurden in hohem Bogen durch die
Luft gewirbelt, als wir im Schnellstart vom Parkplatz
hinaus auf die Straße jagten, und die Reifen der

216
Hinterräder jaulten, sobald wir auf der Betonfahrbahn
waren. Wyse malträtierte sein Auto rücksichtslos; bei
jedem Gangschalten war die Beschleunigung so
rapide, daß ich mich heftig gegen die Lehne meines
Sitzes gedrückt fühlte. Das Motorengeräusch und das
Sausen des Fahrtwindes machten eine Unterhaltung
unmöglich. Ich langte mit einer Hand nach dem etwas
beruhigend wirkenden Haltegriff neben der Armatu-
rentafel und versuchte, die Schönheit der vorüberra-
senden Landschaft im Scheinwerferlicht zu erkennen,
soweit sich das machen ließ.
Wir jagten die Hügelstraße von Sidi bou Said in
wahrem Höllentempo hinab. Die weißen Luxusvillen
reicher arabischer Kaufleute blieben hinter uns zurück
wie Spukgebilde.
Wyse schien außerordentlich beflissen, mir die
Kurvensicherheit seines kleinen Autos zu zeigen. Er
steuerte jede Kurve an, ohne das Tempo zu mindern,
schnitt sie verwegen wie ein Rennfahrer und geriet
dann häufig genug für ein Weilchen auf die Gegen-
fahrbahn. Wäre uns in einer dieser Kurven ein anderer
Wagen begegnet, dann hätte es unvermeidlich zwei
Autowracks sowie Tote und Schwerverletzte gegeben.
Ich packte den Haltegriff fester und versuchte, mich in
orientalischem Fatalismus zu üben. Das gelang nicht
sehr gut, aber glücklicherweise begegnete uns an den
kritischen Stellen kein anderer Wagen.
Wieder einmal drehte Wyse bravourös das Lenkrad,
wieder einmal hatte ich das Gefühl, mein linker

217
Ellbogen werde sogleich die Seitenwand des Autos
durchbrechen. Da begann das Wagenheck nach außen
zu schleudern. Wyse riß das Lenkrad entgegengesetzt
herum, um das Schleudern aufzufangen. Aber seine
Maßnahme blieb ohne Einfluß auf das Verhalten des
Autos. Ich sah ihn wie verrückt am Lenkrad arbeiten,
das plötzlich keinen Widerstand mehr zu haben
schien. Das Auto wirbelte wild und wurde dabei durch
seinen eigenen Schwung gegen den flachen Straßen-
graben und die dahinter aufsteigende Böschung
getragen. Mit dem Heck voraus überwand es den
Straßengraben und prallte gegen die grasbewachsene
Böschung. Der Aufprall war so stark, daß wir fast aus
den Sitzen geworfen wurden. Da die Vorderräder
noch auf der Straße waren, als das Heck jenseits des
Grabens einen halben Meter tiefer gegen die Bö-
schung geriet, hob der Schwung das Vorderteil des
Autos, so daß ich plötzlich die Motorhaube fast
senkrecht über mir in die Luft ragen sah und mich
instinktiv in meinem Sitz zusammenduckte. Einen
Moment lang stand das Auto auf seinem Heck, dann
kippte es langsam um, wobei es sich halb um seine
Längsachse drehte, und blieb mit den Rädern nach
oben liegen.
Der Graben bewahrte uns davor, unter dem Auto
zerquetscht zu werden, denn es lag nun mit der
Motorhaube auf der Straße und mit dem Heck auf der
jenseitigen Grabenböschung, so daß wir uns unter den
flachen Türen hindurch ins Freie zwängen konnten.

218
Während ich dies noch tat, hörte ich Benzin aus dem
leckgewordenen Tank tropfen und hatte das unange-
nehme Gefühl, daß das Autowrack jeden Moment
explodieren könnte. Als ich mich draußen aufrichtete,
sah ich Wyse auf der anderen Seite dasselbe tun.
»Puh! Das war nahe daran!« rief er aus und starrte
zurück zu den korkenzieherartig gewundenen Reifen-
spuren auf der Straße. »Ich bin nicht zu schnell
gefahren, wissen Sie«, fügte er hinzu. »Ich hätte das
Schleudern leicht auffangen können, aber das Lenkrad
ging plötzlich leer!«
Die Tatsache, daß er sich selbst und mich um ein
Haar zu Tode gefahren hätte, schien ihm weniger
wichtig als der Nachweis, nicht für das Unglück
verantwortlich zu sein. Ich nehme an, der Mitfahrer,
der nichts tun kann, als hilflos zuzusehen, hat bei
solchen Gelegenheiten immer die schlechteste Zeit.
Ich ging weit genug von dem verunglückten Auto
fort, um mir in Sicherheit eine Zigarette anzünden zu
können. Wyse war noch einmal halb unter das Auto
gekrochen und hatte eine Taschenlampe aus dem
Handschuhfach geholt. Ich sah ihn damit die Vorder-
achse des Wagens untersuchen. Nach einigen Minuten
kam er zu mir, sehr nachdenklich dreinblickend, und
sagte: »Jemand scheint uns nicht ganz freundlich
gesonnen zu sein. Das war ein Stück wohlüberlegter
Sabotage.«
»Wie meinen Sie das?«
»Der Lenkschenkel war aus seiner Lagerung gelöst

219
und wurde nur von einem Stück Draht gehalten, das
bei etwas stärkerem Druck reißen mußte.«
Wir hatten das Glück, von einem leer aus Sidi bou
Said zurückkehrenden Taxi nach Tunis gebracht zu
werden. Wyse setzte mich beim Hotel Concorde ab,
ehe er sich zu einer Werkstatt fahren ließ, die für das
Abschleppen seines Autos sorgen sollte.
»Vergessen Sie nicht«, rief er mir durch das Fenster
des startenden Taxis zu, »wir sind für morgen zum
Lunch verabredet! Sie haben Ihr Versprechen doch
nicht vergessen?«
»Ich halte meine Versprechen immer«, rief ich ihm
nach.

220
9
Sir Graham Forbes hatte noch keine fünf Minuten
gewartet, als ich ihn im Schreibzimmer des Hotels
fand, seine Brille auf der Nase und einen maschinen-
geschriebenen Bericht auf den Knien.
»Entschuldigen Sie, daß ich Sie warten ließ, Sir
Graham. Ich hatte auf dem Heimweg einen kleinen
Unfall.«
»Ich freue mich, Sie zu sehen, Temple.« Sir Gra-
ham kam mir mit ausgestreckter rechter Hand entge-
gen.
Einen Moment lang waren wir beide betreten. Wir
hatten uns schon an vielen gewohnten und ungewohn-
ten Orten getroffen, aber fast immer war noch eine
andere Person dabeigewesen, deren Fehlen uns jetzt
schmerzlich bewußt wurde - Steve.
»Ich bin froh, daß Sie gekommen sind«, sagte ich.
»Ich habe einen guten Freund jetzt sehr nötig.«
»Ich verstehe. Wo können wir ungestört sprechen?«
»Unsere Suite wäre am besten geeignet, denke ich.«
Das Hotelfoyer war fast verlassen, als wir zum Lift
gingen. Als äußerst respektables Hotel kam das
›Concorde« jeden Abend zeitig zur Ruhe.
Ȇbrigens versprach ich dem Empfangschef, Ihnen
eine Nachricht zu übermitteln«, sagte Sir Graham im
Lift zu mir. »Seit zehn Uhr hat jede Viertelstunde ein
Mann angerufen und nach Ihnen gefragt. Ein gewisser
Leyland.«

221
»Leyland? Was will er?«
»Das hat er anscheinend nicht verraten. Fragte wohl
nur immer, ob Mr. Temple noch nicht zurück wäre.«
»Weiß man, von wo er telefonierte?«
»Das glaube ich nicht. Der Mann wollte nicht viel
sagen.«
»Nun, wenn er wieder anruft, kommt das Gespräch
ja in meine Suite.«
Als wir den Etagenkorridor entlanggingen, sah ich,
daß die Tür zu Audry Bryces Suite offenstand und das
Zimmermädchen das Bett neu bezog. Ich blieb an der
Tür stehen und fragte das Zimmermädchen, wann die
Suite freigeworden wäre.
»Kurz nach der Abendessenszeit, Monsieur. Ma-
dame Bryce bleibt bei Freunden. Der Chauffeur kam,
um ihr Gepäck zu holen.«
»Sehr gründlich«, murmelte ich, als ich mich wie-
der zu Forbes gesellte und meinen Schlüssel ins
Türschloß schob.
»Was denn?«
»Das erkläre ich Ihnen später, Sir Graham.«
Ich schloß die Tür hinter uns und verriegelte sie.
Dann zog ich die Jalousie der Balkontür hoch, um
etwas frische Abendluft einzulassen. Forbes nahm in
einem der Sessel Platz, während ich zum Telefon
ging, um den Empfang anzurufen.
»Falls jetzt Gespräche für mich kommen, lassen Sie
sie bitte in meine Suite durchstellen. Erinnern Sie sich
an das Briefkuvert, das ich Ihnen zur Aufbewahrung

222
gab? Würden Sie es mir bitte von einem Pagen
heraufbringen lassen?«
Ich wandte mich wieder Sir Graham zu, der seinen
Tabaksbeutel herausgeholt hatte und mit dem Stopfen
einer Pfeife beschäftigt war.
»Nun, Sir Graham, wie lautet die Lösung dieses
Rätsels? Ist es nicht wahr, daß Ihr Arzt Ihnen voll-
kommene Ruhe verordnet hatte?«
»Ich fürchte, das war ein Märchen, Temple. Ich
wollte nicht viel über das sprechen, was ich tat. Die
Wahrheit ist, daß ich in Zusammenarbeit mit der
Interpol während der letzten Zeit in Paris gewesen
bin.«
»Sie sagten mir am Telefon, Sie seien wegen einer
Brille hierhergekommen. Würde es Ihnen etwas
ausmachen, dies ein wenig näher zu erläutern?«
Forbes paffte ein paar Sekunden lang an seiner
Pfeife; das Zündholzflämmchen über dem Pfeifenkopf
tanzte auf und nieder.
»Ich wollte mir eigentlich einiges von Ihnen erläu-
tern lassen, Temple. Habe ich recht, wenn ich sage,
daß Ihnen in Paris eine Brille übergeben wurde, durch
die Sie in eine Reihe von Unannehmlichkeiten
gerieten?«
»Unannehmlichkeiten? Das verdient einen Preis für
Untertreibung, Sir Graham. Etliche Leute wurden
ermordet, zum Teil fast direkt vor unseren Nasen,
man versuchte, Steve und mich mit einem Motorboot
zu überrennen, ich bin mit Erschießen bedroht worden

223
und entging heute abend bei einem Autounglück wie
durch ein Wunder dem Tod, während meine Frau seit
heute vormittag verschwunden ist. Und das nennen
Sie Unannehmlichkeiten?« Forbes hatte inzwischen
aus seiner Pfeife so gewaltige Rauchwolken emporge-
schickt, daß die Zimmerdecke über ihm nur noch
undeutlich zu sehen war. »Würden Sie so nett sein,
mir zu verraten«, fuhr ich fort, »was Sie über alles
dies schon wissen?«
»Die Interpol ist eine großartige Organisation«,
erklärte er. »Wir haben Ihre Abenteuer verfolgt, seit
Sie in Nizza von Monsieur Mirabel befragt wurden.
Ein kluger Mann, dieser Mirabel, sehr -«
Er unterbrach sich, da an der Tür geklopft wurde.
Ich ging hin, machte sie auf und gab dem Pagen, der
mir das Kuvert mit dem Stadtplan überreichte, ein
Trinkgeld. Sir Graham hob wißbegierig die Augen-
brauen, aber als er sah, daß ich darauf wartete, mehr
zu hören, räusperte er sich und fuhr fort: »Ihre un-
glücklichen Erlebnisse hängen, wie sich ergab, mit
einem Fall zusammen, an dem ich bei der Interpol
mitarbeite. Sie haben natürlich von den Melrose-
Juwelen gehört?«
»Wer hätte das nicht? Eine der wertvollsten priva-
ten Sammlungen. Sie wurde Ende vorigen Jahres aus
dem Schloß des Herzogs von Melrose gestohlen. Die
Neuigkeit machte damals Sensation. Hatten nicht die
Räuber einen Tunnel von einem nahen Bauernhaus
unter der Schloßmauer hindurch direkt bis zu der im

224
Keller gelegenen Familienschatzkammer getrieben?«
»Ja. Ein sehr waghalsiges und raffiniert geplantes
Unternehmen. Der Raub wurde erst vier Tage später
entdeckt. Der Wert der Beute lag nahe bei einer
halben Million Pfund.«
»Und das ist der Fall, an dem Sie zusammen mit
der Interpol arbeiten?«
»Ja. Die Tat wurde von einer Bande ausgeführt,
aber der leitende Kopf war ein Mann namens
Leather.«
»Leather?«
»Adrian Leather. Ein internationaler Verbrecher.
Sie kennen den Namen?«
»Ja, ich kenne ihn. Entschuldigen Sie bitte, daß ich
Sie unterbrach.«
»Nun, sie schafften die Beute aus Großbritannien
fort, und wir wissen noch nicht, wie. Aber wir wissen,
daß sie damit bis nach Tunesien kamen, ehe ihnen die
Verfolger zu nahe rückten. Leather versteckte die
Juwelen und machte sorgfältige Aufzeichnungen über
das Versteck. Die Mitglieder der Bande waren über-
eingekommen, die Beute aufzuteilen und zu warten,
bis ein wenig Gras über die Sache gewachsen wäre,
ehe sie anfangen würden, die einzelnen Stücke zu
verkaufen. Aber was nützen die schönsten Absichten,
wenn etwas dazwischenkommt? Vor drei Monaten
wurde Leather auf einer Pariser Straße von einem
Auto überfahren und erlitt schwere innere Verletzun-
gen, denen er drei Tage später in einem Pariser

225
Krankenhaus erlag. Während dieser Zeit wich eine
ihm offenbar sehr zugetane Frau nicht von seinem
Bett -«
»Mrs. Audry Leather«, warf ich ein.
»Nein«, entgegnete Forbes. »Das stimmt nicht. Es
war ein Mädchen namens Diana Simmonds.«
»Diana Simmonds! Das ist ja das Mädchen, das
ermordet in der Abfalltonne des Pariser Hauses
gefunden wurde, in dem wir wohnten!«
»Richtig. Und nun das Interessanteste -«
Forbes hielt inne, weil das Telefon klingelte. Ich
ging hin und nahm den Hörer auf.
»Temple.«
»Hier spricht der Empfangschef, Mr. Temple. Ein
Mr. Leyland ist hier und möchte Sie sprechen.«
»Was? Er ist hier im Hotel?«
»Ja, Mr. Temple.«
»Sagen Sie ihm bitte, er möchte heraufkommen.«
»Sehr wohl, Mr. Temple.«
Während der knappen Minute, die Leyland unge-
fähr brauchen mochte, um mit dem Lift in die dritte
Etage zu kommen, informierte ich Sir Graham in
kurzen Zügen, wie dieser Mann in die Sache paßte.
Ich wollte eben die Zimmertür aufschließen, als ich
von draußen das vertraute Geräusch der sich öffnen-
den Lifttüren vernahm. Fast unmittelbar danach
erkannten wir beide, Sir Graham und ich, einen Ton,
den niemand vergißt, der ihn einmal gehört hat - das
trockene Husten einer Pistole mit Schalldämpfer. Es

226
dauerte vielleicht eine Sekunde, bis wir den Zusam-
menhang begriffen, und weitere zwei oder drei
Sekunden, bis ich die Tür aufgeschlossen und geöff-
net hatte.
Nahe dem Lift lag Sam Leyland gekrümmt am
Boden, mit einer Hand nach seinem Rücken tastend.
Die Lifttüren schlossen sich mit leisem Fauchen; ich
konnte nicht mehr sehen, wer in der Kabine war.
»Telefonieren Sie zum Foyer«, rief ich zu Sir Gra-
ham zurück. »Wer mit dem Lift hinabkommt, muß
festgehalten werden!«
Ich eilte zu Sam Leyland, ließ mich neben ihm auf
ein Knie nieder und sah zu meinem Erstaunen, daß er
versuchen wollte aufzustehen.
»Vorsichtig!« mahnte ich ihn. »Keine unnötige
Bewegung!«
»Kümmern Sie sich nicht um mich«, keuchte er.
»Schnappen Sie diesen Bastard.«
Ich eilte zurück zum Zimmer und prallte in der Tür
mit Sir Graham zusammen.
»Hab' beim Empfang Bescheid gesagt«, berichtete
er. »Sie werden jeden festhalten, der aus dem Lift
kommt.«
Über seine Schulter hinweg sah ich den Telefonhö-
rer noch neben dem Apparat auf dem Tisch liegen.
»Helfen Sie mir, ihn hereinzuholen und auf mein
Bett zu legen.«
Gemeinsam trugen wir Leyland in das Zimmer und
legten ihn auf mein Bett. Während Forbes ans Telefon
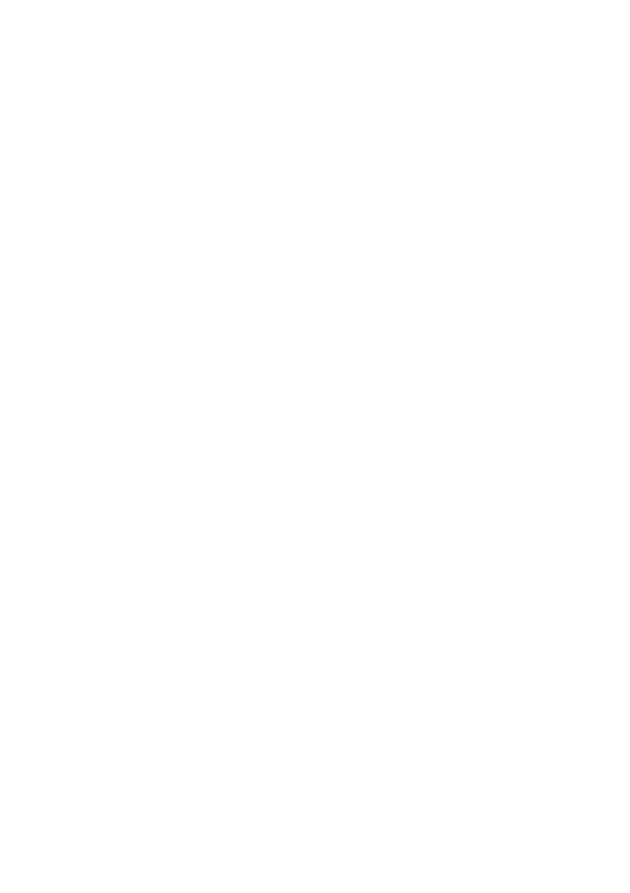
227
zurückkehrte, streifte ich Leyland die Jacke ab und riß
ihm das Hemd am Rücken auf. Der Einschuß befand
sich unmittelbar unterhalb seiner linken Rippenpartie.
Die Kugel hatte wahrscheinlich seine linke Niere
getroffen.
»Die Schweine müssen es besser machen, wenn sie
Sam Leyland stoppen wollen«, knurrte mein Patient.
»Der Feigling hat mich in den Rücken geschossen!«
»Sahen Sie, wer es war?«
»Nein. Aber bestimmt einer von Rostands Schur-
ken. Oh, ich möchte mal drei Minuten allein mit
Rostand im Boxring stehen. Au, verdammt -«
Er hatte versucht, sich herumzudrehen, es aber
schnell wieder unterbrochen. Sir Graham legte den
Telefonhörer auf.
»Der Lift ist nicht bis zum Parterre hinabgefahren«,
sagte er. »Unser Mann muß in der zweiten oder in der
ersten Etage ausgestiegen und über die Feuertreppe
oder durch den Hinterausgang entkommen sein. Das
Hotel telefoniert nach einem Rettungswagen und mit
der Polizei. Wie geht's dem Patienten?«
»Nicht so schlecht«, keuchte Leyland. »Bin viel-
leicht auf die Bretter gegangen, aber noch nicht k. o.
Komische Sache, wissen Sie - es schmerzt gar nicht
sehr. Ein bißchen so, als habe mir ein ziemlich matter
Gaul einen Hufschlag in den Rücken versetzt. Aber
merkwürdig kalt ist mir.«
»Das kommt von dem Schock. Wenn er abklingt,
werden Sie die Kugel spüren.«

228
»Mr. Temple -«
»Ja?«
»Ich kam hierher, um Ihnen was zu sagen. Das paßt
denen nicht, aber deswegen sag' ich's verdammt doch.
Wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen, geben Sie
Rostand die Brille.«
»Haben Sie Steve gesehen? Wissen Sie, wo sie
ist?«
In meiner Erregung packte ich ihn fester beim Arm,
als ich es beabsichtigte.
Er machte einen lahmen Versuch, meine Hand
abzuschütteln, und sagte, als ich wieder losließ: »Nee,
mein Freund, ich weiß nicht, wo sie sie jetzt versteckt
halten. Aber ich weiß, daß sie lebt und daß man ihr
kein Haar gekrümmt hat. Was mehr ist, als sich von
der armen Audry Bruce sagen läßt. Diese Sache hat
mich abspringen lassen. Mord liegt nicht auf meiner
geschäftlichen Linie.«
»Welches ist Ihre geschäftliche Linie, Leyland?«
»Na, wissen Sie, ich hab ja schon allerlei gemacht.
Aber dieses Angebot von Rostand war das beste, das
ich jemals hatte. Eine Brille klemmen - viertausend
Pfund!«
»Wissen Sie, warum Rostand die Brille unbedingt
haben will?«
»Nee, mein Freund. Ich bin nicht dafür, zu viele
Fragen zu stellen. Sagen Sie mal, würde es mir
schaden, wenn ich eine Zigarette rauche?«
Mit meiner Hilfe drehte er sich vorsichtig auf den

229
Rücken. Ich zündete eine Zigarette für ihn an und
steckte sie ihm zwischen die Lippen.
»Hat Ihnen Ihre Motorbootfahrt in der Bucht von
Nizza Spaß gemacht?« fragte ich in beiläufigem Ton.
»Das kam dicht an Mord heran, nicht wahr?«
»Rostand hatte diese Idee, nicht ich«, antwortete
Leyland kleinlaut. »Er dachte, Sie hätten die Brille an
die Polizei abgeliefert und sollten dafür einen Denk-
zettel bekommen.«
»Demnach war Rostand auch in Nizza? Erzählen
Sie mir, Sam - was geschah wirklich in der Villa
Negra? Warum wurde Thompson zusammengeschla-
gen und erschossen?«
Leyland zog heftig an seiner Zigarette. Ich sah, daß
die Wunde ihn zu schmerzen begann. Sein Gesicht
nahm eine häßliche graue Farbe an, und seine Stimme
kam immer stockender. Ich hoffte, der Rettungswagen
würde bald eintreffen.
»Will nicht direkt sagen, daß er verdient hatte, was
er kriegte. Aber er war zu geldgierig. Einhundert
Pfund, um sich als David Foster auszugeben! Nach-
dem er Sie im Hotel Aletti angerufen hatte, wollte er
den Preis steigern. Rostand sah es anders.«
Forbes hatte vom Balkon auf die Straße hinabgese-
hen. Aus der Art, wie er jetzt ins Zimmer zurückkehr-
te, erkannte ich, daß der Rettungswagen eingetroffen
war.
»Noch etwas, Sam. Habe ich recht mit der Vermu-
tung, daß Rostand und Schultz zusammenarbeiten?«

230
»Jetzt ja. Vor dem Abend, an dem Sie in der Villa
Negra waren, kannten sie sich zwar, arbeiteten aber
nicht zusammen, sondern waren, wie man im Ge-
schäftsleben sagt, eher Konkurrenten. Dann taten sie
sich zusammen.«
»Sahen Sie je etwas von Constantin oder O'Hallo-
ran oder einem gewissen Szoltan Gupte?«
Sam Leyland runzelte die Stirn und versuchte sich
zu erinnern. Plötzlich ächzte er mit schmerzverzerr-
tem Gesicht: »Bei Gott, mir ist, als habe ich ein
glühendes Messer im Rücken! - Nein, ich sah nie
einen von ihnen. Nach der Art, wie Rostand über sie
sprach, gehören sie zu einer anderen Bande.«
Vom Etagenkorridor erklangen Stimmen und auch
einiges Geklapper, als würde ein sperriger Gegenstand
aus dem Lift geholt. Sam Leyland legte mir eine Hand
auf den Arm.
»Werden Sie bei der Polizei ein gutes Wort für Sam
Leyland einlegen? Ich habe getan, was ich konnte, um
Ihnen zu helfen.«
Im nächsten Moment stürmte Renouk mit seinem
Gefolge herein. Die Männer vom Rettungswagen
transportierten Leyland ziemlich bald von dannen.
Aber Renouk konnten wir erst loswerden, nachdem
wir ausführlich unsere Wahrnehmungen bei dem
Überfall auf Leyland berichtet hatten. Von den
Informationen, die Leyland mir gegeben hatte, teilte
ich ihm das mit, was ihm nützlich sein konnte.
Mit einer gewissen Erleichterung sahen Sir Graham

231
Forbes und ich schließlich die Tür hinter dem letzten
Polizeibeamten zugehen.
»Die Dinge beginnen in Bewegung zu kommen«,
sagte Forbes. »Ich denke, Renouk wird bald sein Netz
auswerfen.«
»Doch unserem Hauptanliegen sind wir noch nicht
näher gekommen, Sir Graham.«
»Steve? Nein, da haben Sie recht. Aber die Gegen-
seite muß bald einen Schachzug tun, das ist unver-
meidlich. Und welcher Zug das auch sein mag -
unsere Pläne stehen fest. Was Sie zu entscheiden
haben, Temple, ist die Frage, ob Sie diesen Leuten die
Brille gegen eine sichere Rückkehr Ihrer Frau überlas-
sen wollen.«
»Das zu tun, bin ich nicht in der Lage, Sir Graham.
Nicht vor zehn Uhr morgen vormittag. Die Brille liegt
bei der hiesigen Filiale von Lloyds Bank in der
Stahlkammer.«
Sir Graham Forbes erlaubte sich die seltene Ge-
fühlsäußerung, einen leisen Pfiff ertönen zu lassen.
»Das gibt den Dingen ein ganz anderes Aussehen.
Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?«
»Das ist eine lange Geschichte«, warnte ich ihn.
»Trotzdem möchte ich sie hören.«
Ich gab also eine vollständige Schilderung alles
dessen, was sich seit meiner ersten Begegnung mit
Judy Wincott im Café Fouquet in Paris zugetragen
hatte. Sir Graham hörte aufmerksam zu, ohne ein
einziges Mal zu unterbrechen, und machte sich

232
gelegentlich Notizen. Als ich geendet hatte, ging er
mit mir die Liste der notierten Fragen durch, um die
Einzelheiten zu klären, über die er im Zweifel war.
Schließlich sagte er: »Nun ist alles klar, denke ich.
Und ich stimme mit Ihrer Vermutung überein, wel-
ches unter den gegebenen Umständen Rostands
nächster Schachzug sein wird. Nun, ich habe meine
eigenen Ideen, Temple. Aber in Anbetracht der
Tatsache, daß Steve das Pfand ist, denke ich, es liegt
an Ihnen, vorzuschlagen, was getan werden soll.«
»Gut«, erwiderte ich und breitete den Stadtplan von
Tunis aus, den ich an Bord der Jacht gefunden hatte.
»Hören Sie, was ich vorschlage. Meine Ansicht ist,
daß die roten Kreise auf dem Stadtplan die verschie-
denen Gebäude bezeichnen, an denen die Bande
interessiert ist. Zum Beispiel sind dieses Hotel und
das ›Haus künstlerischer Raritäten‹ rot umkreist. Die
Kreuze zeigen an, wo gewisse Dinge passieren sollten
oder passierten. Ich glaube, das Kreuz in der Avenue
de Rome markiert zum Beispiel die Stelle, an der
Steve entführt wurde.«
»Ich schließe mich Ihrer Meinung an. Wäre es nicht
ratsam, die Polizei zu bitten, sich unverzüglich mit
allen diesen Gebäuden zu befassen?«
»Mit Steve in einem dieser Gebäude?«
Forbes gab durch eine Kopfbewegung zu verstehen,
daß er meinen Einwand anerkannte.
»Nein«, fuhr ich fort. »Mein dringlichstes Verlan-
gen ist, dorthin zu gehen, wo Steve sich befindet, und

233
bei ihr zu sein, wenn der Ballon hochgeht. - Was
würden Sie tun, Sir Graham, wenn Sie an Rostands
Stelle wären?«
Er räusperte sich zweimal und rieb sein Kinn. Dann
befühlte er die linke Seitentasche seines Jacketts, und
ich wußte, daß ich gleich wieder sein ganzes Zeremo-
niell mit der Pfeife erleben würde.
»Nun«, sagte er nach kurzem Überlegen, »da ich -
an Rostands Stelle - Ihnen im Hotel Tunesia begegnet
bin und weiß, daß die Polizei binnen kurzem ganz
Tunis auf den Kopf stellen dürfte, würde ich befinden,
daß unverzüglich etwas zu geschehen hat. Da ich Ihre
Nerven hinreichend strapaziert habe, würde ich
wissen, daß Sie sehr zappelig sind. Ich würde bis in
die frühen Morgenstunden warten, wenn die Moral
eines Mannes am tiefsten steht, und Sie dann unter
Druck setzen.«
»Und wie würden Sie das tun? Telefonisch?«
»Ja. Aber ich würde wissen, daß jeder an Sie ge-
langende Anruf von der Polizei zurückverfolgt
werden kann. Ich würde Sie also aus einer abgelege-
nen Telefonzelle anrufen und Ihnen sagen, daß, wenn
Sie Ihre Frau lebendig wiedersehen wollen, Sie sich
lieber schleunigst mit der Brille an einem von mir
benannten Punkt einzufinden hätten.«
»Das ist es, was ich auch denke. Und wenn dieser
Anruf kommt, werde ich zweifellos sehr schnell
handeln müssen. Ihnen wird es überlassen bleiben,
den Gegenangriff zu organisieren. Wenn Sie den

234
Anruf zurückverfolgt haben, können Sie auf dem
Stadtplan die Lage der Telefonzelle feststellen und
entscheiden, bei welchem der markierten Häuser Sie
Ihr Glück versuchen wollen. Aber ich verlasse mich
darauf, daß Sie Renouk von der Veranstaltung eines
Artillerieduells abhalten werden -«
»Sie gehen ein großes Risiko ein«, unterbrach For-
bes nachdenklich. »Noch etwas. Dürfte unser Freund
Rostand nicht ziemlich rauh werden, wenn er findet,
daß Sie mit leeren Händen gekommen sind?«
Ich antwortete nicht, sondern sah Sir Graham fra-
gend an.
»Was gucken Sie so?«
»Sir Graham -«
»Ja?«
»Wäre es Ihnen sehr unangenehm, sich für einige
Zeit von Ihrer Brille zu trennen?«
Er schaute mich noch sehr verwundert an, als das
Telefon klingelte. Wir beide sahen schnell zu dem
Apparat. Dann ging ich hin, um das Gespräch anzu-
nehmen. Ich hatte im Lauf des Tages so viele Anrufe
bekommen, daß ich mir einzureden versuchte, dieser
hier sei nicht der entscheidende. Aber als ich den
Hörer aufnahm, war er wie ein lebendiges Etwas in
meiner Hand.
»Temple.«
»Hören Sie, Temple. Sie wollen Ihre Frau wieder-
sehen - lebendig?«
»Ja.«

235
»Dann hören Sie aufmerksam zu, und befolgen Sie
meine Instruktionen schnell und genau.« Die Stimme
klang gedämpft und so tief, als spreche der Anrufer
durch ein Taschentuch und mit absichtlich veränderter
Tonlage. »Sie werden die ganze Zeit beobachtet. Falls
Sie versuchen, uns zu täuschen oder irgendwie
Kontakt mit der Polizei aufzunehmen, wird Ihre Frau
im Sterben liegen, wenn Sie zu ihr kommen. Haben
Sie mich verstanden?«
»Ja. Weiter.«
»Haben Sie die Brille bei sich?«
»Ja.«
»Ich hoffe, Sie sagen die Wahrheit. Innerhalb zehn
Sekunden nach Ende dieses Gesprächs werden Sie Ihr
Hotelzimmer und innerhalb weiterer dreißig Sekunden
das Hotel selbst verlassen. Gegenüber dem Hotel auf
der anderen Straßenseite wartet ein Taxi. Da steigen
Sie ein. Verstanden?«
»Ja.«
»Demnach haben Sie vierzig Sekunden von jetzt
an.«
Es klickte in der Leitung, und die Verbindung war
beendet. Ich beobachtete den Sekundenzeiger meiner
Uhr.
»Die Stimme habe ich nicht erkannt«, sagte ich
schnell zu Sir Graham. »Ich muß mich sehr beeilen.
Leihen Sie mir bitte Ihre Brille?«
Etwas traurig dreinblickend, gab Forbes sie mir.
Mit ihrem starken Rahmen und den breiten Seitenste-

236
gen sah sie der anderen Brille verblüffend ähnlich. Ich
steckte sie hinter das Taschentuch in meiner äußeren
Brusttasche.
»Alles übrige liegt bei Ihnen«, sagte ich zu Sir
Graham. »Viel Glück.«
»Viel Glück für Sie, Temple«, erwiderte er, seine
linke Hand auf meiner Schulter.
Zwölf Sekunden nach Ende des Anrufes eilte ich in
den Etagenkorridor hinaus. Dies bedeutete, daß ich
auf meinem Weg zum Hotelausgang zwei Sekunden
aufzuholen hatte. Daß mein unbekannter Anrufer
meinte, was er gesagt hatte, war nicht zu bezweifeln.
Rostand war gründlich genug, um die kürzestmögli-
che Zeit erprobt zu haben, in der man von der dritten
Etage zum Hotelausgang gelangen konnte.
Da der Lift im Erdgeschoß stand, mußte ich die
Treppe benutzen. Ich sprang immer vier Stufen auf
einmal hinab.
Ich hatte noch acht Sekunden Zeit, als ich das Erd-
geschoß erreichte. Das Foyer war jetzt verlassen, aber
da das ›Concorde‹ einen Vierundzwanzig-Stunden-
Service bot, weilte ein Hotelbediensteter hinter dem
Empfangstisch. Er staunte nicht schlecht, als er mich
durch das Foyer spurten sah. Vor der gläsernen
Drehtür mußte ich mein Tempo mäßigen. Da hörte ich
ihn rufen: »Mr. Temple! Oh, Mr. Temple!« Ich ließ es
unbeachtet.
Einen Moment lang blieb ich unter dem Baldachin
stehen, der vom Hotelausgang bis zur Bordschwelle

237
reichte. Ich hatte genau vierzig Sekunden gebraucht.
Die Straße war keineswegs völlig verlassen; in den
Cafés brannte noch Licht, und auf den Gehsteigen
tummelten sich verhältnismäßig viele Leute. Tunis
war um diese nächtliche Stunde längst nicht so tot wie
zum Beispiel London. An dem Taxiplatz unfern des
Hotels warteten vier oder fünf Taxis. Und auf der
anderen Straßenseite sah ich das angekündigte Taxi
stehen. Das Gesicht des Fahrers war mir zugewendet.
Als ich mich seinem Taxi näherte, griff er mit einer
Hand nach hinten und öffnete die rückwärtige Tür.
Kein Wort wurde gewechselt, als ich einstieg und
die Tür hinter mir schloß. Der Motor des Taxis lief
bereits. Der Fahrer brauchte nur noch in den ersten
Gang zu schalten und abzufahren. Es überraschte
mich, daß ich sehen durfte, wohin die Fahrt ging.
Das Taxi brachte mich in nördlicher Richtung
durch ein Gewirr kleiner Straßen, deren letzte in einen
breiten Boulevard mit Mittelpromenade mündete.
Nachdem wir diesen Boulevard, auf dem gar kein
Verkehr mehr herrschte, ein Stück entlanggefahren
waren, lenkte der Fahrer das Taxi an die Bordschwelle
und stoppte.
»Hier steigen Sie aus«, sagte er zu mir. »Gehen Sie
in der Fahrtrichtung weiter. Halten Sie sich nahe der
Bordschwelle. Sie dürfen weder stehenbleiben noch
mit jemandem sprechen.«
»Wieviel schulde ich Ihnen?« fragte ich beim Aus-
steigen. Er ging auf diesen Scherz nicht ein, sondern

238
knurrte ein Schimpfwort und fuhr los, um in der
nächsten Querstraße zu verschwinden.
Ich begann den anscheinend endlosen Boulevard
entlangzugehen. Als ich ungefähr zehn Minuten
gegangen war, bemerkte ich, daß ein Baum, den ich
passieren wollte, von den Lichtern eines hinter mir
näher kommenden Autos getroffen wurde. Dann sah
ich auch, wie mein eigener Schatten immer dunkler
wurde. Schließlich überholte mich, dicht neben der
Bordschwelle und ziemlich langsam fahrend, ein
großer amerikanischer Straßenkreuzer und stoppte ein
paar Schritte vor mir. Die Tür zu den Fondsitzen ging
auf, und eine Stimme sagte: »Steigen Sie ein.«
Da der Straßenkreuzer ziemlich niedrig war, mußte
ich zum Einsteigen Kopf und Schultern beugen und
bekam im nächsten Moment einen weiten, rauhen
Sack darübergestülpt. Zwei kräftige Hände zogen
mich vorwärts und abwärts, zwei andere kräftige
Hände drückten mich auf den Wagenboden. Ich hörte
die Tür zufallen.
»Versuchen Sie keinen Widerstand«, warnte eine
gefährlich klingende Stimme. -»Bleiben Sie da, wo
Sie jetzt sind.«
Ich machte es mir so bequem wie möglich, befolgte
die erhaltenen Anweisungen und spürte, wie der
Wagen immer schneller fuhr. Es war gut, daß ich
nicht versucht hatte, mich von Polizisten verfolgen zu
lassen. Durch Rostands geschickte Entführungsme-
thoden wäre jeder Verfolger entdeckt worden. Meiner

239
Schätzung nach waren seit dem Anruf etwa zwanzig
Minuten vergangen. Ich fragte mich, wieviel Glück
Forbes mit der Feststellung haben mochte, woher der
Anruf gekommen war.
Mit dem Sack über dem Kopf fiel es mir schwer, zu
schätzen, wie lange die Fahrt dauerte. Nach den vielen
Kurven, die wir eine Zeitlang fuhren, war zu vermu-
ten, daß der Fahrer alles tat, um sich gegen etwaige
Verfolgung zu schützen. Dann gab es einen so langen
Abschnitt schneller Geradeausfahrt, daß ich fürchtete,
wir wären auf irgendeiner Landstraße schon längst
über die Grenzen des Stadtbezirkes von Tunis und
damit des Stadtplanes hinaus, den ich Sir Graham
Forbes gegeben hatte.
Schließlich verminderte der Wagen sein Tempo
und rollte über eine gewundene Straße mit Kopfstein-
pflaster. Nachdem er noch ein paar scharfe Wendun-
gen gemacht hatte, stoppte er. Ich hörte jemanden
aussteigen, ein paar Schritte gehen und gegen ein
hölzernes Tor klopfen, das gleich darauf entriegelt
und geöffnet wurde. Der Wagen fuhr noch einmal
zwanzig oder fünfundzwanzig Meter, dann kam er zu
einem endgültigen Halt. Meine zwei Bewacher auf
den Fondsitzen öffneten die Tür, und ich wurde
buchstäblich hinausgereicht. Widerstand zu versuchen
hätte keinen Sinn gehabt, denn die beiden neuen
Händepaare waren nicht weniger kräftig als die, die
mich in den Wagen gezerrt und zu Boden gedrückt
hatten. Noch mit dem Sack über dem Kopf, wurde

240
ich, an beiden Armen gehalten, über eine kurze
Treppe und durch einen Korridor in ein Zimmer
geführt.
Dort zog man mir den Sack vom Kopf.
»Setzen Sie sich, Mr. Temple.«
Die Stimme war gefährlich höflich; ich erkannte sie
sofort als Rostands Stimme. Sehen konnte ich im
ersten Moment so gut wie nichts, da meine Augen
sich erst wieder an die Helligkeit gewöhnen mußten.
Dann erkannte ich, daß ich in einem kleinen, halb als
bequemes Büro, halb als Wohnraum eingerichteten
Zimmer war. Hinter dem Schreibtisch saß Schultz.
Diesmal war keine falsche Freundlichkeit in seinem
Gesicht. Im Gegenteil, sein Ausdruck zeigte unver-
hohlene Feindseligkeit. Rostand befand sich an einem
vorhanglosen Fenster, das direkt auf das Meer hinaus-
zusehen schien. Er saß in einer Haltung auf dem
Fensterbrett, die mich vermuten ließ, daß er angetrun-
ken war. Er wirkte hochgemut und sehr zuversicht-
lich.
Der dritte Mann, der in diesem Zimmer wartete,
war so klein und unbedeutend, daß ich ihn zuerst gar
nicht bemerkte. Er hockte auf einem Stuhl in einer
Ecke wie ein verschrumpelter alter Mäuserich und
beobachtete die Szene aus großen, sorgenvollen
Augen.
»Ich hoffe, Sie verlebten einen angenehmen Tag,
Mr. Temple, und waren nicht allzu besorgt um Ihre
Frau?«

241
»Ja, ich verlebte einen sehr interessanten Tag«,
erwiderte ich. Wenn Rostand in der Stimmung war zu
hänseln, dann sollte es mir recht sein. »Mr. Szoltan
Gupte und Mr. O'Halloran erwiesen sich als äußerst
gastfreundlich.«
»O'Halloran?« rief Rostand aus. »Aber er ist doch
gestern abend ermordet worden!«
»Dann sollten Sie tatsächlich mal seinem Geist
begegnen. Der ist so lebendig, daß selbst Mr. Szoltan
Gupte darauf hereinfiel. Sogar Whisky konnte er
trinken, dieser Geist, und Zigaretten rauchen.«
Rostand sah schnell zu Schultz und dann wieder zu
mir. »Temple, Sie lügen! Die Polizei sucht O'Hallo-
rans Mörder.«
»Tut mir leid, daß Sie mir nicht glauben. Ich könnte
Ihnen sonst einige andere nützliche Sachen erzählen.«
»Welche denn?«
»Zum Beispiel, daß Sie einen großen Fehler ge-
macht haben, indem Sie Audry Bryce umbrachten.
Das hat den guten Sam Leyland veranlaßt, zum
Zeugen der Anklage zu werden.«
Schultz schob seinen Stuhl zurück und stand auf.
»Hören Sie mit diesem albernen Geschwätz auf,
Pierre.«
Er sah zu mir. Seine blauen Augen wirkten un-
barmherzig.
»Ich hoffe, Sie waren nicht so töricht, irgendwelche
Tricks zu versuchen. Haben Sie die Brille mitge-
bracht?«

242
»Ja.«
»Dann geben Sie sie her.«
»Nicht, ehe ich meine Frau sehe.«
Schultz lachte höhnisch.
»Sie armer Narr. Begreifen Sie nicht, daß Sie in
unserer Gewalt sind? Wenn Sie die Brille bei sich
haben, können wir sie Ihnen einfach wegnehmen.«
Da die zwei Gorillas, die mich hereingeführt hatten,
dicht hinter mir standen, leuchtete mir das ohne
weiteres ein. Ich zog die Brille aus meiner Brusttasche
und gab sie Schultz.
Schultz und Rostand, der eigens deswegen zu
Schultz hinüberging, betrachteten sie sorgfältig.
»Ich hoffe zu Ihrem Heil, daß dies die richtige Bril-
le ist«, sagte Schultz zu mir. Dann wandte er sich an
den kleinen Mann, der ängstlich auf seinem Stuhl in
der Ecke hockte. »Kommen Sie, Armand, Sie können
jetzt an die Arbeit gehen.«
Armand bückte sich, um den schwarzen hölzernen
Kasten aufzuheben, der zwischen seinen Füßen stand.
Schultz nickte meinen Bewachern zu.
»Gut. Ihr könnt ihn zu seiner Frau führen.«
Wieder wurde ich bei den Armen gepackt, durch
dieselbe Tür geschoben und zum entfernten Ende
desselben Korridors geführt, durch den ich hereinge-
kommen war. Ich hatte den Eindruck, daß dieser
ziemlich lange Korridor in seinem rückwärtigen Teil
schon durch eine Art Souterrain führte; das Haus, in
dem ich mich befand, stand offenbar an einen Hügel

243
gelehnt.
Am Ende des Korridors war eine Tür, die sich auf
eine abwärtsführende Treppe öffnete. Diese brachte
uns vor eine schwere Plankentür mit altertümlich
massivem Schloß. Einer meiner Bewacher drehte den
Schlüssel und öffnete die Tür; der zweite beförderte
mich mit einem kräftigen Stoß in den Rücken hin-
durch. Ich hörte, wie hinter mir die Tür mit erhebli-
chem Krach wieder zugemacht und der Schlüssel
herumgedreht wurde. Der Raum war so finster, daß
ich nicht wagte weiterzugehen, ehe meine Augen sich
an die Dunkelheit gewöhnt hatten.
Dann hörte ich eine vertraute Stimme.
»Paul! Haben sie dir etwas getan?«
Ich machte zwei Schritte vorwärts und begann zu
fallen, als ich unverhofft zwei weitere Stufen hinab-
stolperte. Glücklicherweise war Steve mir entgegen-
gelaufen und fing mich auf.
Wir hielten uns ein paar Sekunden lang fest um-
armt.
Dann sagte ich: »Nein, mir ist nichts geschehen.
Aber viel wichtiger - haben sie dir etwas getan?«
»Nein, nichts - abgesehen davon, daß sie mich
zwangen, mit einem stinkenden alten Sack über dem
Kopf auf dem Fußboden eines Autos zu liegen. Mein
Hauptproblem war die Langeweile. Ich sitze seit
ungefähr Mittag hier, ohne das geringste zu tun.«
»Wo haben sie dich aufgegriffen? Irgendwo in der
Avenue de Rome, nicht wahr?«

244
»Ja. Ich fiel auf einen sehr alten Trick herein. Ein
Auto stoppte neben mir, der darin sitzende Mann
sprang heraus und sagte, du hättest einen Unfall
gehabt, und ich solle schnellstens in das Hotel zu-
rückkommen.«
»Oh, Steve, ich dachte, dafür wärst du viel zu er-
fahren?«
»Das dachte ich auch«, bestätigte sie leise lachend.
»Aber als es wirklich passierte... Paul, was tust du
hier? Haben sie dich auch entführt?«
Meine Augen begannen sich an die Finsternis zu
gewöhnen.
Hoch oben in einer der Wände war ein schmales
Fenster, durch das einige Sterne glitzerten. Die zwei
Gorillas schienen das Licht über der Treppe draußen
nicht ausgeknipst zu haben; jedenfalls schimmerte
durch einen Spalt unter der Tür Helligkeit herein.
»Nein, eigentlich bin ich einer Einladung gefolgt.«
»Du willst sagen, du bist freiwillig in diese Schlan-
gengrube hereinspaziert? Natürlich bin ich froh, daß
du jetzt bei mir bist, Paul. Aber du hast dir doch nicht
die Brille von ihnen abnehmen lassen? Ich glaube, die
Brille ist das einzige, was sie davon abhält, uns zu
töten.«
»Die Brille ist an einem sicheren Ort, von wo sie
sie nie bekommen werden. Ich habe Schultz eine
andere Brille gegeben. Es ist nur eine Frage der Zeit,
wann sie herausfinden, daß ich sie gefoppt habe.
Danach dürften wir einiges sehr Unangenehmes

245
erleben, Steve.«
Steve legte ihren Kopf an meine Brust und flüster-
te: »Ich werde alles leichter ertragen, da du jetzt bei
mir bist.«
»Ahnst du, in was für einem Verlies wir uns hier
befinden? Gibt es in diesem Raum keine Beleuch-
tung?«
»Doch, eine oder zwei Glühlampen an der Decke.
Aber der Schalter ist draußen neben der Tür. Verrät
dir nicht der Geruch, was für ein Raum dies sein
könnte?«
Ich schnüffelte in die Dunkelheit. In der Luft hing
ein Geruch, der irgendwie an eine Weinkneipe
erinnerte. Trotz der Finsternis glaubte ich die Umrisse
zweier großer Weinfässer zu erkennen. Ich ging hin,
um mich zu überzeugen. An der Wand neben den
Weinfässern waren Metallregale mit Reihen über
Reihen liegenden Weinflaschen.
»Es ist ein Keller«, sagte Steve. »Trotzdem kann
man durch die Fenster die Sterne sehen.«
»Ich nehme an, das Haus über uns ist auf einem
Hügel errichtet. Der Hügel dürfte direkt ins Meer
abfallen. In dem Zimmer, wo ich mit Schultz und
Rostand sprach, konnte ich deutlich das Plätschern der
Wellen hören.«
»Hier kann man es auch hören«, bestätigte Steve.
»Das Fenster dort drüben wird uns zur Flucht nicht
nützen. Es ist von außen mit einem starken Gitter
gesichert. Aber unter ihm steht eine Bank, falls du

246
dich hinsetzen möchtest.«
Wir gingen Hand in Hand zu der Bank und setzten
uns.
»Schade, daß wir nicht ein paar Gläser haben«,
sagte ich. »Dann könnten wir wenigstens unser
Wiedersehen feiern - soweit hier von ›Sehen‹ zu
sprechen ist.«
»Irgendwo ist hier ein Glas. Ich sah es, als noch
Tageslicht war. Ich denke, ich kann es finden.«
Steve begann auf Regalen herumzutasten, die ich
kaum wahrzunehmen vermochte. Ich verwünschte es,
daß ich meine Taschenlampe nicht mehr hatte.
Vorhin, sobald ich in das Auto gezerrt worden war
und mit dem Sack über dem Kopf am Boden hockte,
hatten die offenbar sehr erfahrenen Hände der Entfüh-
rer meine Taschen abgetastet und herausgenommen,
was des Herausnehmens wert war - ein kleiner
beruflicher Nebenerwerb, wie es schien. Außer der
Taschenlampe hatten auch meine Brieftasche, mein
goldenes Zigarettenetui und mein ebenfalls goldenes
Feuerzeug den Besitzer gewechselt.
»Hier habe ich das Glas«, sagte Steve. »Es ist ein
ziemlich großes.«
»Fein. Wir werden es gemeinsam benutzen. Weißt
du zufällig, wo sie den Champagner verwahren?«
»Nein. Ich fürchte, dafür habe ich mich nicht inter-
essiert, solange ich hier allein war. Aber irgendwo
muß Champagner sein.«
»Himmel, Steve, jetzt fällt mir etwas ein! Warum

247
habe ich nicht früher daran gedacht? Wir müssen
unter dem ›Trou du Diable‹ sein, dem Lokal von
Schultz in Sidi bou Said! Es wäre in der richtigen
Entfernung, und das Plätschern der Meereswellen paßt
dazu.«
Ich hatte mittlerweile den Weg zu den Flaschenre-
galen gefunden und begann, die Flaschen abzutasten.
Ich äußerte mit gespielter Heiterkeit: »Da haben wir
sie! Endlich mal wieder Glück!«
Ich löste den Pfropfendraht von der gefundenen
Flasche Champagner und öffnete sie. Es konnte uns
nicht schaden, wenn unsere Gemüter ein wenig
ermuntert wurden. Ich wünschte, ich hätte daran
gedacht, Sir Graham Forbes von dem ›Trou du
Diable‹ zu erzählen. Die Chance, daß er uns auf gut
Glück hier finden würde, war äußerst gering.
Ich sah auf dem Leuchtzifferblatt meiner Arm-
banduhr, daß es eben zwei war, etwa fünfzig Minuten
nach dem Eintreffen des Telefonanrufs. Ich nahm jetzt
als sicher an, daß der Anruf aus der nächsten Nach-
barschaft des Hotels Concorde gekommen war und
daß Sir Graham, hierdurch irregeführt, zur Zeit
vielleicht schon die zweite oder dritte vergebliche
Razzia gegen längst verlassene Schlupflöcher der
Banditen unternahm.
»Ich habe seit heute früh eine Menge herausgefun-
den«, sagte ich zu Steve. »Tatsächlich war es ein
äußerst ereignisreicher Tag.«
Ich erzählte ihr von den vielen Dingen, die mich

248
seit dem Vormittag beschäftigt gehalten hatten. Sie
lebte merklich auf, als sie von Sir Graham Forbes'
Eintreffen in Tunis erfuhr, und lauschte aufmerksam,
als ich von dem Raub der Melrose-Juwelen berichtete.
»Natürlich habe ich davon gelesen«, sagte sie. »Hat
Sir Graham dir erklärt, welche Bedeutung die Brille
bei dieser Sache hat?«
»Ich fürchte, das war die eine Lücke in der sonst
sehr vollständigen Schilderung, die er mir gab.
Glücklicherweise konnte ich sie für ihn ausfüllen.«
»Paul! Du meinst, du hast die Antwort längst ge-
wußt? Wie unfair von dir, sie mir zu verschweigen!«
»Ich habe sie nicht längst gewußt, aber ich begann
sie zu ahnen, als wir beide letzte Nacht über die Sache
sprachen. Ich habe mir die Richtigkeit meiner Ahnung
heute, oder richtiger gesagt gestern vormittag, bestäti-
gen lassen, als ich so unklug war, ohne dich aus dem
Hotel fortzugehen.«
Ich kehrte zur Bank zurück und fuhr fort: »Als die
Bande beschloß, die Beute zu verstecken, war es
Adrian Leather, ihr Chef und geistiger Führer, der
diese schwierige Aufgabe verwirklichte. Er brachte
den Schatz zu irgendeiner Stelle in der Wüste und
vergrub ihn. Dann machte er eine genaue trigonome-
trische Berechnung des Ortes und verwandelte die
erhaltenen Zahlen sehr sinnvoll in ein Brillenrezept,
das bekanntlich ebenfalls aus Zahlen besteht. Nach-
dem die Brille mit den entsprechenden Gläsern
angefertigt war, konnte er alle sonstigen Unterlagen

249
über das Versteck der Juwelen vernichten.«
»Eine großartige Idee!« flüsterte Steve erregt. »Es
scheint ausgeschlossen, daß ein Uneingeweihter
dieses Geheimnis enträtseln könnte. Wie, um alles auf
der Welt, bist du bloß darauf gekommen?«
»Durch ein bißchen Glück, genaugenommen. Ich
hatte den Schimmer einer Ahnung. Und dann geriet
ich bei dem Versuch, ein neues Etui für die Brille zu
kaufen, zufällig an einen ziemlich schwerhörigen
alten Optiker. Als er mir statt des Etuis den Rat gab,
meine Augen untersuchen zu lassen und mir anschlie-
ßend ein Brillenrezept überreichte, kam mir plötzlich
Klarheit.«
»Ich finde, wegen seiner Genialität hätte er eigent-
lich verdient, mit der Sache davonzukommen - dieser
Adrian Leather, meine ich.«
»Leather war ein bemerkenswerter Mann. Er hielt
durch seine Überlegenheit die Bande zusammen.
Nach seinem Tod wollte jeder von ihnen jedem
anderen an die Kehle. Jeder dachte nur noch an sich.«
»Wie viele waren sie denn? Rostand, Schultz, Ley-
land?«
»Nein, Leyland gehörte nicht zu der ursprünglichen
Bande. Er kannte nur Rostand und weiß nichts von
dessen Beziehungen zu den anderen. Die Führungs-
schicht der Bande bestand aus Leather, Rostand,
Schultz, Szoltan Gupte - er war der Hehler, der die
Juwelen verkaufen konnte - und einer fünften Per-
son.«

250
»Einer Person, die wir noch nicht getroffen ha-
ben?«
»Tatsächlich haben wir sie schon getroffen, aber
ich glaube kaum, daß du darauf kämst, wer sie zur
Zeit ist.«
»Weiß ich ihren Namen?«
»Gut genug - David Foster.«
»Ah! Demnach existiert David Foster also doch?«
»Auf eine Art, ja.«
Es konnte nicht mehr lange dauern, bis der alte
Mann oben im Büro das Ergebnis seiner Untersu-
chung offenbaren würde. Vermutlich würden Rostand
und Schultz dann recht bald erkennen, daß die Zahlen
des Rezeptes für Sir Grahams Brillengläser keinen
geographischen Sinn ergaben.
»Wie geriet Judy Wincott in diese Sache?« fragte
Steve.
»Du kennst die alte Weisheit: ›Cherchez la femme.‹
In diesem Fall sollte es heißen: ›Cherchez les
femmes.‹ Tatsächlich liefern die Frauen sozusagen
den Schlüssel zu der Sache. Und -«
Ich hielt inne. Auf der Treppe draußen erklangen
Schritte, ein Schatten fiel über den Streifen Helligkeit
unter der Tür.
»Kopf hoch, Steve«, sagte ich. »Jetzt geht's los.«
Der Schlüssel knarrte im Schloß, und die Tür wur-
de aufgestoßen. Die beiden Gorillas, die mich hier-
hergebracht hatten, kamen herein. Auf der Treppe
stand Schultz.

251
»Nach oben mit ihnen!« kommandierte er. »Beeilt
euch!«
»Los, los, Mann«, knurrte mich der größere der
Gorillas an. »Ein fauler Trick, und die Frau kriegt's in
den Magen.«
Mit dem unsympathischen Druck einer Pistolen-
mündung gegen mein Rückgrat stieg ich langsam die
Treppe hinauf. Schultz war in das Büro zurückge-
kehrt. Er und Rostand standen hinter dem Schreib-
tisch, als wir ins Zimmer geschubst wurden. Ihre
Gesichter zeigten, daß die Wahrheit herausgekommen
war. Forbes' Brille lag auf der weißen Löschpapierun-
terlage des Schreibtisches. Der ängstliche alte Mäu-
semann war verschwunden. Rostands Miene zeigte
denselben entnervenden Ausdruck wie an dem Abend
in der Villa Negra. Schultz war vor Wut fahlbleich
geworden.
»Haltet seine Arme!« zischte Rostand den Bewa-
chern zu und stürmte mir entgegen. Wehrlos mußte
ich seine Faustschläge hinnehmen. Obwohl ich bei
jedem Schlag meinen Kopf in den Nacken warf,
spürte ich bald, daß mir Blut übers Gesicht lief und
schmeckte es auch im Mund. Als er sah, daß seine
eigenen Handknöchel zu bluten begonnen hatten,
hörte er plötzlich auf, mich zu schlagen.
»Ist auch genug, Pierre«, hörte ich Schultz sagen.
»Wir haben keine Zeit mehr für Spiele.«
Er hatte Steve gepackt und ihr den rechten Arm auf
den Rücken gedreht, als sie mir zu Hilfe kommen und

252
sich auf Rostand stürzen wollte. Er hielt sie mühelos
mit einer Hand. Sie gab keinen Laut von sich, war
aber ganz bleich geworden.
»Mr. Temple«, sagte Schultz mit gefährlicher Höf-
lichkeit. »Wir haben eine Menge Zeit verschwendet.
Ich bitte Sie, uns die Wahrheit nicht länger vorzuent-
halten. Wo diese Brille ist, erfahren wir schließlich
doch.«
Er drückte Steves freie Hand mit dem Handrücken
nach unten flach auf den Schreibtisch.
»Pierre«, fragte er, »deine Pistole hast du doch bei
dir?«
Rostand zog eine Beretta hervor und blickte, auf
sein Stichwort wartend, begierig zu Schultz.
»Mr. Temple«, wandte sich Schultz wieder an
mich, »Sie wissen wohl, daß Schüsse durch die Hand
zu den schmerzhaftesten Verletzungen gehören? Ich
zähle jetzt bis fünf, und dann drückt Pierre den
Abzug. Eins - zwei -«
Natürlich wußte ich, daß Schüsse durch die Hand
besonders schmerzhaft sind. Ich spürte, wie mir am
ganzen Leibe der Schweiß ausbrach. Die Pranken, die
mich hielten, hatten ihre Griffe verstärkt.
»- drei - vier -«
»Halt, ich will reden«, sagte ich. »Die Brille ist in
der Stahlkammer von Lloyds Bank in Tunis.«
»Wie können wir wissen, daß Sie die Wahrheit
sagen?«
»Die Depotquittung ist in meiner Brieftasche. Aber

253
einer Ihrer Gorillas hat mir die Brieftasche fortge-
nommen.«
Rostands Pistole war aus geringer Entfernung noch
auf Steves Hand gerichtet. Schultz zeigte keine
Überraschung, daß mir die Brieftasche gestohlen
worden war. Er blickte nur auf und fixierte meine
beiden Bewacher. Einer von ihnen überreichte ihm
daraufhin unverzüglich und mit fast demütiger
Bewegung die Brieftasche. Schultz hatte Steves auf
den Schreibtisch gedrückte Hand losgelassen, um die
Brieftasche entgegenzunehmen und zu durchforschen.
Das Geld war weg, aber die kleine Depotquittung von
Lloyds Bank steckte noch im Fahrkartenfach.
»Laßt ihn los«, kommandierte Schultz, »aber bleibt
dicht hinter ihm.« Für mich fügte er hinzu: »Gehen
Sie an den Schreibtisch, und schreiben Sie auf die
Quittung: ›Bitte händigen Sie dem Überbringer den
auf dieser Quittung bezeichneten Gegenstand aus.‹
Dann setzen Sie Ihre Unterschrift darunter.«
Ich tat, wie er gesagt hatte. Ich zweifelte kaum
daran, daß ich Steves und mein eigenes Todesurteil
ausschrieb, aber ich hätte es niemals über mich
gebracht, mit anzusehen, wie Steve durch die Hand
geschossen wurde. Ich schob die Quittung zu Schultz
hinüber. Er und Rostand studierten sie.
»Wird das funktionieren?« fragte Schultz seinen
Partner.
»Sicher«, bestätigte Rostand. »Man kennt mich bei
Lloyds. Es wird keine Schwierigkeiten geben. Aller-

254
dings müssen wir bis zehn Uhr vormittags warten, das
ist alles.«
»Inzwischen können wir auf die Jacht gehen. Ich
finde, wir sind sowieso schon lange genug hier. Je
früher wir aufbrechen, um so besser.«
Sie sprachen miteinander, als ob Steve und ich
nicht mehr existierten.
Rostand sagte: »Vergewissere dich, daß du hier
nichts Wichtiges zurückläßt.«
»Das habe ich schon getan«, erwiderte Schultz,
wobei er nochmals schnell ringsum schaute. Seit er
Steve losgelassen hatte, wurden wir beide durch die
Gorillas bewacht, deren Pistolen ständig auf unsere
Magenpartien gerichtet blieben.
»Gehen wir also«, schlug Rostand vor.
An der Tür blieb Schultz stehen und drehte sich zu
mir um.
»Es war mir eine Freude, Ihnen persönlich zu be-
gegnen, Mr. Temple. Habe ich Ihnen gesagt, daß ich
einige Ihrer Bücher kenne? Sie alle haben ein Happy-
End. Ich bedauere sehr, daß ich Ihnen so etwas bei der
gegenwärtigen Sache kaum versprechen kann.«
Sein Ton wurde ganz anders, als er sich auf franzö-
sisch an die beiden Bewacher wandte.
»Ich lasse euch hier, damit ihr über sie verfügt. Ihr
wißt, was ihr zu tun habt.«
Die Gorillas nickten; hinter Schultz und Rostand
fiel die Tür zu.
»Ich denke, er meint, wir sollen Sie ins Meer

255
schmeißen«, brummte der größere der Bewacher
seinem Gefährten zu, als draußen die Schritte ver-
klangen. »Na, eigentlich können die beiden auf ihren
eigenen Füßen zur Luke laufen, statt daß wir sie
tragen müßten.« Er wandte sich an mich. »Kommen
Sie, Mann. Wenn ihr hübsch folgsam seid, können wir
es nett und schnell für euch machen.«
Ich wußte, daß Steve mich ansah, aber ich wagte
nicht, ihrem Blick zu begegnen. Ich schämte mich zu
sehr über mich selbst, weil ich einfach nicht wagte,
wider jede bessere Einsicht irgendeinen Versuch zu
unserer Befreiung zu machen. Mir fiel nichts ein, was
ich noch hätte tun können. Halb unbewußt hörte ich
das Zufallen der Haustür und dachte daran, daß
Schultz und Rostand nun in das Auto steigen würden.
Dann, plötzlich, kam ein neues Geräusch - das
scharfe Bellen eines Revolvers, gefolgt von dem
kurzen, bösartigen Feuerstoß einer Maschinenpistole.
Unsere Bewacher wandten ihre Nasen der Tür zu wie
Vorstehhunde.
An meinem eigenen Bewacher vorbei sprang ich
den Mann an, der Steve bewachte. Als ich mit ihm zu
Boden stürzte, dröhnte in nächster Nähe ein Schuß.
Verzweiflung und Wut gaben mir übermenschliche
Stärke. Ich riß den Kopf meines Gegners am Haar
zurück und schlug ihn hart auf den Boden. Sein
Körper wurde schlaff.
Emporspringend sah ich Steve mit beiden Händen
die Hand mit der Pistole des anderen Bewachers in die

256
Höhe drängen. Er war seltsamerweise auf ein Knie
gesunken und leistete ihr nur matten Widerstand.
Gemeinsam entwanden wir ihm die Pistole. Unmittel-
bar danach kippte er völlig um und griff nach seinem
rechten Fuß. Aus dem aufgerissenen Schuh floß Blut.
»Was ist geschehen?«
»Er schoß sich vor Schreck selbst in den Fuß, als
du an ihm vorübersaustest.«
Draußen im Korridor erklang eine Anzahl Schüsse,
gefolgt von dem Geräusch rennender Füße. Ich hörte
Schultz' näherkommende Stimme schreien. »Ali!
Toto! Die Fenster auf! Wir müssen die Klippe hinab!«
Draußen dröhnten zwei weitere Schüsse, ein Mann
schrie vor Schmerz. Schultz stieß die Tür auf und kam
herein, den verwundeten Rostand mit sich schleppend.
In furchtbarer Hast schloß und verriegelte er die Tür,
während Rostand zu Boden sank. Als Schultz sich
umdrehte, blickte er in die Mündungen der beiden
Pistolen, die ich, in jeder Hand eine, auf ihn gerichtet
hielt.
»Lassen Sie Ihre Pistole fallen«, sagte ich und feu-
erte einen Schuß in den hölzernen Türrahmen neben
seinem rechten Ohr, nur um ihm zu zeigen, daß ich
auch mit der linken Hand zielsicher schießen konnte.
Er ließ seine Pistole fallen.
»Jetzt schließen und riegeln Sie die Tür wieder
auf.«
Schultz tat, wie ihm geheißen. Aus einem Augen-
winkel sah ich, wie Steve sich bückte und seine

257
Pistole aufhob.
»Nun kommen Sie und stellen sich mit dem Gesicht
zur Wand unter das hübsche Bild von Venedig.«
Mit der Würde eines Mannes, der weiß, wie man
auch vor einem überlegenen Gegner seine Haltung
bewahrt, baute sich Schultz mit halb erhobenen
Händen und dem Gesicht zur Wand unter dem recht
beziehungsreichen Bild der weltberühmten Seufzer-
brücke auf. Rostand, dessen rechte Schulter böse von
einem Schuß getroffen war, lag bewußtlos am Boden,
wo ihm die beiden Gorillas Gesellschaft leisteten, der
eine ebenfalls bewußtlos, der andere ausschließlich
mit seinem verletzten Fuß beschäftigt.
So fanden Sir Graham Forbes und Kommissar Re-
nouk uns versammelt, als sie die Tür aufstießen.

258
10
»Ich weiß noch immer nicht, wie Sie darauf kamen,
daß wir im ›Trou du Diable‹ waren, Sir Graham. Sie
müssen sehr schnell und scharfsinnig überlegt haben.«
Wir drei - Steve, Sir Graham und ich - saßen in
unserer Hotelsuite, jeder vor einer Tasse heißer
Schokolade. Es war nach vier Uhr morgens geworden,
ehe wir ins ›Concorde‹ zurückkehrten. Wir hatten
gesehen, wie Schultz von einigen nicht allzu freundli-
chen Polizisten gefesselt und fortgebracht wurde, wie
man den noch immer bewußtlosen Rostand auf eine
Bahre packte und zum Rettungswagen hinaustrug; er
starb übrigens vor Erreichen des Hospitals. Ali und
Toto, die beiden gedungenen Bewacher, befanden
sich im Gefängnislazarett, der eine wegen des durch-
schossenen Fußes, der andere mit einer schweren
Gehirnerschütterung.
»Ich kann nicht viel Ruhm dafür beanspruchen, Sie
gefunden zu haben, Temple. Tatsache ist, daß ich
völlig ratlos war. Die Zurückverfolgung jenes Tele-
fonanrufs ergab, daß er aus einer der Kabinen im
Foyer dieses Hotels gekommen war. Ich stand prak-
tisch noch immer am Punkt Null.«
Steve und ich lauschten Sir Graham mit dem woh-
ligen Interesse von Kindern, die sicher sein dürfen,
daß die Geschichte gut enden wird.
»Was taten Sie dann?« fragte Steve gespannt.
»Nun, ich selbst hatte nichts mehr, worauf ich mich

259
stützen konnte, und, wissen Sie, ich wollte doch so
gerne meine Brille wiederhaben.« Forbes lachte
gemütlich. »Es lag also nahe, daß ich Renouk ver-
ständigte und dann sofort zu ihm ins Polizeipräsidium
fuhr. Wir kamen schnell überein, daß wir nur die
Wahl hätten, sämtliche auf dem Stadtplan markierten
Häuser auszuheben, und wollten gerade die entspre-
chenden Befehle erteilen, als ein anonymer Telefon-
anruf kam.«
»Ein anonymer Telefonanruf?«
Steve und ich lachten. Wir hatten es wie aus einem
Munde wiederholt.
»Ja. Ein Unbekannter erkundigte sich bei Renouk,
ob nicht die Polizei am Verbleib von Mr. und Mrs.
Temple interessiert wäre, nannte dann prompt das
›Trou du Diable‹ in Sidi bou Said, vergewisserte sich,
daß Renouk richtig verstanden hatte, und legte auf.
Den Rest kennen Sie.«
»Sprach er Englisch?«
»Ja«, nickte Forbes. »Aber trotz Renouks Hinweis
auf eine Belohnung beantwortete er die Frage nach
seinem Namen nicht.«
»Ich denke, damit kann ich Ihnen aufwarten, Sir
Graham.«
»Wirklich, Temple? Wie heißt er denn?«
»David Foster. Genau wie Sie bangte er um seine
Brille.«
»Paul, ich finde, du machst es schrecklich geheim-
nisvoll«, protestierte Steve. »Dieser Fall ist doch jetzt

260
vorüber. Kannst du denn nicht sagen, wer David
Foster ist?«
»Oh, weißt du, der Fall ist noch nicht vorüber. Erst
zwei von den führenden Leuten der Bande sind
ausgeschaltet. Drei befinden sich noch auf freiem Fuß.
Sie sind nicht weniger als Schultz und Rostand darauf
versessen, die Brille an sich zu bringen. Und vergiß
nicht den ungeklärten Mord an einer Bekannten von
uns, der nach Sühne heischt.«
»Du meinst Judy Wincott? Paul, wie paßt sie in
diese Sache?«
Ich sagte: »Ich glaube, ich habe dir vorhin erklärt,
daß das Motto dieses Falles ›Cherchez les femmes‹
heißen sollte und daß die beteiligten Frauen sozusagen
den Schlüssel zu der ganzen Sache liefern. Bitte,
berichtigen Sie mich, Sir Graham, falls ich mich irre.«
Forbes nickte schläfrig; er war offenbar sehr zufrie-
den damit, daß ich das Erzählen besorgte.
»Noch ehe Adrian Leather starb«, fuhr ich fort,
»hatte seine Frau ihn um Rostands willen verlassen -
was ihr jedoch nichts half, als Rostand sie nicht mehr
brauchen konnte. Adrian Leathers neue Gefährtin war
eine von zwei etwas fragwürdigen jungen Damen, die
sorglos und voll Wonne in einem Kreis von Gentle-
menverbrechern lebten, denen sie hingebungsvoll und
ihren Mitteln gemäß bei der Durchführung zwielichti-
ger Pläne halfen. Sie hieß Diana Simmonds, und ihre
Freundin hieß Judy Wincott. Als Leather im Sterben
lag, vertraute er Diana Simmonds sein Geheimnis an

261
und übergab ihr die Brille. Zuerst wollte Diana nicht
recht glauben, daß die Brille wirklich solchen großen
Wert besäße. Doch durch verschiedene beunruhigende
Geschehnisse erkannte sie, daß es Leute gab, die vor
nichts zurückschrecken würden, um die Brille zu
bekommen. Sie wurde schließlich ängstlich und
vertraute sich ihrer Freundin Judy Wincott an.«
»Das alles geschah in Paris um die Zeit, als wir dort
waren?«
»Ja. Teils zu dieser Zeit, teils etwas früher. - Nun
aber war Judy, was Diana nicht wußte, die heimliche
Geliebte des zweitmächtigsten Mannes der Bande -
eines gewissen Edmund Webb. Dieser Webb arg-
wöhnte sofort nach Leathers Tod, daß Leather die
Brille seiner neuen Freundin Diana Simmonds
gegeben hätte. Da er die Brille unbedingt haben, aber
selbst im dunkeln bleiben wollte, versprach er Judy
Wincott fünftausend Pfund, wenn sie Diana Sim-
monds die Brille abschwätzen oder wegnehmen und
nach Tunis schicken würde, wo er die Sendung unter
dem Namen David Foster entgegenzunehmen gedach-
te.«
»Demnach wäre es seine Idee gewesen, uns als
Lieferboten zu benutzen?«
»Vielleicht. Andererseits war Judy Wincott ein sehr
gewitztes Mädchen. Vielleicht kam sie selbst auf den
genialen Einfall.«
Steve hielt es nicht mehr in ihrem Sessel aus. Sie
stand auf und setzte sich zu mir auf das Sofa, wobei

262
sie eifrig fragte: »Was geschah an dem Abend, als
Judy Wincott uns die Brille überbrachte?«
Ich wandte mich an Forbes: »Das müßten Sie bes-
ser wissen als ich, Sir Graham. Können Sie es uns
erzählen?«
»Nun, es handelt sich größtenteils um Vermutun-
gen. Wir glauben, daß die Simmonds der Wincott
heimlich zu Ihrer Wohnung folgte. Während sie unten
wartete, wurde sie von jemandem überrascht und
getötet, der sie im Besitz der Brille wähnte.«
»Und Judy Wincott selbst? Wie kam sie nach Niz-
za? Weshalb wurde sie ermordet?«
»Das ist noch ungeklärt«, erwiderte Forbes. »Mira-
bel arbeitet daran und dürfte das Rätsel bald lösen.
Eine Zeitlang standen Sie selbst im Verdacht, Judy
Wincott ermordet zu haben, Temple. Wußten Sie
das?«
»Ich merkte es wohl, und es war ein sehr unbehag-
liches Gefühl. Übrigens nehme ich jetzt an, daß jene
liebenswürdige Charakterisierung nicht von Chefin-
spektor Vosper, sondern von Ihnen selbst stammte, Sir
Graham - daß ich zwar die merkwürdige Begabung
besäße, irgendwie in jede nur denkbare Art Unheil
verwickelt zu werden, bisher aber noch nie solches
Unheil verursacht hätte?«
Forbes lachte leise und stand auf.
»Ja, ich glaube, irgend so etwas habe ich zu Mira-
bel gesagt. Aber wissen Sie - mir scheint, es wird bald
Tag. Und ich meine, Sie beide könnten etwas Schlaf

263
brauchen.«
»Das meine ich auch.«
Steve und ich begleiteten Forbes zur Tür.
»Sir Graham«, begann ich verlegen. »Es ist eine
ziemlich unbeholfene Art, dies zu sagen, aber - Danke
für alles, was Sie für uns getan haben.«
»Danken Sie nicht mir«, entgegnete Forbes heiter.
»Danken Sie dem anonymen Anrufer. Und nun - gute
Nacht, Temple. Gute Nacht, Steve.«
Als die Tür sich schloß, stand Steve auf den Zehen
wie eine Ballettänzerin und streckte beide Arme in die
Höhe.
»Ich habe noch gar keine Lust, zu Bett zu gehen«,
verkündete sie. »Ich würde lieber tanzen oder irgend
so etwas.«
»Das kommt vom Champagner. Er ist dir zu Kopf
gestiegen. Aber ich fürchte, wir müssen jetzt ans
Schlafengehen denken. Weißt du - wir haben eine
Verabredung zum Lunch.«
»Oh, davon hast du mir noch gar nichts gesagt! Mit
wem?«
»Mit Tony Wyse und Simone Lalange.«
»Fein! Das wird nett! Sie sind die beiden einzigen
unserer Reisebekanntschaften, die uns nicht wegen
dieser verwünschten Brille behelligt haben.«
»Ja, so sieht es aus. Und wie Sir Graham bemerkte
- wir sollten Mr. Wyse sehr dankbar sein.«
»Oh, sagte Sir Graham das? Es muß mir entgangen
sein. Warum verdient Wyse unseren Dank so sehr?«

264
»Weil er der anonyme Anrufer war.«
Unsere kleine Lunchgesellschaft wurde sehr unter-
haltend. Wyse war in ausgezeichneter Stimmung und
beglückwünschte Steve mehr als einmal, dieser
schrecklichen Gefahr entronnen zu sein. Sie war
erfahren genug, um den anonymen Anruf nicht zu
erwähnen. Wir drei saßen bei Cocktails in der Bar, bis
Simone Lalange erschien. Wie die meisten attraktiven
Frauen verließ sie sich darauf, daß ihr die Verspätung
verziehen werden würde, und so war es auch. Wyse
bestand auf noch einer Runde Drinks. Er war offenbar
bis über beide Ohren verliebt in die reizvolle Franzö-
sin und ließ es geschehen, daß sie ihn in charmant
überlegener Art förmlich zum Narren machte.
»Allmählich sollten wir doch in den Speisesaal
gehen«, sagte ich nach einiger Zeit. »Oder wir riskie-
ren, daß alle guten Dinge aufgegessen sind.«
Als wir die ersten drei Gänge verzehrt hatten, war
der Speisesaal fast leer. Während der Kellner sich
entfernte, um unsere Desserts zu holen, erinnerte mich
Wyse an mein Versprechen, ihm die berühmte Brille
zu zeigen.
»Ach ja. Das hätte ich fast vergessen.«
Einmal mehr zog ich die Brille aus meiner Brustta-
sche. Simone Lalange saß links von mir; ihre sehr
elegante große Handtasche hielt sie merkwürdiger-
weise auf dem Schoß. Ihr gab ich die Brille zuerst.
»Sie werden es kaum glauben, Mademoiselle La-

265
lange, aber für diese Brille sind mir zehntausend
Pfund geboten worden.«
»Zehntausend Pfund?« rief sie aus. »Oh, Mr. Tem-
ple, ich glaube, Sie treiben Spaß mit mir!«
»Nein, es ist wirklich wahr.«
»Dann muß es eine magische Brille sein, und wenn
man hindurchschaut, ist alles schön und wunderbar.
Darf ich versuchen, wie Tony Wyse dann aussieht?«
Sie setzte die Brille auf und blickte mit gespielter
Ernsthaftigkeit zu Wyse, der ihr gegenübersaß. Nach
wenigen Sekunden verdrehte sie die Augen und tat,
als erschaudere sie.
»Oh, es ist, als ob man unter Wasser taucht! Und
Tony Wyses Anblick wird dadurch nicht vorteilhafter.
Tut mir leid, Mr. Temple, aber ich glaube nicht, daß
ich Ihnen zehntausend Pfund dafür bieten kann.«
Wyse lachte, und Simone gab die Brille zu Steve
hinüber.
»Wollen Sie sie ausprobieren, Mrs. Temple?«
Sie blinzelte mir anscheinend verworfen zu und
machte dies so echt, daß Wyse vor Eifersucht zu
erbleichen begann.
»Wenn ich Paul ansehe, pflege ich ohnehin immer
eine rosarote Brille aufzuhaben«, lachte Steve.
»Möchten Sie einen Versuch machen, Mr. Wyse?«
Sie hielt Wyse die Brille hin. Er lächelte sehnsüch-
tig zu Simone hinüber, als er nach der Brille griff, und
achtete nicht sehr darauf, was er tat. Kein Wunder,
daß ihm die Brille aus den Fingern rutschte und zu

266
Boden fiel.
»Oh, wie ungeschickt von mir!« rief er, bückte sich
und verschwand für einen Moment hinter dem Tisch.
»Nichts passiert«, verkündete er, als er mit der
Brille wieder auftauchte. »Gottlob hat sie keinen
Schaden genommen.« Er betrachtete sie genau,
schaute probeweise hindurch und erklärte dann:
»Leider muß ich gestehen, daß ich etwas enttäuscht
bin. Ich persönlich würde Ihnen raten, mit fünf Pfund
zufrieden zu sein, Mr. Temple, falls Sie noch ein
Angebot erhalten.«
Lächelnd nahm ich die Brille zurück und steckte sie
wieder in meine Brusttasche.
Wyse hatte während des Essens recht munter ge-
trunken; als der Kaffee vor uns stand, wirkte er
ziemlich aufgedreht.
»Nehmen Sie Zucker, Mr. Wyse?« fragte ihn Steve.
»Ja, bitte. Und ich wäre entzückt, wenn Sie aufhö-
ren könnten, mich mit Mr. Wyse anzureden.«
»Oh, wie soll ich Sie sonst anreden?«
»Vielleicht«, schlug ich vor, »versuchst du es mal
mit David Foster?«
Wyse ließ seine Hände sehr rasch auf die Tischkan-
te sinken und wurde ganz still. Fast eine halbe Minute
verging, ehe er mich fragte: »Was, um alles auf der
Welt, meinen Sie damit?«
Ohne auf die Frage einzugehen, erkundigte ich
mich: »Oder würden Sie es vorziehen, als Mr. Webb
angesprochen zu werden?«

267
Wyse bewegte sich nicht, aber seine Gesichtszüge
nahmen eine merkwürdige Härte an. Er sah plötzlich
ganz anders aus als der freundliche junge Mann, den
wir bisher kannten.
»Habe ich recht, Mr. Temple, wenn ich vermute,
daß dies eine Art Scherz sein soll?«
»Nein. Es ist so wenig ein Scherz, wie zum Bei-
spiel Ihre Idee, die Brille durch uns von Paris nach
Tunis bringen zu lassen. Oder hat Judy Wincott es
Ihnen vorgeschlagen? Eine kluge Vorsichtsmaßnah-
me! Die tunesischen Zollbeamten schienen auf Sie
gewartet zu haben, wie ich bemerkte. Sie überprüften
Sie sehr gründlich, nicht wahr? Vielleicht hatten sie
bereits eine Beschreibung von Edmund Webb.«
»Mr. Temple, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.«
Wyse hatte die Gewalt über seine Gesichtszüge
zurückerlangt und stellte die gewohnte unbekümmert-
liebenswürdige Miene zur Schau. Vergessen hatte er
allerdings seine Hände, die sich auf dem weißen
Tischtuch in rascher Folge abwechselnd streckten und
zu Fäusten ballten. Simone Lalanges Augen waren
vor Verblüffung weit geöffnet; sie starrte bald diesen,
bald jenen von uns völlig fassungslos an und machte
auch dies sehr echt.
»Ich denke, Sie wissen recht gut, wovon ich spre-
che. Wirkliche Vorwürfe gegen Sie hätte ich nicht,
abgesehen von einer Sache. Steve und ich sind Ihnen
dankbar für den Anruf bei Renouk heute nacht,
obwohl wir natürlich wissen, daß Sie in erster Linie

268
von der Sorge getrieben waren, die Brille nicht in die
Hände von Rostand oder Schultz fallen zu lassen.
Ernstlich ist wohl kaum zu bestreiten, daß ein Mann
wie Constantin zu sterben verdiente und für irgendei-
ne seiner zahlreichen Schurkereien früher oder später
sowieso einen gewaltsamen Tod gefunden hätte. Und
daß Sie den Unmenschen Sandro nicht noch viel
härter schlugen, kann ich nur bedauern.«
Wyse ignorierte mich und wandte sich höflich an
Steve: »Verliert sich Ihr Gatte häufiger in solche
Phantastereien?«
»Was ich Ihnen aber nicht vergeben kann«, fuhr ich
fort, »ist der Mord an Judy Wincott, Ihrer Geliebten.
Warum haben Sie das getan, Webb? Entdeckte Judy
den wahren Wert der Brille?«
Jetzt stand Wyse mit solcher Vehemenz auf, daß
die Beine seines Stuhles über das Parkett scharrten.
»Ich habe unseren gemeinsamen Lunch bis jetzt als
sehr nett empfunden«, bemerkte er würdevoll. »Aber
ich denke, der Spaß beginnt nun einseitig zu werden.
Wenn Sie mich bitte entschuldigen wollen -«
»Einen Moment noch! Sie sagten, Sie wären ent-
täuscht von der Brille. Aber ich habe gesehen, daß Sie
die Gelegenheit nutzten, die Brille unter dem Tisch
gegen eine andere auszutauschen. Sie werden eine
noch größere Enttäuschung erleben, wenn Sie heim-
kommen. Sie haben eine ganz gewöhnliche Brille
erwischt. Die richtige Brille befindet sich in der Obhut
von Kommissar Renouk und -«

269
Wyses Gesicht verzerrte sich.
»Seien Sie verdammt, Temple!« schrie er und riß
mit beiden Händen an der Tischkante.
Der Tisch mit all seinen Gläsern und Tassen kippte
klirrend und krachend um. Einen Sekundenbruchteil
vorher hatte Simone Lalange fast melodisch aufge-
schrien und war sehr gewandt zur Seite gesprungen.
Über den umgefallenen Tisch hinweg starrte Wyse zu
Steve und mir. Er hatte eine Pistole aus der Tasche
gezogen.
»Wenn jemals einer es herausgefordert hat«, fauch-
te er, »dann Sie, Temple!«
Ich sah, wie sich sein Zeigefinger um den Abzug
krümmte. Im selben Moment machte das Dröhnen
eines schweren Revolvers unsere Ohren taub. Die
Pistole hüpfte aus Wyses Hand und fiel drei Meter
weiter zu Boden.
»Keine Bewegung!« sagte Simone Lalange scharf.
Völlig verdutzt richtete Wyse seinen Blick auf sie.
Sie stand jetzt in sicherer Entfernung von ihm nahe
der Wand, die Füße einen halben Schritt weit ausein-
ander fest auf den Boden gesetzt. Ihre zarte rechte
Hand, ruhig wie die Hand einer bronzenen Denkmals-
figur, hielt einen respekteinflößenden Revolver, aus
dessen Mündung ein Rauchwölkchen in die Höhe
stieg. Es war ein äußerst widerspruchsvoller Anblick -
diese elegante, hübsche junge Frau mit lackierten
Fingernägeln, langen künstlichen Wimpern, dezentem
Make-up, untadeliger Frisur, und die tödliche Waffe,

270
die sie mit so selbstverständlicher Sicherheit im
Anschlag hielt.
»Was -? Wer -? Wieso -?«
Wyse konnte nur noch stammeln. Er schüttelte den
Kopf wie ein Mann, der zu träumen glaubt.
Ich sagte zu ihm: »Sie haben die Ehre mit Made-
moiselle Carriere von der französischen Kriminalpoli-
zei, die Ihnen seit Nizza auf der Spur ist. Nehmen Sie
es nicht zu tragisch. Auch mich hat Mademoiselle
Carriere lange genug gefoppt.«
Wyse zog die nutzlose Brille aus der Tasche und
warf sie in mattem Schwung zwischen die Scherben
des Lunchgeschirrs.
»Oh«, stöhnte er. »Seit dem Zwischenfall im ›El
Passaro‹ hätte ich es wissen können. Nicht wahr,
Mademoiselle, Sie haben diese bemerkenswerte
Taschenspielerei vollbracht? Die Brille aus Temples
Brusttasche in die Handtasche seiner Frau zu manipu-
lieren, meine ich?«
Mademoiselle Carriere lächelte betörend und ent-
gegnete ganz unschuldig: »Ich glaube, ich erinnere
mich an etwas dieser Art.«
»Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem ich aufgebe«,
äußerte Wyse erschüttert. »Ich habe begriffen...«
Drei Tage später saßen Steve und ich in einem
Flugzeug nach Mailand, wo wir in eine Kursmaschine
nach London umsteigen wollten. Uns gegenüber saß
ein Gentleman fortgeschrittenen Alters, in Aussehen

271
und Haltung der vollendete Typ eines pensionierten
britischen Armeeoffiziers. Er hatte uns während des
ganzen Fluges sorgfältig, wenn auch unaufdringlich
gemustert und ganz gewiß aufmerksam zugehört, als
wir davon sprachen, was wir nach unserer Ankunft in
London tun würden.
Als das Flugzeug vor der Landung in Mailand all-
mählich an Höhe verlor, beugte er sich über das
Klapptischchen und sagte höflich zu Steve: »Ich
hoffe, Sie entschuldigen, daß ich mir die Freiheit
nehme, Sie anzusprechen, aber ich konnte beim besten
Willen nicht überhören, was Sie und Ihr Gatte sagten.
Sie fliegen direkt nach London weiter, nicht wahr?«
»Ja, das tun wir.«
Der alte Gentleman griff in seine Reisetasche und
holte ein flaches viereckiges Päckchen heraus.
»Darf ich Sie bitten, mir einen kleinen Gefallen zu
tun? Ich habe unvorhergesehen einige Tage in Mai-
land zu verbringen und bin sehr besorgt darum, daß
meine kleine Enkelin dieses Päckchen zum Geburts-
tag erhält. Der Geburtstag ist schon morgen. Und ich
glaube nicht, daß es die Post noch schafft.«
Steve sah zu mir, aber ich hob den Blick nicht von
dem Buch, in das ich anscheinend vertieft war. Dann
hörte ich sie mit fester Stimme sagen: »Oh, ich glaube
nicht, daß ich es tun kann. Mein Mann und ich
nehmen es peinlich genau mit den Zollvorschriften.«
»Aber es ist nur ein Kinderbuch!« rief der alte Herr.
»Ich werde es auswickeln und Ihnen zeigen.«

272
Er band die Schnur auf, entfernte das Papier und
hielt ein Buch zu Steve hinüber.
»Sehen Sie selbst - ›Alice im Wunderland‹. Nie-
mand könnte behaupten, es wäre Schmuggelware.«
»Ich bedauere sehr«, antwortete Steve entschieden.
»Ich kann es nicht tun. Wir kennen ein Ehepaar, das
in ernste Schwierigkeiten geriet, weil es auch so ein
kleines Päckchen gefälligkeitshalber durch den Zoll
brachte.«
Das Naserümpfen des alten Herrn zeigte deutlich,
was er von uns dachte.
»Nun«, murmelte er, als er das Buch wieder ein-
wickelte, »manche der jüngeren Leute dieser Epoche
scheinen nicht bereit, einen Finger zu rühren, um
anderen zu helfen. Zu meiner Zeit war das anders,
ganz anders...«
Document Outline
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Durbridge Francis Die Schuhe
Mordercza gra Durbridge Francis
Durbridge Francis Mordercza gra
Durbridge Francis Ten drugi
Durbridge Francis Harry Brent
Durbridge Francis Ten drugi
Durbridge Francis Ten drugi
Durbridge Francis Mordercza gra 2
Durbridge Francis Der Fall Salinger
Durbridge Francis Der Schlüssel
166 Francis Durbridge Harry Brent
Roger Zelazny Francis Sandow 02 To Die In Italbar v1 0
Die Baudenkmale in Deutschland
Brecht, Bertolt Die drei Soldaten
Einfuhrung in die tschechoslowackische bibliographie bis 1918, INiB, I rok, II semestr, Źródła infor
Wywiad ze sw Franciszkiem
Dave Baker Die lachende Posaune SoloPolka für Posaune
więcej podobnych podstron