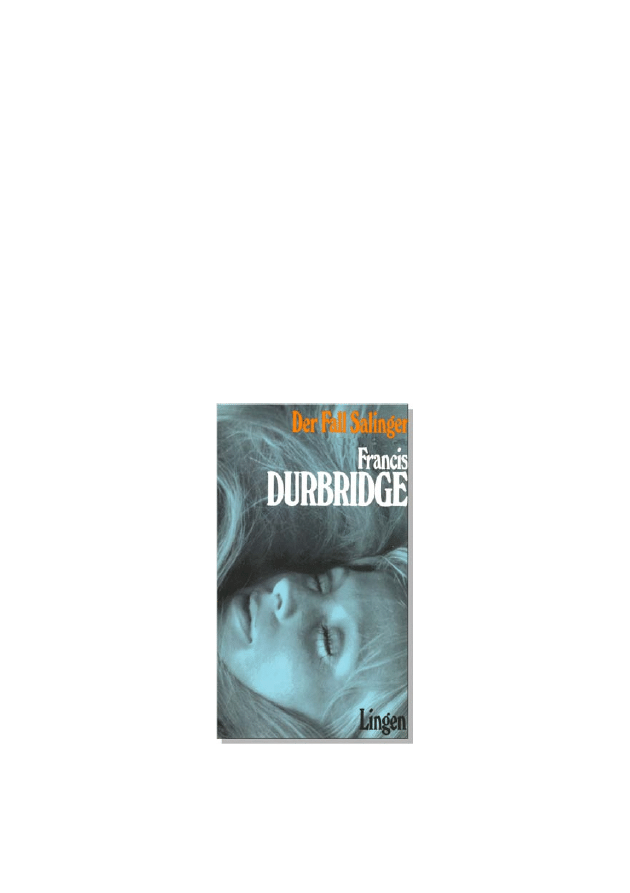
Francis Durbridge
Der Fall Salinger
Der Fall Salinger
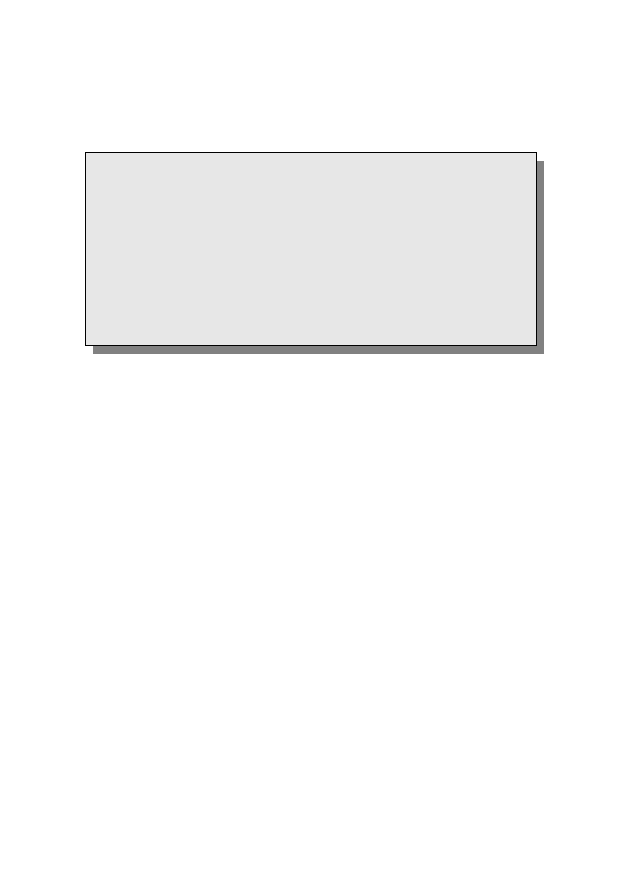
Inhaltsangabe
Der Geheimagent Leo Salinger wurde in Amsterdam von einem Sportwagen über-
fahren und getötet. Frazer übernimmt den Auftrag, die mysteriösen Zusammenhän-
ge seines Todes zu klären. War es tatsächlich ein Verkehrsunfall? Oder hat die char-
mante Barbara Day, die den Wagen steuerte, den Tod Salingers vorsätzlich herbei-
geführt? Frazer muß verdammt viel riskieren, bis er hinter die Schliche und Kniffe
einer kaltblütig zupackenden Diamantenschmugglerorganisation kommt und bis
er sich Zentimeter um Zentimeter an den Boß dieser Bande heranarbeiten kann.

Printed in Western-Germany
Einmalige Sonderausgabe mit
Genehmigung des Gebrüder Weiß Verlages München/Berlin
Gesamtherstellung: Lingen Verlag, Köln • fgb
Schutzumschlag: Roberto Patelli
Dieses eBook ist umwelt- und leserfreundlich, da es weder
chlorhaltiges Papier noch einen Abgabepreis beinhaltet!
☺

1
ls ich aus der stillen Seitenstraße, in der ich wohnte, auf die
Hauptstraße kam und die endlosen Autoschlangen sah, wußte
ich, daß die nachmittägliche Verkehrsspitze ihren Höhepunkt er-
reicht hatte. Ich war für sechs Uhr mit Mr. Ross verabredet, und
zwar pünktlich auf die Minute. Mit einem Blick auf die Uhr stellte
ich fest, daß es noch nicht ganz halb sechs war; daher entschloß
ich mich, zu Fuß zu gehen.
A
A
Während ich im Strom der Verkehrsteilnehmer in Richtung Smith
Square schwamm, überlegte ich, was Charles Ross wohl mit mir
vorhatte. Am Telefon war er kaum mitteilsamer als sonst gewesen.
Auf meine interessierte Frage nach meinem nächsten Auftrag hatte
er kurz angebunden erwidert: »Der Fall Salinger – falls Ihnen das et-
was sagt.«
Natürlich tat es das nicht, und noch bevor ich auflegte, hatte die
andere Seite längst das Gespräch beendet. Ich war genauso klug wie
vorher und fragte mich, warum ich Narr mich eigentlich so mir
nichts, dir nichts in die geheimnisvolle Maschinerie einer Dienst-
stelle hineinziehen ließ, die eine Kreuzung zwischen Geheimdienst
und Kriminalpolizei darstellte. Sicherlich wäre es besser für mich
gewesen, zu meinem erlernten Ingenieurberuf zurückzukehren und
mich den weniger aufregenden Reibereien mit Betriebsratsmitglie-
dern über die Länge der Teepausen zu widmen.
Auf meiner besessenen Suche nach Harry Denston – meinem ein-
stigen Geschäftspartner, dessen Extravaganzen unser gemeinsam be-
1

triebenes Ingenieurbüro zum Konkurs geführt hatten – war ich
plötzlich in Kontakt mit Charles Ross und seinen Mitarbeitern ge-
kommen. Auch Ross suchte meinen ehemaligen Teilhaber. Als er
erkannte, wie außerordentlich nützlich sich meine Kenntnisse über
Harry und dessen Bekannte erweisen konnten, hatte er sich meiner
Hilfe versichert, andererseits mir aber auch alle Hilfsmittel seines
Apparates zur Verfügung gestellt.
Es war mir dann auch wirklich gelungen, Harry aufzuspüren, wo-
bei ich zu meinem eigenen Erstaunen in meiner seelischen Struktur
einen bis dato im verborgenen geblühten Zug von Draufgängertum
entdeckte. Um ehrlich zu sein – meine Eitelkeit fühlte sich ge-
schmeichelt, als Ross mir eine Position in seiner Abteilung anbot.
Ja, wenn ich verheiratet gewesen wäre… Aber ich war es nun einmal
nicht. Als Big Ben dröhnend den ersten Glockenschlag der sechsten
Stunde ertönen ließ, war ich am Smith Square angekommen.
Wie immer, wenn ich das Arbeitszimmer von Charles Ross betrat,
schoß mir der gleiche Gedanke durch den Sinn: Welch ungewöhn-
licher Raum, um hier in eine Aufgabe eingewiesen zu werden, die
ohne weiteres mit meinem gewaltsamen Tod enden konnte. Das
Zimmer war hoch und geräumig, mit stuckverzierter Decke, Wän-
den aus geädertem Marmor und darin eingebauten Bücherregalen.
Schwere lederne Klubsessel standen geschickt verteilt auf einem di-
cken Teppich, dessen Farben gut zur übrigen Einrichtung paßten.
Die einzigen Gegenstände, die mich daran erinnerten, daß man
mich nicht zu einem harmlosen Plauderstündchen geladen hatte,
waren der Aktenschrank aus Stahl in der einen Ecke und die vier
Diensttelefone auf dem großen Schreibtisch.
Hinter dem Schreibtisch saß ein gepflegter Herr von etwa fünfzig
Jahren, der einen gut sitzenden dunkelgrauen Maßanzug anhatte.
Auf den ersten Blick hätte man ihn für einen erfolgreichen Ge-
2

schäftsmann halten können; erst wenn er sprach, merkte man, daß
Charles Ross einige Eigenschaften hatte, die in der Welt des Ge-
schäftslebens fehl am Platze gewesen wären.
Bei meinem Eintritt erhob er sich, schenkte mir ein Wohlwollen
vortäuschendes Lächeln und schüttelte mir die Hand. Während er
sich wieder setzte, neigte er den Kopf in Richtung eines Herrn, der
es sich in einem der breiten Ledersessel bequem gemacht hatte.
»Ich möchte Sie mit Lewis Richards bekannt machen, Frazer. Er
wird diesen Fall mit Ihnen gemeinsam bearbeiten.« Und mit leicht
amüsiertem Blick in Richtung auf Richards fügte Ross hinzu: »Übri-
gens ist Mr. Richards noch nicht ganz davon überzeugt, daß es sich
hierbei wirklich um einen ›Fall‹ handelt. Oder soll Ihr Zynismus in
Wahrheit nur Ihre Trägheit tarnen, Richards?«
Richards lächelte grimmig. »Nicht die Trägheit, aber die Müdig-
keit, Sir. Meines Erachtens war es Bernard Shaw, der einmal gesagt
hat, man brauche Bergschuhe, um Gemäldegalerien abzuklappern.
Es wird mir stets ein Rätsel bleiben, wie dieses Mädchen es geschafft
hat, solche Marathonstrecken auf Pfennigabsätzen zu bewältigen.«
Er stand auf und schüttelte mir mit kräftig zupackendem Griff die
Hand. »Wissen Sie, wieviel Museen es in Amsterdam gibt, Frazer?«
Ich antwortete ihm mit einem unverbindlichen Lächeln, wie man
es gewöhnlich bei Fragen tut, mit denen man nichts anzufangen
weiß. Er lehnte sich in seinem Sessel zurück.
»Sie werden es bald wissen«, versicherte er mir.
Ich musterte ihn kurz. Er hatte ein kluges Gesicht mit langer, ha-
kenförmiger Nase. Die Augen hatten jenen Ausdruck von Tole-
ranz, die ein Mensch besitzt, der viel gesehen und gehört hat, aber
nicht die Hälfte davon glaubt. Mir schien, mit diesem Kollegen
würde ich gut auskommen.
Ross unterbrach meinen Gedankengang. »Hier haben Sie eine
Aufnahme der jungen Dame, die Sie beobachten sollen, Frazer.« Er
nahm ein Foto aus einer Akte und reichte es mir.
3

Die Fotografie zeigte eine Frau Anfang Dreißig, brünett, mit gro-
ßen, dunklen Augen, wohlgeformter Nase und vollem, üppigem
Mund. Ich hätte mir eine Menge weniger amüsanter Aufträge vor-
stellen können, als der Spur so rassiger Beine zu folgen, wie man sie
unter dem kurzen, engen Rock zu sehen bekam.
»Sie heißt Barbara Day«, erläuterte Ross, »ist Engländerin, Teilha-
berin eines Antiquitätenladens in Kensington und mit einem Bör-
senmakler namens Arthur Fairlee verlobt.«
Während ich das Foto interessiert betrachtete, fing ich einen iro-
nischen Blick von Richards auf. »Man könnte diesen Fairlee benei-
den, finden Sie nicht auch, Frazer?«
Ross unterbrach ihn abrupt. Ȇbermorgen fliegt sie nach Amster-
dam. Ich habe es so eingerichtet, daß Sie mit derselben Maschine
fliegen.« Mit fragendem Blick fügte er hinzu: »Haben Sie Ihren Paß
bei sich?«
Ich holte ihn aus der Tasche und gab ihn Ross, der ihn kurz an-
schaute und dann in eine Schublade legte.
»Sie bekommen ihn rechtzeitig vor der Abreise zurück.«
Mir schien der Zeitpunkt gekommen, noch einige Fragen zu stel-
len. »Darf ich erfahren, warum diese junge Dame beschattet werden
soll?«
Ross nahm eine Zigarette aus einer silbernen Dose und forderte
mich auf, mich gleichfalls zu bedienen. »Vor knapp sechs Wochen
wurde ein Mitarbeiter meiner Abteilung namens Leo Salinger getö-
tet. Er wurde von einem Wagen überfahren, den Barbara Day lenk-
te.«
Ich nahm mir eine Zigarette. »Haben Sie den Verdacht, daß es
kein Unfall war?«
Richards legte seine Hände dachförmig zusammen und kniff ein
Auge zu. »Das ist eben die inhaltsschwere Frage.«
Ross ließ mit dünnem Lächeln sein Feuerzeug aufflammen. »Wir
wollen es einmal so formulieren: Leo war einer unserer besten Män-
4

ner. Also hat es bestimmt einige Leute gegeben, denen er im Wege
war.«
Bei der Vorstellung, auch ich könnte eines Tages diesen nicht un-
bedingt beneidenswerten Status in dieser Dienststelle erreichen, be-
schlich mich ein leichtes Frösteln. »Aber es wurde doch sicher eine
Leichenschau abgehalten. Hat die denn nichts ergeben?« erkundigte
ich mich.
Ross machte eine einladende Handbewegung zu meinem neuen
Kollegen hin. »Jetzt sind Sie an der Reihe, Richards. Sie waren da-
bei.«
»Wenn man den Zeugen glauben darf, dann war es einwandfrei
ein Verkehrsunfall«, erläuterte Richards das Ergebnis der Leichen-
schau. »Sie sagten aus, Barbara Day habe alles getan, um den Wa-
gen zum Halten zu bringen, konnte Salinger aber nicht mehr aus-
weichen. Nach den Zeugenaussagen trat er unvermittelt vor ihrem
Wagen vom Bürgersteig auf die Fahrbahn.«
Ich warf erneut einen kurzen Blick auf das attraktive Gesicht auf
dem Foto. »Haben Sie eine Ahnung, was Barbara Day damals in
Amsterdam getan hat?«
Hier schaltete Ross sich ein. »Unseres Wissens verbrachte sie dort
ihren Urlaub.«
»Ist sie seit dem Unfall noch einmal drüben gewesen?«
Ross nickte. »Vor vier Wochen flog sie nach Amsterdam und blieb
sechs Tage dort. Wir haben Richards hinübergeschickt, um sie zu
beobachten.«
Richards stöhnte mit hohlem Klang. »Du meine Güte! Sechs Tage
nichts als Museen und Kunstgalerien. Und das Ergebnis: Nichts Be-
lastenderes als ein gelegentlicher Seitenblick auf eine nackte männ-
liche Statue.«
Ich lächelte. »Und dennoch verdächtigen Sie die junge Dame
auch weiterhin, Salinger absichtlich getötet zu haben?«
»Ich nicht«, erwiderte Richards emphatisch. »Was mich betrifft,
5

so halte ich es für einen echten Unfall. So etwas kommt vor …
selbst in unseren Reihen.« Er rieb sich mit Daumen und Zeigefinger
an seiner langen Nase. »Leider kann ich Mr. Ross nicht davon über-
zeugen, daß sonst nichts dahintersteckt.«
»Schon gut, Richards«, besänftigte Ross seinen Mitarbeiter. »Ich
weiß: Ihrer Ansicht nach habe ich in bezug auf Miß Day einen
Tick. Aber ich mache mir nun einmal meine eigenen Gedanken da-
rüber.«
Richards lachte verlegen. »So habe ich es aber nicht ausgedrückt,
Sir.«
»Ich würde es Ihnen nicht einmal verübeln, wenn Sie so däch-
ten.« Ross lächelte ihn väterlich an und wandte sich dann wieder
mit ernstem Gesicht mir zu. »Diese mehrfachen Reisen von Miß
Day nach Holland können nicht ausschließlich Vergnügungsfahrten
sein. Ich möchte wissen, was dahintersteckt. Das ist Ihr Auftrag,
Frazer. Sie sollen berichten, wohin sie geht und mit wem sie sich
trifft.« Er drehte die Zigarette spielerisch zwischen Daumen und
Zeigefinger. »Vor allem aber möchte ich wissen, ob sie in Amster-
dam auch das Café de Kroon aufsucht.«
Ich hob die Augenbrauen. »Warum gerade de Kroon?«
»Salinger pflegte dort zu verkehren.« Ross holte aus einer seitli-
chen Schublade seines Schreibtisches einen Stadtplan von Amster-
dam hervor, breitete ihn aus und deutete mit manikürtem Finger
auf einen rotumränderten Straßennamen. »Keizersgracht-Platz. Das
Café de Kroon liegt gleich um die Ecke.«
Ich merkte mir den Namen. »Und was war mit Salinger?« fragte
ich. »Können Sie mir etwas über ihn erzählen? Was tat er in Hol-
land?«
»Er wohnte und arbeitete dort, und von Zeit zu Zeit lieferte er
uns einige Informationen.«
Ross preßte die Lippen fest zusammen, so daß mir die Lust ver-
ging, die an sich selbstverständliche Frage nach der Art dieser Infor-
6

mationen zu stellen. Statt dessen fragte ich nur: »Hat jemand davon
gewußt?«
Er schüttelte langsam den Kopf. »Unseres Wissens nicht! Aber na-
türlich müssen gewisse Leute gewußt haben, daß wir einen Kontakt-
mann in Holland haben und durch ihn Informationen erhalten.« Er
lächelte dünn. »Darüber brauchen Sie sich aber keine Gedanken zu
machen. Es handelte sich um ganz allgemeine Informationen.«
Ein durchtriebener alter Knabe, dachte ich und fragte weiter:
»Und wenn Richards nun recht hat? Wenn der Unfall echt und Miß
Day an Salinger überhaupt nicht interessiert war?«
Ross sah mich mit einem langen, kalten Blick an. »Die Fragen
stelle ich, Frazer. Ihre Aufgabe ist es, mir die Antworten zu bringen.
Ihr Flugticket für Amsterdam wird Ihnen noch heute abend durch
Extraboten zugestellt.«
Also brauchte ich mir nicht weiter den Kopf über meine Aufgabe
zu zerbrechen. Ich erhob mich und verabschiedete mich mit kur-
zen Worten. »Auf Wiedersehen, Sir.«
Als ich an Richards vorbeikam, blinzelte mir dieser aus seinem
Sessel mit einem Auge zu. »Ich hoffe, Sie mögen Museen, Frazer«,
frotzelte er mit sanfter Stimme.
Es dämmerte bereits, als ich aus dem Hause trat. Mir gegenüber,
inmitten des Platzes, stand die ausgebombte Kirche mit den vier
Türmen. Man sagt, Königin Anna hätte einst einen Schemel umge-
stoßen und ihren Architekten befohlen, eine Kirche in diesem Stil
zu bauen. Ich empfand plötzlich Sympathien für diese Architekten.
Meine Instruktionen schienen mir keinesfalls sinnvoller zu sein.
7

2
as Flugticket wurde am nächsten Morgen zusammen mit dem
geänderten Paß abgegeben. Ich empfand Erleichterung, als ich
feststellte, daß ich nicht unter einem angenommenen Namen zu
reisen brauchte. Nur meinen Beruf hatte Ross geändert. Im Paß
stand jetzt ›Journalist‹ statt ›Ingenieur‹; außerdem lag eine kurze
Mitteilung für mich dabei: »Sie haben den Auftrag, Artikel für eine
Fachzeitschrift zu schreiben, und zwar über technische Probleme,
da Sie ja die Fachsprache beherrschen. Nehmen Sie eine Filmkame-
ra mit und gebrauchen Sie sie auch. Vernichten Sie diesen Zettel.«
Keine Unterschrift. Das war auch nicht nötig, denn die Abfassung
der Notiz war ganz und gar von der Persönlichkeit von Charles
Ross geprägt.
D
D
Am nächsten Morgen fand ich mich lange vor der Abfahrtszeit
des Zubringeromnibusses der Fluggesellschaft an der Abfahrtsstelle
ein. Ich stand am Zeitungskiosk herum und behielt die Taxis im
Auge, die nach und nach die anderen Fluggäste heranbrachten.
Als Barbara Day eintraf, hielt ich kurz den Atem an. Ihr Foto war
nicht geschmeichelt. Sie trug keinen Hut. Ihr pechschwarzes Haar
war kurz geschnitten und als Ponyfrisur in die Stirn gekämmt, was
ihren wohlgeformten Kopf wirkungsvoll betonte. Sie trug einen Pelz-
mantel lose über die Schultern gelegt und darunter ein dunkles
Kleid. Das beste aber waren ihre Beine. Man hätte meinen können,
sie seien geradewegs von einem Werbeplakat für Seidenstrümpfe
heruntergestiegen. Selbst wenn ich nicht den dienstlichen Auftrag
dazu gehabt hätte, so würde ich doch jeden ihrer Schritte mit –
nun, sagen wir, mit Interesse verfolgt haben.
Dann stand sie neben mir am Zeitungskiosk, umgeben vom zar-
8

ten Duft eines Parfüms, das ich nicht näher definieren konnte. Ich
kam mir vor wie ein Bluthund, dem man einen Handschuh hinge-
worfen hatte mit dem Befehl, ihre Spur aufzunehmen und ihr zu
folgen. Und hätte ich einen Schweif gehabt, würde ich damit gewe-
delt haben.
Sie kaufte sich ein Modemagazin und den letzten Band der Ro-
mantetralogie von Durrell. Ihre Stimme war wohllautend ruhig und
dunkel. Wenn Arthur Fairlee mit ihr telefonierte, mußte ihn der
Klang der Stimme unfehlbar in angenehme Erregung versetzen.
Beim Einsteigen in den Zubringerbus ließ ich ihr den Vortritt und
fand dann einen leeren Sitz drei Reihen hinter ihr auf der gegen-
überliegenden Seite.
Als wir gerade abfahren wollten, kam noch ein Nachzügler keu-
chend angestürzt und kletterte etwas unbeholfen in den Wagen. Sei-
ner Kleidung nach zu urteilen, war er Amerikaner; er trug einen Pa-
namahut, gestreiftes Hemd, einen karierten Anzug und eine farben-
frohe Krawatte. Es lag aber so gar nichts Hemdsärmeliges in der
Art, wie er, seine Luftreisetasche schwenkend, sich stolpernd nach
einem Sitzplatz umsah und dabei jedermann mit einem scheuen
Grinsen bedachte. Schließlich setzte er sich auf den einzigen noch
freien Sitz neben Barbara Day.
Noch bevor wir die endlose und langweilige Westend Road er-
reicht hatten, die zum Flughafen führt, schien er in eine schnell an-
geknüpfte Konversation mit Barbara Day verwickelt, was mich et-
was neidisch stimmte. Er war schätzungsweise in meinem Alter, ob-
wohl er offensichtlich bemüht war, sich ein jugendlicheres Ausse-
hen zu geben.
Am Flughafen verließ ich den Bus als erster und erreichte auch
allen voran die Empfangshalle. Auch auf dem Wege zu unserer Dü-
senmaschine ließ ich die anderen Passagiere hinter mir. An der
Gangway wartete ich jedoch und ließ Barbara Day vor mir einstei-
gen. Als ich dann zögernd neben ihrem Doppelsitz stehenblieb, sah
9

sie auf.
»Oh, Verzeihung! Sind die Sachen Ihnen im Wege?«
Mit diesen Worten räumte sie ihre Handtasche, das Magazin und
das Buch von dem Platz neben ihr.
Nachdem ich ihr gedankt und mich gesetzt hatte, wurde auch
schon die Kabinentür zugeschoben. Die ruhige, distanzierte Stimme
der Stewardeß ermahnte uns, die Sicherheitsgurte anzulegen und
nicht zu rauchen.
Als wir die Flughöhe erreicht und die Gurte gelöst hatten, holte
ich mein Zigarettenetui hervor und hielt es ihr nach kurzem Zö-
gern hin. Sie nahm sich mit ihrer schmalfingerigen Hand eine Ziga-
rette. Ihre Fingernägel waren dunkelrot lackiert und für meinen Ge-
schmack etwas zu lang. Sonst aber war nichts an ihr auszusetzen.
Ich memorierte kurz, was Richards mir von ihr berichtet hatte. An-
scheinend war er ihr auf die unbequeme und mühsame Tour auf
den Fersen geblieben und hatte sich hinter Zeitungen und Perso-
nen versteckt, als er ihr durch Museen und Kunstgalerien folgte.
Ganz plötzlich überkam mich ein unangenehmes Gefühl. Schließ-
lich war Richards ein alter Fuchs in seinem Fach. Dennoch hatte er
es vorgezogen, von dem gejagten Wild nicht gesehen zu werden.
Ob meine eingeschlagene Taktik nicht doch einen Haken hatte?
Vielleicht würde sie mich in eine Situation bringen, der ich nicht
gewachsen war?
Eine Viertelstunde vor der Landung hielt ich den Zeitpunkt für
gekommen, ein Gespräch anzuknüpfen, das mir unter Umständen
einen Hinweis auf den Zweck ihrer Reise geben konnte.
»Wie jemand auf die Idee kommen kann, seinen Urlaub in Hol-
land zu verbringen, ist mir unbegreiflich«, sprach ich sie unvermit-
telt an. »Mich kann nur eine Dienstreise hierher bringen.«
»Genauso könnte auch Arthur, mein Verlobter, sprechen«, erwi-
derte sie in leicht gereiztem Ton. »Man braucht ihm gegenüber nur
das Wort Urlaub zu erwähnen, und er denkt sofort an Südfrank-
10

reich.«
»Nun, zumindest weiß man im voraus, daß dort die Sonne
scheint«, konterte ich höflich. »Sicherlich mag auch Holland seine
Vorzüge haben, aber mit dem Wetter hapert es hier doch ständig.«
»Ach, Unsinn! Ich bin schon oft in Holland gewesen, und das
Wetter war immer prächtig.«
»Dann haben Sie aber großes Glück gehabt, möchte ich behaup-
ten.« Ich forcierte das Thema jetzt, soweit dies möglich war, ohne
ihren Argwohn zu wecken. »Was gibt es denn hier noch Interessan-
tes zu sehen, wenn nicht gerade die Tulpen blühen?«
»Windmühlen.« Sie sah mich einen Moment lang spöttisch an.
»Also – um Ihre Neugierde zu befriedigen: Es gibt viele ausgezeich-
nete Museen und Kunstgalerien. Amsterdam ist nämlich die Stadt
der Museen.« Sie fingerte an ihrem Verlobungsring, als wolle sie da-
mit unterstreichen, daß es nicht eine männliche Anziehungskraft
war, die sie nach Holland lockte, und wechselte das Thema: »Dann
sind Sie also auf einer Geschäftsreise?«
Ich nickte. »Ich bin Journalist und schreibe über technische Din-
ge, meistens über Ingenieurprojekte. Deshalb fliege ich auch nach
Amsterdam. Die Holländer haben ein neues Verfahren bei der Her-
stellung von Außenwänden aus Stahl entwickelt, an dem meine
Fachzeitschrift interessiert ist.«
»Ich fürchte, das liegt ziemlich außerhalb meines Interessengebie-
tes«, antwortete sie lächelnd. »Hoppla… Mir scheint, wir setzen zur
Landung an.«
Fast im selben Augenblick ertönte die Stimme des Flugkapitäns
über den Lautsprecher. Er kündigte an, daß wir in wenigen Mi-
nuten über dem Flughafen Schiphol sein würden, und ermahnte
uns, die Sicherheitsgurte anzulegen.
Barbara sah mich tadelnd an. »Na bitte, da sehen Sie selbst.« Sie
holte einen Taschenspiegel aus der Handtasche hervor und begann
unnötigerweise, Korrekturen an ihrem Make-up vorzunehmen. Noch
11

während sie den Lippenstift gebrauchte, bedankte sie sich bei mir:
»Nett von Ihnen, daß Sie mir auf so angenehme Weise die Zeit ver-
trieben haben. Vielleicht trifft man sich zufällig mal in Amster-
dam.«
Mit einem, wie ich hoffe, nicht mokanten Lächeln antwortete ich:
»Ich werde nach Ihnen Ausschau halten.«
Die Maschine verlor an Höhe und schwebte auf die flache hol-
ländische Küste zu. Zu unserer Linken hoben sich die Silhouetten
der Türme von Amsterdam vor dem blauen Himmel eines wunder-
baren Spätnachmittags im Frühling ab. Wie weiße Bänder durchzo-
gen die in der Sonne glitzernden Kanäle kreuz und quer das Stadt-
bild. Im Sonnenschein schien der Anspruch Amsterdams, als Vene-
dig des Nordens zu gelten, nicht ganz so ausschließlich ein Werbe-
spruch der Reisebüros zu sein.
Ich ließ Barbara Day den Vortritt bei der Paßkontrolle und beim
Zoll. Statt aber ihren feschen, blau-gelb gestreiften Luftkoffer dem
Gepäckkarren des Flughafenomnibusses zu überlassen, nahm sie
diesen mit sportlichem Griff und ging damit flotten Schrittes zum
Hauptausgang. Schnell schnappte ich meinen eigenen Koffer, der
schon auf dem Gepäckkarren lag, und eilte hinter ihr her. Ich kam
gerade noch zurecht, um ein nylonbekleidetes formschönes Bein in
einem Taxi verschwinden zu sehen. Ich winkte dem nächsten Taxi
aus der wartenden Reihe, verlor es aber an den Amerikaner. Seinem
wilden Gestikulieren mit der Reisetasche entnahm ich, daß er den
Fahrer anwies, Barbaras Taxi zu folgen.
Einen Augenblick später bot ich selbst die gleiche Szene. Glück-
licherweise verstand mein Fahrer genug Englisch, um schnell zu be-
greifen, was ich von ihm wollte. Einen Zigarettenstummel im Mund-
winkel, antwortete er auf meine Gesten und Worte nur: »Gewiß,
Sir.«
Wir folgten den beiden anderen Taxis durch eine der belebtesten
Straßen Amsterdams entlang einer Gracht. Als wir uns der ein-
12

drucksvollsten der vielen Brücken über die zahllosen Grachten nä-
herten, verlangsamten die beiden Wagen, denen ich folgte, ihr Tem-
po und fuhren an den Bürgersteig heran. Ich bedeutete meinem
Fahrer weiterzufahren. Er antwortete nur »Okay, Sir«, während ich
mich im Fond des Wagens zurücklehnte, um nicht von der Dame
und dem Herrn erkannt zu werden, die jetzt auf dem Bürgersteig
standen und erstaunte Begrüßungsworte wechselten.
An der nächsten Ecke ließ ich halten. Beim Bezahlen hielt ich es
für angebracht, einen harmlosen Kommentar zu unserer Verfol-
gungsjagd zu geben. Es bestand ja schließlich die Möglichkeit, daß
er den Vorfall der Polizei meldete, und dann würde ich wohl bald
von einem Kriminalbeamten beschattet werden. Deshalb murmelte
ich etwas von einem hübschen Mädel, das ich im Flugzeug gesehen
hatte und dessen Wohnung ich gern in Erfahrung gebracht hätte.
Ich hätte mir die Mühe sparen können. Er reagierte nur mit einem
uninteressierten Schulterzucken und der Bemerkung: »Warum
nicht?« Später entdeckte ich einen österreichischen Schilling unter
dem Wechselgeld, das er mir herausgegeben hatte.
Ich ging die Straße entlang, die in rechtem Winkel auf die Gracht
zulief, bis ich zu einem kleinen Hotel kam, das bestimmt keinen
Stern in Michelins Hotelführer hatte. Aber der mit roten Ziegeln
ausgelegte Empfangsraum war peinlich sauber, und im metallenen
Oberteil des massigen Ofens konnte man sich spiegeln.
Man gab mir ein bescheiden eingerichtetes, aber makellos saube-
res Zimmer mit Blick auf die Straße. Gleich daneben lag ein Bade-
zimmer. Nachdem ich ausgepackt und mich geduscht hatte, zog
ich mich rasch wieder an und ging aus, um mir erst einmal einen
Stadtplan zu kaufen.
In einem anspruchslosen Lokal studierte ich ihn genau. Ohne be-
sondere Mühe fand ich den Keizersgracht-Platz und prägte mir den
Weg dorthin von meinem augenblicklichen Standort aus ein. Dann
machte ich mich auf, um mir das Restaurant de Kroon anzusehen.
13

Es war ein typisch kontinentales Restaurant, mit Tischen draußen
auf dem Bürgersteig, die dem holländischen Klima tapfer Trotz bo-
ten. Es ist eine alte Erfahrung: Will man herausfinden, ob ein Lokal
empfehlenswert ist, dann soll man sich die Gäste ansehen, bevor
man eintritt. Sehen sie wie Einheimische aus und befinden sich kei-
ne Touristen mit umgehängter Kamera darunter, dann kann man
ziemlich sicher sein, daß das Essen gut und preiswert ist. De Kroon
bestand diese Probe. Ich ging jedoch nicht hinein und lief noch ein
paar Stunden durch die Stadt, um mir einige Lokalkenntnisse anzu-
eignen. Nach und nach zog eine Dunstschicht vom Meer herauf,
die bei mir ein klammes Kältegefühl am ganzen Körper verursachte.
Ich empfand daher das dringende Bedürfnis, etwas zu essen und zu
trinken. Am Keizersgracht-Platz gab es verschiedene Bars und Re-
staurants, die jetzt im Schein grellbunten Neonlichtes Gäste anlock-
ten. Ich war viel zu sehr darauf aus, endlich ein warmes Plätzchen
zu finden, und so ging ich durch die Drehtür ins nächstbeste Lo-
kal.
Das bißchen Atmosphäre, das es hatte, war auf Tourismus zuge-
schnitten. Die Kellnerinnen trugen Landestracht mit hellen Schul-
tertüchern; hinter einem Holzkohlenrost stand der Koch und grin-
ste mit vorgetäuschter Bonhomie. Der Büfettier hinter dem lang-
gestreckten Schanktisch hätte in jeder x-beliebigen Touristenbar
zwischen Rom und Paris auf den Namen ›Harry‹ gehört. Ich kippte
erst einmal ein paar Glas Genever hinunter, die bewirkten, daß mei-
ne Lebensgeister wieder erwachten, nachdem ich mich an einem der
kleinen Tische niedergelassen hatte.
Ich bestellte die Spezialität des Hauses – ›Runderlappen‹, die sich
als gedünstetes Steak herausstellte und von bester Qualität war. Als
ich dann schließlich einen Kognak vor mir stehen und die Nach-
tischzigarette angezündet hatte, war ich wieder imstande, meine Ge-
danken etwas zu ordnen und ein Fazit des ersten Tages meines neu-
en Einsatzes zu ziehen. Soweit ich die Dinge bis jetzt beurteilen
14

konnte, war ich geneigt, Richards beizupflichten. Während des Flu-
ges hatte Barbara sich sehr freimütig über sich selbst geäußert. Sie
hatte ihr Interesse an Antiquitäten erwähnt und mit der Natürlich-
keit eines Mädchens, das nichts zu verbergen hat, von ihrem Ver-
lobten erzählt. Ich dachte an Arthur Fairlee. Ein Börsenmakler
schien mir auch nicht gerade der richtige Verlobte für eine junge
Dame zu sein, die mit Leuten verkehrt, an denen die Dienststelle
Ross interessiert war.
Noch einmal vergegenwärtigte ich mir die Unterhaltung im Flug-
zeug. Als ich Barbara Day über ihre häufigen Besuche in Amster-
dam befragte, war sie mir nicht im geringsten ausgewichen. Oder
doch? Ich zerdrückte in plötzlicher Erregung mit völlig unange-
brachtem Kraftaufwand meinen Zigarettenstummel im Aschenbe-
cher, als mir einfiel, wie geschickt sie doch einer Antwort ausgewi-
chen war, als ich sie fast bis zur Unhöflichkeit mit meinen Fragen
bombardiert hatte. Nachdenklich zündete ich mir eine neue Ziga-
rette an und folgte dem Rauch mit ziellosem Blick. Ja, es war schon
so. Sehr geschickt hatte sie es verstanden, der Unterhaltung eine
neue Wendung zu geben, indem sie mich nach den Gründen für
meinen Aufenthalt in Amsterdam fragte, gewissermaßen als Retour-
kutsche für meine plumpe Neugier.
Die Stimme eines Mannes, der eine neue Runde Getränke be-
stellte, erinnerte mich plötzlich an den Amerikaner. Wie paßte er
wohl in dieses Bild? Vielleicht war er gar nicht der harmlose Tou-
rist, den er spielte. Das aber würde bedeuten, daß wir Barbara zu
zweit nachstellten. Natürlich brauchte auch nicht mehr dahinter-
zustecken als der übliche Grund, der einen Mann veranlaßt, hinter
einem attraktiven Mädchen her zu sein. Bei keiner der beiden halb
ausgegorenen Schlußfolgerungen konnte ich zu einer klaren Lösung
kommen, am wenigsten bei der zweiten. Daher zahlte ich und kehr-
te in mein Hotel zurück.
15

3
ier Tage später saß ich am Fenster eines Cafés gegenüber einem
Museum. Inzwischen hatte ich mir eine Methode ausgeklügelt,
um Barbara zu beobachten. Nachdem ich ihr unauffällig in gebüh-
render Entfernung durch fünf Museen gefolgt war, kam ich zu der
Ansicht, daß es mein Gewissen nicht belasten würde, wenn ich ihr
nur bis zum Eingang folgte und dann in einem nahe gelegenen Café
etwas trank, bis sie wieder aus dem Gebäude herauskam. Vielleicht
hätte Richards das nicht gebilligt; aber schließlich hatte seine gewis-
senhaftere Methode auch keine besseren Ergebnisse gezeitigt.
V
V
Abgesehen davon, war mir inzwischen klargeworden, daß Miß
Day zu beschatten gleichbedeutend mit Langeweile war. Ich hatte
eine Liste der Plätze aufgestellt, die sie inzwischen außer den histo-
rischen Sehenswürdigkeiten aufgesucht hatte. Es waren Läden, Ki-
nos und Restaurants – und zwar nicht wenige. Dem Restaurant de
Kroon
war sie jedoch nur einen halben Kilometer nahe gekommen.
Als Barbara das Museum verließ, trank ich mein restliches Bier
mit der Entschlossenheit eines Mannes, der zum Handeln bereit ist.
An diesem Nachmittag würde ich sie ansprechen und die sich da-
raus vielleicht ergebenden Konsequenzen in Kauf nehmen.
Um zwei Uhr nachmittags stand ich vor ihrem Hotel, hielt mich
aber unter der Masse der Spaziergänger und Schaufensterbummler,
um nicht durch allzu großes Interesse für den Hoteleingang aufzu-
fallen. Hin und wieder tat ich so, als fotografierte ich die Touristen-
boote, die auf der Grachtenrundfahrt vorbeikamen.
Erst kurz vor drei Uhr kam Barbara flotten Schrittes aus dem Ho-
tel, überquerte die Straße, stieg die Treppe zum Anlegesteg hin-
unter und bestieg ein Rundfahrtboot.
16

Sobald das Boot abgelegt hatte, ging ich zum Fahrplan und sah
nach, wann es wieder zurück sein würde. Um vier Uhr. Damit hatte
ich noch eine Stunde Zeit zum Trödeln. Also setzte ich mich wie-
der in ein nahegelegenes Café und trank noch ein paar Glas Bier.
Punkt vier Uhr plazierte ich mich an der obersten Stufe des Lan-
destegs und zückte die Filmkamera, als ihr Boot auftauchte. Dies-
mal ließ ich den Film wirklich ablaufen. Schade, daß es kein Farb-
film war, denn das einfache rote Kleid bildete einen vollendeten
Kontrast zu ihrem entzückenden schwarzen Haarschopf.
Als sie die Stufen heraufkam, ließ ich die Kamera sinken. Sie be-
merkte mich erst, als ich ihr einen guten Tag wünschte. Ihre Lippen
öffneten sich, und dann verwandelte die Überraschung auf ihrem
Gesicht sich in ein warmes Lächeln.
»Hallo! Guten Tag – das ist ja eine Überraschung!« rief sie und
grüßte winkend mit einer schwarz behandschuhten Hand.
»Immer noch allein, wie ich sehe.«
»Ich genieße jeden Augenblick, solange ich mein eigener Herr
bin.«
»Was tun Sie denn in dieser Gegend?« fragte ich, so harmlos es
ging. »Sie werden doch nicht schon alle Kunstgalerien durch sein?«
Sie schüttelte den Kopf. »Keineswegs. Aber an einem so schönen
Nachmittag wollte ich mich doch einmal von Museen und Gale-
rien erholen.«
Sie stellte sich neben mich und sah auf die spiegelnde Wasserflä-
che. »Ist das nicht wirklich reizend?« fragte sie mit einem Seufzer
tiefer Zufriedenheit.
In diesem Augenblick konnte ich mir nichts Vollkommeneres
vorstellen. »Ich muß Ihnen in bezug auf Holland recht geben. Es
hat schon seine Reize.«
Sie warf mir einen dankbaren Blick zu. Es kostete mich einige
Mühe, auf das Thema zu kommen, das den Zweck dieses scheinbar
zufälligen Zusammentreffens bildete. »Darf ich mir die Frage erlau-
17

ben, ob Sie heute abend etwas Besonderes vorhaben?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Eigentlich nichts, was der Rede
wert wäre. Irgendwo essen, wie gewöhnlich. Es gibt eine Reihe net-
ter Restaurants in Amsterdam.«
»O ja, das habe ich auch schon festgestellt«, antwortete ich mit
Begeisterung. »Erst gestern habe ich wieder ein sehr gemütliches Lo-
kal entdeckt. De Kroon.« Mit einem schnellen Seitenblick fragte ich:
»Kennen Sie es?«
Sie dachte angestrengt nach. »De Kroon?«
Ich nickte, ohne ihr Gesicht aus den Augen zu lassen.
»Nein, das kenne ich nicht, habe auch noch nie davon gehört.
Wo ist es denn?«
Das klang vollkommen glaubwürdig. Dennoch entschied ich mich
dafür, weiterhin den Begeisterten zu spielen, um sie so vielleicht
doch noch zu einer verräterischen Äußerung zu verleiten. »Man
geht am Dolderplatz rechts zur Keizersgracht… Entschuldigung,
umgekehrt natürlich. Ich wollte sagen, man geht in die Keizers-
gracht und biegt dann am Dolderplatz rechts ab, geht durch die
Middlestraße und wieder links… Nein, auch nicht.« Ich schluckte
ein paarmal und begann dann von neuem. »Also, jetzt habe ich
es… Sie gehen in der Middlestraße links ab, und wenn Sie dann zur
Keizersgracht kommen, dann…«
»Um Himmels willen, hören Sie auf«, flehte sie lachend und legte
eine Hand auf meinen Arm. »Offensichtlich haben Sie nicht den
Schimmer einer Ahnung, wo es ist.«
Ich grinste bewußt einfältig. »Wir könnten ja mit einem Taxi hin-
fahren«, sagte ich und schnippte mit den Fingern. »Das ist doch
überhaupt eine Idee! Darf ich Sie dort zu einem Drink einladen?«
Einen Augenblick lang schaute sie sinnend einem Schwan nach,
der mit majestätischer Gelassenheit auf der Gracht vorbeisegelte.
Dann antwortete sie unentschlossen: »Es ist furchtbar nett von Ih-
nen – aber ich muß zurück zum Hotel und mich zum Abendessen
18
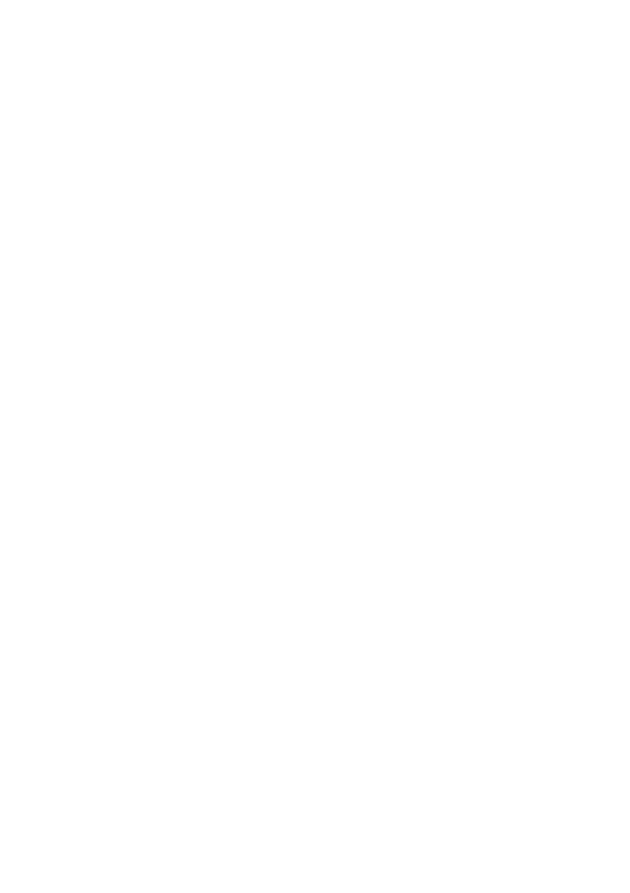
umziehen. Ich muß –«
Ich unterbrach sie. »Aber das macht doch nichts. Für einen Drink
bleibt immer noch genug Zeit. Wie wäre es – wollen wir uns nicht
in einer Stunde hier wieder treffen?«
Barbara Day zögerte noch. Mit einem raschen Blick auf die Arm-
banduhr stimmte sie dann aber lächelnd zu: »Also gut. Ihr Vor-
schlag ist dankend angenommen. Wir treffen uns an dieser Stelle
um halb sechs. Ist es Ihnen so recht?«
»Wunderbar!« rief ich, wobei meine Begeisterung keinesfalls vor-
getäuscht war. »Also abgemacht. Um halb sechs Uhr. Auf Wieder-
sehen bis nachher!« Ich drohte ihr lächelnd mit dem Finger. »Hof-
fentlich fällt Ihnen nicht inzwischen plötzlich ein, doch noch ein
Museum aufzusuchen.«
»Bestimmt nicht.« Lächelnd schickte sie sich zum Gehen an. »Ich
werde pünktlich sein.«
Ich sah ihr nach, wie sie die Straße auf dem Wege zum Hotel
überquerte, wobei mir eigentümlich warm ums Herz wurde. Nun-
mehr war ich sicher, daß ihr der Name de Kroon nicht mehr bedeu-
tete, als wenn ich ihr den Namen irgendeines Restaurants in Tim-
buktu genannt hätte. Mit seinen Ansichten über Barbara Day war
Charles Ross auf dem Holzwege. Und das war mir sehr recht.
Als wir anderthalb Stunden später bei de Kroon anlangten, war es
trotz der späten Nachmittagsstunde noch sehr warm. Die Tische
waren voll besetzt, aber ein diskret dem Kellner in die Hand ge-
drücktes Trinkgeld überzeugte diesen davon, daß draußen noch
Platz für einen weiteren kleinen Tisch war.
Ich bestellte für meine Begleiterin einen Cinzano und für mich
einen Martini Dry und ging dann auf den Bürgersteig, um mit mei-
ner Kamera Aufnahmen von der farbigen Szenerie zu machen.
Gerade als ich die Kamera auf Barbara Day richtete, wurde ich
19

gewahr, daß sie mit jemandem sprach. Eine Sekunde später kam die
Gestalt eines Mannes in den Sucher.
»Hallo, wie geht's?« erklang eine bekannte Stimme. Sie gehörte
dem Amerikaner, dessen pausbäckiges Gesicht das gewohnte ent-
waffnende Lächeln ausstrahlte.
Ich ließ die Kamera sinken, und es gelang mir sogar, ein spötti-
sches Lächeln zu unterdrücken, als er mit einem detaillierten Be-
richt über seinen Tagesablauf begann. Langsam ging ich zum Tisch
zurück, wo er Barbara mit einem so deutlichen Gefühl schwärmeri-
scher Verehrung anstrahlte, daß man ihm einfach nicht böse sein
konnte.
»Du meine Güte – was bin ich heute auf den Beinen gewesen!«
rief er aus. »Um die Mitbringsel für die Lieben daheim zu kaufen,
habe ich mir fast die Füße wund gelaufen.«
»Ach so, natürlich. Sie fahren ja morgen wieder nach Hause«, ant-
wortete Barbara. Als mein Schatten auf den Tisch fiel, wandte sie
sich um und stellte uns einander vor.
Er streckte mir eine gedrungene Hand entgegen. »Freut mich, Sie
kennenzulernen!« rief er, und es klang, als ob es wirklich so ge-
meint war. Ich tat mein Bestes, um ihm ebenso freundlich entgegen-
zutreten, aber es kostete mich einige Mühe.
»Mr. Cordwell wohnt im selben Hotel wie ich«, sagte Barbara zu
mir.
Er nickte eifrig. »Und außerhalb des Hotels stoßen wir immer
wieder aufeinander – einmal auf einem Schiff, ein andermal in ei-
nem Omnibus oder in einem Lift…«
»Und im Museum nicht?« unterbrach ich ihn ein wenig maliziös.
»Aber nein, Sir!« Cordwell winkte verächtlich ab. »Keine Museen;
das ist nichts für mich.« Er griff nach der Lehne eines Stuhls. »Hät-
ten Sie etwas dagegen, wenn ich meine gepeinigten Füße einen
Augenblick von meinem Körpergewicht entlaste?«
Ich fügte mich ins Unabänderliche. »Keineswegs.«
20

»Natürlich möchte ich mich nicht aufdrängen…«
Ich verschluckte eine drastische Antwort, die ich ihm am liebsten
gegeben hätte, und antwortete nur: »Aber nein, schon in Ordnung.
Nehmen Sie doch Platz.«
Er stellte seine Tasche mit Reißverschluß mitten auf den Tisch,
legte die Kamera auf den Boden und machte es sich auf einem frei-
en Stuhl bequem. »Gottlob, jetzt ist mir wohler. Europa ist schon
eine Reise wert, Mr. Frazer. Einfach großartig! Ich bin dem alten
Kontinent richtiggehend verfallen. Nur meine Füße! Was werden
die froh sein, wenn wir wieder zu Hause sind.«
Ich lachte pflichtschuldig, verstaute meine Kamera in ihrer Ta-
sche und stellte sie resigniert unter den Tisch. Nur um etwas zu sa-
gen, fragte ich: »Sind Sie zum erstenmal in Holland, Mr. Cord-
well?«
»O nein. Ich war schon vor fünf oder sechs Wochen hier und
habe auch nicht geglaubt, daß ich noch einmal zurückkommen
würde.« Er strich mit der Hand über sein kurz geschorenes Haar.
»Leider hatte ich ein weniger angenehmes Erlebnis.«
Ich zeigte höfliches Interesse. »Nanu, was war denn los?«
»Am Abend vor meiner Abreise brach jemand in mein Hotelzim-
mer ein und erleichterte mich um mein Gepäck.« Er grinste zer-
knirscht. »Man hat mir damals alles gestohlen; buchstäblich alles!«
Barbara warf ihm einen mitfühlenden Blick zu. »Oh, wie schreck-
lich für Sie.«
»Und ob das schrecklich war.« Cordwell strahlte sie dankbar an.
»Können Sie sich das vorstellen! Mir blieb nur das, was ich gerade
anhatte.«
Ich spürte, daß er sich an der Geschichte zu erwärmen begann
und sie uns in allen Einzelheiten schildern würde. Deshalb gab ich
ihm großzügig das Stichwort: »Und was haben Sie dann getan? Das
nächste Flugzeug nach Hause genommen?«
Er warf mir einen dankbaren Blick zu. »Aber nein, etwas gab es,
21
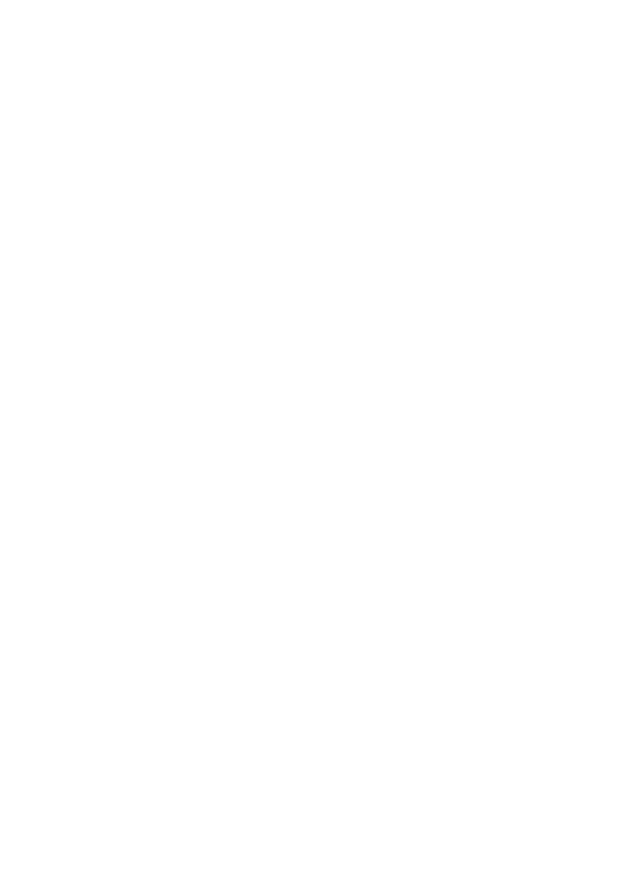
was mir der Dieb nicht stehlen konnte – meine Ferien. Ich kaufte
mir neue Sachen und machte weiter.«
»Aber Sie haben den Diebstahl doch der Polizei gemeldet?« fragte
Barbara.
»Sofort natürlich.« Cordwell beugte sich aufgeregt vor. »Und jetzt
kommt der Clou vom Ganzen. Vor einer Woche schnappte die Po-
lizei den Burschen, der mich bestohlen hatte, schickte mir ein Tele-
gramm und forderte mich auf, zurückzukommen und meine Sa-
chen offiziell in Empfang zu nehmen. Ich war in London und woll-
te gerade wieder nach Hause fliegen. Natürlich bin ich postwen-
dend umgekehrt.«
»Haben Sie nun auch wirklich alles wieder?« fragte ich.
»Alles, bis auf einen Feldstecher.«
»Sie sind ein Glückspilz, Mr. Cordwell.«
Er zuckte mit den Schultern. »Wie man es nimmt. Man könnte
sagen, ich hätte Glück im Unglück gehabt.« Er schnippte mit den
Fingern, um den vorbeikommenden Kellner auf sich aufmerksam
zu machen. »Für meine beiden Freunde hier nochmals dasselbe.
Und für mich einen Whisky auf Eis.«
Vielleicht hatte ich mich in meiner Annahme doch getäuscht,
daß de Kroon ein von ausländischen Touristen noch nicht entdeck-
tes Lokal sei. Jedenfalls lächelte der Kellner bei der in englischer
Sprache gegebenen Bestellung ungerührt und wiederholte in bes-
tem Englisch: »Einen Cinzano, einen Martini Dry und einen Scotch
on the rocks«, und verschwand in Richtung Schanktisch.
»Wetten, daß der Junge genau weiß, wie viele Gulden einen Dol-
lar ausmachen?« fragte Cordwell stolz, nachdem der Kellner ver-
schwunden war. Er zerrte am Reißverschluß seiner Reisetasche. »Den
ganzen Vormittag über war ich mit Einkäufen beschäftigt. Ich habe
ein paar wirklich reizende Sachen erwischt. Sehen Sie doch mal das
hier an.« Nach einigem Herumwühlen holte er ein winziges Fahrrad
hervor, auf dem eine Kleiderpuppe saß, ein Holländer in Landes-
22

tracht. »Nun, was sagen Sie dazu, Barbara?«
Barbaras Lippen zitterten leicht amüsiert. »Wirklich süß.«
»Warten Sie erst einmal ab, bis ich Ihnen die Krone meiner heu-
tigen Einkäufe gezeigt habe. Ein richtiger Gelegenheitskauf aus ei-
nem Geschäft ganz in der Nähe.« Wieder wühlte er in der Tasche.
Mit einem erschöpften Seufzer holte er einen Katalog für Tulpen-
zwiebel hervor und warf ihn auf den Tisch.
Mit einem flüchtigen Blick auf den grellfarbigen Umschlag fragte
ich ihn: »Nanu, wollen Sie sich zu Hause einen holländischen Blu-
mengarten anlegen, Cordwell?«
»Ach, das ist nur für meinen Bruder.« Dann brachte er mit trium-
phierendem Blick ein eigenartig geformtes Metronom zum Vor-
schein und stellte es auf den Tisch. »Ist das nicht toll? Wissen Sie,
wie man das nennt? Ein Metropol. Die Musiker brauchen es, um
damit den Takt einzuüben. Man braucht es nur aufzuziehen – so,
mit ein paar Drehungen.« Er machte sich einen Spaß daraus, es auf-
zuziehen. »Das habe ich für meine Nichte gekauft, für Shirley. Sie
spielt ausgezeichnet Klavier, zumindest behauptet ihre Mutter das.
Ich kann es nicht beurteilen. Wissen Sie, ich bin nicht musika-
lisch.« Er setzte das Metronom durch Antippen des Pendels in
Gang, um dann mit seinem gedrungenen Finger den Takt zu schla-
gen. Dann hielt er inne und grinste selbstgefällig: »Immerhin, es
sieht reizend aus.«
»Es ist wunderschön«, bestätigte Barbara Day atemlos.
»Das kann man wohl sagen. Ich habe solche Dinger schon drü-
ben in den Staaten gesehen, aber kein so schönes wie dies hier.«
Als auch ich bestätigte, daß ich nie zuvor eine so gute handwerk-
liche Arbeit gesehen hätte, war dies keine bloße Höflichkeitsfloskel.
Cordwell überschlug sich fast vor eitler Freude. »Ja, vom Einkau-
fen verstehe ich etwas. Ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt kein
schöneres Metropol.«
»Metronom«, korrigierte Barbara ihn sanft, wobei ihre Augen mir
23

zulächelten.
Cordwell bot mir aus einem vollgestopften Etui eine dicke Zi-
garre an. Als ich dankend ablehnte, steckte er eine in eine unge-
wöhnlich lange Zigarrenspitze, schob diese zwischen seine Zähne
und sah glücklich und zufrieden aus wie ein Kind mit seiner Pup-
pe.
Dann erschien der Kellner mit den Getränken, und wir gerieten
in eine klischeehafte Konversation, wie sie typisch ist für eine Ge-
sellschaft, die aus einer Frau und zwei Männern besteht.
4
inige Tage später landete ich wieder auf dem Flughafen Lon-
don. Ich hatte Ross zwar die Ankunftszeit meines Flugzeuges
gekabelt – mit der Vorzugsbehandlung aber, die mir zuteil wurde,
hatte ich nicht gerechnet.
E
E
Als die Gruppe der ankommenden Passagiere die große Abferti-
gungshalle betrat, stand eine Hosteß vom Bodenpersonal da, die
uns aufmerksam musterte. »Mr. Frazer bitte! Wer ist Mr. Tim Fra-
zer?«
Ich ging zu ihr hinüber, während meine Mitpassagiere mir teils
neidisch, teils unverhohlen neugierig nachstarrten.
»Draußen wartet ein Wagen auf Sie, Mr. Frazer. Ich habe den
Auftrag, Sie so schnell wie möglich durch die Paß- und Zollkontrol-
le zu schleusen.«
Das war schon beinahe ein ›großer Bahnhof‹, fehlte nur noch der
rote Plüschläufer. Im Nu hatte ein Zollbeamter meinen Koffer und
24

meine Kamera mit dem bewußten Kreidestrich versehen. Ich grinste
ihm unverhohlen ins Gesicht, eingedenk des Kreuzverhörs, das ich
hatte über mich ergehen lassen müssen, als ich unter eigener Flagge
den Zoll passieren mußte. Sogar ein Gepäckträger stand für mich
bereit.
Draußen parkte ein schwarz glänzender Humber Snipe an der
Bordsteinkante. Ich konnte gerade noch flüchtig Ross im Fond sit-
zend erkennen, der mir nachdenklich unter dem Rand seines Hom-
burg entgegensah. Dann nahm auch schon ein Chauffeur dem Ge-
päckträger meinen Koffer und meine Kamera ab. Er öffnete die Wa-
gentür, stellte mein Gepäck auf den Boden, und dann saß ich ne-
ben Ross, der ohne alle Begrüßungsformalitäten sofort zur Sache
kam. »Ich brauche sofort Bericht über Barbara Day, damit ich un-
seren Apparat ohne den geringsten Zeitverlust in Bewegung setzen
kann. Die Sache ist dringend, Frazer.«
Wir hatten schon eine beträchtliche Strecke der Fahrt in die Stadt
zurückgelegt, bevor er widerwillig meine Ansichten über Barbara
Day akzeptierte.
Er zog sich den Homburg tiefer in die Stirn. »Es kommt also da-
rauf hinaus, daß Sie mit Richards übereinstimmen. Sie glauben also
auch, das Mädchen sei harmlos?«
Seine Stimme klang derart enttäuscht, daß ich fast wünschte, ich
hätte ihm mehr als nur Belanglosigkeiten zu berichten. »Tja, leider
Sir. Ich fürchte, ich kann Ihnen mit nichts anderem dienen.«
Er knurrte vor sich hin. »Ich nehme an, Sie haben sie die meiste
Zeit unter Beobachtung gehalten?«
Ich nickte. »Selbstverständlich. Zwar habe ich nicht im selben
Hotel gewohnt; aber davon abgesehen, habe ich sie kaum aus den
Augen gelassen. Sie hat auf jeden Fall fast alle Mahlzeiten außer-
halb des Hotels eingenommen.«
»Hm…« Nach kurzer Überlegung fragte Ross: »Und was ist mit
dem Café, das ich erwähnt hatte? De Kroon. Ist sie auch dorthin ge-
25

gangen?«
»Nur auf meine Einladung hin. Ihr Aufenthalt in Amsterdam nä-
herte sich dem Ende. Soweit ich das beurteilen kann, wäre sie aus
eigenem Antrieb nicht in dieses Lokal gegangen. Deshalb hielt ich
es für eine gute Idee, sie dorthin auszuführen…«
Ross schob den Homburg aus der Stirn und sah mich lange und
durchdringend an. »Warum?« fragte er dann.
Ich hatte allmählich das Gefühl, er sei auf dem besten Wege, mein
Interesse für Barbara Day auf nicht rein berufliche Gründe zurück-
zuführen. »Ich wollte dabei feststellen, ob man sie dort kennt. Ein
Kellner vielleicht…«
»Und hat sie jemand erkannt?«
»Nein.« Plötzlich fiel mir der Amerikaner Cordwell ein, und ich
war selbst erstaunt, daß ich unser Zusammentreffen bei de Kroon bis
dahin so völlig vergessen hatte. »Das stimmt nicht ganz«, ergänzte
ich leicht geknickt.
Mit verzweifelter Miene fuhr Ross sich mit der Hand über das
Gesicht. »Lassen Sie sich doch nicht jedes Wort einzeln aus den
Zähnen ziehen.«
Ich schilderte ihm nun schleunigst die Begegnung zwischen Cord-
well und Barbara.
»Glauben Sie wirklich, er ist ihr ins Hotel gefolgt?«
»Es sah ganz danach aus. Mir scheint, er glaubte bei dem Mäd-
chen Eindruck erweckt zu haben.« Ich mußte bei dieser Feststel-
lung unwillkürlich lachen, während Ross jedoch die Stirn runzelte.
»Wie dem auch sei – er drängte sich uns im de Kroon auf und war
nicht mehr abzuwimmeln. Der Mann konnte stundenlang reden.«
»Worüber?« fragte Ross scharf.
»Zumeist über sich selbst. Er bestand darauf, uns seine Souvenirs
zu zeigen. Zwischendurch beklagte er sich immer wieder über seine
schmerzenden Füße. Ich bin sicher, daß Barbara Day genauso ge-
langweilt war wie ich.«
26
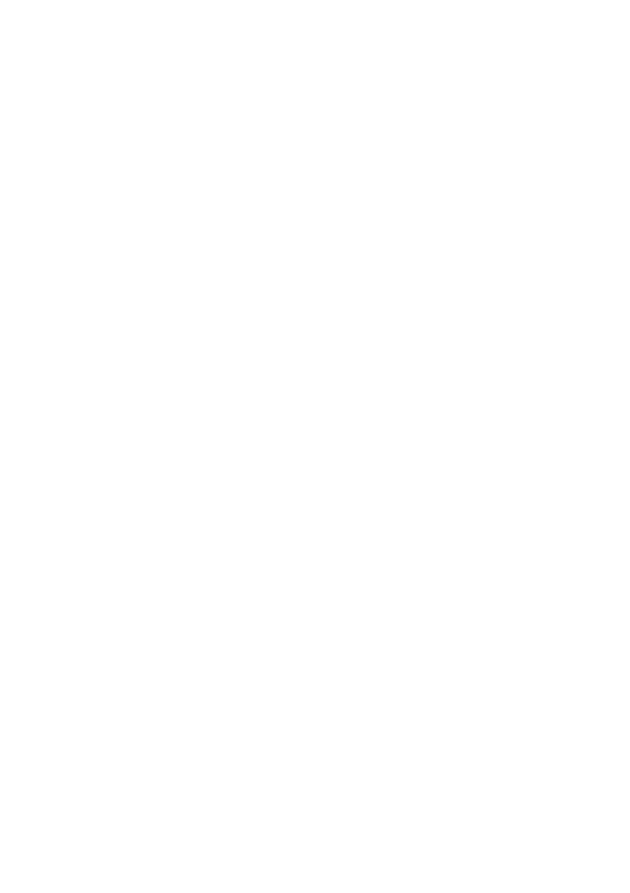
»Bestimmt?« fragte Ross mit einem Anflug von Sarkasmus.
»Etwas jedoch hat mich doch stutzig gemacht«, berichtete ich
weiter, wobei ich mir eingestand, daß ›stutzig‹ wohl nicht ganz die
richtige Bezeichnung für das Gefühl war, das mich damals befiel.
»Bei einer Gelegenheit redete dieser Bursche Miß Day mit ihrem
Vornamen an. Zwar wohnten beide im selben Hotel und liefen sich
auch sonst gelegentlich über den Weg – im Omnibus, bei Boots-
fahrten und so weiter. Als er ihren Vornamen nannte, geschah das
aber mehr in einem Tonfall, der für einen Augenblick das Gefühl
in mir weckte, beide wären mehr als nur zufällig bekannt.«
Ross rieb sich nachdenklich das Kinn. »Wie sah der Mann aus?«
»Wie ein typischer amerikanischer Tourist; so, als sei er gerade ei-
nem Platzregen entronnen. Er muß etwa 35 bis 40 Jahre alt sein und
hat auch etwa meine Größe. Übrigens ist er auf einem Film zu se-
hen, den ich im de Kroon gemacht habe.«
»Ist der Film schon entwickelt?« fragte Ross schnell.
»Noch nicht. Er ist hier drin.« Ich hob die Kamera auf.
Ross streckte die Hand aus. »Geben Sie mir die Kamera. Ich wer-
de sie gleich nach meiner Rückkehr ins Labor geben.« Er richtete
wieder seinen Homburg. »Und dann kommen Sie heute nachmittag
zum Smith Square. Um drei Uhr, bitte. Wir wollen uns mal den
Film ansehen.« Er neigte sich zum Fahrer vor und sagte: »Lassen Sie
mich an der Orchard Street aussteigen.«
Ross machte es sich wieder in seiner Ecke bequem und starrte bis
zur Ecke Orchard Street gedankenversunken zum Wagenfenster
hinaus, wobei er mit den Fingern ungeduldig auf der Kamera in sei-
nem Schoß trommelte. Ich hatte das dringende Verlangen nach ei-
ner Zigarette; aber das hätte bedeutet, daß ich mein Etui auch Ross
reichen mußte. Er schien meine Anwesenheit völlig vergessen zu
haben. Das war mir an sich ganz recht, denn ich fühlte mich wegen
der Ausführung dieses Auftrages doch nicht ganz wohl in meiner
Haut und wünschte nicht, daß eine kurz angebundene Ablehnung
27
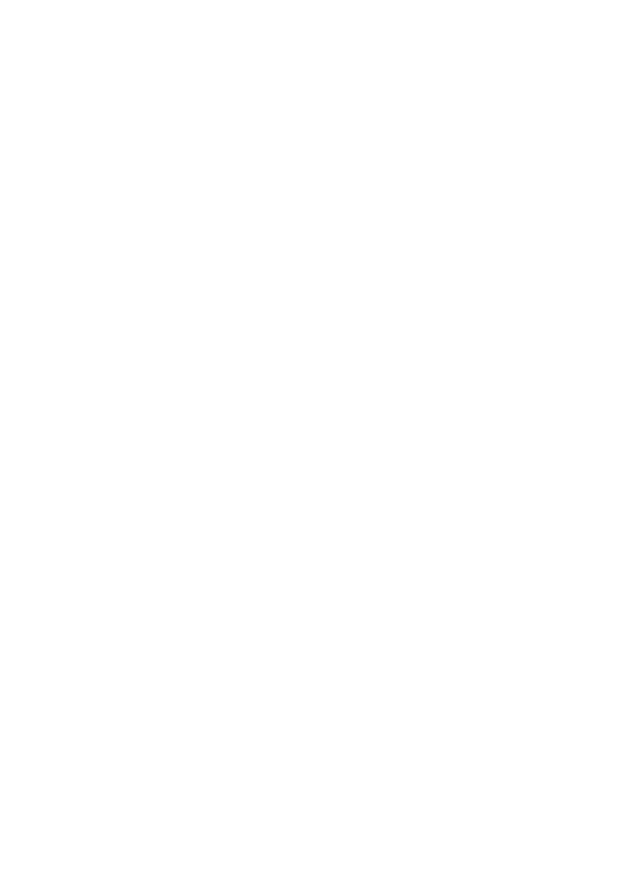
einer angebotenen Zigarette mich an eventuelle Versäumnisse und
Fehler erinnerte.
Wir setzten Ross an der Orchard Street ab. Er erinnerte mich la-
konisch daran, daß wir uns pünktlich um drei Uhr treffen würden;
dann fuhr mich der Chauffeur zu meiner Wohnung.
5
ch hatte heute nicht gerade einen Glückstag. Als ich am Nach-
mittag zu Ross wollte, geriet mein Taxi in Whitehall in eine Ver-
kehrsstauung und mußte weite und zeitraubende Umwege machen,
um ans Ziel zu gelangen.
I
I
So war es denn schon zehn Minuten nach drei Uhr, als ich in das
Bibliothekszimmer am Smith Square geleitet wurde. Die Fenstervor-
hänge waren bereits zugezogen, und Ross marschierte, die Hände in
den Jackentaschen, ungeduldig hin und her. Von einem Bücher-
regal hing eine Filmleinwand herunter. Am anderen Ende des Rau-
mes war Richards mit einem Filmprojektor beschäftigt.
Ross tat meine Entschuldigung mit einer ungeduldigen Handbe-
wegung ab. »Nehmen Sie sich einen Stuhl«, bedeutete er mir ziem-
lich brüsk, legte selbst ein Bein auf die Kante seines Schreibtisches
und nickte Richards zu: »Es kann losgehen.«
Richards langte nach dem Lichtschalter, schaltete die Lampe aus
und ließ dann den Projektor anlaufen.
Während noch die ersten unbelichteten Meter des Films auf der
Leinwand flimmerten, begann ich mit meinen Erklärungen: »Sie
werden Barbara Day gleich in der zweiten Szene sehen – sie besteigt
28

ein Boot zur Grachtenrundfahrt. Die nachfolgenden Aufnahmen
zeigen sie dann beim Betreten eines Museums…«
Im nächsten Augenblick starrte ich sprachlos und offenen Mun-
des auf die ersten Bilder des Films. Sie zeigten einen wenig beleb-
ten, von Bäumen umgebenen Platz, der mir so unbekannt war wie
irgendein Platz in Budapest.
»Halt! Moment mal!« rief ich Richards zu, als ich mich wieder ge-
faßt hatte. »Das ist nicht mein Film!«
Die Stimme von Ross übertönte das Surren des Projektors. »Das
ist der Film aus Ihrer Kamera! Das ist auch Amsterdam. Ich kenne
diesen Platz sehr gut.«
»Aber ich nicht«, antwortete ich kurz angebunden. »Diese Kirche
habe ich noch nie gesehen.«
Ross' Stimme klang verärgert. »Schluß, Richards. Schalten Sie lie-
ber das Licht ein.«
Als der Projektor abgestellt und der Kronleuchter wieder einge-
schaltet war, kam Ross zu mir herüber. »Also was soll das, Frazer?
Dies hier ist Ihr Film. Ich habe ihn unmittelbar nach meinem Ein-
treffen ins Labor zum Entwickeln gebracht und habe dabeigestan-
den, bis er fertig war.«
»Es tut mir leid, Sir«, antwortete ich, wobei ich mir alle Mühe ge-
ben mußte, einen Zornesausbruch gegenüber diesen feindseligen
Blicken von Ross zu unterdrücken, »aber das ist wirklich nicht mein
Film.«
»Widersprechen Sie nicht, Frazer.« Er setzte ein böses Lächeln
auf. »Vielleicht haben Sie vergessen, daß Sie diese Aufnahmen ge-
macht haben, ebenso wie es Ihnen heute nachmittag entfallen war,
daß Sie Cordwell im de Kroon getroffen hatten.«
Ich lief rot an. »Wenn Ihre Meinung über mich…«
Richards unterbrach mich besänftigend. »Wie wäre es, wenn wir
uns auch den Rest des Filmes ansehen würden, Sir? Es scheint hier
einen – wie soll ich es nennen – einen Meinungskonflikt zu geben.
29

Vielleicht läßt sich das Geheimnis besser lüften, wenn wir alles ge-
sehen haben.«
Ross machte auf dem Absatz kehrt, ging zu seinem Schreibtisch
zurück und nahm eine Zigarette aus der silbernen Dose. »Also gut,
Richards. Sehen wir uns den Rest auch noch an.«
Ich machte es mir in meinem Sessel bequem, als der Projektor
wieder zu surren begann. Je weiter der Film lief, desto tiefer sank
mein Blutdruck. Es stand fest, das war nicht mein Film. Ich erkann-
te das Rembrandthaus nur, weil ich Barbara dorthin gefolgt war.
Mit einem leichten Grinsen sah ich zu Ross hinüber und bemerkte,
wie sich im selben Augenblick seine Haltung versteifte. Ohne die
Leinwand aus den Augen zu lassen, gab er Richards mit dem glü-
henden Ende der Zigarette ein Zeichen.
Ich sah schnell wieder auf die Leinwand. Dort war jetzt eine be-
lebte Geschäftsstraße zu sehen. Unter den Müßiggängern und Pas-
santen, die an den Schaufenstern vorbeiflanierten, fiel ein gutgeklei-
deter Herr dadurch auf, daß er sich seinen Weg durch die Menge
unter kräftiger Benutzung der Ellenbogen bahnte. Ohne das unor-
dentlich verpackte Bündel unter seinem Arm hätte ich ihn für ei-
nen Diplomaten gehalten. All das wäre mir aber kaum bemerkens-
wert erschienen, wenn der Mann nicht plötzlich, ohne nach rechts
oder links zu sehen, auf die Fahrbahn getreten wäre.
Ich zuckte automatisch zusammen und hörte im Geiste geradezu
das Quietschen der Bremsen, als der Wagen ihn erfaßte. Er fiel vorn-
über, wobei sein Kopf vom Pflaster wie ein Gummiball zurückprall-
te. Dann lag er auch schon unter dem heftig bremsenden Wagen.
Nach einigen Schrecksekunden umdrängten Fußgänger das Auto.
Der Film flimmerte merklich, als ob die Hand des Kameramannes
gezittert hätte; dann war der Streifen zu Ende. In dem tiefen Schwei-
gen wirkte das Einschalten des Kronleuchters wie ein Blitz, der dem
Donnerschlag vorausgeht.
Ross nahm langsam das Bein vom Tisch und warf Richards mit
30

grimmig zusammengepreßten Lippen einen Blick zu. Richards nick-
te leicht und begann dann, den Film aufzuspulen.
Ungläubig brach es aus mir hervor: »Das – das war doch Barbara
Day, die den Wagen lenkte!«
Ross drückte seine Zigarette im Aschenbecher aus und antwortete
ruhig: »Ja, das war Barbara Day.«
»Dann war der Mann…« Ich machte eine unbestimmte Handbe-
wegung in Richtung auf die Leinwand. »Der Mann, der dort über-
fahren wurde … das muß doch dann…«
»Es war Leo Salinger.« Ross drehte sich um und sah mich an. »Das
war ein Film von dem Unfall, Mr. Frazer.«
Ich hob mich halb aus meinem Sessel. »In meiner Kamera! Aber
das ist doch – das kann doch nicht…«
Vom Projektor erklang Richards' ruhige Stimme: »Ihr Film wurde
offensichtlich gestohlen und dieser dafür eingelegt.«
»Aber wie? Und wann?« Ich erhob mich. »Das ist unmöglich. Die
Kamera ist nie aus meinem Blickfeld gekommen, und ich bin mit
nichts und niemandem so sehr beschäftigt gewesen, daß ein Dritter
Zeit und Gelegenheit gehabt hätte, den Film auszuwechseln.«
»Und wie steht es mit Barbara Day?« fragte Ross aalglatt. »Sie ha-
ben sich doch mehrfach mit ihr getroffen.«
»Ja, aber…« Ich strich mir mit der linken Hand verwirrt über die
Stirn. »Das gibt doch alles keinen Sinn. Selbst wenn sie diesen Film
besaß, warum sollte sie wünschen, daß ich ihn sehe?«
Ross machte eine ungeduldige Geste. »Wie soll ich das wissen?
Das ist eben etwas, was wir herausfinden müssen.« Er betrachtete
nachdenklich seine Fingernägel. Mit einer Plötzlichkeit, die mich
verwirrte, sah er mich eindringlich fragend an. »Haben Sie etwas
mit ihr verabredet?«
»Ich habe versucht, eine Verabredung mit ihr zu treffen. Sie ist
aber nicht darauf eingegangen.«
»Gibt es irgendeinen Grund für Ihre Ablehnung?«
31

Ich antwortete mit dünnem Lächeln: »Zufälligerweise ist sie ver-
lobt, wie Sie wohl wissen.«
»Ich halte es für angebracht, daß Sie mit diesem Verlobten in et-
was stärkeren Wettbewerb treten«, erklärte Ross trocken. »Richten
Sie es so ein, daß Sie ein- oder zweimal mit ihr zusammentreffen.
Es muß aber ganz zufällig scheinen. Ich schätze, Sie wissen, wie
man das macht.« Er sah mich leicht belustigt und abschätzend an.
»Aber tragen Sie nicht zu dick auf. Sollte Miß Day doch in unseren
Fall verwickelt sein, könnte sie leicht Verdacht schöpfen.«
»Ich werde es schon richtig hinkriegen, Sir. Bevor ich aber an die-
sen« – ich riskierte ein leichtes Grinsen – »Auftrag Charme heran-
gehe, würde ich noch gern etwas über Leo Salinger wissen.«
Ross wanderte zu seinem Schreibtisch zurück. »Und das wäre?«
»Was trug Salinger in diesem Paket bei sich?«
»In dem Paket?« Ross schien ehrlich überrascht. »Warum wollen
Sie das wissen?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich bin neugierig – das ist alles.«
Ross warf mir einen nachdenklichen Blick zu und sagte dann:
»Salinger trug ein Metronom bei sich.«
32

6
ch war gerade dabei, meine Haustür aufzuschließen, als drinnen
das Telefon zu läuten begann. Ich ließ die Tür offen und raste
hinein. Nicht daß ich einen dringenden Anruf erwartet hätte. Aber
ich gehöre nun einmal zu den Leuten, die unruhig auf und ab wan-
dern, wenn ihr Telefon zu läuten aufhört, bevor sie den Anruf ent-
gegengenommen haben. Ich stieß die Tür zu meinem Wohnzimmer
auf und machte einen gewaltigen Satz zum Tisch, um den Hörer
abzunehmen.
I
I
»Hallo? Hier Tim Frazer«, keuchte ich in die Muschel.
Eine tiefe, beherrschte Stimme antwortete: »Hier Barbara Day.
Was ist denn los? Ihre Stimme klingt so, als hätten Sie gerade einen
Hundertmeterlauf hinter sich.«
Ich mußte lachen. »Das sind nur die vielen Zigaretten, wahr-
scheinlich rauche ich zuviel. Ich freue mich, wieder einmal Ihre
Stimme zu hören. Wie geht es Ihnen? Hatten Sie einen guten Rück-
flug?«
»Danke. Er war wirklich sehr angenehm.« Ihre Stimme klang nicht
mehr so heiter, als sie weitersprach: »Ich fürchte, ich überfalle Sie
sehr kurzfristig. Hätten Sie Zeit und Lust, noch heute abend einen
Drink bei mir zu nehmen?«
»Aber natürlich, gern.«
»Arthur Fairlee, mein Verlobter, wird auch kommen. Ich weiß,
daß er Sie gern kennenlernen würde.«
»Das ist fein. Wann erwarten Sie mich?«
Sie zögerte. »Um halb acht? Paßt Ihnen das?«
»O ja, ausgezeichnet.«
Barbara Day lachte amüsiert. »Wie töricht von mir – Sie wissen ja
33
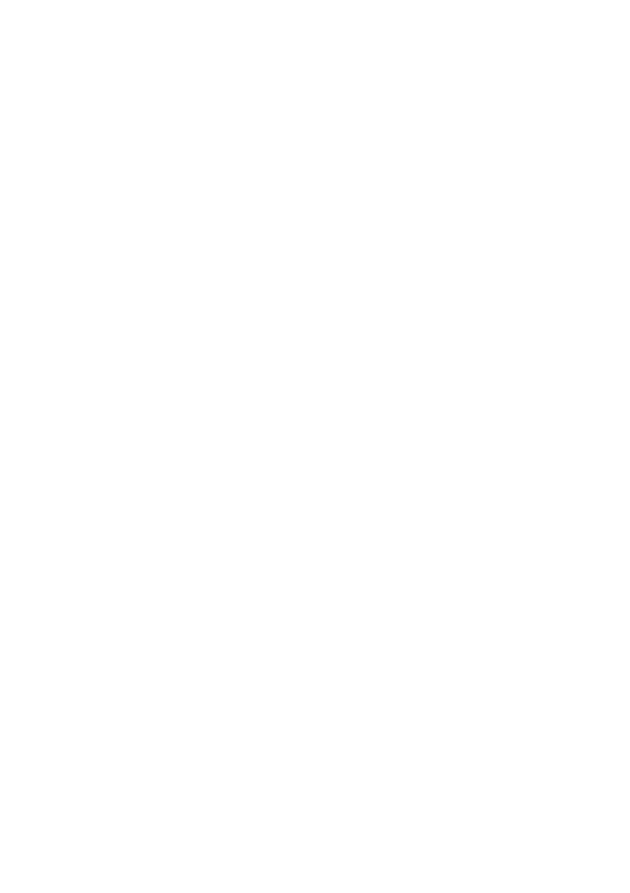
gar nicht, wo ich wohne. In Chelsea, und zwar Crawford House
Mansions Nr. 23. Werden Sie das behalten?«
»Ich schreibe es mir gerade auf.«
»Freue mich, Sie wiederzusehen. Auf bald!«
»Auf Wiedersehen – und herzlichen Dank für die Einladung!«
Nachdenklich legte ich den Hörer auf. Warum mochte sie mich
so urplötzlich angerufen haben? Und warum wollte sie mich unbe-
dingt ihrem Verlobten vorstellen? Stand das vielleicht in irgendei-
nem hintergründigen Zusammenhang mit dem seltsamen Film von
dem Unfall? Ich zögerte, ob ich Ross telefonisch verständigen soll-
te. Schließlich entschied ich mich, es zu unterlassen.
Crawford House Mansions war einer dieser modernen Apartment-
blocks, die wie ein Kaninchengehege wirken – in einer Seitenstraße
der Kings Road gelegen. Das Haus hatte einen Lift mit Selbstbe-
dienung, der mich zum ersten Stock hinaufbrachte. Ich schritt über
einen langen, läuferbelegten Korridor, an einem halben Dutzend
zellenähnlicher Türen vorbei, bis ich zum Apartment 23 kam.
Ich tippte mit der Fingerspitze flüchtig auf den Klingelknopf,
richtete kurz meine Krawatte und legte in meinen Gesichtsausdruck
ein leichtes Lächeln, das den erlaubten Grad froher Erwartung aus-
drücken sollte. Leider war es mir nicht möglich, meine Mimik auch
wirkungsvoll zur Geltung zu bringen, da ich unentwegt die Tür an-
lächelte, die sich nicht öffnete. Nach mehrfachem Läuten legte ich
ein Ohr an die Tür und lauschte. Kein Laut – weder das Öffnen ei-
ner Tür innerhalb der Wohnung noch das Klappern hoher Absätze,
die das eilige Herannahen ihrer Trägerin ankündigten. Nur Stille.
Ein Blick auf meine Armbanduhr zeigte mir, daß es drei Minuten
nach halb acht war. Nachdenklich starrte ich auf die verschlossene
Tür. Dann drückte ich fest mit dem Daumen länger auf die Klingel.
Etwa eine halbe Minute lang lauschte ich dem Läuten, das mich
34

zu verspotten schien. Dann gab ich es auf. Ich beschloß, Barbara
Day später anzurufen. Und sollte ich dann auch nur noch halb so
wütend sein wie im Augenblick, dann würde mein pflichtbewußter
›Charme‹ kaum zu mehr als einem hohlen Lachen reichen.
Gerade als ich mich zum Gehen anschickte, hörte ich ein kratzen-
des Geräusch zu meinen Füßen. Ich blickte hinunter und sah, wie
ein flacher Sicherheitsschlüssel unter dem Türrand durchgeschoben
wurde.
Ratlos starrte ich ihn an und hob ihn auf. Was sollte das wohl
bedeuten? Unentschlossen spielte ich mit dem Schlüssel in der hoh-
len Hand. War das etwa ein Wink für mich, zu einem späteren Zeit-
punkt wiederzukommen?
Endlich entschloß ich mich, doch sofort in die Wohnung zu ge-
hen. Ich schloß auf und betrat einen schmalen Vorraum. Auf dem
Fußboden lag eine Flugreisetasche, deren Reißverschluß aufgerissen
war. Nachdem ich die Wohnungstür mit dem Absatz zugestoßen
hatte, sah ich mir die Reisetasche näher an. Am Handgriff war ein
Anhänger befestigt; der Name darauf lautete: R. Cordwell.
Die gegenüberliegende Tür zum Wohnzimmer stand halb offen.
Ich ging darauf zu, stieß sie weit auf, machte einen Schritt in das
Zimmer hinein und blieb wie erstarrt stehen. Mitten auf dem Tep-
pich lag ein winziges Fahrrad; daneben etwas, was einst eine Klei-
derpuppe gewesen war – ein Holländer in Nationaltracht. Die Klei-
dung der Puppe war zerrissen, die Holzwolle aus ihrem Rumpf über
den ganzen Teppich verstreut. Nicht weit davon entfernt lag der
Tulpenkatalog, den Cordwell in Amsterdam aus einem Koffer ge-
holt hatte.
Der mir aus Amsterdam bereits vertraute Zigarrenrauch war
schwach im Raume spürbar, und mit einem Frösteln böser Vorah-
nung sah ich mich weiter im Raume um. Ich sah den umgestürzten
Teetisch, sah die messingglänzende Lampe daneben, die zerschlage-
ne Porzellanvase und die über den Boden verstreuten Rosenblätter.
35

Dann erst bemerkte ich die grotesk gegeneinander gewickelten Fü-
ße, die viel zu klein für den schweren Mann schienen. Mein Blick
wanderte weiter über den zerknüllten, typisch amerikanischen An-
zug mit dem zerrissenen Rockaufschlag zu dem schweren, blutbe-
fleckten gläsernen Aschenbecher neben dem Kopf mit dem Bür-
stenhaarschnitt.
Ich muß mindestens eine halbe Minute lang regungslos auf Cord-
well gestarrt haben, bevor ich mir des seltsamen Geräusches bewußt
wurde. Ein rhythmisches, jubilierendes Ticken beherrschte den sonst
totenstillen Raum. Ich wirbelte herum und griff mit einem Sprung
nach dem Metronom, das mit Pendel nach oben auf dem Teppich
lag. Ich preßte den Finger auf das nach beiden Seiten ausschlagende
Pendel und hörte jemanden rufen: »Um Gottes willen, hör auf da-
mit!« Der Rufer war ich selbst. Ich ließ das Instrument wieder auf
den Boden fallen, richtete mich auf und ging zu Cordwells Leiche
zurück.
Was ich mich jetzt zu tun anschickte, war mir sehr zuwider. Aber
vielleicht erhielt ich doch einen Hinweis auf die Identität des Mör-
ders, wenn ich Cordwells Taschen durchsuchte. Also kniete ich nie-
der, um im nächsten Augenblick wie von der Tarantel gestochen
wieder hochzuschnellen. Ich war verteufelt nervös; und das plötz-
liche Schrillen des Telefons in diesem im Zeichen des Todes stehen-
den Zimmers erklang ebenso unerwartet wie ein Schrei in einer Kir-
che.
Ich schüttelte mich wie ein Hund, der eben einem eiskalten Fluß
entstiegen ist, und wandte mich dem Telefon zu, das auf einem
Tischchen neben der Anrichte stand. Einen Augenblick lang zöger-
te ich. Dann aber nahm ich mit meinem Taschentuch den Hörer
auf, das ich zuvor aus der Jackentasche gezogen hatte.
Kaum hatte ich den Hörer aufgenommen, als mich auch schon
eine weibliche Stimme in fast atemloser Hast mit einem wahren
Wortschwall überschüttete. »Hier ist Vivien. Ich hatte doch recht,
36

Barbara. Er ist sehr neugierig wegen Ericson und Lennard Street.
Ich dachte, wir sollten doch lieber…« Die Stimme schwankte und
nahm dann einen dringlicheren Ton an. »Hallo, Barbara! Du bist es
doch, nicht wahr?«
Es hatte keinen Sinn, dieses Gespräch noch auszudehnen. Des-
halb ließ ich den Hörer auf die Gabel zurückgleiten und stand noch
einen Augenblick sinnend da, die Hand immer noch auf dem Hö-
rer. Ich versuchte krampfhaft, mir ein Bild von der Lennard Street
zu machen, deren Name mir irgendwie bekannt vorkam; aber es ge-
lang mir nicht. Schließlich steckte ich das Taschentuch wieder ein
und riß mich so weit zusammen, daß ich mich etwas ruhiger wieder
der Leiche zuwenden konnte.
Eine innere Stimme sagte mir, daß mir nicht mehr viel Zeit blieb,
weshalb ich Cordwells Taschen so schnell wie möglich durchsuch-
te. In seiner Brieftasche befand sich nichts, was mir wichtig schien.
Ich hatte gerade eine seiner Seitentaschen nach außen gestülpt, als
ich hörte, wie ein Schlüssel in der äußeren Wohnungstür bewegt
wurde.
Schnell verstaute ich den Kleinkram wieder, sah mich dann im
Raume um und entdeckte dabei eine Tür in der äußersten Ecke.
Noch während ich so schnell und lautlos wie möglich hinüberlief,
hörte ich, wie die Wohnungstür geöffnet und wieder geschlossen
wurde. Ich verschwand im Schlafzimmer, das nach dem leichten,
unverkennbaren Parfümduft offensichtlich Barbara gehörte. Ich ließ
die Tür einen Spalt offen und sah mich sofort nach einem anderen
Ausgang um.
Es gab nur das Fenster als Ausweg, das von einer langen Seiden-
gardine verhüllt war. Behutsam schob ich den Vorhang beiseite und
stellte mit Erleichterung fest, daß es sich um ein unverriegeltes
Schiebefenster handelte. Draußen war die eiserne Plattform einer
Feuerleiter erkennbar. Ich ließ das Fenster fluchtbereit offen und
schlich zur Tür zurück.
37

Ich kam gerade zurecht, um zu sehen, wie Barbara in einem schi-
cken Sommerkleid das Wohnzimmer betrat. Sie sah verblüfft aus,
und ich nahm an, daß sie voller Erstaunen Cordwells Reisetasche
im Vorraum entdeckt hatte. Beim Anblick der zerfetzten Puppe, der
umgestürzten Stühle und des Tulpenkatalogs wandelte sich ihr Ge-
sichtsausdruck in Bestürzung. Dann erst erblickte sie Cordwells Lei-
che.
Unwillkürlich trat sie einen Schritt zurück, als wolle sie einem
Schlag ausweichen. Ihre Hände verkrampften sich über dem Bügel
der Handtasche, so daß die Knöchel weiß wurden. Es schien mir
eine volle Minute zu vergehen, ehe sie einen Schritt nach vorn tat
und dann noch einen. Als ihre Fußspitze gegen das Metronom
stieß, hörte man ein kaum vernehmbares Klicken. Sie blieb stehen
und schaute hinunter, wobei ihr Gesicht sich von der Leiche ab-
wandte.
Das Telefon begann zu läuten, und sie riß sich zusammen, wobei
sich auf ihrer Stirn ein paar winzige, nachdenkliche Falten bildeten.
Im nächsten Augenblick schien sie sich bereits wieder in der Gewalt
zu haben. Sie ging zum Telefon hinüber und nahm den Hörer ab,
fast als sei ihr diese Unterbrechung willkommen.
Sie sprach nicht, sondern lauschte nur dem Wortschwall, den ich
schwach, wenn auch unverständlich vernehmen konnte. Ihre Mund-
winkel spannten sich, und schließlich unterbrach sie den Gesprächs-
partner.
»Vivien, bitte geh aus der Leitung!« forderte sie in gebieterischem
Ton. »Es ist etwas Schreckliches geschehen…« Wieder hörte man
von der anderen Seite einen Wortschwall, bis Barbara Day die Ge-
duld verlor. »Ich muß sofort die Polizei verständigen«, rief sie ener-
gisch in die Sprechmuschel, »würdest du also bitte auflegen!«
Sie knallte den Hörer auf die Gabel. Als sie ihn wieder aufhob,
um festzustellen, ob die Leitung jetzt frei war, zitterte ihre Hand
sichtlich. Dann begann sie zu wählen, und ich hatte nicht den ge-
38

ringsten Zweifel daran, daß sie die bekannte Nummer 999, das
Überfallkommando, anrief.
Ich war nicht darauf versessen, ihre Meldung an die Polizei mit-
zuhören, sondern schlich leise zum Fenster und schwang mich über
die Brüstung auf die Feuerleiter.
Unten fand ich eine Tür mit der Aufschrift ›Für Lieferanten‹. Sie
führte zu einem mit Fliesen ausgelegten Flur, an dessen Ende sich
eine Tür befand, die durch einen Druck auf einen Knopf elektrisch
zu öffnen war. Ich drückte darauf und befand mich auch schon auf
der Straße. Es berührte mich eigenartig, daß die Leute draußen un-
verändert und unberührt ihren Betätigungen nachgingen wie an je-
dem beliebigen Abend.
Wenige Meter weiter die Straße hinauf hatte ein Taxi gerade sei-
nen Fahrgast abgesetzt. Ich hielt den Fahrer an, stieg ein und nann-
te ihm das Ziel: Smith Square.
Beim Abfahren blickte ich mit einem unangenehmen Gefühl zum
Eingang des Wohnblocks zurück, der jedoch ruhig und menschen-
leer dalag.
Als wir eben in die Kings Road einbogen, raste ein Polizeiwagen
mit solchem Tempo um die Ecke, daß eigentlich nur noch zwei Rä-
der den Boden berührten und mein Taxifahrer erschrocken fester
ins Lenkrad griff.
»Die fahren bestimmt nach Chelsea«, hörte ich ihn brummen.
»Diese verdammten Beatniks werden wohl wieder etwas angestellt
haben.«
»Immer leben und leben lassen«, erwiderte ich, wobei ich mir
Mühe gab, völlig gelassen und unbeteiligt zu erscheinen. Ich ließ
mich nicht weiter auf ein Gespräch ein, da es mir ratsam schien,
nichts zu tun oder zu sagen, was den Fahrer später an seinen Fahr-
gast erinnern konnte.
39

7
m Smith Square wurde mir von Hobson geöffnet, dem Haus-
faktotum und ›Mädchen für alles‹ der Dienststelle, einem Mann
mit leiser Stimme, der stets einen schwarzen Zweireiher mit gestreif-
ter Hose trug. Mr. Ross sei leider nicht anwesend, eröffnete er mir
in einem Tonfall, als vertraue er mir ein Staatsgeheimnis an.
A
A
Enttäuscht fragte ich, ob denn wohl Mr. Richards im Hause sei.
Auf diese Weise gelangte ich wenigstens in die Vorhalle, während
Hobson zum entgegengesetzten Ende ging und dort mit flüsternder
Stimme in ein Haustelefon sprach. Als er den Hörer wieder aufge-
legt hatte, erklärte er mir in gedämpftem Ton, Mr. Richards geruhe
mich zu empfangen.
Richards saß im Bibliothekszimmer lässig in einem Sessel, ein
Glas Whisky-Soda in der Hand. »Tut mir leid, daß Ross nicht da
ist. Aber er wurde ins Unterhaus gerufen, um dort einem Staatssek-
retär eine doppelsinnige Antwort auf die heikle Frage eines Abge-
ordneten zu soufflieren…« Richards brach mitten im Satz ab und
sah mich verwundert an. »Menschenskind… Sie sehen ja aus, als wä-
ren Sie einem Geist begegnet.«
»Auf jeden Fall jemandem, dessen Geist wirklich einmal spuken
könnte«, entgegnete ich. »Cordwell, der Amerikaner, den ich in
Amsterdam kennengelernt habe, ist tot – ermordet.«
Richards pfiff kaum hörbar durch die Zähne und erhob sich dann
aus dem Sessel. »Sie brauchen erst einmal einen Schluck zur Stär-
kung.« Er wanderte zum Getränkeschrank hinüber, öffnete ihn und
meinte dann: »Da dürfte ein Kognak wohl das richtige sein. Wie
wäre es mit dem hier, einem Courvoisier?« Beim Einschenken schlug
er bewußt einen burschikosen Ton an, um mir zu helfen, das see-
40

lische Gleichgewicht wiederzufinden. »Der alte Knabe hat stets ein
paar ordentliche Sachen am Lager. Der weiß genau, was gut
schmeckt. Und Sie, Frazer, sollten Ihre Morde zu einer günstigeren
Zeit servieren. Am besten so zur Lunchzeit, und in seinem Klub.«
Ich hatte es mir inzwischen in einem Sessel bequem gemacht, der
dem seinen genau gegenüberstand. »Tut mir leid, daß meine Ner-
ven etwas mitgenommen sind«, entschuldigte ich mich, als ich ihm
das Glas mit dem Kognak abnahm. »Aber man stolpert ja nicht je-
den Tag über eine Leiche.«
»Solche Erlebnisse sind nie sehr angenehm«, bestätigte Richards
und ließ sich wieder in seinen Sessel fallen. »Ross hat mir von die-
sem Amerikaner erzählt. Wie wäre es, wenn Sie jetzt in aller Ruhe
berichten würden?«
Als ich die Ereignisse in Barbara Days Wohnung schilderte, rieb
Richards sich die Nase. »Eine verflixt unangenehme Angelegenheit.
Und der Mörder hat die Wohnung auf dem gleichen Wege verlas-
sen wie Sie? Über die Feuerleiter?«
Ich nickte. »Nachdem er mir vorher noch den Wohnungsschlüs-
sel unter dem Türrand durchgeschoben hatte.«
Richards legte nachdenklich die Stirn in Falten. »Gerade das
macht alles so rätselhaft, Frazer. Warum wollte man, daß Sie die
Leiche so schnell finden? Normalerweise sollte man von einem
Mörder erwarten, daß er versucht, soviel Zeit wie möglich zu fin-
den, um sich aus dem Staube zu machen.«
»Denselben Gedankengang habe ich auch schon gehabt.« Ich
nippte an meinem Kognak, krampfhaft bemüht, das Rätsel zu er-
gründen.
»Es könnte vielleicht so gedacht gewesen sein.« Richards schloß
bei seiner lauten Überlegung nachdenklich die Augen. »Sie wurden
in der Wohnung erwartet. Man schob Ihnen den Schlüssel zu, weil
man damit rechnete, daß Sie hineingehen würden. Stimmt's? Dann
verständigt man die Polizei, es sei da ein Mord geschehen. Die Po-
41

lizei erscheint in der Wohnung, findet Sie bei der Leiche und…«
Ich unterbrach ihn. »Natürlich wurde ich in der Wohnung erwar-
tet. Aber doch von Barbara Day.«
Richards sah mich unbeteiligt über den Rand seines Glases an. »Ja
und?«
»Also bitte, Richards, lassen wir doch das«, fuhr ich ihn erregt an.
»Barbara Day hat mit dem Mord nichts zu tun. Ich habe sie vom
Schlafzimmer aus beobachtet, als sie die Wohnung nach mir betrat.
Und ich sage Ihnen, sie war wie versteinert, als sie die Leiche sah.
Und was die Benachrichtigung der Polizei betrifft, so hat sie doch
selbst den Fall der Polizei gemeldet.«
Richards blickte angestrengt auf seine Fußspitzen und erwiderte
nur: »Der Zeuge der Verteidigung darf jetzt den Zeugenstand verlas-
sen.«
»Ich habe Ihnen die reinen Tatsachen geschildert. Sie reagierte ge-
nauso, wie jede andere Frau reagieren würde, die eine Leiche in
ihrer Wohnung vorfindet«, protestierte ich leidenschaftlich. »Und
außerdem – warum sollte ich sie verteidigen?«
Er warf mir einen amüsierten Blick zu. »Unsere Miß Day ist ein
recht attraktives Mädchen«, sprach er nachdenklich vor sich hin.
»Was wohl Cordwell in ihrer Wohnung zu tun gehabt hatte?«
»Das weiß ich nicht. Mit Sicherheit weiß ich jedoch, daß Miß
Day ebenso betroffen war, ihn dort tot zu finden, wie ich selbst.«
»Und Sie sagen, Cordwells Reisetasche habe im Vorflur gelegen,
während ihr Inhalt im Wohnzimmer auf dem Boden verstreut war?«
»Ein Katalog für Tulpenzwiebeln, ein Metronom und die hollän-
dische Trachtenpuppe.«
»Eine holländische Trachtenpuppe«, wiederholte Richards halb-
laut. »Haben Sie eine Idee, warum der Mörder sie wohl auseinan-
dergenommen hat?«
»Vermutlich suchte er etwas, was sich leicht in einer Puppe verste-
cken läßt.«
42

Richards nickte. »War es ein besonderes Metronom?«
»Der Mechanismus war genauso wie bei allen anderen. Nur das
Gehäuse war bei diesem besonders schön geschnitzt und in hellen
Farben bemalt, von der Art, wie man sie in den Souvenirläden fin-
det.« Meine Finger umspannten den Stiel des Glases fester, als ich
Richards fragte: »Hatte nicht auch Salinger ein Metronom bei sich,
als er getötet wurde? Wie sah denn das aus?«
»Sie haben es eben ziemlich genau beschrieben.«
»Dann…«, begann ich.
Richards schüttelte den Kopf. »Nein. Es war nicht dasselbe. Ross
hat das von Salinger in seinem Safe verschlossen. Nach der Toten-
schau habe ich es ›organisieren‹ können.« Er lächelte. »Unsere
Dienststelle hat ein paar gute Beziehungen, die sie gelegentlich spie-
len läßt.«
Ich setzte eine entsprechend beeindruckte Miene auf und kippte
dann den restlichen Kognak hinunter. »Und was machen wir jetzt?«
»Sie tun im Augenblick am besten gar nichts.« Er stand auf und
trug unsere Gläser zum Getränkeschrank hinüber. »Ich nehme an,
die Polizei wird inzwischen in der Wohnung sein und Miß Day ver-
nehmen. Wenn die junge Dame so harmlos ist, wie Sie glauben,
dann wird sie der Polizei erzählen, daß sie Sie heute abend erwartet
hat.«
»Natürlich wird sie das tun«, erwiderte ich gereizt. »Und es gibt
keinen Grund für so sarkastische Bemerkungen.«
»O Verzeihung! Klang das sarkastisch?« fragte er besänftigend.
»Ich wollte nur auf folgendes hinaus: Sie werden eine recht plau-
sible Geschichte brauchen, um sich die Polizei vom Leibe zu hal-
ten.«
»Ich erzähle ihnen die reine Wahrheit. Schließlich habe ich ja
nichts zu verbergen.«
»Nichts?« fragte Richards, der mir noch einen Courvoisier eingoß
und dann mit seinem Glas in der Hand auf und ab ging. »Sie ha-
43

ben doch die Leiche gefunden. Warum haben Sie nicht gewartet,
bis die Polizei kam, und ihr dann am Tatort Bericht erstattet? Die
Polizei wird von Ihrem Verhalten nicht gerade begeistert sein.« Er
machte eine abwinkende Handbewegung. »Natürlich, wir wissen,
warum Sie gleich hierhergestürzt sind: Sie wollten Ross berichten.
Die Kriminalpolizei aber wird nicht sagen: ›Danke schön, Mr. Fra-
zer; damit sind Sie aus dem Spiel‹, wenn Sie ihr erzählen, Sie hätten
Barbara Day beschattet. Sie wird vielmehr verdammt neugierig
sein.«
»Na, und wenn schon«, erklärte ich leichthin. »Ich brauche doch
nur diese Dienststelle hier zu erwähnen und…«
»Gerade das dürfen Sie nicht!« Richards wandte sich ruckartig zu
mir um. »Prägen Sie sich das ein, Frazer. Ross will nur erfahren, wa-
rum einer unserer besten Agenten sterben mußte. Daß wir nicht an
einen Unfall glauben, hat mit der Sache unmittelbar nichts zu tun.
Ihre Aufgabe ist es, herauszufinden, ob Miß Day mit den Leuten
unter einer Decke steckt, die Salinger aus dem Wege haben wollten.
Deswegen darf sie auf keinen Fall wissen, daß Sie sie beobachtet ha-
ben. Wenn Sie das der Polizei erzählen, werden die Kriminalbeam-
ten ein so unüberhörbares Getue darum machen, daß das Mädchen
bestimmt Verdacht schöpft und seine reizenden Muschelöhrchen
in Ihre Richtung drehen wird. Und sie wird es dann gewiß nicht
mehr auf so charmante Weise tun, wie das bisher der Fall zu sein
scheint.«
»Da haben Sie mir eine gelungene Rückhand verpaßt. Ich werde
sie aber als Kompliment dafür auffassen, wie ich meinen Auftrag
bisher ausgeführt habe«, erwiderte ich grinsend. »Übrigens – glau-
ben Sie auch jetzt noch, daß es ein Unfall gewesen ist?«
»Der Umstand, daß dieser Amerikaner in ihrer Wohnung ermor-
det wurde, eröffnet allerdings neue Perspektiven.« Richards schob
sinnend die Unterlippe vor und forderte mich plötzlich sehr ener-
gisch auf: »Rufen Sie das Mädchen sofort an. Nennen Sie einen
44

glaubwürdigen Grund, warum Sie das Rendezvous nicht eingehalten
haben.« Er ging zum Schreibtisch hinüber und blätterte die Seiten
eines Vormerkkalenders durch. »Hier ist sie: Ihre Nummer ist Chel-
sea 7146. Nehmen Sie den grünen Apparat dort, er ist auf Amtslei-
tung durchgeschaltet.«
Ich ging hinüber, nahm den Hörer ab und wählte langsam, wobei
ich mir eine plausible Entschuldigung überlegte.
Nachdem das Rufzeichen angekommen war, knackte es einen Au-
genblick später in der Leitung, als die Gegenseite den Hörer ab-
nahm.
Eine Männerstimme meldete sich knapp: »Chelsea 7146.«
Ich zögerte, und nach einem undefinierbaren, leicht überraschten
Laut fragte ich betont energisch: »Könnte ich bitte Miß Day spre-
chen, mein Name ist Frazer.«
Es war unverkennbar, daß der Mann am anderen Ende der Lei-
tung die Hand über die Sprechmuschel legte, und ich bildete, zu
Richards gewandt, mit den Lippen lautlos das Wort ›Polizei‹. Er lä-
chelte wissend zurück. Dann war Barbaras Stimme zu vernehmen.
»Sind Sie es, Frazer?«
»Ja, ich bin's. Ich muß mich wegen heute abend sehr entschuldi-
gen«, legte ich los, wobei ich hoffte, daß meine Stimme überzeu-
gend genug nach ehrlicher Reue klang. »Als ich Ihre Einladung an-
nahm, hatte ich eine geschäftliche Verabredung in Slough total ver-
gessen. Später, als es mir dann wieder einfiel, hoffte ich, rechtzeitig
wieder zurück zu sein. Aber die Besprechung zog sich endlos in die
Länge, so daß ich Sie auch jetzt noch von Slough aus anrufe.«
»Das ist allerdings Pech… Ich meine, das mit Ihrer Besprechung.
Ich fürchtete schon ernsthaft, es könnte Ihnen etwas zugestoßen
sein.«
»Ich hatte vorhin schon einmal angerufen, aber da meldete sich
niemand.« Ich warf Richards einen schnellen Blick zu, den das Ge-
spräch zu amüsieren schien. »Das war so um Viertel nach sieben.«
45

»Oh, das ist aber schade. Um diese Zeit war ich noch nicht zu
Hause. Arthur, mein Verlobter, hatte mich angerufen. Er litt wieder
einmal unter einem seiner schweren Asthmaanfälle, und ich hielt es
für geboten, schnell hinüberzufahren und nach dem Rechten zu se-
hen.« Ihre Stimme bekam einen flüssigeren Klang. »Wären Sie recht-
zeitig gekommen, dann hätten Sie vor verschlossener Tür gestan-
den. Vielleicht klappt es ein andermal besser.«
Ich hoffte es sehr, erwiderte ich, entschuldigte mich nochmals
und legte auf.
»Gute Arbeit«, lobte mich Richards, der sich eine Zigarette aus
der silbernen Dose nahm und mir auch eine anbot. »Wo war Miß
Day um Viertel nach sieben?«
»Sie sagte, ihr Verlobter wäre krank gewesen, und sie sei schnell
noch einmal zu ihm gefahren, um sich um ihn zu kümmern.«
»Die Polizei wird das nachprüfen; worauf Sie sich verlassen kön-
nen.« Richards warf mir einen spöttischen Blick zu. »Ich würde Ih-
nen raten, auf der Hut zu sein, Frazer. Die Polizei wird nach einem
Motiv für den Mord an Cordwell suchen. Wie gewöhnlich nach et-
was ganz Handlichem und Primitivem – beispielsweise Eifersucht.«
46

8
s war kurz nach acht Uhr, als ich am anderen Morgen erwachte
und Mrs. Glover, meine Aufwartefrau, in der Küche herumwirt-
schaften hörte. Der belebende Duft frisch gebrühten Kaffees drang
mir in die Nase, als ich nach der Zigarettendose auf meinem Nacht-
tisch griff. Ich hatte viel zu überlegen und gedanklich in den rich-
tigen Zusammenhang zu bringen.
E
E
Die Morgenblätter würden sicher schon über den Mordfall be-
richten, und ich entschloß mich, nachzulesen, ob sie neue Entwick-
lungen meldeten. Gerade als ich Mrs. Glover rufen wollte, mir die
Zeitungen und den Kaffee ans Bett zu bringen, schellte es an der
Wohnungstür.
Mrs. Glover watschelte zur Tür, um zu öffnen, und war wie stets
etwas außer Atem. Dann kam sie zurück und klopfte an meine Tür:
»Ein Herr möchte mit Ihnen sprechen, Sir.«
Gewöhnlich redete sie mich mit ›Mr. Frazer‹ an; es sei denn, sie
wollte Eindruck auf einen Besucher machen. In letzter Zeit waren
dies in der Regel Gläubiger in Sachen meiner bankrott gegangenen
Firma gewesen. Die hätte allerdings höchstens meine Unterschrift
auf einem gedeckten Scheck beeindruckt.
Unwirsch langte ich nach meinen Hausschuhen, warf mir meinen
Morgenrock über, kämmte mir einmal kurz durch das Haar und
steckte mir die Zigarettenschachtel in die Tasche.
Mrs. Glover stand wartend vor der Zimmertür; ihr sonst so fröh-
liches Gesicht zeigte einen Ausdruck leichter Besorgnis. »Es ist ei-
ner von der Kripo«, zischte sie. »Diese Sorte rieche ich von wei-
tem.«
Da hatten wir den Salat! Ich schob beide Hände in die Taschen
47

des Morgenrocks und schlenderte gelassen ins Wohnzimmer.
Ein großer, schlanker Herr mit korrekt zurückgebürstetem Haar,
in dunklem Anzug mit silbergrauer Krawatte, beobachtete mein
Eintreten mit unauffällig forschendem Blick, offensichtlich darauf
bedacht, sich nichts entgehen zu lassen, was verdächtig scheinen
könnte.
»Mr. Frazer?« begann er mit leiser Stimme. »Mein Name ist True-
man – Detektivinspektor Trueman.«
Ich legte verwundert die Stirn in Falten. »Was führt Sie her, In-
spektor? Hat sich jemand beschwert, daß ich meinen Wagen vor
seiner Garage geparkt habe?«
»Ganz so schlimm ist es nicht, Sir«, erwiderte er humorvoll, wenn
auch etwas schwerfällig. »Es handelt sich um eine Dame, die Sie
meines Wissens kennen, Mr. Frazer. Ich meine Miß Barbara Day.«
»O ja, wir sind miteinander bekannt.« Ich setzte eine erschrocke-
ne Miene auf. »Ihr ist doch hoffentlich nichts zugestoßen?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich hätte Ihnen nur gern ein paar Fragen
im Zusammenhang mit dieser Dame gestellt.« Seine Augen waren
ganz beiläufig im Zimmer umhergewandert; jetzt konzentrierten sie
sich auf mich. »Sie waren gestern abend mit ihr verabredet?« Es war
mehr eine Feststellung als eine Frage.
»Ja, das stimmt«, antwortete ich mit betont verwirrtem Gesichts-
ausdruck. »Ich sollte sie um halb acht Uhr in ihrer Wohnung auf-
suchen. Leider konnte ich die Verabredung nicht einhalten, weil ich
in Slough aufgehalten wurde.«
»Ich verstehe«, erwiderte er in neutral gehaltenem Tonfall. »Dann
waren Sie also gestern abend überhaupt nicht in Crawford House
Mansions?«
»Das habe ich Ihnen doch eben schon gesagt, Inspektor.« Ich tat
leicht verärgert.
»Sie haben mir nur gesagt, Sie wären um halb acht Uhr nicht da-
gewesen«, korrigierte er mich.
48

»Um die Sache noch einmal völlig klarzustellen, Inspektor: So-
weit ich weiß, bin ich noch nie näher an dieses Haus … wie heißt
es doch? … herangekommen als bis auf einen Kilometer.« Sein glat-
tes Lächeln provozierte mich zu der Frage: »Darf ich übrigens er-
fahren, was diese ganze Fragerei bedeuten soll? Das ist ja schon bei-
nahe der dritte Grad.«
Diese Frage, die ihm offensichtlich gar nicht ins Konzept paßte,
schien ihn etwas zu verärgern. »Es tut mir leid, daß Sie es so auffas-
sen, Sir.« Er fingerte an seinem dunkelgrauen Hut mit steifem Rand
herum. »Meine Fragen sind reine Routineangelegenheit.« Dann ver-
schärfte sich sein Ton. »Gestern abend wurde ein Mann ermordet –
in der Wohnung von Miß Barbara Day.«
Ich tat mein Bestes, um wieder aufgeregt zu scheinen. »In Miß
Days Wohnung? Haben Sie den Mörder gefaßt?«
»Nein.« Er schwieg einen Augenblick und sagte dann in mehr fra-
gendem Ton: »Soweit mir bekannt ist, haben Sie den Ermordeten
gekannt.«
»Ich soll ihn gekannt haben?«
»Sein Name ist Cordwell.«
»Cordwell… Cordwell…« Ich tat so, als ob ich krampfhaft über-
legte. Dann schnippte ich mit den Fingern. »Aber natürlich! Das ist
doch der Mann, den ich mit Miß Day in Amsterdam getroffen ha-
be. Wobei ich übrigens kaum behaupten könnte, ich hätte ihn ge-
kannt. Ich habe ihn nur einmal gesehen.«
»Miß Day hat mir von dem Zusammentreffen berichtet.« True-
man lächelte nachsichtig, als habe er mich fast ertappt. »Würden
Sie sagen, daß Miß Day mit ihm auf freundschaftlichem Fuß
stand?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Meiner Ansicht nach war es nicht
mehr als eine zufällige Urlaubsbekanntschaft während eines Aufent-
halts im Ausland.«
Er verfolgte mit den Augen seinen Mittelfinger, der um den stei-
49

fen Rand des Hutes kreiste. »Und Sie hatten sich alle gestern abend
bei Miß Day verabredet, um über die Urlaubstage in Amsterdam zu
plaudern?«
Ich fischte meine Zigarettenpackung aus dem Morgenrock, um
Zeit zum Nachdenken zu gewinnen. Worauf zielte er mit dieser Fra-
ge? »Sie hatte mir nichts davon gesagt, daß Cordwell auch eingela-
den war«, antwortete ich und bot ihm eine Zigarette an. »Genauer
gesagt, ich war der Meinung, er sei bereits wieder nach Amerika zu-
rückgeflogen. Miß Day hatte mich eingeladen, damit ich ihren Ver-
lobten kennenlernen sollte.«
»Das hat sie mir auch gesagt.« Er nahm sich eine meiner Zigaret-
ten. »Miß Day ist eine recht attraktive Frau; finden Sie nicht auch,
Mr. Frazer?«
Ich lächelte, weil mir Richards' Theorie vom Mordmotiv einfiel.
»Mein persönlicher Typ ist blond.«
Als ich ihm das brennende Feuerzeug hinhielt, sah er mich fra-
gend an. »Weiß der Verlobte von Miß Day, daß Sie noch Junggesel-
le und im besten heiratsfähigen Alter sind?«
»Wie die Dinge liegen, hätte ich diesen Verlobten gestern abend
gar nicht getroffen«, antwortete ich scharf. »Es scheint, daß er krank
war.« Mit leicht belustigtem Lächeln fügte ich hinzu: »Verbessern
Sie mich, wenn ich mich irre, Inspektor. Aber ich glaube, Sie waren
bei Miß Day in der Wohnung, als sie es mir am Telefon sagte.«
»Ganz recht, ich war dort«, antwortete er, wobei er einen kurzen
Blick auf seine Uhr warf. »Ich danke Ihnen für die Auskunft, Mr.
Frazer. Bitte lassen Sie sich nicht stören. Sie brauchen mich nicht
hinauszubegleiten.« Er machte mit dem Hut eine verabschiedende
Geste, als er das Wohnzimmer verließ, drehte sich dann aber noch
einmal um. »Wir haben die Sache mit dem Asthmaanfall nachge-
prüft. Miß Day war von halb sieben bis kurz nach sieben Uhr bei
ihrem Verlobten, Mr. Frazer.«
Kaum war er gegangen, kam Mrs. Glover mit dem Tablett herein,
50

auf dem die Kaffeekanne und frisch gerösteter Toast standen. »Ist
etwas mit Ihrem Wagen?« fragte sie scheinheilig. »Der Nachbar von
nebenan hat gestern fürchterlich geschimpft, als Ihr Wagen vor sei-
nem Garagentor parkte.«
»Komisch, daß Sie das auch dachten, Mrs. Glover«, antwortete
ich grinsend. »Fast dieselben Worte habe ich auch gebraucht, als
ich den Beamten begrüßte.«
Sie holte die Morgenzeitung unter dem Tablett hervor und legte
sie auf den Tisch. »In Chelsea ist schon wieder jemand ermordet
worden, Mr. Frazer«, berichtete sie, wobei sie unnötigerweise die
Teller auf dem Tablett noch einmal zurechtrückte.
»Das hat mir mein Besucher auch erzählt.«
Sie schien den Wink zu verstehen und schlurfte beleidigt hinaus.
Ich goß mir Kaffee ein, zündete eine Zigarette an und griff nach
der Zeitung. Sie war bereits so gefaltet, daß die ›Letzten Meldun-
gen‹ obenauf lagen. Ich überflog schnell die Nachricht über den
Mord. Sie besagte nur, man habe in einem Luxusapartement in
Chelsea einen Mann tot aufgefunden. Die Besitzerin der Wohnung,
Miß Barbara Day, sei der Polizei bei der Untersuchung des Falles
behilflich.
Ich legte die Zeitung beiseite und ging im Geiste nochmals meine
Unterhaltung mit Inspektor Trueman durch. Es war klar ersichtlich,
daß Barbara Day nichts verschwiegen hatte. Das bestätigte meine
persönliche Meinung von ihr. Sie wußte über Cordwells Tod nicht
mehr als ich selbst.
Aber was hatte der Amerikaner in ihrer Wohnung zu suchen?
Und wie war er hineingekommen? Ich goß mir gerade die zweite
Tasse Kaffee ein, als mir etwas einfiel, was der Inspektor gesagt hat-
te. ›Und Sie hatten sich alle gestern abend bei Miß Day verabredet,
um über die Urlaubstage in Amsterdam zu plaudern?‹ Der Kaffee
lief schon über den Rand der Tasse, ehe ich merkte, was ich ange-
richtet hatte. Mit einem halb unterdrückten »Verdammt!« stellte ich
51

die Kanne auf den Tisch zurück, stand auf, ging zum Telefon und
wählte die Nummer Chelsea 7146.
Das Besetztzeichen erklang. Nach einer halben Minute legte ich
auf und kehrte zu meinem Frühstück zurück. Mit dem Rest der
brennenden Zigarette zündete ich mir eine neue an und ließ den
Stummel in die mit Kaffee gefüllte Untertasse fallen, in Gedanken
darüber versunken, was Truemans Worte wohl für einen Hintersinn
haben konnten. War das etwa die Ausrede gewesen, mit der Barbara
Day den Amerikaner in ihre Wohnung gelockt hatte? Damit er mich
treffen und wir über die Ferientage plaudern konnten? Aber warum?
Um ihn zu ermorden? Wieder sah ich die Leiche vor mir und da-
neben den schweren, blutbefleckten gläsernen Aschenbecher. Diese
Gedankenkombination ging einfach nicht auf. Cordwell war ein
kräftiger Mann. Er hätte eine Frau mit einem einzigen Faustschlag
bewußtlos schlagen können. Außerdem hatte ich doch Barbara Day
beobachtet, als sie in ihre Wohnung kam. Nichts in ihrer äußeren
Erscheinung wies darauf hin, daß sie vorher in einen Kampf verwi-
ckelt gewesen war. Aber irgend jemand mußte Cordwell doch in
ihre Wohnung eingelassen haben – und derjenige mußte es auch
gewesen sein, der mir den Schlüssel unter dem Türrand durchge-
schoben hatte. Den ganzen Umständen nach war diese Person der
Mörder; aber auch das stand nicht unbedingt fest.
Nach einem Dutzend weiterer Vermutungen und Betrachtungen
gab ich es auf. Erst im Badezimmer fiel mir ein, daß Trueman mich
gar nicht gefragt hatte, wo ich am gestrigen Abend gewesen sei. Es
hätte sehr unangenehm für mich werden können, wenn er mich
aufgefordert hätte, den Ablauf des Abends in allen Einzelheiten zu
schildern. Warum hatte er es eigentlich nicht getan? Ich hatte das
unangenehme Gefühl, er argwöhnte, ich hätte meine Verabredung
mit Barbara Day doch eingehalten. Vielleicht wollte er mich nur so
lange an der langen Angelschnur halten, bis es ihm paßte, den zap-
pelnden Fisch an Land zu ziehen.
52

Als ich mich angezogen hatte, versuchte ich es noch einmal, Bar-
bara Day anzurufen. Um zehn Uhr, nach dem dritten vergeblichen
Versuch, gab ich es auf.
Da die Leitung ständig besetzt war, mußte sie wohl zu Hause
sein. Es lag daher nahe, sie persönlich aufzusuchen.
Ich rief Mrs. Glover zu, ich ginge aus. Als ich meinen Wagen aus
der Garage, direkt unter meiner Wohnung, holte, lugte hinter der
Gardine meines Wohnzimmers ihr Gesicht hervor. Ich wies spöt-
tisch mit der Hand in Richtung der benachbarten Garage. Mrs.
Glover wußte sehr wohl, daß ich meinen Jaguar niemals vor einer
anderen Tür parkte.
9
ls ich auf den Klingelknopf von Barbara Days Wohnung in
Crawford House Mansions drückte, fiel mir ein, daß wenig
mehr als zwölf Stunden vergangen waren, seitdem ich erwartungs-
voll am selben Fleck gestanden hatte. Unwillkürlich wanderte mein
Blick zum Fußboden; fast erwartete ich, daß unter dem Türrand
langsam ein Schlüssel sichtbar würde, und zuckte zusammen, als
die Tür plötzlich aufgerissen wurde.
A
A
»Tim! … Mr. Frazer…«
Es entging mir nicht, wie erleichtert ihre Stimme klang.
»Hoffentlich falle ich Ihnen nicht zu ungelegener Zeit ins Haus«,
begrüßte ich sie, da ich das Pelzcape über ihren Schultern bemerk-
te. »Aber meine wiederholten Versuche, Sie anzurufen…«
Sie machte eine Geste, halb Willkommen, halb Entschuldigung.
53

»Oh, das tut mir leid. Hätte ich das gewußt … aber ich habe den
ganzen Morgen über den Hörer ausgehängt. Diese Reporter haben
mich bald zum Wahnsinn getrieben.« Sie biß sich auf die Lippen.
»Und dann dieser Polizeibeamte mit seiner endlosen Fragerei…«
Ich unterbrach sie schnell. »Ich hatte auch die Ehre des Besuches
von Inspektor Trueman.«
»Das habe ich befürchtet«, antwortete sie. »Ich mußte ihm Ihren
Namen nennen, als Sie hier anriefen. Aber kommen Sie doch her-
ein, Mr. Frazer.«
Ich folgte ihr ins Wohnzimmer, das jetzt sauber aufgeräumt war.
»Meine Freunde nennen mich Tim«, sagte ich und lächelte sie da-
bei an.
Sie verzog reumütig das Gesicht. »Das ist mir so 'rausgerutscht,
Tim.« Mit einer einladenden Handbewegung forderte sie mich auf,
mich auf einen der mit Chintz bezogenen Sessel zu setzen. »Neh-
men Sie doch Platz, Tim.«
Sie ließ das Pelzcape von den Schultern gleiten. Darunter trug sie
ein rotes Kleid und als einzigen Schmuck eine mit Diamanten ein-
gefaßte Brosche. »Sie müssen verzeihen, wenn ich noch etwas geis-
tesabwesend bin«, entschuldigte sie sich, während sie sich auf den
gegenüberstehenden Sessel setzte und die Beine lässig übereinander-
schlug. »Aber ich habe mich von dem Schock noch immer nicht
ganz erholt. So etwas liest man zwar beinahe täglich in den Zeitun-
gen, doch glaubt man nie, daß es einem selbst widerfahren könnte.«
Ich nickte mitfühlend. »Als der Beamte es mir erzählte, hat es
mich auch beinahe umgeworfen.« Ich holte mein Zigarettenetui
hervor und öffnete es bedächtig. »Was ich an der ganzen Sache
nicht begreifen kann, ist, daß es gerade Cordwell treffen mußte. Ich
glaubte, er wäre schon längst wieder in den Vereinigten Staaten.«
Erst jetzt blickte ich auf und sah sie aufmerksam an.
Ihre Stirn umwölkte sich. »Ich kann das ja auch nicht fassen.
Auch ich war absolut der Meinung, er wäre an dem Tage, nachdem
54

wir ihn im de Kroon getroffen hatten, nach Hause geflogen.« Sie
zuckte hilflos mit den Schultern. »Danach habe ich ihn nicht mehr
gesehen.«
Während ich ihr das Zigarettenetui hinhielt, fragte ich sie: »Hat er
denn niemals erwähnt, daß er Sie besuchen würde, wenn er nach
London kommen sollte?«
»Er hat es nicht einmal angedeutet.« Sie nahm sich eine Zigarette
und zündete sie an. »Dieser Kriminalbeamte wollte mich unbedingt
dazu bringen, zuzugeben, wir hätten uns alle drei hier verabredet.«
»Das hat er bei mir auch versucht, und er schien einigermaßen
enttäuscht, als ich ihm sagte, Sie hätten Cordwell kaum gekannt.«
Sie lächelte dankbar. »Es tut mir schrecklich leid, daß ich Sie in
diese Sache hineingezogen habe. Aber was sollte ich tun? Ich muß-
te dem Beamten doch sagen, daß ich Sie um halb acht erwartete.«
»Aber ich bitte Sie, Barbara. Sie konnten ja gar nicht anders han-
deln.« Zögernd hielt ich mein Feuerzeug in der Hand, um mir eine
Zigarette anzuzünden. »Wollten Sie gerade ausgehen? Dann lassen
Sie sich bitte durch mich nicht aufhalten.«
Ihre Augen blickten mich lächelnd an. »Sie sind sehr rücksichts-
voll, Tim; aber so eilig habe ich es nun doch nicht. An sich erwar-
te ich Arthur um diese Zeit. Gewöhnlich schaut er auf dem Weg ins
Büro kurz bei mir herein. Aber ausgerechnet heute morgen läßt er
sich nicht blicken, und ich könnte doch so gut etwas Trost brau-
chen.« Sie trommelte mit den Fingern auf die Sessellehne. »Deshalb
war ich gerade dabei, ihn meinerseits zu überfallen. Aber nach dem
Asthmaanfall von gestern abend wird er sich heute vermutlich noch
etwas elend fühlen.«
»Ach so, aus diesem Grunde waren Sie auch nicht zu Hause, als
ich zum ersten Mal hier anrief – das war so gegen Viertel nach sie-
ben.«
»Ja«, sie sah gelegentlich auf ihre Schuhspitzen. »Woher riefen Sie
doch gleich an … war es nicht von Slough aus?« Sie ließ diese Frage
55
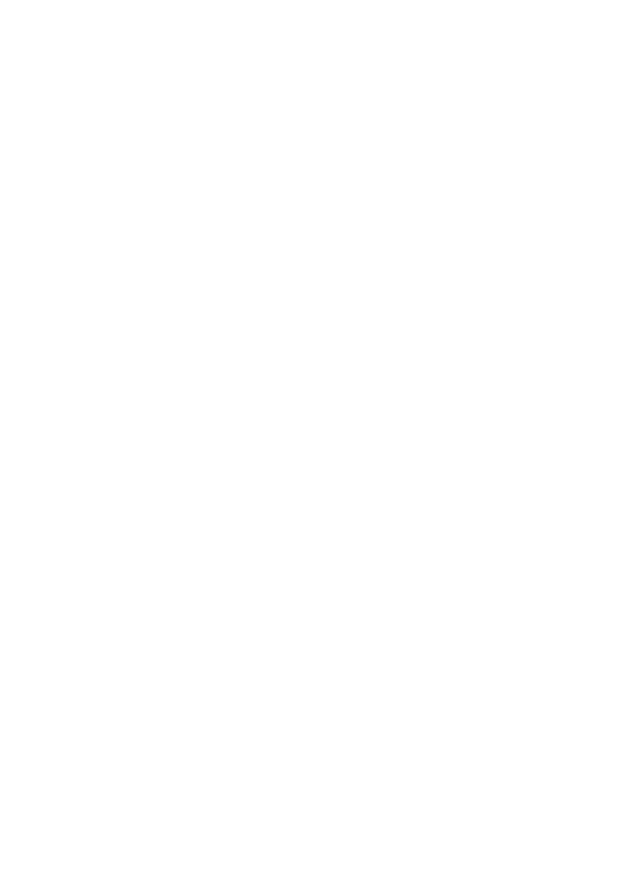
gewissermaßen im Raume stehen.
In diesem Augenblick hatte ich einen Gedanken: Wenn ich mei-
nen Besuch in Slough nebelhaft genug schilderte, dann konnte ich
vielleicht den allzu genauen Nachforschungen vorbeugen, die In-
spektor Trueman in dieser Richtung anstellen mochte. »An sich
sollte ich es Ihnen ja gar nicht erzählen, Barbara. Aber ich war aufs
Geratewohl dahin gefahren; ich wollte versuchen, bei einer der dor-
tigen Ingenieurfirmen eine feste Stellung zu bekommen.« Ich lachte
etwas gezwungen. »Als ich dann aber dort war, bin ich einigerma-
ßen ziellos durch den Ort gewandert, studierte die Firmenschilder
und versuchte mich zu überwinden, irgendwo quasi mit dem Hut
in der Hand hineinzugehen und vorzusprechen. Am Ende hatte ich
so viel Zeit vertrödelt, daß ich sogar unsere Verabredung nicht
mehr einhalten konnte.«
»Als ob das unter diesen Umständen noch etwas zu bedeuten hät-
te.« Ihr Gesicht wurde ernst. »Oder doch, es hätte etwas bedeutet,
nicht wahr? Wenn Sie vielleicht um halb acht Uhr gekommen wä-
ren, dann wäre der arme Cordwell…«
Ich durchbrach das nachfolgende Schweigen. »Wie ist er eigent-
lich in Ihre Wohnung gekommen, Barbara? Und warum war er
hier?«
»Bitte!« flehte sie mich an. »All das bin ich in der vergangenen
Nacht mit dem Inspektor stundenlang durchgegangen.«
»Ich hatte den Eindruck, er war nicht ganz davon überzeugt, daß
Cordwell nur ein flüchtiger Bekannter von Ihnen gewesen ist.« In
diesem Augenblick schien es mir angebracht, eine direkte Antwort
von ihr zu erzwingen. »War er das wirklich nur, Barbara?«
»Ich habe den Mann nie gesehen, bevor ich ihm in meinem Ho-
tel begegnete«, antwortete sie ärgerlich. Mit einem Schulterzucken
fügte sie dann müde hinzu: »Ich sollte es Ihnen doch lieber erzäh-
len. Ich habe gelogen, als ich sagte, ich hätte ihn nach unserem Zu-
sammensein bei de Kroon nicht mehr gesehen.« Sie wich meinem
56

Blick aus, als sie mit leiser Stimme fortfuhr: »Er kam am gleichen
Abend noch in mein Zimmer.«
»Und?«
»Er wurde zudringlich.« Sie spreizte die Hände. »Es ist aber nichts
passiert. Ich konnte ihn schnell zur Vernunft bringen, und als er
ging, stammelte er als Entschuldigung irgendeinen Unsinn von Lie-
be auf den ersten Blick, seitdem er mich auf dem Flugplatz in Lon-
don gesehen habe.«
»Haben Sie das dem Inspektor erzählt?« Als sie den Kopf schüt-
telte, forschte ich: »Warum nicht?«
»Damit er es Arthur gegenüber erwähnt?« fragte sie schnell zu-
rück.
»Und wenn er es täte?« Ich lächelte. »Fairlee wird sich doch si-
cherlich nicht einbilden, ein Verlobungsring ziehe eine Art Stachel-
drahtzaun um eine attraktive Frau?«
»Doch, ich bin überzeugt, daß er in diesem Glauben lebt. Viel-
leicht macht ihn sein Asthma so intolerant.« Ihre Augen hielten ei-
nen Moment lang die meinen fest. »Es ist absurd, aber ich glaube,
er ist sogar auf Sie eifersüchtig.«
Die Türglocke schrillte anhaltend.
Ich lachte kurz. »Auf mich!«
Wieder läutete es beharrlich.
Sie erhob sich. »Es hat ganz den Anschein, als würden Sie jetzt
doch noch mit Arthur zusammentreffen.«
Während sie hinausging, drückte ich den Rest meiner Zigarette in
einem Aschenbecher aus, der mit dem Wappen von Amsterdam ge-
schmückt war.
Eine schrille Stimme erklang aus dem Vorraum.
»Was ist los, Barbara? Warum hast du nicht angerufen?« Man
hörte jemanden schwer atmen. »Ein Polizeiinspektor war gerade bei
mir und sagte…«
Barbaras ruhige Stimme unterbrach ihn. »Bitte, Arthur, sei doch
57

nicht gleich so erregt. Denk an dein Asthma…«
»Ich soll mich nicht aufregen!« Die Stimme wuchs zum Krescen-
do. »Du lieber Himmel, Barbara… Machst du dir eigentlich klar…«
»Nun beruhige dich endlich, Arthur«, schnitt Barbara ihm scharf
das Wort ab. »Mr. Frazer sitzt drin im Wohnzimmer.«
»Frazer?« Fairlees Stimme überschlug sich fast vor Argwohn. »Fra-
zer? Der Mann, den du im Flugzeug kennengelernt hast?«
Ich konnte nicht verstehen, was sie ihm ermahnend zuflüsterte.
Einen Augenblick später stand ich auf und murmelte konventio-
nell: »Freut mich, Sie kennenzulernen«, zu einem hochaufgeschosse-
nen, beinahe dürren Mann mit dunklem Mittelscheitel, kurz ge-
schnittenem Schnurrbart und hakenförmiger Nase, der mich feind-
selig durch seine Hornbrille ansah. Als er ins Zimmer trat, hatte er
seinen steifen Hut abgenommen; der untadelig gerollte Regen-
schirm vervollständigte das Bild.
»Mr. Frazer«, stellte sie uns einander vor, »das ist mein Verlob-
ter, Mr. Arthur Fairlee.«
Er reichte mir eine kraftlose Hand. »Barbara hat von Ihnen ge-
sprochen«, sagte er kalt und entzog mir seine Hand so rasch, als
hielte ich ein schmutziges Taschentuch in der meinen. Dann wand-
te er sich sofort wieder Barbara zu. »Ich muß mit dir sprechen, Bar-
bara. Aber allein, wenn ich bitten darf.«
»Schon gut, Darling«, besänftigte sie ihn. »Mr. Frazer weiß, was
geschehen ist. Deshalb ist er auch hier.«
»Ich dachte mir, ich könnte vielleicht irgendwie behilflich sein«,
schaltete ich mich schnell ein. »Schließlich ist es ja eine ziemlich
üble Geschichte.«
»Ziemlich übel? Du meine Güte, das ist aber stark untertrieben,
wenn Sie gestatten!« Nach diesem Ausbruch hatte Fairlee Mühe,
wieder normal atmen zu können. »Wer ist dieser Cordwell über-
haupt? Ich verlange eine Erklärung, Barbara. Du hast ihn vorher
niemals erwähnt.«
58

»So wichtig war er auch nicht«, entgegnete sie, wobei sie mir ei-
nen spöttisch-verzweifelten Blick zuwarf. »Eine ganz zufällige Be-
kanntschaft, die wir in Amsterdam gemacht haben.«
Fairlee deutete anklagend mit der Spitze seines Regenschirms auf
mich. »Sie haben diesen Cordwell auch gekannt?«
»Ich bin ihm nur einmal begegnet. Miß Day und ich hatten uns
zufällig getroffen und tranken einen Cocktail zusammen.«
»Cocktail? Wir?« keuchte er, wobei er argwöhnisch den Blick zwi-
schen Barbara und mir hin und her wandern ließ. »Wieso ist dieser
Cordwell hierhergekommen? Ich bin schließlich kein Narr, Barbara.
Da steckt doch mehr dahinter, als es auf den ersten Blick den An-
schein hat.«
Es berührte mich doch eigenartig, daß Barbara mit einem so neu-
rotischen Querulanten verlobt war. Mit leicht sarkastischem Ton
wandte ich mich an ihn: »Na, da sind Sie ja jetzt einer tollen Sache
auf die Spur gekommen, Mr. Fairlee.«
Er starrte mich giftig an. »Zu Ihnen habe ich nicht gesprochen,
Sir.«
Barbara seufzte. »Aber Arthur, bitte!«
»Nehmen Sie sich gefälligst etwas mehr zusammen, Fairlee«, sagte
ich jetzt grob zu ihm. »Miß Day hat ein sehr unangenehmes Erleb-
nis gehabt und braucht gerade jetzt Mitgefühl und keine haltlosen
Vorwürfe.«
Seine Lippen preßten sich einen Augenblick wütend zusammen,
dann lächelte er frostig. »Sie haben recht. Entschuldigen Sie, Fra-
zer.« Und zu Barbara gewandt: »Es tut mir leid, Liebling. Ich glau-
be, wir sollten jede weitere Diskussion unterlassen, bis ich etwas ru-
higer geworden bin. Also dann, bis heute abend.« Er warf einen
Blick auf seine Uhr. »In einer halben Stunde fängt meine Aufsichts-
ratssitzung an. Übrigens, Barbara, setz dich bitte mit deiner Teilha-
berin in Verbindung. Sie hat mich heute schon dreimal angerufen,
da sie dich nicht erreichen konnte.«
59

»Natürlich werde ich das, mein Lieber.« Barbara schlug einen ver-
söhnlichen Ton an. »Ich schätze, Vivien wird wütend sein, weil ich
bei ihrem Anruf gestern abend einfach aufgelegt habe.« Sie schau-
derte. »Vivien rief gerade in dem Augenblick an, als ich die Leiche
entdeckt hatte.«
Fairlees Augen folgten ihrer Blickrichtung. Als er antworten woll-
te, erklang die Türklingel.
Barbara seufzte tief. »Will man mich denn heute überhaupt nicht
mehr in Ruhe lassen?«
»Wenn es Reporter sind, sage ihnen nichts!« sagte Fairlee in ei-
nem Befehlston. »Kein Wort, Barbara! Mein Name darf nicht er-
wähnt werden, verstehst du?«
»Keine Sorge, Arthur, mit den Pressefritzen werde ich schon fer-
tig.« Auf dem Weg zur Tür tätschelte sie beruhigend seinen Arm.
Ärgerlich schlug Fairlee mit seinem steifen Hut gegen seinen
Oberschenkel. »Eine Publizität dieser Art könnte mir ganz schön
das Geschäft verderben.« Er starrte mich an, als sei ich für die Lage
verantwortlich. »Ich bin nämlich Börsenmakler, Frazer.«
»Ich glaube, Sie können sich darauf verlassen, daß Miß Day den
richtigen Ton gegenüber den Zeitungsleuten findet«, beruhigte ich
ihn. Dann holte ich mein Zigarettenetui hervor und hielt es ihm
hin. Er lehnte ab und wies entschuldigend auf seine Brust. »Miß
Day erzählte mir einmal, sie sei im Antiquitätenhandel tätig«, sagte
ich, während ich mir die Zigarette anzündete. »Sie erwähnten vor-
hin eine Teilhaberin … Vivien…?«
»Ja«, erwiderte er mürrisch. »Vivien Gilmore und meine Verlobte
sind Teilhaberinnen.« Er sah sich ungeduldig um, da er es eilig hat-
te, in sein Büro zu kommen.
Von der Tür her erklang Barbaras Stimme: »Es ist Inspektor True-
man, Darling.«
Ich wandte mich um. Trueman stand aber bereits im Türrahmen
und ließ seine Augen im Zimmer umherwandern, als nehme er von
60

allen Gegenständen Inventur auf. Als er meinem Blick begegnete,
nickte er: »Guten Morgen, Sir.«
Fairlee kehrte Trueman den Rücken zu und sagte: »Es ist schon
sehr spät für mich, Barbara. Ich muß gehen.« Sein Regenschirm
machte eine unbestimmte Bewegung in meine Richtung. »Kann ich
Sie irgendwo absetzen?«
Trueman räusperte sich. »Wenn Sie nichts dagegen haben, würde
ich mich gern noch etwas mit Mr. Frazer unterhalten.«
Fairlee warf mir einen nachdenklichen Blick zu, nickte dann kurz
und ging an Trueman vorbei zum Ausgang.
»Entschuldigen Sie mich bitte, Inspektor«, sagte Barbara heiter
und geleitete Fairlee aus dem Zimmer.
10
in behagliches Heim, nicht wahr, Sir?«
Ich war Barbara mit den Augen gefolgt und sah, als ich mich
Trueman wieder zuwandte, daß er mich mit leichtem Lächeln beo-
bachtete. »Sehr gemütlich«, antwortete ich mit wacher Aufmerksam-
keit.
E
E
»Sie sind zum erstenmal hier, nicht wahr, Sir?«
Mit einiger Mühe gelang es mir, völlig ruhig zu antworten: »Mei-
nes Wissens habe ich bereits heute früh klargestellt, daß ich gestern
abend zum erstenmal hierher eingeladen wurde.«
Mit spöttisch hochgezogenen Augenbrauen fragte er: »Und Sie
konnten diese Verabredung nicht einhalten, stimmt's, Mr. Frazer?«
Bevor ich antworten konnte, kam Barbara wieder ins Zimmer. Sie
61

schloß die Tür und wandte sich dann zu uns. »Aber bitte, meine
Herren, nehmen Sie doch Platz.«
Trueman griff sich einen Stuhl mit harter Lehne, genau den bei-
den Sesseln gegenüber, auf denen Barbara und ich vor wenigen Mi-
nuten noch gesessen hatten. »Miß Day«, begann er, während er sei-
nen steifen Hut auf dem Knie placierte, »sagt Ihnen der Name Eric-
son etwas?«
Ich inhalierte den Rauch meiner Zigarette und wartete auf ihre
Reaktion. Völlig unbefangen wie jeder, der plötzlich mit einem frem-
den Namen konfrontiert wird, antwortete sie mit unschuldigem
Blick: »Nein, leider gar nichts.«
Trueman warf mir einen Blick zu. »Und Ihnen, Sir?«
Ich schüttelte den Kopf. »Auch bei mir fällt kein Groschen. Oder
müßte er?«
»Nicht, wenn Cordwell nur ein flüchtiger Bekannter von Ihnen
war«, gab er zu. »Es hätte uns bei unserem Bemühen geholfen, et-
was mehr Licht in das Dunkel um die Person Cordwells zu brin-
gen, wenn Sie den Namen gekannt hätten. Er stand in einem No-
tizbuch, das wir bei der Leiche gefunden haben. Augenscheinlich
hatte er Verabredungen mit diesem Ericson für heute, morgen und
übermorgen.« Truemans Ton wurde schärfer. »Miß Day, würden Sie
mir bitte noch einmal sagen, wie oft Sie Cordwell in Amsterdam
getroffen haben?«
»Aber … ich muß schon sagen!« rief sie leicht erregt aus. »Das ha-
be ich Ihnen doch alles schon ganz genau berichtet – es war nur
ein einziges Mal, damals, als ich mit Mr. Frazer im Restaurant de
Kroon
war.«
Trueman fuhr mit dem Fingernagel am Hutband entlang. »Wür-
den Sie bitte genau nachdenken und mir die Frage dann noch ein-
mal beantworten?«
Ihre Entgegnung klang ein wenig dramatisch: »Wollen Sie damit
sagen, daß ich lüge, Inspektor?«
62
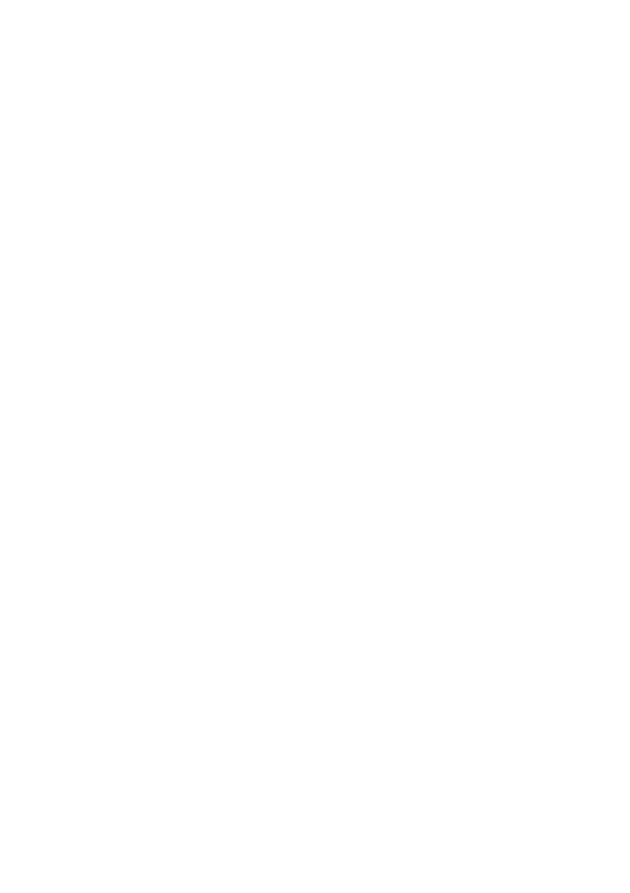
Er zuckte ungerührt mit den Schultern und erklärte ruhig: »Wir
haben unwiderlegbare Beweise dafür, daß Sie Cordwell noch bei ei-
ner anderen Gelegenheit gesehen haben, Miß Day.«
Meine Haltung versteifte sich, als sie etwas weniger sicher fragte:
»Darf man wissen, welcher Art diese Beweise sind, Inspektor?«
Er beugte sich vor. »Es ist ein Schmalfilm, Miß Day. Wir fanden
ihn bei der Leiche, und ich habe ihn mir vor einer knappen Stun-
de vorführen lassen. Er zeigt Aufnahmen von Amsterdam – Sie sind
mehrfach darauf zu sehen. Eine Szene stammt aus dem Café de
Kroon.
Sie zeigt, wie Cordwell sich zu Ihnen an den Tisch setzt.« Er
räusperte sich. »Die Aufnahmen machen den Eindruck, als ob Sie
beide mehr als nur zufällige Bekannte waren.«
Meine Reaktion auf den Aufschluß, den mir die Erklärung des In-
spektors gab, wonach meine in Amsterdam gemachten Filmaufnah-
men bei Cordwell gefunden worden waren, muß wohl zu auffällig
gewesen sein. Das leicht maliziöse Lächeln Truemans ließ erkennen,
daß er meinen Gesichtsausdruck jedoch auf andere Art deutete.
»Sie scheinen bei dieser Gelegenheit nicht dabeigewesen zu sein,
Mr. Frazer.«
»Sie werden sicher überrascht sein, wenn ich Ihnen jetzt sage, daß
diese Filmaufnahmen von mir gemacht wurden, Inspektor«, sagte
ich bewußt aggressiv.
Für einen Augenblick ließ ihn seine Weltgewandtheit im Stich.
»Sie
haben diese Aufnahmen gemacht, Sir?«
Barbara richtete sich mit einem Ruck auf. Ihre Augen glänzten.
»Tim! Aber natürlich! Sie haben mich gefilmt. Ich erinnere mich.«
»Einen Augenblick«, warf Trueman ein, wobei sein Gesicht wieder
den alten skeptischen Ausdruck annahm. »Wenn Sie diese Aufnah-
men gemacht haben, Sir, wie kommen sie dann in Cordwells Ta-
sche?«
Ich glaubte die Antwort zu wissen, wollte mich aber nicht in eine
Diskussion mit Trueman über den Film einlassen. »Das ist Ihre Sor-
63

ge, Inspektor. Ich kann Ihnen nur sagen, daß ich den Film irgend-
wo verloren habe – vermutlich in Amsterdam.«
Trueman war ob dieser unerwarteten Entwicklung der Dinge ent-
täuscht. »Falls Ihnen noch etwas Genaueres einfallen sollte, lassen
Sie es mich bitte wissen. Sie können stets eine Nachricht für mich
beim Yard hinterlassen.« Er stand auf. »Das ist alles, glaube ich …
für den Augenblick jedenfalls. Übrigens, Miß Day, Sie wollen doch
in naher Zukunft nicht nach Amsterdam?«
»Um Himmels willen, nein!« rief sie aus. »Wie kommen Sie da-
rauf?«
»Ich wollte nur sicher sein, daß ich Sie jederzeit erreichen kann,
wenn ich Sie brauche.« Er stand steif da und sah nachdenklich auf
sie hinab. Mit einem urplötzlichen »Ich finde schon allein hinaus«
verließ er uns so hastig, daß wir uns verblüfft ansahen.
Als die Wohnungstür sich hinter ihm geschlossen hatte, stieß Bar-
bara einen Seufzer der Erleichterung aus. »Gott sei Dank, er ist
fort!« Sie lächelte. »Ich wußte gar nicht, daß Sie so viele Aufnah-
men von mir in Amsterdam gemacht haben, Tim.«
»Ich habe Sie hin und wieder gesehen«, erwiderte ich geradeher-
aus. »Eine hübsche junge Dame, dachte ich, würde sich auf den
Aufnahmen von Alt-Amsterdam besonders gut ausnehmen.«
»Das finde ich reizend von Ihnen«, erwiderte sie mit Wärme. »Wo
haben Sie mich denn überall gesehen?«
»Och … beim Verlassen eines Museums, mal auf einer Brücke
und dann beim Aussteigen aus einem Rundfahrtboot«, erklärte ich
ziemlich lahm.
Sie lächelte wieder. »An das eine Mal kann ich mich erinnern«,
antwortete sie sanft, fast zärtlich.
Ich wurde etwas verlegen und erhob mich deshalb. »Ich glaube,
jetzt muß ich aber gehen.«
»Es war wirklich reizend, daß Sie hergekommen sind und mich
seelisch gestützt haben«, verabschiedete sie mich dankbar. »Typisch
64

für Arthur, mich gerade in dem Augenblick allein zu lassen, wo ich
ihn am meisten gebraucht hätte.«
An der Wohnungstür ermahnte ich sie: »Sie werden mich doch
verständigen, wenn neue Ereignisse eintreten, Barbara?«
»Natürlich.« Sie sah mir fest in die Augen. »Das verspreche ich
Ihnen, Tim. Sie werden der erste sein, der etwas erfährt.«
Vor der nächsten Telefonzelle hielt ich an, um Richards anzurufen.
In gönnerhaftem Ton fragte er: »Nun, keine Neuigkeiten von der
schönen Barbara?«
»Erinnern Sie sich, daß ich einen Telefonanruf in Barbaras Woh-
nung entgegennahm, der für Miß Day bestimmt war?«
»Das ging damals leider bei der Schilderung der unheimlichen Be-
gleitumstände unter; ich meine, als Sie mir berichteten, wie Sie die
Leiche fanden. Sie kamen nicht dazu, mir zu erzählen, was bei dem
Telefonat besprochen wurde.«
»Von mir wurde dabei überhaupt nichts gesagt«, antwortete ich,
etwas verärgert über seine neckende Formulierung. »Der Anruf kam
von einer Dame, die sich Vivien nannte. Sie fing sofort zu sprechen
an. Soweit ich mich erinnere, sagte sie: ›Ich hatte recht, Barbara. Er
ist wegen Ericson sehr neugierig…‹«
Richards unterbrach mich. »Wie war der Name, bitte?«
»Ericson.« Ich packte den Hörer fester. »Warum sollte ich den
Namen wiederholen, Richards?«
»Nichts weiter; ich hatte ihn nur nicht richtig verstanden«, wehrte
er meine Frage ab. »Und was weiter?«
»Also … diese Vivien hat sich jetzt als eine Miß Gilmore heraus-
gestellt; sie ist Teilhaberin von Barbara Days Antiquitätengeschäft.«
»Sind Sie schon in diesem Laden gewesen?«
»Nein. Heute früh bin ich zu Barbaras – wollte sagen Miß Days
Wohnung gegangen. Ihr Verlobter war anwesend, und ich habe die-
65

se Information mehr oder weniger zufällig und so nebenbei von
ihm erhalten.«
»Ist er endlich doch in Erscheinung getreten!« Richards lachte.
»Was ist er denn für ein Typ?«
»Ihnen sehr ähnlich, Richards, um das Kind beim Namen zu nen-
nen. Ein absoluter Bastard.«
Ich ließ ihn erst einmal sich das von der Galle reden, was er auf
meine Anspielung loswerden mußte, und berichtete dann weiter:
»Während ich in der Wohnung bei Miß Day war, tauchte ein Kri-
minalbeamter auf, ein gewisser Inspektor Trueman. Vorher, und
zwar heute morgen, hatte er auch mich schon in meiner Wohnung
durch den Wolf gedreht. Er sagte, man habe in Cordwells Tasche
ein Notizbuch gefunden, in dem mehrere Verabredungen mit die-
sem Ericson festgehalten waren. Trueman warf Miß Day diesen Na-
men an den Kopf; die behauptete aber, er besage ihr gar nichts.«
»Hm…« Richards schwieg einen Augenblick. »Glauben Sie, unser
schönes Kind hat gelogen?«
»Und ob sie das getan hat«, antwortete ich bissig. »Ich bin da
ganz sicher. Als Vivien Gilmore anrief, hielt sie es für absolut selbst-
verständlich, daß Miß Day diesen Ericson kannte – und den Na-
men der Straße auch.«
»Welcher Straße? Sie haben bisher nie einen Straßennamen er-
wähnt«, fuhr Richards ziemlich scharf fort.
»Aus dem einfachen Grunde, weil ich den Namen vergessen ha-
be«, erwiderte ich, wobei ich mich im Spiegel der Telefonzelle är-
gerlich betrachtete. »Er lautete so ähnlich wie Lennox Street; kann
auch Lenley … Lenton … oder so ungefähr geheißen haben. Der
Name liegt mir auf der Zunge.«
»Lassen Sie sich einen grundsätzlichen Tip geben, Frazer. Sobald
Sie einen Namen hören, schreiben Sie ihn sich sofort auf … irgend-
wo, und wenn es auf Ihrer Manschette ist. Auf jeden Fall notie-
ren.« Dann lachte er entschuldigend. »Tut mir leid, Frazer, wenn
66

ich hier wie ein Spieß vor der angetretenen Kompanie rede. Aber
etwas, was Sie zu allererst eisern praktizieren müssen, ist, sich nie
auf Ihr Gedächtnis zu verlassen. Ich werde mal nachsehen, ob wir
in unseren Akten etwas über Ericson haben. Und vergessen Sie
nicht, mich anzurufen, sobald Ihnen der Straßenname eingefallen
ist.«
Unweit der Telefonzelle lag eine kleine Kneipe, die ganz passabel
aussah. Ich parkte meinen Wagen davor, ging hinein und ließ mir
ein Käsebrot und einen Krug Bitterbier bringen. Dann fuhr ich zu
meiner Wohnung zurück, wobei ich mehrfach gerade noch bei Gelb
über die Kreuzungen huschte, mehr darauf bedacht, mich des Stra-
ßennamens zu erinnern als auf den Verkehr zu achten.
11
ch zog den Schlüssel aus dem Schloß der Wohnungstür und
wollte gerade meinen Zigarettenstummel im Aschenbecher auf
dem Garderobentisch der Diele ausdrücken, als ich ein leises Ra-
scheln von Papier aus meinem Wohnzimmer hörte. Dann wurde ei-
ne Schublade aufgerissen. Meine Haushälterin, Mrs. Glover, konnte
es nicht sein; sie ging stets Punkt zwölf Uhr nach Hause.
I
I
Vorsichtshalber ließ ich die Wohnungstür weit offen, ging leise
durch den Vorflur und lugte durch den Spalt der nur leicht ange-
lehnten Wohnzimmertür. Alles, was ich von diesem Blickwinkel aus
sehen konnte, war eine Hand, die in den Papieren auf meinem
Schreibtisch herumwühlte.
Behutsam schob ich die Zimmertür ein wenig weiter auf. Ein
67

Mann in grauem Maßanzug stand mit dem Rücken zu mir. Die
schlanke Taille und die kraftvollen breiten Schultern warnten mich,
daß ich wahrscheinlich jedes Quentchen der zehn Jahre Altersunter-
schied zwischen uns beiden in die Waagschale würde werfen müs-
sen, sollte es zu einer physischen Kraftprobe kommen.
Ich trat ins Zimmer und sprach ihn in ruhigem Ton an: »Geld
werden Sie dort kaum finden, wenn es das ist, was Sie suchen.«
Er wirbelte herum, und wir starrten uns schweigend an, wobei je-
der die Kräfte des anderen abschätzte. Er hatte dunkle Augen; über
dem harten Mund zierte, wie von einem Bleistift gezogen, ein
schmaler Schnurrbart sein bleiches Gesicht. Er war einer von den
Typen, wie man sie in den Westend Bars antrifft, wenn sie dort die
letzten Rennergebnisse studieren und es vermeiden, einem Fremden
direkt in die Augen zu sehen.
Er vermied es auch, meinem Blick zu begegnen, als ich ihn fragte:
»Darf ich mir die Frage erlauben, wer Sie sind?«
Er setzte ein dünnes Lächeln auf. »Diese Frage möchte ich Ihnen
zurückgeben. Wer sind Sie, Frazer?«
»Immerhin kennen Sie wenigstens meinen Namen«, gab ich zur
Antwort, trat zu einem Tisch und griff nach dem Telefon. »Viel-
leicht ziehen Sie es vor, daß die Polizei die Fragen stellt.«
»Lassen Sie die Finger vom Telefon, Frazer!«
Meine Hand zuckte zurück, als sei sie von einer Wespe gestochen
worden. Ich blickte in die Mündung eines 38er Revolvers.
»Nun mal 'raus mit der Sprache«, forderte er mich auf. »Warum
beschatten Sie Barbara Day?«
»Ich sie beschatten? Wir sind befreundet.«
»Sie waren es nicht, bevor Sie sich im Flugzeug kennenlernten.«
»Woher wissen Sie das?«
»Wir wissen es. Das muß Ihnen genügen!« antwortete er scharf
und knapp. »Und jetzt möchten wir gern etwas über Sie wissen,
Frazer.«
68

Während dieses Wortwechsels hatte ich fieberhaft nachgedacht.
Mein Wohnzimmer hatte Parkettfußboden, auf dem hier und da
Läufer lagen. Mrs. Glover hatte heute früh gewachst. Keine Rose
hatte mir bisher so lieblich geduftet wie der durchdringende Wachs-
geruch, der mir jetzt in die Nase stieg.
»Na schön; Sie sind im Vorteil«, lenkte ich mit einem Kopfnicken
auf seine Pistole ein. »Aber warum sollen wir bei Adam und Eva
anfangen; kommen wir doch lieber gleich zur Sache.« Bei diesen
Worten blickte ich auf das Ende meiner Zigarette. Er folgte mei-
nem Blick, was ich ausnutzte, um einen Schritt vorwärts zu tun.
»Was wollen Sie eigentlich von mir?«
»Mimen Sie nicht den Ahnungslosen«, entgegnete er. »Was haben
Sie mit ihnen angestellt?«
»Mit ihnen angestellt?« Diesmal brauchte ich meine Überra-
schung nicht vorzutäuschen.
Er hantierte ungeduldig mit der Pistole. »Wollen Sie, daß ich es
Ihnen buchstabiere?«
Der Mann stand auf einem schmalen Läufer neben dem Schreib-
tisch. »Also gut. Von mir aus. Vielleicht sollte ich doch…«, begann
ich und stieß dann einen Schmerzensruf aus. »Verdammt!« rief ich,
und ließ den Zigarettenstummel fallen. »Vor lauter Antworten auf
Ihre dummen Fragen verbrenne ich mir noch die Finger.« Ich bück-
te mich nach dem Zigarettenstummel und griff mit einer plötz-
lichen Bewegung nach dem Ende des Läufers vor mir. Er war dünn
und glitt über den gewachsten Boden, als wäre dieser aus blankem
Eis. Der Mann stürzte rückwärts hin, wobei ihm die Pistole aus der
Hand fiel und bis zur gegenüberliegenden Wand rutschte.
Ich wollte sie mit einem großen Sprung ergreifen; doch rollte er
sich mir in den Weg, packte mich an einer Ferse und riß mich eben-
falls zu Boden. Im nächsten Augenblick war er auch schon über
mir. Ich hatte die gewaltige Kraft seiner breiten Schultern schon
richtig eingeschätzt.
69

Jetzt, da ich flach mit der Nase darauf lag, roch mir das Wachs
gar nicht mehr so lieblich wie vorhin. Ich umklammerte eines sei-
ner Beine mit meinem linken Bein, nutzte dann meine ganze Kör-
perkraft dazu, um mich mit der flachen Hand vom Boden abzudrü-
cken, und rollte ihn über mich. Dann hob ich den Kopf und sah
mich blitzschnell nach der Pistole um; sie lag nur etwa fünfzehn
Zentimeter von meiner linken Hand entfernt. Ich griff danach …
dann krachte etwas auf meinen Kopf, und ich versank in einen gäh-
nenden, pechschwarzen Abgrund…
Ein dumpfer, rhythmischer Schmerz im Innern meines Kopfes weck-
te mich. Ich war groggy und völlig bewegungsunfähig. Ganz oben,
am Rand des Abgrunds, gab es Stimmen und Helligkeit. Langsam
kämpfte ich mich an die Oberfläche … dann schien der Wachsge-
ruch mir das Bewußtsein zurückzugeben.
Die Stimme des Mannes, mit dem ich gerungen hatte, berichtete
gerade: »Nein, im Schreibtisch waren sie nicht.«
»Er hat sie aber auch nicht bei sich«, erwiderte eine andere Stim-
me. Es war eine kultivierte Stimme, welche die Worte mit der Prä-
zision eines Menschen wählt, der sich nicht in seiner Muttersprache
ausdrückt. »Ich würde es nicht getan haben, Lloyd; aber im näch-
sten Augenblick hätte er die Pistole gehabt.«
Mein Angreifer lachte kurz. »Der ist zäher, als er aussieht.«
»Ich will es hoffen«, bemerkte der andere ernst. »Was ist mit dem
Schlafzimmer, Lloyd? Du solltest dich auch dort gründlich umse-
hen.«
Die Tür zum Schlafzimmer wurde geschlossen. Dann spürte ich
eine Hand in der inneren Jackentasche. Mein Zigarettenetui wurde
mir abgenommen. Ich verharrte regungslos, bis ich hörte, wie das
Etui auf den Schreibtisch gelegt wurde. Ganz langsam bewegte ich
den Kopf so weit, daß ich den zweiten Unbekannten wenigstens
70

aus einem Augenwinkel sehen konnte. Er wandte mir den Rücken
zu und schien gerade etwas zu schreiben. Er war untersetzt und
jünger als der Mann, den ich beim Durchsuchen meines Schreibti-
sches ertappt hatte. Sein blondes Haar war am Hinterkopf und an
den Seiten kurz geschnitten. Er machte den Eindruck eines Man-
nes, der großen Wert auf sein Äußeres legt. Dann hörte ich mein
Zigarettenetui zuschnappen und schloß die Augen, als er sich mir
wieder zuwandte.
Als er mir das Etui wieder in die Tasche schob, kehrte der andere,
den er Lloyd genannt hatte, aus dem Schlafzimmer zurück.
»Auch da ist nichts zu finden.«
»Ich habe so das Gefühl, daß du dich getäuscht hast, Lloyd. Ich
glaube nicht, daß Frazer mit den anderen in Verbindung steht.«
Aus dem Klang seiner Stimme schloß ich, daß er dicht neben mir
stand.
»Mir kommen schon selbst Zweifel…« Lloyd brach mitten im Satz
ab und meinte dann: »Nun, wir werden ja sehen, wie die Dinge sich
weiterentwickeln. Wir wollen lieber gehen, bevor er wieder zu sich
kommt!«
Ich wartete, bis die Wohnungstür hinter den beiden zugefallen
war. Dann rollte ich mich auf die Seite und stand mühsam auf. In
meinem Kopf hämmerte es schlimmer als zuvor, und als ich mit
der Hand behutsam den Hinterkopf abtastete, fühlte ich eine gro-
ße Beule. Es war aber kein Blut daran.
Mit wackeligen Beinen stakste ich zum Tisch mit den Getränken
und goß mir einen doppelten Whisky ein, den ich mit einem Ruck
hinunterkippte. Während ich noch mit weichen Knien dastand und
auf das leere Glas starrte, begann der Whisky wohltuend zu wirken.
Das Zigarettenetui fiel mir ein. Unter die Zigaretten war ein kleiner
Zettel geschoben. Ich holte ihn hervor, faltete ihn auseinander und
sah, daß nur zwei Worte darauf gekritzelt waren: L
ENNARD
S
TREET
.
»Lennard Street«, murmelte ich vor mich hin. »Natürlich, ja! Das
71

war es doch. Lennard Street!«
Ich stand noch so unsicher auf den Beinen wie ein neugeborenes
Kalb und war nicht imstande, zusammenhängend zu denken. Des-
halb beschloß ich, erst einmal unter die Dusche zu gehen. An-
schließend streckte ich mich auf der Couch aus und überlegte noch-
mals in aller Ruhe, was sich seit dem Augenblick ereignet hatte, als
ich meine Wohnung betreten hatte.
Aus dem, was der Mann namens Lloyd zu mir gesagt hatte, ließ
sich schließen, daß man einen Gegenstand bei mir vermutete. Seine
Frage »Was haben Sie mit ihnen angestellt?« konnte auf alles mög-
liche bezogen werden, auf geheime Pläne ebenso wie auf Bankno-
ten. Was auch immer dieses ›Etwas‹ sein mochte: Der Unbekannte
war gewillt gewesen, die Pistole zu gebrauchen, um in seinen Besitz
zu gelangen. Wo aber paßte Barbara Day in dieses Geschehen hin-
ein? Und warum wollte er wissen, aus welchem Grunde ich sie be-
schattet hatte?
Plötzlich fiel mir die holländische Trachtenpuppe ein. Ich sah sie
im Geiste vor mir liegen, aufgerissen, neben der Leiche. Hatte Cord-
well dieses ›Etwas‹ bei sich getragen? In der Puppe versteckt? Einen
Augenblick lang fragte ich mich, ob ich vorhin wohl Cordwells
Mörder gegenübergestanden hatte. Diesen Gedanken gab ich aber
schnell wieder auf. Der Angreifer würde das, was er gesucht hatte,
in der Puppe gefunden haben. Die beiden Eindringlinge standen
aber offensichtlich unter dem Eindruck, ich hätte Cordwell umge-
bracht und beraubt.
Nach dem flüchtigen Blick, den ich auf ihn hatte werfen können,
und den Bruchstücken der Unterhaltung, die ich mitgehört hatte,
schien mir der zweite Mann der intelligentere von beiden zu sein.
Daß er über meine Person im unklaren war, ging aus seinen Äuße-
rungen hervor. Warum aber hatte er mir den Zettel ins Zigaretten-
etui gesteckt?
Behutsam tastete ich an der Beule an meinem Hinterkopf herum.
72

Sie schien nicht von einem Pistolenknauf zu stammen, da die Kopf-
haut unverletzt war. Beim Nachhausekommen hatte nicht das ge-
ringste Anzeichen an der Wohnungstür auf einen Einbruch hinge-
deutet. Die beiden schienen also den alten Trick der Einsteigediebe
angewendet und einen Streifen Zelluloid ins Schnappschloß gescho-
ben zu haben. Zumindest der zweite Mann sah nicht wie ein Ga-
nove dieser Gattung aus; auch seine Sprechweise klang nicht da-
nach.
Morgen, nachdem ich eine Nacht geschlafen hatte, wollte ich mir
mal die Lennard Street ansehen. Richards aber sollte erst etwas er-
fahren, wenn ich mir selbst ein Bild von der Lage gemacht hatte.
12
ch fand die Lennard Street im Straßengewirr südlich des Hyde-
parks. Es war eine ziemlich belebte Straße, die von vielen Kraft-
fahrern benutzt wurde, um den Weg zur Brompton Road abzukür-
zen.
I
I
Nachdem ich meinen Wagen in einer stillen Seitenstraße geparkt
hatte, ging ich zurück zur Lennard Street. Wonach suchte ich ei-
gentlich hier? Diese Überlegung stellte ich an, während ich in die
Schaufensterscheibe einer Espressobar blickte. Plötzlich merkte ich,
daß mein Blick auf einer eigenartigen Trachtenpuppe ruhte, einem
kleinen Holländer, der auf einem winzigen Fahrrad saß. Ich sah mir
die anderen Gegenstände im Schaufenster an. Da waren ein Paar
Holzschuhe, einige bastgeflochtene Blumenkörbe mit Tulpen darin
und das Modell einer Windmühle. Ein Blick auf den in Goldschrift
73

quer über die Scheibe gemalten Namen verriet mir, daß diese Es-
pressobar Der Deich hieß. Ich beschloß, hier eine Tasse Kaffee zu
trinken.
Es war die typische Espressobar, wie man sie in jeder größeren
Stadt findet. Die wie eine Miniatur-Jukebox aussehende Kaffeema-
schine stand in der Mitte einer langen Theke. Davor waren ein paar
hohe Barhocker für Gäste aufgestellt, die es eilig hatten. Für Besu-
cher, die sich zu einem längeren Gespräch niederlassen wollten, stan-
den Tische und Stühle an der gegenüberliegenden Wand. Der hol-
ländische Stil des Lokals, auf den schon die Schaufensterauslagen
hinwiesen, trat innen noch stärker in Erscheinung. An den Wänden
hingen große Plakate, die mit farbenfrohen Bildern für den Besuch
Hollands warben. An einem Ende des Schanktisches hing das
mannsgroße ausgeschnittene Bild einer Windmühle. Ich zwängte
mich auf einen Barhocker.
Im Spiegel hinter der Theke konnte ich alle Tische gut im Auge
behalten. Nur ein Gast saß dort, eine fesche Blondine in enganlie-
gendem smaragdgrünem Kleid.
Ein müde und mißmutig aussehendes Mädchen in holländischem
Trachtenrock mit lang herunterhängendem, strähnigem Haar räum-
te ein benutztes Kaffeeservice vor mir weg. »Was darf es sein, Sir?«
fragte sie.
Ich bestellte einen Kaffee und sah gelangweilt zu, wie sie mit dem
Monstrum von Kaffeemaschine hantierte. Als sie mit den paar Zen-
timetern Kaffee unter einer braunen Schaumkrone zu mir zurück-
kehrte, rief das Mädchen am Tisch: »Zahlen bitte, Carol.«
Die Kellnerin murmelte ein unfreundliches »Komme«.
»Wie geht es Jan?« fragte die Dame in Grün, während sie ihr
Make-up auffrischte. »Erwarten Sie ihn heute zurück?«
Die Serviererin fuhr sich nervös über die Augen. »Es geht ihm
schon besser. Heute nachmittag wird er wahrscheinlich wieder da-
sein, Miß Gilmore.«
74

Ich war gerade dabei, mir eine Zigarette anzuzünden. Bei der
Nennung dieses Namens umspannte meine Hand das Feuerzeug
unwillkürlich fester, und ich riskierte einen Blick auf Miß Gilmore.
Sie war ungefähr Mitte Dreißig, sah aber noch recht attraktiv aus
und wirkte etwas hochmütig. Sie hatte hellblaue, durchdringende
Augen, und ihr Mund war um eine Nuance zu groß.
Unsere Blicke begegneten einander, und ich wandte schnell den
Kopf zur Seite. In diesem Augenblick hatte ich das Gefühl, als be-
kunde sie ein mehr als zufälliges Interesse für mich. Aber ich war
wohl im Moment für Eindrücke überempfänglich; die Straßenanga-
be in meinem Zigarettenetui und die Anwesenheit von Vivien Gil-
more in einer Espressobar in dieser Straße, in deren Schaufenster ei-
ne holländische Trachtenpuppe auf einem Miniaturfahrrad saß,
machten es mir unmöglich, an einen reinen Zufall zu glauben.
Im Spiegel beobachtete ich, wie die Kellnerin Vivien Gilmore die
Rechnung überreichte.
Vivien klappte ihre Puderdose zu und fragte in gelangweiltem
Ton: »Was fehlt Jan eigentlich, hat er die Grippe?«
»Ach, die übliche Geschichte mit seinem Magen«, antwortete Ca-
rol. »Ich werde froh sein, wenn er wieder da ist. Das ist doch keine
Art, mich hier mit der ganzen Arbeit allein zu lassen.«
Ein Postbote trat ein, winkte mit einem Bündel Post in Carols
Richtung und knallte die Briefpost neben mir auf die Theke. »Nun
ist es doch wieder schön geworden«, sagte er.
»Wirklich?« fragte Carol. »Ich merke ja doch nichts davon.«
Mein Blick fiel auf den Stoß Briefe neben mir. Das meiste schie-
nen Rechnungen zu sein, abgesehen von einem lederfarbenen, di-
cken Umschlag, der seinem Umfang nach eine Broschüre enthalten
mußte.
Meine Aufmerksamkeit wurde sehr schnell wieder auf den Spiegel
gelenkt, als ich hörte, daß die Tür geöffnet wurde und Vivien Gil-
more »Barbara!« rief.
75

13
ch hörte das Klappern ihrer Absätze und sah, als sie in mein
Blickfeld kam, daß sie ein gelbes Kleid ohne Ärmel mit schwar-
zem Besatz trug, dazu schwarze Handschuhe und keinen Hut. Rasch
ging sie durch das Lokal zu Vivien Gilmores Tisch.
I
I
»Verzeih, daß ich so spät komme, Vivien«, entschuldigte sie sich.
»Ich blieb im Verkehrsgewühl stecken, und dann hat es lange ge-
dauert, bis ich einen Parkplatz fand.«
»Ich überlegte schon, was dich aufgehalten haben könnte«, erwi-
derte Vivien blasiert und warf dabei einen Blick auf ihre Uhr. »Du
hast gerade noch Zeit, einen Kaffee zu trinken. Dann müssen wir
aber schleunigst nach St. Albans.«
»Meinst du, daß es die Fahrt lohnt?« fragte Barbara zögernd.
»Auf jeden Fall«, antwortete Vivien. »Wie ich gehört habe, wird
die Konkurrenz dort vollzählig anwesend sein.«
Aus der sich entspinnenden Unterhaltung entnahm ich, daß die
beiden Damen sich verabredet hatten, in St. Albans eine Versteige-
rung antiker Möbel zu besuchen. Wenn ich gehofft hatte, der Kon-
versation auch nur den geringsten Anhaltspunkt in bezug auf den
Zettel entnehmen zu können, der mich hierher in die Lennard
Street geführt hatte, wurde ich enttäuscht. Ihr Gespräch hatte nicht
mehr Bedeutung als das Geschwätz, das man zufällig irgendwo in
einer Straßenbahn hört.
Ich hatte konzentriert in den Spiegel gestarrt – und natürlich ge-
schah das Unvermeidliche: Barbara wandte den Kopf in meine Rich-
tung und runzelte leicht die Stirn. Dann aber lag ein Lächeln des
Erkennens in ihrem Gesicht.
»Wer ist das?« fragte Vivien scharf, während ich von meinem
76

Hocker glitt und zu ihrem Tisch hinüberging.
»Hallo… Guten Tag!« begrüßte ich sie. »Das ist aber eine Überra-
schung.«
»Ja, nicht wahr?« antwortete Barbara in einem Ton, der einen An-
flug von Skepsis verriet. Dann sagte sie zu ihrer Begleiterin: »Vivien,
darf ich dir Mr. Frazer vorstellen? Wir haben uns in Amsterdam
kennengelernt.« Und zu mir gewandt: »Vivien Gilmore, meine Teil-
haberin.«
Vivien erwiderte meinen Gruß mit kühlem Kopfnicken. Barbara
spürte, daß Viviens Gleichgültigkeit mir das Gefühl gegeben hatte,
ein unwillkommener Störenfried zu sein, und sagte schnell: »Kom-
men Sie, Tim. Setzen Sie sich zu uns.«
Ich zog mir einen Stuhl vom nächsten Tisch heran und fragte:
»Hoffentlich habe ich kein wichtiges Gespräch unterbrochen?«
»Nur eine Aufsichtsratssitzung«, erwiderte Barbara mit vorge-
täuschtem Ernst. »Die Jahreshauptversammlung von Day und Gil-
more.« Sie mußte lachen. »Wir machen nur gerade unsere übliche
Frühstückspause, Tim. Unser Antiquitätengeschäft ist gleich hier
um die Ecke, wie Sie wissen.«
Ich zog mein Zigarettenetui heraus. »Nein, das wußte ich nicht.
Aber … ich bin sehr erfreut, daß es so ist.«
Barbara sah mich verständnisinnig an. »Liegt das hier nicht ziem-
lich außerhalb Ihres Weges? Ich habe Sie hier noch nie gesehen.«
»Ich bin auch zum erstenmal hier. Das Büro einer Ingenieurfirma,
mit der ich geschäftlich zu tun hatte, liegt ein Stück weiter unten in
der Straße«, erklärte ich ihr und bot den Damen Zigaretten an.
»Leider muß ich gestehen, daß es sich um einen unserer Gläubiger
handelt. Ich wollte nur schnell eine Tasse Kaffee trinken, bevor ich
um elf Uhr mit dem Prokuristen verhandle.«
Vivien Gilmore stand unvermittelt auf. »Entschuldigen Sie mich
bitte, aber ich muß zurück ins Geschäft.«
Ich erhob mich ebenfalls und erwiderte förmlich: »Es tut mir leid,
77

wenn ich Sie aufgehalten habe.«
Barbara hielt mich zurück. »Setzen Sie sich doch wieder, Tim.
Wir wollen uns in St. Albans nur einige Antiquitäten ansehen. Es
genügt, wenn wir in etwa zehn Minuten abfahren.«
»Dann also bis gleich im Laden«, verabschiedete sich Vivien Gil-
more und schenkte mir ein frostiges Lächeln.
»Die arme Vivien«, seufzte Barbara und nahm sich eine Zigarette
aus meinem Etui, das ich offen auf den Tisch gelegt hatte. »Ich
fürchte, Sie haben sie nicht gerade in bester Laune erlebt. Es ist we-
gen der Sache mit Cordwell. Sie macht sich Sorgen wegen der un-
erwünschten Publizität – es könnte dem Geschäft schaden.«
»Auch das geht vorbei«, beruhigte ich sie, während ich ihr das
Feuerzeug hinhielt. »Ich würde mich dadurch nicht unterkriegen
lassen.«
»Das tue ich auch nicht. Aber Vivien bedeutet das Geschäft so
ziemlich alles.« Sie sah mir zu, wie ich meine Zigarette anzündete.
»Wissen Sie, ich bin vom Geschäft nicht abhängig, zumindest nicht
– finanziell.«
»Ach so, ich verstehe«, antwortete ich schnell. So gern ich es ge-
tan hätte – dies war kein Thema, das ich weiter verfolgen konnte.
»Da ich nun schon Ihr Gespräch unterbrochen habe – darf ich
Ihnen jetzt einen Kaffee bestellen?«
»Danke, nein. Ich kann Vivien nicht länger warten lassen. Sie will
unbedingt an Ort und Stelle sein, bevor die Auktion beginnt.« Ihre
Augen blieben auf meinem Gesicht haften. »Es freut mich aber,
daß ich Sie getroffen habe, Tim. Ich habe übrigens versucht, Sie
telefonisch zu erreichen, bevor ich hierherkam.« Sie warf einen
Blick auf das Mädchen, das die Kaffeemaschine polierte, und erklär-
te dann: »Jetzt ist keine Zeit mehr dafür. Aber ich muß mich so
bald wie möglich mit Ihnen unterhalten, Tim.« Plötzlich wirkte sie
verloren und hilflos.
»Wann werden Sie zurück sein?« fragte ich.
78

»Heute abend gegen sieben Uhr, schätze ich.«
»Kommen Sie doch auf einen Drink bei mir vorbei, sobald Sie
wieder zurück sind.«
Nach kurzem Zögern nickte sie. »Gut, Tim. Ich werde kommen,
sagen wir, so gegen halb acht.« Sie zerdrückte nachdenklich den
Rest ihrer Zigarette im Aschenbecher. Dann stand sie auf. »Vielen
Dank, Tim.«
Ich sah ihr nach, als sie draußen am Schaufenster vorbeiging. Mei-
nes Erachtens mußte sie in einem Pensionat erzogen worden sein,
wo jungen Mädchen gute Körperhaltung beigebracht wird. Dann
aber verscheuchte ich ihr reizendes Bild aus meinen Gedanken und
überlegte, was sie mir wohl heute abend zu sagen hätte.
Das Läuten des Telefons hinter der Theke erinnerte mich daran,
daß dort immer noch mein Kaffee unberührt stand. Ich kehrte zu
meinem Hocker zurück. Der Kaffee war nur noch lauwarm, und
ich wollte gerade einen neuen bestellen, als ich sah, daß die Servie-
rerin telefonierte.
»Ich bin wirklich froh, daß es Ihnen wieder besser geht«, erklärte
sie in unterwürfigem Ton. »Alle Stammgäste haben schon nach Ih-
nen gefragt…«
Ich hörte nur mit halbem Ohr auf ihren Monolog und beschloß,
keinen neuen Kaffee mehr zu bestellen, sondern gleich zu zahlen.
In diesem Augenblick legte sie den Hörer nieder und blätterte die
auf der Theke liegende Post durch. Sie zog den großen Umschlag
heraus und riß ihn auf, wobei ein Katalog zum Vorschein kam.
Ich warf einen uninteressierten Blick darauf, dann aber blieben
meine Augen an dem farbenfrohen Umschlag haften. Es war ein
Katalog für Tulpenzwiebeln.
Nach einem kurzen Blick auf den Katalog eilte das Mädchen zum
Telefon zurück. »Es stimmt, Sir. In dem großen Umschlag ist ein
Tulpenkatalog.« Sie lauschte einen Augenblick und verabschiedete
sich dann von ihrem Gesprächspartner: »Ich werde froh sein, wenn
79

Sie wieder da sind, Sir.« Damit legte sie auf.
Ich zahlte und verließ das Lokal. An sich gab es keinen Grund,
warum ein Mann mit dem holländischen Namen Jan, der eine hol-
ländische Espressobar leitete, nicht einen Tulpenkatalog geschickt
bekommen sollte – schließlich standen mindestens zwanzig Schalen
mit Tulpen im Raum verteilt. Und warum sollte er angesichts des
ganzen holländischen Lokalkolorits nicht auch die gleiche Trach-
tenpuppe im Schaufenster ausstellen, wie Cordwell sie bei sich hat-
te? Und dennoch: Die Puppe und der Tulpenkatalog zusammen
mußten doch mehr als ein Zufall sein. Allerdings handelte es sich,
soweit mir bekannt war, um die einzige holländische Espressobar
in ganz London. Nun wollte ich doch zu gern erfahren, wie Char-
les Ross auf diese neue Entwicklung reagieren würde.
Ich hielt Ausschau nach der nächsten Telefonzelle.
14
ine Stunde später saß ich meinem Chef im Rauchsalon seines
Klubs gegenüber und nippte an einem Sherry. Ich lächelte in
mich hinein; aus dem Klang meiner Stimme am Telefon hatte er
wohl geschlossen, ich sei schlechter Laune. Daher hatte er, was ty-
pisch für ihn war, für unsere Aussprache einen Ort gewählt, wo ein
ungeschriebenes Gesetz es jedem Gast unmöglich machte, sich mit
dem Gastgeber in eine hitzige Diskussion einzulassen.
E
E
Schweigend widmete er sich seinem Getränk und gab mir Gele-
genheit, mich innerlich zu sammeln. Als er schließlich sein Glas auf
den Tisch stellte, fragte er in leichtem Konversationston: »Nun,
80

Frazer, was haben Sie auf dem Herzen?«
»Den Fall Salinger, Sir«, erwiderte ich trocken. »Es hat sich da ei-
niges ereignet, worüber ich gern mit Ihnen gesprochen hätte.«
»Ich dachte es mir schon, daß sich da noch etwas entwickeln wür-
de«, erwiderte er. »Versuchen Sie bitte, die Dinge so anschaulich
und sachlich wie möglich zu schildern.«
»Ich möchte mit einem Namen beginnen«, fuhr ich fort und lehn-
te mich in meinem Ledersessel zurück. »Ericson. Ich habe bereits
Richards von einem Telefonanruf Vivien Gilmores berichtet, den
ich am Abend von Cordwells Ermordung in Barbara Days Woh-
nung entgegennahm und bei dem sie den Namen Ericson erwähn-
te.«
Sein Gesicht verriet kaum mehr als höfliches Interesse.
Ich legte eine kurze Pause ein und streckte dann die Fühler aus:
»Mir schien, daß Richards den Namen schon kannte.«
»Das ist möglich«, erwiderte Ross.
Jetzt ließ ich meinem Unwillen etwas freien Lauf. »Das hat doch
so keinen Zweck, Mr. Ross«, protestierte ich. »Sie müssen wir schon
so weit vertrauen, daß Sie mich ausreichend über die Hintergründe
des Falles Salinger aufklären.«
Er griff nachdenklich nach seinem Glas. Zu meiner Überraschung
ging er auf meinen Protest ein. »Das ist ein verständliches Verlan-
gen, Frazer. Die Dinge sind jetzt wohl auch so weit gediehen, daß
ich Sie mehr ins Vertrauen ziehen kann.« Er stellte das Glas auf den
Tisch zurück, lehnte sich in seinen Sessel und fuhr fort: »Während
der letzten zwölf Monate hat eine gewisse verbrecherische Organisa-
tion Interpol viel Arbeit verursacht. Die Beamten von Interpol ha-
ben allen Grund zu der Annahme, daß ein gewisser Ericson Chef
dieser Bande ist.«
»Und womit befaßt sich diese Organisation?« stieß ich nach, als
er stirnrunzelnd in sein vorheriges Schweigen zurückfiel.
»Mit gestohlenen Diamanten«, antwortete er, aus seinen Gedan-
81

kengängen aufgescheucht. »Sie werden vom Kontinent nach Eng-
land geschmuggelt. Ericsons kleine Gruppe hat ein ausgezeichnet
funktionierendes System aufgebaut, sie zu kaufen und zu verkau-
fen.«
Ich trommelte unzufrieden mit den Fingern auf die Sessellehne.
»Aber gestohlene Diamanten gehen doch eigentlich nur die Polizei
etwas an. Ich kann immer noch nicht erkennen, welches Interesse
gerade Ihre Dienststelle an einer solchen Sache haben kann.«
»An Ericsons Organisation sind wir direkt auch nicht interessiert.
Das ist eine Angelegenheit der Polizei«, bestätigte er. »Es gibt da
aber zwei Berührungspunkte mit meiner Abteilung. Einige der nach
England geschmuggelten Diamanten sind Industriediamanten, mit
denen lebhafte Geschäfte getätigt werden, und zwar hauptsächlich
durch ausländische Agenten.« Er lächelte. »Ich habe Interpol bereits
eine Liste der möglicherweise in Frage kommenden Agenten über-
mittelt!«
»Verstehe«, erwiderte ich, was jedoch nicht ganz den Tatsachen
entsprach, denn ich wußte immer noch nicht, worauf er hinaus-
wollte, und fragte daher: »Aber wo ist hier das Bindeglied zu Barba-
ra Day? Oder, besser gesagt, zu Leo Salinger?«
»Das ist der zweite der beiden Berührungspunkte, die ich vorhin
erwähnte – für mich übrigens der wichtigste.« Das Gesicht von Ross
verdüsterte sich. »Vor zwei Monaten wurde mir berichtet, die Poli-
zei von Amsterdam habe Salinger in Verdacht, in diese Diamanten-
affäre verwickelt zu sein. Sie werden sich denken können, daß ich
von dieser Nachricht nicht gerade begeistert war. Schließlich hatte
Salinger sehr lange für uns gearbeitet und war dadurch im Besitz
wertvoller Informationen. Außerdem wäge ich stets alles genau ab,
damit auch ja der richtige Mann für die jeweils zu lösende Aufgabe
eingesetzt wird. Ich glaubte nicht, im Falle von Leo Salinger einen
Fehler gemacht zu haben. Aus Sicherheitsgründen mußte ich der
Angelegenheit jedoch nachgehen. Deshalb forderte ich ihn auf, nach
82

London zu kommen.« Ross schwieg ein paar Sekunden, bevor er
fortfuhr: »Er war auf dem Wege zum Flughafen, als er von Barbara
Day überfahren wurde.«
Während des nun folgenden Schweigens betrachtete ich aufmerk-
sam sein Gesicht. Das war plötzlich ein ganz anderer Ross. Ich hat-
te ihn stets für einen Mann gehalten, der sich ohne Skrupel und
Sentiments der einzigen Aufgabe widmete, seine Abteilung wirksam
einzusetzen. Soeben aber, und wenn auch nur für einen Moment,
hatte ich einen flüchtigen Einblick in die warme, sensitive Natur er-
halten, die er seinen Untergebenen gegenüber hinter der Maske der
Gleichgültigkeit verbarg.
Von seinem unerwartet menschlichen Zug seltsam berührt, fragte
ich so nebenbei: »War Salinger Ihr Freund?«
Er richtete sich in seinem Sessel auf und warf mir einen Blick zu,
der teils mißbilligend, teils amüsiert war. »Das ist eine Suggestivfra-
ge, Frazer«, antwortete er dann scharf, ließ dem jedoch eine halb
zustimmende Geste folgen. »Wir kannten uns seit langem persön-
lich. Er spielte wunderbar Klavier. Leo und sein Bruder Arnold hat-
ten auf der Musikakademie Amsterdam studiert; beide waren bril-
lante Musiker. Natürlich gab es für mich andere Gründe als diese,
Leo als Geheimagenten zu verwenden. Obgleich seine Mutter Hol-
länderin war, hatte der Vater als britischer Marineoffizier gedient.«
»Wußte Arnold, daß sein Bruder für Ihre Dienststelle tätig war?«
»Natürlich nicht«, reagierte Ross unwirsch. »Ich wünschte, Sie
hätten diese Frage nicht gestellt. Es fällt mir schwer, an Leo zu
zweifeln. Sollte er jedoch seinem Bruder oder sonst jemandem er-
zählt haben, daß er für uns arbeitet, dann muß ich zugeben, einen
Fehler gemacht zu haben.« Ross machte mit beiden Händen eine
abwehrende Bewegung. »An sich irre ich mich selten in der Beurtei-
lung von Menschen, Frazer; und ich werde keine ruhige Stunde ha-
ben, ehe ich nicht den endgültigen Beweis für Leos Unschuld habe.
Ganz abgesehen von meinen persönlichen Gefühlen, möchte ich es
83

auch nicht auf dem Gewissen haben, als Leiter dieser Dienststelle
einen solchen Fehler begangen zu haben.«
Leicht belustigt stellte ich fest, daß mit dieser Bemerkung wieder
der rücksichtslos seiner Arbeit ergebene Ross zum Vorschein kam.
»Was geschah eigentlich mit dem Metronom, das Salinger bei sich
hatte, als er überfahren wurde?« fragte ich. »Hat Richards es sich nä-
her angesehen?«
»Die Polizei von Amsterdam hat es ihm ausgehändigt. Es waren
aber keine Diamanten darin versteckt, wenn Sie darauf hinauswol-
len. Auch nicht in dem, das Cordwell gehörte.« Er lächelte. »Im all-
gemeinen finden wir Scotland Yard stets hilfsbereit, wenn wir be-
sondere Wünsche haben.«
»Das höre ich gern«, erwiderte ich. »Könnten Sie dann Scotland
Yard nicht überreden, einen der Gegenstände herauszurücken, die
Cordwell bei seiner Ermordung bei sich hatte?«
Ross sah mich durch halb geschlossene Augenlider an. »Welchen
wollen Sie, Frazer? Das Metronom? Ich versichere Ihnen, daß man
es fast in seine Moleküle zerlegt hat, um es zu untersuchen.«
»Nicht das Metronom«, winkte ich lässig ab. »Ich interessiere
mich für den Tulpenkatalog.«
15
m sechs Uhr abends rief mich Arthur Fairlee aufgeregt an. Er
müsse mich unbedingt eine halbe Stunde später in der Bar des
Restaurants Die Antilope sprechen. Da ich um halb acht Uhr mit
Barbara in meiner Wohnung verabredet war, wollte ich ihn schon
U
U
84

abwimmeln; doch dann überlegte ich es mir anders. Schließlich
wollte ich es auch nicht riskieren, bei meiner Unterhaltung mit Bar-
bara durch einen Fairlee gestört zu werden, der, von Eifersucht ge-
plagt, an meine Tür trommelte. Deshalb verabredete ich mich mit
ihm für einen kurzen Drink.
Fairlee stand an der Bar und fingerte nervös an einem Glas Gin
mit Zitrone herum, als ich eintrat.
»Wir müssen uns kurz fassen«, ermahnte ich ihn, nachdem ich
mir Whisky mit Ginger Ale bestellt hatte. »Ich bin um halb acht
verabredet.«
Seine wäßrigblauen Augen sahen mich hinter den Gläsern neugie-
rig an. »Mit Bar…«, begann er, um sich dann schnell zu verbessern,
»…mit diesem verdammten Polizeifritzen?«
Ich schüttelte den Kopf. »Wie kommen Sie darauf, Fairlee?«
»Dieser Kerl ist immer wieder hinter mir her. Heute nachmittag
mußte ich ihm eine ganze Stunde meiner Bürozeit opfern. Immer
wieder reitet er auf den Beziehungen zwischen Barbara und diesem
Cordwell herum.«
»Aber sie hat ihm doch schon mehrfach gesagt, daß sie Cordwell
kaum gekannt hat«, sagte ich ausweichend. Ich kam mir vor, als
wäre ich dazu ausersehen, den Argwohn eines eifersüchtigen Verlob-
ten zu beschwichtigen.
»Schon. Aber aus irgendeinem Grunde scheint dieser Inspektor al-
les nur bedingt zu glauben, was man ihm erzählt.« Der hervorste-
hende Adamsapfel von Fairlee zuckte nervös auf und ab. »Frazer,
Sie waren doch mit Barbara zusammen, als sie Cordwell in dem be-
wußten Café in Amsterdam traf?«
»Ja«, antwortete ich und versuchte dabei, einen Ton leichter Ver-
zweiflung aus meiner Stimme herauszuhalten.
Nun schoß er seine nächste Frage ab: »Hatten Sie den Eindruck,
daß die beiden sich schon von früher kannten?«
»Natürlich hatten sie sich schon früher getroffen. Sie wohnten
85

doch im selben Hotel.«
»Ja, ich weiß. Das meinte ich auch nicht.«
Ohne meinen Mißmut zu verbergen, fragte ich scharf: »Was mein-
ten Sie dann, Fairlee?«
Er blickte verwirrt und unruhig in sein Glas. »Ich meinte … als
die beiden im Café zusammen waren, hatten Sie da den Eindruck,
das Barbara und Cordwell sich vielleicht besser kannten, als sie sich
in der Öffentlichkeit gaben?«
Es war die gleiche Frage, die ich mir selbst mehrfach gestellt hatte.
»Nein, den Eindruck hatte ich nicht.« Bei dieser Antwort war ich
mir nicht ganz im klaren, ob ich mich nicht selbst damit mehr be-
ruhigen wollte, als Fairlee es tat. »Aber ich bin ja auch nicht mit
Miß Day verlobt. Sie selbst hätten ihre Reaktion sicher besser beur-
teilen können.«
»Sachte, sachte! Ich möchte nicht, daß Sie einen falschen Ein-
druck von Barbara erhalten«, lenkte er hastig ein. »Natürlich ver-
traue ich ihr. Aber diese ewige Fragerei der Polizei macht mich ner-
vös.« Er stellte das Glas mit hartem Ruck auf den Tisch. »Die Po-
lizei hat sogar Vivien Gilmore vernommen.«
»Warum denn sie?« fragte ich.
»Weiß der Himmel!« erwiderte er. »Ich habe nicht die leiseste Ah-
nung, alter Freund.«
Wozu hatte er mir dann aber diese Information gegeben? Ich be-
schloß, etwas auf den Busch zu klopfen. »Verlebt Miß Gilmore
auch ihre Ferien in Amsterdam?«
»Aber nein! Sie kann diese Stadt nicht ausstehen. Ich erinnere
mich, daß sie mir einmal erzählt hat…« Er brach mitten im Satz ab
und fragte langsam: »Warum interessiert Sie das überhaupt?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Weil die Polizei sie vielleicht des-
halb vernommen haben könnte.«
»Ach ja, natürlich. Sie gehen den Dingen wirklich auf den Grund,
alter Junge.« Er setzte wieder sein dünnes Lächeln auf. »Nein, Vi-
86

vien mag Holland überhaupt nicht. Offen gestanden, mir geht es
auch so. Verdammt langweilige Gegend, wenn Sie mich fragen.« Er
griff wieder nach seinem Glas und nippte an seinem Gin, ehe er
weitersprach: »Ich kann vor allem nicht begreifen, daß Barbara auch
jetzt noch immer dort hinfährt – nach allem, was vor ein paar Mo-
naten geschehen ist.«
Ich setzte eine Miene auf, die höfliches Interesse andeuten sollte,
und fragte: »War es etwas Unangenehmes?«
»Sehr unangenehm«, bestätigte er, wobei er mich nicht aus den
Augen ließ. »Sie hat in Amsterdam einen Mann namens Salinger
überfahren. Er war gleich tot, der arme Kerl.«
»Großer Gott!« rief ich und spielte den Erschrockenen.
»Das war schon eine üble Sache. Obwohl es keineswegs ihre
Schuld war, beileibe nicht!« Fairlee warf einen flüchtigen Blick auf
seine Uhr. »Was, schon so spät?« Er kippte schnell den Rest seines
Getränks hinunter. »Mir fällt eben ein, daß ich noch eine Verabre-
dung habe, Frazer. Hätte das bei unserer netten Plauderei fast ver-
gessen. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich mich jetzt verabschiede?
Richtig – Sie sind ja auch verabredet.« Etwas zu betont gleichgültig
setzte er hinzu. »Wenn Sie zufällig in Richtung Westend wollen…«
»Mein Wagen steht vor der Tür«, lehnte ich ab. »Vielen Dank für
das Angebot.«
»Also dann auf Wiedersehen, Frazer.« Ohne mir die Hand zu ge-
ben, wandte er sich zur Tür, um sich dann nochmals umzudrehen.
»Ach, ehe ich es vergesse. Sollten Sie zufällig Barbara begegnen …
es wäre mir lieb, wenn Sie unsere heutige Unterhaltung nicht er-
wähnen würden. Sie könnte sonst glauben, ich spioniere ihr nach.«
Mit einigen geheimen Vorbehalten versprach ich ihm, unser Ge-
spräch vertraulich zu behandeln. »Wirklich nett von Ihnen«, be-
dankte er sich und steuerte auf den Ausgang zu.
Um ihm Zeit zu lassen, vor mir abzufahren, vertrödelte ich noch
eine Weile mit meinem Getränk und ließ mir indessen unsere Un-
87

terredung noch einmal durch den Kopf gehen. Ich hatte das Ge-
fühl, daß nicht nur Eifersucht allein Fairlee zu einem Treffen mit
mir bewogen hatte. Zweifellos hegte er einen undefinierbaren Arg-
wohn bezüglich der Beziehungen zwischen Barbara und Cordwell.
Aber steckte nicht doch noch mehr dahinter? Zwei seiner Bemer-
kungen machten mich nachdenklich. Die erste war sein Hinweis da-
rauf, daß auch Vivien Gilmore von der Polizei vernommen worden
war. Er erwähnte das nur kurz und wechselte sofort das Thema, als
ich neugierig wurde. Und warum hatte er den Autounfall erwähnt,
bei dem Salinger von Barbaras Wagen überfahren und getötet wor-
den war? Er hatte mich genau beobachtet, als er es mir erzählte.
Vielleicht sollte diese Frage aber gar nichts weiter als testen, wie gut
ich mich mit Barbara stand und was sie mir anvertraut hatte. Das
war es wohl auch gewesen, dachte ich schließlich und trank aus. Vi-
vien Gilmores Vernehmung hatte er vielleicht nur aus dem Drang
eines Mannes heraus erwähnt, der sich wegen der Freundschaft sei-
ner Verlobten mit einem anderen Manne peinigende Gedanken
macht. Schließlich kam ich zu der Ansicht, Fairlee sei nichts als ein
gescheiterter Romeo, und fuhr zu meiner Wohnung zurück.
Vor der Tür zu meiner Garage parkte ein Morris Minor undefinier-
baren Alters. Eine lange Gestalt lehnte dagegen und rauchte eine
Zigarette. Die Bemerkung, die ich vor mich hin murmelte, als ich
den Wartenden erkannte, war nicht gerade salonfähig.
Als ich aus meinem Wagen stieg, flehte Richards mich an: »Etwas
zu trinken, um der Liebe Allahs willen! Seit mehr als einer halben
Stunde trete ich hier von einem Fuß auf den anderen und warte auf
Sie.«
»Es gibt da seit einiger Zeit so eine Einrichtung, die man Telefon
nennt«, erwiderte ich mit schadenfrohem Grinsen. »Und noch eins:
Das Getränk muß recht schnell die Kehle hinunter, denn in etwa
88

zehn Minuten erwarte ich Besuch.«
»Dieser Besuch wird doch nicht etwa Barbara Day sein?« fragte er
ironisch, während ich ihm kurz darauf im Wohnzimmer einen Whis-
ky mit Soda servierte.
Ich wandte mich dem Tisch mit den Getränken zu und erklärte
mit etwas gezwungenem Lachen: »Da wir gerade von ihr sprechen –
ich hatte ein Plauderstündchen mit Fairlee, ihrem Verlobten.«
»Das muß ja höchst interessant gewesen sein. Was wollte er
denn?«
»Genaugenommen nichts. Offensichtlich wollte er sich nur eine
Portion Eifersucht von der Leber reden.« Ich kehrte mit dem Ge-
tränk, das ich mir gemixt hatte, zu meinem Sessel zurück. »Möchte
nur wissen, was Barbara Day an ihm findet.«
Richards sah mich einen Augenblick fragend an, murmelte ein lei-
ses ›Prost‹ und stürzte sich auf seinen Whisky.
Mittlerweile begann ich unruhig im Zimmer auf und ab zu ge-
hen, darauf bedacht, seinen schelmischen Blicken auszuweichen.
Laß dich doch nicht nervös machen, sagte ich mir. Und was soll
geschehen, wenn Barbara eintrifft, bevor er geht? Gut, sie ist wirk-
lich eine recht attraktive Frau. Aber deswegen brauchen mich Ri-
chards' anzügliche Bemerkungen doch nicht so aus der Fassung zu
bringen.
»Wie ich hörte, haben Sie heute mit Ross gesprochen.«
Ich nickte. »Es war ein ziemlich offenes Gespräch. Zumindest hat
es die Atmosphäre gereinigt.«
»Ich erfuhr, daß Sie sich für Cordwells Tulpenkatalog interessie-
ren.«
Ich fingerte an einem Ornament auf meinem Schreibtisch herum.
»Ross erwähnte allerdings nicht, warum Sie daran interessiert sind«,
fuhr Richards fort, wobei er seiner Feststellung ein deutlich hörba-
res Fragezeichen anhängte.
»Er hat mich nicht danach gefragt«, antwortete ich kühl, mit spür-
89
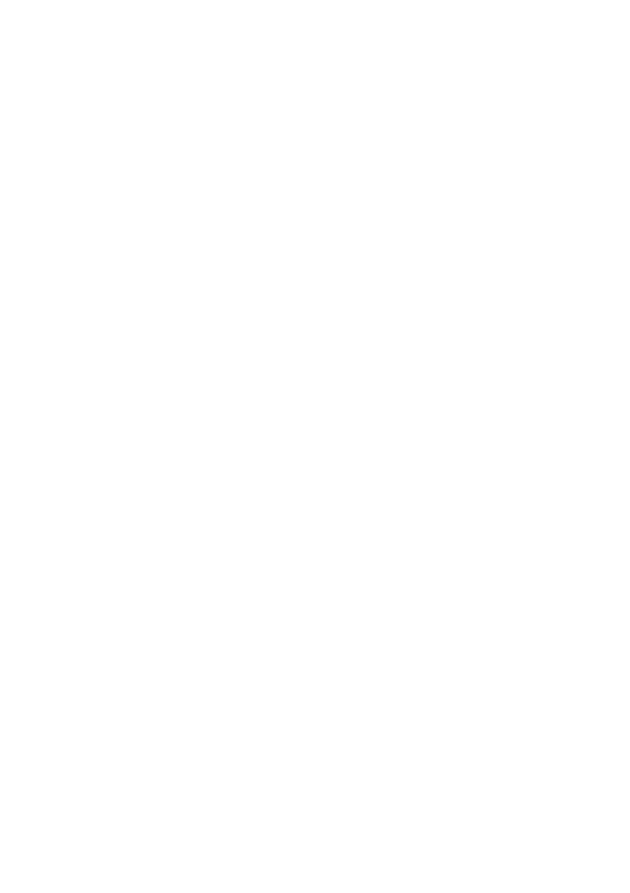
barem Unbehagen. »Ich hätte ihm auch gar keine klare Antwort ge-
ben können. Unter uns gesagt: Ich jage da nur einer unbestimmten
Eingebung nach.«
»Dann Hals- und Beinbruch!« Richards lächelte verständnisvoll.
»Übrigens sind Sie nicht der einzige, der sich für spezielle Gegen-
stände interessiert, die bei Cordwell gefunden wurden. Barbara hat
Inspektor Trueman gefragt, ob sie sich nicht einmal den Film an-
sehen dürfe, der sich in Cordwells Reisetasche befand. Er ist ihr
heute früh vorgeführt worden.«
»Ein merkwürdiges Verlangen«, erwiderte ich verblüfft. »Hat sie ei-
nen Grund dafür angegeben?«
»Nein, aber den kann ich Ihnen liefern.« Richards blickte mit ern-
stem Gesicht in sein Glas. »Es hat ganz den Anschein, als ob das
Mädchen sich für Sie zu interessieren beginnt, Frazer.« Er schwieg
einen Augenblick und fragte: »Es ist doch Barbara Day, die Sie hier
erwarten, nicht wahr?«
»Ja, sie ist es«, gab ich zu. »Ich möchte aber betonen, daß sie es
war, die den Anstoß zu dieser Einladung gegeben hat.«
»Das überrascht mich nicht. Ich gehe jede Wette ein, daß sie mit
Ihnen über den Film sprechen will.« Er schüttelte besorgt den
Kopf. »Sie werden zweifellos einige Phantasie aufbringen müssen,
um das Mädchen von der Harmlosigkeit dieses Filmes zu überzeu-
gen. Ich habe ihn gesehen. Meiner Ansicht nach haben Sie mit den
Aufnahmen von ihr etwas zuviel des Guten getan.«
»Das läßt sich doch einleuchtend erklären. Ich habe ihr bereits
anläßlich einer anderen Gelegenheit gesagt, sie sei nur deswegen auf
dem Film, weil ich meine Erinnerungen an Amsterdam mit einer
schönen Frau bereichern wollte.«
»So nennen Sie das«, murmelte Richards. »Ich würde es umge-
kehrt formulieren: Sie haben Ihre Erinnerungen an Barbara Day mit
ein wenig Amsterdam-Hintergrund bereichert.«
Zynisch lächelnd ging er zum Fenster, schob den Vorhang etwas
90

zur Seite und meldete, nachdem er eine Weile hinausgesehen hatte:
»Und hier kommt auch schon der Star Ihres Films höchstpersön-
lich. Und dazu noch in einem Drei-Liter-Rover.« Er ließ die Gar-
dine wieder fallen. »Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich in Rich-
tung Schlafzimmer von der Bildfläche verschwinde?«
Der Gedanke, Richards werde vielleicht Zeuge einer für mich nicht
gerade angenehmen Unterhaltung sein, schien mir wenig verlo-
ckend; aber im Augenblick blieb mir nichts anderes übrig. »Es ist
die Tür gleich links«, erklärte ich ihm kurz angebunden.
»Versuchen Sie, wirklich überzeugend zu wirken«, riet er mir. »Es
ist auch wichtig für uns zu erfahren, ob sie einen Verdacht hegt.«
Ich nickte nur, denn es läutete bereits an der Tür.
Sie hatte sich umgezogen und trug das Kleid, in dem ich sie bei un-
serem ersten Zusammentreffen gesehen hatte. Als ich ihr ins Wohn-
zimmer folgte, schien sie mir jedoch weniger unbeschwert als da-
mals.
»Es tut mir leid, Tim; aber ich bin zeitlich sehr im Druck«, ent-
schuldigte sie sich noch auf dem Wege ins Zimmer. »Als ich von
St. Albans zurückkam, wartete dieser Kriminalbeamte schon wieder
auf mich. Dieses endlose Katz-und-Maus-Spiel ist wirklich unerhört.
Ich habe es satt und bin es müde, immer wieder dieselben Fragen
beantworten zu müssen. Ich muß ihm schon x-mal erzählt haben,
daß ich diesen – wie heißt er doch – ach ja, diesen Ericson nicht
kenne und noch nie von ihm gehört habe. Trotzdem fragt er im-
mer wieder danach.«
Als ich in ihre vor Empörung funkelnden dunkelblauen Augen
sah, mußte ich mich sehr zurückhalten, um sie nicht auf der Stelle
damit zu konfrontieren, daß ich von Vivien Gilmores Telefonanruf
wußte. Wahrscheinlich hielt mich nur der Gedanke, daß Richards
nebenan im Schlafzimmer mithörte, davon ab. Ich wandte mich da-
91

her ziemlich unvermittelt dem Tisch mit den Getränken zu.
»Nehmen Sie doch Platz, Barbara. Was darf ich Ihnen anbieten?«
»Ginger und Ale, wenn Sie so etwas da haben.« Sie sank mit ei-
nem Seufzer der Erleichterung in den Sessel. »War das wieder ein
Tag heute. Erst Vivien, dann dieser fürchterliche Inspektor, dann
Arthur…« Ihre Stimme nahm jetzt eine hellere Klangfarbe an. »Er
hat doch nicht etwa angerufen?«
Während ich mit den Flaschen hantierte, wandte ich ihr den Rü-
cken zu und überlegte dabei, ob ich ihr die Wahrheit sagen sollte.
»Nein«, log ich schließlich, »er hat nicht angerufen.«
»Wenigstens etwas Gutes«, erwiderte sie mit kurzem Lachen. »Viel-
leicht hat er sein Mißtrauen nun endlich aufgegeben.«
Als ich mit den gefüllten Gläsern zurückkam, lächelte sie mich
freundlich an. Ich nahm einen Whisky-Soda und setzte mich in den
gegenüberstehenden Sessel.
»Das ist genau das, was ich im Augenblick brauche«, sagte sie.
»Und jetzt sollte ich wohl lieber darauf zu sprechen kommen, was
ich auf dem Herzen habe.« Sie sah mich unter halbgeschlossenen
Augenlidern aufmerksam an. »Ich habe Ihren Film gesehen, Tim.
Ich meine den, der bei Cordwell gefunden wurde. Die Polizei hat
ihn mir vorgeführt.«
»Ich fürchte, er ist nicht gerade ein Meisterwerk«, antwortete ich
leichthin. »Es war mein erster Versuch, müssen Sie wissen. Ich hatte
die Kamera erst kurz vor meiner Abreise gekauft.«
Ihre Augen wurden größer. »Für einen Anfänger waren die Auf-
nahmen bemerkenswert gut – besonders die von mir.« Sie drehte
den Stiel des Glases zwischen den Fingern und fragte dann rund-
heraus: »Warum sind Sie mir in Amsterdam gefolgt, Tim?«
»Ich Ihnen gefolgt?« wiederholte ich. Daß sie so schnell aufs Ziel
zusteuern würde, hatte ich nicht erwartet und konnte daher nicht
schlagfertig parieren.
»Eine andere Erklärung gibt es wohl kaum. Obwohl der Inspek-
92

tor mich anscheinend nur bei ein oder zwei Szenen erkannt zu ha-
ben scheint, habe ich mich selbst in mindestens sechs weiteren er-
blickt.« Ihre Augen verengten sich. »Ich kann es einfach nicht glau-
ben, daß wir beide rein zufällig zur gleichen Zeit an all diesen ver-
schiedenen Plätzen gewesen sind.«
Es schien mir nicht mehr viel Sinn zu haben, weiter zu leugnen.
»Nun gut«, gab ich zu. »Ich bin Ihnen gefolgt.«
Die Knöchel ihrer Hand traten weiß unter der Haut hervor, als
die Finger sich fester um das Glas preßten. Es dauerte einige Sekun-
den, bis sie fragte: »Warum?«
»Wenn Sie unbedingt darauf bestehen, es zu erfahren« – ich kam
mir bei diesen Worten etwas lächerlich vor –, »der Grund ist ein
sehr einfacher. Sie sind eine äußerst attraktive Frau.«
»Aber warum sind Sie mir dann heimlich gefolgt?« drang sie wei-
ter in mich. »Sie hatten mich doch im Flugzeug kennengelernt. Sie
hätten mich doch ganz einfach bitten können, mit Ihnen auszuge-
hen.«
»Sie hatten mir sehr deutlich zu verstehen gegeben, daß Sie ver-
lobt sind; und ein Wink mit dem Zaunpfahl genügt bei mir.«
Sie lehnte sich entspannt in den Sessel zurück. »Dann haben Sie
also respektvolle Distanz gewahrt«, murmelte sie. »Das klingt bei-
nahe rührend.«
»Und Sie scheinen so eigenartig erleichtert«, erwiderte ich scharf
in dem Bestreben, herauszufinden, ob sie meinen Ausreden Glau-
ben schenkte.
»Ich muß gestehen, daß ich es wirklich bin; ich vermutete näm-
lich, Sie seien so etwas wie ein Privatdetektiv.«
»Ich?« lachte ich laut heraus. »Wie ich Ihnen bereits sagte, bin ich
Ingenieur.«
»Ich weiß auch nicht, wie ich auf diesen Gedanken gekommen
bin. Aber es sind seltsame Dinge geschehen, seit…« Sie machte eine
abwehrende Handbewegung. »Vergessen wir das lieber. Sie sind also
93

kein Privatdetektiv, das ist alles, worauf es wirklich ankommt.«
»So leicht kommen Sie mir jetzt nicht davon«, drängte ich. »Vor
allem nicht, nachdem Sie mich mehr oder weniger beschuldigt ha-
ben, ich hätte Ihnen nachspioniert. Was sind denn das für seltsame
Dinge, die Ihnen zugestoßen sind?«
Sie biß sich auf die Lippen. »Ich hasse es, mir das alles wieder ins
Gedächtnis zurückzurufen.« Sie schloß die Augen. »Ich habe einen
Menschen getötet.«
Ich versuchte, augenblicklich schockiert auszusehen.
Sie öffnete wieder die Augen und sah mich mit aufrichtigem Blick
an. »Es war ein Verkehrsunfall in Amsterdam. Er hieß Leo Salinger.
Es war zwar seine eigene Schuld – das wurde bei der Untersuchung
einwandfrei nachgewiesen –, aber dennoch fühle ich mich nicht
wohler. Ich habe versucht, mit seiner Familie Kontakt aufzuneh-
men, schließlich sogar einen Anwalt beauftragt, seine Verwandten
ausfindig zu machen, aber ohne jedes Ergebnis. Ich stand immer
wieder wie vor einer unübersteigbaren Mauer.«
»Das ist aber seltsam. Er muß doch irgendwelche Verwandten
haben.«
»Tim«, sagte sie plötzlich mit spürbarer Erregung, wobei sie sich
in ihrem Sessel vorbeugte, »was meinen Sie – ob ein Zusammen-
hang zwischen dem Mord an Cordwell und meinem Unfall be-
steht?«
»Ich wüßte nicht, wie es da einen Zusammenhang geben könnte«,
log ich und beobachtete sie dabei genau. »Sie etwa?«
»Ich weiß es nicht, es sei denn, Cordwell und Salinger hätten sich
gekannt. Cordwell war ja schon vorher einmal in Amsterdam gewe-
sen, wie Sie sich erinnern werden.«
»Ja, natürlich. Er erzählte uns doch, man habe ihm damals seine
ganze Habe gestohlen. Worauf wollen Sie hinaus, Barbara?«
»Ach, ich weiß es selbst nicht. Ich bin von allem, was in den letz-
ten Tagen geschehen ist, so durcheinander.« Sie rieb sich mit dem
94

Handrücken über die Stirn. »Können wir nicht von etwas anderem
sprechen?«
»Wie wäre es mit noch einem Drink?«
Barbara warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. »Danke, es geht
nicht mehr. Ich muß mich jetzt verabschieden. Vivien und ich müs-
sen ein paar Möbelstücke nach Surrey bringen. Man erwartet uns
dort um neun Uhr.«
»Machen Sie denn niemals Feierabend?« fragte ich und versuchte,
dabei nicht allzu neugierig zu erscheinen. »Bis jetzt ist es mir noch
nie gelungen, sie länger als ein paar Minuten festzuhalten.«
Barbara bemühte sich, leicht zerknirscht auszusehen, während ich
mein Klagelied weitersang: »Da war unser allererstes Rendezvous…«
Ich ließ den Satz bewußt unvollendet in der Hoffnung, sie würde
mir irgendeinen Anhaltspunkt geben, über den ich auf mein eigent-
liches Ziel zusteuern konnte.
Sie schauderte. »Dieser entsetzliche Abend. Und ich hatte mich
so darauf gefreut.«
»Etwas wollte ich Sie eigentlich schon lange fragen«, begann ich
ganz beiläufig, während ich aufstand und mit den beiden leeren
Gläsern zum Getränketisch hinüberging. »Ich habe mich schon
mehrfach gefragt, warum Sie mich an jenem Abend eingeladen hat-
ten, Barbara.«
»Aber das habe ich Ihnen damals doch gesagt – damit Sie meinen
Verlobten kennenlernen sollten.«
Ich ging zu ihrem Sessel und blickte auf sie hinab. »Barbara – wir
beide wissen, daß Fairlee fast psychopathisch eifersüchtig ist. Mei-
nes Erachtens hätte Ihnen viel mehr daran gelegen sein müssen, ihn
auf keinen Fall mit einem anderen Mann zusammenzubringen, den
Sie im Urlaub kennengelernt hatten.«
»Aber das ist es ja gerade«, erwiderte sie sehr ernst. »Ich hatte nun
einmal den Fehler gemacht, Sie in meinem Bericht über den Ur-
laub zu erwähnen. Hätte ich Sie danach nicht in meine Wohnung
95

eingeladen, wäre er bestimmt auf den Gedanken gekommen, zwi-
schen uns habe mehr als eine zufällige Bekanntschaft bestanden.«
»Das wäre er allerdings, da haben Sie recht«, pflichtete ich ihr bei.
Sie stand auf und zog ihre Jacke zurecht. »Ich bin so froh, daß wir
uns ausgesprochen haben, Tim. Das Gefühl, Ihnen nicht trauen zu
können, war mir sehr zuwider.«
»Und tun Sie es jetzt?«
Ihre Augen wurden feucht. »Sie wissen, daß ich es tue«, antwor-
tete sie sanft.
Sie stand jetzt dicht vor mir, das Gesicht zu mir erhoben. Als ich
unwillkürlich eine Bewegung auf sie zu machte, hielt sie abwehrend
eine Hand gegen meine Brust. »Tim, warum haben Sie mich nach
dem Grund meiner Einladung gefragt?«
Ich lächelte sie an. »Das ist jetzt alles klargestellt, Barbara.«
»Und Sie hegen mir gegenüber keinen Argwohn?«
In diesem Augenblick war alle Vernunft wie fortgeblasen. »Arg-
wohn? Ihnen gegenüber? Aber natürlich nicht! Warum sollte ich?«
Ihre Hand fiel müde herab, und sie seufzte tief. »Alle scheinen
nämlich argwöhnisch zu sein.«
Als ich auf ihren lackschwarzen Schopf blickte, der sich dicht un-
ter meinem Kinn befand, überfiel mich ein fast überwältigendes Ge-
fühl, dieses glänzende seidenweiche Haar zu streicheln. Dann aber
fiel mir Richards ein. Ich trat einen Schritt zurück. »Sie dürfen Vi-
vien nicht warten lassen«, mahnte ich mit leicht gekünsteltem La-
chen.
Einen Augenblick sah sie mich verwirrt an, dann lächelte sie.
»Danke, Tim. Ich hatte es völlig vergessen.«
Der Zauber war gebrochen. Als ich sie hinausgeleitete, waren wir
wieder zwei normale Menschen, die nach einem kurzen Drink kon-
ventionelle Redensarten wechseln.
Bei meiner Rückkehr ins Wohnzimmer spritzte Richards gerade
Soda in seinen Whisky. »Tut mir leid, daß ich Ihre Gastfreund-
96

schaft so ausnutze, aber die Zunge hing mir schon zum Halse
'raus.«
»Mir auch«, stimmte ich ihm lachend zu und hoffte, daß es nicht
allzu verlegen klang. »Daß Miß Day keinen zweiten Drink wollte,
verdarb mir völlig das Konzept.«
»Das habe ich mir gedacht«, entgegnete er trocken. »Übrigens,
ehe ich es vergesse – hier ist der Tulpenkatalog, nach dem Sie ge-
fragt hatten.« Er holte ihn aus der Jackentasche und reichte ihn
mir.
Ich blätterte den Katalog flüchtig durch. »Hoffen wir, daß meine
Vermutung mich nicht trügt.« Ich schlenderte wieder zum Geträn-
ketisch. »Was halten Sie von der ganzen Sache?«
Er stand breitbeinig mitten im Raum. »Darf ich Ihnen einen un-
eigennützigen Rat geben, Frazer?«
Während ich die Whiskyflasche entkorkte, fragte ich: »Sie wollen
mir raten, ich soll nicht Beruf und private Gefühle miteinander ver-
mengen, nicht wahr?«
»So etwas Ähnliches.«
Warum mußte der Bursche sich stets so schulmeisterlich auffüh-
ren, dachte ich verärgert, wobei ich mir, ohne es zu merken, einen
doppelten Whisky eingoß. Dann hob ich das Glas und prostete
ihm lächelnd zu.
Er sah mich nachdenklich an und fragte ganz ruhig: »Aber sie
können ja gut auf sich aufpassen, nicht wahr, Frazer?«
»Das kann ich, Richards.«
»Das haben andere Leute auch schon gesagt.« Er kippte den Whis-
ky mit einem Ruck hinunter. »Vielleicht auch Leo Salinger. Wer
weiß?«
97

16
ach dem Frühstück am folgenden Morgen zündete ich mir ei-
ne Zigarette an und blätterte den Tulpenkatalog durch, Seite
für Seite. Ich konnte nichts finden, was als verschlüsselte Botschaft
deutbar war, keine unterstrichenen Buchstaben, die die Grundlage
eines Geheimkodes hätten sein können. Der Katalog unterschied
sich in nichts von anderen seiner Art.
N
N
Dann studierte ich systematisch die Namen aller Tulpen: Flamin-
go, Schneesturm, Sammetkönig, Blauer Diamant
und andere exotische
Bezeichnungen waren phantasievoll gewählt worden, um dem Tul-
penliebhaber das Geld aus der Tasche zu locken. Ich hätte eine
zweifarbige Kollektion von 50 Tulpen zu elf Schilling und sechs
Pence haben können – wenn ich Besitzer eines Gartens gewesen
wäre. Aber ich hatte keinen, dafür jedoch eine Ahnung, daß es ir-
gendwo in London jemanden gab, für den die Tulpen auf dem Ein-
banddeckel keineswegs so farbenfroh blühen würden, wenn ich ihm
den Katalog präsentieren könnte.
Als Mrs. Glover den Frühstückstisch abräumte, fragte sie mit der
unschuldigsten Miene, die ihre brennende Neugier tarnen sollte:
»War die Dame, die gestern abend hier war, dieselbe, die heute früh
angerufen hat, Mr. Frazer?«
»Sie sollten besser mit der Zeit gehen, Mrs. Glover. Heutzutage
benutzen auch Männer Parfüm.« Dann spielte ich den Überrasch-
ten. »Hat sie nicht ihren Namen genannt?«
Widerwillig kehrte Mrs. Glover von den Höhen ihrer Entrüstung
auf die Erde zurück. »Sie fragte nur, ob Sie da sind. Als ich sagte:
›Der Herr ist nicht zu Hause‹, hat sie gleich aufgehängt.« Mrs. Glo-
ver setzte wieder ein harmloses Lächeln auf. »Ob es vielleicht je-
98

mand von der weiblichen Kriminalpolizei war, Sir?«
Ich erklärte ihr mit feierlicher Miene, es sei die Kriminalbeamtin
gewesen, die mir Judo beibringe. Wir beschlossen dann, das Frage-
und-Antwort-Spiel unentschieden ausgehen zu lassen. Ich holte den
Wagen aus der Garage, um damit zur Lennard Street zu fahren.
Nachdem ich ihn in einer Seitenstraße geparkt hatte, ging ich ei-
ligen Schrittes zur Espressobar Der Deich.
Es schien, als habe die Zeit stillgestanden, seit ich das erste Mal
dort gewesen war. Der einzige Gast, am selben Tisch und im selben
grünen Kleid wie am Tage zuvor, war Vivien Gilmore. Nur stand
heute ein Mann statt der faden Serviererin hinter der Theke. Er war
klein und gedrungen; das schwarze Haar wuchs ihm bis in die Stirn.
Seine Augen lagen tief unter buschigen Brauen. Sein fleischiger
Hals zeigte bereits den ›Fünf-Uhr-nachmittags‹-Bartwuchs.
Als ich eintrat, rief Vivien Gilmore ihm gerade zu: »Meine Rech-
nung bitte, Jan.«
Ich ging zu ihrem Tisch hinüber und blieb, eine Hand auf der
Stuhllehne, einen Augenblick zögernd stehen. »Guten Morgen, Miß
Gilmore.«
Sie blickte reserviert zu mir auf. »Oh, guten Morgen«, antwortete
sie und verzog das Gesicht auf eine Weise, die ihrer Ansicht nach
wohl ein freundliches Lächeln darstellen sollte. »Wollen Sie nicht
Platz nehmen?«
Ich zog mir einen Stuhl heran, während Jan mit der Rechnung
kam. »Wieder schönes Wetter heute, Miß Gilmore«, sagte er mit
stark holländischem Akzent. Obgleich ich zur Seite blickte, merkte
ich aus der Richtung seiner Stimme, daß er mich einer genauen
Prüfung unterzog. Als ich dann aufsah, strich er gerade mit seiner
muskulösen, behaarten Hand das Geld ein, das Vivien Gilmore auf
den Tisch gelegt hatte.
»Einen Kaffee, bitte«, bestellte ich und sah ihm dabei plötzlich
fest in die Augen. »Wollen Sie nicht eine Tasse mit mir trinken,
99

Miß Gilmore?«
»Ich bin gerade im Begriff zu gehen«, antwortete sie und ließ die
Handtasche zuschnappen. »Schönen Dank für die Einladung.«
Nachdem er noch einen weiteren abschätzenden Blick auf mich
geworfen hatte, ging Jan wieder hinter seinen Schanktisch.
»Kommt Barbara heute nicht?« fragte ich Vivien.
»Ich fürchte, nein, wir haben so viel zu tun.« Sie zog sich einen
Handschuh über. »Zu allem Überfluß ist die Polizei heute früh
schon wieder in unserem Laden gewesen.«
Ich schnalzte mitfühlend mit der Zunge.
»Ich habe schon viel über Mordfälle, polizeiliche Untersuchun-
gen und Vernehmungen gehört«, fuhr sie fort. »Aber selbst bei aller
Phantasie hätte ich es mir so nicht vorgestellt!« Sie zuckte aus-
drucksvoll mit den Schultern. »Dieser Inspektor ist anhänglich wie
ein Terrier. Der würde bedenkenlos jede Art von Folterung anwen-
den, wenn er damit die ihm genehmen Antworten herauspressen
könnte. Woher soll ich beispielsweise wissen, ob Cordwell Verabre-
dungen mit einem gewissen Margetson gehabt hat.«
Ich kratzte nachdenklich mein Kinn. »Wie war der Name? Ich
dachte, er laute Ericson.«
»Ja, natürlich – Ericson.« Sie sah mich einen Augenblick aus-
druckslos an. »Der Name sagt mir gar nichts. Ich habe ja auch nie
etwas von Cordwell gehört, bevor ich diesen Namen in den Zeitun-
gen las. Woher sollte ich wissen, daß er eine Verabredung mit…«
»Ericson«, ergänzte ich.
»Ach, was geht mich dieser Name an. Man soll mich doch damit
in Ruhe lassen.« Sie stand auf. »Jetzt muß ich aber wirklich gehen.«
Ich erhob mich ebenfalls. »Übrigens, Miß Gilmore – Sie haben
mich heute früh nicht zufällig angerufen?«
»Was für eine seltsame Frage«, entgegnete sie ärgerlich und sah
mich dabei auf eine fast beleidigende Weise an. »Ich kenne Sie ja
kaum.«
100

»Genausowenig wie ich Sie«, antwortete ich lächelnd. »Die Dame,
die angerufen hat, nannte ihren Namen nicht, und meine Putzfrau
hat die Stimme nicht erkannt… Ich habe zufällig ein sehr gutes Ge-
hör für Stimmen, Miß Gilmore«, füge ich hinzu. Dabei sah ich sie
fest an und rief mir den Augenblick ins Gedächtnis zurück, in dem
ich ihr durchdringendes Organ zum erstenmal gehört hatte – am
Telefon in Barbaras Wohnung.
Sie hielt meinem Blick ein bis zwei Sekunden stand, ohne auf
meine Bemerkung zu antworten. Dann erwiderte sie mit hartem Lä-
cheln: »Ich darf Barbara nicht warten lassen, Mr. Frazer.« Sie wech-
selte einen schnellen Blick mit Jan und stolzierte aus der Bar.
Ich setzte mich und sah vorsichtig zu dem Mann hinter der The-
ke hinüber. Er hatte gerade meine Kaffeetasse aus der Espressoma-
schine gezogen und war im Begriff, sie mir zu bringen. Ich nahm
den Tulpenkatalog und blätterte langsam eine Seite nach der ande-
ren um, als suchte ich mir die schönsten Sorten aus.
Als er mir den Kaffee auf den Tisch stellte, hielt ich den Katalog
so, daß er den leuchtendbunten Deckel unmittelbar vor Augen
hatte.
»Danke«, sagte ich, als er die Tasse auf den Tisch stellte, und
blickte nur flüchtig auf.
Seine Augen wanderten unruhig zwischen dem Katalog und mei-
nem Gesicht hin und her. Dann faßte er sich nachdenklich mit ei-
ner Hand unter das Kinn.
»Interessieren Sie sich für Tulpen, Jan?« fragte ich mit bedeu-
tungsvoller Miene.
Seine Hand kratzte an seinem stoppeligen Kinn. »Wann sind Sie
angekommen?« fragte er.
»Sie haben meine Frage nicht beantwortet«, erwiderte ich kühl.
Er sah mich lange und gedankenversunken an, nickte dann mehr
für sich selbst als für mich und ging zur Theke zurück. Dort sah er
unter den Tisch, holte etwas hervor, kam wortlos zu mir zurück und
101

ließ den Gegenstand auf meinen Tisch gleiten. Es war ein Tulpen-
katalog von genau der gleichen Art, wie Cordwell ihn bei sich ge-
habt hatte…
Sein klobiger Finger wies auf einen auf den Umschlag geklebten
Zettel. »Das hier ist ein neuer«, bemerkte er schwerfällig. »Er ist auf
dem neuesten Stand.«
Auf dem Zettel stand: Internationale Tulpenzwiebel-Importeure. Lon-
doner Vertreter: Gordon Dempsey, 43a Long Acre, E.C.4.
Als ich die Espressobar mit beiden Katalogen unter dem Arm ver-
ließ, sauste ich zur nächsten Telefonzelle, um leider festzustellen,
daß ich keine passende Münze hatte. Ein Obstkarren, der vorhin
vor dem Espresso gestanden hatte, parkte jetzt neben der Telefon-
zelle. Ich ging hin und fragte den Händler:
»Würden Sie mir das bitte wechseln? Ich habe leider keine Münze
zum Telefonieren.« Ich reichte ihm ein Six-Pence-Stück.
»Aber selbstverständlich, Chef«, antwortete er mit breitem Grin-
sen. »Hier haben wir es – drei und nochmals drei, macht sechs.«
Als ich ihm dankte, sah er sich vorsichtig um und flüsterte mir
dann zu: »Wollen Sie einen guten Tip, Chef? Dann vergessen Sie
nicht ›Fantasie‹. Zwei-dreißig, bester Tip der Woche, Chef.«
Ich dankte ihm mit einem lächelnden Kopfnicken und ging zur
Telefonzelle zurück. Dort suchte ich mir die Telefonnummer von
Gordon Dempsey heraus und wählte sie. Eine Minute lang lauschte
ich dem ankommenden Rufzeichen. Nachdem sich niemand mel-
dete, legte ich auf. Da es beinahe Mittagszeit war, entschloß ich
mich, zunächst eine Kleinigkeit zu essen und es dann erneut bei
Dempsey zu versuchen.
Als ich die Telefonzelle verließ, grinste mich der Mann am Obst-
karren wieder breit und freundlich an. »Nicht vergessen – ›Fantasie‹,
zwei-dreißig, Chef«, erinnerte er mich. »Da setzen Sie auf Sieg.«
102

Ich winkte ihm dankend zurück und blieb dann nachdenklich
stehen. Grübelnd biß ich mir auf die Lippen – vorher war mir das
nicht bewußt geworden, aber jetzt kam mir doch irgend etwas an
diesem sportlich gewachsenen blonden Mann bekannt vor. Achsel-
zuckend gab ich es auf, weiter darüber nachzudenken. Es war wohl
nur die Tatsache, daß er für einen Obstkarrenhändler einen unge-
wöhnlich gepflegten Eindruck machte.
Ich kehrte zu meinem Wagen zurück, fuhr zur Brompton Road
und parkte ihn in einer Seitenstraße neben der Brompton-Kapelle.
In einer Kneipe, die im Viktorianischen ›Plüsch-mit-Troddeln‹-Stil
ausgestattet war, mit riesigen Wandspiegeln und Mahagonimöbeln,
aß ich ein Kalbssteak mit Kartoffelsalat und trank dazu einen Krug
Bier.
Unterwegs hatte ich mir eine Mittagszeitung gekauft, die ich
schnell überflog, um zu sehen, ob es Neuigkeiten in der Sache
Cordwell gab. Ich fand aber nur eine nichtssagende Meldung, wie
sie gewöhnlich publiziert wird, wenn die Polizei bei ihren Ermitt-
lungen in eine Sackgasse geraten ist. Inspektor Trueman schien in
einer ausweglosen Phase seiner Untersuchungen zu sein.
Aus reiner Neugier überflog ich auch die Seite mit den Rennbe-
richten. Der ›heiße Tip‹ meines Obstkarrenhändlers erwies sich als
Niete, da nirgendwo ein Pferd namens ›Fantasie‹ genannt wurde.
Nach dem Essen fuhr ich in Richtung Long Acre und hielt unter-
wegs zweimal an Telefonzellen an, um Dempsey anzurufen, der sich
aber noch immer nicht meldete. Ich ließ meinen Wagen auf einem
Parkplatz und ging in ein Tageskino, das Wochenschauen und Kul-
turfilme zeigte.
Um fünf Uhr rief ich erneut an. Schon nach dem ersten Klingel-
zeichen wurde der Hörer abgenommen, und eine ölige Stimme
meldete sich: »Internationale Tulpenzwiebel-Importeure.«
Als ich nach dem Namen des Sprechers fragte, bekam ich zur Ant-
wort: »Dempsey am Apparat.«
103

Ich versuchte überzeugend zu wirken, als ich erklärte: »Ich bin
am Kauf von Tulpen interessiert, Mr. Dempsey. Ihre Firma ist mir
von einem guten Freund empfohlen worden.«
Einige Sekunden lang war es still am anderen Ende der Leitung.
Dann fragte die Stimme reserviert: »Wie heißt Ihr Freund?«
»Ericson«, erwiderte ich, wobei meine Hand den Hörer unwillkür-
lich fester faßte.
Ich konnte mir das Kopfnicken vorstellen, als Dempsey in sach-
lichem Ton antwortete: »Verstehe. Und wie ist Ihr Name bitte?«
Das Telefonbuch lag offen unter meinem Ellenbogen. Ich warf ei-
nen schnellen Blick darauf und nannte den ersten Namen, der mir
ins Auge fiel: »Scott – Normann Scott. Sie kennen mich sicher
nicht.«
»Nein, ich kenne Sie nicht.« Dempsey legte eine kurze Pause ein
und fragte dann: »Haben Sie auch einen Katalog?«
»Natürlich«, antwortete ich leichthin. »Sonst hätte ich Sie doch
nicht anrufen können.«
»Geht in Ordnung.« Dempsey schien meine Geschichte ge-
schluckt zu haben.
»Ich bin während der nächsten halben Stunde in meinem Ge-
schäft«, erklärte er kurz entschlossen. »Und vergessen Sie nicht, den
Katalog mitzubringen.«
Ich versicherte ihm, daß ich ihn nicht vergessen würde, und legte
auf.
Es hatte nicht viel Sinn, mit dem Wagen zu fahren und dann in
der Long Acre Street erneut nach einem freien Parkplatz zu suchen.
Deshalb ging ich mit flotten Schritten durch die Nebenstraßen und
befand mich drei Minuten später vor dem Bürohaus von Dempsey.
Es war nicht gerade eindrucksvoll. Ein handgemaltes Schild am
Eingang informierte mich, daß die Firma ›Internationale Tulpen-
zwiebel-Importeure‹ ein Büro im ersten Stockwerk unterhielt. Ich
klomm die enge Holztreppe empor, ging durch einen halbdunklen
104

Flur und gelangte schließlich zu einer Tür, auf deren Milchglasschei-
be die Firmenbezeichnung Internationale Tulpenzwiebel-Importeure, Lon-
don und Hilversum
zu lesen stand.
Auf mein Klopfen antwortete die ölige Stimme, die ich am Tele-
fon gehört hatte: »Herein!«
Ich öffnete und trat in einen Raum, dessen Fußboden mit abge-
tretenem Linoleum belegt war. An den verblichenen und teilweise
feuchten Tapeten hingen kaum weniger verblichene Plakate mit
Landschaften aus Holland sowie ein Kalender, der eine bestimmte
Sorte Kunstdünger anpries. Das gesamte Mobiliar bestand aus ei-
nem Besucherstuhl mit Holzlehne, einem Aktenregal und einem
Schreibtisch. Dahinter saß ein Mann mittleren Alters, der mit of-
fensichtlichem Appetit ein belegtes Brot verzehrte. Sein Gesicht war
rund und farblos wie der Vollmond im Dezember. Das strohfar-
bene Haar war genau über einem Ohr gescheitelt und die wenigen
Haare sorgsam über das sonst kahle Haupt gebürstet.
»Mr. Scott?« fragte er, mit vollem Munde kauend. Ich nickte, und
er machte mit seinem Sandwich eine einladende Bewegung in Rich-
tung auf den einzigen Stuhl. »Haben Sie den Katalog bei sich?«
Ich war so vorsichtig gewesen, den Cordwellschen Katalog im
Wagen zu lassen, holte jetzt den hervor, den ich von Jan in der Es-
pressobar bekommen hatte, und legte ihn auf den Tisch. Dempsey
griff danach, sah sich den Aufkleber genau an und schaute dann
fragend zu mir herüber.
Einen Augenblick lang war ich ratlos. Ich war mir darüber klar,
daß meine nächsten Worte bestimmend für den weiteren Verlauf
der Unterredung sein würden. Darum entschied ich mich, ihm den
Schwarzen Peter zuzuschieben. »Ich habe mich noch nicht ganz
entschlossen, welche Tulpensorten ich…« Mit leichtem Lächeln
hielt ich mitten im Satz inne.
Offensichtlich hatte ich das Richtige gesagt, Dempsey nickte, biß
ein weiteres Stück von seinem Sandwich ab und schnurrte dann
105

eine Liste von Namen herunter, wobei ihm die Krümel aus dem
Munde fielen. »Wir haben Verschiedenes: Piccadilly, Roter Papagei,
Fantasie, Oktavius, Hilversum Rot…«
In diesem Augenblick sah ich den Mann vom Obstkarren vor
mir. Ich schaltete sofort und sagte mit erzwungener Fassung: »Ich
glaube, ich werde ein paar ›Fantasie‹ nehmen.«
Er schluckte die Reste des Brotes hinunter, bohrte mit der Zunge
in einem hohlen Zahn, während er mein Gesicht studierte, und
fragte dann: »Wieviel?«
Mir schien, ich hatte mit der ersten Hälfte des Tips, den mir der
Obsthändler gegeben hatte, auf den Sieger Fantasie gesetzt. Jetzt ver-
mutete ich, daß auch die Zeit des Rennens bedeutsam sein mußte,
und ich antwortete: »Lassen Sie mich mal überlegen … ich möch-
te … ja, sagen wir – zwei-dreißig.«
Dempseys schmaler Mund verzog sich zu einem Lächeln. »In
Ordnung, Mr. Scott«, stimmte er leutselig zu. »Wie wäre es, wenn
wir erst mal eine Tasse Kaffee trinken, bevor wir zum Geschäft
kommen?«
Was mir im Augenblick weit mehr not tat, war ein doppelter
Whisky. Außerdem lag mir viel daran, weitere Fragen zu vermeiden.
»Danke für die freundliche Einladung«, erwiderte ich zögernd, »aber
warum sollen wir Zeit verlieren und jetzt erst noch in ein Restau-
rant gehen?«
»Ich habe immer Kaffee hier im Büro«, antwortete er gut gelaunt,
lehnte sich zurück und zog eine Schublade aus dem Aktenschrank.
»Anweisung vom Arzt. ›Geben Sie Ihrem Magengeschwür immer
etwas zu essen‹, sagte der Doktor. ›Essen Sie stets eine Kleinigkeit
und trinken Sie alle zwei Stunden heißen Kaffee.‹« Er holte zwei
Frühstückstassen ohne Untertassen hervor, dazu eine Thermosfla-
sche, und stellte alles auf den Tisch. »Heiß wie die Hölle, süß wie
die Sünde, nicht wahr, Mr. Scott?« Er lachte glucksend, schraubte
den Deckel von der Thermosflasche und goß die dampfende Flüs-
106
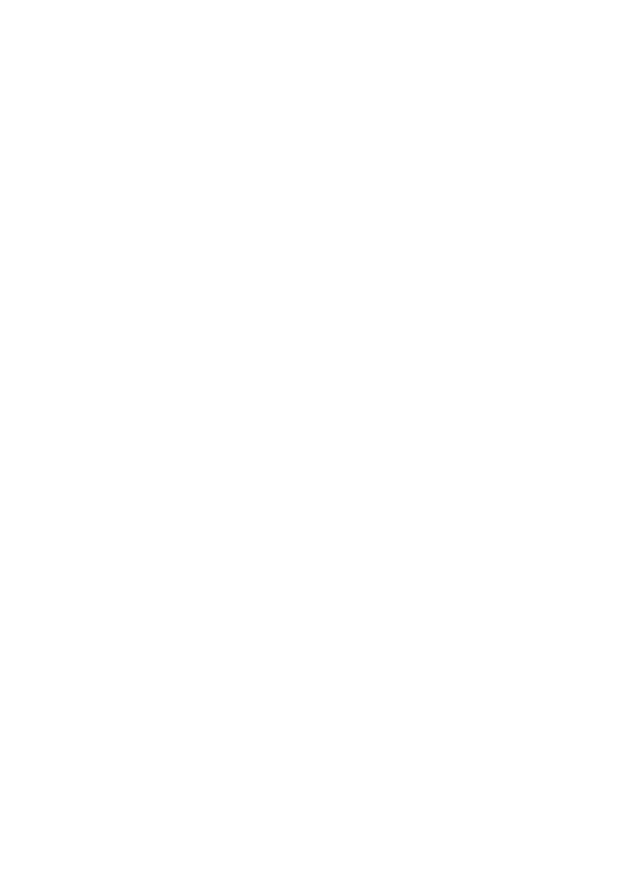
sigkeit in die beiden Tassen. Eine Tasse schob er mir herüber und
sagte: »Und nun können wir zum geschäftlichen Teil übergehen.«
Dempsey holte ein Schlüsselbund aus der Tasche, suchte einen
bestimmten Schlüssel und öffnete damit die Schublade seines
Schreibtisches. Meine Handflächen wurden feucht, während ich ihn
beobachtete.
»Da haben wir es ja!« sprach er, holte einen Gegenstand hervor
und stellte ihn neben die Thermosflasche auf den Tisch.
Das genaue Gegenstück dazu hatte ich neben Cordwells Leiche
liegen sehen… Dempsey schob das buntbemalte Metronom auf sei-
ne Schreibunterlage und sah mich erwartungsvoll an.
Der Tip des Mannes vom Obstkarren hatte das Kaninchen aus
dem Zylinder hervorgezaubert. Jetzt kam ich mir genauso dumm
vor wie die Person aus dem Zuschauerraum, die nach Aufforderung
des Zauberkünstlers auf die Bühne gekommen war, um sich den
Trick aus nächster Nähe abzusehen. Ich fügte mich in die Rolle des
passiven Mitspielers und zeigte ein nichtssagendes Lächeln.
Wie sich eine Wolke über den Mond schiebt, so verschwand
langsam das wohlwollende Grinsen von Dempseys Gesicht. »Nun,
Mr. Scott…«, forderte er mich auf.
In diesem Augenblick läutete das Telefon. Ohne mich aus den
Augen zu lassen, griff er nach dem Hörer. »Internationale Tulpen-
zwiebel-Importeure«, meldete er sich.
Der Teilnehmer am anderen Ende vergeudete keine Zeit mit lan-
gen Vorreden. Ich konnte kein Wort des Redeschwalles auffangen,
merkte aber, daß es eine Frauenstimme war. Dempsey lauschte mit
zunehmender Spannung, die sich in seinen zusammengepreßten
Lippen äußerte. Jetzt wußte ich, daß die angespannte, drängende
Stimme in der Leitung ihn vor mir warnte. Ganz nebenbei glaubte
ich im Klang dieser Stimme etwas Vertrautes zu entdecken.
Während des Telefongesprächs setzte ich eine gelangweilte und
uninteressierte Miene auf, wie man das so zu tun pflegt, wenn die
107

Person, mit der man sich gerade unterhalten hat, einen Telefonan-
ruf entgegennimmt. Doch wußte ich, daß ich mich so nicht aus der
Affäre ziehen konnte.
Ein plötzliches Klicken im Hörer zeigte an, daß der Anrufer auf-
gelegt hatte. Mit finsterer Entschlossenheit legte Dempsey den Hö-
rer auf die Gabel.
Während ich mich leicht vom Stuhl erhob, berechnete ich mit
bis zum Zerreißen angespannten Nerven die Entfernung bis zur
Tür.
»Einen Augenblick noch, Mr. Scott…!« rief Dempsey drohend.
»Oder sollte ich besser Mr. Frazer sagen?« Mit einem Ruck hatte er
die mittlere Schublade aufgezogen, und bevor ich noch die Chance
hatte, meinen Stuhl zu verlassen, blickte ich in die Mündung einer
Pistole.
Meine Lippen waren trocken vor Erregung; doch gelang es mir,
ein schwaches Lächeln vorzutäuschen. »Sie sind heute aber wirklich
nicht auf der Höhe, Dempsey. Der Sicherungshebel ist ja noch um-
gelegt.«
Seine Augen wanderten zur Sicherung der Waffe. Im selben Mo-
ment griff ich nach der Kaffeetasse vor mir und schüttete ihm blitz-
schnell den heißen Inhalt ins Gesicht. Er stieß einen kurzen Schmer-
zensschrei aus, ließ die Pistole fallen und griff sich ins Gesicht. Ich
fegte die Waffe vom Tisch auf den Fußboden, schnappte mir das
Metronom und rannte aus dem .Zimmer.
108

17
ls ich auf die Straße trat, stieg gerade ein Fahrgast aus einem
Taxi. Ich nahm schnell seinen Platz ein und fuhr zu dem Park-
platz, wo ich meinen Wagen abgestellt hatte.
A
A
Von dort kehrte ich dann zur Lennard Street zurück. Ich wollte
unbedingt den Mann am Obstkarren noch erwischen, bevor er ein-
packte und nach Hause fuhr, denn ich wußte jetzt, was mir heute
früh so bekannt an ihm vorgekommen war, als ich ihn zum ersten-
mal gesehen hatte. In dem Augenblick, als Dempsey die Pistole ge-
zückt hatte, war eine ganze Kette von Erinnerungsbildern vor mir
abgerollt: Auch dabei sah ich in die Mündung einer Pistole, erhielt
einen Schlag auf den Hinterkopf, kam langsam wieder zum Be-
wußtsein und sah aus dem Augenwinkel die gutgekleidete Gestalt
eines blondhaarigen Mannes eine Notiz in mein Zigarettenetui
schieben… Nun war ich ganz sicher, daß der Obsthändler und der
Mann, der die Notiz für mich hinterlassen hatte, identisch waren.
Als ich in die Lennard Street einbog, glaubte ich schon, ich hätte
ihn verfehlt. Dann aber sah ich seinen Karren am anderen Ende der
Straße stehen. Ich bremste unmittelbar dahinter, stieg aus und ging
auf den Mann zu.
Er hatte mir den Rücken zugewandt, als ich ihn ansprach: »Schö-
nen Dank für den Tip, er hat sich bezahlt gemacht.«
Als er sich umdrehte, schaute ich in ein fremdes, bleiches Ge-
sicht.
»Was sagst du, Kumpel? Verwechselst mich wohl mit jemandem?«
»Oh, tatsächlich«, antwortete ich lachend. »Ein Pfund Äpfel bit-
te.«
Er sah mich an, als wäre ich betrunken, kam dann wohl doch zu
109

dem Schluß, daß dies nicht der Fall war, legte vier Äpfel in eine
Tüte, reichte sie mir und sagte: »Macht dreißig Cent, Chef.«
Ich holte eine Fünfpfundnote aus der Brieftasche. »Wo ist der an-
dere Bursche, der heute früh hier bediente?« fragte ich.
»Ach, der hat seinen freien Nachmittag«, antwortete er. Dann
kratzte er sich hinter dem Ohr. »Haben Sie es nicht kleiner?«
»Wegen des Wechselgeldes brauchen Sie sich keine Sorgen zu ma-
chen«, redete ich ihm zu, während ich mit der Banknote vor seiner
Nase wedelte. »Sie brauchen mir nur zu sagen, wo der andere Mann
ist.«
»Wofür halten Sie mich?« fragte er mißtrauisch. »Verschwinden
Sie, aber schnell.«
Ich zeigte ihm eine alte Geschäftskarte und überzeugte ihn
schließlich, daß der andere ein ehemaliger Schulkamerad von mir
gewesen sei. Da rückte er endlich mit der Sprache heraus.
»Da ist nicht viel zu erzählen. Der Mann kam und gab mir zehn
Pfund, wenn ich ihm für ein paar Stunden den Karren leihen wür-
de. Er sei Schriftsteller, sagte er, und wolle ein Buch schreiben, in
dem auch etwas über Straßenhändler vorkommt. Hab' mich schon
gewundert, was er wohl anstellen würde, und bin deshalb immer in
seiner Nähe geblieben. Er hat sich überhaupt nicht bemüht, etwas
zu verkaufen. Dann habe ich heute früh gesehen, wie er mit Ihnen
gesprochen hat.« Er wischte sich die Nase mit dem Jackenärmel.
»Das ist alles, Chef.«
»Werden Sie ihn wiedersehen?«
»Weiß nicht. Vielleicht in der Eckkneipe. Dort ist er während der
letzten Abende immer gewesen…«
»Wenn Sie ihn sehen, geben Sie ihm diese Karte.«
Ich reichte ihm meine Geschäftskarte mit der Fünfpfundnote.
»Meine Telefonnummer steht drauf. Sagen Sie ihm, er möchte
mich anrufen.«
»Wird gemacht!« Er steckte das Geld in die Jackentasche und
110

grinste mich zufrieden an. »Donnerwetter! Meine Alte wird mir
kein Wort davon glauben.«
Als ich mit meinem Wagen aus der Lennard Street in eine andere
Straße einbog, sah ich einen schlanken Mann mit steifem Hut am
Bordstein stehen. Ungeduld und Verärgerung spiegelten sich auf
seinem Gesicht, denn sein Winken mit dem Regenschirm nach ei-
nem der besetzten Taxis hatte nicht den geringsten Erfolg. Ich fuhr
an den Bürgersteig heran und bremste.
»Soll ich Sie mitnehmen, Fairlee?« rief ich ihm durch das offene
Fenster zu. »Zu dieser Tageszeit werden Sie kein freies Taxi erwi-
schen.«
Er blinzelte etwas verdattert, dann erkannte er mich und lächelte.
»Ach, Sie sind es, Frazer. Es wäre wirklich nett von Ihnen, wenn Sie
mich an der Ecke Hydepark absetzen könnten.«
Entgegen der Wahrheit versicherte ich ihm, ich führe in diese
Richtung, und langte hinüber, um ihm die Wagentür zu öffnen.
»Da bin ich Ihnen wirklich dankbar, alter Junge«, erklärte er, wäh-
rend er neben mir Platz nahm. »So ein Zufall, daß Sie gerade hier
vorbeikamen.« Aus der verschlagenen Art, in der er das sagte, ent-
nahm ich, daß er mich aushorchen wollte.
»Wirklich ein großer Zufall«, bestätigte ich. »An sich bin ich hier
nur durchgefahren, um dem dichtesten Verkehr auszuweichen.« Ich
schleuste meinen Wagen wieder in den Fahrzeugstrom. »Diese Ab-
kürzung muß ich mir für die Zukunft merken.«
Natürlich hatte ich ihm nicht aus purer Nächstenliebe die Mit-
fahrt angeboten. Ich war mindestens genauso neugierig, zu erfah-
ren, was ihn in die Lennard Street geführt hatte, wie er darauf brann-
te, zu wissen, was ich in dieser Gegend tat. »Sie kommen wohl ge-
rade vom Antiquitätenladen?« leitete ich die Konversation ein.
»Ja, aber ohne Erfolg«, gab er zu. »Ich wollte mit Barbara über
den Besuch sprechen, den der Kriminalbeamte mir heute nachmit-
tag abgestattet hat. Leider war sie nicht da.«
111

»Das ist natürlich Pech«, murmelte ich und erkundigte mich bei-
läufig, was Trueman denn nun schon wieder gewollt habe.
»In seinem Kopf hat sich der Gedanke festgesetzt, ich könnte ihm
Auskunft über einen Mann namens Ericson geben.«
»Und können Sie das?«
»Nein, natürlich nicht; ich habe nie von diesem Burschen ge-
hört!« Er brachte das so leidenschaftlich hervor, daß ein kurzer
Asthmahusten die Folge war. Als er ihn überwunden hatte, fragte
er: »Hat er Sie auch über Ericson befragt?«
»Ja, er wollte auch von mir wissen, ob ich ihn kenne.«
Fairlee schien noch erregter, als er fortfuhr: »Vivien erzählte mir,
er sei auch bei ihr wieder gewesen. Es ist mir einfach rätselhaft, wa-
rum er so steif und fest davon ausgeht, daß wir alle etwas über die-
sen Ericson wissen.«
»Wir alle?« fragte ich scharf. »Wie meinen Sie das, Fairlee?«
»Na, das ist doch so!« erwiderte er. »Er meint Sie, mich, Barbara,
Vivien … er traut doch keinem von uns. Seltsame Zustände sind
das, wenn ein angesehener Börsenmakler es sich gefallen lassen
muß, immer wieder auf unwürdige Weise von so einem idiotischen
Polizisten verhört zu werden! Noch dazu in Zusammenhang mit ei-
nem Mordfall!«
Bis zu dem Zeitpunkt, als wir den Hydepark erreichten, mußte
ich einem Monolog über den untadeligen Lebensweg des Arthur
Fairlee lauschen. Als ich ihn schließlich verabschiedete, fragte ich
mich, ob Barbara auch nur im entferntesten ahnte, worauf sie sich
mit dieser Verlobung eingelassen hatte.
Eine Stunde später, als ich Barbara Day in einer kleinen Bar gegen-
übersaß, mußte ich wieder darüber nachdenken, wie unvorstellbar
es war, daß ein so attraktives Persönchen mit einem Mann wie Fair-
lee verlobt war. Sie selbst hatte gefragt, ob wir uns nicht zu einem
112

schnellen Drink treffen könnten. Ihre Stimme hatte am Telefon
sehr aufgeregt geklungen.
Als ich ihr Feuer für ihre Zigarette gab, sagte ich mit leichter Bit-
terkeit: »Ein Drink auf die Schnelle, so en passant – wie immer bei
uns, nicht wahr, Barbara?«
»Es tut mir wirklich leid, Tim.« Impulsiv faßte sie meine Hand,
zog die ihre aber schnell wieder zurück. »Aber ich muß Vivien auf
jeden Fall in einer halben Stunde treffen. Ich bin seit Mittag nicht
mehr im Geschäft gewesen.« Ihr Gesicht umwölkte sich. »Deshalb
wollte ich Sie übrigens auch sprechen, Tim … wegen dem, was heu-
te nachmittag geschehen ist.«
Ich fingerte am Stiel meines Glases herum. »Was ist denn pas-
siert?«
»Heute mittag fuhr ich nach Haus, um mich umzuziehen. Ich
hatte mir etwas Kaffee auf mein Kleid gegossen. Da ich in Eile war,
achtete ich zunächst nicht besonders auf meine Umgebung. Dann
fiel mir aber doch auf, daß einige Dinge nicht an ihrem gewohnten
Platz lagen, so daß ich sie in der ganzen Wohnung suchen mußte.
Eine Schublade meines Schreibtisches war nicht geschlossen, und
die Küchentür stand offen, obwohl ich genau weiß, daß ich sie heu-
te früh zugemacht hatte…« Ihre Augen suchten meinen Blick. »Ir-
gend jemand hat meine Wohnung durchsucht, Tim.«
»Wurde etwas gestohlen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Das ist es ja gerade, was mich so ver-
wirrt. In der Schreibtischschublade befand sich etwas Geld, und auf
meinem Frisiertisch lagen einige Schmuckstücke. Sie sind zwar nicht
besonders kostbar, aber ein Dieb hätte sie bestimmt nicht liegen
lassen.«
»Es sieht ganz so aus, als habe der Eindringling in Ihrer Woh-
nung etwas ganz Bestimmtes gesucht«, sagte ich. »Vielleicht Briefe,
oder ein bestimmtes Dokument – haben Sie in dieser Richtung kei-
nen Anhaltspunkt?« Ich sah sie fragend an.
113

»Aber ich besitze doch nichts, was möglicherweise zu…« Sie hielt
plötzlich den Atem an. »Denken Sie an etwas, was man benutzen
könnte, um mich zu erpressen?«
»So habe ich es nicht gemeint, Barbara«, beschwichtigte ich sie.
»Ich wollte damit nicht andeuten, daß Sie…«
»Natürlich wollten Sie das nicht, Tim«, erwiderte sie freundlich.
Dann aber veränderte sich ihr Gesichtsausdruck, und sie sagte mit
gerunzelter Stirn: »Cordwell war ein Erpresser.«
Fast brach ich den Stiel meines Glases entzwei. »Woher wissen Sie
das?« fragte ich ungläubig.
»Sobald ich die Gewißheit hatte, daß jemand in meine Wohnung
eingedrungen war, hielt ich es für besser, Inspektor Trueman anzu-
rufen. Er kam auch bald, schien aber nicht besonders interessiert an
dem, was ich ihm zu berichten hatte, und erzählte mir dann aus
unerfindlichem Grunde, daß Cordwell ein Erpresser gewesen sei.«
Ich legte die Stirn in Falten. »Das sieht dem Inspektor so gar nicht
ähnlich, jemandem Informationen zu geben.«
»Er hat mich dabei auch so seltsam angesehen; mir schien, er
wollte auf etwas anspielen, was mit Cordwells Erpressertätigkeit zu-
sammenhing.« Ihre Lippen begannen zu zittern. »Ich hatte das
schreckliche Gefühl, er wollte andeuten, daß Cordwell und ich…«
Sie zögerte.
»Daß Sie beide einer Erpresserbande angehörten?« Ich schüttelte
lachend den Kopf. »Trueman ist ein typischer Kriminalbeamter. Er
wird stets versuchen, den anderen in die Defensive zu treiben. Was
hat er denn sonst noch wissen wollen?«
»Ob Cordwell tatsächlich Zigarren geraucht hat.«
»Sehr stark duftende Zigarren sogar, wenn ich mich recht erin-
nere, damals im Restaurant de Kroon«, erwiderte ich. Plötzlich kam
mir zum Bewußtsein, wie komisch die Frage des Inspektors war.
»Was wollte er denn damit erfahren? Hat er Ihnen nicht gesagt, wa-
rum er das wissen wollte?«
114

»Er erzählte nur, die Polizei habe Cordwells Hotelzimmer in der
Cromwell Road durchsucht und dabei mehrere Kisten Zigarren ge-
funden. Volle Kisten.« Sie zuckte mit den Schultern. »Ich habe kei-
ne Ahnung, warum er glaubt, das würde mich interessieren oder in
Verlegenheit bringen. Er schien zu erwarten, daß ich nach Kenntnis
dieser Information zusammenbrechen und ein Geständnis ablegen
würde.«
»Jetzt gehen Ihnen aber wohl doch die Nerven durch, Barbara!
Sie sollten Ihrer Phantasie nicht so viel freien Lauf lassen.« Wäh-
rend ich dies sagte, überlegte ich krampfhaft, was Trueman mit die-
ser Mitteilung bezweckt haben mochte. »Ich bin trotzdem froh,
Barbara, daß Sie mich unterrichtet haben. Sie wissen doch, daß Sie
mit allem Kummer zu mir kommen können.«
»Ja, das weiß ich«, erwiderte sie. Sie senkte den Blick, zögerte eine
Weile und spielte dann an Ihrem Glas.
»Nun kommen Sie schon heraus mit der Sprache. Sie haben doch
noch etwas auf dem Herzen«, ermunterte ich sie.
»Ach, ich frage mich nur, warum ich eigentlich Arthur nicht an-
gerufen habe, als das alles abrollte.«
»Und warum nicht, Barbara?«
»Ich weiß es selbst nicht. Es ist mir gar nicht in den Sinn gekom-
men. Ich dachte nur an Sie…« Jetzt sah sie mich forschend an. »Ich
griff einfach nach dem Telefon und wählte Ihre Nummer.«
In diesem Augenblick konnte ich mir Richards' spöttisches La-
chen vorstellen. »Da Sie gerade von Arthur sprechen«, unterbrach
ich sie, »ich traf Ihren Verlobten, kurz bevor Sie anriefen, und nahm
ihn in meinem Wagen bis zum Hydepark mit.«
»Sie haben ihn getroffen? Wo denn?«
»An der Ecke Lennard Street.«
»Ich hatte erwartet, daß er in meinen Laden kommen würde. Wie
gut, daß ich nicht da war; so blieben mir wenigstens seine endlosen
Tiraden darüber erspart, wie die Publizität um die Cordwell-Affäre
115
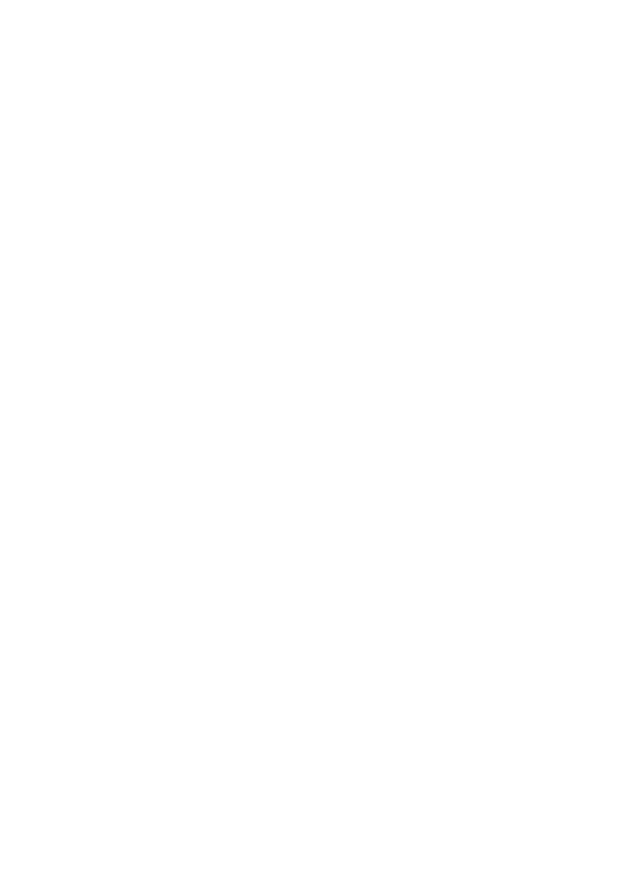
sein Geschäft ruiniere. Er denkt doch nicht einen Augenblick da-
ran, wie sehr ich von all den Geschehnissen geplagt werde.«
»Wenn ich ihn recht verstanden habe, hat Inspektor Trueman ihn
schon wieder aufgesucht, um ihn erneut nach Ericson zu fragen.«
»Ich kann diesen Namen nicht mehr hören«, murmelte sie.
»Fairlee erzählte mir, die Polizei habe selbst Vivien Gilmore nach
Ericson befragt«, berichtete ich weiter und beobachtete sie dabei
sehr genau. »Hat sie den Namen jemals Ihnen gegenüber erwähnt?«
»Nur als sie mir erzählte, daß Trueman sie danach gefragt hätte.«
Barbara runzelte die Stirn. »Tim, Sie glauben doch nicht etwa, daß
Vivien diesen Ericson kennt?«
Ich lächelte ironisch. »Sollte es so sein, würde sie es mir am we-
nigsten anvertrauen.«
Sie konnte ein leises Lächeln nicht unterdrücken. »Es war töricht
von mir, so zu fragen. Aber in dieser Atmosphäre des Argwohns be-
ginnt man selbst an den eigenen Freunden zu zweifeln. Ich kann
nur hoffen, daß Sie mich nicht auch schon beargwöhnen, Tim.«
»Bestimmt nicht! Warum sollte ich auch?«
Sie antwortete nicht, sondern sah auf ihre Armbanduhr. »Jetzt
muß ich aber wirklich gehen.« Nach Handschuhen und Handta-
sche greifend, stand sie auf. »Schade, daß ich keine Zeit mehr ha-
be.«
Ich erhob mich ebenfalls. »Vielleicht läßt es sich so einrichten,
daß wir zusammen zu Abend essen?«
»Ich fürchte, nein. Ich werde den ganzen Abend bei Vivien sein.«
Sie legte eine Hand auf meinen Arm. »Wenn Ihnen inzwischen ein
Grund einfallen sollte, weshalb man meine Wohnung durchsucht
haben könnte, dann rufen Sie mich bitte bei Vivien an. Sie finden
ihre Nummer im Telefonverzeichnis.«
Ich versprach es und geleitete sie zur Tür. Sie verschwand im
Menschengewühl von Park Lane, und ich kehrte zu meinem Tisch
zurück.
116

Bei einem zweiten Sherry dachte ich über das eben Gehörte nach.
Als ich mein Zigarettenetui hervorholte und gedankenverloren mit
den Fingern darauf herumtrommelte, fügten sich die gedanklichen
Bruchstücke plötzlich wie selbstverständlich zusammen. Dieselben
Männer, die meine Wohnung durchsucht hatten, mußten auch in
Barbaras Wohnung eingedrungen sein. Sie suchten offensichtlich,
was sie bei mir nicht gefunden hatten, etwas, was klein genug war,
daß es sich in einer Puppe verstecken ließ.
Ich trug denselben Anzug wie in der Mordnacht. In der kleinen In-
nentasche meiner Jacke fanden meine Finger, was sie suchten – den
Schlüssel zu Barbaras Wohnung.
Behutsam schloß ich die Wohnungstür hinter mir und stand dann
einen Augenblick lauschend im dunklen Flur des Apartments von
Crawford Mansion House Nr. 23. Richards' Worte fielen mir ein:
»Ich hoffe doch, Sie können auf sich achtgeben, Frazer? … Eine
Menge anderer Leute haben das auch gesagt… Vielleicht auch Leo
Salinger…« Es war ein Risiko, das ich auf mich nehmen mußte.
Ich ging zur Wohnzimmertür und stieß sie mit der behandschuh-
ten Rechten weit auf. Ein zweites Mal wollte ich keine Spuren hin-
terlassen, wenn Trueman noch einmal Grund haben sollte, hier nach
Fingerabdrücken zu suchen. Das Zimmer lag in tiefer Dunkelheit,
die schweren Vorhänge waren schon vorgezogen. Im huschenden
Schein meiner Taschenlampe gähnten mich die leeren Sessel und
die Couch auf ungemütliche Weise an.
Mit schnellen Schritten war ich an der Schlafzimmertür, riß sie
auf und sah hinein. Ich erblickte ein leeres Bett, auf dem eine rosa-
farbene Decke lag, einen Kleiderschrank, dessen Türen weit offen-
standen, und verspürte den schwachen Duft von Barbaras Parfüm.
Sonst nichts. Ich kehrte ins Wohnzimmer zurück und schaltete das
Licht ein. Im selben Augenblick ordneten sich die Dinge in mei-
117

nem Kopf, und ich kam auf die Idee, die Szene zu rekonstruieren,
in der Cordwell vermutlich seinem Mörder gegenüberstand.
Zwei Annahmen waren es vornehmlich, die meine nun folgenden
Handlungen bestimmten. Die erste war, daß der Zigarrenrauch, den
ich am Mordabend im Zimmer gespürt hatte, mehr als rein zufäl-
lige Bedeutung haben mußte. Der zweite Schluß war, daß Cord-
wells Mörder des Opfers unmittelbare Reaktion auf seinen Angriff
nicht erfaßt hatte. Darüber hinaus vertraute ich darauf, daß alle, die
vor mir die Wohnung durchsucht hatten, nicht die gleichen Gedan-
kengänge gehabt hatten wie ich und somit nicht gefunden hatten,
was ich jetzt suchte.
Ich ging zu der Stelle hinüber, wo Cordwells Leiche gelegen hat-
te, nahm mir eine Zigarette und steckte sie in den Mund. Dann
wandte ich mich zur Tür um, wobei ich mir vorstellte, mir sei blitz-
artig bewußt geworden, daß ein Angriff auf mich unmittelbar be-
vorstehe. Ich handelte auf die gleiche instinktive Weise, wie ein
Mensch sich bewegen würde, der einen Angreifer abwehren muß.
Ich riß mir mit einem Ruck die Zigarette aus dem Mund und warf
sie in hohem Bogen fort. Dann erst ließ ich die Augen von dem
imaginären Angreifer. Meine Zigarette war neben einen Papierkorb
gefallen. Ich hob sie auf und untersuchte dann den Inhalt des Kor-
bes. Zerrissene Umschläge und Reklameschreiben waren das einzige,
was ich fand. Nach einigen Überlegungen folgerte ich, daß Cord-
wells Zigarre ungefähr doppelt so weit geflogen sein mußte wie mei-
ne federleichte Zigarette. Dementsprechend dehnte ich den Radius
meiner Suchaktion aus und gelangte dabei zum Kamin.
Meine Hände zitterten, als ich niederkniete und unter dem Rost
des elektrischen Kaminfeuers herumtastete. Plötzlich berührten mei-
ne Finger einen glatten, zylindrischen Gegenstand. Ich zog ihn her-
vor und stand auf. In der Hand hielt ich eine halbgerauchte Zigarre
in einer kurzen Zigarrenspitze. Es war dieselbe Spitze, die ich im
Café de Kroon bei Cordwell gesehen hatte.
118
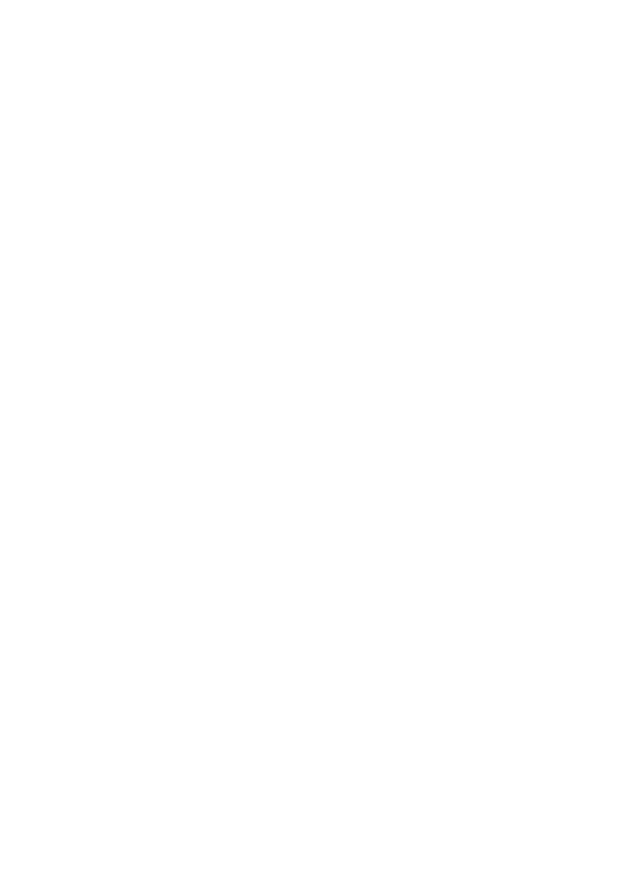
Ich ging zum Tisch, breitete mein Taschentuch aus und legte Zi-
garre und Zigarrenspitze darauf. Mit einem Brieföffner, den ich auf
dem Schreibtisch fand, schlitzte ich die Zigarre auf. Der durchdrin-
gende Geruch kalten Tabaks stieg mir in die Nase. Ich rieb die Ta-
bakblätter zwischen den Fingern, nahm mir dann die Zigarrenspitze
vor und untersuchte sie gründlich. Das Material war Meerschaum,
von Nikotin ziemlich verfärbt. Enttäuscht drehte ich sie zwischen
Daumen und Zeigefinger, wobei mir der Gedanke nicht sehr ange-
nehm war, wie nahe dieser Gegenstand einst mit dem toten Cord-
well verbunden gewesen war. Plötzlich bemerkte ich zwischen
Mundstück und der Hülle für die Zigarre eine Vertiefung. Nun be-
nutzte ich Daumen und Zeigefinger beider Hände, um das Mund-
stück abzuschrauben, und bohrte schließlich mit einem Streichholz
das heraus, was in der Vertiefung verborgen lag und so schwer ans
Tageslicht zu befördern war.
Zwei Diamanten beachtlicher Größe fielen mir prismatisch fun-
kelnd in die Innenfläche der Hand.
18
nd ob das Diamanten sind, mein Lieber! Ich kann sie zwar im
Wert nicht genau abschätzen, aber einen ganz schönen Batzen
sind sie schon wert, das kann ich Ihnen versichern, Frazer.«
U
U
Es war am Nachmittag des folgenden Tages. Den ganzen Vormit-
tag über hatte ich versucht, mit Ross Verbindung aufzunehmen;
aber weder er noch Richards waren zu erreichen. Jetzt saß ich in
der Bibliothek des Hauses am Smith Square und beobachtete, wie
119

Richards mit seinen langen, knochigen Fingern die Diamanten auf
einem Löschblatt hin und her rollen ließ.
»Richards war früher einmal ein Diamantenhändler«, erklärte Ross
trocken, als er sich mir zuwandte. »Im übrigen paßt das alles sehr
gut zu gewissen Dingen, die wir inzwischen ausgegraben haben. Die
Akte Cordwell von Interpol enthält eine Menge Vorstrafen wegen
Handels mit gestohlenen Edelsteinen auf dem Kontinent. Meiner
Ansicht nach war Cordwell als Kurier für Ericson tätig und schmug-
gelte Diamanten nach England. Außerdem ist er aktenmäßig auch
als Erpresser bekannt.«
Ich lächelte. »Diese Information habe ich auch schon erhalten,
und zwar von Barbara Day. Trueman erzählte ihr von Cordwell;
wahrscheinlich nur, um herauszufinden, ob auch sie von ihm er-
preßt wurde.«
»Das wäre allerdings ein Motiv für einen Mord«, meinte Ross.
»Aber nicht in diesem besonderen Fall. Cordwell wurde umge-
bracht, weil jemand wußte, daß er diese Diamanten bei sich hatte.«
»Und Ericson hatte es so eingerichtet, daß er Cordwell in der
Wohnung von Barbara Day treffen würde«, ergänzte Richards.
»Was bedeuten würde, daß sie ebenfalls Mitglied dieser Schmug-
gelorganisation ist«, sagte ich mit gerunzelter Stirn. »Ich kann das
einfach nicht glauben! Erinnern Sie sich, daß ich Barbara beobach-
tete, als sie in ihre Wohnung zurückkehrte und Cordwells Leiche
fand. Sie war völlig konsterniert und ganz offensichtlich auch von
panischer Angst erfaßt, als sie mit der Polizei telefonierte.« Ich
schüttelte den Kopf. »Sie ist genauso ratlos, wie wir es sind.«
Richards lehnte sich vor, um mir zu antworten; aber Ross gab
ihm einen Wink, sich zurückzuhalten. »Was halten Sie von dem Te-
lefonanruf, als Vivien Gilmore Ericson erwähnte? Leugnet Barbara
Day immer noch, je diesen Namen gehört zu haben?«
»Sie fragte mich heute, ob ich der Ansicht wäre, Vivien sei viel-
leicht mit Ericson bekannt. In gewisser Weise könnte das diesen
120
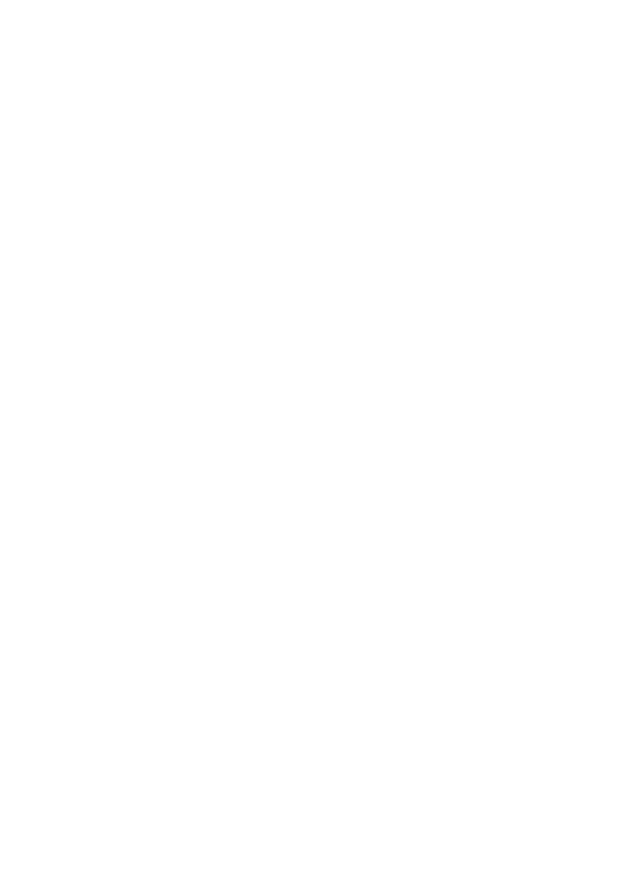
Anruf erklären. Nehmen wir einmal an, Vivien kennt Ericson wirk-
lich – hat vielleicht ein Verhältnis mit ihm, ohne zu wissen, daß er
in kriminelle Sachen verwickelt ist. Würde das nicht erklären, wa-
rum Miß Day leugnet, Ericson zu kennen? Ich meine, daß eine
Freundin die andere deckt.«
»Das spricht für Ihren Einfallsreichtum, erklärt aber nicht, wieso
Cordwell in Barbara Days Wohnung ermordet wurde.«
»Nein«, gab ich zu. »Das tut es nicht.«
Während dieses Gesprächs hatte Ross unaufmerksam mit den Fin-
gern auf den Tisch getrommelt; er verfolgte bereits einen neuen Ge-
dankengang. »Sagten Sie nicht, Sie hätten den Mann am Obstkar-
ren als einen der beiden identifiziert, die bei Ihnen eingebrochen
und Ihre Wohnung durchsucht haben?«
»Ich bin mir da ziemlich sicher.«
»Und sind die beiden Ihrer Meinung nach auch in Miß Days
Wohnung gewesen?«
»Das kann ich natürlich nicht mit Sicherheit behaupten. Fest
steht, daß jemand dort war – wir können nur vermuten, daß es die-
selben Männer gewesen sind.«
Ross nickte. »Ich sehe die Sache so: Wenn die beiden zu Ericsons
Organisation gehörten, dann haben sie nach Richards' Ansicht
Wind davon bekommen, daß Cordwell sich mit Ericson treffen
wollte. Sie haben Ericson übers Ohr gehauen und Cordwell ermor-
det, um sich selbst die Diamanten anzueignen.«
Richards blickte, sich konzentrierend, zur Zimmerdecke. »Es könn-
te natürlich auch sein, daß einer der beiden selber Ericson war.
Vielleicht hat er sich bei diesem Zusammentreffen mit Cordwell zu
einer unüberlegten Gewalttat hinreißen lassen«, gab er zu bedenken.
»Das wäre absolut möglich, Richards.« Ross rieb sich einen Au-
genblick nachdenklich das Kinn und wies dann mit der Hand auf
die drei Metronome, die auf seinem Schreibtisch standen. »Wir ha-
ben diese drei Dinger da untersuchen lassen. Sie sind nichts weiter
121

als ganz normale Metronome. Was sie für eine Bedeutung haben,
ist mir noch völlig schleierhaft. Können Sie es sich vielleicht den-
ken, Frazer?«
»Für mich steht fest, daß Dempsey zur Organisation Ericson ge-
hört. Sicher ist er ein Strohmann, dessen Geschäft dazu benutzt
wird, gestohlene Diamanten anzukaufen. Der Tulpenkatalog gilt als
Ausweis, um den Verkäufer zu identifizieren. Als zusätzliche Vor-
sichtsmaßnahme muß der Dieb auch noch ein Kodewort nennen,
in diesem Falle ›Fantasie zwei-dreißig‹. Es muß aber noch eine drit-
te Prozedur geben, eine, die etwas mit dem Metronom zu tun hat.«
»Hat dieser Dempsey irgend etwas gesagt, als er das Metronom
hervorholte?« fragte Ross.
»Kein Wort. Offensichtlich war ich an der Reihe, eine bestimmte
Äußerung zu tun. Ich war verdammt froh, als sein Telefon in die-
sem Augenblick läutete.«
»Sie sagten, die Stimme am Telefon sei Ihnen bekannt vorgekom-
men?« erkundigte sich Richards.
»Ich bin ziemlich sicher, daß es Vivien Gilmore war.«
»Dann gehört auch sie zur Organisation Ericson. Und Dempsey
wird ihr das Nötige über Sie gesagt haben.« Ross sah mich ernst
und warnend an. »Von jetzt an müssen Sie mit Unannehmlichkei-
ten rechnen, Frazer.«
»Und das nicht nur mit der Ericson-Bande, mein Lieber«, setzte
Richards zynisch hinzu. »Trueman ist noch keinesfalls mit Ihnen
fertig. Mir scheint, er ist bei weitem noch nicht davon überzeugt,
daß Sie die Verabredung mit Barbara Day in der Mordnacht nicht
eingehalten haben.«
Ich sah zu Ross hinüber. »Warum kann man Trueman nicht ein-
fach ins Vertrauen ziehen?«
Ross schüttelte energisch den Kopf. »Lassen Sie es sich ein für
allemal gesagt sein, Frazer: Ich bin nur an Salinger interessiert. Ich
möchte sicher sein, daß er ein ehrenwerter Agent und nicht in die-
122

sen Diamantenschmuggel verwickelt war. Die Aufklärung des Mor-
des ist Sache der Polizei. Sie müssen sich aus der Affäre ziehen, so
gut es eben geht.« Sein Blick wurde hart. »Weiß erst einmal die Po-
lizei, was Sie tun, dann können auch die Zeitungen bald Wind da-
von bekommen. Und dann steht diese Dienststelle hier im Schein-
werferlicht.« Er schnaubte verächtlich. »Das wäre ein gefundenes
Fressen für die Sensationspresse: Britischer Geheimagent in Cordwell-
Mordaffäre verwickelt …
oder wie die Schlagzeilen lauten mögen. Mög-
licherweise kommt es noch zu einer Anfrage im Unterhaus. Nein,
Frazer, mit diesen Sachen müssen Sie schon allein fertig werden.«
»Geht in Ordnung, Sir«, antwortete ich. »Aber wenn ich schon
auf mich allein gestellt arbeiten muß, dann möchte ich auch freie
Hand haben.«
Ross sah mich scharf an. »Was haben Sie vor, Frazer?«
»Die Einzelheiten habe ich noch nicht ausgearbeitet«, erklärte ich
munter. »Doch mir scheint ein nochmaliger Besuch bei Dempsey
angebracht.«
Als ich wieder in meinem Wohnzimmer saß, war mir bedeutend
weniger forsch zumute als vorhin bei Ross. Daß ich Dempsey wie-
dersehen mußte, lag auf der Hand. Schließlich bildete er für mich
das einzige Bindeglied zu Ericson. Und um die Wahrheit über Leo
Salinger herauszufinden, war es am besten, ein Treffen mit dem Lei-
ter der Schmuggelorganisation herbeizuführen. Ich hatte keine Ah-
nung, wie Ericson in einer solchen Situation reagieren würde, ab-
gesehen davon, daß die Reaktion vermutlich in höchstem Grade
unangenehm sein würde. Im Augenblick war ich nur damit beschäf-
tigt, eine Geschichte zusammenzubrauen, die Dempsey veranlassen
konnte, mich an Ericson weiterzuleiten. Aber das mußte schon eine
sehr überzeugende Geschichte sein.
Wie ein Tiger im Käfig lief ich in meinem Wohnzimmer auf und
123

ab, bis ich es nach einer halben Stunde aufgab.
Es war schon nach achtzehn Uhr, und die Dämmerung brach
herein. Ich schaltete die Tischlampe ein, und im selben Augenblick
setzte mein Herzschlag für einen Moment aus. Hatte ich gestern
abend eigentlich das Licht in Barbaras Wohnung ausgeschaltet?
Mich beunruhigte das Gefühl, es in meiner Erregung über die ge-
fundenen Diamanten vergessen zu haben.
Ich entschloß mich, sie anzurufen. Ganz bestimmt würde sie es
erwähnen, wenn bei ihrer Rückkehr das Licht in der Wohnung ge-
brannt hatte. Schnell blätterte ich im Telefonbuch, um die Num-
mer des Antiquitätenladens zu finden. Dabei überlegte ich, welchen
Vorwand ich für den Anruf angeben konnte. Während ich die Num-
mer wählte, mußte ich ein wenig schuldbewußt lächeln. Wäre Ri-
chards hier gewesen, hätte er sicherlich eine bissige Bemerkung ge-
macht.
Vivien Gilmore war am Apparat. Ich nannte ihr meinen Namen
und fragte nach Barbara. Sie antwortete gar nicht erst, sondern rief:
»Es ist dieser Frazer, Barbara!«
Fast unmittelbar darauf wurde der Hörer von Barbara übernom-
men, die in flüsterndem Ton zu mir sprach: »Tim … ich war gerade
im Begriff, hier wegzugehen, um Sie anzurufen.«
Dann hatte die Lampe also doch gebrannt, dachte ich mir. »Ist es
etwas Wichtiges, Barbara?« fragte ich laut.
»O ja.« Sie sprach schnell und leise. »Ich kann es Ihnen jetzt nicht
sagen. Können wir uns nicht abends treffen?«
»Wie wäre es, wenn wir zusammen essen würden?«
Sie zögerte. »Können wir uns an einem ruhigen Ort ungestört un-
terhalten?«
»Dann sollten wir uns bei Marino treffen. Kennen Sie das Lokal
in der Charlotte Street? Ich werde um halb acht dort sein.«
Wir verabschiedeten uns und legten auf. Dabei bemerkte ich, daß
der alphabetisch geordnete Adressenblock, den ich stets neben dem
124

Telefon liegen hatte, verschwunden war. Ich hatte ihn schon seit
mehreren Tagen nicht mehr benötigt, so daß ich nicht genau wuß-
te, wie lange er schon fehlte. Ich fragte mich, ob der Mann, der
meine Wohnung durchsucht hatte, ihn sich vielleicht eingesteckt
hatte, um später in Ruhe die Namen meiner Telefonliste zu über-
prüfen. Dann erinnerte ich mich, daß die letzte Nummer, die ich
darauf notiert hatte, die von Barbara gewesen war. Das würde viel-
leicht erklären, warum man ihre Wohnung durchsucht hatte. Die
anderen Namen und Adressen würden für ihn uninteressant sein.
Glücklicherweise waren Ross und auch Richards auf der Liste nicht
notiert.
Das Telefon läutete. Ich hob ab, nannte meine Nummer und
hörte, wie der Zahlknopf eines Münzautomaten gedrückt wurde.
Dann fragte eine akzentuierte Stimme: »Spreche ich mit Mr. Fra-
zer?«
Ich erkannte die Stimme und packte unwillkürlich den Hörer fes-
ter. Zweifellos gehörte sie dem Manne, der mir den Zettel in das Zi-
garettenetui geschoben hatte. »Ja«, antwortete ich.
»Mein Name ist van Dakar«, sprach die Stimme weiter. »Sie ken-
nen mich nicht.«
»Fantasie, zwei-dreißig, bester Tip der Woche, Chef«, erwiderte
ich und ahmte nach, wie er den Obsthändler gespielt hatte. »Gratu-
liere zu Ihrem Cockneyakzent, Mr. van Dakar.«
Er lachte. »Den habe ich in Ihren Londoner Kneipen aufge-
schnappt.« Sein Ton änderte sich. »Sie haben dem Obsthändler Ihre
Karte gegeben. Haben Sie Lust, sich mit mir zu treffen?«
»Sehr sogar«, antwortete ich, wobei ich mir sanft über den Hin-
terkopf strich. »Ich habe immer noch eine leicht schmerzhafte Erin-
nerung an unser erstes Zusammentreffen.«
»Sie haben erraten, daß ich das war? Nun, nicht so schlimm. Ich
kann mich jetzt bei Ihnen entschuldigen. Wir haben in Ihrem Falle
einen schweren Fehler gemacht, Mr. Frazer.«
125

»Wir?« fragte ich.
»Am Telefon kann ich Ihnen das nicht alles erklären. Wenn ich
es später tue, werden Sie aber einsehen, daß mein Freund und ich
einen legitimen Grund hatten, Ihre Wohnung zu durchsuchen.«
»Und mir dabei meinen Merkkalender mit Telefonnummern zu
stehlen?«
»Ich verstehe Sie nicht, Mr. Frazer. Aus Ihrer Wohnung wurde
von uns nichts entwendet.« Sein Ton wurde nachdenklich. »Mir
scheint es doch sehr wichtig zu sein, daß wir uns bald treffen. Viel-
leicht sogar sofort?«
»Das wird leider nicht möglich sein. Ich habe für halb acht Uhr
eine Verabredung zum Abendessen.«
»Ach so. Wo werden Sie speisen, bitte?«
Ich zögerte. In seinem Ton lag jedoch eine Dringlichkeit, die mir
zu erkennen gab, daß ich mehr als nur meine Neugier befriedigen
könnte, wenn ich diesen Mann noch am selben Abend traf. »In der
Charlotte Street«, antwortete ich. »Ich werde dort mit jemandem zu
Abend essen.«
»Und die Nummer Ihres Wagens?«
Verwundert zuckte ich mit den Schultern. »297 GPD.«
»Sobald Sie sich von Ihrem Bekannten verabschiedet haben, fah-
ren Sie bitte zum Grosvenor Square und halten Sie kurz vor dem
Haupteingang der amerikanischen Botschaft«, wies er mich ganz ge-
schäftsmäßig an. »Ich werde dort um elf Uhr auf dem Bürgersteig
auf Sie warten.«
»Warum müssen Sie es so spannend machen?« fragte ich ärger-
lich. »Können wir uns nicht einfach zu einem Drink treffen?«
»Es ist besser, wenn wir nicht zusammen gesehen werden«, erwi-
derte er ernst. »Ich muß Sie warnen, Mr. Frazer. Die Leute, mit de-
nen wir es zu tun haben, lassen nicht mit sich spaßen. Sie werden
keinen Augenblick zögern, gewalttätig zu werden – wenn nicht gar
Schlimmeres zu tun.«
126

Schon wieder dieses ›wir‹. »Mir wäre wohler, wenn ich wüßte, wer
Sie wirklich sind, Mr. van Dakar«, äußerte ich scharf.
»Ich werde Ihren Wissensdurst später befriedigen, sobald Sie mit
Miß Day gespeist haben.«
»Einen Augenblick mal!« rief ich aus. »Ich habe Ihnen doch gar
nicht gesagt…«
»Ich habe nur auf den Busch geklopft, Mr. Frazer«, unterbrach er
mich mit kurzem Lachen. »Im übrigen ist es ganz gut, daß Sie nicht
zu Miß Day in die Wohnung eingeladen wurden. Auf diese Weise
können Sie Ihre Tasse Kaffee wenigstens unbesorgt trinken.«
»Was, zum Teufel, wollen Sie damit sagen?« erhitzte ich mich.
Er sprach nicht mehr weiter. Ich hörte ein Aufseufzen, danach
das Splittern von Glas und das klappernde Geräusch, als der Hörer
auf das Pult der Telefonzelle fiel.
»Van Dakar!« rief ich. »Van Dakar! Was ist geschehen?«
Plötzlich war nur ein seltsam erstickter Laut zu vernehmen, lautes
Stimmengewirr und der entsetzte Schrei einer Frau. Ich rief immer
wieder ›Hallo!‹ ins Telefon, aber es antwortete niemand, bis schließ-
lich jemand den Hörer auf die Gabel knallte.
Ich legte meinerseits auf und zögerte. Es würde unmöglich sein
festzustellen, woher der Anruf gekommen war. Vielleicht sollte man
die Polizei benachrichtigen? Dann entschied ich mich jedoch dafür,
nichts zu unternehmen, da ein Anruf bei der Polizei mich wieder
zu Erklärungen nötigen würde, die dort mehr als nur vorübergehen-
des Interesse wecken mußten. Ich hatte keine Lust, mich erneut
von Trueman ausquetschen zu lassen.
Van Dakar blieb mir ein Rätsel. Aus den Andeutungen, die er ge-
macht hatte, mußte ich den Eindruck gewinnen, daß er in dieser
Angelegenheit auf der Seite von Gesetz und Recht stand. Und nach
den Geräuschen in der Telefonzelle schien es mir höchst unwahr-
scheinlich, daß er unsere Verabredung um elf Uhr einhalten würde.
Ich warf einen Blick auf meine Uhr. Mir blieben noch zwanzig Mi-
127

nuten, um zur Charlotte Street zu gelangen.
Marino
ist mein Stammlokal, dort habe ich an einem Ecktisch mei-
nen Platz. Der Kellner brachte mir einen Tio Pepe und die Speise-
karte. Während ich das Menü zusammenstellte, das ich Barbara
empfehlen wollte, versuchte ich gleichzeitig, meine Gedanken von
diesem van Dakar abzulenken. Der Vorfall in der Telefonzelle hatte
mich nervös gemacht, und ich wollte nicht, daß Barbara es mir an-
merkte. Ich erwartete ohnehin, daß ich Mühe haben würde, mich
wegen des Lichts in ihrer Wohnung am Abend zuvor geschickt aus
der Affäre zu ziehen, zumal ich den Eindruck gewonnen hatte, daß
sie mich irgendwie mit der vorangegangenen Durchsuchung ihrer
Wohnung in Verbindung brachte.
Im selben Augenblick, als Barbara im Restaurant auftauchte, wuß-
te ich auch schon: Was immer auch auf ihrem Abendprogramm
stehen mochte, ein Abendessen mit mir würde es bestimmt nicht
sein. Sie trug ihr rotes Kleid und eine Andeutung von Hut.
»Es tut mir schrecklich leid«, begann sie schuldbewußt, »aber ich
fürchte, aus unserem Abendessen wird nichts.«
Ich verspürte ein Gefühl der Erleichterung, tat jedoch mein Bes-
tes, dies zu verbergen. »Sie werden doch wenigstens Zeit zu einem
kleinen Drink haben«, erklärte ich, während ich aufstand und ihr ei-
nen Stuhl hinschob. »Außerdem habe ich das Gefühl, Sie könnten
ein Beruhigungsmittel brauchen.«
»Genauso ist es«, antwortete sie seufzend und setzte sich. »Aber
ich habe nicht viel Zeit. Vivien wartet draußen in meinem Wagen.
Es gibt Ärger wegen eines alten Stückes, das wir in St. Albans er-
worben haben. Wir haben einen Kunden dafür, und jetzt behauptet
der Auktionator auf einmal, er habe unser Gebot nicht angenom-
men. Vivien kann es nicht abwarten, die Sache mit ihm auszutra-
gen.«
128

Ich hielt die Stunde für reichlich spät, geschäftliche Meinungsver-
schiedenheiten mit einem Auktionator auszutragen, und sagte dies
auch.
»Er tätigt sehr oft Geschäfte noch am späten Abend«, erklärte
Barbara und spielte mit dem Aschenbecher, der vor ihr stand. »Aber
ich mußte Sie unbedingt sprechen. Es ist wegen meiner Wohnung.
Dort ist schon wieder etwas Seltsames passiert.«
»Wirklich?« erwiderte ich mit betont höflichem Interesse.
»Ich besitze zwei Wohnungsschlüssel. Einen habe ich stets bei
mir« – sie deutete auf ihre Handtasche –, »und der andere liegt im-
mer auf dem chinesischen Tisch im Vorraum.«
Sie legte eine Pause ein, die etwas zu sehr pointiert war. Um sie
zu überbrücken, forderte ich Barbara auf: »Ja und?«
»Als ich heute früh nach dem Reserveschlüssel sah, war er fort!
Ich versuchte sofort, Sie anzurufen, aber es meldete sich niemand.«
»Warum wollten Sie denn gerade mich anrufen, Barbara? Ich hät-
te Ihnen doch auch nicht helfen können.«
»Natürlich nicht, aber…« Ihre Augen sahen mich sonderbar an.
»Nun ja, ich habe Ihnen doch schon erzählt, daß man meine Woh-
nung durchsucht hat, und da dachte ich, die Sache mit dem ver-
schwundenen Schlüssel würde Sie ebenfalls interessieren.«
Ich unternahm den Versuch, Interesse für den Verbleib eines
Schlüssels zu bezeugen, der sich in diesem Augenblick in der Ta-
sche eines meiner Anzüge im Kleiderschrank befand. »Wenn dieser
Schlüssel wirklich benutzt worden ist, um in Ihre Wohnung einzu-
dringen – wie ist der Eindringling denn vorher in seinen Besitz ge-
langt?« forschte ich.
»Gerade das macht mir Sorgen.« Sie sah mir lange fest in die Au-
gen. »Jemand, der mich in den letzten Tagen in meiner Wohnung
besucht hat, muß ihn an sich genommen haben.«
Ich wartete, bis sie weitersprach. »Es waren nur vier Personen«, re-
kapitulierte sie, ohne den Blick von mir zu wenden. »Vivien, Ar-
129

thur, dieser Kriminalbeamte und … Sie.«
»Sie vergessen Cordwell«, fügte ich schnell hinzu. »Und seinen
Mörder.«
»Cordwell wurde ermordet…«, begann sie. Dann nahm ihre Stim-
me einen aufgeregten Klang an. »Der Mörder! Ob er den Schlüssel
mitgenommen hat … und gestern zurückgekommen ist?«
Bis zu dem Augenblick, als van Dakar mich anrief, hatte ich ge-
glaubt, dieses Problem gelöst zu haben. Jetzt mußte ich diesen Ge-
dankengang korrigieren. »Das ist doch absolut möglich«, antwortete
ich und schoß dann eine gezielte Frage ab. »Wie ist Cordwell über-
haupt in Ihre Wohnung hineingekommen?«
Sie starrte mich einen Augenblick schweigend an und fragte dann
mit ruhiger Stimme: »Sie wollen doch wohl nicht andeuten, ich
hätte ihm einen meiner Schlüssel gegeben?«
»Aber nein«, begann ich kleinlaut, »was ich meinte – aber schlecht
ausgedrückt habe, war, daß der Mörder über die Feuerleiter in Ihre
Wohnung eingedrungen sein könnte. Und als Cordwell dann an
der Tür läutete…«
»O Tim«, sagte sie müde. »Warum hätte Cordwell denn bei mir
läuten sollen?«
»Immerhin war er ja in London, und da war es für ihn doch ein
leichtes, im Telefonbuch Ihre Adresse ausfindig zu machen und
Ihnen dann schnell entschlossen einen Besuch abzustatten…«
Sie erhob sich. »Es ist wieder der alte Circulus vitiosus, die Katze,
die sich in den Schwanz beißt. Das bringt uns einfach nicht weiter,
nicht einen Schritt.«
Sie blickte auf ihre Uhr. »Oje, ich bin schon zehn Minuten hier;
Vivien wird gleich einen Wutanfall bekommen.« Ihr Blick wurde
plötzlich sanft. »Ich komme mir wirklich abscheulich vor, daß ich
Sie so oft einfach sitzenlasse.«
»Es gibt immer wieder mal einen Abend«, beruhigte ich sie. »Viel-
leicht morgen?«
130

»Morgen abend esse ich mit Arthur. Und an allen anderen Aben-
den dieser Woche habe ich bereits feste Verabredungen.« Plötzlich
hellte ihr Gesicht sich auf. »Ich habe eine Idee! Ich werde sehen,
daß wir gegen zehn Uhr von St. Albans zurück sind. Kommen Sie
kurz nach zehn bei mir vorbei, dann können wir wenigstens noch
zusammen eine Tasse Kaffee trinken.«
In diesem Augenblick erschien der Wirt höchstpersönlich an un-
serem Tisch. Bestürzt über das offensichtliche Zeichen des Auf-
bruchs, hob er beschwörend die Hände. Sie lächelte ihn freundlich
an und war nach einem kurzen Winken verschwunden.
Ich beruhigte den Wirt, der sich herbemüht hatte, um die Wün-
sche der Dame persönlich entgegenzunehmen. »Es hat nichts mit
der Bedienung zu tun«, versicherte ich ihm, »ihre Schwester ist
plötzlich erkrankt.«
Ich bestellte dann die Scampi, die seiner Empfehlung alle Ehre
machten. Aber meine Gedanken waren bei der Tasse Kaffee, die fol-
gen sollte … dem Kaffee um zehn Uhr in Barbaras Wohnung.
Ich verließ das Restaurant in zwiespältiger Stimmung, enttäuscht ei-
nerseits wegen Barbaras erneuter Ausflucht, andererseits in Erwar-
tung unseres nächsten Zusammentreffens. Einige Minuten lang saß
ich in meinem Wagen und überlegte, wie und wo ich die nächsten
Stunden verbringen sollte. Zwar gab es in unmittelbarer Nähe eine
ganze Reihe guter Lokale; aber es schien mir unbedingt notwendig,
für die nächsten Stunden einen klaren Kopf zu behalten.
Schließlich hielt ich es doch für das beste, in meine Wohnung
zurückzukehren; es konnte ja sein, daß mich jemand noch vor zehn
Uhr anrief. Ich ließ den Motor anspringen und fuhr langsam die
Charlotte Street entlang. Als ich rechts einbog und mich im Rück-
spiegel vergewisserte, daß ich niemanden behinderte, fiel mir eine
schwarze Limousine auf, die dicht neben dem Restaurant Schultz
131

geparkt hatte und sich jetzt hinter mir in den Verkehr einreihte. In
Tottenham Court Road mußte ich vor einer roten Ampel an der
Oxford Street halten und sah den schwarzen Wagen scharf am Do-
minion-Kino an den Bordstein fahren, als wolle er in Richtung Hol-
borne weiterfahren.
Ein paar Minuten später war er jedoch schon wieder hinter mir
in der Oxford Street, keine zwanzig Meter Abstand haltend. Ich
nutzte den Verkehrsstrom aus, um in eine enge Seitenstraße nach
links abzubiegen. Als ich auch hier wieder die dunkle Limousine
hinter mir sah, war ich sicher, daß mich jemand verfolgte.
Aufmerksam durchfuhr ich die enge Straße in Soho, wobei ich
darüber nachdachte, wer der Verfolger wohl sein mochte. Mehrfach
versuchte ich, im Rückspiegel einen Blick auf den Fahrer des ande-
ren Wagens zu erhaschen; aber der Blickwinkel zeigte mir nichts als
Reflexe auf der Windschutzscheibe.
Nun bog ich in die Shaftesbury Avenue ein, beschleunigte auf der
freien Straße das Tempo und fuhr schnell bei Rot über eine Kreu-
zung, während mein Verfolger auf Grün warten mußte.
Im Verkehrsgewühl am Piccadilly Circus glaubte ich, ihn endlich
abgeschüttelt zu haben, aber als ich Green Park passierte, erschien
er wieder in meinem Rückspiegel. Mir fiel van Dakars Warnung ein:
Diese Leute werden vor Gewalttaten nicht zurückschrecken – oder
sogar noch Schlimmerem.
Als ich das hektische Gewühl an der Hydepark Corner, die zu
dieser Zeit einem Chaos glich, durchfahren und die Richtung
Knightsbridge eingeschlagen hatte, blieb der geheimnisvolle Wagen
immer noch im Abstand von ungefähr zwanzig Metern hinter mir.
Ich überlegte, warum man mir wohl nachfuhr. Wenn man einen
Angriff auf mich plante, dann wäre es entschieden leichter, an den
trüb beleuchteten Garagenbauten neben meinem Haus auf mich zu
warten. Oder wußte der Verfolger nicht, wo ich wohnte?
Ich warf einen Blick auf die Benzinuhr. Es war noch genug im
132

Tank für eine ziellose Rundfahrt bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ich
mit Barbara verabredet war. Das aber würde einschließen, daß man
mir eventuell zu ihrer Wohnung folgte. Deshalb beschloß ich, die
schwarze Limousine endgültig abzuschütteln.
Kurz hinter der Brompton-Kapelle bog ich ganz scharf links ein,
fuhr dann am Ende des Beauchamp Place schnell an die Bordkante,
zog den Zündschlüssel ab und war mit einem Sprung aus dem Wa-
gen. An der Schlange haltender Omnibusse vorbei lief ich in die
Arkaden des Hochbahnbahnhofs, um dann im Zubringertunnel zur
Piccadilly Line zu verschwinden. Der Aufzug näherte sich nur lang-
sam, so daß ich die Geduld verlor und mich in Richtung der Trep-
pe zu den Zügen des Inneren Ringes in Bewegung setzte, wo gerade
ein Zug in Richtung Westen einlief. Ich murmelte dem Mann an
der Sperre etwas Unverständliches zu und raste die Treppe hinun-
ter, jeweils drei Stufen auf einmal nehmend. Kaum hatte ich ein
Abteil erreicht, schlossen sich wie auf Kommando die Wagentüren.
Atemlos sank ich auf den nächsten Sitz, aber doch befriedigt, daß
mir in diesen Zug bestimmt niemand gefolgt sein konnte.
Am Bahnhof Gloucester Road verließ ich den Zug, gab dem
Mann an der Sperre einen Shilling und ging auf die Straße. Selbst
jetzt noch sah ich mir argwöhnisch jede schwarze Limousine an,
aber deren Fahrer würdigten mich keines Blickes. In mein Haus ge-
langte ich schließlich durch den Hintereingang.
Ich betrat meine Wohnung so leise wie möglich, schloß lautlos
die Tür hinter mir und blieb, aufs äußerste angespannt, auf der
Hut. Mit einem Ruck riß ich die Wohnzimmertür auf und wartete
dann noch einen Augenblick, bevor ich eintrat. Ich sah hinter die
Tür, trat ans Fenster und zog die Vorhänge zu, bevor ich das Licht
einschaltete. Der Raum schien mir geradezu unnatürlich ruhig.
Nach einer Zigarette fühlte ich mich schon etwas entspannter.
Die Wanduhr in der Ecke schlug neun. Bedächtig blickte ich dem
Rauch einer zweiten Zigarette nach und kam dabei zu dem Ent-
133
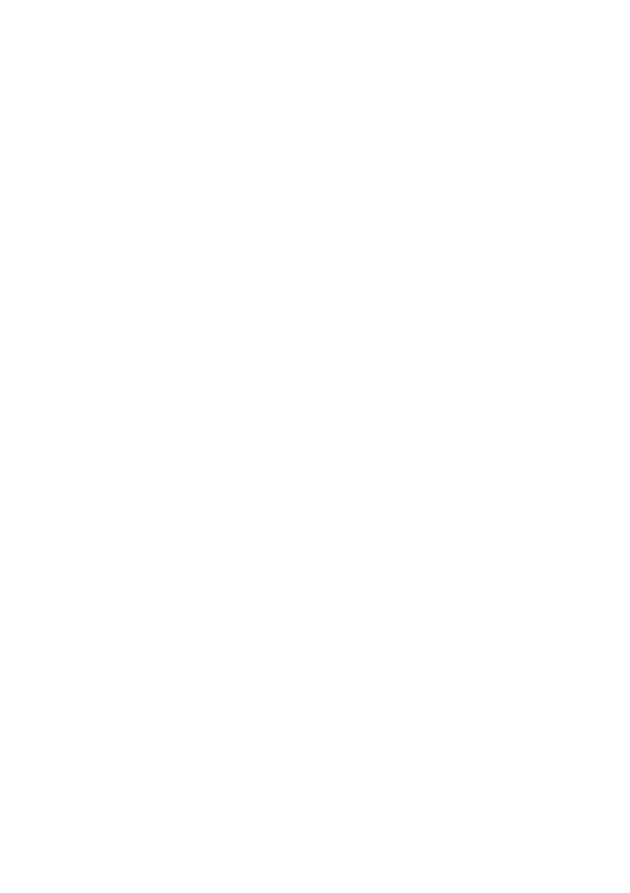
schluß, zum Beauchamp Place zurückzufahren und meinen Wagen
zu holen.
In den Sessel zurückgelehnt, überlegte ich, was Barbara mit ihrer
Einladung bezwecken mochte; aber die drückende Stille im Zimmer
begann mir auf die Nerven zu gehen, und so langte ich nach mei-
nem kleinen Transistorradio, um etwas Musik einzuschalten. Noch
bevor ich es tun konnte, läutete es an der Tür.
In meiner Hast, das Licht auszuschalten, warf ich beinahe das Ra-
diogerät um. Mit vier großen Schritten war ich am Fenster, wo ich
vorsichtig durch die geschlossenen Vorhänge nach draußen lugte.
Vor der Haustür stand die mir gut bekannte dunkle Limousine.
Wieder läutete es an der Tür.
Ich kam zu der Überzeugung, daß ich das Geheimnis ebensogut
jetzt wie später klären konnte – immerhin befand ich mich auf ei-
genem Grund und Boden und in voller Alarmbereitschaft. Deshalb
schaltete ich das Licht wieder ein und ging zur Wohnungstür. Ich
plante, sie vorsichtig einige Zentimeter weit zu öffnen – bereit, sie
jedem unerwünschten Besucher vor der Nase zuzuschlagen.
»Keine Sorge, Sir – ich bin es nur«, erklang eine mir wohlvertraute
Stimme, als ich die Tür öffnete. Ich zog sie weiter auf und erkannte
sofort den Mann im Regenmantel und grauen Homburg.
Es war Detektivinspektor Trueman.
Ich trat einen Schritt zurück, die Hand noch am Türknauf. »Guten
Abend, Sir. Darf ich eintreten?« fragte Trueman, wobei er eine Au-
genbraue mit leicht amüsiertem Lächeln hochzog.
»Natürlich«, antwortete ich kurz, »warum nicht?«
Er trat ein und nahm den Hut ab. »Ich dachte mir, Sie hätten
vielleicht schon Besuch.«
»Heute ist nicht der Wochentag, an dem ich Damenbesuch ha-
be«, erwiderte ich grinsend. »Schade, daß sie die Scampi bei Marino
134

nicht essen konnte. Wie war denn das Essen bei Schultz, Inspek-
tor?«
»Die Suppe kann ich sehr empfehlen«, antwortete er ungerührt.
»Es tut mir leid, daß ich Sie so lange warten ließ«, erwiderte ich.
»Aber warum sind Sie auch nicht direkt hierhergekommen, statt
Räuber und Gendarm zu spielen. War doch ziemlich melodrama-
tisch, mir so zu folgen nicht wahr?«
»Ich wollte Sie nicht verfehlen, Mr. Frazer. Sie hätten ja noch ei-
ne andere Verabredung haben können.«
»Nun, das war nicht der Fall. Und warum folgten Sie Miß Day
zum Restaurant Marino?«
»Reine Routine, Sir. Schließlich wurde in ihrer Wohnung eine Lei-
che gefunden, und zwar unter recht mysteriösen Umständen. Es ge-
hört zur selbstverständlichen Routinearbeit, daß wir uns um den
Tageslauf der jungen Dame kümmern.«
»Sie meinen, Miß Day könnte Sie zu dem Mörder führen? Ist das
nicht etwas naiv, Inspektor?«
»Halten Sie es für naiv, zu glauben, der Mörder könne mit ihr be-
freundet gewesen sein, Mr. Frazer?« Er sah mich spöttisch an. »Wie
sollte er in Miß Days Wohnung gelangt sein, wenn sie ihn nicht ge-
kannt hätte?«
»Über die Feuerleiter«, antwortete ich schlicht. »Wenn ich mich
recht erinnere, haben Sie sich besagte Leiter am Tage nach dem
Mord gründlich angesehen.«
Er lächelte etwas gequält. »Ach so, ja. Wir haben sie natürlich
nach Fingerabdrücken untersucht.«
Ich versuchte mich zu erinnern, ob ich das Geländer berührt hat-
te, als ich die Leiter hinuntergeklettert war. Trueman sah mich for-
schend an. Um seinem Blick auszuweichen, wandte ich mich dem
Tisch mit den Flaschen zu. »Was darf ich Ihnen einschenken, In-
spektor?«
»Danke. Für mich nichts, Mr. Frazer.«
135

»Sie trinken nie im Dienst, Inspektor?«
»So ist es, Sir.« Er drehte seinen Hut in der Hand hin und her.
»Dann darf ich wohl…«, sagte ich und nahm mir ein Glas.
»Ich habe nur ein oder zwei Fragen, die ich mit Ihnen noch klä-
ren möchte, Mr. Frazer.«
»Oh…« Ich konnte nur hoffen, daß mein Lachen ihm nicht so
hohl klingen mochte, wie es mir selbst schien. »Ist es auch gegen
die Vorschrift, sich im Dienst zu setzen?«
Er nahm Platz, und ich setzte mich ihm gegenüber auf einen
Stuhl mit hoher Rückenlehne. Ich tat dies mit der Absicht, aufzu-
stehen und im Zimmer umherzuwandern, falls seine Fragen mir un-
angenehm werden sollten.
»Und welche Fragen haben Sie?«
»Es geht darum, wo Sie in der Mordnacht waren, Sir. Soweit ich
mich erinnere, hatten Sie erklärt, Sie konnten die Verabredung mit
Miß Day an jenem Abend nicht einhalten.«
Ich nickte zustimmend. »Ja, ich war nach Slough gefahren und
konnte nicht mehr rechtzeitig zurück sein.«
»Ach so.« Er schloß nachdenklich ein Auge. »Was war der Zweck
Ihrer Fahrt nach Slough, Sir?«
Da ich bereits Barbara eine plausible Geschichte erzählt hatte,
wiederholte ich sie jetzt in der gleichen Form, sprach von meinen
geschäftlichen Schwierigkeiten, wie ich auf der Suche nach einer
Stellung nach Slough gefahren war und mich dann in letzter Se-
kunde doch davor drückte, die Sache anzupacken.
»Ich verstehe, wie Ihnen zumute war, Sir.« Er nickte mitfühlend,
als ich geendet hatte, und sah dann nachdenklich vor sich hin.
»Dennoch macht dies die Sache ziemlich unangenehm, Sir.« Er lä-
chelte undurchsichtig. »Ich will damit sagen, daß in diesem Falle
wohl niemand bezeugen kann, Sie in der Mordnacht um halb acht
in Slough gesehen zu haben.«
»Wollen Sie damit sagen, ich hätte gelogen?« fragte ich erregt.
136

Seine Augen wanderten fast mechanisch über mein Gesicht. Oh-
ne den Ausdruck zu ändern, sagte er beiläufig: »Sie sind wohl nie-
mals im Diamantengeschäft tätig gewesen, Mr. Frazer?«
»Im Diamantengeschäft? Natürlich nicht! Ich habe Ihnen doch
schon gesagt, daß ich Ingenieur bin.« Ich stand auf und tat nun,
was ich mir vorgenommen hatte, und wanderte ruhelos im Zimmer
auf und ab.
»Auch das ist nur eine Routinefrage, Sir«, erwiderte er kühl. »Ich
dachte nur, daß dies vielleicht Sie und Cordwell in Amsterdam zu-
sammengeführt haben könnte – eine Art gemeinsamen Interesses
für Diamanten.«
»Wir wollen doch noch einmal unmißverständlich klarstellen, In-
spektor«, konterte ich ärgerlich. »Ich habe Cordwell nur einmal ge-
troffen, und zwar zusammen mit Miß Day. Ich kann mich nicht
einmal mehr erinnern, worüber wir uns damals unterhalten ha-
ben – aber bestimmt nicht über Diamanten.«
Er pustete ein nicht vorhandenes Stäubchen vom Hutrand. »Dann
wird es Sie sicher überraschen zu erfahren, daß Cordwell im Dia-
mantenschmuggel tätig war.«
Ich versuchte, angemessen überrascht auszusehen. »Ist ja unvor-
stellbar! Gerade er schien mir wie ein typischer amerikanischer Tou-
rist und benahm sich auch so.« Ich drehte mich um und wanderte
um Truemans Stuhl herum, krampfhaft überlegend, worauf True-
man wohl hinauswollte. Schließlich erklärte ich: »Ich fürchte, ich
komme nicht hinter den Sinn dieser Andeutungen und Fragen, In-
spektor.«
»Ich komme schon darauf zurück, Sir. Nach allem, was wir über
Cordwell wissen, ist es ziemlich sicher, daß sein Mörder hinter den
Diamanten her war, die Cordwell bei sich hatte.«
»Wissen Sie denn, ob er damals im Besitz von Diamanten war?«
fragte ich mit unschuldiger Miene.
»Seine Tätigkeit bestand darin, sie vom Kontinent nach England
137

zu schmuggeln. Daher ist anzunehmen, daß er auch in der Mord-
nacht welche bei sich hatte.« Trueman drehte sich in seinem Stuhl
um und sah mir scharf ins Gesicht. »Möglicherweise waren die Dia-
manten in dieser Puppe versteckt, Mr. Frazer.«
Ich sah ihn verständnislos an. »Puppe? Was für eine Puppe?«
»Neben der Leiche lag eine Puppe. Sie war aufgeschlitzt.«
Ich schnippte mit den Fingern. »Jetzt erinnere ich mich. Er hatte
in Amsterdam eine kleine Trachtenpuppe als Souvenir gekauft. Eine
männliche Figur in holländischer Tracht auf einem winzigen Fahr-
rad.«
»Genau die ist es, Mr. Frazer.« Trueman nickte zustimmend. »Und
Sie haben sie seit Ihrem Zusammentreffen in Amsterdam nicht
mehr gesehen?«
»Wie sollte ich? Ich habe ja Cordwell nicht mehr gesehen.«
»Sind Sie dessen ganz sicher, Sir? Haben Sie ihn wirklich niemals
mehr gesehen, weder lebend« – er machte eine bedeutungsvolle
Pause – »noch tot?«
»Worauf, zum Teufel, wollen Sie hinaus?« fragte ich wütend und
starrte ihn bissig an.
»Es ist nur wegen Ihrer Fingerabdrücke, Mr. Frazer. Wir fanden
sie an der Tür von Miß Days Wohnzimmer.«
Ich lachte. »Natürlich müssen Sie die gefunden haben. Schließlich
war ich ja am nächsten Morgen dort.« Ich trank mein Glas aus.
»Übrigens, Inspektor, woher wissen Sie, daß es meine waren?«
Er schob eine Hand in die Tasche. »Hierdurch, Sir.« Dabei hielt
er mein Telefonbüchlein in die Höhe.
Ich starrte ihn an und antwortete reichlich lahm: »Dann haben
Sie also das Ding an dem Morgen gestohlen, als Sie hier waren.«
»Ich war so frei, Sir. Obwohl ›gestohlen‹ wohl nicht der zutreffen-
de Ausdruck ist. Sagen wir besser: ›Im Zuge der polizeilichen Unter-
suchung an mich genommen.‹ Das wäre die richtige Formulierung.«
»Drücken Sie es aus, wie Sie es wollen«, antwortete ich ärgerlich.
138

»Von mir aus – Sie haben also die Fingerabdrücke gefunden, die ich
am folgenden Morgen in der Wohnung von Miß Day hinterlassen
habe. Was besagt das?«
»Das würde gar nichts besagen, Sir«, antwortete er kalt. »Nur –
Ihre Fingerabdrücke befanden sich bereits unter denen, die wir am
Abend des Mordes in der Wohnung von Miß Day abgenommen
haben…« Sein Blick wurde hart. »Würden Sie die Güte haben, mir
dies zu erklären, Frazer?«
An der Tür klingelte es. Das Schicksal schien prinzipiell darauf
bedacht zu sein, mich durch Telefonanrufe oder Türschellen vor
unangenehmen Fragen zu bewahren. Trueman erhob sich mit allen
Anzeichen der Bereitschaft, selbst zu öffnen.
»Bemühen Sie sich nicht, Inspektor«, wehrte ich ab und ging zur
Tür. »Es wird ja nicht gleich ein Mann mit einer Pistole sein.«
Es war Richards. Als er mit einem Blick über meine Schulter
Trueman erkannte, erstarrte sein Gesicht. »Wenn Sie beschäftigt
sind, Frazer…«
Ich packte ihn beim Rockaufschlag und zog ihn fast herein. »Kei-
neswegs. Inspektor Trueman wollte ohnehin jetzt gehen, nicht
wahr, Inspektor?«
Etwas widerwillig bewegte Trueman sich in Richtung auf den Aus-
gang. »Ja, Sir. Aber ich werde wahrscheinlich noch einmal kurz mit
Ihnen sprechen müssen.«
»Sollte mich freuen, Sie wiederzusehen«, erwiderte ich. »Übrigens,
darf ich bekannt machen … Mr. Richards … Inspektor Trueman.«
Die beiden Herren begrüßten sich durch leichtes Kopfnicken, wo-
bei es mir vorkam, als zeigte sich in Truemans Gesicht bei der Nen-
nung von Richards' Namen für den Bruchteil einer Sekunde ein
Anflug von Verwirrung. Dann sagte Trueman: »Vielleicht rufen Sie
mich an, Mr. Frazer, wenn Ihnen eine Erklärung für das einfallen
sollte, worüber wir eben gesprochen haben.«
»Ich bin sicher, daß es eine gibt, Inspektor.«
139

Er lächelte trocken. »Ich hoffe es, Sir. Guten Abend.«
»Gibt es Schwierigkeiten?« fragte Richards, als Trueman fort war.
»Und was für welche! Ich habe in Barbara Days Wohnung Finger-
abdrücke hinterlassen.«
»Das macht doch nichts. Er weiß doch, daß Sie dort gewesen
sind.«
»Aber nicht, bevor die Polizei Cordwells Leiche fand.«
»Das kann ich nicht begreifen. Wie konnte er feststellen, daß es
Ihre Abdrücke waren?« Er wandte sich ruckartig zu mir um. »Sie
haben doch nicht schon etwa eine Vorstrafenakte, alter Junge?«
»Noch nicht, aber vielleicht bald. Trueman hat sich selbst bedient
und bei einem früheren Besuch mein Notizbuch für Telefonnum-
mern an sich genommen.« Ich warf einen kurzen Blick hinüber zu
dem Platz, wo Trueman gesessen hatte. »Verdammt noch mal, er
hat das Ding wieder mitgenommen.«
Richards pfiff lautlos vor sich hin. »Da haben Sie sich was Schö-
nes eingebrockt, Frazer. Warum waren Sie nicht vorsichtiger?«
»Schließlich konnte ich nicht wissen, daß ich auf eine Leiche sto-
ßen würde«, rechtfertigte ich mich. »Übrigens, was führt Sie hier-
her?«
Richards holte ein zusammengerolltes Blatt Papier aus der Tasche.
»Ich wollte Sie bitten, sich das einmal anzusehen.«
Als ich es aufrollte, erkannte ich die Blitzlichtaufnahme vom Kopf
eines Mannes, der auf einem Kissen ruhte. Seine Augen waren ge-
schlossen, der Mund stand offen. Entweder war er tot oder doch
ziemlich nahe daran.
»Wer ist das?« fragte ich.
»Ein Mann namens van Dakar. Er ist Holländer.«
Betroffen sah ich mir das Foto an und versuchte, das Gesicht mit
dem des lächelnden Mannes am Obstkarren zu vergleichen. Schließ-
lich erkannte ich die Kopfform, das blonde Haar und die hervortre-
tenden Backenknochen, die mich von der Identität des Mannes
140

überzeugten. »Ja, ich erkenne ihn. Es ist der Mann, der mir am
Obstkarren in der Lennard Street den bewußten Tip gegeben hat.«
»Dort wurde er auch niedergeschossen, in einer Telefonzelle der
Lennard Street, während eines Telefongesprächs.«
»Er telefonierte gerade mit mir«, antwortete ich schnell. »Ich hör-
te durch Geräusche, daß ihm in jenem Augenblick etwas zugesto-
ßen sein mußte.« Nach einem weiteren Blick auf das Foto fügte ich
hinzu: »Daß es so schlimm sein würde, hätte ich nicht gedacht.«
»Diese Aufnahme wurde vor zwanzig Minuten in einem Kranken-
haus gemacht. Er hat das Bewußtsein noch nicht wiedererlangt, und
ich fürchte, das wird wohl auch nicht mehr der Fall sein.« Richards
deutete auf seine Brust, dicht über seinem Herzen. »Er wurde hier
getroffen.«
»Wer hat auf ihn geschossen? Hat man den Täter erwischt?«
Richards schüttelte den Kopf. »Die Schüsse kamen aus einen vor-
beifahrenden Kraftwagen. Der Täter konnte ohne Schwierigkeit ent-
kommen.«
Ich gab Richards das Foto zurück. »Wie kommen Sie an diese Sa-
che?«
»Sie sollten wissen, Frazer, daß auch ich immer noch an diesem
Fall arbeite«, antwortete er zurückhaltend. »Erzählen Sie mir mehr
über diesen Telefonanruf.«
Ich tat mein Bestes, um jede Einzelheit des Telefongespräches mit
van Dakar zu schildern.
»Er hat Sie also gewarnt«, sagte Richards mit grimmiger Miene.
»Ist es nicht eine Ironie, daß er unmittelbar danach selbst niederge-
schossen wurde?«
»Bestimmt. Aber von wem?« Eine leichte Gänsehaut lief mir über
den Rücken, als mir bewußt wurde, daß es sich hier um Fragen han-
delte, auf die wir sehr schnell eine Antwort finden mußten.
»Hat er Ihnen keinen Anhaltspunkt für seine Identität gegeben?«
»Nicht den geringsten. Obgleich ich den Eindruck hatte, er könn-
141

te für eine Dienststelle wie die unsrige tätig sein. Er war doch nicht
etwa einer von Ross' Leuten?«
Richards schüttelte den Kopf. »Vielleicht gehörte er zur holländi-
schen Geheimpolizei und jagte gestohlenen Diamanten nach. Au-
ßerdem besteht natürlich noch die Möglichkeit, daß er selbst im
Diamantengeschäft tätig war. Ich kann mir nicht vorstellen, daß
Ericson ein Monopol auf den ganzen Markt für gestohlene Dia-
manten hat.«
»Aber warum hat van Dakar mich dann vor einer Gefahr gewarnt?
Und warum hat er mir den Tip mit der Lennard Street und ›Fanta-
sie zwei-dreißig‹ gegeben?«
Richards zuckte mit den Schultern. »Vielleicht wollte er nur se-
hen, wie Sie darauf reagieren.«
Plötzlich fiel mir ein, was van Dakar über den Kaffee bei Barbara
gesagt hatte. »Da ist noch etwas Sonderbares«, ergänzte ich meinen
Bericht über das Telefongespräch. »Van Dakar erriet, daß ich heute
abend eine Verabredung mit Barbara hatte.«
»In puncto Erraten scheint er es mit mir aufnehmen zu können«,
murmelte Richards.
Ich überhörte diese Bemerkung und berichtete weiter: »Das Ko-
mische daran ist nur folgendes: Als er hörte, daß wir in einem Re-
staurant und nicht bei Barbara zu Hause essen würden, sagte er,
dann könnte ich meinen Kaffee wenigstens unbesorgt trinken.«
»Hm … das klingt ziemlich mysteriös.« Richards überlegte einen
Augenblick. »Und haben Sie den Kaffee genossen?«
»Barbara mußte die Verabredung aus geschäftlichen Gründen ab-
sagen. Aber sie hat mich nun wirklich eingeladen, sie heute abend
zu besuchen, um eine Tasse Kaffee bei ihr zu trinken.«
Richards grinste mich an, als er sich eine Zigarette anzündete.
»Übrigens, wir sprachen ja schon einmal darüber, Frazer: Sie kön-
nen doch auf sich aufpassen? Und da wir gerade bei diesem Thema
sind – wie steht es mit dem zweiten Besuch beim Tulpenzwiebel-
142

Importeur?«
»Der ist schon fest eingeplant«, antwortete ich sorglos. »Vorher
brauche ich aber noch ein paar Sachen von Ihnen. Setzen Sie sich
doch, Richards, damit wir das in Ruhe besprechen können.«
Als ich Barbara ins Wohnzimmer folgte, wandte sie sich zu mir um
und sagte mit gewinnendem Lächeln, wie zu einem alten Freunde:
»Fühlen Sie sich bitte wie zu Hause, Tim.«
Sie hatte sich umgekleidet und trug ein schlichtes schwarzes Kleid
und als einzigen Schmuck eine Diamantenbrosche. Barbara ging
zum Serviertisch, auf dem eine kleine Kaffeemaschine stand, unter
der eine Spiritusflamme brannte.
»Es macht Ihnen doch nichts aus, Tim, wenn es etwas länger dau-
ert? Einen guten Kaffee zu kochen kommt bei mir einer kultischen
Handlung gleich.«
Ich lächelte zustimmend. »Wie ist denn der Streit mit dem Auk-
tionator ausgegangen?«
»Vivien ist wie immer mit einer solchen Situation glänzend fertig
geworden. Natürlich hat er zunächst ein Feuerwerk an Beredsam-
keit losgelassen. Zum Schluß versprach er aber doch, den Tisch bis
morgen früh zehn Uhr zu liefern.«
»Der Antiquitätenhandel scheint auch nicht gerade uninteressant
zu sein«, erwiderte ich und holte mein Zigarettenetui hervor.
»Der unsere bestimmt nicht! Übrigens hat uns der Kriminalbeam-
te wieder besucht, kurz nachdem Sie heute angerufen hatten.«
»Trueman? Was wollte er denn schon wieder?«
Ich gab ihr Feuer für ihre Zigarette; sie inhalierte langsam den
Rauch und sagte dann gedehnt: »Es ging um Sie, Tim.«
»Wie Sie das so sagen, klingt es ziemlich ominös.«
»In gewisser Weise ist es das auch.« Sie stieß einen leichten Seuf-
zer aus. »Warum müssen wir immer wieder auf diese unglückselige
143

Geschichte mit Cordwell zu sprechen kommen?« Sie sah mich mit
sanften Augen an. »Und dabei gibt es einiges andere, worüber ich
gern mit Ihnen gesprochen hätte, Tim.«
»Wollen wir nicht lieber erst die Wolken verjagen, die über mei-
nem Kopf hängen?«
»Es handelt sich um die Verabredung in der Mordnacht. Ganz of-
fensichtlich ist Trueman nicht so fest davon überzeugt, daß Sie hier
nicht aufgekreuzt sind.« Sie lächelte distanziert. »Er scheint mich
jetzt im Verdacht zu haben, daß ich Ihnen die Wohnungsschlüssel
geliehen hätte.«
Mit einer geringschätzigen Handbewegung schob ich diesen Ge-
danken beiseite. »Und wie kommt Trueman auf diese Kateridee?«
»Er behauptet, man habe Ihre Fingerabdrücke an der Tür meines
Wohnzimmers vorgefunden.«
Zu diesem Zeitpunkt wollte ich ihr noch nichts über mein letztes
Gespräch mit Trueman erzählen. »Warum sollte er auch nicht mei-
ne Fingerabdrücke gefunden haben? Er hat mich doch am Morgen
nach dem Mord an Cordwell hier persönlich angetroffen.«
»Genau das habe ich ihm auch gesagt.« Sie sah mich verwirrt an.
»Er hat sich nicht ganz klar ausgedrückt, doch hatte ich den Ein-
druck, er wollte andeuten, Sie seien am Abend vorher schon hier
gewesen.«
»Sind Sie auch seiner Ansicht?«
»Natürlich nicht!« Sie tat die Frage mit einer ungeduldigen Hand-
bewegung ab. »Das war doch gar nicht möglich. Sie riefen mich ja
aus Slough an, und zwar eine ganze Weile nach halb acht.«
Das Telefon läutete. Sie entschuldigte sich und hob den Hörer
ab. Als der Anrufer sich zu erkennen gab, warf sie mir einen schnel-
len Blick zu. »Ach du bist es, Arthur… Ja. Ich bin allein…« Sie nick-
te ergeben mit dem Kopf, während am anderen Ende der Leitung
ein Wortschwall losgelassen wurde. »Hast du deine Tabletten ge-
nommen, Arthur? … Natürlich dauert es eine Zeit, bis sie wirken,
144

Liebling.« Sie lauschte einem langatmigen Protest. »Also gut, Arthur
– ich komme. In einer halben Stunde bin ich da. Bis bald.«
Mit einem Seufzer legte sie den Hörer auf. »Er scheint wieder ei-
nen Asthmaanfall zu haben. Manchmal frage ich mich allerdings,
ob er nicht bloß auf mein Mitgefühl setzt und diese Anfälle zum
Vorwand nimmt, damit ich zu ihm komme und ihn bemuttere.«
Ich setzte eine Miene höflicher Überparteilichkeit auf. »Dennoch
ist er wohl wirklich zu bedauern, nicht wahr?«
Sie nickte, wenn auch wenig begeistert, eilte dann zum Servier-
tisch zurück und blies die Spiritusflamme unter der Kaffeemaschine
aus. »Himmel! Fast hätte ich den Kaffee vergessen!«
Sie setzte sich und schenkte zwei Tassen ein.
»Nehmen Sie Zucker, Tim?«
»Zwei Stück, bitte.«
»Du meine Güte; mir ist der Zucker ausgegangen. Ist es schlimm,
wenn ich Ihnen statt dessen Süßstoff gebe?« Sie lächelte mich ent-
schuldigend an.
Ich erklärte, es mache mir nichts aus. Barbara holte ein kleines
Fläschchen hervor und ließ zwei winzige weiße Tabletten in meinen
Kaffee fallen. Sie reichte mir die Tasse und lehnte sich in den Ses-
sel zurück.
»Arthur würde wirklich einen Anfall bekommen, wenn er wüßte,
daß Sie jetzt bei mir sitzen und Kaffee trinken.« Sie sah mich amü-
siert an »Vivien behauptet, Arthur sei sehr eifersüchtig auf Sie.«
»Er ist der Typ, der selbst auf den Milchmann eifersüchtig sein
würde«, antwortete ich lachend. »War Vivien dabei, als Trueman
heute zu Ihnen kam?«
Sie nickte. »Ja. Und ich mußte mir auf dem ganzen langen Weg
nach St. Albans Viviens Theorien über den Fall Cordwell anhören.«
»Waren die denn wenigstens plausibel?«
Sie biß sich nachdenklich auf die Lippen, bevor sie antwortete.
»Wissen Sie, Tim, Vivien wird aus Ihnen nicht recht klug. Sie wollte
145

unbedingt wissen, ob Sie mir in Amsterdam den Hof gemacht hät-
ten. Als ich das verneinte, fragte sie: ›Wenn er nicht zu den Män-
nern gehört, die einem verlobten Mädchen nachstellen, warum be-
müht er sich denn jetzt auf einmal so sehr um dich?‹« Mit leiser
Stimme fragte Barbara: »Warum tun Sie das, Tim?«
Wieder einmal rettete mich ein Läuten; diesmal war es an der
Wohnungstür. Sie sah mich schweigend an, erhob sich dann und
ging hinaus in die Diele. Als ich hörte, daß sie die Tür öffnete, ver-
tauschte ich schnell unsere Kaffeetassen.
»Vivien!« hörte ich Barbara rufen. »Ist etwas nicht in Ordnung?«
»Kein Grund zur Aufregung«, erklang Viviens Stimme. »Ich habe
mein Zigarettenetui in deinem Wagen liegenlassen.«
Barbara sagte gerade: »Ach, da hättest du doch nur anzurufen
brauchen«, als Vivien die Tür aufstieß.
Die Überraschung, die sie bei meinem Anblick erkennen ließ, war
um eine Nuance zu auffällig. »Sie sind der letzte, den ich hier an-
zutreffen erwartete«, sagte sie affektiert und wandte sich dann Bar-
bara zu. »Es tut mir leid, Darling. Hätte ich gewußt, daß du Besuch
hast, dann wäre ich nicht so hereingeplatzt.«
»Das macht nichts«, erwiderte Barbara mit gekünsteltem Lächeln.
»Hast du das Etui wirklich im Wagen vergessen? Ich kann mich
nicht erinnern, daß du unterwegs geraucht hast.«
»Dann habe ich es in St. Albans im Lokal liegenlassen. In diesem
Falle wird es wohl verloren sein.«
»Vermutlich wirst du es in der Tasche des Mantels finden, den du
vorhin getragen hast«, antwortete Barbara kühl. »Da du nun einmal
hier bist, kannst du auch eine Tasse Kaffee mit uns trinken.«
»Störe ich auch wirklich nicht?«
»Aber nein, ich hole noch eine Tasse.«
Vivien zuckte unmerklich mit den Schultern und lächelte mich
dann an. »Freut mich, Sie wiederzusehen«, begann sie, während sie
es sich in einem Sessel bequem machte. »Es war wirklich unklug
146

von mir, daß ich nicht vorher angerufen habe.«
»Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen«, erwiderte ich. »Ich
war ohnehin im Begriff zu gehen.«
Barbara brachte eine dritte Tasse. »Und ich muß übrigens gleich
zu Arthur. Er hat vorhin angerufen…« Sie stellte das Kaffeegedeck
klappernd auf den Tisch, als das Telefon erneut läutete. »Sollte mich
nicht wundern, wenn es Arthur wäre, der wissen will, warum ich
nicht schon eine Sekunde nach seinem Anruf zu ihm gestürzt bin.
Wäre typisch für ihn.«
»Läßt er dich denn niemals von der Leine, Barbara?« fragte Vivien
mit hochgezogenen Augenbrauen. Sie nahm die gefüllte Kaffeetasse
und rührte mechanisch mit dem Löffel darin.
Barbara hatte inzwischen schon wieder aufgelegt und kehrte zum
Tisch zurück. »Ja, er war es. Ich soll sofort zu ihm kommen; aber
eine Tasse Kaffee werde ich mir vorher wohl noch genehmigen kön-
nen.« Sie sah auf Vivien herab. »Ich glaube, du hast meine Tasse ge-
nommen.«
»Tut mir leid, Darling…«, begann Vivien. »Ich gieße dir gleich
eine neue Tasse ein…«
Ich kippte schnell meinen Kaffee hinunter. »Nanu!« rief ich aus,
wobei ich Barbaras Gesicht beobachtete. »Es scheint eine allgemei-
ne Verwechslung der Tassen gegeben zu haben. Dieser Kaffee hier
ist nicht gesüßt.«
»Ach, Tim. Dann haben Sie meine erwischt. Schadet nichts, ich
hatte noch nicht angefangen. Nehmen Sie doch noch etwas Süß-
stoff…«
»Danke, bemühen Sie sich nicht. Ich muß jetzt wirklich gehen.«
Barbara griff nach ihrer Handtasche. »Ich auch. Arthur ist ziem-
lich schlechter Laune.«
Als ich aufstand, sagte Vivien entschlossen: »Du kannst mir Mr.
Frazer nicht so einfach entführen, Barbara. Ich verlasse mich da-
rauf, daß er mich nach Hause fährt, sobald ich meinen Kaffee ge-
147

trunken habe.«
»Aber«, meinte Barbara offensichtlich ärgerlich, »du hättest zu-
mindest fragen können, ob Tim nichts dagegen hat.« Sie lächelte
mich an. »Ich werde Sie im Laufe des morgigen Tages anrufen.«
»Also dann bis morgen früh, Darling!« rief Vivien ihr nonchalant
zu, während sie sich eine Zigarette anzündete. »Und Arthur kannst
du von mir bestellen, er sei deiner ein wenig zu sicher.«
»Das ist wirklich ein eigenartiger Mann«, seufzte Vivien, als Barbara
uns verlassen hatte. »Er betrachtet andere Menschen als persönli-
ches Eigentum, um es milde auszudrücken.«
»Kranke Menschen tun das gewöhnlich«, entschuldigte ich ihn.
»Ich habe ihr schon hundertmal erklärt, daß sie einen Invaliden
am Halse haben wird, wenn sie ihn wirklich heiraten sollte. Können
Sie nicht versuchen, ihr diese Ehe mit Arthur auszureden?«
»Ich?« protestierte ich. »So gut bekannt sind Barbara und ich
noch nicht, daß ich es wagen könnte, mich in ihre persönlichsten
Angelegenheiten einzumischen.«
»Sie mögen recht haben, obwohl« – Vivien blies langsam den
Rauch durch die vorgeschobenen Lippen – »obwohl Sie doch Ihre
persönlichen Angelegenheiten mit Barbara zu erörtern scheinen.«
»Wie meinen Sie das?«
»Nun, Ihre geschäftlichen Angelegenheiten zumindest. Wie Bar-
bara mir erzählte, ist Ihre Ingenieurfirma in Schwierigkeiten gera-
ten.«
»Ich habe zwar etwas davon erwähnt, doch wundere ich mich,
daß Barbara das hinausposaunt haben sollte.«
Vivien lachte. »So schlimm ist es nun auch wieder nicht, Mr. Fra-
zer. Sie wissen doch, wie das so vor sich geht, wenn zwei Mäd-
chen ihre kleinen Geheimnisse miteinander austauschen.« Sie trank
den Rest des Kaffees aus. »Ich nehme an, Sie werden Ihre Firma
148

wieder in Gang bringen, sobald Sie festen Boden unter den Füßen
haben?«
»Ich hoffe es«, antwortete ich kurz. »Sobald ich etwas Kapital in
die Hände bekomme.«
»Das ist wohl nicht so einfach.« Sie schlug die Beine übereinan-
der. »Hat Barbara Ihnen eigentlich erzählt, daß Inspektor Trueman
sie heute nachmittag wieder aufgesucht hat?«
»Sie hat es nebenbei erwähnt.«
»Ich habe zwar nicht richtig zugehört, doch war es unvermeid-
lich, daß ich einige seiner Fragen mitbekam. Er schien sehr an Ihrer
Verabredung mit Barbara interessiert.«
»Meinen Sie die in der Mordnacht? Ich wurde in Slough aufge-
halten und konnte nicht rechtzeitig zurück sein.«
»Und natürlich hätten Sie auch gar nicht in die Wohnung gelan-
gen können, selbst wenn Sie rechtzeitig dagewesen wären. Barbara
wurde von Arthur aufgehalten – wie gewöhnlich.« Sie ließ sorglos
die Asche ihrer Zigarette auf den Teppich fallen. »Wissen Sie, dieses
Verfahren mit den Fingerabdrücken hat mich stets fasziniert. Kann
man wirklich genau den Tag feststellen, an dem ein Fingerabdruck
gemacht worden ist?«
»Ich möchte annehmen, daß Sie die Antwort auf diese Frage ken-
nen. Warum fragen Sie mich?« stellte ich die Gegenfrage.
»Das war wohl töricht von mir, nicht wahr? Natürlich würden
nur die Fingerabdrücke von Bedeutung sein, die aus der Mord-
nacht stammen.« Sie hob das elegant bestrumpfte schlanke Bein et-
was an und besah sich interessiert die Fußspitze. »Ich hörte True-
man sagen, Cordwell sei Mitglied einer Bande von Diamanten-
schmugglern gewesen.«
»Das hat er mir auch erzählt«, erwiderte ich, wobei mir einfiel,
daß Barbara mir von diesem Teil ihres Gespräches mit Trueman
nichts erzählt hatte. Wollte sie es absichtlich nicht erwähnen? Aber
wir waren schließlich mehrfach unterbrochen worden, und da konn-
149

te es ihr ohne weiteres entfallen sein.
»Ich habe mich schon gefragt, ob Cordwell vielleicht Diamanten
bei sich hatte, als er ermordet wurde«, äußerte Vivien. »Wenn ja,
muß der Mörder einen guten Fang gemacht haben, meinen Sie
nicht auch?«
Ganz augenscheinlich steuerte sie auf ein bestimmtes Ziel los, so
daß ich mich entschloß, darauf einzugehen. »Aber hätte er etwas
mit den Diamanten anfangen können?« fragte ich mit unschuldiger
Miene. »Er kann doch nicht einfach mit gestohlenen Diamanten in
einen Juwelierladen gehen und sie dort verkaufen.«
»Es gibt aber Leute, die solche Geschäfte tätigen. Cordwell muß
einen von ihnen gekannt haben.«
»Dann muß das auch der Mann gewesen sein, mit dem er die
Verabredung hatte«, erwiderte ich, als sei mir plötzlich die Erleuch-
tung gekommen. »Ericson! Jetzt weiß ich auch, warum Trueman
mich immer wieder nach Ericson gefragt hat.«
»Er hat uns alle danach gefragt: mich, Barbara, Arthur –« Vivien
lachte amüsiert. »Jetzt weiß ich auch, was ich zu tun habe. Sollte je-
mals ein Mann mit gestohlenen Diamanten zu mir kommen, die er
loswerden will, dann schicke ich ihn einfach zu – Ericson!«
»Wenn Sie ihn finden«, gab ich zu bedenken und lachte ebenfalls.
»Die Polizei kann es anscheinend nicht.«
»Das stimmt.« Sie ließ ihren Zigarettenstummel in den Kaffeesatz
fallen. »Sie sehen, Mr. Frazer, es würde Ihnen gar nichts nützen, ge-
stohlene Diamanten zu finden, weil Sie nicht in der Lage wären, sie
auch gewinnbringend zu verkaufen.« Sie lächelte wehmütig. »Was
für ein schrecklicher Gedanke. Da wandert nun jemand mit dem
potentiellen Kapital umher, mit dem er seine Firma wieder auf die
Beine stellen könnte, und kann nicht das geringste damit anfan-
gen.«
»Das ist so, als wolle er eine Nähnadel in einem Heuhaufen su-
chen«, pflichtete ich ihr scheinheilig bei. »Wie mag dieser Ericson
150
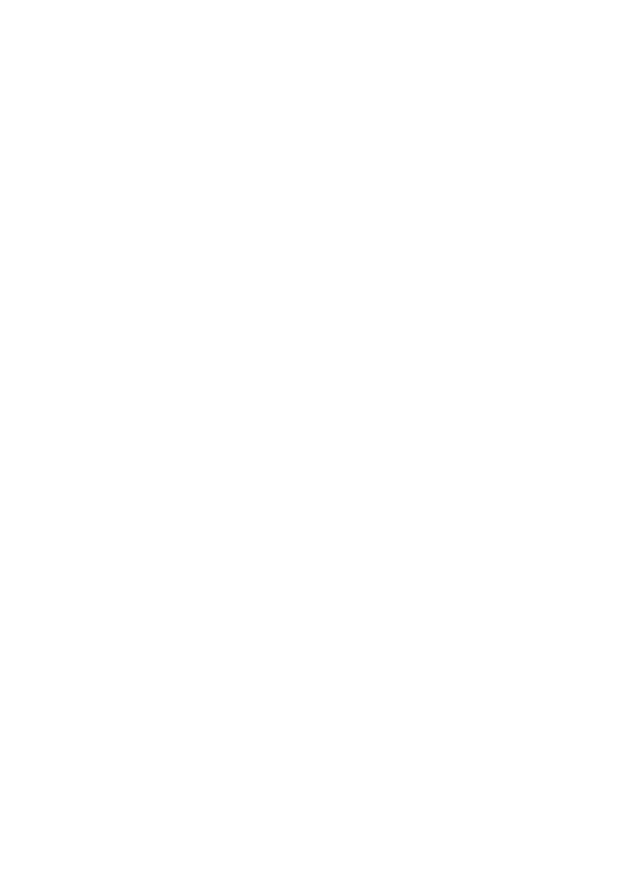
wohl aussehen?«
»Ich nehme an, wie ein reputierlicher Bankbeamter.« Sie stand
auf. »Leider habe ich allzu selbstverständlich über Sie verfügt. Wür-
de es Ihnen etwas ausmachen, mich in Ihrem Wagen mitzuneh-
men?«
»Aber keineswegs. Wo darf ich Sie hinbringen?«
»Wäre Sloane Square Ihnen recht?«
»Das liegt sogar auf meinem Weg.«
An der Wohnungstür blieb sie nachdenklich stehen. »Wissen Sie,
ich habe so den Eindruck, als ob diese Unannehmlichkeiten Barba-
ra dazu bringen, daß sie Arthur plötzlich in ganz neuem Licht sieht.
Bisher hat er auch nicht für fünf Pfennig Interesse für die vielen
Probleme gezeigt, die seitdem auf Barbara eingestürmt sind. Was sie
durchmachen muß, kümmert ihn offensichtlich überhaupt nicht.«
Sie hob bedeutungsvoll die Augenbrauen. »Unter uns gesagt – Ihr
Mitgefühl hat Barbara sehr wohlgetan, Mr. Frazer. Das hat sie mir
erzählt.«
Ich murmelte irgendeine Phrase von der Mannesschulter, an der
eine zarte Frau sich ausweinen kann.
»Barbara ist ein so reizendes Wesen…« Sie lächelte mich wissend
an. Dann gab sie mir mit ihrer Handtasche einen kleinen, freund-
lichen Schubs: »Sie sollten sich beeilen, Mr. Frazer, das Kapital zu
beschaffen, um Ihre Firma endlich wieder in Gang zu bringen.«
151

19
ls ich am nächsten Morgen ins Wohnzimmer trat, stand Mrs.
Glover mit dem Staubwedel in der Hand neben dem Telefon.
Kaum war ich eingetreten, begann sie das Telefon mit ungewohnter
Energie abzustauben. Daran merkte ich, daß sie irgend etwas in pet-
to hatte, um ihre persönliche Neugier zu befriedigen.
A
A
»Was ich Sie schon fragen wollte, Mr. Frazer«, begann sie, »haben
Sie den Merkkalender vom Telefon in Verwahrung genommen?«
Ich setzte mich hinter mein Frühstücksgedeck. »Er liegt in meiner
Schreibtischschublade. Brauchen Sie eine bestimmte Telefonnum-
mer?«
Einen Augenblick lang war sie betroffen, erholte sich dann aber
rasch und begann, einen makellos sauberen Messingleuchter zu po-
lieren. »Haben Sie inzwischen herausgefunden, wer die Dame war,
die angerufen hat?«
Natürlich war es Barbara gewesen. Sie hatte es mir erzählt, als wir
uns in der Espressobar trafen. Doch war ich nicht gewillt, Mrs. Glo-
vers Neugier in diesem Punkt zu befriedigen. Daher schüttelte ich
den Kopf und goß mir Kaffee ein.
»Ein paar Häuser weiter stand heute früh ein Polizeiwagen«, setzte
sie hartnäckig das Gespräch fort. »Ich nehme an, die beobachten je-
manden.«
Das nahm ich auch an. Im stillen verfluchte ich Trueman. In mei-
nen Plänen für diesen Morgen war ein Katz-und-Maus-Spiel mit der
Polizei nicht vorgesehen. Immerhin schien es mir nützlich, heraus-
zufinden, in welcher Richtung der Wagen sich postiert hatte.
Ich versuchte es mit der bei Mrs. Glover so beliebten indirekten
Methode. »Haben Sie zufällig gesehen, ob der Flieder in den Anla-
152

gen schon aufgeblüht war, als Sie heute früh vorbeikamen, Mrs.
Glover?«
Meine Frage zeitigte dieselbe Wirkung, als hätte ich versucht, ei-
nen Hund mit einer Pille von einem Stück Fleisch abzulenken.
»Wenn ich Sie wäre, Mr. Frazer, würde ich heute den Hinteraus-
gang benutzen«, riet sie mir und fuchtelte mit dem Staubwedel in
der Luft. Als es kurz danach an der Tür läutete, stieg die Spannung
bei ihr noch beträchtlich. »Soll ich sagen, Sie sind nicht zu Hause,
Sir?« wisperte sie mir eifrig zu.
Ich überwand meinen aufkommenden Ärger und lachte. »Sie sind
mir vielleicht ein Herzchen, Mrs. Glover. Lassen Sie den Herrn her-
ein und bringen Sie uns noch eine Tasse.«
Wie ich erwartet hatte, war es Richards, der mit einer kleinen Le-
dertasche in der Hand erschien. »Guten Morgen, Frazer. Ich bringe
Ihnen das Gewünschte.«
»Prächtig. Sie trinken doch eine Tasse mit?«
Er nickte lächelnd. »Da wir gerade von Kaffee sprechen…«, be-
gann er, offensichtlich in Anspielung auf meine Verabredung mit
Barbara vom Abend zuvor.
»Vergessen wir das!« winkte ich ab. »War eine Fehlanzeige. Ich ha-
be die Tassen vertauscht.« Dann gab ich ihm einen ausführlichen
Bericht über den Ablauf des Abends. »Barbara Day reagierte völlig
unbefangen; und Vivien Gilmore zeigte nicht die geringsten Anzei-
chen einer Drogeneinwirkung. Im Gegenteil – sie war gedanklich
besonders aktiv.«
»Das klingt so, als wollte van Dakar Sie nur einschüchtern.«
»Sieht ganz so aus«, pflichtete ich ihm bei. »Obwohl er Barbara
offensichtlich nicht mehr traute, als Sie und Ross es tun.«
Richards faßte sich an die Nasenspitze. »Und Sie selbst sind im-
mer noch fest davon überzeugt, daß man ihr trauen kann?«
»Mit einem Vorbehalt, ja.« Ich wechselte schnell das Thema. »Üb-
rigens, wie geht es van Dakar?«
153

»Ich habe heute früh mit dem Krankenhaus telefoniert. Er hat das
Bewußtsein wiedererlangt, und die Ärzte glauben, er hat eine Chan-
ce durchzukommen. Ich werde mich heute nachmittag mit ihm un-
terhalten, wenn es mir gestattet wird.«
Mrs. Glover kam mit dem zweiten Kaffeegedeck herein, beäugte
Richards von der Seite und kam dann wohl zu der Ansicht, es
handle sich um einen Geschäftsfreund. Sie zog sich enttäuscht zu-
rück.
Ich goß Richards Kaffee ein. »Hatten Sie keine Schwierigkeiten,
Ross zu überreden, damit er die Sachen herausrückte?«
Richards öffnete die kleine Ledertasche auf seinem Schoß. »An
die Diamanten wollte er zuerst nicht so recht heran.«
»Das hatte ich mir schon gedacht. Aber keine Sorge, ich werde sie
nicht verlieren.«
Ich öffnete den Juwelenkasten, den er mir reichte, und sah mir
die beiden Diamanten, die darin lagen, genau an. Auf dem schwarz-
samtenen Untergrund sahen sie recht eindrucksvoll aus.
Richards wühlte noch einmal in seiner Ledertasche. »Und hier ist
auch das Metronom, das Sie Dempsey abgenommen haben.« Er
stellte es auf den Tisch.
»Wenn ich nur wüßte, was ich hätte sagen müssen, als er das
Ding auf den Tisch stellte.« Ich rieb mit dem Finger über die po-
lierte Oberfläche. »Ich habe so eine Ahnung, als ob das der Schlüs-
sel zu allem ist, was wir wissen wollen.«
»Womit wir wieder beim Fall Salinger wären«, antwortete Richards
warnend. »War er der ehrbare Mann, für den Ross ihn hält? Oder
war er ein Mitglied der Schmugglerbande? Das ist alles.« Richards
sah mich einen Augenblick lang besorgt an. »Werden Sie lieber
nicht zu ehrgeizig, Frazer.«
»Ich werde es beherzigen, Richards«, antwortete ich nicht gerade
aufrichtig. Ganz privat war ich zu sehr in die Angelegenheit verwi-
ckelt, als daß ich mich mit weniger als der restlosen Aufklärung des
154

Falles Salinger zufriedengegeben hätte.
»Und hier ist noch etwas, was Sie haben wollten.« Richards holte
eine kleine automatische Pistole hervor und balancierte sie auf der
Handfläche. »Ross zog ein ziemlich langes Gesicht, als ich ihm sag-
te, Sie wollten eine Anleihe bei unserer Rüstkammer machen.« Er
gab mir die Waffe vorschriftsmäßig mit dem Kolben nach vorn.
»Und glauben Sie nicht, daß Sie von unserer Dienststelle einen Or-
den erhalten, wenn Sie das Ding benutzen.«
Ich ließ die Pistole in meine Jackentasche gleiten. »Nur, um mei-
nen Überredungskünsten etwas Nachdruck zu verleihen«, erläuterte
ich grinsend meine Absicht.
Richards lachte zurück, schloß seine Aktentasche und ließ die
Schlösser einschnappen. »Haben Sie sich schon Gedanken darüber
gemacht, auf welche Weise Sie Dempsey zum Reden bringen wol-
len?«
»Wie gesagt, mit meiner ganz persönlichen Überredungsgabe.«
»Tatsachen oder Fiktion?«
»Vielleicht von beidem etwas«, antwortete ich.
Bei meinem ersten Besuch in Dempseys Büro hatte ich unweit sei-
nes Hauses eine kleine Snackbar bemerkt, die von den Dienstmän-
nern des Covent Garden besucht wurde, wenn die anderen Kneipen
geschlossen waren. Ich vermutete, daß Dempsey irgendwann einmal
aus seinem Büro kommen würde, um in diesem Lokal seine Ther-
mosflasche mit Kaffee füllen zu lassen und sich ein paar belegte
Brote zu kaufen.
Ich stellte mich in den Eingang eines gegenüberliegenden Lager-
hauses, von wo aus ich Dempseys Bürohaus im Auge behalten
konnte. Nur eine halbe Stunde brauchte ich zu warten, dann er-
schien er auf der Bildfläche, die Thermosflasche unter dem Arm.
Als ich sah, daß er die Snackbar betrat, eilte ich über die Straße
155
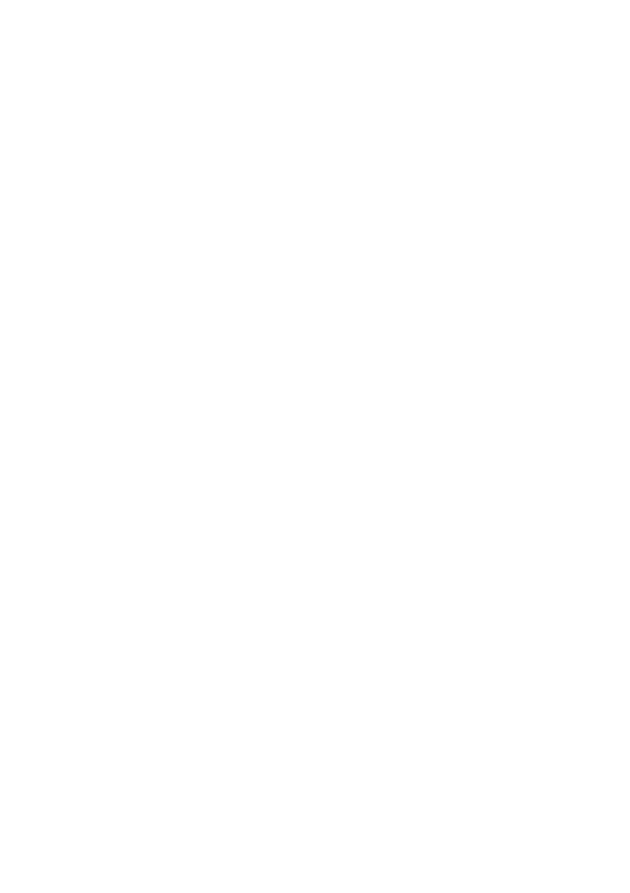
in das Haus und durchquerte mit schnellen Schritten den schwach
erleuchteten Korridor zu seinem Büro. Hatte er die Tür abgeschlos-
sen oder nicht? Das war jetzt die große Frage. Aber das Glück blieb
mir treu. Ich huschte ins Zimmer und schloß die Tür hinter mir.
Ich ging zu Dempseys Stuhl, packte das Metronom aus und stell-
te es mitten auf den Schreibtisch. Dann drehte ich den Stuhl um,
holte die Pistole hervor und legte sie griffbereit neben das Metro-
nom.
In diesem Augenblick hörte ich auch schon schwere Schritte den
Flur entlangkommen. Vor sich hin brummend, betrat Dempsey das
Zimmer und schloß die Tür hinter sich. Er war noch ganz in die
Überschriften der Zeitung vertieft, die er sich auf der Straße gekauft
hatte.
Als er sich umwandte, fiel sein Blick zuerst auf das Metronom.
Einen Augenblick starrte er es unverwandt an, dann wanderten sei-
ne Augen langsam zu der Pistole, die ich auf ihn richtete. Die Ther-
mosflasche rutschte ihm unter dem Arm weg und schlug krachend
auf dem Boden auf.
»Guten Morgen, Mr. Dempsey«, begrüßte ich ihn freundlich. »Sie
sind wohl gerade dabei, in der Zeitung einen Sieger für Fantasie
zwei-dreißig ausfindig zu machen?«
Nun entglitt ihm auch die Zeitung. »Frazer!« Er fuhr sich mit der
Zungenspitze über die Lippen. »Was tun Sie hier?!« Seine Stimme
klang heiser, beinahe erstickt.
»Ich bringe Ihnen nur Ihr Metronom zurück.«
Ohne die Augen von meinem Gesicht zu wenden, schob er die
Thermosflasche mit dem Fuß beiseite. »Wozu?«
»Unsere Unterhaltung wurde damals so abrupt beendet, noch be-
vor wir überhaupt auf das Metronom zu sprechen kamen.« Ich lä-
chelte. »Da hielt ich es für eine gute Idee, wenn wir beide uns noch
einmal ganz freundschaftlich unterhielten.«
»Ich verstehe«, antwortete er mit ängstlichem Blick.
156

»Kommen Sie nicht auf dumme Gedanken, Dempsey«, warnte ich
ihn und zog den Finger am Abzug etwas an. »Ich würde Sie wahr-
scheinlich kaum tödlich treffen; aber auf diese kurze Entfernung
kann ich mir schon den passenden Zielpunkt genau aussuchen.«
Er gab einen wehleidigen Laut von sich. »Was wollen Sie von
mir?«
»Sehen Sie, so ist es schon viel besser«, antwortete ich umgänglich
und wies mit meiner Pistole auf den Stuhl. »Setzen Sie sich doch.«
Er ließ sich schwerfällig auf den Stuhl fallen und legte ein Päck-
chen mit belegten Broten auf den Tisch. »Haben Sie etwas dagegen,
wenn ich ein Sandwich esse?« fragte er und wickelte die Brote aus.
»Essen Sie nur. Den Kaffee werden wir uns heute schenken.«
Er sah mich einen Augenblick säuerlich an, da ihm wohl einfiel,
welchen Gebrauch ich bei unserem letzten Zusammentreffen von
dem heißen Kaffee gemacht hatte. Dann schob er mit einer plötz-
lichen Bewegung die Brote zu mir herüber. »Corned beef – eben
frisch geschnitten.«
Ich schüttelte ablehnend den Kopf. »Kommen wir zur Sache,
Dempsey … zu diesem Metronom. Als Sie es damals auf den Tisch
stellten, erwarteten Sie doch, daß ich daraufhin etwas ganz Bestimm-
tes sagen würde, nicht wahr?«
Er nahm sich ein Sandwich. »Meinen Sie?« fragte er vorsichtig.
»Warum haben Sie es denn nicht gesagt?«
»Sie werden sich vielleicht erinnern, daß mir nicht viel Zeit dafür
blieb, bis zu dem Augenblick, da Sie die Pistole zückten.«
»Heutzutage weiß man nie, woran man mit den Leuten ist. Es
hätte ja auch ein Überfall sein können.« Er biß herzhaft in das Sand-
wich. »Woher sollte ich wissen, ob Sie nicht auch bei Ihrem letzten
Besuch einen Überfall mit dieser Pistole auf mich vorhatten – so,
wie Sie es jetzt tun, Frazer?«
»Ach, damals hatte ich gar keine Pistole bei mir, weil ich keine
Diamanten zu beschützen brauchte.«
157

Er dachte über das nach, was ich ihm eben gesagt hatte, während
er schmatzend kaute. »Haben Sie denn jetzt welche bei sich?« ver-
suchte er mich auszuhorchen.
Ich holte das Juwelierkästchen aus meiner Tasche, drückte auf
den Verschluß und brachte die beiden Steine zum Vorschein.
Dempseys Augen wurden groß und größer.
Er wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. »Darf ich
sie mir einmal ansehen, Mr. Frazer?« Er erhob sich etwas von sei-
nem Stuhl und langte über den Tisch.
Ich legte blitzschnell meine Hand über das Kästchen und gab
ihm mit dem Pistolenlauf einen leichten Schlag auf den Arm. »Las-
sen Sie gefälligst Ihre Hände seitwärts auf dem Tisch liegen, Demp-
sey!«
»Würden Sie mir wenigstens die Lupe geben?« bat er. »In der zwei-
ten Schublade von oben.«
Ich fand sie und schob sie ihm hinüber.
Er klemmte sie in ein Auge und besah sich sachverständig die
Diamanten. »Was verlangen Sie dafür, Frazer?« fragte er ganz sach-
lich, als er die Lupe wieder absetzte.
»Nicht den Preis für einen Mittelsmann. Ich möchte mit dem
Boß persönlich verhandeln.«
Sein Gesichtsausdruck wandelte sich. »Wer sagt Ihnen, daß ich ei-
nen Boß habe?«
»Cordwell.«
Er wollte das zur Hälfte gegessene Sandwich gerade zum Munde
führen, legte es aber wieder zu den anderen zurück. »Sind Sie ein
Freund von Cordwell?«
»Ich kenne ihn von Amerika her«, antwortete ich ausweichend.
»Wir haben früher einmal gemeinsame Geschäfte gemacht.«
»Was für Geschäfte?«
»Wir wollen jetzt damit keine Zeit verlieren«, erwiderte ich kurz.
»Ich hatte mehrere Jahre hindurch den Kontakt mit ihm verloren.
158

Vor einer Woche traf ich ihn ganz zufällig in Amsterdam. Wir ha-
ben gemeinsam eine Nacht durchgebummelt.« Ich schüttelte ge-
ringschätzig den Kopf. »Es war immer noch das alte Lied. Wenn
Cordwell ein paar Schnäpse getrunken hatte, dann konnte er den
Mund nicht halten. Er wurde dann stets sehr redselig.«
Dempsey fuhr sich mit der Hand über die wenigen Haare. »Red-
selig worüber?«
»Über seine Tätigkeit, seine Geschäfte. Da wir in Amerika einst
gut zusammengearbeitet hatten, war er nicht zurückhaltend.«
»Ich habe ja schon immer gesagt, daß dieses Großmaul uns noch
mal in Schwierigkeiten bringen wird!« Dempsey sah mit scheelem
Blick auf die Diamanten. »Also, was erzählte er?«
»Er begann damit, daß er Diamanten vom Kontinent nach Eng-
land schmuggle«, erzählte ich und war selbst überrascht, wie leicht
jetzt alles über die Bühne lief, ganz so, wie ich es erhofft hatte.
»Nach ein paar Schnäpsen hat er dann die Katze aus dem Sack ge-
lassen. Er erzählte von der gut organisierten Schmuggelbande für
Diamanten und brüstete sich damit, wie groß die Organisation sei,
für die er arbeite. Er sprach auch von dem narrensicheren Kodesys-
tem, das die Organisation benutzt.«
»Da haben Sie also die ganze Sache aufgeschnappt«, murmelte
Dempsey, der von meinem sorgsam gesponnenen Garn offensicht-
lich beeindruckt war. »Wir wunderten uns schon, wie Sie an den
Tulpenkatalog und das Kodewort geraten waren.«
»So – da hat also schon eine kleine Aufsichtsratssitzung stattge-
funden?« fragte ich lachend. »Welcher der Direktoren war denn an-
wesend, außer Ihnen und dem Vorsitzenden?«
»Sie sitzen jetzt nicht einem Betrunkenen in der Bar gegenüber,
Mr. Frazer. Und ich bin nicht Cordwell. Sie können sich also die
Mühe sparen, einen Namen aus mir herauszulocken.«
»Na schön. Dann werde ich Ihnen einen Namen nennen. Ericson.
Er ist der Boß Ihrer Organisation.«
159
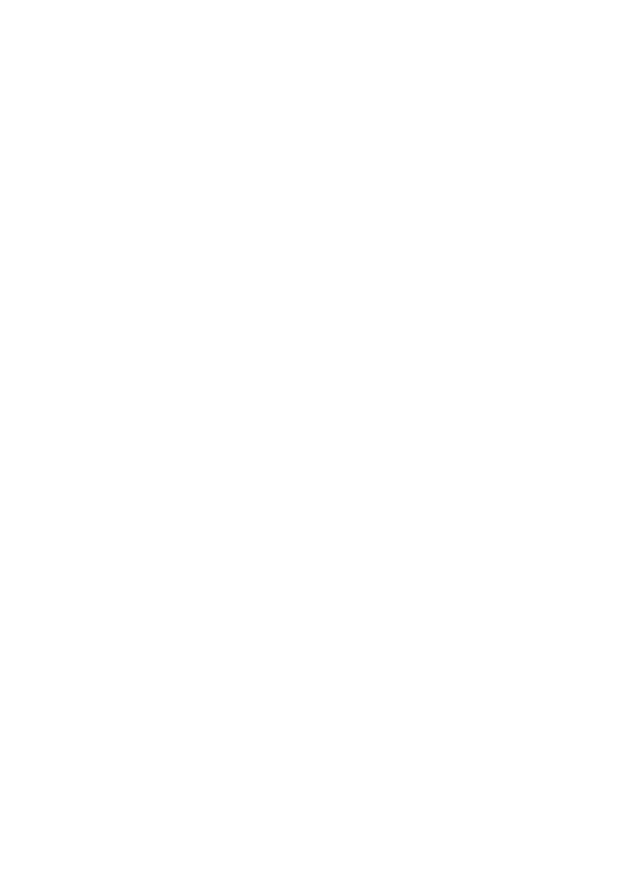
»Cordwell!« Dempsey legte seine ganze Verachtung in dieses
Wort. »Dieser Bastard mit seiner verflucht losen Zunge!« Seine flei-
schigen Finger spielten mit den Diamanten. »Und jetzt erscheinen
Sie also hier auf der Bildfläche und verlangen, daß wir Ihnen die
Dinger abkaufen? Dazu müssen wir erst einmal wissen, woher Sie
die haben.«
»Ich habe sie von Cordwell bekommen.«
Er ließ erstaunt den Unterkiefer sinken. »Er hat sie Ihnen ver-
kauft?«
»Nein.« Ich legte eine Kunstpause ein und sprach dann in ver-
traulichem Ton weiter: »Ich will ganz ehrlich zu Ihnen sein, Demp-
sey. Ich habe so das Gefühl, daß Ericson Ihnen gegenüber nicht
ganz aufrichtig ist.«
»Der sollte lieber nicht versuchen, irgendwelche Tricks anzuwen-
den«, reagierte Dempsey ärgerlich. Dann fragte er reservierter: »Was
meinen Sie damit?«
»Haben Sie jemals von einer Dame namens Barbara Day gehört?«
fragte ich und beobachtete ihn scharf. Er schüttelte den Kopf mit
so verwirrtem Blick, daß man ihm glauben konnte; ich fuhr fort:
»Ich traf sie in Amsterdam. Sie war mit Cordwell gut bekannt. Als
ich wieder in London war, lud sie mich zu einem Drink in ihre
Wohnung ein. Ich ging zu ihr, aber niemand öffnete auf mein Läu-
ten. Gerade als ich gehen wollte…« Ich sah ihn stirnrunzelnd an.
»Sie werden es mir nicht glauben, Dempsey…«
»Sie können es ja mal versuchen«, erwiderte er. »Also was war
dann?«
»Gerade als ich mich umdrehte und weggehen wollte, schob je-
mand einen flachen Schlüssel unter dem Türschlitz durch. Ich hob
ihn auf und öffnete die Tür. In der Wohnung war niemand außer
einer Leiche auf dem Fußboden im Wohnzimmer.«
Er befeuchtete die Lippen. »Cordwell?«
Ich nickte. »Er war ermordet worden, man hatte ihm den Schädel
160

eingeschlagen. Da fiel mir ein, was er mir über die Diamanten-
schmuggelorganisation erzählt hatte, und ich dachte mir gleich, daß
sein Tod damit in Zusammenhang stehen müßte. Und noch etwas
anderes fiel mir ein: Drüben in den Staaten hatte er oft Heroin in
seiner Zigarrenspitze über die mexikanische Grenze geschmuggelt.
Es wäre ja möglich, kombinierte ich, daß er dieselbe Methode auch
bei Diamanten angewendet hat. Er hatte die Zigarrenspitze nicht bei
sich. Aber gerade als ich die Wohnung verlassen wollte, sah ich sie
im Kamin liegen.« Ich deutete mit der Pistole auf die Diamanten.
»Die beiden da habe ich dann in der Zigarrenspitze gefunden.«
Dempsey atmete schwer, sein schwammiges Gesicht war vor Angst
mit Schweißperlen bedeckt. »Und Sie meinen, daß Ericson…?«
»Tja, man kann da natürlich nur vermuten«, zuckte ich mit den
Schultern. »Aber wenn er es getan hat, dann hat er die Diamanten
jedenfalls nicht bekommen.«
Dempsey preßte die Hand auf den Magen. Mit schmerzverzerr-
tem Gesicht stieß er hervor: »Und was jetzt, Frazer?«
»Sie setzen sich mit Ericson in Verbindung. Sagen Sie ihm, ich
hätte die Diamanten und sei zu einem Geschäft bereit. Sonst weiter
keine Fragen. Ich werde ab sieben Uhr abends in meiner Wohnung
sein.«
Ich langte nach den Diamanten, legte sie in das Kästchen, ver-
schloß es und ließ es in meiner Tasche verschwinden. »Übrigens
können Sie ihm auch noch den Tip geben, daß ich kein so harm-
loser Trottel wie Cordwell bin.«
Ich stand auf und ging rückwärts zur Tür. »Tut mir leid, daß ich
Ihr zweites Frühstück unterbrochen habe, Dempsey.«
Sobald ich im Flur war und die Tür hinter mir geschlossen hatte,
schob ich die Pistole in meine Tasche und eilte auf die Straße.
Auf der Suche nach einem Taxi hörte ich ein energisches Hupen.
Als ich mich umschaute, lehnte Richards sich aus der offenen Tür
seines Wagens. Ich ging zurück und öffnete die entgegengesetzte
161

Tür.
»Der Fluchtwagen«, erklärte Richards. »Nur für den Fall, daß Sie
Dempsey eins auf den Pelz brennen und dann schnell verschwin-
den mußten. Ich nehme an, Sie können jetzt einen Drink gut ge-
brauchen. Wir fahren schnell zu Nags. Dort ist um diese Zeit be-
stimmt schon geöffnet.«
»Genau der richtige Ort, um zu hören, was sich in Dempseys Bü-
ro zugetragen hat«, meinte Richards mit einem Nicken in Richtung
auf die mit alten Plakaten beklebten Pfeiler. »Das gibt dem Ganzen
eine gewisse Theateratmosphäre.«
»Die Sache ist ganz planmäßig verlaufen«, begann ich leicht bla-
siert und ließ einen ausführlichen Bericht folgen. Als ich geendet
hatte, nippte Richards nachdenklich an seinem Sherry. »Eigentlich
ein bißchen riskant, zuzugeben, daß Sie in der Mordnacht in Bar-
baras Wohnung waren.«
»Sie meinen, er könnte die Polizei benachrichtigen und dann zu-
sehen, wie sie in seinem Betrieb herumschnüffeln? Das dürfte doch
wohl kaum in Frage kommen. Wenn ich mit meiner Vermutung
recht habe, daß es Vivien Gilmores Stimme war, die ich damals an
Dempseys Telefon hörte, dann wird er ihr jetzt jedes Wort unserer
Unterhaltung brühwarm berichten. Außerdem war das für mich
eine gute Gelegenheit, Barbaras Namen bei ihm auszuprobieren.«
»Und – wie hat er reagiert?«
»Überhaupt nicht. Ich bin ganz sicher, daß er den Namen nie zu-
vor gehört hat.«
»Das muß doch geradezu Balsam für Ihr Herz gewesen sein«, ent-
gegnete Richards lächelnd. »Übrigens, was gedenken Sie zu tun,
wenn Ericson heute abend in Ihrer Wohnung aufkreuzen sollte?«
»Aus den Andeutungen, die ich Dempsey über meine angebli-
chen Abenteuer mit Cordwell in Amerika serviert habe, wird Eric-
son folgern, er habe es mit einem ausgekochten Gauner zu tun.«
Das war weniger eine Antwort an Richards als vielmehr laut ge-
162

dacht. »Ich brauche also kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Im
Laufe der Unterredung gedenke ich Leo Salinger als einen meiner
Kunden für gestohlene Diamanten zu erwähnen. Ericsons Reaktion
wird dann wohl endgültig Aufschluß geben, ob Salinger für ihn ge-
arbeitet hat oder ob Ross' Vertrauen in ihn gerechtfertigt war.«
»Hier, bei einem Glas Sherry, klingt das alles ganz einfach«, mein-
te Richards zweifelnd. »Aber Sie stehen einer hartgesottenen Bande
gegenüber, Frazer. Vergessen Sie das nicht.« Als wolle er diesem
Satz noch besonderen Nachdruck verleihen, fügte er hinzu: »Ich
komme gerade von einem ihrer Opfer.«
»Von van Dakar? Wie geht es ihm?«
»Wenn sich keine besonderen Komplikationen ergeben, wird er
höchstwahrscheinlich durchkommen.«
»Haben Sie mit ihm gesprochen?«
»Etwa fünfzehn Minuten. Er ist Privatdetektiv einer holländischen
Versicherungsgesellschaft und arbeitet schon seit langem am Fall
Ericson. Cordwell war dafür bekannt, daß er Diamanten für die Or-
ganisation schmuggelte, und van Dakar war ihm seit Wochen auf
den Fersen. Er folgte ihm auch in der Mordnacht zu Barbara Days
Wohnung.«
Ich lächelte grimmig. »Und hielt mich wohl für den Mörder?«
Richards nickte. »Er glaubte damals auch, Sie hätten Cordwells
Diamanten. Deshalb wurde Ihre Wohnung durchsucht.«
»Das ist verständlich. Aber warum hat er mir eigentlich die Notiz
über die Lennard Street in das Zigarettenetui gesteckt? Und später
den Tip mit den Kodewörtern gegeben?«
»Ja, das muß an Ihrem unwiderstehlichen Charme liegen, Frazer«,
›
entgegnete Richards ironisch. »Also Scherz beiseite: Als man die
Diamanten nicht in Ihrer Wohnung fand und auch keine anderen
Beweise dafür, daß Sie in diese kriminellen Geschäfte verwickelt
sind, kam er zu der Ansicht, Sie gehörten zur Interpol, und zwar zu
der Abteilung, die sich mit gestohlenen Edelsteinen befaßt. Van Da-
163

kar und sein Assistent waren bei ihren Nachforschungen zwar bis
zu Dempsey vorgedrungen, standen aber seitdem wie vor einer
Mauer und kamen nicht weiter. Da entschlossen sie sich, Ihnen alle
verfügbaren Informationen zuzuspielen und zu beobachten, was
sich dann weiter entwickeln würde.«
»Ist ja recht großzügig von den Herren – obwohl ich bestimmt
nichts dagegen gehabt hätte, wenn sie etwas weniger schlagkräftige
Methoden angewandt hätten«, erklärte ich und strich mir unwill-
kürlich mit der Hand über den Hinterkopf. »Hat van Dakar eigent-
lich an dem Mordabend sonst noch jemanden in der Nähe von
Barbaras Wohnung gesehen?«
»Niemanden. Das Haus hat aber noch einen anderen Ausgang
über den Innenhof. Der Mörder ist höchstwahrscheinlich die Feuer-
leiter heruntergeklettert.«
Während ich meinen Sherry trank, fiel mir ein, daß ich ja noch
fragen wollte, ob van Dakar eine Erklärung für seine seltsame Äuße-
rung über den Kaffee gegeben hatte.
»Er wollte damit nur andeuten, daß Gauner sich oft schöner
Frauen bedienen. Im übrigen ist Ihre lebhafte Tätigkeit als Kamera-
mann in Amsterdam nicht unbemerkt geblieben.«
»Die Aussicht, daß ich für ihn als Privatdetektiv schwärmen könn-
te, besteht jedenfalls nicht«, bemerkte ich kurz. »Steht Barbara Day
bei ihm auf der Liste der Verdächtigen?«
»Cordwell wohnte in Amsterdam im selben Hotel wie sie. Sie
wurde öfter mit ihm zusammen gesehen. Er besuchte sie hier in ih-
rer Wohnung. Alles zusammen gibt ein ganz interessantes Dossier.«
Richards sah mich plötzlich scharf an. »Sie haben sich doch nicht
etwa in das Mädchen verliebt, Frazer?«
»Ach, lassen Sie das doch, Richards. Barbara Day ist, wie Sie wis-
sen, verlobt. Und ganz abgesehen davon, daß es meine Aufgabe ist,
sie zu beobachten, traue ich ihr seit diesem Telefonanruf von Vi-
vien Gilmore in Barbaras Wohnung auch nicht mehr so ganz.«
164

»Und wenn es für diesen Anruf eine vernünftige Erklärung gäbe?«
»Ich lasse mich gern überzeugen«, grinste ich ihn an. »Übrigens,
wie hat denn der gute Onkel Richards seine Freizeit verbracht? Ha-
ben sie mal nachgeforscht, welche beruflichen Aussichten der zu-
künftige Ehemann Fairlee hat?«
»Da kann ich Ihnen nicht viel Hoffnung machen, Frazer. Bei der
Börse steht er auf der Liste der besonders empfohlenen Makler.
Sein Bankdirektor lädt ihn oft zum Lunch ein.« Richards leerte sein
Glas. »Da wir gerade vom Essen sprechen. Ich bin heute Ihr Gast-
geber, als Belohnung für ein mannhaftes Unternehmen. Man ißt
hier übrigens sehr gut.«
Nach dem Mittagessen fuhr ich in meine Wohnung zurück, um
mich etwas zu entspannen. Aber ich war innerlich zu unruhig, um
mich auf die Lektüre eines Buches zu konzentrieren.
Die geplante Zusammenkunft mit Ericson um sieben Uhr war ja
nicht gerade dazu angetan, freudige Erwartungen aufkommen zu
lassen. Angenommen, er drückte mir eine Pistole in den Magen, so-
bald ich auch nur die Tür geöffnet hatte? Ich tastete nach dem Re-
volver in meiner Jackentasche. ›Pistolenduell in einer Reihenhaus-
wohnung‹, das würde eine sensationelle Schlagzeile für die Morgen-
zeitungen abwerfen, dachte ich mir. Und meine Aufwartung, Mrs.
Glover, würde diesen Bericht heißhungrig verschlingen. Gleichzeitig
fiel mir ein, daß sie leidenschaftlich gern zu Beerdigungen ging…
Meine Wohnung kam mir plötzlich kalt, einsam und unwirtlich vor
wie die Eigernordwand.
Auch über Barbara war ich mit mir noch nicht im reinen. Ri-
chards hatte mich mit seinen hartnäckigen Fragen in die Enge ge-
trieben. Zugegeben, ich kannte sie noch nicht lange. Ihr Wesen
strahlte aber so viel Wärme und Freundlichkeit aus, daß dies unter
anderen Voraussetzungen zu einer engeren Freundschaft geführt ha-
ben würde.
Ein Läuten an der Wohnungstür unterbrach meine Gedankengän-
165

ge. Ich blickte auf die Uhr und stellte fest, daß es erst sechs war.
Meine Hand in der Jackentasche umklammerte die Pistole, als ich
zur Tür ging und öffnete.
Auf seinen Regenschirm gestützt, den unvermeidlichen steifen
Hut auf dem Kopf, stand eine Figur vor mir, die kaum furchteinflö-
ßender wirkte als ein gereiztes Kaninchen. Es war Arthur Fairlee.
»Gut, daß Sie zu Hause sind«, begann er, wobei sich sein Schnurr-
bart komisch bewegte. »Ich muß Sie in einer dringenden Angele-
genheit sprechen.«
Ich nahm die Hand von der Pistole und konnte ein amüsiertes
Lächeln nicht unterdrücken.
»Ich würde die Sache gern unter vier Augen mit Ihnen bespre-
chen.«
»Kommen Sie doch herein«, forderte ich ihn auf und trat einen
Schritt zurück.
Er ging an mir vorbei ins Wohnzimmer.
»Nehmen Sie doch Platz und entspannen Sie sich erst etwas –
sonst bekommen Sie wieder einen Ihrer Anfälle.«
»Ich ziehe es vor, stehen zu bleiben«, antwortete er in gereiztem
Ton und pflanzte sich mitten im Zimmer auf, wobei er den steifen
Hut auf die Krücke des Regenschirmes preßte. Dann hob er den
Schirm und schwenkte ihn in meine Richtung. »Ich will gleich zur
Sache kommen: Haben Sie ein Verhältnis mit Barbara?«
»Ob ich was habe? Sagen Sie mal, mein Lieber…«
»Haben Sie ein Verhältnis mit ihr, Frazer?«
Ich tauchte unter dem geschwungenen Regenschirm hinweg, als
er auf mich zukam. Seine Augen starrten wie die eines Wahnsinni-
gen.
»Machen Sie sich doch nicht zum Narren. Natürlich habe ich
kein Verhältnis mit ihr.«
»Das ist eine Lüge!« fauchte er. »Ich bin doch nicht blind. Außer-
dem ist das nicht aus heiterem Himmel auf mich zugekommen,
166

Frazer.«
»Aber was denn nur?« Plötzlich griff ich wieder nach dem Revol-
ver in meiner Tasche.
»Die Auflösung unserer Verlobung.«
Einige Sekunden lang war es still im Raum. Dann hörte ich mich
fragen: »Wann ist das geschehen?«
»Gestern abend. Als ob Sie das nicht wüßten«, stieß er erregt her-
vor. »Wir waren glücklich – bis Sie auftauchten, Frazer.«
»Sind Sie sicher, Fairlee? Vielleicht waren Sie glücklich. Wenn Bar-
bara die Verlobung aufgelöst hat, dann haben Sie sich das nur selbst
zuzuschreiben. Sie waren ihrer allzu sicher.«
»Ich mir selbst zuzuschreiben?« explodierte er. »Meinen Sie, ich
habe es mir selbst zuzuschreiben, wenn ein anderer Mann sich mei-
ne Krankheit zunutze macht, um mir meine Verlobte zu stehlen?«
Langsam wurde ich wirklich ärgerlich. »Das ist Unsinn, Fairlee.
Bei den wenigen Malen, die Barbara Sie im Gespräch erwähnt hat,
geschah das mit größtem Verständnis und Mitgefühl. Und ich bin
überzeugt, daß sie auch auf niemanden hören würde, der Sie kriti-
siert – dazu ist sie viel zu loyal.«
»Eine Verlobung aufzulösen entspricht nicht gerade meiner Vor-
stellung von Loyalität.« Er kam zwei Schritte näher auf mich zu.
»Können Sie beschwören, daß zwischen Barbara und Ihnen nichts
vorgefallen ist?«
»Um Gottes willen, hören Sie doch endlich auf, hier den drama-
tischen Helden zu spielen!« schrie ich ihn wütend an. »Barbara und
ich haben nie auch nur ein einziges Wort gewechselt, das Sie nicht
hätten mithören können.«
Er sah mich lange eindringlich an. »Ich nehme Ihr Wort an, Fra-
zer«, lenkte er schließlich ein. Etwas widerwillig fuhr er dann fort:
»Ich müßte mich wohl bei Ihnen entschuldigen.«
»Schon gut; vergessen wir das, Fairlee«, winkte ich ab.
»Ich wünschte, ich könnte es«, antwortete er voller Selbstmitleid.
167

Seine Stimme wurde ängstlich und wißbegierig, als er fragte: »Hat
Barbara Ihnen gegenüber jemals einen anderen Mann erwähnt?«
»So, wie Sie es meinen – nein. Natürlich hat sie verschiedene Leu-
te im Zusammenhang mit dieser verflixten Mordsache erwähnt –
Cordwell, Trueman zum Beispiel.«
»Ericson?« fragte er nervös.
»Sie bestreitet, den Namen je gehört zu haben«, antwortete ich
und fragte mich, wieviel er wohl wußte.
»Ist nicht gerade das verdächtig?« Er atmete stoßweise. »Warum
verleugnet sie ihn? Ich bin sicher, daß sie ihn kennt.«
»Wie kommen Sie darauf, Fairlee?«
»Gestern besuchte ich ihren Antiquitätenladen. Als ich hinein-
ging, telefonierte Vivien gerade, und ich hörte, wie sie sagte: ›Eric-
son will dich noch einmal sprechen. Soll ich die Verabredung für
morgen früh um zehn Uhr im Deich festmachen?‹ Als Vivien mich
sah, hängte sie augenblicklich auf.«
»Woher wissen Sie, daß sie mit Barbara gesprochen hat?« fragte
ich scharf.
»Barbara war nicht im Laden. Und die schuldbewußte Art und
Weise, wie Vivien die telefonische Unterhaltung beendete, über-
zeugte mich, daß sie mit Barbara gesprochen hatte.«
»Haben Sie Vivien gefragt, wer ihr Gesprächspartner gewesen ist?«
»Natürlich.« Er begann unruhig im Zimmer auf und ab zu wan-
dern. »Sie hat es selbstverständlich geleugnet und behauptet, sie ha-
be mit einem Kunden telefoniert, dem sie eine Zusammenkunft mit
einem Antiquitätenhändler namens Merrison vermitteln wollte.
Heute vormittag bin ich dann in der Espressobar gewesen. Ich
brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, daß weder Vivien noch Barbara
dort aufgekreuzt sind.«
»Und Sie sind ganz sicher, daß Vivien den Namen Ericson ge-
nannt hat?«
»Es besteht nicht der geringste Zweifel.« Er blinzelte mich un-
168

glücklich an. »Warum leugnen beide Frauen, Ericson zu kennen?
Was soll diese ganze Geheimniskrämerei? Ein anderer, und zwar
dieser Ericson, ist schuld daran, daß Barbara die Verlobung mit mir
gelöst hat. Und Vivien hat die Sache angestiftet. Sie hat mich nie
leiden können…«
Ich wurde dieser emotionellen Ausbrüche langsam müde. »Wa-
rum sehen Sie nicht den Tatsachen ins Gesicht, Fairlee?« attackier-
te ich ihn. »Nur Ihr Egoismus ist der Grund dafür, daß Barbara sich
von Ihnen getrennt hat. Aber Ihr Stolz läßt nicht zu, sich das ein-
zugestehen, weshalb Sie die Schuld einem anderen Mann anhängen
wollen. Erst war ich es – jetzt soll Ericson es sein. Ich bin fast über-
zeugt, daß Sie sich nur einbilden, seinen Namen gehört zu haben.«
»Gebe Gott, daß Sie recht haben«, winselte Fairlee mit brüchiger
Stimme. »Ich könnte es nicht ertragen, sie zu verlieren. Seit kurzem
ist sie so verändert…« Er brach ab und rang nach Atem.
Ich goß ihm schnell einen Kognak ein und drückte ihm das Glas
in die Hand. Er zitterte heftig, stammelte einen Dank und trank.
Ich fragte mich gerade, ob es nicht besser sei, einen Arzt zu ru-
fen, als es zweimal kurz hintereinander an der Tür läutete. Für ei-
nen Augenblick überkam mich ein Gefühl der Panik. Wenn das
jetzt Ericson war, würde die Lage sich phantastischer entwickeln, als
ich es mir vorstellen konnte. Mir schien, es würde dann mindestens
eine Leiche geben, um Mrs. Glover zufriedenzustellen. Fairlee war
einem Kollaps nahe, und es schien unwahrscheinlich, daß er den
Schock überleben würde, gerade in diesem Augenblick und völlig
unvorbereitet Ericson gegenüberzustehen.
Als ich die Tür weit aufriß, wäre mir um ein Haar der Telegramm-
bote vor die Füße gefallen. »Entschuldigen Sie bitte«, sagte er mit
einem dämlichen Grinsen. »Ich wollte es gerade durch den Brief-
schlitz stecken, weil ich glaubte, Sie seien nicht zu Haus.«
Ich nahm ihm das Telegramm ab und riß es auf. Dann sagte ich
dem Boten, er brauche nicht auf Antwort zu warten, gab ihm einen
169

Shilling und eilte ins Wohnzimmer zurück.
Fairlee stand noch immer auf dem selben Fleck. Er sah elend aus
und blickte mit starren, ausdruckslosen Augen in sein leeres Glas.
»Fühlen Sie sich jetzt besser?« fragte ich mit ehrlichem Mitgefühl.
»Danke. Der Kognak hat mir gutgetan.« Er lächelte schwach. »Ich
sollte mich wirklich nicht so aufregen.«
»Machen Sie sich jetzt nicht solche Gedanken über die Geschich-
te, Fairlee«, beruhigte ich ihn und nahm ihm das Glas ab. »Es wird
sich bestimmt alles wieder einrenken. Wenn Sie glauben, es allein
bis nach Haus zu schaffen, dann entschuldigen Sie mich bitte. Ich
habe eben ein Telegramm bekommen, das mich abruft.«
»Um mich brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Diese An-
fälle sehen schlimmer aus, als sie in Wirklichkeit sind.« Er gab sich
einen Ruck und schwenkte nochmals seinen Regenschirm. »Ich hof-
fe, Sie haben keine schlechte Nachricht erhalten?«
»Nein. Eine Verabredung wurde nur zeitlich verlegt.«
An der Wohnungstür entschuldigte er sich nochmals und ging
dann ziemlich forsch die Stufen hinunter. Ich hatte das Gefühl, er
wolle damit seine Männlichkeit unter Beweis stellen.
Im Wohnzimmer las ich mir noch einmal das Telegramm durch:
T
REFFE
S
IE
HEUTE
ABEND
ELF
U
HR
IM
P
ARK
NAHE
Q
UEENSMERE
-T
EICH
W
IMBLEDON
. W
ERDE
NACH
I
HNEN
A
USSCHAU
HALTEN
. D
EMPSEY
.
Ich schob das Telegramm in die Tasche, nahm mein unberührtes
Glas in die Hand und sah es lange und nachdenklich an. Dann trug
ich es hinaus in die Küche und goß den Inhalt ins Spülbecken.
Für die Verabredung um elf Uhr brauchte ich einen klaren Kopf.
Es war zehn nach elf Uhr, als ich am Ort des verabredeten Ren-
dezvous erschien. Absichtlich war ich etwas später gekommen, weil
ich wollte, daß Dempsey als erster am Treffpunkt sein sollte. Wenn
er allein war, wollte ich ganz dicht an ihn heranfahren. Vielleicht
170

benutzte man ihn nur als Köder, um mich aus dem Wagen zu lo-
cken, damit ich einem Angriff ungeschützt ausgesetzt war. Auch
hielt ich es für unwahrscheinlich, daß Ericson als Haupt einer inter-
nationalen Gangsterbande ohne Leibwache umherlaufen würde. Na-
türlich hatte ich meine Pistole bei mir, hatte aber nicht die Ab-
sicht, sie zu benutzen, es sei denn, es bliebe mir kein anderer Aus-
weg. Ein halbes Dutzend Streifenwagen anzulocken war gewiß das
letzte, was ich mir wünschte.
Es stellte sich dann aber heraus, daß alle vorherige Planung um-
sonst gewesen war. Kein Empfangskomitee wartete, um mich un-
sanft zu begrüßen; selbst der Köder war nicht zu sehen. Ich parkte
den Wagen so dicht wie möglich am vereinbarten Ort, schaltete die
Scheinwerfer aus, vergewisserte mich noch einmal, daß die Türen
von innen verriegelt waren, und harrte der Dinge, die da kommen
sollten.
Es war eine mondlose Nacht mit leichter Nebelbildung. Wahr-
lich, ein ideales Wetter für finstere Pläne. Ich zündete mir eine Zi-
garette an und machte es mir auf meinem Sitz bequem, wobei ich
bedauerte, daß ich mir nicht ein Taschenfläschchen mit Whisky ab-
gefüllt hatte. Alle meine Nerven und Sinne waren angespannt, und
ich war gewissermaßen ständig auf dem Sprung. Jedesmal, wenn vor
mir die Scheinwerfer eines Wagens aufleuchteten, hielt ich mich
sorgsam im Dunkeln. Ich erinnerte mich ja noch genau der Metho-
de, die man bei van Dakar angewendet hatte.
Beim Warten ging ich nochmals meine Unterredung mit Fairlee
durch. Selbst wenn man seine notorische Eifersucht und sein stetes
Mißtrauen berücksichtigte, schien es doch zu stimmen, daß Vivien
Gilmore am Telefon den Namen Ericson genannt hatte. Weniger
sicher war, ob sie in diesem Augenblick mit Barbara telefoniert
hatte.
Mittlerweile hatte ich meine dritte Zigarette zu Ende geraucht.
Anscheinend war ich in meiner Planung zu umsichtig gewesen, was
171

Dempsey und seine Kumpane veranlaßt haben konnte, nicht zu er-
scheinen oder noch vor meiner Ankunft wieder wegzufahren. Mit
einem unbestimmten Gefühl der Enttäuschung darüber, daß mir ei-
ne aufregende Szene entgangen war, schaltete ich die Scheinwerfer
ein und setzte den Motor in Gang.
Ich war erst wenige hundert Meter gefahren, als ich vor mir auf
der Straße die Umrisse eines Mannes erkannte, der eine Taschen-
lampe kreisförmig bewegte. Ich verlangsamte das Tempo, weil ich
einen Trick der Dempsey-Bande vermutete. Dann erfaßten die
Scheinwerfer einen Mann mitten auf der Straße, der sich über ein
Fahrrad lehnte, das er quer zur Fahrbahn gestellt hatte. Er trug die
Uniform der Parkwächter und machte einen harmlosen Eindruck.
Ich hielt neben ihm an und kurbelte das Fenster nur so weit herun-
ter, daß ich ihn fragen konnte, was er von mir wolle.
»Dahinten im Gebüsch liegt ein Mann«, berichtete er aufgeregt.
»Er ist ziemlich übel zugerichtet – sonst hätte ich Sie nicht angehal-
ten.«
»Was ist denn passiert? Ist er überfahren und liegengelassen wor-
den?«
»Es sieht eher so aus, als ob man ihn zusammengeschlagen habe,
Sir«, antwortete der Parkwächter grimmig. »Der muß unbedingt zur
Behandlung in ein Krankenhaus.«
Ich überlegte einen Augenblick und sagte dann: »Also gut, ich
fahre an den Straßenrand. Wir werden uns um den Mann küm-
mern. Wenn er nicht zu schwer verletzt ist, könnte ich ihn viel-
leicht zum Krankenhaus in Putney fahren.«
Ich stellte den Wagen ab und folgte dem Wärter ins Gebüsch, wo
eine massige Gestalt stöhnend auf dem Boden lag, den Kopf zum
Teil unter den Armen verdeckt.
Ich beugte mich über ihn.
Das strohblonde Haar, das sonst so sorgfältig über den kahlen
Kopf seitwärts gekämmt war, hing jetzt zerzaust über den Ohren.
172

Das runde Mondgesicht mit der breiten Nase war geschwollen und
entstellt. Die unruhigen Augen, die jetzt nicht mehr imstande gewe-
sen wären, eine Juwelierlupe einzuklemmen, starrten mich an.
»Frazer … sind Sie es, Frazer?« Seine Stimme war kaum mehr als
ein Flüstern.
»Keine Sorge, Dempsey. Es wird schon wieder alles gut werden«,
versuchte ich, ihm zuversichtlich zuzureden. »Wir bringen Sie jetzt
zu meinem Wagen und dann…«
»Sie kennen ihn, Sir?« fragte der Parkwächter überrascht. »Das ist
aber komisch, daß Sie gerade vorbeikommen mußten…«
»Wirklich ein glücklicher Zufall«, unterbrach ich ihn. »Helfen Sie
mir bitte, ihn zu meinem Wagen zu bringen.«
Dempsey war schwer hochzuwuchten. Er hing zwischen uns wie
ein Sack Mehl. Aber schließlich hatten wir ihn im Rücksitz meines
Wagens verstaut.
Der Wächter holte Notizbuch und Bleistift hervor und setzte ei-
ne amtliche Miene auf. »Es ist Vorschrift, die Sache der Polizei zu
melden, Sir. Könnte ich bitte Ihre Namen und Adressen haben?«
Es bedurfte nicht des protestierenden Stöhnens aus dem rückwär-
tigen Teil des Wagens, um mir zu sagen, daß wir so schnell wie
möglich von hier fort mußten. »Mein Freund leidet an einem bö-
sen Magengeschwür, weshalb die Sache für ihn sehr kritisch werden
kann. Ich muß ihn erst ins Krankenhaus bringen!« rief ich mit dring-
licher Stimme und legte die Gangschaltung ein. »Das Krankenhaus
wird Ihnen unsere Namen geben. Rufen Sie nachher dort an. Guten
Abend, und vielen Dank für Ihre Hilfe.«
»Sie sind ein guter Mensch, Frazer«, stammelte Dempsey, als wir
mit zunehmender Geschwindigkeit davonfuhren.
»Gut ist das höchstens für Sie!« rief ich nach hinten. »Der Park-
wächter hat sich bestimmt die Nummer meines Wagens notiert.
Und nun sparen Sie lieber Ihre Kräfte, bis wir bei mir zu Haus an-
gelangt sind.«
173
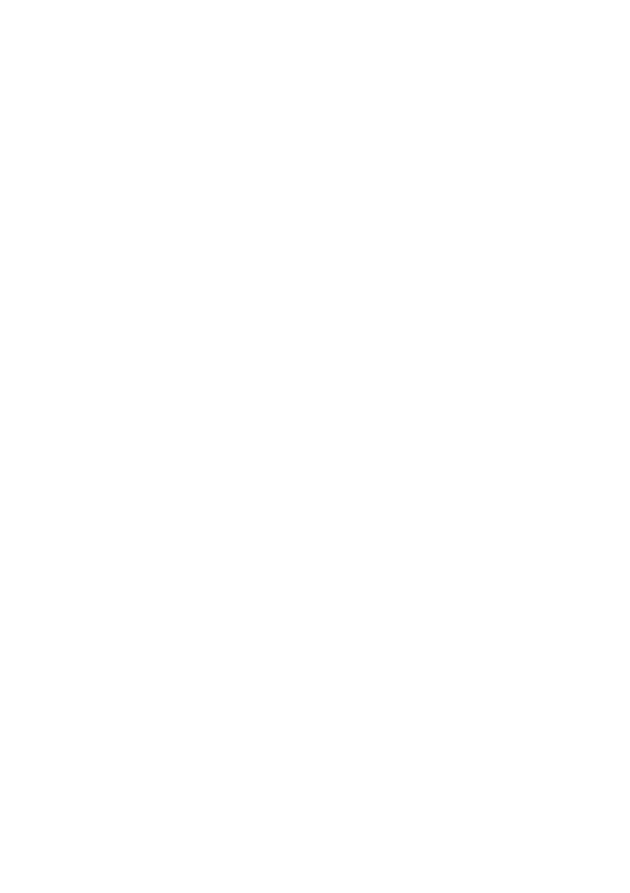
Während der Fahrt hatte Dempsey das Bewußtsein verloren. Als ich
vor meiner Wohnung parkte, atmete er unregelmäßig, und sein
Kopf hing schlaff herab. Ich eilte ins Haus, goß einen Becher halb
voll Kognak und kehrte zum Wagen zurück.
Dempsey rührte sich etwas und öffnete das unverletzte Auge.
»Milch … Frazer … Milch«, murmelte er.
Es gelang mir, ihn unter Aufbietung all meiner Kräfte über die
Schultern zu legen und in meine Wohnung zu tragen. Dort zog ich
ihm die Jacke aus, lockerte die Krawatte und ließ ihn in einen Ses-
sel sinken.
Als ich hinaus in die Küche ging, um ihm ein Glas Milch und
ein Sandwich zu holen, nahm ich seine Jacke mit und brachte sie
erst wieder ins Wohnzimmer zurück, nachdem ich seine Taschen
durchsucht und das Gesuchte gefunden hatte. Ich hängte sie über
die Lehne eines Stuhls und mixte mir dann einen Whisky mit Soda.
»Wie geht es Ihnen jetzt?« fragte ich, während ich stehend auf ihn
hinabsah.
»Ich komme wieder langsam zu mir«, antwortete er. »Gottlob ha-
ben sie mir nicht in den Magen getreten.«
Sein Gesicht war arg zugerichtet. An der linken Schläfe war eine
klaffende Wunde, die aussah, als sei sie von einem Tritt mit dem
Stiefelabsatz hervorgerufen worden, der tödlich wirken sollte.
»Wen meinen Sie mit ›sie‹, Dempsey?«
»Eine Bande von Halbstarken«, erklärte er ohne Überzeugungs-
kraft.
Es trat eine Pause ein, während der er wieder von seinem Sand-
wich abbiß. »Das hat mir der Arzt verordnet«, sagte er, wobei ihm
die Brotkrümel auf sein zerknülltes Oberhemd fielen.
»Soso – da hat also eine Bande von Halbstarken Sie überfallen
und nur so zum Spaß zusammengeschlagen?«
»So etwas kommt doch heutzutage oft vor. Aber die hier waren
hinter meinem Geld her. Haben mir alle Taschen umgekrempelt.«
174
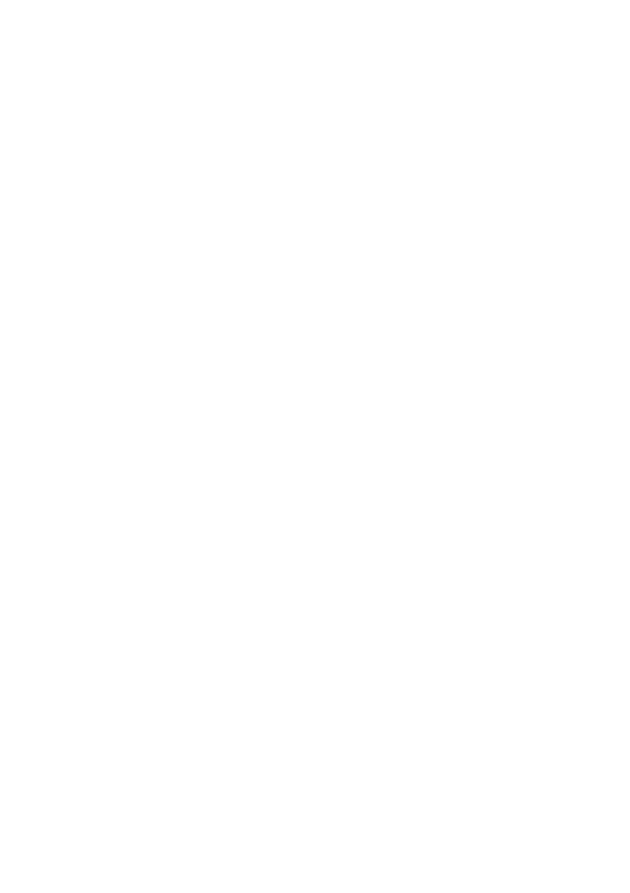
Ich ging zu dem Stuhl, über dem seine Jacke hing, und nahm die
Brieftasche heraus. »Da haben die Kerle aber Pech gehabt! Überse-
hen doch glatt die Brieftasche mit 50 Pfund darin.«
»Da habe ich vielleicht einen Dusel gehabt«, stöhnte er. »Viel-
leicht hat der Parkwächter sie gestört. Ich wünschte nur, er wäre
früher gekommen. Morgen werde ich so steif sein, daß ich mich
überhaupt nicht bewegen kann.«
Aus seiner Jackentasche nahm ich zwei weitere Gegenstände und
hielt sie hoch. »Dann werden Sie wohl das Flugticket nach Mon-
treal zurückgeben müssen. Wie ich sehe, startet Ihre Maschine um
10.30 Uhr.« Ich warf ihm das Ticket in den Schoß.
»Wie, zum Teufel, kommen Sie eigentlich dazu, in meinen Ta-
schen herumzuwühlen?« fragte er bissig, wobei er mich unruhig mit
dem einen unverletzten Auge beobachtete. »Und was machen Sie
mit meinem Paß?«
»Den behalte ich, Dempsey. Ob Sie ihn zurückbekommen, wird
davon abhängen, wieweit Sie meine Fragen beantworten.«
Er reagierte sauer. »Ich werde Ihnen überhaupt keine Fragen be-
antworten, Frazer. Sie vergeuden Ihre Zeit.«
Ich warf den Paß auf den Tisch vor mir. »In Ihrer Jackentasche
befand sich noch etwas, Dempsey. Es ist eine Pistole, für die sich
unter Umständen die ballistischen Experten von Scotland Yard in-
teressieren werden. Bei dem Mann, der gestern in einer Telefonzelle
der Lennard Street durch einen Schuß schwer verletzt wurde, hat
man die Kugel durch Operation entfernt.«
»Das war ich nicht.« Er versuchte, sich im Stuhl aufzurichten,
sank aber stöhnend wieder zurück. »Ich schwöre bei Gott, das war
ich nicht.«
»Sie müssen schon etwas gesprächiger werden, Dempsey. Sonst
händige ich die Pistole der Polizei aus. Ich hoffe doch, daß Sie ei-
nen Waffenschein haben?«
Er stieß einen hilflosen Seufzer aus. »Also gut«, antwortete er fast
175

tonlos. »Was wollen Sie wissen?«
»Zunächst einmal – warum kamen Sie zu unserer Verabredung
mit der Pistole in der Tasche?«
Ich ging zu ihm hinüber, schob eine Hand unter sein Kinn und
hob es so hoch, daß er mir ins Gesicht sehen mußte. »Ich kann die
Antwort auch selbst geben. Sie wollten mich mit dem Ding zwin-
gen, Ihnen die Diamanten auszuhändigen, stimmt's? Sie wollten
auch Ericson übers Ohr hauen und mit den Diamanten außer Lan-
des gehen – so war es doch, nicht?«
»Dafür habe ich doch schon genug gebüßt«, seufzte er. »Sie sehen
doch, wie die Kerle mich zusammengeschlagen haben.«
»Erwarten Sie kein Mitleid von mir!« fuhr ich ihn grob an. »War
Ericson mit von der Partie?«
»Ericson ist viel zu gerissen dafür«, antwortete er bitter.
»Aber Sie wissen doch, wer Ericson ist«, drang ich in ihn.
Er schüttelte den Kopf, während es schmerzhaft in seinem Ge-
sicht zuckte. »Diese Hunde sagen einem doch nie etwas.«
»Antworten Sie auf meine Frage, Dempsey. Wer ist Ericson?«
»Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe noch nicht einmal am Tele-
fon mit ihm gesprochen. Und das ist wirklich die Wahrheit.« Er sah
mich von der Seite an. »Sind Sie ein Detektiv, Frazer?«
»Sie wissen genau, wer ich bin, Dempsey. Diese Auskunft beka-
men Sie doch schon telefonisch, als ich zum ersten Male bei Ihnen
war.« Ich sah ihn nachdenklich an. »Ihre Rolle in der Organisation
ist also die des Mittelsmannes. Die Diamanten werden auf dem
Kontinent gestohlen und dann von Leuten wie Cordwell nach Eng-
land geschmuggelt. Damit sich niemand einschleicht, der nicht zur
Bande gehört, muß sich jeder Schmuggler erst ausweisen, bevor er
an Sie weitergeleitet wird. Stimmt das, Dempsey?«
»Ich denke, Cordwell hat Ihnen das schon erzählt? Warum sollen
wir das alles noch einmal aufwärmen?«
»Ich möchte nur überprüfen, ob alles wirklich so ist, wie er es mir
176

gesagt hat. Also: Wenn ich für Ericson arbeiten würde, dann erhiel-
te ich einen Tulpenkatalog und ginge damit zum Restaurant Deich,
von wo aus ich an Sie weitergeleitet werde.«
»Der Jan hat da einen Fehler gemacht«, antwortete er. »Sie wären
auf all das nicht gekommen, wenn dieser Idiot Ihnen nicht den Ka-
talog gegeben hätte.«
»Ericson wird ihm das schon heimzahlen«, beruhigte ich ihn.
»Und jetzt möchte ich den Rest hören.«
»Ich wage es nicht, Frazer«, winselte er, wobei er sich vor Angst
schüttelte. »Sie sehen doch, was man jetzt schon mit mir angestellt
hat. Beim nächsten Mal, da…« Er machte eine unmißverständliche
Handbewegung um seine Kehle.
»Um so eher sollten Sie mir alles erzählen«, drängte ich und nahm
den Paß vom Tisch. »Den hier werden Sie dringend brauchen. Aber
Sie kriegen ihn nicht eher, bis ich alle Informationen habe, die ich
benötige.«
»Um Gottes willen, Frazer! Ich muß den Paß haben! Sie müssen
ihn mir geben!« Er rutschte ungeduldig im Sessel hin und her.
»Also dann weiter, Dempsey. Ich höre.«
Ich wartete schweigend, und endlich reagierte er: »Wenn jemand
zu mir kommt, dann nenne ich hintereinander eine ganze Reihe von
Namen, unter denen auch das Kodewort ist. Nennt der Betreffende
das dann und dazu auch noch die entsprechende Kodezahl…«
»Fantasie, zwei-dreißig«, ergänze ich seinen Satz.
»Möchte bloß wissen, wo Sie das aufgeschnappt haben. Es wird
jede Woche gewechselt.« Dann sah er mich verschlagen an. »Beim
letzten Test sind Sie dann doch hängengeblieben.«
»Aha… Das Metronom.«
»Richtig.« Trotz seiner Schmerzen streckte er einen Finger aus
und bewegte ihn hin und her. »Sie mußten das Pendel auf eine be-
stimmte Zahl einstellen. Als Sie das nicht taten, wußte ich, daß Sie
nicht zu uns gehörten.«
177

»Und wenn ich die Zahl gewußt hätte? Was dann?«
»Dann hätte ich Sie an jemand weitergeleitet.«
»An Ericson?«
»Niemand kommt zu Ericson.« Er wischte sich mit dem Hand-
rücken den Mund. »Lassen Sie es jetzt endlich genug sein, Frazer.
Oder wollen Sie, daß die Leute mich umbringen?«
»Sie selbst hätten mich doch kaltblütig draußen im Park umge-
bracht!« fuhr ich ihn wütend an. »Ist Vivien Gilmore der nächste
Mittelsmann?«
Er befeuchtete nervös die Lippen mit der Zunge und nickte zu-
stimmend.
»Sie war es doch, die Sie telefonisch vor mir gewarnt hat?«
Wieder nickte er.
»Sie sagen, niemand kommt mit Ericson direkt in Berührung.
Wickelt Vivien Gilmore die Geschäfte ab?«
»Ja.« Er umkrampfte die Lehne des Sessels, einem Schwächeanfall
nahe.
Ich füllte den Becher nochmals zur Hälfte mit Kognak und schob
ihn zu ihm hinüber. Das tat ich gewiß nicht aus reiner Fürsorge,
vielmehr hoffte ich, der Alkohol werde seine Zunge noch mehr
lockern.
Er kippte den Kognak mit einem Zuge hinunter und sah mich
dann zerknirscht an. »Da haben Sie mich aber falsch eingeschätzt,
Frazer. Die Pistole hätte ich gegen Sie bestimmt nicht gebraucht.
Ich wollte nur damit drohen.«
»Na schön. Ich will Ihnen glauben.« Damit ließ ich mich in den
gegenüberliegenden Sessel fallen.
Plötzlich kam er zu einem Entschluß. »Wissen Sie, Frazer: Nach-
dem die Kerle mich so brutal behandelt haben, werde ich sie auch
nicht mehr schonen.«
Ich war der Überzeugung, daß er jetzt wirklich die Wahrheit sa-
gen würde, wenn ich ihm Fragen stellte, und begann: »Was wissen
178

Sie über einen Mann namens Leo Salinger?«
»Ich habe von ihm gehört«, gab er zu. »Der wurde in Amsterdam
bei einem Verkehrsunfall getötet.«
»Und was wurde aus den gestohlenen Diamanten, die…«
»Leo wußte nichts von den Diamanten«, unterbrach er mich. »Sie
waren in dem Metronom versteckt, das Salinger bei sich trug. Er
selbst glaubte aber nur, er liefere ein Geburtstagsgeschenk für einen
Freund seines Bruders ab.«
»Was für ein Bruder?«
»Arnold Salinger. Der hat für Ericson oft Diamanten herüberge-
bracht. Damals aber lag er mit gebrochenem Fuß zu Haus. Er hatte
die Idee, die Diamanten in einem Metronom zu verstecken und
Leo zu bitten, das Ding abzugeben.«
»Aber Leo Salinger ist nie bis hierher gekommen.«
»Auf dem Weg zum Flugplatz wurde er überfahren. Das Metro-
nom verschwand. Mir ist bekannt, daß Ericson darüber sehr wü-
tend wurde. Er glaubte, Arnold habe ihn hereingelegt. Daraufhin
hat er dem armen Teufel die Daumenschrauben angelegt, bis Ar-
nold es satt hatte und Selbstmord beging.«
»Wie mag Cordwell an die gestohlenen Diamanten gekommen
sein?«
Dempsey zuckte mit den Schultern. »Er muß gewußt haben, daß
Salinger sie bei sich trug. Vielleicht hat Arnold es ihm auch erzählt.
Ich nehme an, Cordwell ist Leo dann gefolgt und hat auf eine gün-
stige Gelegenheit gewartet, ihm das Metronom abzunehmen.
Schließlich ist er ja auch hier aufgetaucht und hat versucht, mit
Ericson ins Geschäft zu kommen. Was dann passiert ist, wissen
Sie ja.«
Dies schien mir absolut die Antwort auf die Frage zu sein, die
Ross beschäftigte. Aber ich gab mich noch nicht zufrieden.
»Barbara Day hat den Wagen gefahren, mit dem Leo Salinger
überfahren wurde. Was wissen Sie von ihr?«
179

»Ich habe es Ihnen doch schon gesagt, Frazer. Den Namen habe
ich nie gehört. Wer zum Team Ericson gehört, darf nicht viele Na-
men kennen. Auch Vivien Gilmore kenne ich nur deshalb, weil ich
mit ihr Kontakt aufnehmen mußte, wenn jemand mit Diamanten
in mein Büro kam. Der Antiquitätenladen ist ja nur ein Deckman-
tel für sie.«
»Gemeinsam mit Barbara Day«, sagte ich, mehr zu mir selbst als
zu ihm.
»Wurde Cordwell nicht in Miß Days Wohnung ermordet?« Demp-
sey kratzte sich dabei am Hinterkopf. »Wenn Sie mich fragen, so
wurde er ermordet, weil Ericson glaubte, er verkaufe Diamanten an
eine andere Organisation.«
»Von Ericson persönlich?«
»Das halte ich für möglich.«
»Haben Sie weitergemeldet, daß ich mit Ericson ein Geschäft ma-
chen will?«
»Ja, ich habe Miß Gilmore unterrichtet. Ich weiß nicht, wie Eric-
son vermuten konnte, ich hätte einen Hintergedanken dabei ge-
habt. Ich habe ausdrücklich darauf hingewiesen, daß Sie die Dia-
manten mitbringen würden.«
»Ist es dann nicht seltsam, daß Ericson seine Schlägerbande nicht
auf mich angesetzt hat?«
»Das finde ich auch. Sie haben verdammtes Glück gehabt, Frazer.
Aber die werden auch Sie bald zu fassen kriegen. Passen Sie ja gut
auf sich auf, oder wollen Sie auch so enden wie Cordwell?«
»Ich werde mich entsprechend einstellen.«
»Wie ist es«, fragte er nach einer Weile, »bekomme ich jetzt mei-
nen Paß zurück?«
Das Telefon läutete. Ich hob ab, ohne Dempsey aus den Augen
zu lassen. Eine weibliche Stimme sprach laut und langgezogen:
»Hier Vivien Gilmore. Ich hätte Sie gern gesprochen. Könnten Sie
morgen um zehn Uhr im Restaurant Deich sein?«
180

»Ich glaube, ich kann es einrichten, Miß Gilmore.«
»Aber erwähnen Sie es niemandem, besonders nicht Barbara ge-
genüber. Also dann – bis morgen um zehn Uhr.«
Als ich den Hörer auflegte, fragte Dempsey: »Was wollte sie?«
»Sie will sich mit mir treffen.«
»Na, was habe ich Ihnen gesagt?« Er setzte eine wichtigtuerische
Miene auf. »Jetzt ist man hinter Ihnen her, Frazer! Ich habe Sie ge-
warnt! Nun, was ist mit meinem Paß?«
»Den können Sie haben.« Ich schob ihm den Paß hinüber.
Er nahm ihn und steckte ihn in die Tasche. »Würden Sie mir ei-
nen Gefallen tun? Bitte, bestellen Sie mir ein Taxi. Bis zur Unter-
grundbahn schaffe ich es nie.«
Ich tat ihm den Gefallen.
»Also dann, Dempsey. Der Wagen wird in fünf Minuten hier
sein. Ich an Ihrer Stelle würde ein heißes Bad nehmen und ein paar
schmerzstillende Tabletten schlucken. Und dann sehen Sie zu, daß
Sie morgen früh das Flugzeug erwischen.«
»Da können Sie sicher sein!« Er nahm die Jacke von der Stuhl-
lehne und stöhnte schmerzhaft bei jeder Bewegung, als er sie anzog.
»Könnten Sie mir bitte behilflich sein?«
Während ich ihm half, nahm ich die Pistole aus seiner Jackenta-
sche. Es war eine 38er Automatik. »Ich an Ihrer Stelle würde mich
bei der Landung in Montreal nicht mit diesem Ding antreffen las-
sen, Dempsey. Ich habe mir sagen lassen, die kanadische Polizei
geht mit Revolverhelden ziemlich rauh um.«
»Danke für den gutgemeinten Rat. Und viel Glück noch, Frazer.
Ich hoffe, Sie tragen mir nichts nach.«
»Sie sind vielleicht ein Optimist«, gab ich zur Antwort und schob
ihn in Richtung Tür. »Eben ist Ihr Taxi vorgefahren.«
Am anderen Morgen lief ich beim Verlassen meiner Wohnung In-
181

spektor Trueman direkt in die Arme.
»Ich hätte gern mit Ihnen gesprochen, Sir«, sagte er und dirigierte
mich zurück zu meiner Wohnung. »Es wird nicht lange dauern.«
»Das hoffe ich auch. Ich habe nämlich in zwanzig Minuten eine
Verabredung.«
Im Wohnzimmer räumte Mrs. Glover gerade meinen Frühstücks-
tisch ab. »Trinkt der Herr vielleicht eine Tasse Kaffee, Mr. Frazer?«
fragte sie. Ich winkte mit der Bemerkung ab, der Besucher werde
gleich wieder gehen, und sie verstand den Wink.
»Eine Ehefrau würden Sie nicht so leicht loswerden«, meinte
Trueman neidvoll, als Mrs. Glover das Zimmer verlassen hatte. »Es
gibt Zeiten, in denen ich mir wünsche, ich wäre wieder Junggesel-
le, Sir.«
»Das wundert mich. Für einen Kriminalbeamten gibt es doch im-
mer eine Ausrede, wenn er mal länger ausbleibt. Meiner Ansicht
nach genießen Sie auf diese Weise das Beste aus beiden Bereichen,
Inspektor.«
»Seltsam, daß Sie gerade vom langen Ausbleiben sprechen«, be-
gann er jetzt den dienstlichen Teil des Gespräches. »Um welche
Zeit sind Sie gestern nach Haus gekommen, Sir?«
»Sieh da. Der Parkwächter hat Ihnen wohl die Nummer meines
Wagens gemeldet«, antwortete ich schlagfertig. »Also, was wollen
Sie wissen?«
»Den Namen des Mannes, den Sie angeblich in ein Krankenhaus
bringen wollten.«
»Es war ein Bekannter. Ich brachte ihn hierher. Alles, was er
brauchte, war ein Kognak.«
»Nach uns vorliegenden Informationen war er zusammengeschla-
gen worden. Wissen Sie, warum?«
»Wenn ich das wüßte, Inspektor, wäre das Problem der Jugend-
kriminalität gelöst.«
»Also Halbstarke? Das nahm auch der Parkwächter an.« Trueman
182

sah mich ziemlich ungläubig an. »Toller Zufall, daß es gerade ein
Bekannter von Ihnen war, finden Sie nicht?«
»Und ob. Ich werde von solchen Zufällen geradezu verfolgt. In ei-
ner Wohnung wird ein Mann ermordet, und meine Fingerabdrücke
befinden sich an der Tür.« Ich lachte. »Das ist genau die Art von
Zufällen, über die ich immer wieder stolpere.«
»Ich an Ihrer Stelle würde es nicht so oft geschehen lassen, Sir.
Einmal könnte es sich doch als sehr unangenehm herausstellen.«
»Meinen Sie damit vielleicht, daß man eines Mordes verdächtigt
wird?«
»In der Mordsache Cordwell stehen Sie nicht unter Verdacht, Mr.
Frazer«, informierte er mich etwas widerwillig. »Wir sind jedoch der
Ansicht, daß Sie wissen, wer es getan hat.« Er studierte intensiv sein
Hutband. Ȇbrigens ist es ein schweres Vergehen, Beweismaterial
zurückzuhalten, das der Polizei zur Aufklärung eines Verbrechens
dienen könnte.«
»Wie kommen Sie darauf, daß ich die Polizei hintergehen könn-
te?«
»Sie scheinen mit der Dame, in deren Wohnung der Ermordete
gefunden wurde, befreundet zu sein, Mr. Frazer. Frauen haben die
Neigung, sich anzuvertrauen – vor allem einem ganz bestimmten
Mann.«
»Auch ich kenne das menschliche Leben, Inspektor. Sollte es aber
im Leben von Miß Day ›einen ganz bestimmten Mann‹ geben, wie
Sie es diskret nennen, dann ist das kein anderer als ihr Verlobter.«
»Ich habe Mr. Fairlee gesprochen, kurz bevor ich hierher kam. Er
erzählte mir, die Verlobung sei aufgelöst. Über Ihre Freundschaft
mit Miß Day schien er nicht gerade sehr erbaut zu sein.«
»Seltsam… Als er gestern hier war, hatte ich ganz den Eindruck,
daß er Ihre häufigen Besuche bei Miß Day für übereifrig hielt…
Aber das sollte Sie nicht stören, Inspektor.«
»Das tut es auch nicht«, versicherte er mir. »Obwohl es Sie sicher
183

überraschen würde, wenn ich Ihnen gestehen würde, wie vorsichtig
selbst ein Kriminalbeamter manchmal sein muß, wenn er sich in
seinem sachlichen Urteil nicht beirren lassen will. Eine so attraktive
Frau wie Miß Day kann einen Mann schon ganz schön an der
Nase herumführen und seine Verstandeskraft trüben.«
»Gottlob bin ich kein Polizeibeamter und brauche solche Gewis-
sensnot nicht zu fürchten.«
»Sie scheinen aber mit recht eigenartigen Leuten zu verkehren«,
entgegnete er und schien damit auf Richards anzuspielen.
»Ich habe viele Freunde und Bekannte. Da frage ich nicht jeden
erst, wie er sein Geld verdient.«
»Für mich als Kriminalbeamten ist das das erste, was mich interes-
siert. Leute, die keine nachweisbare Beschäftigung haben, erregen
stets unsere Aufmerksamkeit.« Er rieb sich mit der Hand am Kinn.
»Sie gehören auch zu dieser Kategorie, Sir.«
»Für Ihre Polizeiakten bin ich ein Ingenieur, der sich augenblick-
lich journalistisch betätigt. Genügt das nicht?«
»Das erklärt aber nicht, warum Sie so viel freie Zeit haben, Mr.
Frazer. Oder was Sie damit anfangen.«
»Was soll das alles, Inspektor?«
»Damit will ich Ihnen nur eines sagen, Sir. Überlassen Sie Polizei-
arbeit denen, die dafür bezahlt werden.«
»Wie kommen Sie nur auf den Gedanken, ich mischte mich in
die Arbeit der Polizei ein?«
»Weil Sie an dem Fall Cordwell zu stark interessiert sind, Sir. Und
wenn Sie einen wirklich gut gemeinten Rat annehmen wollen – las-
sen Sie die Finger davon. Cordwell hatte Umgang mit einigen sehr
unangenehmen Typen, die ausgesprochen bösartig werden können,
wenn man ihre Wege kreuzt. Ich warne Sie, Mr. Frazer!«
»Dank für den Rat und die Warnung, Inspektor. Übrigens – ha-
ben Sie eigentlich jemals diesen Ericson aufgespürt, nach dem Sie
uns gefragt haben?«
184

»Wir wissen, daß Ericson Chef der Bande ist, die gestohlene Dia-
manten schmuggelt und der auch Cordwell angehörte. Mehr konn-
ten wir bisher noch nicht herausfinden.« Er sah mich durchdrin-
gend an. »Warum fragen Sie das?«
»Ich bin nur neugierig; das ist alles.«
»Dann möchte ich Ihnen doch raten, Ihre Neugier zu beschrän-
ken, Sir.« Trueman stand auf und ging zur Tür. »Sollten Sie zufällig
etwas über diesen Ericson erfahren, rufen Sie mich an – und zwar
sofort! Das ist eine strikte Anweisung, Mr. Frazer! Sonst könnte es
Ihnen passieren, daß Sie wegen Behinderung der Polizeiarbeit unter
Anklage gestellt werden. Dabei kümmert es mich nicht, wer hinter
Ihnen steht«, fuhr er emphatisch fort. »Ich werde dafür sorgen, daß
Sie sechs Monate bekommen. Das rede ich nicht nur so daher –
ich meine es ernst!«
Seinem Gesicht entnahm ich, daß er nicht spaßte.
Als ich mir ein Taxi nach der Lennard Street nahm, fragte ich
mich, wie gut wohl die Beziehungen sein mochten, die Ross zur
Polizei hatte – und ob er sie notfalls zu meinen Gunsten spielen
lassen würde. Ich hatte das unangenehme Gefühl, er würde es nicht
tun.
Vivien unterhielt sich mit Jan, als ich im Deich eintraf. Bei mei-
nem Anblick verschwand das Lächeln aus ihrem Gesicht. Er folgte
ihrem Blick, drehte sich dann schnell um und verschwand hinter
der Theke.
Ich ging zu ihrem Tisch und setzte mich unaufgefordert. Wäh-
renddessen ging Jan zur Tür, drehte den Schlüssel im Schloß um
und hängte das Schild ›Geschlossen‹ an die Scheibe.
Als ich ihn dabei beobachtete, hörte ich Vivien fragen: »Trinken
Sie eine Tasse Kaffee, Mr. Frazer?«
»Nein, danke«, antwortete ich und behielt Jan im Auge, der aber
185

zu seinem Schanktisch zurückkehrte, ohne zu uns herüberzubli-
cken. »Nun, weshalb wollten Sie mich sprechen?« fragte ich.
Sie ließ ein Stückchen Zucker in den Kaffee fallen und rührte
langsam darin herum. »Ich mache mir Sorgen wegen Barbara«, er-
klärte sie dann mit bedrückter Miene. »Sie hat ihre Verlobung wie-
der gelöst.«
»Daß das gerade Ihnen Sorge macht, wundert mich aber.« Ich
bemühte mich gar nicht, den Sarkasmus in meiner Stimme zu un-
terdrücken.
»Arthur bringt Barbara noch zum Wahnsinn und ruiniert ihre
Nerven völlig. Er glaubt immer noch, sie dazu bringen zu können,
ihre Entscheidung rückgängig zu machen.«
»Wie sollte er denn Ihrer Ansicht nach darauf reagieren?«
»Ich dachte, Sie könnten vielleicht mit Barbara reden. Auf Ihren
Rat hört sie doch sehr. Wenn Sie sie nun überzeugen könnten, daß
sie wirklich den richtigen Entschluß gefaßt hat…«
Ich sah sie amüsiert an. »Haben Sie mich etwa deswegen heute
früh hierher gebeten? Nur, um mich zu bitten, die Seelenkraft Ihrer
Freundin zu stärken?«
Ihre Augen bekamen plötzlich einen harten Blick. »Nein, das war
nicht der Hauptgrund.«
»Warum kommen wir dann nicht zum Hauptgrund?«
Sie blickte zu Jan hinüber und sagte dann leise mit kalter Stim-
me: »Ich will die Diamanten haben.«
Ich tat überrascht. »Welche Diamanten?«
»Spielen wir doch nicht weiter Versteck«, antwortete sie, wobei
ihre Stimme noch metallischer wurde. »Ich weiß, daß Sie die Dia-
manten von Cordwell haben.«
Ich lachte ungläubig. »Was, zum Teufel, ist in Sie gefahren, Vi-
vien? Wollen Sie damit sagen, Cordwell habe Diamanten bei
sich gehabt?«
»Sie wissen genau, daß es der Fall war.« Mit einem Blick zu Jan
186

forderte sie ihn auf: »Es kann losgehen, Jan.«
Er langte unter den Bartisch und holte ein Tonbandgerät hervor.
Kaum hatte er es eingeschaltet, erkannte ich Dempseys Stimme.
»›Was verlangen Sie dafür, Frazer?‹
›Nicht den Preis für einen Mittelsmann. Ich möchte mit dem
Boß persönlich verhandeln.‹
›Wer sagt Ihnen, daß ich einen Boß habe?‹
›Cordwell.‹«
Ich lauschte dieser mir wohlvertrauten Unterhaltung noch einige
Zeit. Dann nickte Vivien wieder, und Jan schaltete gehorsam das
Gerät aus. Es entstand eine Pause.
»Sie haben Dempsey also nicht getraut.«
»Ericson tat es nicht. Aber er traut niemandem. Nicht einmal
mir.«
»Offensichtlich traut er Ihnen aber wenigstens so weit, daß er Sie
die Diamanten ankaufen läßt«, erwiderte ich. »Also, reden wir nicht
mehr darum herum. Wieviel wollen Sie zahlen, Vivien?«
»Keinen Penny«, antwortete sie kühl. »Händigen Sie mir die Dia-
manten aus, und dann wollen wir die Angelegenheit als erledigt be-
trachten.«
»Und wenn ich das nicht tue, Vivien?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Dann melden wir einfach der Po-
lizei, daß Sie die Diamanten haben. Rechnet man dazu, daß Ihre
Fingerabdrücke in Barbaras Wohnung gefunden wurden, dann sit-
zen Sie ganz schön in der Tinte.«
»Als Cordwells Mörder, meinen Sie? Glauben Sie wirklich, Sie
könnten mir das anhängen? Hören Sie sich den Rest des Tonban-
des an, dann wissen Sie, wie ich damals in die Wohnung hineinge-
kommen bin.«
»Ich habe es mir ganz angehört, Tim. Glauben Sie etwa, die Po-
lizei wird Ihnen die Geschichte von dem Schlüssel abnehmen, der
durch den Türschlitz geschoben wurde?«
187

»Wie sollte ich denn sonst hineingekommen sein?«
»Auf demselben Wege wie Cordwell – über die Feuerleiter.«
»Und warum sollte er diesen ungewöhnlichen Weg genommen
haben?« fragte ich ungläubig. »Irgend jemand hat ihn in die Woh-
nung eingelassen.«
»Dann hat Barbara Ihnen also nicht erzählt, was geschehen ist?«
Sie lachte kurz. »Dann werde ich es Ihnen sagen: Cordwell hatte
nämlich außer dem Diamantenschmuggel noch eine Nebenbeschäf-
tigung.«
»Erpressung?«
Sie nickte. »Im Café de Kroon in Amsterdam hat er Ihre Kamera
an sich genommen, vermutlich aus Versehen. Als er sich dann den
Film angesehen hatte, glaubte er etwas in der Hand zu haben, wo-
mit er Barbara erpressen könnte. Er wußte, daß sie mit einem Mann
verlobt war, der vor Eifersucht außer sich geraten würde, wenn er
erführe, daß ein anderer Mann stark an ihr interessiert ist.«
»Für diesen Film gibt es doch eine höchst harmlose Erklärung.
Hat Barbara es Ihnen nicht erzählt?«
»Ihre faule Ausrede, daß Sie ein attraktives Mädchen auf den Er-
innerungsfotos von Amsterdam haben wollten?« Vivien lachte höh-
nisch. »Barbara muß schon verteufelt naiv sein, wenn sie auf so et-
was hereingefallen ist! Aber zurück zu Cordwell – er rief Barbara an
und wollte wissen, wieviel sie für den Film zahlen würde. Sie hielt
ihn für verrückt und dachte gar nicht daran, ihm den Film abzu-
kaufen. Deshalb stieg er über die Feuerleiter in ihre Wohnung, um
sie durch Einschüchterung doch noch zu einem Geschäft zu bewe-
gen.«
»Woher wissen Sie das alles? Waren Sie etwa zur gleichen Zeit in
der Wohnung?«
»Natürlich nicht. Aber die Dinge liegen doch ganz klar. Während
Barbara zu Arthur fuhr, folgten Sie Cordwell und kletterten hinter
ihm die Feuerleiter hoch. Sie wußten, daß er die Diamanten bei sich
188

hatte – das haben Sie Dempsey selbst erzählt. Vergessen Sie nicht –
auch das ist auf Band festgehalten. Diesmal können Sie sich nicht
aus der Sache herauswinden.«
Richard hatte also recht gehabt. Es war falsch von mir gewesen,
Dempsey von meinem Besuch in Barbaras Wohnung am Mord-
abend zu erzählen. »Ich war da«, gab ich zu. »Aber Cordwell war
bereits tot. Er wurde von dem ermordet, der mir den Schlüssel
durch den Türschlitz geschoben hat.«
»Wer soll Ihnen die Geschichte abnehmen? Die Polizei? Bestimmt
nicht! Das können Sie mir glauben. Und ich werde dafür sorgen,
daß dieser Teil der Bandaufnahme gelöscht wird.«
»Auch ich habe meine Trümpfe«, unterbrach ich sie. »Das habe
ich gestern abend aus Dempsey herausgeholt, nachdem man ihn
zusammengeschlagen hatte.« Mit einem kurzen Blick auf die Uhr
hatte ich festgestellt, daß Dempsey jetzt schon auf dem Wege nach
Montreal sein mußte. »Jawohl, ich war in der Wohnung und nahm
auch den Hörer ab, als Sie Barbara anriefen, um sie zu warnen, daß
jemand wegen Ericson und der Lennard Street neugierig war.«
Sie nickte. »Nur, daß dieser ›jemand‹ Fairlee war. Versuchen Sie ja
nicht, Barbara etwas anzuhängen, Tim. Sie ist eine kleine, dumme
Närrin, die keinen festen Entschluß fassen kann.«
»Warum riefen Sie sie denn wegen Ericson an? Wenn sie mit ihm
nicht in Verbindung steht, warum dann diese Warnung?«
»Ericson hat mich mit Barbara gesehen und ist in sie verknallt.
Ich sollte unbedingt für ihn ein Rendezvous mit ihr im Deich arran-
gieren. Fairlee kam eines Tages in den Antiquitätenladen, als Bar-
bara gerade nicht da war. Er behauptete, er hätte gehört, wie sie mit
jemandem ein Rendezvous ausmachte. Deshalb rief ich an dem be-
wußten Abend an – um sie zu warnen, daß Fairlee Verdacht ge-
schöpft hatte.«
»Hat Barbara diesen Ericson jemals persönlich gesehen?«
»Niemals«, antwortete Vivien emphatisch. »Sie weiß auch nichts
189

von dem Diamantenhandel.«
Obwohl diese Antwort mich keineswegs befriedigte, wollte ich
mich in keine weitere Diskussion mit ihr einlassen. »Also gut, Vi-
vien. Ich nehme Ihre Erklärungen an. Sie können Ericson melden,
ich fordere 12.000 Pfund für die Diamanten. Sie sind viel mehr wert,
und ich bin überzeugt, daß er noch immer einen ganz schönen Ge-
winn erzielen wird. 12.000 Pfund und keinen Penny weniger. Und
ich will sie von Ericson persönlich.«
Sie starrte mich argwöhnisch an. »Sie arbeiten doch nicht etwa
für die Polizei, Tim?«
»Meinen Sie, dann könnte ich Ihnen gestohlene Diamanten zum
Verkauf anbieten? Sollte Ericson aber nicht die 12.000 Pfund her-
ausrücken, dann werde ich der Polizei über Sie einen Tip geben.
Daher sollten Sie lieber schnell mit Ericson Verbindung aufneh-
men.«
Sie überlegte ein paar Minuten und sagte dann: »Ich werde versu-
chen, eine Zusammenkunft zwischen Ihnen und Ericson zu arran-
gieren.«
Sie bekam einen verkniffenen Zug um den Mund. »Eins kann ich
Ihnen aber jetzt schon versprechen: Anschließend werden Sie eine
Tracht Prügel beziehen, daß Ihnen die Sache mit Dempsey wie eine
harmlose Balgerei in einem Kindergarten vorkommen wird.«
Ich ließ sie deutlich spüren, daß diese Drohung mich überhaupt
nicht schreckte.
Auf dem Weg zur Tür nahm ich Jan beiseite.
»Sie sollten sich für gestern abend um elf Uhr lieber ein gutes Ali-
bi ausdenken«, riet ich ihm. »Die Polizei sucht die Rabauken, die
um diese Zeit Dempsey im Wimbledon Park zusammengeschlagen
haben. Bevor ich mich mit Ericson treffe, werde ich einen Brief an
Inspektor Trueman schreiben und ihn bitten, bei Ihnen 'reinzu-
schauen, wenn ich länger als 24 Stunden von meiner Wohnung ab-
wesend sein sollte. Daran sollten Sie jede Stunde denken, Jan.«
190

»Trueman kann hier einen Kaffee auf Geschäftskosten trinken«,
konterte Jan drohend. »Und sich dabei das Tonband anhören, Mr.
Frazer.«
»Vielleicht spielt er Ihnen dann anschließend das Tonband vor,
das ich von meiner Unterhaltung mit Dempsey aufgenommen ha-
be – gestern abend, nachdem er zusammengeschlagen wurde.« Ich
grinste frech. »Ihr Name kommt mehrfach darin vor. Das Schild
›Geschlossen‹ lasse ich wohl lieber gleich hängen«, erklärte ich, als
ich die Hand auf den Türgriff legte. »Ich habe so das Gefühl, es
wird dort noch ziemlich lange hängen. Guten Morgen, Jan.«
Ich verließ das Lokal mit der Erkenntnis, daß Jans Schatz an eng-
lischen Flüchen für einen Holländer recht beachtlich war.
20
ichards ging ungeduldig vor meinem Hause auf und ab. Als ich
aus dem Taxi stieg, sagte ich dem Fahrer, er solle zehn Minuten
warten und mich dann nach Chelsea fahren.
R
R
»Ich wette eine Flasche Whisky, wenn ich nicht die Adresse weiß«,
neckte mich Richards, der plötzlich neben mir stand. »Der Herr
will nachher zum Crawford House Mansions Nr. 23, Fahrer.«
»Das war aber nicht gerade originell, Richards«, knurrte ich ärger-
lich, als wir in meine Wohnung gingen.
»Frazer, Ihr Auftrag ist erledigt«, sagte Richards energisch. »Was
hat es jetzt noch für einen Sinn, hinter Barbara Day herzujagen und
einen Mord aufklären zu wollen, der uns nichts angeht?«
»Sie hat mich zum Lunch in ihre Wohnung eingeladen. Muß ich
191

Ross vielleicht erst um Erlaubnis bitten, ob ich mit jemandem es-
sen darf?«
»Ross ist zur Zeit in einer Stimmung, in der er zu allem ja sagen
würde, um was Sie ihn bitten. Das ist auch der eigentliche Grund
meines Kommens. Ich soll Ihnen seine Anerkennung zu der Art und
Weise übermitteln, wie Sie den Fall Salinger gelöst haben. Da wir
jetzt wissen, daß Salinger unschuldig war und nichts mit Ericson zu
tun hatte, ist der Fall für uns abgeschlossen.«
»Für mich aber noch nicht. Im Ingenieurberuf lernt man, eine Sa-
che wirklich bis zum Ende zu bringen. Dieses Ende ist für mich
erst erreicht, wenn ich weiß, wer Ericson ist.«
»Das ist natürlich außerordentlich edel gedacht, Frazer. Leider
bringe ich dafür nicht das geringste Verständnis auf.«
»Darf ich etwas genauer erfahren, was Sie damit sagen wollen?«
fragte ich ärgerlich.
Er schüttelte tadelnd den Kopf. »Habe ich nicht recht mit der
Annahme, Sie wollen beweisen, daß Barbara Day nichts mit dem
Mord an Cordwell zu tun hat?«
»Na, und wenn schon?« wies ich ihn zurecht. »Ist es vielleicht ver-
boten, einem Mädchen aus einer verdammt unangenehmen Lage zu
helfen?«
»Und wenn Sie wirklich beweisen sollten, daß sie das süße, un-
schuldige Geschöpf ist, als das sie in Ihren Vorstellungen lebt – was
dann? Welche Art von Belohnung erwarten Sie sich?«
»Ihre schwache Seite ist, daß Sie zu romantisch sind, Richards«,
erwiderte ich bissig.
»Meine schwache Seite ist eher, daß ich ein Zyniker bin, der es
liebt, seinen Gewinn einzustreichen, wenn er die Wette gewonnen
hat.«
»Lassen wir das jetzt, Richards«, lenkte ich ein. »Schenken Sie sich
lieber ein Glas ein.«
Er ging zur Hausbar und sah mich besorgt an. »Sie befinden sich
192

auf gefährlichem Pflaster, Frazer.«
»Ich weiß es. Trotzdem verfolge ich die Sache bis zum Ende, Ri-
chards. Ich bin gerade dabei, mich mit Ericson zu verabreden, und
hoffe, ihm diese Diamanten für 12.000 Pfund zu verkaufen.«
Er stieß einen überraschten Pfiff aus. »Sie wissen hoffentlich, daß
der Handel mit gestohlenem Gut ein Verbrechen ist? Ganz abgese-
hen davon, daß die Diamanten nicht Ihnen gehören. Wollen Sie
mich etwa zum Komplicen einer strafbaren Handlung machen, in-
dem ich Ihnen grünes Licht dafür gebe?«
»Ich spiele die Karten auf meine Weise aus«, antwortete ich ziem-
lich selbstbewußt. »Ich will nichts weiter als Ericson treffen, wozu
die Diamanten nur der Köder sind. Mein Ziel ist es, Cordwells
Mörder zu finden.« Nicht gerade überzeugend meinte ich dann:
»Alles deutet darauf hin, daß Ericson der Mörder ist. Sobald dieses
üble Subjekt hinter Schloß und Riegel sitzt, wird der Fall Salinger
auch für mich abgeschlossen sein.«
»Sie sollten sich lieber auf den eben errungenen Lorbeeren ausru-
hen«, riet Richards. »Im Augenblick sind Sie das Lieblingskind von
Ross.«
»Unvollendete Aufgaben haben mich noch nie befriedigt«, wehrte
ich ab.
»Dann sollten Sie mich wenigstens wissen lassen, wann und wo
Sie ihn treffen werden, Frazer«, erwiderte Richards. »Van Dakar fühl-
te sich nicht sehr wohl, als ich ihn heute früh im Krankenhaus an-
rief. Er ist ziemlich schwach.«
»Das ist ein weiterer Grund, Ericson zur Strecke zu bringen«, rea-
gierte ich heftig. »Also gut; ich verspreche, Ihnen Bescheid zu ge-
ben, wann und wo ich ihn treffe. Sind Sie jetzt beruhigt?«
»Immerhin erspart mir das möglicherweise den Griff in die Brief-
tasche, um meinen Anteil am Kranz zu zahlen.«
Mein Taxifahrer ging bereits auf und ab, als wir das Haus verlie-
ßen.
193

»Einsteigen, Chef«, forderte er mich auf. Richards betrachtete
mich nachdenklich, als er mich im Wagen sitzen sah. Ich fuhr in
Richtung Chelsea.
Vor Barbaras Haus angekommen, zahlte ich und fuhr mit dem
Lift nach oben.
Barbara schien erleichtert, als sie mich sah. »Vivien ist hier«, sagte
sie, »und Arthur hat auch eben angerufen. Er entwickelt sich zu
einer Landplage.«
»Weil Sie die Verlobung aufgelöst haben?« fragte ich mitfühlend.
»Dann ist er also bei Ihnen gewesen?« Barbara führte mich ins
Wohnzimmer.
»Ja, er war bei mir, und zwar in höchster Erregung. Er beschuldig-
te mich, für den Bruch verantwortlich zu sein.«
Ich nickte Vivien zu, die es sich in einem Sessel bequem gemacht
hatte. Sie erwiderte den Gruß mit einem bedeutungsvollen Blick.
Das Telefon läutete, und Barbara machte eine ungeduldige Geste.
»Das ist er wahrscheinlich schon wieder. Ich nehme den Apparat
ins Schlafzimmer, wenn es Ihnen nichts ausmacht, Tim.«
Ich nickte verständnisvoll, und sie verschwand mit dem Telefon.
Vivien blickte ihr nach und wandte sich dann mir zu. »Ich habe
für heute abend eine Verabredung mit Ericson arrangiert. In Maide
Vale.«
»Er ist also verhandlungsbereit?«
»Er hat Ihren Preis akzeptiert und will Sie in Monkton Villas Nr. 3
treffen.«
Ich holte mein Notizbuch hervor. »Einen Augenblick; ich will mir
nur die Adresse notieren.« Mir war Richards' Mahnung eingefallen,
Adressen grundsätzlich aufzuschreiben.
»Und kommen Sie allein«, mahnte Vivien. »Falls Sie jemand be-
gleitet, ist das Geschäft sofort abgeblasen.«
»Ich komme schon allein«, beruhigte ich sie.
»Ericson wird sehr darauf bedacht sein sicherzugehen. Das Haus
194

können Sie gar nicht verfehlen. Draußen hängt ein Schild ›Zu ver-
mieten‹.« Sie nahm einen Sicherheitsschlüssel aus der Tasche und
händigte ihn mir aus. »Damit können Sie sich selbst einlassen. Das
Haus steht leer.«
Ich sah sie nachdenklich an. »Und welche Garantie habe ich, daß
Ericson mir wirklich das Geld gibt und ich das Haus wieder bei
voller Gesundheit verlasse?«
»Dafür gibt es keine Garantien«, erwiderte sie kühl. »Ich nehme
an, Sie haben auch daran gedacht, bevor Sie um diese Begegnung
nachsuchten.«
Ich nickte lächelnd. »Wenn ich jetzt nach Haus komme, schreibe
ich einen Brief an Inspektor Trueman. Ich werde ihn mit genauen
Weisungen meinem Bankdirektor übergeben. Welcher Art diese In-
struktionen sein werden, brauche ich Ihnen wohl kaum zu erklären,
Vivien. Sollte mir heute abend etwas zustoßen, wird der Brief mor-
gen früh bei Scotland Yard abgeliefert. Das können Sie auch Eric-
son mitteilen.«
»Das werde ich tun.« Sie lachte. »Ich glaube, Ihnen steht eine
Überraschung bevor, Frazer.«
»Vielleicht wird auch Ericson nicht weniger überrascht sein«, er-
widerte ich und steckte den Schlüssel ein. »Um welche Zeit kommt
er?«
»Um Mitternacht.« Sie warf einen schnellen Blick auf ihre Arm-
banduhr. »Da fällt mir ein, daß ich in zehn Minuten verabredet
bin. Entschuldigen Sie mich bitte bei Barbara.«
Kurze Zeit danach kam Barbara wieder ins Zimmer. Sie nickte
schweigend, als ich ihr erzählte, Vivien sei gegangen, und ließ sich
offensichtlich deprimiert in einen Sessel sinken.
»Arthur treibt mich noch zum Wahnsinn«, beklagte sie sich. »Un-
ter anderem droht er mit Selbstmord.«
»Er wird darüber hinwegkommen. Sie müssen aber fest bleiben
und sich weigern, ihn wiederzusehen.«
195

Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück. »Zuerst hatte er mich
ja beschuldigt, mit Ihnen ein Verhältnis zu haben. Dann aber schob
er die Schuld auf diesen Ericson. Ich versuchte ihm klarzumachen,
daß Sie niemanden dieses Namens kennen. Das verhält sich doch
auch so, nicht wahr, Barbara?«
»Nein, ich kenne ihn nicht«, antwortete sie zögernd, den Blick
fest auf mich gerichtet. »Ich kenne ihn nicht, aber … Ericson ist ein
Freund von Vivien, und wenn ich das Trueman erzähle, dann –« Sie
brach den Satz mit einem hilflosen Zucken der Schultern ab.
»Was dann?«
»Ich dachte, die Polizei würde dann glauben, Vivien habe auch
etwas mit der Sache Cordwell zu tun.«
»Und hat sie etwas damit zu tun?« bohrte ich weiter.
»Nein. Ich bin sicher, daß dies nicht der Fall ist«, antwortete Bar-
bara mit fester Überzeugung.
»Kennen Sie Vivien schon lange?«
»Schon ziemlich lange.« Sie verschränkte die Hände hinter dem
Kopf und schloß halb die Augen. »Genaugenommen hat Arthur
uns miteinander bekannt gemacht.«
»Wußten Sie etwas über sie, bevor Sie Vivien kennenlernten?«
»Nicht viel«, gestand sie widerwillig. »Aber sie kannte eine Menge
Leute mit Geld, die sich für Antiquitäten interessierten. Aus diesem
Grund hielt ich sie für eine passende Geschäftspartnerin.« Sie fing
meinen Blick auf und meinte dann: »Vivien könnte Ihnen nützlich
sein, wenn Sie etwas Kapital brauchen, um Ihre Firma wieder in
Gang zu bringen. Warum sprechen Sie nicht einmal mit ihr?«
»Ich würde 12.000 Pfund benötigen«, antwortete ich zweifelnd.
»Das ist eine Menge Geld, und ich kann ihr keine Sicherheiten bie-
ten.«
»Das ist allerdings schwierig. Haben Sie denn überhaupt keine
Sicherheiten?«
Ich schüttelte den Kopf und brachte das Gespräch langsam wie-
196

der auf Ericson zurück. »Hat Cordwell Ihnen gegenüber jemals
Ericson erwähnt?« erkundigte ich mich und fügte schnell hinzu:
»Sie wissen doch, daß Cordwell mit gestohlenen Diamanten han-
delte, Barbara?«
Sie sah überrascht aus. »Nein! Nein, das wußte ich nicht. Zwar er-
zählte mir Trueman, daß Cordwell ein Erpresser gewesen sei, aber…«
Ich wollte ihr glauben. Vivien mußte mich belogen haben, als sie
mir sagte, Barbara habe um die andere Tätigkeit von Cordwell ge-
wußt. Vermutlich hatte sie das nur behauptet, um das Gespräch auf
die Diamanten lenken zu können.
»Wollen Sie mich etwa vor Vivien warnen, Tim?« fragte sie be-
sorgt. »Ich habe ihr stets vertraut. Der Gedanke, daß sie in eine
böse Sache verwickelt sein könnte, wäre mir sehr unangenehm.«
»So meinte ich das nicht«, tröstete ich sie schnell. »Aber Vivien
kennt Ericson, und Trueman hegt einen schweren Verdacht gegen
Ericson. Da ist es doch nur natürlich, daß man sich für Viviens
Vergangenheit interessiert.«
»Wirklich, Sie sind genauso schlecht wie Arthur«, protestierte sie.
»Er hat mich auch stets vor ihr gewarnt.«
»Da gibt es noch eine andere Möglichkeit, Barbara. Glauben Sie,
Cordwell sei vielleicht an jenem Abend gekommen, um Sie zu er-
pressen?«
»Mich erpressen? Wie sollte er das? Es gab doch nichts, weswegen
er mich hätte erpressen können.«
»Und wie ist es mit dem Film, den man bei ihm gefunden hat?
Ich meine den, den ich von Ihnen in Amsterdam aufgenommen
hatte. Fairlee hätte eifersüchtig werden können, wenn er erfahren
hätte, daß ich Ihnen überall gefolgt bin.«
»Ich muß gestehen, es sah wirklich so aus, als hätten Sie ein mehr
als zufälliges Interesse für mich, Tim«, gab sie lächelnd zu. Sie setz-
te sich aufrecht. »Wie ist denn Cordwell nur an den Film herange-
kommen? Ich erinnere mich, daß Sie dem Inspektor sagten, Sie hät-
197

ten ihn irgendwo verloren; Cordwell muß ihn gestohlen haben.« Sie
stand mit einer verzweifelten Geste auf. »Ich kann das alles einfach
nicht mehr ertragen. Seit jenem Unfall mit dem Wagen habe ich
ständig das Gefühl, verfolgt zu werden. In Amsterdam ist mir ein
Mann überallhin gefolgt. Er war immer in der Nähe, wohin ich
auch ging – in Museen, Gemäldegalerien… Dann kamen Sie, mach-
ten die vielen Aufnahmen von mir… Dann der Mord an Cordwell
in meiner Wohnung … und diese ständigen Vernehmungen durch
den Inspektor.«
Impulsiv legte ich eine Hand auf ihre Schulter. »Sagen Sie mir die
Wahrheit, Barbara: Haben Sie Ericson jemals getroffen?« fragte ich
sanft.
Sie hob den Kopf und sah mir fest in die Augen, ohne den Blick
zu senken. »Ericson bedeutet mir nichts, gar nichts, Tim. Können
Sie das nicht verstehen?«
Beruhigt lächelte ich zu ihr hinab. »Heute abend treffe ich Eric-
son. Vivien hat es arrangiert.«
Sie schüttelte den Kopf. »Sie dürfen diese Verabredung nicht ein-
halten. Ich bin sicher, daß etwas Furchtbares geschehen wird.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Ich spüre es«, antwortete sie. »Irgendwie ist Vivien in die Sache
verwickelt, wenn ich auch nicht genau weiß, wie. Es ist scheußlich,
wenn man sich von so viel Argwohn umgeben sieht. Tim, ich muß
von allem etwas Abstand gewinnen. In Cornwall besitze ich ein
kleines Landhaus, in St. Mawes, hoch über dem Hafen. Dort ist es
wundervoll ruhig.« Sie lächelte mich an. »Können Sie ein Segelboot
bedienen, Tim?«
Ich nickte. »Ich habe viel gesegelt … in Burnham-on-Crouch. Dort
bin ich früher immer hingefahren, wenn ich geschäftliche Pro-
bleme am Halse hatte. Wenn man in einem Boot auf dem Wasser
schwimmt, erscheinen die Probleme gar nicht mehr so riesenhaft.«
Sie streckte mir die Hand entgegen. »Warum kommen Sie nicht
198

mit mir, Tim? Dann könnten wir die vielen unangenehmen Dinge
einmal in die richtige Perspektive rücken. Wollen Sie, Tim?«
Es klang sehr verlockend.
Ihre Augen nahmen einen sanften Schimmer an. »Bis morgen früh
werde ich alles gepackt haben. Wir könnten um 10.30 Uhr vom
Bahnhof Paddington abfahren. Wollen Sie mich hier abholen?«
Ich sagte zu, was ihr einen Seufzer der Befriedigung entlockte.
»Und bitte, gehen Sie heute abend nicht zu Ericson. Versprechen
Sie mir das?«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich möchte diese Cordwell-Angelegen-
heit um Ihretwillen klären, Barbara. Solange das nicht erledigt ist,
werden Sie nicht zur Ruhe kommen. Keine Sorge, Barbara. Wenn
wir uns morgen wiedersehen, hoffe ich alles geklärt zu haben.«
»Dann passen Sie gut auf sich auf. Versprechen Sie mir das, Tim?«
Während ich es ihr versprach, berührte ich ganz kurz die Pistole
in meiner Jackentasche. Nur so aus Aberglauben.
Der Gedanke an die Pistole in meiner Tasche war mir auch recht
tröstlich, als ich nachts durch die verlassene Maide Vale Street ging
und mir die hohen, im spätviktorianischen Stil erbauten Villen an-
sah. Die meisten waren baufällig oder hätten zumindest dringend
einen neuen Verputz nötig gehabt. Die Nummer 3 mit dem Schild
›Zu Vermieten‹ an der Tür machte keine Ausnahme.
Ich stieg die Stufen zur Haustür empor, deren Farbe abgeblättert
war, und schob den Schlüssel ins Schloß. Die Tür quietschte, als
ich sie aufstieß, und ich gelangte in einen übelriechenden Vorraum.
Dort schaltete ich die Taschenlampe ein und sah mich in der
dürftig möblierten Diele um. Rechts, gegenüber der Treppe, war
eine Tür. Ich blieb stehen und lauschte. Wenn Ericson bereits hier
war, dann gab es zumindest kein Anzeichen für seine Anwesenheit.
Langsam drehte ich den Türknauf und öffnete die Tür dann mit ei-
199

nem Stoß.
Es war ein ganz gewöhnliches Wohnzimmer. Im Schein der Ta-
schenlampe tauchten die vertrauten Umrisse von Stühlen, Anrich-
ten und einem kleinen Schreibtisch auf; nur lag auf allem eine di-
cke Staubschicht. Ich ließ den Lichtkegel der Lampe in weitem Um-
kreis umherwandern und ging dann langsam ins Zimmer hinein –
in einen Raum, der auf die Möbelpacker zuwarten schien, nichts
weiter. Plötzlich fiel das Licht meiner Taschenlampe auf den Fuß
eines Mannes.
Der Fuß war nach oben gekehrt, und als ich den Lichtschein wei-
terwandern ließ, entdeckte ich, daß der Besitzer dieses Fußes offen-
sichtlich bewußtlos hinter der Couch lag.
Meine erste Reaktion war, die Taschenlampe auszuschalten und,
ohne mich zu rühren, auf seinen Atem zu lauschen. Durch das ver-
hängte Fenster drang der schwache Lichtschimmer einer Straßen-
laterne. Eine beängstigende und unheimliche Stille herrschte im
Raum. Auch aus den anderen Räumen des Hauses war kein Laut zu
vernehmen.
Schließlich ermannte ich mich, eilte zur Couch und legte mich,
mit der Taschenlampe leuchtend, auf sie. Was ich sah, ließ mich
um die Couch herumgehen, um besser sehen zu können.
Das bleiche Gesicht und die spärlichen strohfarbenen Haare wa-
ren mir nur allzu gut bekannt. Dempsey hatte seinen Paß nach
Montreal nicht gebraucht, und wie es schien, würde er ihn auch nie
mehr benötigen.
An seiner linken Schläfe bemerkte ich eine blutverkrustete Wun-
de, und aus einem Mundwinkel floß ein schwaches Rinnsal Blut.
Dempsey war nicht mehr zu helfen, das war auf den ersten Anblick
ersichtlich. Als ich mich wieder aufrichtete, wurde mein Gesicht
vom grellen Schein einer starken Taschenlampe getroffen.
Meine Augen brauchten ein paar Sekunden, um sich an das star-
ke Licht zu gewöhnen. Im Türrahmen stand, die Taschenlampe in
200

der Linken und eine automatische Pistole in der Rechten, Arthur
Fairlee. Er hatte seine Brille nicht auf, und seine Augen starrten
mich kalt und drohend an.
Ich wartete darauf, daß er das Schweigen brach; aber er blieb
stumm.
»Ich will mich hier mit Ericson treffen«, sprach ich ihn schließ-
lich an, wobei ich plötzlich das Gefühl hatte, daß meine Lippen
sehr trocken waren.
»Das ist eine verdammte Lüge«, entgegnete er wütend. »Sie haben
sich hier mit Barbara verabredet.«
Ich umspannte mit beiden Händen die Lehne eines Sessels.
»Schalten Sie die Taschenlampe aus und nehmen Sie die Hände
hoch!« befahl er, und es schien mir sicherer, ihm zu gehorchen. Sein
Gesicht war seltsam verzerrt, als er sagte: »Warum, zum Teufel,
konnten Sie sich nicht auf die Arbeit beschränken, die Ihnen aufge-
tragen war, und Barbara aus dem Spiele lassen?«
»Welche Arbeit war mir denn aufgetragen?« fragte ich, wobei ich
mich vorsichtig um einige Zentimeter vorschob.
»Sie sollten doch den Schmugglerring aufdecken, stimmt es?« Er
umspannte den Griff der Pistole fester. »Vivien ist Ihnen auf der
Spur geblieben, seit Ihrem ersten Besuch bei Dempsey.«
»Ich habe die Diamanten mitgebracht«, antwortete ich, nahm den
Arm herunter und suchte in der Jackentasche nach dem Schmuck-
kästchen. »Haben Sie die 12.000 Pfund dabei?«
»Bleiben Sie stehen, wo Sie sind!« warnte er mich scharf. »Nein,
die 12.000 Pfund habe ich nicht dabei. Glauben Sie etwa, ich sei
Ericson?«
»Nein, das glaube ich nicht. Aber seien Sie doch kein Narr, Fair-
lee. Glauben Sie wirklich, die Leute, für die ich arbeite, werden Sie
entkommen lassen, nachdem Sie mich umgebracht haben? Stecken
Sie Ihre Pistole weg, und Sie können die Diamanten haben.«
»Nicht Sie stellen hier die Bedingungen, Frazer.« Er kam bei die-
201

sen Worten einen Schritt näher auf mich zu. »Sie werden sterben,
nicht nur, weil Sie zu viel wissen, sondern auch, weil Sie mir Bar-
bara ausgespannt haben.«
»Nehmen Sie Vernunft an«, drängte ich und öffnete den Schmuck-
kasten. »Trueman ist Cordwells Mörder hart auf den Fersen. Wenn
Sie noch einen Rest von Verstand haben, verlassen Sie dieses Land
so schnell wie möglich. Dazu werden Sie viel Geld brauchen. Hier,
nehmen Sie diese Diamanten und verkaufen Sie sie an Ericson.« Ich
hielt ihm das Kästchen hin, wobei ich es so einrichtete, daß das
Licht seiner Taschenlampe sich in den funkelnden Steinen brach.
»Hiermit können Sie sich die Freiheit erkaufen. Im anderen Falle
warten mindestens fünfzehn Jahre Zuchthaus auf Sie.«
Die Pistole in seiner Hand schwankte. Er beugte sich vor und
starrte auf die funkelnden Diamanten. Im selben Augenblick
schnellte ich die Hand mit meinem ganzen dahinterstehenden Kör-
pergewicht hoch, so daß die Diamanten ihn direkt zwischen die
Augen trafen.
Er prallte zurück, und ich schlug ihm blitzschnell mit dem an-
deren Arm die Pistole aus der Hand. Als ich jedoch mit einem Satz
vorschnellte, um sie zu fassen, kam er mit angezogenem Knie auf
mich herunter. Seine Finger umkrallten meine Kehle mit der un-
heimlichen Kraft eines nahezu Wahnsinnigen. Im verzweifelten Be-
mühen, diesen würgenden Fingern zu entgehen, wuchtete ich mei-
nen Körper hoch, wobei ich Fairlee über meinen Kopf schleuderte.
Seine linke Hand gab meine Kehle frei, erreichte aber wieder die
Pistole. Dann kniete er über mir und zielte zwischen meine Augen.
Ich hörte ein hartes Krachen, das ich im ersten Augenblick für die
Explosion der Kugel hielt, die mir in den Schädel drang. Aber dann
erkannte ich, daß die Pistole selbst auf meine Stirn geprallt war und
das Blut, das ich im Gesicht spürte, von Fairlees Handgelenk tropf-
te.
»Für einen kranken Mann war das doch eine ganz beachtliche
202

Leistung, finden Sie nicht auch?« hörte ich Richards fragen.
»Danke, Richards!« war das einzige, was ich atemlos herausbrach-
te, als ich endlich wieder auf den Füßen stand. Ich deutete hinter
die Couch. »Immerhin geht es mir besser als Dempsey dort, dem
armen Teufel.«
»Das wissen wir bereits«, entgegnete Richards trocken. »Als ich
hier eintraf, hatte die Bande mit ihm schon abgerechnet.«
»Nun sagen Sie mir erst einmal, was Sie hier eigentlich tun«, frag-
te ich, immer noch um Atem ringend.
»Unsere Dienststelle ist ja schließlich kein Selbstmörderverein,
Frazer. Als Sie nicht davon abzubringen waren, sich mit Ericson zu
treffen, blieb mir nichts anderes übrig, als Sie im Auge zu behal-
ten.«
»Also darum wollten Sie unbedingt wissen, wann und wo ich mich
mit Ericson treffen sollte.«
Er lächelte, hob Fairlees Pistole auf und wickelte sie in ein Ta-
schentuch. »Das Ding hier wird Scotland Yard interessieren, schätze
ich«, sprach er zu Fairlee, der sich sein eigenes Taschentuch um das
verletzte Handgelenk band. »Inspektor Trueman muß jeden Augen-
blick hier eintreffen. Ich rief ihn an, als ich Dempsey entdeckt hat-
te.«
»Da habe ich einen Mordsdusel gehabt, Richards! Wenn Sie nicht
hergekommen wären… Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken
soll –«
»Es war mir ein Vergnügen. Und vergessen Sie die Diamanten
nicht, Frazer. Ross wird mir ihren Gegenwert so lange vom Gehalt
abziehen, bis sie bezahlt sind, wenn ich sie ihm nicht heil zurück-
bringe.«
Ich lachte, sammelte die Diamanten auf und übergab Richards
das Kästchen. Ein Wagen fuhr draußen vor.
»Kommen Sie, Frazer. Wir können gehen.«
Als wir den Gartenweg entlangliefen, stieg Inspektor Trueman aus
203

dem Wagen. »Mit Ihnen rede ich morgen mal ein ernstes Wort,
Mr. Frazer«, erklärte er im Vorbeigehen.
»Sagen wir um zehn Uhr«, antwortete ich. »In Crawford House
Mansion Nr. 23, es wird vielleicht sehr dringend sein.«
»Ich werde zwei meiner Leute schicken«, antwortete Trueman
über die Schulter. »Wir wollen es doch lieber nicht riskieren, daß
wieder jemand über die Feuerleiter verschwindet, nicht wahr, Sir?«
Am nächsten Morgen läutete ich pünktlich um zehn Uhr an Bar-
baras Tür. Sie öffnete mir in einem schwarzen Kleid, über dem sie
eine Pelzjacke trug.
»Genau das hatten Sie an, als wir uns kennenlernten. Erinnern Sie
sich noch, Barbara? Damals im Flugzeug.«
Sie nickte, wobei es in ihren Augen feucht schimmerte. »Dachten
Sie vielleicht, ich hätte es vergessen?« Sie küßte mich leicht auf die
Wange und deutete mit der Hand auf die Koffer in der Diele. »Ich
bin schon seit sieben Uhr auf den Beinen – es ist alles gepackt.«
Sie ließ mich eintreten und schloß dann die Tür hinter mir. »Ich
bin so froh, daß Sie da sind. Telefonisch habe ich Sie leider nicht
erreicht.«
»Ich hatte doch versprochen, daß ich kommen würde«, antwor-
tete ich ruhig.
»Ja, ich weiß.« Sie seufzte. »In letzter Zeit habe ich aber so viel
Aufregendes durchmachen müssen, daß man nichts mehr für selbst-
verständlich hält. Und Vivien ist total durchgedreht. Es wird wun-
derbar sein, das alles endlich einmal hinter sich zu lassen.« Sie lä-
chelte und hielt mir ihre Hand hin. »Tim, wo ist Ihr Gepäck?«
»Draußen, in meinem Wagen«, hielt ich sie hin.
Sie warf einen flüchtigen Blick auf die Armbanduhr. »Wir haben
gerade noch Zeit für eine Tasse Kaffee. Darf ich Ihnen eine anbie-
ten?«
204

Ich schüttelte den Kopf. Jetzt erst schien sie zu merken, daß ich
verkrampft und aufs äußerste angespannt war.
»Ist etwas nicht in Ordnung?« fragte sie.
Ich deutete auf die Tür des Wohnzimmers. »Können wir nicht
hineingehen? Nur für ein paar Minuten?«
Sie stand mit dem Rücken zum Kamin und sah mich an. Zu-
nächst wußte ich nicht, wie ich es sagen sollte. Dann aber gab ich
mir einen Ruck: »Ich gehe nicht mit, Barbara.«
Einen Augenblick hielt sie den Atem an, während ihre Hand die
Lehne eines Stuhles umkrampfte. »Warum sind Sie dann gekom-
men?« fragte sie, während ich einige Schritte auf sie zuging.
»Um Ericson zu treffen«, antwortete ich ruhig.
Sie starrte mich einige Sekunden lang sprachlos an. Kein Laut war
im Zimmer zu hören, außer dem gedämpften Dröhnen eines pneu-
matischen Gesteinsbohrers irgendwo draußen auf der Straße.
»Sie erwarten Ericson hier bei mir zu treffen?« fragte sie mit un-
gläubigem Ton.
Ich nickte. »Arthur Fairlee hat bei der Polizei ein volles Geständ-
nis abgelegt. Man weiß dort über die Diamanten Bescheid und wa-
rum Cordwell zu Ihnen gekommen ist. Auch daß Fairlee ihn er-
mordete und dann den Schlüssel unter dem Türschlitz durchschob,
damit ich in die Wohnung gelangen und meine Fingerabdrücke
hinterlassen konnte.«
»Das ist nicht wahr!« protestierte sie, aber ich sprach unbeirrt wei-
ter.
»Sie verschwanden beide über die Feuerleiter. Dann kamen Sie
allein zurück und spielten mir eine Szene vor, die einer großen Tra-
gödin würdig gewesen wäre. Hatten Sie mich zu diesem Zweck ein-
geladen – um ein gutes Publikum dafür zu haben?«
»Nein, Tim«, antwortete sie. »Es war ein Unfall, das müssen Sie
mir glauben.«
»Und warum luden Sie mich für jenen Abend in Ihre Wohnung
205

ein?«
»Damit Arthur Sie einmal sehen konnte. Ich wußte, daß Sie mir
in Amsterdam gefolgt waren. Und ich dachte, falls auch Sie im Dia-
mantengeschäft tätig waren, hätte Arthur Sie vielleicht wiedererken-
nen können.«
»Es war also nicht von vornherein geplant, Cordwell umzubrin-
gen?«
»Nein. Er tauchte ganz plötzlich auf – aus heiterem Himmel. Als
er dann mit erpresserischen Drohungen begann, verlor Arthur die
Beherrschung. Die Sache ist ja dann noch einigermaßen gut abge-
laufen – bis auf die Diamanten.« Sie fingerte an der Naht des Pol-
stersessels herum. »Wie kamen Sie auf die Idee, in der Zigarren-
spitze nachzusehen?«
»Es gehört zu meinem Beruf, an derlei Dinge zu denken«, erwi-
derte ich ausweichend. Die Karten lagen jetzt offen auf dem Tisch,
und ich beobachtete Barbara scharf auf das geringste Anzeichen ei-
ner verdächtigen Bewegung. »Ich kann Sie nicht verstehen, Barba-
ra«, erklärte ich dann hilflos. »Sie töteten Leo Salinger, weil Sie
glaubten, sein Bruder Arnold betrüge Sie und Leo wolle sich mit
den Diamanten auf und davon machen. Arnold Salinger trieben Sie
zum Selbstmord. Sie haben Ihre beste Freundin in den Diamanten-
schmuggel hineingezogen und Ihren Verlobten in einen Mordfall…
Warum das alles?«
Sie sah mich lange schweigend und distanziert an. Dann antwor-
tete sie gelassen: »Weil ich nun einmal Ericson bin.«
Einen Augenblick zögerte ich, ging dann in die Diele hinaus und
öffnete die Wohnungstür. Trueman stand draußen, wie ich es er-
wartet hatte, und wir gingen zusammen zurück ins Wohnzimmer.
Als wir eintraten, nahm Barbara ihre Handtasche an sich.
»Ich war mir schon lange darüber im klaren, daß dies alles irgend-
206

wann einmal enden mußte«, sagte sie mit einem Kopfnicken in
Richtung auf den Inspektor. »Aber es wird auf meine Art enden,
nicht so, wie andere es wollen.«
Als Trueman durch das Schlafzimmer ging und den Beamten auf
der Feuerleiter hereinrief, zog sie eine kleine Pistole aus der Tasche.
»Rühren Sie mich nicht an!« rief sie und richtete die Pistole auf
Trueman. Der Polizist kam aus dem Schlafzimmer, ein gemütlicher,
grauhaariger Mann, der beim Anblick der Waffe erstarrte. »Stellen
Sie sich dort drüben neben den Inspektor!« befahl Barbara mit ei-
ner drohenden Bewegung. »Ich mache sonst von diesem Ding hier
Gebrauch. Ich spaße nicht!«
»Tun Sie, was sie sagt«, wies Trueman den Beamten an. »Es hat
keinen Sinn mehr, jetzt noch eine große Szene aufzuziehen.«
Barbara faßte noch einmal in ihre Handtasche und holte noch ei-
ne kleine Phiole mit roter Kappe hervor. »Ich gehe jetzt in mein
Schlafzimmer«, erklärte sie. »Folgen Sie mir nicht, Tim – auch nicht
später. Ich möchte nicht, daß Sie mich noch einmal sehen.«
Ich hörte eine seltsam klingende Stimme, die ich mit Mühe als
meine eigene erkannte, sagen: »Barbara, seien Sie doch nicht
töricht!« Dann verschwand sie im Schlafzimmer und verriegelte die
Tür hinter sich.
»Fairlee hat mir das bereits angekündigt«, sagte Trueman. Hastig
schickte er den Polizisten los mit der Anweisung, nochmals über
die Feuerleiter ins Schlafzimmer einzusteigen.
Als der Mann wenig später die Tür von innen geöffnet hatte,
wußten wir, daß es zu spät war. Trueman blickte auf die leblose Ge-
stalt auf dem Bett. »Dafür werde ich von meinen Vorgesetzten eini-
ges zu hören kriegen; aber besser so als noch ein Mord«, meinte er.
»Sie hätte die Pistole bestimmt abgedrückt.« Als ich auf das Bett
zuging, hob er abwehrend die Hand. »Ich würde es an Ihrer Stelle
nicht tun, Sir«, warnte er mich ruhig.
Ich zögerte, verließ dann mit kurzem Kopfnicken das Zimmer
207

und ging hinaus in die Diele.
Richards saß an einem reservierten Tisch seines Stammlokals, als
ich dort ankam.
»Ich habe ein Dutzend Austern bestellt«, sagte er. »Wollen Sie
nicht lieber zuerst ein Glas Sekt trinken?« Er winkte dem Kellner.
»Sie hat Selbstmord begangen«, berichtete ich, als der Kellner da-
vongeeilt war.
»Sie hatte mehr Zivilcourage als dieser Fairlee«, antwortete Ri-
chards. »Der diskutiert noch immer. Er will zwar gewußt haben, was
gespielt wurde, der Organisation selbst will er aber nicht angehört
haben. Angeblich will er bereits früher mit Auflösung der Verlo-
bung gedroht haben, wenn Barbara die Gangsterbande nicht auf-
gäbe. Damit wird er vor Gericht aber nicht weit kommen. Daß man
es ihm abnimmt, er habe Cordwell in einem Anfall von Eifersucht
getötet, halte ich jedoch für möglich. Das würde ihn vor dem Strang
retten.«
»Auch ich würde meinen, daß er in diesem Punkt die Wahrheit
sagt«, erwiderte ich. »Cordwell wurde mit dem schweren Aschenbe-
cher erschlagen, was an sich auf einen Ausbruch sinnloser Wut
schließen läßt. Letzte Nacht in Maide Vale hatte ich unbedingt den
Eindruck, daß Fairlee nicht normal war – obwohl ich nicht zu sei-
nen Gunsten in den Zeugenstand treten würde.«
»Sie treten überhaupt nicht in den Zeugenstand. Punktum.« Ri-
chards wurde energisch. »Ross wünscht nicht, daß seine Dienststelle
diese Art von Publizität erhält.« Er legte einen Augenblick seine
Hand auf meinen Arm. »Tut mir leid, alter Junge. Barbara Day war
schon ein verdammt attraktives Mädchen, und ich kann es gut ver-
stehen, daß Sie sich in sie verknallt hatten. Aber die Hauptsache ist,
Sie haben Ihre Aufgabe gelöst, und zwar großartig, und darauf soll-
ten wir jetzt trinken!«
208

»Bollinger … Jahrgang 49«, las ich auf dem Flaschenetikett. »Das
ist schon ein Sekt zum Feiern. Den größten Teil müssen Sie aller-
dings austrinken, Richards.«
»Verdammt noch mal, ich möchte nur wissen, was mit mir los
ist«, erwiderte Richards. »Aber mir ist heute gar nicht so sehr nach
Austern und Champagner zumute. Ich habe übrigens so etwas läu-
ten hören, daß Ross schon einen neuen Fall für uns in petto hat.
Nur jetzt sollten wir ihn nicht überfallen, er liebt es gar nicht, wenn
man während der Bürostunden bei ihm aufkreuzt. Manchmal habe
ich den Eindruck, er hält Morde, die nicht zwischen morgens neun
und nachmittags fünf Uhr stattfinden, als nicht zuständig für seine
Abteilung. Ich hoffe, es ist Ihnen nicht zu langweilig, für unsere Be-
hörde zu arbeiten, Frazer.«
Ich sagte ihm, ich würde versuchen, mich nicht zu langweilen.
Als wir zwei Stunden später das Restaurant verließen, fragte Ri-
chards: »Sagen Sie mal, Frazer, Sie gehören doch wohl nicht zu den
Männern, die Parfüm benutzen?«
Ich schnupperte am Ärmel meiner Jacke. »Das erinnert mich an
ein Mädchen, das ich einst auf dem Londoner Flughafen kennen-
lernte. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn wir zuerst bei mir
zu Haus vorbeifahren? Ich würde gern meinen Anzug wechseln.«
»Und stecken Sie sich auch ein neues Taschentuch vorn in Ihre
Rocktasche«, riet mir Richards. »An diesem hier ist Lippenstift. Ross
würde das nicht richtig zu würdigen wissen.«
»Zum Teufel mit Ross, Richards! Ich habe meine Meinung geän-
dert. Wir fahren direkt zum Smith Square.«
Richards und ich saßen Ross gegenüber, der unsere Berichte über
den Fall Ericson vor sich liegen hatte. Über Barbaras Einladung, sie
nach Cornwall zu begleiten, war in dem meinen nichts erwähnt.
Ross schloß die Akte und wandte sich mir zu.
209

»Ich hoffe, Sie wissen es zu schätzen, daß wir Ihnen in diesem
Fall eine gewisse Ellenbogenfreiheit gelassen haben, Frazer. Sie ha-
ben den Fall Salinger so zufriedenstellend gelöst, daß ich mich von
Richards dazu überreden ließ, Ihnen zu gestatten, noch hinter Eric-
son herzujagen. Doch möchte ich Sie darauf aufmerksam machen,
daß Sie dies nicht als Präzedenzfall werten können.«
Ich murmelte etwas vor mich hin, daß ich persönlich zu sehr in
die Sache verwickelt gewesen sei, um anders handeln zu können.
»Sie können von Glück reden, daß Richards Sie die ganze Zeit im
Auge behalten hat«, sagte Ross sehr ernst. Er schloß auch die zwei-
te Akte und legte beide in den Aktenschrank zurück. Dann griff er
nach einem neuen Ordner und legte ihn vor sich auf den Tisch.
»Nun zu unserem nächsten Auftrag…«, begann er, wurde jedoch
vom Läuten des Telefons unterbrochen.
Der Anruf war für Richards bestimmt, der ins Nebenzimmer ging,
um von dort aus zu sprechen. Während wir auf seine Rückkehr
warteten, öffnete Ross die Schublade zu seiner Rechten und ent-
nahm ihr eine Filmkamera.
»Die können Sie jetzt auch zurückhaben.«
Ich nahm sie, warf einen flüchtigen Blick darauf und reichte sie
ihm zurück.
»Die gehört mir nicht«, sagte ich.
»Das erklärt dann auch, wie die Filme vertauscht wurden.« Ross
holte aus einer unteren Schublade eine andere Kamera hervor. »Die
hier wurde bei Cordwells Leiche gefunden.«
»Ja, die beiden Kameras sind bestimmt bei de Kroon vertauscht
worden. Cordwell hatte seine gerade erst von der Polizei zurücker-
halten, sie war ihm bei seinem vorherigen Besuch in Amsterdam ge-
stohlen worden. Das muß damals gewesen sein, als er die Aufnah-
me von dem Autounfall gemacht hatte.«
»Ja, so muß es gewesen sein«, stimmte Ross mir zu. »Die Kame-
ras sind das gleiche Fabrikat, und auch die Taschen sind fast iden-
210

tisch.«
»Es war Vivien Gilmore, die mich zuerst auf diesen Gedanken
brachte«, berichtete ich. »Sie wollte mich glauben machen, Cord-
well habe die Kamera durch Zufall an sich genommen und dann
meinen Film benutzt, um Barbara zu erpressen. Sicherlich geschah
das Vertauschen zufällig, aber Cordwell brauchte meinen Film gar
nicht zu seinem Erpressungsversuch. Er hatte schon längst heraus-
gefunden, wer Ericson war. Damit hat er sie erpreßt!«
»Es war vielleicht ein wirklicher Glücksfall, daß Sie die falsche Ka-
mera bekamen«, sagte Ross lächelnd. »Hin und wieder erweisen sich
Fehler als ganz nützlich. Aber leiten Sie hiervon niemals eine Ent-
schuldigung ab.«
»Ich freue mich sehr, daß Sie im Falle Salinger recht behalten ha-
ben, Sir.«
Er zuckte mit den Schultern. »Wahrscheinlich haben Sie mich für
übertrieben sentimental gehalten. Da er nun einmal tot ist, was
spielte es da noch für eine Rolle, ob er schuldig oder unschuldig
war? Aber für mich spielt es doch eine große Rolle.«
Diese Geisteshaltung war es, die Ross die volle und rückhaltlose
Mitarbeit aller Männer sicherte, die unter ihm tätig waren. Richards
kehrte aus dem Nebenzimmer zurück, und Ross öffnete zum zwei-
ten Male den Aktendeckel auf seinem Tisch.
»Und jetzt zu Ihrem nächsten Auftrag, Frazer…«
211
Document Outline
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Durbridge Francis Der Schlüssel
Blaulicht 250 Ansorge, Hans Der Fall Telbus
Mordercza gra Durbridge Francis
Durbridge Francis Die Schuhe
Durbridge Francis Mordercza gra
Durbridge Francis Ten drugi
Durbridge Francis Harry Brent
Durbridge Francis Die Brille
Durbridge Francis Ten drugi
Durbridge Francis Ten drugi
Durbridge Francis Mordercza gra 2
Francisca Loetz Sprache in der Geschichte Linguistic Turn vs Pragmatische Wende
166 Francis Durbridge Harry Brent
Blaulicht 270 Johann, Gerhard Der seltsame Fall des Doktor Vau
Gegenstand der Syntax
60 Rolle der Landeskunde im FSU
fall leaves cal numbers2
Zertifikat Deutsch der schnelle Weg S 29
więcej podobnych podstron