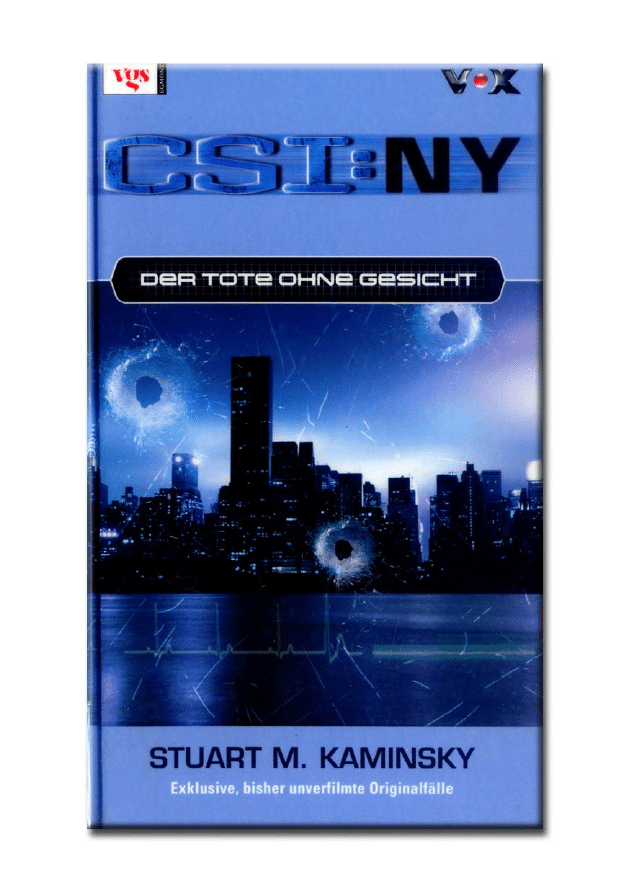

Stuart M. Kaminsky
CSI:NY
Der Tote ohne Gesicht
Aus dem Amerikanischen von Frauke Meier
VGS

Erstveröffentlichung bei Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc. New York 2005.
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »CSI:NY – Dead of Winter«
Das Buch »CSI: NY – Der Tote ohne Gesicht« entstand auf Basis der gleichnamigen Fernseh-
serie von Anthony E. Zuiker, ausgestrahlt bei VOX.
© 2006 CBS Broadcasting Inc. and Alliance Atlantis Productions, Inc.
CSI:NY in USA is a trademark of CBS Broadcasting Inc. and outside USA is a trademark of
Alliance Atlantis Communications Inc. All Rights Reserved.
CBS and the CBS Eye design™ CBS Broadcasting Inc. ALLIANCE ATLANTIS with the sty-
lised »A« design™ Alliance Atlantis Communications, Inc.
Based on the hit CBS television series »CSI: NY«
Produced by CBS PRODUCTIONS, a business unit of
CBS Broadcasting Inc. and Alliance Atlantis Productions, Inc.
Executive Producers: Jerry Bruckheimer, Anthony E. Zuiker, Ann Donahue, Carol Mendel-
sohn, Andrew Lipsitz, Danny Cannon, Pam Veasy, Jonathan Littman
Series created by: Anthony E. Zuiker, Ann Donahue, Carol Mendelsohn
© des VOX-Titel-Logos mit freundlicher Genehmigung
1. Auflage 2006
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Egmont vgs Verlagsgesellschaft mbH
Alle Rechte vorbehalten.
Redaktion: Sabine Arenz
Lektorat: Ilke Vehling
Produktion: Susanne Beeh
Umschlaggestaltung: Danyel Grenzer, Köln
Senderlogo: © VOX 2006
Titelfoto: © 2006 CBS Broadcasting Inc. and
Alliance Atlantis Productions, Inc.
Satz: Achim Münster, Köln
Printed in Germany
ISBN 3-8025-3533-2
Ab 01.01.2007: ISBN 978-3-8025-3533-8
www.vgs.de
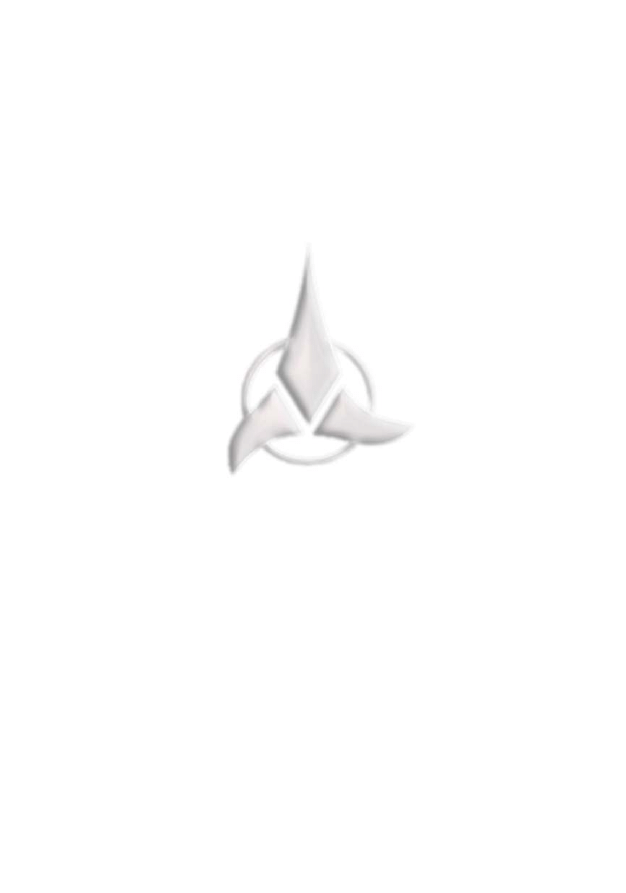
Ganz New York liegt wie erstarrt unter einer
Schneedecke, während das CSI-Team in einem un-
gewöhnlichen Fall ermittelt: Im Fahrstuhl eines
vornehmen Appartementgebäudes wird die Leiche
von Charles Lutnikov entdeckt. Als sich Aiden
Burn und ihr Kollege Mac Taylor bei den Nachbarn
umhören, führen alle Spuren zu der Krimiautorin
Louisa Cormier. Könnte es sein, dass die Lösung
des Falles in ihren Büchern verborgen liegt?
Gleichzeitig arbeiten Stella Bonasera und Don
Flack an einem mysteriösen Mordfall: Der Draht-
zieher des organisierten Verbrechens von New Y-
ork, Anthony Marco, steht vor Gericht. Aber eines
Morgens wird Alberta Spanio, die Kronzeugin der
Staatsanwaltschaft, tot in ihrem Hotelzimmer ge-
funden. Ein offenes Badezimmerfenster legt die
Vermutung nahe, dass der Mörder von außen ein-
gedrungen ist. Beobachtet wurden allerdings zwei
Männer, die sich in dem Raum über Alberta ein-
gemietet hatten. Somit scheint die Lösung des Rät-
sels nahe, aber eines wissen CSI-Ermittler: Wenn
es um Mord geht, ist nichts einfach.

Mein Dank gilt Bruce Whitehead und der Crime Scene
Investigation Unit des Büros des County Sheriffs von Sarasota,
Florida, sowie Lee Lofland, Denene Lofland und Dr. D. P. Lyle,
die mich an ihrem forensischen Wissen teilnehmen ließen.
Außerdem danke ich Hugo Parrilla, Detective im Ruhestand
und ehemals Mitglied der 24. Squad des NYPD,
für seine Unterstützung.

Prolog
Eine Nacht zum Träumen.
Es war Anfang Februar, in New York die kälteste Zeit des
Jahres. Vergessen Sie die Berichte über Januarstürme, plötzlich
auftretende Regenfälle oder kalte Winde aus Kanada von An-
fang November bis Mitte März.
Sie können damit rechnen, dass der Februar der unange-
nehmste Monat in New York ist. Und diesmal war er ganz be-
sonders unangenehm.
Die Temperatur ließ die Quecksilbersäule auf minus acht-
zehn Grad sinken. Der Wind wütete durch geisterhaft einsame
Straßen. Der Schnee fiel unablässig und war wirklich nicht ge-
eignet für Schneeballschlachten und Schlittenfahrten an einem
Samstagmorgen.
Die städtischen Schneepflüge tuckerten einzeln oder in
Konvois über die Straßen und bemühten sich, die Pfade freizu-
schaufeln. Der Müll, der nicht abtransportiert worden war,
wurde unter Schneemassen begraben und würde erst dann wie-
der zum Vorschein kommen, wenn das Tauwetter einsetzte.
Es war vier Uhr morgens.
Mac Taylor drehte sich im Bett auf die linke Seite. Er hatte
einen Wecker, doch er stellte ihn nie. Er wachte stets wenige
Minuten vor der Zeit in tiefer Dunkelheit auf. Eine Stunde lang
lag er dann da, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, und
sah zur Decke empor. Er beobachtete das Scheinwerferlicht der
vorüberfahrenden Fahrzeuge, das sich zusammen mit dem
Licht der Sterne und dem Licht des Mondes an der Decke sei-
nes Schlafzimmers widerspiegelte. Doch in dieser Nacht gab es
keinen Verkehr, keine Sterne und keinen Mond am Himmel,

sondern nur Schnee. Er blickte in die Dunkelheit hinauf, darum
bemüht, nicht zu denken. In einer Stunde würde er aufstehen
müssen, und er hoffte, dass diese Stunde schnell vorbeiging.
Stella Bonasera hatte einen fiebrigen Traum. Nachdem sie
aufgestanden war, um zwei Paracetamoltabletten und einen in
der Mikrowelle erhitzten Tee zu sich zu nehmen, war sie gleich
wieder eingeschlafen. In ihrem Traum hing der gewaltige, auf-
gedunsene Körper einer Frau wie ein Fesselballon über ihrem
Bett. Stella wollte den Körper daran hindern, aus dem offenen
Fenster zu schweben, aber sie konnte sich nicht bewegen. Sie
hoffte, der Körper wäre zu groß, um durch das Fenster zu pas-
sen. Auf dem Körper der Frau saß eine Katze, eine graue Kat-
ze, die Stella mit starren Augen anblickte. Dann endete der
Traum – und Stella schlief friedlich weiter.
Aiden Burn war gegen zwei Uhr morgens eingeschlafen, als
sie versucht hatte, sich an den Namen ihrer Mathelehrerin aus
dem zweiten Jahr an der Highschool zu erinnern. Mrs Farley
oder Farrell oder Furlong? Sie konnte das Gesicht der Frau vor
sich sehen und ihre Stimme hören, die zum fünfhundertsten
Mal die Klasse darauf hinwies, dass selbst kleinste Fehler zum
falschen Ergebnis führten. »Ihr überschaut vielleicht das große
Ganze, aber schon ein einziger Moment der Unachtsamkeit
macht alles falsch.« Aiden hatte nichts aus ihrer Highschoolzeit
so deutlich vor Augen wie diese Lehrerin und hatte sich auch
nach der Highschool darum bemüht, ihren Rat zu befolgen.
Doch immer wieder holten sie die Worte ihrer Lehrerin ein –
vor allem dann, wenn der Wind an den Fenstern rüttelte und
eine eisige Kälte sich trotz der zischenden Radiatoren im Zim-
mer ausbreitete.
Danny Messer griff nach seiner Brille und warf einen Blick
auf die rot leuchtenden Zahlen seines Weckers. Wenige Minu-
ten nach vier. Er berührte sein Gesicht. Wenn er aufgestanden
war, würde er sich rasieren müssen. Das würde er unter der

Dusche erledigen. Er drehte sich auf die linke Seite, fand eine
bequeme Lage und fiel sofort in einen traumlosen Schlaf.
Sheldon Hawkes lag auf einer Pritsche in seinem Labor und
las ein Buch über eine archäologische Ausgrabung in Israel.
Auf einem Foto war ein Schädel abgebildet, der dort gefunden
worden war. In dem Text, verfasst von jemandem, dessen Na-
me er nicht kannte, hieß es, der Schädel sei etwa dreitausend
Jahre alt und durch eine Naturkatastrophe beschädigt worden.
Hawkes schüttelte den Kopf. Das Loch in dem Schädel musste
das Ergebnis eines Schlags gewesen sein, der mit einem
scharfkantigen Stein ausgeführt worden war. Es war der einzi-
ge Schaden an diesem Fund. Keine Kratzer, keine Brüche. Der
Schädel war beinahe perfekt erhalten. Hätte ein Naturereignis
dieses Loch verursacht, dann hätte es Anzeichen für weitere,
schwächere Verletzungen geben müssen. Für eine sichere Aus-
sage musste man natürlich den Schädel selbst untersuchen, a-
ber in Hawkes’ Augen gab es keinen Zweifel daran, dass dieser
vor langer Zeit verstorbene Bursche durch einen Schlag mit ei-
nem Stein getötet worden war. Aufgrund verschiedener Hin-
weise in der Nähe des Fundortes vermutete man eine königli-
che Abstammung. Hawkes fragte sich, wer ihn wohl ermordet
hatte und warum. Wenn er das Buch zu Ende gelesen hätte,
würde er dem Archäologen eine E-Mail schicken. Hawkes las
weiter. Die vier Stunden Schlaf, die er benötigte, hatte er be-
reits hinter sich. Er war zufrieden. Er war in seinem Labor in
der Nähe seiner Leichen und las ein gutes Buch.
Don Flack hatte vielleicht geträumt, aber er erinnerte sich
nicht mehr daran, was ihm ganz recht war, denn der Detective
hatte schon eine Menge gesehen, was genügend Stoff für Alb-
träume abgegeben hätte. Um sieben Uhr würde der Wecker
klingeln, und er würde sofort wach sein. Das war schon immer
so gewesen, auch als er ein kleiner Junge war, und er hoffte, es
würde auch für den Rest seines Lebens so bleiben.

Die Brüder Marco schliefen die halbe Stadt weit voneinan-
der entfernt. Anthony, der auf Riker’s Island in Haft saß, hatte
nur einen leichten Schlaf. Denn im Gefängnis gab es nachts
fürchterliche Geräusche: abgehacktes Husten, Schnarchen,
Leute, die im Schlaf Selbstgespräche führten, und die Schritte
der Wachen. Gefängnisse waren Orte, an denen man zu jeder
Zeit damit rechnen musste, dass sich jemand von hinten heran-
schlich. Obwohl Anthony sich nicht fürchtete, wusste er nicht,
ob er vielleicht nicht auch jemanden gekränkt oder beleidigt
hatte. Draußen besaß der Name Anthony Marco vielleicht Ge-
wicht, doch hier drinnen war er nur ein alter weißer Idiot, der
morgen vor Gericht stehen würde. Aber wenn es gut lief, fiel
der Prozess zu seinen Gunsten aus. Und das war für Anthony
Marco selbstverständlich.
Anthonys Bruder Dario war wach. Hyposomnie. Das
Geschnarche seiner Frau. Sein schlimmer Magen. Er stand auf
und ging ins Badezimmer, wo er sich setzte und die Entertain-
ment Weekly las. Er war nervös. Heute Nacht, etwa jetzt, war
es so weit. Er hatte vor fünf Stunden angerufen, um den Plan
zu ändern. Seine Tochter hatte ihn überzeugt, dass es besser so
wäre, und deshalb hatte er den Anruf getätigt. Doch es konnte
schief gehen. Wenn man sich auf Idioten verließ, ging man ein
Risiko ein, selbst wenn die Idioten loyal waren. Marco hatte
eine Theorie. Nur auf die Loyalität von Idioten konnte man
wirklich zählen. Schlaue Köpfe dachten zu viel und waren
mehr an ihrem eigenen Wohl interessiert. Marco wusste das. Er
war selbst einer der schlauen Köpfe. Zum Teufel damit. Er
ging zurück ins Bett und stupste seine Frau an, in der Hoff-
nung, sie würde sich auf die Seite drehen und aufhören zu
schnarchen. Sie grunzte und drehte sich, aber das Schnarchen
wurde lauter. Er legte sich ein Kissen über den Kopf und wuss-
te, dass er, wenn er in den nächsten fünf oder sechs Minuten
nicht einschlafen würde, endgültig aufstehen müsste.

Steve Guista träumte von Wasser, nur Wasser, eine ausge-
dehnte Wasserfläche. Er wusste, dass es kalt war und er nicht
hinein wollte, aber es sah wunderschön aus. Er wollte nichts
weiter, als es noch etwas betrachten. Dann war da auf einmal
so ein Gefühl. Etwas näherte sich von hinten. Er wollte sich
nicht umdrehen, um nachzusehen. Er wollte in das Wasser
springen. Aber er fürchtete sich, in das Wasser zu springen.
Wie erstarrt stand er am Ufer des Sees – oder was auch immer
das war – und wünschte sich, er könnte aufwachen.
Jacob Laudano war, verflucht noch mal, schon wieder auf
einem Pferd. Er wusste, dass er träumte, aber er konnte nicht
aufwachen, und er konnte das Pferd nicht dazu bringen, stehen
zu bleiben oder langsamer zu laufen. Er beugte sich vor,
klammerte sich fest und wusste durch die Position der anderen
Pferde, dass er verlieren oder, schlimmer noch, stürzen würde.
Acht Jahre war er Jockey gewesen, und er hasste jeden einzel-
nen Tag davon. Er hasste die Hungerkuren, und er hasste jeden
Augenblick auf dem Rücken dieser dummen Tiere, deren bloße
Existenz er kaum ertragen konnte. Er mochte sie nicht. Sie
mochten ihn nicht. Er war ein lausiger Jockey gewesen. Er war
ein durchschnittlicher Dieb. Wenn er doch nur aufwachen
könnte, um etwas zu trinken – Wasser, Whiskey, irgendwas.
Danach würde er wieder einschlafen. Er war erst vor einer
Stunde in sein Appartement zurückgekommen. Er hatte getan,
was getan werden musste. Es war leicht gewesen. Er hatte sein
Geld. Also, warum zum Teufel hatte er Albträume? Vor allem
diesen Traum, in dem er auf einem verdammten Pferd sitzen
musste und wusste, dass er verlieren würde. Er gab sich Mühe,
rief laut im Schlaf, kämpfte und strampelte, und erwachte
plötzlich in eisiger Finsternis. In seinem Traum hatte er das
Johlen der Zuschauer gehört, doch es war bloß das Pfeifen des
Windes. Die Zugluft, die er an seinen Beinen gespürt hatte,
kam von der Kälte, die durch die schlecht isolierten Fenster he-

reindrang, und der Schweiß auf seiner Stirn stammte nicht von
der Strapaze des Rennens, sondern von einem Gefühl wach-
sender Angst. Und so kam es, dass Jacob, der Jockey, sich
fürchtete, wieder einzuschlafen.
Sie hatte drei Namen. Den ersten hatte sie mit ihrer Geburt
erhalten, den zweiten durch die Heirat mit diesem Mistkerl, der
sich eines Nachts einfach davongeschlichen hatte, und den drit-
ten hatte sie sich selbst zugelegt. Es war ein Pseudonym, aber
auch ihr respektabler Name.
Helen Grandfield war im Alter von dreißig geboren worden,
nachdem sie ihre Identität als Stripperin hinter sich gelassen
hatte und es ihr nicht gelungen war, berühmt zu werden – oder
durch ihren verdorbenen Ruf ihren Vater zu erzürnen. Der alte
Mann hatte sie einfach ignoriert. Solange sie den Familienna-
men nicht benutzte, war ihm alles egal. Er hatte andere Kinder,
die nicht versuchten, ihn zum Wahnsinn zu treiben, und er hat-
te zu viele andere Dinge im Kopf – beispielsweise am Leben
zu bleiben und nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten. Ir-
gendwann hatte sie sich plötzlich verändert. Einfach so. Von
einem Moment zum anderen. Hatte Wirtschaftskurse bei Ford-
ham belegt und Buchhaltung gelernt. Nun war sie für ihren Va-
ter von praktischem Nutzen. Und für sich selbst auch. Denn tief
in ihrem Inneren glaubte sie, dass, wenn die Dinge so gut lie-
fen, wie sie es gerade taten, sie irgendwann ihren Ehemann
finden würde. Dann endlich würde sie die Gelegenheit be-
kommen, diesem Mistkerl die Kehle durchschneiden zu lassen –
vorzugsweise, während sie dabei zusah. Helen Grandfield
schlief friedlich.
Ed Taxx und Cliff Collier hatten nicht geschlafen und sie
hatten es auch gar nicht erst versucht. Denn sie sollten nicht
schlafen. Sie saßen im Hotelzimmer. Ed las einen Kriminalro-
man von Jonathan Kellerman, und Cliff sah sich die Videoauf-
nahme eines Hockeyspiels an, das bereits Stunden vorher statt-

gefunden hatte. Deshalb hatte er sich auch die Nachrichten auf
ESPN nicht angesehen. Er wollte nicht erfahren, wie das Spiel
ausgehen würde. Im Augenblick lagen die Rangers am Anfang
des dritten Drittels mit 3:1 in Führung. Cliff arbeitete an einer
Diätcola. Ed hatte eine Dr. Pepper. Keiner der Männer war
wirklich müde. Ihnen ging zu viel im Kopf herum. Wie auch
immer, ein kräftiger Schluck Koffein konnte nicht schaden.
Taxx sah auf seine Armbanduhr. Zwei Stunden bis zur Däm-
merung. Er hatte Schwierigkeiten, sich auf das Buch zu kon-
zentrieren. Cliff hatte angeboten, den Ton abzudrehen, aber Ed
hatte ihm gesagt, das würde ihn nicht stören. Er mochte Ho-
ckey nicht, aber er wusste, wie es ausgehen würde. Ed richtete
sein Schulterhalfter und lehnte sich mit dem Buch auf der Brust
zurück.
Der Name des Mädchens war Lilly. Sie war elf, ein bisschen
klein für ihr Alter, aber nicht allzu sehr. Etwas weckte sie. Von
ihrem Bett aus sah sie sich zu ihrer Mutter um, die so atmete,
wie sie es immer tat, wenn sie schlief. Lilly war einigermaßen
überzeugt davon, dass der Wind sie geweckt haben musste.
Sie kletterte aus dem Bett, ging ins Wohnzimmer und schalte-
te die Lampe in der Ecke ein. Da war er, der Hund. Er sah nicht
übel aus, aber er war auch kein schöner Hund. Sie fragte sich, ob
sie ihn mit Braun und Gold hätte bemalen sollen, statt einfach
nur mit Weiß. Noch war es nicht zu spät. Aber sie wusste, sie
würde es nicht tun. Sie war zu müde. Sie würde vielleicht einen
Fehler machen. Das wäre dann noch schlimmer. Der Hund wür-
de wohl weiß bleiben. Sie hoffte, er würde ihm gefallen, obwohl
er ein wenig wackelte. Sie hatte ein Hinterbein zu kurz gemacht.
Lilly holte sich ein Glas aus dem Küchenschrank, ging dann
zum Kühlschrank und schüttete sich Kakao ein. Mit dem Kakao
und einem Schokoladenkeks setzte sie sich an den Tisch und
fuhr fort, den Hund zu untersuchen. Sie beschloss, ihn Spark zu
nennen. Oder vielleicht irgendwie anders.

Lilly aß ihren Keks und trank das Glas aus, stellte es vor
sich auf den Tisch und lehnte sich zurück. Sie konnte den
Schnee sehen, der auf das Fenster fiel. Sie wollte nicht zurück
ins Bett, sie war einfach zu faul. Dann schlief sie ein.

1
Der tote Mann lehnte zusammengesunken an der hinteren
Wand des holzgetäfelten Fahrstuhls. Sein Kopf war auf die lin-
ke Schulter gefallen, und seine gefalteten Hände lagen auf sei-
ner Brust. Über der rechten Hand war ein Blutfleck zu sehen,
und sein linkes Bein ragte aus dem Fahrstuhl heraus.
Der Fuß in dem Pantoffel war das Erste, was Detective Mac Tay-
lor sah, als er über die Marmorfliesen schritt, mit denen die Lobby
des Appartementgebäudes an der York Avenue ausgelegt war.
Mac Taylor ging an zwei uniformierten Beamten vorbei und
blieb vor der offenen Fahrstuhltür stehen. Aiden Burn, seine
Kollegin, war gerade dabei, die Leiche im Inneren des Fahr-
stuhls zu fotografieren. Der tote Mann trug einen grauen Jog-
ginganzug, der in Brusthöhe zwei Löcher aufwies. Es waren
eindeutig die Spuren eines Verbrechens.
»Schneit es noch?«, fragte Burn, als Mac Taylor einen Blick
auf die Uhr warf. Es waren wenige Minuten nach zehn. Er zog
ein Paar Latexhandschuhe an.
»Es werden noch knapp acht Zentimeter mehr erwartet«,
antwortete Mac und kniete sich neben die Leiche. In der klei-
nen Fahrstuhlkabine war gerade genug Platz für die beiden
Tatortermittler und den Toten.
»Wer ist er?«
»Sein Name ist Charles Lutnikov. Appartement sechs, drit-
ter Stock.«
Lutnikov war etwa fünfzig, hatte spärliches schwarzes Haar
und einen Bierbauch.

»Der Jogginganzug hat keine Taschen«, stellte Mac fest und
drehte den Leichnam vorsichtig zuerst nach rechts und dann
nach links. »Wer hat ihn identifiziert?«
»Der Pförtner«, murmelte Burn und sah sich zu dem uni-
formierten Streifenpolizisten um, der unverhohlen ihren Hin-
tern bewunderte.
»Sind Sie verheiratet?«, fragte sie den Cop.
»Ich?«, grinste der Cop und deutete auf sich selbst.
»Sie«, entgegnete Aiden.
»Ja.«
»Hier liegt ein toter Mann«, sagte sie. »Vermutlich ermor-
det. Sehen Sie sich ihn an, und denken Sie über ihn nach – und
nicht über meinen Arsch. Schaffen Sie das?«
»Ja«, antwortete der Cop, der nun nicht mehr grinste.
»Gut. Meine Ausrüstung ist draußen neben der Tür. Bringen
Sie sie her und stellen Sie sie so ab, dass ich sie erreichen kann.«
»Schlecht geschlafen?«, fragte Mac.
»Ich hatte jedenfalls schon bessere Nächte«, erwiderte Ai-
den und fotografierte weiter, als der Cop mit ihrer Ausrüstung
zurückkehrte.
Macs Augen fixierten die Brust des toten Mannes. »Sieht
nach zwei Einschusslöchern aus. Keine Pulverspuren.«
Mac studierte die Wände, den Boden und die Decke der
kleinen, holzgetäfelten Fahrstuhlkabine. Dann beugte er sich
vor und zog den Leichnam vorsichtig hoch.
»Keine sichtbaren Austrittswunden«, stellte er fest und ließ
die Leiche wieder zu Boden gleiten.
»Dann sind die Kugeln noch in ihm.«
»Nein, ich glaube nicht.« Mac nahm ein Lederetui aus sei-
ner Tasche und holte ein dünnes, stählernes Werkzeug heraus,
das an ein Zahnarztinstrument erinnerte.
Vorsichtig zog er das Hemd des toten Mannes hoch, um sich
die Wunden genauer anzusehen.
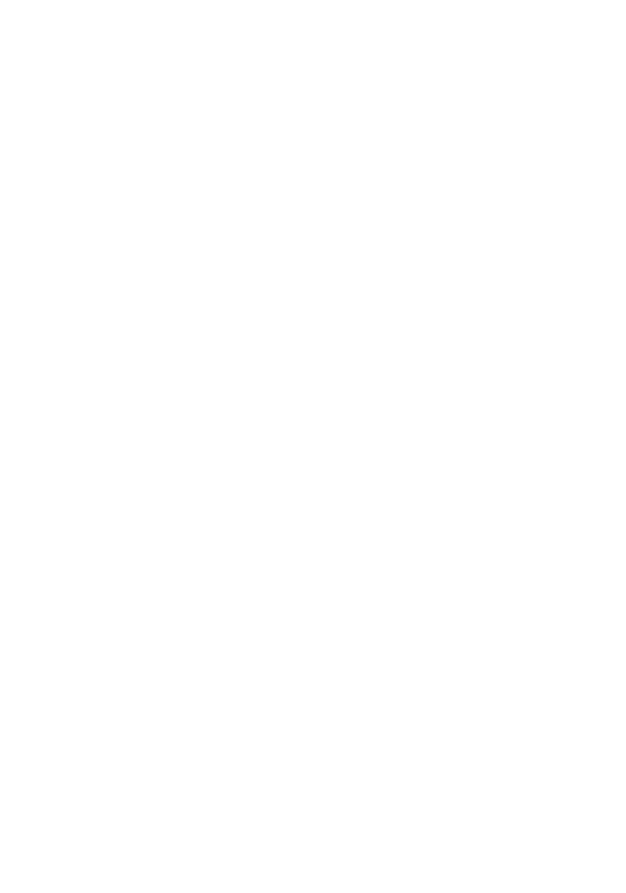
»Ein Schuss«, sagte er laut zu sich selbst, während er jedes
Loch genau untersuchte. »Das hier ist die Eintrittswunde. Klei-
nes Kaliber. Sie hat sich beinahe wieder geschlossen. Das
daneben ist die Austrittswunde. Sie ist größer, unsauberer, und
die Haut ist nach außen aufgerissen.«
»Dann sollte irgendwo Blut zu finden sein«, antwortete Ai-
den.
»Und da ist es schon.« Mac blickte hinab auf die dunklen
Flecken am Boden.
Er stand auf und steckte sein Werkzeug weg. Danach zog er
die Latexhandschuhe aus, ließ sie in einen Beutel gleiten und
holte ein neues Paar aus der Tasche.
Wenn Blut im Spiel war, musste man die Handschuhe jedes
Mal wechseln, wenn man etwas Neues berührte. Keine Konta-
mination. Kriminalisten auf der ganzen Welt hatten diese Regel
spätestens seit dem peinlichen Fehler im Fall O. J. Simpson
zum obersten Gebot erhoben.
»Keine Waffe?«, fragte Mac.
»Keine Waffe«, antwortete Aiden. »Keine Kugel.«
»Körpertemperatur?«
»Er ist noch keine zwei Stunden tot, vermutlich sogar weni-
ger als eine. Der Pförtner hat die Leiche gefunden und 9-1-1
gerufen.«
Mac warf noch einen letzten Blick auf den toten Mann und
sagte: »Fotografiere seine Unterschenkel. An diesem hier ist
ein Bluterguss.« Mac deutete auf das Bein, das aus der Fahr-
stuhltür heraushing. »Dann …«
»Untersuchen wir die Wände, den Boden, den Joggingan-
zug?«, fragte Aiden.
Mac nickte und fügte hinzu: »Das volle Programm.« Zum
vollen Programm gehörte auch die Untersuchung der Umge-
bung mithilfe einer Alternate Light Source, abgekürzt ALS.
Dieses spezielle Licht macht Körperflüssigkeiten wie Sperma,

Speichel und Urin, aber auch Fingerabdrücke und sogar Betäu-
bungsmittelspuren sichtbar. Aiden besaß eine eigene ALS, die
so klein war, dass sie in einem Behälter von der Größe eines
Brillenetuis Platz fand. Sie ließ sich an jede Steckdose an-
schließen. Aiden benutzte sie, um die Sauberkeit von Hotel-
oder Motelzimmern zu prüfen, in denen sie übernachten muss-
te, wenn sie beruflich unterwegs war.
Mac verließ den Fahrstuhl und ging an zwei Polizisten vor-
bei. Er wollte zu dem Pförtner, der in seiner purpurfarbenen
Uniform neben den Beamten stand und ihnen bei der Arbeit
zuschaute. Der Mann war klein, schwarz und sehr nervös. Er
hatte keine Ahnung, was er mit seinen Händen anstellen sollte,
also versuchte er, sie in die Taschen zu stecken, um sie dann
gleich wieder herauszuziehen. Mac baute sich vor ihm auf.
»Er ist tot«, begann der Pförtner. »Ich weiß es. Ich konnte es
sehen.«
»Wann haben Sie Ihren Dienst angetreten, Mr …?«
»McGee, Aaron McGee. Aber alle nennen mich Mr Aaron.
Ich meine, die Hausbewohner tun das. Weiß auch nicht wa-
rum.«
»Wann haben Sie Ihren Dienst angetreten, Mr McGee?«
»Um fünf Uhr morgens.« Er sah auf seine Armbanduhr.
»Vor fünf Stunden. Fünf Stunden und zehn Minuten. Hab
zwei Stunden gebraucht, um bei dem Schnee hierher zu kom-
men.«
»Wer hatte vor Ihnen Dienst?«
»Ernesto, Ernesto … lassen Sie mich nachdenken. Er ist
schon seit fünf, sechs Jahren hier. Ich kenne seinen Nachna-
men. Ich hab ihn gleich.«
Mac nickte.
»Haben Sie eine Besucherliste?«, fragte er.
McGee nickte. »Ich schreibe den Namen jedes Besuchers
auf und frage jedes Mal bei den Hausbewohnern nach, ehe ich

jemanden reinlasse. Die Bewohner trage ich nur ein und sage
›Guten Morgen‹ oder ›Gute Nacht‹ oder so was. Während der
Feiertage letzten Monat hab ich ›Frohe Weihnachten‹ zu denen
gesagt, die Christen sind wie ich, und ›Frohes Chanukka‹ zu
den Juden. Zu den Melvoys sage ich gar nichts. Das sind A-
theisten, aber sie schenken mir trotzdem eine Kleinigkeit zu
Weihnachten.«
»Hatte Mr Lutnikov heute Morgen irgendwelche Besu-
cher?«
»Nicht einen«, antwortete der Pförtner und schüttelte be-
kräftigend den Kopf. »Kein Besuch für ihn. Für niemanden in
diesem Haus. Heute sollten nur die Computerleute kommen,
um Rabinowitz’ Rechner zu reparieren.«
»Haben heute Morgen schon irgendwelche Bewohner das
Haus verlassen?«
»Die Shelbys um zehn«, wusste der Pförtner und gab Mac
ein Zeichen, ihm zur Vordertür der Belvedere Towers zu fol-
gen. »Sie haben ihren Hund ein paar Minuten ausgeführt und
sind dann wieder zurückgekommen. Zu kalt da draußen für das
kleine Ding, aber er hat sein Geschäft gemacht. Mrs Shelby
hatte eine von diesen kleinen durchsichtigen Tüten dabei. Sie
sind schnell wieder hier gewesen.«
Mac nickte.
»Und Ms Cormier«, fuhr McGee fort. »Die geht jeden Mor-
gen los – Regen, Sonnenschein, Schnee, macht alles keinen
Unterschied. Sie geht spazieren. Acht Uhr, jeden Morgen. Sagt
immer ›Hallo, Aaron‹ zu mir. Bleibt vielleicht eine halbe Stun-
de weg. Sogar heute Morgen.«
»Hatte sie irgendetwas bei sich?«, fragte Mac.
»So wie immer«, entgegnete McGee. »Eine von diesen gro-
ßen Tüten aus dem Buchladen mit dem Bild von diesem bärti-
gen Kerl drauf. Wie ist bloß der Name von dem Laden?«
»Barnes and Noble?«

»Das ist er«, bestätigte McGee. »Jeden Tag die gleiche Tü-
te.«
McGees Bewegungen waren ein wenig schwankend. Der
Mann musste mindestens siebzig sein, vermutlich sogar älter.
»Manchmal gehen auch die Glicks samstags Früh weg«,
sagte er. »Sie wohnen in Nummer zwei, aber seitdem er diese
Chemotherapie bekommt, bleiben sie meistens zu Hause.«
Vor dem Pförtnertresen rechts neben der Eingangstür blie-
ben sie stehen. Durch die Tür drang die Kälte des Februars her-
ein. Der Schnee lag inzwischen mindestens sechzig Zentimeter
hoch, und obwohl es schon vor Stunden aufgehört hatte zu
schneien, fiel die Temperatur weiter. Mac war überzeugt, dass
es inzwischen etwa achtzehn Grad unter Null sein musste.
Sein Wagen parkte einen Block entfernt direkt vor einem
Delikatessengeschäft mit heruntergeklappter Sonnenblende,
sodass die C.S.I.-Plakette zu erkennen war. Der Weg vom Wa-
gen zum Appartementhaus hatte ungefähr fünf Minuten gedau-
ert. Normalerweise hätte er nicht mehr als ein oder zwei Minu-
ten erfordert. Das alles erinnerte Mac an einen heftigen
Schneesturm vor etwa sechs Jahren in Chicago. Nach diesem
Sturm hatten die Leute über kleine, ungleichmäßige, aber sehr
glatte Schneehügel hinwegklettern müssen. Mac und seine Frau
hatten damals in einem Bezirk gewohnt, dessen Abgeordneter
nicht zu den Demokraten gehörte – und was wiederum bedeu-
tete, dass dieser Stadtteil stets zuletzt von den Schneepflügen
besucht wurde. Bis sie ihren Wagen aus der Garage hätten fah-
ren können, wären Tage, wenn nicht sogar Wochen vergangen.
Also hatten sie die Herausforderung angenommen und sich
kletternd und rutschend, gleitend und stürzend auf den Weg zu
der vier Blocks entfernten Hauptstraße gemacht und dort tat-
sächlich einen geöffneten Supermarkt gefunden.
Als Mac auf dem Heimweg auf einem Schneehügel ausge-
rutscht und mit dem Hintern im Schnee versunken war, hatte

Claire gelacht. Um ihn herum hatten sich Lebensmittel verteilt,
die im Schnee ihre Abdrücke hinterließen.
Mac hatte nicht darüber lachen können. Er hatte mit einem
übertriebenen Stirnrunzeln aufgeblickt, doch die Falten waren
bald einem Lächeln gewichen. Claire stand bis zu den Knö-
cheln im Schnee – ihre Ohren glühten rot, und ihre blaue Roll-
mütze hatte sie tief in die Stirn gezogen. An ihren Händen trug
sie rote Strickhandschuhe, mit denen sie die Einkaufstaschen
umklammerte. Sie lachte. Er konnte es noch vor sich sehen:
dunkle Straße, weißer Schnee, glimmende Straßenlaternen –
und seine Frau, die lachte.
»Sehen wir vorsichtshalber noch einmal nach«, meinte Mc-
Gee. »Es ist Samstag, also überlegen es sich die Leute dreimal,
ob sie bei so einem Wetter einen Fuß auf die Straße setzen, und
es ist noch früh, also …«
Er sah in sein Buch.
»Nichts«, stellte er fest. »Niemand sonst ist rein, niemand
sonst ist raus.«
»Wann beginnt Ernestos Schicht?«, fragte Mac, der sich
wieder gefangen hatte und sich nun wieder auf die Ermittlung
konzentrierte.
»Von Mitternacht bis fünf, wenn ich komme.«
McGee sah erneut in sein Buch und kniff die Augen zu-
sammen.
»Keine Einträge während Ernestos Schicht. Gar nichts.
Niemand rein, niemand raus.«
Ein Ambulanzfahrzeug hielt vor der Tür. Die Sirenen
schwiegen. Zwei Sanitäter, unter den blauen Jacken weiß ge-
kleidet, stiegen aus, öffneten die hintere Tür des Fahrzeugs und
zogen eine Rolltrage und einen Leichensack heraus.
Der Pförtner hielt inne, um ihnen zuzusehen, wie sie das
Haus betraten. »Ich habe gar keine Namen von Ihnen und all
den anderen Polizisten«, überlegte er. »Vielleicht sollte ich …«

»Das ist schon in Ordnung«, fiel ihm Mac ins Wort. »Erzäh-
len Sie mir von Mr Lutnikov.«
»Tut mir Leid, Taylor, wir sind spät dran«, grüßte der erste
Sanitäter, ein Bodybuilder mit einem Kindergesicht. »Wet-
ter.«
Mac nickte und sagte: »Bringen Sie ihn so schnell wie mög-
lich ins Labor, aber seien Sie vorsichtig da draußen.«
»Roger«, entgegnete der Bodybuilder und ging zusammen
mit seinem Partner an Mac und dem Pförtner vorbei.
»Wo waren wir?«, fragte McGee, während er zusah, wie die
beiden Sanitäter noch mehr Schnee in die Lobby trugen.
»Mr Lutnikov«, half ihm Mac auf die Sprünge.
»Ist meistens für sich allein geblieben«, erklärte McGee.
»Netter Mann. Kurz angebunden, aber das war er immer. Hat
mir einen Fünfzigdollarschein gegeben zu Weihnachten. Jedes
Jahr zu Weihnachten.«
»Hatte er viel Geld?«, fragte Mac.
»Weiß nicht. Das ist Weihnachten normal. Alle Hausbe-
wohner geben mir zu den Feiertagen Geld. Wollen Sie wissen,
wie viel ich diese Weihnachten zusammengekriegt habe? Drei-
tausendvierhundertundfünfzig Dollar. Hab’s gleich auf die
Bank gebracht.«
Aus der Nähe des Fahrstuhls hörte man Geräusche. Mac
schaute sich um. Das Bein des Toten war noch immer zu se-
hen.
»Sie haben die Leiche gefunden«, begann Mac wieder.
»Hab ich«, sagte McGee und deutete den Korridor entlang.
»Hab gehört, dass der Fahrstuhl anhält, und habe hingeguckt,
ob jemand aussteigt. Aber da war niemand. Die Glocke hat
immer wieder Dingdong gemacht, also bin ich hingegangen,
und raten Sie mal, was ich gesehen habe.«
»Ein Bein, das heraushing, und eine Tür, die ständig dage-
genstieß«, antwortete Mac.

»Stimmt genau, stimmt genau. Das ist eine automatische
Tür. Wenn etwas im Weg liegt, schlägt sie immer wieder dage-
gen und macht dieses Dingdong.«
»Kommt der Fahrstuhl automatisch herunter?«
»Nein, Sir. Man muss den Knopf drücken – oder er bleibt
dort, wo er ist.«
»Sind die beiden anderen Fahrstühle genauso klein wie die-
ser hier?«
»Nein, Sir«, erklärte der Pförtner. »Die sind viel größer.
Fahrstuhl drei ist so klein, weil er nur vom sechzehnten Stock
bis zum Penthouse fährt – und natürlich bis hier unten in die
Lobby.«
Ein Windstoß rüttelte an der gläsernen Vordertür und zog
die Aufmerksamkeit des Pförtners auf sich. »Sieht wirklich
schlimm aus da draußen. Hab gehört, es soll ziemlich kalt sein.
Zwanzig Grad minus oder so.«
»Mr Lutnikov hat im dritten Stock gewohnt«, sagte Mac.
»Haben Sie eine Ahnung, warum er in einem Fahrstuhl war,
der in seinem Stockwerk gar nicht hält?«
McGee schüttelte den Kopf. »Vom sechzehnten Stock an auf-
wärts gibt es nur noch ein Appartement pro Etage. Vier, fünf Zim-
mer, mit Balkon. Ms Louisa Cormier hat in ihrem Appartement so-
gar ein richtiges kleines Kino mit Plüschsesseln und einem riesigen
Bildschirm. Die Leute da oben haben ’ne Menge Geld.«
»Wenn Lutnikov Fahrstuhl drei benutzen wollte …«, über-
legte Mac.
»Dann musste er in die Lobby kommen, in Fahrstuhl drei
steigen und nach oben fahren«, entgegnete der Pförtner.
»Kennt Mr Lutnikov jemanden von den Leuten, die im
sechzehnten Stock wohnen oder darüber?«, fragte Mac.
»So was weiß ich nicht«, antwortete der Pförtner. »Ist ein net-
tes Gebäude, aber die Leute haben kaum etwas miteinander zu
tun. In der Lobby sagen sie hallo, lächeln höflich, aber sonst …«

Die Sanitäter gingen mit der Trage, auf der in einem ver-
schlossenen Leichensack der Tote lag, an ihnen vorbei.
Währenddessen beobachtete Mac, wie Aiden Burn gerade
die Fahrstuhltür mit Absperrband sicherte.
»Ich mache Ihnen die Tür auf.« McGee hastete an den Sani-
tätern vorbei und stieß die Tür auf. Der Wind trug eine Lawine
Schnee und einen Schwall eisiger Luft herein. Mac spürte, wie
die Kälte von seinem Körper Besitz ergriff.
Aiden kam zu ihm. Sie streifte die Handschuhe ab und ließ
sie in ihre Tasche fallen. Als die Kälte sie traf, zog sie den
Reißverschluss ihrer Jacke hoch, auf deren Rückseite »Crime
Scene Unit« stand.
»Er wollte sicher nicht in Hausschuhen nach draußen«, stell-
te Mac fest, als er zusah, wie die Leiche in das Ambulanzfahr-
zeug geladen wurde.
»Aber wo wollte er überhaupt hin?«, fragte Aiden.
»Oder woher ist er gekommen?«
»Von irgendwo zwischen dem Sechzehnten und dem Zwei-
undzwanzigsten«, antwortete Aiden. »Denn abgesehen von
diesen Etagen kann man mit diesem Fahrstuhl nur noch die
Lobby und den Keller erreichen. Für die Garage und die
Stockwerke bis zum Sechzehnten gibt es keine Knöpfe.«
»Du übernimmst den Keller. Ich fange mit dem Sechzehnten
an«, entschied Mac.
»Wer auch immer unser Opfer erschossen hat, stand außer-
halb der Kabine«, sagte Aiden. »Keine Pulverspuren auf sei-
nem Hemd. Aber der Fahrstuhl ist zu klein, um einen Schuss
abzugeben, ohne Pulver zu hinterlassen.«
Mac nickte.
»Und«, fügte sie hinzu, »er oder sie war ein guter Schütze.
Die Eintrittswunde liegt in einer Linie mit dem Herzen.«
»Kann ich Fahrstuhl drei wieder in Betrieb nehmen?«, frag-
te der Pförtner, der zu ihnen gekommen war.

»Nein«, antwortete Mac. »Das ist ein Tatort. Gibt es eine
Treppe?«
McGee nickte. »Das ist Gesetz.«
»Die Hausbewohner werden bis zum fünfzehnten Stock die
Treppe benutzen müssen, und dort können sie entweder in ei-
nen anderen Fahrstuhl umsteigen oder zu Fuß weitergehen.«
»Das wird ihnen nicht gefallen«, sagte McGee kopfschüt-
telnd. »Das wird ihnen gar nicht gefallen. Kann ich sie anrufen
und ihnen Bescheid sagen?«
»Erst nachdem Sie mir die Namen von den Bewohnern ab
Etage sechzehn gegeben haben«, sagte Mac.
»Ich schreibe sie für Sie auf.« McGee griff nach seinem
Kugelschreiber, der auf dem braunen Tresen lag, und drückte
mit dem Daumen den Knopf am oberen Ende herunter.
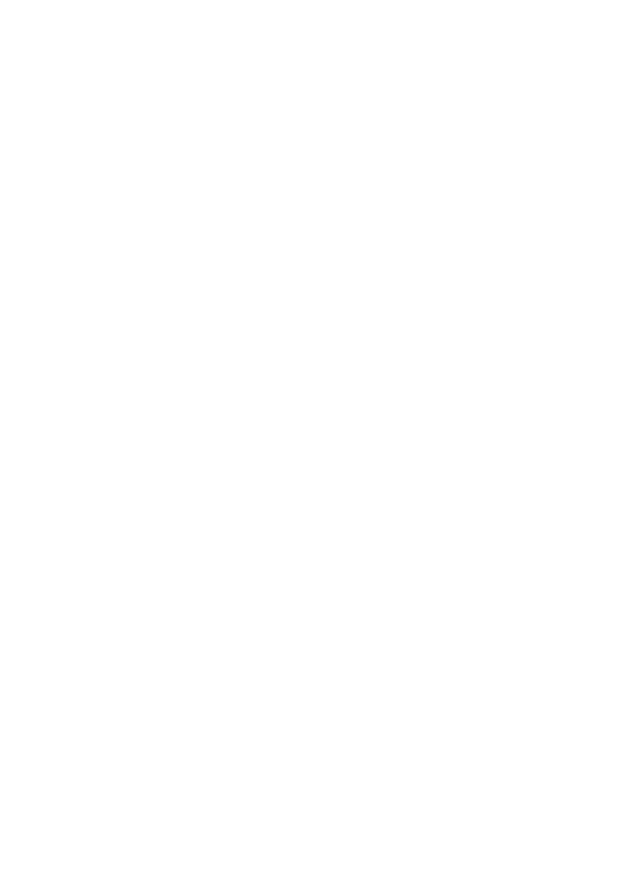
2
Ed Taxx stellte den Thermostat in Zimmer 614 des Brevard
Hotels neu ein. Achtzehn Grad wurden angezeigt, aber das
Brevard war alt, die Heizungsanlage wenig verlässlich und das
Wetter draußen eisig.
Taxx konnte auf fünfundzwanzig Jahre Erfahrung im Dienst
der Sicherheitsabteilung des Bezirksstaatsanwalts zurückbli-
cken. Noch ein Jahr, und seine Tochter würde wegziehen, um
in Boston das College zu besuchen. Dann, so sagte Ed immer
zu seiner Frau, würden sie beide nach Florida gehen und den
New Yorker Winter endlich vergessen können, ein für alle
Mal.
Ed war auf Long Island aufgewachsen. Damals war er ein
Draufgänger gewesen, der mit halb erfrorenen Fingern und Oh-
ren im Stanton Park Hockey gespielt und sich immer auf den
winterlichen Schnee gefreut hatte – auf die Schneeballschlach-
ten und die Schlittenfahrten auf dem Maryknoll Hill.
Als er vierzig wurde, hatte er aufgehört, sich auf den Winter
zu freuen. Ihn nervte das Auto, das nicht anzuspringen drohte,
der Schnee, der ihn stundenlang in einem überhitzten Wagen
festhielt und ihn zwang, die Spur zu halten und sich auf die
Fahrbahn zu konzentrieren. Am schlimmsten aber waren die
langen, grauen Tage. Er würde die Stadt nicht vermissen, wenn
er erst einmal im Ruhestand war.
Er sah sich zu Cliff Collier um, der den Eindruck machte,
als würde er überhaupt nicht frieren. Collier war zweiunddrei-
ßig und stark wie ein Bulle. Er war sechs Jahre lang unifor-

mierter Beamter gewesen und seit zwei Jahren Detective im
NYPD.
In zwei Stunden würde ein anderes Team die Überwachung
von Alberta Spanio, die zu diesem Zeitpunkt im abgeschlosse-
nen Schlafzimmer nebenan ruhte, übernehmen. Vor zwei
Nächten hatten Cliff und Ed ihren Dienst angetreten, als sie ih-
rerseits zwei Kollegen ablösten. Wie jeden Abend mussten sie
Alberta kurz vor Mitternacht in ihr Schlafzimmer bringen und
zuhören, wie sie die Tür verriegelte. Danach schaute Collier in
der Regel fern. Doch die Filme wurden ständig von Wetterbe-
richten unterbrochen, die erzählten, wie dick die Schneedecke
inzwischen geworden war. Taxx sah ein wenig zu, griff aber
zwischendurch immer wieder zu seinem Kriminalroman und
las darin.
Die beiden Männer brachten einander weder Sympathie noch
Antipathie entgegen. Sie hatten außer ihrem Job wenig gemein-
sam. Nachdem Alberta ihre Tür verschlossen hatte, waren sie
mit Jay Lenos Stimme im Hintergrund nach einem zehnminüti-
gen Geplauder wieder einmal ins Schweigen verfallen.
Das Brevard Hotel zählte nicht zu den üblichen Sicher-
heitsmaßnahmen für das Zeugenschutzprogramm des NYPD
oder der Bezirksstaatsanwaltschaft. Doch bei Alberta Spanio
wollte der Staatsanwalt kein Risiko eingehen. Immerhin war es
nicht ausgeschlossen, dass es im Department eine undichte
Stelle gab. Das jedenfalls hatte man den beiden Männern und
den Leuten aus den anderen zwei Schichten erzählt. Sie alle
hatten genug Erfahrung in diesem Job und wussten, wie schnell
die Leute, vor denen sie Alberta Spanio beschützen sollten, he-
rausbekommen konnten, wo sie war.
Hätte Alberta, klein, hübsch, blondiertes Haar und verständ-
licherweise sehr furchtsam, gebeten, einen Telefonanruf tätigen
zu dürfen, hätten Ed und Cliff ihr ein höfliches »Nein« entge-
gengebracht – das gleiche höfliche »Nein«, das sie auch gehört

hätte, hätte sie sich ein Schinkensandwich gewünscht. Kein
Zimmerservice. Keine Bringdienste. Frisches Essen gab es nur,
wenn ein Schichtwechsel anstand.
Die Ablösung, die binnen zwei Stunden eintreffen sollte,
würde etwas zum Frühstück mitbringen, vermutlich Egg
McMuffins und Kaffee – das war zumindest am Vortag das
Frühstück ihrer Wahl gewesen.
»Es ist acht«, sagte Taxx mit einem Blick auf seine Arm-
banduhr. »Wir sollten sie lieber wecken.«
»Ich könnte mal aufs Klo gehen.« Collier erhob sich von der
Couch, ging Richtung Schlafzimmer und klopfte laut an die
Tür. »Aufwachen, Alberta.«
Keine Antwort. Collier klopfte erneut.
»Alberta!« Erst rief er, dann fragte er: »Alberta?«
Taxx war neben ihn getreten. Auch er klopfte und brüllte:
»Aufwachen!«
Immer noch keine Antwort. Die beiden Männer sahen sich
an. Taxx nickte Collier zu, und der verstand.
»Öffnen Sie, oder wir brechen die Tür auf«, rief Taxx mit
lauter, aber ruhiger Stimme.
Taxx sah auf die Uhr, zählte fünfzehn Sekunden ab und trat
aus dem Weg, damit der jüngere und größere Beamte sein Ge-
wicht gegen die Tür stemmen konnte. Collier warf sich mit der
Schulter gegen die Tür, wie sie es in der Akademie gelernt hat-
ten. »Benutzt den muskulösen Teil des Arms, nicht den kno-
chigen der Schulter. Werft euch nicht schon beim ersten Anlauf
mit aller Kraft hinein, wenn ihr nicht sofort reinmüsst. Schlagt
hart zu, bis das Holz nachgibt. Kämpft gegen das Holz, nicht
gegen das Schloss«. Als Collier die Tür traf, hinterließ er einen
Riss, aber die Tür öffnete sich nicht. Das Schloss hielt. Collier
wich ein paar Schritte zurück und warf sich erneut gegen die
Tür. Diesmal flog sie auf, begleitet von dem Geräusch split-
ternden Holzes. Collier stolperte voran und wäre fast gestürzt.

Im Raum herrschte Eiseskälte.
Taxx betrachtete das Bett, einen Berg aus Decken. Das
Fenster auf der anderen Seite des Zimmers war geschlossen,
aber durch die offene Badezimmertür drang Zugluft herein.
»Badezimmerfenster«, rief Taxx und stürmte zum Bett.
Collier richtete sich auf und rannte die zweieinhalb, drei
Meter durch den Raum zum Badezimmer. Das Fenster stand
offen, weit offen. Collier stieg in die Badewanne, um aus dem
Fenster über den Berg aus Schnee hinauszublicken. Er dachte
daran, das Fenster zu schließen, hielt sich aber im letzten Mo-
ment zurück. Dann kletterte er aus der Wanne und ging über
den gefliesten Boden zurück zur Tür.
Taxx stand neben dem Bett. Er hatte die Decken zurückge-
schlagen. Collier konnte die Leiche von Alberta Spanio sehen, die
mit geschlossenen Augen und blassem Gesicht auf der Seite lag.
Ein Messer mit einem langen Griff steckte tief in ihrem Hals.
Ed Taxx und Cliff Collier hatten Alberta Spanio nicht ge-
kannt, aber das Wenige, was sie von ihr kannten, hatte ihnen
nicht gefallen. Sie hatte keine Strafakte, keine Gefängnisauf-
enthalte. Sie hatte auch keinen Handel mit der Staatsanwalt-
schaft abgeschlossen. Aber sie war drei Jahre lang Anthony
Marcos Geliebte gewesen, und sie hatte Angst vor ihm gehabt.
Sie hatte aussteigen wollen, und als Marco wegen Mordes ver-
haftet worden war, hatte sie im Büro des Bezirksstaatsanwalts
angerufen.
Nachdem sie alles erzählt hatte, was sie wusste, verwandelte
sie sich in eine mürrische, verbissene und reizbare Person, de-
ren Launen den Umgang mit ihr unerträglich machten.
Taxx und Collier fühlten keine Trauer, aber sie hatten ver-
sagt. Sie hatten es nicht geschafft, die wichtigste Zeugin im
Mordprozess gegen einen der wichtigsten Drahtzieher des or-
ganisierten Verbrechens zu schützen, und das würde Konse-
quenzen haben und sich auf ihre Karrieren auswirken.

Im Schlafzimmer gab es kein Telefon. Es war entfernt wor-
den, um Alberta Spanio daran zu hindern, jemanden anzurufen.
Collier musste durch die aufgebrochene Tür zurück in das an-
dere Zimmer, um dort die Polizei anrufen zu können.
Don Flack, Detective der Mordkommission, kannte Cliff Col-
lier – nicht gut, aber gut genug für die Anrede mit dem Vorna-
men. Manchmal trafen sie sich auf den Gängen des Depart-
ments, blieben stehen, plauderten miteinander oder tranken zu-
sammen eine Tasse Kaffee aus dem Automaten. Sie hatten ge-
meinsam die Akademie besucht.
Collier gehörte zur Staatsanwaltschaft und seine Fälle reich-
ten von betrügerischer Prostitution bis hin zu Bandenkriminali-
tät. Dank seiner Größe wirkte Collier recht Furcht erregend.
Und dank seines Charakters war er es auch. Flack wusste, dass
Colliers Ehre verletzt war, denn schon sein Vater und sein On-
kel waren Cops gewesen.
Taxx kam ihm in Bezug auf das, was geschehen war, gelas-
sener vor. Immerhin hatten sie eine wichtige Zeugin für einen
Prozess verloren. Die Tote hätte in zwei Tagen aussagen sollen.
Solche Fehler würden einen Beamten nicht die Pension kosten,
aber die Karriere. Doch Taxx hatte keine beruflichen Ambitio-
nen mehr. Was geschehen war, würde in seiner Akte vermerkt
werden. Und? Ihn interessierte keine Beförderung oder Gehalts-
erhöhung mehr. Aber er war verantwortlich für das, was gesche-
hen war. Er war schließlich im Dienst gewesen, als die Person,
die er hätte schützen sollen, ermordet wurde – nicht direkt vor
seinen Augen, aber doch in seiner unmittelbaren Nähe.
Flack hielt sein Notizbuch in der Hand und hatte den Kragen
seiner Lederjacke zum Schutz vor der Kälte hochgeschlagen.
Da die Tür kaputt und das Badezimmerfenster immer noch of-
fen war, wurde es in dem Raum, in dem sie standen, trotz des
Heizlüfters mit jeder Sekunde kälter.

Neben dem Bett im Schlafzimmer stand Detective Stella
Bonasera. Sie hatte sich gerade über die Leiche gebeugt und
Fotos gemacht, als Danny Messer, der das Badezimmer unter-
suchte, rief: »Keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindrin-
gen.«
Stella hustete und fühlte ein leichtes Kratzen im Hals. Wo-
möglich hatte sie sich eine Erkältung zugezogen. Sie würde,
sobald sie die Gelegenheit dazu bekam, ein paar Aspirin neh-
men.
Sie hielt die Kamera in der Hand und blickte auf den vor ihr
liegenden toten Körper. Sie musste sich zusammennehmen, um
dem Impuls zu widerstehen, eine Locke des blonden, an der
Wurzel dunklen Haares aus dem Gesicht der toten Frau zu
streichen. Alberta Spanio hatte sich große Mühe gegeben, die
Brooklyn-Schönheit zu erhalten, die sie vor zehn oder zwölf
Jahre gewesen sein mochte. Nun hatte sie den Kampf verloren.
Das Blut war über ihren Hals und auf das Kissen gelaufen,
auf dem sie nun ruhte. Es war nicht viel Blut, jedenfalls nicht
im Vergleich zu der Menge, die Stella erwartet hätte. Sie steck-
te die Kamera in die Tasche und griff in den Koffer, der ihre
Tatortausrüstung enthielt. Sie nahm die Magnetpulverschachtel
heraus, öffnete sie und zog den Puderpinsel hervor. Dann un-
tersuchte sie den glatten Griff des Messers, der im Hals der
Frau steckte. Sauber. Keine Fingerabdrücke.
Auf dem Tisch neben dem Bett lagen zwei interessante Ge-
genstände. Das eine war ein offenes Fläschchen, in dem noch
zwei Pillen waren. Auf der Schachtel stand Aleppo, was, wie
Stella wusste, ein Generika von Sonata war. Sheldon Hawkes
würde ihr später verraten können, wie viel von dem Medika-
ment er im Körper der toten Frau gefunden hatte.
Stella untersuchte die Schachtel auf Fingerabdrücke. Es gab
einen. Mit zwei Fingern, die in Latexhandschuhen steckten, hob
sie das Pillenfläschchen hoch und ließ es zusammen mit dem De-

ckel, der in der Nähe gelegen hatte, in einen Plastikbeutel fallen.
Dann versiegelte sie ihn und legte ihn in den Ausrüstungskoffer.
Der andere Gegenstand war ein Null-Komma-Zwei-Liter-
Glas mit einer kleinen Menge bernsteinfarbener Flüssigkeit.
Stella beugte sich vor und roch an dem Glas. Alkohol. Hawkes
würde ihr auch erzählen können, wie viel Alkohol die tote Frau
konsumiert hatte. Eine Kombination aus Schlaftabletten und
Alkohol konnte tödlich sein, aber das Messer in Alberta Spanios
Hals schloss diese Möglichkeit als Todesursache wohl aus.
Stella goss die Flüssigkeit in einen Plastikbehälter mit
Schraubverschluss und untersuchte dann das Glas auf Finge-
rabdrücke. Sie fand drei. Das Glas wurde vorsichtig in einem
Plastikbeutel verstaut und versiegelt.
»Willst du hier mal einen Blick drauf werfen?«, rief Danny,
der in der Tür zum Badezimmer stand.
Er hatte den Türgriff auf der Innenseite bereits eingepudert
und die Abdrücke vorsichtig abgenommen.
»Komme«, antwortete Stella, während sie vom Bett zurück-
trat.
Sie ging in das Badezimmer und betrachtete das offene
Fenster.
»Wann ist sie gestorben?«, fragte Danny.
Stella zuckte mit den Schultern.
»Der Körper ist kalt, also können wir das nicht mit Sicher-
heit sagen. Vielleicht kann Hawkes die Zeit eingrenzen. Sie
weist keine Spuren von Frost auf. Ich würde sagen, in den letz-
ten drei Stunden. Höchstens.«
»Wann hat es aufgehört zu schneien?«, fragte Danny.
»Ich weiß nicht. Vor vier oder fünf Stunden. Das finden wir
heraus.«
»Der Mörder muss klein gewesen sein«, stellte Danny fest
und sah zu dem offenen Badezimmerfenster. »Ist mithilfe einer
Leiter oder einem Seil reingeklettert. Da draußen gibt es keine

Feuertreppe. Eine verdammte Zirkusnummer bei all dem Wind
und Schnee.«
Stella holte ein frisches Paar Latexhandschuhe aus der Ta-
sche und zog sie an. Dann trat sie ans Fenster, streckte die
Hand aus und strich mit dem Finger über den hölzernen Rah-
men. Sie tastete auch den äußeren Rahmen des Fensters ab. Die
Kälte brannte noch auf ihren Wangen, als sie zurück in den
Raum glitt.
»Wir müssen das Fenster ins Labor bringen«, entschied sie.
»Gut.« Danny nickte.
»Und überprüf auch die Toilette«, fügte Stella hinzu, wäh-
rend sie sich gleichzeitig verbot, sich vorzustellen, welche un-
angenehmen Dinge Danny dort erwarten würden.
»Hab ich schon. Nichts«, lautete die nüchterne Antwort ih-
res Kollegen.
»Dann lass uns im anderen Raum weitermachen. Ich unter-
suche die Leiche, das Bett und den Tisch. Du kümmerst dich
um Boden und Wände.«
»Nachdem ich das Fenster ausgebaut habe?«, fragte er.
»Das Fenster kann warten bis wir fertig sind.«
Im Nebenzimmer hörte man Taxx’ Stimme: »Sehen Sie es
sich selbst an.«
Zusammen mit Flack ging er zum Fenster und blickte hin-
aus. Collier aber blieb mitten im Raum stehen und stierte unru-
hig durch die offene Tür ins Badezimmer.
»Sieben Stockwerke hoch«, sagte Taxx zu Flack. »Keine
Feuertreppe.«
»Auch nicht vor dem Badezimmerfenster?«, hakte Flack
nach.
Taxx schüttelte den Kopf. »Nur eine Ziegelmauer. Verge-
wissern Sie sich ruhig.«
»Das werde ich«, sagte Flack. »Und Sie haben die ganze
Nacht keine Geräusche aus dem Schlafzimmer gehört?«
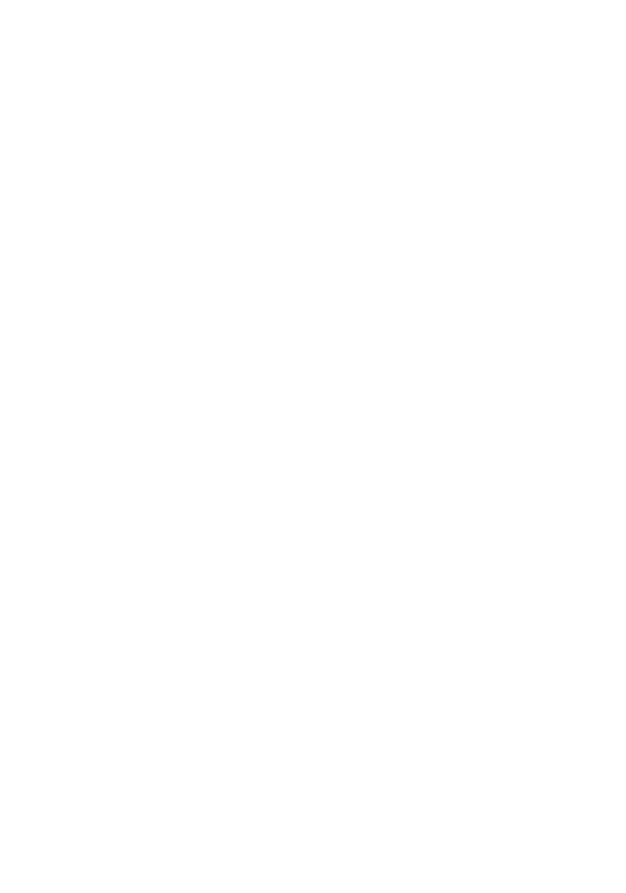
»Nichts«, sagte Taxx.
»Nichts«, stimmte ihm Collier zu.
»Als sie ins Bett gegangen ist … Erzählen Sie mir, was pas-
siert ist«, forderte Flack ihn auf.
Das Ganze hatte sich, wie die beiden Beamten übereinstim-
mend berichteten, an allen drei Abenden nach demselben Mus-
ter abgespielt. Alberta Spanio trug einen Drink in das Schlaf-
zimmer, nahm zwei Schlaftabletten, sagte »Gute Nacht« und
verriegelte die Tür. Die Männer vermuteten, dass sie gleich ins
Bett ging. Es gab einen Fernseher in dem Raum, aber sie hatten
ihn nie gehört. Sie hatten auch kein Wasser in die Wanne lau-
fen hören, nichts. Obwohl es Alberta bestimmt nicht geschadet
hätte, denn die letzte Dusche hatte sie vor zwei Nächten ge-
nommen. Das Einzige, was die Männer tatsächlich gesehen
hatten, war die Einnahme der Schlaftabletten zusammen mit
einem großen Schluck Scotch. Demzufolge musste Alberta be-
reits eine Minute, nachdem sie im Schlafzimmer verschwunden
war, tief geschlafen haben.
»Was zum Teufel ist passiert?«, fragte Collier und starrte in
Richtung Badezimmer. Er stellte sich vermutlich gerade vor,
wie er den Rest seines Lebens als kleiner Cop verbringen wür-
de.
Flack lieferte ihm keine Antwort. Er wusste aber auch, dass
Collier keine erwartete. Er klappte sein Notizbuch zu.

3
Lutnikovs Appartement war klein – ein Wohnzimmer, ein
Schlafzimmer und eine Singleküche in einer Nische.
Das Wohnzimmer erinnerte an eine Bibliothek. An drei Sei-
ten des Raums standen deckenhohe Regale voller Bücher. Auf
einem großen hölzernen Schreibtisch in der Mitte des Raums
thronte eine Schreibmaschine. Der Schreibtisch war mit einem
wirren Durcheinander aus Notizblättern, Zeitungsausschnitten
und Zeitschriften übersät, und einige der Papierstapel drohten
auf den Boden zu fallen. Der Tisch stand vom Fenster abge-
wandt, sodass das Licht bei der Arbeit über die Schulter fiel.
Nicht weit von dem Schreibtisch entfernt sah man einen
Lehnsessel und einen kleinen Tisch mit einer Stehlampe. Ge-
genüber dem Sessel stand ein Sofa, das weich, braun, repara-
turbedürftig, aber nicht alt genug war, um als Antiquität aus
den Fünfzigern durchzugehen.
Der einzige andere Raum in dem Appartement, das der
Hausmeister für Aiden und Mac aufgeschlossen hatte, war
Lutnikovs Schlafzimmer. Es enthielt noch mehr Bücherregale,
diesmal auch Zeitschriften, außerdem einen Kleiderschrank,
eine Schubladenkommode, auf der ein weißer Sony-Fernseher
seinen Platz gefunden hatte, und ein Doppelbett, das militärisch
korrekt bezogen war. Es bildete einen scharfen Kontrast zu
dem Chaos des restlichen Appartements.
»Die Küche ist da drüben«, erklärte der Hausmeister, ein
Mann namens Nathan Gremold. Er war in den Sechzigern, mit
einer breiten, silbernen Krawatte um den Hals, die seine Auto-
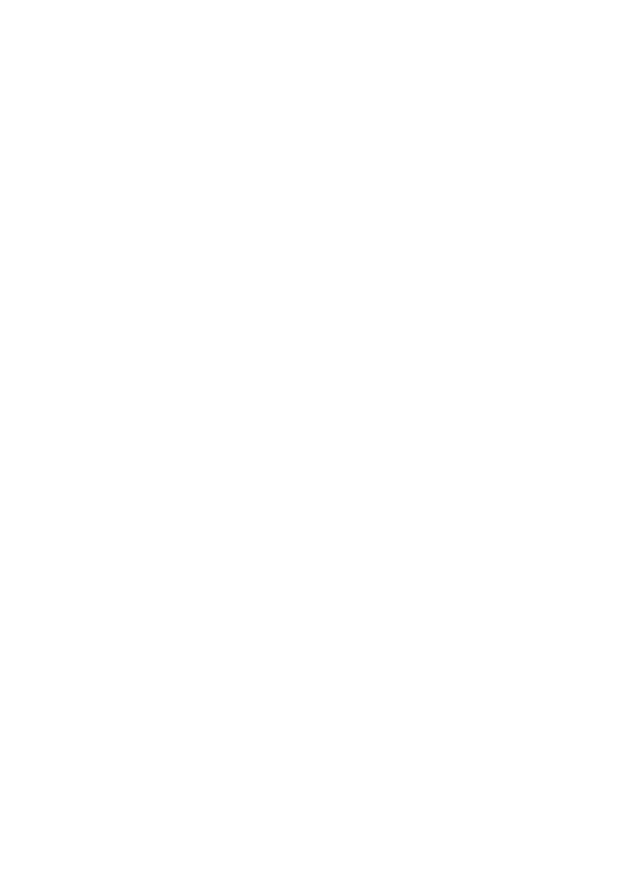
rität unterstreichen sollte. Gremold war Chefhausmeister bei
Hopwell and Freed, der drittgrößten Gebäudeverwaltungsge-
sellschaft von Manhattan, die sich auf gehobene Appartement-
gebäude spezialisiert hatte. Er bemühte sich, sich sein Missfal-
len bezüglich Lutnikovs offensichtlicher Gleichgültigkeit ge-
genüber seiner erstklassigen Behausung nicht anmerken zu las-
sen.
Das, worauf Gremold gerade deutete, war keine Küche,
sondern eine Nische, und der Hinweis darauf war absolut unnö-
tig.
Aiden und Mac folgten Nathan Gremold durch das Wohn-
zimmer, vorbei an dem Schreibtisch, zu der Singleküche. Die
Kochnische war makellos sauber. Sie war mehr als sauber. Sie
war klinisch rein. Der winzige Küchentresen war vollkommen
leer – bis auf ein Salz- und Pfefferset.
Mac öffnete die Schränke. Sämtliche Dosen waren ordent-
lich aufgereiht. Ein Fach diente ausschließlich der Aufbewah-
rung von Kartons mit biologisch wertvollen Getreideproduk-
ten.
»Der Mann hatte eine Vorliebe für gesunde Zutaten«, stellte
Aiden fest.
Mac zog einen Karton hervor, untersuchte ihn kurz und leg-
te ihn zurück.
Der Kühlschrank war gut ausgerüstet, aber nicht übertrieben
voll. Eine kaum aufgebrauchte Tüte Sojamilch befand sich im
obersten Fach neben einem sauber verpackten, halben Laib
Brot aus Vollkornmehl.
Sie kehrten in das Wohnzimmer zurück, in dem Nathan
Gremold auf sie gewartet hatte.
»Wir kommen allein zurecht«, sagte Mac. »Wir werden die
Tür abschließen, wenn wir fertig sind. Nur noch zwei Fragen«,
fügte er hinzu, als Aiden bereits an den Schreibtisch trat und an-
fing, sich die Papierstapel und die Schreibmaschine anzusehen.

Gremold zögerte. »Ja?«
»War Mr Lutnikov der Eigentümer dieses Appartements?«
»Nein«, sagte Gremold. »Er hatte es nur gemietet.«
»Wie hoch ist die Miete?«
»Dreitausend im Monat. Das ist eines unserer wenigen
preisgünstigen Appartements.«
»Wie hat er bezahlt?«
»Mit Scheck. Am Ersten. Immer pünktlich.«
»Wissen Sie, womit er seinen Lebensunterhalt verdient
hat?«
»Ich habe mir seine Bewerbung angesehen, als die Polizei
sich bei uns meldete. Wenn Sie übrigens eine Kopie wollen …«
»Wollen wir.«
»In der Bewerbung hat Mr Lutnikov angegeben, er sei Tex-
ter, Werbetexter, hauptsächlich für Möbelkataloge der gehobe-
nen Klasse.«
»Einkommen?«
»Wenn ich mich recht erinnere, sagte er, er verdiene durch-
schnittlich einhundertdreißigtausend im Jahr.«
»Hatte er Referenzen?«
»Ganz sicher hatte er die, aber aus dem Stand …«
»Danke«, unterbrach Mac, zog eine Karte hervor und reichte
sie Gremold. »Bitte faxen Sie eine Kopie der Bewerbung an
mein Büro.«
»Natürlich«, sagte Gremold, zog ein Notizbuch aus der Ja-
ckentasche und steckte die Karte hinein.
Als er weg war, widmete Mac seine Aufmerksamkeit wieder
dem Appartement.
»Das meiste von dem Zeug«, sagte Aiden mit einem Blick
auf den Stapel auf dem Schreibtisch, »sieht nach Notizen aus.
Manche davon sind mit der Maschine geschrieben.«
»Was für Notizen?« Mac blickte neugierig auf das Bücher-
regal links von ihm.

»Solche wie die hier.« Aiden hielt ein Blatt hoch.
Die hingekritzelten Wörter auf dem blauen Post-it lauteten:
»Gifte überprüfen. Irgendwas, das nicht entdeckt werden
kann?«
»Er hätte sich an uns wenden sollen«, kommentierte Mac
den Fund.
»Komische Notiz für einen Kerl, der Katalogtexte verfasst«,
meinte Aiden und wandte sich wieder dem Stapel zu.
»Der ganze Kerl ist komisch. Sein Bett macht er wie ein Drill
Sergeant bei den Marines, seine Küche ist so sauber wie ein O-
perationssaal, und sein Arbeitsplatz ist ein einziges Chaos.«
»Ein Chaos, stimmt«, sagte Aiden, während sie einen Stapel
Zeitschriften in Augenschein nahm. »Aber sauber. Müsste er
nicht einen Computer haben?«
»Regression«, erwiderte Mac ohne aufzusehen.
Er trat zurück und sah sich um, als suche er irgendetwas. Da
er es nicht fand, machte er sich auf einen langsamen Rundgang
durch das Appartement. Etwa die Hälfte der Bücher in den Re-
galen waren Kriminalromane. Der Rest umfasste ein umfang-
reiches Wissensspektrum, zu dem Geschichte, Geografie, Wis-
senschaft und Kunst im Allgemeinen gehörten.
Als er ins Wohnzimmer zurückkehrte, durchsuchte Aiden
gerade die Schreibtischschubladen.
»Ist dir irgendwas aufgefallen, was nicht hier sein sollte?«,
fragte er.
Aiden hielt inne, schaute sich um, schüttelte den Kopf und
schaute ihn an.
»Wie ist es mit etwas, das da sein sollte, aber nicht da ist?«,
hakte er nach.
Wieder sah sie sich um, und dann bemerkte sie es auch.
»Er hat Gremold doch erzählt, er würde seinen Lebensun-
terhalt mit Werbetexten für hochwertige Kataloge verdienen«,
sagte sie.

»Siehst du irgendwelche Kataloge in diesem Appartement?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Der Mann scheint auf seine Arbeit nicht gerade stolz ge-
wesen zu sein.«
»Oder er hat seinen Lebensunterhalt doch nicht mit Werbe-
texten verdient«, überlegte Mac.
Ausgestattet mit der Namensliste, die ihm der Pförtner Aaron
McGee gegeben hatte, machte sich Mac im sechzehnten Stock
an die Arbeit. Mit einer tragbaren ALS, in der Art einer Ta-
schenlampe, zu der eine bernsteinfarbene Schutzbrille gehörte,
untersuchte er sorgfältig den kleinen Korridor vor dem Fahr-
stuhl. Alles konnte von Nutzen sein: Spuren von Blut, Speichel
oder dergleichen. Er hielt auch nach der Mordwaffe oder der
Kugel Ausschau, wenngleich er nicht damit rechnete, sie zu
finden. Der Mörder hatte wahrscheinlich beides an sich ge-
nommen, aber man konnte ja nie wissen. Aus langjähriger Er-
fahrung wusste Mac, dass schon merkwürdigere Dinge passiert
waren. Diese Suche würde er nun auf jeder Etage wiederholen.
Vermutlich hätten die Bewohner der oberen sieben Stock-
werke die Schüsse nur dann gehört, wenn sie auch auf ihrer Eta-
ge abgefeuert worden wären. Doch die Appartements waren alt
und hatten dicke Wände. Vielleicht hätten die Bewohner einen
Schuss gehört, wenn sie direkt vor dem Fahrstuhl gestanden hät-
ten. Aber das wäre, so schloss er, davon abhängig gewesen, wie
viele Stockwerke entfernt der Schuss abgefeuert worden war.
Sechs der Bewohner überwinterten laut Auskunft des Pfört-
ners in Florida, einschließlich der Galleghers auf der siebzehn-
ten Etage und der Galleghers auf der achtzehnten. Die Galleg-
hers im siebzehnten Stock waren Sohn, Schwiegertochter und
Enkelkinder der Galleghers im achtzehnten. Mason und Tess
Cooper aus dem Zwanzigsten waren in Palm Springs in Kali-
fornien. Cooper hatte McGee mehr als einmal erzählt, dass das

Haus, das er in Palm Springs bewohnte, gleich neben dem
Haus stand, das einmal Danny Thomas gehört hatte.
Damit blieben der sechzehnte, neunzehnte, einundzwanzigs-
te und zweiundzwanzigste Stock übrig.
Evan und Faith Taft schliefen noch, als Mac den Messing-
klopfer an ihrer Tür betätigte. Evan, in den Fünfzigern, geklei-
det in einen blauen Morgenrock, der seinen Bauch doch nicht
verbergen konnte, öffnete die Tür mit zerzaustem braunen
Haar. Er blinzelte, als Mac ihm seine Marke zeigte.
»Was gibt es?«
»In Ihrem Fahrstuhl wurde jemand ermordet, Mr Taft.«
»In unserem Fahrstuhl?«
»Haben Sie heute Morgen Schüsse oder irgendwelche un-
gewöhnlichen Geräusche gehört?«
»Jemand wurde in diesem Gebäude erschossen? In unserem
Fahrstuhl?«
»Ja«, bestätigte Mac. »Haben Sie etwas gehört?«
»Nein«, sagte Taft. »Ich werde meiner Frau davon erzählen
müssen. Oh, so ein Mist. Sie hat Herzprobleme. Vermutlich
werden wir das Appartement verkaufen und umziehen müssen.
Sie wird nie wieder freiwillig in den Fahrstuhl steigen. Wissen
Sie, wie es auf dem Wohnungsmarkt in dieser Stadt aussieht?«
Mac wartete, während Evan Taft sein Klagelied fortsetzte.
»Vielleicht können wir in unserer Wohnung auf Long Island
unterkommen. Falls wir es überhaupt schaffen, da hinzukom-
men bei all dem Schnee.«
»In diesem Gebäude wohnt auch ein Charles Lutnikov.
Kennen Sie ihn?«
»Der Name sagt mir nichts. Hat er jemanden umgebracht?«
»Nein, er war das Opfer.«
»In welchem Stockwerk hat er gewohnt?«
»Im dritten. Stämmiger Mann, beginnende Glatze, vielleicht
ein wenig ungepflegt.«

»Ich weiß nicht, vielleicht. Klingt irgendwie vertraut, aber …«
»Ich werde später jemanden mit einem Foto von ihm vor-
beischicken«, sagte Mac. »Wie gut kennen Sie Ihre übrigen
Nachbarn? Die, die ebenfalls diesen Fahrstuhl benutzen?«
»Nicht gut«, antwortete Taft. »Die Wainwrights wohnen im
Neunzehnten. Er ist der Wainwright von Rogers and Wainw-
right, den Börsenmaklern. Er kümmert sich um einen Teil un-
serer Investitionen. Die anderen kennen wir gerade gut genug,
um hallo zu sagen, wenn wir uns im Fahrstuhl oder in der Lob-
by begegnen. Die Barths im Einundzwanzigsten sind im Ruhe-
stand, gehören zu Redwear, haben Pappkartons in North Caro-
lina hergestellt. Und die Coopers aus dem Zwanzigsten – ken-
nen Sie die Daisy-Ice-Cream-Kette im Süden?«
»Nein«, gestand Mac.
»Nun ja, die gehört der Familie Cooper«, erklärte Evan,
strich sich das Haar zurück und blickte sich über die Schulter
um, um nachzusehen, ob seine Frau sich näherte. »Große Fami-
lie.«
»Oberstes Stockwerk? Louisa Cormier?«
»Unsere Prominente«, sagte Taft. »Sie ist schon wieder in
der Bestsellerliste der Times. Eine ziemlich nette Dame. Aber
Sie kennen das, alles nur Fahrstuhlerfahrungen. ›Wie geht es
Ihnen‹ und so was in der Art. Sie lebt ziemlich zurückgezo-
gen.«
»Ja«, sagte Mac. »Haben Sie heute Morgen irgendwelche
Geräusche gehört, vermutlich kurz vor acht Uhr?«
»Geräusche?«
»So etwas wie einen Schuss.«
»Nein. Unser Schlafzimmer liegt im hinteren Teil des Ap-
partements. Sonst noch etwas?«
»Nein«, antwortete Mac.
»Dann gehe ich besser zurück und überlege mir, wie ich das
am besten meiner Frau beibringe.«

Mac nickte, und Taft schloss die Tür.
In den anderen Stockwerken hatte Mac auch nicht mehr
Glück. Aiden stieß im zweiundzwanzigsten Stock zu ihm. Zu-
sammen untersuchten sie den Korridor vor dem Fahrstuhl, so
wie es bereits auf den vorangegangenen Stockwerken gesche-
hen war. Als sie fertig waren, saugte Aiden den Fußboden und
verstaute die Ausbeute in einem separaten Plastikbeutel.
Als hier die ALS-Lampe zum Einsatz kam, entdeckte Mac
kleine, aber unverkennbare Spuren von Blut. Er stand vor
Louisa Cormiers Tür. Dann griff er zu dem schimmernden
Messingklopfer.

4
Dr. Sheldon Hawkes, schlank, dunkelhäutig, gekleidet in Jeans
und T-Shirt, auf dessen Rückseite die Buchstaben »CSI« zu le-
sen waren, befand sich im Autopsiesaal. Zwei Leichen lagen
für die Autopsie bereit, und zwischen den beiden Leichen stand
Stella Bonasera. Sie wartete auf Hawkes’ Ergebnisse der Un-
tersuchung.
Die einzige helle Lichtquelle hing unter der Decke und
tauchte den kargen Raum in grelles Weiß. Die beiden Stars des
Tages waren Alberta Spanio, in deren Hals immer noch das
Messer steckte, und Charles Lutnikov, in dessen Brust die bei-
den Einschusslöcher nun deutlich sichtbar waren. Beide Lei-
chen lagen unbekleidet auf Stahltischen und verließen die Welt
so, wie sie sie betreten hatten – nackt. Ihre Augen waren ge-
schlossen, und ihre Köpfe ruhten auf kleinen Blöcken.
Hawkes hatte die Temperatur beider Leichen in dem Moment
gemessen, in dem sie bei ihm angekommen waren, und sie mit
der Rektaltemperatur verglichen, die Stella und Aiden gemessen
hatten. Der Zeitpunkt des Todes ließ sich nie mit hundertprozen-
tiger Genauigkeit feststellen, es sei denn, ein Zeuge stand
daneben und man vertraute ihm und seiner Armbanduhr.
Rigor mortis hatte noch bei keiner der Leichen eingesetzt,
was die Vermutung nahe legte, dass der Tod vor weniger als
acht Stunden eingetreten war. »Vermutung« war die maßgebli-
che Vokabel, da Stella Alberta Spanios Leichnam in einem
Raum untersucht hatte, in dem eine Temperatur von minus
fünfeinhalb Grad geherrscht hatte.

Der Fachbegriff »Rigor mortis« bezeichnet die Versteifung
und Kontraktion der Muskeln, die durch chemische Prozesse
in den Muskelzellen ausgelöst wird. »Rigor mortis« kann in
den unterschiedlichsten Ausprägungen vorkommen. Norma-
lerweise fängt die Leichenstarre im Gesicht an und arbeitet
sich durch jeden einzelnen Muskel hindurch, bis schließlich
die Zehen des Toten in Mitleidenschaft gezogen werden. Im
Allgemeinen setzt die Leichenstarre achtzehn bis sechsund-
dreißig Stunden nach Eintritt des Todes ein und hält zwei Ta-
ge vor, bis die Muskeln sich wieder entspannen und der Ver-
fallsprozess einsetzt. Hitze beschleunigt diesen Prozess. Haw-
kes erinnerte sich aber auch an Fälle, in denen die Leichen-
starre erst nach einer Woche eingesetzt hatte. Bei mageren
Personen konnte sie unabhängig von der Temperatur sehr
schnell, bei korpulenten Personen hingegen viel langsamer
ablaufen.
Noch ehe er mit der Autopsie begann, wusste Hawkes, dass
der Todeszeitpunkt, den die C.S.I.-Detectives an den jeweili-
gen Tatorten ermittelt hatten, einigermaßen korrekt war. Die
normale Körpertemperatur liegt bei 36,7°C. Der Körper passt
sich der Umgebungstemperatur mit etwa 0,833°C in der Stunde
an, es sei denn, die Umgebung, in der die Leiche gefunden
wird, ist extrem heiß oder extrem kalt. Berücksichtigte man die
22°C im Fahrstuhl und die Körpertemperatur des toten Man-
nes, so ließ sich Charles Lutnikovs Todeszeitpunkt recht ein-
fach bestimmen.
In Bezug auf Alberta Spanio war das schwerer, deutlich
schwerer. Aufgrund der extrem niedrigen Temperatur musste
ihre Körpertemperatur sehr schnell gefallen sein. Hawkes
konnte den Zeitpunkt ihres Todes besser einschätzen, wenn er
sich ihr zuerst widmete und anfing, ihren Körper und ihre Or-
gane genauestens zu untersuchen.
Er fing mit dem Messer an, das in ihrem Hals steckte.
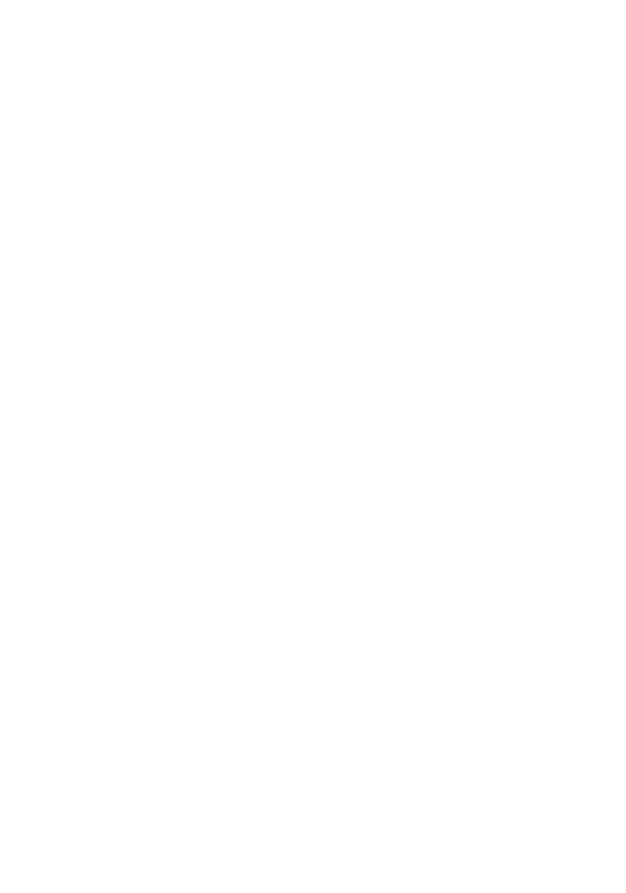
»Von oben nach unten geführt«, sagte er, als er das Messer
vorsichtig herauszog. »Tief. Der Täter war stark. Und er hatte
Glück, oder er wusste, wo die Halsschlagader sitzt. Sie hat ge-
schlafen. Kein Kampf. Keine Bewegung. Nicht einmal, nach-
dem sie erstochen wurde. Das Messer ist ein Springmesser, das
direkt aus Die Saat der Gewalt oder West Side Story hätte ent-
sprungen sein können, was beweist, wie gut ich mich mit mo-
dernen Filmen auskenne. Billig und scharf.«
Hawkes ließ das blutige Messer in eine Stahlpfanne fallen
und gab sie Stella. Sie würde sie der Sammlung hinzufügen, zu
der bereits das Pillenfläschchen, der Deckel und das Glas mit
Alkohol zählten. Wenn Hawkes mit der Leiche fertig wäre,
würde vermutlich auch das Badezimmerfenster, das im Labor
auf sie wartete, dazugehören.
Routiniert machte Hawkes mit der Autopsie weiter. Es hatte
immer wieder etwas Heiliges an sich, denn es war der erste
Schritt, um ein Verbrechen aufzuklären und den Opfern Ge-
rechtigkeit widerfahren zu lassen.
Sorgsam setzte Hawkes zu dem Y-Schnitt an, einem Schnitt
in den Leichnam, der von beiden Schultern aus zum Brustbein
führte und danach über den Bauch zum Becken weitergezogen
wurde.
Die inneren Organe lagen nun offen vor ihm. Hawkes be-
nutzte eine gewöhnliche Astschere, um Rippen und Brustbein
zu durchtrennen. Dann hob er die Rippen an, um das Herz und
die anderen Organe freizulegen, einzeln herauszuholen und zu
wiegen. Danach mussten aus allen Organen Flüssigkeitsproben
entnommen werden. Im Anschluss wurden Magen und Darm
aufgeschnitten, um den Inhalt zu analysieren.
Als die Untersuchung des Torsos abgeschlossen war, wid-
mete sich Hawkes Albertas Kopf. Zuerst schaute er sich die
Augen an. Vielleicht gab es Hinweise auf Blutungen, und das
Opfer war erst erstickt worden, bevor es erstochen worden war.

Dann schnitt er vorsichtig mit einem scharfen Messer durch die
Kopfhaut, zog sie über das Gesicht und legte den Schädel frei.
Mit einer Hochgeschwindigkeitssäge öffnete er den Knochen
und spaltete ihn schließlich mit einem Meißel. Dann nahm er
das Gehirn aus der Schädeldecke, um es ebenfalls zu wiegen
und zu untersuchen.
Während er einen Schritt nach dem anderen durchführte,
diktierte er das, was er tat und sprach in ein Mikrofon. Auch
dieses Tonband würde bald zu der Sammlung von Beweisstü-
cken gehören.
»Fertig«, sagte er endlich. »Ich bringe die Proben ins La-
bor.«
»Sag ihnen, sie sollen sich beeilen«, bat Stella. Es passierte
in New York oft genug, dass die Laborberichte in einem Mord-
fall Wochen oder sogar Monate auf sich warten ließen.
Hawkes nickte und ging zu dem Waschbecken in der Ecke,
wo er den blutigen Kittel auszog, die Handschuhe abstreifte
und sich wusch.
Stella fühlte sich ein wenig benommen, und das war ihr of-
fenbar anzusehen, denn Hawkes fragte: »Alles in Ordnung mit
dir?«
»Bestens.«
Was an ihr zehrte, war nicht die Autopsie oder der Anblick
des geschundenen Leichnams. Dass was ihre Energie raubte,
war diese verdammte Grippe. Sie verfluchte ihre Schwäche.
Sie dankte Hawkes für seine Nachfrage und machte sich auf
den Weg.
»Und jetzt«, rief Hawkes ihr hinterher, »werde ich mich mal
ein bisschen mit Mr Lutnikov unterhalten.«
Zu Stellas Glück war Lutnikov Aidens und Macs Fall. Sie
fragte sich, warum keiner der beiden bei der Autopsie dabei
war.

Detective Don Flack hatte Rücksprache mit der Hotelrezeption
gehalten und herausgefunden, wer in den Zimmern ein Stock-
werk über und unter Alberta Spanios Raum gewohnt hatte. Um
sicher zu sein, hatte er auch die Zimmer zwei Stockwerke hö-
her und tiefer überprüft.
Der möglicherweise interessanteste Raum war, wie sich heraus-
stellte, der direkt über dem Badezimmer. Er war von einem Wen-
dell Lang bewohnt worden, der schon zwei Tage zuvor speziell
nach diesem Raum gefragt hatte. Damals musste er abgewiesen
werden, weil genau dieser Raum belegt gewesen war. Er hatte also
zunächst ein anderes Zimmer genommen, war aber sofort umgezo-
gen, als der Raum über Alberta Spanio frei geworden war. Mr
Lang hatte das Hotel um sechs Uhr an diesem Morgen verlassen.
Unglücklicherweise war der Portier, der bei Wendells Ein-
checken dabei gewesen war und eine Personenbeschreibung
hätte abliefern können, gerade nicht im Dienst.
Flack nahm das Buchungsformular von Wendell vorsichtig
an sich und ließ es in einen kleinen Plastikbeutel fallen, den er
in seine Tasche steckte. Dann, mit einem Schlüssel, den ihm
der Manager überlassen hatte, ging er hinauf in das Zimmer,
das Wendell Lang gemietet hatte.
Das Zimmer war klein, und das Zimmermädchen hatte be-
reits sauber gemacht. Im Korridor fand er das Mädchen mit
seinem Handwagen. Er zeigte ihr seine Marke und fragte sie,
ob sie im Zimmer gesaugt hätte.
Die Frau, Estrella Gomez, war pausbäckig, hellhäutig und in
den Dreißigern. Sie sprach mit einem schwachen Akzent, als
sie sagte: »Zimmer 704. Der Mülleimer war leer. Keine Zei-
tungen, kein gar nichts im ganzen Zimmer. Hat die Handtücher
nicht benutzt. Hat nicht einmal in dem Bett geschlafen. Ich ha-
be staubgesaugt. Das war alles.«
Flack wies Estrella Gomez an, zur Rezeption zu gehen und
den Leuten zu sagen, sie sollten niemanden in das Zimmer las-

sen, da es sich um einen möglichen Tatort handeln könnte. Dann
kehrte er in den Raum zurück, ging zum Fenster, öffnete es und
blickte in die Tiefe. Freier Fall und zwei Probleme. Das Fenster
war von jedem, der von der 51. Straße hochschaute oder aus ei-
nem der Bürogebäude gegenüber sah, leicht zu erkennen. Die
Chance, dass jemand aus diesem Fenster hinausstieg und die
Fassade hinunterkletterte, ohne dabei beobachtet zu werden, war
erbärmlich – sogar in der Dunkelheit der Nacht.
Nach Hawkes’ Untersuchung würde Flack wissen, wann
Alberta Spanio ermordet wurde. Sollte die Sonne bereits ge-
schienen haben, hätte jemand, der aus einem sechsstöckigen
Hotel herauskletterte, entdeckt werden müssen.
Als er den Kopf wieder zurückzog, sah Flack etwas in der
Mitte der Fensterbank, eine kleine Kerbe, die sich wie ein
schmales Band durch das weiße Holz zog. Die Vertiefung sah
neu aus, das bloßgelegte Holz sauber. Er berührte es, um sich
zu vergewissern, dass der Schaden neu war. Dann zog er sein
Mobiltelefon hervor und rief Stella an.
Als er gerade an Louisa Cormiers Tür klopfen wollte, klingelte
Macs Mobiltelefon. Die Nummer des Anrufers, die auf dem
Display angezeigt wurde, war ihm nicht bekannt. Er stutzte ei-
nen Moment, doch dann nahm er schließlich ab.
»Ja«, meldete er sich, während er die hohe Tür aus polier-
tem dunklen Holz musterte, die mit geschnitzten Blütenranken
verziert war.
»Mr Taylor?«, erklang eine weiche Frauenstimme.
Gleich neben ihm stand Aiden mit ihrem Aluminiumkoffer
in der Hand und wartete.
»Ja.«
»Hier spricht Wanda Frederichson. Wir würden die Angele-
genheit gern verschieben, bis das Wetter besser ist, und wir ge-
nug Schnee wegschaffen können.«

Mac sagte nichts.
»Wenn Sie das natürlich unbedingt am Montag erledigen
möchten, dann werden wir unser Bestes tun, aber wir raten da-
zu …«
»Montag«, sagte Mac. »Es muss am Montag sein. Tun Sie
einfach, was Sie können.«
»Und Sie wollen immer noch alles so haben, wie wir es be-
sprochen haben?«
»Ja. Der Wetterbericht sagt, nach morgen soll es mindestens
eine Woche lang keinen Schneefall mehr geben.«
»Aber«, wandte Wanda Frederichson ein, »die Temperatur
soll noch mindestens sieben Tage lang bei etwa zwanzig Grad
minus liegen.«
Mac spürte, dass die Frau ihn gern überzeugt hätte zu war-
ten, aber warten kam nicht in Frage. Es musste Montag sein.
»Und Sie sagten, es werden keine Gäste da sein?«, hakte
Wanda Frederichson zur Sicherheit noch einmal nach.
»Keine Gäste. Nur ich.«
»Dann am Montag um zehn«, beendete Wanda Frederichson
das Gespräch mit einem resignierten Unterton.
Mac klappte sein Mobiltelefon zu. Sein Blick traf den Ai-
dens. Sollte sich hinter ihren braunen Augen eine Frage formu-
liert haben, so verbarg sie es. Sie war klug genug, den Mund zu
halten.
Mac bewegte den Klopfer und pochte an die kunstvolle Tür.
Aus dem Inneren des Appartements konnte er einen Klingelton
hören.
»Phantom der Oper«, sagte er.
»Hab ich nie gesehen«, entgegnete Aiden.
Die Tür wurde geöffnet. Eine kleine Frau in den Fünfzigern,
gekleidet in weißer Bluse und blauem Rock, stand vor ihnen.
Ihr Haar war kurz, lockig und honigblond, die Augen blau.
Sowohl die Farbe der Haare wie auch die der Augen war un-

echt, künstlich, aber nahezu perfekt. Sie war nicht wirklich
hübsch, aber sie besaß eine zarte Eleganz und ein beinahe trau-
riges Lächeln, das den Blick auf perfekte weiße Zähne freigab.
»Louisa Cormier?«, fragte Mac.
Die Frau sah Mac und Aiden an. »Die Polizei, stimmt’s? Ich
habe Sie bereits erwartet. Mr McGee hat mich von unten ange-
rufen. Bitte, kommen Sie herein.«
»Ich bin Detective Taylor«, stellte Mac sich vor. »Das ist
Detective Burn. Sie wird hier draußen auf mich warten.«
Louisa Cormier sah Aiden an.
»Sie wäre mir sehr willkommen …«, setzte Louisa an, doch
dann fiel ihr Blick auf Aidens Jacke. »Tatortermittlung. Die
junge Dame will sich mein Foyer ansehen.«
Mac nickte.
»Ich habe absolut nichts dagegen«, sagte Louisa lächelnd.
»Nicht, dass ich etwas dagegen tun könnte, wenn es anders wä-
re. Hier hat ein Mord stattgefunden, und als die Hausbewohne-
rin, die am weitesten weg von der Lobby wohnt, bin ich sehr
daran interessiert, dass Sie so schnell wie möglich herausfin-
den, wer das getan hat. Bitte, kommen Sie herein.«
Sie trat zurück, um Mac hineinzulassen. Als er drin war,
schloss sie die Tür.
Der Raum war mehr als nur ein Raum. Es war eine dunkle,
mit Marmor ausgelegte Halle mit einem Essbereich, der allein
schon größer war als Macs Wohnung. Hier stand ein massiver
Holztisch mit sechzehn Stühlen. Außerdem gab es einen
Wohnbereich, der beinahe einem Tennisplatz glich, möbliert
mit antiken Möbeln, die neu gepolstert und mit leuchtend far-
bigen Stoffen bezogen waren. Glasschiebetüren führten hinaus
auf einen Balkon, der in nördlicher Richtung einen Panorama-
blick über die Stadt bot.
»Groß, nicht wahr?«, sagte Louisa, die Macs Blick gefolgt
war. »Das ist der Teil, den ich den Leuten von Architectural

Digest überlasse – das hier und die Küche und meine Kombi-
nation aus Arbeitszimmer und Bibliothek. Der Zutritt zu mei-
nem Schlafzimmer jedoch …« Sie deutete auf eine Tür im
Wohnbereich, »ist Architectural Digest verwehrt geblieben,
aber Ihnen nicht.«
»Ich würde mir gern alle Räume ansehen«, sagte Mac.
»Ich verstehe. Sie tun nur Ihre Pflicht. Kaffee?«
»Nein, danke. Nur ein paar Fragen.«
»Über Charles Lutnikov?«, fragte sie, ging zum Wohnbe-
reich voran und lud ihn mit einem zarten Wink ein, Platz zu
nehmen.
Mac setzte sich in einen hohen Polstersessel mit aufrechter
Lehne. Louisa nahm ihm gegenüber auf einem Sofa Platz.
»Sie kannten Mr Lutnikov?«
»Ein wenig«, sagte sie lächelnd. »Der arme Mann. Ich habe
ihn kennen gelernt, als er eingezogen ist. Er hatte eines meiner
Bücher bei sich und wusste gar nicht, dass ich hier wohne. Ich
habe mir den Ruf, nicht gern über meine Arbeit zu reden, wohl
verdient, aber als ich Charles einige Wochen später in der Lob-
by begegnet war, hatte er schon wieder eines meiner Bücher
bei sich. Eitelkeit.«
»War er eitel?«
»Nein«, entgegnete sie mit einem Seufzen, »das ist der Titel
des Buchs und bezieht sich auf die Hauptfigur. Aber ich erlag
meiner Eitelkeit, als ich Charles mit einem meiner Bücher sah.
Ich fragte ihn, ob es ihm gefiele, und er sagte, er sei ein großer
Fan davon. Dann habe ich ihm erzählt, wer ich bin. Für einen
Moment hat er mir nicht geglaubt, bis er das Buch aufgeschla-
gen und sich die Fotografie auf der Innenseite des Umschlags
angesehen hat. Ich weiß, was Sie denken. Sie glauben, er hätte
die ganze Zeit gewusst, wer ich bin, aber das hat er nicht. Ich
konnte es ihm ansehen. Meine einzige Sorge war, dass er sich
womöglich zu einem überschwänglichen Verehrer entwickeln

könnte. Ich hätte nicht mit so einem Menschen im selben Ge-
bäude leben wollen. Ich hätte Angst davor gehabt, ihm zufällig
zu begegnen und mich mit ihm unterhalten zu müssen, wissen
Sie. Die Leute in diesem Gebäude haben meine Privatsphäre
stets so respektiert wie ich die ihre.«
»Also …?«
»Also haben wir Regeln festgelegt«, erzählte sie. »Ich wür-
de seine Bücher signieren, und er würde mich nicht mit Fragen
oder Kommentaren belästigen, wenn wir einander begegneten.
Wir würden uns einfach zulächeln und hallo sagen.«
»Und es hat funktioniert?«
»Perfekt.«
»War er je hier?«
»Hier oben? Nein. Haben Sie je eines meiner Bücher gele-
sen?«
»Nein, tut mir Leid«, gestand er.
»Das ist nicht nötig. Aber Millionen haben sie gelesen.«
Sie lächelte breit.
»Jemand in unserer Einheit ist auch ein Fan von Ihnen«,
verriet Mac. »Ich habe ihn mit Ihren Büchern gesehen. Haben
Sie heute Morgen einen Schuss gehört?«
»Um welche Zeit?«, fragte sie.
»Vermutlich gegen acht.«
»Um acht Uhr war ich nicht da«, sagte sie ernsthaft. »Ich
gehe jeden Morgen aus.«
»Wo waren Sie heute Morgen?«
»Nun, bei gutem Wetter gehe ich in den Central Park, aber
heute ist nicht der richtige Tag für so etwas«, erklärte sie. »Ich
habe mir eine Zeitung gekauft, bin zu Starbucks gegangen, um
einen Kaffee zu trinken und habe mich dann auf den Weg nach
Hause gemacht. Bitte folgen Sie mir.«
Sie erhob sich und ging zu dem Raum, den sie sowohl Ar-
beitszimmer als auch Bibliothek genannt hatte.

»Kommen Sie«, sagte sie. »Ich werde für Ihren Kollegen ein
Buch signieren – das neue. Wer dem Tod huldigt. Es kommt in
etwa einem Monat heraus.«
Mac erhob sich, um ihr zu folgen. »Haben Sie heute Morgen
irgendwelchen Lärm gehört?«
»Nein.« Sie öffnete die Tür zu ihrem Büro. »Nein, aber ich
hätte vermutlich nicht einmal etwas gehört, wenn jemand di-
rekt vor meiner Tür geschossen hätte. Ich war hier in meinem
Arbeitszimmer, von sechs bis acht, und habe hinter verschlos-
sener Tür geschrieben, und dann bin ich rausgegangen.«
»Haben Sie den Fahrstuhl benutzt?«
»Sie meinen: Habe ich im Fahrstuhl einen toten Mann gese-
hen?«, gab sie zurück. »Nein, habe ich nicht. Ich habe den
Fahrstuhl nicht benutzt. Ich bin zu Fuß hinuntergegangen.«
»Zweiundzwanzig Stockwerke«, bemerkte Mac.
»Einundzwanzig«, korrigierte sie. »Hier gibt es kein drei-
zehntes Stockwerk. Ich gehe jeden Morgen die Treppe hinun-
ter, und nach meinem Spaziergang gehe ich sie wieder hinauf.
Diese Treppen und mein Spaziergang sind wirklich meine ein-
zige körperliche Ertüchtigung.«
Das Bibliotheksbüro war groß, nicht so groß wie der Rest des
Appartements, aber groß genug für einen reich verzierten Eben-
holzschreibtisch mit gekrümmten Beinen und Elfenbeineinlege-
arbeiten, sowie einem dazu passenden Stuhl. Vor zwei Wänden
standen Bücherregale. Es waren nicht ganz so viele wie in Lut-
nikovs Wohnung, aber die Anzahl war durchaus beachtlich. An
der anderen Wand befand sich eine deckenhohe Vitrine mit einer
wirren Sammlung der verschiedensten Gegenstände.
»Meine Sammlung«, erzählte Louisa Cormier lächelnd.
»Dinge, die ich für die Recherchen zu meinen Büchern ge-
braucht habe. Ich versuche, die entscheidenden Gegenstände
selbst zu benutzen oder wenigstens zu berühren, damit ich
weiß, wovon ich schreibe.«

Mac betrachtete die Sammlung, zu der auch ein altes Arvin-
Radio aus den Vierzigern zählte, außerdem eine Pfadfinderaxt,
ein großer Kristallaschenbecher, ein gewaltiges Buch mit ei-
nem roten Stoffeinband, eine Art-déco-Statue von Erté, die auf
etwa dreißig Zentimetern Höhe eine schnittig gekleidete und
frisierte Frau darstellte, ein Schreinerhammer mit einem dunk-
len Holzgriff, ein blaues, dekoratives Kissen mit gelben Trod-
deln und den aufgedruckten Worten New Yorker Weltausstel-
lung auf der Vorderseite, ein sechzig Zentimeter langer
Krummsäbel mit goldenem Heft, eine Coke-Flasche aus den
Vierzigern – und Dutzende anderer seltsamer Sachen.
»Man hat mir gesagt«, erzählte Louisa, »die Sammlung wä-
re annähernd eine Million Dollar wert, wenn ich die Stücke
signieren und bei Ebay versteigern würde.«
»Keine Waffen«, stellte Mac fest.
»Wenn ich über Waffen schreibe, gehe ich in einen Waffen-
laden oder auf einen Schießstand«, sagte sie. »Ich sammle sie
nicht.«
An der Wand hinter dem Schreibtisch stand ein Set aus
sechs Aktenschubfächern. Über den Aktenschränken hingen
vierzehn gerahmte Auszeichnungen und ein achtundzwanzig
mal sechsunddreißig Zentimeter großes Schwarzweißfoto von
einem hübschen jungen Mädchen, das vor einem Reinigungs-
geschäft stand.
»Das war ich«, sagte sie. »Mein Vater war der Geschäfts-
führer in diesem Laden. Ich habe nach der Schule und an den
Samstagen dort gearbeitet. Das war damals in Buffalo.
Wir waren alles andere als wohlhabend, was sich im Nach-
hinein als Segen herausstellte, denn ich weiß mein Geld zu
schätzen und gebe es mit Freuden aus. Da ist es.«
Sie stand vor einem Regal in der rechten Ecke des Raums,
zog ein Buch heraus, schlug es auf der Titelseite auf und fragte:
»Für wen ist es?«

»Sheldon Hawkes.«
Sie schrieb ein wenig verschnörkelt, schlug das Buch zu und
reichte es Mac.
»Danke«, sagte er und nahm es an sich.
Auf dem Tisch stand ein Computer, ein Macintosh, und ein
Drucker, aber kein Scanner oder ein anderes technisches Ac-
cessoire.
»Gibt es sonst noch etwas?«, fragte sie und faltete die Hän-
de. Ihr Lächeln war breit und warmherzig.
»Im Augenblick nicht«, antwortete Mac. »Danke, dass Sie
sich Zeit genommen haben.«
Sie führte ihn zur Wohnungstür und öffnete. Aiden stand,
den Metallkoffer in einer Hand, auf dem Flur.
»Falls ich Ihnen noch irgendwie helfen kann …«, sagte
Louisa Cormier.
»Haben Sie irgendwelche Hausangestellten?«
»Nein, aber alle drei Tage kommt eine Putztruppe und
macht sauber.«
»Sekretärin?«, hakte Mac nach.
Louisa legte den Kopf leicht auf die linke Seite wie ein neu-
gieriges Vögelchen. »Ann Chen. Sie führt meinen persönlichen
und meinen geschäftlichen Kalender, beschützt mich vor Re-
portern, Fans und neugierigen Gaffern und kümmert sich um
meine Korrespondenz und meine Homepage.«
»Arbeitet sie hier?«
»Gewöhnlich nicht. Normalerweise arbeitet sie zu Hause in
ihrer Wohnung im Village. Meine Telefonnummer steht nicht
im Telefonbuch, aber irgendwie machen die Leute sie immer
wieder ausfindig. Die Anrufe werden an Ann umgeleitet, die
einfach auf einen Knopf drückt, um sie zu mir weiterzuleiten,
wenn sie sie überprüft hat.«
Sowohl Aiden als auch Mac konnten sehen, dass Louisa er-
wog, eine Frage zu stellen, sich aber dann dagegen entschied.

»Ist das alles?«, fragte sie stattdessen.
Aiden öffnete die Tür zum Treppenhaus. Der abgesperrte
Fahrstuhl war immer noch im Erdgeschoss.
»Für den Moment, ja«, erwiderte Mac mit einem Lächeln.
»Ich bin sicher, Sheldon wird sich über das Buch freuen.«
Mac hielt es hoch, als er Aiden durch die Tür folgte und sie
eine lächelnde Louisa hinter sich zurückließen.
Als die Tür ins Schloss gefallen war, fragte Aiden: »Hawkes
liest Krimis?«
»Keine Ahnung«, antwortete Mac und machte sich an den
Abstieg. »Gib mir eine große Tüte. Ich möchte die Finge-
rabdrücke unserer berühmten Autorin überprüfen. Hast du Pro-
ben von dem Blut auf dem Teppich?«
Aiden nickte.
»Also«, sagte Mac, »dann sehen wir mal, ob sie zu Charles
Lutnikovs Blutgruppe passen.«
»Weiß sie etwas?«, fragte Aiden, und ihre Stimme hallte von
den Wänden wider, als sie langsam die Treppe hinunterstiegen.
Mac zuckte mit den Schultern.
»Sie weiß etwas. Sie hat zu viel geredet und immer wieder
das Thema gewechselt. Sie hat sich alle Mühe gegeben, sich als
fürsorgliche Gastgeberin zu zeigen, die nichts zu verbergen
hat.«
»Aber sie hat gelogen«, schlussfolgerte Aiden. Mac hatte
ein Gespür für Unwahrheiten. Alle, die mit ihm zusammenar-
beiteten, hatten schnell, und manchmal auf die harte Tour, ge-
lernt, Mac niemals anzulügen.
»Jeder lügt, wenn er mit der Polizei spricht«, hatte er einmal
zu ihr gesagt.
»Hast du noch irgendetwas Wichtiges entdeckt?«, fragte er sie.
Als sie die Lobby betraten, zog Aiden ein kleines Plastikdö-
schen aus der Jackentasche und reichte es Mac. Er hielt es hoch
ins Licht, um sich den Inhalt anzusehen.

»Was ist das?«
»Sechs kleine Papierfetzen. Weiß. Wie Konfetti. Hab sie auf
dem Teppich vor Louisa Cormiers Wohnungstür gefunden.«

5
Auf dem Tisch vor Stella und Flack lagen das Pillenfläschchen,
das Badezimmerfenster und das Glas aus dem Hotelzimmer, in
dem Alberta Spanio ermordet worden war.
Stella hatte die Beweismittel auf Fingerabdrücke untersucht.
Saubere Abdrücke fanden sich nur auf dem Glas und dem Pil-
lenfläschchen. Auf dem Badezimmerfenster hatten sie keine
Abdrücke gefunden, aber Stella hatte das Fenster nicht deshalb
mitgenommen. Was sie wollte, waren vor allem vernünftige
Antworten.
»Das ist die Außenseite des Fensters. Siehst du das Loch?«,
fragte sie Flack.
Sie deutete auf eine Stelle des Fensters. Es war kaum zu ü-
bersehen. Ein zweieinhalb Zentimeter langer Einschnitt in der
Form eines Kometen und der Farbe unbehandelten Holzes.
»Ich habe die Innenseite des Lochs untersucht«, sagte sie.
»Es sind Gewindespuren. Etwas ist in dieses Fenster ge-
schraubt und herausgerissen worden, und diese Schramme ist
zurückgeblieben.« Stella hatte einen Abdruck angefertigt, auf
dem gleichmäßige, kleine Riefen zu sehen waren.
Danny Messer, bekleidet mit einem weißen Laborkittel, kam
herein und hielt zwei Objektträger in der Hand. Er reichte sie
Stella und sagte: »Das sind die Proben, die ich aus dem
Schraubenloch des Fensters gekratzt habe. Bitte sehen Sie sich
das an.«
Stella legte den ersten Objektträger unter das Mikroskop
und untersuchte ihn, als Danny bereits fortfuhr: »Das ist Eisen-
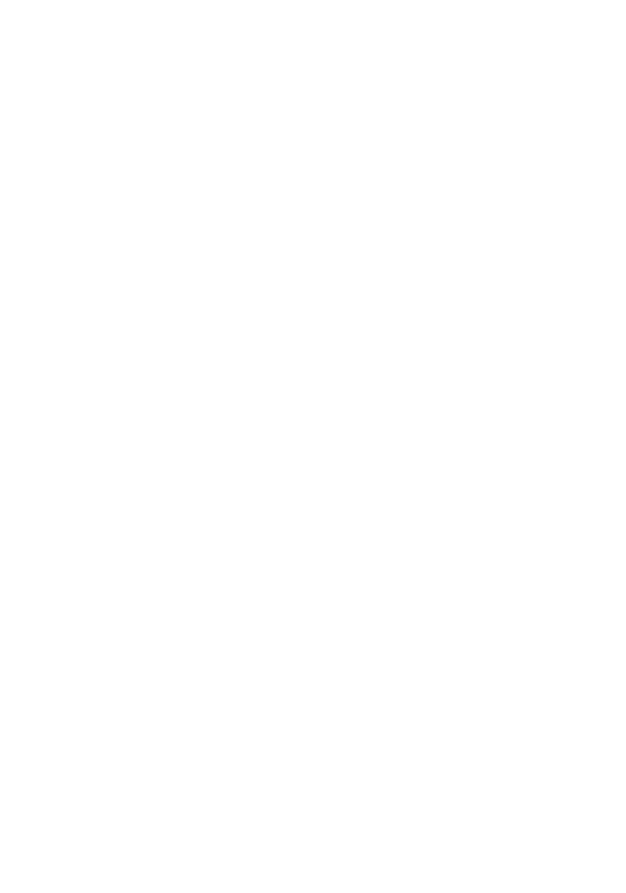
oxid. Ganz eindeutig. Was auch immer da eingeschraubt war,
war aus Eisen und so gut wie neu.«
Stella ging zur Seite, um Flack einen Blick auf die Probe zu
gewähren. Er sah durch das Mikroskop und erkannte kleine
dunkle Splitter, die sich in unspezifischer Anordnung über den
Objektträger verteilten. Als er sich wieder von dem Mikroskop
entfernte, legte Stella den zweiten Objektträger ein, auf dem
die Probe aus dem Raum über Alberta Spanios Zimmer zu se-
hen war. Ein paar Sekunden betrachtete sie die Probe, dann
machte sie Platz für Flack. Weitere Splitter, aber diese sahen
anders aus als die auf dem ersten Objektträger.
»Stahl«, erklärte Danny. »Das sind die Partikel, die Detecti-
ve Flack entnommen hat, und zwar aus den Riefen des Fensters
über Alberta Spanios Badezimmer. Die Proben passen nicht
zusammen.«
»Und was sagt uns das?«, fragte Flack.
»Nichts weiter, nur, wer immer das Stahlding aus dem Fens-
ter gehängt hat, ließ etwas Schweres daran baumeln, denn sonst
wären nicht solche Kerben entstanden.«
»Ein Kind?«, fragte Flack.
»Jemand hat ein Kind zu dem Fenster runtergelassen, damit
es einbricht und Alberta Spanio ein Messer in den Hals
rammt?«, fragte Stella.
»Ich habe auf der Straße schon Kinder kennen gelernt, die
so etwas für ein paar Hundert Dollar erledigen würden«, gab
Flack zurück. »Aber vielleicht war es ja auch eine Frau –
dünn, vielleicht von Drogen ausgezehrt und bereit, ihr Leben
zu riskieren, um sich Geld für weitere Drogen zu beschaf-
fen.«
»Wie wäre es damit?«, fragte Danny. »Jemand lässt eine
Kette mit einem Haken aus dem Fenster über Spanios Bade-
zimmer gleiten. Der Haken passt genau in einen anderen Haken
oder Ring, der in Spanios Badezimmerfenster eingeschraubt

ist. Er zieht das Fenster hoch, und zwar so heftig, dass sich der
Haken löst und dieses Loch hinterlässt.«
»Und dann ist jemand an der Kette runtergeklettert?«, fragte
Flack.
»Möglich«, gab Danny zu. »Oder es wurde eine andere Per-
son hinuntergelassen.«
»An einer Stahlkette runterzuklettern ist verdammt gefähr-
lich.« Flack schüttelte den Kopf.
»Vor allem in einem Schneesturm«, stimmte ihm Danny zu.
»Und um sich dann auch noch durch ein Fenster zu schwin-
gen.« Flack überlegte die Möglichkeiten. »Einem Kind oder
einem Junkie dürfte das ziemlich schwer fallen.«
Stella fühlte sich schwach und müde. Sie wollte am liebsten
ihren Kopf auf den Tisch legen und eine Stunde schlafen. Doch
stattdessen sagte sie: »Gehen wir noch einmal hin und sehen
uns etwas genauer den Raum über Spanios Badezimmerfenster
an.«
Ausgebreitet auf dem Edelstahltisch vor Dr. Sheldon Hawkes
lag der Leichnam von Charles Lutnikov. Von einer Stelle, kurz
unter dem Hals des Toten bis knapp über seinen Bauch hinaus,
befand sich ein sauberer Schnitt. Der durch den Schnitt ent-
standene Gewebelappen war umgeschlagen und hing dunkelrot
über den frei gelegten Rippen.
Der Brustraum war aufgebrochen, und die Eingeweide lagen
offen vor ihm. Das Licht über der Leiche vertrieb jeden Schat-
ten und offenbarte den Verlauf des Dickdarms, der Knochen
und Arterien.
Die Raumluft fühlte sich nach Macs Empfinden etwas küh-
ler an als üblich, was ihm nur recht war. Das Aroma, von was
auch immer der tote Mann heute Morgen oder in der Nacht zu-
vor gegessen hatte, trieb durch den Raum. Mac sah Hawkes an,
der beide Hände auf den Tisch gelegt hatte.

»Der Mann hatte eine Pizza zum Frühstück«, sagte Hawkes.
»Fleischkloß, Aubergine und Zwiebel.«
»Interessant.«
»Wir fangen mit den einfachen Sachen an«, sagte Hawkes.
»Was wissen wir über unseren Mann?«
»Seine Fingerabdrücke wurden in der Datenbank des Mili-
tärs gefunden«, berichtete Mac. »Lutnikov hat vier Jahre bei
der Militärpolizei der United States Army gedient. Und er hat
im ersten Golfkrieg gedient. Purple Heart.«
Hawkes deutete auf eine Narbe am Bein des Toten, gleich
oberhalb des Fußgelenks.
»Vermutlich eine Landmine«, sagte er. »Da sind immer
noch ein paar Fragmente von dem Schrapnell. Der Arzt, der ihn
operiert hat, wird vermutlich beschlossen haben, sie dort zu
lassen, um nicht bei der Entfernung noch mehr Traumen auszu-
lösen. Wahrscheinlich eine gute Entscheidung.«
»Was ist mit dem Schuss, der ihn umgebracht hat?«
Hawkes beugte sich vor und schloss die linke Seite des
Brustkorbs, als würde er ein Buch zuklappen.
»Die Wunde, die ihn getötet hat, stammt von einer Pistole.
Ein kleines Kaliber, vermutlich eine .22er. Die Kugel ist beina-
he senkrecht ins Herz eingedrungen. Er hat direkt vor dem
Schützen gestanden, der entweder genau gewusst hat, worauf
er oder sie zielen musste, oder verdammt viel Glück gehabt
hat.«
Mac nickte und beugte sich ebenfalls vor, um die Wunde zu
untersuchen.
»Aiden hat einen Blutstropfen vom Boden des Fahrstuhls
untersucht. Das Blut aus der Wunde ist einen Meter siebenund-
dreißig tief gefallen.«
»Der Tote ist knapp ein Meter achtzig«, sagte Hawkes.
»Das bedeutet, dass Lutnikov gestanden haben muss, da die
Kugel senkrecht eingedrungen ist«, stellte Mac fest.

»Und …?«
»Falls der Schütze mit der Waffe in der Hand auch stand …«,
fuhr Mac fort.
»Dann war der Schütze etwa ein Meter fünfundfünfzig bis
ein Meter achtundfünfzig groß«, übernahm Hawkes. »Willst du
etwas über den Weg wissen, den die Kugel genommen hat?«
Mac nickte.
»Die Kugel ist durch das Herz gegangen, abgebogen, hat ei-
ne Rippe getroffen, kehrtgemacht und ist nur einige Zentimeter
von der Eintrittswunde entfernt wieder rausgekommen.«
Wie ein Magier zauberte Hawkes einen dünnen, biegsamen
Metallstab zur Untersuchung des Schussverlaufs herbei und
führte ihn in die Eintrittswunde. »Wie ich bereits sagte, ist sie
direkt von vorn eingedrungen, was ihr durch die Verteilung der
Blutspritzer bestätigen könnt.«
Hawkes ergriff einen zweiten Metallstab, den er in einem
scharfen, aufwärts gerichteten Winkel in die Austrittswunde
einführte, und demonstrierte damit den Verlauf der Kugel.
Als Hawkes damit fertig war, zog er die Stäbe wieder heraus
und fragte: »Ihr habt keine Kugel gefunden?«
»Bisher nicht«, gestand Mac. »Hast du noch etwas für uns?«
Hawkes griff unter den Tisch und zog einen kleinen, durch-
sichtigen, wieder verschließbaren Plastikbeutel hervor und ü-
berreichte ihn Mac. Der hielt ihn hoch und sah Hawkes an.
»Stammt aus Wunde eins«, sagte Hawkes. »Kleine Fetzen
blutverschmierten Papiers.«
»Aiden hat ähnliche Fragmente am Tatort gefunden. Die
Kugel muss durch Papier gegangen sein, bevor sie Lutnikov
getroffen hat.«
»Durch eine Menge Papier«, verbesserte Hawkes. »Wenn
wir davon ausgehen, dass ein Teil des Papiers sofort verbrannt
ist, dann sind anscheinend immer noch genügend Fetzen übrig
geblieben, die von Aiden und mir gefunden werden konnten.«

»Ein Buch?«, fragte Mac.
»Das musst du beantworten«, sagte Hawkes und öffnete den
Brustkorb wieder. »Aber auf einigen dieser Fragmente sind Tinten-
spuren zu sehen. Oh, ja, Lutnikovs Blut und die Probe, die ihr vor
Louisa Cormiers Appartement entnommen habt – Volltreffer.«
Fünf Minuten später klingelte Mac Taylors Mobiltelefon. Mac
beugte sich gerade über Aidens Schulter, während sie im Labor
die blutigen Papierfragmente unter dem Mikroskop untersuchte.
»Taylor«, sagte er.
»Mr Taylor, Wanda Frederichson noch einmal. Tut mir
Leid, Sie stören zu müssen, aber ich habe im Büro mit Mr
Melvin gesprochen, und er sagt, Montag ist unmöglich. Wir
werden keine Mannschaft zusammenstellen können, um den
Schnee zu räumen, und die Fahrwege werden …«
»Was, wenn jemand stirbt?«, entgegnete Mac.
Aiden blickte von ihrem Mikroskop auf. Mac trat zurück
und ging quer durch den Raum.
»Pardon?«
»Was tun Sie, wenn zwischen heute und Montag jemand
stirbt?«, fragte Mac.
»Wollen Sie wirklich …?«
»Ja.«
»Wir kühlen die Leiche.«
»Was ist mit den Juden?«, hakte Mac nach.
»Juden?«
»Sie müssen ihre Toten in einer Zeitspanne von ein oder
zwei Tagen beerdigen, nicht wahr?«
»Um derartige Fragen kümmert sich unser jüdischer Ge-
schäftsführer, Mr Greenberg«, sagte sie.
»Ich würde gern mit Mr Greenberg sprechen«, sagte Mac.
»Bitte, Mr Taylor«, entgegnete Wanda Frederichson in ge-
duldigem Ton. »Ich weiß …«

»Detective Taylor«, korrigierte er. »Haben Sie die Nummer
von Mr Greenberg?«
»Ich kann Sie mit ihm verbinden«, erwiderte sie mit einem
Seufzen.
»Danke«, sagte Mac und sah sich zu Aiden um, die so tat,
als höre sie nicht zu.
Ein Doppelklingeln, dann noch ein Doppelklingeln und die
Stimme eines Mannes ertönte. »Arthur Greenberg, kann ich Ih-
nen helfen?«
Mac erklärte ihm die Situation, und Greenberg hörte
schweigend zu.
»Lassen Sie mich mal nachsehen«, bat Greenberg. »Ich
brauche ein paar Sekunden, um auf meine Daten im Computer
zugreifen zu können. Normalerweise wäre ich am Sabbat gar
nicht hier, aber wir hatten einen … Sehen wir mal. Wir hatten
nie … Ja. Mr Taylor, ich sehe mir gerade den Sachverhalt in
Ihrer Angelegenheit an. Wir kriegen das hin.«
Mac gab Greenberg die Nummer seines Mobiltelefons,
dankte ihm, klappte das Telefon zu und ging zu Aiden zu-
rück.
Sie blickte zu ihm auf, offenbarte ihre Neugierde, aber er
ignorierte sie.
»Was haben wir?«, fragte er stattdessen.
»Alles in Ordnung?«
»Bestens«, antwortete er. »Was haben wir?«
»Was wir nicht haben, ist eine Waffe oder eine Kugel«, sag-
te sie. »Was wir haben, sind einige Partikel eines Materials für
den gehobenen Anspruch: weißes Hartpostpapier, A4-Format,
80g/m
2
, säurefrei, nicht löschbar. Das stimmt mit dem Papier in
Lutnikovs Appartement überein.«
»Und auf einem Teil des Papiers, das Hawkes gefunden hat,
war Tinte. Was ist mit den Papierfragmenten, die du vor Louisa
Cormiers Appartement entdeckt hast?«

Aiden nickte und sagte: »Stimmt überein. Das beweist nicht,
dass sie ihn erschossen hat, aber es deutet darauf hin, dass der
tödliche Schuss vor Louisa Cormiers Fahrstuhltür abgefeuert
wurde. Aber es gibt viele Möglichkeiten, wie diese sechs
Fragmente auf den Teppich in Louisa Cormiers Foyer gekom-
men sein könnten. Sogar wir hätten sie unter unseren Sohlen
dorthin tragen können.«
»Nein«, sagte Mac.
»Nein«, stimmte Aiden zu.
»Aber«, sagte Mac, »ein guter Anwalt …«
»Und Louisa Cormier kann sich den besten leisten«, fügte
Aiden hinzu.
Mac nickte. »Ein guter Anwalt könnte einen ganzen Haufen
Erklärungen finden. Sieh mal, ob du eine Übereinstimmung
zwischen diesen Tintenspuren und Lutnikovs Schreibmaschine
findest.«
Einige Sekunden stand er schweigend da, ehe er erneut das
Wort ergriff.
»Wie groß, denkst du, ist Louisa Cormier?«
Aiden blickte auf, dachte einen Augenblick nach und sagte:
»Vielleicht ein Meter achtundfünfzig. Warum?«
Ehe er antworten konnte, sagte sie: »Die Blutspritzer.«
»Die Blutspritzer«, bestätigte er und erzählte ihr von seinem
Gespräch mit Sheldon Hawkes und von seinen Erkenntnissen.
»Lutnikov hat das Papier getragen, als auf ihn geschossen
wurde. Die Kugel ging durch das Papier, das er an seine Brust
gepresst hatte.«
»Zum Schutz?«, fragte Aiden.
»Vor einer Kugel?«, fragte Mac.
»Das war alles, was er hatte.«
»Vielleicht hat er aber auch versucht, das zu schützen, was
er geschrieben hat«, wandte Mac ein. »Vielleicht wurde er des-
halb umgebracht.«

»Wo ist dann das, was er geschrieben hat?«, fragte sie.
»Und wo ist die Kugel …?«
»Und die Waffe«, fügte Mac hinzu. »Du weißt, was wir als
Nächstes tun müssen.«
Aiden erhob sich.
»Ich ziehe meinen Mantel an, bahne mir einen Weg durch
den kalten Norden und komme mit einem Farbband aus einer
Schreibmaschine zurück.«
»Und …«, fing Mac an.
»Weiteren Papierproben aus Lutnikovs Appartement«, be-
endete sie den Satz. »Proben von beschriebenem Papier.«
»Nimm einen Staubsauger mit«, sagte Mac, »und such noch
einmal den Boden in jedem Stockwerk vor dem Fahrstuhl ab.«
»Das haben wir doch schon getan.«
»Aber jetzt wissen wir, wonach wir suchen müssen.«
Aiden nickte. »Die Mordwaffe, die Kugel und was immer
Lutnikov an seine Brust gepresst hielt, als er erschossen wurde,
und …«
»Ein Motiv«, sagte Mac.
»Ich mache mich besser auf den Weg.«

6
Das Zimmermädchen hatte bestätigt, dass das Bett von dem
Mann, der das Hotelzimmer für die Nacht gemietet hatte, nicht
benutzt worden war und sie es deshalb an diesem Morgen nicht
beziehen musste. Während Danny Messer auf allen vieren über
den Boden krabbelte, untersuchte Stella Bonasera das Bett, bis
sie überzeugt davon war, dass dieser Mann höchstwahrschein-
lich noch nicht einmal darauf gesessen hatte.
Die beiden Ermittler hatten die wenigen Möbelstücke in
dem Raum genau unter die Lupe genommen – Bett, Stuhl, ei-
nen kleinen Tisch, einen Schrank mit drei Schubladen, auf dem
ein kleiner Farbfernseher stand, Kleiderschrank, und sogar die
Kleiderstange und die Innenwände des Kleiderschranks. Aber
sie hatten nichts gefunden.
Stella ging zum Fenster.
Don Flack hatte die übrigen Hotelangestellten befragt, auch
den Portier, der am Vortag, als Wendell Lang sich eingecheckt
hatte, seinen Dienst angetreten war. Der Mann hatte im Voraus
bezahlt und zweihundert Dollar extra draufgelegt, für Telefon
oder die Getränke aus der Minibar. Aber er hatte keine Anrufe
getätigt, auch nichts aus der Bar genommen und sich auch
nicht seine zweihundert Dollar zurückgeholt. Er hatte sich ein-
fach elektronisch abgemeldet und war verschwunden. Deshalb
war der Portier auch nicht im Stande gewesen, ihnen eine aus-
reichende Personenbeschreibung zu liefern.
»Es hat gestürmt«, hatte er Flack erzählt. »Er hatte seinen
Hut tief ins Gesicht gezogen und einen Schal um das Kinn ge-

wickelt. Er war groß, das kann ich Ihnen sagen. Sehr groß.
Mindestens hundertzehn Kilo, wahrscheinlich noch ein gutes
Stück mehr. Der andere Mann war klein. Sehr klein.«
»Der andere Mann?«, fragte Flack.
»Ja«, sagte der Portier. »Ich denke, die gehörten zusammen.
Der andere Mann ist im Hintergrund geblieben, hatte die Hän-
de in den Manteltaschen. Hatte den Kragen hochgeschlagen
und einen dieser alten Hüte auf, den er tief ins Gesicht gezogen
hatte.«
»Aber dieser Wendell Lang, der den Raum gemietet hat, hat
nur sich selbst eingetragen? Nur eine Person?«, hakte Flack
nach.
»Ja, aber das war nicht wichtig. Der Preis für das Zimmer
bleibt gleich, egal, ob es einfach oder doppelt belegt ist. Es ist
ein Einzelzimmer. Ein Bett. Sie waren ein komisches Paar, ei-
ner riesig, der andere klein.«
Einer, der nicht viel wog, und einer, der das Gewicht eines
kleinen Mannes am Ende einer Stahlkette hätte halten können,
überlegte Don. Er war sofort zurück in das Zimmer gegangen
und hatte Stella davon berichtet. Sie nickte anerkennend und
arbeitete weiter.
Stella untersuchte den Fenstersims, auf dem Don Flack die
Probe von dem Stahlspan gefunden hatte. Sie verteilte Puder
auf der Innenseite des Fensters und auf dem Griff, um nach
Fingerabdrücken zu suchen. Dann öffnete sie das Fenster. Sie
beugte sich hinaus in die eisige Luft und pinselte auch die Au-
ßenseite des Fensters ein. Danach zog sie die Klebebänder mit
den Spuren der Fingerabdrücke wieder ab und schloss das
Fenster.
»Ich werde den Teppich entfernen müssen«, sagte Danny,
der noch immer auf dem Boden kniete. Stella drehte sich zu
ihm um. Danny, der sich die Hände rieb, blickte auf, als würde
er beten.
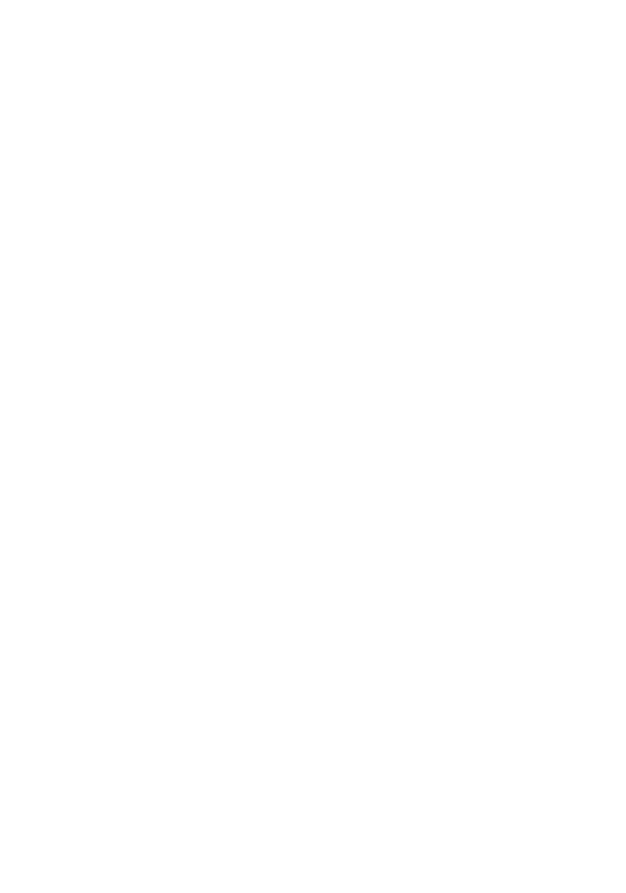
»Mach das«, sagte sie.
Danny nickte, stand auf, ging zu seinem Werkzeugkoffer,
der an der Wand neben der Tür stand, zog einen Hammer
heraus und machte sich an die Arbeit. Weder er noch Stella
rechneten damit, unter dem Teppich etwas zu finden, aber
sie suchten nach etwas Besonderem – oder zumindest nach
einem Beweis, der verriet, dass das, was sie suchten, nicht
existierte.
»Ich werde ins Labor zurückfahren, um die Fingerabdrücke
zu überprüfen. Außerdem werde ich versuchen, herauszufin-
den, was genau die Kerbe in der Fensterbank verursacht hat.«
Dann wandte sie sich an Flack. »Willst du mitkommen?« Flack
lehnte ab und sagte, er wolle zunächst alle Spuren im Hotel
weiterverfolgen.
Danny nickte Stella zu. In seiner Hand hielt er bereits den
Hochleistungssauger, der die Beweisspuren nicht in einem
normalen Staubbeutel auffing, sondern in einem sterilen Ein-
wegplastikbeutel. Der Raum war nicht groß. Stella wusste, dass
er, wenn er Glück hatte, nicht mehr als eine Stunde brauchen
würde, um den Teppich herauszulösen. An einem normalen
Tag würde er danach wohl die Zeit haben, nach Hause zu ge-
hen und eine Dusche zu nehmen, aber der Schnee und der
schwerfällige Verkehr würden ihn heute mindestens eine wei-
tere Stunde kosten.
Als der erste Streifen Teppich abgezogen wurde und eine
Sammlung toten Ungeziefers einschließlich einer platt ge-
drückten schwarzen Kakerlake zum Vorschein kam, sagte Stel-
la: »Ruf mich an, wenn du mehr weißt, egal was.«
»Genau«, grunzte er.
Aiden und Mac trafen im Whitney’s im Village auf eine höchst
aufgewühlte Ann Chen. Sie war nicht schwer auszumachen.
Die Asiatin betrat das fast leere Kaffeehaus kurz nach ihnen.

Als sie zur Tür hereinkam, blickte sie sich um und sah die
beiden C.S.I.-Ermittler in der Ecke an einem Tisch. Vor beiden
stand jeweils ein Becher Kaffee. Mac hielt eine Hand hoch,
und Ann Chen antwortete mit einem Nicken. Sie nahm die
Wollmütze ab und zog den Mantel aus. Ein großer, weißer
Wollsweater mit Rollkragen kam zum Vorschein. Sie legte
Mantel und Mütze auf den freien Platz neben Aiden.
»Kaffee?«, fragte Mac.
»Espresso, doppelt«, erwiderte sie.
Ohne seinen Platz zu verlassen, bestellte Mac bei dem jun-
gen Mann, der nicht weit entfernt hinter dem Tresen bediente.
Ann Chen war dünn, etwa dreißig, hübsch, aber nicht schön.
Außerdem war sie offensichtlich nervös und rutschte immer
wieder auf ihrem Stuhl herum.
»Normalerweise schlafe ich am Wochenende länger«, sagte
sie, »es sei denn, Louisa braucht mich.«
»Braucht sie Sie oft am Wochenende?«
»Eigentlich nicht«, sagte Ann. »Mr Lutnikov ist wirklich
tot?«
»Kannten Sie ihn?«, fragte Aiden.
Ann zuckte mit den Schultern, als der junge Mann ihr den
doppelten Espresso servierte. Mac reichte ihm drei Dollarno-
ten.
»Ich bin ihm manchmal im Haus oder draußen begegnet«,
sagte Ann und umfasste den Becher mit ihren schlanken Fin-
gern.
»Ist er je vor Ms Cormiers Appartement aufgetaucht?«
Ann blickte zu Boden und sagte: »Ich muss Ihnen sagen,
dass ich mich mit dieser Sache nicht wohl fühle. Louisa war
immer so gut zu mir, dass … ich fühle mich einfach nicht wohl
dabei.«
»Hat sie Sie heute Morgen angerufen?«, fragte Mac.
Ann nickte.

»Sie hat gesagt, ich solle damit rechnen, dass sich die Poli-
zei bei mir meldet. Dann haben Sie angerufen.«
»Hat sie Sie gebeten, uns irgendetwas nicht zu erzählen?«,
fragte Mac.
»Nein«, sagte Ann mit Nachdruck.
»Was tun Sie für Louisa?«, erkundigte sich Aiden.
»Korrespondenz, ich arrangiere Interviews für Radio und
Fernsehen und für die Printmedien. Außerdem plane ich Auto-
grammstunden und Tourneen«, erklärte Ann. »Und ich küm-
mere mich um die Bezahlung ihrer Rechnungen und beantwor-
te die E-Mails, die auf der Homepage eingehen.«
»Sie arbeiten nicht an ihren Manuskripten?«, hakte Mac
nach.
»Doch, wenn sie fertig sind. An manchen Tagen komme ich
in ihr Appartement und sie sagt so etwas wie ›Das Neue ist fer-
tig.‹ Dann gibt sie mir eine Diskette, und ich lege sie an den
Computer, der sich im hinteren Bereich der Wohnung befindet,
noch hinter der Küche. Dann fange ich an, den Text zu redigie-
ren. Normalerweise sind die Manuskripte aber ziemlich gut, al-
so gibt es nicht viel zu tun. Trotzdem ist es aufregend, die erste
Person zu sein, die einen neuen Krimi von Louisa Cormier zu
lesen bekommt.«
»Und dann?«, fragte Aiden.
»Dann sage ich Louisa, dass ich fertig bin und dass mir das
Buch sehr gefällt, weil das immer so ist.«
»Und wie reagiert sie?«, fragte Mac.
»Meistens lächelt sie und sagt: ›Danke, meine Liebe‹, oder
so was in der Art und nimmt die Diskette wieder an sich«.
Nach kurzem Zögern fügt sie hinzu: »Ich habe in Bennington
Englisch im Hauptfach studiert.«
Ann Chen nahm einen weiteren Schluck Kaffee. »Und ich
habe selbst zwei Romane verfasst. Ich habe die letzten drei
Jahre damit verbracht, mir zu überlegen, ob ich Louisa bitten

soll, sie zu lesen. Womöglich gefallen sie ihr nicht. Oder sie
könnte denken, ich hätte den Job bei ihr nur angenommen, um
meiner eigenen Karriere als Schriftstellerin auf die Sprünge zu
helfen. Ich habe ein paarmal versucht, ihr einen Hinweis zu ge-
ben, dass ich selbst auch gern schreiben würde, aber sie ist
nicht darauf eingegangen.«
»Wie groß sind Sie?«, fragte Aiden.
Ann sah verwundert aus.
»Wie groß? Etwa ein Meter achtundfünfzig.«
»Hat Ms Cormier eine Waffe?«, wollte Mac wissen.
»Ja, ich habe eine in ihrer Schreibtischschublade gesehen«,
sagte Ann. »Das Einzige, was mir an der Arbeit für Louisa
wirklich zu schaffen macht, sind die vielen Verrückten, die hier
herumlaufen. Sie glauben gar nicht, was die Fans ihr schreiben.
Sie schicken E-Mails oder Geschenke mit Grußkarten und er-
zählen ihr, sie würden sie lieben, und wollen, dass sie Knob-
lauch an den Fenstern anbringt, um außerirdische Eindringlinge
zu vertreiben, und so was in der Art. Das mit dem Knoblauch
und den Außerirdischen hat wirklich jemand geschrieben. Das
habe ich mir nicht ausgedacht.«
»Können Sie uns sonst noch etwas über Louisa erzählen?«,
fragte Aiden.
»Zum Beispiel?«
»Irgendetwas.«
»Sie geht jeden Morgen spazieren, bei Wind und Wetter«,
sagte Ann und überlegte. »Wenn sie an einem Buch arbeitet,
schließt sie sich manchmal in der letzten Arbeitswoche ein und
kommt gar nicht mehr raus.«
»Sie kümmern sich um ihr Bankkonto?«
»Die Konten, richtig.«
»Hat sie je größere Summen in bar abgehoben?«, fragte Aiden.
»Ja, wenn sie ein Buch beendet hat, hebt sie fünfzigtausend
Dollar von ihrem persönlichen Konto ab. In bar.«

»Was macht sie dann damit?«
»Sie spendet es den Wohltätigkeitsorganisationen, die ihr
am Herzen liegen«, sagte Ann Chen lächelnd. »Steckt es in
Briefumschläge und geht persönlich hin, um es unter der Tür
durchzuschieben. Bei der NAACP, der Heilsarmee, dem Roten
Kreuz.«
»Haben Sie beobachtet, dass sie so etwas tut?«, fragte Ai-
den.
»Nein. Nie. Sie hat das immer allein getan. Anonym.«
»Kümmern Sie sich um ihre Steuern?«
»Ja und nein«, antwortete Ann. »Mein Bruder hat einen
Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft von der NYU. Er un-
terstützt mich dabei.«
»Und«, hakte Aiden nach, »gibt sie ihre Spenden in der
Steuererklärung an?«
»Nein«, sagte Ann. »Ich habe sie gedrängt, es zu tun. Mein
Bruder hat gesagt, es sei idiotisch, das nicht zu tun, aber Louisa
weigert sich, ihre Spenden dafür zu benutzen, ihre Steuerlast zu
senken. Ich sage Ihnen, sie ist ein guter Mensch, aber ich glau-
be, Sie denken, sie könnte Mr Lutnikov ermordet haben.«
»Hat sie?«, fragte Mac.
»Nein«, entrüstete sich Ann. »Sie kommt dafür nicht mehr
infrage als ich selbst.«
»Also schön«, sagte Aiden. »Haben Sie Charles Lutnikov
getötet?«
»Was? Nein, warum sollte ich? Das ist wirklich alles, was
ich Ihnen sagen kann. Es gefällt mir nicht, mich Louisa gegen-
über wie eine Verräterin zu fühlen.«
Ann Chen erhob sich.
»Danke für den Kaffee«, verabschiedete sie sich, als sie in
ihren Mantel schlüpfte.
Kaum war sie fort, sagte Aiden: »Ich spreche mit der
NAACP und den Niederlassungen der Heilsarmee in der Um-

gebung von Louisa Cormiers Wohnung und erkundige mich,
ob irgendjemand Umschläge mit Bargeld unter ihren Türen
durchschiebt, wenn ein neues Buch von Ms Cormier er-
scheint.«
»Noch einen Kaffee?«, fragte Mac.
»Entkoffeiniert, halb Sahne, halb Milch, kein Zucker«, bat sie.
Mac bestellte Kaffee für sie und für sich selbst und zog ei-
nen Kunststoffbeutel aus seinem Koffer, der unter dem Tisch
stand. Während er seine Latexhandschuhe überstreifte, sah der
junge Mann hinter dem Tresen ihm staunend zu. Mac deponier-
te Anns benutzte Tasse in dem Beutel, versiegelte ihn und ver-
staute ihn in seinem Koffer.
»Sie sind von der Polizei, richtig?«, fragte der junge Mann,
als er ihren Kaffee brachte.
»Ja.«
»Cool«, antwortete Kellner.
»Wie viel kostet die Tasse?«, fragte Mac.
»Nichts, es merkt so oder so keiner, wenn die weg ist. Und
falls doch, sage ich, ein Gast hätte sie zerbrochen.« Der junge
Mann sah Aiden an. »Sind Sie auch bei der Polizei?«
»Bin ich«, bestätigte sie.
»Man weiß nie, wen man vor sich hat, was?«, sagte er und
verzog sich hinter seinen Tresen, als ein junges Paar lachend
zur Tür hereinkam.
Etwas mehr als eine Stunde später saß Danny neben Flack auf
dem Beifahrersitz und rückte seine Brille zurecht, während er
Stella anrief.
»Der Hotelmanager will wissen, wer den Teppich bezahlt«,
antwortete er.
»Sag ihm, er soll die Rechnung an die Stadt schicken«, ent-
gegnete sie.
»Das habe ich getan.«

Der Wagen hielt vor einer roten Ampel an, bog nach rechts
ab und blieb wenige Zentimeter von einem kleinen, weißen
Lieferwagen entfernt stehen. Der Fahrer sah Danny an. Er
schnappte nach Luft, weil er einen Zusammenstoß erwartet hat-
te, und nachdem das nicht passiert war, wurde er wütend.
Sogar durch das mit Eisblumen überzogene Fenster konnte
Danny den Mann in einer Sprache brüllen hören, die definitiv
skandinavisch klang. Don Flack zog gemächlich seine Briefta-
sche aus der Jackentasche, griff an Danny vorbei und hielt sei-
ne Marke an das Fenster. Er konnte sich den Anflug eines Lä-
chelns nicht verkneifen.
Der Skandinavier, der eine Rasur hätte vertragen können,
sah die Marke und wedelte mit der Hand, um deutlich zu ma-
chen, dass es ihm egal war, ob Flack ein Polizist, der Bürger-
meister, der Papst oder Robert DeNiro war.
»An dieser Ecke gibt es eine Videokamera«, sagte Flack und
steckte die Brieftasche wieder ein. »Ich schätze, jemand sollte
den Wikinger beruhigen, bevor es mit ihm durchgeht und je-
mand verletzt wird.«
Danny nickte.
»Danny?«, fragte Stella nervös, aber geduldig.
»Am Boden war nichts«, berichtete Danny. »Keine Löcher,
die größer waren als die, die ich verursacht habe, als ich die
Nägel herauszog.«
Das hatte Stella erwartet. Danny drückte auf eine Taste, um
ihre Stimme auf die Freisprechanlage umzuleiten, sodass Flack
ihr Gespräch mithören konnte. Dieser hatte in der Zwischenzeit
die Videoüberwachung über den rotgesichtigen Wikinger in-
formiert, der, kaum dass die Ampel umgeschaltet hatte, aufs
Gas getreten war. Flacks Wagen hatte er dabei nur um Haares-
breite verfehlt und fuhr nun im Zickzack vor ihnen her.
»Die Fingerabdruckanalyse hat uns einen Treffer geliefert«,
hörten sie Stella sagen. »Steven Guista alias Big Stevie, frühere

Festnahmen wegen diverser Delikte von Einschüchterung über
tätlichen Angriff bis hin zu Mord. Zwei Verurteilungen, für die
er im Gefängnis gesessen hatte. Eine wegen Meineids, eine
wegen Erpressung. Offiziell arbeitet er als LKW-Fahrer für
Marco’s Bakery, deren Eigentümer …«
„… Darius Marco heißt«, beendete Danny den Satz.
»Der Bruder von Anthony Marco, gegen den Alberta Spanio
morgen hätte aussagen sollen«, fügte sie hinzu.
»Weiß Mac Bescheid?«, fragte Flack, während er langsam
weiterfuhr und zusah, wie sich der Wikinger in dem Transpor-
ter rutschend der nächsten Ampel näherte.
»Ich will ihn jetzt anrufen.«
»Und was soll ich tun?«, wollte Danny wissen.
»Komm zurück und werde zu einem Kettenspezialisten.«
»Peitschen auch?«, fragte er spontan.
Sie legte auf.
Big Stevie saß in Toolie Prines Bar an der 9. Avenue und gur-
gelte mit einem kalten Sam Adams. Den weißen Buchstaben
am Fenster zufolge hieß die Bar Terry Malloy’s, benannt nach
der Rolle, die Marlon Brando in Stevies Lieblingsfilm gespielt
hatte. Offiziell gehörte die Bar Toolies Schwester, Patricia
Rhondov, weil Toolie als ehemaliger Strafgefangener keine Li-
zenz bekam. Offiziell war Toolie Barkeeper. Offiziell musste
er sich einmal in der Woche im Büro seines Bewährungshelfers
melden. Jeder, der das wusste, aber auch die, die es nicht wuss-
ten, nannten den Laden trotzdem Toolie Prines Bar.
Big Stevies Hinterteil ragte deutlich über den Barhocker
hinaus. Stevie war stark, das hatte er in den Genen. Er hatte nie
trainiert. Sein alter Herr war schon stark gewesen, hatte auf den
Docks gearbeitet. Stevie hätte Schauermann werden können
wie sein Vater. Dann wäre er jetzt Stevie, der Schauermann,
nicht einfach nur Big Stevie.
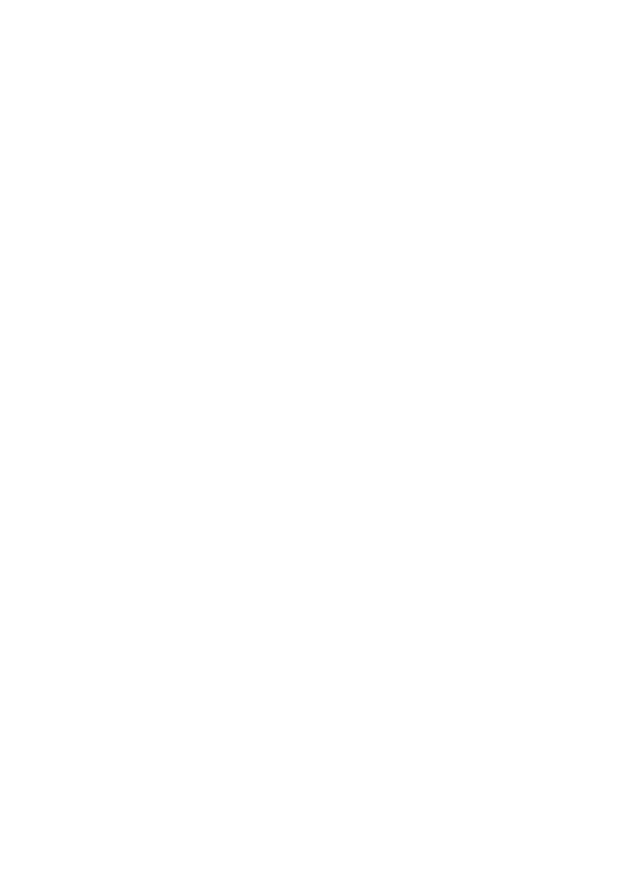
Außer Steve waren keine Gäste in Toolies Bar, doch er saß
gern allein im Dunkeln und beobachtete durch das Fenster die
Wagen und die Leute, die sich auf der Straße durch den Schnee
quälten.
Stevie war zufrieden mit sich. Er hatte den Job erledigt, der
ihm aufgetragen worden war. Es war leicht gewesen – bis auf
die Stelle, an der er beinahe aus dem Fenster gefallen wäre –,
und er hatte zehn Porträts von Benjamin Franklin in seiner
Brieftasche, ohne dass er vorher jemandem das Gesicht lädiert
oder das Knie gebrochen hatte. Aber er hatte sich vier Stunden
lang das Gejammer des Jockeys anhören müssen.
Jake, der Jockey, war kein schlechter Kerl, aber er war ein
Jammerlappen. Er jammerte über den Film im Fernsehen und
über die Größe des Apparats. Er jammerte über die Hitze im
Raum. Er jammerte über das Gyros, das sie gegessen hatten
und das, nach Stevies Empfinden, sogar besonders gut gewesen
war. Stevie hatte zwei Portionen verdrückt.
Der Job war gut gelaufen, und darum hatte Mr Marco ihm
heute freigegeben und morgen – Montag, Stevies Geburtstag –
auch. Er sollte irgendetwas tun, um das zu feiern, statt einfach
nur in Toolies Bar rumzusitzen und eimerweise Sam Adams in
sich hineinzuschütten. Aber er wusste einfach nicht, was ihm
Spaß machen könnte, abgesehen davon, Sandrine anzurufen
und ihr zu sagen, sie solle ihm ein Mädchen in sein Zweizim-
merappartement schicken, vorzugsweise Maxine. Er mochte
zierliche Mädchen. Vielleicht später, falls er bis dahin nicht zu
viel getrunken hatte.
Das Telefon klingelte, und Toolie hob ab. »Ja.«
Dann reichte Toolie das Telefon an Big Stevie weiter, der
ebenfalls »Ja« sagte.
Stevie lauschte aufmerksam.
»Verstanden«, sagte er dann und gab Toolie das Telefon zu-
rück.

Big Stevie hatte einen neuen Auftrag zu erledigen. Er fragte
sich, ob er für diese Art der Arbeit nicht allmählich ein biss-
chen zu alt wurde.
Morgen würde Big Stevie Guista einundsiebzig Jahre alt
werden.
Aiden Burn hatte in den Büros der NAACP und der Heilsarmee
angerufen. Bei NAACP hatte sie niemanden erreicht, aber es
gab eine Notfallnummer.
Sie rief die Notfallnummer an und geriet an eine Frau na-
mens Rhoda James, die sagte, sie hätte in dem Büro gearbeitet,
würde sich aber nicht an Spenden erinnern, die irgendwann in
den letzten vier Jahren anonym unter der Tür hindurchgescho-
ben wurden.
Bei der Heilsarmee wurde ihr Anruf sofort entgegengenom-
men. Ein Captain Allen Nichols sagte ihr, er erinnere sich vor al-
lem an eine Spende vor etlichen Jahren, es war ein Umschlag mit
einer Einhundertdollarnote gewesen, und man hatte ihn im Brief-
kasten entdeckt. Wie stets kurz vor Weihnachten landeten alle
Spenden, ob es nun ein paar Cent oder mehrere Tausend Dollar
waren, in einem großen Topf. Und sie waren alle anonym.
Aiden hatte Mac die Information zukommen lassen, ehe sie
zu Charles Lutnikovs Appartement zurückgekehrt war. Dort fo-
tografierte sie zunächst sämtliche Frontansichten von Lutni-
kovs Bücherregalen. Sie stand nah genug davor, um später Fo-
toabzüge im Format zwanzig auf fünfundzwanzig anfertigen zu
können, worauf sie alles würde lesen können.
Im Schlafzimmer blieb sie vor einem Regal stehen, in dem
in zwei Fächern völlig unberührte Bände standen. Es waren
ausschließlich Louisa Cormiers Bücher. Aiden legte die Kame-
ra weg und nahm eines mit dem Titel Ah, Mord
in die Hand.
Sie schlug es auf und sah sich das Titelblatt an. Louisa
Cormier hatte es nicht signiert. Sie überprüfte sämtliche Bü-

cher der Autorin und stellte sie wieder zurück, als sie fertig
war. Ihr Eindruck, das keines davon gelesen worden war, wur-
de bestätigt. Als sie in den Seiten von Ah, Mord
blätterte, kleb-
ten zwei Seiten an den Rändern noch zusammen. Weder Lutni-
kov oder sonst jemand hätte dieses Buch lesen können.
Aiden nahm ihr Notizbuch zur Hand und schrieb ihre Ent-
deckung auf. Eigentlich brauchte sie eine derartige Gedanken-
stütze gar nicht, aber es konnte auch nicht schaden, und es ent-
sprach außerdem den Dienstvorschriften.
Die Untersuchung von ein paar Dutzend anderer Bücher, die
sie willkürlich aus den vielen Hundert herausgriff, ergab, dass
diese wirklich gelesen worden waren. Hier waren die Einbände
abgenutzt, die Rücken eingerissen oder aufgelöst, Seiten durch
Kaffeeflecken verfärbt oder mit Toast- oder Doughnutkrümeln
übersät.
Nach den Bücherregalen widmete sich Aiden der Schreibma-
schine. Sie hob den grauen Metalldeckel hoch und beugte sich
vor, um das schwarze Farbband in Augenschein zu nehmen. Et-
wa ein Drittel des Bands befand sich auf der rechten Spule, und
zwei Drittel waren auf der linken. Das Band auf der rechten Spu-
le war das, was sie interessierte. Vorsichtig löste sie die Metall-
klammern, die die Spulen fixierten, und hob sie heraus.
Sie tütete das Farbband der Schreibmaschine ein, schloss ih-
ren Ausrüstungskoffer, sah sich ein letztes Mal im Raum um
und öffnete dann die Tür. Als sie sich unter dem Tatortabsperr-
band hinwegduckte, warf sie einen prüfenden Blick zurück –
dann zog sie die Tür hinter sich ins Schloss.
Mac saß im Labor, vor ihm lagen mehrere Stapel Dias und Ab-
züge von Fingerabdrücken, die aus dem Fahrstuhl gesichert
worden waren.
Für Mac hatten Fingerabdrücke eine große Bedeutung, und
waren mehr wert als DNS-Proben oder ein Geständnis. Er hatte

sie studiert, hatte Notizen über die Entwicklungsgeschichte
dieser Wissenschaft gesammelt und zu Hause in einem Akten-
schrank archiviert. Es waren Notizen, die er eigentlich zu ei-
nem Buch hatte verarbeiten wollen, doch von diesem Plan war
er an jenem Tag abgerückt, an dem seine Frau gestorben war.
Fingerabdrücke konnten schlicht und einfach nicht lügen.
Geschickte Kriminelle mochten versuchen, mit den Abdrücken
zu tricksen, aber Tatsache war: Es gab keine zwei identischen
Fingerabdrücke auf der Welt. Ein persischer Arzt hatte das be-
reits im 14. Jahrhundert herausgefunden, und wirklich niemand
hatte jemals zwei identische Fingerabdrücke gefunden. Selbst
eineiige Zwillinge, die sich sonst so verblüffend ähnlich sahen,
hatten unterschiedliche Fingerabdrücke. Mac hatte einmal eine
Predigt von einem Polizeikaplan gehört, der angedeutet hatte,
dass Gott diese mikroskopische Wahrheit geschaffen hatte, um
die Größe seiner Schöpfung zu demonstrieren. Über solche
Spekulationen machte sich Mac keine Gedanken. Für ihn war
nur wichtig, dass diese Tatsache existierte.
Im Jahr 1882 wurden in den Vereinigten Staaten von Gilbert
Thompson, einem Vermessungsbeamten in New Mexico, erst-
mals Fingerabdrücke benutzt, um die eigene Identität zu legi-
timieren. Er setzte seinen Fingerabdruck unter ein Dokument,
um Fälschungen vorzubeugen.
Und schon zu Mark Twains Zeiten auf dem Mississippi im
Jahr 1883, wurde ein Mörder anhand seiner Fingerabdrücke
überführt.
Doch die erste aktenkundige Identifikation eines Verbre-
chers im Jahr 1892 geht auf Juan Vucetich zurück, einen argen-
tinischen Polizeibeamten. Er identifizierte eine Frau namens
Rojas, die ihre beiden Söhne ermordet und sich selbst einen
Schnitt in die Kehle beigebracht hatte, um den Verdacht auf ei-
nen unbekannten Dritten zu lenken. Vucetich fand einen bluti-
gen Fingerabdruck von Rojas an einer Tür und entdeckte, dass

der Abdruck dort hinterlassen worden war, noch bevor sie sich
selbst verletzt hatte.
1897 wurde in Kalkutta in Indien, als das Land unter briti-
scher Regentschaft stand, das erste Fingerabdrucklabor einge-
richtet. Es arbeitete mit der Klassifikation, die von zwei indi-
schen Experten entwickelt wurde und bis heute benutzt wird.
1905, acht Jahre später, benutzte die Armee der Vereinigten
Staaten Fingerabdrücke, um ihre Soldaten zu identifizieren.
Navy und Marine Corps schlossen sich bald darauf an.
Heute setzt das FBI ein Computerprogramm ein, das mehr als
sechsundvierzig Millionen Fingerabdrücke von bekannten Ver-
brechern verwaltet. Es heißt AFIS: Automatisches-
Fingerabdruck-Identifikations-System. Jeder Staat hat seine eige-
ne Fingerabdruckdatei, und New York bildet da keine Ausnahme.
Nach drei Stunden stellte Mac abschließend fest, dass die
Fingerabdrücke von Ann Chen, Charles Lutnikov und Louisa
Cormier neben denen vieler anderer Personen überall in dem
Fahrstuhl verteilt waren, in dem Lutnikov getötet worden war.
Mac fragte sich, wann der Fahrstuhl das letzte Mal sorgfäl-
tig gereinigt worden war. Er bezweifelte stark, dass das in
jüngster Zeit stattgefunden hatte. Er betrachtete die Finge-
rabdrücke von Lutnikov und den beiden Frauen. Vielleicht er-
wies sich der Fahrstuhl als Sackgasse, aber da war immer noch
eine Mordwaffe, die darauf wartete, gefunden zu werden. Viel-
leicht hatten sie noch nicht an allen Stellen nachgesehen.
Mac setzte sich mit schmerzendem Rücken auf. Er versuch-
te, sich vorzustellen, wie die Rojas damals ihre Kinder ermor-
det und sich selbst in die Kehle geschnitten hatte. Doch dafür
reichte seine Fantasie nicht aus. Aber wie Juan Vucetich die
Fingerabdrücke gefunden hatte, sah er klar vor sich.
Das war ein Moment der forensischen Geschichte, den Mac
zu gern miterlebt hätte.

»Kein Problem«, sagte der Mann, der am Tresen im Woo
Ching’s an der Second Avenue an seinem Kaffee nippte.
Seine Frühlingsrolle, von der er nur zweimal abgebissen
hatte, lag vor ihm. Er war nicht hungrig. Rechts von ihm saß
eine Frau, nicht alt, nicht jung, einst schön, jetzt immer noch
gut aussehend mit kurzem, platinblondem Haar. Sie war
schlank, sehr gepflegt und trug eine pelzgefütterte Lederjacke
und eine Pelzmütze. Sie hatte ein paarmal an dem grünen Tee
genippt, den sie bestellt hatte.
Es war elf Uhr morgens an einem Sonntag, zu kalt für Lauf-
kundschaft, abgesehen von den wenigen, die bei einem Kaffee
oder einem Tee, einer Wan-Tan-Suppe oder einem Teller Ei
»Foo-Yung« Zuflucht vor dem Wetter suchten.
Folglich waren die einzigen anderen Gäste drei Frauen, die
in einer Nische am Fenster saßen.
Der Mann hatte nicht gewusst, wer ihn treffen und mit ihm
reden wollte, er hatte nur gewusst, dass er ins Woo Ching’s ge-
hen und dort etwas essen sollte. Als sie schließlich eingetreten
war, hatte er sie erkannt.
»Details«, sagte sie, wärmte ihre Hände an der Tasse und igno-
rierte die kleine Schale mit gebratenen Nudeln, die vor ihr stand.
Lächelnd schüttelte er den Kopf, doch in dem Lächeln lag
keine Spur von Fröhlichkeit.
»Was ist denn so lustig?«, fragte sie.
Sie hatten einander nicht direkt angesehen, und sie würden
es auch während ihrer weiteren Konversation nicht tun. Sie war
fünf Minuten, nachdem er bestellt hatte, eingetroffen, hatte ihm
gegenüber Platz genommen und ihren Tee bestellt.
»Schnee«, sagte der Mann.
»Was ist an Schnee lustig?«, fragte sie und warf einen Blick
zur Uhr.
Er erklärte ihr, wie der Schnee ein Problem hervorgerufen
hatte, mit dem sie nicht gerechnet hatten.

»Aber es geht in Ordnung?«, fragte sie.
»Es wird in Ordnung gehen«, sagte er, streckte die Hand
nach seinem gebratenen Reis mit Schweinefleisch aus, dann
überlegte er es sich noch einmal und widmete sich wieder der
Frühlingsrolle. »Das restliche Geld.«
»Hier«, sagte sie, zog einen dicken Umschlag aus der Hand-
tasche und schob ihn über den Tresen in seine Richtung. Er war
ein Profi, und er hatte alles aufs Spiel gesetzt – sein Leben und
die Sicherheit seiner Familie.
Sie erhob sich, zog ein paar Dollar aus der Jackentasche und
suchte einen Fünfdollarschein heraus. Dann legte sie ihn neben
ihre Teetasse und ging zur Tür. Der Mann sah ihr nicht nach.
Er wartete, bis er hörte, wie die Tür ins Schloss fiel, ehe er sich
hastig umsah und dabei so tat, als würde er die Frauen in der
Nische und den Verkehr vor dem Fenster mustern. Zufrieden
stellte er fest, dass er nicht beobachtet wurde, und plötzlich
fühlte er sich hungrig. Schnell schlang er den Rest seiner Früh-
lingsrolle mit großen Bissen hinunter. Er genoss den Ge-
schmack, obwohl die Frühlingsrolle inzwischen schon ein we-
nig aufgeweicht war.
Auf der anderen Straße musste der Mann in dem Wagen mit
den getönten Fensterscheiben eine Entscheidung treffen. Entwe-
der folgte er der Frau, oder er blieb bei dem Mann, der in dem
chinesischen Restaurant am Tresen saß. Er entschied sich für die
Frau. Er wusste, wo er den Mann später wiederfinden würde.
Er nahm an, dass die Frau zur U-Bahn-Station an der 86.
Straße wollte, und er behielt Recht.
Außerdem war er überzeugt, dass der Mann, den sie im Woo
Ching’s getroffen und dem sie etwas übergeben hatte, auch mit
dem Mord an diesem Morgen zu tun hatte. Und er hatte die
Absicht herauszufinden, wie es zusammenhing, ehe die Leute
anfingen, mit Anschuldigungen um sich zu werfen, von denen
einige auch ihn treffen würden.

Er knöpfte seine Jacke zu, legte seine Ohrenschützer an und
folgte der Frau die Straße hinunter.
Stella stand an einem Tisch und blickte hinab auf die neun Me-
ter lange Kette. Sie hatte sie direkt neben dem Fensterbrett
ausgebreitet, das aus dem Hotelzimmer stammte, in dem Alber-
ta Spanio ermordet worden war.
Mac, die Arme vor der Brust verschränkt, musterte die Kette
ebenfalls. Danny stand direkt neben ihm.
»Könnte das ein Kabel gewesen sein?«, fragte Mac, deutete
auf die Kerbe im Holz und griff nach einer Lupe.
»Sieh es dir genau an«, empfahl Stella.
Sie verschränkte die Arme vor der Brust.
Mac untersuchte die Kerbe sorgfältig und nickte.
»Ein Kabel hätte eine glattere Kerbe hinterlassen, sauberer, e-
benmäßiger«, sagte sie. »Die Kerbe misst eineinviertel Zentimeter
in der Breite. Die Ketten sind eineinviertel Zentimeter dick.«
Mac richtete sich auf und blickte sie an.
»Falls der Mörder an einer eineinviertel Zentimeter dicken
Kette zu dem Badezimmer runtergeklettert ist, muss er oder sie
sehr leicht gewesen sein«, fuhr Stella fort.
»Oder sehr mutig«, wandte Danny ein.
»Oder dumm oder verzweifelt.« Stella überlegte. »Er oder
sie hätte sich durch das Fenster des Badezimmers schwingen
müssen, ohne dabei den Schnee zu berühren. Bedenkt man
dann noch die Größe des Fensters, dann hätte diesen Job nur
ein Supermodel übernehmen können.«
»Oder ein Kind«, sagte Mac.
Stella zuckte mit den Schultern und dachte nach, wie klein
der Mann sein mochte, der bei Stevie Guista gewesen war, als
dieser das Zimmer im Brevard gemietet hatte.
»Es bleibt eine wichtige Frage offen«, sagte sie. »Wer war
in dem Raum und hat die Kette gehalten?«

»Sie war nicht am Boden festgeschraubt oder um irgendein
Möbelstück geschlungen worden?«, fragte Mac und griff nach
einem Kettenglied.
»Nein. Danny hat den Teppich entfernt. Keine Löcher. Kei-
ne Kettenspuren und keine einschlägigen Kratzer in den Mö-
belstücken«, sagte Stella.
»Also hat, wer immer in dem Raum war, die Kette gehal-
ten«, sagte Mac.
»Oder sich selbst um den Leib gewickelt«, fügte Stella hinzu.
»Die Person muss sehr stark gewesen sein, wenn sie jeman-
den halten kann, der an der Kette herunterklettert und Schwung
holt, um in ein Fenster einzusteigen«, wandte Mac ein.
»Ich habe die stärksten Ketten untersucht, die zu den Spuren
auf der Fensterbank passen würden«, sagte Stella. »Selbst eine
gerade vierzig Kilo schwere Person am Ende der Kette würde
vermutlich reichen, damit sie reißt, besonders, wenn die Person
damit hin und her schaukelt.«
»Klingt nach einer echten Zirkusnummer«, sagte Mac.
»Meinst du?«
»Nein«, sagte er. »Such in der Datenbank nach Größe und
Gewicht.«
»Können wir das?«, fragte Danny.
»Wir können.«
»Kannst du dir vorstellen, dass ein Mann oder ein Junge dumm
genug ist, sich während eines Schneesturms aus einem Fenster im
siebten Stock an einer Kette herunterzulassen?«, fragte Danny.
»Er muss furchtbar dämlich oder furchtbar mutig sein.«
»Und eine Menge Vertrauen zu demjenigen haben, der die
Kette gehalten hat«, fügte Mac hinzu.
»Und was dieses Loch im Holz an der Unterseite des Bade-
zimmerfensters von Alberta Spanios Appartement betrifft«,
sagte Stella. »Das ist nicht von einer Kette. Es stammt von ei-
ner großen Schraube.«

»Also«, sagte Mac. »Was haben wir bisher sicher?«
»Einen Fingerabdruck von Steven Guista«, sagte Stella.
»Auch bekannt als Big Stevie.«
»Hast du die Adresse?«
»Ja, aber er könnte unterwegs sein und feiern.« Stella reich-
te Mac ein Telefax, auf dem Big Stevies Foto nebst seiner Akte
aufgeführt war. »Heute ist sein Geburtstag.«
»Ich frage mich, was er letzte Nacht gefeiert hat«, sagte
Mac. »Gehen wir los und bringen ihm ein Geschenk.«
Es fühlte sich falsch an. Schal. Detective Don Flack spürte es.
Kein Beweis. Nur ein Bauchgefühl. Er hatte die Tür zu dem
Schlafzimmer überprüft, in dem Alberta Spanio ermordet wor-
den war. Er hatte ein Zimmermädchen gebeten, in das Zimmer
zu gehen und zu schreien, nachdem er die Tür geschlossen hat-
te. Das Zimmermädchen Rosa Martinez war eine Mexikanerin,
legal in den Staaten. Sie wollte nicht in das Zimmer gehen, in
dem die Frau wenige Stunden zuvor gestorben war.
»Sie schließen die Tür nicht ab?«, fragte sie.
Als sie die Frage stellte, kannte sie die Antwort bereits. Die
Tür konnte nur von innen abgeschlossen werden.
Rosa ging hinein, schloss die Tür und schrie. Dann öffnete
sie die Tür wieder.
»Gehen Sie zum Bett, stellen Sie sich neben das Bett, und
schreien Sie noch einmal«, bat Flack.
Sie wollte ganz bestimmt nicht zu dem Bett gehen, in dem
die Frau gestorben war, aber sie tat es, und Flack schloss die
Tür. Sie schrie erneut und beeilte sich dann sehr, die Tür wie-
der zu öffnen und das Zimmer zu verlassen.
»Okay?«, fragte sie.
»Nur noch eines«, sagte Flack. »Gehen Sie in das Bade-
zimmer, öffnen und schließen Sie das Fenster und schreien Sie
noch einmal.«

»Dann kann ich gehen?«
»Dann können Sie gehen«, versprach er.
Rosa kehrte in das Schlafzimmer zurück, schloss die Tür,
ging ins Badezimmer und öffnete das Fenster. Dann schrie sie
einmal, schloss das Fenster und hastete durch das Hotelzimmer
hinaus in den Raum, in dem der Detective wartete.
»Okay«, sagte er. »Danke.«
Rosa verschwand eilends.
Als sie das erste Mal geschrien hatte, hatte Flack sie gehört,
aber nur leise. Der zweite Schrei neben dem Bett war noch lei-
ser gewesen, aber der Schrei im Badezimmer und das Öffnen
oder Schließen des Fenster, konnte er gar nicht hören.
Er zog sein Mobiltelefon hervor und rief Stella an.
Es gab Neuigkeiten zu berichten.

7
Aiden Burn betrat das Labor etwa fünf Minuten, nachdem Mac
und Stella gegangen waren. Sie hatte das Labor für sich allein.
Der Kühlschrank in der Ecke summte, und durch die geschlos-
sene Glastür sah sie einen verlassenen Korridor.
Sie setzte ihren Koffer ab, nahm vorsichtig die Dinge her-
aus, die sie brauchte, platzierte sie in der Nähe des Mikroskops
und machte sich auf die Suche nach einer Tasse Kaffee.
Von Adelson im Schusswaffenlabor hätte sie einen ordent-
lichen Kaffee bekommen können, aber dafür hätte sie sich
auch mindestens fünf Minuten lang lahme Witze anhören
müssen. Dafür war sie nicht in der Stimmung. Sie entschied
sich für den Automaten. Mit einer Menge Sahne und einem
der Päckchen Stevia, die sie in ihrer Tasche hatte, war er er-
träglich.
Sie trug den Kaffee zurück ins Labor und stellte ihn auf ei-
nen Platz, der ein gutes Stück entfernt von dem Tisch war, an
dem sie arbeiten wollte. Keine Flecken. Sie würde sich eben
bewegen müssen, wenn sie trinken wollte.
Zuerst wollte sie sich das Farbband aus Lutnikovs Schreib-
maschine ansehen. Dazu würde sie es auf einen Lichtkasten le-
gen, der in den Labortisch eingelassen war.
Sie trank etwas Kaffee. Er war immer noch heiß, aber nicht
zu sehr.
Vorsichtig wickelte sie das Band ab. Sie brauchte knapp
fünf Minuten, um zum Anfang zu kommen. Dann legte sie es
flach auf den Lichtkasten, und die Buchstaben erstrahlten

durch das schwarze Band hindurch in einem hellen Weiß. Jetzt
konnte sie mit dem Lesen beginnen.
… die dritte Tür, die letzte, die einzige auf der linken Seite. Er,
es, musste hinter dieser Tür sein. Peggy hatte zwei Möglichkei-
ten. Weglaufen oder, mit dem Schürhaken in der Hand, die letzte
Tür öffnen. Es war beinahe dunkel, aber noch nicht vollkommen
finster. Etwas Licht drang durch das Flurfenster des kleinen
Hauses. Sie hatte keine Ahnung, wie viel Licht in dem kleinen
Raum war. Aber sie hatte eine Ahnung, was sie dort finden wür-
de – einen Mörder, die Person, die auf grausame Weise drei jun-
ge Frauen und einen schwulen Transvestiten zerstückelt hatte.
Der Mörder würde sein Arbeitswerkzeug in der Hand halten, ein
sehr scharfes Messer oder ein Skalpell. Der Mörder konnte hin-
ter der Tür warten, bereit, sie anzugreifen. Peggy wusste, sie
würde den Schürhaken benutzen. Alles, was sie tun musste, war,
sich an die Bilder der Opfer zu erinnern, die man ihr gezeigt hat-
te, besonders an das ihrer eigenen Nichte Jennifer. Den Schür-
haken in der rechten Hand, griff Peggy nach dem Türknauf. Sie
konnte immer noch kehrtmachen und flüchten, aber wenn sie
das tat, würde der Mörder, den man den Schnitzer nannte, da-
vonkommen und wieder zuschlagen. Sie musste sich keine Mü-
he geben, leise zu sein. Er wusste, dass sie im Haus war. Gewiss
hatte er ihre Schritte auf dem Holzboden gehört. Peggy drehte
den Knauf herum und stieß die Tür auf.
Eine Hand schoss hervor und packte ihr Handgelenk, als sie
ausholte.
»Er ist tot, Peggy«, sagte Ted und ließ ihren Arm los.
Sein Gesicht blutete aus einer Schnittwunde über dem rech-
ten Auge.
Sie ließ den Schürhaken auf den Boden fallen und sank in
seine Arme.

Aiden blickte auf, trank etwas von dem Kaffee, der inzwischen
lauwarm geworden war, und griff zu ihrem Telefon. Es blieb
noch eine Menge Farbband übrig, aber sie musste Mac anrufen.
Nach dem zweiten Klingeln hob er ab.
»Ja«, sagte er.
Sie erzählte ihm, was sie gefunden hatte, und er sagte: »Lass
es abschreiben und in einer Datei erfassen. Sobald du es zu-
rückbekommst, leg mir Band und Datei auf den Schreibtisch.
Ich hole sie später ab.«
»Ich kümmere mich darum«, antwortete sie, dann legte sie
auf.
Stella und Mac trafen kurz vor drei Uhr vor Steven Guistas
Appartement ein. Sie hatten sich in einem Eckladen ein paar
Sandwichs gekauft und diese im Wagen auf dem Weg nach
Brooklyn gegessen. Mac hatte Hühnchen mit Salat, Stella Eier-
salat.
»Haben wir nicht gestern schon das gleiche Zeug zum Mit-
tagessen gegessen?«, fragte sie.
Mac saß am Steuer.
»Ja, warum?«, fragte er.
»Abwechslung ist die Würze des Lebens«, erklärte sie, wäh-
rend sie einen kleinen Bissen von ihrem Sandwich nahm.
»Wir haben genug Abwechslung«, gab er zurück.
Macs Frau hatte, wie er sich erinnerte, Hühnchen mit Salat
gemocht, und das war vermutlich auch der Grund dafür, dass er
es nun aß. Der Geschmack, der Geruch, all das erinnerte ihn an
sie. Es war ein bisschen, als kitzelte er damit seinen Ge-
schmacksnerv, um sich zu erinnern, obwohl es ihm keine große
Freude machte. Er hatte seit Wochen nicht anständig gegessen.
Heute hatte er vorgehabt, sich am Abend ein paar koschere
Hotdogs und eine Diätcola zu holen. Der Termin rückte schnell
näher. Nur noch ein paar Tage. Und je näher er kam, desto

stärker fühlte Mac es tief in seinem Inneren. Der Himmel war
dunkel, und er ahnte weiteren Schneefall. Er würde sich den
Weather Channel ansehen, wenn er nach Hause käme. Kurz
überlegte er, ob er Arthur Greenberg anrufen sollte, entschied
sich aber dagegen.
Mac klopfte an die Tür von Appartement 4G in dem dreistö-
ckigen Vorkriegsziegelbau. Im Korridor war es dunkel, aber
einigermaßen sauber.
Er erhielt keine Antwort.
»Steven Guista«, rief Mac. »Polizei! Öffnen Sie die Tür!«
Nichts.
Mac klopfte noch einmal. Die Tür auf der anderen Seite des
Korridors wurde geöffnet. Eine schlanke Frau in den Fünfzi-
gern stand auf der Schwelle. Ihr Haar war dunkel und kraus.
Sie trug eine Kellnerinnenuniform und hatte sich einen Mantel
über den Arm geworfen. Neben ihr stand ein Mädchen, ganz
die Tochter ihrer Mutter und genauso ernst. Sie konnte nicht äl-
ter als elf sein.
»Er ist nicht zu Hause«, sagte die Frau.
Mac zeigte ihr seine Marke und fragte: »Wann haben Sie
ihn zum letzten Mal gesehen?«
»Gestern, irgendwann am Vormittag.« Die Frau zuckte mit
den Schultern.
»Er war die ganze Nacht nicht zu Hause«, sagte das Mädchen.
Die Frau sah ihre Tochter an, und ihr Blick machte deutlich,
dass sie der Polizei so wenig Informationen wie möglich zu-
kommen lassen wollte. Aber das Mädchen schien nichts davon
zu merken.
»Er hat um zehn nach mir gesehen«, sagte das Mädchen.
»Aber letzte Nacht und heute Morgen nicht.«
»Ich arbeite in der Spätschicht, manchmal auch in der
Nachtschicht«, erklärte die Frau. »Steve ist so lieb, dann nach
Lilly zu sehen.«

»Manchmal gucken wir zusammen fern«, erklärte Lilly.
»Manchmal.«
»Hat er gesagt, ob er heute zu einer Party wollte oder ob er
vorhatte, sich mit Verwandten oder Freunden zu treffen?«
Beide, Mädchen und Frau, schien die Frage in Erstaunen zu
versetzen.
»Heute ist sein Geburtstag«, erklärte Mac.
»Das hat er uns nicht gesagt«, entgegnete die Frau. »Ich hät-
te ihm einen Kuchen besorgt. Vielleicht sollte ich irgendwo ein
Geschenk kaufen. Steve war gut zu uns, vor allem zu Lilly.«
»Er sieht schaurig aus«, sagte das Mädchen. »Aber er ist
sehr nett.«
»Da bin ich sicher.« Stella sah in Gedanken Stevie Guistas
Strafakte vor sich.
»Ich muss los«, sagte die Frau und bückte sich, um ihrer
Tochter einen Kuss auf die Stirn zu drücken.
»Schließ die Tür ab«, sagte sie zu dem Mädchen.
»Das mache ich immer«, entgegnete Lilly.
Die Mutter lächelte und drehte sich zu den beiden Tatorter-
mittlern um. »Sollen wir Steve sagen, dass Sie ihn suchen?«
Mac zog eine Karte aus der Tasche und reichte sie der Frau,
die sie an ihre Tochter weitergab.
»Hat er etwas Böses getan?«, fragte Lilly.
»Wir wollen nur mit ihm reden«, beruhigte Stella sie.
»Worüber?«
Mord, dachte Mac, aber er sagte: »Er könnte Zeuge eines
Verbrechens gewesen sein.«
»Was für ein …?«, fing das Mädchen an, aber ihre Mutter
fiel ihr ins Wort.
»Lill, es ist Zeit, reinzugehen. Und für mich ist es Zeit, zur
Arbeit zu gehen.«
Das Mädchen verabschiedete sich von Stella und Mac, ging
hinein und verriegelte die Tür.

Als die Tür geschlossen war, sagte die Frau: »Ich weiß von
seiner Vergangenheit. Aber Steve ist heute ein guter Kerl.«
Mac nickte und reichte ihr eine zweite Karte. »Bitte geben
Sie ihm das, wenn Sie ihn sehen, und bitten Sie ihn, mich anzu-
rufen.«
Die Frau nahm die Karte an sich, betrachtete sie kurz und
steckte sie in die Manteltasche.
Die Frau mit dem Platinhaar und der Pelzmütze war in der U-
Bahn-Station an der 86. Straße in die Linie 6 eingestiegen. Der
Mann, der ihr folgte, nahm den Wagon hinter ihr. Das Wetter
hatte dafür gesorgt, dass das Gedränge in der Bahn größer war
als üblich, aber das konnte dem Mann, der die Frau durch ein
Fenster beobachtete, nur recht sein. Trotz ihrer zusammenge-
kniffenen Lippen war die Frau hübsch. Der Mann vermutete,
dass sie älter war, als sie aussah. Es war die Art, wie sie sich
bewegte, aber wahrscheinlicher war, dass sie mit plastischer
Chirurgie nachgeholfen hatte.
Er war ein geschulter, erfahrener Beobachter, und er war
hier, um seinen Arsch und seinen Job zu retten. Er würde die
Frau nicht verlieren.
Der Mann war ihr zu Woo Ching’s
gefolgt und hatte gese-
hen, wie die Frau dem Mann neben sich etwas übergeben hatte.
Er war zu weit entfernt gewesen, um zu erkennen, was es ge-
wesen war. Aber eine Spur führte zur anderen, und derzeit
folgte er der Spur der Frau. Er hoffte, sie würde ihn schließlich
zu jemand anderen führen, und wenn er Glück hätte, war das
das Ende des Weges. Wenn nicht, würde er eine weitere Spur
finden, der er folgen konnte. Immer wieder ermahnte er sich,
geduldig zu sein, allerdings war Geduld nicht eine seiner Stär-
ken.
Als sie in Castle Hill in der Bronx aus dem Zug stieg, folgte
er ihr mit genügend Abstand, um sicher zu sein, nicht entdeckt

zu werden. Jetzt hatte er eine Vorstellung davon, wohin sie
ging. Beinahe hätte er zufrieden gelächelt. Beinahe, denn noch
war es zu früh, um zufrieden zu sein.
Die Frau betrat den Eingang eines großen, einstöckigen
Backsteingebäudes, dessen Farbe sich im Laufe eines knappen
halben Jahrhunderts verändert hatte und nun völlig schwarz
war. Nur ein Hauch der alten, schmutzig gelben Farbe schim-
merte noch durch.
Als die Frau durch die Tür verschwand, trat der Mann näher.
Er wusste, wohin sie ging und wen sie aufsuchen wollte. Er
musste nur dieser Spur bis zum Ende folgen.
Er ging durch die Holztür und fand sich in einem dunklen
Korridor wieder. Ein angenehmer Geruch, der seiner Ansicht
nach nur von frisch gebackenem Brot stammen konnte, erfüllte
die Luft und erinnerte ihn einen Augenblick lang an seine
Kindheit, an einen Feiertag, vielleicht auch an mehrere, an de-
nen es ähnlich gerochen hatte.
Die Frau war nirgends zu sehen. Er ging weiter und überleg-
te sich eine passende Geschichte, sollte ihm jemand begegnen,
der wissen wollte, was er hier zu suchen hatte. Er fühlte das be-
ruhigende Gewicht der Waffe, die unter seinem Arm durch das
Holster an seinen Körper gepresst wurde.
Dann passierte es. Keine Zeit, die Waffe zu ziehen. Keine
Zeit, irgendetwas zu tun, außer nach dem Arm des Mannes zu
greifen, der blitzschnell aus der offenen Tür gekommen war
und seinen kräftigen Unterarm um die Kehle des Mannes ge-
schlungen hatte. Als der Mann unter seine Jacke griff, schlug
der Riese, der ihn würgte, seine Hand fort und brach ihm mit
einem einzigen tödlichen Ruck das Genick.
Der Körper von Detective Cliff Collier sackte zu Boden. Der
Mörder sah sich um, ehe er die annähernd neunzig Kilo schwere
Leiche mühelos hochhob. Er trug den toten Mann in das abge-
dunkelte Büro, stieß die Tür ins Schloss und ging zum Fenster.

Er öffnete es und sah sich um, obwohl das eigentlich unnö-
tig war. Er wusste, dass die Straße verlassen war und dass dort
nur der kleine Transporter stand.
Er hievte den Leichnam durch das Fenster und ließ ihn auf
einen Schneehaufen fallen. Dann kletterte er hinterher, wobei
er nicht vergaß, im letzten Moment noch das Fenster zu schlie-
ßen. Als er die Leiche auf die geöffnete Ladefläche des Trans-
porters schob, fiel sein Blick auf die Waffe im Holster des
Mannes. Er suchte nach der Brieftasche und erlebte eine Über-
raschung.
Es war ein Cop. Niemand hatte ihm gesagt, dass er einen
Cop umbringen würde – nicht, dass das wirklich von Bedeu-
tung gewesen wäre, aber für einen Moment dachte er, er hätte
darüber informiert werden müssen. Denn einen Cop zu töten
war etwas Besonderes. Er hätte es gerne vorher gewusst.
Er schloss die Türen des Transporters und glitt auf den Fah-
rersitz.
Noch nie zuvor hatte Big Stevie einen Cop umgebracht.
Nicht, dass er Bedauern verspürte, nein, im Grunde nicht, aber
es wäre nett gewesen, hätte man es ihm gesagt. Langsam fuhr
er die Gasse hinunter und überlegte, wo er die Leiche abladen
sollte.
Mac hatte es Stella und Don überlassen, Big Stevie aufzuspü-
ren, und fuhr nun so schnell, wie das Wetter und der Verkehr
es erlaubten, zu dem noblen Appartementhaus, in dem Charles
Lutnikov ermordet worden war.
Aiden hatte ihn angerufen, als sie das Farbband ins Labor ge-
schickt hatte. Dort wurde der Text erfasst und in einer Datei ab-
gespeichert. Ein Anruf von Mac würde die Laborarbeit voran-
treiben, trotzdem konnte es noch eine Weile dauern, bis sie die
Diskette mit dem Text wieder zurückerhielten. Deshalb hatte
Mac im Büro angerufen und erklärt, wie wichtig die Sache war.

Aiden wartete in der Lobby auf ihn. Vor dem Eingang
stampfte er mit den Füßen auf, um seine Stiefel vom Schnee
zu befreien. Dann betrat er das Gebäude und wurde mit einem
dankbaren Nicken von Aaron McGee, dem Portier, empfan-
gen.
»Die Leute stellen einen Haufen Fragen«, begann McGee.
»Ich kann ihnen keine vernünftigen Antworten geben. Was soll
ich ihnen sagen?«
»So wenig wie möglich«, antwortete Mac.
»Das hat die Lady auch gesagt.« Mit dem Kopf deutete
McGee auf Aiden. »Ich weiß sowieso nicht viel.«
Mac und Aiden gingen zum Fahrstuhl. Über der offenen Tür
hing immer noch das Absperrband. Sie duckten sich, um dar-
unter hindurchzukriechen.
»Jeder Quadratzentimeter wurde auf Fingerabdrücke unter-
sucht. Es gibt Abdrücke von beinahe jedem Bewohner aus die-
sem Teil des Gebäudes.« Aiden seufzte.
Mac drückte auf den Knopf, der den Fahrstuhl in Bewegung
setzte, und sie fuhren nach oben. Als die Kabine sich schloss,
ging Mac in die Knie und untersuchte den schmalen Metallrand
an der Vorderseite des Lifts. Zwischen der Kabine und der Tür
befand sich ein kleiner Zwischenraum von vielleicht zweiein-
halb Zentimetern Breite. Er blickte auf.
»Möglich«, sagte Aiden, die genau wusste, woran er dachte.
»Ich werde dich begleiten«, versprach er.
Sie hatten beide schon seltsamere Dinge entdeckt als eine
einfache Kugel, die durch einen schmalen Spalt gefallen und
irgendwo stecken geblieben war.
Das konnte eine schmutzige Angelegenheit werden.
Aiden unterdrückte ein Seufzen und wünschte sich eine Tas-
se Kaffee. Der Fahrstuhl hielt sanft an, und die Türen glitten
lautlos auseinander.
Mac trat vor und griff nach dem Türklopfer.

Sowohl Aiden als auch Mac merkten, dass hinter der Tür
jemand war, der sie durch den Spion beobachtete. Dann wurde
geöffnet.
»Haben Sie ihn geschnappt?«, fragte Louisa Cormier. »Den
Mann, der den armen Mr Lutnikov erschossen hat?«
»Es könnte auch eine Frau gewesen sein«, gab Aiden zu-
rück.
»Natürlich.« Louisa Cormier lächelte. »Ich hätte mich präzi-
ser ausdrücken sollen. Bitte, kommen Sie herein.«
Sie trat zur Seite.
Die Frau war nicht ganz so modisch schick und zwanglos
gekleidet wie beim letzten Mal. Ihr Haar saß beinahe perfekt,
aber ein paar Löckchen hatten ihren richtigen Platz verfehlt,
und ihre Augen wirkten müde. Sie trug eine Designerjeans und
einen weißen Kaschmirpullover, dessen Ärmel hochgekrempelt
waren und eine juwelenbesetzte Armbanduhr offenbarten.
»Bitte«, sagte sie und ließ ihre perfekt weißen Zähne auf-
blitzen. Sie deutete mit nach oben gerichteter Handfläche auf
einen kleinen Holztisch am Fenster. Um den Tisch herum stan-
den drei Stühle, die einen wunderbaren Panoramablick auf die
Stadt gestatteten.
»Kaffee? Tee?«, fragte Louisa Cormier.
»Kaffee«, bat Aiden. »Danke.«
»Sahne? Zucker?«
»Nein«, entgegnete Aiden.
»Kaltes Wasser«, bat Mac.
»Ich habe Ann ein paar Tage freigegeben«, erzählte Louisa
Cormier, als die beiden Beamten Platz genommen hatten. »Sie
war wirklich beunruhigt wegen dieser Schießerei. Ich werde
den Kaffee holen. Ich habe gerade eine frische Kanne aufge-
setzt. Offen gestanden, denke ich, sie fürchtet sich herzukom-
men, solange der Mörder nicht festgenommen wurde. Ann ist
ein Juwel. Ich würde sie nur ungern verlieren.«

Und mit diesen Worten eilte sie aus dem Zimmer. »Gibt es
schon irgendetwas im Mordfall Alberta Spanio?«, erkundigte
sich Aiden leise.
»Irgendetwas gibt es immer«, murmelte Mac und sah zum
Fenster hinaus.
Monet hatte London gemalt, hell und glitzernd, dunstig vom
Nebel, feucht vom Regen, dachte er. Hatte er je New York ge-
malt? Was hätte Monet gesehen, hätte er an diesem Tag aus
diesem Fenster gesehen?
Ehe Louisa Cormier zurück war, erzählte Aiden Mac, dass
sie Lutnikovs Appartement noch einmal durchsucht hatte.
»Kein Hinweis darauf, dass er Prosa geschrieben hat«, sagte
sie. »Keine Manuskripte, keine Papierstapel in den Schubladen,
nur das, was auf dem Farbband ist.«
Mac nickte, doch gleichzeitig wanderte sein Blick über die
Dächer der grauen Stadt.
Louisa kam mit dem Kaffee und einem Glas Eiswasser zu-
rück. Für sich hatte sie nichts mitgebracht. Als sie Platz ge-
nommen hatte, fuhr sie sich mit den Fingern durch das Haar.
»Lange Nacht«, erklärte sie. »Ich habe eine Deadline für
den neuen Pat-Fantome-Roman. Falls Sie je eines meiner Bü-
cher lesen, werden Sie feststellen, dass ich nichts mit Pat ge-
meinsam habe – es sei denn, dass ich sie erschaffen habe. Ich
lasse Pat in meinem Büro, wenn ich den Computer ausschalte
und für die übrige Welt wieder Louisa Cormier werde. Eine
Ausnahme sind natürlich Autogrammstunden oder Talkshows.
Dann, denke ich, überlasse ich größtenteils Pat Fantome das
Feld. Ich bin Pat dankbar, aber es ist nicht leicht, mit ihr zu le-
ben. Sie ist eine Getriebene. Ich dagegen …« Sie winkte ab
und ließ den Rest des Satzes unausgesprochen.
Aiden nippte an ihrem Kaffee. Er war heiß und gut. Mac
wirbelte die Eiswürfel in seinem Glas herum und sah, wie sie
aneinander schlugen.
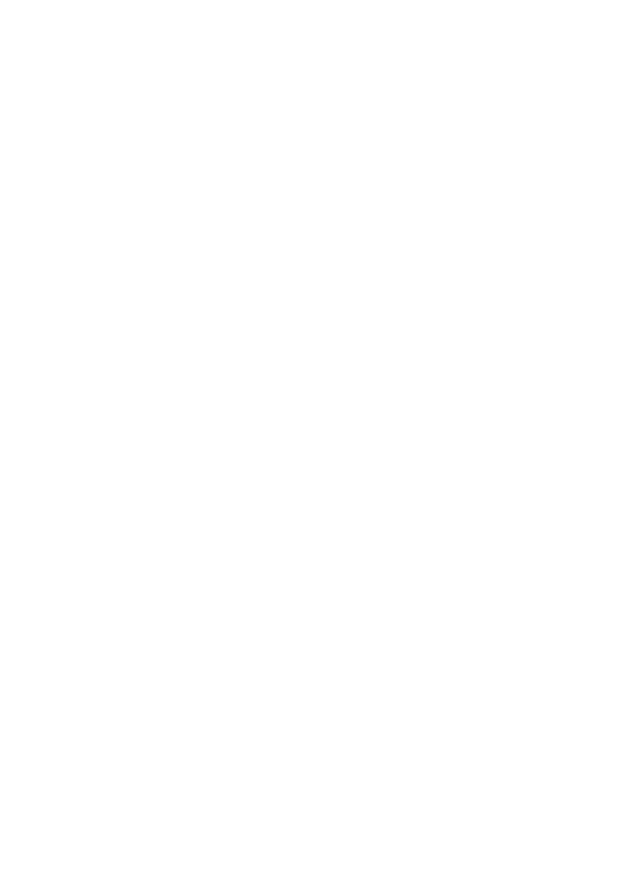
»Oh, nein«, sagte Louisa Cormier mit einem Lachen, als sie
ihre Mienen sah. »Ich bin nicht verrückt. Es gibt natürlich kei-
ne Pat Fantome. Nicht in der Wirklichkeit. Das ist nur eine Art
zu denken, derer ich mich bediene, wenn ich schreibe. Es gibt
ein paar Übereinstimmungen zwischen Pat und mir, doch die
Unterschiede überwiegen bei weitem. Aber Sie sind sicher
nicht gekommen, um über mich oder Pat zu sprechen. Sie ha-
ben Fragen in Bezug auf den armen Mr Lutnikov?«
Endlich trank Mac einen Schluck Wasser, hielt dann kurz
inne und fragte: »Besitzen Sie eine Waffe?«
Louisa Cormier sah erschrocken drein, fuhr mit der rechten
Hand hoch und berührte die dünne Goldkette an ihrem Hals.
»Äh … ja«, sagte sie. »Eine Walther. Sie ist im Schreibtisch
meines Büros. Möchten Sie sie sehen?«
»Bitte.«
»Verdächtigen Sie mich des Mordes an Mr Lutnikov?«,
fragte sie amüsiert.
»Wir überprüfen jeden, der diesen Fahrstuhl benutzt«, er-
klärte Aiden.
»Was könnte sich eine Krimiautorin Schöneres wünschen
als so eine Situation. Der Stoff liegt vor der eigenen Tür. Ich
hole sie.«
Louisa Cormier, nun unzweifelhaft interessiert, eilte zu der
geschlossenen Bürotür.
Macs Telefon klingelte, und er nahm ab. »Ja«, sagte er und
wartete einen Augenblick, bis er weitersprach. »Ich komme so
schnell ich kann. In einer halben Stunde.«
Er legte auf, als Louisa Cormier gerade aus dem Büro zu-
rückkam. Die Waffe hielt sie am Lauf und streckte sie Mac
entgegen. Er bat sie, sie auf den Tisch zu legen.
»Irgendwo habe ich auch die Erlaubnis dafür«, sagte Louisa.
»Ann kann sie heraussuchen, wenn …«
»Ich denke, das wird nicht nötig sein«, unterbrach Mac sie.

Aiden zog ein frisches Paar Handschuhe an und griff nach
der Waffe. Louisa Cormier sah ihr fasziniert zu. Nachdem sie
die Waffe untersucht hatte, sagte Aiden: »Eine Walther P22
mit einem Sechsundachtzig-Millimeter-Lauf. Wurde in letzter
Zeit nicht abgefeuert.«
»Ich glaube nicht, dass sie je abgefeuert wurde«, sagte sie.
»Sie liegt in dieser Schublade, um den Wunsch meiner Agentin
zu befriedigen, die mich, wie ich glaube, sehr mag. Aber ihre
fünfzehn Prozent liebt sie noch mehr als mich.«
»Ein paar Fragen noch«, sagte Mac, als Aiden Louisa Cor-
mier die Waffe zurückgab. Zuvor hatte sie natürlich das Maga-
zin überprüft und festgestellt, dass es in der Tat voll war. Loui-
sa legte die Waffe auf den Tisch, beugte sich interessiert vor
und faltete die Hände im Schoß.
»Waren Sie je in Charles Lutnikovs Appartement?«, fragte
Mac.
»Nein. Lassen Sie mich nachdenken. Nein, ich denke nicht.«
»War er je in Ihrem Appartement?«
»Ein paarmal. Eigentlich kommt oder vielmehr kam er jedes
Mal herauf, wenn ein neues Buch von mir erschienen ist und er
fast schüchtern um ein Autogramm bitten wollte.«
»Agent Burn hat Ihre Bücher in Mr Lutnikovs Appartement
gefunden«, sagte Mac. »Sie waren ungelesen.«
»Das überrascht mich nicht«, sagte sie. »Er war ein Sammler.
Signierte, ungelesene Erstausgaben. Er hat sich zum Lesen ein
zweites Buch gekauft. Darüber hat er ganz offen gesprochen.«
»Wir haben keine weiteren Ausgaben Ihrer Bücher in sei-
nem Appartement gefunden«, wandte Aiden ein.
»Er hat sie an andere Bewohner weitergegeben, wenn er sie
gelesen hatte. Er hatte ja noch die unberührten Erstausgaben.
Mein Gott, ist das faszinierend.«
»Hat Lutnikov Ihnen je etwas von dem gezeigt, was er ge-
schrieben hat?«, fragte Mac.

»Geschrieben? Ich dachte, er hätte Werbetexte für Kataloge
verfasst. Warum um alles in der Welt sollte er mir so etwas
zeigen?«
»Keine Prosa?«, hakte Aiden nach. »Kurzgeschichten? Ge-
dichte?«
»Nein. Und um die Wahrheit zu sagen, hätte er das getan, so
hätte ich ihn höflich darauf aufmerksam gemacht, dass ich viel
zu beschäftigt bin, um seine Arbeiten zu lesen, und dass ich
selten irgendwelche Prosa lese – nicht einmal, wenn sie von
meinen engsten Freunden verfasst wurde. Hätte er mich ge-
drängt, wie es manche tun, hätte ich ihm erklärt, dass meine
Agentin und mein Herausgeber mir eingetrichtert haben, ich
solle niemals ein unveröffentlichtes Manuskript lesen, weil
man mich anderenfalls später des geistigen Diebstahls bezich-
tigen könnte. Sie würden staunen, wie viele unseriöse Klagen
gegen mich eingereicht werden, was auch der Grund ist, wa-
rum ich die Lobby für eine Reform des Schadenersatzrechts
maßgeblich unterstütze.«
»Arbeiten Sie zurzeit an einem neuen Buch?«, fragte Mac.
»In etwa einer Woche sollte ich fertig sein.«
»Sie arbeiten an Ihrem Computer?«
»Ich kenne ein paar Autoren, Dutch Leonard, Loren Estle-
man, die immer noch Schreibmaschinen benutzen, aber ich
verstehe nicht, warum.«
»Welche Art Papier benutzen Sie?«, fragte Aiden.
»In meinem Drucker?«
»Ja.«
»Das weiß ich wirklich nicht. Irgendwas Gutes. Ann kauft
es in dem Schreibwarenladen an der 44. Straße.«
»Dürften wir einen Bogen davon haben?«, bat Mac.
»Einen Bogen meines Druckerpapiers … ja, natürlich. Ist
das alles?«
»Ja«, sagte Mac. »Für den Moment sind wir fertig.«

Er erhob sich, und die beiden Frauen folgten seinem Bei-
spiel. Louisa Cormier, die Waffe in der rechten Hand, unter-
nahm einen Abstecher in ihr Büro und kehrte mit einigen Bö-
gen Papier zurück, die sie Mac überreichte. Die Waffe hatte sie
nicht mehr bei sich.
»Sie sollten wissen, dass ich meinem Verleger keine ge-
druckte Fassung meiner Manuskripte gebe«, erklärte sie.
»Das tue ich schon seit Gott weiß wie vielen Jahren nicht
mehr. Ich schicke ihm das fertige Manuskript einfach per E-
Mail, und sie drucken es selbst aus und geben es zum Lekto-
rat.«
»Dann haben Sie alle Ihre Manuskripte als Datei auf Ihrer
Festplatte gespeichert?«, fragte Mac.
Louisa Cormier sah ihn neugierig an.
»Ja. Außerdem habe ich Sicherheitskopien auf Disketten,
die ich in meinem feuersicheren Wandsafe aufbewahre.«
»Danke«, sagte Mac. »Nur noch ein oder zwei abschließen-
de Fragen. Besitzen Sie noch eine weitere Waffe?«
Louisa Cormier sah leicht amüsiert aus.
»Nein.«
»Haben Sie je eine Waffe abgefeuert?«
»Ja, im Zuge meiner Nachforschungen. Meine Figur, Pat
Fantome, ist eine Expolizistin, die sehr zielsicher schießen
kann. Ich denke, es ist hilfreich, zu wissen, wie es sich anfühlt,
eine Waffe abzufeuern. Dafür gehe ich zu Drietch’s Range an
der Achtundfünfzigsten.«
»Das werden wir finden«, meinte Mac. »Noch eine Frage.
Haben Sie irgendeine Vorstellung davon, wie Lutnikovs Blut
auf den Teppich gekommen ist, der sich vor dem Fahrstuhl auf
Ihrem Stockwerk befindet?«
»Nein. Ich bin wirklich eine Verdächtige, nicht wahr?« Die
Vorstellung schien sie zu erfreuen.
»Ja«, sagte Mac. »Aber das gilt auch für all Ihre Nachbarn.«

»Danke für den Kaffee«, sagte Aiden und griff nach ihrer
Ausrüstung.
»Sie dürfen mich jederzeit wieder besuchen«, sagte Louisa,
als sie sie zur Tür begleitete. »Ich würde zu gern erfahren, wie
es mit Ihren Ermittlungen weitergeht. Jetzt werde ich meine
Agentin anrufen und ihr von alldem erzählen.«
Als sie wieder im Aufzug waren, fragte Aiden: »Keller?«
»Da musst du allein hin«, gestand Mac. »Stella hat gerade
Cliff Collier tot aufgefunden.«
»Collier? Der Cop, der Alberta Spanio bewachen sollte?«
»Ja, er ist erdrosselt worden.«
»Wo?«
»In einer kleinen Straße in Chinatown.«
Aiden erstickte mit zusammengepressten Lippen ein Seuf-
zen und nickte. Sie würde sich allein auf die Suche nach der
Kugel machen müssen. Sie hatte sich schon öfter auf dem Bo-
den eines Fahrstuhlschachtes umgesehen, und die Erfahrung
war stets interessant gewesen. Aber angenehm nie.
Mac betrachtete die Papierbögen, die Louisa Cormier ihm
gegeben hatte.
Er und Aiden dachten beide das Gleiche.
»Durchsuchungsbefehl?«
Er schüttelte den Kopf.
Aiden und Mac wussten, dass Louisa Cormier gelogen hatte,
aber sie wussten nicht, über was. Sie vermuteten, dass es um
die Blutspuren ging. Doch ein Verdächtiger sagte meistens in
irgendeinem Punkt die Unwahrheit, selbst dann, wenn er abso-
lut unschuldig war.
»Keine ausreichenden Gründe«, sagte Mac.
»Wir könnten sie lieb bitten«, schlug Aiden vor.
»Und sie kann lieb nein sagen und ihren Anwalt anrufen.«
»Also?«
»Also müssen wir mehr Beweise finden.«

8
»Erledigt?«, fragte der Mann.
»Erledigt«, antwortete Big Stevie Guista.
Big Stevie hatte aus einer Bar, eine Straße vom Zabar’s ent-
fernt, angerufen. Er hatte eine ganze Einkaufstüte mit Lebens-
mittel bei sich – Würste, Brötchen, Käse, ein großes Stück
Gorgonzola, seinen Lieblingsbrotaufstrich, Limonade und mit
Puderzucker bestäubte Kekse.
Sein Plan lautete, sich eine Mini-Geburtstagsparty mit Lilly
zu gönnen, dem kleinen Mädchen, das in der Wohnung gegen-
über wohnte. Ihre Mutter arbeitete zurzeit.
Hätte Big Stevie je geheiratet und Kinder bekommen, dann wä-
ren seine Enkel jetzt in Lillys Alter. Vielleicht. Sie war ein gutes
Kind. Er würde mit ihr feiern und vielleicht ein bisschen fernsehen.
Seinen Sex würde er sich morgen holen. Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag, Stevie. Aber er beklagte sich nicht.
»Gut«, sagte die Stimme am anderen Ende.
Beide, der Mann und Stevie, waren klug genug, kein weite-
res Wort zu verlieren. Dann legten sie auf.
Stevies Lieferwagen parkte im Halteverbot vor einem Feu-
erhydranten, dessen Spitze gerade noch aus einem Schneeberg
hervorlugte. Aber Stevie hatte keinen Strafzettel bekommen.
Den bekam er nie. Die Polizei und alle anderen Leute, die den
geparkten Transporter sahen, dachten, er würde etwas auslie-
fern, und genau das hätte er auch behauptet, wäre ihm jemand
in die Quere gekommen. Doch es gab nicht viele Leute, die be-
reit waren, Big Stevie in die Quere zu kommen.

Stevie setzte vorsichtig rückwärts aus der Parklücke und sah
sich über die Schulter um.
Die Ladefläche des kleinen Lieferwagens war leer, die
Drahtgestelle sauber. Er hatte die Leiche des Cops schon vor
über zwei Stunden in der Nebenstraße abgeliefert. Da war kein
Geruch des Todes, nur der vertraute, schwächer werdende Duft
von ehemals frischem Brot.
Stevie mochte diesen Geruch. Er mochte ihn noch mehr,
wenn das Brot noch ganz frisch war. Alles in allem mochte
Stevie seine Arbeit.
Die Leiche lag hinter einem Müllcontainer, der zum Hinterhof
des Ming Lo’s Dim Sum in Chinatown gehörte. Cliff Collier lag
auf dem Rücken, die Beine ausgestreckt, die Arme grob über
der Brust verschränkt, den Kopf verdreht, als hätte er im Mo-
ment seines Todes direkt nach hinten geblickt.
Stella hatte mindestens ein Dutzend Mal im Ming Lo’s geges-
sen, immer an einem Sonntagmorgen, immer mit Verwandten,
die nach New York gekommen waren, um ein bisschen was von
der Stadt zu sehen. Der Eingang zu Ming Lo’s, der auf der ande-
ren Seite des Gebäudes an der Mott Street lag, war hell erleuch-
tet. Hinter den Glastüren war eine breite Rolltreppe zu erkennen,
an deren oberen Ende sich ein großer Raum voller Tische be-
fand. Die chinesische Bedienung versorgte die Kundschaft, fast
ausschließlich Chinesen, mit Dim-Sum-Karten. Es gab Dutzende
von Wahlmöglichkeiten, und alle Gerichte konnten entweder mit
Stäbchen oder mit den Fingern gegessen werden. Stellas Ver-
wandtschaft zeigte sich regelmäßig beeindruckt.
Sie fragte sich, wie beeindruckt ihre Verwandtschaft wohl
beim Anblick des toten Mannes in der Seitenstraße gewesen wäre.
»Das ist mein Job«, sagte sie und stellte sich vor, sie würde
sich mit einer Tante oder Cousine unterhalten. »Ich stelle toten
Leuten Fragen.«

Der Gedanke an Dim Sum, das sie normalerweise sehr
mochte, verursachte ihr heute Bauchweh. In ihrem Magen bro-
delte es. Stella ging neben der Leiche in die Knie. Sie hatte
furchtbare Krämpfe auf einmal. Danny hatte bereits Fotos von
dem toten Mann, der Mauer und dem Müllcontainer geschos-
sen.
Don Flack stand neben der Hintertür des chinesischen Re-
staurants und sprach mit dem Küchengehilfen, der die Leiche
entdeckt hatte. Der sichtlich verängstigte, dickleibige Mann
antwortete auf Chinesisch, und eine junge Frau in einem Sei-
denkleid übersetzte. Während sie sprach, zitterte sie.
Flack zog den Mantel aus und wickelte ihn der jungen Frau
um die Schultern. Sie nickte ihm dankbar zu. Der dicke Mann
sprach hastig und aufgeregt.
»Er wusste, dass der tote Mann kein Obdachloser war«, ü-
bersetzte die junge Frau. »Er war zu gut gekleidet und sein
Haar war geschnitten.«
Flack, das Notizbuch in der Hand, nickte.
»Hat er irgendjemanden gesehen, irgendwas gehört?«
Die junge Frau übersetzte. Der dicke Mann schüttelte nach-
drücklich den Kopf.
Flack drehte sich zu der Leiche um und sah sie sich genauer
an. Er hatte Collier gekannt, nicht sehr gut, aber gut genug, um
sich gegenseitig nach ihren Angehörigen zu erkundigen, ohne
dass es peinlich gewesen wäre. Don erinnerte sich, dass Collier
nicht verheiratet war, aber dass er Eltern hatte, die in Queens
lebten.
Danny, Stella und Don fiel der Geruch gleichermaßen auf,
eine Mischung aus scharfen und süßen chinesischen Gewürzen.
Danny hätte gern gebackene Wan Tan bestellt oder irgendwas
anderes, was ebenso gut war. Vielleicht konnte er Stella über-
reden, wenn sie hier fertig waren, mit der Befragung drinnen
weiterzumachen und dabei etwas zu essen.

Flack hingegen fiel der Geruch nicht auf. Nicht, dass er chi-
nesisches Essen nicht gemocht hätte, aber der tote Mann be-
herrschte derzeit seine Gedanken und ließ keinen Platz für der-
artige Dinge.
»Danke«, sagte er zu der jungen Frau.
Das musste sie nicht übersetzen. Der dicke Mann warf einen
Blick auf die Leiche und hastete zurück ins Restaurant. Das
Mädchen gab Flack den Mantel zurück, und ihre Blicke trafen
sich. Vielleicht hätte sich daraus etwas ergeben können, aber er
hatte kein Interesse – nicht jetzt, nicht hier, nicht, während Col-
liers Leiche da herumlag.
Als das Mädchen in das Restaurant zurückging, machte
Flack kehrt und sah Mac Taylor die Straße heraufkommen. Er
bewegte sich langsam und hatte die Hände tief in den Taschen
seines Mantels vergraben.
Mac blieb neben Danny stehen und blickte auf die Leiche
und auf Stella, die neben ihr kniete. Macs Lippen waren fest
zusammengekniffen, doch mit seinen Augen registrierte er al-
les, was in dieser schmalen Gasse herumlag.
»Genickbruch«, stellte Stella fest.
Sie drehte die Leiche auf die Seite. Sie hatte nicht viel Platz,
und der tote Mann war schwer. Natürlich hätte sie um Hilfe bit-
ten können, aber sie wollte so wenig wie möglich am Tatort
verändern. Es gab schon zu viele Kontaminierungen.
»Die Seitenstraße ist voller Fußabdrücke«, sagte Danny.
»Mindestens sechs verschiedene Personen. Ich habe die Ab-
drücke gesichert.«
Danny hatte die Fußabdrücke mit Sprühwachs im Schnee
konserviert. Dann hatte er Wasser in einen Gipsbeutel gefüllt,
den Beutel durchgeknetet und alles in den Abdruck gegossen,
um so einen verwertbaren Gipsabdruck zu erhalten. Außerdem
hatte er, um den Aushärtungsvorgang zu beschleunigen, dem
Gips etwas Salz zugesetzt.

»Irgendein auffallend großer Abdruck?«, fragte Mac.
»Ja«, sagte Danny. »Da drüben haben wir einen.«
Danny wusste, warum Mac ihn nach großen Abdrücken ge-
fragt hatte. Collier war über ein Meter achtzig groß und mehr
als neunzig Kilo schwer. Er hatte eine gute Kondition.
Wer immer Collier umgebracht hatte, musste stärker und
mindestens genauso groß gewesen sein wie der Detective. Vor-
ausgesetzt, es handelte sich um einen Einzeltäter. Hawkes wür-
de die Leiche wiegen müssen, damit sie sich ein genaues Bild
machen konnten.
Danny deutete auf drei Fußabdrücke, die zum Container
hinführten, sowie auf zwei andere, die etwa genauso groß wa-
ren und vom Müllbehälter wegführten. Die Abdrücke, die sich
entfernten, waren nicht so tief wie die, die sich dem Container
näherten. Damit war klar, dass jemand die Leiche auf seinen
Schultern zum Müllcontainer getragen und sie dort abgeworfen
hatte.
»Miss die Schneedichte«, sagte Mac. »Wir werden eine
Formel aufstellen, um mathematisch nachzuweisen, dass die
Leiche von jemanden getragen wurde. Schau nach der Briefta-
sche und finde heraus, welches Gewicht in Colliers Papieren
eingetragen ist.«
Danny nickte. Niemand zweifelte daran, dass die Fußabdrü-
cke demjenigen gehörten, der Colliers Leiche zum Müllcontai-
ner getragen hatte, aber vor Gericht brauchte man stichhaltige
Beweise. Und sie alle wollten auf Nummer sicher gehen.
Flack stand bei Danny und Mac und sah Stella bei der Ar-
beit zu. Keiner musste es aussprechen, denn alle vier Mitglie-
der der C.S.I.-Einheit ahnten die Verbindung zwischen der Er-
mordung des Detectives und dem Mord an Alberta Spanio, der
Frau, die von diesem Detective beschützt werden sollte.
Stella hatte sich inzwischen wieder aufgerichtet und war da-
bei, ihre Handschuhe auszuziehen.

Mac konnte die Stellen erkennen, an denen der Müllcontai-
ner auf Fingerabdrücke untersucht worden war. Da waren etli-
che Spuren, aber es schien eher unwahrscheinlich, dass darun-
ter auch Fingerabdrücke von der Person waren, die Colliers
Leiche hier abgelegt hatte.
»Er wurde nicht hier getötet«, sagte Stella.
Mac nickte.
»Keine Fußabdrücke hinter der Leiche«, fuhr sie fort.
»Wenn er hier umgebracht worden wäre, hätte er umgedreht
werden müssen, aber dafür gibt keine Hinweise.«
»Keine Anzeichen für einen Kampf?«, fragte Mac.
»Auch das nicht.«
»Wir haben nur Fußabdrücke«, sagte Danny.
Stella nickte. Hier war nichts mehr zu tun – den Rest muss-
ten sie im Labor erledigen.
Jeder von ihnen hatte eine Theorie, und jeder von ihnen war
bereit, augenblicklich von ihr abzurücken, wenn ein neuer Be-
weis auftauchte und die Karten neu gemischt wurden.
Flacks erster Gedanke war, dass Collier den Mörder von Al-
berta Spanio aufgespürt und verfolgt hatte, und dann entdeckt
und getötet worden war.
Danny überlegte. Collier hatte vielleicht etwas im Zusam-
menhang mit dem Mord gesehen oder sich an etwas erinnert,
das er der falschen Person gegenüber erwähnte. Vielleicht hatte
der Mörder auch gemerkt, dass ein wichtiges Indiz direkt mit
ihm in Verbindung gebracht werden konnte.
Stella kam zu dem Schluss, Collier könnte in den Mord an
Alberta Spanio verwickelt sein und wurde ermordet, um den
oder die Mörder zu schützen.
»Ed Taxx.« Mac drehte sich zu Flack. »Sprich mit ihm. Er
könnte auch auf der Liste des Mörders stehen. Sollte Collier
etwas gesehen oder gewusst haben, dann könnte Taxx über das
gleiche Wissen verfügen.«

Flack nickte.
»Und wir müssen Stevie Guista finden«, fügte er hinzu, als
er einen Blick auf die Leiche warf und den Sanitätern zunickte,
die gerade eingetroffen waren.
Mac sah auf seine Armbanduhr.
»Jemand hungrig?«, fragte er.
»Ja.« Danny rieb sich die Hände, während er von einem
Bein aufs andere trat, um die Taubheit aus seinen Füßen zu
verscheuchen.
»Ich passe«, sagte Stella.
Don schüttelte den Kopf und sah zu, wie die Sanitäter den
Müllcontainer wegschoben und den toten Mann in einen
schwarzen Sack hüllten.
Das Quartett rührte sich nicht. Schweigend verfolgten sie
das Geschehen. Macs Blick fiel auf drei eingepackte Glücks-
kekse, die dort, wo der Müllcontainer gestanden hatte, im
Schnee lagen. Er ging hin, bückte sich und hob sie auf.
Mac und seine Frau waren auch einmal im Ming Lo’s gewe-
sen. In jener Nacht hatte es ebenfalls Glückskekse gegeben,
aber er erinnerte sich nicht, was sie prophezeit hatten.
Nach einigen Sekunden ließ er die ungeöffneten Kekse in
den Müllcontainer fallen. Dann drehte er sich zu den anderen
um und fragte: »Dim Sum?«
Big Stevie klopfte an die Tür und wartete, bis Lillys Stimme
ertönte: »Wer ist da?«
»Ich, Stevie«, antwortete er.
Als sie die Tür öffnete, gab er ihr die Einkaufstüte von Za-
bar. Sie war zu schwer, und das Mädchen schleifte sie über den
Boden.
»Ich habe Geburtstag«, sagte er. »Was hältst du von einer
Geburtstagsparty?«
Er trat ein und schloss die Tür hinter sich.

»Ich weiß, dass du Geburtstag hast«, sagte sie, ging in die
kleine Küche und fing an, all die Leckereien aus der Tüte zu
holen. Dabei hielt sie immer wieder inne, um daran zu riechen.
»Ich habe ein Geschenk für dich gemacht.«
Darauf war Stevie nicht vorbereitet, und wie es schien, hatte
sich seine Rührung auf seinen Zügen niedergeschlagen. »Es ist
nichts Besonderes«, sagte Lilly. »Ich gebe es dir, wenn wir ge-
gessen haben.«
Er zog Mantel und Schuhe aus, legte den Mantel über einen
Stuhl in der Nähe der Tür und stellte die Schuhe gleich auf eine
Fußmatte.
»Wie wäre es vor dem Essen?«, schlug er vor und versuchte,
sich zu erinnern, wann er zum letzten Mal ein Geburtstagsge-
schenk bekommen hatte. Bestimmt nicht mehr, seit er ein Jun-
ge gewesen war, ein »junger« Junge. Ein »kleiner« Junge war
er nie gewesen.
»Okay«, sagte Lilly, als sie die letzte Packung aus der Ein-
kaufstüte zog.
Sie ging in das Schlafzimmer und kam Sekunden später mit
einem kleinen Päckchen zurück. Es war unbeholfen in rotes
Papier gewickelt und mit einem rosafarbenen Band verschnürt
worden. Sie legte das kleine Päckchen in seine riesige Hand.
»Mach auf«, sagte sie.
Er tat es, sorgsam darauf bedacht, weder das Papier noch
das Band zu zerreißen. Es war ein kleines, hosentaschengroßes
Tierchen. Lilly hatte es aus Ton oder so etwas in der Art ge-
macht und weiß angemalt.
»Das ist ein Hund«, klärte sie ihn auf. »Ich wollte dir ein
Pferd machen, aber das war zu schwer. Magst du ihn?«
»Ja«, sagte er und stellte den Hund auf den Tisch.
Er schwankte ein wenig, fiel aber nicht um.
»Darf ich ihm einen Namen geben?«, fragte Lilly.
»Klar.«

»Rolf, wie der Hund in der Sesamstraße.«
»Rolf«, sagte er. »Klingt wie ein Bellen.«
»Ich glaube, das soll es auch.«
»Also«, sagte er, »wollen wir essen?«
Lilly besorgte Teller, Messer, Gabeln, Papierservietten und
Gläser.
»Haben die Leute dich gefunden?«, fragte sie, während sie
eine Wurstpackung öffnete.
»Welche Leute?«, fragte Stevie.
»Ein Mann und eine Frau. Die waren hier, als Mom zur Ar-
beit gehen wollte.«
»Haben sie gesagt, wer sie sind?«, fragte er, als Lilly mit
großer Sorgfalt eine Scheibe Wurst auf das Brötchen legte, das
sie vorher aufgeschnitten hatte.
»Ich glaube, sie waren von der Polizei«, sagte sie, gab ihm
das Sandwich, das sie zubereitet hatte, und holte die Karte, die
ihre Mutter ihr gegeben hatte, bevor sie gegangen war.
Stevie schwieg. Er las die Visitenkarte mit Mac Taylors
Namen und Telefonnummer und gab sie dem Mädchen zurück.
Dann nahm er das Sandwich entgegen und stierte es an, als hät-
te er so etwas noch nie gesehen. Er wusste nicht, was er davon
halten sollte.
»Ich glaube, einer von denen wartet in deiner Wohnung auf
dich«, sagte sie und kaute auf ihrem eigenen Sandwich herum.
Stevie steckte den Tonhund ein und drehte sich auf dem
Stuhl herum, um zur Tür zu schauen, als könne er, wenn er sich
nur genug Mühe gab, durch sie hindurch und bis in seine eige-
ne Wohnung hineinsehen.
Stevie musste nachdenken. Das brauchte seine Zeit. Denken
war nicht gerade eine seiner Stärken. Er nahm einen großen
Bissen von dem Sandwich. Der Geschmack war angenehm ver-
traut.

Jacob Laudano fing an, sich ernsthaft Sorgen zu machen. Es
war alles viel zu leicht gewesen, und jetzt erhielt er einen Tele-
fonanruf, der ihn darüber aufklärte, was er zu sagen hatte,
wenn die Polizei bei ihm auftauchte.
Warum zum Teufel sollte die Polizei bei ihm auftauchen?
Okay, sie hatten immer einen Grund, ihn zu suchen, aber er
konnte ihnen aus dem Weg gehen – vorausgesetzt, sie hatten
nicht vor, ihn festzunageln. Sie hatten keinerlei Beweise gegen
ihn. Sie konnten keine haben.
Jacob Laudano, genannt der Jockey, war gerade ein Meter
siebenundvierzig groß, wog dreiundvierzig Kilo, gute zwei Ki-
lo zu viel, um noch an Pferderennen teilnehmen zu können.
Doch dafür, dass er vor acht Jahren das letzte Mal auf einem
Pferd gesessen hatte, war es eine beachtliche Leistung von ihm
gewesen, seinen Lebensstandard halten zu können. Er hatte
sein Gewicht im Griff, Essen auf dem Tisch, ein Einzimmerap-
partement in East Side und noch genug Geld für Klamotten und
Drinks.
Er musste nicht bezahlen, damit Frauen zu ihm kamen. Im
Gegensatz zu Big Stevie, denn keine wollte von Stevies Mas-
sen erdrückt werden oder aufblicken und in sein Gesicht sehen.
Jake dagegen besaß aus irgendeinem Grund eine Anziehungs-
kraft, die er sich selbst nicht erklären konnte, die er jedoch oh-
ne Murren akzeptierte. Er wusste, dass es etwas mit seiner
Größe zu tun hatte. Er sah nicht schlecht aus, aber das Gesicht,
das ihn jeden Morgen aus dem Spiegel im Badezimmer ansah,
gehörte auch nicht gerade Tom Cruise. Jake war blass, seine
Nase ein wenig zu spitz und seine Augen zu schmal. Er ging
auf die Fünfzig zu, wurde aber meist jünger geschätzt. Wieder
ein Verdienst seiner Größe.
Pferde hatte er nie gemocht, es sei denn, um auf sie zu wet-
ten, und das hatte ihn in Schwierigkeiten gebracht. Für eine
Weile war es gut gelaufen. Er hatte auf seine eigenen Rennen

gewettet und alle Tricks angewandt, um dafür zu sorgen, dass
der Favorit nicht siegte. Das war keine sehr angesehene Kunst,
und am wenigsten angesehen war sie unter den anderen Jo-
ckeys, die ihn schließlich ans Messer lieferten.
Mit sechsundzwanzig Jahren war für Jake in dem Geschäft
nichts mehr zu holen gewesen, und so hatte er sich mit seiner
Behändigkeit und seinem mangelnden Respekt vor dem Gesetz
dem traditionellen Familiengeschäft zugewandt und war Ein-
brecher geworden.
Auf diese Weise hatte er sich über mehrere Jahre lang recht
gut durchschlagen können. Doch dann hatte er die unterste
Schublade einer Kommode aufgebrochen – dort, wo die Leute
gern kleinere Wertgegenstände versteckten –, als plötzlich je-
mand die Wohnungstür öffnete.
Wirklich dumm gelaufen. Jake war zum Fenster geflüchtet,
weil der Kerl ihn dorthin geprügelt hatte. Dort hatte er ihm den
Weg versperrt und ihm Hiebe gegen die Brust versetzt, die här-
ter waren als alles, was er bis dahin erlebt hatte, und auch här-
ter waren als das, was er später in den zwei Jahren im Knast er-
leben sollte.
Der Kerl war, wie sich herausstellte, Third Baseman bei den
Mets gewesen. Dumm gelaufen.
Jake knüpfte im Knast Kontakte, die für die Zeit nach seiner
Entlassung nützlich waren. Sie brachten Arbeit und Geld, si-
cherten ihm sein Auskommen. Er war immer noch verdammt
gut darin, dorthin zu kommen, wo niemand sonst hinkam, und
erst recht seine Auftraggeber, die großen, dicken und oftmals
alten Leute. Als ihm zum ersten Mal jemand zehntausend Dol-
lar für einen Mord angeboten hatte, hatte er bloß genickt.
Seitdem hatte er noch drei weitere Menschen umgebracht,
alle zum Standardpreis von zehntausend Dollar. Jake, der Jo-
ckey, hatte einen Ruf. Er versuchte nicht, mehr Geld herauszu-
schlagen, wen immer er auch ermorden sollte.

Jakes bevorzugte Methode war ein Stich in den Hals mit ei-
nem langen, scharfen Messer, während die Zielperson schlief.
Er richtete seine Krawatte vor dem Spiegel und zog den
Knoten nach, bis er perfekt saß. Jemand hatte ihn mal als
schick bezeichnet, das hatte ihm gefallen.
Das Telefon klingelte. Jake arbeitete weiter an seiner Kra-
watte, als er das Bad verließ und den Hörer abhob.
»Ja«, sagte er.
Und dann lauschte er.
»Alles gut gelaufen«, sagte Jake. »Wie ich es Ihnen gesagt
habe. Rein, raus. Keine Fragen … Ja, sie haben mich gesehen,
aber nicht mein Gesicht … Wenn er das tut, mach ich das, aber
er wird nicht herkommen … Okay, okay, ich rufe an.«
Dann war die Leitung tot. Er legte den Hörer auf und starrte
ihn einige Sekunden lang an. War irgendetwas schief gegan-
gen?
Im Fahrstuhlschacht war es dunkel. Deshalb hatte Aiden ihre
große Taschenlampe auf einer Metallstrebe abgelegt.
Sie trug Handschuhe und hatte eine Packung Beweismittel-
beutel griffbereit an ihrer Seite. In dem Schacht war nicht so
viel Müll, wie sie befürchtet hatte, aber es war immer noch ge-
nug, um ihr die Arbeit zu vermiesen.
Es war eine Herausforderung.
Sie fand zerknittertes Zeitungspapier aus den Fünfzigern. Auf
einer abgerissenen Seite las sie das Wort »Ike«. Sie wühlte sich
durch vergammelte Briefumschläge, deren Absender und Emp-
fänger ihr unbekannt waren. Sie fand eine Verpackung von ei-
nem Baby-Ruth-Schokoriegel, eine Reihe Schrauben, Reißnägel
und andere Metallgegenstände. Unter einem nicht identifizierba-
ren Haufen feuchten Unrats fand sie zwei tote Ratten. Eine der
Ratten war schon lange tot, und man sah ihr Skelett, die andere
war frischeren Datums und höchst übel riechend.

Sie wühlte fünfundvierzig Minuten dort herum und beendete
ihre Suche mit einem ausgetrockneten, in Aluminiumfolie ge-
wickelten Kondom. So viel zu Appartementgebäuden zu fin-
den. Das wusste sie nun so sicher, wie sie wusste, dass sie eine
Dusche brauchte.
Sie machte sich daran, aus dem Schacht zurück in den Kel-
ler zu klettern. Als sie ein Knie bereits auf dem Betonboden
hatte, sah sie sich noch einmal um und leuchtete mit ihrer Ta-
schenlampe die Ecken aus. Sie schaute zu dem Boden des über
ihr hängenden Fahrstuhls, den sie außer Betrieb gesetzt hatte,
ehe sie heruntergeklettert war – und dann sah sie es plötzlich.
Das Projektil oder das, was davon übrig war, lag dunkel und
schwer auf einer Metallstützstrebe. Es war gar nicht bis zum
Boden des Schachts gefallen.
Aiden kletterte mit einer Pinzette und einem Kunststoffbeu-
tel wieder zurück in den Schacht, schoss drei Fotos und sicher-
te die Beweismittel.

9
Hawkes blickte auf Colliers Leichnam hinunter. Mac und Stel-
la standen neben ihm.
»Der Mörder war größer als das Opfer«, sagte Hawkes.
»Seht euch die Blutergüsse an.«
Er deutete auf den Hals des Toten.
»Er wurde erst zurück und dann nach oben gerissen, um die
Hebelwirkung zu verstärken. Die Blutergüsse fangen am A-
damsapfel an und führen nach oben. So etwa.«
Hawkes stellte sich hinter Mac und zeigte ihm, was er mein-
te. Mac fühlte, wie Hawkes’ Arm ihn umfasste und sich locker
aufwärts bewegte.
»Vermutlich hat er das Opfer einfach hochgehoben.«
Hawkes trat zurück und sah erneut den Leichnam an.
»Der Tote wiegt fünfundneunzig Kilo und ist ein Meter sie-
benundachtzig groß«, erklärte er weiter. »Euer Mörder ist min-
destens ein Meter sechsundneunzig, vielleicht ein Meter acht-
undneunzig oder sogar zwei Meter groß und sehr stark. Der hat
nicht lang gefackelt. Er hat dem Opfer von hinten einfach einen
Arm um den Hals gelegt und ihm mit einem kräftigen Ruck das
Genick gebrochen. Ein Kampf hat gar nicht stattgefunden.«
»Und?«, fragte Stella.
»Der Mörder ist Rechtshänder«, sagte Hawkes. »Der über-
wiegende Teil der Quetschungen an der Speiseröhre des Opfers
befindet sich auf der rechten Seite.«
»Wenn wir also einen linkshändigen Riesen finden, ist der
unschuldig«, sagte Mac mit ausdrucksloser Miene.

»Linkshändige Riesen kommen nicht infrage«, bestätigte
Hawkes.
»Er hat das schon öfter gemacht«, sagte Stella.
»Dann wusste er genau, was er tat«, sagte Hawkes. »Mögt
ihr übrigens Opern?«
»Hab nie eine gesehen«, sagte Stella.
Im Gegensatz zu Mac. Seine Frau hatte die Oper geliebt.
Und Mac hatte sich an die fremdartigen, albernen Geschichten
gewöhnt, an die übertriebene Darstellung und die mehr oder
weniger pompöse Ausstattung. Vor allem hatte er gern zugese-
hen, wenn Claire sich für einen großen Abend zurechtmachte.
Sie hatte stets voller Vorfreude gelächelt. Und Mac lernte, die
Musik und den Gesang zu lieben.
»Ich habe zwei Karten für die morgige Don-Giovanni-
Aufführung«, sagte Hawkes. »Donatelli aus der Mordkommis-
sion hat sie mir gegeben. Er hat einen Cousin, der im Chor
singt. Aber seine Frau hat Grippe, und er sagt, er sei ihr ir-
gendwas schuldig.«
»Gehst du nicht hin?«, fragte Stella.
»Ich ziehe CDs vor. Willst du es dir ansehen?«
»Nein, danke«, sagte Stella.
»Mac?«, fragte Hawkes.
Mac dachte nach und sah Stella an.
Ihre Wangen waren gerötet, aber unter der OP-Lampe war
schwer zu erkennen, ob sie wirklich rot waren. Ihre Augen wa-
ren ein wenig glasig, und er hatte den Eindruck, dass sie etwas
wacklig auf den Beinen stand.
»Nimm sie«, sagte Stella.
»Alles in Ordnung mit dir?«, fragte er.
»Nur eine Erkältung.«
Mac streckte die Hand aus, und Hawkes zog zwei Karten
aus seiner Tasche. Mac sah sie an. Gute Plätze, Orchester.
»Danke«, sagte er und steckte sie ein.

Auf dem Korridor in dem kalten, grauen Licht, das durch
die Fenster fiel, fragte Stella: »Magst du Opern wirklich?
Weißt du, du musst die Karten nicht nehmen.«
Beinahe hätte er gesagt: »Wir haben sie sehr gemocht.« A-
ber dann besann er sich schließlich eines Besseren und sagte
stattdessen: »Kommt auf die Oper an. Don Giovanni sehe ich
mir sehr gerne an.«
Die C.S.I.-Ermittler machten sich auf den Weg ins Labor.
Danny Messer stand vor einem großen Tisch, auf dem eine
sechzig Zentimeter lange Stahlkette lag.
»Wo fangen wir an?«, fragte er und schaute zu Stella und Mac.
Mac deutete mit dem Kinn auf die Kette.
»Gut«, sagte Danny. »Standardausführung. Auf manchen
Gliedern sind kleine Nummern, die einen Hinweis auf den Her-
steller geben. Eines steht fest: Diese Kette passt zu den Spuren,
die wir in dem Hotelzimmer gefunden haben. Ich habe den
Hersteller angerufen. Sie garantieren, dass die Kette fünfund-
vierzig Kilo trägt. Die Frau, mit der ich gesprochen habe, sagt,
wenn mehr als fünfundvierzig Kilo an der Kette hängen, wür-
den vermutlich ein oder mehrere Glieder reißen.«
»Colliers Klamotten?«, fragte Mac.
Danny lächelte und ging zum Mikroskop. Neben dem Mik-
roskop lagen ordentlich nummerierte Objektträger. Danny legte
einen davon unter das Mikroskop, stellte es scharf und trat zu-
rück.
»Ich habe die weiß-braunen Flecken untersucht«, sagte er.
»Mehl. Nur auf der Rückseite der Jacke.«
Stella schaute sich die Substanz auf dem Objektträger durch
das Mikroskop an.
»Colliers Leiche wurde also in einem Fahrzeug transportiert,
in dem Mehl war«, stellte Mac fest.
»Jedenfalls ist die Jacke von hinten beinahe vollständig mit
einer dünnen Schicht Mehl überzogen«, sagte Danny.
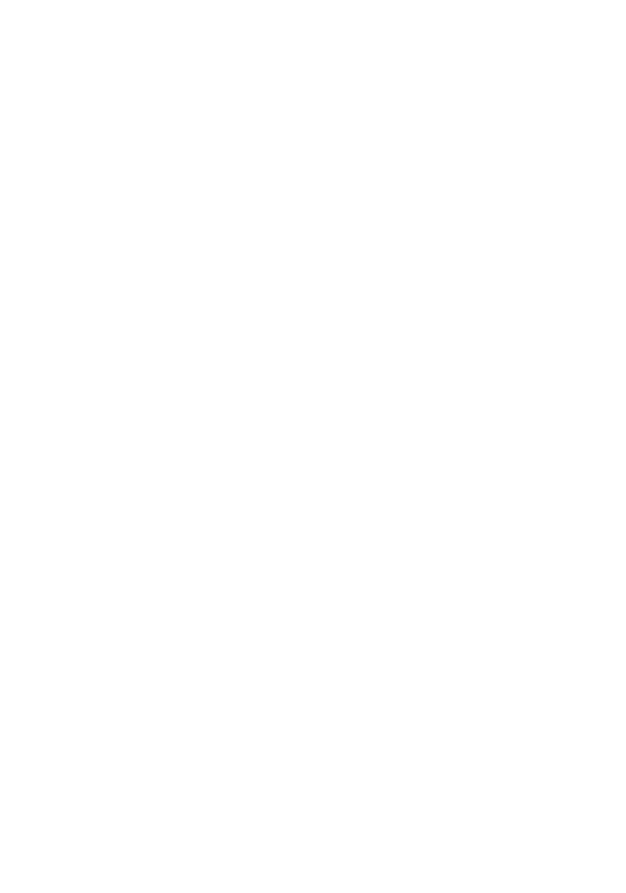
»In dem Mehl sind Insektenteile«, sagte Stella und blickte
vom Mikroskop auf. »In den anderen Proben auch?«
»Yep«, machte Danny.
»Die Federal Drug Administration erlaubt einen bestimmten
Anteil davon in jedem Mehl, das die Bäckereien benutzen«, er-
klärte Mac.
»Ich werde daran denken, wenn ich mir später ein Sandwich
zum Abendessen bestelle«, sagte Danny. »Vielleicht überlege
ich es mir aber noch einmal.«
Stella trat zur Seite, und Mac sah durch das Mikroskop.
»Die Insekten unterscheiden sich von Bäckerei zu Bäckerei.«
»Und«, fügte Danny hinzu, »das Mehl hat jeweils unter-
schiedliche Zusätze. Ich bin gerade dabei, den Hersteller von
diesem Mehl hier zu ermitteln und mir eine Kundenliste geben
zu lassen. Dann können wir mithilfe des Mehls ermitteln, mit
welcher Bäckerei wir es zu tun haben.«
»Vielleicht …« Stella zögerte.
»Vielleicht?«, fragte Danny.
»Vielleicht fängst du am besten mit Marco’s Bakery an«,
beendete Stella ihren Satz.
Sie alle wussten, warum. Der Fingerabdruck in dem Ho-
telzimmer über Alberta Spanios Schlafzimmer stammte von
Steven Guista – und das war ein großer Mann mit einem
langen Vorstrafenregister, der als Fahrer für Marco’s Bakery
arbeitete. Einer Bäckerei, die Dario Marco gehörte, dem
Bruder jenes Mannes, gegen den Alberta Spanio hätte aussa-
gen sollen.
»Hat Flack sich gemeldet?«, fragte Mac.
»Noch nicht«, sagte Danny. »Er wartet in Guistas Wohnung.
Richter Familia hat einen Haftbefehl ausgestellt.«
Mac sah Stella besorgt an, die ein Schniefen unterdrücken
musste.
»Ich hole meine Ausrüstung«, sagte sie.

Sie würden zwanzig Minuten brauchen, um Guistas Woh-
nung zu erreichen. Zwanzig Minuten, in denen eine Menge
passieren konnte.
Don Flack durchsuchte Guistas kleine Wohnung sorgfältig und
lauschte dabei auf Schritte im Hausflur. Hier hätte ebenso gut
ein Mönch wohnen können.
In dem kleinen Wohnzimmer gleich hinter der Tür zum
Korridor stand ein fleckiger grüner Lehnsessel. Das schmutzige
Möbelstück wies eine tiefe Mulde auf. Es war höchstwahr-
scheinlich der Platz, auf dem Guista den größten Teil seines
Lebens zubrachte. Eine traurige Vorstellung. Ein Farbfernseher
der Marke Zenith stand auf einer alten Kommode mit drei
Schubladen, die wiederum direkt vor dem Sessel stand. Auf der
Armlehne des Sessels lag eine Fernbedienung.
In der Küche stand ein Resopaltisch mit Aluminiumbeinen
und drei passenden Stühlen mit Sitzflächen und Lehnen aus
blauem Plastik. Außerdem registrierte Flack einen fast leeren
Kühlschrank und einen Geschirrschrank. In dem Geschirr-
schrank gab es drei Tassen, vier Teller und ein paar Gläser.
Unter der Spüle standen ein Topf und eine angeschlagene, tef-
lonbeschichtete Pfanne.
Das Schlafzimmer war winzig. Ein großes, sauber bezoge-
nes Bett mit einer grünen Decke und vier Kissen füllte den
größten Teil des Raums aus. Es gab keine Bücher oder Zeit-
schriften auf dem Nachttisch. An der Wand am Fuß des Bettes
hing ein Bild, das drei grasende Pferde auf einer ausgedehnten,
hügeligen Weide zeigte.
In dem kleinen Bad stand eine alte, große Badewanne mit
Klauenfüßen und Porzellanarmaturen.
Was Flack in der Wohnung am meisten auffiel, war, dass sie
makellos sauber war, beinahe antiseptisch – fast, als wäre sie
unbewohnt. In den Schubladen und Schränken waren nicht vie-

le Kleidungsstücke zu finden. Guista schien eine Vorliebe für
Grün zu haben, soweit es seine Socken und Hemden und einen
Teil seiner Möbel betraf.
Don ging zurück in den Wohn- und Küchenbereich und
setzte sich auf einen der Stühle an dem Resopaltisch – der Tür
zugewandt.
Don war darauf vorbereitet, den Rest des Tages und die
ganze Nacht in der kleinen Wohnung zu verbringen.
Auf der anderen Seite des Korridors feierten Big Stevie und
Lilly Geburtstag. Sie aßen zusammen und sahen die Wiederho-
lung einer alten Schwarzweißfolge von Rauchende Colts,
in
der noch Dennis Weaver den Chester gespielt hatte.
Stevie wollte bleiben. Er hatte für einen Tag genug getan,
mehr als genug, und er hoffte, sein Einsatz würde auf Aner-
kennung stoßen. Er rechnete nicht mit einem Sonderbonus. Ein
kleines Zeichen der Anerkennung würde vollkommen genügen.
Dieser Tag war schließlich sein Geburtstag gewesen.
Aber im Augenblick musste er nachdenken. Da war jemand
in seiner Wohnung, ein Mann, und wartete auf ihn, durchsuchte
seine sauber zusammengefalteten Kleider, seine gleichmäßig
angeordneten Unterhosen, Hemden und Jacken, seine Kaffee-
tassen und Küchendosen und brachte vermutlich alles durch-
einander.
Big Stevie wusste, dass er verschwinden sollte, aber es fühl-
te sich richtig an, mit Lilly hier zu sitzen, den Rest des Ku-
chens zu essen und Orangen-Mandarinen-Saft zu trinken.
Vermutlich war das ein Cop in seiner Wohnung. Aber so
schnell konnten sie ihn nicht finden. Im Grunde rechnete er über-
haupt nicht damit, entdeckt zu werden. Und doch waren sie hier.
Dann kam ihm ein anderer Gedanke. Er versuchte, ihn zu
verscheuchen, doch es ging nicht. Was, wenn es nicht die Cops
waren? Was, wenn Mr Marco dachte, Big Stevie sollte abgelöst

werden? Was, wenn Mr Marco dachte, Big Stevie wäre allmäh-
lich zu alt für den Job? Nein, das konnte nicht sein. So was
würde nicht passieren. Aber wer weiß …?
Stevie musste in seine Wohnung gehen und es herausfinden.
Er musste sich die paar Dinge schnappen, die ihm wichtig wa-
ren, er musste mit Marco sprechen und irgendwohin gehen –
nach Detroit oder Boston vielleicht. Er kannte sich gut aus in
Detroit und Boston.
»Ich habe keine Angst«, sagte Lilly.
»Was?«
»Der Mann in der Scheune wird Marshall Dillon nicht tö-
ten«, erklärte sie. »Er könnte, aber wenn er Marshall Dillon tö-
ten würde, gäbe es keine neuen Folgen mehr, und wir wissen,
dass es ganz viele davon gibt.«
»Du bist ein kluges Mädchen«, sagte Stevie und berührte ihr
Haar mit seiner breiten Hand.
»Klüger als der klügste Durchschnittsbär«, sagte sie.
Stevie verstand kein Wort.
Die Folge von Rauchende Colts ging zu Ende, Marshall Dil-
lon erschoss den Bösen in der Scheune. Stevie stand auf. Er
musste sich vergewissern.
»Du bleibst hier«, sagte er zu Lilly. »Vielleicht wirst du
Lärm auf dem Flur hören, aber du bleibst hier drin. Schließ die
Tür hinter mir ab.«
»Musst du schon gehen?«
»Geschäfte«, sagte er.
»Der Mann in deiner Wohnung?«, fragte sie.
»Ja.«
»Kommst du zurück, wenn du mit ihm fertig bist?«
»Heute nicht.«
Er steckte die Hand in die Tasche und zog den bemalten
Hund hervor, den sie für ihn gemacht hatte.
»Danke«, sagte er und hielt ihn hoch.

»Magst du ihn wirklich?«
»Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, das ich je be-
kommen habe«, sagte er und steckte den Hund wieder in die
Tasche.
Er drehte den Fernseher leiser, ging zur Tür und öffnete sie
leise. Lilly sah ihm zu.
»Abschließen«, flüsterte er.
Sie nickte, folgte ihm zur Tür und schloss hinter ihm ab.
Im Korridor blieb Stevie einige Sekunden lang stehen, ehe
er sich leise zu seiner Wohnungstür schlich. Hatte der Mann in
seiner Wohnung die Tür abgeschlossen? Vermutlich. Sicher
wollte er hören, wenn Stevie seinen Schlüssel in das Schloss
steckte und ihn herumdrehte, und genau deshalb warf sich Ste-
vie höchstpersönlich gegen die Tür.
Don hätte vorbereitet sein müssen, aber der große Mann, der
mit der geborstenen Tür in die Wohnung geflogen kam und
sich auf ihn stürzte, bewegte sich so schnell, dass der Detective
keine Chance hatte, seine Waffe zu ziehen.
Er versuchte, von seinem Stuhl aufzustehen, aber der große
Mann stürmte auf ihn zu und landete mit seinem ganzen Ge-
wicht auf Don. Beide stürzten zu Boden.
»Polizei«, keuchte Don.
Der große Mann lag auf dem Detective, dem sich zu allem
Unglück auch noch ein Metallbein des Stuhls in den Rücken
bohrte.
Stevie war erleichtert. Also hatte Marco niemanden ge-
schickt, um ihn umzubringen. Mit der Polizei würde Stevie fer-
tig werden. Das tat er schon sein ganzes Leben lang. Anthony
Korncoff, der die Hälfte seines Lebens in der Zelle zugebracht
hatte, hatte gesagt, Stevies mangelnde Intelligenz sicherte ihm
das Überleben.
»Du bestehst nur aus animalischen Instinkten«, hatte Korn-
coff gesagt.

Stevie hatte das als Kompliment verstanden. Er hielt eben
alles gern einfach. Er musste. Stevie konnte keine Lügen erzäh-
len, und tat er es doch, so konnte er keinen klaren Gedanken
mehr fassen, weil er nicht mehr wusste, was er gesagt hatte. Er
ließ sich besser auf nichts ein. Auch jetzt nicht.
»Was wollen Sie?«, fragte er.
»Gehen Sie von mir runter, und beantworten Sie mir ein
paar Fragen«, sagte Don, während er sich bemühte, den
Schmerz zu ignorieren.
»Fragen? Worüber?«
Der Detective zögerte. Dieser Mann, der Don am Boden
festhielt, hatte wenige Stunden zuvor höchstwahrscheinlich
Cliff Collier ermordet. Unzweifelhaft hatte er auch etwas mit
dem Mord an Alberta Spanio zu tun. Dieser große Mann würde
Don vielleicht ermorden, wenn er irgendetwas preisgab.
»Lassen Sie mich erst mal Luft schnappen«, keuchte Don.
Steve dachte nach und ließ von ihm ab. Das war ein Fehler.
Don griff nach seiner Waffe und zog sie aus dem Holster. Im
gleichen Moment legten sich Stevies Finger um seinen Hals.
Don fühlte, wie sich die dicken Daumen in seine Haut gru-
ben, gleichmäßig und schnell. Er schoss. Er war nicht sicher,
wohin die Waffe zielte. Er hoffte nur, dass sie auf Stevie
Guista gerichtet war.
Stevie grunzte, und der Druck seiner Daumen lockerte sich
ein wenig. Don schlug dem großen Mann den Lauf seiner Waf-
fe auf die Nase. Mit wackeligen Beinen erhob sich Stevie. Blut
floss aus dem fleischigen Oberschenkel seines linken Beins
und aus seiner gebrochenen Nase.
Don rutschte hastig auf dem Boden nach hinten. Er wollte
den Mann immer noch verhaften, aber er würde kein Risiko
mehr eingehen.
Er zögerte. In dem Augenblick stieß Big Stevie mit dem Fuß
gegen die Waffe in seiner Hand, sodass sie in einem hohen Bo-

gen durch die Luft flog und klappernd in der Küchenspüle lan-
dete.
Stevie musste nun eine Wahl treffen. Das war jetzt le-
bensnotwendig. Ein Schuss war gefallen. Jemand könnte ihn
gehört haben. Sollte er den Polizisten töten? Hatte er genug
Kraft, ihn zu töten? Würde das den Schmerz verschlimmern?
Und was hatte er davon, wenn er noch einen Cop umbrach-
te?
Es gab keine Wahl. Stevie stampfte durch die offene Tür
hinaus in den Korridor.
Hinter sich konnte er hören, wie der Cop versuchte, sich
aufzurichten. Es schien ihm große Mühe zu bereiten. Die Tür
der Wohnung gegenüber wurde geöffnet. Lilly stand auf der
Schwelle und sah ihn an.
»Alles in Ordnung«, sagte er. »Geh wieder rein. Und schließ
die Tür ab.«
»Du bist verletzt«, sagte sie und zeigte auf die Wunde in
seinem Bein.
Sie fing an zu weinen.
Er sah sich zu seiner Wohnung um und hörte, wie Don dar-
um kämpfte, aufzustehen.
»Um mich hat noch nie jemand geweint«, sagte er.
Er lächelte unter dem Blut, das sein Gesicht bedeckte, und
seine Zähne färbten sich rot.
Hastig stolperte Stevie den Gang hinunter, ohne sich noch
einmal umzusehen. Seine Hand tastete nach dem bemalten
Hund in seiner Tasche. Er umfasste ihn fest, aber nicht so fest,
dass er hätte zerbrechen können.
Mac und Stella verpassten Stevie um höchstens drei Minuten.
Sie sahen das Blut auf der Treppe, als sie die Stufen hochstie-
gen. Sie wussten nicht, wessen Blut das war, aber sie konnten
erkennen, dass, wer immer hier geblutet hatte, die Treppe hin-

unter- und nicht hinaufgegangen war. Sie verfolgten die Bluts-
tropfen zurück zu Stevies Wohnung.
Als sie in der offenen Tür standen, hatte Mac bereits seine
Waffe gezogen. Was sie jedoch sahen, war ein am Boden lie-
gender Don Flack mit einem schmerzverzerrten Gesicht und
ein kleines Mädchen, das neben ihm kniete.
»Eine oder zwei Rippen sind wohl gebrochen, schätze ich«,
sagte Flack. »Guista kann noch nicht weit gekommen sein. Ist
nur ein paar Minuten her. Hab auf ihn geschossen.«
Stella blieb bei dem verwundeten Flack, während Mac sich
umdrehte und den Blutstropfen folgte.
Die Frau, groß, hübsch, kurzes platinblondes Haar, vermutlich
Mitte vierzig, trug ein graues Kostüm, eine weiße Bluse und
eine Kette aus falschen Perlen. Inmitten der Bäckerei erweckte
sie den Eindruck von Klasse. Aus der Backstube jenseits der
Doppeltüren am Ende des Korridors hörte man leise Stimmen.
Danny wollte seine Brille richten, hielt sich aber zurück. Ir-
gendwie glaubte er, die Bewegung könne die Frau alarmieren.
»Weshalb wollen Sie mit Mr Marco sprechen?«, fragte sie
und sah den uniformierten Officer hinter Danny an. Der Officer
war breitschultrig, dunkelhäutig und erfahren. Sein Name lau-
tete Tom Martin. Er begegnete dem Blick der Frau ohne das
kleinste Blinzeln.
Eine der ersten Lektionen, die er vor einundzwanzig Jahren
in der Akademie gelernt hatte, war, dass man, wenn man eine
harte Nuss vor sich hatte, niemals blinzeln darf. Wörtlich und
im übertragenen Sinne. Sein Ausbilder, ein erfahrener und viel-
fach ausgezeichneter Mann, hatte vorgeschlagen, sich die Au-
gen von Filmstars anzusehen.
»Charlton Heston, Charles Bronson«, hatte der Ausbilder
gesagt. »Die blinzeln nicht. Das ist ein Teil ihres Geheimnis-
ses. Macht es zu einem Teil eures Geheimnisses.«

Martin wusste, wo sie waren und warum. Sie rechneten
nicht mit Schwierigkeiten, aber er hatte schon mehr als einmal
scheinbar harmlose Türen geöffnet und sich unversehens in ei-
nem Horrorszenario wiedergefunden. So war er an die rosarote
Narbe an seinem Kinn gekommen – und an eine Menge Erfah-
rungen.
»Mr Marco ist beschäftigt«, sagte die Frau, die sich nicht
vorgestellt hatte.
»Ich möchte nur einen Blick in die Backstube werfen und
ein paar Fragen stellen«, erklärte Danny.
»Ich kann Ihre Fragen beantworten«, entgegnete sie.
»Ist Steven Guista hier?«
»Er hat heute und morgen frei. Sein Geburtstag. Mr Marco
kennt die Geburtstage aller Leute, die ihm gegenüber loyal
sind.«
Danny nickte.
»Ist sein Lieferwagen hier?«
»Nein«, erwiderte sie. »Mr Marco hat ihm den Wagen über-
lassen, damit er Sachen für seinen Geburtstag transportieren
kann. Sie haben die Wahl. Das überlasse ich ganz Ihnen.«
»Einen Laster?«, fragte Danny.
»Einen kleinen Lieferwagen«, korrigierte sie ihn.
»Ich möchte jetzt die Backstube und Mr Marco sehen«, ver-
kündete Danny. »Oder ich komme mit einem Durchsuchungs-
befehl zurück.«
»Es tut mir Leid, aber …«, fing sie an.
»Sie verkaufen Brot?«
»Das ist unser Geschäft.«
»Dann hätte ich gern einen frischen Laib«, sagte Danny.
Sie drehte den Kopf leicht zur Seite und überlegte, ob er sie
auf den Arm nehmen wollte.
»Welche Sorte?«, fragte sie schließlich.
»Was immer Guista ausliefert.«

»Wir haben acht verschiedene Brotsorten«, sagte sie.
»Einen Laib von jeder Sorte«, sagte Danny. »Ich zahle auch
dafür.«
»Warten Sie hier.« Die Frau eilte den Korridor hinunter zur
Backstube. Ihre flachen Absätze klapperten auf den ausgetrete-
nen Bodenplatten.
Die Bürotür befand sich links von den beiden Männern. Da-
rio Marcos Name stand in goldenen Lettern auf der Vordersei-
te. Danny sah Martin an – der nickte und öffnete die Tür. Die
beiden Männer gingen hinein und fanden sich in einem kleinen
holzgetäfelten Vorzimmer wieder. Auf einem Schreibtisch
stand ein Namensschild: Helen Grandfield.
Jenseits des Schreibtischs war eine weitere Tür. Hinter der
Tür erklang die Stimme eines Mannes. Danny und Martin gin-
gen hin und klopften. Danny öffnete die Tür, ohne eine Reakti-
on abzuwarten.
Dario Marco trug eine graue Hose und ein weißes Hemd,
dessen oberster Knopf offen war. Er stand vor seinem Schreib-
tisch und telefonierte, als sich ihm die beiden Männer in den
Weg stellten. Verdutzt starrte er sie einen Augenblick lang an,
dann legte er auf und schaute verärgert in ihre Richtung.
»Ich erinnere mich nicht, Sie hereingebeten zu haben«, sagte
er.
Er war Anfang sechzig, schlank, und sein Haar war unzwei-
felhaft gefärbt. Vermutlich hatte er als junger Mann auf eine
geheimnisvolle Weise gut ausgesehen, aber nun war er alt und
seine Züge waren schlaff geworden. Was auch immer er mit
seinem Leben angestellt hatte, es lastete schwer auf seinen
Schultern.
»Tut mir Leid«, fing Danny an.
»Was wollen Sie?«
»Wann haben Sie zum letzten Mal mit Ihrem Bruder ge-
sprochen?«, fragte Danny.

Marco schaute dem Polizisten in die Augen, doch der hielt
dem Blick stand und gewann das Kräftemessen. Er war besser
ausgebildet. Marco blinzelte, drehte sich zu Danny um und
musterte den C.S.I.-Ermittler in einer Weise, die zum Ausdruck
bringen sollte, dass er keineswegs beeindruckt war.
»Welchen?«
»Anthony.«
Marco schüttelte den Kopf.
»Anthony ist das schwarze Schaf in der Familie. Wir reden
nicht miteinander. Ich habe ihn nicht einmal im Gefängnis be-
sucht.«
Der Blick, mit dem er Danny ansah, war eine glatte Heraus-
forderung. Alle wussten, dass es zahlreiche Möglichkeiten gab,
um jemanden im Knast zu kontaktieren.
»Überprüfen Sie seine Telefonate und die Besucherlisten«,
schlug Dario vor.
»Das haben wir bereits«, sagte Danny.
»Was wollen Sie dann noch?«
»Steven Guista.«
»Der ist nicht hier. Sein Geburtstag. Ich habe ihm zwei Tage
freigegeben. Seit dieser Low-Carb-Diät-Mist angefangen hat,
musste ich sieben Bäcker entlassen und die Produktion um die
Hälfte runterfahren. Brot ist plötzlich an allem Schuld. Können
Sie sich das vorstellen? Was wollen Sie von Stevie? Hat er was
angestellt?«
»Wir würden gern selbst mit ihm reden und einen Blick in
seinen Lieferwagen werfen«, erklärte Danny.
»Mit dem ist er unterwegs.«
»Ich weiß. Das hat uns Ihre Sekretärin schon erzählt.«
»Helen ist meine Assistentin«, korrigierte Marco.
In dem Augenblick wurde die Tür geöffnet, und die Frau
kam mit einer großen weißen Papiertüte in das Zimmer.
»Es tut mir Leid«, sagte sie zu Marco.

Zerknirscht klang sie allerdings nicht. Marco zuckte nur mit
den Schultern. Sie reichte Danny die Tüte.
»Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich gern selbst in
die Backstube gehen und mir mein Brot aussuchen«, sagte er.
»Denken Sie, ich habe mich rausgeschlichen und es auf der
Straße gekauft?«, fragte sie.
Danny zuckte mit den Schultern und konnte dem Bedürfnis,
seine Brille zurechtzurücken, nicht länger widerstehen.
»Schon gut«, sagte Marco. »Zeig den Herren die Backstube,
und dann zeigst du ihnen den Ausgang.«
An Danny gerichtet sagte er: »Keine Fragen mehr. Wenn
Sie noch einmal herkommen wollen, dann besorgen Sie sich
eine richterliche Anordnung.«
Helen Grandfield führte die beiden Männer zur Tür hinaus.
Sie folgten ihr den Korridor hinunter in die Backstube. Der Ge-
ruch des frischen Brotes war angenehm und wohltuend.
»Nehmen Sie sich, was Sie wollen«, sagte Helen, als etwa
ein Dutzend Bäcker und Bäckergehilfen in weißen Schürzen
und weißen Papiermützen aufblickten und sie beobachteten,
ohne ihre Arbeit zu unterbrechen.
Danny stellte die Papiertüte, die er von Helen bekommen
hatte, auf den Boden ab und begann damit, verschiedene Bröt-
chen und Brote zusammenzusuchen und sie in einer neuen Pa-
piertüte zu verstauen. Danach wischte er etwas Mehl von ei-
nem Backtisch, auf dem meterweise der Brotteig lag, und ließ
es ebenfalls in eine frische Tüte rieseln.
»Danke«, sagte er und reichte Martin seinen Koffer. Er
selbst griff nach den Papiertüten.
Der C.S.I.-Ermittler hielt die Tüten mit seinen Fingerspitzen
am oberen Rand fest. Danny Messer achtete darauf, Helen
Grandfields Fingerabdrücke nicht zu verwischen.
»War das alles?«, fragte sie.
»Das war alles«, bestätigte Danny.
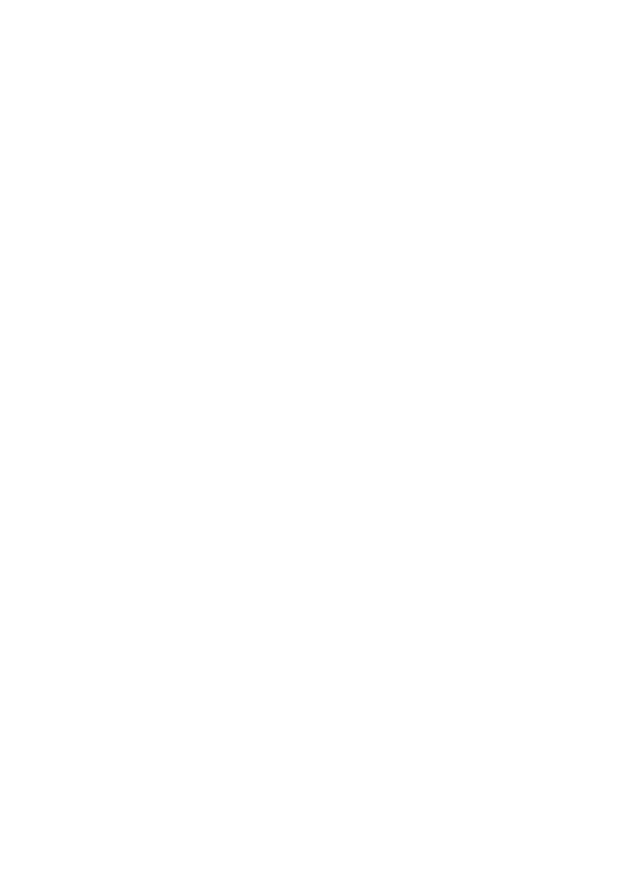
Mit Martin an seiner Seite ging er zum Ausgang der Back-
stube. Helen Grandfield folgte ihnen nicht. Auf dem Weg hin-
aus musterte Danny automatisch die Wände und den Boden –
er lauschte und schnüffelte. Sie waren den Korridor bereits ei-
nige Meter entlanggegangen, als Danny plötzlich stehen blieb
und zu Boden sah. Martin beobachtete ihn, wie er in die Hocke
ging.
Da waren zwei dunkle Linien zu erkennen, etwa dreißig
Zentimeter lang und fünfzehn Zentimeter voneinander entfernt.
Danny öffnete seinen Koffer und machte Fotos von den Spu-
ren, ehe er vorsichtig einige Partikel von dem Boden aufhob
und in einen Beweismittelbeutel fallen ließ.
Als er beinahe fertig war, wurde die Backstubentür am an-
deren Ende des Korridors geöffnet. Danny und Martin sahen
sich um und erblickten Helen Grandfield.
Aus der Ferne sah sie Danny direkt in die Augen. Ihm
machte es nichts aus, als Erster zu blinzeln. Es ging nicht dar-
um, die Gegnerin niederzustarren. Seine Gedanken drehten
sich um die dunklen Schmierspuren am Boden, bei denen es
sich vielleicht, aber nur vielleicht, um die Hinterlassenschaften
eines Schuhabsatzes handeln konnte.

10
Mac war gerade rechtzeitig wieder auf der Straße, um zu sehen,
wie ein kleiner weißer Lieferwagen mit der Aufschrift Marco’s
Bakery aus einer Ladezone eines Feinkostgeschäfts herausge-
fahren kam.
Obwohl er beinahe auf dem Schnee ausgerutscht wäre, er-
reichte er die Ladezone noch früh genug, um zu beobachten,
wie der weiße Lieferwagen an der nächsten Ecke, etwa hundert
Meter entfernt, schlingernd nach rechts abbog.
Während er dem Wagen nachsah, war Stella zu ihm gesto-
ßen. Beide Ermittler wussten, dass es sich nicht lohnen würde,
die Verfolgung aufzunehmen. Bis sie in ihrem Wagen säßen,
wäre Guista längst verschwunden.
Mac ging zu dem Platz, an dem der Transporter geparkt
hatte und begann mit der Arbeit. Dort, wo die Fahrertür
gewesen sein musste, fand er einen Blutfleck so groß wie
ein Handballen. Guista blutete stärker. Die Rennerei zu sei-
nem Wagen hatte sich negativ auf seine Verwundung aus-
gewirkt.
Stella, die für Notfälle immer eine Ausrüstung parat hatte,
kniete sich neben den Blutfleck und nahm mit einem Tupfer
eine Probe. Danach versiegelte sie ihn in einem Plastikbeutel
und wiederholte den Vorgang nochmals.
Ein paar Passanten blieben stehen, um zu sehen, was da los
war, aber niemand blieb länger stehen als ein paar Sekunden.
Es war wieder einmal, wie so oft in New York, einfach zu
kalt.

»Und jetzt?«, fragte Stella. Als sie sich erhob, bemühte sie
sich, sich die Schmerzen in Armen und Beinen nicht anmerken
zu lassen.
»Wir rufen die Krankenhäuser an«, sagte Mac, als ein Wa-
gen mit nicht zugelassenen Schneeketten an ihnen vorbeiratter-
te. »Und wir rufen den Lieferwagen zur Fahndung aus.«
»Er blutet ziemlich stark«, sagte Stella mit einem Blick auf
das dunkelrote Blut. »Vielleicht schafft er es nicht mehr bis ins
Krankenhaus.«
»Vielleicht versucht er es auch gar nicht«, erwiderte Mac.
»Wie geht es Flack?«
»Gebrochene Rippen. Guista hat auf seinem Brustkorb ge-
sessen. Aber er kommt wieder in Ordnung«, beruhigte ihn Stel-
la. »Ich rufe jetzt einen Krankenwagen.«
»Ich geh zu ihm«, entschied Mac. »Du fährst ins Labor, er-
ledigst die Telefonanrufe, und ich …«
Macs Telefon klingelte. Er zog es aus der Tasche und drück-
te auf den Verbindungsknopf. Stella eilte an ihm vorbei zu ih-
rem Wagen, den sie einen Block weiter geparkt hatte.
»Ja«, sagte Mac.
»Hab die Kugel im Schacht gefunden«, berichtete Aiden.
»Du hattest Recht.«
»Ich komme so schnell ich kann.«
»Das ist nicht alles«, fuhr Aiden fort. »Danny hat etwas für
dich, das du dir bestimmt anhören solltest.«
»Sag ihm, ich komme so schnell wie möglich.«
Als sie sich wieder sahen, waren mindestens zwei Stunden ver-
gangen. Es war bereits kurz vor sieben. Aiden hatte immer
noch nicht geduscht und zwei Tüten voller Brot und Brötchen
aus Marco’s Bakery
standen unberührt auf dem Tisch.
Im Krankenhaus wurde Flack geröntgt und mit einem Ver-
band um seine Rippen versorgt. Mac, der ihn begleitet hatte,
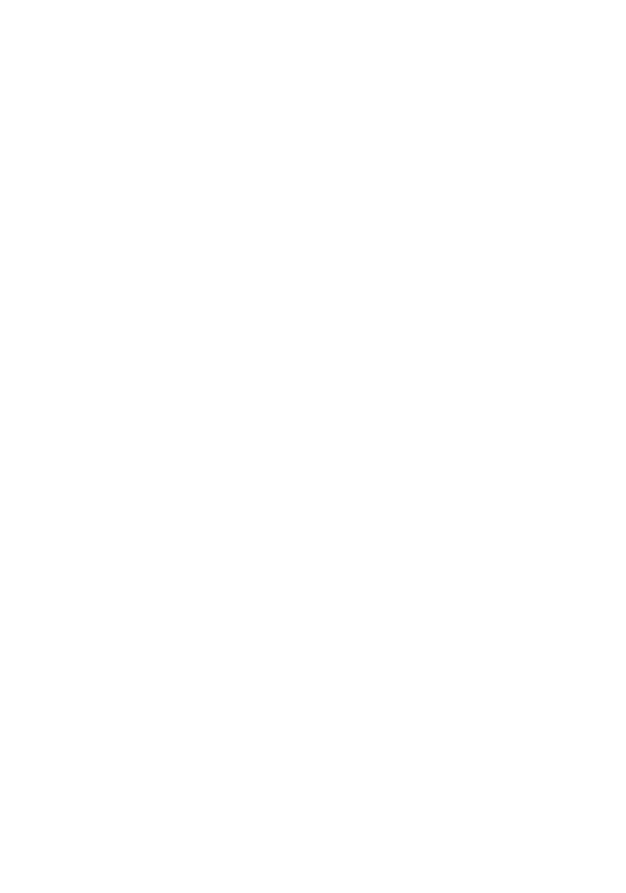
ging währenddessen in ein nahe gelegenes griechisches Restau-
rant und bestellte für sich und sein Team Gyros.
Außer Stella, die bloß an einem Pitabrot nagte, aßen alle mit
großem Appetit.
»Die Absatzspuren im Korridor der Bäckerei stammen defi-
nitiv von Colliers Schuhen.« Danny war der Erste, der von dem
aktuellen Ermittlungsstand berichtete. »Ich habe es überprüft.
Er muss in der Bäckerei umgebracht worden sein.«
Die gemeinsame Lagebesprechung wurde fortgeführt. Mac
warf Aiden einen auffordernden Blick zu.
Sie erwiderte ihn und sagte: »Die Kugel, die Lutnikov getö-
tet hat, war eine ‚22 er.«
»Louisa hat eine ‚22er«, sagte Mac.
»Aber aus der wurde nicht geschossen«, erinnerte ihn Aiden.
»Vielleicht hat sie noch eine«, sagte Mac. »Oder sie hat die
Waffe, aus der geschossen wurde, verschwinden lassen und
durch die ersetzt, die sie uns gezeigt hat.«
»Um sich von dem Verdacht zu befreien?«
»Sie ist immerhin Krimiautorin.«
»Wir hätten die Registrierung der Waffe überprüfen sollen,
die sie uns gezeigt hat«, sagte Aiden. »Haben wir genug für ei-
nen Durchsuchungsbefehl?«
»Nein«, antwortete Mac. »Sind dir Louisa Cormiers Hände
aufgefallen, als wir mit ihr gesprochen haben?«
»Sauber.«
»Sauber geschrubbt«, korrigierte Mac. »Ihre Hände waren
rot. Warum?«
Mac sah sich um und wartete.
»Erinnert an Lady Macbeth«, meinte Danny.
»Schmauchspuren«, wusste Stella. »Sie hat Angst, dass wir
etwas finden könnten.«
Mac, der von Aiden einen Bericht über Schussrückstände
erhalten hatte, erzählte Stella und Danny, worum es dabei ging.

Bei der Entladung einer Feuerwaffe werden Gase freige-
setzt, die Rückstände auf der Hand und den Kleidern des
Schützen zurücklassen – vorwiegend Blei, Barium und Anti-
mon.
»Sie kann nicht alles weggewaschen haben«, erklärte Aiden.
Die C.S.I.-Ermittler mussten Proben von Louisa Cormiers
Haut beschaffen, um sie mithilfe einer Atomabsorpti-
onsspektrometrie analysieren zu können.
»Vielleicht weiß sie gar nicht, dass sie es nicht vollständig
abwaschen kann«, sagte Mac. »Sie schaut einfach ins Internet,
liest dort die üblichen Informationen, und schrubbt ihre Hände.
Vermutlich verbrennt sie auch noch sämtliche Kleidungsstü-
cke, die sie zum Zeitpunkt des Mordes getragen hat.«
»Und weiter?«, fragte Danny. »Können wir sie zwingen, ih-
re Hand mit einem Hautwiderstandsmessgerät untersuchen zu
lassen?«
»Nicht mit den Beweisen, die wir bisher haben«, sagte Ai-
den. »Aber wir könnten ihr Angst einjagen, damit sie einen
Fehler begeht.«
»Wie?«
»Wir belügen sie«, schlug Aiden vor. »Mac ist der beste
Lügner, den ich kenne.«
»Danke«, entgegnete Mac. »Dann werde ich das gleich
morgen Früh mal ausprobieren. Gibt es etwas Neues von
Guista?«
»Bis jetzt nicht«, sagte Stella.
»Wie geht es Don?«, erkundigte sich Danny.
»Er hat das Krankenhaus verlassen«, sagte Mac. »Der Arzt
hat ihm gesagt, er solle nach Hause gehen, und hat ihm
Schmerzmittel gegeben. Vermutlich liegt er inzwischen in sei-
nem Bett.«
Aber da irrte sich Mac.

Don Flack kämpfte gegen das Zittern, während er vor einem
Haus in Flushing, Queens, stand und auf den Klingelknopf
drückte. Es war nach neun. Die langsam aufziehende Nacht
ließ die Temperatur auf minus zwanzig Grad fallen und alles
schien zu erstarren.
Im Haus brannte Licht. Er klingelte erneut und bemühte
sich, nicht zu tief einzuatmen. Der Arzt, der ihm den Verband
angelegt hatte, Dr. Singh, hatte ihm gesagt, er solle eine der
Hydrocodeintabletten schlucken und ins Bett gehen. Don hatte
nur einen Teil des Rates in die Tat umgesetzt. Er hatte eine
Tablette genommen, bevor er das Krankenhaus verlassen hatte.
Mehr nicht.
Die Tür wurde geöffnet. Die Wärme des Hauses strömte ihm
entgegen, und er sah sich einem hübschen brünetten Mädchen
im Teenageralter gegenüber, das ein Buch in der Hand hielt.
»Ja?«, fragte sie.
»Ist Mr Taxx zu Hause?«
»Ja«, sagte das Mädchen. »Ich hole ihn. Kommen Sie rein.«
Flack trat ein und schloss die Tür hinter sich zu.
»Alles in Ordnung?«, fragte ihn das Mädchen.
»Alles bestens«, gab er zurück.
Sie nickte, ging den Korridor entlang, bog nach rechts in ei-
nen Raum und rief: »Dad, da ist jemand, der dich sprechen
will.«
Kaum einen Moment später war das Mädchen schon wie-
der da.
Die Wärme des Hauses, der stechende Schmerz und das
Hydrocodein machten dem Detective zu schaffen. Er spürte,
dass er ein wenig schwankte.
»Sind Sie krank?«, fragte das Mädchen.
»Mir geht es gut«, log er.
Ed Taxx kam aus dem Zimmer heraus, in dem das Mädchen
Sekunden vorher verschwunden war. Er trug Jeans mit hoch-

gekrempelten Hosenumschlägen und ein New-York-Jets-
Sweatshirt.
»Flack, alles in Ordnung?«
»Bestens. Können wir uns unterhalten?«
»Sicher«, sagte Taxx. »Kommen Sie rein. Möchten Sie Kaf-
fee, Tee, irgendwas?«
»Kaffee«, sagte Flack, der, als er ihm folgte, mühsam ein
Zucken unterdrückte.
»Kannst du Detective Flack eine Tasse Kaffee bringen?«,
bat Flack das Mädchen.
Das Mädchen nickte.
»Sahne, Zucker, beides?«, fragte sie.
»Schwarz«, sagte Flack, bevor das Mädchen verschwand.
Taxx und er standen in einem kleinen, sauberen Wohnzimmer.
Die Möbel waren nicht neu, aber hell, ordentlich, ein Raum für
Frauen. Zwei Sofas, die beinahe zusammenpassten, standen ein-
ander gegenüber. Zwischen ihnen war ein niedriger grauer Tisch
platziert, auf dem nebeneinander die neuesten Ausgaben von En-
tertainment Weekly und dem Smithsonian Magazine lagen.
Taxx machte es sich auf einem der beiden Sofas bequem,
Flack setzte sich ihm gegenüber.
»Cliff Collier ist tot«, begann Flack das Gespräch.
»Man hat mich angerufen«, sagte Taxx und schüttelte den
Kopf. »Irgendwelche Hinweise auf den Mörder?«
»Ich habe auf ihn geschossen. Aber er ist noch irgendwo da
draußen. Er konnte entkommen.«
»Ich kannte Collier nicht besonders gut«, sagte Taxx. »Nur
dienstlich aus diesen zwei Nächten. Waren Sie ein Freund von
ihm?«
»Wir waren zusammen auf der Akademie«, erklärte Flack,
bemüht, sich nicht zu rühren, denn er wusste genau, dass jede
Bewegung zu einem neuen stechenden Schmerz in seiner Brust
führen würde.

Das Mädchen kam mit zwei gelben Bechern und Korkunter-
setzern zurück und stellte die Getränke vor den beiden Män-
nern auf den Tisch.
»Danke, Liebes.« Taxx lächelte seiner Tochter zu.
»Ich gehe wieder in mein Zimmer«, sagte sie. »Es sei denn …«
»Geh nur«, sagte Taxx.
Das Mädchen sah sich noch einmal um und ging langsam
aus dem Raum hinaus – vermutlich, so dachte Flack, in der
Hoffnung, einen Teil des Gesprächs zwischen ihrem Vater und
dem unerwarteten Besucher belauschen zu können.
»Meine Frau ist bei Nachbarn zum Bridgespielen«, sagte
Taxx.
Dann schwiegen sie und tranken ihren Kaffee.
»Haben Sie Probleme bekommen?«, fragte Flack.
Taxx zuckte mit den Schultern.
»Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Ich werde vermutlich ei-
nen Tadel kassieren, und da ich in etwa einem Jahr in den Ru-
hestand gehe, werde ich wohl nie mehr im Außendienst arbei-
ten dürfen. Ich kann nicht behaupten, dass mir das allzu viele
Sorgen bereitet. Jemand muss nun mal die Verantwortung da-
für übernehmen, dass wir unsere Hauptzeugin verloren haben.«
Flack trank. Der Kaffee war heiß, aber nicht dampfend.
»Ich schätze, die Medienleute werden behaupten, dass die
Ermordung von Cliff darauf hindeutet, dass er in den Mord
verwickelt war und daher zum Schweigen gebracht werden
musste«, sagte Don.
»Ich glaube nicht, dass das der Fall war.« Taxx trank einen
Schluck Kaffee. »Ich kannte ihn zwar nicht so gut, aber ich war
dort. Er hatte nichts mit dem Mord zu tun.«
»Dann hat derjenige, der ihn ermordet hat, angenommen,
Cliff hätte etwas gesehen«, sagte Flack. »Oder herausgefunden.
Ich vermute, dass Cliff eigenmächtig eine Spur verfolgt hat und
dabei ertappt worden ist.«

»Klingt nachvollziehbar«, sagte Taxx.
»Wer es auch war, könnte jetzt hinter Ihnen her sein.«
Taxx nickte und sagte: »Darüber habe ich auch schon nach-
gedacht. Aber ich wüsste nicht, warum.«
Flack bat Taxx, die Geschehnisse im Hotel noch einmal mit
ihm durchzugehen.
»Ich habe es Ihnen doch schon erzählt«, sagte Taxx. »Wir
haben an die Tür geklopft.«
»Wir?«
»Ich glaube, Collier war derjenige, der geklopft hat. Ich ha-
be Albertas Namen gerufen. Keine Reaktion. Collier hat die
Hand an die Tür gelegt und mich angesehen. Dann hat er mir
ein Zeichen gegeben, seinem Beispiel zu folgen. Die Tür war
kalt.«
»Wessen Idee war es, die Tür aufzubrechen?«
»Wir haben nicht darüber diskutiert. Wir haben es einfach
getan. Als wir drin waren, ist Collier ins Badezimmer gelaufen
und ich zum Bett.«
»Warum ist er ins Badezimmer gegangen?«
»Der Windzug kam von dort«, sagte Taxx. »Wir haben uns
nur kurz abgestimmt. Mit einem Nicken oder so. Sie wissen,
wie das geht, wenn man bei einem Einsatz ist.«
»Ja«, gab Flack zu. »Warum ist er ins Badezimmer gegan-
gen und Sie zu der Leiche?«
Taxx hielt die Tasse Kaffee in der Hand.
»Ich weiß es nicht. Es ist eben so gelaufen. Ich habe ihn ins
Badezimmer rennen sehen, damit blieb für mich nur das Bett.«
»Wie lange war er dort?«
»Fünf, zehn Sekunden«, sagte Taxx. »Flack, was ist los mit
Ihnen? Sie sehen …«
»Der Kerl, der Cliff umgebracht hat, saß auf meinem Brust-
korb und hat mir die Rippen gebrochen.«
»Mussten Sie weit fahren, um herzukommen?«

»War nicht schlimm.«
»Möchten Sie über Nacht hier bleiben?«, fragte Taxx. »Wir
haben ein Gästezimmer.«
»Nein, danke«, lehnte er ab. »Ich komme zurecht. Wie ist
das abgelaufen, als Alberta Spanio in dieser Nacht ins Bett ge-
gangen ist?«
»Genauso wie in den Nächten vorher. Wir haben die Fenster
überprüft, ob sie abgeschlossen waren.«
»Wer hat das gemacht?«
»Wir beide.«
»Wer hat das Badezimmerfenster kontrolliert?«
»Collier. Danach haben wir Alberta allein gelassen, und sie
hat die Tür verriegelt. Wir haben gehört, wie das Schloss ein-
rastete.«
»Und in der Nacht gab es keine Geräusche?«, hakte Flack
nach.
»Aus ihrem Zimmer? Nein.«
»Von irgendwoher?«
»Nein.«
»Vielleicht sollte man Ihr Haus unter Beobachtung stellen,
bis wir den Kerl geschnappt haben, der Cliff ermordet hat.«
»Ich bin bewaffnet«, sagte Taxx. »Und ich weiß, wie man
eine Waffe benutzt.«
»Möglicherweise sollten Sie sie bei sich tragen und nachts
neben dem Bett aufbewahren.«
Taxx zog sein Jets-Sweatshirt hoch, und darunter kam ein
kleines Holster mit einer Waffe am Gürtel zum Vorschein.
Dann ließ er das Sweatshirt wieder herunter.
»Auf den Gedanken bin ich auch gekommen, als ich erfah-
ren habe, was mit Collier passiert ist, aber bei meinem Leben,
ich weiß nicht, was Collier oder ich gehört oder gesehen haben
könnten, das Marco veranlassen könnte, uns einen Auftragskil-
ler auf den Leib zu hetzen. Er muss doch wissen, dass, wenn

mir irgendetwas zustößt, die Zeitungen voll davon wären und
man ihn fertig machen würde. Noch Kaffee?«
»Nein, danke«, sagte Flack und erhob sich vorsichtig.
»Sind Sie sicher, dass Sie nicht hier übernachten wollen?«
»Nein, danke«, wiederholte er.
»Ganz, wie Sie meinen«, sagte Taxx und begleitete ihn zur
Haustür.
»Versuchen Sie zu überlegen, ob es irgendetwas gibt, das
Sie übersehen oder vergessen haben könnten«, riet der Detecti-
ve ihm.
»Das habe ich bereits. Bin alles noch einmal durchgegan-
gen, aber … Ich werde es weiter versuchen.« Taxx öffnete die
Haustür. »Seien Sie vorsichtig da draußen.«
Flack ging hinaus in die Nacht. Die Tür fiel hinter ihm ins
Schloss und schnitt ihn damit von dem letzten bisschen Wärme
ab. Etwas stimmte nicht. Er wusste es. Er fühlte es.
Nun würde er nach Hause fahren, vorsichtig, wohl wissend,
dass der Schmerz gewonnen hatte – zumindest für den Augen-
blick, bis er zu Hause angekommen wäre und eine weitere
Hydrocodeintablette genommen hätte. Am Morgen würde er
mit Stella sprechen und sich erkundigen, ob sie inzwischen et-
was Neues herausgefunden hatte. Was er sonst noch am Mor-
gen tun würde, hing ganz davon ab, ob Stevie Guista bis dahin
geschnappt worden war.
Er stieg in seinen Wagen und griff in die Jackentasche. Die
Bewegung jagte einen hämmernden Schmerz in seinen Brust-
korb. Er zog ein Pillenfläschchen hervor und wollte es gerade
öffnen, als er es sich anders überlegte.
Der Heimweg kostete ihn beinahe zwei Stunden.
Die Frau am Videomonitor der Überwachungsanlage für die
Ampelkreuzungen des Wohnviertels hieß Molly Ives. Sie war
untersetzt, schwarz, studierte tagsüber Jura – und war zudem

hellwach. Ihre Schicht, die Nachtschicht, hatte vor fünfzehn
Minuten angefangen.
Sie entdeckte den Transporter der Bäckerei vor einer roten
Ampel an der Sechsundneunzigsten, Ecke Dritte. Sie war zu-
nächst nicht sicher, ob es der Wagen war, auf den sie laut An-
weisung achten sollte. Sie war es erst, als die Ampel auf Grün
schaltete und sie auf der Rückseite den Schriftzug Marco’s Ba-
kery erkennen konnte.
Molly Ives benachrichtigte die Telefonzentrale des NYPD,
welche einen Streifenwagen losschickte. Fünf Minuten später
schnitt der Streifenwagen dem Transporter den Weg ab, und
zwei Polizisten sprangen heraus.
Mit den Waffen in den Händen näherten sie sich dem klei-
nen Lieferwagen, ein Officer auf jeder Seite.
»Kommen Sie raus«, rief einer der Beamten. »Mit erhobe-
nen Händen.«
Die Tür des Lieferwagens wurde geöffnet, und der Fahrer
kletterte langsam heraus.
Big Stevie hatte die Blutung gestoppt. Er hatte bei laufender
Heizung auf der Ladefläche seines Transporters gesessen, hatte
sein T-Shirt ausgezogen und oberhalb seines rechten Knies auf
die Wunde gepresst. Als er die Rückseite seines Beins abtaste-
te, fand er eine Austrittswunde. Die blutete weniger, aber das
Loch war größer. Knochen waren anscheinend nicht gebro-
chen. Er wickelte das T-Shirt fest um sein Bein.
Den Lieferwagen würde er aufgeben müssen. Und er musste
einen Arzt oder eine Krankenschwester aufsuchen. Wer konnte
schon wissen, was in seinem Bein vorging? Womöglich hatte
er innere Blutungen oder eine Embolie oder so was in der Art.
Und er würde Geld brauchen, um aus der Stadt verschwinden
zu können. Steven Guistas Not war groß, und er kannte nur ei-
nen Ort, an dem man sie lindern konnte.

Er fuhr weiter, dachte daran, die Brücke nach Manhattan zu
nehmen, entschied sich aber dagegen und steuerte die Gegend
an, in der er sich am besten auskannte. Die provisorische Ban-
dage hielt einigermaßen, aber ein bisschen Blut sickerte immer
noch durch. Er fuhr zu einem öffentlichen Münzsprecher, der
vor einem Lebensmittelgeschäft stand, das vierundzwanzig
Stunden geöffnet hatte. Hier hatte er schon ein paar Dutzend
Mal gehalten. Er parkte den Wagen und humpelte zum Telefon.
»Ich bin’s«, sagte er, als die Frau den Hörer abnahm. Er
nannte ihr die Nummer des Telefons, von dem er sprach und
legte auf. Zitternd und benommen stand er da und wartete. Die
Frau rief nach zehn Minuten zurück.
»Wo sind Sie?«, fragte sie.
»Brooklyn«, sagte er. »Bin nach Hause gegangen, doch da
hat ein Cop auf mich gewartet und geschossen.«
Die Pause, die nun eintrat, hielt so lange vor, dass Stevie
fragte: »Sind Sie noch da?«
»Ja, ich bin noch da. Wie schlimm sind Sie verletzt?«
»Bein«, sagte er. »Muss zum Arzt.«
»Ich gebe Ihnen eine Adresse. Können Sie sich das mer-
ken?«
»Hab keinen Stift bei mir.«
»Dann wiederholen Sie sie leise für sich. Und lassen Sie den
Wagen stehen. Nehmen Sie ein Taxi.«
Sie nannte ihm den Namen einer Frau, Lynn Contranos, und
die Adresse. Er wiederholte beides und sie bestätigte.
»Ich rufe sie an und sage ihr, dass Sie kommen.«
Die Frau legte auf. Stevie wühlte ein paar Münzen aus der
Tasche hervor, rief die Auskunft an und ließ sich die Nummer
eines Taxiunternehmens geben. Dann bestellte er einen Wagen
und wartete. Währenddessen wiederholte er immer wieder den
Namen der Frau, die er aufsuchen sollte: Lynn Contranos,
Lynn Contranos …

Sein Geburtstag würde in wenigen Stunden vorbei sein, aber
darüber wollte er nicht nachdenken. Stattdessen musste er sich
zwingen, immer wieder den Namen der Frau zu wiederholen.
Seine Hose klebte inzwischen an seinem Bein, und sein Blut
gefror in der Kälte.
Unentwegt wiederholte er sein Mantra, während er wartete.
Er hatte nur einen einzigen Gedanken, er musste diese Frau
aufsuchen. Keinen Schritt weiter. Vielleicht würde er diese Ge-
schichte doch noch überstehen.
Fünfzehn Minuten später war immer noch kein Wagen da,
und Big Stevie setzte sich wieder in den Transporter, schaltete
die Heizung ein und wartete. Regungslos starrte er auf die
Straße.
Wenn das Taxi in zehn Minuten nicht hier ist, dachte er,
dann fahre ich. Es fiel ihm zunehmend schwerer, sich an den
Namen und an die Adresse der Frau zu erinnern. Immer wieder
verhaspelte er sich, als er die Worte wiederholte und auf einen
Wagen wartete, der vielleicht nie kommen würde.
Mac saß in seinem Wohnzimmer in dem abgenutzten braunen
Sessel. Seine Frau hatte ihn damit verwöhnt. Er hatte den Ses-
sel geliebt, fühlte sich noch heute von ihm angezogen, aber die
Liebe war fort. Es war nur noch ein Ort, an dem man sitzen
und arbeiten oder die Fernsehübertragung eines Spiels an-
schauen konnte.
Heute Abend trug er einen sauberen grauen Jogginganzug
und arbeitete. Auf dem leicht zerkratzten Holztisch neben ihm
lagen zwei Stapel Bücher, neue Bücher, die einen frischen Ge-
ruch verströmten. Außerdem ruhten dort noch siebenundzwan-
zig ordentlich getippte Bögen Papier, die von einer Büroklam-
mer zusammengehalten wurden. Auf einem kleinen Holzbrett,
das gerade so groß war wie eines der Bücher, stand ein Becher
Kaffee. Er hatte ihn in der Mikrowelle erhitzt.

Zu seinem Pensum gehörten auch eine Menge Buchkritiken,
teils älteren, teils jüngeren Datums, die er im Internet recher-
chiert und ausgedruckt hatte. Sie bezogen sich alle auf Louisa
Cormiers Pat-Fantome-Krimis.
Es war kurz vor zehn.
Die Bücher von Louisa Cormier hatte er in chronologischer
Reihenfolge geordnet. Die Besprechungen ihres Erstlingswerks
waren wohlwollend, mehr nicht. Aber der Verkaufserfolg war
phänomenal. Beim vierten Buch behaupteten die Kritiker,
Louisa Cormier hätte erfolgreich die Kurve genommen und ge-
höre nun zu den Krimiautoren der gehobenen Klasse. Von da
an verglich man sie mit Autorinnen wie Sue Grafton, Mary
Higgins Clark, Marcia Muller, Faye Kellerman und Sara Pa-
retsky.
Mac trank einen Schluck von seinem Kaffee. Er war nicht
mehr heiß genug, aber er wollte nicht noch einmal aufstehen
und die Mikrowelle anstellen. Stattdessen trank er etwas mehr
und hoffte, er würde in Louisa Cormiers Werken auf etwas In-
teressantes stoßen.
Ehe er das erste Buch aufschlagen konnte, klingelte das Te-
lefon.
Es war kurz nach zehn Uhr abends. Stella blickte Danny über
die Schulter, als sich das Bild auf dem Computermonitor im
Labor langsam aufbaute.
Stellas Augen brannten. Sie hatte keinerlei Zweifel mehr,
dass sie eine Krankheit ausbrütete. Etwas, das ihre Augen trä-
nen ließ und ein Kratzen in ihrem Hals verursachte. Sie gab
sich Mühe, beides zu ignorieren.
Das Bild auf dem Monitor sah aus, als wäre es ein Aus-
schnitt aus einem jener computergenerierten Spiele, für die im
Fernsehen so oft geworben wurde und in denen sich Menschen,
die gar nicht mehr wie Menschen aussahen, mit den brutalsten

Waffen niedermetzelten – begleitet von ohrenbetäubenden
Soundeffekten. Tatsächlich aber war es so, dass Danny mit ei-
nem speziellen Computerprogramm versuchte, die Tatortsitua-
tion und den möglichen Tathergang zu simulieren.
Auf dem Schirm zeigte sich eine Ziegelmauer, in der sich
ein einzelnes Fenster befand.
»Wie weit über dem Badezimmerfenster war Guistas Hotel-
zimmer?«, fragte er.
»Drei Meter fünfundsechzig«, sagte Stella.
Dannys Finger hüpften über die Tasten und bewegten die
Maus. Das Bild verschob sich, und plötzlich tauchte ein zwei-
tes Fenster auf.
»Verkleinere es, damit wir beide Fenster sehen können.«
Danny tat es. Die Fenster waren nun direkt übereinander.
»Es war Nacht«, erinnerte sie ihn.
Danny ließ es Nacht werden.
»War das Badezimmerlicht eingeschaltet?«, fragte er.
Stella zog ihre Notizen und ein kleines Päckchen Taschen-
tücher hervor. Sie blätterte und sagte: »Sie hat mit eingeschal-
tetem Badezimmerlicht geschlafen.«
Und schon leuchtete ein gelber Lichtschein in dem unteren
der beiden Fenster auf.
»Dann kommt jetzt die Kette, die aus Guistas Zimmer her-
unterbaumelte.«
Stella putzte sich die Nase.
»Ketten, Ketten, Ketten, Ketten«, wiederholte Danny leise,
schob die Brille hoch und klickte auf eine Maustaste. »Hier.
Such dir eine Kette aus.«
Er führte den Cursor abwärts.
»Diese ist der, die tatsächlich benutzt wurde, recht ähnlich«,
sagte er.
»Kannst du sie aus Guistas Zimmer herunterhängen las-
sen?«, fragte Stella.

»Du brütest eindeutig etwas aus.« Danny schaute sie mitlei-
dig an.
»Wenn er die Kette dazu benutzt hat, jemanden abzuseilen«,
sagte Stella, statt auf seine Bemerkung einzugehen, »dann
muss dieser Jemand klein und mutig gewesen sein und gehofft
haben, dass das Badezimmerfenster offen ist.«
»Oder gewusst haben, dass es offen ist«, fügte Danny hinzu.
»Kannst du eine Person an das Ende der Kette hängen?«
Eine Figur, männlich und gekleidet wie ein Ninja, tauchte auf.
»Mach ihn kleiner.«
Danny machte die Figur kleiner.
»Kannst du das Fenster öffnen?«
»Wie breit war das Fenster in geöffnetem Zustand?«
Sie blätterte erneut in ihren Notizen. »Etwa fünfunddreißig
Zentimeter.«
Danny öffnete das Fenster in entsprechender Weise.
»Eng«, sagte er. »Soll ich den Ninja noch kleiner machen?«
»Klar«, sagte sie.
»Erledigt.«
»Wenn du das ins Verhältnis setzt, wie schwer dürfte er o-
der sie höchstenfalls sein?«, fragte Stella.
Danny lehnte sich zurück, überlegte und sagte: »Vielleicht
fünfundvierzig Kilo. Maximal fünfzig.«
»Er musste das Fenster öffnen und sich hineinschwingen«,
überlegte Stella.
»Und er musste auch wieder durch das Fenster hinausklet-
tern«, erinnerte sie Danny. »Ein Akrobat? Vielleicht sollten wir
Turner und Zirkusakrobaten überprüfen.«
Stella überlegte kurz. »Kannst du dort, wo wir an dem Ba-
dezimmerfenster von Alberta Spanio das Schraubenloch ent-
deckt haben, irgendwas platzieren?«
»Irgendwas?«
»Ein rundes Stück Metall.«

»Durchmesser?«
»Fang groß an, sagen wir zwölfeinhalb Zentimeter.«
Danny suchte. Ein Kreis erschien am unteren Rand des Ba-
dezimmerfensters.
»Kannst du es senkrecht zum Fenster drehen?«, fragte sie.
»Ich kann es versuchen.«
Er bewegte den Kreis, sodass er als dreidimensionaler Ring
erkennbar war.
Beide schauten auf den Monitor und kamen zum gleichen
Schluss.
»Sagst du es oder soll ich?«, fragte er.
»Schmeiß den Ninja raus«, sagte sie.
»Gemacht«, sagte Danny, und der Ninja war verschwunden.
»Verbinde das Ende der Kette mit dem Ring und …«
Noch bevor sie den Satz beenden konnte, war es erledigt.
»Guista hat die Kette mit dem Ring verhakt und gezogen,
bis der Ring mit der Schraube abgesprungen ist«, sagte Danny
und führte das Geschehen am Monitor vor. »Das ist passiert.
Das erklärt auch, warum er eine Metallkette statt eines Seils
benutzt hat. Ein Seil hätte der Kraft des Windes nicht wider-
standen. Mit einer Kette und einem Haken war der Ring besser
zu greifen. Und dann hat er die Person runtergelassen, die Al-
berta Spanio ermordet.«
»Warum konnte der Mörder das Fenster nicht einfach öffnen
und hineinklettern?«, fragte Stella, ohne den Blick vom Bild-
schirm zu wenden. »Warum dieser Aufwand mit Ring und Kette?
Vielleicht ist der Mörder gar nicht durch das Fenster gekommen.«
»Warum sollte jemand sich so viel Mühe geben, ein Fenster
zu öffnen, wenn er es gar nicht benutzen will?«, konterte Danny.
»Vielleicht, um die Temperatur im Schlafzimmer unter den
Gefrierpunkt sinken zu lassen, damit wir den Todeszeitpunkt
nicht exakt ermitteln können.«
»Wozu denn das?«

Stella zuckte mit den Schultern.
»Vielleicht wollten sie es nur so aussehen lassen, als wäre
jemand durch das Fenster gekommen«, schlug Danny vor. »A-
ber der Schnee war dabei im Weg.«
»Wir übersehen immer noch etwas«, sagte Stella und nieste.
»Erkältung.« Danny sah sie an. »Vielleicht auch eine Grippe.«
»Allergie«, entgegnete Stella. »Wir müssen Guista finden
und ein paar Antworten aus ihm herauskitzeln.«
»Falls er noch lebt«, sagte Danny.
»Falls er noch lebt«, wiederholte Stella.
»Ich habe Vitamin-C-Tabletten in meinem Koffer. Willst du
eine?«
»Gib mir drei.«
Danny erhob sich, musterte dabei aber immer noch das Bild
auf dem Monitor.
»Was?«, fragte Stella.
»Vielleicht irren wir uns«, sagte er. »Vielleicht ist doch je-
mand an dieser Kette runtergeklettert.«
»Der kleine Mann, den der Portier in Guistas Begleitung ge-
sehen hat?«, fragte sie.
»Zurück zum Anfang?«, fragte Danny.
»Vielleicht finden wir ja etwas in der Datenbank«, überlegte
Stella.
»Also doch die Suche nach dem kleinen Mann«, sagte Dan-
ny. »Gehen wir heim und fangen morgen noch einmal an.«
Normalerweise hätte Stella etwas gesagt wie ›Geh nur, ich
habe noch ein paar Dinge zu erledigen.‹ aber nicht heute A-
bend. Sie bestand nur noch aus einem großen Schmerz, und
›heimgehen‹ klang in ihren Ohren ausgesprochen verlockend.
Beide fuhren nach Hause. Vielleicht würden am nächsten
Morgen schon wieder neue Beweise auftauchen und ihre Theo-
rien über den Haufen werfen.

Die beiden schwarzen Jugendlichen, die aus dem Lieferwagen
der Bäckerei sprangen und die Hände hoch in die Luft streck-
ten, konnten nicht viel älter als fünfzehn Jahre sein.
Die Polizistin, eine schwarze Frau namens Clea Barnes,
hielt ihre Waffe auf den Fahrer gerichtet. Ihr Partner, Barney
Royce, war zehn Jahre älter als Clea und kein annähernd so gu-
ter Schütze. Auf dem Schießplatz war er immer nur durch-
schnittlich gewesen. Glücklicherweise hatte er in seinen sechs-
undzwanzig Dienstjahren nie auf jemanden schießen müssen.
Clea, die gerade vier Jahre dabei war, hatte bereits auf drei
Verbrecher geschossen. Keiner von ihnen war gestorben. Bar-
ney nahm an, dass Punks und Säufer Clea für eine leichte Geg-
nerin hielten. Aber da irrten sie sich gewaltig.
»Weg von dem Laster«, befahl Barney.
»Wir haben nichts getan«, schrie der Fahrer auf eine Art, die
den beiden Polizisten nur allzu vertraut war.
Die beiden Jungs, beide in schwarzen Wintermänteln ohne
Mützen oder Schals, sahen den Lieferwagen an, als hätten sie
ihn gerade erst bemerkt.
»Meinen Sie diesen Laster?«, fragte einer von ihnen, als
Barney näher trat, um die beiden Jungs nach Waffen abzusu-
chen. Sie waren sauber.
»Genau«, sagte Clea geduldig.
»Ein Freund hat uns damit fahren lassen«, behauptete der
Fahrer.
»Dann erzählt uns mal von eurem Freund«, forderte Barney
sie auf.
»Nur ein Freund«, gab einer der Jungs mit einem Schulter-
zucken zurück.
»Name, Hautfarbe.«
»So ein weißer Kerl. Den Namen hab ich nicht verstanden.«
»Ihr kennt seinen Namen nicht, aber er lässt euch mit sei-
nem Wagen fahren?«, hakte Barney nach.

»Genau«, sagte der Junge.
»Eine Chance habt ihr noch«, sagte Clea. »Wir packen euch
ein, nehmen eure Fingerabdrücke und lassen euch dann wieder
laufen, wenn ihr uns die Wahrheit erzählt. Jetzt. Und keinen
weiteren Blödsinn mehr. In Ordnung?«
Der Junge, der den Wagen gefahren hatte, schüttelte den
Kopf und sah seinen Kumpel an.
Der zweite Junge machte den Mund auf.
»Wir waren in Brooklyn«, sagte er. »Haben Freunde be-
sucht. Auf dem Weg zur U-Bahn haben wir diesen großen, al-
ten, weißen Kerl rumlaufen sehen. Ist vor so einem Lebensmit-
telladen rumgehumpelt. Das war nicht gerade die Gegend, in
der man damit rechnet, dass irgendwelche Weißen rumspazie-
ren, egal wie groß sie sind.«
»Also habt ihr beschlossen, ihn auszurauben?«, fragte Bar-
ney.
»Das habe ich nicht gesagt. Aber während wir uns unterhal-
ten haben, ist ein Taxi gekommen, und er ist eingestiegen. Wir
haben uns den Lieferwagen angesehen, als er weg war. Der
Schlüssel steckte noch.«
»Und ihr habt ihn genommen?«, fragte Clea.
»Schneller als die U-Bahn«, kommentierte der erste Junge.
»Wo ist dieser Laden in Brooklyn?«, fragte Barney.
»Flatbush Avenue«, verriet ihnen der zweite Junge. »J.V.’s
Deli.«
»Also«, sagte Clea, »die große Frage, die euch den Hals ret-
ten wird, falls ihr nicht wegen irgendetwas gesucht werdet, lau-
tet: Was war das für ein Taxi, und um welche Zeit ist der weiße
Mann da eingestiegen?«
Der zweite Junge lächelte und sagte: »Es war eine Limousi-
ne von einem Taxiunternehmen. Green Cab Nummer 4304. Hat
ihn ein paar Minuten nach neun abgeholt.«

Aiden hatte ihre Dusche bekommen, sich die Haare gewaschen,
ihren wärmsten Pyjama angezogen und das Fernsehgerät in ih-
rem Schlafzimmer eingeschaltet. The Daily Show würde in ei-
ner halben Stunde anfangen. In der Zwischenzeit schaltete sie
um auf CNN, legte sich mit einem Schreibblock ins Bett und
warf bisweilen einen Blick auf den Nachrichtenticker am unte-
ren Rand des Bildschirms.
Auf den Block schrieb sie:
Erstens: Cormiers Agentin anrufen. Nach der .22er fragen,
die sie ihr angeblich gegeben hat. Und nach den Manuskripten,
die Cormier geliefert hat. Auf Diskette? Ausgedruckt?
Zweitens: Haben wir genug, um einen Durchsuchungsbefehl
für Cormiers Appartement zu beantragen? Mit Mac abspre-
chen.
Drittens: Alle Bewohner, die den Lift benutzt haben, über-
prüfen, ob jemand eine .22er besitzt. Vielleicht irren wir uns in
Bezug auf Cormier. Glaube ich aber nicht.
Von der Kugel war nicht mehr viel übrig, aber es war ge-
nug, um sie mit der Waffe zu vergleichen, sollte je eine gefun-
den werden.
Während sie mit halbem Ohr der Daily Show lauschte, ver-
suchte sie, darüber nachzudenken, ob sie irgendetwas überse-
hen hatte. Sie machte sich noch ein paar weitere Notizen, als
die Show vorbei war, dann schaltete sie um auf ABC, um sich
anzusehen, was Nightline zu bieten hatte. Es ging um die Fra-
ge, ob Serienmörder böse sind. Als Gäste waren ein Anwalt,
ein Profiler des FBI, ein Psychologe und ein Psychiater gela-
den.
Aiden schaltete den Fernseher mit der Fernbedienung aus.
Sie wusste, dass das Böse existierte. Sie hatte es gesehen, hatte
ihm gegenüber am Tisch gesessen. Es gab einen Unterschied
zwischen einer Person, die einfach nur verrückt war, und einer,
die tatsächlich böse war.

Aber das war keine wissenschaftliche Diagnose und kein
nachvollziehbarer Grund dafür, warum einige Menschen mor-
deten. Für solche Fälle gab keine klinische Beschreibung,
nichts, das man ihnen hätte zuordnen können. Es gab Dutzende
von psychologischen Definitionen, in die Serienmörder einge-
teilt wurden – brutale Ein- oder Zweifachtäter, Kinderschänder –
aber nichts von alldem entsprach einer Person, die einfach nur
böse war.
Sie wollte die Gedanken so kurz vor dem Schlafen nicht
weiterführen, wollte nicht schon wieder die Argumente für o-
der gegen die Todesstrafe durchgehen. Wenn jemand tatsäch-
lich böse war, dann gab es für ihn oder sie keine Therapie und
keine Behandlung auf der ganzen Welt. So eine Person schloss
man entweder für immer weg oder exekutierte sie.
Sie schaltete das Licht aus und schlief beinahe auf der Stelle
ein.
Big Stevie gab dem Fahrer nicht die exakte Adresse. Er wollte
nicht, dass er sie notierte oder sich erinnern konnte. Stattdessen
nannte er ihm eine Straße, die einen Block entfernt war. Lieber
wären ihm zwei Blocks gewesen, aber er traute seinem pulsie-
renden Bein nicht mehr zu.
Es gab nur ein Problem. Stevie hatte die Adresse in Gedan-
ken ständig wiederholt und fürchtete, er könnte sie vergessen,
wenn er dem Fahrer eine andere nannte. Doch er musste vor-
sichtig sein. Mr Marco würde es auch so wollen.
Als der Wagen hielt, bezahlte Stevie den Fahrer und gab
ihm ein bescheidenes Trinkgeld, nicht zu viel, nicht zu wenig.
Dann versuchte er, seinen Schmerz zu verbergen. Unter größter
Anstrengung stieg er aus dem Wagen und lief über die Straße.
Er verzog keine Miene – niemandem sollte etwas auffallen.
Der Fahrer fuhr weiter, kaum dass Stevie die Tür geschlos-
sen hatte. Er fragte gar nicht, ob er warten solle. Stevie fand

sich in einem ihm vage vertrauten Bereich von Brooklyn
Heights wieder. Es gab keinen Bürgersteig, aber es fuhr sowie-
so kein Auto die schmale Straße, die von den dreistöckigen
Backsteingebäuden gesäumt war, hinunter. Zusammen mit den
Schneemassen stapelte sich der Müll seitlich der Fahrbahn und
erinnerte fast an eine Befestigungsmauer.
Stevie befand sich auf der Straßenseite, die seinem Zielort
gegenüberlag. Er humpelte wieder, wurde mit jedem Schritt
schwächer und wusste, dass die Blutung wieder eingesetzt hat-
te. Er hatte vermutlich Blut auf dem Sitz des Taxis hinterlas-
sen. Nicht zu ändern.
Er wollte gerade die Straße überqueren, als ihm ein Fahr-
zeug auffiel. Es parkte wenige Meter vor ihm auf der gleichen
Straßenseite. Die Fenster waren beschlagen, und der Motor
brummte leise im Leerlauf.
Er dachte, er würde zwei Gestalten auf den Vordersitzen er-
kennen, aber die beschlagenen Scheiben verhinderten die Sicht.
Beobachteten sie den Eingang zu dem Gebäude, in das er woll-
te?
Cops? Nein, unmöglich. Vielleicht warteten die gar nicht
auf ihn. Vielleicht warteten sie auf jemand anderen oder sie
hatten angehalten, um irgendetwas zu besprechen oder … Ste-
vie glaubte nicht daran. Was ihm heute widerfahren war, hatte
ihn zum Denken gezwungen. Dabei zog er es vor, andere für
sich denken zu lassen, Leute, denen er trauen konnte wie Mar-
co. Aber das war jetzt ein Problem. Er fing an, Marco zu miss-
trauen.
Denk nach, sagte er sich, als er in den Schatten eines dunk-
len Hauseingangs trat, aus dem heraus er die beiden Leute in
dem Wagen einige Zeit lang beobachten wollte.
Ich habe den Job im Hotel erledigt. Ich habe einen Cop um-
gebracht. Ich habe einen anderen Cop in die Mangel genom-
men. Marco könnte besorgt sein. Er könnte befürchten, dass ich

rede, sollte ich geschnappt werden. Er sollte es besser wissen,
aber er könnte besorgt sein. Kann ich ihm das vorwerfen? Ja.
Er konnte nicht länger warten. Stevie musste irgendwohin
gehen, wo er wieder zusammengeflickt werden würde. Er blu-
tete, und das nicht zu knapp.
Sollte er das Risiko mit Lynn Contranos eingehen? Er kann-
te sie nicht. Oder sollte er sich überlegen, wohin er sonst gehen
könnte? Er hatte eigentlich keine Wahl. Naja, vielleicht eine,
aber die wollte er nach Möglichkeit meiden. Er überquerte die
Straße und steuerte das Backsteingebäude an. Er sah sich nicht
um, aber er hörte, wie hinter ihm die Wagentür geöffnet und
wieder geschlossen wurde.
Er fand den Namen auf dem Kunststoffschild. Lynn Contra-
nos, Massagetherapie. Er drückte auf den Knopf, fühlte, wie
sich zwei Personen von hinten näherten. Keine Reaktion. Er
drückte noch einmal auf den Knopf, und die Stimme einer Frau
erklang aus dem kleinen Lautsprecher. »Ja?«
»Steven Guista«, sagte er.
»Bin gleich da.« Die Stimme der Frau klang gedämpft, und
sie unterbrach die Verbindung mit einem leisen Klicken.
Kannte er diese Stimme? Stevie war nicht sicher. Ein paar
Sekunden später hörte er ein metallisches Summen, das von der
Eingangstür kam. Er streckte die Hand nach dem Türgriff aus
und spürte, dass die beiden Personen nur noch ein paar Schritte
von ihm entfernt waren. Statt die Tür zu öffnen, drehte sich Big
Stevie abrupt um und überraschte die beiden Männer, die sehr
viel jünger waren als er. Und keiner von ihnen war so groß wie
er. Einer der Männer hielt eine Waffe in der rechten Hand.
Stevie kannte beide. Einer war Bäckergehilfe in Marco’s
Bakery. Der andere war dort Sicherheitsangestellter. Er war
auch derjenige, der die Waffe hielt.
Stevie zögerte nicht. Seine Faust donnerte tief in den Bauch
des Mannes, der daraufhin nach vorn zusammenklappte.

Gleichzeitig streckte Stevie die freie Hand nach dem Hals des
anderen Mannes aus.
Stevie vergaß den Schmerz in seinem Bein und konzentrier-
te sich ganz einfach darauf, sein Leben zu retten.

11
»Wer?«, fragte Danny am nächsten Morgen, nachdem Stella
die E-Mail laut vorgelesen hatte, die gerade auf dem Bild-
schirm vor ihr angezeigt wurde.
Danny hatte nicht gut geschlafen. Er hatte von einer Kette
geträumt, die im kalten Wind hin und her baumelte und da-
von, wie er versucht hatte, daran herabzuklettern. Immer wie-
der waren seine Hände abgeglitten und ein Stück tiefer ge-
rutscht. Er wusste, dass er irgendwann am Ende der Kette an-
kommen und in die unter ihm liegende Finsternis stürzen
würde. Er hatte um Hilfe gerufen, aber durch das Pfeifen des
Windes konnte ihn niemand hören. Um fünf Uhr morgens war
er froh gewesen, aus dem zu Bett klettern und zur Arbeit ge-
hen zu können.
»Jacob Laudano«, sagte Stella.
Danny blickte über ihre Schulter auf den Bildschirm und las
laut vor: »Jacob, der Jockey?«
»So wird er genannt«, sagte sie.
»Er ist Jockey?«
»War«, korrigierte sie.
»Was bedeutet …«, setzte Danny an.
»Dass er vermutlich ziemlich klein ist«, ergänzte Stella den
Satz. »Sehen wir mal …«
Sie benutzte die Maus und drückte ein paar Tasten.
»Zum letzten Mal wurde er im August festgenommen, und
da war er ein Meter siebenundvierzig groß und hat einundvier-
zig Kilo gewogen. Sieh dir sein Strafregister an.«

Danny folgte ihrer Aufforderung. Die Liste war lang und
umfasste auch einen tätlichen Angriff auf eine Prostituierte und
fünf Festnahmen wegen Kneipenschlägereien, und jedes Mal
war ein Messer im Spiel gewesen.
»Laudano ist bereits als Partner von Steven Guista be-
kannt«, sagte Stella.
»Und was jetzt?«, fragte Danny.
»Wir hängen ein Einundvierzig-Kilo-Gewicht an die Kette«,
sagte sie, »lassen sie drei Meter und fünfundsechzig Zentimeter
weit herunterhängen und sehen, ob sie hält.«
»Dafür brauchen wir ein längeres Stück Kette.«
»Brauchen wir«, stimmte Stella zu. »Aber das kann warten.
Guistas Transporter wurde gestern Nacht gefunden. Er steht in
einer Verwahrungsstelle auf Staten Island.«
»Dann gehen wir da zuerst hin?«, fragte Danny.
Stella schüttelte den Kopf. »Nein, zuerst fahren wir nach
Brooklyn.«
»Brooklyn«, wiederholte Danny. »Warum?«
»Guista hat sich letzte Nacht in Brooklyn von einem Taxi ab-
holen lassen«, erklärte sie, griff nach einem Bericht, der neben
ihrem Schreibtisch lag, und reichte ihn an Danny weiter. »Wir
müssen das Taxiunternehmen überprüfen. Herausfinden, wohin
er gefahren ist. Sollte kein Problem sein. Einer der beiden Jungs,
die sich Guistas Lieferwagen für eine Spritztour ausgeliehen ha-
ben, hat sich an das Fahrzeug und die Uhrzeit erinnert.«
»Das wird ein arbeitsreicher Tag«, sagte Danny. »Was ist
mit Laudano, dem Jockey?«
»Flack ist schon dran.«
»Er sollte eigentlich im Bett sein.«
»Er sollte eigentlich im Krankenhaus sein«, erwiderte Stella.
»Aber da ist er nicht. Er ist auf der Straße. Also gehen wir.«
»Da wir gerade vom Krankenhaus sprechen, du siehst keine
Spur besser aus als gestern.«

»Mir geht es gut.«
»Dein Gesicht ist rot. Du hast Fieber.«
Stella ignorierte seine Worte, schaltete den Computer auf
Stand-by und heftete einen kleinen Stapel Berichte in einem
Aktenordner ab. Dann erhob sie sich.
»Der Jockey«, sagte Danny beinahe im Selbstgespräch.
»Wer hätte das gedacht. Das ergibt keinen Sinn.«
»Warum nicht?«, fragte Stella, als sie zur Labortür voran-
ging.
»Ein betrügerischer Gewerkschaftsboss mit Verbindungen
zum organisierten Verbrechen heuert einen Zirkusartisten an,
um eine Zeugin zu ermorden? Ein starker Mann und ein …«
»Kleiner Kerl«, ergänzte Stella.
»Warum?«, fragte Danny. »Sie mussten doch auffallen.«
Stella schnappte sich mit der linken Hand ihren Koffer und
mit der rechten den Aktenordner. Danny übernahm ihren Platz
am Computer.
»Vielleicht sollen wir ja tatsächlich auf eine falsche Fährte
gelockt werden«, überlegte sie.
»Sie könnten uns an der Nase herumgeführt haben«, meinte
Danny.
»Meine juckt jedenfalls«, sagte sie lächelnd.
Danny ächzte.
Stella verließ das Labor und ging zum Fahrstuhl. Sie hustete
heiser und mühevoll.
»Warum?«, fragte Michelle King. Sie war eine nervöse Frau Ende
vierzig und Louisa Cormiers Agentin. Wie Louisa war auch sie
sehr gepflegt, schlank und in ein schwarzes Kostüm und eine
weiße Bluse gekleidet. Sie verfügte nicht über das gute Aussehen
ihrer Klientin, aber das machte sie mit einer angenehmen, von
Selbstbewusstsein getragenen Ernsthaftigkeit wett. Der Raum
roch nach Zigaretten und Blumenduft aus der Sprühflasche.

Aiden saß auf einem der Stühle in Kings Büro an der Madi-
son Avenue. King spielte mit einem Stift und tippte immer
wieder ungeduldig auf die Tischplatte ihres Mahagonischreib-
tischs.
»Warum?«, fragte Michelle King noch einmal.
Mac sah sie zehn Sekunden lang an und sagte: »Wir können
Sie zum Revier mitnehmen und darüber diskutieren. Ich glaube
nicht, dass es Ihnen dort gefallen wird. Leichen und Be-
weisstücke, die die meisten Leute nicht anrühren würden und
am liebsten nie zu Gesicht bekämen.«
»Ich habe Louisa geraten, sich eine Waffe zuzulegen und sie
geladen in ihrem Appartement zu verwahren«, gab Michelle
King zu und griff nach einer Zigarette aus dem Päckchen in ih-
rer Schreibtischschublade.
»Macht es Ihnen etwas aus?«, fragte sie und hielt mit zittri-
ger Hand die Zigarette hoch.
»Wir werden Sie deswegen nicht festnehmen, falls Sie sich
darüber Sorgen gemacht haben«, sagte Mac. Rauchen war nur
in städtischen Gebäuden verboten. »Viele, mit denen wir es zu
tun bekommen, rauchen«, fuhr er fort. »Wir akzeptieren das.
Das ist eben eines von unseren Berufsrisiken.«
»Passivrauchen?«, fragte Michelle King, als sie sich die Zi-
garette mit einem versilberten Feuerzeug anzündete. »Das ist
ein Mythos, den die fanatischen Rauchgegner erfunden haben,
weil sie nichts Besseres zu tun haben.«
»Und aktiver Mord?«, erwiderte Mac. »Ist das auch nur ein
Mythos?«
Die Agentin sah Aiden an. Diese schwieg, was die Agentin
mehr aus der Fassung brachte als Macs Frage.
»Also schön«, sagte King. »Ich habe ihr geraten, sich eine
Waffe anzuschaffen. Ich habe ihr eine empfohlen, die ich auch
besitze.«
»Können wir Ihre Waffe sehen?«

»Denken Sie, ich habe den Mann erschossen?«, fragte sie
empört, stieß eine Rauchwolke hervor und hörte vorüberge-
hend damit auf, mit dem Stift zu pochen.
»Wir wissen nur, dass er tot ist«, sagte Mac.
»Warum um alles in der Welt sollten Louisa oder ich diesen
Mann umbringen wollen, wer auch immer er war?«
»Sein Name war Charles Lutnikov«, sagte Aiden. »Er war
Autor.«
»Nie von ihm gehört.« Michelle King drückte ihre Zigarette aus.
»Ihr Name und ihre Telefonnummer stehen aber in seinem
Adressbuch.«
»Mein …«
»Er hat in der letzten Woche dreimal in Ihrem Büro angeru-
fen«, sagte Aiden. »Das steht in der Abrechnungsliste der Tele-
fongesellschaft.«
»Ich habe nie mit ihm gesprochen«, beharrte King.
»Ihre Sekretärin vielleicht?«, schlug Mac vor.
»Warten Sie, bei dem Namen klingelt etwas«, sagte King.
»Ich glaube, das könnte der Name dieser Person sein, die stän-
dig ihre Telefonnummer hinterlassen hat. In der Nachricht, die
mir Amy, meine Assistentin, hinterlassen hatte, hieß es, er habe
mir etwas Wichtiges zu sagen.«
»Aber Sie haben nicht zurückgerufen?«
Sie zuckte mit den Schultern.
»Amy sagte, er hätte einen nervösen Eindruck gemacht, sei
sehr hartnäckig gewesen und … naja, ich bin Agentin. Ich wer-
de ständig von irgendwelchen Spinnern angesprochen, die mit
mir über ihre tollen Buchideen reden wollen. Eine von Amys
Aufgaben ist es, mir diese Leute vom Hals zu halten.«
»Aber dieser Spinner lebte im selben Appartementgebäude
wie eine Ihrer wichtigsten Klientinnen«, sagte Aiden.
»Meine wichtigste«, korrigierte King. »Das war mir nicht
bewusst.«

Sie griff in ihre Schreibtischschublade und brachte plötzlich
eine kleine Waffe zum Vorschein. Sie hielt sie auf Aiden ge-
richtet, doch diese zuckte nicht einmal mit der Wimper.
»Meine Waffe«, sagte King und schob sie über den Tisch.
Mac nahm sie an sich und reichte sie an Aiden weiter, die
kurz danach verkündete: »Wurde nie abgefeuert.«
»Sie ist nicht einmal geladen«, sagte King. »Das ist wie mit
der Chenilledecke, die ich hatte, als ich ein kleines Mädchen
war. Ich hatte sie zu meiner Beruhigung immer bei mir. Sie hat
mir ein Gefühl von Sicherheit vermittelt, das ich mir selbst
vorgegaukelt habe und von dem ich glaubte, es sei real.«
»Was passiert mit Luisa Cormiers Manuskripten, nachdem
Sie sie bekommen haben?«, fragte Mac.
»Sie gibt mir ihre Manuskripte nicht«, sagte King. »Sie
schickt sie mir per E-Mail. Ich lese sie und schicke sie weiter
an ihren Lektor. Louisas Werke erfordern wenig Nachbearbei-
tung – sowohl ich als auch der Lektor haben kaum etwas zu
beanstanden. Sie arbeitet immer sehr gewissenhaft .«
King griff erneut zu dem Stift, und machte Anstalten, wie-
der auf die Tischplatte zu klopfen. Dann überlegte sie es sich
anscheinend anders und warf ihn zur Seite.
»Was ist mit den ersten drei Büchern?«, fragte Mac.
King musterte ihn misstrauisch.
»Die ersten drei Bücher waren … ein bisschen ungeschlif-
fen«, gab sie zu. »Sie mussten überarbeitet werden. Woher
wissen Sie das?«
»Ich habe sie gestern Abend gelesen, ebenso wie das vierte
und fünfte Buch. Etwas hat sich verändert.«
»Mit Erfahrung und zunehmendem Selbstvertrauen wurde Loui-
sas Arbeit, wie ich mit Freuden berichten kann, ständig besser.«
»Haben Sie die Bücher auf Ihrer Festplatte?«, fragte Mac.
»Ja. Außerdem habe ich natürlich noch Disketten und Aus-
drucke sämtlicher Bücher.«

»Wir würden uns die Disketten gern ausleihen.«
»Ich werde Amy sagen, sie soll Kopien für Sie anfertigen«,
sagte King. »Aber warum wollen Sie …?«
»Wir werden Ihre Zeit nun nicht länger in Anspruch neh-
men.« Mac erhob sich.
Aiden folgte seinem Beispiel.
King blieb sitzen.
»Wir bleiben in Verbindung«, sagte Mac auf dem Weg zur
Tür.
»Ich hoffe aufrichtig, dass das nicht der Fall sein wird«, er-
widerte die Agentin und griff nach ihren Zigaretten.
Als sie das Vorzimmer passiert hatten und auf den Korridor
hinaustraten, sagte Aiden: »Sie lügt.«
»Worüber?«
»Diese ersten drei Bücher«, sagte sie.
Mac nickte. »Sie beschützt ihr goldenes Kalb.«
»Also?«, fragte Aiden.
»Gehen wir Louisa Cormier besuchen.«
Stella bemerkte Blutflecken auf dem verschneiten Gehweg
gleich neben einem schwarzen Kunststoffmüllbeutel.
Der Fahrer, ein Nigerianer namens George Apappa, hatte ihr
gezeigt, wo der Mann, der auf seiner Rücksitzbank geblutet
hatte, ausgestiegen war. Das Blut hatte George entdeckt, kaum
dass er zu Hause in Jackson Heights angekommen war. Er hat-
te es nicht übersehen können. Es war eine kleine Pfütze auf
dem Boden und eine dunkle, immer noch feuchte Schliere auf
dem Sitz.
Die Blutflecken zu entfernen hatte George beinahe eine
Stunde gekostet. Gegen zwei Uhr morgens war er mit seiner
Frau zu Bett gegangen. Um sechs hatte das Telefon geklingelt –
seine Zentrale forderte ihn auf, sofort in der Garage des Taxi-
unternehmens zu erscheinen. Er hatte Stella all das im Tonfall

eines Mannes erzählt, der fest vorgehabt hatte, bis mittags zu
schlafen, sich aber stattdessen mit der vagen Befürchtung, ge-
feuert zu werden, wenn er nicht in der Garage einträfe, aus dem
Bett gequält hatte. Stella wusste, dass ein Zwanzigdollarschein
ihm helfen würde, über den Schlafmangel hinwegzukommen.
Stella spürte, wie George Apappa sie aus seinem Taxi her-
aus beobachtete. Sie schnäuzte sich die Nase und machte ein
Foto von dem Schneehaufen, ehe sie mit einer Schaufel eine
kleine Probe davon in einem Plastikbeutel verschwinden ließ.
Dann fing sie an, langsam den Gehsteig entlangzugehen. Al-
le paar Schritte blieb sie stehen, um ein weiteres Foto zu ma-
chen. Der Spur des gefrorenen Bluts zu folgen, war nicht
schwer. Da bisher nur wenige Fußgänger unterwegs waren, war
der vereiste Gehweg fast noch unberührt.
Stella fühlte ihre Stirn. In ihrem Koffer hatte sie ein Ther-
mometer, doch sie brauchte es nicht herauszuholen, um zu wis-
sen, dass sie Fieber hatte. Außerdem gehörte es zu ihrer Aus-
rüstung und war für die Toten reserviert. Bevor sie losgefahren
war, hatte sie im Labor noch drei Aspirin mit einem Glas O-
rangensaft getrunken. Aber die Hoffnung, dass das in irgendei-
ner Weise helfen würde, hatte sie inzwischen aufgegeben.
Sie folgte weiter den Blutspuren und kam nach vier Minuten
zu der Eingangstür. Hier waren die Blutspritzer nicht sehr groß,
aber trotzdem gut sichtbar. Auf der Schwelle war außer dem
Blut noch etwas Gelblich-Braunes, das aussah wie Erbroche-
nes. Sie machte einige Fotos, nahm eine Probe von der gelblich
braunen Pampe und wollte sich gerade wieder aufrichten, als
sie etwas Weißes in dem Riss einer Betonstufe aufblitzen sah.
Sie ging wieder in die Knie und erkannte einen Zahn. Einen
blutigen Zahn. Sie tütete ihn ein und erhob sich wieder. Als
Nächstes schrieb sie die Namen der Hausbewohner von den
Klingelschildern ab, um sie später im Büro überprüfen zu kön-
nen. Die Namen sagten ihr nichts, aber man konnte nie wissen.

Was immer hier passiert war – es war, laut dem Fahrtenbuch
des Taxifahrers, kurz vor zehn passiert. Es war möglich, dass
jemand im Haus etwas gehört hatte und vielleicht wusste, wa-
rum sich jemand übergeben und einen gesunden Zahn verloren
hatte.
Stella rieb die Hände aneinander und rief Danny Messer im
Labor an.
»Überprüf doch mal diese Namen«, bat sie. »Hast du einen
Stift?«
»Du hörst dich furchtbar an.«
»Ich weiß, ich höre mich furchtbar an«, stimmte sie ihm zu.
»Hier sind die Namen.«
Dann schaute sie auf die Liste und buchstabierte jeden ein-
zelnen Namen.
»Verstanden«, sagte er.
»Solltest du etwas herausfinden, dann ruf mich an. Viel-
leicht wollte Guista letzte Nacht eine dieser Personen aufsu-
chen, und irgendetwas ist schief gegangen.«
»Was?«
»Keine Ahnung. Ich schicke alles, was ich habe, mit einem
Taxi zu dir«, sagte sie. »Zahl du den Fahrpreis. Trinkgeld habe
ich dem Fahrer schon gegeben.«
Stella versuchte, ein Husten zu unterdrücken, aber sie
schaffte es nicht.
»Stella …«, fing Danny an, aber sie fiel ihm ins Wort.
»Ich muss weitermachen. Bitte. Tu alles so, wie ich es ge-
sagt habe«
Sie beendete das Gespräch und ging zu dem Wagen, in dem
George Apappa saß, den Kopf zurückgelegt, die Augen ge-
schlossen. Sie öffnete ihren Koffer und ließ die Fotodisk, die
Blutproben, den blutigen Zahn und die Probe des Erbrochenen –
alles einzeln eingetütet – in einen wieder verschließbaren Beu-
tel fallen. Dann öffnete sie die Fahrertür.

George wachte auf. Er hatte den Beutel in die Hand ge-
drückt bekommen, noch bevor er den Mund aufmachen und
Fragen stellen konnte.
Sie gab ihm die Adresse des C.S.I.-Büros und wies ihn an, den
Beutel an Daniel Messer zu übergeben, der auf ihn warten würde.
Messer, so sagte sie, würde die Rechnung für die Fahrt überneh-
men. Zusätzlich gab sie ihm noch einen Zehndollarschein.
Einen Herzschlag lang konnte sie George ansehen, dass er
fragen wollte, was das alles zu bedeuten habe, aber er tat es
nicht. Er legte den Beutel auf den Beifahrersitz, und Stella
schloss die Fahrertür.
Als Louisa Cormier dieses Mal die Tür für Mac und Aiden öff-
nete, wirkte sie nicht so strahlend und übersprudelnd wie bei
den Besuchen vorher. Sie sah aus, als hätte sie nicht geschla-
fen, und trug etwas, das aussah wie ein übergroßer geblümter
Kittel. Ihre Frisur saß gut, ihr Make-up ebenfalls, aber nicht so
perfekt wie am Vortag.
Sie trat zurück und ließ die Ermittler hinein.
»Meine Agentin, Michelle, hat mich angerufen, um mir zu
sagen, dass ich mit Ihrem Besuch rechnen müsste.«
Mac und Aiden erwiderten nichts.
»Sie verdächtigen mich, den Mann im Fahrstuhl ermordet
zu haben«, sagte sie ruhig.
Mac und Aiden verzogen keine Miene.
»Bitte, setzen wir uns doch«, sagte Louisa. »Kaffee? Gute
Manieren sind nicht totzukriegen. Keine glückliche Wortwahl,
aber …«
»Nein, danke«, lehnte Mac für sich und Aiden ab. Die drei
standen direkt hinter der Wohnungstür.
»Nun, ich war gerade dabei, einen Kaffee zu trinken, wenn
Sie also nichts dagegen haben …« Luisa Cormier ging in die
Küche. »Nehmen Sie Platz.«

Mac und Aiden nahmen am Tisch vor dem Fenster Platz.
Kalter Nebel hatte sich über Manhattan gelegt. Abgesehen von
ein paar Lichtern im dichten Grau und den Dächern der Hoch-
häuser über den Wolken war nicht viel zu sehen.
»Es tut mir Leid«, sagte Louisa Cormier, als sie sich mit
einer dampfenden Tasse Kaffee in Händen auf denselben
Stuhl setzte, auf dem sie schon am Vortag gesessen hatte.
»Ich habe die ganze Nacht gearbeitet. Michelle hat Ihnen
vielleicht erzählt, dass ich mein Buch bis Ende der Woche
fertig stellen muss – nicht, dass mein Verleger mir auf die
Füße treten würde, sollte ich mich verspäten, aber ich ver-
späte mich niemals. Wenn man sich seinen Lebensunterhalt
mit dem Schreiben verdient, dann ist das ein Job wie jeder
andere auch. Ich halte es für unangemessen, mich zu verspä-
ten. Entschuldigen Sie, ich schweife ein wenig ab. Ich bin
müde, und man hat mir gerade erklärt, ich sei eine Mordver-
dächtige.«
»Schmauchspuren«, sagte Mac.
»Ich weiß, was das ist«, sagte sie. »Partikel, Rückstände von
Pulver, die beim Abfeuern einer Waffe zurückbleiben.«
»Sie lassen sich nur schwer entfernen«, erklärte Aiden.
Beide Ermittler sahen Louisa Cormiers Hände an. Sie waren
rot geschrubbt.
»Sie wollen meine Hände auf Schmauchspuren untersu-
chen?«, fragte sie.
»Schmauchspuren können von den Händen einer Person auf
andere Gegenstände übertragen werden, wenn diese von der
Person angefasst worden sind«, erklärte Mac.
»Interessant«, entgegnete Louisa und trank einen Schluck
Kaffee.
»Als wir gestern hier waren, haben Sie einige Dinge be-
rührt«, fuhr Mac fort.
Nun wirkte Louisa sehr wachsam.

»Sie haben etwas aus meinem Appartement gestohlen?«,
fragte sie.
Mac ignorierte die Frage. Er würde ihr so wenig wie möglich
verraten. Weder er noch Aiden hatten etwas mitgenommen.
»Sie haben kürzlich eine Waffe abgefeuert«, sagte Aiden.
Mac glaubte, die Spur eines Lächelns auf den Lippen der
Autorin gesehen zu haben.
»Das können Sie nicht wissen«, sagte Louisa. »Sie haben
meine Hände nicht untersucht, und ich bezweifle, dass Sie oh-
ne richterliche Verfügung irgendein Kleidungsstück von mir
mitgenommen hätten.«
Aiden und Mac antworteten nicht.
»Wie dem auch sei«, sagte Louisa, »Sie können das gern
tun. Ich denke, Sie werden einen Rückstand an meiner rechten
Hand finden. Ich habe vor zwei Tagen auf einem Schießstand
in der Nähe eine Waffe abgefeuert, kurz vor dem Sturm. Ich
denke, ich sollte meinen Anwalt anrufen.« Louisa lächelte im-
mer noch.
»Sie haben Recht, Sie sollten einen Anwalt anrufen, ehe sie
weitere Fragen beantworten«, sagte Mac.
Louisa Cormier zögerte.
»Ich habe Ihnen erzählt, dass ich eine Waffe abgefeuert ha-
be«, sagte sie. »Ich probiere alle Waffen aus, die ich in meinen
Büchern verwende. Gewicht, Klang, Rückschlag, Größe. Vor
zwei Tagen war ich auf dem Schießstand. Auch das habe ich
Ihnen gesagt. Es war Drietch’s Range an der Achtundfünfzigs-
ten. Ich gebe Ihnen die Adresse. Sie können gern mit Mathew
Drietch sprechen.«
»Was war das für eine Waffe?«, wollte Aiden wissen.
»Eine .22er«, sagte sie.
»Wie die in Ihrem Schreibtisch«, stellte Mac fest.
»Exakt. Ich hatte mich entschlossen, über eine Waffe zu
schreiben, die der entspricht, die in meinem Besitz ist«, sagte sie.

»Lutnikov wurde mit einer .22er getötet«, sagte Mac.
»Ich habe eine Kugel am Fuß des Fahrstuhlschachts gefun-
den«, fügte Aiden hinzu.
»Und wir werden auch eine Waffe finden, die zu dieser Ku-
gel passt. Sie haben gesagt, Sie besäßen keine andere Waffe als
die, die Sie uns gestern gezeigt haben?«
»So ist es«, antwortete Louisa. »Mathew Drietch hat genau
die gleiche Waffe wie ich. Er hat Hunderte von Waffen. Sie
können frei wählen, welche Sie benutzen wollen. Mr Drietch
hat sie mir mit Vergnügen zur Verfügung gestellt.«
»Sie wissen nicht zufällig, wo diese .22er jetzt ist, oder?«,
fragte Mac.
»Ich nehme an, sie ist sicher im Waffenschrank des Schieß-
stands eingeschlossen«, sagte Louisa.
»Haben Sie etwas dagegen, wenn wir Ihr Appartement
durchsuchen?«, fragte Mac. »Wir können uns auch einen
Durchsuchungsbefehl holen.«
»Ja, ich habe etwas dagegen, wenn Sie mein Appartement
durchsuchen«, gab sie zurück. »Aber wenn Sie sich den Durch-
suchungsbefehl holen und sich hier umsehen, werden sie keine
andere Waffe finden als die, die ich in meinem Schreibtisch
habe, und von der Sie bereits wissen, dass sie in jüngster Zeit
nicht benutzt worden ist.«
»Nur noch eine Frage«, sagte Mac.
»Keine Fragen mehr«, entgegnete Louisa durchaus höflich.
»Der Name meines Anwalts lautet Lindsey Terry. Er steht im
Telefonbuch. Es tut mir Leid, wenn ich ein bisschen gereizt
wirke, aber ich habe nicht geschlafen, und …«
»Ich habe letzte Nacht einige Ihrer Bücher gelesen«, sagte
Mac.
»Oh«, machte Louisa. »Welche?«
»Der Albtraum einer anderen, Frau im Dunkel, Der Platz
einer Frau«, zählte Mac auf.

»Meine ersten drei Bücher«, sagte Louisa. »Haben Sie Ihnen
gefallen?«
»Nach diesen drei wurden die Bücher besser.«
»Ich dachte immer, meine ersten drei wären die besten.«
Louisa lächelte. »Haben Sie die anderen denn auch gelesen?«
»Zwei davon.«
»Sie lesen schnell.«
»Ich habe einiges überflogen. Ich werde einen Linguistik-
professor an der Columbia bitten, einen Blick auf Ihre Bücher
zu werfen.«
»Warum um alles in der Welt tun Sie das?«, fragte Louisa.
»Ich denke, das wissen Sie.« Mac schaute sie an.
»Sie haben den Namen meines Anwalts«, sagte Louisa mit
Nachdruck. »Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden. Ich
habe ein Buch zu Ende zu schreiben und muss mich ausruhen.«
Als Aiden und Mac wieder in dem kleinen Korridor vor dem
Fahrstuhl standen, sagte Aiden: »Sie war es.«
Sie gingen durch die Lobby zur Vordertür, und ihre Schrit-
te hinterließen ein dumpfes Echo. Vor ihnen, etwa zwanzig
Meter entfernt, stand ein schlanker Mann Ende zwanzig oder
Anfang dreißig. Der ordentlich rasierte, blasse Mann mit dem
ausdruckslosen Gesicht trug Jeans, ein blaues T-Shirt und ei-
ne Eddie-Bauer-Daunenjacke. Er hielt die Hände vor dem
Leib gefaltet und sah zu, wie Aiden und Mac sich ihm näher-
ten.
Als die Ermittler nur noch wenige Meter von ihm entfernt
waren, trat er ihnen in den Weg.
»Sie untersuchen den Mord an Charles Lutnikov«, sagte er
langsam und mit ruhiger Stimme.
»Das ist richtig«, erwiderte Mac.
»Ich habe ihn umgebracht«, verkündete der Mann.
Er zitterte.

»Wie kommst du voran?«, fragte Stella, wobei sie sich ein paar
Schritte von Danny entfernt hielt, um ihn nicht anzuatmen.
Sie war krank, daran bestand kein Zweifel. Temperatur,
Schüttelfrost, leichte Übelkeit.
Aber Übelkeit war den C.S.I.-Ermittlern nicht fremd, und Stel-
la war da keine Ausnahme. Sie trug nur selten am Tatort eine
Maske, ganz egal, wie schlimm der Gestank auch war, egal wie
lange eine Leiche in einer Badewanne gelegen hatte, und egal wie
aufgebläht sie war und ihren fauligen Geruch verströmte.
Das letzte Mal musste Stella ihren Magen mühsam bändi-
gen, als sie und Aiden vor zwei Wochen die Wohnung einer
Katzenhalterin in einem Gebäude an der East Side aufgesucht
hatten. An der Tür wartete ein uniformierter Beamter, der seine
angewiderte Miene nicht verbergen konnte.
Stella und Aiden waren hineingegangen und beinahe er-
schlagen worden von dem Gestank, dem Geheul Dutzender
Katzen und der drückenden Hitze, die die Radiatoren verström-
ten. Der dunkle Raum hatte nach Tod, Urin und Fäkalien ge-
stunken.
»Lass uns nicht die Helden spielen«, hatte Stella gesagt.
Aiden hatte genickt. Sie hatten die Masken aus ihren Koffern
genommen und angelegt, ehe sie sich ihren Weg in das Schlaf-
zimmer bahnten, wo sie die Leiche der alten Frau in einem ge-
blümten Kleid vorfanden. Auf ihrer Brust lag Erbrochenes, das
schon eingetrocknet war. Ihre aufgerissenen Augen starrten zur
Decke empor. Eine große, orange-rote Katze hockte auf ihrem
aufgeblähten Bauch und fauchte die beiden Frauen an.
»Sprich mit dem Officer«, sagte Stella. »Sollte er das Tier-
heim noch nicht angerufen haben, dann sorg dafür, dass er es
jetzt tut.«
Ihre Worte und der Klang ihrer eigenen Stimme erinnerten
Stella daran, dass das, was sie tat, getan werden musste und
dass sie darin besser war als jeder andere, den sie kannte.

Und so hatte sie eine Stunde in dem Dreck verbracht, der
sich schon lange vor dem Tod der Frau in der Wohnung ange-
häuft hatte. Eine Untersuchung der Leiche hatte ergeben, dass
die Frau, die aussah, als wäre sie erdrosselt worden, an einem
gewöhnlichen Herzanfall gestorben war, der dazu geführt hatte,
dass sie an ihrem Erbrochen erstickt war.
Danny hatte Stella den Rücken zugekehrt. Er hielt ein ver-
korktes Reagenzglas mit einer gelben Flüssigkeit hoch.
»Zum letzten Mal«, sagte er, »du bist krank. Du gehörst ins
Bett.«
»Das ist nur eine Erkältung«, antwortete sie.
Er schüttelte den Kopf.
»Ich achte auf mich. Außerdem habe ich schon einen Tee
getrunken«, beharrte sie.
»Ein kleiner Schritt für die Menschheit.« Danny schüttelte
missbilligend den Kopf.
Stella ignorierte die Bemerkung. »Was hast du herausgefun-
den?«
»Wer immer das erbrochen hat, sollte seine Ernährung än-
dern«, sagte Danny. »Er benutzt seinen Magen, um Fett zu la-
gern. Er hatte Peperoni und eine Art Wurst, außerdem größere
Mengen Pasta mit einer würzigen Soße, die für eine Skala von
eins bis zehn nicht ausreichen würde.«
»Danny«, mahnte Stella mit kaum verhohlener Ungeduld.
»Mehl«, sagte Danny. »Unbearbeitet. Ungebleicht. Der Kerl
hat Mehl eingeatmet.«
»Hast du das Mehl untersucht?«, fragte sie und unterdrückte
ein Niesen.
»Spuren im Erbrochenen. Marco’s Bakery. Passt perfekt zu
unserer Probe.«
»Und die Gummispuren auf dem Korridor der Bäckerei pas-
sen definitiv zu Colliers Schuhabsätzen?«
»Alle Spuren führen zu Marco’s Bakery«, sagte er.

Danny legte das Reagenzglas weg und drehte sich um.
»Macht es dir etwas aus, wenn ich ein medizinisches Urteil
abgebe?«, fragte er, wartete jedoch keine Antwort ab. »Deine
Nase ist so rot wie eine Maraschinokirsche.«
»Stella, die rotnasige C.S.I.-Ermittlerin«, sagte sie und ver-
suchte ein Grinsen.
»Das ist nicht lustig«, mahnte Danny. »Du solltest …«
»Ich dachte, du wärest endlich damit fertig, Doktor zu spie-
len«, fiel sie ihm ins Wort.
Danny zuckte mit den Schultern.
»Möchtest du wissen, was die Blutspuren ergeben haben?«
Er nickte.
»Wie erwartet stammt ein Teil der Proben, die wir auf dem
Gehsteig und vor der Tür gefunden haben, von Guista«, sagte
sie. »Er hat eine Menge Blut verloren. Falls er nicht schon tot
ist, wird er es bald sein, wenn er keinen Arzt aufsucht. Aber da
war auch Blut von einer anderen Person.«
Stella ließ sich langsam auf einen Hocker gleiten und rekon-
struierte die Geschehnisse.
»Guista wurde von Flack angeschossen«, sagte sie. »Er hat
seinen Transporter nach Brooklyn gefahren, hat ihn vor einem
Lebensmittelgeschäft stehen gelassen und ein Taxi genommen.
Nachdem er ausgestiegen ist, ist er einen halben Block weit
marschiert. Jemand hat auf ihn gewartet.«
»Und jemand hat ihn überrascht«, fügte Danny hinzu.
»Meine Vermutung: Guista hat kräftig zugeschlagen. Der Kerl
übergibt sich, blutet und verliert einen Zahn. Guista läuft wie-
der davon. Oder sagen wir, er humpelt davon.«
Stella nickte und sagte: »So etwas in der Art. Die Jugendli-
chen, die den Wagen geklaut haben, haben gesagt, er hätte tele-
foniert. Hast du den Anruf überprüft?«
Danny schüttelte den Kopf. »Das werde ich jetzt machen.
Du gehst nach Hause.«

Der Blick, mit dem sie ihn bedachte, veranlasste Danny,
seine Gedanken über Stellas Gesundheit sofort einzustellen.
Und zwar endgültig.
»Hast du die Namen der Leute überprüft, die in dem Gebäu-
de wohnen?«
»Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Bis auf eine Per-
son haben alle ein Vorstrafenregister.«
»Und …?«, hakte Stella nach.
»Die Person ohne Vorstrafenregister ist eine Lynn Contra-
nos.«
»Deine innere Befriedigung quillt dir ja förmlich aus sämtli-
chen Knopflöchern.« Stella musste grinsen.
»Meine was …?«
»Das stammt aus einem Hitchcock-Film«, erklärte sie und
schnäuzte sich die Nase. »Was ist mit ihr?«
»Lynn Contranos alias Helen Grandfield ist Dario Marcos
zuverlässige Assistentin.«
Stella nickte.
»Aber das ist noch nicht alles«, erklärte er und richtete seine
Brille. »Helen Grandfields Name lautete, bevor sie Stanley
Contranos geheiratet hat, der übrigens zehn bis zwanzig Jahre für
Mord zweiten Grades aufgebrummt bekam, Helen Marco. Sie ist
eine Nichte von Anthony Marco, der, während wir uns hier unter-
halten, vor Gericht steht. Also ist Dario Marco ihr Vater.«
»Alle Straßen führen zu Marco’s Bakery«, stellte Stella fest.
»Statten wir ihm doch einen Besuch ab.«
»Nehmen wir ein paar Uniformierte mit?«, fragte Danny.
Stella nickte und suchte in ihrer Tasche nach dem kleinen
Tablettenfläschchen, das Sheldon Hawkes ihr vor knapp einer
Stunde gegeben hatte.
»Das könnte dich müde machen«, hatte Hawkes gesagt, aber
es lindert die Beschwerden. Sie öffnete das Plastikfläschchen.

Der Name des jungen Mannes, der den Mord an Charles Lutni-
kov gestanden hatte, lautete Jordan Breeze. Er wohnte im zwei-
ten Stock des Belvedere Towers in einer Einzimmerwohnung.
Breeze, Absolvent der Drexel University, arbeitete als Compu-
terprogrammierer für ein indisches Unternehmen an der Fünf-
undfünfzigsten. Sein Job war es, Software für die Kartografie-
rung des Universums zu entwickeln.
Mac schaute von dem Ordner in seinen Händen auf, gera-
dewegs in Jordan Breezes Augen, ehe er den Blick wieder in
die Papiere senkte. Breeze hatte nie Schwierigkeiten mit der
Polizei gehabt und gehörte keiner radikalen Gruppe an. Aus der
Befragung seiner Nachbarn schloss Mac, dass er ein ruhiger
Mieter war, der seinen Nachbarn stets einen guten Morgen ge-
wünscht hatte. Allerdings war er in den letzten paar Monaten
immer seltener gesehen worden. Andere Hausbewohner hatten
ihn zwei Straßen weiter im Starbucks gesehen, wo er bei einem
Grande Latte an seinem Computer gearbeitet hatte, aber auch
das war schon eine Weile her. Mac schaltete das Diktiergerät
an.
»Sind Sie sicher, dass Sie keinen Anwalt wollen?«, fragte er.
»Ganz sicher.«
»Warum haben Sie ihn umgebracht?«
»Er hat mich als Tunte bezeichnet, nicht nur einmal. Viele
Male. Immer, wenn ich am Morgen meine Wohnung verlassen
habe oder am Abend zurückgekommen bin, hatte ich Angst,
ihm zu begegnen. Ich sehe Ihnen an, dass Sie eine Frage ha-
ben.«
»Die lautet?«
»Sie wollen wissen, ob ich schwul bin.« Mit diesen Worten
setzte sich Breeze aufrecht hin. »Das bin ich nicht, aber einige
meiner Freunde sind schwul, und ich will nicht unter ho-
mophoben Idioten leiden müssen. Ich habe das beinahe ein
ganzes Jahr ertragen.«

»Und dann«, sagte Mac, »haben Sie ihn umgebracht. Wie?«
»Mit einer Schusswaffe. Er war im Fahrstuhl. Ich hätte ihm
aus dem Weg gehen können, wenn ich die Treppe genommen
hätte, aber er hatte mich da bereits gesehen.«
»Sie hatten die Waffe dabei?«, hakte Mac nach.
»Hatte ich.«
»Hatten Sie geplant, ihn umzubringen, wenn er Ihnen wie-
der zu nahe treten würde?«
»Ja. Ich bin in den Fahrstuhl gestiegen. Die Türen schlossen
sich. Er fing an … Er hat mich eine dürre Arschfotze genannt«,
sagte Breeze nach kurzem Zaudern. »Die Waffe war in der
Außentasche meiner Notebooktasche. Es gibt ein paar Dinge,
die ich einfach nicht ertragen kann.«
Mac nickte, warf erneut einen Blick auf die Akte und sah
dann wieder Jordan Breeze an.
»Woher hatten Sie die Waffe?«, fragte er.
»Sie gehörte meinem Vater«, erklärte Breeze. »Er ist vor ein
paar Jahren gestorben. Krebs.«
»Was für eine Waffe ist das?«
»Eine .22er.«
»Was wollten Sie in dem Fahrstuhl, der doch nur zu den o-
beren Etagen fährt?«
»Ich bin Lutnikov gefolgt, als er ausgestiegen ist und den
Fahrstuhl gewechselt hat. Er wirkte überrascht, schien das aber
amüsant zu finden.«
»Dann sind Sie in den Fahrstuhl gestiegen, weil Sie vorhat-
ten, ihn zu töten?«
»Ja.«
»Was haben Sie mit der Waffe gemacht, nachdem Sie
Charles Lutnikov ermordet haben?«
»Ich bin aus dem Fahrstuhl ausgestiegen und hab ihn nach
oben geschickt. Dann bin ich vergnügt durch den Schnee zum
East River spaziert und hab sie hineingeworfen. Sie ist durch

eine dünne Eisschicht gebrochen. Die Lederhandschuhe, die
ich getragen habe, habe ich auch in den Fluss geworfen. Ich be-
fürchte, Sie werden mich wegen Mordes und wegen Gewässer-
verschmutzung anklagen müssen.« Breeze lächelte.
»Wie oft haben Sie auf Lutnikov geschossen?«
»Zweimal«, sagte Breeze. »Einmal, als er vor mir stand, und
dann noch einmal, als er zu Boden fiel.«
»Der Portier erinnert sich nicht daran, dass Sie das Haus
verlassen haben«, sagte Mac.
»Ich habe bis zum Nachmittag gewartet, und da sind viele
Leute ein- und ausgegangen.«
»Wie gut kennen Sie Louisa Cormier?«
»Hab sie nie getroffen«, sagte Breeze. »Ich wüsste es nicht
einmal, sollte ich ihr im Haus begegnet sein. Ich weiß, dass sie
im Penthouse wohnt. Aber so lange wohne ich hier noch nicht.«
»Macht es Ihnen etwas aus, wenn wir uns in Ihrem Appar-
tement umsehen?«, fragte Mac. »Wir können uns auch einen
Durchsuchungsbefehl holen.«
»Bitte«, antwortete Breeze. »Durchsuchen Sie mein Appar-
tement und auch den Vorratsschrank im Keller.«
Breeze trug ein ruhiges Lächeln zur Schau, das beinahe aus-
sah wie das Lächeln eines Sektenangehörigen, der überzeugt
war, die Wahrheit des Lebens zu kennen, und sich ihr demütig
beugte.
Mac schaltete das Diktiergerät aus, erhob sich und ging zur
Tür. Als er öffnete, stand auch Breeze mit zitternden Beinen
auf.
Nachdem Jordan Breeze abgeführt worden war, betrat Aiden
das Verhörzimmer. Mac hatte wieder Platz genommen und
pochte mit dem dünnen Ordner auf den Tisch.
»Du glaubst nicht, dass er es getan hat, oder?«, fragte sie.
»Ich werde der Sache nachgehen. Falls er es nicht getan hat,
hat ihm jemand eine Menge Informationen über den Mord ge-

geben. Auf jeden Fall sollten wir die Ermittlungen in Bezug
auf Louisa Cormier nicht nur fortsetzen, sondern auch intensi-
vieren.«
»Du könntest dich irren«, sagte sie.
»Ich könnte«, stimmte Mac zu.

12
Bei dem ersten Wagen, den er starten wollte, scheiterte Stevie.
Seit er zum letzten Mal versucht hatte, ein Auto zu knacken,
waren beinahe fünfzig Jahre vergangen. Anscheinend konnte
man auch Rad fahren verlernen.
Der Wagen war ein grüner Ford Escort, der einen halben
Block von der Stelle entfernt war, an der er den beiden Männer
aus der Bäckerei begegnet war. Als er sie das letzte Mal sah,
lag der eine vor Schmerzen zusammengekrümmt auf dem Bo-
den, und der andere war mit dem Versuch beschäftigt, sein Na-
senbluten zu stoppen. Stevie war überzeugt davon, dass die
beiden zu schwer verletzt waren, um ihn zu verfolgen. Er hatte
überlegt, sie umzubringen, aber dann hätte er zwei Leichen zu-
rückgelassen. So konnten sie selbst davonkriechen.
Das Problem war nur, dass auch Stevie sich nur noch krie-
chend fortbewegen konnte. Er verlor mehr und mehr Blut.
Mühsam versuchte er, sich zu überlegen, wohin er gehen könn-
te.
Eine der hinteren Türen des Escort war offen gewesen, das
Schloss kaputt. Normalerweise hätte es ganz einfach sein müs-
sen. Aber Stevie hatte keinerlei Werkzeug bei sich. Nichts, was
er benutzen konnte, um den Wagen zu stehlen.
Er war wieder aus dem Wagen ausgestiegen und hatte sich
zu dem Haus umgesehen, vor dem er die beiden Männer zu-
rückgelassen hatte. Stevie hatte dem einen, den er zuerst über-
wältigt hatte, die Waffe abgenommen. Später hatte er seine
Fingerabdrücke abgewischt und sie über eine Ziegelmauer ge-

worfen. Er wollte sich zusätzlichen Ärger vom Hals schaffen.
Seine Hände wusste er zu gebrauchen, eine Waffe nicht. Dafür
brauchte man Verstand. Man musste überlegen, Dinge beach-
ten und so weiter. Das war nicht Stevies Art. Für ihn mussten
die Dinge einfach ablaufen.
Der zweite Wagen, den er zu stehlen versuchte, ein weißes
1992er Oldsmobile Cutlass Calais, ließ beinahe seinen Glauben
an Gott wieder aufleben. Das Fenster konnte er mit etwas
Druck so weit herunterschieben, dass er hineingreifen und die
Tür öffnen konnte. Dann glitt er auf den Fahrersitz und über-
legte, was zu tun war.
Er öffnete das Handschuhfach auf der Suche nach einem
passenden Werkzeug. Nichts, aber da war ein kleines schwar-
zes Münztäschchen aus Leder. Er klappte es auf. Ein Schlüssel.
Ein Schlüssel mit einem Kunststoffgriff. Ein Oldsmobile-
Schlüssel. Der Wagen sprang beinahe auf Anhieb an, und Ste-
vie war unterwegs. Wohin? Der Jockey. Er war nicht sicher, ob
er Jake Laudano trauen konnte. Die Beziehung zwischen ihnen,
dem langsamen, starken großen Kerl und dem nervösen kleinen
Mann, war eher geschäftlicher als freundschaftlicher Natur.
Keiner der beiden war besonders flink im Kopf.
Aber Stevie hatte, wie er dachte, kaum eine Wahl. Entweder
der Jockey oder das Krankenhaus, vorausgesetzt er schaffte es
bis zur Wohnung des Jockeys.
Nein, so beschloss er, während er fuhr, es gäbe keine Wahl.
Er würde es schaffen.
Die nächsten vierzig Minuten gingen einfach verloren. Als
er wieder erwachte, drang gedämpftes Tageslicht durch die
Fensterscheibe, und er lag auf einem abgenutzten Sofa, das viel
zu klein für ihn war.
Langsam setzte er sich auf. Sein Bein war bandagiert. Das
Pulsieren war erträglich. Und sein Selbstvertrauen wieder er-
wacht. Er befand sich in einer kleinen Einzimmerwohnung.

Das Sofa stand an der einen Wand – ein Schrankbett, das der-
zeit zugeklappt war, an der anderen.
Plötzlich öffnete sich die Wohnungstür. Stevie versuchte,
auf die Beine zu kommen, aber sein verwundetes Bein hielt ihn
zurück.
Der Jockey kam mit einer Papiertüte in einer Hand zur Tür
herein.
»Hab dir Kaffee geholt«, sagte er. »Und ein paar Dough-
nuts.«
»Danke«, sagte Stevie, warf einen Blick in die Tüte, die Ja-
ke ihm gegeben hatte, und nahm den Kaffee heraus.
Ihm war mulmig. Der Kaffee und die Doughnuts konnten
ihm vielleicht helfen. Er war tatsächlich hungrig. Er griff nach
einem Doughnut und lachte.
»Was ist so lustig?«, fragte Jake.
»Gestern war mein Geburtstag.«
»Ehrlich wahr?«, fragte der Jockey. »Herzlichen Glück-
wunsch.«
Anders Kindem, außerordentlicher Professor für Linguistik an
der Columbia University, hatte nur noch den Hauch eines nor-
wegischen Akzents.
Mac hatte über ihn in einem Artikel in der New York Times
gelesen. Kindem hatte wohl endgültig bewiesen, dass William
Shakespeare, nicht Christopher Marlowe, Sir Walter Raleigh
oder John Grisham war.
Kindem, noch keine vierzig, trug glattes blondes Haar, wirk-
te ein wenig unbeholfen und lächelte ständig. Er war kaffee-
süchtig und nahm seine Droge aus einem übertrieben großen
weißen Becher zu sich, auf dem in den verschiedensten Farben
das Wort »Worte« zu lesen war. Eine Tasse desselben lauwar-
men Gebräus sah Mac neben einem der vier Computermonitore
stehen. Kindem braute seinen Kaffee aus selbst gemahlenen

Bohnen, die er in einer grünen Dose neben der Kaffeemaschine
aufbewahrte.
In dem Raum gab es insgesamt vier Rechner auf jeweils
zwei gegenüberstehenden Schreibtischen. Der Professor saß
zwischen den vier Computern auf einem Drehstuhl.
Mac sah zu, wie er hin und her rollte, sich um seine eigene
Achse drehte und wieder zurückfuhr. Er erinnerte dabei an ei-
nen Musiker, der an einem wertvollen Konzertflügel hochkon-
zentriert ein schwieriges Stück einspielte.
Sein wissenschaftliches Ansehen wurde durch die Jeans und
das grüne Sweatshirt mit den hochgerollten Ärmeln stark be-
einträchtigt. Auf der Vorderseite des Sweatshirts standen zu-
dem in großen weißen Lettern die Worte ›MAN MUSS NUR
WISSEN, WO MAN SUCHEN MUSS‹.
Noch bevor Mac Kindems Büro betreten hatte, hatte er die
Musik gehört.
Als Kindem ihn sah, verringerte er die Lautstärke und sagte:
»Detective Taylor, wie ich annehme.«
Mac schüttelte ihm die Hand.
»Stört Sie die Musik? Mir hilft sie, mich zu konzentrieren.«
»Bach«, stellte Mac fest. »Synthesizer.«
»Switched On Bach«, bestätigte Kindem die Vermutung.
Mac schaute sich um. Jetzt sah er, dass noch ein dritter
Schreibtisch mit einem Computer in dem Raum stand und die
Stühle drum herum alle auf den Monitor ausgerichtet waren.
An den Wänden hingen gerahmte Zeugnisse und Auszeichnun-
gen, die von dem wissenschaftlichen Ehrgeiz des Hochschul-
dozenten zeugten.
Kindem folgte dem Blick des Detectives und sagte: »Ich lei-
te kleine Seminare, eigentlich handelt es sich eher um Diskus-
sionsrunden für die Studenten im Aufbaustudium, die ich
betreue.«
Mit einem Nicken deutete er auf die drei Stühle.

»Sehr kleine Seminare. Und der ganze Wandschmuck? Nun,
was soll ich sagen. Ich bin ehrgeizig und besitze einen kleinen
Hauch akademischer Eitelkeit. Möchten Sie mir jetzt die Dis-
ketten geben?«
Mac fand ein freies Plätzchen an einem der Schreibtische.
Er öffnete seine Aktentasche und zog die Disketten heraus, auf
denen die Dateien von Louisa Cormiers Büchern abgespeichert
waren. Jede einzelne steckte in einem separaten Schutzum-
schlag, der exakt etikettiert worden war. Er reichte sie dem
Professor.
»Sie werden sie wohl erst lesen wollen«, sagte Mac. »Rufen
Sie mich an, wenn Sie mir irgendetwas darüber sagen können.«
Mac gab Kindem eine Karte. Kindem hatte die Disketten
zwischen den beiden Computern auf einem der Tische abge-
legt. »Ich muss sie nicht lesen und will es auch nicht. Erst recht
nicht auf einem Monitor. Ich verbringe schon mehr als genug
Zeit damit, alles Mögliche auf dem Monitor zu lesen. Wenn ich
einen Roman lesen möchte, will ich ihn als Buch zwischen
meinen Händen halten.«
Mac konnte ihm nur zustimmen, sagte aber nichts.
Kindem lächelte.
»Ein paar Dinge kann ich Ihnen ganz schnell verraten, falls
es sich um einfache Fragen handelt. Sollten sie eine vollständi-
ge Analyse benötigen, so müssen Sie mir einen Tag Zeit lassen.
Ich werde dann einen meiner Studenten damit beauftragen, ei-
nen Bericht anzufertigen, den er ihnen per E-Mail zuschicken
wird.«
»Klingt gut«, sagte Mac.
»Okay«, sagte Kindem und schob die Disketten in einen
Tower zwischen den Monitoren.
Jede der Disketten glitt mit einem Klicken und einem leisen
Summen in den Schacht.
»Also«, sagte er, »wonach suche ich?«

»Ich möchte wissen, ob alle Bücher von derselben Person
geschrieben wurden«, erklärte Mac.
»Und?«, fragte Kindem weiter.
»Alles, was Sie mir sonst noch über den Autor erzählen
können.«
Kindem machte sich an die Arbeit und demonstrierte seine
Kunstfertigkeit an der Tastatur. Er drehte nebenbei die Laut-
stärke der CD wieder auf und glich danach einem Musiker, der
sein Instrument im Takt der Musik spielt.
»Worte, ganz einfach«, sagte Kindem, als er zwischen den
Computern hin und her rollte und Befehle eintippte. »Aber sa-
gen Sie das nicht dem Leiter des Fachbereichs. Der hält das für
schwer. Er tut so, als würde er das hier verstehen. Ich verzichte
darauf, ihn auf seine zahlreichen Fehler aufmerksam zu ma-
chen. Worte sind leicht. Musik ist schwerer. Geben Sie mir
zwei Musikstücke, und ich gebe sie in den Computer ein und
sage Ihnen, ob sie von derselben Person geschrieben wurden.
Hätten Sie gedacht, dass Mozart von Bach geklaut hat?«
»Nein«, sagte Mac.
»Hat er auch nicht«, sagte Kindem. »Ich habe das einem an-
geblichen Gelehrten nachgewiesen, der mit diesem akademi-
schen Beschiss eine Professur in Leipzig ergattern wollte.«
So ging es noch etwa zehn Minuten lang weiter. Er redete
ununterbrochen, trank Kaffee und wechselte von einem Moni-
tor zum anderen.
»Ausrufezeichen«, sagte er. »Ein guter Punkt für den An-
fang. Ich mag sie nicht, und ich benutze sie auch nicht. Keine
Ausrufezeichen in wissenschaftlichen und akademischen
Schriften. Zeigt nur einen Mangel an Vertrauen in die eigenen
Worte. Das Gleiche gilt für die Fiktion. Der Autor vertraut den
Worten nicht, also versucht er, ihre Wirkung zu verstärken. In-
terpunktion, Vokabular, Wortwiederholungen, Anzahl der Ad-
verben und Adjektive. Es ist wie mit den Fingerabdrücken.«

Mac nickte.
»Die ersten drei Bücher«, sagte Kindem. »Überladen mit
Ausrufezeichen. Über zweihundertfünfzig in jedem der Bücher.
Dann, in allen späteren Büchern, verschwinden sie. Der Autor
ist erleuchtet worden, oder …«
»Wir haben es mit einem anderen Autoren zu tun«, sagte
Mac.
»Sie haben es begriffen«, sagte Kindem. »Und da ist noch
viel mehr. In den ersten drei Büchern taucht das Wort ›sagte‹
durchschnittlich dreißigmal pro Buch auf. Ich werde das noch
überprüfen, aber es scheint, als würde der Autor das Wort ›sag-
te‹ vermeiden wollen und ständig nach anderen Möglichkeiten
suchen, den Dialog zu skizzieren. So schreibt der Autor statt
›sagte sie‹ beispielsweise ›rief sie‹ oder ›keuchte sie‹. In den
späteren Büchern taucht das Wort ›sagte‹ aber durchschnittlich
zweihundertsechsundachtzigmal auf. Zunehmendes Selbstver-
trauen? Vielleicht. Wollen Sie noch mehr?«
Mac nickte.
»Das Satzgefüge in den ersten drei Bänden ist weitaus kom-
plizierter, die Sätze sind länger.« Kindem sah auf den Monitor.
»Ein unerfahrener Leser wird das bewusst vielleicht gar nicht
wahrnehmen, aber unbewusst … Sie sollten mit jemandem von
der psychologischen Fakultät sprechen.«
»Sonst noch was?«
»Eine Menge«, sagte Kindem. »Das Vokabular. Beispielswei-
se taucht das Wort ›vergelten‹ in jedem der ersten drei Bücher
durchschnittlich elfmal auf. In den anderen Büchern gar nicht.«
»Könnte die Veränderung nach den ersten drei Büchern dar-
auf zurückzuführen sein, dass der Autor beschlossen hat, den
Stil zu ändern, oder dass er tatsächlich besser geworden ist?«
»Nicht bei einer so umfassenden Veränderung«, wandte
Kindem ein. »Und ich denke, ich werde noch mehr finden,
wenn Sie mir ein paar Stunden Zeit lassen.«

»Das Schema ist in allen Büchern ziemlich ähnlich«, sagte
Mac. »Frau, verwitwet oder noch nicht verheiratet, obwohl sie
bereits Mitte dreißig ist, hat ein Kind oder ist für eines verant-
wortlich, das durch einen rachsüchtigen Verwandten, die Mafia
oder einen Serienkiller in Gefahr gerät. Die Hilfe der Polizei ist
nicht ausreichend. Die Frau muss sich und das Kind schützen.
Und irgendwo auf den letzten dreißig Seiten tritt die Frau dem
Bösen gegenüber und gewinnt durch die Hilfe eines neuen
Mannes, den sie im Laufe der Geschichte irgendwann getroffen
hat, die Oberhand.«
»Was bedeutet, dass derjenige, der diese Bücher geschrie-
ben hat, stets dem gleichen Schema folgt«, sagte Kindem. »Es
bedeutet nicht, dass es immer dieselbe Person war.«
Nun war Mac endgültig überzeugt. Louisa Cormier hatte die
ersten drei Bücher geschrieben. Charles Lutnikov alle anderen.
Aber warum sollte sie ihn erschossen haben, fragte sich
Mac. Ein Streit? Weshalb? Geld?
»Wollen Sie die Ergebnisse in gedruckter Form?«
»E-Mail«, antwortete Mac. »Die Adresse steht auf der Karte.«
»Werden Sie mich als Zeugen vor Gericht brauchen?«
»Möglich.«
»Gut«, sagte Kindem. »So etwas wollte ich schon immer
mal erleben.«
Benommen und schmerzgeplagt saß Stella auf dem Beifahrer-
sitz, während Danny das Auto steuerte. Zum achten Mal ging
Stella nun schon die Akte von Alberta Spanios Ermordung
durch.
Sie betrachtete die Tatortfotos – Leiche, Bett, Wände, Bei-
stelltisch. Und sie betrachtete die Fotos vom Badezimmer –
Toilette, Boden, Badewanne, offenes Fenster über der Wanne.
Etwas klingelte in ihrem Kopf. Etwas war falsch. Es war ein
Gefühl, als würde sie versuchen, sich an den Namen eines

Schauspielers oder eines Schriftstellers zu erinnern. Oder an
den des Mädchens, das damals, vor unzähligen Jahren, im Ma-
theunterricht in der Schule neben ihr gesessen hatte. Sie wuss-
te, dass der Name in ihrem Kopf verborgen war. Aber man
konnte das ganze Alphabet fünfzehnmal hintereinander durch-
gehen und würde den Namen doch nicht finden, und dann,
plötzlich, tauchte er wie aus dem Nichts wieder auf.
Sie las die Zeugenaussagen von Taxx und Collier, der bei-
den Männer, die Alberta Spanio hätten schützen sollen.
Dann, als sie weiterlas, ging ihr ein Licht auf. Sie blätterte
zu den Badezimmerfotos zurück.
Collier hatte Flack erzählt, er hätte in der Wanne gestan-
den, um aus dem Fenster zu sehen. Wenn der Mörder durch
das Fenster gekommen war, hätte er oder sie den ganzen
Schnee, der sich vor dem Fenster angehäuft hatte, in die
Wanne schieben müssen. In der Wanne hätte geschmolzener
Schnee liegen müssen, als Collier hineingestiegen war. Doch
auf Stellas Fotos war in der Wanne keine Spur von Feuchtig-
keit zu sehen. Und auf den Bodenfliesen waren auch keine
Abdrücke von Colliers Schuhen zu sehen, obwohl die doch
feucht gewesen sein müssten, nachdem er in der Wanne ge-
standen hatte.
Warum, überlegte sie, hatte Collier gelogen?
Sheldon Hawkes saß neben Mac am Schreibtisch und schaute
auf die Videoaufnahme.
»Noch einmal«, sagte Hawkes und beugte sich noch weiter
vor.
Mac spulte zurück und trank Kaffee, während Hawkes sich
die zwanzigminütige Aufnahme noch einmal ansah, stoppte,
und vor- und zurückspulte.
»Hören wir uns auch das Band von der Vernehmung noch
einmal an.«

Mac drückte auf den Knopf, und sie hörten sich das Ton-
band an, das er während der Vernehmung von Jordan Breeze
aufgenommen hatte.
»Willst du ihn sehen?«, fragte Mac. »Wahrscheinlich wer-
den wir nur in dem bestätigt, was wir schon wissen.«
Hawkes erhob sich und sagte: »Du hast Recht.« Dann er-
zählte er Mac, was er festgestellt hatte.
»Sicher«, sagte Mathew Drietch.
Er war drahtig, um die vierzig Jahre alt, hatte schütteres gelb-
blondes Haar und das Gesicht eines Boxers. Seine Äußerung war die
Antwort auf Aiden Burns Bitte, ihr die .22er zu zeigen, die Louisa
Cormier für Probeschüsse auf dem Schießstand benutzt hatte.
»Mögen Sie das Geräusch von Schüssen?«, fragte Drietch.
»Nicht besonders.«
»Ich schon«, sagte er und blickte an ihr vorbei zu der Glas-
tür, hinter der die einzelnen Boxen für das Schießtraining mit
den Handfeuerwaffen zu sehen waren. »Das Krachen, die E-
nergie – wissen Sie, was ich meine?«
»Nicht so ganz«, gab Aiden zu. »Können Sie mir jetzt die
Waffe zeigen?«
Langsam erhob er sich und zog dabei seine schwarze Frei-
zeithose hoch.
»Wann war Louisa Cormier zum letzten Mal hier?«, fragte sie.
»Vor ein paar Tagen. An dem Tag vor dem Sturm, glaube
ich, aber das kann ich überprüfen.«
Er ging zu der Tür seines Büros und öffnete sie. Drietch
wartete, bis Aiden hindurchgegangen war, dann überholte er
sie und zeigte ihr den Weg. Sie passierten einige Schützen, die
gerade in den einzelnen Boxen trainierten.
»Die Kälte lockt sie her«, erklärte Drietch. »Sie werden un-
ruhig und wollen auf irgendwas schießen. Das bringt sie völlig
aus der Spur.«

Aiden antwortete nicht. Drietch stand vor einer Tür neben
dem Empfangstresen und wartete. Ein Mann, stämmig, beinahe
kahl, griff unter den Tresen, drückte auf einen Knopf, und die
Tür öffnete sich.
»Ich habe einen Schlüssel«, sagte Drietch, »aber Dave ist
fast immer hier.«
Der Raum war klein, hell und mit deckenhohen Regalen
ausgestattet, in deren Fächern kleine Metallkassetten ruhten. In
der Mitte des Raums stand ein Tisch, aber es gab keine Stühle.
»Wir haben hier fast vierhundert Handfeuerwaffen«, erklär-
te Drietch, während er seinen Schlüsselbund aus der Tasche
zog. »Der Generalschlüssel passt für alle.«
Er nahm eine Kiste behutsam heraus und stellte sie auf dem
Tisch ab.
Aiden betrachtete die Kiste und die Regale. »Manche der Me-
tallkassetten haben Vorhängeschlösser, andere nicht«, sagte sie.
»Wo keine Waffe drinliegt, da gibt es auch kein Schloss«,
erklärte er.
»Diese Kiste hat auch kein Schloss«, stellte sie fest.
»Muss wohl vergessen haben, es wieder anzubringen. Ver-
mutlich liegt es drin.«
Drietch schien die Zügel recht locker zu halten, dachte Ai-
den. Er war nicht so achtsam, wie er ihr gegenüber vorgab.
»Aber die Munition ist in einem Safe«, beeilte sich Drietch
zu sagen, denn der Tadel in ihrer Miene war ihm nicht verbor-
gen geblieben.
Aiden sagte nichts. Sie beugte sich vor und hob den Deckel
der Metallkassette hoch. Im Inneren befand sich eine Waffe,
eine Walther .22, exakt die gleiche Waffe wie die, die Louisa
in der Schublade ihres Schreibtischs aufbewahrte.
»Scheibenwaffe«, verkündete Drietch.
»Trotzdem kann man damit töten.« Aiden schob einen Blei-
stift in den Pistolenlauf und hob die Waffe aus der Kiste.

Sie brauchte nur ein paar Sekunden, um festzustellen, dass
die Waffe erst vor kurzer Zeit gereinigt worden war.
»Hat Louisa Cormier die Waffe gereinigt?«
»Nein, das macht Dave.«
Aiden tütete die Waffe ein und drehte sich zu Drietch um.
»Ich brauche eine Quittung dafür«, sagte er.
Sie zog ihr Notizbuch hervor und schrieb eine Quittung aus.
Dann setzte sie ihre Unterschrift darunter und übergab sie
Drietch.
»Ist Ms Cormier allein, wenn sie die Kassette öffnet?«
»Nein. Sie steht da und wartet. Ich habe den Schlüssel. Ich
nehme sie heraus, vergewissere mich, dass sie nicht geladen ist
und gebe sie ihr. Dann bringe ich ihr die Munition auf den
Stand. Wenn sie mit dem Schießen fertig ist, gibt sie mir die
Waffe zurück, und ich schließe sie ein.«
»Das Schloss und die Kassette rührt sie gar nicht an?«, hak-
te Aiden nach.
»Sie hat keinen Schlüssel«, antwortete er geduldig.
Aiden nickte und untersuchte die Kiste nach Fingerabdrü-
cken – sie fand vier.
Sie würde außerdem die Toiletten, die Abfalleimer und die
Mülltonnen draußen durchsuchen. Vielleicht gab es dort ja
Hinweise auf das fehlende Schloss. Das würde keinen Spaß
machen, war aber immer noch besser als die Suche nach der
Kugel im Fahrstuhlschacht.
Alles in allem dauerte es zwanzig Minuten, aber dann hatte
Aiden den kostenpflichtigen Parkplatz nebenan auch zweimal
kontrolliert.
Als sie wieder hineinging, stand Drietch in einer freien Box
auf dem Schießstand. Auf dem Pult, an dem er lehnte, lag eine
Waffe, auf die er mit dem Finger zeigte.
Als Aiden näher kam, trat er zur Seite, um ihr Platz zu ma-
chen.

Die C.S.I.-Ermittlerin zielte und drückte ab. Die schwarzen
Kreise auf dem weißen Grund waren etwa sechs Meter entfernt. Sie
verschoss fünf Patronen und gab ihm die Waffe zurück. Etwas auf
dem Boden des Schießstands hatte ihre Aufmerksamkeit erregt.
Drietch betrachtete die Zielscheibe. Die Schüsse verteilten
sich alle im Zentrum. Aiden hätte genauso gut gezielt, wenn
die Zielscheiben doppelt so weit entfernt gewesen wären.
»Sie sind gut«, sagte er in respektvollem Ton.
»Danke. Lassen Sie bitte alle aufhören zu schießen und sa-
gen Sie den Leuten, sie sollen die Waffen niederlegen.«
»Warum zum …?«, fing er an.
»Weil da draußen ein Schloss auf dem Boden liegt«, sagte
sie. »Und das werde ich als Beweismittel an mich nehmen.«
»Es ist alles bereit«, sagte Arthur Greenberg.
Mac hatte ihn angerufen, um ganz sicherzugehen.
»Schnee, Regen, nichts außer dem Zorn Gottes wird uns
aufhalten«, fuhr Greenberg fort. »Gibt es irgendjemanden, den
Sie verständigen möchten?«
»Nein«, sagte Mac.
Er wartete im Gerichtsgebäude darauf, dass ein Martin Witz,
Detective der Mordkommission, und eine Ellen Carasco, stell-
vertretende Staatsanwältin, aus dem Büro von Richter Meriman
kamen und ihm einen Durchsuchungsbefehl für das Apparte-
ment von Louisa Cormier übergaben.
»Dann«, sagte Greenberg, »sehen wir uns morgen Früh um
zehn?«
»Ja«, sagte Mac, den Blick auf die massive Tür mit dem po-
lierten Messingschild gerichtet, auf dem in beeindruckender
Schrift der Name des Richters zu lesen war.
Greenberg legte auf. Mac tat das Gleiche, und in dem Mo-
ment öffnete sich die Tür des Richterzimmers, aus der Ellen
heraustrat.

»Er will mit Ihnen sprechen.«
Carasco besaß eine schmale Silhouette. Aber Mac wusste,
dass sich unter ihrem locker sitzenden Kostüm die Muskeln ei-
ner Bodybuilderin verbargen. Carasco zählte weltweit zu den
Top-Dreißig der weiblichen Bodybuilder. Ihr Gesicht war
hübsch, die Haut glatt, das Haar dunkel und lang. Stella hatte
mehr als nur einmal angedeutet, Carasco würde ihn nicht ab-
weisen, sollte er sie zum Essen einladen. Mac war den Einflüs-
terungen nie gefolgt. Und er hatte auch nicht vor, es zu tun.
Der C.S.I.-Ermittler folgte ihr in das Richterzimmer, wo De-
tective Martin Witz schwerfällig auf einem rötlich braunen Le-
dersessel vor dem Schreibtisch des Richters Platz genommen
hatte.
Meriman, der sich dem Ruhestand näherte und stolz auf sei-
ne weiße Mähne und den gepflegten, weißen Schnauzbart war,
nickte Mac zu. Der erwiderte die Geste.
»Wir haben uns die Beweismittel angesehen«, sagte Meri-
man mit geübtem Bariton. »Ich möchte sie noch einmal mit Ih-
nen durchgehen, ehe ich meine Entscheidung treffe.«
Wieder nickte Mac. Meriman streckte die Hand aus, um an-
zudeuten, er möge sich hinsetzen. Mac setzte sich in aufrechter
Haltung auf einen Sessel, der dem von Witz glich. Carasco
blieb zwischen den beiden Männern stehen.
»Das Opfer war Charles Lutnikov«, begann Mac. »Hat im
selben Gebäude gewohnt wie Louisa Cormier. Sie kannten ein-
ander.«
»Wie gut?«, fragte der Richter.
»Den Beweisen zufolge ziemlich gut.«
Mac erzählte dem Richter von Aiden Burns Entdeckungen
auf der Drietch’s Range, von der offenen Metallkassette und
der Handfeuerwaffe des gleichen Kalibers wie die von Louisa
Cormier. Er erwähnte auch die Kugel im Fahrstuhlschacht und
das Farbband aus der Schreibmaschine Lutnikovs, auf dem der

Text zu lesen war. Bei der Gelegenheit wies er auf Kindems
Bericht hin, demzufolge nicht Louisa Cormier, sondern eine
andere Person den überwiegenden Teil ihrer Romane geschrie-
ben haben könnte – und das war der Schluss seiner Beweismit-
telkette.
»Wurde geprüft, ob die Waffe zu der Kugel passt?«, fragte
Meriman.
»Wir sind gerade dabei.«
»Dünn«, kommentierte der Richter, faltete die Hände und
sah nacheinander seine drei Besucher an.
»Durchsuchungsbefehle wurden schon auf der Grundlage
von weniger Beweisen erteilt«, wandte Carasco ein.
»Ich habe zwei Hinweise für Sie«, begann Meriman. »Ers-
tens: Wir sprechen hier über eine weltberühmte Schriftstellerin,
die genügend Geld besitzt, um mühelos einen kostspieligen
und gerissenen Anwalt zu beauftragen. Zweitens: Ihre Beweise
sind überwiegend Indizien ohne Substanz. Überaus suggestiv,
da stimme ich Ihnen zu, aber …«
Macs Mobiltelefon vibrierte in seiner Tasche. Er griff da-
nach und sagte: »Es tut mir Leid, Euer Ehren, aber das könnte
der Sache dienlich sein.«
»Fassen Sie sich kurz«, sagte der Richter und warf einen
Blick auf die Uhr an der Wand. »Und brechen Sie das Ge-
spräch ab, falls es für Ihren Antrag auf Erteilung eines Durch-
suchungsbefehls nicht relevant ist.«
Mac meldete sich: »Ja.«
Er lauschte. Das Telefonat dauerte nicht länger als zehn Se-
kunden. Er klappte das Telefon zu und steckte es wieder in die
Tasche. »Das war die C.S.I.-Ermittlerin Burn. Auf dem
Schloss, das gewaltsam von der Kiste entfernt worden ist, sind
zwei saubere Fingerabdrücke. Sie stammen beide von Louisa
Cormier.«
»War ihre Waffe in der Metallkassette?«, fragte der Richter.

»Nein«, antwortete Mac. »Sie gehört dem Schießstand. Der
Eigentümer sagt, Ms Cormier hatte keinen Schlüssel für das
Schloss. Sie muss aber den Abdrücken zufolge wenigstens ge-
wusst haben, in welcher Metallkassette diese Waffe zu finden
ist.«
Aiden hatte noch etwas anderes erzählt, etwas, das Mac dem
Richter allerdings nicht sagen wollte. Er würde es nur dann
preisgeben, wenn es notwendig war. Aiden hatte nämlich au-
ßerdem herausgefunden, dass die Kugel aus dem Fahrstuhl-
schacht nicht aus der Waffe des Schießstands stammen konnte.
Warum, überlegte Mac, war Louisa Cormier bei Drietch
eingebrochen, um sich eine Waffe zu besorgen, die doch nicht
die Mordwaffe war? Das Problem, so dachte Mac weiter, war,
dass seine Hauptverdächtige eine Krimiautorin war, die wusste,
wie man eine Ermittlung geradewegs im Land von Oz enden
ließ.
Richter Meriman drehte sich mit seinem Stuhl herum und
blickte hinaus in den grauen Tag. Es würde auch heute wieder
neuen Schnee geben. Dann drehte er sich wieder zurück und
sagte: »Ich werde einen Durchsuchungsbefehl für Louisa Cor-
miers Appartement ausstellen, um eine .22er-Waffe zu suchen,
die zu der Kugel, die Sie im Zuge der Ermittlungen gefunden
haben, passen könnte.«
Die Waffe, die Louisa Cormier ihnen gezeigt hatte, konnte
unmöglich zu der Kugel aus dem Fahrstuhlschacht passen. Da-
von war Mac überzeugt. Die Chancen, dass sie also in der
Wohnung noch eine dritte .22er finden würden, waren äußerst
gering. Sollte es aber doch noch eine dritte Waffe geben, die
bisher unentdeckt geblieben war, dann hatte Louisa Cormier
sie höchstwahrscheinlich in der Zwischenzeit beseitigt. Für den
Augenblick jedoch genügte es, wenn die C.S.I.-Ermittler we-
nigstens Louisa Cormiers Wohnung durchsuchen konnten, und
die Gelegenheit wollte sich Mac nicht entgehen lassen.

»Danke«, sagte er zu dem Richter.
»Ich brauche einen forensischen Beweis, dass die fragliche
Waffe, sollten Sie sie finden, die ist, mit der Lutnikov getötet
wurde. Wenn die .22er vom Schießstand nicht die Mordwaffe
ist, können Sie Schussversuche mit jeder .22er ausführen, die
Sie in Louisa Cormiers Appartement finden, um sie mit der
Kugel aus dem Fahrstuhlschacht zu vergleichen.«
Der Richter schaute Mac auffordernd an.
»Sollte sich bei der Suche nach der Waffe andeuten, dass es
weitere Beweise dafür gibt, dass Louisa Cormier in das zu un-
tersuchende Verbrechen verwickelt ist, so müssen diese wäh-
rend der Wohnungsdurchsuchung entdeckt worden sein. Ist das
klar?«
»Ja«, sagten Carasco, Witz und Taylor im Chor.
»Dann sind wir fertig.«
Meriman griff zu seinem Telefon, drückte auf die Taste und
forderte die Person am anderen Ende auf, in sein Büro zu
kommen.
»Eines sollten Sie noch wissen, Euer Ehren«, begann Caras-
co, »uns liegt das Geständnis einer anderen Person vor.«
Der Richter lehnte sich mit einem ärgerlichen Seufzer zu-
rück.
»Detective Taylor glaubt, das Geständnis sei falsch«, fügte
Carasco hinzu.
»Wenn Sie Beweise liefern können, dass das Geständnis
falsch ist, dann werde ich den Durchsuchungsbefehl für Louisa
Cormiers Appartement ausstellen«, beendete er das Gespräch.
»Und jetzt gehen Sie. Sie haben genug von meiner Zeit ver-
schwendet.«
Die drei Besucher verließen das Büro und hörten, wie hinter
ihnen mit einem leisen Klicken ein Radio eingeschaltet wurde.

13
»Mr Marco hat Ihnen nichts zu sagen«, verkündete Helen
Grandfield, als Stella und Danny das Büro in Begleitung zwei-
er uniformierter Beamter betraten. »Und dies ist Privatbesitz.
Sollten Sie also keinen Durchsuchungsbefehl haben …«
»Das ist ein Tatort«, sagte Stella.
Der Geruch von frischem Brot musste überall in der Luft
liegen, aber Stella roch rein gar nichts, stattdessen unterdrückte
sie den Drang, sich ihre Nase zu putzen.
»Was für ein Tatort?«, fragte Helen Grandfield und erhob
sich.
»Wir haben Beweise, die unzweifelhaft darauf hindeuten,
dass in Ihrem Korridor ein Polizeibeamter ermordet wurde«,
erklärte Danny.
Helen Grandfield starrte Danny und die beiden uniformier-
ten Polizisten, die die Ermittler begleiteten, an.
»Das ist Blödsinn«, blaffte sie.
»Mrs Contranos«, sagte Stella.
»Ich benutze und bevorzuge den Namen Grandfield«, sagte
sie.
»Nur nicht an der Tür Ihres Appartementhauses«, konterte
Stella. »Außerdem wurden Sie als Helen Marco geboren. Eine
Menge Namen.«
Helen Grandfield gab sich Mühe, nicht gar zu wütend drein-
zublicken, aber es gelang ihr nicht.
»Wir möchten wissen, ob einer Ihrer Bäckereiangestellten
heute Morgen nicht zum Dienst erschienen ist, und wir möch-

ten mit jedem sprechen, der in der Bäckerei arbeitet. Außerdem
müssen wir darauf bestehen, noch einmal mit Ihrem Vater zu
sprechen.«
Die Erwähnung ihres Geburtsnamens und der Hinweis auf
ihre Verwandtschaft mit Dario Marco brachte die Frau, die ge-
rade zum Protest ansetzen wollte, zum Schweigen.
»Ms Contranos, Sie wohnen an der President Street in
Brooklyn Heights. Hat ein Angehöriger der Bäckerei Sie letzte
Nacht dort besucht?«, fragte Stella.
»Nein. Warum?«
»Jemand hat vor Ihrer Tür geblutet«, erklärte Stella und
merkte, wie ihr selbst mulmig wurde. »Und jemand hat sich
erbrochen. Sie wissen doch, dass wir die Person mit einer
DNS-Analyse ermitteln können.«
Die Frau stand da, die Arme um den Leib geschlungen, und
zitterte.
»Wir würden Ihre Kooperation zu schätzen wissen«, ver-
sprach Stella.
»Mein Vater ist noch nicht hier. Ich brauche seine Erlaub-
nis, um …«
Stella schüttelte abwehrend den Kopf, noch ehe die Frau ih-
ren Satz beenden konnte.
»Was ist mit Steven Guista?«
»Das ist einer unserer Lieferwagenfahrer«, entgegnete He-
len Grandfield, bemüht, ihre Haltung zu bewahren.
»Wir möchten mit ihm sprechen.«
»Ich bin nicht …«
»Er hat einen Polizeibeamten angegriffen und wird in Ver-
bindung mit dem Mord an Alberta Spanio gesucht. Die Frau,
die heute oder morgen gegen Ihren Onkel aussagen sollte.
Reicht das?«, fragte Stella.
Helen Grandfield sagte nichts, atmete tief durch und ergriff
dann mit ruhiger Stimme wieder das Wort.

»Steve Guista hat frei. Gestern war sein Geburtstag. Mein
Vater hat ihm zwei Tage freigegeben. Ich kann Ihnen seine Ad-
resse geben.«
»Die haben wir«, sagte Stella. »Also, wer ist heute sonst
noch abwesend, obwohl er eigentlich hier sein sollte?«
»Alle sind ordnungsgemäß zur Arbeit erschienen.«
»Wir brauchen eine Namensliste der Angestellten und einen
Raum, in dem ich mit jedem Einzelnen sprechen kann.«
»Wir haben keinen Raum, der dafür geeignet wäre.«
»Schön«, sagte Stella. »Dann machen wir es eben in der
Backstube.« Stella hielt es nicht länger aus. Sie fischte ein di-
ckes Taschentuch aus ihrer Tasche und schnäuzte sich die Nase.
Jordan Breeze saß ein weiteres Mal Detective Mac Taylor im
Verhörzimmer gegenüber. Beide Männer hatten Pappbecher
mit Kaffee vor sich stehen.
Mac schaltete den Kassettenrekorder an und klappte die Ak-
tenmappe auf, die auf dem Tisch lag. Sie war dicker als bei der
letzten Unterhaltung.
»Sie haben Charles Lutnikov nicht umgebracht.«
Breeze lächelte und trank etwas Kaffee.
»Ihre Hand zittert.«
»Nervosität.«
»Nein.« Mac schüttelte den Kopf. »Multiple Sklerose.«
»Sie hatten kein Recht, meinen Arzt nach dieser Diagnose
zu fragen«, regte Breeze sich auf.
»Dazu brauche ich Ihren Arzt gar nicht«, sagte Mac. »Wir
haben einen eigenen Arzt, und der hat Sie beobachtet. Ruckar-
tige Augenbewegungen. Störung der Augenmobilität und Au-
genmotorik. Sie haben gestottert, als ich mit Ihnen gesprochen
habe, und mir ist aufgefallen, dass Sie Probleme hatten, Ihre
Tasse zu greifen. Ihre Hände haben gezittert. Sie geben sich
viel Mühe und sprechen langsam und bedächtig, um eine un-

deutliche Aussprache zu vermeiden, aber Sie können das nicht
vollständig kontrollieren. Sie können nicht gerade sitzen. Sie
sacken immer wieder zusammen. Als ich Ihre Hand berührt
habe, war sie auffallend kalt. Und zweimal, als Sie in Ihrer Zel-
le auf und ab gegangen sind, sind Sie beinahe gestürzt. Sie hät-
ten im Schnee niemals bis zum Fluss und wieder zurück mar-
schieren können.«
Langsam richtete Breeze sich auf dem Stuhl auf.
»Sehen Sie doppelt?«, fragte Mac. »Leiden Sie unter Mus-
kelschwäche? Muskelzuckungen? Schmerzen im Gesicht? Ü-
belkeit? Inkontinenz?«
Breeze erbleichte und stellte den Pappbecher auf dem Tisch
ab, bemüht, nichts zu verschütten.
»Gedächtnisstörungen?«
»Meine Krankenakte bekommen Sie nicht.«
»Sie haben einen Mord gestanden«, sagte Mac. »Wir ste-
cken Sie ins Gefängnis und lassen Sie vom Gefängnisarzt un-
tersuchen.«
Breeze sagte nichts.
»Wie viel Zeit bleibt Ihnen, bis die Krankheit vollständig
ausbricht?«
»Ein Jahr, zwei.«
»Haben Sie eine Familie, die sich um Sie kümmern würde?«
»Keinen Menschen.« Breezes rechte Hand zitterte deutlich.
»Sie hatten nie eine Waffe, oder?«
Breeze antwortete nicht.
»Wir haben einen Koffer in einem Schließfach gefunden«,
sagte Mac. »Er war voll mit signierten Büchern von Louisa
Cormier. Sie haben sie aus Ihrer Wohnung entfernt, als Sie von
dem Mord gehört und sich mit Louisa Cormier abgesprochen
haben.«
»Sie hat sie für mich signiert«, sagte er. »Ich bin ein großer
Fan. Das nächste Buch will sie mir sogar widmen.«

»Sie haben Charles Lutnikov nicht ermordet. Und er hat sie
nie schikaniert.«
»Ich war es.«
»Hatte Lutnikov irgendetwas bei sich, als Sie ihn ermordet
haben?«
»Nein.«
»Keine Zeitung, Bücher …?«
»Nichts.«
»Bezahlt Louisa Cormier Ihre Arztkosten?«, fragte Mac.
Breeze antwortete nicht. Stattdessen drehte er den Kopf
weg. Mac glaubte, Schmerz in seiner Miene erkannt zu ha-
ben.
»Wir werden es herausfinden.«
»Sie ist ein guter Mensch.«
Mac sagte nichts dazu, und schließlich senkte Breeze den
Blick.
»Alles, was ich anfasse, geht schief.«
»Hat Louisa Ihnen die Details über den Mord verraten?«,
fragte Mac.
»Ich denke, ich möchte jetzt doch einen Anwalt«, sagte
Breeze.
»Und ich denke, das ist eine gute Idee«, antwortete Mac.
Eine Stunde später, nachdem er sich die Aufzeichnung des
Gesprächs zwischen Mac und Jordan Breeze angehört hatte,
stellte Richter Meriman einen Durchsuchungsbefehl für Louisa
Cormiers Appartement aus.
Dieses Mal bot Louisa Cormier Aiden und Mac keinen Kaffee
an. Sie war nicht abweisend, mürrisch oder auch nur unhöflich.
Tatsächlich zeigte sie sich kooperativ und freundlich, aber Kaf-
fee und charmantes Geplauder mit dem C.S.I.-Duo, das mit ei-
nem Durchsuchungsbefehl wedelte, standen heute eindeutig
nicht auf ihrer Tagesordnung.

Als sie die Ermittler in die Wohnung ließ, wirkte sie in ih-
rem locker sitzenden Blümchenkleid ein wenig abgespannt und
müde, und ihre Augen waren blutunterlaufen.
»Bitte warten Sie«, sagte sie, kaum dass sie eingetreten waren.
Mac und Aiden waren dazu nicht verpflichtet. Dennoch
warteten sie, bis Louisa das Telefonat beendet hatte. An einem
kunstvoll verzierten Tisch jenseits der Wohnungstür hatte sie
mit ihrem drahtlosen Telefon ihren Anwalt angerufen.
»Ja«, sagte Louisa am Telefon, darum bemüht, die Ermittler
gar nicht zu beachten. »Ich halte ihn in der Hand.«
Sie betrachtete den Durchsuchungsbefehl.
»Soll ich ihn vorlesen? … Also schön. Bitte beeilen Sie
sich.«
Louisa legte auf. »Warum sind Sie hier?«, fragte sie. »So-
weit ich gehört habe, hat bereits jemand den Mord an Mr Lut-
nikov gestanden.«
»Wir glauben ihm nicht«, erklärte Mac. »Sein Name ist Jor-
dan Breeze. Kennen Sie ihn?«
»Flüchtig. Mein Anwalt wird in fünfzehn Minuten hier
sein«, sagte sie. »Ich muss Sie bitten, alles so zu hinterlassen,
wie Sie es vorgefunden haben.«
Mac nickte.
»Ich habe die Absicht, Ihnen zuzusehen«, fuhr Louisa fort.
»Recherche für mein neues Buch.«
»Mit dem Letzten sind Sie fertig?«, fragte Mac höflich.
Louisa lächelte und sagte: »Fast.«
Aiden und Mac blieben einen Moment schweigend stehen
und warteten darauf, dass sie fortführe. Louisa legte eine Hand
an ihre Stirn und sagte: »Es könnte mein Letztes gewesen sein,
zumindest für eine Weile. Wie Sie sicher sehen, hat es mir sehr
viel abverlangt. Darf ich fragen, was Sie hier zu finden hoffen?
Vielleicht kann ich Ihnen ein wenig Zeit ersparen und gleich-
zeitig meine Teppiche und meine Privatsphäre sauber halten.«

»Unter anderem eine Pistole Kaliber .22«, sagte Mac.
»Nicht die, die Sie uns gestern gezeigt haben. Und einen Bol-
zenschneider.«
»Einen Bolzenschneider?«, fragte sie.
»Auf der Drietch’s Range
wurde das Vorhängeschloss an
der Metallkassette, in der eine von Ihnen benutzte Pistole auf-
bewahrt wurde, aufgebrochen, vermutlich irgendwann im Lauf
des gestrigen Tages.«
»Und die Waffe aus der Kassette ist verschwunden?«, fragte
sie, und ihre Blicke trafen sich.
»Nein«, sagte Mac.
»Nun, ich fürchte, Sie werden sich selbst umsehen müssen«,
sagte Louisa. »Sie werden nichts finden. Ich allerdings sollte
mir Notizen darüber machen, wie es sich anfühlt, eines Mordes
verdächtigt zu werden. Schließlich bin ich ganz offensichtlich
die Hauptverdächtige, nicht wahr?«
»Sieht so aus«, antwortete Mac.
»Eine Hauptverdächtige ohne Motiv«, fügte sie hinzu.
Weder Mac noch Aiden antworteten ihr. Stattdessen zogen
sie ihre Latexhandschuhe an und begannen dort mit ihrer Ar-
beit, wo sie sich gerade aufhielten – im Eingangsbereich.
»Sie werden mich umbringen«, sagte Big Stevie zu Jake, dem
Jockey.
Stevie saß, tief eingesunken und mit schmerzendem Bein,
auf dem Sofa, aber er dachte weder an seinen Geburtstag noch
an den Schmerz, sondern allein an den Verrat, den Dario
Marco begangen hatte. Eine andere Erklärung gab es nicht.
Demnach war Stevie eine Belastung. Er wusste, was mit Al-
berta Spanio passiert war. Marco konnte das Risiko, dass Ste-
vie geschnappt und zum Reden gebracht würde, nicht einge-
hen – also hatte er ihn mit der Adresse in Brooklyn in eine
Falle gelockt.

Stevie hätte nicht geredet. Abgesehen von seiner kleinen
Wohnung, seinem Job als Lieferwagenfahrer für die Bäckerei,
ein paar Fernsehsendungen, die er gern sah, und einer Bar, in
der er gern ein bisschen abhing, hatte er nur noch Lilly und ihre
Mutter in der Wohnung gegenüber. Und Marco. Bis gestern
hatte ihm das zu seinem Glück vollkommen gereicht.
»Willst du Kaffee, einen Drink, irgendwas?«, fragte ihn der
Jockey, der an dem Tisch in der Einzimmerwohnung saß.
»Nein, danke«, sagte Stevie.
Stevie und der Jockey hatten einige Jobs zusammen erledigt,
meistens für die Familie Marco. Das Reden übernahm größten-
teils der Jockey, wenn sie zusammen waren. Nicht, dass er zu
den Leuten gehört hätte, die einfach nicht aufhören konnten zu
reden, aber verglichen mit Stevie war er Leno oder Letterman.
»Was wirst du jetzt tun?«, fragte der Jockey.
Stevie wollte nicht über seine Möglichkeiten nachdenken,
aber er zwang sich dazu. Er konnte etwas Geld auftreiben,
nicht viel, aber immerhin zwanzigtausend oder so. Falls er
nicht von der Polizei überwacht wurde, konnte er es von der
Bank abheben. Er konnte sich auch stellen, gegen Anthony und
Dario Marco aussagen, vielleicht sogar einer Mordanklage ent-
gehen und in das Zeugenschutzprogramm aufgenommen wer-
den. Was schuldete er Marco jetzt noch? Er hatte sich der Fa-
milie gegenüber absolut loyal verhalten, und sie hatten ver-
sucht, ihn umzubringen.
Nein, selbst wenn er einen guten Anwalt finden und einen
guten Handel abschließen könnte, würde er einige Zeit sitzen
müssen. Er hatte einen Cop erdrosselt. Da kam er nicht drum
herum. Stevie war einundsiebzig Jahre und ein paar Stunden
alt. Er würde im Knast an Altersschwäche sterben, vorausge-
setzt, die Marcos bekamen ihn nicht vorher in die Hände.
Zurzeit konnte Stevie sich noch mühelos zur Wehr setzen,
aber in ein paar Jahren war er vielleicht nicht mehr schnell ge-
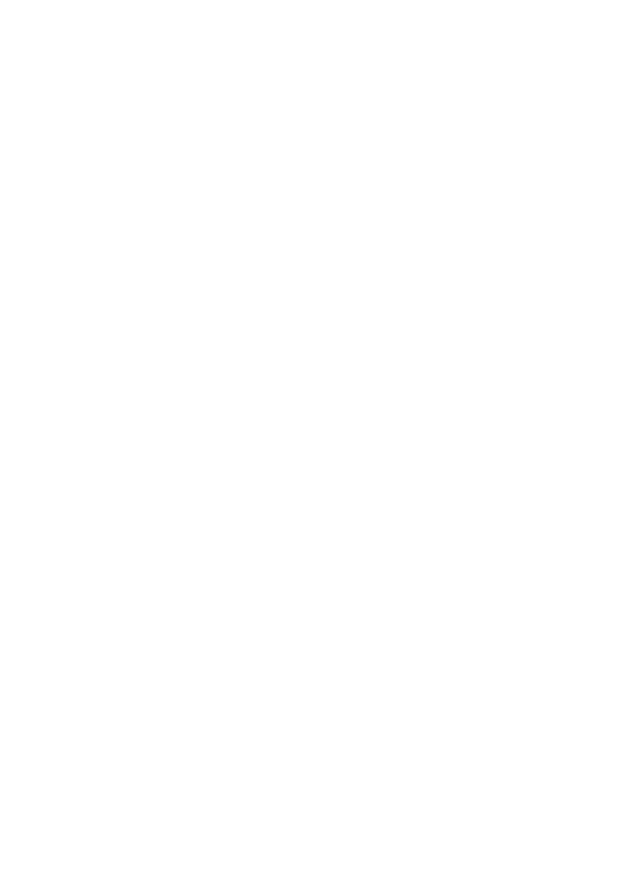
nug, und im Knast konnte einem schnell etwas zustoßen. Viel-
leicht, falls er Glück hatte, würde er von den anderen Gefange-
nen isoliert werden, würde in einer eigenen Zelle leben und
sterben.
Nein, im Grunde gab es nur eine Sache, die er tun konnte.
Er musste Dario Marco töten. Doch Dario umzubringen würde
lediglich bedeuten, dass sie quitt wären. Vermutlich hatte er die
beiden Männer, die versucht hatten, ihn vor dem Eingang zu
Lynn Contranos Wohnhaus zu schnappen, kaltmachen sollen.
Vielleicht hatte er sogar einen von ihnen getötet. Vielleicht lag
der, den er in den Bauch geschlagen hatte, inzwischen mit in-
neren Blutungen in irgendeinem Krankenhaus und schloss in
diesem Augenblick für immer die Augen. Dem zweiten Kerl
hatte er nur die Nase gebrochen. Stevie glaubte sich zu erin-
nern, dass sein Name Jerry lautete. Stevie hatte ihnen die Waf-
fe abgenommen und weggeworfen. Vielleicht hätte er sie be-
halten sollen, aber Stevie hatte Waffen noch nie gemocht. Viel-
leicht sollte er auch diese Lynn Contranos töten. Wenn er alle
Fakten in Betracht zog, boten sich ihm wirklich nicht viele
Möglichkeiten, wie er es anstellen sollte, am Leben zu bleiben.
Er musste einfach der Letzte sein, der überlebt.
Es klopfte an der Tür. Der Jockey stand ruckartig auf und
sah erst Stevie und dann die Tür an.
»Wer ist da?«, fragte Jake.
»Polizei.«
Viele Verstecke gab es hier nicht. Den Kleiderschrank oder
das Badezimmer. Der Jockey deutete auf das Badezimmer.
Stevie setzte sich auf. »Stell dich hinter die Tür«, flüsterte Ja-
ke. »Lass sie offen und zieh die Toilettenspülung.«
Stevie kämpfte sich aus dem tiefen Sessel empor und hum-
pelte zum Badezimmer, während Jake zur Tür ging. Unterwegs
sah er sich um und suchte auf dem Boden nach verräterischen
Blutspuren. Er konnte keine entdecken.

Stevie drückte auf die Spülung und versteckte sich hinter
der offenen Tür.
»Ich komme«, sagte der Jockey, sah sich noch einmal um
und vergewisserte sich, dass Stevie im Bad war.
Er machte den Reißverschluss seiner Hose auf und öffnete
die Tür. Dann zog er den Reißverschluss wieder zu. Der Cop
war allein, Zivilkleidung, Ledermantel.
»Jacob Laudano?«, fragte der Cop.
»Lloyd«, entgegnete der Jockey. »Jake Lloyd. Hab den Na-
men ganz legal ändern lassen.«
»Kann ich reinkommen?«
Jake zuckte mit den Schultern und sagte: »Klar, ich habe
nichts zu verbergen.«
Er trat zurück, und Don Flack betrat die kleine Wohnung.
Die Badezimmertür stand offen.
In Marco’s Bakery in Castle Hill waren achtzehn Mitarbeiter
beschäftigt. Alle waren an ihrem Arbeitsplatz, bis auf Steven
Guista.
Stella kontrollierte die Namensliste, während die Männer
und Frauen in das Büromateriallager kamen, das den C.S.I.-
Ermittlern für ihre Befragung zur Verfügung gestellt worden
war.
Als sie mit den ersten neun Personen gesprochen hatten und
ihre Fingerabdrücke und DNS-Proben überprüft hatten, war
klar, dass jeder Mitarbeiter entweder ein ehemaliger Strafge-
fangener war oder in irgendeiner Beziehung zur Familie Marco
stand. Oft war beides der Fall.
Jerry Carmody war Nummer zehn. Er war groß, breit, etwa
vierzig, übergewichtig und hatte seine Nase bandagiert. Seine
Augen waren rot und geschwollen.
»Was ist mit Ihrer Nase passiert?«, fragte Stella, als Danny
dem Mann eine Speichelprobe abnahm.

»Unfall. Bin gestürzt«, sagte er.
»Muss ein harter Sturz gewesen sein. Haben Sie etwas da-
gegen, wenn ich mir das mal ansehe?«
»War heute Morgen schon beim Doktor«, sagte Carmody.
»Hat’s wieder gerichtet. War gebrochen.«
»Sie hatten Glück, dass Ihnen der Knochen nicht ins Gehirn
getrieben wurde«, sagte Stella. »Sie haben einen harten Schlag
abbekommen.«
»Hab doch gesagt, ich bin gestürzt«, erwiderte Carmody.
»Waren Sie gestern Abend in Brooklyn?«
Carmody sah sich zu dem Uniformierten um, der ihn in das
Materiallager geführt hatte.
»Ich wohne in Brooklyn.«
»Kennen Sie eine Lynn Contranos?«
»Nein.«
»Wir brauchen eine Blutprobe von Ihnen«, sagte Stella und
hustete.
»Wozu?«
»Ich glaube, Stevie Guista hat Ihnen das angetan, als Sie
ihm aufgelauert haben«, sagte sie. »Sie haben vor Lynn
Contranos Tür geblutet. Wir haben eine Probe.«
Carmody verfiel ins Schweigen.
»Sie kennen Helen Grandfield?«, fragte Stella.
»Klar«, sagte er.
»Sie ist Lynn Contranos«, sagte Stella.
»Und weiter?«, fragte Carmody desinteressiert.
»Wo ist Guista?«
»Big Stevie? Keine Ahnung. Zu Hause oder unterwegs, um
sich zu betrinken. Er hatte gestern Geburtstag. Vermutlich
schläft er gerade seinen Rausch aus.«
»Wir werden uns noch ein bisschen über Stevie unterhalten,
wenn wir Ihr Blut mit dem auf der Türschwelle verglichen ha-
ben. Krempeln Sie den Ärmel hoch.«

»Und was, wenn ich nein sage?«
»Ermittler Messer ist sehr vorsichtig«, sagte Stella. »Wenn
Sie nicht wollen, dass wir Ihnen hier Blut abnehmen, dann ho-
len wir uns die richterliche Verfügung und kommen mit dem
Laborassistenten wieder. Wer hat heute Dienst?«
»Janowitz«, sagte Danny in nichts sagendem Ton.
»Janowitz wird Ihnen nicht gefallen«, sagte Stella.
»Janowitz, der Stecher«, kommentierte Danny.
Carmody krempelte den Ärmel hoch.
Ned Lyons war der zwölfte Angestellte, der in das Material-
lager geführt wurde, und Danny und Stella erkannten auf An-
hieb, dass sie einen Volltreffer gelandet hatten.
Lyons war schlank, gut gebaut, sah aber mit seinem ver-
härmten Gesicht älter aus als vierunddreißig. Das Gehen berei-
tete ihm offensichtlich Schmerzen, was er erfolglos zu verber-
gen suchte.
»Geht es Ihnen gut?«, fragte Stella, als Lyons sich langsam
und vorsichtig auf den Holzstuhl am Tisch setzte.
»Magen-Darm-Grippe«, sagte er.
»Sollten Sie mit einer Magen-Darm-Grippe in der Bäckerei
arbeiten?«, fragte sie.
»Sie haben Recht«, sagte Lyons. »Vielleicht sage ich dem
Boss besser, dass ich krank bin.«
»Ziehen Sie bitte Ihr Hemd hoch«, bat Stella.
Lyons sah sich um, seufzte und zog das Hemd hoch. Der
blaue Fleck um den Solarplexus herum war so groß wie eine
Tortenplatte. Schon jetzt leuchtete er in Purpur, Gelb und Blau.
»Und was verrät Ihnen das jetzt?«, fragte er.
»Können Sie mir bitte sagen, was Mr Lyons gestern Abend
gegessen hat?«, fragte Stella und wandte sich an Danny, der,
den Blick auf Lyons gerichtet, antwortete: »Peperoni, Wurst
und einen Haufen Pasta. Mr Lyons bevorzugt eine würzige So-
ße.«

»Woher wissen Sie, was ich …«, setzte Lyons an.
»Öffnen Sie den Mund, Mr Lyons«, befahl Stella.
Ein nunmehr arg verwirrter Ned Lyons klappte den Mund
auf, und Stella beugte sich vor, um einen Blick hineinzuwerfen.
Als sie sich wieder zurücklehnte, sagte sie: »Ich habe eine
gute Neuigkeit für Sie. Wir haben Ihren verlorenen Zahn ge-
funden.«
In Louisa Cormiers drittem Buch hatte der Mörder, ein nach
außen sanftmütig erscheinender Büroleiter, einen Schrank im
Keller seines dritten Opfers aufgebrochen, wozu er einen fünf-
unddreißig Zentimeter langen, eineinviertel Kilo schweren
Bolzenschneider aus Stahl benutzt hatte.
Louisa hatte beschrieben, wie es sich anfühlte und anhörte,
das Schloss aufzubrechen. Louisa wusste also, wie man einen
Bolzenschneider benutzen musste. Das Schloss der Metallkas-
sette auf Drietch’s Range wurde auch mit einem Bolzenschnei-
der durchtrennt. Eine Untersuchung hatte das eindeutig erwie-
sen.
Als Louisa am Morgen des Mordes, nach der Aussage des
Portiers, wie üblich zu ihrem Morgenspaziergang aufgebrochen
war, hatte sie eine große Tasche von Barnes and Noble
bei sich
gehabt – zweifellos groß genug, um einen Bolzenschneider zu
transportieren, der so aussah wie der, den die Autorin in einem
ihrer Bücher beschrieben hatte.
Aber in Louisa Cormiers Sammlung in der Bibliothek gab
es keinen Bolzenschneider.
Keinen Bolzenschneider und keine Waffe Kaliber .22. Das
ergab die zweiunddreißigminütige Durchsuchung. Was Mac
jedoch in der untersten Schublade des Schreibtisches entdeckte,
war ein ebenso interessanter Fund. Es war ein gebundenes Ma-
nuskript. Er legte es auf den Schreibtisch, als Louisa Cormier
bereits zu protestieren begann.

»Das ist das Konzept für eines meiner früheren Bücher.
Damals habe ich noch eine Schreibmaschine benutzt. Es wurde
nie veröffentlicht. Ich wollte es schon längst überarbeitet ha-
ben, um es zu veröffentlichen. Mir wäre lieber, Sie würden
nicht …«
Louisa sah ihren Anwalt an, Lindsey Terry, der vor einigen
Minuten eingetroffen war. Er hielt eine Hand hoch, um anzu-
deuten, dass seine Klientin ihren Protest einstellen sollte.
Mac klappte den dicken grünen Einband des Manuskripts
auf und blickte auf die Titelseite.
»Wenn Sie das jetzt bitte zurücklegen würden«, sagte sie.
»Es hat nichts mit Bolzenschneidern oder Schusswaffen zu
tun.«
Mac deutete auf die vor ihm liegende Seite.
»Nichts Ehrenrühriges«, sagte Louisa. »Ich habe auf das
Buch geschossen.«
Mac legte den Kopf auf die Seite wie ein Vogel, der neugie-
rig ein Bröckchen beäugt und überlegte, ob er es vielleicht es-
sen sollte.
»Als ich fertig war«, sagte sie, »habe ich es verabscheut. Ich
habe damals in Sidestock, Pennsylvania, gelebt und für die ört-
liche Zeitung gearbeitet, freiberuflich, um meine nicht gerade
bemerkenswerten Einkünfte aufzubessern. Ich habe das Buch
gelesen und gedacht, es wäre ein totaler Fehlschlag, ein Jahr
vergeudeter Zeit in meinem Leben. Also habe ich es in den
Wald hinter dem Haus getragen und darauf geschossen. Ich
dachte, mein erhofftes Leben als Schriftstellerin wäre vorbei,
bevor es überhaupt begonnen hatte. Eine vollkommen impulsi-
ve Tat.«
»Aber Sie haben es nicht weggeworfen«, sagte Mac.
»Nein, das habe ich nicht. Das musste ich nicht. Ich habe
meine Verzweiflung abgeschüttelt. Aber ich konnte mich nicht
überwinden, auch das Manuskript wegzuwerfen. Und ich bin

froh, dass ich es nicht getan habe. Das Manuskript erinnert
mich daran, dass die Musen wankelmütig sein können. Und in-
zwischen glaube ich tatsächlich, dass ich eines Tages im Stan-
de sein werde, es zu retten.«
»Macht es Ihnen etwas aus, wenn wir es mitnehmen?«, frag-
te Mac und blätterte auf die letzte Seite des Manuskripts. »Wir
geben es Ihnen natürlich zurück.«
Wieder blickte Louisa ihren Anwalt, Lindsey Terry, an, der
die ganze Zeit schweigend neben ihr gestanden hatte und auch
jetzt nichts sagte. Terry war ein Relikt aus vergangenen Zeiten.
Er hatte sich vor über einem Jahrzehnt zur Ruhe gesetzt, war
jedoch in den Beruf zurückgekehrt, als er feststellte, dass ihm
die Leidenschaft, die er früher für die Aufzucht exotischer Fi-
sche gehegt hatte, verloren gegangen war. Relikt oder nicht,
Lindsey Terry war ein gefürchteter Anwalt. Er war klug, und er
wusste, wie er die Alterskarte wirksam ausspielen konnte. Zu-
dem war Mac überzeugt, dass Lindsey Terry, sollte Anklage
gegen Louisa Cormier erhoben werden, zu Gunsten eines ande-
ren Anwalts zurücktreten würde – eines Anwalts, der eine grö-
ßere Beachtung in der Öffentlichkeit genoss.
»Hat dieses Manuskript irgendeinen Einfluss auf die Auf-
klärung des Verbrechens?«, fragte der Anwalt.
»Ja, Sir«, sagte Mac. »Ich denke, den hat es.«
»Ich will nicht, dass er es liest«, sagte Louisa.
»Ist es notwendig, dass Sie Ms Cormiers Manuskript le-
sen?«, fragte der Anwalt.
»Ich bin in den letzten zwei Tagen zu einem Fan gewor-
den«, sagte Mac und blickte auf die aufgeschlagene Seite.
»Können Sie nicht …?«, fing Louisa an und sah den kahl-
köpfigen, sauber rasierten alten Mann an ihrer Seite an.
»Ich kann nicht«, antwortete Terry. »Ich kann Detective
Taylor nur warnen, dass die Ergebnisse seiner Durchsuchung
nutzlos werden, wenn er seine Kompetenzen überschreitet.«

»Ich verstehe«, sagte Mac und erhob sich.
Aiden betrat den Raum. Ehe sie von Louisa Cormier oder
dem Anwalt bemerkt wurde, gab sie Mac ein Zeichen, dass sie
nichts gefunden hatte.
»Der Name Ihres neuen Buchs?«, fragte Mac.
»Die zweite Chance.«
Aiden trat zu dem Schreibtisch, von dem Mac sich gerade
erhoben hatte, und schaltete den Computer an.
»Was macht sie da?«, fragte Louisa.
»Sie sucht die Datei ihres neuen Buches«, erklärte Mac.
Aidens Finger huschten flink über die Tastatur, während ihr
Blick auf die Bildschirmoberfläche gerichtet war. Auf der rech-
ten Seite wurde eine Datei angezeigt, die den Namen Die zwei-
te Chance trug. Sie klickte sie an und rief das Ende des Doku-
ments auf.
»Seite dreihundertundsechs.«
»Ich bin fast fertig«, sagte Louisa.
Aiden klickte das Symbol an, öffnete den Ordner und fand
die Roman-Dateien. Dann sah sie Mac an und schüttelte den
Kopf.
»Wir sind fertig.« Mac zog die Handschuhe aus und legte
sie in seine Tasche. Das Manuskript klemmte er unter seinen
Arm, während er mit der Hand den Koffer griff.
Als sie das Appartement verließen, blickte sich Mac noch
einmal zu Louisa Cormier um und schloss aus dem, was er sah,
dass die berühmte Schriftstellerin es nun nicht mehr für so inte-
ressant hielt, eines Mordes verdächtigt zu werden.
»Was ist mit dem Manuskript?«, fragte Aiden.
Mac gab es ihr. Aiden schlug es auf und starrte das Loch an.
»Letzte Seite«, sagte Mac.
Aiden blätterte zur letzten Seite. Als der Fahrstuhl schließ-
lich in der Lobby hielt, hatte sie genug gelesen, um zu wissen,
dass das, was sie hier vor sich sah, exakt die Worte waren, die

sie schon auf dem Farbband von Charles Lutnikovs Schreibma-
schine gelesen hatte.
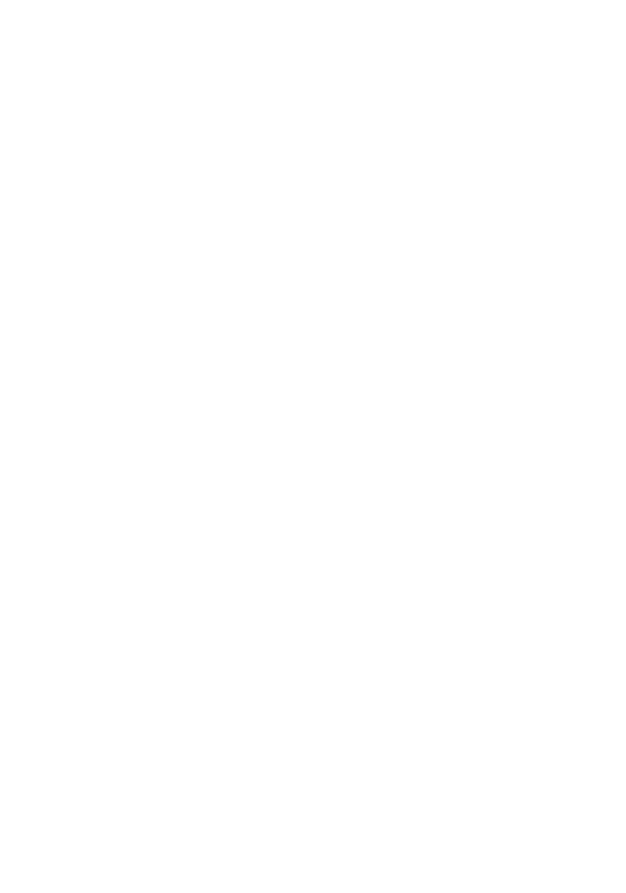
14
»Stevie Guista«, sagte Don Flack zu Jacob Laudano, dem Jo-
ckey. Von dort, wo er stand, konnte Don den ganzen Raum,
sowie die Toilette und das Waschbecken jenseits der offen ste-
henden Badezimmertür sehen.
Er trat ein und schloss die Tür hinter sich zu.
»Hab Big Stevie schon seit Monaten nicht mehr gesehen«,
sagte Jacob.
»Er war in der vorletzten Nacht im Brevard Hotel«,
sagte
Flack. »Und Sie auch.«
»Ich? Nein«, widersprach der Jockey.
»Dann haben Sie sicher nichts gegen eine Gegenüberstel-
lung einzuwenden.«
»Eine Gegenüberstellung? Wozu zum Teufel?«
»Um festzustellen, ob einer der Mitarbeiter des Hotels Sie
wiedererkennt«, erklärte Don. »Sollte das der Fall sein, landen
Sie ganz oben auf der Liste der Mordverdächtigen.«
»Warten Sie eine Minute«, sagte Jake, ging zum Tisch und
setzte sich. »Ich habe niemanden ermordet. Nicht vorletzte
Nacht und auch sonst nicht. Ich habe ein Strafregister, ja, aber
ich habe nie irgendjemanden ermordet.«
»Das stimmt. Man konnte Ihnen die Morde nie nachweisen.«
»Vielleicht war ich im Brevard«, sagte Jake. »Ich gehe da
manchmal hin und schau auf einen Sprung hinein. Ganz unter
uns, manchmal wird in einem der Zimmer um hohe Einsätze
gespielt.«
»Vorletzte Nacht auch?«, fragte Don.
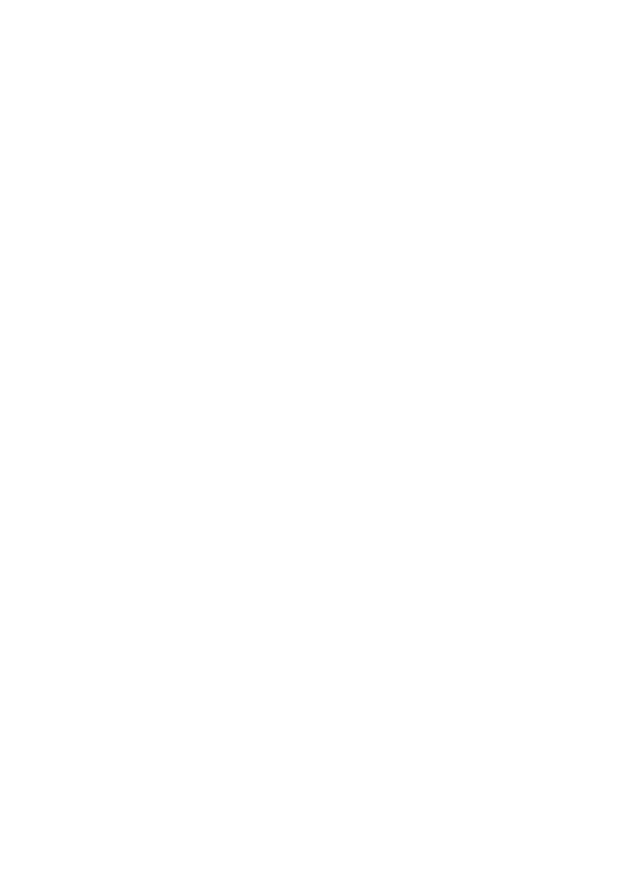
»War nichts los. Bin woanders hin.«
»Wer organisiert die Spiele?«, fragte Flack und ging auf Ja-
ke zu, der vor ihm zurückwich.
»Wer das Spiel organisiert? Ein Kerl namens Paulie. Keine
Ahnung, wie sein Nachname lautet. Hab ich nie gewusst. Für
mich ist er einfach Paulie.«
»Ich will Steven Guista«, sagte Don. »Wenn ich Ihnen auf
die Füße treten muss, um ihn zu kriegen, hinterlasse ich auf
dem Teppich bestimmt nur einen kleinen Fleck.«
»Ich weiß nicht, wo er ist. Ich schwöre es.«
»Genau«, sagte Don. »Warum sollten Sie auch lügen?«
»Genau«, stimmte Jake ihm zu.
Don stand vor dem Mann, der so klein war, dass er sich
durchaus in der vorletzten Nacht zu Alberta Spanios Fenster
hätte hineinschwingen und ihr ein Messer in den Hals rammen
können.
Gut, es gab keine handfesten Beweise. Keine Fingerabdrü-
cke. Keine Zeugen. Aber die gewalttätige Vergangenheit des
Jockeys und seine Größe machten ihn zu einem guten Kandida-
ten für dieses Verbrechen. Und auch die Tatsache, dass er da-
bei gewesen war, als Guista ein Zimmer gemietet hatte.
Don zog eine Karte hervor und reichte sie dem Jockey, der
sie verständnislos anstarrte.
»Rufen Sie mich an, wenn Guista sich bei Ihnen meldet.«
»Warum sollte er?«
»Sie sind befreundet.«
»Ich habe es Ihnen doch schon gesagt: Wir kennen uns
kaum.«
»Behalten Sie die Karte«, sagte Don. Er verließ die Woh-
nung und zog die Tür hinter sich ins Schloss.
Als er einigermaßen sicher war, dass der Cop fort war,
blickte Jake auf und sah, wie Big Stevie aus dem Badezimmer
heraushumpelte.

»Das ging viel zu leicht«, sagte Big Stevie.
»Er hatte nichts in der Hand«, widersprach Jake.
Stevie nahm dem Jockey die Karte ab und las sie.
»Er hätte dich stärker bedrängen müssen«, sagte Big Stevie.
»Ich habe ihm die Rippen gebrochen. Der muss stinksauer sein.«
Stevie steckte Don Flacks Karte ein und fuhr fort: »Ich muss
hier verschwinden. Geh auf den Korridor und sieh nach, ob er
noch da ist.«
»Wohin willst du?«, fragte Jake, während er zur Tür ging.
»Ich habe noch was zu erledigen, ehe er mich wieder ein-
holt.«
Der Jockey ging zur Tür, öffnete sie, blickte den Korridor
hinunter, drehte sich zu Stevie um und sagte: »Ich sehe ihn
nicht.«
Stevie war über die Hintertreppe in Jakes Appartement ein-
gestiegen, und so wollte er auch wieder verschwinden. Kurz
vorher drehte er sich noch einmal zum Jockey um und bedank-
te sich.
»Kein Problem. Ich wünschte, ich könnte mehr für dich
tun«, sagte Jake.
Stevie humpelte zur Hintertreppe.
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag«, rief Jake ihm
hinterher.
Eine dämliche Bemerkung. Er wusste es, aber irgendwas
hatte er einfach sagen müssen. Er sah zu, wie Stevie die Hinter-
treppe hinunterkletterte. Dann ging Jake zum Telefon und
wählte eine Nummer.
Als am anderen Ende abgenommen wurde, sagte er: »Er ist
gerade gegangen. Ich schätze, er ist jetzt hinter Ihnen her.«
»Nur, dass ich das richtig verstehe, Sie wollen, dass ich Ihnen
meinen eigenen Bruder ans Messer liefere?«, fragte Anthony
Marco.

Der vergitterte Besucherraum in Riker’s Island war bei-
nahe überfüllt. Marco, in einem bescheidenen grauen Anzug
mit hellblauer Krawatte, die Hände in Handschellen vor dem
Körper, saß hinter dem Tisch. Sein Anwalt, Donald Overby,
ein hoch angesehener Angehöriger der Anwaltskanzlei O-
verby, Woodruff und Cole, saß neben seinem Klienten. O-
verby war groß, schlank, etwa fünfzig und trug einen gradli-
nigen, militärischen Kurzhaarschnitt. Seine Kollegen nann-
ten ihn »Colonel«, weil er genau diesen Rang besaß, als er
während des ersten Golfkriegs im JAG-Büro in Washington
gearbeitet hatte. Im Gegensatz zu ihm wurde der Spitzname
seines Klienten »Bogie« nur hinter dessen Rücken ausge-
sprochen. Er besaß eine vage Ähnlichkeit mit Humphrey
Bogart und vermittelte wie dieser das Gefühl, er wäre un-
verwundbar. Aber Anthony besaß eine gefährliche Reizbar-
keit, eine nervöse, ungeduldige Energie, die dazu geführt
hatte, dass er sich nun schon den zweiten Tag wegen Mordes
vor Gericht verantworten musste.
Der für diesen Fall zuständige stellvertretende Bezirks-
staatsanwalt war Carter Ward, ein Afroamerikaner mit staats-
männischer Ausstrahlung, Ende sechzig, stämmig und mit tie-
fer Stimme. Er sprach langsam und mit Bedacht. Mit einfachen
Worten erklärte er den Geschworenen den Sachverhalt, und er
behandelte Zeugen so, als wäre er zutiefst enttäuscht, wenn er
den Eindruck hatte, dass sie Lügen erzählten.
Ward und Stella saßen Marco und Overby gegenüber. Stella
fühlte sich benebelt. Sie hatte zwei Aspirin und einen Pappbe-
cher mit lauwarmem Tee hinuntergestürzt, ehe sie den Raum
betreten hatte. An einem der kältesten Tage des Jahres kam er
ihr erdrückend heiß vor.
»Das ist Tatortermittlerin Stella Bonasera«, stellte Ward sie
vor. »Ich habe sie gebeten, bei diesem Treffen anwesend zu
sein.«

Was, streng genommen, stimmte. Ward hatte sie gebeten, nach
Riker’s Island zu kommen, aber Stella war diejenige gewesen, die
den Plan geschmiedet und ausgearbeitet hatte. Zu guter Letzt hatte
sie sich auch noch das Einverständnis des Bezirksstaatsanwalts
gesichert, nachdem sie sich mit Ward einig geworden war. Der
Bezirksstaatsanwalt war sehr daran interessiert, Anthony Marco
mit einer roten Schleife ins Gefängnis zu schicken. Ein Todesur-
teil wäre nett gewesen, aber angesichts verschiedener Zwischen-
fälle war der Bezirksstaatsanwalt auch gewillt, sich mit einem an-
deren Urteil zufrieden zu geben, vorausgesetzt, es fiele lang genug
aus und konnte in der Öffentlichkeit vertreten werden.
Marco nickte Stella zu, sie erwiderte die Geste nicht. Ward
öffnete seine Aktentasche und zog einen Block mit gelbem, li-
niertem Papier hervor.
»Wir wissen alle«, begann er, »dass die Medien den Mord an
Alberta Spanio neugierig aufgenommen haben. Wir wissen auch,
dass die Geschworenen, die inzwischen isoliert wurden, trotzdem
von dem Mord an der Hauptbelastungszeugin erfahren haben.«
Weder Marco noch sein Anwalt sagten etwas, also fuhr
Ward fort.
»Natürlich nimmt die Jury an, dass Ihr Mandant diesen
Mord in Auftrag gegeben hat, und obwohl der Richter und Sie
selbst die Geschworenen auffordern werden, sich ausschließ-
lich an die Fakten zu halten, wird jeder einzelne Geschworene
glauben, dass Anthony Marco am Nachmittag des sechsten
September letzten Jahres Joyce Frimkus und Larry Frimkus
ermordet hat. Der Mord an Alberta Spanio hat diese Annahme
nur verstärkt.«
Ward sah Anthony Marco an, der seinen Blick ruhig erwi-
derte.
»Versuchen wir es mal so«, sprach Ward weiter. »Wer im-
mer sie ermordete, hätte wissen können, welchen Schaden er
Ihnen damit zufügt. Als Zeugin vor Gericht hätte Alberta Spa-

nio nur den Eindruck einer Mitläuferin erweckt. Ihr überaus fä-
higer Rechtsvertreter hätte mit Leichtigkeit ihre Glaubwürdig-
keit in Zweifel ziehen können. Aber jetzt, nachdem einer der
beiden Männer, die Ms Spanio bewacht haben, ein Polizeibe-
amter, auch ermordet worden ist, ermordet in der Bäckerei Ih-
res Bruders, Mr Marco …«
»Dieser Mord ist irrelevant«, unterbrach Overby.
»Vermutlich ist er das, vermutlich«, stimmte Ward ihm zu.
»Aber ich werde eine Möglichkeit finden, den Geschworenen
diese Information zukommen zu lassen, bevor der Richter sie
als unzulässig ausschließen kann.«
»Was wollen Sie, Ward?«, fragte der Colonel.
»Warten wir, bis Ermittlerin Bonasera Ihnen erzählt hat, was
sie in der Hand hat«, antwortete Ward.
Stella berichtete von ihren Ermittlungen im Mordfall Alber-
ta Spanio, erzählte, wie sie Guista auf die Spur gekommen wa-
ren, und von den Beweisen aus der Bäckerei, die zu Colliers
Mörder führten.
Als sie fertig war, wollte Stella nur noch den Waschraum
aufsuchen, sich mit geschlossenen Augen irgendwo dort hin-
setzen und warten, bis die Übelkeit sie endgültig übermannte.
»Geben Sie uns die Beweise, die wir brauchen, um Ihren
Bruder wegen eines Kapitalverbrechens unter Druck zu set-
zen«, sagte Ward, »und wir verzichten auf die Todesstrafe.«
Gefangener und Anwalt unterhielten sich eine Weile im
Flüsterton, und als sie fertig waren, sagte der Colonel: »Mord
zweiten Grades, und Sie fordern die Mindeststrafe. Die Strafe
wird zwischen zwanzig Jahren und lebenslänglich liegen, und
Mr Marco kommt in zehn Jahren wieder raus, vielleicht sogar
noch viel früher, wenn Sie die Tür offen lassen.«
»Einverstanden«, sagte Ward. »Wenn die Information, die
wir von Ihrem Klienten erhalten, korrekt und belastend für sei-
nen Bruder ist.«

»Das ist sie«, versicherte der Colonel.
Anthony lächelte Stella zu, die sich an einem finsteren Blick
versuchte, während sie das Fieber auf ihrer Stirn fühlte.
»Zum Teufel damit«, sagte Anthony. »Dario hat Mist ge-
baut, ob absichtlich oder nicht. Das macht nicht den geringsten
Unterschied. Dieser Hurensohn von einem Bruder will meine
Geschäfte übernehmen.«
»Die welcher Art sind?«
»Privater Art«, antwortete Marco. »Das ist ein Teil unseres
Abkommens, wenn wir weitermachen wollen.«
Ward erklärte sein Einverständnis mit einem Nicken.
»Mein Bruder, Dario, ist ein gewitzter Idiot«, sagte Marco
und schüttelte den Kopf. »Einen Jockey durch ein Fenster zu
schicken. Wie kann man nur auf so eine blöde Idee kommen?«
Stella blieb friedlich – nicht nur, weil sie krank war und hier
raus wollte, sondern auch, weil sie sicher war, dass kein Jockey
Alberta Spanio ermordet hatte. Auf den ersten Blick erschien die
Wahrheit unwahrscheinlich, aber sie ließ sich leicht nachweisen,
wenn man die Beweise am Tatort richtig zu deuten verstand.
Ward stellte sein Diktiergerät auf den Tisch und blieb mit
gefalteten Händen aufrecht sitzen.
Anthony Marco fing an zu reden.
Sheldon Hawkes hatte einen Anruf von Mac erhalten. Dieser
hatte ihn gebeten, die Leiche von Charles Lutnikov aus dem
Kühlraum zu holen.
Als Mac und Aiden eintrafen, lag Lutnikovs Leiche mit ge-
öffneten Brustkorb, der die eingefallenen Organe preisgab, auf
dem Metalltisch. Von der Decke strahlte ein grelles weißes
Licht.
»Schließ die Hautlappen«, bat Mac.
Hawkes klappte die Hautlappen zurück an ihren ursprüngli-
chen Platz. Dann zeigte Aiden dem Pathologen das Manu-

skript, das sie aus Louisa Cormiers Appartement mitgenommen
hatten.
Sie hatte das Buch aufgeschlagen, sodass Hawkes hineinse-
hen konnte. Der musterte die Seiten und nickte. Er wusste, was
Mac und Aiden wollten. Es gab mehrere Vorgehensweisen. Er
entschied sich dafür, einen Behälter mit durchsichtigen, sech-
zig Zentimeter langen Kunststoffstäben aus dem Schrank zu
holen und zwei dieser Stäbe daraus zu entnehmen.
Dann führte er die Stäbe durch die Einschusslöcher in den
Brustbereich. Er musste sich vorsichtig vorantasten, um sicher-
zustellen, dass die biegsamen Stäbe in dem inzwischen er-
schlafften Körper auch tatsächlich dem Verlauf des Schusska-
nals folgten. Er brauchte mehr als drei Minuten. Dann trat er
zurück, damit Aiden besser sehen konnte. »Könntest du den
überstehenden Teil der Stäbe abzwicken, ohne sie dabei zu ver-
schieben?«, fragte sie.
Er nickte, ging zum Schrank, zog eine große, glänzende Me-
tallschere hervor und schnitt die Stäbe ab, sodass sie nur noch et-
wa zweieinhalb Zentimeter weit aus der Leiche herausragten.
Dann versuchte Aiden die Stäbe mit Hawkes’ Hilfe durch die Lö-
cher des Manuskripts zu führen und stellte fest, dass sie exakt
hineinpassten. Treffer. Sie mussten sich kaum anstrengen. Es sah
aus, als sei das Buch vor der Brust des toten Mannes festgeheftet.
»Schlussfolgerung«, sagte Hawkes und beugte sich vor, um
die Stäbe zu entfernen. »Die Waffe, mit der Charles Lutnikov
erschossen wurde, hat auch dieses Manuskript durchlöchert.«
»Er hat das Manuskript vor seinen Körper gehalten, als sie
geschossen hat«, sagte Mac. »Die Kugel ist durch das Papier in
seinen Körper eingedrungen, abgeprallt, und, als sie wieder
ausgetreten ist, in den Fahrstuhlschacht gefallen.«
»Klingt logisch«, sagte Hawkes.
»Und?«, fragte Aiden. »Haben wir jetzt genug für einen
Haftbefehl?«

»Jedenfalls wird Ms Cormier eine gute Ausrede brauchen«,
meinte Hawkes.
»Sie ist Krimiautorin«, sagte Aiden.
»Nein, ist sie nicht«, widersprach Mac. »Lutnikov war der
Autor.«
»Zurück zu ihrem besten Gegenargument«, sagte Aiden.
»Warum sollte sie die Gans töten wollen, die goldene Bestsel-
lerromane legt?«
»Das muss uns die Dame selbst erklären«, antwortete Mac.
»Braucht ihr die Leiche noch?«, fragte Hawkes.
Mac schüttelte den Kopf, und Hawkes rollte den Tisch zu-
rück zu den Kühlschränken, in denen die Toten lagen.
»Wir brauchen immer noch die Waffe und den Bolzen-
schneider«, erklärte Aiden, als sie Hawkes’ Autopsiesaal ver-
ließen. »Und die hat sie vermutlich verschwinden lassen.«
»Vermutlich«, stimmte Mac zu. »Aber nicht zwangsläufig.
Wir haben drei Punkte, die uns weiterhelfen könnten. Erstens:
Sie weiß, wo die Sachen sind. Zweitens: Sie weiß nicht, wie
viel wir wissen oder wie viel wir an dem Tatort entdeckt ha-
ben.«
»Und drittens?«, fragte Aiden.
»Der Bolzenschneider«, sagte er. »Sie hat ihn in einem der ers-
ten drei Romane beschrieben. Alle Trophäen in ihrer Bibliothek
stammen aus diesen ersten drei Romanen. Deshalb nehme ich an,
dass sie ganz bestimmt auch den Bolzenschneider behalten hat.«
»Vermutlich.« Aiden nickte.
»Immerhin eine Möglichkeit«, fuhr Mac fort. »Und sie weiß
nicht, dass wir einen Bolzenschneider schon anhand eines mit
ihm durchtrennten Gegenstands identifizieren können.«
»Hoffen wir, dass sie das nicht weiß«, sagte sie. »Aber
selbst wenn wir ihn finden, fehlt uns immer noch die Waffe.«
»Ein Beweisstück nach dem anderen«, sagte Mac.

Abhauen war keine Option. Big Stevie wusste das. Er hatte
weder das Geld noch den Grips dafür, und ihm waren sowohl
die Polizei als auch Darios Leute auf den Fersen.
Der Taxifahrer musterte ihn ständig im Spiegel. Stevie
kümmerte sich nicht darum.
Stevie hatte sich in der Nähe der Penn Station ein Taxi ge-
nommen. Der Fahrer hatte hinter dem Steuer gesessen und ein
Taschenbuch gelesen. Er hatte sich über die Schulter umge-
blickt, als Stevie die Tür geschlossen hatte, und mehr zu sehen
bekommen, als er ihm lieb war.
Hätte Stevie versucht, den Wagen auf der Straße anzuhalten,
hätte der Fahrer, Omar Zumbadie, ihn bestimmt nicht mitge-
nommen.
Der riesige, alte weiße Mann brauchte dringend eine Rasur.
Er brauchte frische Kleider. Und er stank nach etwas Fauligem.
Omar betete, dass der alte Mann sich nicht übergeben würde.
Er sah nicht aus, als wäre er betrunken, sondern nur müde. Sein
Kopf wackelte wie in Trance hin und her.
Das Taxi fuhr über den Riverside Drive nordwärts zur
George Washington Bridge in Richtung Cross Bronx Express-
way. Big Stevie zählte sein Geld. Er hatte dreiundvierzig Dol-
lar bei sich, und seine Wunde blutete trotz des provisorischen
Verbands, mit dem der Jockey sein Bein versorgt hatte.
Wäre Stevie ein rachsüchtiger Mensch gewesen, so hätte er
den Detective umgebracht, der in der Wohnung des Jockeys
aufgetaucht war. Der Detective, der laut Visitenkarte Don
Flack hieß, hatte schließlich auf Big Stevie geschossen. Eine
Kugel im Bein, Geburtstagsgrüße vom NYPD. Die Kugel war
nicht mehr da, aber es schmerzte, und der Schmerz breitete sich
aus. Big Stevie ignorierte ihn. Das alles wäre bald vorbei, und
wenn er Glück hätte, was vermutlich nicht der Fall sein würde,
konnte er sich Dario Marco vom Hals schaffen und würde au-
ßerdem noch zu etwas Geld kommen.

Das Leben ist unfair, dachte Stevie, als der Wagen an der
Ausfahrt Castle Hill abfuhr. Stevie wusste das. Trotzdem hatte
er den Fehler begangen, das zu vergessen. Dass aber Dario
zwei Leute aus der Bäckerei geschickt hatte, um ihn umzubrin-
gen, war mehr als unfair. Stevie war ein guter Soldat gewesen
und ein guter Lieferwagenfahrer. Die Leute auf seiner Tour
mochten ihn. Er kam prima mit den Kindern aus, sogar mit Da-
rios Enkelkindern, die schon im Alter von neun und vierzehn
aussahen wie ihr Vater und niemandem über den Weg trauten.
Vergiss die Fairness, dachte er. Nun ging es darum, die Dinge
ins Lot zu bringen und vielleicht am Leben zu bleiben. Die andere
Möglichkeit lautete, den Cop anzurufen, dessen Karte er in der
Hand hielt, ihn anzurufen und, so stellte er sich die Sache vor,
nach Stunden, Tagen des Verhörs, des Verrats, einen Anzug an-
zuziehen und zu Darios Verhandlung zu gehen, wo ihn einer von
Darios Anwälten wie einen Trottel aussehen lassen würde. Und
dann Knast. Es war nicht wichtig, wie lange er sitzen würde. Es
würde lang genug sein, und er war schon jetzt ein alter Mann.
Nein, der Weg, den er einschlagen wollte, war der einzige
Weg, den er einschlagen konnte.
»Mister«, sagte Omar.
Stevie starrte weiter aus dem Fenster. Er hatte die Karte des
Detectives wieder in seine Tasche gesteckt, und seine Hand
umfasste nun das kleine, bemalte Tier, das Lilly für ihn gebas-
telt hatte.
»Mister«, wiederholte Omar, sorgsam darauf bedacht, auch
nicht im Mindesten verärgert zu klingen.
Stevie blickte auf.
»Wir sind da«, sagte Omar.
Stevie konzentrierte sich und erkannte die Ecke, an der sie
angehalten hatten. Grunzend griff er in seine Tasche.
»Wie viel?«
»Zwanzig Dollar und sechzig Cent«, sagte Omar.

Stevie streckte die Hand über die leicht milchige und ver-
mutlich kugelsichere Scheibe, die Omar ein wenig herunterge-
lassen hatte, nach vorn und reichte dem Fahrer einen Zwanzi-
ger und einen Fünfdollarschein.
»Stimmt so«, sagte er.
Omar starrte das Geld an, als Stevie aus dem Taxi stieg. Das
fiel Stevie nicht leicht. Sein gesundes Bein musste die ganze
Last des Körpers tragen. Aber Stevie war stark.
»Danke«, sagte Omar.
Auf den Banknoten in seiner Hand prangten blutige Finge-
rabdrücke – Fingerabdrücke, die frisch aussahen.
Omar wartete, bis Stevie die Wagentür geschlossen hatte,
ehe er davonfuhr. Er legte die beiden Banknoten auf das Ta-
schenbuch, das auf dem Beifahrersitz ruhte.
Das Klügste, was er tun konnte, überlegte Omar, war, die
Scheine zu säubern und den großen Mann zu vergessen. Er war
überzeugt, dass die meisten Fahrer so handeln würden. In So-
malia hatte Omar das Blut an den Händen von Männern gese-
hen, die Frauen und Kinder geschlachtet hatten, und keiner war
bereit gewesen, sie für ihre Taten anzuklagen. Wer Gerechtig-
keit fordert, dachte er, während er den Wagen steuerte, riskiert
sein Leben und das seiner Familienangehörigen.
Aber dies war Amerika. Er war legal in diesem Land. Die
Dinge waren nicht perfekt und nicht immer ungefährlich, vor
allem für einen Taxifahrer.
Aber Omar war ein gewissenhafter Moslem, und er tat, was
seiner Überzeugung nach ein gewissenhafter Moslem tun
musste. Er griff nach dem Funkgerät und rief seine Zentrale.
»Hatten Sie Ihre Schuhe an- oder ausgezogen?«, fragte Stella,
die mit geschlossenen Augen hinter dem Schreibtisch saß und
vor sich eine Tasse mit schwarzem Kaffee stehen hatte. Sie litt
unter Schüttelfrost.

»Ausgezogen«, sagte Ed Taxx. Er stand in seinem Wohn-
zimmer, während er in den Telefonhörer sprach. »Wir waren
gerade erst aufgestanden und hatten Hosen, Hemden und So-
cken angezogen.«
»Sind Sie sicher?«, hakte Stella nach.
»Ist mit Ihnen alles in Ordnung?«, fragte Taxx.
Diese Frage schien ihr zurzeit jeder zu stellen.
»Mir geht es gut«, sagte sie. »Danke.«
»War das alles, was Sie wissen wollten?«
»Für den Augenblick, ja.«
»Schön«, sagte Taxx. »Nehmen Sie fünfzehn Aspirin, und
rufen Sie mich morgen wieder an.«
»Mach ich«, sagte Stella.
»Das war ein Witz.«
»Ich weiß«, sagte Stella. »Aber es war ja auch so etwas wie
ein guter Rat.«

15
Noah Pease, Louisa Cormiers neuer, hoch angesehener Anwalt,
glatt rasiert und dürr, erinnerte Mac an eine Figur aus Die To-
ten von Spoon River von Edgar Lee Masters.
Pease war etwa fünfzig, nicht wirklich gut aussehend, aber
ausgestattet mit einer tiefen Stimme, die ihn, zusätzlich zu sei-
ner Erfahrung als Rechtsvertreter von Prominenten, zu einem
perfekten Kandidaten für das Gerichtsfernsehen gemacht hätte.
Neben Pease auf dem Sofa saß Louisa Cormier, schick an-
zusehen in ihrem sauber gebügelten Kostüm. Sie hatte dem
Fenster mit dem breiten Panoramablick über die Stadt den Rü-
cken zugekehrt. Den beiden gegenüber saßen Mac Taylor und
Joelle Fineberg, eine kleine Frau in einem grünen Kostüm, die
erst seit etwas mehr als einem Jahr der Staatsanwaltschaft an-
gehörte. Sie sah aus, als wäre sie jung genug, um an einer
Sweet-Sixteen-Party teilnehmen zu können.
In Louisa Cormiers Wohnzimmer versammelten sich sie-
benundzwanzig Jahre juristische Erfahrung, wobei nur ein Jahr
davon auf Joelle Finebergs Konto ging.
»Ms Fineberg, Ihnen ist doch sicher bewusst, dass Ms Cor-
mier sich absolut kooperativ gezeigt hat«, sagte Pease gedehnt.
»Derzeit gibt es für sie absolut keine Notwendigkeit, mit Ihnen
zu sprechen, es sei denn, Sie haben vor, Klage zu erheben.«
»Ich verstehe«, sagte Fineberg. Ihr Tonfall und ihr Lächeln
deuteten an, dass sie die Kooperation zu schätzen wusste.
»Niemand weiß von den Untersuchungen der Polizei und
der …« Pease legte eine Pause ein und sah Mac an. »C.S.I.-

Einheit. Detective Taylors Beschuldigung, meine Klientin habe
ihre Bücher nicht selbst geschrieben, darf nicht veröffentlicht
werden. Sollte das doch geschehen, werden wir die Stadt New
York und Detective Taylor auf achtzehn Millionen Dollar
Schadenersatz verklagen. Und ich bin überzeugt, man wird uns
den Betrag zusprechen. Verstehen Sie, was ich meine?«
»Absolut«, sagte Fineberg, die Hände auf dem Aktenkoffer
gefaltet. »Ihre Klientin interessiert sich mehr für ihre Reputati-
on als für die Tatsache, dass wir eine Mordanklage gegen sie
vorbereiten.«
»Meine Klientin hat niemanden ermordet«, wies sie Pease
zurecht.
Offensichtlich von ihrem Anwalt instruiert, gab Louisa kei-
nen Ton von sich und reagierte nicht im Geringsten auf Fine-
bergs Beschuldigung.
»Wir glauben, sie hat«, entgegnete die Staatsanwältin.
»Schön«, sagte Pease. »Sehen wir uns Ihre Beweise an. Ein
Bewohner dieses Gebäudes wurde mit einem Schuss aus einer
Waffe des Kalibers .22 getötet. Es wurde keine Waffe gefun-
den. Es gibt keine Zeugen. Keine Fingerabdrücke. Keine DNS-
Beweise.«
»Der tote Mann hat die Romane Ihrer Klientin als Ghostwri-
ter verfasst«, sagte Fineberg. »Er hat zwei Schusswunden im
Leib, die mit den Löchern in dem Manuskript übereinstimmen,
das er bei sich hatte und das Detective Taylor und seine Mitar-
beiterin in diesem Appartement gefunden haben.«
Pease nickte.
»Eine Erklärung«, sagte er, »die mir als Erstes in den Sinn
kommt, könnte folgendermaßen lauten. Nehmen wir an, die
Waffe gehört Mr Lutnikov oder jemandem, der zusammen mit
ihm im Fahrstuhl war. Die beiden geraten in Streit, die andere
Person schießt auf Mr Lutnikov und kommt davon. Mr Lutni-
kov fährt, nunmehr tot, bis zu dieser Etage. Er oder sein Mör-

der hat auf den entsprechenden Knopf gedrückt. Meine Klien-
tin hat darauf gewartet, dass er das Manuskript bei ihr abliefert.
Die Fahrstuhltür öffnet sich, und sie sieht Lutnikov, tot, das
Manuskript an die Brust gepresst. Entsetzt, aber notgedrungen
nimmt sie das Manuskript an sich, nachdem sie sich vergewis-
sert hat, dass der arme Mann tatsächlich tot ist. Dann schickt
sie den Fahrstuhl wieder hinunter in die Lobby, wo er, wie sie
weiß, gefunden werden muss. Mangelndes Urteilsvermögen,
vielleicht, aber die Geschworenen würden Verständnis dafür
aufbringen, und, lassen Sie mich das noch einmal betonen, Sie
haben keine Mordwaffe.«
»Ich bin unschuldig«, verkündete Louisa Cormier plötzlich.
In ihren Worten war keine Spur von Entrüstung zu hören,
auch kein Werben um Verständnis. Sie hatte lediglich eine
Feststellung getroffen.
Pease berührte seine Klientin an der Schulter und sah Joelle
Fineberg an. »Und vergessen Sie nicht, das ist nur das Szena-
rio, welches mir als Erstes in den Sinn kam«, wiederholte Pea-
se.
Weder Fineberg noch Mac zweifelten an seinen Worten.
»Wir haben genug, um vor Gericht zu gehen«, sagte Fineberg.
Pease zuckte mit den Schultern.
»Öffentliches Interesse, Verhandlungen, die dem Image der
Staatsanwaltschaft schaden, gefolgt von einer Anzeige im Na-
men meiner Klientin«, zählte er auf. »Weder hat Louisa Cor-
mier Charles Lutnikov umgebracht, noch hat sie ihn als
Ghostwriter für ihre Romane engagiert. Das Manuskript ist ei-
ne Kopie des neuesten Romans meiner Klientin, das sie ihrem
Fan Charles Lutnikov, der ihr schon seit Jahren insgeheim auf
die Nerven ging, als einmaligen Gefallen übergeben hatte.«
»Also«, sagte Fineberg, »haben Sie ihm einen Ausdruck des
vollständigen Buches gegeben, damit er sich eine Kopie anfer-
tigen konnte?«
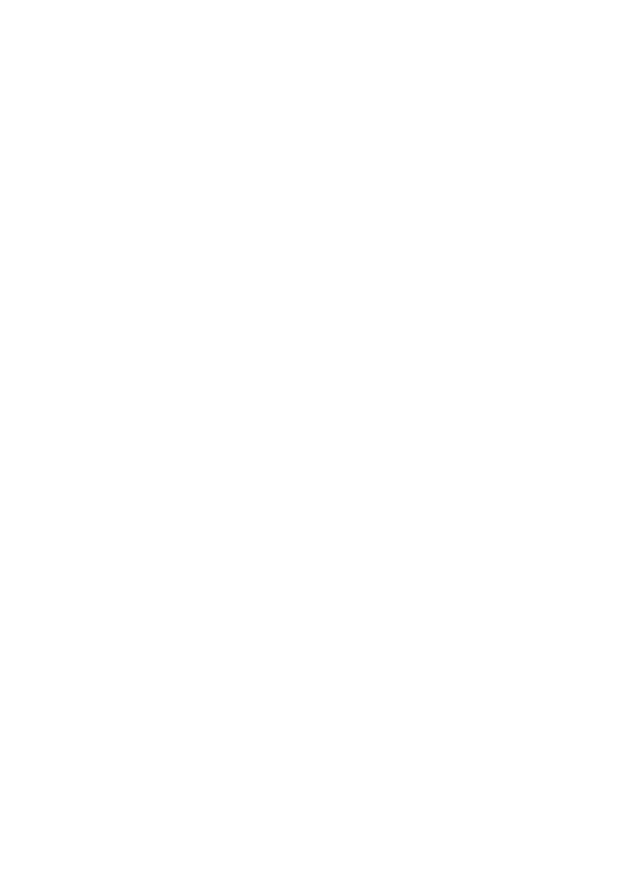
»Nein«, sagte Pease. »Damit er es als Erster lesen konnte.
Sie hatte keine Ahnung, dass er sich eine Kopie anfertigen
wollte, und hat es erst erfahren, als er sie anrief und es ihr er-
zählte. Sie hatte natürlich darauf bestanden, dass kopierte Ma-
nuskript ausgehändigt zu bekommen. Deshalb ist er zu ihr
hochgefahren und hatte es im Augenblick seiner Ermordung an
seine Brust gepresst.«
»Genauso war es«, sagte Louisa.
»Sie haben uns gestern erzählt, Sie würden immer noch an
dem Buch schreiben«, sagte Mac.
»Umschreiben«, korrigierte sie. »Das haben Sie missver-
standen. Ich habe an der zweiten Fassung gearbeitet.«
»Darf ich Ihnen eine Frage stellen?«, erkundigte sich Mac.
Louisa sah Pease an, der daraufhin sagte: »Sie können fra-
gen, aber ich werde meiner Klientin möglicherweise raten, die
Antwort zu verweigern. Wir wollen mit der Polizei nur zu-
sammenarbeiten, um Ihnen bei der Suche nach Mr Lutnikovs
Mörder behilflich zu sein.«
Fineberg wusste, worauf Macs Frage zielen würde. Er hatte
ihr gegenüber schon auf dem Weg in die Wohnung angedeutet,
was er vorhatte.
»Können Sie eines der folgenden Wörter definieren?«
Mac hatte sein kleines Notizbuch aus der Tasche gezogen.
»Mufti, devot, tendenziös.«
Louisa Cormier blinzelte.
»Ich weiß nicht …«, setzte sie an.
»Die Worte tauchen in Ihren Büchern auf«, erklärte Mac.
»Ich habe noch siebzehn andere, nach denen ich Sie fragen
möchte.«
»Benutzen Sie den Thesaurus Ihres Schreibprogramms,
Louisa?«, fragte Pease gelassen.
»Manchmal«, antwortete sie.
Pease hob die Hände und lächelte.

»Und unser Experte, der bezeugen wird, dass Charles Lutni-
kov Louisa Cormiers Romane geschrieben hat?«, fragte Fine-
berg.
»Ich habe fünf Experten, die bezeugen werden, dass sie ihre
Bücher selbst geschrieben hat«, gab Pease zurück. »Alle tragen
den Titel Dr. phil. Wie geht es nun weiter?«
»Wir finden die Mordwaffe«, erklärte Mac. »Und den Bol-
zenschneider, den Ihre Klientin benutzt hat, um die Metallkas-
sette auf der Drietch’s Range
aufzubrechen.«
»Viel Glück«, sagte Pease. »Ihrem eigenen Bericht zufolge
ist die Waffe, die dort gefunden wurde, nicht die Mordwaffe.«
»Das ist sie nicht«, stimmte Mac zu, dessen Blick auf Loui-
sa ruhte. »Aber ich denke, ich weiß, wo die Waffe ist, mit der
Lutnikov getötet wurde.«
»Und der verschwundene Bolzenschneider?«, fragte Pease.
Mac nickte nur.
»Sie bluffen«, sagte Pease. »Wo sind die Sachen denn?«
»An einem allen Blicken ausgesetzten Ort«, sagte Mac.
»Klingt das vertraut, Ms Cormier?«
Louisa Cormier verlagerte ihr Gewicht und wich seinem
Blick aus.
»Ich denke, wir sind hier fertig«, beendete Pease das Ge-
spräch. »Es sei denn, Sie haben vor, meine Klientin festzuneh-
men.«
Joelle Fineberg erhob sich. Mac und Pease folgten ihrem
Beispiel. Louisa blieb sitzen, und ihre Augen fixierten Mac.
Im Fahrstuhl nach unten sagte Joelle Fineberg: »›An einem
allen Blicken ausgesetzten Ort?‹ Wo haben Sie das her? Poe
oder Conan Doyle?«
»Aus einem von Louisa Cormiers Romanen«, erklärte Mac.
»Und ich weiß nicht, wo sie es her hat.«
Der Fahrstuhl stoppte in der Lobby, und die Türen gingen
auf.

»Rufen Sie mich an, wenn Sie etwas Neues haben«, sagte
Fineberg.
Mac nickte.
In der Lobby kamen sie an McGee, dem Portier, vorbei, der
ihnen lächelnd zunickte. Es schneite wieder, nicht stark, aber es
schneite. Die Temperatur betrug minus fünfzehn Grad.
»Die Waffe ist in diesem Gebäude«, sagte Mac. »Sie kann
sie nicht verschwinden lassen.«
»Warum?«
»Weil wir wissen, dass sie ihr gehört«, erwiderte er.
»Sie haben ihre Waffe untersucht. Aus der wurde nicht ge-
schossen.«
»Aus der Waffe, die sie uns gezeigt hat, wurde nicht ge-
schossen«, korrigierte er.
Die Juristin nickte.
»Und der Bolzenschneider? Was ist, wenn sie den hat ver-
schwinden lassen?«
»Sie bildet sich ein, sie sei schlau genug, um uns an der Na-
se herumzuführen.«
»Was?«
Mac lächelte und ging in Richtung Treppenhaus. Joelle sah
ihm einige Augenblicke nach, ehe sie ihren Mantel zuknöpfte,
sich den Schal um den Hals wickelte und ein paar Ohren-
schützer überstülpte, die sie aus ihrer Tasche herausgekramt
hatte.
Als sie sich noch einmal über die Schulter umblickte, war
Mac nicht mehr zu sehen. McGee öffnete die Tür für sie, und
sie trat hinaus in die beißende Kälte.
»Wo hast du das her?«, fragte Hawkes.
»Taschentuch im Mülleimer«, antwortete Danny. Sie saßen
in dem gefliesten Kellerraum des C.S.I.-Hauptquartiers. An
den Wänden standen Kaffee-, Sprudel- und Süßigkeitenauto-
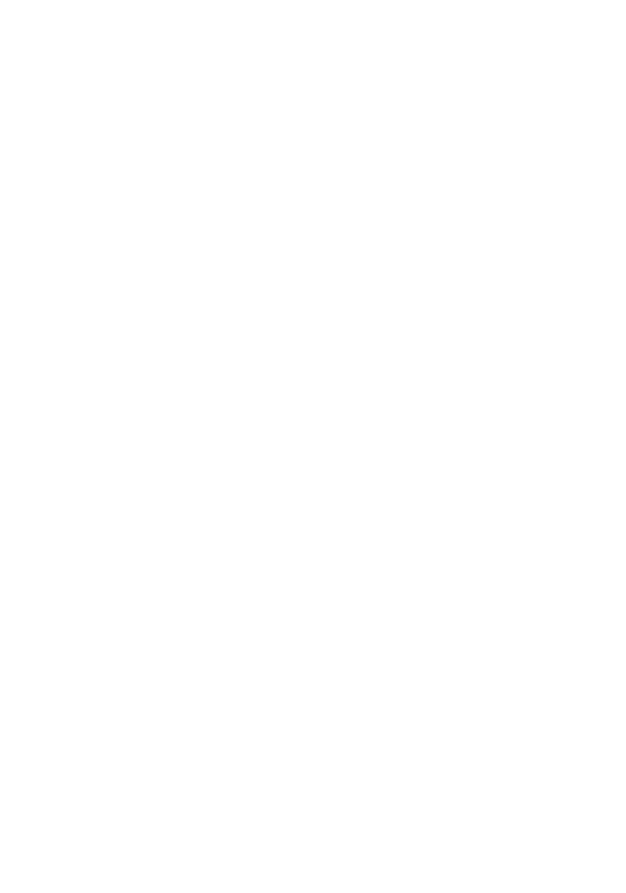
maten in einer Reihe wie die Spielautomaten in einem Wasch-
raum von Las Vegas. Über ihnen flackerte grelles Licht.
Sheldon Hawkes legte das Thunfischsandwich mit der gro-
ßen Portion Mayonnaise auf einen Pappteller und nahm Danny
den Objektträger ab.
»Komm mit rauf und sieh es dir unter dem Mikroskop an«,
schlug Danny vor.
»Hast du es schon identifizieren können?« Hawkes gab ihm
den Objektträger zurück.
»Ja, es ist selten, aber nicht zu selten.«
»Hast du schon jemandem davon erzählt?«
»Niemand da«, erklärte Danny. »Stella hat angerufen. Sie
sagte, sie wäre auf dem Weg hierher und hat mich gebeten, alle
Fotos vom Alberta-Spanio-Tatort herauszusuchen.«
»Wie hat sie sich angehört?«
»Krank«, sagte Danny.
Hawkes aß den letzten Bissen seines Sandwichs und kipp-
te den letzten Schluck seiner Dr.-Pepper-Diätlimonade hin-
unter. Dann warf er die Abfälle in den Mülleimer und erhob
sich.
»Sehen wir es uns an«, sagte er.
Auf dem Tisch vor Stella lagen die exakt angeordneten Fotos
des Schlafzimmers, in dem Alberta Spanio ermordet worden
war, und die des dazugehörigen Badezimmers. Das Badezim-
mer stellte derzeit den Mittelpunkt ihres Interesses dar.
Sie wählte vier Fotos aus und musterte sie eingehend, tief
herabgebeugt, sodass ihr Kopf direkt über den Bildern hing.
Diese Haltung verstärkte ihre Kopfschmerzen, und sie spürte
wieder dieses mulmige Gefühl in ihrem Magen. Aber ihre Er-
innerung hatte sie nicht betrogen.
Stella griff nach dem Tee, von dem sie bereits einen Schluck
getrunken hatte, in der Hoffnung, er würde ihren Magen beru-

higen. Doch er schien wenig hilfreich zu sein, und so stellte sie
die Tasse wieder ab.
Sie war überzeugt davon, dass sie Recht hatte und nun
wusste, wer Alberta Spanio ermordet hatte und warum Collier
getötet worden war. Ohne die Grippe, die sie nicht länger igno-
rieren konnte, wäre sie gewiss schon viel früher darauf ge-
kommen.
Sie hörte, wie jemand hinter ihr die Labortür öffnete. Stella
richtete sich auf und drehte sich um. Sie fühlte sich schwach,
aber entschlossen.
Hawkes und Danny blieben vor ihr stehen.
»Ich habe die Lösung gefunden«, begrüßte sie ihre Kolle-
gen. Dann fiel ihr ein, dass Hawkes hier im Grunde nichts zu
suchen hatte. Er verließ seine Leichen nur, um sich etwas zu
essen zu holen oder um nach Hause zu fahren.
»Welche Lösung?«, fragte Danny.
»Für den Mord an Alberta Spanio«, sagte sie. »Ich muss un-
bedingt Mac anrufen.«
»Hawkes und ich haben hier ein paar Objektträger, die du
dir unbedingt ansehen solltest«, erwiderte Danny.
Hawkes hielt sie ihr entgegen.
»Kann ich nicht …?«
Hawkes schüttelte den Kopf »Nein.«
»Was ist hier los?«, fragte sie.
»Sieh dir die Objektträger an«, forderte Danny sie noch
einmal auf.
Seufzend trat Stella zum Mikroskop, schaltete die Beleuch-
tung ein und nahm die Objektträger aus Hawkes’ Hand. Dann
setzte sie sich an das Gerät, während die beiden Männer hinter
ihr Position bezogen. Sie stellte das Mikroskop scharf. Es war
ein Gerät mit vielen Extrafunktionen und mit besonders starken
Linsen. Mit wenigen Korrekturen ordnete sie beide Objektträ-
ger nebeneinander an und verglich sie miteinander.

»Bakterien«, sagte sie. »Dieselbe Art auf beiden Trägern.«
»Weißt du, was das ist?«, fragte Hawkes.
»Nein«, gestand Stella.
»Leptospirosa«, sagte Hawkes.
Stella blinzelte und ging im Geiste den Katalog der ihr be-
kannten Krankheiten durch.
»Selten«, stellte sie fest.
»Einer von zweihundert belegten Fällen in diesem Jahr in
den Vereinigten Staaten«, erklärte Danny. »Die Hälfte davon
wurde auf Hawaii registriert. Das ist normalerweise eine Tro-
penkrankheit.«
»Wir haben hier eine Ausnahme«, sagte Hawkes. »Was
weißt du über diese Krankheit?«
»Eine bakterielle Infektion, wird meistens durch den Urin
von Tieren übertragen«, sagte sie. »Einer unserer Fälle? Lut-
nikov, Spanio, Collier oder einer von Dario Marcos Män-
nern?«
»Nein«, sagte Hawkes. »Du. Danny hat eine Schleimprobe
aus einem deiner Taschentücher entnommen, die du wegge-
worfen hast. Du hast keine Grippe. Was weißt du über Lep-
tospirose?«
»Fast gar nichts.« Stella lehnte sich zurück und schloss die
Augen.
Hawkes’ Hand berührte ihre Stirn.
»Fieber«, stellte er fest. »Kopfschmerzen?«
»Ja.«
»Schüttelfrost, Muskelschmerzen, Übergeben?«
»Übelkeit, kein Übergeben.«
Sanft drehte er sie mit ihrem Stuhl zu sich herum und sah ihr
direkt ins Gesicht.
»Leichte Gelbsucht, rote Augen«, diagnostizierte er.
»Du hörst dich an, als würdest du eine Autopsie durchfüh-
ren«, protestierte Stella.

»Meine Patienten geben normalerweise keine frechen Ant-
worten. Leibschmerzen, Diarrhö?«
»Beides, ein bisschen.«
»Krankenhaus«, entschied Hawkes.
»Wie steht es mit einer ambulanten Behandlung?«, fragte
sie. »Ich bin wirklich ganz nahe dran, den Fall Spanio zu lö-
sen.«
»Danny kann das zu Ende führen. Weißt du, was aus einer
unbehandelten oder nicht ausreichend behandelten Leptospiro-
se werden kann? Nierenschaden, Meningitis, Leberversagen.
Ich habe schon einen Todesfall erlebt. Wann haben die Sym-
ptome angefangen?«
»Gestern«, sagte Stella resigniert. »Vielleicht auch vorges-
tern.«
»Erinnerst du dich, Kontakt zu animalischen …«
»Die Katzen«, sagte Danny.
»Was war damit?«, fragte Hawkes.
»Eine alte Frau, die in ihrer Wohnung in East Side gestor-
ben ist«, sagte Stella. »Katzenhalterin. Siebenundvierzig haben
wir gefunden. Wir haben die Wohnung als Tatort behandelt,
weil es Anzeichen für einen Einbruch gab, aber sie hatte einen
Herzanfall. Übergewicht, achtundsiebzig Jahre alt. Hat nicht
auf sich geachtet.«
»Oder auf ihre Katzen«, sagte Hawkes. »Wo sind sie jetzt?«
»Der Tierschutzbund hat sie aufgenommen«, sagte Danny.
Hawkes schüttelte den Kopf.
Stella drehte sich zu Danny. »Sieh zu, dass du die Leute zu-
sammentrommelst.«
»Falls es irgendwelche kürzlich verstorbenen Tiere gibt«,
sagte Hawkes, »hätte ich sie gern in meinem Labor.«
»Ich schätze, dass sie alle, bis auf ein paar wenige Glücks-
pilze, eingeschläfert und verbrannt worden sind. Wie wird die
Behandlung ablaufen?«, fragte Stella.

»Die Nacht verbringst du in einem Krankenhausbett«, sagte
Hawkes. »Antibiotika, vermutlich Doxycyclin. Ich rufe Kirk-
baum an und sorge dafür, dass sie dir ein Zimmer reservieren.«
»Wie lange?«
»Wenn wir es früh genug festgestellt haben, zwei oder drei
Tage. Wenn nicht, sprechen wir möglicherweise von ein bis
zwei Wochen. Gemessen an der Bakteriendichte in der Probe
könnte es gut sein, dass Danny dir das Leben gerettet hat.«
Danny grinste selbstzufrieden und richtete seine Brille.
»Ich bin ein sturer Esel«, sagte sie. »Danke.«
»Gern geschehen«, lächelte Danny. »Und, ja, du bist ein
furchtbar sturer Esel.«
Stella erhob sich und sagte: »Bitte, sammle all diese Fotos
ein und sag Mac, er soll so schnell wie möglich ins Kranken-
haus kommen.«
»Du wirst schon wieder«, beruhigte Hawkes sie. »Meine Pa-
tienten haben sich noch nie beschwert.«
»Die sind ja auch tot«, konterte Stella.
Am Eingang zu Marco’s Bakery stand ein uniformierter Cop.
Ein anderer hielt sich am Hinterausgang auf. Für Big Stevie
war das keine Überraschung.
Die einzige Frage lautete: Waren die Cops hier, um zu ver-
hindern, dass Marco das Gebäude verließ, oder um zu verhin-
dern, dass Stevie oder jemand anderer es betritt?
Im Grunde war das egal. Stevie kannte noch mindestens
zwei Wege, um in das Gebäude zu gelangen. Er wusste, dass
sich das Fenster der Herrentoilette problemlos öffnen ließ.
Selbst wenn es verschlossen war, bestand das Schloss lediglich
aus einem kleinen Schubriegel, den er mit einem kräftigen
Ruck würde aufbrechen können. Es würde keinen Lärm geben.
Wollte er durch das Fenster einsteigen, musste er jedoch zu-
nächst etwas finden, auf dem er stehen konnte. Normalerweise
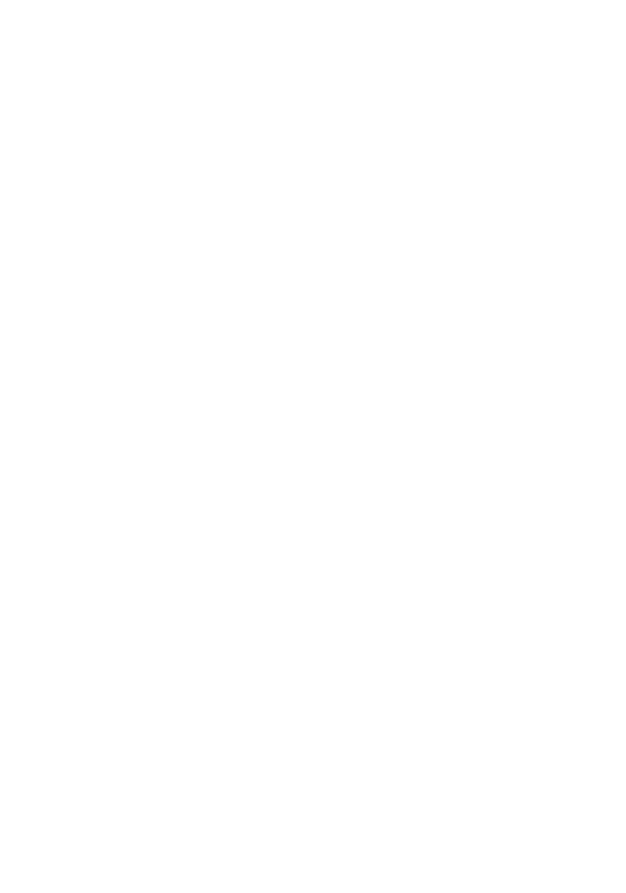
wäre das kein Problem, aber nun, da sein Bein zunehmend taub
wurde, bestand die Gefahr, dass ihn diese Kletterei schlicht ü-
berfordern würde. War er erst einmal in der Toilette, müsste er
nur noch zur Tür hinaus und an den Bäckern und ihren Gesel-
len vorbei. Er würde dort nicht sonderlich auffallen, normaler-
weise. Denn normalerweise achtete dort niemand auf den gro-
ßen Mann, doch heute mochte das anders sein. Dennoch nahm
er an, dass selbst in seinem geschwächten Zustand, blutend und
mit den Bewegungen einer Mumie, niemand in der Backstube
im Stande wäre, ihn aufzuhalten. Die meisten würden einfach
so tun, als hätten sie ihn gar nicht bemerkt. Sie alle hatten im
Gefängnis das Verhalten der drei Affen trainiert: Nicht sehen,
nicht hören, nicht sprechen. Das war die Philosophie, mit der
man an solchen Orten am besten überleben konnte.
Nein, er würde besser das Lagerfenster im Keller nehmen.
Aber ob sich eine der milchigen Glasscheiben öffnen ließ, ohne
dass dabei Lärm entstand, wusste er nicht. Aber er wusste, dass
ihn der Cop vor dem Hinterausgang dann nicht würde sehen
können. Also machte sich Stevie auf den Weg Richtung Keller.
Fenster Nummer eins war standhaft und wollte nicht nachge-
ben. Vermutlich war es seit zwanzig oder mehr Jahren nicht
geöffnet worden.
Fenster Nummer zwei hatte im rechten oberen Abschnitt ei-
ne Scheibe, die bereits locker war.
Stevie fand einen Betonbrocken und ging neben dem Fens-
ter, das in Bodenhöhe lag, in die Knie. Dann riss er ein Stück
Stoff aus seinem Hemd, legte es auf die wacklige Scheibe und
schlug vorsichtig mit dem Betonbrocken darauf. Es gab kaum
ein Geräusch, aber die Scheibe gab auch nicht nach. Er ver-
suchte es noch einmal, schlug dieses Mal etwas kräftiger zu.
Dann krachte es und ein Loch, so groß wie seine Faust, war in
dem Fenster. Er legte den Betonbrocken weg und zog das zer-
fetzte Stück Stoff zur Seite.

Vorsichtig schob er seine dicken Finger durch das Loch und
fühlte die Schärfe des Glases. Er ignorierte den Schmerz, löste
das Glasstück langsam heraus und legte es auf den Boden.
Stevie wischte sich die blutigen Finger an der Hose ab und
griff durch das Loch. Er hatte gerade genug Platz, um seine
Hand und seinen Arm weit genug hindurchzuzwängen, um das
Schloss zu erreichen. Es war zugerostet, aber Stevie war fest
entschlossen, es zu öffnen. Er rappelte ein wenig herum, bis
sich der verrostete Metallriegel löste. Er drückte von innen mit
der Hand gegen das Fenster. Noch hielt es stand. Aber dann
konnte Stevie fühlen, wie es nachgab und plötzlich mit knar-
renden Scharnieren aufsprang.
Keuchend verharrte Stevie in seiner Position und lauschte
auf näher kommende Schritte, aber nichts geschah. Er hielt
kurz inne.
Den leichteren Teil der vor ihm liegenden Aufgabe hatte er
erledigt. Nun kam der schwerere Teil, denn er musste seinen
mächtigen Leib durch das offene Fenster zwängen, und er
wusste, dass es viel zu eng war. Stevie zog seinen Mantel aus
und legte ihn auf den Boden.
Der kalte Wind zerrte an seiner Kleidung, und aus den Au-
genwinkeln registrierte er, dass der Schneefall langsam wieder
einsetzte. Stevie wurde immer schwächer, er musste sich
schnell bewegen, solange er dazu noch in der Lage war.
Er schob zuerst sein verwundetes Bein durch die Fensteröff-
nung, dann sein gesundes Bein. Schließlich versuchte er, auf
dem Rücken liegend den Rest seines Körpers durch das Fenster
zu drücken. Als er bis auf Bauchhöhe hineingerutscht war,
fühlte er, wie es eng wurde, wenn auch nicht zu eng. Er schob
sich immer weiter. Sein Bauch blieb an den dünnen Metallstre-
ben des Fensters hängen. Er war nicht ganz sicher, ob er es
schaffen würde. Aber er war an einem Punkt, an dem er nicht
mehr zurück konnte. Grunzend kämpfte er sich voran, sah das

Blut aus seinen Fingern tropfen, und dann, plötzlich, hatte er es
geschafft. Er war durch die Fensteröffnung geplumpst und
rücklings alle viere von sich gestreckt in die staubige Dunkel-
heit des Kellers gefallen.
Keuchend lag er auf dem Rücken, vollkommen außer Atem,
und hielt die Augen geschlossen. Big Stevie hatte Schmerzen.
Er fror. Und er blutete. Aber er hatte eine Mission zu erfüllen,
und er war im Gebäude von Marco’s Bakery.
Zwei uniformierte Officer halfen Aiden dabei, die Umgebung
der Drietch’s Range systematisch zu durchkämmen und nach
dem verschwundenen Bolzenschneider zu suchen.
Aiden war überzeugt, dass es Louisa Cormier gewesen war,
die das Vorhängeschloss geknackt und anschließend auf den
Boden des Schießstandes hatte fallen lassen. Aber was war mit
dem Bolzenschneider geschehen? Lag er vielleicht in einer
Mülltonne hier in der Nähe des Schießstandes?
Inzwischen hätten sie ihn längst finden müssen.
Ihr Telefon vibrierte in ihrer Tasche, und sie nahm den An-
ruf entgegen.
»Komm ins Labor«, sagte Mac. »Ich habe den Bolzen-
schneider gefunden.«
»Wo?«
»Im Keller des Appartementgebäudes«, sagte er. »Sie hat
ihn zusammen mit anderen Werkzeugen dort aufgehängt. Der
Hausmeister besitzt zwar auch einen Bolzenschneider, aber er
sagt, das ist er nicht.«
»Sie hat ihn also direkt vor unseren Augen versteckt«, sagte
Aiden.
»Wie in einem ihrer Romane«, kommentierte Mac. »Oder
sollte ich vielleicht sagen, aus einem von Charles Lutnikovs
Louisa-Cormier-Romanen? Im Buch ist es jedoch kein Bolzen-
schneider, sondern eine Schaufel.«

»Fingerabdrücke?«
»Einer«, sagte Mac. »Ein Teilabdruck. Aber gut genug, um
Louisa Cormier damit überführen zu können.«
»Ich beeile mich hier und fahre dann zurück ins Labor.«
»Gut, ich werde inzwischen Stella im Krankenhaus besu-
chen.«
»In Ordnung«, sagte Aiden, klappte ihr Mobiltelefon zu und
machte sich auf die Suche nach den beiden uniformierten Be-
amten, die ihr geholfen hatten. Sie wusste nicht recht, was sie
von alldem halten sollte. Auf jeden Fall würden sie Louisa
Cormier mit den neuen Beweisen konfrontieren. Aiden war
nicht sicher, ob die Frau hinterhältig und manipulativ war, oder
ob sie einfach nur in einer Wahnvorstellung lebte und selbst an
das glaubte, was sie sagte. Aiden Burn hätte weder auf das eine
noch auf das andere wetten wollen.
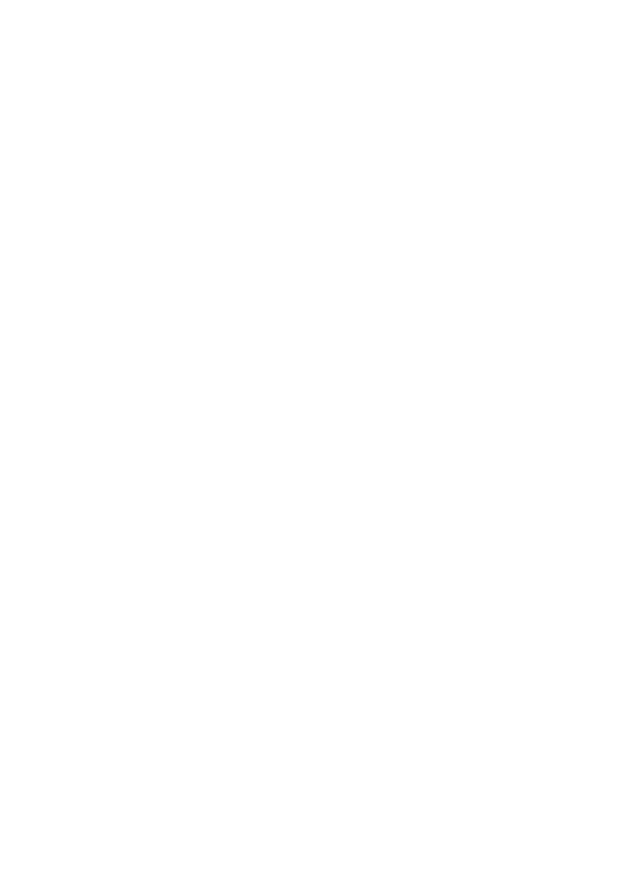
16
Ein weißer Sandstrand hing über Stella, als sie die Augen auf-
schlug. Sie konnte sogar den Wellenschlag der Brandung ver-
nehmen.
Stella hatte seit drei Jahren keinen Urlaub mehr gehabt. Sie
hatte nie verreisen wollen. Es gab immer einen neuen Fall oder
einen, der erst halb abgeschlossen war.
Langsam kam sie wieder ganz zu sich, und der Schleier lüf-
tete sich nach ein oder zwei Sekunden. Sie erkannte, dass der
Sandstrand die Zimmerdecke war und das Brandungsgeräusch
von einem Monitor stammte, dessen dünne Kabel mit ihrem
Körper verbunden waren.
Stellas Mund war trocken.
Sie drehte den Kopf und sah Mac an ihrer linken Seite stehen.
»Wie …?«, fing sie an, doch schon dieses eine Wort erklang
wie ein schmerzlich unzusammenhängendes Krächzen.
Sie hustete und deutete auf den weißen Plastikkrug auf dem
Tisch neben ihrem Bett. Mac nickte, schenkte Wasser in ein
Glas, wickelte einen Strohhalm aus seiner Papierhülle und
steckte ihn hinein. Dann hielt er ihr das Glas hin.
»Langsam«, sagte er, während er das Glas so hielt, dass sie
trinken konnte.
Der erste Schluck brannte in ihrer Kehle. Sie würgte ein
wenig, aber das ging vorbei, und sie trank ein bisschen mehr.
»Wie schlimm ist es?«, fragte sie.
»Du wirst wieder gesund«, versicherte ihr Mac. »Du bist zu-
sammengebrochen. Danny und Hawkes haben dich herge-

bracht. Hawkes’ Freund hat dich mit Glukose und Antibiotika
versorgt. Er hat einen Experten für Leptospirose in Honolulu
aufgetan und ihn angerufen und … da bist du nun.«
»Wie lange werde ich hier bleiben müssen?«
»Ein paar Tage. Und dann musst du dich noch ein paar Tage
zu Hause ausruhen«, sagte Mac. »Hättest du dich gleich unter-
suchen lassen, als du gemerkt hast, dass du eine Krankheit aus-
brütest, würdest du jetzt nicht hier liegen.«
»Ich bin ein Workaholic. Das weißt du doch«, sagte Stella
und verzog die Lippen zu etwas, von dem sie hoffte, dass es
wie ein Lächeln aussah.
Mac erwiderte es. Stella sah sich in dem Krankenhauszim-
mer um. Viel gab es nicht zu sehen. Ein Fenster zu ihrer Lin-
ken und eins gegenüber, durch das sie ein rotes Gebäude auf
der anderen Straßenseite erkennen konnte. An einer Wand hing
die Reproduktion eines Bildes, das sie zu kennen glaubte. Es
waren drei Frauen in bäuerlicher Kleidung, die in der Nähe ei-
nes großen Heuballens auf einem Feld arbeiteten. Die Frauen
waren vornübergebeugt, um etwas zu ernten – Bohnen, Reis –
und danach in einen Korb zu werfen.
Mac folgte ihrem Blick.
»Die Frau rechts«, sagte Stella. »Sie hat Schmerzen. Sieh dir
die deformierte, c-förmige Krümmung ihres Rückens an. Das
kommt von jahrelanger gebückter Haltung. Wenn sie sich auf-
richtet, hat sie Schmerzen und bückt sich wieder. Bald wird sie
sich gar nicht mehr anders bewegen können.«
»Möchtest du sie genauer untersuchen?«, fragte Mac.
»Nicht, solange sie nicht ermordet wird oder selbst mordet«,
meinte Stella, den Blick immer noch auf das Gemälde gerich-
tet. »Wie alt, denkst du, ist das Originalbild? Kannst du das
schätzen?«
»Das Bild heißt Die Ährenleserinnen«, sagte Mac. »Und
stammt von Jean François Millet. 1857.«

Stella drehte den Kopf, um ihn anzusehen, sagte aber nichts.
»Meine Frau hatte einige Drucke seiner Arbeiten«, sagte
Mac. »Einer der Höhepunkte unserer Europareise vor vielen
Jahren war der Besuch des Musée d’Orsay in Paris, in dem
Millets Angelus hängt.«
Stella nickte. Das war mehr, als Mac je zuvor über seine tote
Frau erzählt hatte.
Macs Lächeln war nun breiter.
»Sie hat Schönheit in diesen Gemälden gesehen«, sagte er.
»Und du siehst eine Frau mit einem medizinischen Problem.«
»Tut mir Leid«, sagte Stella.
»Nein«, sagte Mac. »Ihr habt beide Recht.«
»Mac«, sagte sie. »Ich weiß, wer Alberta Spanio umge-
bracht hat. Und der Jockey war es nicht.«
Als Don Flack den Anruf auf seinem Mobiltelefon entgegen-
nahm, erzählte ihm Mac, was er von Stella erfahren hatte.
»Ich fahre gleich hin«, sagte Flack.
»Willst du Verstärkung?«, fragte Mac.
»Werd ich nicht brauchen.«
»Gibt es irgendetwas Neues über Guista?«
»Den werde ich schon noch finden«, erwiderte Flack und
berührte den empfindlichen Bereich um seine gebrochenen
Rippen.
Flack klappte sein Mobiltelefon zu und fuhr weiter, aber nun
war nicht mehr Marco’s Bakery
sein Ziel, sondern er war un-
terwegs nach Flushing in Queens.
Die Temperatur war auf minus zehn Grad gestiegen, und der
Schneefall hatte aufgehört. Der Verkehr floss nur träge, und
nach dem beinahe vier Tage andauernden Schneesturm und der
eisigen Kälte lagen bei vielen die Nerven blank. Bei dem
Schneckentempo konnte jederzeit irgendein Verkehrsrowdy die
Geduld verlieren.

Don sah auf seine Armbanduhr. Das Telefon klingelte. Wie-
der Mac.
»Wo bist du?«, fragte Mac.
Don erzählte es ihm.
»Hol Danny im Labor ab. Er hat die Tatortfotos, und Stella
hat ihn gerade eingewiesen.«
»In Ordnung«, sagte Don. »Wie geht es ihr?«
»Gut. Die Ärzte sagen, sie kann in ein paar Tagen wieder
arbeiten.«
»Sag ihr, dass ich nach ihr gefragt habe«, bat Don und legte
auf.
Danny wartete hinter der Glastür in einem dicken, knielan-
gen Mantel und einer Mütze mit Ohrenklappen. Die Hände
steckten in Handschuhen. In der einen Hand hielt er einen Ak-
tenkoffer, mit der anderen winkte er Don zu, um anzudeuten,
dass er ihn sah und herauskommen würde.
Kaum hatte er die Tür geöffnet, beschlug seine Brille, und er
musste kurz innehalten, um die Gläser mit seinem Schal abzu-
wischen.
»Kalt«, sagte er, als er in den beheizten Wagen kletterte.
»Kalt«, stimmte Don zu.
Auf dem Weg nach Flushing erzählte Danny alles, was er
von Stella wusste. Flack suchte nach Löchern in der Beweis-
führung, Alternativen zu Stellas Schlussfolgerungen, aber er
konnte nichts finden. Er stellte das Radio an und lauschte den
Nachrichten, bis sie Ed Taxx’ Haus erreicht hatten.
Taxx öffnete die Tür. Er trug Jeans, ein weißes Hemd und
einen braunen Wollpullover. In der Hand hielt er eine Kaffee-
tasse, auf der, umrahmt von blauen Zierstreifen, in großen ro-
ten Lettern das Wort »DAD« prangte.
»Ist sonst noch jemand zu Hause?«, fragte Don.
Irgendwo im Haus lief ein Fernseher. Es erklang ein Frauen-
lachen. Ein Lachen, das in Dons Ohren unaufrichtig klang.

»Ich bin allein und langweile mich furchtbar«, sagte Taxx
und trat zurück, um die beiden Männer hineinzulassen. Dann
zog er die Tür hinter den beiden wieder zu. »Ich bin immer noch
beurlaubt, weil die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist.«
Er führte die Männer ins Wohnzimmer und fragte sie über
die Schulter, ob er ihnen einen Kaffee oder eine Diätcola an-
bieten könne. Beide verneinten.
Taxx nahm in einem dick gepolsterten Sessel Platz, Don und
Danny setzten sich auf das Sofa.
»Was führt Sie hierher?«, fragte Taxx und nippte an seinem
Kaffee.
»Ein paar Fragen«, sagte Flack.
»Schießen Sie los.«
»Als Sie die Tür zu Alberta Spanios Schlafzimmer auf-
gebrochen haben, sind Sie da direkt zu ihrem Bett gegangen?«
»Ja«, sagte Taxx.
»Und Collier haben Sie ins Badezimmer geschickt?«, fuhr
Flack fort.
»Ich würde nicht sagen, dass ich ihn geschickt habe. Wir
haben einfach getan, was wir tun mussten. Was …?«
»Collier hat ausgesagt, Sie hätten ihm gesagt, er solle das
Badezimmer überprüfen«, sagte Flack.
»Möglich«, gab Taxx zu.
»Sind Sie ins Badezimmer gegangen, nachdem er herausge-
kommen ist?«
Taxx dachte nach und antwortete: »Nein. Wir sind in unse-
ren Raum zurückgegangen und haben den Mord gemeldet.
Keiner von uns ist in Albertas Zimmer zurückgekehrt. Es war
ja schließlich ein Tatort.«
»Collier hat ausgesagt, er hätte in der Wanne gestanden und
aus dem offenen Fenster hinausgesehen«, sagte Flack.
»Ich war nicht bei ihm«, entgegnete Taxx mit verwirrter
Miene.

»Zeig ihm die Fotos, Danny.«
Danny öffnete den Aktenkoffer und nahm den Stapel Fotos
heraus, die er und Stella geschossen hatten. Er suchte vier aus
und reichte sie Taxx. Alle vier Fotografien zeigten die Bade-
wanne und das offene Fenster. Taxx betrachtete die Fotos und
gab sie Danny zurück.
»Was hätte ich auf diesen Bildern sehen sollen?«, fragte er
und stellte seine Kaffeetasse ab.
»Da ist kein Schnee, keine Spur von Schnee oder Eis in der
Wanne«, erklärte Flack. »Es war in dem Raum viel zu kalt, als
dass der Schnee hätte schmelzen können.«
»Und?«, fragte Taxx.
»Wenn jemand durch das Fenster gekommen wäre, um Al-
berta Spanio umzubringen, dann hätte er automatisch den
Schnee, der vor dem Fenster lag, in die Wanne geschoben.«
Taxx nickte, sagte aber dann: »Vielleicht hat er den Schnee
mit dem Arm oder dem Bein zur Seite gewischt, statt ihn rein-
zuschieben.«
»Wozu?«, fragte Danny. »Dann hätte er eine Hand loslassen
oder mit dem Fuß ausholen müssen, um den Schnee seitlich
wegzuschieben. Es ist doch einfacher, sich durch das Fenster
zu schwingen und dabei den Schnee nach innen zu treten und
in der Badewanne zu landen. Dann hätte der Mörder genug
Zeit gehabt, um in Albertas Schlafzimmer zu gehen, sie umzu-
bringen und wieder zu verschwinden.«
»Jemand muss den Schnee vom Badezimmerfenster aus
fortgeschoben haben«, sagte Flack.
»Warum? Und wer? Collier? Alberta?«, fragte Taxx.
»Alberta Spanio war durch eine Überdosis Schlaftabletten
außer Gefecht gesetzt worden«, sagte Danny. »Und aus wel-
chem Grund hätte sie bei Minustemperaturen auch das Fenster
öffnen und die Kälte hereinlassen sollen?«
»Collier?«, fragte Taxx.

»Wir denken, dass die Person, die für den Tod Albertas ver-
antwortlich ist, auch den Schnee vor dem Fenster beseitigt hat.
Sie wollte uns glauben lassen, jemand wäre von außen durch
das Fenster eingestiegen«, erklärte Flack. »Denn sonst wäre der
Verdacht auf die beiden Personen gefallen, die als Einzige in
der Nähe waren.«
Taxx sagte zunächst nichts. Seine Zungenspitze bohrte sich
von innen in seine rechte Wange.
»Collier?«, fragte Taxx erneut.
»Wann und wie?«, fragte Danny zurück. »Die Tür zum
Schlafzimmer war die ganze Nacht verschlossen.«
»Und das Badezimmerfenster war zu«, sagte Taxx. »Sowohl
Collier als auch ich haben das bestätigt. Wir haben das Schlaf-
zimmer gemeinsam verlassen.«
»Aber am Morgen haben Sie die Tür aufgebrochen, und einer
von Ihnen ist zum Bett gegangen, während der andere ins Badezim-
mer lief«, sagte Danny. »Das war der einzige Zeitpunkt, zu dem Al-
berta ermordet werden konnte. Und Sie waren derjenige, der zu ih-
rem Bett gegangen ist. Sie haben Ihr Messer aus der Tasche gezogen
und es der bewusstlosen Frau in den Hals gerammt. Das konnten Sie
in fünf Sekunden schaffen. Wir haben das nachgeprüft.«
»Diese Frau?«, fragte Taxx und starrte zum Fenster hinaus.
»Ja, Stella hat es herausgefunden«, bestätigte Don.
»Dario Marco hat Guista und Jake Laudano angeheuert,
damit sie sich in dem Zimmer im Brevard Hotel einmieten«,
sagte Flack. »Sie sollten gesehen werden, ein großer starker
Mann und ein kleiner. Wir sollten denken, dass sie Spanio er-
mordet haben, damit der echte Mörder, nämlich Sie, gar nicht
erst in Verdacht gerät.«
»Guista hatte außerdem die Aufgabe, das Badezimmerfens-
ter zu öffnen, indem er eine Kette mit einem Haken hinunter-
ließ, um damit den Ring, den Sie vorher in den Fensterrahmen
eingeschraubt hatten, herauszuziehen.«

»Das ist weit hergeholt.« Taxx hatte die Augenbrauen hoch-
gezogen.
»Vielleicht«, stimmte Flack ihm zu. »Aber wir werden uns
Jake Laudano schnappen, und haben wir erst beide, ihn und
Guista, so wird die Staatsanwaltschaft einen Handel anbieten,
und dann fangen die beiden an zu reden.«
»Bin ich verhaftet?«, fragte Taxx leise.
»So gut wie«, antwortete Flack.
»Ich denke, ich sollte einen Anwalt anrufen«, sagte Taxx.
»Hört sich vernünftig an«, kommentierte Flack.
Der Detective erhob sich, und die gebrochenen Rippen in sei-
nem Brustkorb plagten ihn mit einem plötzlichen scharfen
Schmerz. Er brachte die vier Schritte bis zu Taxx hinter sich und
fesselte die Hände des Mannes hinter seinem Rücken mit Hand-
schellen.
Danny rückte seine Brille zurecht und legte die Fotos weg,
während Flack die Miranda-Rechte vorlas. Don sprach lang-
sam, und aus irgendeinem Grund hörte es sich an, als sagte er
ein gut geübtes Gebet auf.
Aiden untersuchte den Bolzenschneider und das aufgebrochene
Schloss. Sie hatte eine vergrößerte Aufnahme von beiden
Schneidkanten des Bolzenschneiders und von der Schnittstelle
des Schlossbügels vor sich liegen.
Sie saß im Labor und verglich die Bilder.
Die kleinen Riefen der Schneiden waren für das bloße
Auge kaum erkennbar, aber auf der Vergrößerung waren sie
so eindeutig wie Fingerabdrücke. Für sie gab es keinen
Zweifel mehr. Und für die Geschworenen würde es auch
keinen Zweifel geben. Das Schloss, das sie auf dem Schieß-
stand gefunden hatte, war mit dem Bolzenschneider aufge-
trennt worden, den Mac im Keller des Appartementgebäudes
entdeckt hatte.

Sie griff zum Telefon, rief Mac an und erzählte ihm, was sie
wusste.
»Das reicht«, sagte Mac.
»Reicht für …?«, fragte sie und ließ die Frage offen.
»Einen Haftbefehl«, ergänzte Mac. »Wir treffen uns bei
Louisa Cormier mit jemandem von der Mordkommission.«
Aiden legte auf. Alle Beweise gegen Louisa Cormier wa-
ren Indizien. Sie hatten keine Augenzeugen, und sie hatten
die Waffe nicht gefunden. Aber die meisten Fälle wurden
vor Gericht überwiegend durch Indizienbeweise gewonnen.
Gerissene Strafverteidiger mochten all die Beweise anfech-
ten, mochten verschiedene Szenarien entwerfen, die Ermitt-
lung für fehlerhaft erklären, alles durcheinander bringen, a-
ber Aiden, die nun ihren Mantel holte, glaubte nicht daran,
dass irgendwelche Verwirrspiele Beweise dieser Art noch
kippen konnten.
Es gab genügend stichhaltige Anhaltspunkte für eine Ankla-
ge: der Bolzenschneider, mit dem das Schloss einer Kassette
geöffnet worden war, in der eine .22er aufbewahrt wurde – eine
Handfeuerwaffe, mit der Louisa Cormier zu üben pflegte; das
Manuskript mit den zwei Schusslöchern, das Louisa Cormier
aus den Händen des toten Charles Lutnikov gerissen und in al-
ler Eile kopiert hatte, und die Tatsache, dass Lutnikov Louisa
Cormiers Ghostwriter war.
Aiden zog ihren Mantel an, und als sie zum Fahrstuhl ging,
dachte sie: Wir haben immer noch keine Mordwaffe, und wir
haben immer noch kein Motiv, Louisa Cormier dagegen hat
Noah Pease.
Vielleicht sollten sie doch noch warten, weitere Beweise
sammeln, und Waffe und Motiv suchen. Aber Mac hatte ge-
sagt, sie hätten genug, und Aiden vertraute seinem Urteilsver-
mögen.

»Das ist schikanös«, sagte Louisa Cormier, als sie die Tür öff-
nete. Aiden fiel auf, dass Louisa die Hände zusammenhielt, um
ihr Zittern zu verbergen. Derweil fiel Louisas Blick auf den
Mann im blauen Anzug, der die beiden C.S.I.-Ermittler beglei-
tet hatte.
»Ich werde Sie nicht hereinbitten«, sagte sie. »Und ich rufe
meinen Anwalt an. Ich werde eine gerichtliche Verfügung ge-
gen Sie und die ganze …«
»Wir wollen nicht hereinkommen«, sagte Mac.
Louisa Cormier sah verwirrt aus.
»Nicht? Nun, ich werde auf Anraten meines Anwalts keine
Ihrer Fragen beantworten.«
»Das müssen Sie auch nicht«, sagte Mac. »Aber Sie müssen
mit uns kommen. Sie sind verhaftet.«
»Ich …«, fing Louisa an.
»Und es wäre schön, wenn Sie Ihre Walther mitnehmen
könnten, falls Sie so freundlich wären. Dieser Detective wird
Sie begleiten, wenn Sie sie holen. Wir haben die notwendigen
Papiere bei uns.«
Mac zog ein dreifach gefaltetes Blatt Papier hervor.
»Das können Sie nicht«, sagte Louisa Cormier. »Ich habe
Ihnen die Waffe gezeigt. Sie wissen, dass nicht mit ihr ge-
schossen wurde.«
»Wir denken, sie wurde doch abgefeuert«, sagte Aiden.
Louisa Cormier stand am Rande eines Zusammenbruchs.
Aiden trat vor, um sie aufzufangen, und erhaschte einen Hauch
von ihrem Parfüm, ein Gardenienduft, der exakt so roch wie
der, den Aidens Mutter benutzte.
Stevie schlich langsam die dunkle Treppe hinauf und zog dabei
sein Bein hinter sich her. Als er den Treppenabsatz im Erdge-
schoss erreicht hatte, drangen die Gerüche der Backstube durch
die Tür zu seiner Linken.

Stevie mochte die Bäckerei, den Geruch von frischem Brot,
mochte es, den Lieferwagen zu fahren, mit den Kunden auf
seiner Tour zu reden. Er wusste, all das wäre in wenigen Minu-
ten nicht mehr da, und er wusste, dass auch er auf die eine oder
andere Weise nicht mehr da sein würde. Er hatte Dario Marco
sein ganzes Vertrauen und seine Loyalität geschenkt und war
verraten worden.
Ehe er auf den Korridor trat, blieb er in der Dunkelheit ste-
hen und sah sich in beide Richtungen um. Nichts rührte sich.
Dario Marcos Büro war nur drei Türen entfernt zu seiner
Rechten. Stevie gab sich alle Mühe, schnell und leise zu sein.
Um leise zu sein, musste er sich sehr zusammenreißen und den
Schmerz vergessen.
Sollte Helen Grandfield da sein, wenn er die Tür öffnete,
würde er sie vermutlich töten müssen. Das konnte er schnell er-
ledigen, sie würde ihn nicht aufhalten können. Sie war Dario
Marcos Tochter und Anthony Marcos Nichte und zudem Teil
des Komplotts gewesen, das geplant hatte, den dummen Stevie
zu Fall zu bringen.
Vor der Tür zum Büro hielt er inne und lauschte. Er hörte
nichts. Er öffnete die Tür zum Vorzimmer, bereit, sich auf eine
erschrockene Helen Grandfield zu stürzen. Aber im Zimmer
war niemand.
Stevie fragte sich, ob Dario womöglich gar nicht im Haus
war. Vielleicht hatte er sich einen freien Tag genommen. Das
wäre zwar ungewöhnlich gewesen, aber nach den letzten Tagen
durchaus verständlich.
Stevie ging durch den Vorraum, lauschte, hörte nichts und
öffnete langsam Marcos Bürotür. Die Beleuchtung war ge-
dämpft, die Jalousien heruntergezogen, doch Stevie erkannte
Dario Marco hinter dem Schreibtisch.
Dario schaute auf. Auf den Anblick, der sich ihm bot, war
Stevie nicht vorbereitet.

»Wir haben auf dich gewartet, Stevie«, hörte er Dario sagen.
In der Ecke standen Jacob, der Jockey, und Helen Grand-
field. Der Jockey hielt eine Waffe in der Hand und zielte damit
auf Stevie.
Der Tisch vor Joelle Finebergs Schreibtisch war voller Akten.
Sie hatte den niedrigsten Rang bei der Staatsanwaltschaft und
deshalb auch das kleinste Büro.
Für ihren Raum hatte sie sich einen sehr kleinen Schreib-
tisch und ein sehr kleines Bücherregal ausgesucht, sodass noch
genügend Platz blieb für einen Tisch, an dem mindestens sechs
Leute sitzen konnten. Diesen Tisch benutzte sie auch als Ar-
beitstisch. Aber wenn ein Treffen wie dieses stattfand, räumte
sie ihn natürlich ab. Sie stapelte die Papiere und Bücher ein-
fach zusammen und verstaute sie in einem schwarzen Kunst-
stoffkasten, den sie bei solchen Gelegenheiten hinter ihrem
Schreibtisch außer Sichtweite verschwinden ließ.
»Sie haben nicht einmal genug für die Anklagejury«, sagte
Noah Pease, dessen Hand auf Louisa Cormiers Schulter ruhte,
die neben ihm saß und stur geradeaus blickte.
»Ich denke, das haben wir sehr wohl«, entgegnete Fineberg,
die ihm zwischen Mac und Aiden gegenübersaß.
Einige der ordentlich zusammengelegten Stapel von Papie-
ren und Fotografien lagen auf dem Tisch wie ein großes Kar-
tenspiel, das auf eine heiße Partie Poker wartete, was dem
Spiel, das hier gespielt wurde, sehr nahe kam.
Fineberg sah Mac an und sagte: »Detective, würden Sie die
Beweise noch einmal aufzählen.«
Mac blickte auf den gelben Block, der vor ihm lag, und ging
die Beweisstücke Schritt für Schritt durch. Dann sah Fineberg
Aiden an, die zustimmend nickte.
Peases Gesicht blieb ausdruckslos. Das Gleiche galt für
Louisa Cormiers Antlitz.

»Würde es Sie überraschen, wenn ich Ihnen sagte, dass die
Detectives Taylor und Burn die Fingerabdrücke von Ms Cor-
mier auf sieben verschiedenen Gegenständen in Charles Lutni-
kovs Wohnung gefunden haben?«, fragte Fineberg.
»Ja«, sagte Pease, »das würde es.«
Fineberg ging die Papiere durch und förderte sieben Foto-
grafien zu Tage, die sie Pease reichte.
»Perfekte Treffer«, sagte die stellvertretende Bezirksstaats-
anwältin. »Eine Tasse, eine Tischplatte, der Schreibtisch und
vier Abdrücke in Regalfächern.«
Die Fingerabdrücke stimmten absolut mit denen von Louisa
Cormier überein.
Louisa Cormier griff nach den Fotos.
»Indizien«, verkündete Pease mit einem Seufzer.
»Ihre Klientin hat uns belogen, als sie behauptete, nie in
Lutnikovs Appartement gewesen zu sein«, stellte Fineberg fest.
»Ich war einmal dort«, sagte Louisa. »Ich erinnere mich
wieder. Er hat mich gebeten etwas abzuholen … irgendet-
was.«
»Gibt es einen Grund, warum wir hier sind?«, fragte Pease.
»Verhandlungen«, sagte Fineberg.
»Nein«, sagte Pease und schüttelte den Kopf.
»Dann gehen wir vor die Jury und erheben Anklage wegen
Mordes zweiten Grades«, sagte Fineberg.
Sie drehte sich zu Mac um und fügte hinzu: »Die Detectives
Taylor und Burn werden als Zeugen auftreten. Ich bin von den
Beweisen, die die C.S.I-Einheit aufgespürt hat, überzeugt, und
das werden die Geschworenen auch sein.«
»Ms Cormier ist eine höchst angesehene Person des kultu-
rellen Lebens und hat kein Motiv«, sagte Pease. »Ihr Fall ba-
siert ausschließlich auf der Behauptung, sie habe ihre Bücher
nicht selbst verfasst. Aber das hat sie doch.«
»Detective Taylor?«, sagte Fineberg.

»Überzeugen Sie mich, und überzeugen Sie meinen Exper-
ten«, forderte Mac.
»Wie?«, fragte Pease.
»Lassen Sie sie irgendetwas schreiben«, schlug Fineberg
vor.
»Das ist lächerlich«, sagte Pease.
»Sie hat vier Tage Zeit, bis wir vor die Anklagejury treten«,
sagte Fineberg. »Fünf Seiten. Das sollte nicht zu viel verlangt
sein, vor allem, wenn es um eine Anklage wegen Mordes
geht.«
»Ich kann unter Druck nicht schreiben«, sagte Louisa Cor-
mier und gab ihrem Anwalt die Fotos von den Fingerabdrücken
zurück, worauf dieser sie sauber übereinander gestapelt wieder
zu Fineberg hinüberschob.
»Sie zählen darauf, dass die Geschworenen einer so be-
rühmten und sehr beliebten Prominenten wie Ihnen Sympathie
entgegenbringen werden«, sagte Fineberg. »Wie schnell ha-
ben Sie Martha Stewart vergessen. Sie könnten nun natürlich
mit O. J. Simpson kontern, aber … Überlegen Sie es sich
gut.«
Pease starrte Fineberg mit verärgerter Miene an. Dabei ver-
riet sein Blick, dass seine Stimmung in offenen Hass hätte um-
schlagen können, wäre er nicht so ein erfahrener Jurist gewe-
sen.
»Wir tragen die Geschichte der Anklagejury vor«, sagte Fi-
neberg, »und wir werden unseren Fall durchbringen – jeden-
falls weit genug, um eine True Bill zu bekommen.«
Eine True Bill ist, wie beide Rechtsgelehrten wussten, die
schriftliche Entscheidung einer Anklagejury, unterschrieben
von dem Geschworenensprecher, die besagt, dass der Jury sei-
tens der Anklage ausreichende Beweise vorgelegt worden sind,
um die beschuldigte Person wegen eines mutmaßlichen
Verbrechens anklagen zu können.

»Und den Ruf meiner Klientin beschmutzen«, sagte Pease.
»Eine Absprache zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidi-
gung hätte den gleichen Effekt.«
»Wir haben die Waffe«, sagte Fineberg und sah sich zu Mac
um.
»Wir untersuchen die Waffe aus Ms Cormiers Schublade«,
sagte er.
»Aus der, wie Sie bereits ermittelt haben, nicht …«, fing
Pease an.
»Sie passt zu der Kugel, die wir am Fuß des Fahrstuhl-
schachts gefunden haben«, fiel ihm Mac ins Wort. »Ms Cor-
mier hat auf Charles Lutnikov geschossen, hat ihren Mantel
angezogen, die Waffe und den Bolzenschneider, den sie ver-
mutlich in ihrem Trophäenschrank aufbewahrt hatte, in ihre
Tragetasche gepackt, den Aufzug auf ihrem Stockwerk blo-
ckiert und ist danach schnell die Treppe hinuntergelaufen, um
ihren üblichen Morgenspaziergang anzutreten. Es war acht Uhr
morgens, und draußen tobte ein Schneesturm. Es war kaum an-
zunehmen, dass in den nächsten Stunden irgendjemand aus
dem Penthouse den Fahrstuhl benutzen würde. Außerdem hatte
sie vor, nicht mehr als dreißig Minuten fortzubleiben.«
»Und wo ist meine Klientin Ihrer fantasievollen Geschichte
zufolge hingegangen?«, fragte Pease.
»Zu Drietch’s Range,
vier Blocks entfernt«, sagte Mac.
»Sogar bei Schnee und Eis konnte sie den Weg in fünfzehn
Minuten schaffen. Ich habe es überprüft. Sie wusste, dass der
Schießstand samstags erst in drei Stunden öffnen würde. Die
Außentür hat sie mit einer gewöhnlichen Kreditkarte geöffnet,
so wie es die Ermittlerin in drei ihrer Bücher auch getan hat.
Ms Cormier hat es bestimmt einmal ausprobiert.«
»Vorsatz«, sagte Joelle Fineberg.
»Ihre Klientin ist in den Raum gegangen, in dem die Waffen
aufbewahrt werden«, fuhr Mac fort. »Sie hat das Schloss der

Kassette aufgeknackt, in der die Waffe lag, hat diese herausge-
nommen, sie in die Tasche gesteckt und durch die Mordwaffe
ersetzt. Dann hat sie das Schloss einfach auf den Boden des
Schießstandes geworfen. Sie wusste, irgendjemand würde es
finden. Sie nahm an, dass die unbenutzte Walther, die nun in
ihrem Besitz war, untersucht werden würde und jeder halbwegs
kompetente Detective erkennen musste, dass diese Waffe in
letzter Zeit nicht abgefeuert worden war. Außerdem gab es
keine Übereinstimmung zwischen dieser Waffe und der Kugel
aus dem Fahrstuhlschacht. Hätte man die Waffe, die sich nun
in der Metallkassette befand, auf Schmauchspuren überprüft,
wäre auch das kein Problem gewesen. Auf einem Schießstand
ist das schließlich die Regel, und Ms Cormier wäre außer Ver-
dacht gewesen.«
»Weit hergeholt …«, kommentierte Pease.
»Ich schlage vor, Sie lesen eines der ersten drei Bücher Ihrer
Klientin, wenn Sie wissen wollen, wie weit hergeholt eine ihrer
Geschichten klingen kann.«
Pease schüttelte müde den Kopf, als wäre Macs Vortrag für
ihn eine unverdiente Strafe, die er nur mühsam aushalten konn-
te.
Mac ignorierte den Anwalt und fuhr fort.
»Ms Cormier ist so schnell wie möglich nach Hause zu-
rückgekehrt, hat den Bolzenschneider in den Keller gebracht
und ist die Treppe hinaufgestiegen. Dann hat sie den Fahrstuhl
wieder freigegeben, der daraufhin ins Erdgeschoss hinunter-
fuhr, und die unbenutzte Waffe, die sie auf dem Schießstand
entwendet hatte, in ihre Schreibtischschublade gelegt.«
»Und dann?«, fragte Pease und schüttelte den Kopf, als hät-
te man ihn gezwungen, einer Märchenstunde beizuwohnen.
»Sie hat darauf gewartet, dass wir kommen, und hat uns be-
reitwillig und übereifrig die Waffe gezeigt. Es war die Waffe,
die sie auf dem Schießstand an sich genommen hatte, nicht ihre

eigene, die sie normalerweise in der Schreibtischschublade
aufbewahrte. Nachdem wir weg waren, hat sie erneut den
Schießstand aufgesucht und die Waffen wieder ausgetauscht,
sodass nun wieder die Waffe in der Kassette lag, die dort auch
tatsächlich hingehörte. Officer Burn hat diese Waffe untersucht
und festgestellt, dass es nicht die Mordwaffe war.«
»Ihre Klientin hatte die Mordwaffe gut sichtbar in der
Schublade ihres Schreibtischs deponiert«, sagte Fineberg. »Das
hat sie getan, weil sie glaubte, die Ermittler würden die Waffe
kein zweites Mal untersuchen, nachdem sie einmal festgestellt
hatten, dass sie nicht abgefeuert wurde.«
»Wir werden eine Übereinstimmung zwischen der Kugel
und Ihrer Waffe nachweisen«, sagte Mac zu Louisa Cormier.
»Sie haben die ganze Geschichte zu kompliziert aufgebaut.«
»Es hätte beinahe funktioniert«, wisperte Louisa Cormier.
»Louisa«, sagte Pease warnend und beugte sich vor, um sei-
ner Klientin etwas zuzuflüstern, ehe er sich wieder aufrichtete.
»Selbstverteidigung«, sagte er. »Charles Lutnikov ist zur Woh-
nung meiner Klientin gegangen, nachdem er sie bereits am Te-
lefon bedroht hatte. Sie hatte ihre Waffe herausgeholt, um sich
zu schützen. Er wollte sie ihr abnehmen. Ein Schuss hat sich
gelöst. Sie ist in Panik geraten.«
»Und hat sich dann im Handumdrehen diese komplizierte
Verschleierungstaktik einfallen lassen?«, fragte Fineberg.
»Ja«, sagte Pease. »Sie ist Schriftstellerin und besitzt ein
sehr lebendiges Vorstellungsvermögen.«
»Eine Schriftstellerin, die ihre eigenen Bücher nicht selbst
schreibt«, sagte Mac.
»Wir werden sehen, was die Jury darüber denkt«, gab Pease
zurück.
»Warum hätte Lutnikov Louisa Cormier bedrohen sollen?«,
fragte Mac.
Weder Anwalt noch Klientin antworteten spontan.

»Fahrlässige Tötung«, sagte Pease. »Bewährungsstrafe.«
»Nein«, sagte Fineberg. »Die Beweise, die diese Beamten
vorgelegt haben, verraten, dass Absicht, Vorsatz und Vertu-
schung im Spiel waren.«
Pease beugte sich erneut vor und flüsterte etwas in Louisa
Cormiers Ohr. Ein Ausdruck puren Entsetzens legte sich auf
ihr Gesicht.
»Mord zweiten Grades«, sagte Fineberg.
»Totschlag«, gab Pease zurück. »Und nichts geht an die Öf-
fentlichkeit. Sie suchen einen Richter, der die Akte versiegelt.
Und Sie lassen sich für die Medien was einfallen.«
Fineberg sah Mac an, ehe sie sich wieder Pease zuwandte
und den Kopf schüttelte.
»Inoffiziell?«, fragte Pease und tätschelte die Hand seiner
Klientin.
»Inoffiziell«, sagte Fineberg.
»Louisa?«, sagte Pease, die Hand auf ihrem Arm, bereit, sie
mit sanftem Druck auf den Weg zu bringen.
»Ich kann nicht«, sagte Louisa Cormier und sah Pease an.
Pease legte den Kopf schief und sagte: »Sie können nichts
damit anfangen, solange wir es nicht zulassen.«
Louisa Cormier seufzte.
»Ich habe Charles Lutnikov erschossen. Er hat mich er-
presst«, gab sie schließlich zu und starrte auf den Tisch, die
Hände gefaltet und so angespannt, dass die Knöchel weiß her-
vortraten.
»Sie haben ihn dafür bezahlt, dass er Ihre Bücher schreibt«,
sagte Fineberg.
»Es ging nicht um Geld«, sagte Louisa. »Es ging um das
Ansehen als Autorin. Er wollte, dass auf allen künftigen Bü-
chern unsere beiden Namen erscheinen. Ich habe ihm mehr
Geld geboten, aber daran war er nicht interessiert.«
»Also haben Sie ihn erschossen?«, fragte Fineberg.

»Er hat gesagt, er würde das Manuskript des neuen Buchs
hochbringen, und er würde es mir nur geben, wenn ich eine no-
tariell beglaubigte Erklärung vorzeigen könnte, in der ich mich
verpflichten würde, künftig auch seinen Namen auf dem Buch-
cover zu nennen. Das war zu viel.
Die Leute, die Lektoren, die Kritiker, sie alle würden an-
fangen, über meine früheren Bücher Fragen zu stellen, und
ich konnte mich nicht darauf verlassen, dass Charles nieman-
dem erzählen würde, dass er mir auch schon früher geholfen
hat.«
»Und …?«, hakte Fineberg nach, als Louisa Cormier eine
lange Pause einlegte.
»Als er heraufkam, habe ich den Fahrstuhl angehalten. Das
Manuskript lag in seinen Händen. Er hatte es an seine Brust
gepresst wie ein Baby. Und er wollte, dass es sein Baby bliebe.
Ich habe versucht, vernünftig mit ihm zu reden, habe ihm ver-
sprochen, ich würde ihm helfen, seine eigenen Romane zu ver-
öffentlichen. Er war nicht interessiert. Er hat die Hand ausge-
streckt und auf einen der Fahrstuhlknöpfe gedrückt, und dann
ist es passiert.«
»Sie haben auf ihn geschossen«, stellte Fineberg fest.
»Ich wollte das nicht«, sagte sie. »Ich wollte ihn nur er-
schrecken, ihn warnen, ihn einschüchtern, ihn dazu bringen,
dass er mir das Manuskript gibt. Die Fahrstuhltür hat sich ge-
schlossen und meine Hand erwischt. Er hat nach der Waffe ge-
griffen. Er war wütend. Ein Schuss hat sich gelöst. Die Tür
ging wieder auf. Ich konnte sehen, dass er tot war. Ich habe
wieder auf die Stopptaste des Fahrstuhls gedrückt und ihm das
Manuskript abgenommen.«
»Ein bedauernswerter Unfall«, sagte Pease mit einem brei-
ten Lächeln. »Nein, es war sogar Selbstverteidigung.«
»Warum haben Sie dann die Waffe versteckt?«, fragte Fine-
berg. »Wozu die ganze Vertuschungsgeschichte?«

»Meine Karriere, mein … ich hatte Angst«, sagte Louisa
Cormier.
»Sie hatten nicht vor, ihn umzubringen, aber als es passiert
war, haben Sie sich sofort einen Plan ausgedacht, einen sehr
komplizierten Plan. Sie waren binnen Minuten, vielleicht sogar
binnen Sekunden nachdem Sie Lutnikov erschossen hatten, mit
der Waffe und dem Bolzenschneider unterwegs zum Schieß-
stand«, sagte Fineberg skeptisch.
»Machen Sie ein Angebot, Ms Fineberg«, forderte Pease sie
auf. »Ein gutes Angebot.«
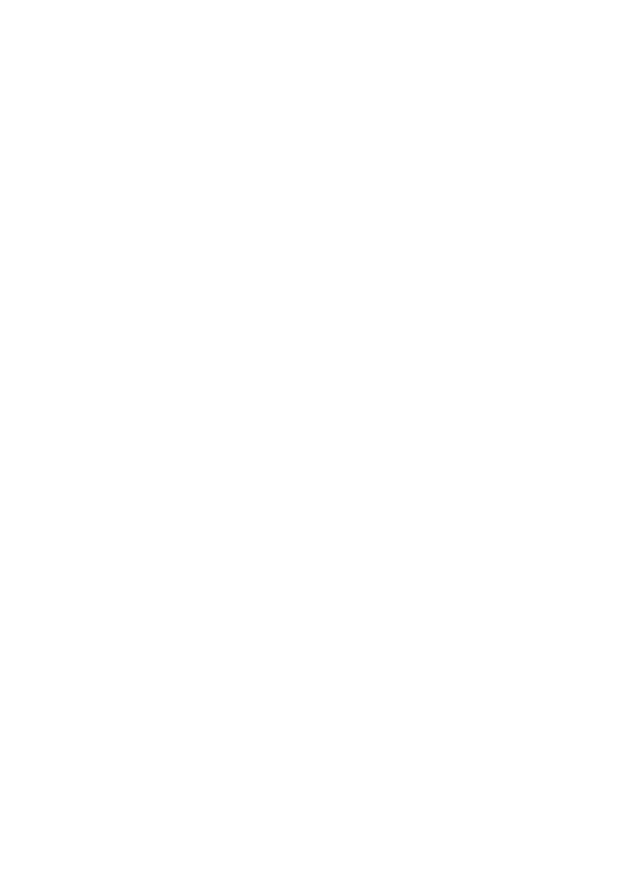
17
»Diese Sache tut mir wirklich Leid, Stevie«, sagte Dario Mar-
co, der hinter seinem Schreibtisch saß. »Du bist ein guter Mit-
arbeiter, ein loyaler Angestellter, ein guter Junge.«
Stevie stand stumm auf einem Bein, das drohte, unter ihm
nachzugeben, und starrte mit offenem Mund den Mann hinter
dem Schreibtisch an, der sein Boss gewesen war, sein Beschützer.
»Das Problem an der Sache ist«, fuhr Marco fort und lehnte
sich dabei zurück, während er sein Jackett glatt strich, »dass
wir der Polizei jemanden liefern müssen. Sie haben das ganze
Haus durchsucht. Sie haben Beweise dafür, dass du in den
Mord an Spanio verwickelt bist und dass du einen Cop umge-
bracht und einen anderen angegriffen hast. Das große Problem
ist, dass du den Cop direkt vor der Tür, durch die du gerade
gekommen bist, kaltgemacht hast. Was soll ich da tun? Das
frage ich dich?«
Stevie sagte nichts.
Marco zuckte mit den Schultern, um anzudeuten, dass er gar
keine Wahl hatte. »Außerdem bist du wirklich ein blöder Mist-
kerl, und du wirst allmählich alt.«
Stevie sah Jake an, der ihn verraten hatte, und dann Helen
Grandfield, deren Miene zu Eis geworden war.
»Lass es uns einfach tun, Dad«, forderte Helen.
»Ich schuldete Stevie eine Erklärung«, sagte Dario geduldig.
»Er ist hergekommen, um dich umzubringen«, konterte sie.
»Du hast Recht. Und er ist eingebrochen, und wir können
von Glück sagen, dass wir eine Waffe haben.«

»Der Jockey hat keinen Waffenschein«, sagte Stevie, wäh-
rend er versuchte nachzudenken.
»Das ist richtig«, sagte Marco. »Er ist ein verurteilter Ver-
brecher. Du bist blöd, aber nicht so blöd. Die Waffe gehört mir.
Ich habe einen Waffenschein dafür. Jacob hat sie von meinem
Schreibtisch genommen. Dort lag sie, weil ich sie gerade ge-
reinigt hatte, als du …«
»Warum?«, fragte Stevie. »Sie haben mich von Anfang an
reingelegt. Sie wollten, dass die Cops hinter mir her sind. Wa-
rum?«
»Als Absicherung«, sagte Dario. »Glaub mir, ich wollte,
dass du davonkommst. Warum sollte ich dich anlügen? Aber in
unserem Geschäft muss man sich den Rücken freihalten. Du
wirst alt, Stevie. Du wirst langsamer. Scheiße, du bist schon
langsamer. Sieh dich doch an. Jetzt bist du in mein Büro einge-
drungen und hast gesagt, du würdest mich umbringen. Vor drei
Zeugen.«
Dario Marco nickte Jacob zu, der Stevie anblickte und zö-
gerte.
»Dich hat er auch reingelegt, Jake«, sagte Stevie.
»Erschieß den alten Langweiler«, sagte Marco.
Der Sprung, mit dem Stevie über den Schreibtisch hechtete,
war eine Überraschung für alle Anwesenden, vermutlich sogar
für Stevie selbst. Als sein Bauch auf den Tisch prallte, verlor er
jegliches Gefühl in seinem verwundeten Bein. Er griff nach
Darios Hals und packte zu. Jetzt würde er tun, was er wirklich
gut konnte, egal, wie blöd er war.
»Schieß«, brüllte Helen.
Jake feuerte und verfehlte sein Ziel. Seine Hand zitterte, a-
ber Stevies nicht. Mit dem Bauch auf dem Schreibtisch liegend
hob er Dario von seinem Stuhl und brach ihm das Genick.
Helen hing an seinem Rücken, rammte ihm die Fingernägel ins
Gesicht und schrie. Jake suchte nach einer freien Schussbahn.

Dann fiel Dario Marcos Körper in sich zusammen. Mit seinem
Kinn blieb er am Rand der Tischplatte hängen. Stevie warf Helen
Grandfield ab. Sie stolperte zurück und stürzte über einen Stuhl.
Stevie versuchte, sich aufzurichten. Er drehte den Kopf zu
Jake um, der zitternd zurückgewichen war und die Waffe mit
beiden Händen festhielt. Stevie hatte keine Chance, sich auf
ihn zu stürzen, ehe ihn die Kugel treffen würde. Er griff in sei-
ne Tasche und umklammerte den Hund, den Lilly ihm ge-
schenkt hatte.
»Aufhören«, rief eine Stimme.
Alle sahen sich um – Jake über seine Pistole, Helen über den
umgestürzten Stuhl und Stevie über seine Schulter. Sie alle
starrten den uniformierten Cop an, der noch vor kurzer Zeit am
Vordereingang gestanden hatte und dem Stevie auf seinem
Weg in das Gebäude ausgewichen war. Der Cop hatte den
Schuss gehört.
Der Cop, der auf den Namen Rodney Landry hörte, war ein
Bodybuilder mit vier Jahren Diensterfahrung. Er wusste, was er
zu tun hatte: Seine Waffe war auf den kleinen Mann neben dem
Schreibtisch gerichtet. Aus dem Dossier mit der Personenbe-
schreibung wusste Landry, dass der Mann mit dem blutenden
Bein, der aus einem unerfindlichen Grund auf dem Schreibtisch
lag, derjenige war, nachdem er hatte Ausschau halten sollen.
Von der Stelle aus, an der Landry mit der Waffe in der Hand
stand, konnte er Dario Marco nicht sehen.
»Legen Sie die Waffe auf den Boden, aber langsam«, befahl
Landry dem Jockey.
Jake bückte sich langsam und legte die Waffe auf dem Bo-
den ab. Auch Stevie schaffte es, sich umzudrehen und auf ei-
nen Ellbogen zu stützen.
»Er ist hier eingebrochen«, kreischte Helen Grandfield und
zeigte mit dem Finger auf Stevie. »Er hat meinen Vater umge-
bracht.«

Nun konnte Landry den Toten erkennen. Was er sah, war
wie ein schlechter Witz, ein Halloweenulk. Das Kinn des toten
Mannes ruhte auf der Schreibtischplatte, und die Augen waren
weit aufgerissen. Sie sahen überrascht aus, sehr überrascht.
Stevie, der sein Bein nicht mehr fühlen konnte, griff wieder
in seine Tasche, umklammerte den bemalten Hund und lächelte.
Ed Taxx ließ sich auf einen Handel ein. Er lieferte Beweise ge-
gen Dario Marco und seine Tochter und erreichte im Gegenzug
dafür die Mindeststrafe für Mord zweiten Grades. Er besprach
die einzelnen Punkte und unterschrieb das Geständnis. Er
kannte den Ablauf und befolgte ihn. Außerdem hatte er genug
Geld auf die Seite gebracht, um seine Familie versorgt zu wis-
sen. Er wollte nicht, dass die Polizei in seinem Leben oder in
seinen Bankkonten herumschnüffelte.
»Ich liefere Ihnen Dario Marco und Helen Grandfield, und
Sie stellen Ihre Ermittlungen in Bezug auf mich oder mein Ei-
gentum ein«, sagte er.
»Und alles, was Sie gegen Anthony Marco in der Hand ha-
ben«, sagte Ward.
»Da habe ich nicht viel.«
»Wir werden nehmen, was Sie uns geben können«, antwor-
tete Ward.
Taxx saß am Tisch, bereit, seine Geschichte zu erzählen.
Ihm gegenüber saßen der stellvertretende Staatsanwalt Ward
und C.S.I.-Ermittler Danny Messer.
»Was kriege ich?«, fragte Taxx.
»Kommt auf Ihre Geschichte an.«
»Die ist gut.«
Helen Grandfield war an ihn herangetreten, hatte ihm aber
nicht erzählt, woher sie wusste, dass er für den Schutz von Al-
berta Spanio abkommandiert worden war oder woher sie wuss-
te, dass er an Prostatakrebs erkrankt war, der bereits all seine

Organe in Mitleidenschaft gezogen hatte. Aber Taxx war es
auch vollkommen egal. Er hatte weder seiner Frau noch sonst
jemandem von der Krankheit erzählt. Er hatte ein bisschen
Geld auf die Seite gebracht, aber die Summe, die seiner Fami-
lie später noch zur Verfügung gestanden hätte, wäre nach ei-
nem sorgenfreien letzten Lebensjahr erheblich zusammenge-
schrumpft. Die Ironie der Geschichte war nun, dass jetzt der
Staat für seine Behandlung aufkommen musste.
Als er Dario Marco getroffen hatte, hatte der ihm einhun-
dertfünfzigtausend Dollar in bar geboten. Dafür sollte er Alber-
ta Spanio eine Überdosis Schlaftabletten verabreichen und da-
für sorgen, dass das Badezimmerfenster, nachdem er den Ring
angeschraubt hatte, offen blieb.
»Warum?«, fragte Ward.
»Helen Grandfield hat mir später erzählt, dass jemand aus
dem Fenster des darüber liegenden Raums hätte abgeseilt wer-
den sollen, aber dass das durch den Sturm nicht möglich sei.
Um drei Uhr morgens sollte ich einen dreiminütigen Hustenan-
fall simulieren, um eventuelle Geräusche zu übertönen.«
Taxx hatte akzeptiert und sein Geld im Voraus erhalten.
»So weit«, sagte er zu dem stellvertretenden Bezirksstaats-
anwalt, mit dem er fünfzehn Jahre zusammengearbeitet hatte,
»gab es keine Probleme.«
»Und dann?«, fragte Ward.
»In der Nacht, in der es passieren sollte, erhielt ich einen An-
ruf«, sagte er. »Mobiltelefon. Collier war ebenfalls im Zimmer.
Ich tat, als wäre es meine Frau. Aber es war Helen Grandfield.
Sie hat mir gesagt, was ich tun sollte: Ich sollte am Morgen die
Tür zu Spanios Zimmer aufbrechen, Collier ins Badezimmer
schicken, um nach dem offenen Fenster zu sehen, und mich
selbst zum Bett umdrehen und Spanio ein Messer in den Hals
rammen. Auch das war kein Problem. Ich habe mir genau über-
legt, was ich in Gegenwart Colliers zu Helen sagen würde. Es

war so was wie ›Nein, Süße, sag ihm, dann muss er neben dem,
was er bereits gebracht hat, noch mal das Doppelte leisten.‹
Während des Telefonats hat Collier sich ein Basketballspiel im
Fernsehen angesehen, aber ich wusste, dass er zugehört hatte.
Helen hat sich einen kurzen Moment lang mit Dario abgespro-
chen und dann gesagt, es wäre in Ordnung. Ich glaube nicht,
dass sie jemals vorhatten, tatsächlich jemanden durch das Fens-
ter abzuseilen. Ich glaube, sie haben sich von Anfang an darauf
verlassen, dass ich Alberta umbringen würde.«
»Und?«
»Spanio war durch die Pillen bewusstlos, als wir die Tür
aufbrachen. Ich habe mich zwischen Collier und dem Bett auf-
gebaut, sodass er sie nicht sehen konnte, und mit dem Kinn
Richtung Badezimmer gedeutet. Collier ist ins Badezimmer ge-
laufen. Ich habe das Messer aus der Tasche gezogen und Al-
berta in den Hals gestoßen. Vier oder fünf Sekunden, höchs-
tens. Collier ist aus dem Badezimmer zurückgekommen. Ich
habe mich vom Bett entfernt, sodass er das Messer in ihrem
Hals sehen konnte. Dann habe ich zugesehen, wie er in das an-
dere Zimmer rannte, um Verstärkung zu rufen.«
»Und da tauchte dann ein Problem auf?«, fragte Ward.
Taxx nickte.
»Ich ging ins Badezimmer. Das Fenster war offen. Mein ers-
ter Gedanke war: ›Bestens, Collier hat es gesehen und denkt,
der Täter wäre durch das Fenster reingekommen und so auch
wieder geflüchtet.‹ Dann ist mir der Schnee aufgefallen, der
sich vor dem Fenster aufgetürmt hatte. Niemand konnte durch
das Fenster kommen, ohne dabei den Schnee wegzuschieben.«
»Und dann ist Ihnen einen Fehler unterlaufen«, sagte Ward.
Wieder nickte Taxx.
»Ich habe den Schnee mit dem Ärmel vom Fenstersims nach
draußen geschoben«, sagte er. »Statt nach innen in die Wanne.
Ich konnte Collier im anderen Zimmer telefonieren hören und

habe das Bad verlassen, ehe er wieder reinkam, um mir zu sa-
gen, dass das Zimmer ein Tatort wäre und wir im anderen
Raum auf die C.S.I.-Ermittler warten sollten. Ich wollte
schließlich nicht riskieren, dass er noch einmal ins Badezim-
mer ging und merkte, dass der Schnee weg war.«
»Und?«, hakte Ward nach.
»Gestern bin ich in ein chinesisches Restaurant gegangen
und habe mich mit Helen Grandfield getroffen«, berichtete
Taxx. »Collier musste einen Verdacht geschöpft haben. Er ist
mir gefolgt. Ich habe ihn auf der anderen Straßenseite gesehen.
Ich dachte, dass er vielleicht mit meiner Frau gesprochen hatte
und nun wusste, dass sie mich nicht am Abend zuvor angerufen
hatte. Oder dass er sich die Tatortfotos angesehen und festge-
stellt hatte, dass der Schnee vor dem Badezimmerfenster ver-
schwunden war.«
»Also haben Sie Helen Grandfield davon erzählt, und die
hat Ihnen versprochen, sie würde sich darum kümmern«, sagte
Ward. »Und sie hat Ihnen auch das restliche Geld gegeben.«
»Dazu habe ich nichts zu sagen«, antwortete Taxx.
»Sie wussten, dass sie Collier töten würden«, verkündete
Ward.
Für einen Augenblick blieb Taxx die Antwort schuldig,
dann sagte er: »Ich möchte darüber nicht nachdenken.«
»Wo ist das Geld, das Sie bekommen haben?«
Wieder verweigerte Taxx die Antwort.
Ed Taxx besaß außer seinen Ersparnissen, und dem Geld,
das er von Dario Marco bekommen hatte, eine Lebensversiche-
rung von fast einer Million Dollar.
Danny schüttelte den Kopf, als er sagte: »Ich werde Stella
informieren.«
Aiden öffnete die oberste Schublade von Louisa Cormiers
Schreibtisch.

»Sie ist nicht da«, sagte sie und blickte zu Mac.
»Jemand muss sie gestohlen haben«, sagte Louisa.
»Besitzen Sie einen Tresor?«, fragte Mac.
Louisa drehte sich zu Pease um, was dieser mit einem Seuf-
zen quittierte.
»Entweder, ihre Klientin öffnet ihn, oder wir tun es«, sagte
Mac. »Ich nehme an, dass er in diesem Raum ist, aber wir kön-
nen …«
»Öffnen Sie ihn, Louisa«, sagte Pease. »Kooperieren Sie.«
Louisa ging zu einem Gemälde von Georgia O’Keeffe, das
eine Blume in leuchtend roten Farben zeigte, und klappte es
zur Seite. Der Tresor befand sich in der Wand hinter dem Bild.
Wieder sah sich Louisa zu Pease um, worauf dieser ihr zu-
nickte und sie damit aufforderte, den Tresor zu öffnen. Sie
schüttelte den Kopf, aber er drängte sie.
»Wir können das regeln«, sagte Pease sanft. »Sie haben in
Notwehr gehandelt.«
Louisa öffnete den Tresor, und Aiden griff mit Handschu-
hen hinein und zog die .22er Walther hervor. Dieses Mal war
sie sicher, dass sie die passende Waffe zu der Kugel im Fahr-
stuhlschacht gefunden hatten.
»Sie haben einen Fehler begangen, den meine Pat Fantome
nie begangen hätte«, sagte Louisa.
»Louisa«, mahnte Pease, aber seine Klientin konnte nicht
widerstehen.
»Sie haben die Seriennummer der Waffe in meiner Schreib-
tischschublade nicht überprüft, als Sie zum ersten Mal hier wa-
ren«, sagte sie. »Sonst hätten Sie sofort festgestellt, dass das
nicht meine Waffe war, sondern dass sie Mathew Drietch ge-
hörte. Aber Sie hatten ja auch keinen Grund dafür. So nahe war
ich dran, es zu schaffen.«
Louisa hielt Daumen und Zeigefinger der rechten Hand ei-
nen knappen Zentimeter voneinander entfernt.

»Charles Lutnikovs Pat Fantome hätte vielleicht die Serien-
nummer überprüft«, stimmte Mac zu. »Aber Pat Fantome ist
nicht real. Wir schon. Wir machen Fehler, aber wir korrigieren
sie auch wieder.«
Dann las er Louisa Cormier die Miranda-Rechte vor.
Die Metallgittertür schwang auf, und Anthony Marco blickte
Ward und Mac entgegen.
»Dieses Mal ohne eine hübsche Frau?«, fragte Marco.
»Sie ist nicht ganz auf dem Posten«, sagte Mac.
»Ich werde ihr Blumen schicken«, entgegnete Marco lä-
chelnd.
»Worum geht es?«, wollte Marcos Anwalt wissen.
»Die Verhandlung geht schnell voran«, sagte Marco. »Und
wir haben einen Deal.«
»Nein, haben wir nicht«, erwiderte Ward. »Wir können auf
die Zusammenarbeit mit Ihnen verzichten.«
Anthony Marco sah sich über die Schulter zu seinem An-
walt um, ehe sein Blick zu Mac und Ward zurückkehrte.
»Was?«, fragte er.
»Kennen Sie einen Steven Guista?«
»Nein«, sagte Anthony und richtete sich auf seinem Stuhl auf.
»Er kennt Sie aber«, sagte Ward. »Er weiß eine Menge über
Sie und Ihren Bruder. Er wurde als Zeuge aufgenommen und
wird aussagen.«
»Gegen mich?«, fragte Anthony erstaunt.
Mac nickte.
»Es heißt, er hätte einen Cop ermordet und einem anderen
die Scheiße aus dem Leib getreten«, sagte Anthony.
»Ich dachte, Sie kennen ihn nicht«, gab Ward zurück.
»Ich habe gelogen.«
»Guistas Zeugenaussage ist wertlos«, sagte Anthonys Anwalt.
»Was haben Sie ihm geboten, damit er einen Meineid leistet?«

»Nichts«, sagte Ward. »Er hat nichts gewollt, und wir haben
ihm nichts angeboten. Sie können ihn selbst fragen, wenn er im
Zeugenstand ist.«
»Ich hatte nichts mit dem Mord an der Spanio zu tun«, be-
harrte Anthony. »Das war Darios Idee.«
»Ihr Bruder ist tot«, sagte Mac.
»Nein«, empörte sich Anthony.
»Ihr Anwalt kann Ihnen das mit einem Anruf bestätigen«,
sagte Mac.
»Dario ist tot? Dieser dumme Hurensohn, lässt mich einfach
mit … dürfen die das? Dürfen die mir das antun?«, fragte An-
thony seinen Anwalt.
Der Anwalt antwortete nicht.

Epilog
Der Schneefall hatte aufgehört, nicht aber die bittere Kälte.
Mac stand mit gesenktem Kopf da und hielt die Beine ge-
spreizt, um den immer wieder auftretenden Böen zu trotzen,
die ihn von Claires Grab fortwehen wollten. Nur die Spitzen
der Grabsteine stachen aus der Schneedecke hervor, und Mac
erinnerte sich, dass es hier einige Gräber gab, die nur eine
schlichte Messingplatte besaßen und nun einen halben Meter
tief unter dem Schnee begraben waren.
Der Schneepflug hatte sich vorsichtig vorangetastet. Mr
Greenberg, der die Räumung arrangiert hatte, war gekommen
und hatte die Arbeiten beaufsichtigt. Er hatte den Schneepflug
angewiesen, einen Pfad vom Parkplatz aus durch den Schnee
freizuschaufeln.
Der sanfte Wind ließ in der Kälte sein klagendes Lied erklin-
gen und durchbrach die friedliche Stille des Morgens. Mac hielt
Blumen in den Händen und spürte, wie der Wind an dem Strauß
aus Rosen zerrte. Nur mit Mühe hatte er den bunten Strauß – ro-
te, rosa, weiße und gelbe Rosen – beschaffen können.
Greenberg war ein dünner kleiner Mann von mindestens
sechzig Jahren. Er hatte rote Wangen und trug einen zu großen
Mantel. Er hielt sich diskret im Hintergrund, die Hände vor
dem Leib gefaltet. Mac ging ein paar Schritte näher an das
Grab heran.
Hinter sich hörte er das Geräusch eines Fahrzeugs, das von
den Friedhofstoren zu der Parkfläche fuhr, auf der auch er sein
Auto abgestellt hatte.

Er drehte sich nicht um. Er stand nun direkt neben dem
Grabstein und las die eingemeißelten Worte. Er hörte Schritte
auf dem schmalen Weg, und dann drehte er sich um. Don
Flack, Aiden, Stella und Danny kamen auf ihn zu. Stella stützte
sich auf Dannys Arm.
»Du solltest im Krankenhaus sein«, sagte Mac, als sie näher
kamen.
»Das ist dein Jahrestag«, antwortete Stella. »Den wollte ich
nicht verpassen.«
Sie versammelten sich um das Grab, und Mac kniete nieder,
um die Blumen vor den Stein zu legen, der ihnen ein wenig
Schutz vor dem Wind bot.
Greenberg trat rasch heran und befestigte die Blumen mit
einem glatten, runden Stein. Dann erhob er sich wieder und
reichte jedem der Anwesenden einen kleinen Stein.
»Wenn Sie mögen«, sagte Greenberg. »Das ist eine Traditi-
on. Wir legen jedes Jahr zur Erinnerung einen Stein auf das
Grab eines geliebten Menschen.«
Mac sah den kleinen braunen Stein in seiner Hand an und
legte ihn auf den Granitgrabstein. Stella, Aiden, Danny und
Flack taten das Gleiche. Dann gingen alle bis auf Mac einige
Schritte zurück.
Es gab nichts zu sagen. Es war nicht nötig, irgendetwas zu
sagen. Eine Weile, es schien wie eine Ewigkeit, stand er da,
ehe er sich umwandte und zu den anderen ging, um mit ihnen
zum Parkplatz zurückzukehren.
Document Outline
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
CSI NY Kaminsky, Stuart M Blutige Spur
Vance, Jack Der Mann Ohne Gesicht
Heyne 3448 Vance, Jack Durdane 1 Der Mann Ohne Gesicht
Vance, Jack Durdane 1 Der Mann Ohne Gesicht
Utopia Classics 73 Lin Carter Der Mann Ohne Planet
Dunn, Carola Miss Daisy 06 Miss Daisy und der Tote auf dem Wasser
CSI NY poradnik do gry
Carter, Lin Der Mann Ohne Planet
Bellin Eva Der Tote im Grandhotel
Blaulicht 193 Siebe, Hans Der Tote im Strandbad
Blaulicht 231 Siebe, Hans Der Tote im fünften Stock
Granger, Ann Fran Varady 01 Nur der Tod ist ohne Makel
Charmed 19 Phoebe & Cole Gesichter der Liebe Tabea Rosenzweig & Sergej Koenig
Brisard, Jean Charles Das neue Gesicht der Al Qaida
Gegenstand der Syntax
60 Rolle der Landeskunde im FSU
Ny i Norge Tekstbok Leksjon 12
Zertifikat Deutsch der schnelle Weg S 29
Fieber ohne Focus
więcej podobnych podstron