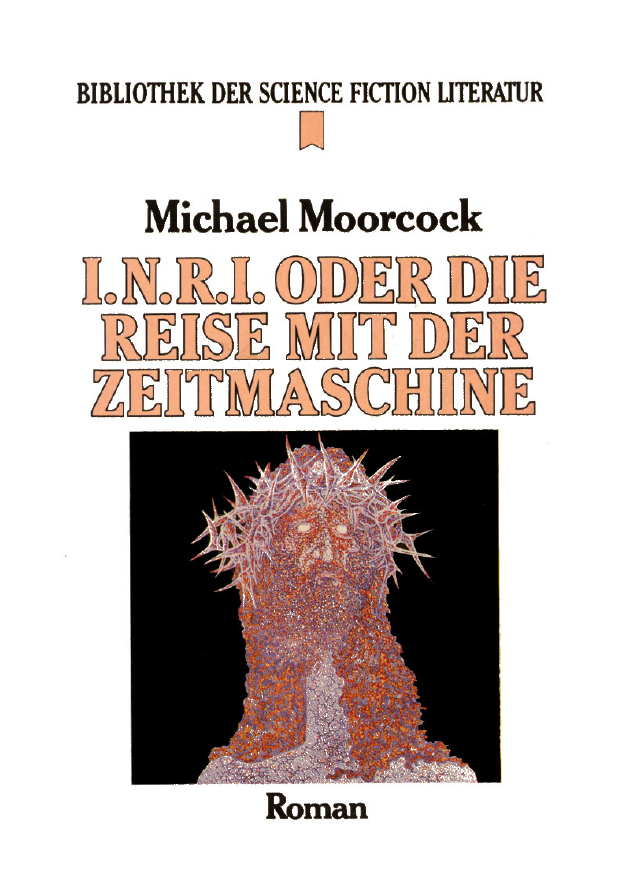

MICHAEL MOORCOCK
I.N.R.I.
ODER
DIE REISE MIT DER
ZEITMASCHINE
Science Fiction Roman
Sonderausgabe
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
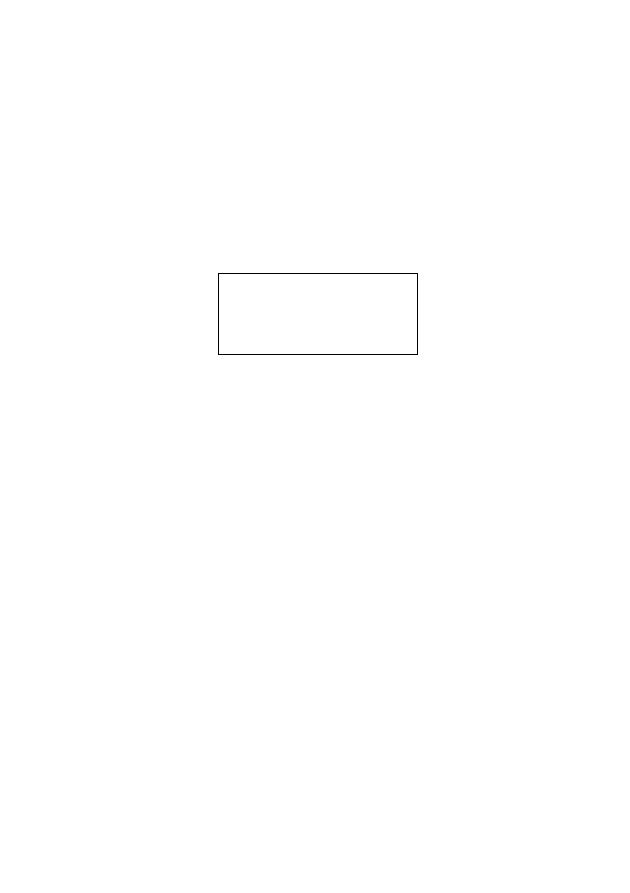
BIBLIOTHEK DER SCIENCE FICTION LITERATUR
Band 06/63
Titel der englischen Originalausgabe
BEHOLD THE MAN
Deutsche Übersetzung von Alfred Scholz
Das Titelbild schuf Helmut Wenske
Sonderausgabe des
HEYNE-BUCHS
Band 06/3399
Redaktion: Wolfgang Jeschke
Copyright © 1970 by Michael Moorcock
Copyright © 1972 der deutschen Übersetzung by Marion
von Schröder Verlag GmbH, Hamburg und Düsseldorf
Printed in Germany 1987
Umschlaggestaltung: Atelier Ingrid Schütz, München
Satz: Schaber, Wels Druck und Bindung:
Presse-Druck, Augsburg
Scanned by RedStarBurner
ISBN 3-453-31348-8

ERSTER TEIL
1
Die Zeitmaschine ist eine mit einer milchigen Flüssigkeit
gefüllte Kugel, und der in einem Gummianzug steckende
Reisende schwimmt darin und atmet durch eine Maske,
die über einen Schlauch mit der Wand der Maschine ver-
bunden ist.
Die Kugel platzt bei der Landung auf, und die auslaufen-
de Flüssigkeit versickert im Staub. Die Kugel setzt sich in
Bewegung und rollt polternd und springend über kahlen
Felsboden.
Oh, Herr Jesus! O Gott!
Oh, Herr Jesus! O Gott!
Oh, Herr Jesus! O Gott!
Oh, Herr Jesus! O Gott!
Herrgott! Was geschieht mit mir?
Ich bin im Arsch. Ich bin erledigt.
Das verdammte Ding funktioniert nicht.
Oh, Herr Jesus! O Gott! Wann hört das verfluchte Ding
auf zu springen?
Karl Glogauer rollt sich zusammen. Der Flüssigkeits-
spiegel fällt, und er sinkt auf das elastische Plastikmaterial,
mit dem die Maschine ausgekleidet ist.
Die kryptographischen, unkonventionellen Instrumente
geben kein Geräusch von sich, rühren sich nicht. Die
– 4 –

Kugel kommt allmählich zur Ruhe, während der letzte
Rest der Flüssigkeit durch den breiten Riß in der Wand
hinausrinnt.
Warum tat ich es? Warum tat ich es? Warum tat ich es?
Warum tat ich es? Warum tat ich es? Warum tat ich es?
Schnell öffnen und schließen sich Glogauers Augen,
dann weitet sich sein Mund wie zu einem Gähnen, seine
Zunge flattert, und er gibt ein Stöhnen von sich, das sich
in ein Heulen verwandelt.
Er hört das Heulen und denkt abwesend: Die Stimme
der Zungen, die Sprache des Unbewußten… Aber er kann
nicht hören, was er sagt.
Luft zischt, und das Plastikfutter sinkt, bis Glogauer mit
dem Rücken auf der Metallwand liegt. Er hört auf zu
schreien und sieht den ausgezackten Riß in der Wand an;
er ist nicht neugierig, was dahinter liegt. Er versucht sei-
nen Körper zu bewegen, aber der ist vollkomme gefühl-
los. Es fröstelt ihn, als er die kalte Luft spürt, die durch
die aufgeplatzte Wand der Zeitmaschine hereinweht. Es
scheint Nacht zu sein.
Seine Reise durch die Zeit war schwierig. Selbst die dicke
Flüssigkeit hat ihn nicht ausreichend geschützt, obwohl
sie ihm zweifellos das Leben gerettet hat. Einige Rippen
sind vielleicht gebrochen.
Schmerzen kommen mit diesem Gedanken. Aber er ent-
deckt, daß er Arme und Beine tatsächlich ausstrecken
kann.
Er kriecht über die schlüpfrige Wandfläche zu dem Riß
hin. Er keucht, verschnauft und kriecht weiter.
– 5 –

Er wird bewußtlos, und als er wieder zu sich kommt, ist
die Luft wärmer. Durch den Riß sieht er grelles Sonnen-
licht und einen stählern schimmernden Himmel. Er
zwängt sich halb durch den Riß hinaus und schließt die
Augen, als ihn das starke Sonnenlicht voll trifft. Er verliert
wieder das Bewußtsein.
Schuljahr 1949, Winter
Er war neun Jahre alt, geboren zwei Jahre nachdem sein
Vater aus Österreich nach England gekommen war.
Die anderen Kinder auf dem mit grauem Kies bestreuten
Spielplatz der Schule schrien vor Lachen; sie spielten ein
Spiel. Am Rande des Spielplatzes lagen noch kleine
Haufen schmutzigen Eises. Hinter dem Zaun hoben sich
die häßlichen Häuser von Süd-London schwarz vor dem
kalten Winterhimmel ab.
Das Spiel hatte ernst genug angefangen, und Karl hatte
ein wenig ängstlich selbst die Rolle vorgeschlagen, die er
spielen wollte. Zuerst hatte er die Beachtung genossen,
aber jetzt weinte er.
»Laßt mich runter! Bitte, Mervyn, hör auf!«
Sie hatten ihn mit ausgebreiteten Armen am Drahtge-
flecht des Spielplatzzauns festgebunden. Der Zaun beulte
sich unter seinem Gewicht nach außen, und einer der
Pfähle drohte nachzugeben. Er versuchte seine Füße frei-
zubekommen.
»Laßt mich runter!«
Mervyn Williams, der Junge mit dem roten Gesicht, der
das Spiel vorgeschlagen hatte, begann an dem Pfahl zu wa-
– 6 –

ckeln, so daß Karl an dem Drahtgeflecht hin- und herge-
schaukelt wurde.
»Hör auf! Hilf mir doch einer!«
Sie lachten wieder, und er erkannte, daß seine Schreie
sie nur noch mehr anfeuerten, also biß er die Zähne zu-
sammen. Tränen rollten ihm über das Gesicht, und er
fühlte sich verwirrt und betrogen. Er hatte alle für
Freunde gehalten; er hatte einigen von ihnen bei ihren
Aufgaben geholfen, anderen Bonbons gekauft, einigen
Mitleid gezeigt, als sie unglücklich waren. Er hatte ge-
glaubt, sie mochten ihn, bewunderten ihn. Warum hatten
sie sich gegen ihn gewandt – selbst Molly, die ihm ihre Ge-
heimnisse anvertraut hatte?
»Bitte!« schrie er. »Das gehörte nicht zu dem Spiel!«
»Jetzt tut es das!« lachte Mervyn Williams mit leuchten-
den Augen und rotem Gesicht, während er noch kräftiger
an dem Pfahl rüttelte. Eine Weile ließ sich Karl das Schau-
keln noch gefallen, dann ließ er sich instinktiv zusammen-
sacken und täuschte Bewußtlosigkeit vor. Er hatte so et-
was schon früher gemacht, um seine Mutter zu erpressen,
von der er den Trick gelernt hatte.
Die Schulkrawatten, die sie als Fesseln benutzt hatten,
schnitten ihm in die Handgelenke. Er hörte, wie die
Kinder leiser wurden.
»Ist ihm nicht gut?« flüsterte Molly Turner. »Er ist doch
nicht tot, oder…?«
»Red keinen Quatsch!« antwortete Williams unsicher. »Er
macht bloß Spaß.«
»Wir sollten ihn aber trotzdem lieber runterholen.« Das
war Ian Thompsons Stimme. »Wir kommen in Teufels Kü-
che, wenn…«
– 7 –
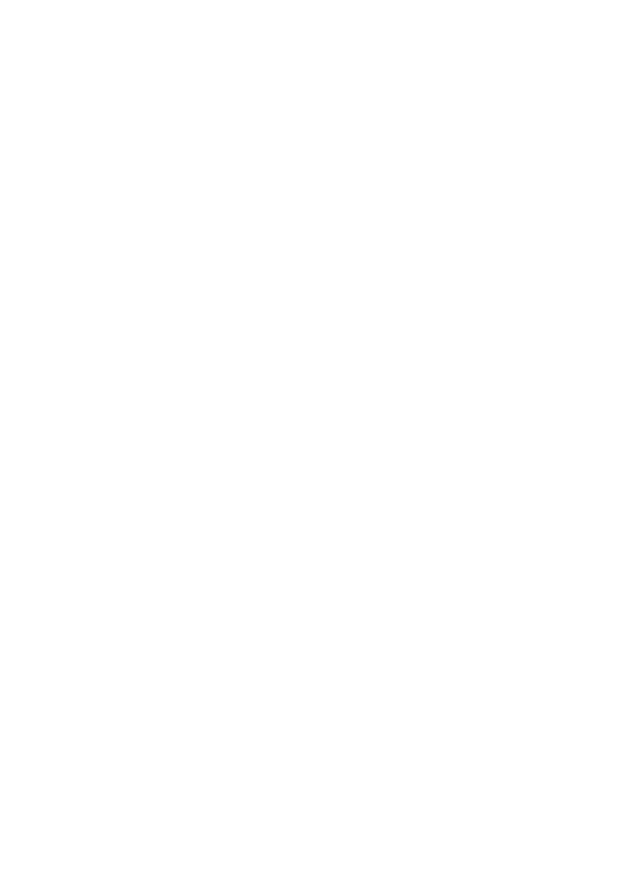
Er spürte, wie sie ihn losbanden, wie ihre Finger an den
Knoten zerrten.
»Ich kann diesen nicht aufkriegen…«
»Hier ist mein Taschenmesser – schneid ihn durch!«
»Das kann ich nicht – es ist meine Krawatte – mein Vater
würde mich…«
»Beeil dich, Brian!«
An der letzten Krawatte hängend, ließ er sich absichtlich
sacken und behielt die Augen fest geschlossen.
»Gib es mir! Ich schneide sie durch.«
Als die letzte Fessel nachgab, ließ er sich auf die Knie
fallen, zerschrammte sie sich auf dem Kies und fiel dann
vornüber zu Boden.
»Ich werd' verrückt, er ist wirklich…«
»Red kein dummes Zeug – er atmet noch. Er ist nur be-
wußtlos.«
Aus der Ferne, weil er von seiner Täuschung selbst halb
überzeugt war, hörte er ihre besorgten Stimmen.
Williams schüttelte ihn.
»Wach auf, Karl! Hör auf mit dem Quatsch!«
»Ich hole Mr. Matson«, sagte Molly Turner.
»Nein, nich…«
»Es ist sowieso ein gemeines Spiel.«
»Komm zurück, Molly!«
Den größten Teil seiner Aufmerksamkeit verlangten jetzt
die Kiessplitter, die in die linke Seite seines Gesichts
schnitten. Er fand es leicht, die Augen geschlossen zu hal-
ten und ihre Hände an seinem Körper zu ignorieren. All-
mählich verlor er das Gefühl für die Zeit. Dann hörte er
aus dem allgemeinen Gemurmel Mr. Matsons Stimme her-
– 8 –
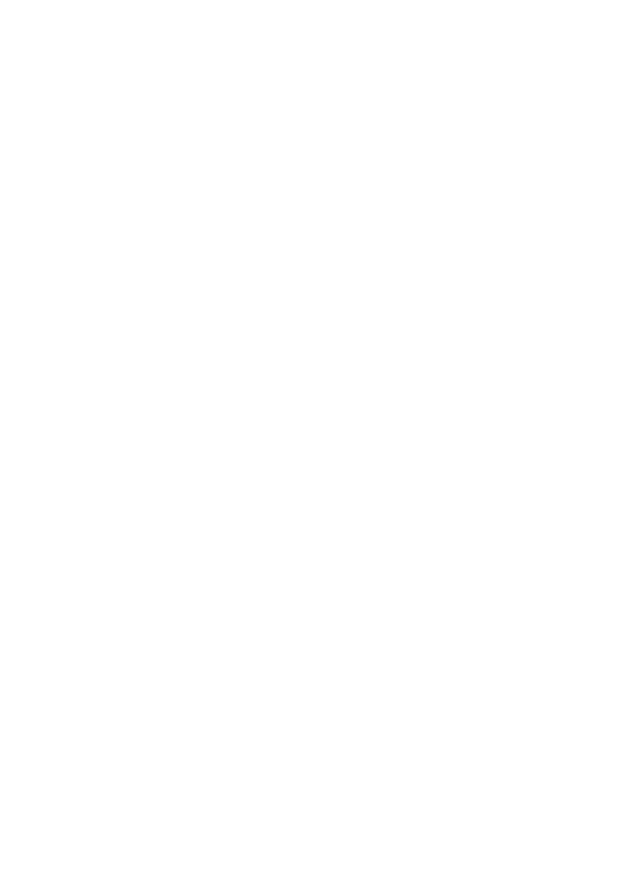
aus. Sie klang tief, sardonisch und unbeirrt wie immer. Es
wurde still.
»Was in aller Welt hast du diesmal angestellt, Williams?«
»Nichts, Sir. Es war ein Spiel. Es war zum Teil Karls
eigene Idee.«
Schwere männliche Hände drehten ihn um. Es gelang
ihm immer noch, die Augen geschlossen zu halten.
»Es war ein Spiel, Sir«, sagte lan Thompson. »Jesus. Karl
war Jesus. Wir haben es schon öfter gespielt, Sir. Wir
fesselten ihn an den Zaun. Es war seine Idee, Sir.«
»Nicht ganz zur Jahreszeit passend«, murmelte Mr.
Matson und seufzte, während er Karls Stirn befühlte.
»Es war nur ein Spiel, Sir«, sagte Mervyn Williams wieder.
Mr. Matson prüfte seinen Puls. »Du hättest klüger sein
können, Williams. Glogauer ist kein sehr kräftiger Junge.«
»Es tut mir leid, Sir.«
»Wirklich eine große Dummheit.«
»Es tut mir leid, Sir.« Williams war jetzt den Tränen nahe.
»Ich werde ihn zur Vorsteherin bringen. Ich hoffe um
deinetwillen, Williams, daß ihm nichts Ernstliches passiert
ist. Melde dich nach der Schule im Gemeinschaftsraum
bei mir!«
Karl spürte, wie Mr. Matson ihn aufhob.
Er war befriedigt.
Er wurde weggetragen.
Sein Kopf und seine Seite schmerzten so sehr, daß er das
Gefühl hatte, er müßte sich übergeben. Es war ihm nicht
möglich gewesen, genau festzustellen, wohin die Zeitma-
schine ihn gebracht hatte, aber als er den Kopf drehte und
– 9 –

die Augen öffnete, erkannte er an dem schmutzigen Schaf-
fellwams und dem baumwollenen Lendentuch des
Mannes zu seiner Rechten, daß er fast mit Sicherheit im
Nahen Osten war.
Er hatte beabsichtigt, im Jahre 29 n. Chr. in der Wüste
hinter Jerusalem, unweit von Bethlehem zu landen. Ob
sie ihn jetzt wohl nach Jerusalem trugen?
Er war wahrscheinlich in der Vergangenheit, denn die
Bahre, auf der sie ihn trugen, war offensichtlich aus nicht
besonders gut gegerbten Tierfellen gemacht. Aber viel-
leicht auch nicht, dachte er, denn er hatte genug Zeit in
den kleinen Stammessiedlungen im Nahen Osten zuge-
bracht, um zu wissen, daß es noch Menschen gab, die ihre
Lebensgewohnheiten seit Mohammeds Zeiten kaum ge-
ändert hatten. Er hoffte, er hätte sich nicht umsonst die
Rippen gebrochen.
Zwei Männer trugen die Bahre auf ihren Schultern, wäh-
rend andere auf beiden Seiten daneben hergingen. Sie
waren alle bärtig und dunkelhäutig und trugen Sandalen.
Die meisten trugen Stäbe. Er roch Schweiß und Tierfett
und einen muffigen Geruch, den er nicht identifizieren
konnte. Sie schritten auf eine ferne Hügelkette zu und
hatten sein Erwachen nicht bemerkt.
Die Sonne war nicht mehr so stark wie zu der Zeit, als er
aus der Zeitmaschine gekrochen war. Es war vielleicht
Abend. Das Gelände war felsig und kahl, und selbst die
Hügel vor ihnen sahen grau aus.
Er wimmerte, wenn die Bahre schaukelte, und stöhnte,
als die Schmerzen in seiner Seite wieder nahezu unerträg-
lich wurden. Zum zweitenmal wurde er bewußtlos.
Vater unser, der du bist im Himmel…
– 10 –

Er war wie die meisten seiner Mitschüler zu einem ge-
wissen Lippenbekenntnis zur christlichen Religion erzo-
gen worden. Morgendliche Gebete in der Schule. Er hatte
sich angewöhnt, zwei Gebete am Abend zu sprechen. Das
eine war das Vaterunser, und das andere lautete: »Gott
segne Mami, Gott segne Papi, Gott segne meine
Schwestern und Brüder und all die lieben Menschen, die
mich umgeben, und Gott segne mich! Amen.« Das hatte
ihm eine Frau beigebracht, die sich eine Zeitlang um ihn
kümmerte, wenn seine Mutter zur Arbeit war. Er hatte
dem selbst noch eine Reihe von Danksagungen (»Danke
dir für den schönen Tag, danke dir dafür, daß ich die
Fragen in Geschichte richtig beantwortet habe…«) und
Entschuldigungen hinzugefügt (»Verzeih, daß ich häßlich
zu Molly Turner war, verzeih, daß ich Mr. Matson nicht
die Wahrheit gesagt habe…«). Er war siebzehn Jahre alt,
bevor es ihm möglich war, ohne dieses Gebetsritual einzu-
schlafen, und selbst dann war es nur seine Ungeduld, zum
Masturbieren zu kommen, die die Gewohnheit schließlich
durchbrach.
Vater unser, der du bist im Himmel…
Seine letzte Erinnerung an seinen Vater war mit einem
Urlaub an der See verbunden. Er war vier oder fünf ge-
wesen. Damals war Krieg, die Züge waren voll von Solda-
ten. Sie hatten oft gehalten und waren oft umgestiegen. Er
erinnerte sich, daß sie über Geleise gegangen waren, um
auf einen anderen Bahnsteig zu kommen, und er hatte
seinen Vater gefragt, was die Waggons enthielten, die im
– 11 –

Sonnenschein neben ihnen verschoben wurden. Hatte es
da nicht einen Witz gegeben? Etwas mit Giraffen?
Er hatte seinen Vater als einen großen, starken Mann in
Erinnerung. Seine Stimme war freundlich gewesen,
vielleicht ein wenig traurig, und in seinem Blick hatte et-
was Melancholisches gelegen.
Er wußte jetzt, daß sich seine Eltern um jene Zeit ge-
trennt hatten und seine Mutter seinem Vater diesen letz-
ten Urlaub mit ihm zugestanden hatte. War es in Devon
oder in Cornwall? Was er von Kliffs, Felsen und Strand in
Erinnerung hatte, schien mit Landschaften im Westen des
Landes übereinzustimmen, die er seither im Fernsehen
gesehen hatte.
Er hatte in seinem Obstgarten gespielt, in dem es von
Katzen wimmelte. Darin hatte auch ein ausgedienter Ford
gestanden, in dem Unkraut wuchs. Das Bauernhaus, in
dem sie gewohnt hatten, war auch voll von Katzen ge-
wesen; ein Meer von Katzen, das Stühle, Tische und Kom-
moden überschwemmte.
Am Strand war Stacheldraht gewesen, aber er hatte nicht
erkannt, daß er die Landschaft verschandelte. Es hatte
Brücken und Statuen aus Sandstein gegeben, die Wind
und Wasser geformt hatten. Es hatte rätselvolle Höhlen
gegeben, aus denen Wasser lief.
Es war fast die früheste und gewiß die glücklichste Er-
innerung an seine Kindheit.
Er sah seinen Vater nie wieder.
– 12 –

Gott segne Mami, Gott segne Papi…
Es war blödsinnig. Er hatte keinen Papi, hatte keine
Brüder und Schwestern.
Die alte Frau hatte ihm erklärt, daß sein Papi irgendwo
sein müßte und daß alle Mitmenschen Brüder oder
Schwestern seien.
Er hatte das akzeptiert.
Einsam, dachte er. Ich bin einsam. Er erwachte kurz und
dachte, er sei im Anderson-Luftschutzbunker mit dem röt-
lichen Stahlblechdach und den Drahtgitterwänden, und es
sei Fliegeralarm. Er hatte sich in der Geborgenheit des
Andersonbunkers immer wohl gefühlt. Es hatte Spaß ge-
macht, hineinzukriechen.
Aber die Stimmen sprachen eine fremde Sprache. Es war
wahrscheinlich Nacht, denn es schien sehr dunkel zu sein.
Sie waren nicht mehr auf dem Marsch. Ihm war heiß. Er
hatte Stroh unter sich. Er betastete das Stroh und fühlte
sich erleichtert, ohne zu wissen warum. Er schlief ein.
Schreien. Spannung.
Seine Mutter schrie oben Mr. George an. Mr. George
und seine Frau hatten die beiden Hinterzimmer des
Hauses gemietet.
Er rief zu seiner Mutter hinauf.
»Mami! Mami!«
Ihre hysterische Stimme: »Was ist los?«
»Ich möchte, daß du kommst.«
Er wollte, daß sie aufhörte.
»Was ist los, Karl? Jetzt hast du das Kind aufgeweckt!«
– 13 –

Sie erschien über ihm auf dem Treppenabsatz, zog ihren
Morgenmantel fester um sich und lehnte sich dramatisch
über das Geländer.
»Mami, was ist passiert?«
Sie verharrte einen Augenblick so, als überlegte sie, und
klappte dann zusammen und rollte langsam die Treppe
herunter. Sie lag jetzt am Fuß der Treppe auf dem
dunklen, abgetretenen Teppich. Er schluchzte und zerrte
an ihren Schultern, aber sie war zu schwer für ihn. Er war
von Panik erfaßt. »Oh, Mami!«
Mr. George kam mit schweren Schritten die Treppe her-
unter. Er wirkte resigniert. »Oh, zum Teufel!« sagte er.
»Greta!«
Karl sah ihn wütend an.
Mr. George sah Karl an und schüttelte den Kopf. »Es
fehlt ihr nichts, mein Sohn. Komm, Greta, wach auf!«
Karl stand zwischen Mr. George und seiner Mutter. Mr.
George zuckte die Achseln und schob ihn beiseite, bückte
sich dann und stellte Karls Mutter auf die Beine. Ihr
langes, schwarzes Haar fiel über ihr schönes, gehetztes
Gesicht. Sie öffnete die Augen, und selbst Karl war über-
rascht, daß sie so schnell aufgewacht war.
»Wo bin ich?« fragte sie.
»Komm, komm, Greta! Dir fehlt nichts.«
Mr. George führte sie wieder die Treppe hinauf.
»Was ist mit Karl?« fragte sie.
»Mach dir um den keine Sorgen!«
Sie verschwanden.
Das Haus war jetzt still. Karl ging in die Küche. Ein
Bügelbrett war aufgestellt, mit einem Bügeleisen darauf.
– 14 –

Auf dem Herd kochte etwas. Es roch nicht sehr gut. Es war
wahrscheinlich etwas, was Mrs. George kochte.
Er hörte jemanden die Treppe herunterkommen und
rannte durch die Küche in den Garten hinaus.
Er weinte. Er war sieben.
– 15 –

2
Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der
Wüste des jüdischen Landes und sprach: Tut Buße, das
Himmelreich ist nahe herbeigekommen! Und er ist der,
von dem der Prophet Jesaja gesagt hat und gesprochen:
»Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet
dem Herrn den Weg und machet richtig seine Steige!« Er
aber, Johannes, hatte ein Kleid von Kamelhaaren und
einen ledernen Gürtel um seine Lenden; seine Speise aber
war Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm
hinaus die Stadt Jerusalem und das ganze jüdische Land
und alle Länder an dem Jordan und ließen sich taufen
von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden.
Matthäus 3, 1-6
Sie wuschen ihn.
Er spürte das kalte Wasser über den Körper laufen und
schnappte nach Luft. Sie hatten ihm seinen Schutzanzug
ausgezogen, und es lagen jetzt dicke Lagen Schaffell um
seine Brust, mit Lederbändern festgebunden.
Er hatte weniger Schmerzen, aber er fühlte sich sehr
schwach und heiß. Die geistige Verwirrung der Wochen
vor seinem Einstieg in die Zeitmaschine, die Reise selbst
und jetzt das Fieber machten es ihm schwer zu verstehen,
was mit ihm vorging. Alles war seit so langer Zeit wie ein
Traum gewesen. Er konnte immer noch nicht wirklich an
die Zeitmaschine glauben. War er vielleicht nur von
irgend etwas high? Sein Sinn für die Realität war nie be-
sonders stark gewesen; während des größten Teils seiner
– 16 –

Jugend und seines Lebens als Erwachsener hatten es ihm
nur gewisse Instinkte ermöglicht, sich sein körperliches
Wohlbefinden zu erhalten. Doch das über ihn fließende
Wasser, die Berührung des Schaffells um seine Brust, das
Stroh unter ihm, das alles war von einer deutlicheren
Realität als alles, was er seit seiner Kindheit erfahren
hatte.
Er war in einem Gebäude – oder vielleicht in einer
Höhle, es war zu dunkel, das zu erkennen –, und das
Stroh war von dem Wasser durchnäßt.
Zwei Männer in Sandalen und Lendentüchern gossen
aus irdenen Krügen Wasser über ihn. Einer trug ein über
die Schulter zurückgeworfenes Stück Baumwollzeug.
Beide hatten sie dunkle, semitische Gesichtszüge, große
dunkle Augen und volle Barte. Ihre Gesichter blieben
ausdruckslos, selbst als sie innehielten und er zu ihnen
aufsah. Für einige Augenblicke starrten sie ihn an und
hielten die Wasserkrüge vor ihrer behaarten Brust.
Glogauers Kenntnisse der alten aramäischen Schriftspra-
che waren gut, aber er war nicht sicher, ob er die Sprache
gut genug sprechen konnte, um sich verständlich zu ma-
chen. Er würde es zuerst mit Englisch versuchen, denn es
wäre lächerlich, wenn er doch nicht durch die Zeit gereist
wäre und versuchte, mit modernen Israelis oder Arabern
in einer arabischen Sprache zu reden.
Er fragte schwach: »Sprechen Sie Englisch?«
Einer der Männer runzelte die Stirn, und der andere, der
mit dem Baumwollumhang, verzog das Gesicht, sprach
ein paar Worte zum anderen und lachte dann. Der andere
antwortete in ernsterem Ton.
– 17 –

Glogauer glaubte ein paar Wörter zu erkennen und lä-
chelte nun selbst. Sie sprachen das alte Aramäisch. Er war
ganz sicher. Er war gespannt, ob es ihm gelingen würde,
einen Satz zu bilden, den sie verstehen würden.
Er räusperte sich. Er befeuchtete seine Lippen. »Wo –
sein – dieser – Ort?« fragte er unbeholfen.
Jetzt runzelten sie beide die Stirn, schüttelten die Köpfe
und stellten ihre Wasserkrüge auf den Boden.
Glogauer fühlte seine Energie schwinden und sagte
eindringlich: »Ich – suchen – ein Nazarener – Jesus…«
»Nazarener. Jesus.« Der größere der beiden wiederholte
die Worte, aber sie schienen ihm nichts zu bedeuten. Er
zuckte die Achseln.
Aber der andere wiederholte nur das Wort Nazarener
und sprach es langsam aus, so als hätte es eine besondere
Bedeutung für ihn. Er sprach leise ein paar Worte zu dem
anderen Mann und ging dann weg.
Glogauer richtete sich mühsam ein wenig auf und
winkte dem zurückgebliebenen Mann, der ihn voller
Verwunderung ansah.
»Welches – Jahr«, fragte Glogauer langsam, »sitzt – der
römische Kaiser – in Rom?«
Es war eine verwirrende Frage, die er da gestellt hatte,
wurde ihm klar. Christus war im fünfzehnten Regierungs-
jahr des Tiberius gekreuzigt worden, und deshalb hatte er
die Frage gestellt. Er versuchte sie besser zu formulieren.
»Wie viele – Jahre – regiert Tiberius?«
»Tiberius?« Der Mann furchte die Stirn.
Glogauers Ohr gewöhnte sich schon an den Klang der
Sprache, und er bemühte sich, ihn besser nachzuahmen.
– 18 –

»Tiberius. Der Kaiser der Römer. Wie viele Jahre regiert er
schon?«
»Wie viele?« Der Mann schüttelte den Kopf. »Ich weiß
nicht.«
Wenigstens war es ihm gelungen, sich verständlich zu
machen, dachte Glogauer. Sein sechsmonatiges Studium
der aramäischen Sprache im Britischen Museum war also
doch von Nutzen gewesen. Diese Sprache war anders –
vielleicht zweitausend Jahre älter –, und sie lehnte sich
mehr ans Hebräische an, aber es war erstaunlich leicht ge-
wesen, sich mit dem Mann zu verständigen. Er dachte dar-
an, wie seltsam es ihm vorgekommen war, daß er gerade
diese Sprache müheloser gelernt hatte als andere. Der
eine oder andere seiner etwas übergeschnappten Freunde
hatte angedeutet, daß ihm die Erinnerungen seiner Rasse
dabei geholfen haben könnten. Manchmal war er fast
selbst davon überzeugt gewesen.
»Wo ist dieser Ort?« fragte er.
Der Mann sah ihn überrascht an. »Aber, es ist die Wüste«,
sagte er. »Die Wüste hinter Machärus. Weißt du das
nicht?«
In biblischer Zeit war Machärus eine große Stadt südöst-
lich von Jerusalem, auf der anderen Seite des Toten Mee-
res. Sie war am Hang eines Berges erbaut, im Schutze
einer
prächtigen,
von
Herodes
Antipas
gebauten
Burganlage. Wieder spürte Glogauer seine Stimmung
steigen. Im zwanzigsten Jahrhundert würden nur wenige
den Namen Machärus gekannt, geschweige denn ihn als
Orientierungshilfe benutzt haben.
Es war fast kein Zweifel möglich, daß er in der Vergang-
enheit war und daß die Zeit irgendwo in der Regierungs-
– 19 –

zeit von Tiberius lag, wenn der Mann, mit dem er gespro-
chen hatte, nicht völlig ungebildet war und keine Ahnung
hatte, wer Tiberius war.
Aber hatte er die Kreuzigung verpaßt? War er zur fal-
schen Zeit gekommen?
Wenn ja, was sollte er dann jetzt tun? Denn seine Zeit-
maschine war beschädigt, ließ sich vielleicht nicht mehr
reparieren.
Er ließ sich aufs Stroh zurücksinken und schloß die
Augen. Wieder einmal packte ihn das vertraute Gefühl der
Niedergeschlagenheit.
Als er das erste Mal versuchte Selbstmord zu begehen, war
er fünfzehn gewesen. Er hatte eine Schnur an einen
Haken in der Wand des Umkleideraums in der Schule
gebunden. Er hatte die Schlinge um den Hals gelegt und
war von der Bank gesprungen.
Der Haken war aus der Wand gerissen und mit einem
Haufen Putz heruntergekommen. Sein Hals hatte noch
den ganzen Tag weh getan.
Der andere Mann kehrte jetzt zurück und brachte noch
jemanden mit.
Das Geräusch ihrer Sandalen auf den Steinen erschien
Glogauer sehr laut.
Er sah zu dem Neuankömmling auf.
Er war ein Riese und bewegte sich wie eine Katze in dem
Dämmerlicht. Seine Augen waren groß, stechend und
braun. Seine Haut war gebräunt, und seine stark
behaarten Arme waren sehr muskulös. Ein Ziegenfell
bedeckte seinen mächtigen Rumpf und reichte bis über
– 20 –

seine Oberschenkel herunter. In der rechten Hand hielt er
einen dicken Stab. Sein schwarzes, lockiges Haar hing ihm
um das Gesicht; seine roten Lippen schauten aus dem bu-
schigen Bart heraus, der den oberen Teil seiner Brust be-
deckte.
Er schien müde zu sein.
Er lehnte sich auf seinen Stab und sah Glogauer nach-
denklich an.
Glogauer starrte zurück, erstaunt über die spürbare un-
geheure körperliche Gegenwärtigkeit des Mannes.
Als der Neuankömmling sprach, tat er es mit tiefer
Stimme, aber für Glogauer zu schnell, um ihn zu ver-
stehen. Er schüttelte den Kopf.
»Sprich – langsamer…!« sagte er.
Der große Mann hockte sich neben ihm nieder.
»Wer bist du?«
Glogauer zögerte. Es war klar, daß er dem Mann nicht
die Wahrheit sagen konnte. Er hatte sich tatsächlich schon
eine Geschichte zurechtgelegt, die ihm glaubwürdig er-
schien, aber er hatte nicht damit gerechnet, daß man ihn
so finden würde, und die ursprüngliche Geschichte war
jetzt nicht mehr zu brauchen. Er hatte gehofft, unbemerkt
zu landen und sich als Reisender aus Syrien auszugeben,
daß die örtlichen Dialekte sich genügend voneinander un-
terscheiden würden, um seine ungenügende Kenntnis der
Sprache zu erklären.
»Woher kommst du?« fragte der Mann geduldig.
Glogauer antwortete vorsichtig.
»Ich bin aus dem Norden.«
»Aus dem Norden? Nicht aus Ägypten?« Er sah Glogauer
erwartungsvoll, fast hoffnungsvoll an. Glogauer dachte
– 21 –

sich, wenn es sich anhörte, als käme er aus Ägypten, wäre
es wohl das beste, dem Mann zuzustimmen, und er fügte
seine eigenen Ausschmückungen hinzu, um Komplika-
tionen in der Zukunft aus dem Wege zu gehen.
»Ich kam vor zwei Jahren aus Ägypten«, sagte er.
Der große Mann nickte, anscheinend zufrieden. »Du bist
also aus Ägypten. Das hatten wir uns gedacht. Und of-
fensichtlich bist du ein Magus, mit deiner merkwürdigen
Kleidung und deinem von Geistern gezogenen Wagen aus
Eisen. Gut. Dein Name ist Jesus, wurde mir gesagt, und
du bist der Nazarener.«
Offenbar mußte der Mann Glogauers Frage mißverstan-
den und gedacht haben, er hätte ihm seinen eigenen Na-
men genannt. Er lächelte und schüttelte den Kopf.
»Ich suche Jesus, den Nazarener«, sagte er.
Der Mann schien enttäuscht zu sein. »Was ist dann dein
Name?«
Glogauer hatte auch darüber nachgedacht. Er wußte,
daß sein Name den Leuten in der biblischen Zeit zu
fremdländisch vorkommen würde, und so hatte er
beschlossen, den Vornamen seines Vaters zu benutzen.
»Ich heiße Immanuel«, sagte er dem Mann.
»Immanuel…« Er nickte, anscheinend zufrieden. Er
strich sich mit der Spitze des kleinen Fingers über die Lip-
pen und starrte nachdenklich zu Boden. »Immanuel…
ja…«
Glogauer wußte nicht, was er davon halten sollte. Ihm
schien, daß er mit jemandem verwechselt wurde, den der
große Mann erwartet hatte, daß er Antworten gegeben
hatte, die den Mann davon überzeugten, daß er, Glogau-
er, der erwartete Mann sei. Er fragte sich nun, ob es klug
– 22 –

gewesen war, diesen Namen zu wählen, denn Immanuel
bedeutete im Hebräischen »Gott mit uns« und hatte fast
mit Gewißheit eine mystische Bedeutung für seinen
Befrager.
Glogauer begann sich ungemütlich zu fühlen. Es gab
Dinge, die er feststellen mußte, Fragen, die er selbst
stellen mußte, und seine gegenwärtige Lage gefiel ihm
nicht. Bevor er in einer besseren körperlichen Verfassung
war, konnte er hier nicht weggehen und konnte sich nicht
leisten, seinen Befrager zu verärgern. Wenigstens
verhielten sie sich nicht feindlich gegen ihn, dachte er.
Aber was erwarteten sie von ihm?
»Du mußt versuchen, dich auf deine Arbeit zu kon-
zentrieren, Glogauer.«
»Du bist zu verträumt, Glogauer. Dein Gesicht schwebt
ständig in den Wolken. Nun…«
»Du bleibst nach dem Unterricht hier, Glogauer…«
»Warum wolltest du ausreißen, Glogauer? Warum fühlst
du dich hier nicht wohl?«
»Du mußt mir wirklich etwas entgegenkommen, wenn
hier…«
»Ich glaube, ich werde deine Mutter bitten müssen, dich
von der Schule zu nehmen…«
»Vielleicht strengst du dich an – aber du mußt dich viel
mehr anstrengen. Ich hatte große Hoffnungen in dich
gesetzt, als du kamst, Glogauer. Im letzten Jahr hast du
dich großartig gemacht, und jetzt…«
»Auf wie vielen Schulen warst du schon, bevor du zu uns
kamst? Guter Gott!«
– 23 –

»Ich glaube, daß du irgendwie da hineingetrieben
wurdest, Glogauer, und deshalb will ich diesmal nicht zu
streng mit dir sein…«
»Schau nicht so niedergeschlagen drein, mein Junge –
du schaffst es schon!«
»Hör mir zu, Glogauer! Paß auf, in Herrgotts Namen…«
»Du hast den Verstand, Junge, aber du scheinst ihn nicht
benutzen zu wollen…«
»Tut mir leid? Es genügt nicht, daß es dir leid tut. Du
mußt hören…«
»Wir erwarten, daß du dich im nächsten Jahr viel mehr
anstrengst.«
»Und wie heißt du?« fragte Glogauer den hockenden
Mann.
Der richtete sich auf und sah nachdenklich auf Glogauer
herab.
»Du kennst mich nicht?«
Glogauer schüttelte den Kopf.
»Du hast noch nicht von Johannes gehört, den sie den
Täufer nennen?«
Glogauer versuchte, seine Überraschung zu verbergen,
aber offensichtlich bemerkte Johannes der Täufer, daß
sein Name ihm bekannt war. Er nickte mit seinem zotte-
ligen Kopf.
»Du hast doch von mir gehört, wie ich sehe.«
Da überkam ihn ein Gefühl der Erleichterung. Dem Neu-
en Testament nach war der Täufer einige Zeit vor der
Kreuzigung Christi getötet worden. Es war jedoch merk-
würdig, daß gerade Johannes noch nichts von Jesus von
– 24 –

Nazareth gehört hatte. Bedeutete das am Ende, daß Chris-
tus gar nicht existiert hatte?
Der Täufer fuhr sich mit den Fingern durch den Bart.
»Nun, Magus, ich muß also jetzt entscheiden, wie?«
Glogauer, der mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt
war, sah abwesend auf. »Was mußt du entscheiden?«
»Ob du der uns prophezeite Freund bist oder der Fal-
sche, vor dem uns Adonai gewarnt hat.«
Glogauer wurde nervös. »Ich habe mich nicht als solcher
ausgegeben. Ich bin nur ein Fremder, ein Reisender…«
Der Täufer lachte. »Ja – ein Reisender in einem Zau-
berwagen. Meine Brüder haben mir erzählt, daß sie ihn
kommen sahen. Es gab ein Donnergetöse, einen Blitz –
und auf einmal war dein Wagen da und rollte durch die
Wüste. Sie haben viele Wunder gesehen, meine Brüder,
aber kein so überwältigendes wie das Erscheinen deines
Wagens.«
»Der Wagen ist kein Zauberwerk«, versicherte Glogauer
eilig, war sich aber klar, daß der Täufer kaum verstehen
würde, was er ihm sagte. »Es ist – eine Art Maschine – die
Römer haben solche. Du mußt davon gehört haben. Sie
werden von gewöhnlichen Menschen gebaut, keinen Zau-
berern…«
Der Täufer nickte langsam. »Ja – wie die Römer. Die Rö-
mer möchten mich meinen Feinden, den Kindern Hero-
des, ausliefern.«
Obgleich er ziemlich viel über die Politik jener Zeit wuß-
te, fragte Glogauer: »Warum das?«
»Du mußt doch wissen, warum. Rede ich nicht gegen die
Römer, die Judäa versklaven? Rede ich nicht gegen die un-
gesetzlichen Dinge, die Herodes tut? Prophezeie ich nicht
– 25 –
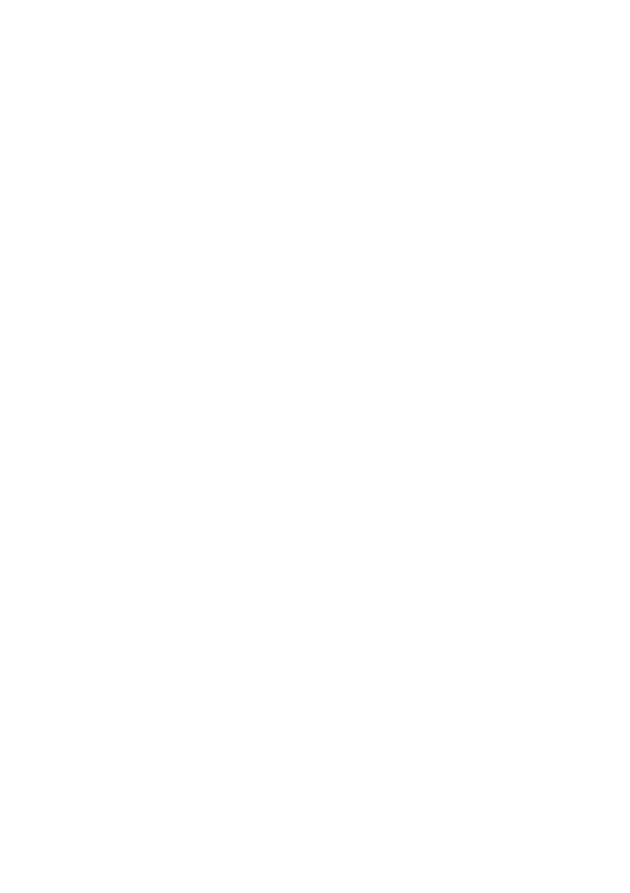
die Zeit, da alle Ungerechten vernichtet werden und Ado-
nais Königreich auf Erden wieder errichtet wird, wie die
alten Propheten uns verkündet haben? Ich sage zu den
Leuten: »›Bereitet euch auf den Tag vor, da ihr das
Schwert aufnehmen werdet, um Adonais Willen zu erfül-
len.‹ Die Ungerechten wissen, daß sie an diesem Tage
sterben werden, und sie möchten mich vernichten.«
Obgleich des Täufers Worte fürchterlich waren, sprach er
in ganz sachlichem Ton. In seinem Gesicht und in seiner
Haltung lag keinerlei Irrsinn oder auch nur Fanatismus.
Karl erinnerte sich an einen anglikanischen Vikar, der eine
ähnliche Predigt gehalten, deren Bedeutung für ihn längst
an Schärfe verloren hatte.
»Du rufst die Leute auf, das Land von den Römern zu
befreien, ist es das?« fragte Karl.
»Ja – von den Römern und ihrem Herodes.«
»Und wen möchtest du an ihre Stelle setzen?«
»Den rechtmäßigen König von Judäa.«
»Und wer ist das?«
Johannes zog die Stirn kraus und sah ihn merkwürdig
von der Seite an. »Adonai wird es uns sagen. Er wird uns
ein Zeichen geben, wenn der rechtmäßige König kommt.«
»Weißt du, was für ein Zeichen das sein wird?«
»Ich werde es wissen, wenn es kommt.«
»Es gibt also Prophezeiungen?«
»Ja, es gibt Prophezeiungen…«
Daß dieser Umsturzplan Adonai (einer der Namen
Jahwes und bedeutet »mein Herr«) zugeschrieben wurde,
sollte ihm, wie Glogauer erschien, lediglich mehr Gewicht
verleihen. In einer Welt, in der Politik und Religion, selbst
im Westen, unentwirrbar miteinander verquickt waren,
– 26 –

mußte dem Plan eine übernatürliche Herkunft gegeben
werden.
Es war in der Tat sogar äußerst wahrscheinlich, daß Jo-
hannes selbst glaubte, sein Plan komme direkt von Gott.
Die Griechen auf der anderen Seite des Mittelmeers
stritten immer noch über den Ursprung der Inspiration –
ob sie im Menschen selbst entstehe oder ihm von Gott
eingegeben würde.
Daß Johannes ihn als einen ägyptischen Zauberer ansah,
überraschte Glogauer auch nicht besonders. Die Um-
stände seiner Ankunft mußten den Leuten außerordent-
lich wundersam erschienen sein und dennoch glaub-
würdig, da sie doch so sehr nach Bestätigung ihres Glau-
bens an solche Dinge lechzten.
Johannes wandte sich dem Eingang zu. »Ich muß nach-
denken«, sagte er. »Ich muß beten. Du bleibst hier, bis mir
Rat gesandt worden ist.«
Er schritt rasch davon.
Glogauer sank auf das nasse Stroh zurück. Irgendwie
bestand eine Verbindung zwischen seinem Erscheinen
und dem Glauben des Täufers – oder Johannes versuchte
wenigstens, dieses Erscheinen mit seinem Glauben in Ein-
klang zu bringen, seine Ankunft vielleicht anhand von
biblischen Weissagungen zu deuten. Glogauer fühlte sich
hilflos. Wie würde der Täufer ihn benutzen? Würde er am
Ende zu dem Schluß kommen, daß er irgendeine bös-
artige Kreatur sei, und ihn töten? Oder würde er zu dem
Schluß kommen, daß er irgendein Prophet sei, und Weis-
sagungen von ihm verlangen, zu denen er nicht imstande
wäre?
– 27 –
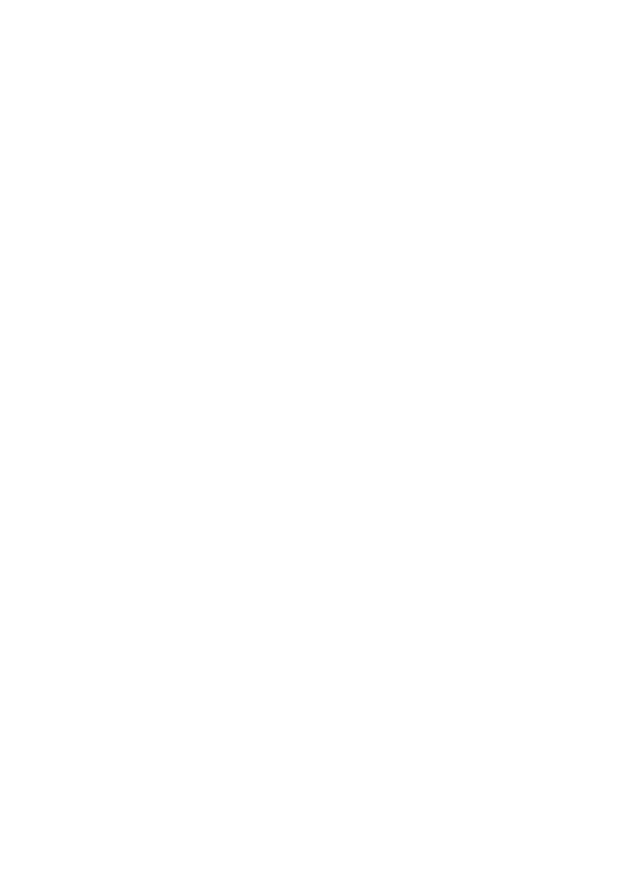
Glogauer seufzte und streckte schwach den Arm aus, um
die Wand zu betasten.
Sie war aus Kalkstein. Er war in einer Kalksteinhöhle.
Höhlen deuteten an, daß Johannes und seine Leute sich
vielleich verborgen hielten – bereits als Banditen von den
Soldaten der Römer und des Herodes gesucht wurden.
Das bedeutete, daß er auch in Gefahr wäre, wenn die Sol-
daten das Versteck des Johannes fänden.
Die Luft in der Höhle war überraschend feucht.
Es mußte draußen sehr heiß sein.
Er fühlte sich schläfrig.
Das Sommerlager 1950, Isle of Wight
Am ersten Abend, den er dort verbrachte, war eine Kanne
mit kochendheißem Tee über seinen rechten Oberschen-
kel geschüttet worden. Es hatte schrecklich geschmerzt,
und es hatten sich fast sofort Blasen gebildet.
»Sei ein Mann, Glogauer!« sagte der rotgesichtige Mr.
Patrick, der das Lager leitende Lehrer. »Sei ein Mann!«
Er versuchte sich das Weinen zu verkneifen, als sie unge-
schickt Gipsbrei auf die Watte strichen.
Sein Schlafsack war neben einem Ameisenhaufen. Er lag
darin, während die anderen Kinder spielten.
Am nächsten Tag sagte Mr. Patrick den Kindern, daß sie
sich das Taschengeld, das ihre Eltern ihm zur Aufbewah-
rung gegeben hatten, ›verdienen‹ müßten.
»Wir werden sehen, wer von euch Mumm hat und wer
nicht«, sagte Mr. Patrick und ließ den Rohrstock durch die
Luft sausen, während er auf dem freien Platz stand, um
den herum die Zelte aufgebaut waren. Die Kinder waren
– 28 –

in zwei langen Reihen aufgestellt – in einer die Mädchen,
in der anderen die Jungen.
»Stell dich in die Reihe, Glogauer!« rief Mr. Patrick. »Drei
Pence für einen Schlag auf die Hand – sechs Pence für
einen Schlag auf den Hintern. Sei kein Feigling,
Glogauer!«
Widerstrebend reihte Glogauer sich ein.
Der Rohrstock sauste auf und nieder. Mr. Patrick atmete
schwer.
»Sechs Schläge auf den Hintern – das macht drei
Schillinge.« Er gab dem kleinen Mädchen das Geld.
Weitere Schläge, weitere Auszahlungen.
Karl wurde unruhig, als die Reihe bald an ihn kam.
Schließlich trat er aus und ging zu den Zelten zurück.
»Glogauer! Hast du keinen Mumm in den Knochen,
Junge? Willst du kein Taschengeld?« rief Mr. Patricks derbe
Stimme spottend hinter ihm her.
Glogauer schüttelte den Kopf und begann zu weinen. Er
ging in sein Zelt und warf sich schluchzend auf den
Schlafsack.
Draußen war Mr. Patricks Stimme immer noch zu hören.
»Sei ein Mann, Glogauer! Sei ein Mann, Junge!«
Karl holte Briefpapier und Kugelschreiber heraus. Seine
Tränen fielen auf das Papier, während er den Brief an sei-
ne Mutter schrieb.
Draußen hörte er den Rohrstock auf das Fleisch der
Kinder klatschen.
Die Schmerzen in seinem Oberschenkel wurden am
nächsten Tag schlimmer, und er wurde von Lehrern und
Kindern ignoriert. ›Sogar die Heimmutter‹ (Patricks Frau)
– 29 –

sagte ihm, er solle sich allein darum kümmern, die Ver-
brühung sei nicht der Rede wert.
Die folgenden zwei Tage, bis seine Mutter ankam, um
ihn von dem Lager abzuholen, waren die schlimmsten, die
er je erlebt hatte.
Kurz vor der Ankunft seiner Mutter machte Mrs. Patrick
einen Versuch, die Blasen mit einer Nagelschere wegzu-
schneiden, damit es nicht so schlimm aussähe.
Seine Mutter nahm ihn mit und schrieb später an Mr.
Patrick und verlangte ihr Geld zurück. Sie schrieb, es sei
eine Schande, wie er das Lager führte.
Er schrieb zurück, er würde das Geld nicht zurück-
erstatten. Und wenn sie es wissen wolle, sie habe einen
Schwächling zum Sohn. »Wenn Sie meine Meinung wissen
wollen«, schrieb er in dem Brief, den Karl las, sobald er
dazu Gelegenheit fand, »Ihr Sohn ist ein kleiner Waschlap-
pen.«
Ein paar Jahre später wurden Mr. Patrick, seine Frau und
seine Gehilfen angeklagt und ins Gefängnis geschickt,
wegen verschiedener sadistischer Handlungen in ihrem
Sommerlagern auf der Insel Wight.
– 30 –

3
Morgens, und manchmal auch abends, trugen sie ihn auf
seiner Bahre ins Freie.
Er war hier nicht, wie er zuerst angenommen hatte, in
einem provisorischen Banditenlager, sondern in einer fes-
ten Siedlung. Es gab Felder, die von einer in der Nähe ge-
legenen Quelle bewässert wurden. Darauf wurde Getreide
angebaut, und auf den Hügeln weideten Ziegen- und
Schafherden.
Ihr Leben verlief ruhig und gemächlich, die meiste Zeit
gingen sie ihrer Tagesarbeit nach und kümmerten sich
nicht um Glogauer.
Manchmal erschien der Täufer und erkundigte sich nach
seinem Befinden. Einige Male stellte er auch rätselvolle
Fragen, die Glogauer beantwortete, so gut er konnte.
Sie schienen freundliche Menschen zu sein und sich an
wesentlich mehr kleinere religiöse Riten zu halten, als
Glogauer selbst für eine solche Gemeinde als normal
angesehen hätte. Er nahm wenigstens an, daß es religiöse
Riten waren, zu denen sie so oft gerufen wurden, denn sie
spielten sich dort ab, wo er sie nicht sehen konnte.
Glogauer war im wesentlichen seinen eigenen Gedan-
ken, seinen Erinnerungen und Spekulationen überlassen.
Seine Rippen heilten sehr langsam, und er wurde unge-
duldig und fragte sich, ob er jemals das Ziel erreichen
würde, um dessentwillen er gekommen war.
Glogauer war überrascht, wie wenige Frauen der
Gemeinde angehörten. Die Atmosphäre war fast wie in
einem Kloster, und die meisten der Männer mieden die
– 31 –

Frauen. Ihm wurde allmählich klar, daß es sich wahr-
scheinlich in der Hauptsache um eine religiöse Gemein-
schaft handeln mußte. Waren die Leute vielleicht Essener?
Wenn Sie Essener wären, würde das eine Reihe von
Dingen erklären – das weitgehende Fehlen von Frauen
(wenige Essener hielten etwas von der Ehe), die apoka-
lyptischen Glaubensvorstellungen des Johannes, das
Schwergewicht, das auf religiöse Handlungen gelegt
wurde, das strenge, einfache Leben, das diese Leute
führten, die Tatsache, daß sie anscheinend absichtlich von
anderen Menschen abgesondert lebten…
Clogauer fragte den Täufer bei der nächsten Gelegen-
heit.
»Johannes – nennt man euch Essener?«
Der Täufer nickte.
»Wie kamst du darauf?« fragte er Glogauer.
»Ich – ich habe von euch gehört. Hat euch Herodes ge-
ächtet?«
Johannes schüttelte den Kopf. »Herodes würde uns äch-
ten, wenn er es wagte, aber er hat keinen Anlaß. Wir füh-
ren unser eigenes Leben, tun keinem etwas zuleide, ma-
chen keinen Versuch, anderen unseren Glauben aufzu-
zwingen. Von Zeit zu Zeit ziehe ich aus und predige unser
Glaubensbekenntnis – aber damit verstoße ich gegen kein
Gesetz. Wir achten die Gebote des Moses und predigen
nur, daß auch andere sie befolgen sollen. Wir sprechen
nur für Gerechtigkeit. Selbst Herodes kann da nichts
dagegen haben…«
Jetzt verstand Glogauer den Sinn einiger der Fragen
besser, die Johannes ihm gestellt hatte; verstand, warum
– 32 –

diese Leute gerade so und nicht anders lebten und
handelten.
Es wurde ihm nun auch klar, warum sie die Art seines
Auftauchens mit so wenig Erregung aufgenommen hatten.
Eine Sekte wie die Essener, die sich in dieser heißen
Wüste in Selbstkasteiung und Fasten übten, mußte an
Visionen gewöhnt sein.
Es fiel ihm auch ein, daß er einmal auf die Theorie
gestoßen war, daß Johannes der Täufer ein Essener ge-
wesen sei und daß viele der frühchristlichen Ideen auf die
Vorstellungen der Essener zurückgingen.
Die Essener nahmen zum Beispiel rituelle Bäder – Taufe
–, sie glaubten an eine Gruppe von zwölf von Gott ausge-
wählten Männern (die Apostel), die am Jüngsten Tag die
Richter sein würden, sie predigten den Glaubenssatz
»Liebe deinen Nächsten«, sie glaubten, ebenso wie die
ersten Christen, in der Zeit kurz vor dem Armageddon zu
leben, der letzten Schlacht zwischen Licht und Finsternis,
dem Guten und dem Bösen, wenn alle Menschen gerich-
tet würden. Wie bei gewissen christlichen Sekten gab es
auch bei den Essenern den Glauben, daß sie die Kräfte
des Lichts repräsentierten und andere – Herodes oder die
römischen Eroberer – die Kräfte der Finsternis, und daß
es ihr Auftrag sei, diese Kräfte zu vernichten. Diese poli-
tischen Vorstellungen waren unentwirrbar mit den religi-
ösen Vorstellungen verknüpft, und obwohl es denkbar
wäre, daß jemand wie Johannes der Täufer zynisch genug
gewesen wäre, die Essener für die Förderung seiner
eigenen politischen Absichten zu benutzen, war es doch
höchst unwahrscheinlich.
– 33 –

Im zwanzigsten Jahrhundert, dachte Glogauer, hätte man
die Essener als Neurotiker angesehen, mit ihrem fast para-
noischen Mystizismus, der sie dazu brachte, Geheimspra-
chen zu erfinden und ähnliches – ein sicheres Zeichen für
ihren labilen Geisteszustand.
All dies stellte Glogauer, der verhinderte Psychiater, fest,
aber Glogauer, der Mensch, wurde hin- und hergerissen
zwischen der extremen Vernunft und dem Wunsch, selbst
von diesem Mystizismus überzeugt zu sein.
Der Täufer war weggegangen, bevor er ihm weitere
Fragen stellen konnte. Er sah den großen Mann in einer
Höhle verschwinden und richtete dann seine Aufmerk-
samkeit auf die Felder in der Ferne, wo ein magerer
Essener einen Pflug führte, der von zwei anderen Mitglie-
dern der Sekte gezogen wurde.
Glogauer studierte die gelben Hügel und die Felsen. Er
brannte darauf, mehr von dieser Welt zu sehen, und er
hätte auch gern gewußt, was aus seiner Zeitmaschine ge-
worden war. War sie überhaupt nicht mehr zu reparieren?
Würde er jemals in der Lage sein, diese Zeit zu verlassen
und ins zwanzigste Jahrhundert zurückzukehren?
Sexus und Religion.
Dem Kirchenklub war er beigetreten, um Freunde zu fin-
den.
– 34 –

Ein Ausflug ins Grüne, 1954
Er und Veronica hatten die anderen im Wald von Farlowe
verloren.
Sie war dick und unförmig, schon mit siebzehn, aber sie
war ein Mädchen.
»Laß uns ein bißchen hier sitzen und ausruhen«, sagte er
und zeigte auf einen Hügel in einer kleinen, von Gebüsch
umgebenen Lichtung.
Sie setzten sich hin.
Sie sagten nichts.
Seine Blicke hingen nicht an ihrem runden, derben
Gesicht, sondern an dem kleinen silbernen Kreuz, das an
einer Kette um ihren Hals hing.
»Wir müssen wohl lieber die anderen suchen«, sagte sie
unruhig. »Sie werden sich um uns sorgen, Karl.«
»Sie sollen uns suchen«, sagte er. »Wir werden sie bald
rufen hören.«
»Sie könnten nach Hause gehen.«
»Sie werden nicht ohne uns gehen. Mach dir keine
Sorgen! Wir werden sie rufen hören…«
Er beugte sich plötzlich vor und griff nach den mit einer
marineblauen Wolljacke bekleideten Schultern, den Blick
immer noch auf das Kreuz geheftet.
Er versuchte ihre Lippen zu küssen, aber sie drehte den
Kopf weg. »Komm, gib mir einen Kuß!« sagte er und hielt
den Atem an. Schon in dem Augenblick wurde ihm be-
wußt, wie lächerlich, wie albern er sich benahm, aber er
zwang sich weiterzumachen. »Gib mir einen Kuß, Veroni-
ca…«
»Nein, Karl. Laß das!«
»Komm…«
– 35 –

Sie begann sich zu wehren, riß sich los und stand auf.
Er errötete jetzt.
»Entschuldige!« sagte er. »Entschuldige!«
»Schon gut…«
»Ich dachte, du wolltest es«, sagte er.
»Du hättest mich doch nicht so überfallen müssen. Nicht
sehr romantisch.«
»Es tut mir leid…«
Sie wandte sich zum Gehen. Das Kreuz baumelte. Es fas-
zinierte ihn. Stellte es eine Art Amulett dar, gegen die Art
von Gefahr, der sie eben entgangen war, wie sie gewiß
meinte?
Er folgte ihr.
Bald hörten sie die Rufe der anderen im Wald, und Karl
fühlte sich unerklärlicherweise angewidert.
Einige der anderen Mädchen begannen zu kichern, und
einer der Jungen sah ihn grinsend an.
»Was habt ihr denn vorgehabt?«
»Nichts«, sagte Karl.
Aber Veronica sagte gar nichts. Obwohl sie nicht bereit
gewesen war, ihn zu küssen, genoß sie doch offensichtlich
die Anspielungen.
Auf dem Rückweg hielt sie seine Hand.
Es war dunkel, als sie bei der Kirche ankamen, wo sie
noch für eine Tasse Tee einkehrten. Sie saßen nebenein-
ander. Die ganze Zeit starrte er das Kreuz an, das zwi-
schen ihren schon großen Brüsten hing.
Die anderen hatten sich alle am anderen Ende des nack-
ten Kirchenraumes versammelt. Manchmal hörte Karl
eines der Mädchen kichern und sah einen Jungen in seine
– 36 –

Richtung schielen. Er fühlte sich inzwischen ganz mit sich
zufrieden. Er rückte näher an sie heran.
»Kann ich dir noch eine Tasse Tee holen, Veronica?«
Sie starrte zu Boden. »Nein, danke. Ich muß jetzt besser
nach Hause. Meine Eltern werden sich bestimmt Sorgen
machen.«
»Ich bringe dich nach Hause, wenn du willst.«
Sie zögerte.
»Es ist kein großer Umweg für mich«, sagte er.
»Also gut.«
Sie standen auf. Er nahm ihre Hand und winkte den
anderen zu.
»Tschüs, alle zusammen! Bis Donnerstag!« sagte er.
Die Mädchen konnten das Lachen nicht mehr zurückhal-
ten, und er errötete wieder.
»Tut ja nichts, was ich nicht tun würde!« rief einer der
Jungen.
Karl zwinkerte ihm zu.
Sie gingen durch die hell erleuchteten Vorortstraßen,
beide zu verlegen, um zu sprechen. Ihre Hand lag schlaff
in seiner.
Als sie vor ihrer Haustür ankamen, blieb sie stehen und
sagte dann hastig: »Ich muß jetzt reingehen.«
»Willst du mir nicht jetzt einen Kuß geben?« fragte er. Er
starrte immer noch das Kreuz auf ihrer marineblauen
Wolljacke an.
Sie küßte ihn hastig auf die Wange.
»Das kannst du noch besser«, sagte er.
»Ich muß jetzt gehen.«
»Komm«, sagte er, »gib mir einen richtigen Kuß!« Er ge-
riet fast außer Fassung, war puterrot im Gesicht und
– 37 –

schwitzte. Er griff nach ihr und zwang sich, ihre Arme zu
halten, obwohl ihn ihr dickes, grobes Gesicht und ihr
schwerer, plumper Körper schon abzustoßen begann.
»Nein.«
Hinter der Tür ging das Licht an, und er hörte ihren
Vater im Flur knurren.
»Bist du das, Veronica?«
Er ließ seine Hände sinken. »Schön, wenn du so sein
willst«, sagte er.
»Es tut mir leid«, begann sie, »es ist nur, weil…«
Die Tür öffnete sich, und ein Mann in Hemdsärmeln
stand vor ihnen. Er war so dick und grobschlächtig wie
seine Tochter.
»Hallo, hallo«, sagte er, »du hast einen Freund mit?«
»Das ist Karl«, sagte sie. »Er hat mich nach Hause ge-
bracht. Er ist auch im Klub.«
»Sie hätten sie ein bißchen früher nach Hause bringen
können, junger Mann«, sagte ihr Vater. »Möchten Sie mit
hereinkommen auf eine Tasse Tee oder sonst etwas?«
»Nein, danke«, sagte Karl. »Ich muß nach Hause. Tschüs,
Veronika! Wir sehen uns Donnerstag.«
»Vielleicht«, sagte sie.
Am nächsten Donnerstag kam er zur Bibelstunde in den
Klub. Veronica war nicht da.
»Ihr Vater hat sie nicht gehen lassen«, erzählte ihm eines
der anderen Mädchen. »Es muß deinetwegen gewesen
sein.« Sie sagte es verächtlich, er konnte sich das nicht er-
klären.
»Wir haben kaum etwas getan«, sagte er.
»Das hat sie auch gesagt«, erzählte ihm das Mädchen lä-
chelnd. »Sie sagte, du wärst nicht sehr gut darin.«
– 38 –

»Was heißt das? Sie wollte nicht«
»Sie sagte, du könntest nicht richtig küssen.«
»Sie gab mir keine Gelegenheit.«
»So hat sie jedenfalls gesagt«, sagte das Mädchen und
warf den anderen Blicke zu.
Karl wußte, daß sie ihn herauslocken wollten, spürte so-
gar, daß sie auf ihre Weise mit ihm flirteten, nicht wußten,
was sie von ihm halten sollten, aber er konnte nicht
verhindern, daß er errötete, und er verließ die
Diskussionsgruppe früh.
Er ging nie wieder in den Kirchenklub, aber seine Vor-
stellungen beim Masturbieren wurden in den nächsten
Wochen von Veronica und dem kleinen silbernen Kreuz
beherrscht, das zwischen ihren Brüsten hing. Selbst wenn
er sie sich nackt vorstellte, blieb das Kreuz dort. Es war
tatsächlich bald das eigentlich Erregende, und noch lange
nachdem Veronica aus seinen Träumen verschwunden
war, dachte er an Mädchen mit kleinen silbernen Kreuzen
zwischen ihren Brüsten, und der Gedanke verschaffte ihm
unglaublichen Genuß.
– 39 –

4
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott,
und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei
Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne
dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war
das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.
Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finster-
nis hat's nicht begriffen. Es ward ein Mensch, von Gott ge-
sandt, der hieß Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, daß
er von dem Licht zeugte, auf daß sie alle durch ihn
glaubten. Er war nicht das Licht, sondern daß er zeugte
von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, welches
alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es
war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe ge-
macht; und die Welt kannte es nicht. Er kam in sein
Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie
viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes
Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben; welche
nicht von dem Geblüt noch von dem Willen des Fleisches
noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott ge-
boren sind.
Johannes 1,1-13
– 40 –

Einsam, einsam, einsam…
Oh, Herr Jesus…
Laß das!
Na-rr
LASS DAS
Na
LASS DAS rr NEIN!
Herr Je…
LASS DAS!
Ich liebe dich… LASS DAS
Herr Jesus, ich…
LASS DAS
Einsam…
Akne. Waschen. Einsam. Vernunft. Ein großes silbernes
Kreuz ficken.
Seine Rippen verheilten.
An den Abenden humpelte er jetzt zum Eingang der
Höhle und hörte sich den Singsang der Essener bei ihrem
Abendgebet an. Aus irgendeinem unerfindlichen Grunde
brachte der monotone Singsang immer Tränen in seine
Augen, und er begann haltlos zu weinen.
In diesem Stadium seiner Genesung wurde er oft von
Depressionen erfaßt, die ihn an Selbstmord denken
ließen.
Er hatte alle Gashähne im Haus aufgedreht und es zeitlich
so eingerichtet, daß es mit der Rückkehr seiner Mutter
von der Arbeit zusammenfiel.
– 41 –

Eben bevor sie das Gartentor öffnete und auf die Haus-
tür zuging, legte er sich im Wohnzimmer vor den Gasofen.
Als sie hereinkam, schrie sie, hob ihn auf, legte ihn auf
das Sofa und schlug sämtliche Fenster im Erdgeschoß ein,
bevor ihr einfiel, die Gashähne zuzudrehen und einen
Arzt zu rufen.
Als der Arzt kam, hatte sie eine Geschichte für ihn bereit
– über einen Unfall. Aber der Arzt schien voll im Bilde zu
sein. Er zeigte nicht allzuviel Mitgefühl für Karl.
»Du möchtest im Rampenlicht stehen, junger Mann«,
sagte er, als Karls Mutter nicht im Zimmer war. »Du möch-
test im Rampenlicht stehen, wenn du mich fragst.«
Karl hatte zu weinen angefangen.
»Wir werden eine Urlaubsreise machen«, sagte seine
Mutter, als der »Arzt gegangen war. »Was ist es denn?
Kommst du in der Schule nicht gut mit? Wir werden in
Urlaub fahren.«
»Es hat nichts mit der Schule zu tun«, schluchzte er.
»Was ist es dann?«
»Du bist es…«
»Ich? Ich? Warum ich? Was hab' ich damit zu tun? Was
willst du damit sagen?«
»Nichts.« Er wurde trotzig.
»Ich muß anrufen, daß sie kommen und die Scheiben
einsetzen«, sagte sie und eilte hinaus. »Es wird ein Vermö-
gen kosten.«
Liebe mich, liebe mich, liebe mich…
Einsam…
– 42 –

Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein
Name, dein Reich komme…
LIEBE MICH!
Schwebend, größer als die Welt, den kleinen beschnit-
tenen Pimmel in der Hand, Silberwolken in der Form
eines großen, weichen Kreuzes, ich treibe, treibe, komme,
komme…
LIEBE MICH!
Bill Haley und seine Comets. See you later, alligator. Und
für dreieinhalb Monate war Gott vergessen.
Einen Monat war Johannes der Täufer abwesend. Glogau-
er lebte bei den Essenern und fand es erstaunlich leicht,
als seine Gesundheit sich besserte, sich an ihren Alltag zu
gewöhnen.
Er entdeckte, daß das Dorf der Essener aus einem weit
verstreuten Haufen von eingeschossigen, aus Kalkstein
und Lehmziegeln gebauten Häusern und aus den Höhlen
auf beiden Seiten des flachen Tales bestand. Einige waren
natürliche Höhlen, andere waren von frühen Bewohnern
des Tals und von den Essenern selbst ausgehauen
worden.
Die Essener lebten in Gütergemeinschaft, und manche
Mitglieder dieser Sekte, was Glogauer schon vorher auf-
gefallen war, hatten auch Ehefrauen, obwohl die meisten
von ihnen ein absolut mönchisches Leben führten.
– 43 –

Glogauer erfuhr zu seiner Überraschung, daß die mei-
sten der Essener Pazifisten waren und sich weigerten,
Waffen herzustellen oder zu besitzen. Ihre Glaubensvor-
stellungen
stimmten
nicht
ganz
mit
den
eher
kriegerischen Ankündigungen des Täufers überein, doch
die Sekte duldete und verehrte Johannes ohne Zweifel.
Vielleicht verdrängte ihr Haß gegen die Römer ihre
Prinzipien. Vielleicht waren sie nicht absolut sicher, was
Johannes vorhatte. Möglicherweise hatte er sich absicht-
lich in dieser Sache nicht klar ausgedrückt – oder
vielleicht hatte Glogauer ihn nicht richtig verstanden. Was
immer der Grund dafür sein mochte, daß sie ihn dulde-
ten, es bestand kaum ein Zweifel daran, daß er praktisch
ihr Anführer war.
Das Leben der Essener bestand aus drei rituellen Bädern
am Tag, einem Gebet bei jeder Mahlzeit und bei Tages-
und Nachtanbruch, und aus Arbeit.
Die Arbeit war nicht schwierig.
Manchmal führte Glogauer einen Pflug, den zwei andere
Mitglieder der Sekte zogen; manchmal half er einen Pflug
ziehen; manchmal hütete er die Ziegen, die an den Berg-
hängen weideten.
Es war ein friedliches, geordnetes Leben, und selbst die
ungesunden Aspekte gehörten so fest zur Routine, daß
Glogauer sie nach einiger Zeit gar nicht mehr wahrnahm.
Wenn er die Ziegen hütete, lag er auf einer Bergkuppe
und schaute über das Wüstenland hinaus. Es war keine
absolute Wüste, sondern ein felsiges, mit Gestrüpp be-
wachsenes Land, das Tieren wie Ziegen oder Schafen aus-
reichend Futter bot.
– 44 –

Hier und da wuchsen Sträucher, und am Ufer des Flus-
ses, der zweifellos ins Tote Meer mündete, auch einige
kleinere Bäume.
Das Gelände war uneben. Es hatte die Konturen eines
aufgewühlten Sees, der dann gefroren und gelb und
braun geworden war.
Hinter dem Toten Meer lag Jerusalem.
Offenbar hatte Christus die Stadt noch nicht zum letzten-
mal betreten.
Johannes der Täufer müßte (wenn man sich auf das
Neue Testament verlassen konnte) noch vorher sterben.
Salome müßte für Herodes tanzen, und der große Kopf
des Täufers müßte von seinem Körper abgetrennt werden.
Die Art, wie dieser Gedanke ihn erregte, erzeugte ein
Schuldgefühl bei Glogauer. Müßte er den Täufer nicht
warnen?
Er wußte, daß er es nicht tun würde. Er war besonders
gewarnt worden, bevor er sich in die Zeitmaschine begab,
daß er keinen Versuch machen dürfe, am Lauf der Ge-
schichte etwas zu ändern. Er redete sich selbst ein, daß er
ja nicht genau wußte, welchen Lauf die Geschichte dieser
Zeit genommen hatte. Es gab nur Legenden, keine rein
historischen Berichte. Die Bücher des Neuen Testaments
waren Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte nach den Ereig-
nissen geschrieben, die sie schilderten. Sie waren nie his-
torisch überprüft worden. Spielte es dann eine Rolle,
wenn er in das Geschehen eingriff?
Aber er wußte dennoch, daß er keinen Versuch machen
würde, Johannes vor der Gefahr zu warnen.
– 45 –

Undeutlich empfand er auch, weshalb. Er wollte, daß die
Ereignisse wahr wurden. Er wollte, daß das Neue Testa-
ment recht behielt.
Bald würde er Jesus aufsuchen müssen.
Seine Mutter zog häufig um, neigte jedoch dazu, immer
ungefähr in der gleichen Gegend zu bleiben. Wenn sie ein
Haus in einem Teil von Süd-London verkaufte, kaufte sie
ein anderes nur einen Kilometer davon entfernt.
Nach seiner kurzen Phase als Rock-and-Roll-Fan zogen
sie nach Thornton Heath, und er trat dem dortigen Kir-
chenchor bei. Seine Stimme war gut und klangvoll, und
der Kurat, der die Proben des Chors leitete, begann ein
besonderes Interesse an ihm zu zeigen. Zuerst unter-
hielten sie sich über Musik, aber bald drehten sich ihre
Gespräche mehr und mehr um Religion. Karl bat den
Kuraten um Rat bei seinen recht allgemeinen Gewis-
sensproblemen. Wie konnte er ein normales Leben mit
normaler Betätigung führen, ohne jemanden zu verletzen?
Warum waren Menschen so gewalttätig gegeneinander?
Warum gab es Kriege?
Mr. Youngers Antworten waren etwa so verschwommen
und allgemein wie Karls Fragen, aber er gab sie mit einer
so tiefen, selbstsicheren und überzeugenden Stimme, daß
Karl sich anschließend immer wohler fühlte.
Sie gingen miteinander spazieren. Mr. Younger legte sei-
nen Arm um Karls Schultern.
An einem Wochenende fuhr der Chor zu einem Fest
nach Winchester, und sie übernachteten in einer Jugend-
herberge. Karl schlief in einem Zimmer mit Mr. Younger.
– 46 –

Spätnachts kroch Mr. Younger zu Karl ins Bett.
»Ich wünschte, du wärst ein Mädchen, Karl«, sagte Mr.
Younger und streichelte Karls Kopf.
Karl war zu verwirrt, um zu antworten, aber er reagierte,
als er Mr. Youngers Hand an seinen Genitalien spürte.
Sie liebten diese ganze Nacht, aber am Morgen fühlte
sich Karl angeekelt, und er stieß Mr. Younger vor die
Brust und sagte ihm, wenn er das jemals wieder versu-
chen sollte, würde er es seiner Mutter sagen.
Mr. Younger weinte und sagte, es täte ihm leid. Könnten
er und Karl nicht Freunde bleiben? Aber Karl hatte das Ge-
fühl, daß Mr. Younger ihn irgendwie verraten hatte. Mr.
Younger sagte, er liebte Karl – nicht so, sondern auf eine
christliche Art – und daß ihm seine Gesellschaft viel Freu-
de gemacht hätte. Aber Karl sprach nicht mit ihm und
wich ihm auf der Heimfahrt nach Thornton Heath aus.
Karl blieb noch einige Wochen im Kirchenchor, aber zwi-
schen ihm und Mr. Younger herrschte Spannung.
Am Ende eines Probenabends bat Mr. Younger Karl,
noch dazubleiben, und Karl wurde zwischen Abscheu und
Verlangen hin- und hergerissen.
Schließlich blieb er und erlaubte Mr. Younger, seine
Genitalien zu streicheln, unter einem Plakat, das ein
schlichtes Holzkreuz mit der Unterschrift GOTT IST DIE
LIEBE zeigte.
Karl brach in hysterisches Gelächter aus, rannte aus der
Kirche davon und ging nie wieder hin.
Er war fünfzehn.
– 47 –

Silberkreuze gleich Frauen. Holzkreuze gleich Männer.
Er stellte sich oft selbst als Holzkreuz vor. Er hatte zwi-
schen Schlafen und Wachen Halluzinationen, in denen er
sich als schweres Holzkreuz sah, das ein zartes Silberkreuz
durch dunkle Weiten verfolgte.
Als er siebzehn war, hatte er alles Interesse am formalen
Christentum verloren und begeisterte sich für heidnische
Religionen, besonders für den keltischen Mystizismus und
den Mithraskult. Er hatte eine Affäre mit der Frau eines
Sergeant-Major gehabt, die in Kilburn wohnte. Er hatte sie
bei einer Party getroffen, die von einer Frau gegeben
wurde, die er durch eine Bekanntschaftsanzeige in dem
kurzlebigen Magazin Avilion kennengelernt hatte.
Die Frau des Sergeant-Major (er war irgendwo im Fernen
Osten) hatte ein kleines silbernes Keltenkreuz, ein ›Son-
nenkreuz‹, am Hals getragen, und das war es gewesen,
was ihn zuerst angezogen hatte. Er hatte allerdings eine
halbe Flasche Gin gebraucht, bevor er es gewagt hatte, sei-
nen Arm um ihre mageren Schultern zu legen und später,
in der Dunkelheit, seine Hände zwischen ihre Schenkel zu
schieben und ihre Fotze durch ihre Satinhosen zu befüh-
len.
Nach Deirdre Thompson hatte er Erfolg auf Erfolg bei
den faden Frauen der Gruppe, die alle, wie er entdeckte,
die gleichen Satinhosen trugen.
Innerhalb von sechs Monaten war er erschöpft, verab-
scheute die neurotischen Weiber, haßte sich selbst und
war fertig mit dem keltischen Mystizismus. Er hatte die
meiste Zeit nicht zu Hause gewohnt, überwiegend bei
Deirdre Thompson, aber jetzt ging er nach Hause zurück
und bekam einen Nervenzusammenbruch.
– 48 –

Seine Mutter war der Ansicht, er brauchte Abwechslung,
und gab ihm das Fahrgeld, damit er Freunde von ihm in
Hamburg besuchte.
Seine Hamburger Freunde hielten sich für Nachfahren
des Volkes, das umgekommen war, als Atlantis durch
Atombomben zerstört wurde, die unfreundliche Geister
vom Mars aus fliegenden Untertassen abgeworfen hatten.
Es gab diesmal eine Folge von faden deutschen Frauen.
Im Unterschied zu ihren britischen Schwestern trugen sie
alle schwarze Nylon-Spitzenhöschen.
Das brachte etwas Abwechslung.
In Hamburg wurde er zum militanten Christengegner
und vertrat die Meinung, das Christentum sei die Perver-
sion eines älteren Glaubens, eines nordischen Glaubens.
Aber er konnte nie ganz akzeptieren, daß dieser Glaube
in seiner reinsten Form der der Atlanter gewesen sein
sollte, und am Ende zerstritt er sich mit seinen deutschen
Freunden, fand das übrige Deutschland recht unsympa-
thisch und reiste nach Tel Aviv ab, wo er den Besitzer
eines Buchladens kannte, der sich auf okkultistische Wer-
ke spezialisiert hatte, hauptsächlich in Französisch.
Dort in Tel Aviv erfuhr er in einem Gespräch mit einem
ungarischen Maler von Jung und tat seine Schriften als
Unsinn ab. Er zog sich noch mehr von der Welt zurück
und nahm eines Tages einen Bus, der ihn in ein ländli-
ches Gebiet in der Halbwüste brachte. Er landete
schließlich im Antilibanon, wo die Menschen eine Sprache
sprachen, die dem alten Aramäisch näherkam als alles,
was er bis dahin gehört hatte. Er fand diese Menschen
gastfreundlich; es gefiel ihm bei ihnen. Er lebte vier Mona-
te bei ihnen, bevor er nach Tel Aviv zurückkehrte und in
– 49 –

einer aufnahmebereiteren Stimmung wieder mit dem Un-
garn über Jung sprach. In dem okkultistischen Buchladen
und in anderen Buchläden und Bibliotheken in Tel Aviv
fand er nichts von Jung in Englisch. Er beschloß, nach
England zurückzukehren, und lieh sich das Fahrgeld vom
britischen Konsulat.
Sobald er in Süd-London ankam, ging er in die dortige
Bibliothek und verbrachte eine Menge Zeit mit der Lektü-
re von Jung.
Seine Mutter fragte ihn, wann er sich eine Stellung su-
chen wollte.
Er sagte ihr, daß er die Absicht habe, Psychologie zu stu-
dieren und dann Psychiater zu werden.
Der Lebensstil der Essener war, bei aller Einfachheit, recht
angenehm.
Sie hatten ihm ein Lendentuch aus Ziegenfell und einen
Stab gegeben, und bis auf die Tatsache, daß er ständig
bewacht wurde, hatten sie ihn anscheinend als eine Art
Laienmitglied der Sekte akzeptiert.
Manchmal befragten sie ihn so nebenher über seinen
Wagen – die Zeitmaschine, die sie bald aus der Wüste
bergen wollten –, und er erzählte ihnen, daß er ihn von
Ägypten nach Syrien und dann hierher getragen habe. Sie
nahmen das Wunder gelassen auf. Sie waren an Wunder
gewöhnt.
Die Essener hatten merkwürdigere Dinge gesehen als
seine Zeitmaschine.
Sie hatten Menschen über Wasser laufen und Engel vom
Himmel herabkommen und wieder aufsteigen sehen; sie
– 50 –

hatten die Stimme Gottes und seiner Erzengel gehört, und
auch die verführerische Stimme des Teufels und seiner
Gesellen.
Sie schrieben all diese Dinge in ihre Pergamentrollen,
die
lediglich
Aufzeichnungen
des
Übernatürlichen
enthielten, so wie sie in ihren anderen Rollen Aufzeich-
nungen über ihr tägliches Leben und Nachrichten, die
reisende Mitglieder ihrer Sekte mitbrachten, verzeichne-
ten.
Sie lebten ständig in der Gegenwart Gottes, sprachen mit
Gott und erhielten Antworten von ihm, wenn sie ihr
Fleisch genügend kasteit und genug gefastet und ihre Ge-
bete unter der sengenden Sonne Judäas gesprochen
hatten.
Karl Glogauer ließ sein Haar lang wachsen und rasierte
sich nicht mehr. Sein Gesicht und sein Körper waren bald
von der Sonne gebräunt. Er kasteite sich und fastete und
sprach seine Gebete unter der Sonne, so wie sie es taten.
Aber er hörte Gott kaum, und nur einmal meinte er
einen Erzengel mit brennenden Schwingen gesehen zu
haben.
Eines Tages führten sie ihn zum Fluß und tauften ihn auf
den Namen, den er Johannes dem Täufer zuerst genannt
hatte. Sie tauften ihn Immanuel.
Die Zeremonie mit ihrem Singen und Schwingen stieg
ihm sehr zu Kopfe, und er war danach in einer eupho-
rischen Stimmung und glücklicher als je zuvor.
– 51 –

5
Trotz seiner Bereitschaft, die Visionen der Essener selbst
zu erleben, wurde Glogauer enttäuscht.
Andererseits überraschte es ihn, daß er sich so wohl fühl-
te angesichts der Härten, die er auf sich nahm. Er fühlte
sich auch gelöst in der Gesellschaft dieser sonderbaren
Männer und Frauen, die, das mußte er zugeben, nach
jeder normalen Betrachtungsweise zweifellos wahnsinnig
waren. Vielleicht kam es daher, daß ihr Wahnsinn von sei-
nem nicht allzu verschieden war, daß er sich nach einiger
Zeit keine Gedanken mehr darum machte.
Monica.
Monica hatte kein silbernes Kreuz.
Sie hatten sich kennengelernt, als er in der Nervenheil-
anstalt von Darley Grange als Pfleger arbeitete. Er hatte
geglaubt, er könnte sich hocharbeiten. Sie war eine psych-
iatrische Sozialarbeiterin, die mehr Mitgefühl gezeigt hatte
als die anderen, als er sich um Gehör für seine Klagen
über die harte Behandlung der Patienten bemühte, über
die kleinen Quälereien durch andere Pfleger und
Schwestern, die Schläge und Anschnauzer.
»Wissen Sie, wir kriegen einfach nicht das richtige Per-
sonal«, hatte sie ihm gesagt. »Die Bezahlung ist viel zu
schlecht…«
»Dann sollten sie eben mehr bezahlen.«
Statt die Achseln zu zucken wie die anderen, hatte sie
genickt. »Ich weiß. Ich habe deswegen schon zwei Briefe
– 52 –

an den Guardian geschrieben – ohne meine Unterschrift,
wissen Sie –, und keiner wurde veröffentlicht.«
Er war kurz danach gegangen und sah sie mehrere Jahre
nicht wieder. Er war zwanzig.
Johannes der Täufer kehrte eines Abends zurück. Mit
zwanzig oder mehr seiner engsten Jünger im Gefolge kam
er über die Hügel gewandert.
Glogauer sah ihn, als er sich anschickte, die Ziegen für
die Nacht in ihre Höhlen zu treiben. Er wartete auf Johan-
nes.
Zuerst erkannte der Täufer ihn nicht, aber dann lachte
er.
»Aber, Immanuel, du bist ein Essener geworden, wie ich
sehe. Haben sie dich schon getauft?«
Glogauer nickte. »Ja.«
»Gut.« Dann zog der Täufer die Stirn kraus, als ihm ein
anderer Gedanke kam. »Ich war in Jerusalem«, sagte er.
»Um Freunde aufzusuchen.«
»Und was gibt es aus Jerusalem zu berichten?«
Der Täufer sah ihn offen an. »Daß du wahrscheinlich
kein Spion des Herodes oder der Römer bist.«
»Ich bin froh, daß du zu diesem Schluß gekommen bist«,
sagte Glogauer lächelnd.
Der harte Gesichtsausdruck des Johannes milderte sich.
Er lächelte und packte ihn in der Art der Römer am Ober-
arm.
»Du bist also unser Freund. Vielleicht mehr als nur ein
Freund…«
– 53 –

Glogauer zog die Brauen hoch. »Ich verstehe dich nicht.«
Er war erleichtert, daß der Täufer, der offensichtlich die
ganze Zeit damit zugebracht hatte, sorgfältig zu überprü-
fen, ob Glogauer nicht im Sold seiner Feinde stand, zu der
Überzeugung gekommen war, daß er ein Freund sei.
»Ich glaube, du weißt, was ich meine«, sagte Johannes.
Glogauer war müde. Er hatte sehr wenig gegessen und
den größten Teil des Tages beim Ziegenhüten in der
Sonne verbracht. Er gähnte und konnte sich nicht dazu
bringen, die Frage weiter zu verfolgen
»Ich weiß nicht…«, fing er an.
Das Gesicht Johannes' verfinsterte sich für einen Augen-
blick, aber dann lachte er etwas gezwungen. »Sag jetzt
nichts! Iß heute abend mit mir! Ich habe wilden Honig
und Heuschrecken.«
Glogauer hatte diese Speise noch nicht gegessen, sie war
die Hauptnahrung von Reisenden, die keinen Proviant
mitführten, sondern sich von dem ernährten, was sie un-
terwegs fanden. Manche hielten es für eine Delikatesse.
»Danke«, sagte er. »Heute abend.«
Johannes lächelte ihn an, ein mysteriöses Lächeln, und
schritt dann mit seinen Männern davon.
Rätselnd trieb Glogauer die Ziegen in ihre Höhlen, und
schloß das Tor aus Weidengeflecht, um sie einzusperren.
Dann ging er über den freien Platz zu seiner eigenen Höh-
le und legte sich aufs Stroh.
Offenbar sah ihn der Täufer in irgendeiner Rolle, die in
seine eigenen Pläne paßte.
– 54 –

All das Gras, all die Bäume, all die Sonnentage mit Eva,
der süßen, jungfräulichen, ihn bewundernden Eva. Er
hatte sie in Oxford auf einer Party kennengelernt, die Ge-
rard Friedman gab, der Journalist, der auf Bücher über
das Übernatürliche spezialisiert war.
Am nächsten Tag waren sie an der Isis spazierenge-
gangen, hatten die Barken am anderen Ufer angesehen,
die fischenden Jungen und die Türme der Colleges in der
Ferne.
Sie war beunruhigt.
»Du darfst dir nicht soviel Sorgen machen, Karl. Nichts
ist vollkommen. Kannst du das Leben nicht nehmen, wie
es kommt?«
Sie war das erste Mädchen, bei dem er sich entspannt ge-
fühlt hatte. Er hatte gelacht. »Ich nehme es an. Warum
nicht?«
Sie war so warm. Ihr blondes Haar war lang und fein, fiel
ihr oft über das Gesicht und verbarg ihre großen blauen
Augen, die ihn immer so offen ansahen, ob sie ernst oder
belustigt war.
Diese paar Wochen hatte er das Leben genommen, wie
es kam. Sie schliefen miteinander in seiner kleinen
Bodenkammer in Friedmans Haus, ließen sich weder
durch Friedmans widerwärtiges Interesse an ihrem Ver-
hältnis noch durch die Briefe, die sie manchmal von ihren
Eltern bekam, stören, in denen sie fragten, wann sie nach
Hause käme.
Sie war achtzehn, ihr erstes Jahr am Somerville College,
und es waren Ferien.
Es war das erstemal, daß ihn jemand liebte. Sie war voll-
kommen in ihn verliebt und er in sie. Zuerst hatten ihn
– 55 –

ihre Leidenschaft und ihre Sorge um ihn verlegen ge-
macht, ihn mißtrauisch gemacht, denn er konnte nicht
glauben, daß jemand soviel Liebe für ihn empfinden
könnte. Allmählich hatte er sie angenommen und er-
widert. Wenn sie voneinander getrennt waren, schrieben
sie einander ziemlich schlechte Liebesgedichte.
»Du bist so gut, Karl«, sagte sie oft. »Du wirst bestimmt
einmal etwas ganz Großartiges in der Welt vollbringen.«
Er lachte dann. »Das einzige Talent, das ich habe, ist das
Talent zum Selbstmitleid…«
»Selbstunsicherheit – das ist etwas anderes.«
Er versuchte dann immer, ihr das idealisierte Bild von
ihm auszureden, doch das überzeugte sie nur von seiner
Bescheidenheit.
»Du bist wie – wie Parzival…«, sagte sie eines Abends zu
ihm, und er lachte laut, merkte, daß er sie beleidigt hatte,
und küßte sie auf die Stirn.
»Sei nicht albern, Eva!«
»Ich meine es wirklich, Karl. Du suchst nach dem Heili-
gen Gral. Und du wirst ihn finden.«
Er war von ihrem Glauben an ihn beeindruckt gewesen
und begann sich zu fragen, ob sie recht hätte. Vielleicht
war ihm wirklich etwas vorausbestimmt. Sie gab ihm ein
so heroisches Gefühl. Er sonnte sich in ihrer Verehrung.
Er war mit einigen Recherchen für Friedman beschäftigt
und verdiente damit genug Geld, um ihr ein kleines
silbernes ägyptisches Kreuz als Kettenanhänger zu kaufen.
Sie hatte sich riesig darüber gefreut. Sie studierte verglei-
chende Religionswissenschaft und war zu der Zeit beson-
ders begeistert von den Ägyptern.
– 56 –

Aber es genügte ihm nicht lange, sich an ihrer Liebe für
ihn zu erfreuen. Er mußte sie auf die Probe stellen; sich
Sicherheit verschaffen. Er begann sich an den Abenden zu
betrinken, ihr schmutzige Geschichten zu erzählen, in
Kneipen Streit vom Zaun zu brechen – Streit, den er dann
nicht ausfocht, weil er zu feige war, wie er klar zu er-
kennen gab.
Und sie begann sich von ihm zurückzuziehen.
»Du machst mich nervös«, erklärte sie ihm voller Sorge.
»Du versetzt mich so in Spannung.«
»Was ist los? Kannst du mich nicht lieben, wie ich bin? So
bin ich nun mal. Ich bin nicht Parzival.«
»Du läßt dich gehen, Karl.«
»Ich versuche nur, dir zu zeigen, wie ich wirklich bin.«
»Aber du bist nicht wirklich so. Du bist lieb – gut –
freundlich…»
»Ich bin ein mich selbst bemitleidender Versager. Nimm
mich als das oder laß es!«
Sie ließ es. Sie fuhr zwei Tage später nach Hause zu ih-
ren Eltern. Er schrieb ihr und erhielt keine Antwort. Er
fuhr hin, um mit ihr zu sprechen, aber ihre Eltern sagten,
sie sei nicht zu Hause.
Mehrere Monate fühlte er sich schrecklich verloren und
verwirrt. Warum hatte er ihre Beziehungen absichtlich zer-
stört? Weil er wollte, daß sie ihn so akzeptierte, wie er
war, nicht wie sie ihn sich vorstellte. Aber angenommen,
sie hatte recht? Hatte er absichtlich die Chance, etwas
Besseres zu sein, zurückgewiesen? Er konnte es nicht
sagen.
– 57 –

Einer der Jünger des Täufers holte ihn eine Stunde später
ab und führte ihn zu dem Haus auf der anderen Seite des
Tals.
Es waren nur zwei Räume in dem Haus: einer zum Essen
und einer zum Schlafen.
Johannes begrüßte ihn in dem kaum möblierten Eß-
raum. Er winkte ihm, sich auf die Baumwollmatte hinter
dem niedrigen Tisch zu setzen, auf dem das Essen bereit-
gestellt war.
Er setzte sich hin und kreuzte die Beine. Johannes setzte
sich ihm gegenüber und zeigte lächelnd mit der Hand auf
das Essen. »Fang an!«
Das Gericht aus Honig und Heuschrecken war zu süß für
seinen Geschmack, aber es war eine willkommene Ab-
wechslung von Gerste oder Ziegenfleisch.
Johannes der Täufer aß mit Appetit. Die Nacht war her-
eingebrochen, und der Raum wurde von Lampen erhellt,
die aus ölgefüllten Schalen mit darin schwimmenden
Dochten bestanden. Von draußen drangen leises Ge-
murmel und das Stöhnen und die Rufe der Betenden her-
ein.
Glogauer tauchte wieder eine Heuschrecke in die Schüs-
sel mit Honig. »Warum wünschtest du mich zu sehen,
Johannes?«
»Weil es Zeit ist.«
»Zeit wofür? Planst du, die Bevölkerung von Judäa gegen
die Römer zu führen?«
Dem Täufer schien die direkte Frage ungelegen zu kom-
men. Es war die erste dieser Art, die ihm Glogauer gestellt
hatte.
– 58 –

»Wenn es Adonais Wille sein sollte«, sagte er, ohne auf-
zusehen, während er sich über die Honigschüssel beugte.
»Wissen die Römer das?«
»Ich bin nicht sicher, Immanuel, aber Herodes, der Blut-
schänder, hat ihnen zweifellos erzählt, daß ich gegen die
Ungerechten predige.«
»Und doch verhaften die Römer dich nicht.«
»Pilatus wagt es nicht – nicht, seit die Petition an Kaiser
Tiberius gesandt wurde.«
»Petition?«
»Ja, die von Herodes und von den Pharisäern unter-
schrieben wurde, als Pilatus, der Prokurator, Votivtafeln
im Palast in Jerusalem aufstellte und den Tempel zu
schänden versuchte. Tiberius erteilte Pilatus eine Rüge,
und seit der Zeit ist der Prokurator, obwohl er die Juden
immer noch haßt, etwas vorsichtiger im Umgang mit uns.«
»Sag mir, Johannes, weißt du, wie lange Tiberius in Rom
schon regiert?« Er hatte bis jetzt keine Gelegenheit gehabt,
dies noch einmal zu fragen.
»Vierzehn Jahre.«
Es war 28 nach Christus – fast ein Jahr vor dem Datum,
an dem nach der übereinstimmenden Meinung der meis-
ten Gelehrten die Kreuzigung stattfand; und seine Zeitma-
schine war zerschlagen.
Jetzt plante Johannes der Täufer einen bewaffneten Auf-
stand gegen die römischen Besatzer, aber, wenn man den
Evangelien glauben durfte, müßte er bald durch Herodes
enthauptet werden. Gewiß hatte in dieser Zeit keine
Rebellion größeren Ausmaßes stattgefunden.
Selbst diejenigen, die behaupten, daß der Einzug Jesu
und seiner Jünger in Jerusalem und die Invasion des Tem-
– 59 –

pels einfach Handlungen bewaffneter Rebellen gewesen
seien, hatten keine Hinweise dafür gefunden, daß Johan-
nes der Täufer eine ähnliche Revolte angeführt haben
könnte.
Wieder kam ihm in den Sinn, daß er Johannes warnen
könnte. Aber würde der Täufer ihm glauben? Würde er es
nicht vorziehen, ihm nicht zu glauben, ganz gleich, was
für Beweise ihm vorgelegt würden?
Glogauer schätzte den Täufer inzwischen sehr. Der
Mann war ganz eindeutig ein hartgesottener Revolutionär,
der seit Jahren den Aufstand gegen die Römer plante und
sich langsam eine genügend große Gefolgschaft aufgebaut
hatte, um den Versuch erfolgversprechend zu machen.
Er erinnerte Glogauer stark an den Typus eines Parti-
sanenführers im Zweiten Weltkrieg. Er besaß die gleiche
Zähigkeit und den Sinn für die Realitäten seiner Lage. Er
wußte, daß er nur eine einzige Chance haben würde, die
im Lande stationierten Kohorten zu zerschlagen. Wenn
sich die Revolte in die Länge zöge, hätte Rom genügend
Zeit, Truppenverstärkungen nach Jerusalem zu schicken.
»Was glaubst du, wann Adonai die Ungerechten durch
deine Hand zu vernichten beabsichtigt?« fragte Glogauer
diplomatisch.
Johannes sah ihn ein wenig belustigt an.
»Das Passahfest ist eine Zeit, wenn die Menschen erregt
und am meisten aufgebracht gegen die Fremden sind«,
sagte er.
»Wann ist das nächste Passahfest?«
»Erst in vielen Monaten.«
Glogauer aß eine Weile schweigend, dann sah er den
Täufer offen an.
– 60 –

»Ich spiele eine Rolle in dieser Sache, nicht wahr?« fragte
er.
Johannes sah zu Boden. »Du wurdest uns von Adonai ge-
sandt, um uns dabei zu helfen, seinen Willen zu erfüllen.«
»Wie kann ich euch helfen?«
»Du bist ein Magus.«
»Ich kann keine Wunder wirken.«
Johannes wischte sich Honig von seinem Bart. »Das kann
ich nicht glauben, Immanuel. Die Art deiner Ankunft war
wundersam. Die Essener wußten nicht, ob du ein Teufel
oder ein Sendbote Adonais warst.«
»Ich bin keines von beiden.«
»Warum verwirrst du mich, Immanuel? Ich weiß, daß du
Adonais Sendbote bist. Du bist das Zeichen, das die
Essener erwarteten. Die Zeit ist fast reif. Das Reich Gottes
auf Erden wird bald errichtet werden. Komm mit uns!
Sage den Leuten, daß du mit Adonais Stimme sprichst!
Wirke große Wunder!«
»Deine Macht läßt nach, ist es das?« Glogauer sah Jo-
hannes scharf an. »Du brauchst mich, um die Hoffnung
deiner Rebellen zu erneuern?«
»Du sprichst wie ein Römer, mit so wenig Takt.«
Johannes stand ärgerlich auf.
Offenbar zog er es vor, sich weniger direkt auszudrücken
wie die Essener, mit denen er lebte. Es gab dafür einen
praktischen Grund, erkannte Glogauer, da Johannes und
seine Männer ständig Verrat fürchteten. Selbst die Auf-
zeichnungen der Essener waren zum Teil in Code ge-
schrieben, wobei ein harmlos erscheinendes Wort oder
eine Wendung etwas vollkommen anderes bedeuten
konnte.
– 61 –

»Verzeih mir, Johannes! Aber sag mir bitte, ob ich recht
habe!«
Glogauer sprach leise.
»Bist du kein Magus, wenn du in diesem Wagen aus dem
Nichts auftauchst?« Der Täufer breitete die Hände aus und
zuckte die Achseln. »Meine Leute sahen dich. Sie sahen,
wie das glänzende Ding in der Luft Gestalt annahm, auf-
platzte und dich heraussteigen ließ. Ist das nichts Wunder-
bares? Die Kleider, die du trugst – war das eine irdische
Gewandung? Die Talismane in dem Wagen – sprachen die
nicht für einen mächtigen Zauber? Der Prophet sagte, es
würde ein Magus aus Ägypten kommen, und er würde
Imanuel heißen. So steht es im Buch Micha. Sind all diese
Dinge nicht wahr?«
»Die meisten. Aber es gibt Erklärungen…« Er brach ab,
weil ihm kein passender Ersatz für das Wort ›rational‹ ein-
fiel. »Ich bin ein gewöhnlicher Mann wie du. Ich habe
nicht die Macht, Wunder zu wirken. Ich bin nur ein
Mensch!«
Johannes sah ihn böse an. »Du willst damit sagen, du
verweigerst uns deine Hilfe?«
»Ich bin dir und den Essenern dankbar. Ihr habt mir mit
großer Wahrscheinlichkeit das Leben gerettet. Wenn ich
mich dafür erkenntlich zeigen kann…«
Johannes nickte nachdenklich. »Du kannst es, Im-
manuel.«
»Wie?«
»Sei der große Magus, den ich brauche! Laß mich dich
allen vorführen, die ungeduldig werden und sich von
Adonais Willen abkehren möchten! Laß mich ihnen erzäh-
len, wie du zu uns gekommen bist! Dann kannst du sagen,
– 62 –

daß alles Adonais Wille ist und sie sich bereitmachen
müssen, ihn zu erfüllen.«
Johannes starrte ihn durchdringend an.
»Willst du das, Immanuel?«
»Johannes – gibt es keine Möglichkeit, dir zu helfen, oh-
ne dich oder mich oder die Leute zu täuschen…?«
Johannes sah ihn nachdenklich an. »Vielleicht bist du dir
deiner Bestimmung nicht bewußt…«, sagte er sinnend.
»Warum nicht? Ich wäre tatsächlich viel mißtrauischer,
wenn du große Ansprüche geltend machtest. Immanuel,
willst du es mir nicht glauben, daß du derjenige bist,
dessen Ankunft uns prophezeit wurde?«
Glogauer fühlte sich geschlagen. Wie konnte er dagegen
anstreiten? Nach allem, was er wußte, konnte er doch der-
jenige sein. Angenommen, es gab Menschen, die mit einer
Art hellseherischer Begabung ausgestattet waren… Oh,
das war Unsinn. Aber was konnte er tun?
»Johannes, du brauchst dringend ein Zeichen. Angenom-
men, der echte Magus kommt an…«
»Er ist gekommen. Du bist es. Ich habe gebetet, und ich
weiß es.«
Wie konnte er Johannes sagen, daß es sein dringender
Wunsch nach Hilfe war, der ihn wahrscheinlich davon
überzeugt hatte? Er seufzte.
»Immanuel – willst du der Bevölkerung von Judäa nicht
helfen?«
Glogauer schob die Lippen vor. »Laß es mich überlegen,
Johannes! Laß mich schlafen! Komm morgen zu mir, und
ich werde es dir sagen.«
Mit einiger Überraschung wurde ihm klar, daß sich ihre
Rollen vertauscht hatten. Statt daß er sich das Wohlwollen
– 63 –

des Täufers zu erhalten suchte, war der Täufer jetzt
äußerst bemüht, sich seines zu erhalten.
Als er zu seiner Höhle zurückkehrte, war er in Hochstim-
mung, konnte ein breites Lächeln nicht unterdrücken.
Ohne etwas dafür getan zu haben, befand er sich jetzt in
einer Machtposition. Wie sollte er die Macht einsetzen?
Hatte er wirklich eine Mission zu erfüllen? Konnte er den
Gang der Geschichte ändern und als der verantwortliche
Mann den Juden helfen, die Römer hinauszuwerfen?
– 64 –

6
»Jude sein, heißt unsterblich sein«, hatte Friedman ihm
einige Tage nach Evas Heimfahrt gesagt. »Jude sein, heißt
ein Schicksal haben – selbst wenn man dieses Schicksal
leicht überleben kann.«
Friedman war groß und stark und hatte ein blasses,
dickes Gesicht und zynische Augen. Er war fast völlig kahl.
Er trug schwere Anzüge aus grünem Tweed. Er war
äußerst großzügig zu Karl und schien wenig Gegenleis-
tung dafür zu erwarten – nur Karl als Zuhörer gelegent-
lich.
»Jude sein, heißt ein Märtyrer sein. Nimm noch einen
Sherry!« Er ging quer durch sein Arbeitszimmer und
schenkte Karl noch ein großes Glas ein. »Da lag dein Feh-
ler bei ihr, mein Junge. Du konntest einen solchen Erfolg
nicht ertragen.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, Gerard. Ich
wollte, daß sie mich so nahm, wie ich bin…«
»Du wolltest, daß sie dich so nahm, wie du dich selbst
siehst, nicht so, wie sie dich sah. Wer will sagen, wer recht
hat? Du siehst dich als Märtyrer, nicht wahr? Was für ein
Jammer! So ein hübsches Mädchen. Du hättest sie lieber
mir abtreten können, statt sie zu vergraulen.«
»Oh, red nicht so, Gerard! Ich habe sie geliebt.«
»Dich selbst aber noch mehr geliebt.«
»Wer tut das nicht?«
»Viele Leute empfinden überhaupt keine Liebe für sich
selbst. Es spricht für dich, daß du dich selbst liebst.«
»Du redest, als wäre ich Narziß.«
– 65 –

»Du siehst nicht so aus. Mach dir nichts vor!«
»Einerlei, ich glaube nicht, daß es überhaupt etwas damit
zu tun hat, daß ich Jude bin. Du und deine Generation,
ihr macht immer etwas so Mystisches aus dem Judentum.
Ihr überkompensiert, was unter Hitler geschah.«
»Möglich.«
»Außerdem bin ich gar kein richtiger Jude. Ich wurde
nicht jüdisch erzogen.«
»Bei so einer Mutter? Nicht jüdisch erzogen? Vielleicht
bist du nicht in die Synagoge gegangen, mein Sohn, aber
du hast es auf andere Art mitbekommen…«
»Oh, Gerard! Du vernebelst die eigentliche Sache – ich
suche nach einer Möglichkeit, sie zurückzugewinnen.«
»Vergiß sie! Such dir ein nettes jüdisches Mädchen! Das
meine ich wirklich. Sie wird dich verstehen. Wenn man es
von allen Seiten betrachtet, Karl, diese nordischen Typen
taugen nicht für das, was du brauchst…«
»Herrgott! Ich wußte nicht, daß du ein Rassist bist.«
»Ich bin nur ein Realist…«
»Das habe ich schon einmal gehört.«
»Na gut. Wenn du Ärger suchst…«
»Vielleicht tue ich es.«
Vater…
Schmerzliche Blicke.
Vater…
Ein Mund, der sich bewegt. Keine Worte.
– 66 –

Schweres Holzkreuz, das sich durch den Sumpf kämpft,
während ein zartes Silberkreuz von einem Hügel aus zu-
sieht.
Hil… NEIN!
Darf nicht bitten.
Will nur… NEIN!
HILF MIR!
Nein!
»Eine formale Religion taugt nichts«, sagte Johnny ihm im
Pub. Johnny war ein Studienkollege Gerards. »Sie ist
einfach nicht zeitgemäß. Du mußt die Antwort in dir
selbst finden. Meditation.«
Johnny war dünn und hatte ein ewig sorgenvolles
Gesicht. Nach dem, was Gerard sagte, war er in seinem
dritten Jahr und kam sehr schlecht voran.
»Man holt sich Trost aus einer Religion, ohne Verant-
wortung zu übernehmen«, sagte Friedman von seinem
Barhocker hinter Johnny. Karl lachte.
Johnny drehte sich zu Friedman um. »Das ist typisch,
nicht? Du weißt nicht, was du redest. Verantwortung? Ich
bin Pazifist – bereit, für meinen Glauben zu sterben. Das
ist mehr, als du tun würdest.«
»Ich habe keinen Glauben…»
»Genau!«
Karl lachte wieder. »Ich bin bereit, gegen jeden in die-
sem Pub passiven Widerstand zu leisten.«
»Oh, halt doch den Mund! Ich habe etwas gefunden, was
keiner von euch beiden je finden wird.«
– 67 –

»Es scheint dir nicht viel geholfen zu haben«, sagte Karl
grausam, bereute es gleich und legte Johnny die Hand auf
die Schulter. Aber der junge Mann zuckte die Achseln und
verließ den Pub.
Karl wurde sehr niedergeschlagen.
»Mach dir keine Sorgen wegen Johnny!« sagte Gerard.
»Er schnappt immer gleich ein.«
»Das ist es nicht. Er hatte recht. Er hat etwas, woran er
glaubt. Mir will es nicht gelingen, etwas zu finden.«
»Das ist gesünder.«
»Ich verstehe nicht, wie du von Gesundheit reden
kannst, bei deinem krankhaften Interesse für Hexensabba-
te und solches Zeug…«
»Wir haben alle unsere Probleme«, sagte Gerard. »Trink
noch einen!«
Karl zog die Stirn kraus. »Ich habe Johnny nur angegrif-
fen, weil er mich verlegen machte, mich irgendwie bloß-
stellte.«
»Wir haben alle unsere Probleme. Trink noch einen!«
»Na schön.«
Gefangen. Versinkend. Kann nicht ich selbst sein. Zu et-
was gemacht, was andere Leute von mir erwarten. Ist das
jedermanns Schicksal? Waren die großen Individualisten
die Produkte ihrer Freunde, die einen großen Indivi-
dualisten zum Freund haben wollten?
Große Individualisten müssen einsam sein. Jeder muß
glauben, sie seien unverwundbar. Und am Ende werden
sie weniger als menschliche Wesen behandelt als alle
anderen. Als Symbole für etwas hingestellt, das es nicht
geben kann. Sie müssen einsam sein.
Einsam…
– 68 –

Es gibt immer einen Grund dafür, einsam zu sein.
Einsam…
»Mami – ich möchte …«
»Wer will wissen, was du möchtest? Fast ein Jahr weg ge-
wesen. Nie geschrieben. Was schert es dich, was ich möch-
te? Wo warst du? Ich hätte sterben können…«
»Versuch mich zu verstehen…«
»Warum sollte ich? Hast du je versucht, mich zu ver-
stehen?«
»Ich habe es versucht, ja…»
»Den Teufel hast du. Was willst du diesmal?«
»Ich möchte…«
»Habe ich dir erzählt, was der Arzt mir gesagt hat…«
Einsam…
Ich brauche…
Ich möchte…
»Man bekommt in dieser Welt nichts, was man sich nicht
verdient hat. Und was man sich verdient hat, bekommt
man auch noch nicht immer.«
Betrunken lehnte er an der Bar und sah den kleinen
Mann mit dem roten Gesicht an, der das gesagt hatte.
»Es gibt eine Menge Leute, die nicht bekommen, was sie
verdient haben«, sagte der Wirt und lachte.
»Was ich meine, ist…«, sagte der rotgesichtige Mann
langsam.
»Warum halten Sie nicht den Mund?« sagte Karl.
– 69 –
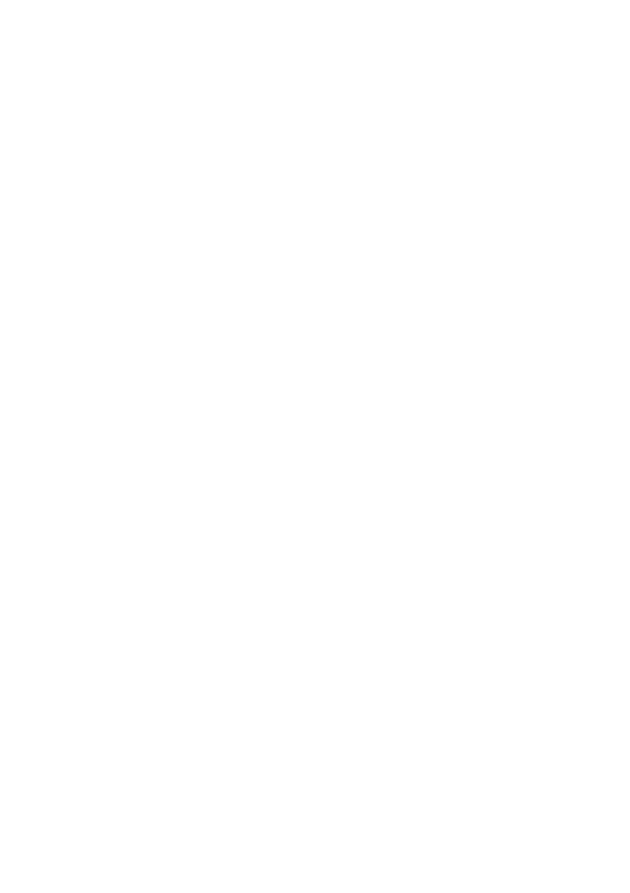
»Halt doch selbst den Mund!«
»Oh, haltet doch beide den Mund!« sagte der Wirt.
Liebe…
Scheu. Zart. Süß,
Liebe …
»Dein Problem, Karl«, sagte Gerard, als sie die High Street
entlang zum ›Mitre‹ gingen, wo Gerard ein Mittagessen
spendieren wollte, »ist, daß du dich an eine romantische
Liebe hängst. Sieh mich an! Ich habe alle möglichen
krankhaften Neigungen – wie du mir so gern mit deiner
vorwurfsvollen Stimme vorhältst. Ich werde so schrecklich
geil, wenn ich eine schwarze Messe beobachte und all das.
Aber ich schleiche nicht umher und schlachte Jungfrauen
ab – teils, weil es gegen das Gesetz wäre. Aber ihr per-
versen Romantiker – euch bietet kein Gesetz Einhalt. Ich
kann es nicht tun, wenn sie nicht einen schwarzen Schlei-
er oder so etwas trägt, aber ihr könnt es nicht tun, wenn
ihr nicht ewige Liebe geschworen habt und sie euch ewige
Liebe geschworen hat und alles fürchterlich vernebelt ist.
Der Schaden, den ihr anrichtet! Wie ihr euch selbst
schadet und den armen Mädchen, die ihr gebraucht! Es ist
widerlich…«
»Du bist noch zynischer als gewöhnlich, Gerard.«
»Nein! Kein bißchen. Ich spreche mit absoluter Auf-
richtigkeit – ich habe in meinem ganzen Leben nichts so
leidenschaftlich ernst gemeint. Romantische Liebe! Es
sollte tatsächlich ein Gesetz dagegen geben. Widerlich.
– 70 –

Verheerend. Sieh dir an, wie es Romeo und Julia ging! Das
muß uns allen eine Warnung sein.«
»Oh, Gerard…«
»Warum kannst du nicht einfach ficken und es genießen?
Laß es dabei bleiben! Nimm es als selbstverständlich hin!
Pervertiere nicht auch noch irgendein armes Mädchen!«
»Sie sind es gewöhnlich, die es so haben wollen.«
»Da ist was dran, mein Lieber.«
»Glaubst du überhaupt nicht an Liebe, Gerard?«
»Mein lieber Karl, wenn ich nicht an irgendeine Art von
Liebe glaubte, würde ich mir dann die Mühe machen, dir
diese Warnung zu geben?«
Karl lächelte ihn an. »Du bist sehr lieb, Gerard…«
»Oh, mein Gott! Nicht doch, Karl, bitte! Verstehst du
nicht, was ich meine? Wenn du mich noch einmal so an-
siehst, gebe ich dir nicht dieses teure Essen aus. Ich meine
es ernst.«
Karl seufzte. Der einzige Mann, der ihm je uneigennützi-
ge Zuneigung geschenkt hatte, war auch der einzige
Mann, der sich jede Zuneigung von ihm verbat. Es war
wirklich Ironie.
Ich möchte…
Ich brauche…
Ich möchte…
– 71 –
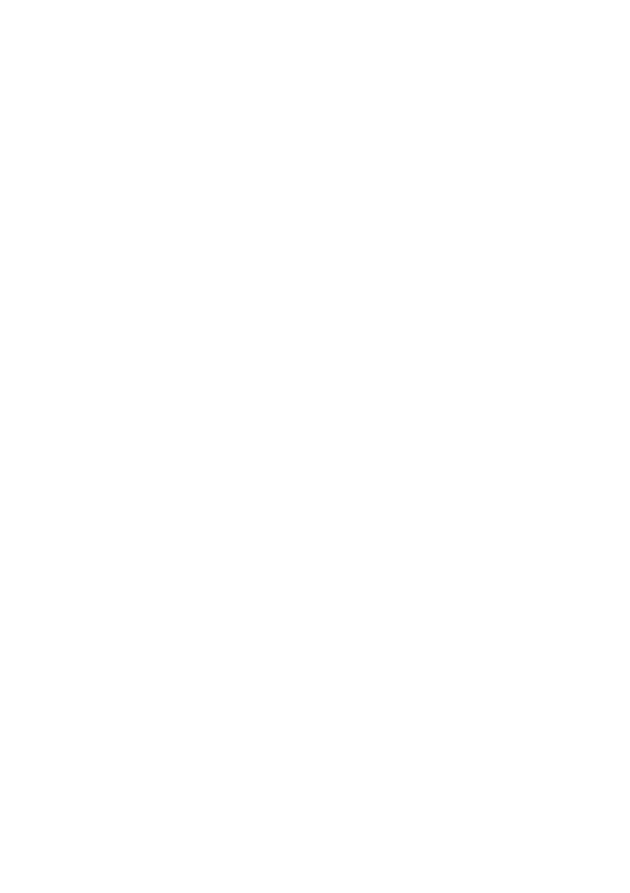
»Monica. Es ist irgendein Mangel in mir…«
»Was für ein Mangel?«
»Nun, vielleicht ist es mehr der Mangel eines Mangels,
wenn du verstehst, was ich meine.«
»Oh, um Himmels willen!«
»Du bist sensibel«, hatte Eva ihm gesagt.
»Nein, ich sagte dir – ich bemitleide mich selbst. Das häl-
tst du für Sensibilität.«
»Oh, Karl. Warum hast du kein Erbarmen für dich
selbst?«
»Erbarmen? Ich verdiene es nicht.«
»Wonach suchst du, Karl?« fragte Gerard beim Essen.
»Ich weiß es nicht. Vielleicht nach dem Heiligen Gral.
Eva schien zu glauben, daß ich ihn finden würde.«
»Warum nicht? Er müßte heutzutage ein Vermögen wert
sein. Trinken wir noch eine Flasche?«
»Du weißt, ich bin kein Märtyrer, Gerard, ich bin kein
Heiliger, ich bin kein Held, und ich bin auch nicht
wirklich ein Lump. Ich bin einfach ich selbst. Warum
können die Leute mich nicht so nehmen?«
»Karl – ich mag dich gerade, weil du genauso bist, wie du
bist.«
»Weil du den Gönner spielen kannst. Dir gefällt es, daß
ich so durcheinander bin, meinst du.«
»Vielleicht hast du recht. Noch eine Flasche?«
»Na schön.«
– 72 –

Gerard hatte ihm angeboten, die Kosten für sein Psycholo-
giestudium zu übernehmen.
»Ich tue es nur, weil ich mir große Sorgen mache, was
sonst aus dir wird«, hatte er gesagt. »Wenn es so wei-
tergeht, trittst du noch zur katholischen Kirche über!«
Er hatte ein Jahr studiert und es dann wieder aufgege-
ben. Er hatte nur Jung studieren wollen, und sie hatten
darauf bestanden, daß er auch noch alles mögliche andere
studieren sollte. Ihm sagte das meiste andere nicht zu.
Gott?
Gott?
Gott?
Keine Antwort.
Mit Gerard war er ernst, eindringlich, intelligent.
Mit Johnny war er überlegen, herablassend.
Mit manchen war er still. Mit anderen laut. In Gesell-
schaft von Narren war er fröhlich wie ein Narr. In Gesell-
schaft von Leuten, die er bewunderte, war er froh, wenn
es ihm gelang, scharfsinnig zu erscheinen.
»Warum bin ich alles mögliche und benehme mich so
verschieden mit allen Leuten, Gerard? Ich weiß einfach
nicht, wer ich wirklich bin. Wer von diesen Leuten bin ich,
Gerard? Was stimmt mit mir nicht?«
»Vielleicht bemühst du dich nur ein wenig zu sehr zu
gefallen, Karl.«
– 73 –

7
Er hatte Monica im Sommer 1962 wiedergesehen, kurz
nachdem er sein Studium aufgegeben harte. Er war mit
allerlei Gelegenheitsarbeiten beschäftigt, und seine Stim-
mung war sehr schlecht.
Zu der Zeit war ihm Monica als große Hilfe erschienen,
eine großartige Führung durch die seelische Düsternis,
die ihn umfangen hatte.
Sie wohnten beide nicht weit vom Holland Park, und
dort hatten sie sich eines Sonntags am Goldfischbecken in
den Gartenanlagen getroffen.
Sie gingen in diesem Sommer fast jeden Sonntag im
Holland Park spazieren. Er war zu dieser Zeit vollkommen
beherrscht von Jungs merkwürdigem christlichen Mystizis-
mus.
Sie, die Jung ablehnte, hatte bald begonnen, all seine
Gedanken schlechtzumachen.
Obwohl sie ihn nie wirklich überzeugte, gelang es ihr
doch bald, ihn unsicher zu machen.
Es dauerte sechs Monate, bis sie miteinander ins Bett
gingen.
Er erwachte und sah Johannes vor sich stehen. Das
bärtige Gesicht des Täufers drückte Erwartung und Sorge
aus.
»Nun, Immanuel?«
Karl kraulte sich seinen Bart. Er nickte. »Also gut, Jo-
hannes. Ich will euch helfen, um euretwillen, weil ihr
freundlich zu mir wart und mir das Leben gerettet habt.
– 74 –

Aber würdest du dafür Männer ausschicken, um meinen
Wagen so bald wie möglich hierher zu holen? Ich will se-
hen, ob er sich reparieren läßt.«
»Das will ich tun.«
»Du darfst meine Kraft nicht zu hoch einschätzen, Jo-
hannes…«
»Ich glaube absolut an deine Kraft…«
»Ich hoffe, du wirst nicht enttäuscht.«
»Das werde ich nicht.« Johannes legte seine Hand auf
Glogauers Arm. »Du wirst mich morgen taufen, um allen
Leuten zu zeigen, daß Adonai mit uns ist.«
Er war immer noch beunruhigt über den Glauben des
Täufers an seine Kräfte, aber er konnte nichts mehr sagen.
Wenn auch andere den Glauben des Täufers teilten, konn-
te er möglicherweise etwas tun.
Glogauer spürte wieder die Hochstimmung des letzten
Abends, und das breite Lächeln kam ungewollt wieder auf
seine Lippen.
Der Täufer begann zu lachen, unsicher zuerst, aber dann
gelöster.
Glogauer fing auch an zu lachen, konnte sich nicht hal-
ten, mußte nur ab und zu pausieren, um Luft zu schnap-
pen.
Es war vollkommen widersinnig, daß er es sein sollte,
der mit Johannes dem Täufer Christus den Weg bereiten
sollte.
Aber Christus war noch nicht geboren. Vielleicht wurde
Glogauer das allmählich klar, ein Jahr vor der Kreuzigung.
– 75 –

Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und
wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des
eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahr-
heit. Johannes zeugt von ihm, ruft und spricht: Dieser
war es, von dem ich gesagt habe: Nach mir wird kom-
men, der vor mir gewesen ist; denn er war eher als ich.
Johannes 1, 14-15
Es war ungemütlich heiß.
Sie saßen im Schatten der Cafeteria und beobachteten in
der Ferne ein Cricketspiel.
In der Nähe saßen zwei Mädchen und ein Junge auf dem
Rasen und tranken Orangensaft aus Plastikbechern. Eines
der Mädchen hatte eine Gitarre auf dem Schoß liegen, es
stellte den Becher ab und begann zu spielen und mit ho-
her, zarter Stimme ein Volkslied dazu zu singen.
Karl versuchte den Text zu verstehen. Am College hatte
er eine Vorliebe für Volksmusik entwickelt.
»Das Christentum ist tot.« Monica schlürfte ihren Tee.
»Die Religion stirbt. Gott wurde 1945 getötet.«
»Es könnte eine Wiederauferstehung geben«, sagte er.
»Hoffentlich nicht. Die Religion wurde aus der Angst ge-
boren. Das Wissen vernichtet die Angst. Wenn es keine
Angst mehr gibt, kann die Religion nicht überleben.«
»Du glaubst, es gibt keine Angst in unseren Tagen?«
»Nicht mehr dieselbe Angst, Karl.«
»Hast du dich nie mit der Idee des Christus beschäftigt?«
fragte er sie, den Kurs wechselnd. »Was die für die Chris-
ten bedeutet?«
– 76 –

»Die Idee des Traktors bedeutet dasselbe für einen
Marxisten«, erwiderte sie.
»Aber was kam zuerst? Die Idee oder die Wirklichkeit des
Christus?«
Sie zuckte die Achseln. »Die Wirklichkeit, wenn das von
Belang ist. Jesus war ein jüdischer Aufrührer, der eine Re-
volte gegen die Römer organisierte. Er wurde für seine Be-
mühungen gekreuzigt. Das ist alles, was wir wissen, und
mehr brauchen wir auch nicht zu wissen.«
»Eine große Religion kann nicht so simpel begonnen
haben.«
»Wenn die Leute eine brauchen, machen sie eine große
Religion aus den unwahrscheinlichsten Anfängen.«
»Das ist ja gerade, was ich meine, Monica.« Er gestiku-
lierte wild, und sie rückte ein wenig von ihm ab. »Die Idee
ging der Wirklichkeit Christi voraus.«
»Oh, Karl, red nicht weiter! Die Wirklichkeit Jesu ging
der Idee Christi voraus.«
Ein Paar ging vorbei und sah sie neugierig an, als sie mit-
einander stritten.
Monica bemerkte sie und verstummte.
»Warum bist du so wild darauf, die Religion zu verurtei-
len und abfällig über Jung zu reden?« fragte er.
Sie stand auf, und er erhob sich auch, aber sie schüttelte
den Kopf.
»Ich geh nach Hause, Karl. Bleib du hier! Wir sehen uns
in einigen Tagen.«
Er sah ihr nach, während sie auf dem breiten Weg dem
Parktor zuschritt: Vielleicht schätzte er ihre Gesellschaft,
dachte er, weil sie bereit war, genauso heftig zu streiten
wie er – oder jedenfalls fast so heftig.
– 77 –

Vampire.
Wir sind ein Paar.
Als er am nächsten Tag von der Arbeit nach Hause kam,
fand er einen Brief vor.
Sie mußte ihn geschrieben haben, nachdem sie ihn
verlassen hatte, und noch am selben Tag aufgegeben
haben. Er öffnete ihn und begann zu lesen.
Lieber Karl,
Gespräche scheinen keine große Wirkung auf Dich zu
haben. Weißt Du, es ist, als ob Du den Klang der Stimme
hörtest, den Rhythmus der Wörter, ohne je zu hören, was
man Dir mitzuteilen versucht.
Du bist ein wenig wie ein sensibles Tier, nehme ich an,
das nicht versteht, was man ihm sagt, aber spürt, ob die
Person, die zu ihm spricht, freundlich oder zornig ist und
so weiter. Deshalb schreibe ich Dir – um zu versuchen,
Dir meine Gedanken mitzuteilen. Wenn wir zusammen
sind, reagierst Du zu sehr gefühlsmäßig.
Er lächelte darüber. Es war gerade einer der Gründe,
warum er so gern mit ihr zusammen war, daß sie meistens
leidenschaftlich reagierte.
– 78 –

Du machst den Fehler, das Christentum als etwas zu be-
trachten, das sich innerhalb weniger Jahre entwickelte,
vom Tode Jesu bis zu der Zeit, in der die Evangelien ge-
schrieben wurden. Aber das Christentum war nichts Neu-
es. Nur der Name war neu. Das Christentum war nur
eine Phase in der Begegnung, der gegenseitigen Befruch-
tung und der Metamorphose der westlichen Logik und
des östlichen Mystizismus. Sieh Dir an, wie sich die Reli-
gion selbst im Laufe der Jahrhunderte änderte, wie sie
immer wieder neu ausgelegt wurde, um sie den
veränderten Zeiten anzupassen. Christentum ist nur ein
neuer Name für ein Konglomerat aus alten Mythen und
Philosophien. Die Evangelien berichten nichts anderes
als den alten Sonnenmythos und werfen einige der Ge-
danken der Griechen und Römer durcheinander.
Schon im zweiten Jahrhundert wiesen jüdische Gelehrte
nach, was für ein Mischmasch sie darstellten.
Sie wiesen auf die großen Ähnlichkeiten zwischen den
verschiedenen Sonnenmythen und dem christlichen My-
thos hin. Die Wunder geschahen nicht – sie wurden spä-
ter erfunden, von hier und dort entliehen.
Erinnerst Du Dich an die alten viktorianischen Professo-
ren, die behaupteten, Plato sei in Wirklichkeit ein Christ
gewesen, weil er christliche Gedanken vorwegnahm?
Christliche Gedanken!
Das Christentum war ein Boden für Gedanken, die schon
Jahrhunderte vor Christus im Umlauf waren. War Mark
Aurel ein Christ? Er schrieb in der direkten Tradition
westlicher Philosophie. Deshalb faßte das Christentum in
Europa Fuß und nicht im Osten!
Du hättest bei Deiner Voreingenommenheit Theologe sein
– 79 –

sollen – und nicht versuchen sollen, Psychologe zu
werden. Das gleiche gilt für Deinen Freund Jung.
Versuch Dir all diesen krankhaften Unsinn aus dem Kopf
zu schlagen, und Du wirst mit Deinem Leben viel besser
zurechtkommen.
Deine Monica!
Er zerknüllte den Brief und warf ihn weg. Später am
Abend kam ihm die Versuchung, ihn noch einmal zu
lesen, aber er widerstand der Versuchung.
Die Zeitmaschine kam ihm fremd vor. Vielleicht, weil er
sich so an das primitive Leben der Essener gewöhnt hatte,
erschien ihm die aufgeplatzte Kugel so sonderbar, wie sie
ihnen erscheinen mußte.
Er berührte den Stift, der normalerweise die Luft-
schleuse von außen betätigt hätte, aber es geschah nichts.
Er kroch durch den Riß hinein. Die ganze Flüssigkeit war
ausgelaufen, wie er schon wußte, und ohne die polstern-
de Wirkung der Flüssigkeit würde jede Reise durch die
Zeit wahrscheinlich sowieso tödlich für ihn enden.
Johannes der Täufer spähte hinein, als hätte er Angst,
Glogauer würde versuchen, mit seinem Wagen zu fliehen.
Glogauer lächelte ihn an. »Mach dir keine Sorgen, Jo-
hannes!«
Alles war tot. Die Motoren liefen nicht an, und selbst
wenn er ihr Gehäuse geöffnet hätte, er war nicht
Techniker genug, um sie in Ordnung zu bringen. Keines
der Instrumente arbeitete. Die Zeitmaschine war tot.
– 80 –

Wenn Headington nicht eine neue Maschine baute und
ihm nachschickte, mußte er für immer in dieser Zeit
bleiben.
Die Einsicht traf ihn wie ein Schock.
Er würde wahrscheinlich das zwanzigste Jahrhundert nie
wiedersehen und nicht berichten können, was er hier
erlebte.
Tränen traten in seine Augen. Er wankte von der Maschi-
ne weg und stieß Johannes beiseite.
»Was ist, Immanuel?«
»Was mache ich hier? Was mache ich hier?« rief er in
Englisch. Er brachte die Worte kaum heraus. Auch sie
kamen ihm fremd vor. Was ging mit ihm vor?
Es kam ihm der Gedanke, die ganze Sache könne eine Il-
lusion sein, ein langer Traum. Die Idee der Zeitmaschine
kam ihm jetzt absolut lächerlich vor. Das Ding war eine
Unmöglichkeit.
»O Gott«, stöhnte er, »was geht vor?«
Wieder überkam ihn ein Gefühl völliger Verlassenheit.
– 81 –

8
Wo bin ich?
Wer bin ich?
Was bin ich?
Wo bin ich?
»Zeit und Identität«, pflegte Headington voller Begeiste-
rung zu sagen, »die zwei großen Mysterien. Winkel, Kur-
ven, weiche und harte Perspektiven. Was sehen wir? Was
sind wir, daß wir auf besondere Art sehen? Was können
wir sein oder gewesen sein? All die Windungen und Kur-
ven der Zeit. Ich hasse die Gedanken, die die Zeit als eine
Dimension des Raumes dargestellt wissen wollen, sie mit
räumlichen Metaphern beschreiben. Kein Wunder, daß sie
nirgendwohin führen. Die Zeit hat nichts mit dem Raum
zu tun – sie hat mit der Psyche zu tun. Ah! Niemand ver-
steht das. Nicht einmal ihr!«
Die anderen Mitglieder der Gruppe hatten ihn als ein
wenig geistesverwirrt angesehen.
»Ich bin der einzige«, hatte er ruhig und ernst gesagt,
»der die Natur der Zeit wirklich versteht…«
»Und um da einzuhaken…«, sagte Mrs. Rita Blen unge-
rührt. »Ich glaube, es ist Zeit für eine Tasse Tee, meint ihr
nicht?«
Die anderen Mitglieder stimmten ihr begeistert zu.
Mrs. Rita Blen war ein wenig taktlos gewesen. Heading-
ton war beleidigt aufgestanden und gegangen.
»Ach, was«, sagte sie. »Ach was…«
– 82 –

Aber die anderen nahmen es ihr übel. Headington war
schließlich sehr bekannt und gab der Gruppe ein gewisses
Prestige.
»Ich hoffe, er kommt wieder«, hatte Glogauer gemur-
melt.
Er litt schon seit seiner Jugend unter Migräne. Ihm wurde
dann schwindelig, er mußte brechen und wurde vollkom-
men von Schmerzen beherrscht.
Oft begann er während der Anfälle eine andere Identität
anzunehmen – die einer Person aus einem Buch, das er
gerade las, eines Politikers, der zu der Zeit viel genannt
wurde, einer historischen Gestalt, wenn er kurz zuvor
eine Biographie gelesen hatte.
Das einzige, was alle kennzeichnete, waren ihre Ängste.
Heyst in Victory war mit den drei Männern beschäftigt
gewesen, die auf die Insel kamen, hatte sich gesorgt, wie
er sie aufhalten, wie er sie möglichst töten könnte (als
Heyst war er ein etwas verfeinerterer Charakter geworden
als Conrads). Nachdem er die Geschichte der russischen
Revolution gelesen hatte, hielt er sich für Sinowjew, den
Minister für Verkehrs- und Telegrafenwesen, dem es ob-
lag, Ordnung in das Chaos von 1918 zu bringen, und der
sich dabei aber auch hüten mußte, daß er nicht nach
wenigen Jahren einer Säuberung zum Opfer fiele.
Er lag dann in einem verdunkelten Zimmer, mit gräßli-
chen Kopfschmerzen, und konnte nicht richtig schlafen,
weil er keine Lösung für die rein hypothetischen Proble-
me fand, die ihn verfolgten. Er verlor den Sinn für seine
eigene Identität und die Umstände völlig, wenn niemand
– 83 –

kam, um ihn daran zu erinnern, wer und wo er war. Moni-
ca hatte es belustigt, als er ihr das erzählte.
»Eines Tages«, sagte sie, »wirst du aufwachen und fragen,
wer du bist – und ich werde es dir nicht sagen.«
»Du bist mir eine feine Sozialarbeiterin!« hatte er la-
chend gesagt.
Keiner von beiden sorgte sich wegen dieser harmlosen
Halluzinationen. In seinem alltäglichen Leben wurde er
von keinen abnorm schizoiden Tendenzen geplagt, außer
daß er seine Rolle manchmal ein wenig änderte, um sie
der Gesellschaft anzupassen, in der er sich befand; er
ertappte sich dabei, daß er unbewußt Nuancen der
Sprechweise anderer Leute nachahmte, aber ihm war be-
wußt, daß das alle Leute bis zu einem gewissen Grade
tun. Das gehört zum Leben.
Manchmal wanderte er umher und wunderte sich dar-
über, wie die Persönlichkeit anderer Leute sich seiner
eigenen überlagerte.
Einmal war er in einem Pub, als er betrunken war, plötz-
lich vom Tisch aufgesprungen, hatte die Arme ge-
schwenkt, war auf und nieder gesprungen und hatte
Monica angegrinst. »Sieh mich an!« hatte er gesagt. »Sieh –
die Koralleninsel…«
Sie hatte ihn ärgerlich angesehen. »Was ist jetzt mit dir
los? Sie werden uns hinauswerfen, wenn du dich so
benimmst.«
»Ich bin's doch nur, bin über's Meer gekommen, ich bin
Barnacle Bill, der Seemann«, sang er.
»Du verträgst nicht viel Alkohol, Karl, das ist dein Pro-
blem…«
»Ich vertrage zuviel – das ist mein Problem.«
– 84 –

»He, was soll das?« fragte ein Mann an der Bar, dessen
Ellbogen er angestoßen hatte.
»Ich wünschte, ich wüßte es, mein Freund. Ich wünsch-
te, ich wüßte es.«
»Komm, Karl!« Sie war aufgestanden und zupfte an sei-
nem Ärmel.
»Das Leben jedes Mannes verkleinert mich«, sagte er,
während sie ihn zur Tür hinausschleppte.
Pubs und Schlafzimmer; Schlafzimmer und Pubs. Er
schien den größten Teil seines Lebens im Halbdunkel zu
verbringen. Selbst im Buchladen war es meistens düster.
Es hatte natürlich Tage draußen gegeben – Sonnentage
und helle Wintertage –, aber all seine Erinnerungen an
Monica standen vor dunklen Hintergründen irgendeiner
Form. Sie stapften durch schmutzigen Schnee im Park un-
ter diesem typisch englischen Himmel, dem schweren,
bleigrauen Himmel.
Ganz gleich zu welcher Stunde, sie schienen immer in
der Dämmerung miteinander gelebt zu haben, nach
diesen ersten Begegnungen im Sommer, bevor sie mitein-
ander geschlafen hatten.
Er hatte einmal gesagt: »Ich habe einen zwielichten
Geist…«
»Wenn du einen getrübten Geist meinst, stimme ich dir
voll zu«, hatte sie geantwortet.
Er ignorierte ihre Bemerkung. »Es ist meine Mutter, glau-
be ich. Sie hatte nie einen klaren Begriff von der Reali-
tät…«
– 85 –

»Es wäre alles ganz in Ordnung mit dir, wenn du dich
den Dingen stellen würdest – ein Schuß zuviel Narzißmus,
das ist alles.«
»Jemand sagte mir, ich haßte mich selbst zu sehr…«
»Einfach zuviel Ich.«
Er hielt seinen beschnittenen Penis in der Hand und sah
ihn liebevoll an.
»Du bist der einzige Freund, den ich habe. Der einzige
Freund, den ich habe.«
Oft nahm er in seinen Gedanken einen selbständigen
Charakter an. Ein lieber Freund, ein Freudenspender.
Doch auch ein bißchen ein loser Bursche, der ihn immer
wieder in Schwierigkeiten brachte.
Weiche Silberkreuze, die sich auf der blanken Meeresober-
fläche ausbreiteten.
Platsch!
Hölzerne Kreuze fielen vom Himmel.
Platsch!
Sie zerrissen die Oberfläche und schlugen die Silber-
kreuze entzwei.
»Warum zerstöre ich alles, was ich liebe?«
»Oh, Gott! Laß das weinerliche Pubertätsgestammel,
Karl, ich bitte dich!«
Platsch.
– 86 –
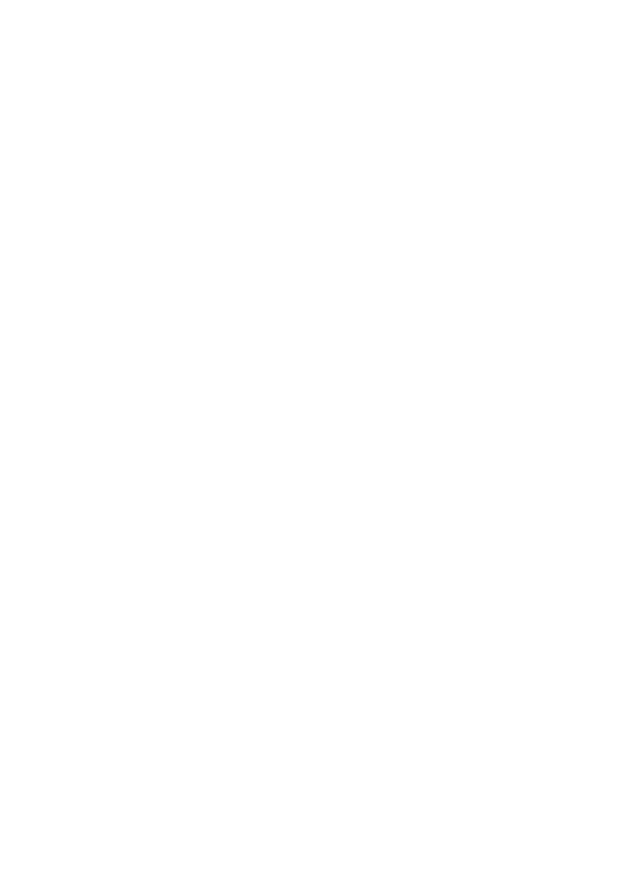
Durch die ganze Arabische Wüste zog ich meinen Weg, ein
Sklave der Sonne, auf der Suche nach meinem Gott.
»Zeit und Identität – die beiden großen Mysterien…«
Wo bin ich?
Wer bin ich?
Was bin ich?
Wo bin ich?
– 87 –

9
Fünf Jahre in der Vergangenheit.
Fast zweitausend Jahre in der Zukunft.
Im heißen, verschwitzten Bett mit Monica.
Wieder einmal hatte ein Ansatz zu einem normalen
Liebesakt nach und nach zur Ausübung leicht abartiger
Handlungen geführt, die sie mehr zu befriedigen schienen
als alles andere.
Ihr richtiges Werben und die Erfüllung sollten noch
kommen. Wie gewöhnlich würden sie verbaler Natur sein.
Wie gewöhnlich würden sie Ihre Klimax in einem zor-
nigen Streitgespräch finden. »Ich nehme an, du willst mir
sagen, daß du wieder nicht befriedigt bist.« Sie nahm die
brennende Zigarette, die er ihr in der Dunkelheit reichte.
»Mir fehlt nichts«, sagte er.
Es herrschte eine Weile Stille, während sie rauchten.
Schließlich begann er doch zu reden, obwohl er wußte,
wohin es führen würde.
»Es ist doch Ironie, nicht?« begann er.
Er wartete auf ihre Antwort. Sie hielt sie noch eine Weile
zurück.
»Was?« fragte sie endlich.
»All dies. Du bringst den ganzen Tag damit zu, Neuro-
tikern mit ihren sexuellen Problemen zu helfen. Und in
der Nacht tust du dasselbe wie sie.«
»Nicht im gleichen Ausmaß. Du weißt, daß es bei allem
nur auf den Grad ankommt.«
»So sagst du.«
– 88 –

Er drehte den Kopf herum und betrachtete in dem Ster-
nenlicht, das durchs Fenster kam, ihr Gesicht.
Sie war ein hagerer Rotkopf mit der ruhigen,
professionellen Verführerstimme der psychiatrischen Hel-
ferin. Es war eine so weiche, unaufrichtige Stimme. Nur
gelegentlich, wenn sie besonders erregt wurde, ließ ihre
Stimme ihren wahren Charakter durchblicken.
Ihre Gesichtszüge, dachte er, erscheinen nie entspannt,
nicht einmal, wenn sie schlief. Ihre Blicke waren ewig
wachsam, ihre Bewegungen selten spontan. Jeder Zoll ih-
res Wesens war abgeschirmt, und das war wahrscheinlich
der Grund, weshalb sie so wenig Spaß am normalen
Liebesakt fand.
Er seufzte.
»Du kannst dich einfach nicht gehenlassen.«
»Oh, hör mir doch auf, Karl! Sieh dich doch selber an,
wenn du nach neurotischem Fehlverhalten suchst!«
Sie bedienten sich der psychiatrischen Terminologie.
Beide fühlten sich wohler, wenn sie etwas beim Namen
nennen konnten.
Er wälzte sich von ihr weg, griff nach dem Aschenbecher
auf dem Nachttisch und erhaschte einen Blick auf sich
selbst im Spiegel über der Frisierkommode.
Er war ein bleicher, überspannter, düsterer jüdischer
Kleriker mit einem Kopf voller Vorstellungen und unge-
löster fixer Ideen, einem Körper voller widersprüchlicher
Emotionen. Er zog bei diesen Streitereien mit Monica
immer den kürzeren. Verbal zumindest war sie die Do-
minierende.
Diese Wortgefechte erschienen ihm oft perverser als ihre
sexuellen Handlungen, bei denen er wenigstens meistens
– 89 –

eine männliche Rolle spielte. Zu dieser Zeit war ihm be-
wußt geworden, daß er im wesentlichen passiv, masochis-
tisch und unentschlossen war. Sogar sein häufig aufkom-
mender Zorn war in diesen Tagen impotent.
Monica war um zehn Jahre älter als er, um zehn Jahre
bitterer. Als Individuum war sie dynamischer als er, glaub-
te er jedenfalls. Doch sie versagte sehr oft bei ihrer Arbeit.
Sie machte aber weiter und wurde nur oberflächlich
immer zynischer, doch im stillen hoffte sie vielleicht doch
auf ein paar aufsehenerregende Erfolge bei Patienten. Sie
versuchte zuviel zu erreichen, das war der Fehler, dachte
er. Die Priester boten im Beichtstuhl ein Allheilmittel an;
die Psychiater versuchten zu heilen, und in den meisten
Fällen versagten sie. Aber sie versuchten es wenigstens,
und er überlegte, ob das an sich nicht schon eine Tugend
war.
»Ich habe mich angesehen«, sagte er.
Schlief sie?
Er drehte sich herum.
Ihre wachsamen Augen waren noch offen und sahen
zum Fenster hinaus.
»Ich habe mich angesehen«, wiederholte er. »So wie Jung
es tat. ›Wie kann ich diesen Menschen helfen, wenn ich
selbst fliehe und vielleicht auch an dem morbus sacer
einer Neurose leide?‹ das fragte sich Jung selbst…«
»Dieser alte Effekthascher. Dieser alte Rationalisierer sei-
nes eigenen Mystizismus. Kein Wunder, daß aus dir nie
ein Psychiater wurde.«
»Ich wäre nie ein guter geworden. Das hatte nichts mit
Jung zu tun…«
»Wirf es nicht mir vor…«
– 90 –

»Ich wollte Menschen helfen. Ich fand keinen Zugang zu
ihnen. Du hast mir selbst gesagt, daß du ähnlich emp-
findest – du hältst es für zwecklos.«
»Nach einer harten Arbeitswoche könnte ich so etwas
sagen. Gib mir noch eine Zigarette!«
Er öffnete die Packung auf dem Nachttisch, steckte zwei
Zigaretten in den Mund, zündete sie an und reichte ihr
dann eine.
Fast unbewußt nahm er wahr, wie die Spannung wuchs.
Der Streit war sinnlos, wie immer. Aber nicht der Streit
war das Wichtige: Es war einfach der Ausdruck des eigent-
lichen Verhältnisses. Er fragte sich, ob auch der überhaupt
von Bedeutung war.
»Du sprichst nicht die Wahrheit.« Er wußte, daß es jetzt
kein Halten mehr geben würde, da das Ritual in Gang
gesetzt war.
»Ich sage die volle Wahrheit. Ich habe kein Bedürfnis,
meine Arbeit aufzugeben. Sie hinzuschmeißen. Ich will
keine Versagerin sein…«
»Versagerin? Du bist noch melodramatischer als ich!«
»Du bist zu ernst, Karl. Du müßtest ein wenig aus dir
herausgehen.«
Er höhnte: »Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich
meine Arbeit aufgeben, Monica. Du eignest dich nicht
besser dafür als ich.«
Sie zuckte die Achseln und zupfte an der Decke. »Du bist
ein gemeiner Hund.«
»Ich bin nicht eifersüchtig auf dich, wenn du das meinst.
Du wirst nie verstehen, wonach ich suche.«
Ihr Lachen klang spröde. »Der moderne Mensch auf der
Suche nach einer Seele, wie? Der moderne Mensch auf
– 91 –

der Suche nach einer Krücke, würde ich sagen. Und du
kannst das auffassen, wie du willst.«
»Wir zerstören die Mythen, die die Welt in Bewegung
halten.«
»Jetzt sagst du gleich: ›Und was setzen wir an ihre Stelle?‹
Du klingst schal und dumm, Karl. Du hast noch nie etwas
vernünftig betrachtet – nicht einmal dich selbst.«
»Was soll's? Du sagst, der Mythos sei unwichtig.«
»Die Wirklichkeit, die ihn entstehen läßt, ist wichtig.«
»Jung wußte, daß der Mythos auch die Wirklichkeit her-
beiführen kann.«
»Was beweist, was für ein alter Trottel er war.«
Er streckte seine Beine aus. Dabei berührte er ihre und
fuhr zurück. Er kratzte sich am Kopf. Sie lag immer noch
da und rauchte, aber sie lächelte jetzt.
»Komm!« sagte sie. »Laß uns ein bißchen über Christus
reden.«
Er sagte nichts.
Sie reichte ihm das Ende ihrer Zigarette, und er legte es
in den Aschenbecher. Er schaute auf seine Uhr.
Es war zwei Uhr morgens.
»Warum tun wir das?« fragte er.
»Weil wir müssen.«
Sie schob ihre Hand unter seinen Hinterkopf und zog
ihn zu ihren Brüsten heran. »Was können wir sonst tun?«
Er begann zu weinen.
Großmütig im Sieg, streichelte sie seinen Kopf und
sprach leise auf ihn ein.
Zehn Minuten später liebte er sie brutal.
Zehn Minuten danach weinte er wieder.
– 92 –

Betrug.
Er betrog sich selbst und wurde so betrogen.
»Ich möchte Menschen helfen.«
»Du solltest dir lieber zuerst jemanden suchen, der dir
hilft.«
»Oh, Monica. Monica.«
Wir Protestanten sind auf dem besten Wege, zu diesem
Problem zu gelangen: Sollen wir die imitatio Christi so
verstehen, daß wir sein Leben kopieren, gewissermaßen
seine Wundmale nachäffen, oder, ihn in tieferem Sinne
verstehend, unser Leben so leben, wie er das seinige in
seinem ihm allein eigentümlichen So-sein gelebt hat? Das
Christusleben nachahmen ist keine leichte Sache; aber es
ist unsäglich viel schwieriger, das eigene Leben so zu
leben, wie Christus das seine gelebt hat. Jeder würde
gegen seine historische Bedingtheit verstoßen – und sie
dadurch zwar erfüllen; jedoch würde er in seiner Art ver-
kannt, verspottet, gequält und gekreuzigt… Neurose ist
die Persönlichkeitsspaltung in letzter Linie.
C. G. JUNG: Über die Beziehungen der Psychotherapie
zur Seelsorge.
Einsam…
Ich bin einsam…
– 93 –

»So, er ist also tot? Hat mir nie einen Penny geschickt, als
er noch lebte. Hat mich nie besucht. Jetzt hinterläßt er dir
ein Geschäft.«
»Mami – es ist eine Buchhandlung. Vielleicht geht sie gar
nicht gut.«
»Ein Buchladen! Das ist typisch für ihn, nehme ich an.
Ein Buchladen!«
»Ich werde ihn verkaufen, wenn du willst, Mami – dir das
Geld geben.«
»Besten Dank!« sagte sie voll Ironie. »Nein, behalte du
es! Vielleicht kommst du dann nicht mehr zu mir, um
mich anzupumpen.«
»Es ist komisch, daß sie nicht früher geschrieben haben«,
sagte er.
»Sie hätten uns zur Beerdigung einladen können.«
»Wärst du hingegangen?«
»Er war mein Mann, oder nicht? Dein Vater.«
»Ich nehme an, sie brauchten eine Weile, bis sie her-
ausfanden, wo wir wohnen.«
»Wie viele Glogauers gibt es in London?«
»Stimmt. Wenn ich jetzt darüber nachdenke – es ist doch
merkwürdig, daß du nie etwas von ihm gehört hast.«
»Warum hätte ich von ihm hören sollen? Er stand nicht
im Telefonbuch. Wie hieß der Laden?«
»Mandala Bookshop. Er ist in der Great Russel Street.«
»Mandala. Was für ein Name ist das?«
»Sie verkaufen Bücher über Mystizismus und solche
Dinge.«
»Na, ganz gewiß gehst du ihm nach, nicht? Ich habe
immer gesagt, daß du ihm nachgehst.«
– 94 –

Er bahnte sich einen Weg durch die Bücher seines
Vaters. Der vordere Teil des Ladens war verhältnismäßig
ordentlich; die Bücher standen in den Regalen, die den
kleinen Raum fast ganz ausfüllten. Der hintere Raum war
jedoch voll von schwankenden, bis an die Decke rei-
chenden Bücherstapeln, die um den unaufgeräumten
Schreibtisch aufgetürmt waren.
Im Keller waren noch mehr Bücher, übereinandergesta-
pelt, mit schmalen Gängen, die sich wie ein Irrgarten zwi-
schen ihnen durchzogen.
Er gab es auf, den Laden aufzuräumen.
Am Ende ließ er die Bücher, wo sie waren, veränderte
einiges im Hauptteil des Ladens, stellte einige seiner
eigenen Möbel in den oberen Teil und fühlte sich dann
eingerichtet. Was für einen Sinn hatte es, etwas zu
verändern?
Er stieß auf einige Privatdrucke von Gedichten unter
dem Namen John Fry. Das fremde Mädchen, das im Laden
arbeitete, sagte ihm, daß sie von seinem Vater seien. Er las
einige. Sie waren nicht sehr gut, ziemlich überladen mit
Symbolismus und Bildern, aber sie enthüllten eine
Persönlichkeit, die so sehr seiner eigenen glich, daß er es
nicht ertragen konnte, lange zu lesen.
»Er war ein komischer alter Kauz«, sagte der dicke Kunde
mit dem aufgeschwemmten Gesicht, der kam, um Bücher
über schwarze Magie zu kaufen. »Ein bißchen verdreht in
seiner Art, glaube ich. Wie ein böser alter Mann kam er
mir vor. Immer schrie er Leute an. Die Streitereien, die
man aus den hinteren Räumen hören konnte! Kannten Sie
ihn?«
– 95 –

»Nicht besonders gut«, sagte Glogauer. »Hau ab, altes
Arschloch!«
Es war seine erste mutige Tat, soweit er sich erinnerte.
Er grinste, als der Mann sich schimpfend aus dem Laden
trollte.
Seine ersten Monate als Besitzer des Ladens gaben ihm
das Gefühl, jemand zu sein. Aber als die Rechnungen her-
einkamen und er mit schwierigen Kunden umgehen muß-
te, verging ihm das Gefühl allmählich.
Er erwachte in der Höhle und sagte laut: »Ich habe kein
Recht, hier zu sein. Meine Existenz hier ist eine Un-
möglichkeit. Es gibt so etwas wie eine Reise durch die Zeit
gar nicht.«
Es gelang ihm nicht, sich selbst zu überzeugen. Sein
Schlaf war unruhig gewesen, von Träumen und Erinne-
rungen unterbrochen. Er wußte nicht einmal sicher, ob
die Erinnerungen exakt waren. Hatte er wirklich einmal
anderswo existiert, in einer anderen Zeit?
Er stand auf, band sich sein leinenes Lendentuch um
und ging zum Eingang der Höhle.
Der Morgenhimmel war grau, die Sonne war noch nicht
aufgegangen. Die Erde unter seinen bloßen Füßen war
kalt, als er zum Fluß ging.
Er erreichte den Fluß und bückte sich, um sich das
Gesicht zu waschen, wobei er sein Spiegelbild in dem
dunklen Wasser sah. Sein Haar war lang, schwarz und ver-
filzt, sein Bart bedeckte den ganzen unteren Teil seines
Gesichts, und sein Blick war leicht irre. Er unterschied
sich durch nichts von den anderen Essenern außer durch
– 96 –

seine Gedanken. Und die Gedanken vieler Essener waren
merkwürdig genug. Waren Sie verrückter als sein Glaube,
daß er ein Besucher aus einem anderen Jahrhundert sei?
Er schüttelte sich, als er sich kaltes Wasser ins Gesicht
spritzte.
Da war die Zeitmaschine. Die hatte er erst gestern gese-
hen. Das war ein Beweis.
Solcherlei
Überlegungen
waren
jedoch
sowieso
unsinnig, dachte er, während er sich aufrichtete. Die
brachten ihn nirgendwohin. Sie waren Selbstbespiege-
lung.
Was war andererseits mit dem Glauben des Johannes,
daß er ein großer Magus sei? War es recht, ihn in dem
Glauben zu lassen, daß er die Gaben eines Sehers habe?
Und war es recht, wenn Johannes ihn dazu benutzte, den
nachlassenden Glauben derjenigen zu stärken, die die Re-
volution erwarteten?
Es spielte keine Rolle. Er war hier, dies widerfuhr ihm, er
konnte nichts daran ändern. Er mußte am Leben bleiben,
wenn es irgend ging, um in einem Jahr die Kreuzigung
mitzuerleben, wenn sie tatsächlich stattfand.
Warum hatte es ihm gerade die Kreuzigung so angetan?
Warum sollte sie ein Beweis für die Göttlichkeit des Chris-
tus sein? Das würde sie natürlich nicht sein, aber sie
würde ihn spüren lassen, was wirklich geschah, was die
Menschen wirklich damals fühlten.
War Christus wie Johannes der Täufer? Oder war er ein
subtiler Politiker, der hauptsächlich in den Städten arbei-
tete und sich Freunde im Establishment verschaffte? Und
im geheimen arbeitete – denn Johannes hatte noch nichts
– 97 –

von ihm gehört, und gerade Johannes mußte etwas von
ihm wissen, denn er sollte ja ein Vetter von Jesus sein.
Vielleicht, dachte Glogauer, befand er sich in der fal-
schen Gesellschaft.
Er lächelte und wandte sich wieder dem Dorf zu. Er
spürte plötzlich eine Spannung. Etwas Dramatisches sollte
heute geschehen, etwas, das seine Zukunft bestimmen
würde. Aus irgendeinem Grunde wehrte er sich jedoch
gegen den Gedanken, den Täufer zu taufen. Es war nicht
recht. Er hatte kein Recht, sich als großer Prophet aufzu-
spielen.
Er rieb sich den Kopf. Er spürte dort leichte Schmerzen.
Er hoffte, sie würden vergehen, bevor er Johannes traf.
Unsere Geburt ist nur ein Schlaf und ein Vergessen…
WORDSWORTH
Die Höhle war warm und angefüllt mit seinen Erinne-
rungen und Gedanken. Er betrat sie mit einer gewissen
Erleichterung.
Wenig später sollte er sie zum letztenmal verlassen.
Dann würde es kein Entrinnen mehr geben.
»Wir alle wählen unsere archetypischen Rollen schon früh
in unserem Leben«, sagte er der Gruppe. »Und laßt euch
nicht irreführen von dem großen Wort ›Archetypus‹ –
denn es gilt ebenso für den Bankangestellten in
Sheperton wie für die großen Gestalten der Geschichte –
›archetypisch‹ heißt nicht ›heroisch‹. Das Seelenleben des
– 98 –

Bankangestellten ist so reich wie eures oder meins, die
Rolle, die er auszufüllen meint, ist genauso wichtig wie
die eines jeden anderen. Wenn auch sein bürgerlicher
Anzug euch täuschen mag – und auch die, mit denen er
zusammen lebt und arbeitet – er ist…«
»Quatsch, Quatsch«, sagte Sandra Peterson und fuchtelte
mit ihren dicken Armen. »Die sind überhaupt keine Arche-
typen – die sind Stereotypen…«
»So etwas gibt es nicht«, blieb Glogauer bei seiner Mei-
nung. »Es ist inhuman, über Menschen so zu urteilen…«
»Ich weiß nicht, wie du sie nennst, aber ich weiß, daß
diese Leute die Grauen sind – die Kräfte der Mittelmäßig-
keit, die die anderen herabzuziehen versuchen.«
Glogauer war schockiert, dem Weinen nahe. »Aber,
Sandra, ich möchte erklären –«
»Für mich ist klar, daß du Jung völlig falsch auslegst«,
sagte sie fest. »Ich habe alles gelesen, was er geschrieben
hat!«
»Ich glaube, Sandra hat nicht ganz unrecht«, sagte Mrs.
Rita Blen. »Schließlich sind wir hier, um gerade über diese
Dinge zu diskutieren, oder nicht?«
Es könnte gelingen.
Er hatte die Zeit gut gewählt.
Die Gasöfen waren an, als Monica die Wohnung über
dem Buchladen betrat. Der Gasgeruch erfüllte das ganze
Zimmer. Er lag neben dem Ofen.
Sie öffnete ein Fenster und ging dann zu ihm hin.
»Mein Gott, Karl, was du nicht alles anstellen würdest,
um Beachtung zu finden!«
– 99 –

Er fing an zu lachen.
»Herrgott! Bin ich so leicht zu durchschauen?«
»Ich gehe«, sagte sie.
Sie kam fast zwei Wochen nicht mehr. Er wußte, sie wür-
de wiederkommen. Sie war schließlich nicht mehr die
Jüngste, und so attraktiv war sie auch nicht. Sie hatte nur
ihn.
»Ich liebe dich, Monica«, sagte er, als er zu ihr ins Bett
kroch.
Sie hatte ihren Stolz. Sie reagierte nicht.
Johannes stand jetzt vor der Höhle. Er rief nach Karl.
»Es ist Zeit, Magus.«
Widerstrebend verließ er die Höhle. Er sah den Täufer
flehend an.
»Johannes – bist du dir sicher?«
Der Täufer wandte sich zum Fluß und marschierte los.
»Komm! Sie warten schon.«
»Ich komme mit meinem Leben nicht zurecht, Monica.«
»Geht uns das nicht allen so, Karl?«
– 100 –

ZWEITER TEIL
10
Und dein des Menschen Antlitz, dein
Des Menschen Glieder und sein Atem,
Einziehend durch die Pforte der Geburt und
Ausziehend durch die Pforte des Todes.
William Blake: Jerusalem: An die Juden
Johannes stand bis an die Hüften in dem träge fließenden
Wasser des Flusses. Die Essener waren alle gekommen,
um die Taufe mitzuerleben. Sie standen stumm an den
Ufern.
Glogauer stand unsicher an dem sandigen Uferhang, sah
auf Johannes hinunter und sprach in seinem sonderbaren,
stark akzentuierten Aramäisch zu ihm.
»Johannes, ich kann es nicht. Es kommt mir nicht zu, das
zu tun.«
Der Täufer furchte die Stirn. »Du mußt es.«
Glogauer atmete schwer, und seine Augen füllten sich
mit Tränen, während er Johannes verzweifelt bittend an-
sah.
Aber der Täufer hatte kein Erbarmen.
»Du mußt. Es ist deine Pflicht.«
Glogauer fühlte sich schwindelig, als er zum Täufer in
den Fluß stieg. Ihn fror.
Er stand zitternd im Wasser, unfähig, sich zu bewegen.
– 101 –
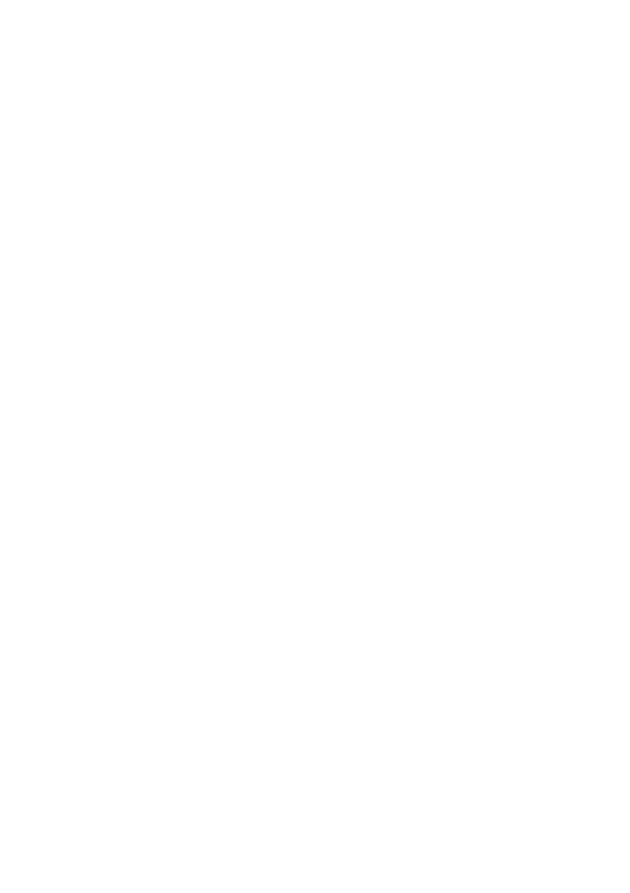
Er rutschte auf den Steinen im Flußbett aus. Johannes
packte ihn am Arm und bewahrte ihn davor, umzufallen.
An dem klaren, harten Himmel stand die Sonne im Zenit
und brannte auf seinen unbedeckten Schädel herab.
»Immanuel!« rief Johannes plötzlich: »Der Geist Adonais
ist in dich gefahren!«
Glogauer war erschrocken. »Was…?« sagte er auf eng-
lisch. Er blinzelte.
»Der Geist Adonais ist in dir, Immanuel!«
Glogauer hatte immer noch Mühe zu sprechen. Er
schüttelte schwach den Kopf. Das Kopfweh war noch
nicht vorbei, und jetzt wurden die Schmerzen noch stär-
ker. Er konnte kaum sehen. Er wußte, daß er den ersten
Migräneanfall seit seiner Ankunft hier erlebte.
Er spürte Brechreiz.
Die Stimme des Täufers klang verzerrt und weit entfernt.
Glogauer taumelte im Wasser.
Als er Johannes entgegenfiel, verschwamm alles um ihn
herum.
Er spürte, wie Johannes ihn auffing, und hörte sich
selbst verzweifelt sagen: »Johannes – du mußt mich
taufen!« Und dann hatte er Wasser im Mund und im Ra-
chen und begann zu husten.
Er hatte eine solche Angst nicht mehr erlebt seit der
Nacht, in der er zum erstenmal mit Monica ins Bett ge-
gangen war und geglaubt hatte, er sei impotent.
Johannes schrie irgend etwas.
Was immer es gewesen sein mochte, es rief bei den Men-
schen an den Ufern eine Reaktion hervor.
– 102 –

Das Dröhnen in Glogauers Ohren verstärkte sich, wurde
der Art nach anders. Er schlug im Wasser um sich und
spürte dann, wie er auf die Beine gestellt wurde.
Immer noch war er von Panik und Schmerzen be-
herrscht. Er erbrach sich ins Wasser und stolperte, als Jo-
hannes ihn schmerzhaft fest am Arm packte und zum Ufer
führte.
Er hatte Johannes im Stich gelassen.
»Es tut mir leid«, sagte er. »Es tut mir leid. Es tut mir leid.
Es tut mir leid…«
Er hatte Johannes um seine letzte Chance zum Sieg ge-
bracht. »Es tut mir leid. Es tut mir leid.«
Wieder einmal hatte er nicht die Kraft gehabt, das Richti-
ge zu tun. »Es tut mir leid.«
Ein sonderbares rhythmisches Summen kam von den
Essenern, während sie schwankten; es schwoll an, wenn
sie sich nach der einen Seite neigten, und wurde schwä-
cher, wenn sie sich zur anderen Seite neigten.
Als Johannes ihn losließ, hielt Glogauer sich die Ohren
zu. Er würgte immer noch, aber jetzt nur noch trocken,
doch schlimmer als je.
Er rannte davon, rannte, nur mühsam das Gleichgewicht
bewahrend und sich immer noch die Ohren zuhaltend;
rannte über das steinige, mit Gestrüpp bewachsene Land;
rannte, während die Sonne am Himmel pulsierte und ihre
Hitze auf seinen Schädel hämmerte; rannte davon.
– 103 –

Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf wohl,
daß ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir?
Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Laß es jetzt al-
so sein! Also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfül-
len. Da ließ er's zu. Und da Jesus getauft war, stieg er als-
bald herauf aus dem Wasser; und siehe, da tat sich der
Himmel auf über ihm. Und er sah den Geist Gottes gleich
als eine Taube herabfahren und über ihn kommen. Und
siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist
mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe.
Matthäus 3, 14–17
Er war fünfzehn und machte sich ganz gut auf der Ober-
schule.
Er hatte in den Zeitungen von den Teddy-Boy-Banden
gelesen, die den Süden Londons unsicher machten, aber
die paar Jugendlichen in pseudo-edwardianischer Klei-
dung, die er gelegentlich getroffen hatte, waren ihm recht
harmlos und blöd vorgekommen.
Er war in Brixton Hill im Kino gewesen und hatte
beschlossen, zu Fuß nach Streatham zurückzugehen, weil
er das Busgeld zum größten Teil für Eis ausgegeben hatte.
Sie kamen zur gleichen Zeit aus dem Kino. Er bemerkte
sie kaum, als sie ihm folgten.
Dann war er plötzlich von ihnen umringt.
Sie waren blasse, ärmlich aussehende Bürschchen, die
meisten um ein bis zwei Jahre älter als er. Zwei von ihnen
kannte er vom Sehen. Sie besuchten eine große öffentli-
che Schule in derselben Straße, in der auch seine Schule
lag. Sie benutzten denselben Fußballplatz.
– 104 –

»Hallo«, sagte er schwach.
»Hallo, mein Sohn«, sagte der älteste der Teddy-Boys. Er
kaute Gummi und stand da, das eine Knie eingeknickt,
und grinste ihn an.
»Wohin willst du denn?«
»Nach Hause.«
»Nach Hause«, wiederholte der größte gedehnt, Karls
Aussprache nachahmend.
»Was willst du denn anfangen, wenn du dort an-
kommst?«
»Zu Bett gehen.«
Karl versuchte aus dem Ring auszubrechen, aber sie
ließen ihn nicht. Sie drängten ihn in einen Ladeneingang.
Hinter ihnen auf der Hauptstraße brausten Autos vorbei.
Die Straße war hell erleuchtet von Straßenlampen und
den Neonschriften der Geschäfte.
Mehrere Leute kamen vorbei, aber niemand blieb ste-
hen. Karl wurde von Angst gepackt.
»Mußt du keine Schularbeiten mehr machen, mein
Sohn?« sagte der Junge, der neben dem Anführer stand. Er
hatte rote Haare und Sommersprossen und harte graue
Augen.
»Willst du dich mit einem von uns schlagen?« fragte ein
anderer. Es war einer der beiden, die Karl erkannt hatte.
»Nein. Ich schlage mich nicht. Laßt mich gehen!«
»Hast du Angst, mein Sohn?« fragte der Anführer grin-
send. Betont lässig zog er seinen Kaugummi weit aus und
steckte ihn dann in den Mund zurück. Er kaute weiter,
immer noch grinsend.
»Nein. Warum sollte ich mich mit euch schlagen? Ich
meine, man sollte sich nie schlagen.«
– 105 –

»Dir bleibt kaum eine andere Wahl, mein Sohn, nicht
wahr?«
»Hört doch, ich bin spät dran. Ich muß nach Hause.«
»Für ein paar Runden wird deine Zeit noch reichen…«
»Ich habe euch schon gesagt, ich will mich nicht mit
euch schlagen.«
»Du hältst dich für etwas Besseres als wir, das ist es
doch, nicht wahr, mein Sohn?«
»Nein.« Er begann zu zittern. Tränen traten ihm in die
Augen. »Natürlich nicht.«
»Natürlich nicht, mein Sohn.«
Karl trat wieder vor, aber sie stießen ihn in den Eingang
zurück.
»Du bist doch der Bursche mit dem Krautkopfnamen,
nicht?« sagte der andere der beiden, die er kannte.
»Gluckeier oder so ähnlich.«
»Glogauer. Laßt mich gehen!«
»Schimpft deine Mami, wenn du zu spät kommst?«
»Eher ein jüdischer Name als ein deutscher.«
»Bist du ein Jid, mein Sohn?«
»Er sieht wie einer aus.«
»Bist du ein Jid, mein Sohn?«
»Bist du ein Jude, mein Sohn?«
»Bist du ein Jid, mein Sohn?«
»Haltets Maul!« schrie Karl. »Warum habt ihr es auf mich
abgesehen?«
Er rannte gegen sie an. Einer boxte ihn in den Magen. Er
stöhnte vor Schmerz. Ein anderer stieß ihn, und er tau-
melte.
– 106 –

Immer noch hasteten Leute auf dem Gehsteig vorbei.
Manche warfen im Vorbeigehen einen Blick auf die
Gruppe.
Ein Mann blieb stehen, aber seine Frau zerrte ihn weiter.
»Nur Jungs, die sich balgen«, sagte sie.
»Zieht ihm die Hosen runter!« schlug einer der Jungen
lachend vor. »Dann kriegen wir den Beweis.«
Karl schob sich zwischen ihnen durch, und diesmal leis-
teten sie keinen Widerstand.
Er lief die Straße hinunter.
»Gebt ihm einen kleinen Vorsprung!« hörte er einen der
Jungen sagen.
Er rannte weiter.
Dann nahmen sie lachend und höhnend die Verfolgung
auf.
Sie holten ihn nicht ein, bevor er die Allee erreichte, in
der er wohnte. Vielleicht hatten sie gar nicht beabsichtigt,
ihn zu fangen. Er errötete.
Er erreichte das Haus und lief den dunklen Fußweg
entlang zur Hintertür. Seine Mutter war in der Küche.
»Was ist mit dir los?« fragte sie.
Sie war eine große, hagere Frau, nervös und hysterisch.
Ihr dunkles Haar war ungepflegt.
Er ging an ihr vorbei ins Frühstückszimmer.
»Was ist los, Karl?« rief sie. Ihre Stimme war schrill.
»Nichts«, sagte er.
Er wollte keine Szene.
– 107 –

11
Es war kalt, als er erwachte. Im Osten war der Himmel
hellgrau, und er sah nichts als Ödland ringsherum. Er
wußte nicht mehr viel über den letzten Tag, außer daß er
Johannes irgendwie im Stich gelassen hatte und dann eine
weite Strecke gerannt war.
Er fühlte sich benommen. Sein Schädel war leer. Sein
Nacken schmerzte noch.
Tau hatte sich auf sein Lendentuch gelegt. Er nahm es ab
und benetzte seine Lippen und wischte sich mit dem Stoff
über das Gesicht.
Wie stets nach einem Migräneanfall, fühlte er sich
schwach und seelisch und körperlich völlig verausgabt.
Als er an seinem nackten Körper herabsah, bemerkte er,
wie mager er geworden war;
»Ich sehe aus wie ein Belsen-Opfer«, dachte er.
Er fragte sich, warum er so in Panik geraten war, als Jo-
hannes ihn bat, ihn zu taufen. War es einfach Ehrlichkeit –
etwas in ihm, das sich in letzter Minute dagegen sträubte,
die Essener zu täuschen? Es war schwer zu sagen.
Er wand sich das zerrissene Lendentuch um die Hüften
und knotete es über seinem linken Oberschenkel. Er hielt
es für angebracht, den Weg zurück zur Siedlung zu su-
chen und sich bei Johannes zu entschuldigen, ihn zu
fragen, ob er es wiedergutmachen könnte.
Danach würde er vielleicht weiterziehen.
Die Zeitmaschine war immer noch in dem Essenerdorf.
Wenn sich ein guter Schmied fände oder ein anderer
Handwerker, gäbe es vielleicht noch die Möglichkeit, sie
– 108 –

zu reparieren. Es war eine schwache Hoffnung. Selbst
wenn man sie zurechtflicken könnte, wäre die Rückreise
gefährlich.
Er überlegte, ob er sofort zurückreisen oder versuchen
sollte, etwas näher an die tatsächliche Kreuzigung her-
anzukommen. Es war wichtig, daß er die Stimmung in Je-
rusalem während des Passahfestes selbst miterlebte, bei
dem Jesus in die Stadt eingezogen sein sollte.
Monica war der Meinung, Jesus habe die Stadt mit einer
bewaffneten Schar erstürmt. Sie sagte, alle Hinweise deu-
teten darauf hin.
Alle Hinweise von einer bestimmten Art deuteten wohl
darauf hin, nahm er an, aber er konnte sie nicht an-
erkennen. Es steckte bestimmt mehr dahinter, dessen war
er sicher.
Wenn er nur Jesus begegnen könnte.
Johannes hatte offenbar nie von ihm gehört, obgleich er
erwähnt hatte, daß der Messias einer Prophezeiung nach
Nazarener sein würde.
Aber es gab viele Prophezeiungen, und viele widerspra-
chen sich.
Er machte sich auf den Rückweg in der Richtung, in der
er das Essenerdorf vermutete. Er konnte sich nicht sehr
weit davon entfernt haben.
Bis zum Mittag war die Luft viel heißer und das Land
immer öder geworden. Die Luft flimmerte, und er kniff
zum Schutz gegen das grelle Licht die Augen zusammen.
Das Gefühl der Erschöpfung, mit dem er aufgewacht war,
hatte sich verstärkt; seine Haut brannte, sein Mund war
ausgetrocknet, und seine Beine wollten ihn kaum tragen.
Er war hungrig und durstig, und er hatte nichts zu essen
– 109 –

und nichts zu trinken. Von der Hügelkette, an der das
Dorf der Essener lag, war nichts zu sehen.
Er hatte sich verirrt, und es war ihm fast egal. In seinem
Geist war er schon fast eins mit der Wüste. Wenn er hier
umkäme, würde er den Übergang zwischen Leben und
Tod kaum spüren. Er würde sich hinlegen, und sein Kör-
per würde in dem braunen Boden aufgehen.
Mechanisch schleppte er sich weiter durch die Wüste.
Später sah er etwa drei Kilometer südlich einen Hügel.
Der Anblick belebte sein Bewußtsein ein wenig. Er
beschloß, auf den Hügel zuzugehen. Von dort oben
würde er wahrscheinlich seine Orientierung wieder-
finden, vielleicht sogar eine Siedlung sehen, wo er etwas
zu essen und Wasser bekommen würde.
Er rieb sich über Stirn und Augen, aber die Berührung
mit seiner eigenen Hand verursachte ihm Schmerzen. Er
schleppte sich auf den Hügel zu.
Der sandige Boden verwandelte sich in Treibsand, wenn
seine Füße ihn aufrührten. Das karge Gestrüpp, das da
und dort wuchs, riß ihm die Knöchel und die Waden auf,
und er stolperte über Felsbrocken.
Zerschunden und blutend erreichte er den Fuß des
Hügels.
Er ruhte sich eine Weile aus, starrte gedankenverloren
über die einförmige Landschaft hin. Dann begann er den
Hang hinaufzusteigen.
Der Aufstieg zum Gipfel (bis zu dem es viel weiter war, als
er zuerst geschätzt hatte) war schwierig. Er rutschte in
dem losen Geröll am Steilhang aus, fiel aufs Gesicht,
– 110 –

stemmte sich mit seinen aufgerissenen Händen und mit
den Füßen dagegen, um nicht wieder zurückzurutschen,
hielt sich an Grasbüscheln und Flechten fest, die dort
wuchsen, umklammerte größere Felsvorsprünge, wenn er
konnte, ruhte oft aus, und sein Geist und sein Körper
waren betäubt von Schmerzen und Müdigkeit.
Er hatte vergessen, warum er kletterte, aber er war wie
ein kaum einer Empfindung fähiges Lebewesen entschlos-
sen, den Gipfel zu erreichen. Wie ein Käfer arbeitete er
sich den Berg hoch.
Er schwitzte in der Sonnenglut. Der Staub blieb auf sei-
nem nassen, fast nackten Körper kleben und verkrustete
ihn von Kopf bis Fuß. Sein Lendentuch war in Fetzen.
Die öde Welt drehte sich um ihn, Himmel und Erde
vermischten sich irgendwie, gelbes Gestein mit weißen
Wolken. Nichts schien stillzustehen.
Er stürzte und rutschte den Berg hinunter. Sein Schen-
kel wurde aufgerissen und sein Kopf arg abgeschürft.
Sobald er zu rutschen aufhörte, fing er wieder an zu
steigen und kroch langsam die brennenden Felsen hinauf.
Die Zeit war bedeutungslos, seine Identität bedeutungs-
los. Jetzt war er zum erstenmal in einer Lage, in der er
Headingtons Theorien hätte begreifen können, aber das
Bewußtsein war auch geschwunden. Er war nur ein
Gegenstand, der einen Berg erklomm.
Er erreichte den Gipfel und hörte auf zu kriechen.
Eine kleine Weile lag er blinzelnd da, dann fielen ihm
die Augen zu.
Er hörte Monicas Stimme und hob den Kopf. Einen
Augenblick lang meinte er, sie aus dem Augenwinkel zu
sehen.
– 111 –

Sei nicht so melodramatisch, Karl…
Das hatte sie oft gesagt. Seine eigene Stimme antwortete
jetzt.
Ich bin in der falschen Zeit geboren, Monica. Ich passe
nicht in dieses Zeitalter der Vernunft. Es wird mich zu
guter Letzt noch umbringen.
Ihre Stimme antwortete.
Schuld und Angst und Feigheit und dein Masochismus.
Du hättest ein brillanter Psychiater werden können, aber
du hast dich so völlig all deinen Neurosen ergeben…
»Halts Maul!«
Er wälzte sich auf den Rücken. Die Sonne brannte auf
seinen zerschundenen Körper herab.
»Halts Maul!«
Das ganze christliche Syndrom, Karl. Es würde mich
nicht wundern, wenn du demnächst zur katholischen
Kirche übertreten würdest. Wo ist deine Geisteskraft?
»Halts Maul! Geh, Monica!«
Angst formt dein Denken. Du suchst nicht nach einer
Seele oder auch nur nach einem Sinn des Lebens. Du
suchst Trost.
»Laß mich allein, Monica!«
Er hielt sich mit seinen verdreckten Händen die Ohren
zu. Seine Haare und sein Bart waren verfilzt und mit
Staub verklebt. Blutkrusten hatten sich auf den Wunden
gebildet, die jetzt seinen ganzen Körper bedeckten. Die
Sonne über ihm schien im Gleichtakt mit seinem Herzen
zu schlagen.
Du gehst bergab, Karl, erkennst du das nicht? Bergab.
Reiß dich zusammen! Du bist zu rationalem Denken
nicht völlig unfähig…
– 112 –

»Oh, Monica! Hält's Maul!«
Seine Stimme war hart und brüchig.
Ein paar Raben kreisten über ihm am Himmel. Er hörte
sie in einer Stimme rufen, die seiner eigenen nicht unähn-
lich war.
Gott ist 1945 gestorben…
»Wir haben nicht 1945 – wir schreiben das Jahr 28. Gott
lebt!«
Wie kannst du dir soviel Gedanken über eine offensicht-
lich synkretistische Religion wie das Christentum machen
– rabbinisches Judentum, stoische Ethik, griechische Mys-
terienkulte, orientalische Rituale…
»Es ist egal.«
Für dich, in deinem derzeitigen Geisteszustand.
»Ich brauche Gott!«
Darauf läuft alles hinaus, nicht wahr? Ein unzulängli-
cher Mensch endet immer dort. Gut, Karl, schnitz dir
deine eigenen Krücken! Nur denk dran, was du hättest
werden können, wenn du mit dir selbst fertig geworden
wärst…!
Glogauer riß seinen mißhandelten Körper hoch, stand
auf dem Berggipfel und schrie.
Die Raben erschraken. Sie schwenkten am Himmel her-
um und flogen davon.
Der Himmel verfinsterte sich jetzt.
Da ward Jesus vom Geist in die Wüste geführt, auf daß er
von dem Teufel versucht würde. Und da er vierzig Tage
und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn.
Matthäus 4, 1–2
– 113 –

12
Der Verrückte kam in die Stadt getaumelt.
Sein Gesicht war der hochstehenden Sonne zugewandt;
seine Augen waren verdreht; seine Arme hingen schlaff am
Körper herab, und seine Lippen bewegten sich wortlos.
Seine Füße wirbelten den Staub auf, und Hunde bellten
ihn von allen Seiten an. Kinder lachten ihn aus, warfen
mit Steinen nach ihm und zogen sich dann zurück.
Der Verrückte fing an zu sprechen.
Die Worte, die sie hörten, wurden nicht in einer den
Stadtbewohnern vertrauten Sprache gesprochen; aber sie
wurden mit solcher Intensität und Überzeugungskraft aus-
gesprochen, daß es durchaus möglich erschien, daß Gott
selbst diese abgemagerte, nackte Kreatur als seinen Spre-
cher benutzte.
Sie fragten sich, woher der Verrückte gekommen sein
konnte.
Einmal hatten römische Legionäre angehalten und ihn
barsch, aber nicht unfreundlich gefragt, ob er Verwandte
habe, zu denen sie ihn bringen könnten. Sie hatten ihn in
gebrochenem Aramäisch angesprochen und waren über-
rascht gewesen, als er ihnen in einem merkwürdig ausge-
sprochenen, aber reineren Latein geantwortet hatte, als
sie selbst sprachen.
Sie fragten ihn, ob er ein Rabbiner oder ein Gelehrter
sei. Er sagte ihnen, er sei weder das eine noch das andere.
Der Offizier der Legionäre hatte ihm etwas Dörrfleisch
und Wein angeboten. Er hatte das Fleisch gegessen und
um Wasser gebeten. Sie gaben es ihm.
– 114 –

Die Männer gehörten zu einer Patrouille, die einmal im
Monat auf dieser Strecke vorbeikam. Sie waren kräftig ge-
baute, braungebrannte Männer mit harten, glattrasierten
Gesichtern. Sie trugen gefärbte Lederröcke, Brustpanzer
und Sandalen, auf dem Kopf eiserne Helme und an den
Hüften Kurzschwerter, die in einer Scheide steckten.
Selbst als sie ihn so im Licht der späten Abendsonne um-
standen, wirkten sie nicht entspannt. Der Offizier, der sich
nicht so laut benahm wie seine Männer, ihnen aber sonst
sehr ähnlich war, nur daß er einen Brustpanzer aus Me-
tall, einen langen Mantel und einen Federbusch am Helm
trug, fragte den Verrückten nach seinem Namen.
Für einen Augenblick hatte der Verrückte dagestanden
und den Mund auf- und zugemacht, als könnte er sich
nicht erinnern, wie er genannt wurde.
»Karl«, sagte er endlich, etwas unsicher. Es war mehr ein
Vorschlag als eine Aussage.
»Klingt fast wie ein römischer Name«, sagte einer der Le-
gionäre.
»Oder vielleicht ein griechischer«, sagte ein anderer. »Es
gibt viele Griechen in dieser Gegend.«
»Bist du ein römischer Bürger?« fragte der Offizier.
Aber der Geist des Verrückten war offensichtlich abge-
schweift. Er wandte sich von ihm ab und murmelte vor
sich hin.
Auf einmal drehte er sich wieder zu ihnen um und sagte:
»Nazareth. Wo ist Nazareth?«
»In dieser Richtung.« Der Offizier zeigte auf die Straße,
die sich zwischen den Bergen durchwand.
Der Verrückte nickte befriedigt.
– 115 –

»Karl… Karl… Carlus… ich weiß nicht…« Der Offizier
streckte den Arm aus, packte den Verrückten am Kinn und
sah ihm in die Augen. »Bist du ein Jude?«
Darüber schien der Verrückte erschrocken zu sein.
Er sprang auf und versuchte den Kreis der Soldaten zu
durchbrechen. Sie ließen ihn durch und lachten. Er war
ein harmloser Verrückter.
Sie sahen ihm nach, als er davonrannte.
»Vielleicht einer ihrer Propheten«, sagte der Offizier und
ging zu seinem Pferd. In diesem Land wimmelte es von
Propheten. Jeder zweite Mann, dem man begegnete, be-
hauptete, die Lehre ihres Gottes zu verkünden. Sie mach-
ten keinen Ärger; die Religion schien sogar ihre Gedanken
von Rebellionen abzulenken.
Wir müßten ihnen dankbar sein, dachte der Offizier.
Seine Männer lachten immer noch.
Sie marschierten davon, in die entgegengesetzte Rich-
tung zu der, die der Verrückte eingeschlagen hatte.
Später gesellte er sich zu einer Gruppe von Menschen, die
genauso abgemagert waren wie er. Sie befanden sich auf
einem obskuren Pilgerzug zu einer Stadt, von der er noch
nie etwas gehört hatte. Ihre Sekte forderte wie die Essener
strikte Rückkehr zum Mosaischen Gesetz, aber in anderen
Dingen blieben sie vage, bis auf die Idee, daß Gott ihnen
König David schicken würde, um ihnen bei der Ver-
treibung der Römer und der Eroberung Ägyptens zu hel-
fen – ein Land, das sie irgendwie mit Rom und mit Baby-
lon identifizierten.
Sie behandelten ihn wie ihresgleichen.
– 116 –

Er wanderte mehrere Tage mit ihnen. Dann kamen eines
Abends, als sie sich neben der Straße gelagert hatten, etwa
ein Dutzend Reiter in Rüstungen und Uniformen, viel
prächtiger als die der Römer, angaloppiert, stießen die
Kochkessel um und ritten durch die Feuer.
»Die Soldaten Herodes'!« schrie einer von der Sekte.
Weiber kreischten, und Männer rannten in die Nacht
hinaus. Bald waren alle bis auf zwei Frauen und den Ver-
rückten verschwunden.
Der Anführer der Soldaten hatte ein dunkles, schönes
Gesicht und einen dichten, geölten Bart. Er riß den Ver-
rückten an den Haaren hoch und spuckte ihm ins Gesicht.
»Bist du einer dieser Rebellen, von denen wir soviel ge-
hört haben?«
Der Verrückte murmelte etwas und schüttelte den Kopf.
Der Soldat versetzte ihm einen Schlag mit dem
Handrücken. Er war so schwach, daß er sofort zu Boden
stürzte.
Der Soldat zuckte die Achseln. »Der ist keine Gefahr.
Waffen sind hier nicht. Wir haben uns geirrt.«
Er sah die Frauen einen Augenblick abschätzend an und
wandte sich dann mit hochgezogenen Brauen an seine
Männer. »Wenn einem von euch danach ist – ihr könnt sie
haben.«
Der Verrückte lag auf der Erde und hörte die Schreie der
Frauen, als sie vergewaltigt wurden. Er meinte, aufstehen
und ihnen zu Hilfe kommen zu müssen, aber er war zu
schwach, sich zu rühren, hatte zuviel Angst vor den Solda-
ten. Er wollte nicht umgebracht werden. Es würde bedeu-
ten, daß er nie sein Ziel erreichen würde.
– 117 –

Die herodianischen Soldaten ritten schließlich weiter,
und die Sektenmitglieder kamen zurückgeschlichen.
»Wie geht es den Frauen?« fragte der Verrückte.
»Die sind tot«, sagte ihm einer.
Ein anderer begann aus der Schrift vorzulesen, Verse
über Rache und Gerechtigkeit und die Strafe des Herrn.
Niedergeschlagen verkroch sich der Verrückte in der
Dunkelheit.
Er verließ die Sekte am nächsten Morgen, als er entdeck-
te, daß ihr Weg sie nicht nach Nazareth führen würde.
Der Verrückte kam durch viele Städte – Philadelphia, Ge-
rasa, Pella und Skythopolis – an den Straßen der Römer.
Jeden Reisenden, den er traf, hielt er an und stellte ihm
in seiner fremdländischen Aussprache die gleiche Frage:
»Wo liegt Nazareth?«
Bevor er eine Stadt verließ, vergewisserte er sich jedes-
mal, daß er den Weg einschlug, der nach Nazareth führte.
In manchen Städten hatten sie ihm zu essen gegeben. In
anderen hatten sie ihn mit Steinen beworfen und da-
vongejagt. In anderen hatten sie ihn um seinen Segen ge-
beten, und er hatte getan, was er konnte, denn er brauch-
te die Nahrung, die sie ihm anboten. Er hatte ihnen die
Hände aufgelegt und in seiner merkwürdigen Sprache zu
ihnen gesprochen.
In Pella heilte er eine blinde Frau.
Er hatte bei dem römischen Viadukt den Jordan überquert
und wanderte weiter nordwärts auf Nazareth zu.
– 118 –

Es war zwar nicht schwer, den Weg nach Nazareth zu
erfahren, aber es kostete ihn immer mehr Mühe, der Stadt
näher zu kommen.
Er hatte eine Menge Blut verloren und hatte auf seiner
Reise sehr wenig gegessen. Er ging immer, bis er zu-
sammenbrach, blieb dann liegen, bis er wieder gehen
konnte, oder, was immer häufiger geschah, bis ihn je-
mand fand und ihm ein wenig sauren Wein oder Brot gab,
um ihn wieder auf die Beine zu bringen.
Nach dem Zwischenfall mit den herodianischen Soldaten
wurde er vorsichtiger und reiste nur noch allein, identifi-
zierte sich nie mit irgendwelchen Sekten oder Gruppen,
die er traf. Manchmal fragten ihn Leute: »Bist du der
Prophet, den wir erwarten?«
Dann schüttelte er den Kopf und sagte: »Sucht Jesus!
Sucht Jesus!«
Die weiße Stadt bestand hauptsächlich aus ein- und zwei-
stöckigen Häusern aus Steinen und Lehmziegeln, sie war
um einen Marktplatz herum gebaut, an dessen einer Seite
eine alte, schlichte Synagoge stand. Vor der Synagoge sa-
ßen alte Männer in dunklen Gewändern, mit Schals auf
den Köpfen und redeten miteinander.
Die Stadt war wohlhabend und sauber; sie war durch
den Handel mit den Römern aufgeblüht. Nur ein oder
zwei Bettler waren in den Straßen, und sie waren wohlge-
nährt. Die Straßen folgten dem Auf und Ab des Berghangs,
an dem die Stadt lag. Es waren gewundene, schattige und
friedliche Landstraßen.
– 119 –

Überall hing der Geruch von frisch geschnittenem Holz
in der Luft, und überall hörte man die Geräusche von Sä-
gen, Beilen und Hobeln, denn die Stadt war in erster Linie
berühmt für ihre tüchtigen Zimmerleute. Sie lag am Rande
der Ebene von Jesreel, an der Handelsstraße zwischen Da-
maskus und Ägypten, und ständig verließen Wagen die
Stadt, beladen mit den Erzeugnissen ihrer Handwerker.
Die Stadt hieß Nazareth.
Jetzt hatte der Verrückte Nazareth gefunden.
Die Städter musterten ihn mit Neugier und nicht
geringem Mißtrauen, als er auf den Marktplatz wankte. Er
konnte ein Wanderprophet sein oder auch ein von Teu-
feln Besessener. Er konnte ein Bettler sein oder ein Mit-
glied einer Sekte wie die Zeloten, die in jenen Tagen sehr
unbeliebt waren wegen des Unheils, das sie vierzig Jahre
vorher über Jerusalem gebracht hatten. Die Bewohner von
Nazareth hatten mit Rebellen oder Fanatikern nicht viel
im Sinn. Es ging ihnen gut, sie waren wohlhabender als zu
irgendeiner Zeit, bevor die Römer kamen.
Als der Verrückte an den Menschenknäueln vor den
Ständen der Händler vorbeiging, verstummten sie, bis er
vorbei war. Die Frauen zogen ihre schweren Wollschals
enger um ihre üppigen Leiber, und die Männer rafften ih-
re Baumwollgewänder zusammen, damit er sie nicht be-
rührte. Normalerweise hätten sie als erstes daran gedacht,
ihm Steuern für seine Geschäfte in der Stadt aufzuerlegen,
aber sein Blick war von solcher Intensität, und sein
Gesicht drückte trotz seines verhungerten Aussehens so-
viel Feuer und Vitalität aus, daß sie ihm einen gewissen
Respekt entgegenbrachten und Abstand hielten.
– 120 –

Als er die Mitte des Marktplatzes erreicht hatte, blieb er
stehen und sah sich um. Er schien von den Menschen nur
langsam Notiz zu nehmen. Er blinzelte und fuhr sich mit
der Zunge über die Lippen.
Eine Frau ging vorbei und beäugte ihn mißtrauisch. Er
sprach zu ihr, mit leiser Stimme und sorgfältig geformten
Worten.
»Ist das hier Nazareth?«
»Ja.« Sie nickte und ging schneller.
Ein Mann überquerte den Platz. Er trug ein rot und
braun gestreiftes Wollgewand. Auf seinem schwarzen
Kraushaar saß ein rotes Käppchen. Sein Gesicht war rund
und freundlich.
Der Verrückte stellte sich ihm in den Weg und hielt ihn
an.
»Ich suche einen Zimmermann.«
»Es gibt viele Zimmerleute in Nazareth. Es ist eine
Zimmermannsstadt. Ich bin selbst ein Zimmermann.« Der
Mann war freundlich, väterlich. »Kann ich dir helfen?«
»Kennst du einen Zimmermann namens Joseph? Ein
Nachkomme Davids. Seine Frau heißt Maria, und er hat
mehrere Kinder. Ein Sohn heißt Jesus.«
Der freundliche Mann zog etwas spöttisch die Brauen
hoch und sagte: »Ich kenne mehr als einen Joseph. Und
ich kenne viele Marias…« Dann wurde sein Blick nach-
denklich, und seine Lippen verzogen sich, so als genösse
er angenehme Erinnerungen. »Ich glaube, ich kenne den,
den du suchst. Dort hinten in der Gasse wohnt ein armer
Schlucker.« Er wies in die Richtung. »Er hat eine Frau, die
Maria heißt. Versuch es dort! Du müßtest ihn leicht
– 121 –

finden, wenn er nicht gerade Arbeit abliefert. Sieh dich
nach einem Mann um, der nie lacht!«
Der Verrückte schaute in die Richtung, die der Mann ihm
gewiesen hatte. Dann schien er alles andere um sich zu
vergessen und ging mechanisch auf die Gasse zu.
In der engen Gasse war der Holzgeruch noch stärker. Er
schritt knöcheltief durch Hobelspäne.
In Nazareth herrschte nicht die trockene Hitze, an die er
sich gewöhnt hatte. Es war eher wie an einem schönen
Sommertag in England, einem süßen, faulen Tag…
Dem Verrückten begann das Herz zu klopfen.
Aus jedem Haus hörte er Hämmern und das Knirschen
von Sägen. Bretter und Bohlen aller Größen lehnten an
den blassen, schattigen Wänden, und dazwischen war es
so eng, daß man kaum durchkommen konnte.
Der Verrückte hielt an. Er zitterte vor Angst.
Viele der Zimmerleute hatten ihre Werkbänke direkt vor
ihrer Haustür stehen. Sie schnitzten Tröge, arbeiteten an
einfachen Drechselbänken und verarbeiteten Holz zu
allen erdenklichen Gegenständen.
Der Verrückte setzte sich wieder in Bewegung. Die
Zimmerleute sahen auf, als sie ihn kommen sahen.
Er trat an einen alten Zimmermann mit einer Leder-
schürze heran, der an seiner Bank saß und eine Figur
schnitzte. Der Mann hatte graues Haar und wirkte kurz-
sichtig, als er den Verrückten anblinzelte.
»Was willst du? Ich habe kein Geld für Bettler.«
»Ich bin kein Bettler. Ich suche einen, der in dieser
Gasse wohnt.«
– 122 –
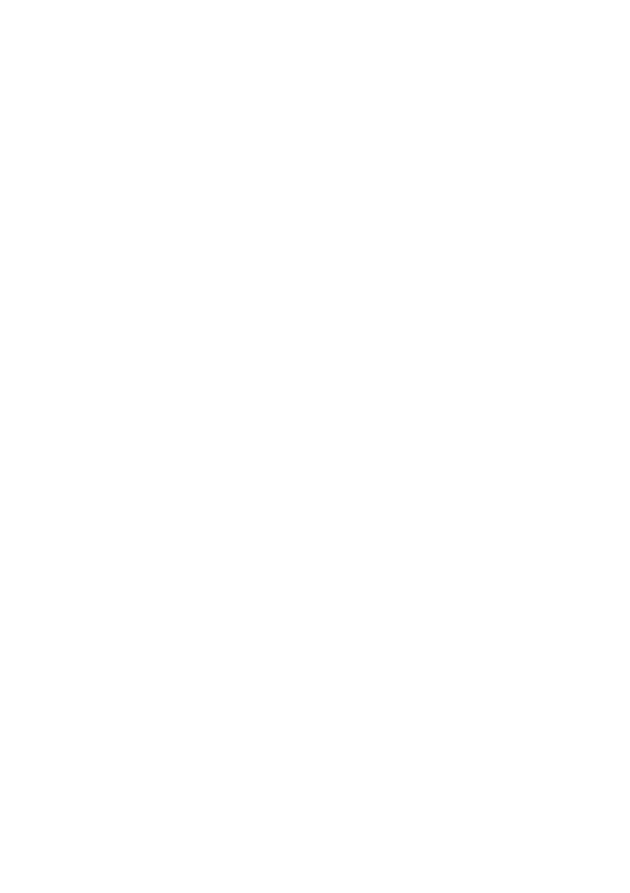
»Wie heißt er?«
»Joseph. Er hat eine Frau, die Maria heißt.«
Der alte Mann zeigte mit der Hand, in der er die halb
fertige Figur hielt. »Zwei Häuser weiter, auf der anderen
Seite.«
Er begann zu zittern und zu schwitzen.
Narr – es ist nur…
O Gott…
Vielleicht stellt sich heraus, daß sie gar nichts wissen. Es
ist nur ein Zufall.
O Gott!
An dem Haus, zu dem der Verrückte kam, lehnten nur
sehr wenig Bretter, und das Holz schien von geringerer
Qualität zu sein als das andere, das er gesehen hatte. Die
Werkbank beim Eingang war an einem Ende verzogen,
und der Mann, der darübergebeugt stand und einen
Hocker reparierte, schien auch mißgestaltet zu sein.
Der Verrückte tippte ihm auf die Schulter, und er richte-
te sich auf. Sein Gesicht war zerfurcht und von Armut ge-
zeichnet. Sein Blick war müde, und der dünne Bart zeigte
schon graue Strähnen. Er hustete verlegen, vielleicht weil
ihn die Störung so überrascht hatte.
»Bist du Joseph?« fragte der Verrückte.
»Ich habe kein Geld.«
»Ich will nichts haben – nur ein paar Fragen stellen.«
»Ich bin Joseph. Was willst du wissen?«
»Hast du einen Sohn?«
»Mehrere, und Töchter auch.«
– 123 –

Der Verrückte machte eine Pause. Joseph sah ihn neugie-
rig an. Er schien sich zu fürchten. Es war etwas Neues für
Joseph, daß sich jemand vor ihm fürchtete.
»Was ist los?«
Der Verrückte schüttelte den Kopf. »Nichts.« Seine Stim-
me war heiser. »Deine Frau heißt Maria? Du stammst von
David ab?«
Der Mann machte eine wegwerfende Bewegung. »Ja, ja –
als ob ich davon was hätte…«
»Ich möchte einen deiner Söhne sehen. Hast du einen,
der Jesus heißt? Kannst du mir sagen, wo er ist?«
»Dieser Taugenichts! Was hat er wieder ausgefressen?«
»Wo ist er?«
Josephs Blick wurde abschätzend, während er den Ver-
rückten anstarrte. »Bist du ein Seher? Bist du gekommen,
um meinem Sohn zu helfen?«
»Ich bin in gewissem Sinn ein Prophet. Ich glaube, ich
kann die Zukunft voraussagen.«
Joseph stand seufzend auf. »Ich habe nicht viel Zeit. Ich
muß so bald wie möglich Arbeiten nach Nain liefern.«
»Laß mich zu ihm!«
»Du kannst ihn sehen. Komm!«
Joseph führte den Verrückten durch das Tor in den
engen Innenhof des Hauses, der mit Holzabfällen, zerbro-
chenen Möbeln und Werkzeugen und rottenden Säcken
voll Hobelspäne vollgestellt war.
Sie betraten das dunkle Haus.
Der Verrückte atmete schwer.
Im ersten Raum, offensichtlich die Küche, stand eine
Frau an einem großen Lehmherd. Sie war groß und hatte
schon ziemlich Speck angesetzt. Ihr langes, schwarzes
– 124 –

Haar war fettig und fiel lose über große, strahlende
Augen, die immer noch Sinnlichkeit versprühten. Sie mus-
terte den Verrückten.
»Wie ich sehe, hast du einen neuen, zahlungskräftigen
Kunden gefunden, Joseph«, sagte sie sardonisch.
»Er ist ein Prophet.«
»Oh, ein Prophet. Und hungrig, nehme ich an. Wir haben
nichts zu essen für Bettler oder Propheten, egal wie sie
sich nennen.« Sie zeigte mit einem Holzlöffel auf eine
kleine Gestalt, die in einer Ecke im Schatten saß. »Dieses
nutzlose Ding ißt uns schon genug weg.« Die Gestalt
rührte sich, während sie sprach.
»Er sucht unsern Jesus«, sagte Joseph zu der Frau.
»Vielleicht ist er gekommen, um uns die Bürde zu erleich-
tern.«
Die Frau sah den Verrückten von der Seite an und zuckte
die Achseln. Sie fuhr sich mit ihrer dicken Zunge über die
roten Lippen. »Vielleicht hast du recht. Er hat etwas an
sich…»
»Wo ist er?« fragte der Verrückte mit heiserer Stimme.
Die Frau legte die Hände unter ihre großen Brüste und
schob sie in ihrem groben braunen Gewand zurecht. Sie
rieb sich mit der Hand über den Bauch und warf dem Ver-
rückten einen verstohlenen Blick zu. »Jesus!« rief sie,
ohne sich umzudrehen.
Die Gestalt in der Ecke stand auf.
»Da ist er«, sagte die Frau mit einer gewissen Genugtung.
– 125 –

Wie?
Das k…
Jesus!
Ich brauche…
Nein!
Der Verrückte runzelte die Stirn und schüttelte schnell
den Kopf. »Nein«, sagte er. »Nein.«
»Was soll das, ›nein‹?« fragte sie gereizt. »Mir ist ganz
egal, was du mit ihm machst. Wenn du ihm das Stehlen
abgewöhnen kannst. Er weiß es nicht besser, aber er wird
eines Tages in größte Schwierigkeiten kommen, wenn er
einen bestiehlt, der nichts über ihn weiß…«
»Nein…«
Der Junge war mißgestaltet.
Er hatte einen deutlichen Buckel und schielte mit dem
linken Auge. Das Gesicht war das eines Idioten. Ein wenig
Speichel lief ihm von den Lippen.
»Jesus?«
Er kicherte, als sein Name wiederholt wurde. Er kam un-
beholfen einen Schritt näher.
»Jesus«, sagte er, undeutlich und mit belegter Stimme.
»Jesus.«
»Das ist alles, was er sagen kann«, sagte die Frau. »Er ist
immer so gewesen.«
»Großes Urteil«, sagte Joseph.
»Ach, halts Maul!« Sie grinste ihren Mann böse an.
– 126 –

»Was fehlt ihm?«
Es lag ein kläglicher, verzweifelter Ton in der Stimme
des Verrückten.
»Er ist immer so gewesen.« Die Frau wandte sich dem
Herd zu. »Du kannst ihn haben, wenn du ihn willst. Nimm
ihn mit! Mißgeburt, innerlich und äußerlich. Ich trug ihn,
als meine Eltern mich an diesen halben Mann verheirate-
ten…«
»Du Sau! Du schamlose…« Joseph hielt inne, als seine
Frau ihn wieder angrinste und ihn herausforderte wei-
terzusprechen. Um sein Gesicht zu wahren, versuchte er
zurückzulächeln. »Du hattest eine gute Erklärung für sie,
nicht wahr? Die älteste Entschuldigung auf der Welt! Von
einem Engel genommen. Von einem Teufel genommen ist
wahrscheinlicher.«
»Ja, er war der Teufel«, sagte sie grinsend. »Und er war
ein Mann…«
Joseph fiel für einen Augenblick in sich zusammen, aber
dann, als erinnerte er sich an die Angst, die er dem Ver-
rückten vorher eingeflößt zu haben schien, drehte er sich
zu dem Mann um und herrschte ihn an: »Was geht dich
unser Sohn an?«
»Ich wollte mit ihm sprechen. Ich…«
»Er ist kein Orakel – kein Seher – wir glaubten früher, er
könnte es sein. Es gibt immer noch Leute in Nazareth, die
zu ihm kommen, damit er sie heilt oder ihnen ihre Zu-
kunft prophezeit, aber er kichert nur und sagt immerzu
nur seinen Namen…«
»Seid ihr sicher – daß er – nicht etwas an sich hat – et-
was, das ihr noch nicht bemerkt habt?«
– 127 –

»Gewiß!« sagte Maria betont verächtlich. »Wir brauchen
Geld dringend genug. Wenn er irgendwelche magischen
Kräfte hätte, wüßten wir es bestimmt schon.«
Jesus kicherte wieder.
»Jesus«, sagte er. »Jesus, Jesus.«
Er hoppelte in einen anderen Raum.
Joseph rannte hinter ihm her. »Er darf dort nicht hinein!
Ich will nicht, daß er schon wieder den Fußboden naß-
macht.«
Während Joseph in dem anderen Raum war, sah Maria
den Verrückten wieder abschätzend an. »Wenn du die Zu-
kunft voraussagen kannst, mußt du einmal kommen und
mir meine voraussagen. Er reist heute abend nach Nain
ab…«
Joseph führte den Krüppel in die Küche zurück und setz-
te ihn auf einen Hocker in der Ecke. »Bleib hier, ver-
dammter Kerl!«
Der Verrückte schüttelte den Kopf. »Es ist unmöglich…«
Hatte die Geschichte sich verändert?
War das alles, worauf die Geschichte beruhte?
Es war unmöglich…
Joseph schien den schmerzlichen Blick in den Augen des
Verrückten zu bemerken.
»Was ist?« fragte er. »Was siehst du? Du sagtest, du könn-
test die Zukunft voraussagen. Sag uns, was uns bestimmt
ist!«
»Nicht jetzt«, sagte der Prophet und wandte sich ab. »Wie
kann ich? Nicht jetzt.«
– 128 –

Er rannte aus dem dunklen Haus hinaus in die Sonne. Er
rannte die Gasse hinunter, in der es nach gehobeltem
Eichen-, Zedern- und Zypressenholz roch.
Einige der Zimmerleute sahen, auf und hätten ihn fast
für einen Dieb gehalten. Aber sie sahen, daß er nichts bei
sich trug.
Er lief zum Marktplatz zurück. Dort blieb er stehen und
blickte geistesabwesend um sich.
Der Verrückte, der Prophet, Karl Glogauer, der Zeit-
reisende, der neurotische verhinderte Psychiater, der Su-
cher nach einem Sinn, der Masochist, der Mann mit dem
Todestrieb und dem Messiaskomplex, der Anachronismus,
ging nach Luft ringend über den Marktplatz.
Er hatte den Mann gesehen, den er gesucht hatte. Er hat-
te Jesus gesehen, den Sohn von Maria und Joseph.
Er hatte einen Menschen gesehen, den er zweifelsfrei als
einen geborenen Idioten erkannt hatte.
Der freundliche Mann mit dem roten Käppchen war noch
auf dem Marktplatz, er kaufte gerade Kochtöpfe für ein
Hochzeitsgeschenk. Als der Fremde vorbeitaumelte, zeig-
te er durch ein Kopfnicken auf ihn. »Das ist er.«
»Woher kommt er?«
»Keine Ahnung. Nicht aus dieser Gegend, nach seinem
Dialekt zu urteilen. Ich vermute, er ist ein Verwandter des
sauertöpfischen Joseph – ihr wißt doch, der mit der
Frau…«
Der Topfhändler grinste.
– 129 –

Sie sahen ihn im Schatten an der Wand der Synagoge
niedersinken.
»Was ist er? Ein religiöser Fanatiker? Ein Zelot oder so et-
was?« fragte der Topfhändler.
Der andere schüttelte den Kopf. »Das Aussehen eines
Propheten hat er, oder nicht? Aber ich weiß es nicht.
Vielleicht ist er nur in seiner Heimat ins Unglück geraten
und wollte bei seinen Verwandten Hilfe suchen…«
»Beim alten Joseph Hilfe suchen!« Der Mann lachte.
»Vielleicht wurde er aus seiner Heimat vertrieben«, sagte
der Mann mit dem roten Käppchen. »Wer weiß? Er kann
bei Joseph nicht viel erreicht haben. Er war nicht sehr
lange dort.«
»Er weiß wohl nicht, wo er jetzt hin soll«, sagte der Topf-
händler.
Er blieb an der Synagogenwand bis zum Anbruch der
Nacht. Er begann starken Hunger zu spüren. Außerdem
regte sich zum erstenmal seit mehr als einem Monat
wieder Lust bei ihm. Es war, als käme ihm der Trieb als
Retter in der Not, als ob die Lust ihn die Verwirrung
vergessen machen könnte, die in seinem Geist herrschte.
Er stand langsam auf und ging zu der Gasse zurück.
Er ging durch die Zimmermannsgasse, in der es jetzt still
war. Aus den Häusern waren einige Stimmen und das
Bellen eines Hundes zu hören.
Er erreichte das Haus. Die Werkbank und das Holz wa-
ren weg. Das Tor war verriegelt.
Er klopfte.
Es kam keine Antwort.
– 130 –

Er klopfte etwas lauter und konnte seine Diskretion
kaum verstehen.
Das Tor wurde geöffnet, und ihr Gesicht schaute heraus.
Sie schenkte ihm ein breites, wissendes Lächeln.
»Komm herein!« sagte sie. »Er ist schon vor Stunden
nach Nain abgereist.«
»Ich bin hungrig«, sagte er.
»Ich werde dir etwas zu essen geben.«
In der Küche rührte sich etwas in der Dunkelheit, aber
er sah nicht hin. Er eilte durch den nächsten Raum. Eine
Lampe brannte dort. Eine Leiter führte zu einer Öffnung
in der Decke.
»Warte hier!« sagte sie. »Ich hole etwas zu essen.«
Sie ging mehrere Male in die Küche und kam wieder zu-
rück. Zuerst brachte sie ihm Wasser zum Waschen und
dann ein Gericht aus Dörrfleisch, Brot und eine Kanne
Wein.
»Das ist alles, was wir haben«, sagte sie.
Sie sah in sein dunkles, mürrisches Gesicht. Er hatte sei-
nen Körper vom Staub befreit und sein Haar und seinen
Bart ausgekämmt. Jetzt sah er ganz präsentabel aus. Aber
sein Blick war zurückhaltend, während er aß, und er sah
sie nicht direkt an.
Sie atmete jetzt schwer. Sie konnte das Verlangen ihres
großen Körpers nur noch schwer zügeln. Sie zog ihren
Rock über ihre Waden hinauf und spreizte ihre Beine, als
sie sich vor ihn auf den Hocker setzte.
Er kaute weiter, aber sein Blick ruhte jetzt auf ihrem Kör-
per.
»Beeil dich!« sagte sie.
Er aß zu Ende und trank langsam den Rest des Weines.
– 131 –

Dann fiel sie ihn an. Ihre Hände rissen ihm das zerlump-
te Lendentuch ab, ihre Finger waren an seinen Genitalien,
ihre Lippen auf seinem Gesicht, und ihr großer Körper
drängte sich ungestüm an ihn.
Er schnappte nach Luft, schob ihren Rock hoch, drang
mit den Fingern in sie ein, stieß sie um, legte sie auf den
Fußboden und drückte ihr hastig die Beine auseinander.
Sie stöhnte, schrie auf, fauchte, verkrallte sich in ihn und
lag dann still, als er unaufhörlich in sie hineinstieß. Aber
die Lust verging ihm, bevor er fertig war. Er seufzte und
schaute plötzlich auf.
Der Idiot stand in der Tür und sah ihnen zu. Ein Spei-
chelfaden hing ihm vom Kinn, und auf seinem Gesicht
stand ein leeres Grinsen.
– 132 –

DRITTER TEIL
13
Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns.
Johannes 1, 14
Jeden Dienstag traf sich die Diskussionsgruppe der Jun-
gianer in dem Leerzimmer über dem Mandala-Buchladen,
um über schwierige doktrinäre Fragen zu debattieren und
sich mit Gruppenanalyse und Gruppentherapie zu
beschäftigen.
Glogauer hatte die Gruppe nicht organisiert, aber er hat-
te ihr bereitwillig seine Räume zur Verfügung gestellt. Es
war eine große Erleichterung, einmal in der Woche mit
gleichgesinnten Menschen reden zu können.
Das Interesse an Jung hatte sie zusammengeführt, aber
jeder hatte noch seine besonderen Eigeninteressen. Mrs.
Rita Blen zeichnete die Flugbahnen von Fliegenden Un-
tertassen auf, wenn auch nicht klar war, ob sie wirklich an
sie glaubte oder nicht. Hugh Joyce war überzeugt, daß alle
Jungschen Archetypen von den alten Lemurianern abgelei-
tet waren, die vor Jahrtausenden umgekommen waren.
Alan Chedder, der Jüngste in der Gruppe, interessierte
sich für den indischen Mystizismus, und Sandra Peterson,
die Organisatorin, war eine große Spezialistin für He-
xenkünste.
James Headington interessierte sich für die Zeit. Als Sir
James Headington war er der Stolz der Gruppe, ein
– 133 –

Physiker, Erfinder in der Kriegszeit, sehr reich und Träger
von allerlei Auszeichnungen für seinen Beitrag zum Sieg
der Alliierten. Er hatte im Krieg im Ruf gestanden, ein
großer Improvisator zu sein, aber später war er dem War
Office lästig geworden. Sie hielten ihn für überge-
schnappt, und am schlimmsten fanden sie, daß er seine
Übergeschnapptheit öffentlich zur Schau trug.
Sir James hatte ein hageres, aristokratisches Gesicht
(obgleich seine Eltern aus dem Mittelstand Norwoods
stammten), einen schmalen, etwas unmännlich gebauten
Mund, eine lange weiße Mähne und dichte schwarze
Augenbrauen. Er trug altmodische Anzüge, sehr grelle
Hemden und Krawatten mit Blumenmustern. Von Zeit zu
Zeit erzählte er den anderen Mitgliedern von seinen Fort-
schritten mit seiner Zeitmaschine. Sie ließen es über sich
ergehen. Die meisten von ihnen neigten dazu, ihre
eigenen Erfahrungen im Zusammenhang mit ihren ver-
schiedenen Interessen ein wenig auszuschmücken.
Eines Dienstagabends fragte Headington Glogauer, nach-
dem alle anderen gegangen waren, ob er mit nach Banbu-
ry kommen und sich sein Laboratorium ansehen möchte.
»Ich beschäftige mich zur Zeit mit allerhand spektakulä-
ren Experimenten. Schicke Kaninchen durch die Zeit und
dergleichen Dinge. Sie müssen wirklich einmal mitkom-
men und sich das Labor ansehen.«
»Ich kann es nicht glauben«, sagte Glogauer. »Sind Sie
wirklich in der Lage, Dinge durch die Zeit zu schicken?«
»O ja. Sie sind der erste, dem ich es erzählt habe.«
»Ich kann es nicht glauben!« Und er konnte es wirklich
nicht.
»Kommen Sie mit und sehen Sie selbst!«
– 134 –

»Warum erzählen Sie das mir?«
»Oh, ich weiß nicht. Ich mag Sie, nehme ich an.«
Glogauer lächelte. »Na gut. Ich werde kommen. Wann
würde es am besten passen?«
»Wann Sie wollen. Möchten Sie nicht am Freitag kom-
men und übers Wochenende bleiben?«
»Sind Sie sicher, daß es Ihnen recht wäre?«
»Absolut!«
»Ich habe eine Freundin…«
»Hm…« Headington sah unsicher drein. »Ich bin nicht
allzu sehr daran interessiert, dies schon jetzt an die Öf-
fentlichkeit kommen zu lassen…«
»Ich werde ihr absagen.«
»Fein! Nehmen Sie den Vieruhrzug von Paddington,
wenn Sie können! Ich hole Sie vom Bahnhof ab. Dann bis
Freitag!«
»Bis Freitag!«
Glogauer sah ihm nach und fing an zu grinsen. Der alte
Kerl war wahrscheinlich verrückt. Er besaß wahrscheinlich
einen Riesenhaufen teurer, aber sinnloser elektronischer
Einrichtungen, aber es würde ganz nett sein, ein Wochen-
ende außerhalb Londons zu verbringen und zu sehen, was
in Banbury wirklich vorging.
Headington besaß eine alte Pfarrei in einem Dorf, etwa
drei Kilometer von Banbury entfernt. Die Laborgebäude
auf dem Grundstück waren alle ziemlich neu.
Headington beschäftigte zwei junge Männer ganztägig
als Assistenten; sie gingen gerade, als der Physiker Glogau-
er in das Hauptgebäude führte.
– 135 –

Wie Glogauer schon erwartet hatte, war das Haus voller
technischer Apparaturen, und überall hingen Drähte und
Kabel herum.
»Hier«, sagte Headington und zog Glogauer zu dem frei-
en Teil des Laboratoriums. Auf einem breiten Tisch stan-
den mehrere durch Drähte verbundene schwarze Kästen.
In deren Mitte stand ein anderer Kasten, ein silbergrauer.
Headington schaute auf seine Uhr und studierte die Ska-
len an den schwarzen Kästen. »Jetzt wollen wir mal sehn.«
Er drehte an verschiedenen Knöpfen. Dann ging er zu
einer Reihe von Käfigen auf der anderen Seite des Raumes
und holte ein zappelndes weißes Kaninchen heraus. Er
setzte das Kaninchen in den silbernen Kasten, verstellte
wieder einige Knöpfe an den schwarzen Kästen und legte
dann einen Schalter um, der auf dem Tisch festgeschraubt
war. »Die Stromzufuhr«, sagte er.
Glogauer blinzelte. Es war, als hätte die Luft für einen
Augenblick
gezittert.
Der
silberne
Kasten
war
verschwunden.
»Mein Gott!«
Headington lachte. »Sehen Sie – ab durch die Zeit!«
»Es ist verschwunden«, gab Glogauer zu. »Aber das be-
weist nicht, daß es in die Zukunft gereist ist.«
»Richtig. Es ist nämlich in die Vergangenheit gereist. In
die Zukunft kann ich es nicht schicken. Das ist zur Zeit
noch unmöglich.«
»Nun – ich meinte, es beweist nicht, daß das Kaninchen
durch die Zeit reist.«
»Wohin sollte es sonst sein? Sie können es mir glauben,
Glogauer. Das Kaninchen ist hundert Jahre zurückgereist.«
»Woher wissen Sie das?«
– 136 –

»Kurzzeitversuche haben es bewiesen. Ich kann etwas zu
einem ziemlich genau berechneten Datum zurückschi-
cken. Glauben sie mir!«
Glogauer verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich glau-
be Ihnen, Sir James.«
»Wir bauen jetzt das Ding in groß. Um einen Menschen
zurückschicken zu können. Die einzige Schwierigkeit ist,
daß die Reise zur Zeit noch ein wenig unbequem ist.
Sehen Sie her!« Er drückte auf einen Knopf am ersten
schwarzen Kasten. Sofort stand der silberne Kasten wieder
auf dem Tisch. Glogauer faßte ihn an. Er war recht heiß.
»Hier.« Headington langte in den Kasten und zog das
Kaninchen heraus. Es blutete am Kopf, und seine
Knochen schienen gebrochen zu sein. Es lebte, aber litt
offensichtlich schreckliche Schmerzen. »Sehen Sie, was ich
meine?« fragte Headington. »Armes kleines Ding.«
Glogauer wandte sich ab.
Als sie wieder im Arbeitszimmer waren, sprach Heading-
ton über seine Experimente, aber er nahm an, Glogauer
wäre mit der Physiksprache vertraut, und Glogauer war zu
stolz zuzugeben, daß er von Physik so gut wie nichts ver-
stand. So kam es, daß er einige Stunden in einem Sessel
saß und schlau nickte, während Headington begeistert er-
zählte.
Headington zeigte ihm später, wo er schlafen sollte. Es
war ein eichengetäfeltes Zimmer mit einem breiten, be-
quemen, modernen Bett.
»Schlafen Sie gut!« sagte Headington.
In dieser Nacht wurde Glogauer wach und sah eine
Gestalt auf seinem Bettrand sitzen. Es war Headington,
– 137 –
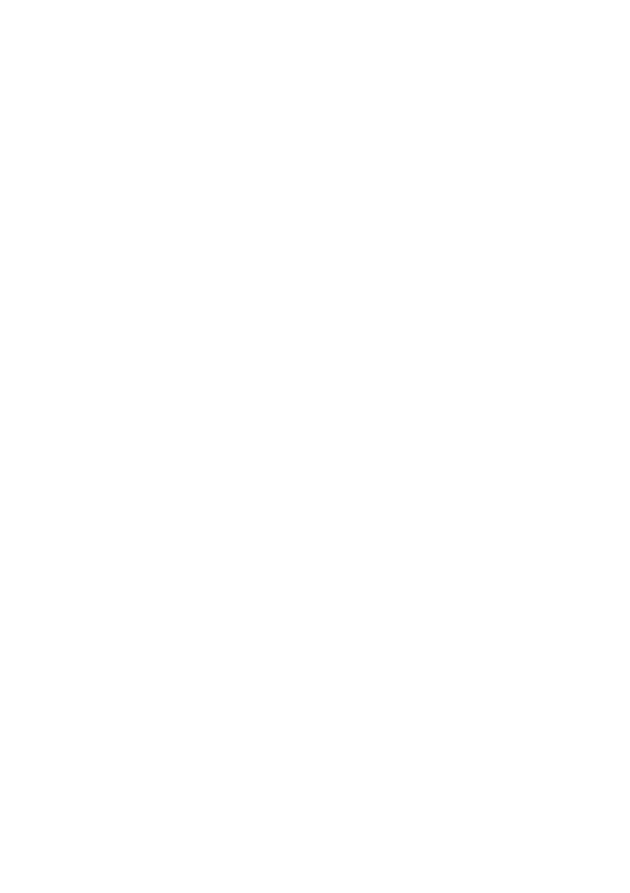
und er war völlig nackt. Er hatte seine Hand auf Karls
Schulter liegen.
»Ich nehme an – «, begann Headington.
Glogauer schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, Sir James.«
»Nun, ja«, sagte Headington. »Nun, ja.«
Sobald er gegangen war, begann Glogauer zu mastur-
bieren.
Headington hatte ihn einige Tage später angerufen und
gefragt, ob er wieder einmal nach Banbury kommen
möchte, aber Glogauer hatte höflich abgelehnt.
»Wir sind dabei, einige der kleinen Probleme zu lösen«,
erzählte ihm Headington. »Wir haben zum Beispiel her-
ausgefunden, wie wir den Reisenden am besten schützen.
Keiner meiner jungen Leute ist jedoch bereit, das Ver-
suchskaninchen zu sein. Würde es Sie nicht interessieren,
Glogauer?«
»Nein«, sagte Glogauer. »Tut mir leid, Sir James.«
Während der nächsten Wochen wurde Glogauer immer
unruhiger. Monica kam nicht mehr so oft zu ihm, und
wenn sie kam, schien sie keinerlei Lust zu Liebesspielen
irgendwelcher Art zu haben.
Eines Nachts wurde er wütend und fuhr sie an.
»Was ist los mit dir? Du bist kalt wie ein Faß Eis.«
Sie ließ das eine halbe Stunde über sich ergehen, bevor
sie müde sagte: »Nun, einmal mußtest du es ja erfahren.
Wenn du es unbedingt wissen willst, ich habe ein Verhält-
nis.«
– 138 –

»Was?« Er wurde sofort ruhig. »Das glaube ich nicht.« Er
war immer so davon überzeugt gewesen, daß sich kein
anderer von ihr angezogen fühlen würde. Er hätte beina-
he gefragt, wer sie schon nehmen würde, hielt sich aber
dann zurück.
»Was ist es für einer?« fragte er schließlich.
»Eine«, sagte Monica. »Eine Kollegin in der Klinik. Zur
Abwechslung mal was anderes.«
»Oh, Herrgott!«
Monica seufzte. »Es ist wirklich eine Erholung für mich.
Ich habe nicht so schrecklich viel Spaß daran – aber ich
war so müde von deinen Gefühlsausbrüchen, Karl. Krank
und müde.«
»Warum verläßt du mich dann nicht ganz? Was für ein
Kompromiß ist das?«
»Ich nehme an, weil ich die Hoffnung nicht aufgeben
kann«, sagte Monica. »Ich glaube immer noch, daß etwas
in dir steckt, das es wert ist, gefördert zu werden. Ich bin
vielleicht blöd.«
»Was willst du mir antun?« Er wurde hysterisch. »Was –
was ist…? Du hast mich betrogen!«
»Du mußt mich verstehen, Karl. Es ist kein Betrug – es ist
nur ein Urlaub.«
»Dann mach lieber einen Dauerurlaub daraus!« sagte er
wütend, ging hinüber und warf ihr ihre Kleider hin.
»Scher dich fort, du Sau!«
Sie stand müde und resigniert auf und begann sich anzu-
ziehen.
Als sie fertig war, öffnete sie die Tür. Er lag auf dem Bett
und weinte.
»Leb wohl, Karl!«
– 139 –

»Hau ab!«
Die Tür schloß sich.
»Du Sau! Oh, du Sau!«
Am nächsten Morgen rief er Sir James Headington an.
»Ich habe meine Meinung geändert«, sagte er. »Ich bin
bereit zu tun, was Sie von mir wünschen. Ich bin Ihr
Mann. Es ist nur eine Bestimmung dabei.«
»Welche?«
»Ich will selbst bestimmen, in welche Zeit und an wel-
chen Ort ich reise.«
»In Ordnung.«
Eine Woche später fuhr er an Bord eines privat
gecharterten Schiffes in den Nahen Osten. Eine Woche da-
nach verließ er 1970 und kam im Jahr 28. n. Chr. an.
– 140 –

14
In der Synagoge war es kühl und ruhig, und es duftete
nach Weihrauch. In dem sauberen weißen Gewand, das
Maria ihm geschenkt hatte, als er am Morgen von ihr ging,
ließ er sich von den Rabbinern in den Hof führen. Genau
wie die Stadtbewohner wußten auch sie nicht, was sie von
ihm halten sollten, aber sie waren überzeugt, daß er nicht
von einem Teufel besessen war.
Ab und zu sah er an seinem Körper herunter und be-
rührte ihn, als ob er erstaunt wäre, oder befühlte verwirrt
das Gewand. Er hatte Maria fast vergessen.
»Alle Männer haben einen Messiaskomplex, Karl«, hatte
Monica einmal gesagt.
Die Erinnerungen wurden jetzt lückenhaft – wenn es
überhaupt Erinnerungen waren. Er brachte sie durchein-
ander.
»Es gab damals Dutzende Messiasse in Galiläa. Daß es ge-
rade Jesus war, der in der Legende und in der Philosophie
weiterlebte, war ein historischer Zufall…«
»Es muß mehr daran gewesen sein, Monica.«
Es war Brauch bei den Rabbinern, vielen der jetzt überall
in Galiläa umherziehenden Propheten Obdach zu geben,
solange sie nicht irgendeiner verbotenen Sekte ange-
hörten.
Dieser hier war sonderbarer als alle anderen. Sein Ge-
sicht war die meiste Zeit unbeweglich, und sein Körper
– 141 –

war steif, aber oft liefen ihm Tränen über die Wangen. Die
Rabbiner hatten noch nie solchen Schmerz in den Augen
eines Mannes gesehen.
»Die Wissenschaft kann uns sagen wie, aber sie fragt nie
warum«, hatte er Monica gesagt. »Sie kann keine Antwort
geben.«
»Wer will's wissen?« hatte sie geantwortet.
»Ich.«
»Nun, du wirst es nie herausfinden, oder?«
Sau! Verräterin! Kanaille!
Warum ließen sie ihn immer sitzen?
»Setz dich, mein Sohn!« sagte der Rabbiner. »Was möch-
test du uns fragen?«
»Wo ist Christus?« fragte er.
Sie verstanden seine Sprache nicht.
»Ist es Griechisch?« fragte einer, aber ein anderer
schüttelte den Kopf.
Kyrios: Der Herr.
Adonai: Der Herr.
Wo war der Herr?
Er zog die Stirn kraus und sah sich unsicher um.
»Ich muß mich ausruhen«, sagte er in ihrer Sprache.
»Woher kommst du?«
– 142 –

Er wußte nicht, was er antworten sollte.
»Woher kommst du?« wiederholte ein Rabbiner die Fra-
ge.
Schließlich murmelte er: »Ha-Olam Hab-Bah…«
Sie sahen einander an. »Ha-Olam Hab-Bah«, sagten sie.
Ha-Olam Hab-Bah; Ha-Olam Haz-Zeh: Die Welt, die
kommt, und die Welt, die ist.
»Bringst du uns eine Botschaft?« fragte einer der Rabiner.
Dieser Prophet war so anders. So sonderbar, daß man fast
glauben konnte, er sei ein echter Prophet. »Eine Bot-
schaft?«
»Ich weiß es nicht«, sagte der Prophet heiser. »Ich muß
mich ausruhen. Ich bin schmutzig. Ich habe gesündigt.«
»Komm! Wir werden dir Essen und eine Schlafstätte ge-
ben. Wir werden dir zeigen, wo du baden und wo du be-
ten kannst.«
Diener brachten heißes Wasser, und er reinigte seinen
Körper. Sie stutzten ihm den Bart und das Haar und
schnitten ihm die Nägel.
In der Zelle, die die Rabbiner ihrem Besuch zugewiesen
hatten, brachten sie ihm dann gutes Essen, das er nur mit
Mühe essen konnte. Und der Strohsack im Bett war ihm
zu weich. Er war das nicht gewohnt. Aber in Josephs Haus
hatte er keine richtige Ruhe gefunden, und er legte sich
hin.
Er schlief schlecht, schrie im Traum, und draußen vor
der Zelle horchten die Rabbiner. Aber sie verstanden nicht
viel von dem, was er sagte.
– 143 –

»Daß du von allen Dingen ausgerechnet Aramäisch stu-
dieren würdest, Karl, hätte ich zuallerletzt erwartet. Kein
Wunder, daß du…«
Meine Teufelin, meine Versucherin, mein Verlangen, mein
Kreuz, meine Liebe, meine Lust, mein Bedürfnis, meine
Nahrung, mein Anker, meine Herrin, meine Sklavin, mein
Fleisch, meine Befriedigung, meine Zerstörerin.
Ach, all die Tage voller Liebe, die es hätte geben können,
wenn ich stark gewesen wäre; nach Eva und all denen, die
mich wegen meiner Schwächen verschmähten; nach all
dem Lohn, der dem Tapferen zuteil wird, nach all den
Realitäten, die dem Starken winken, danach sehne ich
mich. Das ist die Ironie.
Die förmliche Ironie, unvermeidlich und gerecht.
Ich bin nicht zufrieden.
Karl Glogauer blieb einige Wochen in der Synagoge. Er
verbrachte die meiste Zeit mit Lesen in der Bibliothek. Er
suchte in den langen Schriftrollen nach einer Antwort auf
sein Dilemma. Die Testamentstexte, die in vielen Fällen
ein
Dutzend
verschiedene
Auslegungen
erlaubten,
verwirrten ihn nur noch mehr. Es gab nichts Greifbares,
nichts, das ihm sagte, wo der Fehler lag.
Dies ist eine Komödie. Ist es das, was ich verdiene? Gibt es
keine Hoffnung? Keine Lösung?
Die Rabbiner hielten meistens Abstand. Sie hatten ihn als
einen heiligen Mann akzeptiert. Sie waren stolz, ihn in ih-
– 144 –

rer Synagoge zu haben. Sie waren sicher, daß er einer der
Auserwählten Gottes war, und sie warteten geduldig, bis
er zu ihnen sprach.
Aber der Prophet sagte wenig, murmelte nur manchmal
etwas vor sich hin, ein paar Worte in ihrer Sprache und
dann wieder in der unverständlichen Sprache, die er oft
benutzte, sogar wenn er sie direkt ansprach.
Die Einwohner von Nazareth sprachen kaum über etwas
anderes als den mysteriösen Propheten in der Synagoge.
Sie wußten, daß er ein Verwandter von Joseph war, und
Joseph bestätigte das jetzt stolz. Sie wußten, daß Joseph
vom Geschlecht Davids war, ganz gleich, was der gries-
grämige Zimmermann sonst sein mochte. Also war auch
der Prophet vom Geschlecht Davids. Ein wichtiges Zei-
chen, darin waren sich alle einig.
Sie befragten die Rabbiner, aber die weisen Männer er-
zählten ihnen nichts, außer daß sie ihrer Arbeit nachgehen
sollten, daß es Dinge gebe, die sie noch nicht wissen
dürften. Auf diese Art wichen sie Fragen aus, die sie nicht
beantworten konnten, wie Priester das schon immer ge-
macht hatten, während sie andererseits den Eindruck
erweckten, mehr zu wissen, als tatsächlich der Fall war.
Dann, an einem Sabbat, erschien er im öffentlichen Teil
der Synagoge und nahm seinen Platz unter denen ein, die
zum Gottesdienst gekommen waren.
Der Mann zu seiner Linken, der aus der Schriftenrolle
vorlas, verhedderte sich und schielte den Propheten an.
Der Prophet saß da und hörte mit abwesendem Blick zu.
Der Chefrabbiner sah ihn unsicher an und gab dann ein
Zeichen, man solle die Schriftrolle dem Propheten geben.
– 145 –

Zögernd ging ein Junge hin und drückte dem Propheten
die Rolle in die Hand.
Der Prophet sah die Worte lange an, und es schien, als
wollte er nicht lesen, denn er machte einen verstörten
Eindruck. Dann richtete er sich auf und begann mit klarer
Stimme zu lesen, fast frei von seinem üblichen Akzent. Er
las aus dem Buch Jesaja.
Die Leute hörten ihm mit großer Aufmerksamkeit zu.
»Der Geist des Herrn ist bei mir, darum daß er mich
gsalbt hat; er hat mich gesandt, zu verkündigen das
Evangelium den Armen, zu heilen die zerstoßenen
Herzen, zu predigen den Gefangenen, daß sie los sein
sollen, und den Blinden das Gesicht und den Zer-
schlagenen, daß sie frei und ledig sein sollen, und zu ver-
kündigen das angenehme Jahr des Herrn.« Und als er das
Buch zutat, gab er's dem Diener und setzte sich. Und
aller Augen, die in der Schule waren, sahen auf ihn.
Lukas 4, 18–20
Glogauer setzte danach sein Studium der Testamente
nicht fort, sondern machte es sich zur Gewohnheit, in den
Straßen umherzuwandern und mit den Menschen zu re-
den. Sie erwiesen ihm viel Ehrerbietung und baten ihn
um Rat in allen möglichen Dingen. Er tat sein bestes, um
sie gut zu beraten.
Seit seinen ersten Wochen mit Eva hatte er sich nicht
mehr so gut gefühlt.
– 146 –

Er beschloß, das nicht ein zweitesmal zu verlieren.
Zuerst zögerte er und weigerte sich, wenn sie ihn baten,
einem Kranken die Hand aufzulegen. Aber einmal, in
einem Fall von offensichtlicher hysterischer Blindheit,
nach allem was die Verwandten ihm erzählten, legte er
doch seine Hände auf die Augen der Frau, und ihre Blind-
heit verließ sie.
Ohne es zu wollen, war Glogauer bei der Rückkehr in
seine Zelle in der Synagoge sehr erregt. Es gab hier so
viele Fälle von Hysterie aller Art.
Vielleicht war die Hysterie ein Produkt der Zeit, er konn-
te das nicht sagen. Schließlich schlug er sich den Ge-
danken aus dem Kopf. Er würde sich später darum
sorgen.
Am nächsten Tag sah er Maria über den Marktplatz ge-
hen. Sie führte ihren unehelichen Sohn an seinem Um-
hang.
Glogauer machte eilig kehrt und ging in die Synagoge
zurück.
– 147 –

15
Sie folgten ihm jetzt, als er Nazareth verließ und in Rich-
tung auf den See Genezareth davonwanderte. Er hatte das
frische weiße Leinengewand an, das sie ihm gegeben hat-
ten, und bewegte sich mit wunderbarer Anmut und
Würde; ein großer Führer, ein großer Prophet; aber
obwohl sie meinten, er führe sie, trieben sie ihn in
Wirklichkeit vor sich her.
Wenn sie unterwegs jemand fragte, sagten sie: »Es ist un-
ser Messias.« Und es gingen schon Gerüchte über viele
Wundertaten um.
Meine Erlösung, meine Rolle, meine Bestimmung. Bei der
Überwindung einer Versuchung muß ich erst einer
anderen nachgeben; Feigheit und Stolz. Mit der Lüge
leben, um die Wahrheit herbeizuführen. Ich habe viele
betrogen, die mich betrogen haben, weil ich mich selbst
betrog.
Aber Monica würde meinen Pragmatismus jetzt bil-
ligen…
Wenn er die Kranken sah, taten sie ihm leid, und er tat
sein möglichstes, weil sie etwas von ihm erwarteten. Für
viele konnte er nichts tun, aber anderen, mit offensicht-
lich leicht zu behebenden psychosomatischen Leiden,
konnte er helfen. Sie glaubten stärker an seine Kräfte als
an ihre Krankheit. So heilte er sie.
– 148 –

Als er nach Kapernaum kam, folgten ihm fünfzig Men-
schen in die Straßen der Stadt. Es war schon bekannt, daß
irgendeine Verbindung zwischen ihm und Johannes dem
Täufer bestand, der sich in Galiläa eines großen Rufes er-
freute und von vielen Pharisäern als echter Prophet aner-
kannt wurde. Doch dieser Mann hatte Kräfte, die denen
des Täufers in mancher Weise überlegen waren. Er war
kein so guter Redner wie Johannes, aber er hatte Wunder
gewirkt.
Kapernaum war eine weitläufige Stadt am kristallklaren
See Genezareth. Zwischen den einzelnen Häusern lagen
große Marktgärten. Fischerboote an der weißen Kaimauer,
auch Handelsschiffe, die die Städte an den Ufern des Sees
anliefen.
Obwohl der See auf allen Seiten von grünen Bergen ein-
gerahmt war, lag Kapernaum selbst auf einer Ebene, im
Schutz der Berge. Es war eine ruhige Stadt, die wie die
meisten in Galiläa viele nichtjüdische Einwohner hatte.
Griechische, römische und ägyptische Händler sah man in
den Straßen, und viele hatten Häuser dort. Es gab eine
wohlhabende Mittelklasse aus Kaufleuten, Handwerkern
und Schiffseignern, dazu Ärzte, Rechtsanwälte und Ge-
lehrte, denn Kapernaum lag an den Grenzen der Provin-
zen Galiläa, Trachonitis und Syrien, war zwar eine verhält-
nismäßig kleine Stadt, aber ein wichtiger Handels- und
Verkehrsknotenpunkt.
Der sonderbare, verrückte Prophet in dem wallenden
Leinengewand, mit dem bunt zusammengewürfelten Ge-
folge, das hauptsächlich aus armen Leuten bestand, zu
dem aber doch auch Männer von einigem Rang gehörten,
zog in Kapernaum ein.
– 149 –

Es hatte sich die Nachricht verbreitet, daß der Mann
wirklich die Zukunft voraussagen könne, daß er schon die
Verhaftung von Johannes durch Herodes Antipas vor-
ausgesagt habe und Herodes bald danach den Täufer in
Peräa eingesperrt habe.
Das war es, was sie beeindruckte. Er machte seine Vor-
hersagen nicht in allgemeinen Wendungen, in vagen Aus-
drücken wie die anderen Propheten. Er sprach von
Dingen, die sich bald ereignen sollten, und er gab genaue
Einzelheiten an.
Keiner kannte zu dieser Zeit seinen Namen. Das machte
ihn noch geheimnisvoller und erhöhte seine Bedeutung.
Er war einfach der Prophet aus Nazareth oder der Naza-
rener.
Manche sagten, er sei ein Verwandter, vielleicht der
Sohn eines Zimmermanns in Nazareth, aber das konnte
auch davon kommen, daß die Schriftbilder der Worte
›Sohn eines Zimmermanns‹ und ›Magus‹ fast gleich aussa-
hen. Der Irrtum konnte also auf diese Weise entstanden
sein.
Es wurde sogar gelegentlich behauptet, sein Name sei
Jesus. Der Name war ein- oder zweimal gefallen, aber
wenn sie ihn fragten, ob das tatsächlich sein Name sei, be-
stritt er es oder antwortete, geistesabwesend wie er war,
überhaupt nicht.
Seine eigentlichen Predigten hatten nicht das Feuer und
die Wirkung wie die des Johannes, und viele seiner Hin-
weise erschienen ein wenig unverständlich, selbst den
Priestern und Gelehrten, die aus Neugier kamen, ihn
anzuhören.
– 150 –

Dieser Mann sprach sanft, ziemlich vage, und lächelte
oft. Er sprach auch in einer merkwürdigen Weise über
Gott, und er schien ebenso wie Johannes zu den Essenern
zu gehören, denn er predigte gegen die Anhäufung von
persönlichem Reichtum und bezeichnete ebenfalls die
Mitmenschen als Brüder.
Aber es waren besonders die Wunder, auf die alle warte-
ten, als er in die schöne Synagoge von Kapernaum geleitet
wurde.
Vor ihm hatte noch kein Prophet Kranke geheilt und Ver-
ständnis für die Leiden gezeigt, über die man selten
sprach. Es waren nicht so sehr seine Worte, sondern mehr
sein Mitgefühl, auf das sie ansprachen.
Doch manchmal wurde er verschlossen und wollte nicht
reden, verlor sich in seinen eigenen Gedanken, und man-
che bemerkten, wie schmerzvoll sein Blick war, und
ließen ihn allein, weil sie glaubten, er stehe in Gedanken-
verbindung mit Gott.
Diese Perioden wurden mit der Zeit kürzer, und er wid-
mete den Kranken und Hilfsbedürftigen mehr Zeit, tat
sein möglichstes für sie, und selbst die Weisen und die
Reichen in Kapernaum begannen ihn zu achten.
Vielleicht die größte Wandlung, die er durchgemacht
latte, war, daß Karl Glogauer zum erstenmal in seinem
Leben Karl Glogauer vergessen hatte. Zum erstenmal in
seinem Leben tat er, wozu er sich immer zu schwach ge-
wähnt hatte. Damit ging gleichzeitig sein größter Wunsch
in Erfüllung; er vollbrachte, was er immer zu vollbringen
gehofft hatte, bevor er die Psychiatrie aufgab.
Da war noch etwas anderes, etwas, das er mehr instinktiv
als mit dem Verstand erfaßte. Er hatte jetzt die Gelegen-
– 151 –

heit, Erlösung und gleichzeitig Bestätigung für das Leben
zu finden, das er geführt hatte, bis er Johannes den Täufer
verließ und in die Wüste floh.
Aber es war nicht sein eigenes Leben, das er von nun an
führte. Er brachte der Welt einen Mythos, eine Generati-
on, bevor dieser Mythos geboren werden sollte. Er schloß
einen gewissen seelischen Kreis. Er sagte sich, daß er die
Geschichte nicht verändere; er verlieh der Geschichte le-
diglich mehr Gehalt.
Da ihm der Gedanke, Jesus sei nichts weiter als ein My-
thos gewesen, immer unerträglich gewesen war, hielt er
es für seine Pflicht, Jesus zu einer physischen Realität
werden zu lassen, statt nur zu einem Geschöpf eines my-
thogenetischen Prozesses. Warum war das wichtig? fragte
er sich; aber er wies die Frage immer schnell von sich,
denn solche Fragen verwirrten ihn, erschienen ihm wie
Fallen, eine Ausflucht und die Möglichkeit, sich wieder
einmal selbst zu betrügen.
So sprach er also in den Synagogen. Er sprach von einem
milderen Gott als andere vor ihm, und soweit er sich an
sie erinnern konnte, erzählte er ihnen Gleichnisse.
Und nach und nach schwand das Bedürfnis, sein Tun
verstandesmäßig zu rechtfertigen, und sein Identitätsge-
fühl wurde immer schwächer und durch ein anderes
ersetzt, in dem die Rolle, die er gewählt hatte, immer
mehr Gewicht erhielt. Es war eine in jeder Beziehung ar-
chetypische Rolle, eine Rolle, die einem Schüler Jungs
liegen mußte. Es war eine Rolle, die über eine bloße
Nachahmung hinausging. Es war eine Rolle, die er jetzt bis
ins kleinste Detail durchspielen mußte.
– 152 –

Karl Glogauer hatte die Wirklichkeit gefunden, nach der
er gesucht hatte. Das hieß jedoch nicht, daß er nicht
immer noch Zweifel hatte.
Und es war ein Mensch in der Schule, besessen mit einem
unsauberen Teufel; der schrie laut und sprach: Halt, was
haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Du
bist gekommen, uns zu verderben. Ich weiß, wer du bist:
Verstumme und fahre aus von ihm! Und der Teufel warf
ihn mitten unter sie und fuhr von ihm aus und tat ihm
keinen Schaden. Und es kam eine Furcht über sie alle,
und sie redeten miteinander und sprachen: Was ist das
für ein Ding? Er gebietet mit Macht und Gewalt den un-
saubern Geistern, und sie fahren aus. Und er erscholl
sein Gerücht in alle Örter des umliegenden Landes.
Lukas 4, 33–37
– 153 –

16
Aber ich weiß, daß mein Erlöser lebt; und als der letzte
wird er über dem Staube sich erheben.
Hiob 19, 25
O felix culpa, qua talem ac tantum meruit habere
Redemp-torem.
Missale – Karsamstag.
»Massenhalluzinationen. Wunder, Fliegende Untertassen,
Geister, das Tier aus dem Es, das ist alles dasselbe«, hatte
Monica gesagt.
»Sehr wahrscheinlich«, hatte er geantwortet. »Aber war-
um sahen sie ihn?«
»Weil sie ihn sehen wollten.«
»Warum wollten sie es?«
»Weil sie Angst hatten.«
»Du meinst, mehr ist da nicht dran?«
»Genügt es nicht?«
Als er Kapernaum das erstemal verließ, folgten ihm viel
mehr Menschen.
Es war nicht mehr möglich gewesen, in der Stadt zu
bleiben, denn die Geschäfte waren fast zum Erliegen ge-
kommen durch die Menschenmassen, die gekommen
waren, um ihn seine einfachen Wunder wirken zu sehen.
Also sprach er außerhalb der Städte zu ihnen, von Berg-
hängen und Flußufern aus.
– 154 –

Er sprach mit klugen, belesenen Männern, mit denen ihn
etwas zu verbinden schien. Darunter waren die Besitzer
von Fischereiflotten – Simon, Jakobus und Johannes und
andere. Ein anderer war Arzt, einer ein Beamter, der ihn
in Kapernaum zum erstenmal reden gehört hatte.
»Es müssen zwölf sein«, sagte er eines Tages zu ihnen
und lächelte. »Es muß ein Zodiakus sein.«
Und er wählte sie nach ihren Namen aus. »Ist hier ein
Mann, der Petrus heißt? Ist einer hier, der Judas heißt?«
Und als er sie gewählt hatte, bat er die anderen wegzuge-
hen, weil er eine Weile mit den Zwölfen allein sprechen
wollte.
Es muß so genau sein, wie ich es noch in Erinnerung
habe. Es wird Schwierigkeiten geben, Widersprüche, aber
ich muß wenigstens das Gerüst liefern.
Er nahm kein Blatt vor den Mund, bemerkten die Leute.
Er war bei seinen Attacken und mit seinen Beispielen so-
gar noch deutlicher als Johannes der Täufer. Nur wenige
Propheten waren so mutig; wenige strahlten soviel Zuver-
sicht aus.
Viele seiner Gedanken waren sonderbar. Viele der Din-
ge, über die er sprach, waren ihnen fremd. Manche Phari-
säer hielten ihn für einen Gotteslästerer.
Gelegentlich versuchte jemand ihn zu warnen, schlug
ihm vor, er solle um seiner Sache willen manche seiner
Aussagen modifizieren, aber er lächelte nur und schüttelte
den Kopf. »Nein. Ich muß sagen, was ich sagen muß. Es ist
so beschlossen.«
– 155 –

Eines Tages traf er einen Mann, in dem er einen der
Essener aus der Kolonie bei Machärus wiedererkannte.
»Johannes möchte mit dir sprechen«, sagte der Essener.
»Ist Johannes noch nicht tot?« fragte er den Mann.
»Er wird in Peräa festgehalten. Ich glaube, Herodes traut
sich nicht, ihn zu töten. Er läßt Johannes im Garten seines
Palastes Spazierengehen, läßt ihn mit seinen Männern
sprechen, aber Johannes fürchtet, daß Herodes bald den
Mut finden wird, ihn steinigen oder enthaupten zu lassen.
Er braucht deine Hilfe.«
»Wie kann ich ihm helfen? Er muß sterben. Es gibt keine
Hoffnung für ihn.«
Der Essener sah verständnislos in die irren Augen des
Propheten.
»Aber, Meister, es gibt sonst keinen, der ihm helfen
könnte.«
»Es darf ihm nicht geholfen werden. Er muß sterben.«
»Er sagte mir, wenn du dich zunächst weigertest, sollte
ich dir sagen, du habest ihn einmal im Stich gelassen, du
solltest ihn jetzt nicht im Stich lassen.«
»Ich lasse ihn nicht im Stich. Ich bin dabei, mein Versa-
gen wiedergutzumachen. Ich habe alles getan, was ich zu
tun hatte. Ich habe die Kranken geheilt und den Armen
gepredigt.«
»Ich wußte nicht, daß er das wollte. Jetzt braucht er Hil-
fe, Meister. Du könntest sein Leben retten. Du hast Macht,
und die Leute hören auf dein Wort. Herodes könnte dich
nicht abweisen.«
Der Prophet zog den Essener von den Zwölfen weg.
»Sein Leben kann nicht gerettet werden.«
»Ist es Gottes Wille?«
– 156 –

Der Prophet machte eine Pause und sah zu Boden.
»Johannes muß sterben.«
»Meister – ist es Gottes Wille?«
Der Prophet schaute auf und sagte feierlich: »Wenn ich
Gott bin, dann ist es Gottes Wille.«
Seiner Hoffnung beraubt, wandte sich der Essener ab
und verließ den Propheten.
Der Prophet seufzte. Er erinnerte sich an den Täufer und
daran, wie gern er ihn gemocht hatte. Ohne Zweifel war
es in erster Linie Johannes zu verdanken, daß ihm das
Leben gerettet wurde. Aber er konnte nichts tun. Jo-
hannes dem Täufer war der Tod bestimmt.
Er zog mit seinem Gefolge weiter durch Galiläa. Außer
seinen zwölf Männern folgten ihm hauptsächlich arme
Leute. Sie setzten in ihn ihre einzige Hoffnung auf ein
besseres Leben. Viele gehörten zu denen, die bereit ge-
wesen wären, mit Johannes gegen die Römer loszu-
schlagen. Aber jetzt war Johannes eingesperrt.
Vielleicht würde dieser Mann ihr Führer in einem Auf-
stand, bei dem sie die Reichtümer Jerusalems, Jerichos
und Cäsareas plündern könnten.
Müde und hungrig, mit glasigen Augen von der Sonnen-
hitze, folgten sie dem Mann in dem weißen Gewand. Sie
brauchten Hoffnung, und sie fanden Grund zur Hoffnung.
Sie sahen, wie er größere Wunder wirkte.
Einmal predigte er von einem Boot aus zu ihnen, wie er
das oft tat, und als er durch das seichte Wasser zum Ufer
zurückschritt, sah es aus, als liefe er auf dem Wasser.
Durch ganz Galiläa wanderten sie in jenem Herbst und
hörten überall die Nachricht von der Enthauptung des Jo-
hannes. Die Verzweiflung über den Tod des Täufers
– 157 –

schlug um, und sie setzten um so mehr Hoffnung in
diesen neuen Propheten, der ihn gekannt hatte.
In Cäsarea wurden sie von römischen Wachen aus der
Stadt gejagt. Sie waren an die Wilden mit ihren Weis-
sagungen gewöhnt, die in den ländlichen Gegenden um-
herzogen.
Aus anderen Städten wurden sie verbannt, als der Ruf
des Propheten wuchs. Nicht nur die römischen Behörden,
auch die jüdischen schienen den neuen Propheten nicht
so dulden zu wollen, wie sie Johannes geduldet hatten.
Das politische Klima veränderte sich.
Es wurde schwierig, Nahrung zu bekommen. Sie lebten
von dem, was sie unterwegs fanden, und hungerten wie
abgezehrte Tiere.
Karl Glogauer, Zauberdoktor, Psychiater, Hypnotiseur,
Messias, lehrte sie, in ihrer Einbildung zu essen und ihre
Gedanken vom Hunger abzulenken.
Da traten die Pharisäer und Sadduzäer zu ihm; die ver-
suchten ihn und forderten, daß er sie ein Zeichen vom
Himmel sehen ließe. Aber er antwortete und sprach: Des
Abends sprecht ihr: Es wird ein schöner Tag werden,
denn der Himmel ist rot; und des Morgens sprecht ihr: Es
wird heute Ungewitter sein, denn der Himmel ist rot und
trübe. Ihr Heuchler! Über des Himmels Gestalt könnt ihr
urteilen; könnt ihr denn nicht auch über die Zeichen
dieser Zeit urteilen?
Matthäus 16, 1-3
– 158 –

»Du mußt vorsichtiger sein. Man wird dich steinigen. Man
wird dich töten.«
»Man wird mich nicht steinigen.«
»So will es das Gesetz.«
»Es ist nicht mein Schicksal.«
»Hast du keine Angst vor dem Tode?«
»Es ist nicht die größte meiner Ängste.«
Ich habe Angst vor meinem eigenen Geist. Ich fürchte,
der Traum könnte enden. Ich fürchte… Aber ich bin jetzt
nicht einsam.
Manchmal zweifelte er an seiner selbstgewählten Rolle,
und seine Gefolgschaft wurde verwirrt, wenn er sich
widersprach.
Sie nannten ihn jetzt oft bei dem Namen, den sie gehört
hatten: Jesus der Nazarener.
Meistens verwehrte er ihnen nicht, diesen Namen zu ge-
brauchen, aber in manchen Fällen wurde er zornig und
schrie merkwürdige gutturale Worte.
»Karl Glogauer! Karl Glogauer!«
Und sie sagten: »Hört, er spricht mit der Stimme Ado-
nais.«
»Nennt mich nicht bei diesem Namen!« schrie er sie an,
und sie erschraken und ließen ihn allein, bis sich sein
Zorn gelegt hatte. Gewöhnlich suchte er sie dann wieder
auf, als lege er großen Wert darauf, ihre Gesellschaft nicht
zu verlieren.
Ich habe Angst vor meinem eigenen Geist. Ich habe Angst
vor dem einsamen Glogauer.
– 159 –

Sie bemerkten, daß er sein eigenes Spiegelbild nicht gern
sah. Sie hielten das für Bescheidenheit und versuchten
ihm nachzueifern.
Als das Wetter sich änderte und der Winter kam, zogen sie
nach Kapernaum zurück, das zu einer Hochburg seiner
Anhänger geworden war.
In Kapernaum wartete er den Winter ab und sprach wäh-
rend der Zeit zu allen, die ihn hören wollten. Die meisten
seiner Reden befaßten sich mit Prophezeiungen.
Viele dieser Prophezeiungen betrafen ihn selbst und das
Schicksal seiner Jünger.
Da verbot er seinen Jüngern, daß sie niemand sagen soll-
ten, daß er, Jesus, der Christus wäre. Von der Zeit an fing
Jesus an und zeigte seinen Jüngern, wie er müßte hin gen
Jerusalem gehen und viel leiden von den Ältesten und
Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden
und am dritten Tage auferstehen.
Matthäus 16, 20–21
Sie saßen in ihrer Wohnung vor dem Fernseher. Monica
aß einen Apfel. Es war zwischen sechs und sieben an
einem warmen Sonntagabend. Monica zeigte mit dem
abgebissenen Apfel auf den Fernsehschirm.
»Sieh dir diesen Quatsch an!« sagte sie. »Du kannst mir
nicht im Ernst einreden, daß dir das etwas sagt.«
– 160 –
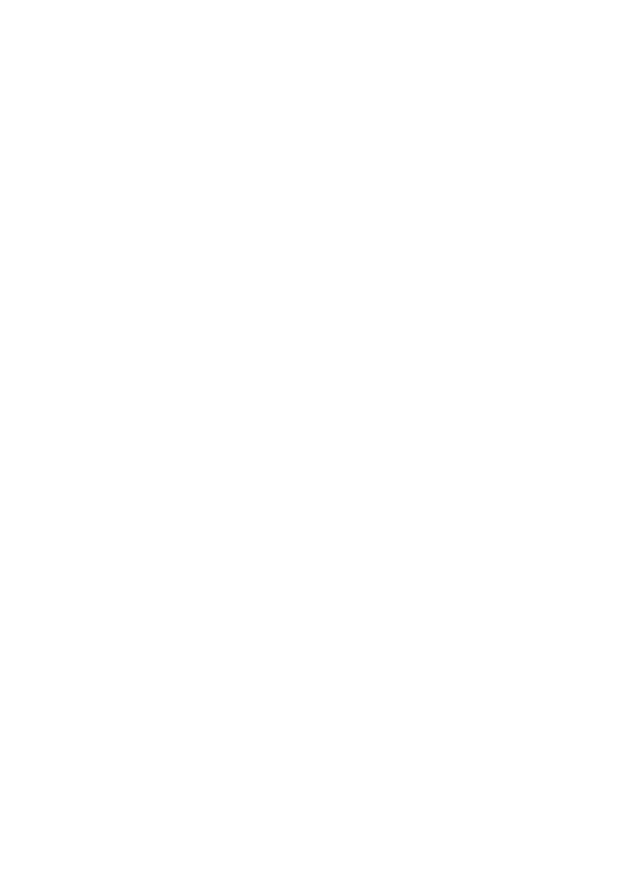
Es war eine religiöse Sendung über eine Pop-Oper in
einer Kirche in Hampstead. Thema der Oper war die Kreu-
zigung.
»Pop-Gruppen auf der Kanzel«, sagte sie. »So weit ist es
schon gekommen.«
Er antwortete nicht. Die Sendung erschien ihm irgend-
wie obszön. Er konnte darüber nicht mit ihr streiten.
»Der Leichnam Gottes fängt jetzt wirklich an zu faulen«,
lästerte sie. »Pfui! Was für ein Gestank!«
»Dann schalt's halt ab…!«
»Wie heißt die Pop-Gruppe? Die Maden?«
»Sehr witzig. Ich werde ausschalten, soll ich?«
»Nein, ich will es mir ansehen. Es ist spaßig.«
»Oh, schalt aus!«
»Imitatio Christi!« schnaufte sie. »Es ist eine üble Karika-
tur.«
Ein Negersänger, der Christus darstellte und mit tiefer
Stimme zu einer banalen Begleitung sang, begann leblose
Verse über die Bruderschaft aller Menschen herunterzulei-
ern.
»Wenn er so etwas von sich gab, ist es kein Wunder, daß
sie ihn ans Kreuz nagelten«, sagte Monica.
Er streckte den Arm aus und schaltete das Bild aus.
»Mir machte es Spaß«, sagte sie mit gespielter Enttäu-
schung. »Es war ein wundervoller Schwanengesang.«
Später sagte sie mit einer Spur Liebe, die ihn beunruhig-
te: »Du altmodischer Schwärmer. Was für ein Jammer! Du
hättest ein John Wesley oder Calvin oder so einer sein
können. In unseren Tagen kannst du kein Messias sein,
nicht nach deiner Vorstellung. Es gibt niemanden, der dir
zuhören würde.«
– 161 –

17
Der Prophet wohnte im Haus eines Mannes, der Simon
hieß, den der Prophet jedoch lieber Petrus nannte. Simon
war dem Propheten dankbar, weil er seine Frau von
einem Leiden geheilt hatte, das sie eine Zeitlang geplagt
hatte. Es war eine mysteriöse Krankheit gewesen, aber der
Prophet hatte sie fast mühelos geheilt.
Es waren zu dieser Zeit sehr viel Fremde in Kapernaum,
von denen viele gekommen waren, den Propheten zu se-
hen. Simon warnte ihn, daß manche von ihnen bekannte
Spitzel der Römer oder der Pharisäer seien. Viele der Pha-
risäer standen dem Propheten im großen und ganzen
nicht ablehnend gegenüber, mißtrauten aber dem Gerede
von Wundern, das ihnen zu Ohren gekommen war. Aber
die ganze politische Atmosphäre war gestört, und die
römischen Besatzungstruppen, von Pilatus über seine
Offiziere bis hinunter zu den einfachen Soldaten, waren
nervös und erwarteten einen Ausbruch, konnten aber
keine greifbaren Anzeichen dafür erkennen.
Pilatus, ein ungewöhnlich mäßiger Mann, goß Wasser in
das kleine bißchen Wein auf dem Boden seines Bechers
und überlegte seine Lage.
Er hoffte auf Unruhen größeren Ausmaßes.
Wenn irgendeine Rebellenbande, wie etwa die Zeloten,
Jerusalem angriffen, würde das Tiberius beweisen, daß er,
ganz gegen den Rat von Pilatus, in der Sache mit den Vo-
tivtafeln viel zu milde gegen die Juden gewesen war.
– 162 –

Pilatus wäre gerechtfertigt und bekäme mehr Macht über
die Juden. Vielleicht könnte er dann in der Politik wirklich
einiges durchsetzen. Gegenwärtig hatte er ein schlechtes
Verhältnis zu allen Tetrarchen der Provinzen – besonders
zu dem wankelmütigen Herodes Antipas, in dem er einst
seinen einzigen Parteigänger gesehen hatte.
Abgesehen von der politischen Lage, war auch seine
häusliche Situation nicht in Ordnung, weil seine neuro-
tische Frau wieder ihre Alpträume hatte und weit mehr
Beachtung forderte, als er ihr geben konnte.
Es könnte sich eine Möglichkeit ergeben, dachte er, ei-
nen Zwischenfall zu provozieren, aber er müßte sehr auf-
passen, daß Tiberius das nie erführe.
Er überlegte sich, ob dieser neue Prophet einen Ansatz-
punkt bieten könnte. Bis dahin hatte sich der Mann als
ziemliche Enttäuschung erwiesen. Er hatte nicht gegen die
Gesetze der Juden und auch nicht gegen die der Römer
verstoßen, obgleich er ein wenig scharf gegen das etablier-
te Priestertum redete. Doch das regte niemanden auf – es
war allgemein üblich, die Priester zu attackieren. Die Prie-
ster selbst waren meistens zu bequem, den Attacken viel
Aufmerksamkeit zu schenken. Es gab kein Gesetz, das es
einem Mann verbot, sich als Messias auszugeben, was die-
ser Mann angeblich getan hatte. Und man konnte in die-
sem Stadium kaum sagen, er stachelte das Volk zu einer
Revolte an – eher das Gegenteil. Man konnte auch einen
Mann nicht verhaften, nur weil einige seiner Anhänger
ehemalige Anhänger Johannes des Täufers waren. Die
ganze Sache mit dem Täufer war falsch angefaßt worden,
als Herodes die Nerven verloren hatte.
– 163 –

Vor dem Fenster in seiner Kammer, die Minarette und
Türme Jerusalems im Blickfeld, überdachte Pilatus die In-
formationen, die seine Spitzel ihm in letzter Zeit gebracht
hatten.
Bald nach dem Fest, das die Römer Saturnalien nannten,
verließen der Prophet und seine Anhänger Kapernaum
wieder und begannen durch das Land zu ziehen.
Jetzt, da das heiße Wetter vorbei war, wirkte der Prophet
wenige Wunder, aber seine Prophezeiungen wurden be-
gierig aufgenommen.
Er warnte sie vor all den Fehlern, die in der Zukunft be-
gangen werden würden, und vor allen den Verbrechen,
die in seinem Namen verübt werden würden, und er bat
sie nachzudenken, bevor sie in seinem Namen handelten.
Er wanderte durch Galiläa und durch Samaria, folgte den
guten römischen Straßen in Richtung auf Jerusalem.
Die Zeit bis zum Passahfest war jetzt nicht mehr lang.
Ich habe alles getan, was mir eingefallen ist. Ich habe
Wunder gewirkt, ich habe gepredigt, ich habe meine
Jünger ausgewählt. Aber all das war leicht, weil ich das
war, wonach die Menschen verlangten. Ich bin ihre
Schöpfung.
Habe ich genug getan? Ist der Kurs, den ich eingeschla-
gen habe, unabänderlich?
Wir werden es bald wissen.
In Jerusalem sprachen die römischen Beamten über das
kommende Fest. Es war immer eine Zeit der schlimmsten
Unruhe. Es hatte beim Passahfest schon früher Tumulte
– 164 –

gegeben, und zweifellos würde es auch dieses Jahr wieder
irgendwelchen Ärger geben.
Pilatus bat die Pharisäer zu sich. Als sie kamen, sprach er
so freundlich und einnehmend wie möglich zu ihnen und
bat sie um ihre Mithilfe.
Die Pharisäer sagten, sie wollten ihr möglichstes tun,
könnten aber nichts dafür, wenn die Leute unvernünftig
handelten.
Pilatus war zufrieden. Andere hatten jetzt gesehen, daß
er Unruhen abzuwenden versucht hatte. Sollte es jetzt
welche geben, könnte man ihm nicht die Schuld zu-
schieben.
»Sehen Sie«, fragte er die anderen Beamten, »was kann
man mit ihnen anfangen?«
»Wir werden schnellstens so viele Soldaten wie möglich
in Jerusalem zusammenziehen«, sagte sein Stellvertreter.
»Aber sie sind draußen im Lande schon jetzt recht dünn
gesät.«
»Wir müssen unser Bestes tun«, sagte Pilatus.
Als sie gegangen waren, ließ Pilatus seine Spitzel rufen.
Sie sagten ihm, daß der neue Prophet unterwegs sei.
Pilatus rieb sich das Kinn.
»Er erscheint mir recht harmlos«, sagte einer der
Männer.
»Er mag vielleicht jetzt harmlos sein«, sagte Pilatus, »aber
wenn er während des Passahfestes nach Jerusalem
kommt, ist er vielleicht nicht mehr so harmlos.«
Zwei Wochen vor dem Passahfest erreichte der Prophet
die Stadt Bethanien bei Jerusalem. Einige seiner gali-
– 165 –

läischen Anhänger hatten Bekannte in Bethanien, und
diese waren nur zu gern bereit, dem Mann Obdach zu ge-
ben, von dem sie von anderen Pilgern gehört hatten, die
nach Jerusalem und zum Großen Tempel unterwegs
waren.
Nach Bethanien waren sie gekommen, weil es den
Propheten beunruhigte, daß ihm so viele Leute folgten.
»Es sind zu viele«, hatte er zu Simon gesagt. »Zu viele,
Petrus.«
Sein Gesicht war jetzt hager. Die Augen lagen tiefer in ih-
ren Höhlen, und er sprach wenig.
Manchmal sah er sich unsicher um, als wüßte er nicht
genau, wo er war.
In das Haus in Bethanien kamen Berichte, daß römische
Spitzel sich nach ihm erkundigt hätten. Es störte ihn nicht.
Im Gegenteil, er nickte nachdenklich, als ob es ihn befrie-
digte.
»Man sagt, Pilatus suche nach einem Sündenbock«, warn-
te Johannes.
»Dann soll er einen haben«, erwiderte der Prophet.
Einmal wanderte er mit zwei seiner Jünger hinaus in die
Felder, um einen Blick auf Jerusalem zu werfen. Die
leuchtendgelben Mauern der Stadt sahen in der nachmit-
täglichen Beleuchtung prächtig aus. Die Türme und die
hohen Gebäude, von denen viele mit roten, blauen und
gelben Mosaiksteinen verziert waren, konnte man aus
einigen Kilometern Entfernung sehen.
Der Prophet ging nach Bethanien zurück.
– 166 –

Dort ist es, und ich fürchte mich. Ich fürchte den Tod und
fürchte die Blasphemie.
Aber es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keine andere
sichere Methode, dies zu vollbringen, als es zu durch-
leben.
»Wann gehen wir nach Jerusalem?« fragte ihn einer seiner
Anhänger.
»Noch nicht«, sagte Glogauer. Er ließ seine Schultern
hängen und hielt seine Arme um die Brust geschlungen,
als fröre er.
Zwei Tage vor dem Passahfest in Jerusalem machte sich
der Prophet mit seinen Jüngern auf den Weg zum Ölberg
und nach Bethphage, einem Vorort Jerusalems an den
Hängen des Berges.
»Besorgt mir einen Esel!« sagte er ihnen. »Ein Fohlen.
Ich muß die Prophezeiung jetzt wahrmachen.«
»Dann werden alle wissen, daß du der Messias bist«, sag-
te Andreas.
»Ja.«
Der Prophet seufzte.
Die Angst ist nicht mehr die gleiche. Es ist jetzt mehr die
Angst eines Schauspielers, der gleich seine letzte, drama-
tischste Szene spielen soll…
Kalter Schweiß stand auf den Lippen des Propheten. Er
wischte ihn weg.
– 167 –

In dem schwachen Licht musterte er die Männer um ihn
herum. Die Gesichter einiger seiner Jünger hatte er sich
noch immer nicht eingeprägt. Er hatte sich nur für ihre
Namen und die Anzahl interessiert. Zehn waren bei ihm.
Die anderen zwei suchten den Esel.
Es wehte eine leichte, warme Brise. Sie standen an dem
grasbewachsenen Abhang des Ölberges und schauten auf
Jerusalem und den Großen Tempel hinab.
»Judas?« sagte Glogauer zögernd.
Einer von ihnen hieß Judas.
»Ja, Meister?« fragte er. Er war groß, sah gut aus und hat-
te krauses rotes Haar und neurotische, intelligente Augen.
Glogauer hielt ihn für einen Epileptiker.
Glogauer sah Judas Ischariot nachdenklich an. »Du mußt
mir nachher helfen«, sagte er, »wenn wir in Jerusalem ein-
gezogen sind.«
»Wie, Meister?«
»Du mußt den Römern eine Nachricht überbringen.«
»Den Römern?« Judas sah besorgt aus. »Warum?«
»Es müssen die Römer sein. Es dürfen nicht die Juden
sein. Die würden Steine oder einen Pfahl oder ein Beil
benutzen. Ich sage dir mehr, wenn es soweit ist.«
Der Himmel war jetzt dunkel, und über dem Ölberg
waren die Sterne herausgekommen. Es war kalt ge-
worden. Glogauer zitterte.
– 168 –

18
Aber du, Tochter Zion, freue dich sehr,
Und du, Tochter Jerusalem, jauchze!
Siehe, dein König kommt zu dir,
Ein Gerechter und ein Helfer,
Arm, und reitet auf einem Esel
Und auf einem jungen Füllen der Eselin.
Sacharja 9, 9
»Osha'nal Osha'na! Osha'nal«
Als Glogauer auf dem Esel in die Stadt einritt, liefen
seine Anhänger ihm voraus und streuten Palmzweige auf
seinen Weg. Zu beiden Seiten der Straße stand dicht ge-
drängt viel Volk, das durch seine Anhänger von seinem
Kommen erfahren hatte.
Jetzt konnten sie sehen, wie der Prophet die Weis-
sagungen der alten Propheten wahrmachte, und viel mehr
Leute glaubten an ihn, glaubten, daß er in Adonais Namen
gekommen war, um sie gegen die Römer zu führen. Ge-
rade jetzt war er möglicherweise auf dem Weg zum Haus
des Pilatus, um dem Prokurator entgegenzutreten.
»Osha'na! Osha'na!«
Glogauer sah verwirrt um sich. Er saß unbequem auf
dem Eselrücken, trotz der Mäntel seiner Jünger, die ihm
als Polster dienten. Er schwankte und klammerte sich an
die Mähne des Tiers. Er hörte die Worte, konnte sie aber
nicht genau verstehen.
»Osha'na! Osha'na!«
– 169 –
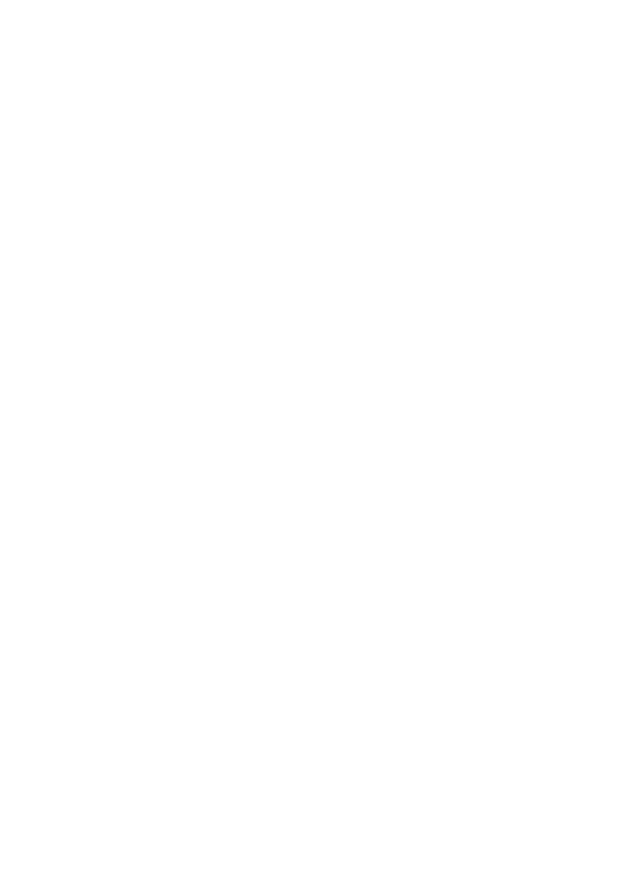
Es klang zunächst wie ›hosiana‹, bis ihm klar wurde, daß
sie ihm auf armäisch zuriefen: »Befreie uns!«
»Befreie uns! Befreie uns!«
Johannes hatte einen bewaffneten Aufstand gegen die
Römer für dieses Passahfest geplant. Viele hatten sich an
der Rebellion beteiligen wollen.
Sie glaubten, daß er die Stelle des Johannes als Rebellen-
führer eingenommen hatte.
»Nein«, sprach er zu ihnen, als er in die erwartungsvol-
len Gesichter sah. »Nein. Ich bin der Messias. Ich kann
euch nicht befreien. Ich kann es nicht…«
Ihrem Glauben hatte er damit den Boden entzogen. Aber
sie hörten seine Worte nicht in dem allgemeinen Ge-
schrei.
Karl Glogauer zog in Christus ein, und Christus zog in
Jerusalem ein. Die Geschichte näherte sich ihrem Höhe-
punkt.
»Osha'na!«
Es gehörte nicht in die Geschichte. Er konnte ihnen
nicht helfen.
Es war sein Fleisch.
Es war sein Fleisch, das Stück für Stück verschenkt wur-
de, an jeden, der es haben wollte. Es gehörte ihm nicht
mehr.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer aufnimmt, so ich
jemand senden werde, der nimmt mich auf; wer aber
mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt
hat. Da Jesus solches gesagt hatte, ward er betrübt im
Geist und zeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich
– 170 –

sage euch: Einer unter euch wird mich verraten. Da sa-
hen sich die Jünger untereinander an, und ward ihnen
bange, von welchem er redete. Es war aber einer unter
seinen Jüngern, der zu Tische saß an der Brust Jesu, wel-
chen Jesus liebhatte. Dem winkte Simon Petrus, daß er
forschen sollte, wer es wäre, von dem er sagte. Denn
derselbe lag an der Brust Jesu, und er sprach zu ihm:
Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den
Bissen eintauche und gebe. Und er tauchte den Bissen ein
und gab ihn Judas, Simons Sohn, dem Ischariot. Und
nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus
zu ihm: Was du tust, das tue bald!
Johannes 13, 20–27
Judas Ischariot runzelte etwas unsicher die Stirn, als er
den Raum verließ und auf die Straße hinaustrat, um sich
durch die Menschenmenge seinen Weg zum Palast des
Statthalters zu bahnen. Zweifellos sollte er einen Teil
eines Plans ausführen, dessen Ziel es war, die Römer zu
täuschen und das Volk dazu zu bringen, sich zu Jesu
Verteidigung zu erheben. Aber er hielt den Plan für zu
gewagt. Die Stimmung unter den sich in den Straßen
zusammendrängenden Männern, Frauen und Kindern war
gereizt. Viel mehr römische Soldaten als sonst pa-
trouillierten in der Stadt.
»Aber sie haben keinen Anlaß, dich zu verhaften, Herr«,
hatte er zum Propheten gesagt.
»Ich werde ihnen Anlaß geben«, hatte der Prophet geant-
wortet.
– 171 –

Es hatte keinen anderen Weg gegeben, es zu ar-
rangieren.
Er glaubte nicht, daß es von Bedeutung sein würde. Die
Chronisten würden es schon wieder umarrangieren.
Pilatus war ein beleibter Mann, trotz seiner Mäßigkeit in
Essen und Trinken. Er hatte einen genießerischen Mund
und harte, seichte Augen. Er sah den Juden verächtlich an.
»Wir bezahlen Informanten nicht, deren Informationen
sich als falsch erweisen«, warnte er ihn.
»Ich bin nicht auf Geld aus, Herr«, sagte Judas. Er sprach
in der unterwürfigen Art, die die Römer von den Juden zu
erwarten schienen. »Ich bin ein treuer Untertan des
Kaisers.«
»Wer ist dieser Rebell?«
»Jesus von Nazareth, Herr. Er betrat die Stadt heute…«
»Ich weiß. Ich habe ihn gesehen. Aber ich hörte, er
predige Frieden und Gehorsam gegen die Gesetze.«
»Um dich zu täuschen, Herr. Aber heute hat er sich selbst
verraten, indem er die Pharisäer verärgerte und gegen die
Römer sprach. Er hat seine wahren Absichten enthüllt.«
Pilatus zog die Brauen hoch. Es war gut möglich. Es
schmeckte nach der Art von Täuschung, die er diesen
Leisetretern zutraute.
»Hast du Beweise?«
»Es gibt hundert Zeugen.«
»Zeugen haben ein kurzes Gedächtnis«, sagte Pilatus
ärgerlich. »Wie wollen wir sie identifizieren?«
»Dann werde ich seine Schuld bezeugen. Ich bin einer
seiner Leutnants.«
– 172 –

Das klang zu schön, um wahr zu sein. Pilatus schob die
Lippen vor. Er konnte es sich nicht leisten, die Pharisäer
zu diesem Zeitpunkt zu verärgern. Sie hatten ihm schon
genug Scherereien gemacht. Besonders Kaiphas würde so-
fort
Ungerechtigkeit
rufen,
wenn
er
den
Mann
gefangennehmen ließe. Du sagst, er hat die Priester
verärgert?«
»Er behauptet, der rechtmäßige König der Juden zu sein,
ein Nachkomme Davids«, sagte Judas, so wie sein Meister
es ihm aufgetragen hatte.
»Tut er das?« Pilatus sah nachdenklich zum Fenster hin-
aus.
»Und, die Pharisäer, Herr…«
»Was ist mit ihnen?«
»Sie sähen ihn am liebsten tot. Ich habe es aus einer zu-
verlässigen Quelle. Einige der Pharisäer, die anderer Mei-
nung sind als die Mehrheit, versuchten ihn zu warnen und
zur Flucht aus der Stadt zu veranlassen, aber er weigerte
sich.«
Pilatus nickte. Sein Blick war gesenkt, während er über
diese Information nachdachte. Die Pharisäer haßten den
Propheten vielleicht, aber sie würden sehr schnell poli-
tisches Kapital aus seiner Verhaftung schlagen.
»Die Pharisäer möchten ihn hinter Schloß und Riegel se-
hen«, fuhr Judas fort. »Das Volk läuft zusammen, um den
Propheten zu hören, und heute stifteten viele in seinem
Namen Unruhe im Tempel.«
»So, das war er?« Es stimmte, daß etwa ein halbes Dut-
zend Leute die Geldwechsler im Tempel angegriffen und
zu berauben versucht hatten.
– 173 –
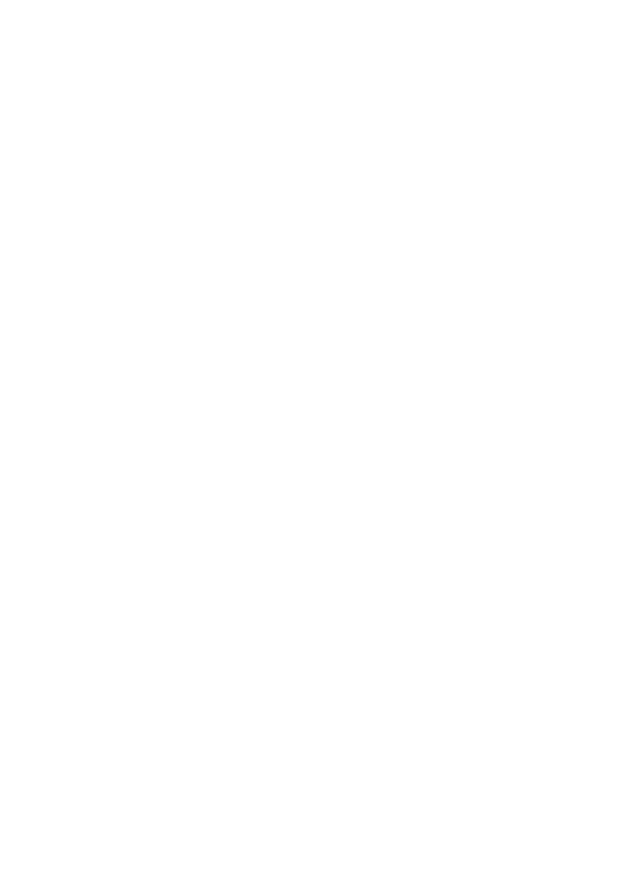
»Frag die Verhafteten, wer sie zu ihrem Verbrechen an-
stiftete!« sagte Judas. »Es waren die Männer des Naza-
reners.«
Pilatus biß sich auf die Unterlippe.
»Ich könnte die Verhaftung nicht veranlassen«, sagte er.
Die Lage in Jerusalem war schon jetzt gefährlich, aber
wenn sie diesen ›König‹ verhaften würden, könnte daraus
ein großer Aufstand entstehen, mit dem er nicht allein
fertig würde. Er wünschte sich Unruhen, wollte aber
nicht, daß es so aussah, als hätte er den Anlaß geliefert. Ti-
berius würde ihn verantwortlich machen, nicht die Juden.
Wenn jedoch die Juden selbst die Verhaftung durch-
führten, würde sich der Zorn des Volkes weniger gegen
die Römer richten, so daß die Truppen Herr der Lage
bleiben könnten. Es galt, die Pharisäer dafür zu gewinnen.
Sie mußten die Verhaftung veranlassen. »Warte hier!« sag-
te er zu Judas. »Ich will Kaiphas eine Nachricht schicken.«
Und sie kamen zu einem Hofe mit Namen Gethsemane.
Und er sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hier, bis ich
hingehe und bete. Und nahm zu sich Petrus und Jakobus
und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen. Und
sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod;
bleibet hier und wachet!
Glogauer sah jetzt den Mob auf sich zukommen. Zum
erstenmal seit Nazareth fühlte er sich physisch schwach
und erschöpft.
Sie würden ihn töten. Er mußte sterben; das akzeptierte
er, aber er hatte Angst vor den Schmerzen, die ihm bevor-
– 174 –

standen. Er setzte sich an dem Berghang hin und beob-
achtete die sich nähernden Fackeln.
»Das Ideal des Märtyrertums hat es nur im Geist einiger
Asketen gegeben«, hatte Monica gesagt. »In allen anderen
Fällen war es krankhafter Masochismus, ein leichter Weg,
sich vor der normalen Verantwortung zu drücken, eine
Methode zur Beherrschung unterdrückter Menschen…«
»Es ist nicht so einfach …«
»Es ist so einfach, Karl.«
Er konnte es Monica jetzt zeigen.
Er bedauerte, daß sie es wahrscheinlich nie erfahren
würde. Er hatte die Absicht gehabt, alles aufzuschreiben
und in die Zeitmaschine zu legen, in der Hoffnung, daß
sie geborgen werden könnte. Es war merkwürdig. Er war
kein religiöser Mensch im üblichen Sinne. Er war ein
Agnostiker. Es war nicht Überzeugung, was ihn dazu ge-
bracht hatte, die Religion gegen Monicas zynische Verach-
tung zu verteidigen; es war vielmehr ein Mangel an Über-
zeugung von der Richtigkeit des Ideals, an das sie glaubte,
ihres Glaubens an die Wissenschaft als Löserin aller Pro-
bleme. Er konnte ihren Glauben nicht teilen, und es gab
sonst nichts anderes für ihn als die Religion, obwohl er an
einen Gott wie den der Christenheit nicht glauben konn-
te. Ein Gott als mystische Kraft aus den Mysterien des
Christentums und anderer großer Religionen war ihm
nicht persönlich genug. Sein nüchterner Verstand hatte
ihm gesagt, daß es Gott in einer persönlichen Form über-
haupt nicht gebe. Sein Unterbewußtsein hatte ihm gesagt,
– 175 –

daß der Glaube an. die Wissenschaft nicht genüge. Er er-
innerte sich an die Selbstverachtung, die er einmal emp-
funden hatte, und fragte sich, warum er sie empfunden
hatte.
»Wissenschaft ist im Grunde das Gegenteil von
Religion«, hatte Monica gesagt. »Ganz gleich, wie viele
Jesuiten zusammenkommen, um ihre Ansichten über die
Wissenschaft zu rationalisieren, es bleibt die Tatsache be-
stehen, daß die Religion die grundsätzliche Einstellung
der Wissenschaft nicht akzeptieren kann, und es ist un-
vermeidlich, daß die Wissenschaft die grundlegenden
Prinzipien der Religion angreift. Das einzige Gebiet, auf
dem es keine Differenzen gibt und kein Krieg nötig ist, ist
die eigentliche Annahme eines Gottes. Man kann
annehmen, daß es einen Gott gibt, und man kann das
Gegenteil annehmen. Aber sobald einer anfängt, seine
Annahme zu verteidigen, muß es Streit geben.«
»Du sprichst von organisierter Religion…«
»Ich spreche von Religion im Gegensatz zum Glauben.
Wer braucht das Ritual einer Religion, wenn wir das weit
überlegene Ritual der Wissenschaft an seine Stelle setzen
können? Religion ist ein brauchbarer Ersatz für Wissen.
Aber wir brauchen keinen Ersatz mehr, Karl. Die Wissen-
schaft bietet uns eine viel gesündere Grundlage für die
Formulierung von Denkmodellen und einer Ethik. Wir
brauchen das Zuckerbrot des Himmels und die Peitsche
der Hölle nicht mehr, wenn uns die Wissenschaft die
Konsequenzen unseres Handelns zeigen kann und der
Mensch leicht selbst beurteilen kann, ob er richtig oder
falsch handelt. «
»Das kann ich nicht akzeptieren.«
– 176 –

»Weil du krank bist. Ich bin auch krank, aber ich habe
wenigstens die Aussicht auf die Gesundung vor Augen.«
»Ich sehe nur den drohenden Tod…«
Wie sie vereinbart hatten, küßte Judas ihn auf die Wange,
und die gemischte Streitmacht aus Tempelwachen und
römischen Soldaten umringte sie.
Zu den Römern sagte er, mit ziemlicher Mühe. »Ich bin
der König der Juden.« Zu den Dienern der Pharisäer sagte
er: »Ich bin der Messias, der gekommen ist, eure Herren
zu vernichten.«
Jetzt hatte er sich ihnen ausgeliefert, und das Schlußritu-
al konnte beginnen.
– 177 –

19
Es war ein unordentlicher Prozeß, eine willkürliche Vermi-
schung römischen und jüdischen Rechts, die niemanden
so recht zufriedenstellte. Der Zweck wurde erreicht, nach
mehreren Konferenzen zwischen Pontius Pilatus und Kai-
phas und drei Versuchen, ihre verschiedenen Rechtssyste-
me so zurechtzubiegen, daß sie den Erfordernissen der Si-
tuation gerecht würden. Beide Seiten brauchten einen
Sündenbock zu unterschiedlichen Zwecken, und so
kamen sie schließlich zu dem gewünschten Ergebnis, und
der Verrückte wurde verurteilt, einerseits wegen Aufruhrs
gegen Rom und andererseits wegen Ketzerei.
Eine Besonderheit des Prozesses war, daß die Zeugen
alle Anhänger dieses Mannes waren und dennoch den An-
schein erweckten, als wollten sie ihn alle verurteilt sehen.
»Ach, die krankhaften Fanatiker«, sagte Pilatus: Er war zu-
frieden.
Die Pharisäer waren einverstanden, und die römische
Hinrichtungsmethode wurde in diesem Fall der Zeit und
der Situation am ehesten gerecht. So wurde beschlossen,
ihn zu kreuzigen. Der Mann hatte jedoch einen großen
Ruf, so daß es notwendig sein würde, einige der erprob-
ten römischen Methoden zur Demütigung anzuwenden,
um ihn in den Augen der Pilger zu einer bedauernswerten
und lächerlichen Gestalt zu machen.
Pilatus versicherte den Pharisäern, daß er dafür sorgen
würde, aber er sorgte auch dafür, daß sie Dokumente un-
terschrieben, aus denen hervorging, daß sie seinen Aktio-
nen zustimmten.
– 178 –

Der Gefangene war schweigsam, schien aber fast zufrie-
den zu sein. Er hatte während des Prozesses genug
gesprochen, um seine Verurteilung herbeizuführen, hatte
aber wenig zu seiner Verteidigung gesagt.
Es ist vollbracht.
Mein Leben ist bestätigt.
Die Kriegsknechte aber führten ihn hinein in das Richt-
haus und riefen zusammen die ganze Schar und zogen
ihm einen Purpur an, und flochten eine dornene Krone
und setzten sie ihm auf und fingen an, ihn zu grüßen:
Gegrüßet seist du, der Juden König! Und schlugen ihm
das Haupt mit dem Rohr und verspeiten ihn und fielen
auf die Knie und beteten ihn an. Und da sie ihn
verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpur aus und zo-
gen ihm seine eigenen Kleider an und führten ihn aus,
daß sie ihn kreuzigten.
Markus 15, 16–20
»Oh, Karl, du würdest alles tun, um Beachtung zu fin-
den…«
»Sie wollen im Rampenlicht stehen, junger Mann…«
»Mein Gott, Karl, was würdest du nicht alles tun, um Be-
achtung zu finden…«
Nicht jetzt. Nicht dieses. Es ist zu nobel.
Lachten die Gesichter ihn durch den Schleier der
Schmerzen an?
– 179 –

War sein eigenes Gesicht dabei, mit lächerlichem Selbst-
mitleid im Blick? Sein eigener Geist…?
Aber sie konnten ihm das tiefe Gefühl der Befriedigung
nicht nehmen, das er empfand. Das erste vollständige
Erlebnis dieser Art, das er je gehabt hatte.
Sein Geist war jetzt getrübt durch die Schmerzen und
durch die rituellen Schmähungen; durch sein völliges Auf-
gehen in seiner Rolle.
Er war zu schwach, das schwere Holzkreuz zu tragen,
und ging dahinter her, als es von einem Kyrener, den die
Römer dazu gezwungen hatten, nach Golgatha geschleppt
wurde.
Während er durch die stumme Menge in den Straßen
wankte, unter den Augen derer, die geglaubt hatten, er
würde sie gegen die römischen Unterdrücker führen, irr-
ten seine Blicke hin und her, und er taumelte gelegentlich
von der Straße herunter und wurde von einem der
römischen Soldaten zurückgestoßen.
»Du bist zu emotional, Karl. Warum benutzt du nicht
deinen Verstand und reißt dich zusammen…?«
Er erinnerte sich an die Worte, aber er fand es schwer,
sich zu erinnern, wer sie gesprochen hatte oder wer Karl
war.
Die Straße, die auf den Berg hinaufführte, war steinig,
und er rutschte manchmal aus. Er erinnerte sich dabei an
einen anderen Berg, auf den er gestiegen war. Ihm schien,
– 180 –

er mußte damals noch ein Kind gewesen sein, aber die Er-
innerungen liefen ihm durcheinander. Er konnte nicht
mehr sagen, wann es gewesen war.
Er atmete schwer und mit ziemlicher Mühe. Den
Schmerz von den Dornen in seinem Kopf spürte er kaum,
aber sein ganzer Körper schien im Takt mit seinem
Herzen zu pochen. Er glich einer Trommel.
Es war Abend. Die Sonne ging unter. Er fiel auf das
Gesicht, riß sich die Haut an einem scharfen Stein auf, als
er eben den Gipfel des Berges erreicht hatte. Er verlor das
Bewußtsein.
Er war ein Kind gewesen. War er noch ein Kind? Sie
würden doch ein Kind nicht umbringen. Wenn er ihnen
klarmachte, daß er ein Kind war…?
Und sie brachten ihn an die Stätte Golgatha, das ist
verdolmetscht: Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe
im Wein zu trinken; und er nahm's nicht zu sich.
Markus 15, 22-23
Er stieß den Becher von sich. Der Soldat zuckte die
Achseln und griff nach einem seiner Arme. Ein anderer
Soldat hielt schon seinen anderen Arm.
Als er wieder zu Bewußtsein kam, begann er heftig zu
zittern. Er spürte die starken Schmerzen von den Stricken,
die ihm an den Hand- und Fußgelenken ins Fleisch
schnitten. Er bäumte sich auf.
– 181 –

Er spürte etwas Kaltes an seiner Handfläche. Obwohl es
nur einen kleinen Fleck in der Mitte seiner Hand bedeck-
te, schien es sehr schwer zu sein. Er hörte ein Geräusch,
das auch den gleichen Rhythmus wie sein Herzschlag
hatte. Er verdrehte den Kopf, um die Hand anzusehen. Es
war eine Menschenhand.
Der große eiserne Nagel wurde von einem Soldaten, der
einen schweren Hammer schwang, in die Hand getrieben,
während er auf dem schweren Holzkreuz lag, das jetzt
waagerecht auf der Erde lag. Er sah zu und wunderte sich,
warum er keinen Schmerz spürte. Der Soldat schwang
den Hammer höher, als der Nagel auf das Holz stieß.
Zweimal verfehlte er den Nagel und traf die Finger.
Er drehte den Kopf zur anderen Seite und sah, daß der
zweite Soldat auch einen Nagel einschlug. Offensichtlich
hatte er den Nagel oft verfehlt, denn die Finger dieser
Hand waren blutig und zerquetscht.
Der erste Soldat hatte seinen Nagel eingeschlagen und
widmete seine Aufmerksamkeit nun den Füßen.
Er spürte das Eisen durch sein Fleisch fahren, hörte das
Hämmern.
Mit Hilfe einer Seilrolle richteten sie das Kreuz jetzt auf.
Glogauer merkte, daß er allein war. An diesem Tag wurde
sonst niemand gekreuzigt.
Das kleine Silberkreuz baumelte zwischen den Brüsten,
das große Holzkreuz näherte sich.
Seine Erektion kam und verging wieder.
– 182 –

Er sah deutlich die Lichter Jerusalems unter sich. Es war
noch ein wenig Helligkeit am Himmel, aber sie verblaßte
schon.
Bald würde es völlig dunkel sein.
Eine Menge Menschen sahen zu. Eine der Frauen kam
ihm bekannt vor. Er rief sie.
»Monica?«
Aber seine Stimme war brüchig, und das Wort war nur
ein Flüstern.
Die Frau sah nicht auf.
Er spürte, wie sein Körper an den Nägeln zerrte, die ihn
hielten. Er meinte, einen plötzlichen Schmerz in seiner
linken Hand zu spüren. Er schien stark zu bluten.
Es war merkwürdig, dachte er, daß er es sein sollte, der
dort hing. Er nahm an, daß es das Ereignis war, das er
ursprünglich hatte miterleben wollen. Daran gab es tat-
sächlich kaum einen Zweifel. Alles hatte perfekt geklappt.
Der Schmerz in seiner linken Hand war stärker gewor-
den.
Er sah zu den römischen Wachen hinunter, die am Fuße
des Kreuzes würfelten. Er lächelte. Sie waren in ihr Spiel
vertieft. Die Augen auf den Würfeln konnte er aus dieser
Entfernung nicht erkennen.
Er seufzte. Die Bewegung seiner Brust schien den Zug
an seinen Händen noch zu verstärken. Die Schmerzen
waren jetzt ziemlich schlimm. Er stöhnte und versuchte
sich irgendwie an das Holz zurückzulehnen.
Er atmete mühsam. Der Schmerz breitete sich über sei-
nen ganzen Körper aus. Er biß die Zähne aufeinander. Es
war schrecklich. Er keuchte und schrie. Er wand sich.
– 183 –

Es war kein Licht mehr am Himmel. Schwere Wolken
verbargen Sterne und Mond.
Von unten kam Flüstern zu ihm herauf.
»Laßt mich herunter!« rief er. »Oh, bitte, laßt mich herun-
ter!«
Ich bin nur ein kleiner Junge.
Hau ab, du Sau!
Der Schmerz füllte ihn ganz aus. Er japste nach Luft. Er
sackte nach vorn, aber niemand befreite ihn.
Ein wenig später hob er den Kopf. Die Bewegung brach-
te die Schmerzen zurück, und er fing wieder an, sich am
Kreuz zu winden. Er wurde langsam asphyktisch.
»Laßt mich herunter! Bitte! Bitte hört auf!«
Jeder Teil seines Fleisches, jeder Muskel und jede Sehne
und jeder Knochen war von dem unmöglichen Schmerz
ausgefüllt.
Er wußte, daß er den nächsten Tag nicht erleben würde,
wie er zunächst geglaubt hatte.
Und um die neunte Stunde rief Jesus laut und sprach: Eli,
Eli, lama asabthani? Das ist verdolmetscht: Mein Gott,
mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Markus 15, 34
– 184 –

Glogauer hustete. Es war ein trockenes, kaum hörbares
Husten. Die Soldaten unter dem Kreuz hörten es, weil die
Nacht jetzt sehr still war.
»Es ist komisch«, sagte einer. »Gestern beteten sie den
Hund noch an. Heute schienen sie ihn umbringen zu
wollen – selbst jene, die ihm am nächsten standen.«
»Ich werde froh sein, wenn wir aus diesem Land heraus
sind«, sagte sein Kamerad.
Sie sollten ein Kind nicht töten, dachte er.
Er hörte Monicas Stimme wieder. »Es sind Schwäche und
Angst, Karl, die dich dazu getrieben haben. Märtyrertum
ist eine Form von Eitelkeit.«
Er hustete noch einmal, und die Schmerzen kehrten zu-
rück, aber sie waren jetzt dumpfer. Sein Atem wurde fla-
cher.
Kurz bevor er starb, begann er wieder zu sprechen,
stammelte, bis er zu atmen aufhörte. »Es ist eine Lüge – es
ist eine Lüge – es ist eine Lüge…«
Später, nachdem die Diener einiger Ärzte seine Leiche
gestohlen hatten, weil ihre Herren glaubten, sie könnte
besondere Eigenschaften haben, gab es Gerüchte, er sei
nicht gestorben. Aber die Leiche verweste schon in den
Sezierräumen der Ärzte. Bald sollte sie vernichtet sein.
– 185 –

NACHWORT
I.N.R.I.
Die Gretchenfrage
Nachwort von Florian F. Marzin
Der 1969 erschienene Roman I.N.R.I. oder Die Reise mit
der Zeitmaschine (Behold the Man) ist die erweiterte
Fassung der gleichnamigen Erzählung von Michael Moor-
cock aus dem Jahre 1967, die 1968 mit dem Nebula Award
ausgezeichnet wurde und damals wie heute einen der
kompromißlosesten Texte der Science Fiction darstellt.
M. Moorcock nimmt das seit H. G. Wells bekannte Motiv
der Zeitreise und benutzt es zu einer Auseinandersetzung
mit der Religion, d.h. mit der Gestalt Christi, wie sie im
Neuen Testament beschrieben wird.
Es fehlte bis zu diesem Zeitpunkt (1967) nicht an Time
Travel Stories bzw. Romanen, es sei nur an Robert A.
Heinleins: All You Zombies und L. Sprague De Camp: Lest
Darkness Fall erinnert, doch machten diese, wenn man
einmal von Mark Twains mehr auf die Parodie ab-
zielenden Roman A Connecticut Yankee in King Arthur's
Court absieht, einen weiten Bogen um historisch ex-
ponierte Gestalten.
Auf der anderen Seite hatte sich die Science Fiction auch
schon mit Religion und dem Christentum beschäftigt, wie
P. J. Farmers The Lovers, Olaf Stapletons Star Maker, Ja-
mes Blish A Case of Conscience oder W. M. Millers A Can-
tide for Leibowitz beweisen.
– 186 –

Doch es blieb M. Moorcock vorbehalten in I.N.R.I. Diese
beiden Aspekte zu verbinden und einen Roman zu schaf-
fen, der in bis dahin – auch für die Science Fiction – nicht
denkbarer Konsequenz ein sakrosanktes Thema behandel-
te.
Nun sag, wie hast du's mit der Religion? – ist die Frage,
die der Science Fiction in I.N.R.I. gestellt wird. Jene Frage,
die Gretchen bekanntermaßen an Faust richtet, wird von
M. Moorcock in seinem Roman eindeutig beantwortet: Es
gibt das Christentum, weil vor 2000 Jahren aus der Kennt-
nis des Mythos von Christi Leiden, dieser selbst erst ge-
schaffen wurde. Alles Göttliche, was im Neuen Testament
zum Ausdruck kommt, hat seinen Ursprung in der Gestalt
eines körperlich mißgestalteten, geistig behinderten
Schwachsinnigen, der – Bastard einer promiskuren Mutter
– dem in jeder Beziehung ärmlichen Zimmermann Josef
aus den Geschlecht Davids untergeschoben wurde.
Hier wird nicht der Mythos Jesus zerstört, und das, nach-
dem seit einiger Zeit Archäologen die Existenz einer ge-
schichtlich verbürgten Gestalt Jesu von Nazareth nachge-
wiesen zu haben glauben, sondern ohne diese Tatsache –
inzwischen ist auch das Turiner Grabtuch Jesu zu einer
Untersuchung freigegeben worden – in Abrede zu stellen,
trennt Moorcock den Mythos von der Person. Diese Per-
son Jesus wurde nicht etwa vom Heiligen Geist oder
einem Engel empfangen, nein, wie die Schlampe Maria
selbst sagt »Ja er [der Vater von Jesus – FFM] war ein Teu-
fel (…) Und er war ein Mann…«, Jesus ist ein Kind der
Sünde, die Ausdruck in seinem deformierten Menschsein
findet.
– 187 –

Doch was hier auf den ersten Blick so blasphemisch
klingt, ist bei genauerer Überlegung keineswegs so. Jesus
ist ja nicht Jesus Christus, sondern ein Schwachsinniger,
dem alle in der Bibel zugeordneten Attribute fehlen. Er
wurde nicht vom Heiligen Geist empfangen, seine Mutter
war keine unbescholtene Jungfrau, ihr Mann, von Vater
kann man ja nicht sprechen, kein ehrbarer Zimmermann,
und Jesus selbst ist nichts weniger als ein Erlöser. Moor-
cocks Jesus von Nazareth ist ein Mensch, der diesen
Namen trägt, wie wahrscheinlich viele zu dieser Zeit in Is-
rael, wo es auch in Nazareth bestimmt noch einige Per-
sonen gab, die so hießen. Der biblische Jesus wird zum
Erlöser durch seine göttliche Herkunft, bei der man un-
schwer den Einfluß hellenistischen Gedankengutes er-
kennen kann (man erinnere sich an Zeus und Alkmene,
die Gattin des Amphitryon und dem aus dieser Ver-
bindung entsprungenen Herakles), durch sein Wirken
und durch seinen Opfertod am Kreuz. Alles dies fehlt dem
Schwachsinnigen, der in einem armseligen Hinterzimmer
in Nazareth dahinvegetiert. Die Funktion Jesu ist in dem
Mythos und die vitae Christi erfüllt alle Voraussetzungen
eines Mythos (an dieser Stelle muß auf eine Begriffsbe-
stimmung aus Opportunität verzichtet werden), festgelegt.
Diese Funktion ergibt sich aus den oben genannten At-
tributen, von denen nur eines von Karl Glogauer nicht er-
füllt wird: die göttliche Herkunft. Doch wie in den
Gesprächen mit Johannes dem Täufer schon anklingt,
muß für die Menschen im Israel der Zeitwende Glogauers
Erscheinen in der Zeitmaschine Züge göttlicher Herkunft
tragen.
– 188 –

Karl Glogauer ist nicht Jesus, aber in seinem Leidensweg,
den er erst unfreiwillig, dann aber, durch die Umstände
gezwungen, immer bereitwilliger annimmt, zeigt sich, daß
der Mythos, auch wenn er sich Christentum nennt, von
der Person unabhängig ist.
Ein Mythos ist nicht an ein Individuum gebunden, son-
dern an die von ihm repräsentierte Funktion. So auch in
I.N.R.I. in bezug auf die Gestalt des Protagonisten Karl
Glogauer. Er leistet fast mühelos – unterstützt durch eine
Zeit und von Moorcock eindringlich geschilderten Um-
ständen, die solche Wunder geradezu herausfordert –
diese Wunder, an die eine Gesellschaft, in der Magie noch
im Bereich des Alltäglichen lag, nur allzugerne glauben
will. In dem Verhältnis zu seinen Jüngern zeigt sich ein
weiteres Mal die extreme Willkürlichkeit, und die Festle-
gung auf eine Funktion: Sie werden nach ihren Namen
auserwählt, um die schon bestehende biblische Überliefe-
rung zu verifizieren. Geschichte wird damit zum Palimp-
sest, das getilgt und mit dem gleichen – schon gelesenen –
Text neu beschrieben wird.
Sogar seinen eigenen Untergang muß Karl Glogauer
noch arrangieren, denn keiner der Jünger, nicht einmal
Judas Ischariot, käme auf den Gedanken, den Propheten
des Heils zu verraten. Gerade in diesem Umstand zeigt
sich, daß Karl Glogauer, der Substitut, größer ist als der,
dessen Stelle er eingenommen hat. Jesus, hier der
biblische und nicht die fiktionale Figur Moorcocks, war
ein still erduldender, einer, der eigentlich über das
Predigen hinaus nie zum Handelnden wurde, der, laut
göttlicher Fügung in einer Form fast islamischer Un-
terworfenheit unter das, was im Buch des Schicksals ge-
– 189 –

schrieben steht, sein Fatum annahm. Karl Glogauer muß
das Spiel, in dem er sich wiederfindet erst noch selbst in-
szenieren. Er geht nicht offenen Auges in seinen Un-
tergang, der ihm vorherbestimmt ist, nein, er richtet ihn
sich selbst ein, um den Mythos, die Überlieferung zu erfül-
len.
Damit bleibt in I.N.R.I. jeder göttlicher Wille auf der Stre-
cke, wird zum Theaterdonner oder, um noch einmal mit
Goethe zu sprechen: »Laßt uns auch so ein Schauspiel ge-
ben/Greift nur hinein ins volle Menschenleben.« Die vitae
Christi, sein Leidensweg, ist nicht mehr Ausdruck gött-
licher Fügung, sondern Schauspiel; in Szene gesetzt von
dem Juden Glogauer, der mit seiner Umwelt (in der
Gegenwart des 20. Jahrhunderts) nicht zurechtkam.
Dieses Judentum des Protagonisten ist denn auch die
einzige Gemeinsamkeit, die Glogauer und der biblische
Jesus haben, der, was heute oft nicht mehr ins Bewußt-
sein dringt, auch Jude war.
Dem Leser wird, geht er auf die Fiktion des Autors ein,
in dem Moment, da sich Jesus als Schwachsinniger ent-
puppt, der Mythos bzw. der Glaube an die sich auf ihn
gründende Kirche demontiert. Doch der Protagonist, von
derselben Erkenntnis fast am Boden zerstört, begreift –
allerdings nicht etwa seine Chance, er ist in letzter Konse-
quenz kein geltungssüchtiger, vom Leben vernachlässigter
Niemand – die Notwendigkeit den Mythos zu schaffen.
Damit entlarvt M. Moorcock schonungslos die Religion
als das, was sie ist, ein Märchen. Ein Märchen, das, wie
Propp nachgewiesen hat, nicht den individuellen Charak-
ter benötigt, d.h. den einzelnen, unverwechselbaren Men-
schen, sondern eine Funktion (im Christentum den am
– 190 –

Kreuz sterbenden, verratenen Erlöser), bei der es egal ist,
von welcher Person sie ausgefüllt wird.
Für die Menschen, aus deren Gegenwart Karl Glogauer
mit seiner Zeitmaschine gestartet ist, ändert sich nichts.
Der Jesus Zwischenfall wie Frank Herbert es einmal als
Titel eines Romans recht treffend ausgedrückt hat, findet
statt, was ändert es, wenn Christus Karl Glogauer heißt?
Für den Mythos nichts, solange er sich erfüllt.
Aber zurück zu der Frage nach dem Verhältnis der Scien-
ce Fiction zur Religion.
Kann eine Religion, oder die Kirche als institutio-
nalisierte Religion, ein Thema für die Science Fiction sein?
Schließen sich, geht man einmal von dem traditionellen
Selbstverständnis der Science Fiction aus, wie es u.a. John
W. Campbell formuliert hat, der sagte, daß Science Fiction
von »technisch Interessierten über technisch Interessierte
zur Befriedigung technisch Interessierten geschrieben
würde, Science Fiction und Religion nicht aus? Die
Science Fiction läßt nur – im Rahmen eines gattungsinter-
nen Konsens – die Rationalität gelten, während die Religi-
on gerade diese transzendiert und das irrationale Element
zu ihrem Wesen macht.
Genau an dieser Stelle greift M. Moorcocks Roman die
Religion an ihrem verwundbarsten Punkt an – indem er
sie des irrationalen Moments, landläufig als Glauben be-
zeichnet, entkleidet, ohne die Aussagen zu negieren. Er
wird damit zum Atheisten, der die Religion genau da
packt, wo sie sich am sichersten fühlt – auf ihrem ur-
eigensten Terrain. Dazu benötigt der Autor allerdings eine
Zeitmaschine, und wo bekommt er diese her: aus dem gut
gefüllten Asservatenraum der Science Fiction.
– 191 –

Mit dieser Zeitmaschine – ein direktes Nachfolgemodell
der von H. G. Wells entwickelten, so mag es scheinen –
macht sich nun Moorcocks Protagonist auf den Weg
dorthin, wo alles begann. Er findet aber nicht etwa eine
wohlgeordnete Welt vor, in der Jesus predigt, nein, die
Welt ist zwar geordnet, doch nicht in der erwarteten
Weise.
Was nun bis zur Kreuzigung passiert, kann ein jeder in
der Bibel nachlesen. Alles ereignet sich so, wie es von den
Evangelisten berichtet wird, mit einem ganz kleinen Un-
terschied allerdings: Gott bleibt vor der Tür. Er wird nicht
mehr benötigt; die Menschen schaffen sich ihren Mythos
selbst, wie schon unzählige Male vorher und nachher.
Gott ist, wenn überhaupt, ein deus absconditus.
M. Moorcock packt nicht das Übel, wohl aber die christli-
che Kirche an ihrer Wurzel. Es gibt kein: Was wäre wenn,
sondern nur ein: Jeder kann (wenn er im richtigen
Moment an der richtigen Stelle ist) zum Religionsstifter
werden.
Karl Glogauer ist allein. Niemand stirbt neben ihm am
Kreuz, wie es die Bibel berichtet, und er leidet auf Golga-
tha. Seine göttliche Sendung endet da, wo der Schmerz
bewußt und übermächtig wird. Der Ausruf Jesu »Mein
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen« wird von
Glogauer, der so peinlich dem Mythos gefolgt ist und ihn
damit geschaffen hat, nicht ausgesprochen. Statt dessen
fleht er: »Laßt mich herunter! Bitte! Bitte hört auf!«
Doch mit seinem Opfer hat er einen Mythos geschaffen,
der sich in den folgenden Jahrhunderten verselbständigen
wird. Die rationalen Erklärungen werden durch irrationa-
le – spektakulärere – ersetzt, und Karl Glogauer wird gött-
– 192 –

liche Züge annehmen, doch ›es ist eine Lüge – es ist eine
Lüge‹. Diese von dem Protagonisten mehrfach wiederhol-
ten Worte, seine letzten übrigens, – worauf beziehen sie
sich? Auf die Lüge, deren Ausdruck er selbst ist? Auf die
Lüge vom göttlichen Jesus, an die er sein Leben lang ge-
glaubt hat? Oder ist es eine Warnung an alle zukünftigen
Generationen, daß hier kein Mythos geschaffen wurde,
sondern eine Lüge, die in den nachfolgenden Jahr-
hunderten immer größer werden wird?
»Antworte!« möchte man Karl Glogauer zurufen, »welche
Lüge meinst du!« Für Karl Glogauer besteht selbst in sei-
nem Sterben keine Hoffnung mehr, und auch darin über-
trifft sein Opfer – es wird ihm spät, zu spät bewußt – das
des biblischen Jesus um ein Vielfaches. Jesus, Inkarnation
Gottes auf Erden, ertrug seine irdischen Leiden ohne Kla-
gen. Für ihn war sein Weg durch die Welt eine Durch-
gangsstation. Der Heiland ging nach seinem irdischen Tod
in das Reich Gottes ein – ein ehrenvoller Lohn für das von
ihm Vollbrachte – doch welcher Lohn erwartet Karl Glo-
gauer?
Er, der gelitten hat wie Jesus, erkennt im Moment, da er
am Kreuz stirbt, den Mythos als Mythos und stellt fest, daß
er der Schöpfer dieses Mythos ist und für ihn nicht einmal
die Hoffnung bleibt, die die nachfolgenden Generationen
in seine Gestalt setzen werden. Die Menschen werden
sich an seine Lüge klammern, und Karl Glogauer weiß es.
Wenn er Christus ist, dann ist Gott eine Lüge – doch die
Warnung verhallt ungehört.
– 193 –

Michael Moorcock hat in dem Roman I.N.R.I. einige Anlei-
hen bei der Psychologie, besonders bei C. G. Jung ge-
macht, die einerseits die psychische Disposition seines
Protagonisten begreifbar machen, andererseits auf die psy-
chologischen Implikationen der Religion abzielen. Im Mit-
telpunkt steht dabei der von G. G. Jung gebrauchte Begriff
des kollektiven Unbewußten, den dieser im Gegensatz
zum persönlich Unbewußten als »eine in jedermann vor-
handene, allgemein seelische Grundlage überpersönlicher
Natur« beschreibt. Repräsentiert werden diese Strukturen
in Märchen und Mythos (!) als Erbe der Menschheit in
Form der representations collectives (Levy-Bruhl), die
symbolische Werte primitiver Weltanschauung aus-
drücken. Bei Moorcock zeigt sich dies in der Sehnsucht
des Protagonisten nach einem Erlöser bzw. Erlösung, wie
es die Gefährtin Glogauers, Monica, mehrfach ausdrückt.
Die Sehnsucht nach dem Erlöser (dem Messias, auf den
die Juden heute noch warten) äußert sich bei Karl Glogau-
er in dem Wunsch, bei der Kreuzigung Christi anwesend
zu sein. Als seine Hoffnung enttäuscht wird, nimmt er
schließlich die Stelle des Erlösers ein und stellt am Kreuz
fest, daß der Erlöser selbst nicht erlöst werden kann: »Es
ist eine Lüge.«
Dieser Wunsch, dabei zu sein, wenn ein Mythos entsteht,
offenbart einen weiteren Aspekt des Scheiterns: Der Ver-
such Karl Glogauers an die Wurzeln des Mythos vorzu-
dringen, ihn dem Dunkel der Überlieferung zu entreißen
und zu verifizieren, d.h. nicht zuletzt die Wunder des
Christentums als Augenzeuge zu überprüfen, muß erfolg-
los bleiben, denn die Annäherung an den Mythos entblößt
diesen der mythischen Ausformung – er wird trivial.
– 194 –
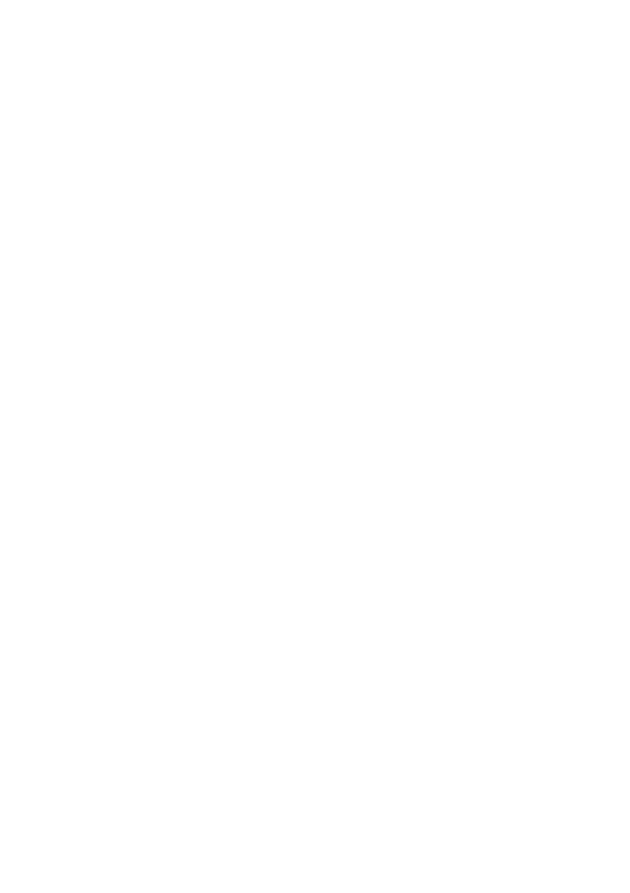
So erklären sich die Wunder-Heilungen des Karl Glogau-
er, das Laufen auf dem Wasser und das Verschwinden des
Leichnams, der von Ärzten gestohlen wird, durchaus in
Übereinstimmung mit der Rationalität, da der Mythos
noch nicht ausgeformt ist. In ähnlicher Weise hat sich der
Mythos von Kaiser Friedrich Barbarossa, der im Kyffhäuser
sitzen und irgendwann einmal auferstehen und das Deut-
sche Reich neubegründen soll, entwickelt. Der Beweis für
den Glauben – in diesem Fall Christus am Kreuz sterben
zu sehen – kann und darf nicht erbracht werden, denn da-
mit würde dem Christentum eben diese unabdingbare
Kategorie entzogen werden, es geriete ins Joch der Ratio-
nalität – geriete zur Science Fiction. Somit zerfällt die vitae
Christi bei der Annäherung mit der Zeitmaschine zu
einem Konglomerat von Zufälligkeiten, die nie den Boden
des empirischen Weltbildes verlassen und in dem die Per-
son des Mythenschöpfers austauschbar ist – nicht über die
Funktion, die er erfüllt.
Leicht kann bei der Lektüre des Romans I.N.R.I. der Ein-
druck entstehen, dem Autor ginge es nur um Effekte, mit
denen er allerdings auch nicht spart. Leicht stellt sich die
Vermutung ein, hier will ein Schriftsteller einen blasphe-
mischen Angriff auf die Religion loswerden, doch so zu ur-
teilen wäre falsch, und man würde Michael Moorcock Un-
recht tun.
I.N.R.I. zeigt, wie Religion, nicht nur das Christentum,
entstehen, und legt darüber hinaus schonungslos offen,
daß die Interpretation der Ereignisse sich unter günstigen
– 195 –

Umständen verselbständigt und eine Eigendynamik entwi-
ckelt.
Gleichzeitig wird die Frage nach Christus gestellt, und
Michael Moorcock trennt die Funktion von der Person.
Nach der Zurückweisung eines Schwachsinnigen, der zu-
fällig den Namen Jesus trägt, als Erlöser, läßt er einen
Menschen des 20. Jahrhunderts, Karl Glogauer, an dessen
Stelle treten und nichts ändert sich, außer daß ein paar in-
teressante Fragen am Horizont des Lesers auftauchen und
man sich Gedanken über Inhalt und Form religiöser Über-
lieferungen machen sollte. Auch wenn auf den ersten
Blick der Anschein entstehen könnte, Moorcock führe
einen blasphemischen Schlag gegen die Kirche, so
schließt er sich doch nicht der Rede des toten Christus
vom Weltgebäude herab an, daß da kein Gott sei.
Die Imitatio Christi (so übrigens der Titel, den die Er-
zählung Behold the Man bei ihrer deutschen Erstveröffent-
lichung, 1971, erhalten hat), die Aufforderung der Kirche
an ihre Gläubigen, das eigene Leben nach dem Jesu Chris-
ti auszurichten, seinem Beispiel zu folgen, wird hier in
letzter Konsequenz innerhalb des fiktionalen Textes
verwirklicht. Mit Hilfe der Mittel, die die Gattung Science
Fiction einem Autor zur Verfügung stellt, erreicht es Moor-
cock, die Kirche zu desavouieren, denn wenn jeder, oder
auch nur ein gewöhnlicher Mensch wie Karl Glogauer in
der Lage ist, das zu leisten, was Jesus Christus dem My-
thos nach geleistet hat, dann wird Jesus überflüssig, denn
jeder kann den Mythos aufs neue erfüllen.
Copyright © 1986 by Florian F. Marzin
– 196 –
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Wenn die Maus mit der Maus auf der
Moorcock, Michael Am Ende Der Zeit 2 Das Tiefenland
Terra Fantasy 058 Moorcock, Michael Burg Brass 03 Der Ewige Held
Moorcock, Michael Zeitnomaden 2 Der Landleviathan(1)
Moorcock, Michael Am Ende Der Zeit 01 Ein Unbekanntes Feuer
Moorcock, Michael Zeitnomaden 1 Der Herr Der Lüfte
Ritter; Zukunft mit Tradition San Marino die aelteste Demokratie der Welt
Michaelis, Julia Die Wikinger Prinzessin und der Scheich 01
Moorcock, Michael Zeitnomaden 2 Der Landleviathan
Programmieren mit der BASIC Stamp 2 (8)
Die antike Theorie der feiernden Rede im historischen Aufriß
Kuczkowski, Kajkowski Die heiligen Wälder der Slawen in Pommern im frühen Mittelalter
Programmieren mit der BASIC Stamp 2 (7)
Buckower Elegien von?rtholt Brecht – die?rechnung mit?r Situation in?r?R nach?r Zweiten Weltkriegx
Die Werbung dient der Gesellschaft
Bots, Dennis Hotel 13 02 Das Raetsel der Zeitmaschine
Programmieren mit der BASIC Stamp 2 (2)
Programmieren mit der BASIC Stamp 2 (4)
więcej podobnych podstron