

Judith Borgwart (Hrsg.)
Kai Kolpatzik (Hrsg.)
Aus Fehlern lernen – Fehlermanagement in Gesundheitsberufen
Top im Gesundheitsjob

Judith Borgwart (Hrsg.)
Kai Kolpatzik (Hrsg.)
Aus Fehlern lernen –
Fehlermanagement
in Gesundheitsberufen
Mit 6 Abbildungen
123

Dr. Judith Borgwart
Hoherodskopfstraße 40, 60435 Frankfurt
Kai Kolpatzik
AOK-Bundesverband
Rosenthaler Straße 31, 10178 Berlin
ISBN-13 978-3-642-12622-2 Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der
Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funk-
sendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in
Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Ver-
vielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom
9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflich-
tig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.
Springer Medizin
Springer-Verlag GmbH
ein Unternehmen von Springer Science+Business
springer.de
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch
ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Waren-
zeichen- und Markenschutzgesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann
benutzt werden dürften.
Produkthaftung: Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom
Verlag keine Gewähr übernommen werden. Derartige Angaben müssen vom jeweiligen Anwender
im Einzelfall anhand anderer Literarturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft werden.
Planung: Barbara Lengricht und Susanne Moritz, Berlin
Projektmanagement: Ulrike Niesel, Heidelberg
Lektorat: Dr. Sirka Nitschmann, Werl-Westönnen
Layout und Umschlaggestaltung: deblik Berlin
Satz: Fotosatz-Service Köhler GmbH – Reinhold Schöberl, Würzburg
SPIN: 12990276
Gedruckt auf säurefreiem Papier 22/2122/UN – 5 4 3 2 1 0


V
Geleitwort
von Dr. Jörg Lauterberg
In einer funktionierenden Sicherheitskultur
sind alle Lernende
Jeder Patient, auch der aufgeklärte »mündige« Patient möchte und
braucht eine verlässliche Größe: das Vertrauen in die Menschen,
die ihn versorgen, weil er krank, schwach oder hilfsbedürftig ist. Die
Qualität der Versorgung in unserem Gesundheitssystem stellt Tag für
Tag bei Tausenden von Menschen unter Beweis, dass dieses Vertrauen
berechtigt ist. Denn ob Mitarbeiter in einem ambulanten Pflegedienst,
Ärztin oder Arzt in Klinik und Praxis, Auszubildende, Hebamme oder
OP-Schwester – sie alle geben ihr Bestes, um Menschen optimal zu
betreuen und zu versorgen. Dennoch kommt es immer wieder vor,
dass eine »Panne« passiert, etwas »schief läuft« und alle Beteiligten
gerade noch einmal »mit einem blauen Auge« davonkommen. Oder
eben auch nicht. Dann hat ein Fehler, ein vermeidbares unerwünschtes
Ereignis einem Patienten Schaden an seiner Gesundheit zugefügt, viel-
leicht sogar sein Leben in Gefahr gebracht.
Die aus Tabugründen im Gesundheitswesen immer noch gebräuch-
lichste, aber auch gefährlichste Art, mit Fehlern umzugehen, ist Ver-
schweigen. Denn dann hat niemand die Chance, andere Patienten
davor zu beschützen, dass dieser Fehler sich wiederholt. Deswegen ist
es so wichtig, darüber zu sprechen. Über Fehler sprechen und sie
nüchtern analysieren zu können, fällt leichter, wenn nicht gleich mit
Schuldzuweisungen und Sanktionen reagiert wird. Gegründet auf die
moderne Fehlerforschung setzt sich allmählich die Erkenntnis durch,
dass viele vermeidbare, unerwünschte Ereignisse mit Systemfehlern
und Fehlerketten, und nicht allein mit dem persönlichen Versagen von
Einzelnen zusammenhängen. Eine lebendige und konstruktive Sicher-

heitskultur kommt allen Beteiligten zu Gute, vor allem aber Patienten
und Bewohnern: Wo Fehler offen und ohne Zeit zu verlieren kommu-
niziert werden, kann Schlimmeres oftmals abgewendet werden. Oder
Fehler können ganz vermieden werden, weil ihre Ursachen erkannt
und ausgeschaltet worden sind.
Mit diesem Buch möchte ich Sie einladen, sich in Ihrem beruflichen
Wirkungskreis für eine neue Sicherheitskultur zu engagieren. Lassen
Sie sich ein auf einen Prozess, in dem alle Lernende sind. In dem es um
nicht mehr und nicht weniger geht als die Gesundheit und die Sicher-
heit der Menschen, die sich Ihnen anvertraut haben.
Im Juli 2010
Dr. Jörg Lauterberg
Geschäftsführer Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V.
VI
Geleitwort

VII
Geleitwort
von Andreas Westerfellhaus
Die Suche nach »Schuldigen« führt in eine Sackgasse
Der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt soll einmal gesagt haben:
»Wenn man einen Fehler gemacht hat, muss man sich als erstes fragen,
ob man ihn nicht sofort zugeben soll. Leider wird einem das als
Schwäche angekreidet«. Und damit sind wir schon mitten in der
Diskussion! Das Dilemma ist ja, dass niemand davor gefeit ist, Fehler
zu machen. Wie dann damit umgegangen wird – wie man selbst damit
umgeht und wie die anderen damit umgehen – hat Dimensionen, die
weit über das Persönliche hinausgehen. Deswegen machen wir es uns
alle gern einfach: Wir reduzieren den Fehler! Dann erscheint er als das
Ergebnis einer konkreten Handlung einer konkreten Person. Und die
ist Schuld! Ein solcher Umgang mit Fehlern führt in eine Sackgasse!
Wenn man aber, anstatt zu fragen: »
Wer
hat den Fehler gemacht?«
fragt: »
Wie
kam es zu dem Fehler?« entdeckt man oft ganze Kaskaden
von »Teilfehlern« – Missstände und Missverständnisse, Informationen,
die nicht weitergegeben wurden, Unwissenheit (womöglich aller Be-
teiligten), Unterlassungen – die dem Fehler unbeachtet vorausgegan-
gen sind. Und plötzlich ist er da, der Fehler. Eine Studie konnte nach-
weisen, dass einem »sichtbaren« Fehler – eine Patientin wurde ver-
wechselt – 17 »unsichtbare«, weil unbemerkte Fehler vorausgegangen
sind! Möglicherweise hätte die Vermeidung eines einzelnen davon,
die Fehlerkaskade wirksam unterbrochen. Deswegen brauchen wir eine
neue Fehlerkultur. Eine Kultur, die hinschaut, anstatt Schuldige heraus
zu deuten. In der es möglich ist, offen mit Fehlern umzugehen und
gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Damit Fehler sich nicht wieder-
holen, sondern als das erkannt werden können, was sie sind: Hinweise
auf eine notwendige Verbesserung. Eine solche neue Fehlerkultur ist

eine herausragende Stärke, Zeichen von Professionalität. Und sie ist ein
unmissverständliches Vertrauensangebot an die Menschen, die sich an
uns wenden, weil sie hilfsbedürftig, krank oder ratsuchend sind.
Ein offener Umgang mit Fehlern ist der einzige Weg, der aus der
Sackgasse führt. Denn man kann Fehler weder verbieten noch
hundertprozentig vermeiden. Man kann nur aus ihnen lernen.
Im Juli 2010
Andreas Westerfellhaus
Präsident des Deutschen Pflegerates
VIII
Geleitwort

IX
Die Herausgeber
Dr. Judith Borgwart hat nach dem Stu-
dium der Kulturanthropologie und Euro-
päischen Ethnologie zunächst als freie
Autorin und Sprecherin beim Hessischen
und Bayerischen Rundfunk gearbeitet.
Sie leitete den Programmbereich Ge-
sundheitskommunikation bei MVS
Medizinverlagen Stuttgart. Heute lebt
und arbeitet sie als freie Autorin und
Medienberaterin in Frankfurt am Main.
Kai Kolpatzik, MPH, EMPH, ist Arzt
und Gesundheitswissenschaftler und ar-
beitete als Assistenzarzt in der Chirurgie
in Krankenhäusern in Freiburg und am
Bodensee. Stationen in der Gesundheits-
wissenschaft waren die Universität
Bielefeld – mit Abschluss European
Master of Public Health – und die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) in
Genf, bevor er 2004 seine Tätigkeit im
AOK-Bundesverband aufnahm. Seit
2009 leitet er die Abteilung Prävention
im AOK-Bundesverband.


XI
Die Autoren
Professorin Christel Bienstein
Leiterin des Departements für Pflegewissenschaft
der Universität Witten/Herdecke gGmbH, Fakultät Medizin
Dr. phil. Judith Borgwart
Freie Autorin, Frankfurt am Main
Claudia Christ-Steckhan
Projektleitung im Bereich Risikomanagement, Zentrales Qualitäts-
management der Charité – Universitätsmedizin, Berlin
Henning Cramer
Zentrum für Pflegeforschung und Beratung (ZePB), Hochschule Bremen
Hedwig Francois-Kettner
Pflegedirektorin an der Charité – Universitätsmedizin, Berlin
Sabine Girts
Geschäftsführerin Verband Bundesarbeitsgemeinschaft
Leitender Pflegepersonen e.V. – BALK
Professorin Dr. Monika Habermann
Leiterin des Zentrums für Pflegeforschung und Beratung (ZePB)
der Hochschule Bremen
Dr. med. Marc-Anton Hochreutener
Geschäftsführer der Stiftung für Patientensicherheit, Zürich
Rolf Höfert
Geschäftsführer des Deutschen Pflegeverbandes e. V. (DPV),
Experte für Pflegerecht

Dr. phil. Edith Kellnhauser
Professorin im Fachbereich Pflege und Gesundheit
(ehemalige Funktion), Katholische Fachhochschule Mainz
Kai Kolpatzik
Leiter der Abteilung Prävention beim AOK-Bundesverband, Berlin
Professor Dr. Andreas Lauterbach
Studiengangsleiter Pflege, Hochschule für Gesundheit, Bochum
Vera Lux
Pflegedirektorin der Universitätsklinik Köln
Dr. Karin Pöppel
Sozialwissenschaftlerin, Offenbach am Main
Dr. Marianne Rabe
Pädagogische Geschäftsführerin – Charité Gesundheitsakademie,
Berlin
Gertrud Stöcker
Stellvertretende Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes
für Pflegeberufe – DBfK-Bundesvorstand, alternierende Vorsitzende
des Deutschen Bildungsrates für Pflegeberufe (DBR), Grevenbroich
Professor Dr. Martin Teising
Fachhochschule Frankfurt am Main – University of Applied Sciences
Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit
Professor Dr. Dr. Karl-Heinz Wehkamp
Professor für Gesundheitswissenschaften; Ethik- und Organisations-
berater für Kliniken und andere Einrichtungen in Gesundheitswesen
und Gesundheitswirtschaft
XII
Die Autoren

XIII
Inhaltsverzeichnis
1
Fehler – was ist das eigentlich?
. . . . . . . . . . . . . . . . .
2
1.1 Definitionen nach dem Aktionsbündnis
Patientensicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.2 Auf der Suche nach geeigneten Definitionen in der Pflege
5
2
Fehler dürfen nicht individualisiert werden!
. . . . . . . .
17
2.1
Weniger Pflegekräfte – mehr Patienten . . . . . . . . . . . . 17
2.2 Stellenabbau: Patienten gefährdet, Fehlerrisiko erhöht . . .
21
2.3 Welche Lösungen werden diskutiert? . . . . . . . . . . . . . .
22
2.4 Bei jedem Fehler ist auch das System gefordert . . . . . . .
23
2.5 Wer aufhört zu jammern, handelt . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3
Hohe Arbeitsbelastungen: Was Sie tun können
. . . . . 27
3.1 Leider nicht die Ausnahme: Mängel in der Pflege . . . . . .
28
3.2 Werden Sie aktiv! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
3.3 Darüber reden heißt nicht petzen . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4
Reaktionen von Pflegenden auf ein Fehlergeschehen
.
36
4.1 Ängste, Stress und Sorgen im Umgang mit Fehlern . . . . .
36
4.2 Ethische Konflikte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.3 Leitungsverantwortung und persönliche Reaktionen
auf Fehler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.4 Folgen eines Fehlergeschehens in der Fragebogen-
erhebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5
Professionelles Berufsverständnis braucht Ethik
. . . . . 47
5.1 Eine Frage der Augenhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
5.2 Ethik regelt unser Zusammenleben . . . . . . . . . . . . . . . 49

6
Dekubitusprophylaxe – aber bitte richtig!
. . . . . . . . . 59
6.1 Die 5 wichtigsten Fehler bei der Vermeidung
von Druckgeschwüren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
6.2 Einen guten Job machen, ist nicht alles . . . . . . . . . . . . .
62
7
Kein Fehler vor dem Schnitt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
7.1 Was ist eine Eingriffsverwechslung? . . . . . . . . . . . . . . .
67
7.2 Ohne Konsequenz geht es nicht . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
7.3 Und im Fall der Fälle? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
8
Wie sage ich’s dem Patienten?
. . . . . . . . . . . . . . . . . 78
8.1 Vorgehen bei der Fehlerkommunikation . . . . . . . . . . . .
78
9 Ȇbergabefehler
verursachen
6%
der nosokomialen Todesfälle.«
. . . . . . . . . . . . . . . . . 82
9.1 Dauer der Übergaben und Anzahl der Patienten . . . . . . .
82
9.2 Informative Übergabe oder »Schema F«? . . . . . . . . . . . .
83
9.3 Mündliche Übergabe und Dokumentation –
wie von verschiedenen Eltern . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
10 Fehlverhalten – zwischen Fürsorge und Machtausübung
89
10.1 Fehler oder Fehlverhalten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
10.2 Fehlverhalten kann viele Gesichter haben . . . . . . . . . . . 91
11 Pflege ist auch »Gefühlsarbeit« – zur Psychoanalyse
der Pflegebeziehung
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
11.1 Unsere erste Pflegebeziehung: die (frühe) Kindheit . . . . . 101
11.2 Warum wir mitfühlen können . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
11.3 Warum wir Pflegebedürftigkeit gerade im Alter so fürchten 104
11.4 Im Unbewussten abgespeichert: die erste Pflegebeziehung 106
12 Pflege und Betreuung: Auch eine Frage
des Patientenbildes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
12.1 Noch viel zu häufig: das Bild vom »unmündigen« Patienten 110
12.2 Zeit zum Umdenken: Der Patient ist Partner und Mensch . 111
XIV
Inhaltsverzeichnis

XV
13 Fehlerkultur für die Altenpflege und den
hausärztlichen Bereich
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
13.1 Berichtssysteme – damit Fehler gar nicht erst passieren . . 119
13.2 Beispiele von Berichtssystemen . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
13.3 Die ersten Schritte sind getan, weitere müssen folgen . . . 124
14 Beispiele aus dem Sicherheitsmanagement der Charité
127
14.1 Jeder Fehler ist eine Chance! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
14.2 Fehler als »Trainingspartner« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
15 Vorbeugen ist besser als haften – Aus Fehlern lernen
. . 136
15.1 Die gesetzliche Grundlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
15.2 Rechtsfälle aus der Praxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
15.3 Mir ist ein Fehler passiert! Und jetzt? . . . . . . . . . . . . . . 144
16 Ein Blick über den Tellerrand – Fehlervermeidung
durch Qualitätssicherung in den USA
. . . . . . . . . . . . 146
16.1 Die »Joint Commission« zur Qualitätskontrolle . . . . . . . . 146
16.2 Wie fit bin ich? Die Leistungsbewertung . . . . . . . . . . . . 149
16.3 Fehlern vorbeugen: Das Risikomanagement . . . . . . . . . 151
Stichwortverzeichnis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Inhaltsverzeichnis

Kennen Sie das auch?
Zu sagen: »Ich habe einen Fehler gemacht« – das fällt schwer! Denn
die Antwort darauf lautet normalerweise nicht: »Wie gut, dass du es
gesagt hast! Jetzt können wir gemeinsam danach suchen, wie wir
solche Fehler in Zukunft vermeiden«. Deswegen war es 2008 eine
kleine Sensation, als 17 Ärzte und Vertreter anderer Gesundheits-
berufe sich dazu bekannten, Fehler gemacht zu haben. Öffentlich in
einer Broschüre des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, die vom
AOK-Bundesverband organisiert und umgesetzt wurde. Unter dem
Titel »Aus Fehlern lernen« wurde in einem ganz besonders fehler-
sensiblen Bereich, der Behandlung und Versorgung kranker, alter
und hilfsbedürftiger Menschen, öffentlich gemacht, dass über un-
erwünschte Ereignisse, Fehler, Schäden und Beinahe-Schäden ge-
sprochen werden muss, um sie vermeiden zu können. Fast nie ist es
ein einzelner, der sie allein zu verantworten hat. Kommt es zu einem
Fehler, hat er meist eine »unsichtbare« Vorgeschichte, die aus vielen
kleinen Fehlern vieler Beteiligter wie z. B. Unterlassungen, Fehlinfor-
mationen, Unwissenheit besteht, die nur entdeckt werden können,
wenn man offen darüber spricht.
Von der Broschüre des Aktionsbündnisses hin zur Idee dieses Buches,
das sich insbesondere an Auszubildende und Studierende in den Ge-
sundheitsberufen wendet, war es kein langer Weg – aber was für ein
schwieriger! Sehr bald stellte sich heraus, dass in der Pflege, einer Arzt-
praxis oder z. B. als Hebamme Tätige noch immer nicht den Mut fin-
den, offen einen Fehler zu bekennen. Nicht einmal dann, wenn am
Ende alles gut ausgegangen und niemand zu Schaden gekommen ist.
Noch immer scheint die Erwartung übermächtig, auf ein Fehlereinge-
ständnis werde mit Schuldzuweisungen, Vorwürfen und Sanktionen
reagiert. In unserem Buch wollen wir nicht nur einzelne Akteure, die
sagen: »Ich habe einen Fehler gemacht«, sondern die Fehler selbst »zu
Wort kommen lassen«. Denn wir vertrauen darauf, dass jeder Fehler in
sich den Keim zu seiner Vermeidung trägt. Nur dann, wenn man offen
mit Fehlern umgehen und sich auf eine moderne Sicherheitskultur
verlassen kann, können Fehler als Chance für Verbesserungen ge-
sehen und genutzt werden. Davon profitieren nicht nur Patienten und
Angehörige, davon profitiert unsere Gesellschaft als Ganzes.
Dr. Judith Borgwart, Kai Kolpatzik

2
Kapitel 1 · Fehler – was ist das eigentlich?
Fehler – was ist das
eigentlich?
Judith Borgwart
Nach Angaben des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), des
Aktionsbündnisses Patientensicherheit e.V. und dem AOK-Bundes
-
verband sind die Zahlen über Vorfälle, bei denen in Deutschland
im Rahmen eines Krankenhausaufenthaltes Menschen zu Schaden ge-
kommen sind, alarmierend [22]:
Jedes Jahr infizieren sich 500.000 Menschen mit Krankenhaus-
keimen.
4 % der Patienten bzw. 88.000 Menschen, die in der inneren Medi-
zin aufgenommen werden, sind Opfer gefährlicher Nebenwirkun-
gen oder Wechselwirkungen. Die Folgekosten, die sich daraus er-
geben, werden mit 400 Millionen Euro beziffert!
Jedes Jahr werden 40.000 Vorwürfe wegen eines medizinischen
Behandlungsfehlers erhoben – 12.000 davon werden als solche an-
erkannt.
17.000 Todesfälle, die sich jährlich in deutschen Kliniken ereignen,
wären vermeidbar gewesen (
.
Abb. 1.1
).
4
4
4
4
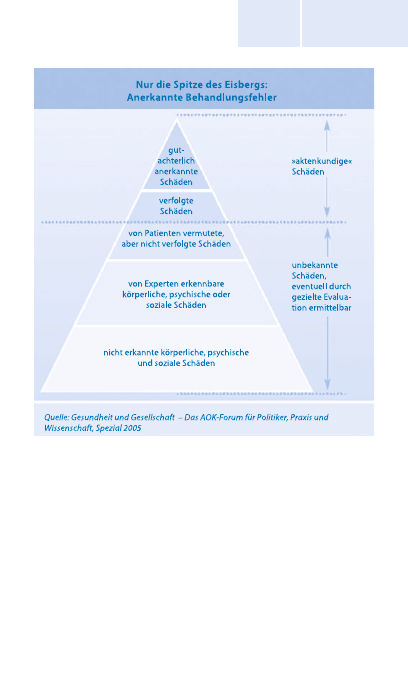
1
3
Abb. 1.1. Spitze des Eisbergs.
.
1 · Fehler – was ist das eigentlich?
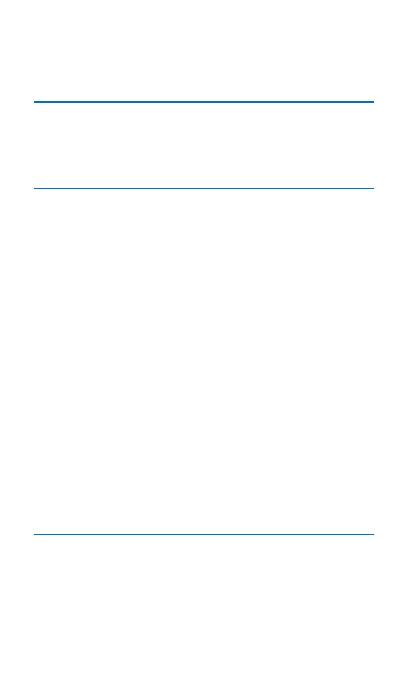
4
Kapitel 1 · Fehler – was ist das eigentlich?
1.1
Definitionen nach dem Aktionsbündnis
Patientensicherheit
Die genannten Zahlen machen deutlich: Über Fehler muss geredet
werden. Aber was ist eigentlich ein Fehler? Das Aktionsbündnis
Patientensicherheit e.V. (APS) hat 5 Schlüsselbegriffe zum Thema
Patientensicherheit definiert.
Definition von 5 Schlüsselbegriffen zur Patientensicherheit
Unerwünschtes Ereignis
Ein schädliches Vorkommnis, das eher auf der Behandlung als auf der
Erkrankung beruht. Es kann vermeidbar oder unvermeidbar sein.
Vermeidbares unerwünschtes Ereignis
Ein unerwünschtes Ereignis, das vermeidbar ist.
Kritisches Ereignis
Ein Ereignis, das zu einem unerwünschten Ereignis führen könnte
oder dessen Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht.
Fehler
Eine Handlung oder ein Unterlassen, bei dem eine Abweichung vom
Plan, ein falscher Plan oder kein Plan vorliegt. Ob daraus ein Schaden
entsteht, ist für die Definition des Fehlers irrelevant.
Beinahe-Schaden
Ein Fehler ohne Schaden, der zu einem Schaden hätte führen können.
Nach: »Jeder Tupfer zählt« – Glossar zum Downloaden unter [31]
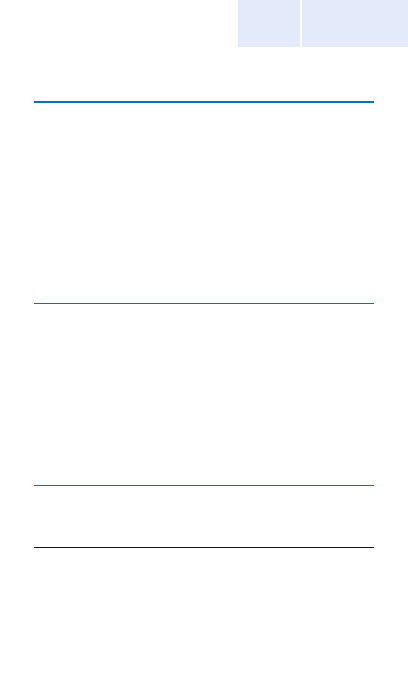
1
5
1.2
Auf der Suche nach geeigneten Definitionen
in der Pflege
Die folgenden Ausführungen entstanden auf Basis mehrerer ausführ-
licher Gespräche mit Frau Dr. Angelika Abt-Zegelin, Departement für
Pflegewissenschaft, Universität Witten/Herdecke.
Meist wird ein Fehler in Zusammenhang mit der medizinischen Ver-
sorgung betrachtet, wenn z. B. etwas verwechselt oder falsch gemacht
worden ist. Bei genauerer Betrachtung greifen solche »Definitionen«
oftmals zu kurz. Denn sie berücksichtigen weder die Verkettung von
Umständen, die zu einem Fehler führt, noch unterscheiden sie zwi-
schen den Folgen, die ein Fehler für die betroffene Patientin oder den
betroffenen Patienten hat.
Kurzfristige und langfristige Folgen von Fehlern
In der Medizin: meist Fehler mit akuten Folgen
In der Pflege: Fehler mit meist langfristigen Folgen und vorrangig
2 Ursachen:
Eine den Patienten gefährdende Situation wird aufgrund
fehlenden Wissens nicht erkannt bzw. aus Unwissenheit wird
eine Betreuungshandlung durchgeführt, die nicht zum Nutzen
des Patienten ist.
Für den Patienten und seine Gesundheit förderliche Maß-
nahmen werden unterlassen.
Unwissenheit und Unterlassung
In der Diskussion um »Pflegefehler« gilt es, überhaupt erst einmal eine
genaue Definition zu finden. Denn fast nie lässt sich eine einzelne
»falsche« Pflegehandlung identifizieren, fast immer geht einer Situa-
tion, in der ein Patient Schaden nimmt, eine ganze Kaskade von Unter-
lassungen voraus, an denen oft mehrere Personen beteiligt sind. Kom-
4
4
4
4
1.2 · Auf der Suche nach Definitionen

6
Kapitel 1 · Fehler – was ist das eigentlich?
biniert mit Unterlassung, aber auch als eigenständige Ursache von Feh-
lern, lässt sich auch Unwissenheit identifizieren. Sie kann dazu führen,
dass ein Pflegebedarf nicht erkannt wird oder eine falsche bzw. unge-
eignete Pflegehandlung durchgeführt wird. Verschiedene Vorschläge,
solche Ereignisse zu kategorisieren, sind:
Kritisches Ereignis: Beschrieben wird damit ein Ereignis, das selbst
zu einem unerwünschten Ereignis führt oder zumindest ein uner-
wünschtes Ereignis wahrscheinlicher macht.
Fehler: Bei dieser Definition ist es unerheblich, ob tatsächlich ein
Patient zu Schaden gekommen ist. »Fehler« beschreibt vielmehr
eine Abweichung vom Plan oder einen falschen Plan oder das
Fehlen eines Plans.
Unerwünschtes Ereignis: Der Patient nimmt aufgrund eines Ereig-
nisses Schaden, zu dem es eher im Rahmen der Behandlung denn
als Folge der Erkrankung gekommen ist.
Beinahe-Schaden: Es ist kein Schaden entstanden, aufgrund eines
Fehlers hätte aber ein Schaden entstehen können.
Vermeidbares unerwünschtes Ereignis: Das im Rahmen der Be-
handlung unerwünschte Ereignis hätte vermieden werden können.
Was bis heute fehlt, ist eine Nomenklatur, eine Definition, die die
komplexen Ursachenzusammenhänge wirklich erfasst. Das Wort
»Fehler« reicht dafür nicht aus (
.
Abb. 1.2).
Fehlerkonstellationen am Beispiel der Bettlägerigkeit
Unwissenheit? Unterlassung? Pflegefehler? Im Folgenden werden am
Beispiel der Bettlägerigkeit Fehlerkonstellationen reflektiert, an deren
Ende ein Schaden für den betroffenen Patienten steht. Dieses Beispiel
mag zeigen, wie unzureichend der Begriff des Fehlers ist.
Liegen führt zum Liegen!
Ein Beispiel für das Ineinandergreifen von vielen, ganz unterschied-
lichen Faktoren, die dann zu einem Schaden für den Patienten führen,
ist die allmähliche Ortsfixierung als pflegerische Komplikation. Mit
4
4
4
4
4
>
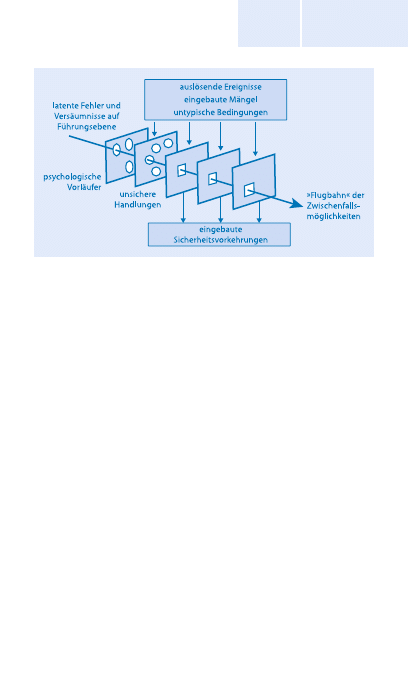
1
7
sehr schweren Folgen für den Betroffenen kann sie in die finale Bett-
lägerigkeit führen, von der ein Patient sich nicht mehr erholen kann.
Unerwünschtes Dauerliegen ist eine pflegerische Komplikation, die
gefährliche Risiken wie z. B. Thrombosen, Dekubitus, Pneumonie und/
oder Kontrakturen nach sich ziehen kann.
Zu den körperlichen Risiken kommen Folgen für die Seele dazu:
Ortsfixierte und bettlägerige Patienten fühlen sich isoliert, ver-
zweifelt und ohne Hoffnung, traurig bis hin zur manifesten
Depression. Die Welt schrumpft auf das Bett zusammen, das Zeit-
gefühl geht verloren.
Spricht man in diesem Fall von einem Fehler, einer Unterlassung,
einem aus Unwissenheit nicht erkannten Risiko? Eine Untersuchung
zeigt, dass Bettlägerigkeit selbst in der Regel überhaupt nicht hinter-
fragt wird. Im Gegenteil: Die Abläufe in stationären und ambulanten
Einrichtungen fördern Bettlägerigkeit nur allzu oft, die dann selbst
Risiko für die genannten schweren Folgeerkrankungen ist. Damit
ist Bettlägerigkeit in vielen Fällen eine vermeidbare pflegerische Kom-
plikation.
>
Abb. 1.2. Das »Schweizer-Käse-Modell« nach Reason veranschaulicht, wie einem
Fehler eine Kette von Fehlern vorausgeht (Modifiziert nach Reason, James: Human error,
Cambridge University Press 1990, S. 208).
.
1.2 · Auf der Suche nach Definitionen

8
Kapitel 1 · Fehler – was ist das eigentlich?
Bettruhe und Bettlägerigkeit sind zweierlei
»Patient« und »Bett« lassen sich meist in einem Atemzug nennen.
Denn bei Krankheit oder nach einem Unfall für eine kurze Zeit das
Bett zu hüten, scheint ein Beitrag zur Genesung zu sein. Dies wird aber
in der Medizin zunehmend hinterfragt. Zahlreiche Studien belegen
sogar, dass Betthüten eher schädlich als nützlich ist.
Im Gegensatz zur Bettruhe, die man hat, ist man bettlägerig. Bett-
lägerigkeit ist ein Seinszustand. Dieser unterscheidet sich von
der Bettruhe durch die lange Dauer, die ein Patient (ohne es zu
wollen) überwiegend im Bett verbringt, und birgt selbst Risiken
für seine Gesundheit bzw. sein Gesundwerden.
Unterscheiden lässt sich:
Leichtere Bettlägerigkeit: Der Patient verbringt die überwiegende
Zeit im Bett, verlässt es aber täglich für mindestens 4–5 Stunden.
Mittelschwere Bettlägerigkeit: Der Patient verlässt das Bett nur
noch, um zur Toilette zu gehen oder sich zu waschen.
Schwere Bettlägerigkeit: Der Patient steht überhaupt nicht mehr
auf.
Die Übergänge sind fließend
Im Prozess des Bettlägerigwerdens lassen sich 5 Phasen unterscheiden
[2]. Diese Phasen gehen schleichend ineinander über. An ihrem Ende
liegt ein Mensch »wie fest genagelt« im Bett, unfähig auch nur die Tasse
an den Mund zu heben oder sich die Haare zu kämmen.
Phase 1: Instabile Phase
Der Betroffene ist in seiner Bewegung kaum eingeschränkt, bewegt
sich aber sehr vorsichtig. Oft steckt die Angst, zu stürzen oder in der –
vielleicht engen – Umgebung anzustoßen, dahinter, dass körperliche
Aktivität mit diffusen Befürchtungen besetzt wird. Bereits gemachte
Sturzerfahrungen bestärken Unsicherheit und Furcht. Der Einsatz
von Hilfsmitteln, z. B. Gehstöcke oder Rollator, und/oder das Um-
stellen der Möbel zu Hause sollen Sturzgefahren mindern und Halt
geben.
>
4
4
4

1
9
Phase 2: Ereignis
Ein Krankenhausaufenthalt oder der Einzug in eine Pflegeeinrichtung
ist z. B. ein Ereignis, das Bettlägerigkeit ungewollt fördert. Viele Pa-
tienten glauben, sowie sie das ihnen zugewiesene Zimmer betreten,
in den Schlafanzug schlüpfen und sich ins Bett legen zu müssen. »Wo
soll ich mich denn sonst aufhalten?« meinen sie und: »Wenn der Arzt
kommt, muss ich doch da sein!« Im Krankenhaus im Bett zu liegen,
wird auch vom Pflegepersonal offenbar als normaler Zustand betrach-
tet, so dass Ermunterungen, das Bett zu verlassen, wenn man nicht
liegen muss, meist ausbleiben. In einer Befragung kam heraus, dass
manche Patienten, die noch in der Untersuchungsphase waren, nach
einer Woche unfähig waren aufzustehen – obwohl sie zunächst nur zur
Untersuchung ins Krankenhaus gekommen waren.
Der Einzug in eine Pflegeeinrichtung ist für viele Menschen das
zentrale Ereignis, das in dauerhafte Bettlägerigkeit mündet. Die
neue Umgebung wird als Wartesaal für die letzten Monate erlebt.
Betroffene ziehen sich immer weiter in sich zurück, geben sich auf,
weil sie keine Perspektive mehr für sich sehen. Auch hier die Frage:
Pflegefehler? Unterlassung? Oder in Wahrheit das ungelöste Prob-
lem einer Gesellschaft, die nicht weiß, wie man mit dem Altern
und alten Menschen umgeht?
Phase 3: Immobilität im Raum
In dieser Phase können die Betroffenen sich zwar noch bewegen, ver-
bringen aber die meiste Zeit im Bett oder auf einem Stuhl und können
schon bald nur noch mühsam ein paar Schritte laufen. Diese Phase
entscheidet meist über den weiteren Verlauf. Bleibt langes Liegen und/
oder Sitzen im Sessel, das nicht krankheitsbedingt ist, unbeachtet, und
werden keine Maßnahmen getroffen, um der drohenden Bettlägerig-
keit zuvorzukommen bzw. sie hinauszuzögern, setzt fast immer un-
weigerlich die nächste Phase ein.
>
1.2 · Auf der Suche nach Definitionen

10
Kapitel 1 · Fehler – was ist das eigentlich?
Praxistipp
Immobilität kann lange hinausgeschoben werden, wenn man die
Möbel im Raum so arrangiert, dass man sich gut abstützen kann,
wenn man z. B. zur Toilette geht oder das Fenster öffnen will. In
den Rollstuhl gesetzt zu werden, fördert nicht die Mobilität der
Betroffenen, denn auch im Rollstuhl sind sie ortsfixiert und schein-
mobil.
Häufig geschehen solche Fehler aus Zeitmangel, und der Zeitmangel
aus Personalmangel – sind es dann Pflegefehler? Unterlassungen? Un-
wissenheit?
Eine ältere Dame bekommt wegen Blasenschwäche einen Blasen-
katheter. An sich noch gut zu Fuß, schämt sie sich nun, mit dem Beutel
in der Hand auf dem Stationsgang hin- und her zu marschieren oder
sogar damit in das Patienten-Café zu gehen. Da bleibt sie doch lieber
im Zimmer, da sieht sie nur die Bettnachbarin, und die hat ebenfalls
einen Urinbeutel. Zunächst versucht sie noch, es sich auf dem Stuhl
an dem kleinen Tischchen bequem zu machen und Kreuzworträtsel zu
lösen. Dann aber schmerzt ihr zunehmend der Rücken, weil der Stuhl
unbequem ist. Also zieht sie sich ins Bett zurück – da liegt sie einiger-
maßen entspannt, nur mit dem Kreuzworträtselraten will es nicht so
recht gehen. Schließlich liegt sie nur noch, die Hände auf der Bett-
decke, vor sich hin träumend im Bett. In der Folgewoche kann sie es
ohne Hilfe nicht mehr allein verlassen.
Phase 4: Ortsfixierung
Menschen in dieser Phase können sich nicht mehr ohne Hilfe aus dem
Bett oder ihrem Sessel erheben und herumlaufen, sie sind »wie an-
gekettet, festgenagelt«. Diese Phase des Nicht-von-allein-Wegkönnens
ist entscheidend, denn sie mündet direkt in die letzte Phase, die Bett-
lägerigkeit. Selbst dann, wenn die Betroffenen im Sinne einer zu eng
gefassten Auffassung von Mobilisierung täglich kurz aus dem Bett he-
rausgesetzt wurden.
v

1
11
Praxistipp
Die wenigen Schritte zum Toilettenstuhl oder dem WC sind extrem
wichtig. Nicht nur aus Gründen der Mobilität, auch aus Gründen
der Würde. Fast alle Menschen gehen ein Leben lang selbstständig
zur Toilette. Das aufgeben zu müssen, bedeutet für die meisten
einen Verlust an Autonomie und Würde. Statt der Frage nach
einem Pflegefehler sollten hier die strukturellen Ursachen dafür
beleuchtet werden!
Phase 5: Bettlägerigkeit
Nun wird das Bett gar nicht mehr verlassen. Viele Patienten beschrei-
ben weitere Veränderungen, die sie in dieser Phase erleben:
es wird vermehrt über sie als mit ihnen gesprochen,
es wird »von oben nach unten« mit ihnen gesprochen.
Beides führt dazu, dass sie sich weniger ernst genommen fühlen. Hinzu
kommt, dass die feste Bettlägerigkeit keinen Rückzug erlaubt – alles
wird im Bett verrichtet, und für alles wird immer öfter Hilfe gebraucht.
Aus Rücksichtnahme auf die Verhältnisse und die Pflegenden
machen Bettlägerige oft keine Ansprüche geltend – man will das
Pflegepersonal »ja nicht dauernd stören«.
Zeitmangel und fehlende Konzepte
Bettlägerigkeit im Sinne eines unerwünschten Dauerliegens kann für
den Betroffenen katastrophale Folgen haben: nicht nur vermeidbare
Folgeerkrankungen, sondern auch die oft unwiederbringlich verlorene
Fähigkeit, aktiv seinen Alltag gestalten zu können.
Das Risiko, als Patient in einer Einrichtung zu einem bettlägerigen
Pflegebedürftigen zu werden, hat dabei ganz verschiedene Ursachen,
zum Beispiel:
v
4
4
>
1.2 · Auf der Suche nach Definitionen

12
Kapitel 1 · Fehler – was ist das eigentlich?
Faktor Unwissenheit
Vielen Pflegenden ist überhaupt nicht bewusst, dass Bettlägerigkeit
kein Schicksal ist, sondern oft die logische Folge mangelnder und
zunehmend eingeschränkter Mobilität. Der aus dem 19. Jahrhundert
stammende Irrglauben, »Betthüten« selbst sei eine Heilmaßnahme,
verstellt den Blick auf die schlimmen Folgen zu langen Betthütens. Die
zunehmende Schwäche eines Patienten, zu der es dadurch kommen
kann, wird nicht als Folge zu langen Liegens erkannt, sondern als deren
Ursache missverstanden.
Faktor fehlende Konzepte
Viele Pflegende kennen keinerlei Konzepte für die Mobilisierung von
Patienten. Aktivitäten, die sich dazu eignen sollen, den Patienten
»aus dem Bett zu bekommen«, taugen oft genug nur dazu, ihm Angst
zu machen. Da wird im Hauruck-Verfahren aus dem Bett gezerrt,
während der Kranke in dauernder Furcht ist, den Halt zu verlieren und
zu stürzen.
Faktor fehlende Zeit
Die Zeittaktung der ambulanten wie auch der stationären Pflege steht
oftmals im krassen Widerspruch zu dem, was es braucht, um Bettläge-
rigkeit vorzubeugen – ein paar Minuten für eine professionelle Mobili-
sation reichen einfach nicht aus!
Bettlägerigkeit vermeiden
Auf Seiten der (Alten-)Pflege gilt es, überholte Vorstellungen aufzu-
geben: Alt oder krank zu sein bedeutet nicht automatisch, fest das Bett
hüten zu müssen.
Unsere Sprache ist verräterisch, was unsere Vorstellungen von
Krankheit und Alter betrifft und die Hauptrolle, die das Liegen
dabei spielt: Da wird jemand »verlegt«, wartet auf »ein Bett« im
Krankenhaus, die Politik spricht von der »Liegedauer« im Kranken-
>
6
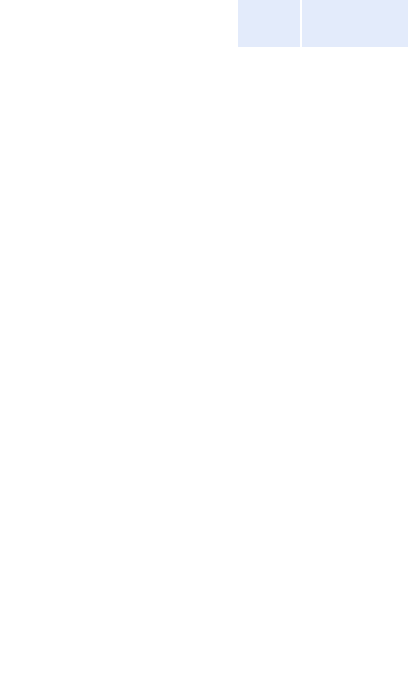
1
13
haus, das Krankenhaus von »Belegung« und seiner »Bettenzahl«.
All diese Begriffe tun so, als sei Liegen der Normalzustand bei Alter
oder Krankheit.
Während einerseits berücksichtigt werden muss, dass manche Men-
schen einfach liegen wollen (und es ihnen vielleicht sogar zur »Da-
seinsstrategie« wird), muss gegenwärtig sein, dass Bettlägerigkeit selbst
ein Gesundheitsrisiko ist, das vermieden oder lange, lange hinausge-
zögert werden sollte.
Praxistipp
Zeit für den Transfer: Wenn Patienten für Bewegung im Raum
Hilfe benötigen, braucht es Zeit und Geduld seitens der Helfer.
Hast kann dazu führen, dass Patienten befürchten, Pflegeper-
sonen hätten keine Zeit für sie. Und fehlende Technik wieder-
um kann für die Patienten schmerzhaft sein, wenn anstelle
eines sicheren und kompetenten Transfers gezerrt und geruckt
wird. Kinästhetik bietet hier ein geeignetes Transferkonzept.
Zeit für das An- und Ausziehen: Sich an- und auszukleiden ist
kein Luxus, sondern etwas, das Patienten ein Leben lang be-
herrscht haben – es sollte auch in Einrichtungen gefördert und
unterstützt werden.
Eigenaktivitäten, z. B. der Kauf einer Zeitschrift am Kranken-
hauskiosk, sollten aktiv unterstützt und nicht aus falsch ver-
standener Hilfsbereitschaft für den Patienten erledigt werden.
Es sei denn, er bittet darum, weil er etwas nicht selbst tun kann.
Biografiearbeit: Auch alte Menschen brauchen Sinn
Die psychischen Folgen von Bettlägerigkeit sind mit einem Verlust an
Lebenssinn zu beschreiben. Hier unterscheiden sich die verschiedenen
Einrichtungen ganz erheblich – Verwahrung statt Sinnerhaltung und
Sinngebung ist aber leider manchmal die traurige Realität. Dabei sind
Anknüpfungspunkte an das, was individuell als Sinn und damit Lebens-
freude spendend erlebt wird, da! Man findet sie, wenn man Betroffene
nach ihrer Biografie fragt und nach dem, was sie als sinnvolle Tätig-
v
4
4
4
1.2 · Auf der Suche nach Definitionen

14
Kapitel 1 · Fehler – was ist das eigentlich?
keiten in ihrem Leben beurteilen. Biografiearbeit kann Menschen nicht
nur vor Immobilität und deren Folgen schützen, sie kann sie sogar aus
ihrer Immobilität herauslocken – wenn sie an das anknüpft, was im Le-
ben Orientierung und Sinn gestiftet hat. Dass hier geeignete Konzepte
nicht gekannt, nicht umgesetzt oder schlicht in ihrer Bedeutung nicht
wahrgenommen werden: Soll das ein Pflegefehler sein? Oder zeigt es
nicht vor allem, dass eine Gesellschaft die Umkehrung der Alterspyra-
mide (noch) nicht verdaut und keine lebensweltlich wirksamen Sinn-
konstrukte dafür entwickelt hat? Sinngebung und Sinnerhaltung durch
Biografiearbeit kann Lösung im individuellen Fall sein. Wie eine Ge-
sellschaft als Ganzes in diesem Zusammenhang fällige Sinnfragen löst
– das bleibt weiterhin eine spannende Frage.
Fazit
Was ein »Pflegefehler« ist, muss aus der Pflege heraus definiert
werden. Am Beispiel der Bettlägerigkeit wurde diskutiert, wie eine
Reihe von Verkettungen und Missverständnissen dazu führt, dass
Menschen ungewollt und nicht durch ihren Gesundheitszustand
bedingt bettlägerig werden können, ohne dass der Begriff »Pflege-
fehler« richtig greifen würde.
4
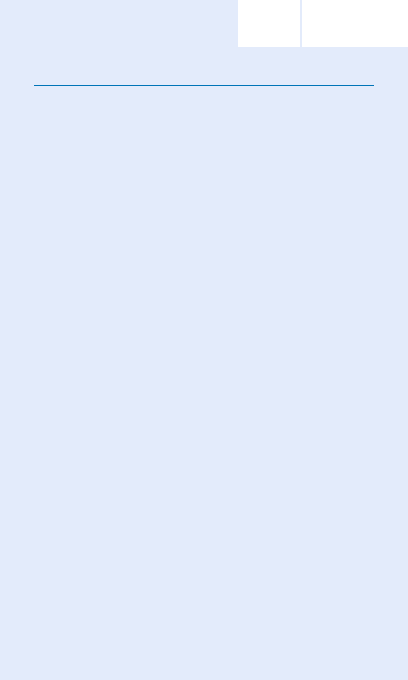
1
15
Meine Geschichte: Peter Bechtel
Vorsitzender des Verbandes Bundesarbeitsgemeinschaft Leitender
Pflegepersonen e.V. (BALK)
»Ich tat, wie mir geheißen – und hätte beinahe den Tod
eines Patienten herbeigeführt«
Hätte ich mich damals anders verhalten sollen, anders verhalten
können? Ja und Nein. Ich war im 2. Ausbildungsjahr und auf der Inten-
sivstation eingesetzt. Einer meiner Patienten war ein etwa 40-jähriger
alkoholkranker Mann, der über einen Infusiomaten Distraneurin i. v.
appliziert bekam. Distraneurin wirkt nicht nur gegen die Entzugs-
erscheinungen, es galt damals auch als Mittel der Wahl, um dem
gefürchteten Delirium tremens vorzubeugen. Bei der Übergabe
gab man mir den Auftrag, immer dann, wenn der Patient unruhig
oder wach würde, das Rädchen am Infusiomaten ein bisschen höher
zu drehen und kurzzeitig die Distraneurin-Dosis zu steigern und
anschließend das Rädchen wieder herunterzudrehen.
Auf einmal rannten alle
Ich tat, wie mir geheißen war. Und war zu Tode erschrocken, als
plötzlich das gesamte Personal der Intensivstation an das Bett des Pa-
tienten gerannt kam und Wiederbelebungsmaßnahmen – Intubation,
maschinelle Beatmung usw. – einleitete. Auf dem zentralen Über-
wachungsmonitor war zum Entsetzen meiner Kollegen plötzlich eine
Nulllinie erschienen, die den Atem- und Kreislaufstillstand meines
Patienten angezeigt hatte. Dank der Versiertheit und Erfahrenheit des
Pflegepersonals ist dem Patienten glücklicherweise nichts passiert, er
konnte buchstäblich ins Leben wieder zurückgeholt werden. Durch
einen Fehler, den ich aus Unwissenheit begangen hatte, hatte ich das
Leben des Patienten in Gefahr gebracht. Denn was ich nicht wusste
und worauf mich auch niemand vorbereitet hatte: Distraneurin kann
bei zu hoher Dosierung zum Atemstillstand und damit einem lebens-
bedrohlichen Zustand führen!
O
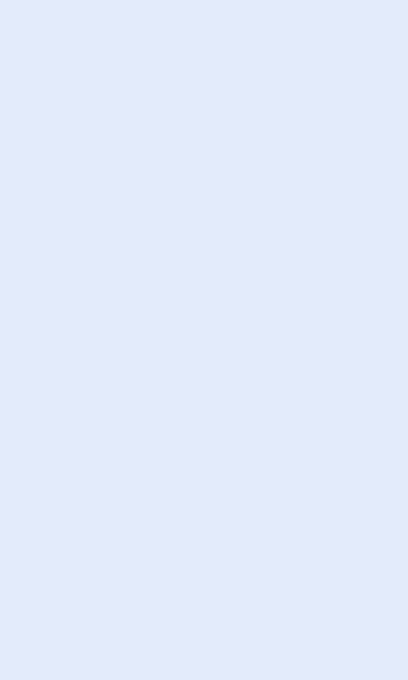
Verantwortung muss man nicht nur tragen wollen,
sondern auch können
Heute weiß ich das natürlich, aber damals, im 2. Ausbildungsjahr,
hätte man mich darauf vorbereiten müssen, mir sagen: Vorsicht! Das
kann ins Auge gehen! Stattdessen machte man mir Vorwürfe. Sicher-
lich hätte ich damals fragen sollen: Was kann schlimmstenfalls passie-
ren? Worauf muss ich achten, wenn ich die Dosis steigere? Ich hatte
Verantwortung übernommen, die ich eigentlich noch gar nicht tragen
konnte! War mir dessen nicht einmal bewusst!
Dieser Vorfall war sehr prägend für meinen weiteren Berufsweg.
Ich lernte daraus, niemals einfach zu machen, was man mir sagt,
einfach nur Anweisungen zu befolgen, sondern nachzufragen, mich
kundig zu machen, auch den Mut zu haben, Nein zu sagen. Und ich
habe gelernt, wie wichtig es ist, bei Fehlern nicht nur einfach nach
Schuldigen zu suchen, sondern sie zu analysieren, herauszufinden,
wie sie passieren konnten. Denn nur so kann man Fehler auch ver-
meiden.

2
17
Fehler dürfen nicht
individualisiert werden!
Zur Situation in den Pflegeberufen
Sabine Girts
Wenn von »Fehlern« und »Fehlermeidung« im Bereich der Gesund-
heitsversorgung gesprochen wird, richtet sich der Blick häufig auf
das persönliche Fehlhandeln einzelner, konkreter Akteure. Der Frage,
welche Bedeutung die Rahmenbedingungen für das Auftreten von
unerwünschten Ereignissen haben, soll mit diesem Beitrag nachge-
gangen werden. Grundlage dieser Ausführungen sind die Ergebnisse
des Pflege-Thermometers 2009, für das mehr als 10.000 Pflegekräfte,
die in Krankenhäusern in Deutschland arbeiten, zur beruflichen Situa-
tion und Patientenversorgung befragt worden sind. Diese Studie, die
von der B.-Braun-Stiftung unterstützt wurde, ist die größte zusammen-
hängende Befragung von Pflegekräften in Deutschland und wurde am
19.05.2010 in Berlin im Rahmen einer Pressekonferenz der Öffentlich-
keit vorgestellt.
2.1
Weniger Pflegekräfte – mehr Patienten
Zunächst die gute Nachricht: Seit 2008 wurde in den allgemeinen
Krankenhäusern erstmals seit 12 Jahren Personal im Bereich der Pflege
aufgestockt – 1.840 Vollkräfte wurden zusätzlich eingestellt. Das ent-
spricht 0,7%. Damit wurde zum ersten Mal seit 1996 der Personalabbau
in den Krankenhäusern gestoppt, der dazu geführt hatte, dass zwischen
1996 und 2008 ca. 50.000 Vollkraftstellen in der Krankenhauspflege
abgebaut worden sind. Und das ist die schlechte Nachricht, denn dieser
Stellenabbau beschreibt im Ergebnis nichts anderes als einen chroni-
schen Mangel an Pflegekräften im Krankenhaus.
2.1 · Weniger Pflegekräfte – mehr Patienten
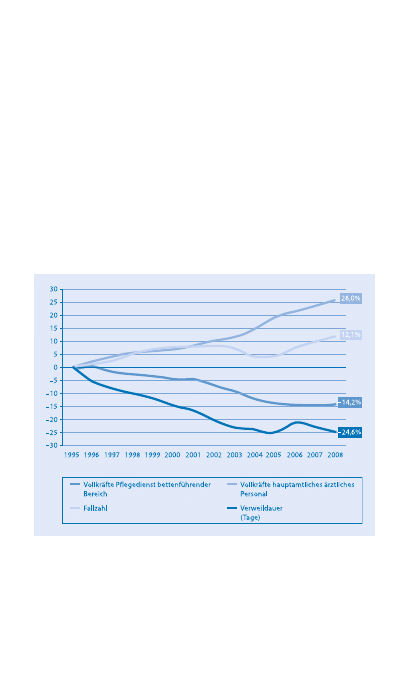
18
Kapitel 2 · Fehler dürfen nicht individualisiert werden!
Die logische Folgerung, dass vor dem Hintergrund des Abbaus an
Pflegepersonal immer weniger Personal immer mehr Patienten zu ver-
sorgen hat, gewinnt umso mehr an Bedeutung für den Alltag in der
Pflege, als die Zahl der behandelten Patienten im gleichen Zeitraum
kontinuierlich angestiegen ist: Lagen die Fallzahlen in den allgemeinen
Krankenhäusern 1995 noch bei rund 15,6 Millionen, waren es 2008
schon 17,5 Millionen. Ursache für diesen Anstieg um immerhin 12,1%
ist die kürzere Verweildauer der Patienten im Krankenhaus. Damit ist
allein von 2007 auf 2008 die von einer Pflegekraft zu betreuende Fall-
zahl von 59 auf 61,5 Fälle angestiegen.
Abb. 2.1. Entwicklung der Pflegekräfte zwischen 1995 und 2008. Zwischen 1995 und
2008 sinkt die Anzahl der Pflegekräfte um 14,2%. Im gleichen Zeitraum wird die Verweil-
dauer der Patienten um nahezu ein Viertel (24,6%) reduziert, während die Fallzahl um
12,1% ansteigt [14]. Zum Vergleich: Die Zahl der Ärzte hat um ein gutes Viertel (26%) zu-
genommen – eine Entwicklung, die auch Folge einer zunehmend verdichteten und inten-
siveren medizindiagnostischen Arbeit ist. Im Pflegebereich bedeutet die Zunahme ärzt-
licher Arbeit zumeist auch eine Zunahme von Betreuungsaufwand, der von einer sinken-
den Zahl an Pflegekräften zu leisten ist.
.
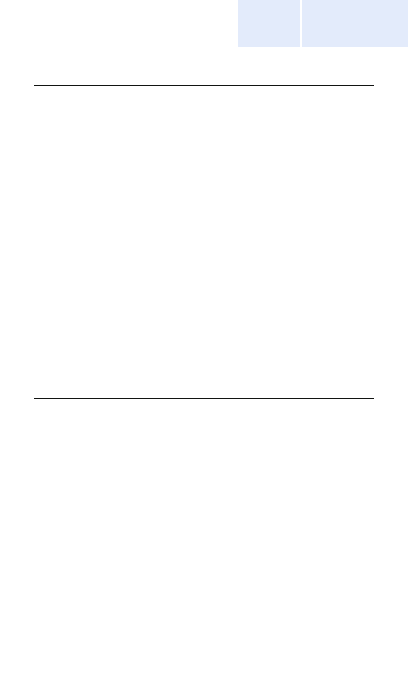
2
19
Personalabbau: Die Jungen trifft es am ehesten
Der Stellenabbau von 50.000 Vollkräften wurde zu einem Gutteil
dadurch realisiert, dass junge Menschen nach der Ausbildung nicht
übernommen wurden. Dadurch verschob sich die Altersstruktur im
Krankenhaus hin zu den älteren Pflegenden. In Zahlen ausgedrückt:
Während zwischen 2000 und 2008 die Zahl der Beschäftigten, die
unter 35 waren, um 50.000 (–15%) gesunken ist, hat sich in der
gleichen Zeit die Beschäftigtengruppe der über 50-Jährigen nahezu
verdoppelt auf 171.000 Mitarbeiter!
Die stetig anwachsende Arbeitsbelastung bzw. Überforderung ver-
suchen offenbar viele Pflegende durch eine Reduzierung ihrer Arbeits-
zeit zu kompensieren: Waren es im Jahr 2000 noch 34,71% Teilzeitbe-
schäftigte, so hat sich diese Zahl 2008 auf 45,7% erhöht. Und 2009 gab
immerhin jede vierte für das Pflege-Thermometer befragte Pflegekraft
an, eine Reduzierung ihrer Arbeitszeit aufgrund von Überforderung
anzustreben.
Dauerbelastung die Regel und nicht die Ausnahme
Welche Folgen Stellenabbau und steigende Arbeitslast für die Beschäf-
tigten in der Gesundheits- und Krankenpflege haben, lässt sich an
objektiven Daten ablesen: So belegen Auswertungen verschiedener
Krankenkassen und Rentenversicherungsträger, dass Pflegekräfte in
der Gruppe der über 50-Jährigen etwa doppelt so häufig wie andere
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte aufgrund psychischer und
physischer Erkrankungen zeitweilig arbeitsunfähig werden. Das
Gleiche gilt für Frühberentung inklusive Erwerbsminderung.
Das Pflege-Thermometer 2009 führt als objektive Belastungsdaten
auf:
Zunahme der zu betreuenden Patienten,
Personalabbau,
Überstunden,
Einspringen an (eigentlich freien) Wochenenden und Feiertagen.
4
4
4
4
2.1 · Weniger Pflegekräfte – mehr Patienten

20
Kapitel 2 · Fehler dürfen nicht individualisiert werden!
Jede/r Fünfte ist »hochbelastet«
Die Zahl der in den letzten 6 Monaten geleisteten Überstunden bezif-
fern 40% der Befragten mit 46–70! Umgerechnet entspricht das 15.000
zusätzlichen Vollzeitkräften! Mehrheitlich können die Überstunden
nicht zeitnah wieder abgebaut werden. Vor diesem Hintergrund haben
die Forscher des Pflege-Thermometers 2009 eine Untergruppe von so
bezeichneten »hochbelasteten« Pflegenden identifiziert, deren Arbeits-
alltag direkt von einerseits dem Stellenabbau und andererseits der
Zunahme der Patientenzahlen bestimmt wird. Hinzu kommt, dass die
Überstunden nicht zeitnah durch Freizeit ausgeglichen werden
können. Jede fünfte Pflegeperson muss zu der Untergruppe der Hoch-
belasteten gerechnet werden!
»Bei dieser Gruppe (der Hochbelasteten, Anm. d. Autorin.) lassen sich
in der Folge Unterschiede zur Gesamtgruppe hinsichtlich der Patienten-
versorgung und -sicherheit aufzeigen,« heißt es im Pflege-Thermometer
2009 [32].
Pflegeberufe verlieren an Attraktivität
Zu dem wirtschaftlich begründeten Stellenabbau hinzu kommt ein
steigender Trend zu einem nachlassenden Interesse am Pflegeberuf.
Entsprechend ist auch die Nachfrage nach Ausbildungs- und Arbeits-
plätzen rückläufig. Ursachen für die sinkenden Bewerberzahlen im
Ausbildungsbereich und um Arbeitsplätze werden nicht nur in der
demografischen Entwicklung (überalterte Bevölkerung und Geburten-
rückgang) gesehen. Auch die unattraktiven Arbeitsbedingungen und
ein verbesserungsbedürftiges Image der Pflegeberufe in der Bevölke-
rung werden dafür verantwortlich gemacht.
Die Personal- und Ausbildungssituation der Pflegeberufe wird sich
also in den nächsten Jahren weiter dramatisch zuspitzen. Die zuneh-
mende Knappheit von beruflich Pflegenden wird Folgen für die Sicher-
stellung der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung haben. Unsere
Gesellschaft erwartet aber auch bei immer knapper werdenden Res-
sourcen eine optimale Versorgung zum günstigen Preis.
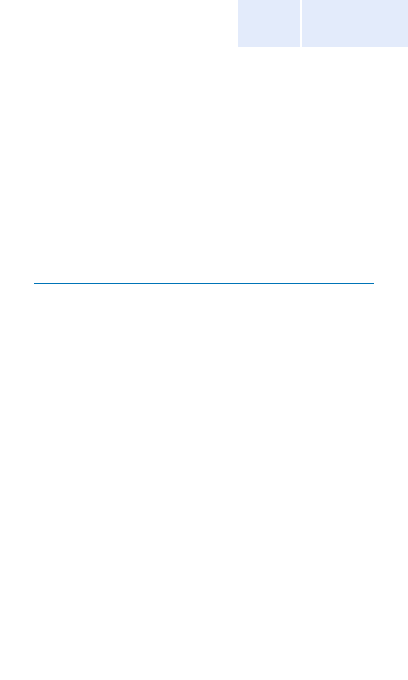
2
21
In den Krankenhäusern wurden in den letzten 15 Jahren rund
50.000 Vollkraftstellen abgebaut. Mit einem von der Bundesregierung
aufgelegten Pflege-Förderprogramm sollen in den nächsten drei Jahren
bis zu 17.000 zusätzliche Pflegepersonalstellen in den Krankenhäusern
geschaffen werden, die zu 90% durch die Krankenkassen finanziert
werden können. Das bedeutet, dass heute vakante Stellen jetzt noch
nicht besetzt werden können. Die Folge ist ein hoher Bedarf an pflege-
rischem Personal, der zu einem scharfen Wettbewerb um qualifizierte
Pflegekräfte führt.
2.2
Stellenabbau: Patienten gefährdet,
Fehlerrisiko erhöht
Wirtschaftliche Ziele, die ja auch jede Gesundheitseinrichtung hat,
werden über einen quantitativen Leistungsdruck auf die Mitarbeiter
der Pflegeberufe versucht zu realisieren. Die Ergebnisse des Pflege-
Thermometers 2009 zeigen eindrucksvoll, wie sich das auf die Qualität
der Patientenversorgung und -sicherheit auswirkt. Der Studie zufolge
stellen die festgestellten Mängel mittlerweile den Regelfall dar. Jeder
weitere Abbau in der Pflege verschärft also die Gefährdung der Patien-
tensicherheit und erhöht das Fehlerrisiko.
Neben den berechtigten Aspekten der Wirtschaftlichkeit von
Gesundheitseinrichtungen wurden die Bedürfnisse der für die direkte
pflegerische Versorgung verantwortlichen und zuständigen Personen
komplett außer Acht gelassen. In Anbetracht des guten Willens und
der Einsatzbereitschaft der Pflegenden, ihr Bestes für Patienten oder
Bewohner in unserem Gesundheitswesen geben zu wollen, erscheint
dies als paradox. Das Pflege-Thermometer stellte unter anderem fest,
dass »die verbliebenen Pflegekräfte aber versuchen, die Versorgung für
alle Patienten so gut wie irgend möglich aufrecht zu halten.« [14].
2.2 · Stellenabbau
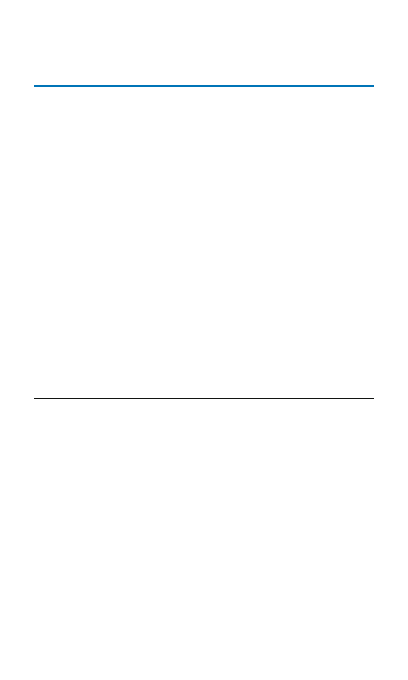
22
Kapitel 2 · Fehler dürfen nicht individualisiert werden!
2.3
Welche Lösungen werden diskutiert?
Der Gesundheitswirtschaft stehen vielfältige Lösungskonzepte zu
Verfügung, um ihre wirtschaftlichen Ziele zu realisieren. Beispielsweise
die Umsetzung von Qualitätsmanagement und die Einführung von
Expertenstandards.
Als grundlegende Voraussetzungen für die Erreichung dieser Ziele
sind allerdings ständige Fort- und Weiterbildungen notwendig, weil
sich die Ziele dauerhaft nur mit Hilfe gut ausgebildeter Mitarbeiter
erreichen lassen. Und: Es bedarf aussagekräftiger Studien, um die Um-
setzung und Auswirkungen von Weiterbildungsinhalten bewerten zu
können. Das Pflege-Thermometer 2009 weist auf diesen Umstand hin:
Es gibt zum Beispiel keine Daten darüber, welche Kliniken Wund-
manager einsetzen und mit welchem Erfolg für die Wundversorgung
[14]. Zu klären wäre hier auch, inwieweit Fortbildungsinhalte aufgrund
der prekären Personalsituation überhaupt in der Pflegepraxis greifen
können.
Ressourcen müssen zur Verfügung gestellt werden
Damit die Strategie einer fachgerechten pflegerischen Versorgung und
die damit verbundenen Ziele überhaupt umgesetzt werden können,
müssen Politik und ihre verantwortlichen Verhandlungspartner die
nötigen Ressourcen nicht nur ständig ermitteln, sondern auch zur
Verfügung stellen. Außerdem ist es heute notwendiger denn je, die er-
forderlichen Grundinformationen über pflegerische Handlungsfelder,
Berufsbilder und Ausbildungsgänge zentral aufzubereiten und in
einem Gesamtkonzept zu bündeln. Andernfalls besteht die Gefahr,
dass aufwändige Konzepte fehlgesteuert verpuffen.
Pflege braucht Wertschätzung und angemessene Honorierung
Noch mehr Menschen als heute werden in Zukunft auf eine pflege-
rische Versorgung angewiesen sein. Pflegerische Tätigkeiten sind hoch
komplex. Leider werden sie (nicht nur) in der Öffentlichkeit als eher
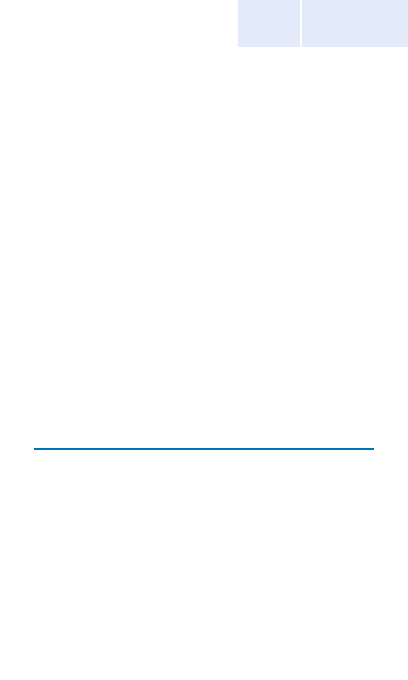
2
23
persönlich individuelle denn als fachliche Leistungen verzerrt dar-
gestellt. Damit aber befürchtete und bereits öffentlich thematisierte
Krisen verhindert werden können, sollte ein wichtiges gesellschaft-
liches Ziel werden, die entsprechende Wertschätzung, das gewünschte
Image der Pflegeberufe und die damit verbundene angemessene Hono-
rierung zu unterstützen.
Zudem muss beachtet werden, dass der demografische Wandel
sogar doppelt im Gesundheitswesen angekommen ist: Einerseits finden
sich mehr ältere und hochbetagte Patienten und Bewohner in den
Gesundheitseinrichtungen. Andererseits steigt, wie oben gezeigt, der
Altersdurchschnitt der Belegschaften stetig an. Wie in der Gesamtwirt-
schaft werden auch im Gesundheitswesen künftig mehr über 50-Jäh-
rige als unter 30-Jährige beschäftigt sein; schon heute sind nahezu die
Hälfte der beruflich Pflegenden über 45 Jahre alt. Der Verbleib im
Pflegeberuf so lange wie möglich wird über die Aufrechterhaltung des
Gesundheitswesens genauso mitentscheiden wie eine ausreichende
Zahl von Berufseinsteigern. Attraktive Arbeits- und Organisationsbe-
dingungen werden dafür genauso eine Rolle spielen wie eine Strategie
zur Erhaltung und Förderung der Arbeitsbewältigungsfähigkeit des
Personals.
2.4
Bei jedem Fehler ist auch das System gefordert
Jeder Fehler ist einer zu viel. Personalabbau, stetig steigende Arbeits-
belastung und schon 20% »hochbelastete« Pflegeberufler machen mehr
denn je dringend, die Fehlerverursachung nicht zu individualisieren!
Was zusätzlich zu einer angemessenen personellen Ausstattung ge-
braucht wird, sind Instrumente zur Arbeitsgestaltung, Gesundheitsvor-
sorge, Unternehmenskultur, Personalentwicklung und Arbeitsbewälti-
gungsfähigkeit, innerhalb derer Nachdenken, Umsetzen und Wider-
spruch bei Fehlerstrategien möglich sein müssen.
Jeder weiß heute, dass ohne Fehler keine Entwicklung und kein
Lernen möglich ist. Ein Fehler ist eine Interpretation, eine Frage der
gewählten Perspektive. Die Tatsache, dass den meisten Fehlern ganze
2.4 · Bei jedem Fehler ist das System gefordert
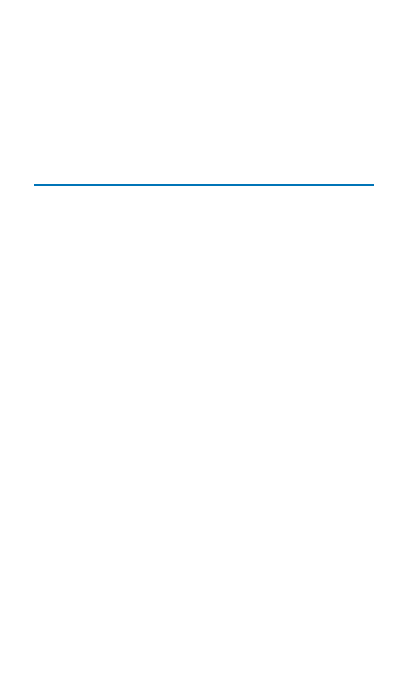
24
Kapitel 2 · Fehler dürfen nicht individualisiert werden!
Kaskaden unerwünschter Vorfälle vorausgehen, lässt ahnen, wie
schlecht man beraten wäre, würde man sich nach dem Motto »den
Letzten beißen die Hunde« nur auf den »sichtbaren«, benennbaren
Fehler am Ende einer Kette konzentrieren.
2.5
Wer aufhört zu jammern, handelt
Hat man in seinem Beruf Erfolg, gewinnt man Selbstbestätigung, Mut
und Energie. Erfährt man eine Niederlage, können aus dieser Erfah-
rung Anregungen für bessere Ideen hervorgehen. Gewinnt diese Sicht-
weise die Oberhand, kann man nicht nur aus Fehlern lernen, etwas
besser zu machen. Man bekommt auch das Selbstvertrauen, sich kennt-
nisreich und kompetent für Bedingungen einzusetzen, die Fehler-
risiken mindern und damit Kranke und Verletzte schützen. Die beruf-
liche Situation, so wie sie jetzt ist – Personalnot, Arbeitsüberlastung –,
ist von den meisten von uns so nicht unbedingt gewählt. Aber für die
Schlüsse, die wir daraus ziehen, sind wir selbst verantwortlich. Gerade
hier liegt die große Chance: Wer aufhört zu jammern, handelt. Wer
bewusst wählt, übernimmt Verantwortung für alle Konsequenzen.
Wer Verantwortung übernimmt, übernimmt die Regie für sein Leben –
das ist nichts anderes als Freiheit [31]. Die Verantwortung für die
eigene Motivation und Leistungsbereitschaft im Pflegeberuf muss jeder
selbst für sich übernehmen [32].
Fazit
Pflege ist ein zukunftsorientierter Beruf, wenn diejenigen, die ihn
ausüben, das professionell mit »Herz und Seele« tun. Eine Vielzahl
von Bedingungen, vom Stellenabbau über Personalnot bis hin zu
Fragen des Image der Pflege in der Öffentlichkeit, fördern das
Risiko von pflegebedingten Fehlern. Hier gilt es, nicht zu resignie-
ren, sondern sich aktiv und selbstbewusst für Verbesserungsmaß-
nahmen einzusetzen. Dem Pflegeberuf selbst gehört die Zukunft!
4
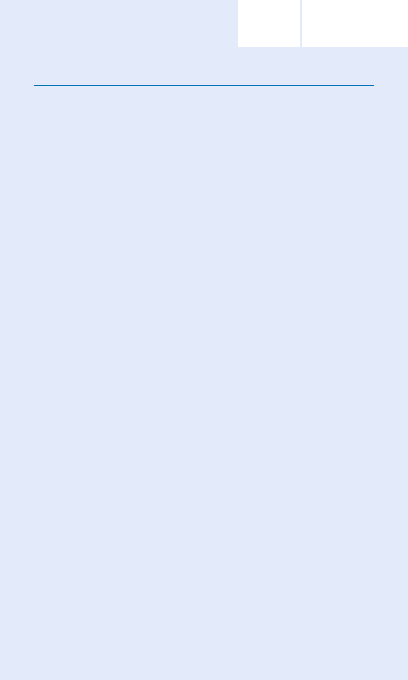
25
Meine Geschichte: Martina Klenk
Präsidentin des Deutschen Hebammenverbandes e.V.
»Hebammen und Fehler?!? – Das geht gar nicht!«
Gleich vorab: Natürlich passieren Hebammen auch Fehler! Und natür-
lich ist es sehr wichtig, Fehler frei und offen eingestehen zu können.
Denn Fehler sind eine Ressource – nämlich zu lernen, wie man es
besser machen kann.
Wir Hebammen sind in den letzten Jahren in eine schlimme
Zwickmühle geraten. Gerade zur Zeit, wo langwierige Verhandlungen
klären sollen, wie sich Hebammen für den Schadensfall vernünftig
und ausreichend absichern können, scheint eine offene Debatte über
Fehler als Beitrag zu einer so dringend notwendigen Fehlerkultur in
Deutschland schwieriger denn je.
Die Gründe dafür liegen nur auf den ersten Blick bei den Heb-
ammen und ihrer Arbeit. Bei genauerem Hinschauen zeigt sich,
dass der Konflikt zwischen eventuell folgenreichen Fehlern auf Seiten
der Hebammen und der Frage nach dem Versicherungsschutz unserer
kleinen Berufsgruppe in Wahrheit ein gesellschaftliches Problem
enthüllt.
Beginnen wir der Reihe nach: Jede in einem Gesundheitsberuf
tätige Person – ob eine Ärztin, ein Pfleger oder eben eine Hebamme –
braucht eine vernünftige rechtliche und finanzielle Absicherung
für den Fall, dass ein Mensch aufgrund eigenen Fehlverhaltens zu
Schaden kommt. Noch 1992 reichte für diesen Versicherungsschutz
eine in Euro umgerechnete Summe von 187,95€, die eine freiberuf-
liche Hebamme im Jahr zu entrichten hatte. Bis 2009 ist der Versiche-
rungsbeitrag um mehr als das 12-fache angestiegen auf 2.370 € im
Jahr! Eine Summe, die in keinem Verhältnis mehr steht zum Einkom-
menszuwachs einer freiberuflichen Hebamme.
O
2
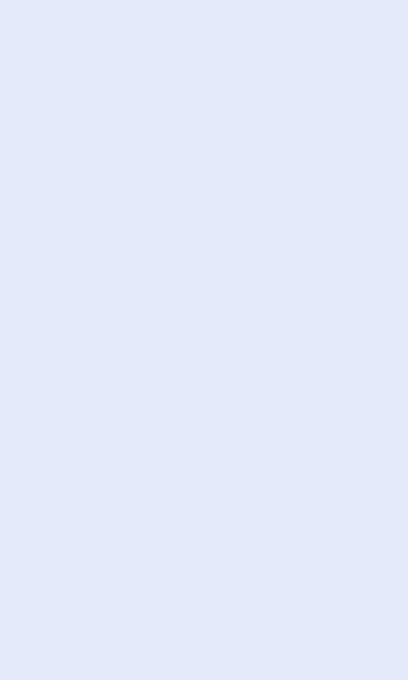
Hebammen können die Folgen gesellschaftlichen Wandels
nicht allein tragen
Machen Hebammen mehr Fehler als früher? Sind die Kindseltern im
Schadenfall streitlustiger geworden? Hebammen machen nicht mehr
Fehler als früher. Aber Eltern klagen heute mehr. Der Grund liegt
außerdem in den Fortschritten von Medizin und Medizintechnik, die
als Kehrseite Schadenssummen in horrende Höhen treiben. Kinder,
die aufgrund eines geburtshilflichen Fehlers zu Schaden gekommen
sind, leben heute sehr viel länger, als das noch vor einigen Jahren der
Fall war. Vielleicht mit lebenslänglichen gesundheitlichen Einschrän-
kungen, die dann Jahrzehnte lang finanziert werden müssen und
auch sollen. Und das will – und kann! – kaum eine Versicherung so
ohne weiteres tragen. Aber auch nicht eine so vergleichweise kleine
Berufsgruppe wie wir! 20.000 Hebammen in Deutschland können
nicht allein dafür geradestehen, dass der begrüßenswerte und er-
freuliche Gewinn von mehr und besseren Jahren auch dann, wenn es
bei der Geburt zu einem Schaden gekommen ist, finanziert werden
kann. Hier müssen Regelungen her, die auch von den Hebammen
zu tragen sind – nicht zuletzt, um wieder zu einem offenen und fairen
Diskurs über Fehler- und Risikomanagement zu finden, der für die
Hebammen genauso wichtig ist wie für alle anderen Gesundheits-
berufe.

3
27
Hohe Arbeitsbelastungen:
Was Sie tun können
Gertrud Stöcker
Das Ansehen, das die Krankenpflege hierzulande genießt, ist ausge-
sprochen hoch: 92 Prozent der Deutschen geben an, ihr Vertrauen in
diese Berufsgruppe sei »sehr hoch« oder »ziemlich hoch«. Nur Feuer-
wehrleute schneiden noch ein kleines bisschen besser ab, Ärzte und
Apotheker dagegen rangieren etwas unterhalb der Krankenpflege [12].
Aber wie sehen Angehörige dieser Berufsgruppe selbst ihre Situa-
tion? Wie erleben sie selbst den Alltag in der Pflege? Der Deutsche
Berufsverband für Pflegeberufere (DBfK) hat dazu zwischen Oktober
2008 und Februar 2009 eine Umfrage bei Pflegekräften durchgeführt.
Die Ergebnisse sind alles andere als rosig [13]:
Knapp 70% geben an, die Pflegequalität in den Krankenhäusern
habe in den zurückliegenden 12 Monaten abgenommen.
Mehr als
4
/
5
, nämlich 83,2%, sind der Meinung, dass die Perso-
nalausstattung nicht ausreiche.
Fast die Hälfte aller Befragten (45,5%) berichten, dass sie selten bis
nie eine ungestörte Pause nehmen könnten.
Auch die innerbetrieblichen Abläufe zeigen der DBfK-Umfrage zufolge
deutliche Defizite zum Beispiel im Bereich der Kommunikation:
Rund 75% der Befragten halten den Informationsfluss für häufig
bis oft unzureichend.
44,1% berichten, Informationen mehrmals die Woche verspätet zu
bekommen.
Mehr als
2
/
3
der Befragten, (67,9%) erhalten häufig bis oft unklare
Anweisungen.
4
4
4
4
4
4
3 · Hohe Arbeitsbelastungen
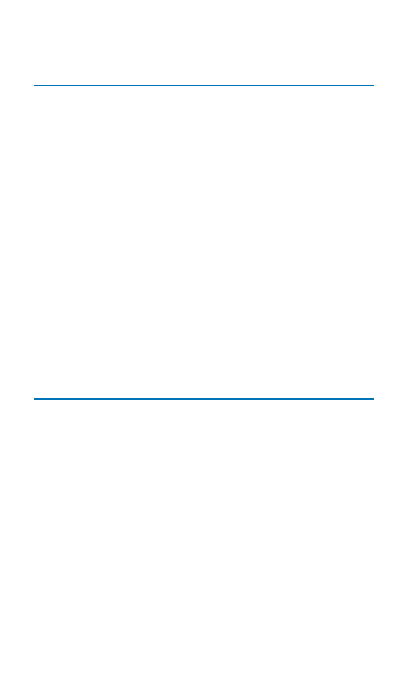
28
Kapitel 3 · Hohe Arbeitsbelastungen: Was Sie tun können
3.1
Leider nicht die Ausnahme: Mängel in der Pflege
Die Zunahme der Arbeitsbelastung durch den massiven Stellenabbau
im Bereich der Krankenhauspflege – seit 1996 ist die Vollzeitstellenzahl
um 55.000 zurückgegangen – belastet die Beschäftigen und gefährdet
eine qualitativ hochwertige Versorgung der Patienten. Zu diesen alar-
mierenden Ergebnissen kommt das Deutsche Institut für angewandte
Pflegeforschung e.V., kurz dip, in seinem Pflege-Thermometer 2009
[14]. Prof. Michael Isfort, der Leiter der Studie, sieht durch den Stellen-
abbau in der Krankenhauspflege die Versorgung der Patienten in Ge-
fahr – »Mängel in der pflegerischen Versorgung (sind) nicht mehr die
Ausnahme, sondern die Regel« [28]. Ausdrücklich lobt Isfort die Pflege-
kräfte, die »die Versorgung der Patienten trotz der schwierigen Bedin-
gungen so gut wie irgend möglich aufrecht zu erhalten« suchten [28].
Die Frage nach den Ursachen und möglichen Vermeidungsstra-
tegien von Fehlern ist damit v. a. auch eine Frage der Versorgungskapa-
zität und der Arbeitsbelastung der einzelnen Akteure.
3.2
Werden Sie aktiv!
Pflegekräfte werden in aller Regel nicht gefragt, wenn es um die perso-
nelle Ausstattung der Einrichtung oder der Station, auf der sie arbeiten,
geht. Das kann man zu Recht beklagen, aber Klagen hilft in der ganz
konkreten Situation meist nicht weiter. Es verbessert nicht die Versor-
gung der Patienten und es mindert nicht die Arbeitsbelastung der
Akteure (
7
Top im Job: Und jetzt Sie
;
7
Top im Job: Nicht ärgern, ändern
).
Der DBfK empfiehlt deshalb, sich aktiv mit der zu hohen Arbeitslast
auseinanderzusetzen und nach Verhaltensregeln zu suchen, die sowohl
den Patienten als auch das Pflegepersonal schützen. Hinweise dazu
finden sich auf unserer Website [13]. Meine weiteren Ausführungen
möchte ich an diesen Verhaltensregeln orientieren.

3
29
Dauerbrenner Zeitdruck
Personalknappheit und in der Folge zu hohe Arbeitslast wird meist
»intuitiv« durch eine Steigerung des Arbeitstempos auszugleichen ver-
sucht. 100% der anfallenden Arbeit in 80% (oder weniger) der dafür
nötigen Zeit zu bewältigen führt leicht dazu, dass Pflegestandards nicht
eingehalten und Hygienevorschriften und Sicherheitsmaßnahmen ver-
nachlässigt werden. Sich Informationen zwischen Tür und Angel oder
auf dem Gang zuzurufen prädestiniert geradezu zu Missverständnis-
sen, an deren Ende dann ein unerwünschtes Ereignis, ein Fehler stehen
kann. Zeitdruck gefährdet die Patienten und schadet den Pflegekräften,
die deswegen oftmals auf Hilfsmittel oder rückenschonende Arbeits-
weisen verzichten – »es muss halt schnell gehen!«
Die Verantwortung liegt bei Ihnen!
Bitte denken Sie daran: Die Durchführungsverantwortung bei jeder
Tätigkeit liegt in Ihrer Hand – werden Pflegestandards nicht eingehal-
ten, kann das für Sie arbeitsrechtliche und strafrechtliche Folgen haben!
Deswegen:
Egal wie knapp die Zeit ist: Halten Sie Pflegestandards ein! Niemand
kann Sie zwingen, aus Zeitnot bei der Einhaltung von Standards Ab-
striche zu machen.
Unterstützen Sie Ihre Kollegen bei der Einhaltung von Standards,
weisen Sie sie ggfs. in bestehende Standards ein.
Schüler/-innen bzw. Studierende sollten ansprechen, wenn sie beob-
achten, dass auf Station praktizierte Pflege und in der Schule/Hoch-
schule gelehrte Pflegestandards auseinanderklaffen – im Pflegeteam
und in der Schule/Hochschule.
4
4
3.2 · Werden Sie aktiv!

30
Kapitel 3 · Hohe Arbeitsbelastungen: Was Sie tun können
Dauerbrenner fehlende Pausen
In zwei Patientenzimmern geht die Klingel, das Telefon läutet und im
Gang stehen Angehörige, die eine Frage haben. Wie soll man da an
Pause denken?! Mehr als 6 Stunden ohne Erholungspause durchzuar-
beiten, deckt sich nicht mit dem Arbeitszeitgesetz.
Das Arbeitszeitgesetz sieht nämlich mindestens 30 Minuten Ruhepause
bei einer Arbeitszeit von 6–9 Stunden und mindestens 45 Minuten bei
mehr als 9 Stunden vor! Deswegen:
Treffen Sie Absprachen mit Ihren Kollegen, wer wann in die Pause
geht. Und: halten Sie sich daran. Bedenken Sie, dass vernünftige
Pausenregelungen sowohl Ihnen selbst als auch den Patienten
dienen, weil eine gestresste Pflegeperson nicht unbedingt eine
bessere Pflegeperson ist.
Auch im Nachtdienst zum Beispiel haben Sie Anrecht auf eine
Pause. Ihr Arbeitgeber ist verpflichtet, sich um eine entsprechende
Pausenablösung zu kümmern.
Verbringen Sie Ihre Pause wenn möglich nicht auf Station.
Informieren Sie Ihre Vorgesetzten, wenn Sie keine Pause nehmen
konnten. Diese Zeit muss zusätzlich vergütet werden.
Lassen Sie sich zur dauerhaften »Lösung« des Pausenproblems nicht
auf den Pakt »Bezahlte-Mehrarbeit-gegen-Pause« ein. Das schadet
auf Dauer der Gesundheit und hilft, strukturelle Personalknappheit
zu verfestigen.
Dauerbrenner Überstunden
Kennen Sie das unangenehme Gefühl, nicht alle Arbeit geschafft zu
haben und übrig Gebliebenes an die nachfolgende Schicht weiter-
reichen zu müssen? Viele Pflegekräfte »lösen« dieses Problem, indem
sie mehr und länger arbeiten. Arbeitsüberlastung ist aber eine der
wesentlichen Ursachen für das Zustandekommen von Fehlern.
Deswegen:
4
4
4
4
4

3
31
Machen Sie sich nicht selbst dafür verantwortlich, wenn Arbeit
liegen bleibt: Es ist nicht Ihre Schuld, wenn Kollegen ausfallen
und/oder die Station permanent überbelegt und personell unter-
versorgt ist.
Lassen Sie sich moralisch nicht unter Druck setzen, immer wieder
einzuspringen.
Gehen Sie offensiv mit Mehrarbeit und Überstunden um, sprechen
Sie das Thema an und fordern Sie von Ihren Vorgesetzten eine
Lösung dafür.
Dauerbrenner körperliche Belastungen
Wussten Sie, dass Pflegende häufiger schwerer heben als Bauarbeiter
(68% der Pflegenden, 54% der Bauarbeiter)? Dass z. B. Rückenschmer-
zen wie auch andere Beschwerden durch Muskel- und Skeletterkran-
kungen in den Pflegeberufen viel häufiger sind als in anderen Berufen?
Oder dass 27% der Pflegenden angeben, oft bis an die Grenzen ihrer
Leistungsfähigkeit gehen zu müssen? Zu diesen Ergebnissen ist näm-
lich die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (baua)
2007 gekommen [13]. Ganz abgesehen von den gesundheitlichen
Folgen der körperlichen Belastungen für die Pflegenden, können
falsche Hebetechniken zum Beispiel auch ein Risiko für die Patienten
sein, wenn etwa beim Lagern von Bettlägerigen dadurch Scherkräfte
entstehen, die die Dekubitusgefahr an den aufliegenden Körperteilen
erhöhen. Deswegen:
Nutzen Sie die zur Verfügung stehenden Hilfsmittel. Auch dann,
wenn die Zeit knapp ist.
Lassen Sie sich zeigen, wie Hilfsmittel richtig und das heißt z. B.
rückenschonend eingesetzt werden.
Geben Sie unverzüglich an Ihre Vorgesetzten weiter, wenn Hilfs-
mittel defekt sind oder sogar fehlen.
Nehmen Sie an Fortbildungsveranstaltungen, die schonende Ar-
beitsweisen zum Thema haben, teil.
Nehmen Sie Ihre Gesundheit ernst (
7
Top im Job: Nicht ärgern, ändern
)!
4
4
4
4
4
4
4
4
3.2 · Werden Sie aktiv!
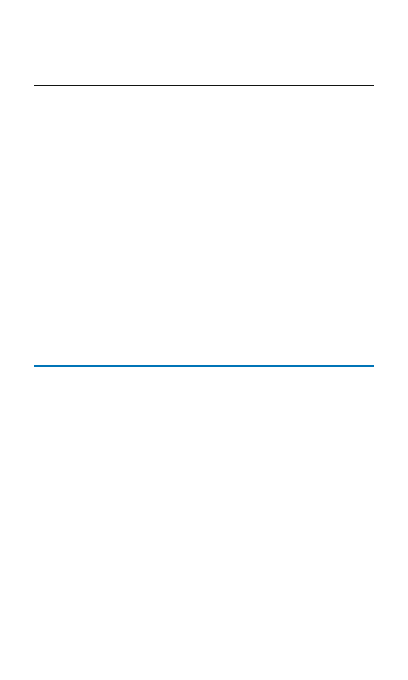
32
Kapitel 3 · Hohe Arbeitsbelastungen: Was Sie tun können
Psychische Belastungen
Hoher Arbeits- und Leistungsdruck, hohe Anforderungen an sich
selbst (z. B. niemals Fehler machen zu dürfen), eine fehlende Fehler-
kultur und Spannungen im Team können ebenso Quellen für psy-
chische Belastungen sein wie die Konfrontation mit dem Leid anderer.
Den Kummer »einfach« herunterzuschlucken, ist auf Dauer aber keine
Lösung! Deswegen:
Treten Sie im Team dafür ein, dass die psychischen Aspekte der
Arbeit nicht unter den Tisch gekehrt werden. Über eigene Hilflosig-
keit und Leiden am Leiden anderer muss man sprechen können.
Fordern Sie Fallbesprechungen und Supervisionen ein, wenn sie
noch nicht zu Ihrem Pflegealltag gehören.
Tauschen Sie sich im Team über Ihr Berufsverständnis aus: Was
sind Ihre Werte? Welche Konflikte können dadurch entstehen? etc.
3.3
Darüber reden heißt nicht petzen
Gerade wenn man noch Lernender ist und noch nicht so »sattelfest«
fällt es schwer, auf die genannten »Dauerbrenner-Probleme«, aber auch
genauso auf die psychischen Herausforderungen eine eigene Antwort
zu finden. Eine Antwort, die nicht so ausfällt, dass man, z. B. aus Angst
vor schlechten Noten »halt mitmacht«. Denn alle genannten Probleme
können dazu beitragen, dass auch die Qualität der Ausbildung leidet.
Unter Druck und ohne Pause können Arbeitsschritte oft nicht genauso
gezeigt und erklärt werden, wie das in der Ausbildung nötig ist. Wenn
man sich selbst fachlich noch nicht fit fühlt, neigt man ganz schnell
dazu, etwas als eigenes Versagen zu deuten, nur weil man es noch nicht
kann. Bitte bedenken Sie, dass Sie ein Recht auf eine gute Ausbildung
haben. Und das bedeutet auch, dass die examinierten Kollegen sich für
Sie Zeit nehmen können. Sprechen Sie die Stationsleitung auf Ihre
Beobachtungen an. Teilen Sie Versorgungsengpässe auch in Ihrer
Schule/Hochschule mit. Auch wenn Sie das Gefühl haben, pflegerische
Aufgaben erfüllen zu sollen, auf die Sie nicht vorbereitet sind, oder
4
4
4

3
33
wenn Sie erleben, dass Pflegestandards, wie Sie sie in der Schule lernen,
in der Hektik des Stationsalltages unterlaufen werden. Mit »Petzen«
hat das nichts zu tun, denn es geht letztendlich um die verantwortungs-
volle Betreuung von Patienten und das Vermeiden von Fehlern.
Fazit
Hohe Arbeitsbelastungen, fehlende Pausen, Überstunden, die sich
anhäufen, psychische Belastungen und Zeitdruck sind Faktoren,
die es schwierig machen, Pflegestandards immer einzuhalten. Das
geht nicht nur zu Lasten der Patienten und erhöht das Risiko für
Fehler, es tut auch den Pflegepersonen nicht gut. Verschweigen,
aushalten, Augen zu und durch – das sind keine Lösungen! Verant-
wortung als Pflegeperson übernehmen heißt auch, Defizite offen
anzusprechen, Missstände zum Thema zu machen und gemeinsam
nach Lösungen zu suchen.
4
3.3 · Darüber reden heißt nicht petzen
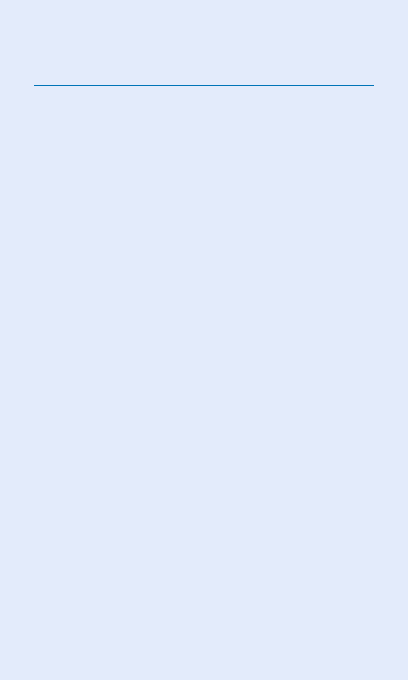
Meine Geschichte: Rolf Höfert
Geschäftsführer des Deutschen Pflegeverbandes e.V. (DPV)
»Mein falsch eingesetztes Helfersyndrom machte mich zum Täter«
Es war die letzte OP an einem langen Arbeitstag. Die Patientin, Mitte
70 und sehr kachektisch, hatte gerade eine Schenkelhalsoperation
hinter sich und befand sich, eingespannt auf dem Extensionstisch und
sehr unbequem, noch in der Aufwachphase. Offensichtlich tolerierte
sie den Tubus immer weniger. Alle riefen nach dem OP-Pfleger, aber
der kam nicht. Die Frau tat mir leid: Auf dem Extensionstisch zu liegen,
das tut schon beim Zusehen weh, wie unangenehm musste es erst
sein, selbst darauf zu liegen?!? Weil der OP-Pfleger nicht beikommen
wollte und ich, bevor ich als Anästhesiefachkraft tätig wurde, schon als
OP-Pfleger gearbeitet hatte, betrat ich kurz entschlossen den OP-Be-
reich. Unterstützt von dem Oberarzt, der das Bein der Patientin hielt,
schnitt ich beim Gipsspalten der Länge nach von der Kniescheibe bis
fast zur Leiste auf. Von der Schnitttechnik her völlig korrekt – aber was
wir beide, der Oberarzt und ich, nicht bedacht hatten, war der kachek-
tische Zustand der Patientin. Anstatt die Gipsstanze über einen Spalt
zwischen Oberschenkel und Gips einzuführen, fädelte ich sie in eine
Hautfalte der alten Dame ein und durchtrennte ihr dadurch die Haut
bis zum oberen Rand des Gipses. Da keine Schmerzenslaute vernehm-
bar waren und die Patientin schon vorher intensiv auf dem Tubus
gekaut hatte, war nicht zu unterscheiden, ob das Abwehr gegen den
Tubus oder gegen den Schnitt war. Als klar wurde, was passiert war,
wurde die Wunde umgehend genäht und mit Antibiotika versorgt.
In den darauffolgenden Tagen besuchte ich die Patientin täglich
in ihrem Zimmer, um mich zu vergewissern, dass es ihr gut ging und
sich nicht am Ende noch die Wunde infizieren würde. Rechtliche Kon-
sequenzen ergaben sich daraus weder für mich noch für den Oberarzt
– im Gegenteil: Die Patientin nahm es mit Humor und war stolz, eine
viel längere Narbe als ihre drei Zimmernachbarinnen vorweisen zu
können.
O
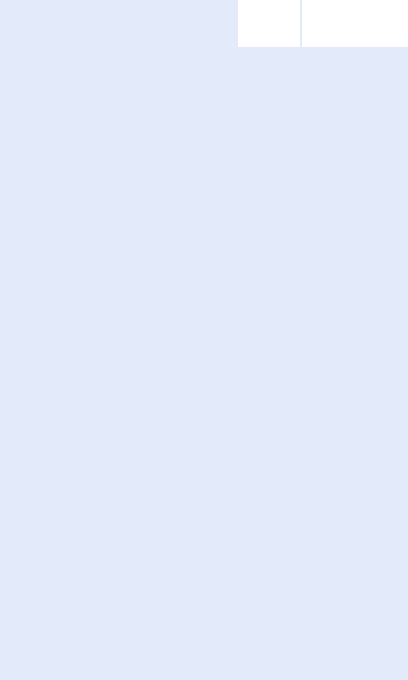
35
Die richtige Technik allein genügt nicht
Der Oberarzt und ich diskutierten noch lange, was unser Fehler ge-
wesen war: Zwar war die Schnitttechnik einwandfrei, da die Patientin
aber sehr dünn war, hätte ihr Bein während des Schnittes anders ge-
halten werden müssen – am Oberschenkel und nicht am Fuß. So hätte
man sicherstellen können, dass zwischen Haut und Gips genügend
Freiraum ist, um mit der Gipsstanze nicht die Haut zu verletzen.
Mein Resümee: Pflegestandards sind unabdingbar
Um die Patientin auf dem Extensionstisch nicht unnötig leiden zu
lassen, ist ein Fehler unterlaufen, der auch einen Mangel an Profes-
sionalität offenbart: In dem Wunsch, rasche Hilfe zu leisten, haben
wir dem Zustand der Patientin nicht genügend Rechnung getragen.
Die Hautfalte aufgrund ihres kachektischen Zustandes war geradezu
prädestiniert, einem Schnitt durch den Gips im Wege zu sein. Pflege-
standards, die das Risikomanagement miteinschließen, sind unab-
dingbar – müssen natürlich erfüllt sein und auch unter Druck greifen.
Sie fehlten damals vor 30 Jahren. Unser Druck war, wie so oft, ein
mehrfacher: Da war die Patientin in der Aufwachphase, die durch ihr
Kauen auf dem Tubus bereits Unbehagen signalisierte, der eigentlich
zuständige OP-Pfleger, der nicht greifbar war, die Erschöpfung seitens
des Personals einschließlich des Oberarztes und der Wunsch, schnell
zu helfen.
Was man damals vor über 30 Jahren lernte war, wie man etwas
korrekt tut. Was man nicht lernte, waren auf unterschiedliche Situa-
tionen angepasste Pflegestandards. Dass man zum Beispiel nach
einer Oberschenkelhals-OP den Gips bei einem kachektischen Patien-
ten etwas anders spalten muss als bei einem normalgewichtigen –
das muss man intus haben, es muss einem in Fleisch und Blut über-
gegangen sein, damit man es im Ernstfall abrufen kann. Risiko-
management ist daher ebenso wichtig wie das Erlernen der Pflege,
denn nur dann kann man sich nicht nur verantwortlich fühlen, son-
dern auch verantwortlich handeln.
3

36
Kapitel 4 · Reaktionen von Pflegenden auf ein Fehlergeschehen
Reaktionen von Pflegenden
auf ein Fehlergeschehen
Henning Cramer, Monika Habermann
Bis vor kurzem lagen kaum empirische Erkenntnisse über Einschät-
zungen von Pflegenden in Deutschland zum Thema »Fehler« vor. Eine
Untersuchung des Zentrums für Pflegeforschung und Beratung der
Hochschule Bremen (ZePB) unter der Leitung von Prof. Dr. Monika
Habermann hat diese Lücke nun geschlossen (»Pflegefehler, Fehlerkultur
und Fehlermanagement in stationären Versorungseinrichtungen«, s. a.
www.zepb.de): Im Jahr 2007 wurden mit 18 Pflegenden aus Kranken-
häusern und Pflegeheimen teilstrukturierte Interviews zu verschiedenen
Aspekten von »Pflegefehlern, Fehlerkultur und Fehlermanagement in
stationären Versorgungseinrichtungen« geführt. Ein Jahr später wurden
1.100 Pflegende aus 30 Krankenhäusern und 46 Pflegeheimen mit einem
umfangreichen Fragebogen zu ihrer Meinung zum selben Thema befragt
(ebd.). Es liegen nun Ergebnisse vor zu Fragen
der Einschätzung von Fehlern,
des Umgangs mit Fehlern und
nach den Folgen von Fehlern in der Pflege.
Der Teil der Ergebnisse, in dem nach individuellen Reaktionen und
allgemeinen Folgen von Fehlern gefragt wurde, wird in diesem Beitrag
vorgestellt. Er gibt Einblicke, wie Pflegende Fehler erleben und an
welche Folgen sie sich in diesem Zusammenhang erinnern.
4.1
Ängste, Stress und Sorgen im Umgang mit Fehlern
In den Interviews wurden die Pflegenden u. a. gefragt, ob sie persönlich
Ängste haben, Fehler zu begehen. Generell scheint dies eher nicht der
Fall zu sein. Angst und deren Begleiterscheinungen treten allerdings vor
4
4
4

4
37
allem dann auf, wenn ein Fehler schon einmal vorgekommen ist und
die betreffende Person sich dadurch in ihrer Routine und Sicherheit er-
schüttert sieht: Könnte der Fehler ein zweites Mal passieren? Warum
konnte der Fehler überhaupt passieren? Ist man immer ausreichend
konzentriert genug? Solche Fragen beschäftigen Pflegende dann länger
und können auch zu Beeinträchtigungen der alltäglichen Arbeitsgestal-
tung führen. Als Beispiel seien hier 2 Interviewausschnitte angeführt:
»Zum Beispiel mit Medikamenten. Wir stellen die nachts und manch-
mal wirklich ›zwischen Tür und Angel‹ und brauchen 2 Stunden dafür,
weil wir ständig zur Klingel müssen oder so etwas. Dann passiert es
schon mal, dass du etwas falsch stellst. Davor habe ich natürlich Angst.
Aber ich versuche, mich da nicht mehr so reinzusteigern wie früher.
Früher habe ich Phantasien entwickelt, ganz toll, aber das will ich
nicht. Ich will keine schlaflosen Nächte deswegen.«
Eine andere Person beschreibt den Sachverhalt folgendermaßen:
»Natürlich hatte auch ich Gedanken wie: ›Mein Gott, nur keinen Fehler
machen!‹ Aber ich denke, wer so arbeitet, macht gerade Fehler. Er lebt
in einer Angst, hat Angst zur Arbeit zu kommen und ist dann nicht ein-
setzbar. Er geht psychisch kaputt. Und das ist nicht gut für die Arbeit.«
Distanz schaffen schon in der Sprache
Häufig kommt es vor, dass Pflegende wie in dem oben zitierten Inter-
viewausschnitt Zuflucht zu einer eher unpersönlichen Beschreibung
nehmen wie »…Er lebt dann in einer Angst…«. Fehler stellen sich auch
in der Forschung als eine Möglichkeit des Alltagslebens dar, der man
eher distanziert begegnen möchte. Konkreter wird eine Pflegende in
folgendem Interviewabschnitt:
»Eine Kollegin hat im Rahmen unserer Supervision mal geäußert, dass
sie Angst hat, dass ihr ein Fehler passiert. Und das hat mich ganz schön
erschrocken, weil ich für mich so eigentlich nicht wahrnehme, dass ich
da ständig mit einer Angst herumlaufe, dass ein Fehler passieren
könnte. Und ich glaube, das setzt ganz schön unter Druck.«
4.1 · Ängste, Stress und Sorgen

38
Kapitel 4 · Reaktionen von Pflegenden auf ein Fehlergeschehen
Auch die folgende Interviewpassage zeigt, wie die Angst vor dem Feh-
ler persönlichen Stress im Arbeitsalltag aufbauen kann.
»Was ich auch schon mal mache, ist so eine Mehrfachkontrolle. Dass
ich mir dann plötzlich nicht sicher bin: Hab ich das jetzt wirklich ge-
macht? Dann geh ich noch mal hin und schau nach. ›Ja, ist ok, hab
ich.‹ Und dann zwei, drei Stunden später fällt mir dieser Punkt plötz-
lich noch einmal ein, und ich denke: Oh – nee – doch. Nee. Nee, du bist
da gewesen. Oder? Geh lieber noch mal gucken.«
Aus Angst passieren noch mehr Fehler
Ängste sind aber nicht immer konkret benennbar, wie z. B. die oben
angeführte Angst einer Pflegenden, sich beim nächtlichen und oft
unterbrochenen Medikamentenstellen zu irren. Sie sind vielmehr oft
diffuser Art und richten sich z. B. allgemein auf den Verlust des Ar-
beitsplatzes oder auf die Gefährdung der Bewohner/Patienten, die aus
einem persönlichen Fehler resultieren könnte:
»Viele haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Ich finde, dass es bis vor
fünf, sechs, sieben Jahren ganz anders war. Seit Kostenprobleme auf
dem Haus lasten, sind viele wirklich ganz ängstlich. Ich glaube, durch
diese Angst passieren noch mehr Fehler.«
Ängste auch bei Leitungsaufgaben
Ängste werden auch bei der Erledigung von Leitungsaufgaben deutlich.
So erzählte eine Pflegende, die mit dem Anfertigen des Dienstplans
betraut war, dass sie häufig von Ängsten heimgesucht werde, obwohl
alles richtig bedacht sei und der Plan die notwendige Pflege auch ge-
währleiste. Auch Pflegende in diesen Positionen erleben hier zuweilen
erheblichen inneren Druck, der sie bis in die Freizeit verfolgt und sie
ständig überlegen lässt, ob denn nun alles auch angemessen geregelt sei.

4
39
Und was, wenn ein Fehler passiert ist?
In der Fragebogenerhebung gab ein Viertel (23,4%, n=1.100) der
Pflegenden an, nach einem Fehler Angst gehabt zu haben, dass ihnen
dieser noch einmal passiert, und 15,5% meinten, dass ein Fehler sie im
Nachhinein unsicher gemacht habe. Die Angst vor beruflich-recht-
lichen Folgen wurde allerdings eher selten im Fragebogen angekreuzt.
Nur 2,2% im Krankenhausbereich (n=724) und 4,3% im Pflegeheim
(n=376) berichteten dieses.
Fragt man nicht nur nach »Ängsten«, sondern bezieht auch
»weichere«, unbestimmtere Äußerungen im Sinne von allgemeinem
»Stress« und »Sorgen« in das Antwortverhalten mit ein, ergibt sich ein
deutlicheres Bild einer Belastung in der Fragebogenstudie: Mehr als die
Hälfte (52,6%) der Teilnehmer gaben an, dass sie ein Fehler schon ein-
mal »aufgeregt, gestresst oder geärgert« hätte.
Über »Sorgen«, eine unbestimmte »Unruhe« oder auch »Stress« im
Kontext eines Fehlergeschehens berichteten auch einige der interview-
ten Pflegenden. Verbunden mit einer hohen Arbeitsbelastung wird dies
z. B. hinsichtlich der Übergabe an eine Nachtwache berichtet. Fehler-
bezogene Sorgen und Stress können sich nämlich auch ganz allgemein
auf die Gewährleistung einer guten Pflege beziehen:
»Es ist eher das Gefühl, in harten Zeiten, zu denen wir viele Frisch-
operierte haben, bei denen zum Beispiel halbstündlich Protokoll ge-
führt werden muss, dass ich das nicht schaffe. Ich kann dann wirklich
nur das Nötigste machen. Das finde ich schon belastend, auch gerade,
wenn man an die Nachtwache abends dann übergeben muss. Und
die steht dann allein vor diesem ganzen Berg. Dann macht man sich
schon Sorgen oder denkt: ›Mein Gott, dem Patienten geht es jetzt so
schlecht, wie wird das aussehen, wenn wir morgen früh kommen? Ist
da was passiert?‹ Man schafft es ja kaum zu viert. Das finde ich schon
belastend.«
Ein hoher Arbeitsanfall wurde dann auch von mehr als zwei Dritteln
(69,5%) der TeilnehmerInnen der Fragebogenbefragung als eine der
Hauptursachen von Pflegefehlern angesehen.
4.1 · Ängste, Stress und Sorgen

40
Kapitel 4 · Reaktionen von Pflegenden auf ein Fehlergeschehen
4.2
Ethische Konflikte
Sorgen bereiten auch ethische Konflikte und die Frage, wie diese denn
angemessen zu lösen seien:
»Eine Patientin hatte dann irgendwann einen Dekubitus. Irgendwann
hatte sie [die Kollegin] dann auch gesagt, die Patientin lässt sich nicht
mehr lagern, und das haben die anderen dann auch so hingenom-
men. Beim Lagern hat man natürlich auch die Haut dann inspiziert,
und da war dann recht schnell ein Dekubitus entstanden, ein sehr
schlimmer Dekubitus. Gut, das musste dann einem Oberarzt gesagt
werden und der Pflegedienstleitung und da gab es ein großes Trara.
Die Folge war, dass die Patientin gegen ihren Willen gelagert wurde.
Da ist dann so ein Zwiespalt. Es gibt ja auch Patienten, die irgend-
welche Dinge ablehnen, obwohl sie wissen, dass es jetzt wirklich
wichtig ist, und auch durch Überzeugungskraft kann man da wirklich
nichts erreichen. Das ist auch ein Zwiespalt, der schon belastend sein
kann. Wenn man weiß, es kann etwas passieren, und es passiert auch
was, und der Patient ist nicht einsichtig.«
Große Sorgen bereitet insbesondere auch ein Fehler, dessen Ausgang
man noch nicht kennt und den man dann abwarten muss, wie folgende
Interviewsequenz exemplarisch erläutert:
»Das war eine Patientin, die hatte schon ziemlich viel Pech während
ihres Krankenhausaufenthaltes. Sie ist gekommen, weil ihre Gebär-
mutter herausgenommen werden sollte, und unter der OP haben sie
den Darm so angeritzt, dass sie einen Anus-praeter-Beutel brauchte.
Sie hat dann noch einen MRSA-Keim gehabt und kam dann zu uns in
die Reha. Und der ganze Bauch war auf, war vorher gespült worden
und dieser Anus praeter, der passte nicht auf die Bauchwunde oder
hielt nicht auf dem Bauch, weil da Läsionen waren. Und die Patientin
tat mir mit ihrem ganzen Krankheitsbild und ihrem ganzen Leiden
tierisch leid. Sie hatte einfach so mein Mitgefühl, sagen wir mal so.
Und dann ging es ihr zwischendurch ziemlich dreckig. Sie musste sich
6

4
41
immer wieder übergeben, hatte morgens Nahrungskarenz, und dann
ist mir im Laufe des Nachmittags aufgefallen, dass sie kaum ausschei-
det. Ich habe dann einen Internisten angerufen – die Krea-Werte
waren alle erhöht. Sie sollte aber nicht auf die Intensivstation. Und
dann haben wir ein großes Infusionsprogramm laufen lassen und
immer ordentlich Lasix gespritzt, um die Nieren wieder in Gang zu
kriegen. Und abends sagte sie dann, dass sie Hunger hatte auf eine
Stulle Weißbrot, und die habe ich ihr gegeben. Tja.«
(Interviewerin) »Obwohl nüchtern angeordnet war?«
»Ja, Nahrungskarenz, genau. Das hatte ich im Umgang mit der Niere
völlig ausgeblendet, hab das dann dem Internisten auch gesagt. Das
hatte erstmal keine Konsequenz. Ich habe mir halt schon Sorgen ge-
macht. Und dann kam ich am nächsten Tag zum Dienst, da kam meine
Kollegin mit so einem Gesicht und sagte, dass jemand gestorben ist.
Und ich habe dann natürlich gedacht, es wäre DIE Patientin gewesen.
Da ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Aber sie war es nicht, und sie
hat dann auch mehr als fünfzig Milliliter ausgeschieden, das hatten wir
hingekriegt. Aber da hab ich mir schon Sorgen gemacht.«
Fehler als »Versagen im Job«
Direkt im Anschluss an die soeben wiedergegebene Passage kommt die
Pflegende auf einen weiteren wichtigen Aspekt zu sprechen, der auch
in anderen Sequenzen und Zusammenhängen eine Rolle spielte: Das
Gefühl beruflicher Inkompetenz infolge eines Fehlers. Befragt dazu,
was der Pflegenden nach diesem für sie doch dramatischen kurzen
Moment der vermeintlichen Schuld an dem Tod einer Patientin durch
den Kopf gegangen sei, meint diese:
»Ich glaube, ich könnte da schlecht mit umgehen, wenn das so wäre.
Ich wüsste jetzt nicht, wie ich da überhaupt mit umgehen kann. Wenn
ich wirklich richtigen Schaden anrichte, ich glaube, dann würde ich
meinen Beruf an den Nagel hängen.«
4.2 · Ethische Konflikte
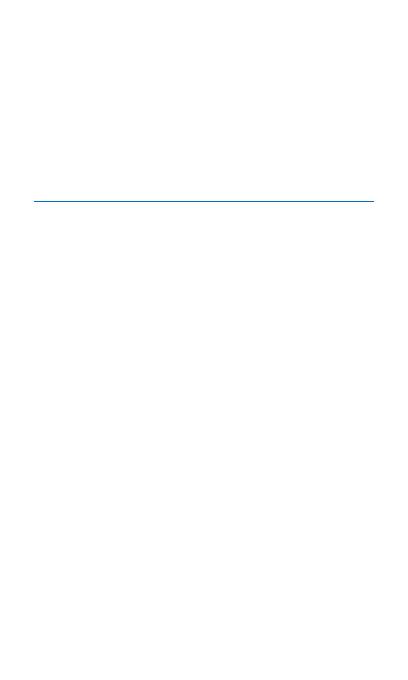
42
Kapitel 4 · Reaktionen von Pflegenden auf ein Fehlergeschehen
Das Gefühl, nach einem Fehlerereignis im Job versagt zu haben, wurde
auch von vielen TeilnehmerInnen der Fragebogenerhebung angegeben
(18,2%). Auch die Frage, ob sie sich über die Arbeit hinaus generell als
Person in Frage gestellt hätten, wurde von immerhin 8,6% bejaht.
4.3
Leitungsverantwortung und persönliche Reaktionen
auf Fehler
Der Leitung einer Pflegeeinrichtung, einer Abteilung oder Arbeits-
gruppe kommt eine wichtige Aufgabe zu, wenn es um die persönliche
Belastung durch Fehlergeschehen geht – sei dieses nun selbst ver-
schuldet oder beobachtet bei Kollegen. Ein wichtiger Hinweis auf diese
Verantwortung der Leitung und ihre hohe Bedeutung des erlebten oder
antizipierten Umgangs mit Fehlern findet sich in der Schilderung der
Vertuschung eines Fehlers. Dies geht einher mit erheblichen Sorgen
und Ängsten, die um das eigene Wohlbefinden und die Gefährdung
einer Patientin kreisen:
»Früher mussten die Frauen, bevor sie eine Chemo kriegten, Sammel-
urin abgeben, auch Kreatinin-Clearance. Und die Frau – es war eine
Privatpatientin – hat vierundzwanzig Stunden gesammelt, und ich
habe den Urin abgemessen, spezifisches Gewicht und [schnalzt mit
der Zunge] ab ins Becken. Und wo ist der Urin für das Labor? Ich bin
dann hingegangen und habe gesagt, es reicht nicht, ich brauche noch
einen Becher voll. Und der wäre dann natürlich völlig verfälscht. Dann
bin ich ins Wochenende gegangen und habe geschwitzt ohne Ende,
habe so eine Angst gehabt, wenn die jetzt ihre Chemo kriegt und mit
den Nieren ist irgendetwas nicht in Ordnung, dann hast DU Schuld.
Und dann komme ich am Montag rein und die Frau sagte zu mir: ›Wir
beide haben ein kleines Geheimnis‹. Sie wusste das ganz genau, die
war auch ganz plietsch [Norddeutsch für ›aufgeweckt, gescheit‹,
Anmerkung der Autoren] und meinte, das sei ja auch kein Wunder.
Aber ich habe eine Angst vor unserer Leitung gehabt. Die hat immer
6
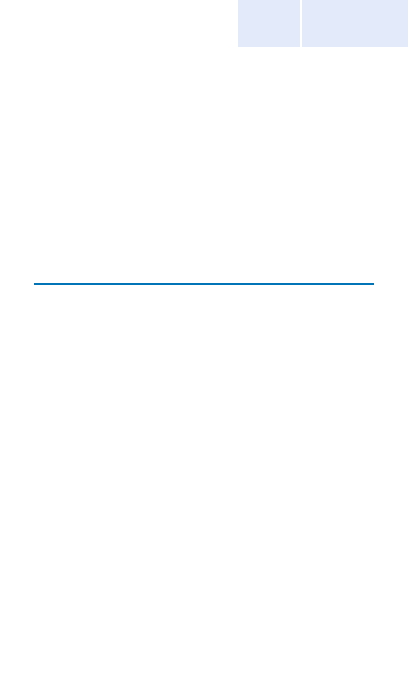
4
43
so alle viertel Jahr jemanden auf dem Kieker gehabt. Und in dem
Moment war ich diejenige welche. Und da hätte ich gedacht: Das
hältst du nicht aus, wenn du ihr das jetzt sagst. Dann kann ich meine
Sachen packen und gehen. Ich habe trotzdem eine Wahnsinnsangst
gehabt, und die anderen haben gesagt: ›Ja, das ist mir auch schon
passiert, ich habe gesagt, der Urin ist ins Labor gegangen, und wenn
die den verschludern, dann ist das doch nicht mein Bier‹. Auf die Idee
wäre ich nie gekommen. Ich habe mich ganz ganz lange nicht getraut,
das laut zu sagen, dass mir das passiert ist.«
4.4
Folgen eines Fehlergeschehens
in der Fragebogenerhebung
Im Fragebogen wurde noch nach weiteren Folgen für Pflegende ge-
fragt. Diese sind weniger stark als die bereits geschilderten und
könnten sogar als normale oder natürliche Folgen bei einem Fehler
charakterisiert werden: »Bedauern« und »Scham«. Der Anteil der Teil-
nehmerInnen, die diese Folgen von Pflegefehlern bereits einmal durch-
lebt haben, ist zumindest beim »Bedauern« höher als derjenige der Be-
fragten, deren Fehler oben genannte Konsequenzen hatten (
.
Abb. 4.1
).
Interessant ist auch, dass diese Folgen sowie »Aufregung«, »Stress«,
»Ärger« von Befragten aus dem Krankenhaussektor allesamt häufiger
angegeben wurden als von solchen aus dem Pflegeheimbereich.
In der Fragebogenerhebung gaben darüber hinaus 14,9% der Teil-
nehmerInnen an, bereits einmal unter Schlafstörungen aufgrund eines
Fehlers gelitten zu haben. Andere körperliche Symptome wie Kopf-
schmerzen etc. wurden auch in den Interviews nicht erwähnt.
Fehler haben aber nicht nur negative Folgen. »Aus Fehlern wird man
klug«, und so wurde im Fragebogen auch gefragt, ob die Befragten schon
einmal aus einem Fehler etwas für ihren Beruf gelernt hätten oder viel-
leicht sogar persönlich gewachsen seien. Ein Lernen aus Fehlern hatte
bei gut der Hälfte der Befragten stattgefunden (51,5%), und fast ein
Viertel (24,4%) gab an, als Person gewachsen zu sein. Die Ergebnisse der
Fragebogenbefragung sind zusammengefasst in
.
Abb. 4.1
ersichtlich.
4.4 · Folgen eines Fehlergeschehens
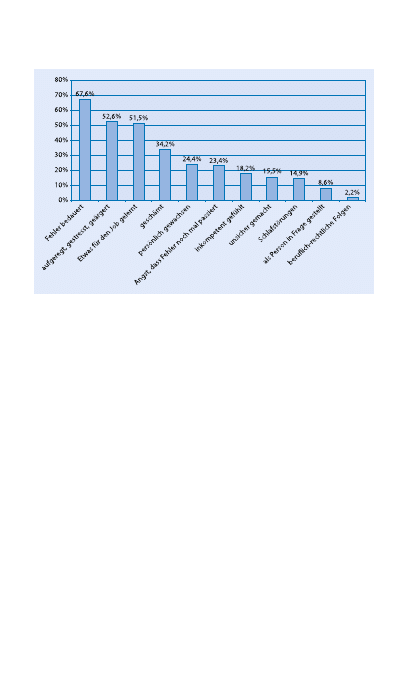
44
Kapitel 4 · Reaktionen von Pflegenden auf ein Fehlergeschehen
Fazit
Pflegefehler haben teilweise massive Folgen für diejenigen
Pflegenden, denen sie unterlaufen. Die hohen Anforderungen und
das potentielle Leid, das ein Fehler auslöst, machen den Teilneh-
merInnen beider Untersuchungsteile mitunter schwer zu schaffen.
Das Arbeitsumfeld ist nicht immer so gestaltet, dass es Pflegende,
die einen Fehler begehen, auffängt. Häufig herrscht eine negative
Fehlerkultur vor, so dass dem Pflegenden dann oft die alleinige
Schuld zugeschoben wird. Dabei ist längst klar, dass organisato-
rische Fehler, die Pflegende häufig gar nicht beeinflussen können,
Fehler an der »Pflege-Front« sehr oft begünstigen, ja Pflegende
regelrecht in Fehler treiben.
Die Entwicklung eines positiven Umgangs mit Fehlern ist eine der
größten Aufgaben, denen sich ein Fehlermanagement-System
gegenüber sieht. Viele Pflegende gaben an, aus einem Fehler ge-
lernt zu haben. Notwendig ist aber nicht nur das persönliche Lernen:
Die Etablierung einer Lernkultur, von lernenden Organisationen ist –
auch mit Nutzen für die Patienten/Bewohner – dringend notwendig.
Ebenso muss ein offener, nicht-strafender Umgang mit Fehlern in
der Pflege erreicht werden, um die geschilderten, oft schwerwie-
genden Folgen von Fehlern für Pflegende abzuwenden.
4
4
4
Abb. 4.1. Folgen von Fehlern für Pflegende (n=1.100).
.
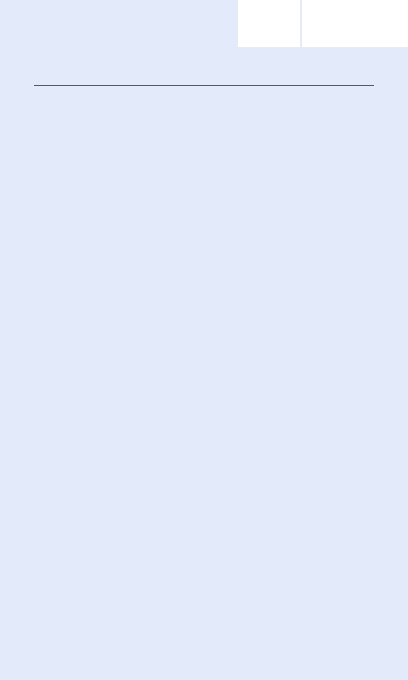
45
Meine Geschichte: Heiko Rutenkröger
Leiter des Fachbereichs Pflege im Kuratorium Deutsche Altershilfe
»Ich hätte den Mut haben sollen, mich zu irren. Stattdessen habe
ich die Situation heruntergespielt«
Als ich während meiner Abendrunde bei der Klientin eintraf – ich war
damals Altenpfleger bei einem ambulanten Pflegedienst – bemerkte
ich die Veränderung sofort. Normalerweise war das Waschen, Betten
und Lagern der netten alten Dame, die schon seit vielen Jahren von
diesem Pflegedienst betreut wurde, eine schwierige Pflegehandlung:
Ihr fortgeschrittener Parkinson, der auch die Ursache für ihre Bettläge-
rigkeit war, hatte zu starken Spastiken geführt, die ihre Versorgung
schwierig machten. Heute dagegen war sie völlig schlaff, Arme und
Beine hingen kraftlos und ohne jede Spannung einfach so herab.
Trotzdem machte ich sie wie gewohnt frisch und wusch, bettete und
lagerte sie wie sonst für die Nacht, verabschiedete mich und ging.
Und das war ein sehr großer Fehler.
Ich hätte Kontakt zu den Angehörigen aufnehmen müssen
Als meine Kollegin die Klientin am anderen Morgen aufsuchte, war sie
bereits verstorben. Allein. Ohne ihre Angehörigen, die Nichte und den
Neffen, zu denen sie ein sehr inniges Verhältnis hatte und die sie alle
zwei, drei Tage besucht hatten. Diesen Fehler, für den ich keine Ent-
schuldigung habe, trage ich bis heute mit mir herum. Ich hätte unbe-
dingt Kontakt mit den Angehörigen der alten Dame aufnehmen sol-
len, sagen, dass die Veränderungen, die ich beobachte hatte, mögli-
cherweise ein Hinweis auf den beginnenden Sterbeprozess wären. Ich
habe es nicht getan. Denn ich war mir nicht hundert Prozent sicher,
ob meine Beobachtungen wirklich auf einen finalen Sterbeprozess
hinwiesen. Kein Mensch – auch kein noch so erfahrener Arzt – kann
mit Sicherheit voraussagen, wie der Zustand eines Menschen sich in
fünf Stunden verändert und ob es sich wirklich um einen sterbenden
Menschen handelt.
O
4
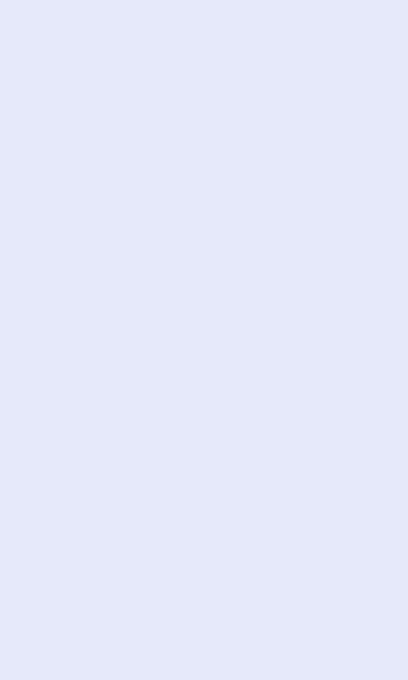
Anstatt mich mit meinen Kollegen, die ja erreichbar gewesen wä-
ren, zu beraten oder mich beim Hausarzt der Patientin rückzuversi-
chern und dann die Angehörigen anzurufen, habe ich die Situation
vor mir heruntergespielt: ›Du weißt ja nicht genau, ob die Frau
wirklich heute Nacht stirbt, versetz’ die Angehörige nicht unnötig in
Aufruhr und warte erst einmal ab‹. Das war falsch. Ich hätte den Mut
haben müssen, mich mit der Beurteilung dessen, was ich sah, mög-
licherweise zu irren. Hätte den Mut haben müssen, meine Kollegen
zu involvieren, anstatt die Symptome herunterzuspielen. Heute weiß
ich, dass man eine zweite Meinung einholen und den Mut zum Risiko
haben muss, eine Situation auch einmal falsch zu interpretieren.
So musste die alte Dame ihre letzten Stunden allein erleben und
die Angehörigen hatten nicht die Möglichkeit, sich von ihr zu verab-
schieden.
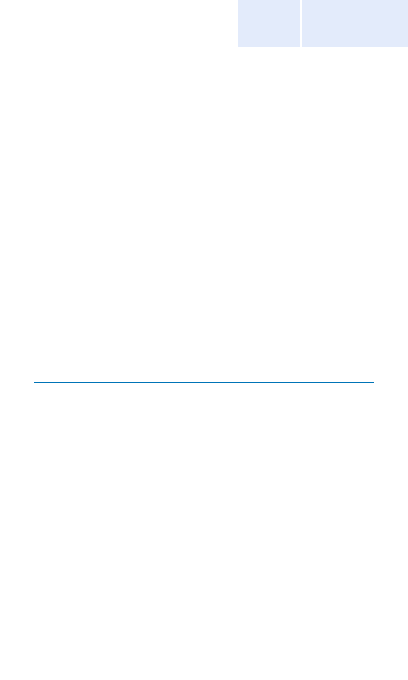
5
47
Professionelles Berufs-
verständnis braucht Ethik
Marianne Rabe, Judith Borgwart
Ein vertauschtes Tablettenschälchen oder eine falsch beschriftete In-
fusionsflasche sind ganz offensichtlich Fehler. Die Beziehung zwischen
Patienten und ärztlichem bzw. Pflegepersonal birgt jedoch ihrer Grund-
struktur nach das prinzipielle Risiko für Fehler, die vor allem den
Umgang mit (abhängigen) Kranken und Alten betreffen und die im
weitesten Sinn mit der ethischen Grundhaltung der Akteure zu tun
haben. Diese Grundstruktur ist gekennzeichnet von Asymmetrie: auf
der einen Seite der Wissende und Helfende – auf der anderen Seite der
Unwissende und Hilfsbedürftige.
5.1
Eine Frage der Augenhöhe
Menschen, die aufgrund einer Erkrankung, einer Behinderung oder
ihres Alters die Hilfe anderer in Anspruch nehmen müssen, finden sich
ganz schnell in der Rolle, nicht mehr gleichwertiger Partner und auf
Augenhöhe mit ihrem Gegenüber zu sein. Sie fühlen sich unterlegen,
abhängig, unwissend und entmündigt. Dass die Gefahr dafür in der
Beziehung zwischen Patienten und Pflege- und ärztlichem Personal so
besonders groß ist, hat vor allem zwei Ursachen:
Wer krank ist oder in seiner Gesundheit eingeschränkt, hat viel-
leicht Schmerzen, fühlt sich unwohl oder sogar schlecht, ist in
seiner Mobilität eingeschränkt oder hat Angst. Weil die meisten
Patienten die genauen Zusammenhänge und Gründe für ihr Krank-
sein nicht kennen, macht sie das zusätzlich unsicher und hilflos.
Dann noch in ein Krankenhaus oder eine andere stationäre Ein-
richtung zu kommen, in der man sich nicht auskennt, die einem
völlig fremd ist, kann Gefühle von Orientierungs- und Hilflosigkeit
4
5.1 · Eine Frage der Augenhöhe

48
Kapitel 5 · Professionelles Berufsverständnis braucht Ethik
auslösen. Hinzu kommt, dass Krankheit zumeist eine »außeralltäg-
liche« Erfahrung ist. Man hat sie nicht schon x-mal durchgemacht
und seinen Weg, damit umzugehen, gefunden. Alles ist neu.
Das Personal im Krankenhaus kennt sich aus. Es weiß nicht nur,
wo die Patiententoiletten sind oder die Röntgenabteilung, wann
es Essen gibt und um welche Uhrzeit gewöhnlich die Visite ist, es
kennt und bestimmt auch die Abläufe, weiß, wer die schichtführen-
de Krankenschwester ist, wann Blut abgenommen wird und wel-
cher Arzt wofür zuständig ist. Und das verleiht Macht.
Diese Asymmetrie zwischen einem »Gesundheitsberufler« und einem
Patienten verleiht aber nicht nur Macht, sondern erfordert viel mehr
die Fähigkeit, mit dieser prinzipiellen Asymmetrie zum Wohle des
Patienten umgehen zu können. Dazu braucht es neben persönlichen
Eigenschaften wie der Fähigkeit zur Selbsterkenntnis oder einem ange-
messenen Umgang mit den eigenen Gefühlen eine professionelle
Grundhaltung als Pflegeperson. Dazu gehören die Berufsethik und die
regelmäßige ethische Reflexion des eigenen Handelns.
Die Geschichte von Rainer S.: Teil I
»Was hat denn der Arzt damit gemeint?«
Kurz nach der Arztvisite klingelt der Patient Rainer S. Er sitzt mit fra-
gend-ratlosem Gesicht im Bett und bittet den Pfleger, der auf sein
Klingeln kommt, ihm zu erklären, was der Arzt gemeint habe. Der habe
von »so einer« Untersuchung gesprochen, und was das denn sei und
ob er jetzt etwas machen müsse? »Muss ich vorher nüchtern sein?«
fragt Herr S. und: »Wer bringt mich denn dann da hin?« Der Pfleger
seinerseits ist etwas genervt, denn der Patient hat ihn von einer Arbeit
weggeholt, nur um zu fragen, was er doch auch den Arzt bei der Visite
hätte fragen können! »Wieso haben Sie denn das bei der Visite nicht
angesprochen?!?« ist die gereizte Antwort. »Ich weiß auch nicht, was
der Arzt da gesagt hat, ich war nicht dabei.«
Für den Patienten ist die Situation ziemlich unangenehm: Die
angekündigte Untersuchung macht ihm gleich in zweierlei Hinsicht
4
6
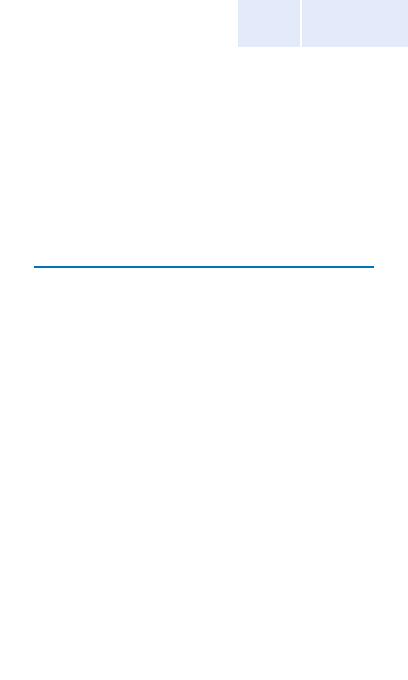
5
49
Angst: erstens fürchtet er sich vor einem möglicherweise unange-
nehmen Ergebnis, zweitens fürchtet er sich vor der Untersuchung
selbst, weil er keine Ahnung hat, was auf ihn zukommt. Den Arzt traut
er sich nicht zu fragen, der hat es immer so eilig und außerdem ver-
steht er sein Fachchinesisch nicht. Nun gibt ihm auch noch der Pfleger
zu verstehen, dass er eigentlich keine Zeit für seine Fragen habe.
Zum Gefühl der Unsicherheit empfindet Rainer S. nun auch ein
diffuses Gefühl von Demütigung und Unterlegenheit. Ein unsicheres
Pflaster, so ein Krankenhaus...
5.2
Ethik regelt unser Zusammenleben
Wer von »Moral« und »Ethik« sprechen möchte, kann sich nun nicht
unbedingt auf Vorschuss-Lorbeeren verlassen: den meisten fällt dazu
der »Moralapostel« ein, der »erhobene Zeigefinger« oder »moralin-
sauer«. Und das nicht ganz zu Unrecht. Denn allzu oft macht man die
Erfahrung, dass der »Moralapostel« von anderen fordert, was er selbst
nicht zu geben bereit ist.
Tatsächlich bestimmen ethische Grundsätze – Prinzipien und
Werte – aber in sehr hohem Maß das Zusammenleben von Menschen
in einer Gesellschaft. Es geht sogar noch weiter: ohne ethisches Ver-
halten ihrer Mitglieder könnte eine Gesellschaft gar nicht überleben!
Dass man seinem Nachbarn nicht einfach eine Scheibe einschlägt,
einer Hochschwangeren in der U-Bahn seinen Sitzplatz anbietet und
den ausgeliehenen Rasenmäher unbeschädigt an seinen Besitzer zu-
rückgibt, sind ungeschriebene Grundsätze. Wenn solche »Selbstver-
ständlichkeiten« keine bindende Wirkung mehr haben, kommt eine
Gesellschaft insgesamt in Gefahr, aus den Fugen zu geraten.
In der Pflege kranker und alter Menschen kommt dem der Pflege
zugrundeliegenden Moralverständnis eine ganz besondere Bedeutung
zu. Die Schwäche, die Abhängigkeit, das Leiden und die Hoffnungen
der pflegebedürftigen Menschen berühren die zentrale Dimension
unseres Moralverständnisses und unserer Ethik: Die Würde des
Menschen.
5.2 · Ethik regelt unser Zusammenleben

50
Kapitel 5 · Professionelles Berufsverständnis braucht Ethik
Das »Herzstück« von Moral und Ethik:
Die Würde des Menschen
Die Vorstellung davon, was die »Würde« eines Menschen ist, ist tief
verankert im abendländischen Weltbild und hat ihren Ursprung in der
Ethik der Spätantike und in der christlichen Idee, dass Gott den Men-
schen »sich zum Bilde« geschaffen habe. Untrennbar damit verbunden
ist die Würde des Menschen, die ihm zukommt – allein, weil er Mensch
ist. Ohne jede Bedingung, ohne jede Voraussetzung, egal was er getan
hat und egal was er ist – »die Würde des Menschen ist unantastbar«,
so heißt es im Grundgesetz.
Vernunftfähigkeit
Wird die Zuschreibung der Würde vor allem mit der »Vernunftfähig-
keit« des Menschen begründet, dem Hauptmerkmal, das ihn vor allen
Lebensformen auf der Welt auszeichnet, dann liegt darin bereits eine
potentielle Bedrohung unseres Begriffs von Würde: denn wie steht
es dann um die Würde von Menschen, die weniger oder gar nicht ver-
nunftfähig sind – Embryonen, ungeborene Kinder, Menschen im
Koma, Menschen mit schwerer geistiger Behinderung, Verstorbene?
Man braucht nur einen Blick in die Zeitung zu werfen, um zu erken-
nen, dass Diskussionen hierüber in allen Bereichen der Gesellschaft
nicht abgeschlossen sind und immer wieder aufflackern – übrigens
auch ein Beleg für zwei Aspekte von Würde: dass sie im Prozess gesell-
schaftlichen Wandels immer wieder neu ausgehandelt und definiert
werden muss und dass sie auch immer wieder in Gefahr geraten kann.
Ganz besonders markante Problemfelder sind hier zum Beispiel die
Diskussion um die Stammzellenentnahme von Embryonen oder die
Debatte um die Sterbehilfe, also die Fragen um die Grenzen des
menschlichen Lebens.
Würde – eine Frage der Selbstbestimmtheit
In der Pflege von kranken und alten Menschen ist das Thema »Würde«
immer präsent. Auf die Hilfe anderer angewiesen und damit in seiner
Autonomie eingeschränkt zu sein, empfinden die meisten Menschen
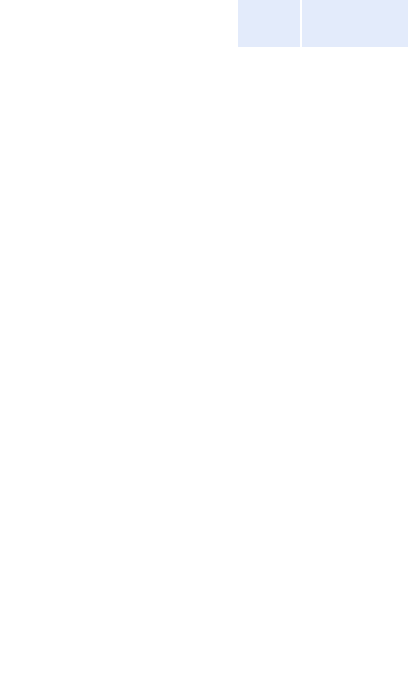
5
51
als Verletzung ihrer Würde. Die Intimpflege bei einem Patienten ohne
Sichtschutz zu verrichten oder Sätze wie »die Galle aus Zimmer 8«
untergraben die Würde eines Menschen weiterhin. Denn sie verletzen
einerseits die ihm zugehörige Privatsphäre, anderseits machen sie ihn
zur Nummer – ohne Namen, ohne Eigenschaften, ohne Schamgefühl,
ohne Geschichte. Der Patient wird zum Objekt, reduziert auf seine
Krankheit und seine Bedürftigkeit.
Nimmt man das oben genannte Beispiel von Rainer S., der wissen
wollte, welche Untersuchung auf ihn zukommt, kann man sich unmit-
telbar in sein Gefühl von Unsicherheit, Entwertung und Würdeverlust
hineinfühlen. Betrachtet man nun die 5 weiteren Prinzipien, die zu-
sammen mit dem Grundsatz der Würde eine moralische Pflege be-
gründen, kann man auch verstehen, aus welchen Anteilen sich dieses
Gefühl von Würdeverlust zusammensetzt
Das Prinzip Autonomie
»Autonomie« wird im Allgemeinen als das Recht auf Selbstbestimmt-
heit und Selbstverwirklichung verstanden. Diese verkürzte Sicht ent-
spricht nicht ganz dem eigentlichen Wortsinn, nach dem Autonomie
die Selbstgesetzlichkeit eines Menschen meint, der aus freien Stücken
moralischen Grundsätzen folgt. Für die Ethik im Gesundheitswesen ist
das Recht auf Selbstbestimmtheit von großer Bedeutung. Gerade vor
dem Hintergrund der charakteristischen Asymmetrie, in der der Pati-
ent der Unwissende und Hilflose und der »Gesundheitsberufler« der
Wissende und Helfende ist, ist sie potentiell immer bedroht. Zwar
wünschen offiziell alle den »mündigen« Patienten, wenn jemand aber
wirklich einmal etwas genau wissen will, kritisch hinterfragt oder sogar
ablehnt, gilt er schnell als »schwieriger« Patient.
Die Geschichte von Rainer S.: Teil II
»Der muss jetzt zum CT.«
Möglicherweise ist es eine Computertomografie, die der Arzt »ange-
ordnet«, aber nicht erklärt hat. Dass Herr S. nur nebulöse (und falsche)
Vorstellungen davon hat – »da kommt man in so eine Röhre!«, »da drin
6
5.2 · Ethik regelt unser Zusammenleben

52
Kapitel 5 · Professionelles Berufsverständnis braucht Ethik
ist es so laut, als würde man neben einem Presslufthammer liegen!« –
ist die Folge von mindestens 2 Verletzungen seiner Autonomie: Denn
1. muss er – und das steht sogar im Gesetz – in die Lage versetzt
werden, autonom zu entscheiden, indem er angemessen aufge-
klärt und informiert wird, und
2. wurde sein Einverständnis mit der Untersuchung, deren Ziel und
Zweck er gar nicht verstanden hatte, stillschweigend vorausgesetzt.
Übrigens: Nicht nur für ärztliche Eingriffe, auch für Pflegemaßnahmen
gilt: Sie dürfen nur mit Einwilligung des Patienten erfolgen. Viele Pflege-
kräfte sind sich darüber nicht im Klaren, denn sie sind der Auffassung,
da es sich bei der Pflege um die Sicherung menschlicher Grundbedürf-
nisse handle, sei ein Patient automatisch damit einverstanden.
Prinzip Gerechtigkeit
Auch im Bezug auf das, was gerecht ist, gibt es unterschiedliche Stand-
punkte: Ist Gerechtigkeit dasselbe wie Rechtmäßigkeit, also gesetzeskon-
formes Verhalten? Oder meint Gerechtigkeit, dass alle das Gleiche be-
kommen? Oder dass alle das bekommen, was sie tatsächlich brauchen?
Oder dass alle nur das bekommen, was sie verdient haben?
Die Geschichte von Rainer S.: Teil III
»Die Station ist einfach nicht gut besetzt!«
Rainer S. hat es sofort bemerkt: Keiner hat Zeit für ihn. Der Arzt ist in
Eile und der Pfleger schon unterwegs zum nächsten Patienten. Von
beiden hätte er gern Auskunft über die Untersuchung bekommen, die
ihm so viele Bauchschmerzen bereitet. Zur Last fallen möchte er auch
nicht, er sieht ja, wie das Personal rennt. Er versteht: Vor die Alternative
gestellt, mit ihm ein ausführliches Aufklärungsgespräch zu führen
oder einen anderen Patienten zu versorgen, hat sich das Personal für
das zweite entschieden. Denn schließlich kann sich niemand verdop-
peln – hier ein Patientengespräch führen und gleichzeitig dort einen
Verband wechseln. Und Rainer S. geht durch den Kopf, was er neulich
in der Zeitung gelesen hat: »Pflegenotstand in deutschen Kliniken«
stand da, und »Hier ist die Gesellschaft als Ganzes gefordert.«

5
53
Prinzip Dialog
Kommunikation, das Miteinander-Sprechen als Praxis der gegenseitigen
Würdigung und Wertschätzung ist etwas, was gerade vor dem Hinter-
grund personeller und zeitlicher Engpässe sehr schnell zu kurz kommt:
Da wird angeordnet, anstatt miteinander zu reden, mitgeteilt anstatt zu
informieren und aufzuklären und durchgeführt, ohne sich vorher der
Zustimmung des Patienten zu vergewissern. Diese Asymmetrie in der
Kommunikation wird durch Zeit- und Personalnot noch gefördert und
damit das Gefühl der betroffenen Patienten, als Mensch nicht gesehen
zu werden und mehr eine Nummer, ein Fall zu sein denn eine Person.
Die Geschichte von Rainer S.: Teil IV
»Lesen Sie das. Da steht alles drin.«
Rainer S. wollte sich über die bevorstehende Untersuchung informie-
ren und spricht noch einmal den Pfleger darauf an. Wie oft in solchen
Fällen wird auch ihm eine schriftliche Information in die Hand gedrückt
mit dem Worten: »Lesen Sie das. Da steht alles drin!« Mit Kommunika-
tion hat das nichts zu tun. Vielleicht liest Herr S. das Schriftstück, und
vielleicht versteht er auch den Inhalt. Das ungute Gefühl, abgefertigt
worden zu sein, bleibt. Um Antworten auf Fragen, die er gern stellen
würde, zu bekommen, muss er wieder nach der Klingel greifen und um
etwas bitten, muss nun seinerseits wieder die asymmetrische Situation
herstellen, in der er der Unwissende ist und der andere der Schlaue.
Und dieser Schlaue hat womöglich noch nicht einmal Zeit für ihn, so
dass Herr S. sich des Gefühls nicht erwehren kann, zu stören und von
Wichtigerem abzuhalten. Also unterdrückt er seine Fragen.
Ein klärendes Gespräch gleich von Anfang an hätte Herrn S. in
mehrfacher Hinsicht gut getan:
Er hätte danach das Gefühl gehabt, Bescheid zu wissen: Das ist
die Untersuchung, und so wird sie durchgeführt. Bei Fragen hätte
er gleich nachhaken können, Bedenken wären möglicherweise
leicht auszuräumen gewesen.
So, in einem partnerschaftlichen Dialog, hätte Herr S. gespürt:
»Hier werde ich ernst genommen und wertgeschätzt.«.
4
4
6
5.2 · Ethik regelt unser Zusammenleben

54
Kapitel 5 · Professionelles Berufsverständnis braucht Ethik
Gut und umfassend informiert hätte sich Herr S. guten Gewissens
gegen die Untersuchung entscheiden können oder, wie man ihm ge-
raten hat, dafür. In beiden Fällen hätte er eine autonome Entscheidung
treffen können.
Prinzip Fürsorge
Fürsorge wird manchmal missverstanden als verkappte Bevormundung.
Das ist Fürsorge nicht. Fürsorge nimmt Bezug auf die Würde des Men-
schen und seine Autonomie. Kurz: Fürsorge respektiert die Eigenheiten
des anderen, sie entmündigt ihn nicht. Entsprechend geht eine fürsorg-
liche Pflege nicht am Gepflegten vorbei, sondern bezieht in aktiv mit
ein, verhält sich solidarisch und ergreift Partei für ihn, wenn er sich
selbst nicht mehr vertreten kann. Das Spannungsfeld spannt sich auf
zwischen der Autonomie des Pflegebedürftigen und der Fürsorge für
ihn: Nimmt die Fürsorglichkeit überhand und missachtet dabei die
Autonomie des Patienten, wirkt sie entmündigend. Wird die Autonomie
allein zum Dreh- und Angelpunkt aller Entscheidungen und fehlt es
an mitfühlender Fürsorge, wird Zuwendung kalt und gleichgültig. Am
Bespiel von Rainer S. lässt sich das gut veranschaulichen:
Die Geschichte von Rainer S.: Teil V
»Zwingen können wir ihn nicht ....«
Verunsichert über Sinn und Zweck der Untersuchung hat sich Rainer S.
am Ende dagegen entschieden, »in die Röhre geschoben zu werden.«
»Okay!« sagt sich das Personal, »wenn das seine Entscheidung ist –
zwingen können wir ihn nicht.« Und das, obwohl alle Beteiligten
wissen, dass die Untersuchung über die nachfolgende Therapie und
möglicherweise deren Erfolg entscheidet. Herrn S. jetzt unverrichteter
Dinge nach Hause zu schicken, hätte zwar seine Autonomie berück-
sichtigt, wäre aber wenig fürsorglich gedacht. Fürsorglich wäre ge-
wesen nachzufragen, warum Herr S. die Untersuchung ablehnt – mög-
licherweise hatte er nur Angst vor den höllischen Rückenschmerzen,
die er auf sich zukommen sieht, wenn er während der Untersuchung
eine halbe Stunde lang auf dem Rücken liegen muss. Und sicherlich
hätte man dafür eine Lösung finden können.

5
55
Prinzip Verantwortung
Lange Zeit galt die Pflege als ein Assistenzberuf und Pflegende als eine
Berufsgruppe, die weisungsgebunden handeln. Heute gehört es zum
professionellen Berufsverständnis Pflegender, die Verantwortung für das
eigene Handeln und damit für die Patienten, die sich ihnen anvertraut
haben, zu übernehmen. Diese besondere Verantwortung ist begründet in
der Abhängigkeit des Patienten, die unter dem Stichwort »Asymmetrie«
schon erwähnt wurde. Die Verantwortung gründet sich aber auch auf
das Vertrauen, das der Patient Pflegenden und Ärzten entgegenbringt.
Ver-antwort-ung ist daher die professionelle Antwort auf krankheits-
oder verletzungsbedingte Hilfsbedürftigkeit und entgegengebrachtes
Vertrauen. Man stelle sich vor, eine Pflegeperson hängt einer Patientin
eine Infusion an mit den Worten: »Ich weiß ja auch nicht, warum Sie die
kriegen, da saust Ihnen der Blutdruck ja gleich in den Keller, aber auf
dem Plan hier steht es so!« Wie viel Vertrauen wäre hier verspielt, wie
viel Würde missachtet – und wie unprofessionell gehandelt!
Die Geschichte von Rainer S.: Teil VI
»Davon weiß ich nichts!«
Auf Zureden seiner Ehefrau will Rainer S. nun doch das CT machen lassen.
Und nun kommt niemand, um ihn in den Untersuchungsraum zu brin-
gen. Er wartet. Was er nicht weiß: Während er noch immer ratlos auf der
Bettkante sitzt, klingelt im Stationszimmer das Telefon: »Wo bleibt denn
Herr S.?!? Hier ist alles fertig, und wer nicht da ist, ist Herr S.!« Am späten
Nachmittag dann schaut ein junger Pfleger bei Herrn S. zur Tür herein:
»Morgen um 10 zum CT.« – »Aber darauf habe ich heute gewartet!«, ant-
wortet Rainer S. »Heute??«, fragt der Pfleger. »Davon weiß ich nichts!«
Eine professionelle Dosis Verantwortungsübernahme hätte hier
gleich 3 »Missverständnisse« ausgeräumt bzw. gar nicht erst entste-
hen lassen:
den verpassten Untersuchungstermin,
Herrn S.’ unnütze Wartezeit auf eine Untersuchung, die nicht statt-
findet,
einen Kollegen, der nicht entsprechend informiert ist.
4
4
4
6
5.2 · Ethik regelt unser Zusammenleben

56
Kapitel 5 · Professionelles Berufsverständnis braucht Ethik
Bloß: Wer war verantwortlich dafür?!? Verantwortung kann leicht im
Team verschwinden, wenn nicht jede und jeder eine gute Portion Mit-
verantwortung für das eigene Arbeitsumfeld mitbringt.
Die Geschichte von Herrn S. zeigt, wie »alltäglich« Verletzungen aller
ethischen Prinzipien sind. Wie wichtig eine professionelle Grund-
haltung und die Mitverantwortung aller Helfenden für das Geschehen
in der Institution sind, kann man spüren, wenn man versucht, sich in
Herrn S. hineinzuversetzen. Nicht aufgeklärt und in Entscheidungen
miteinbezogen, abgefertigt und uninformiert, fühlt er sich wie eine
Nummer, ein Gegenstand, über den verfügt wird. Professionalität
kommt nicht ohne Ethik aus. Denn es geht dabei um die Würde – so-
wohl der Hilfsbedürftigen als auch der Helfer.
Fazit
Die prinzipielle Asymmetrie im Verhältnis zwischen »wissendem«
Gesundheitsberufler und »unwissendem« Patienten kann durch
ein Verhalten, das ethischen Prinzipien folgt, ausgeglichen werden.
Mit anderen Worten: Wenn die Würde des Menschen beachtet
wird, die ansonsten in Gefahr geraten kann.
4
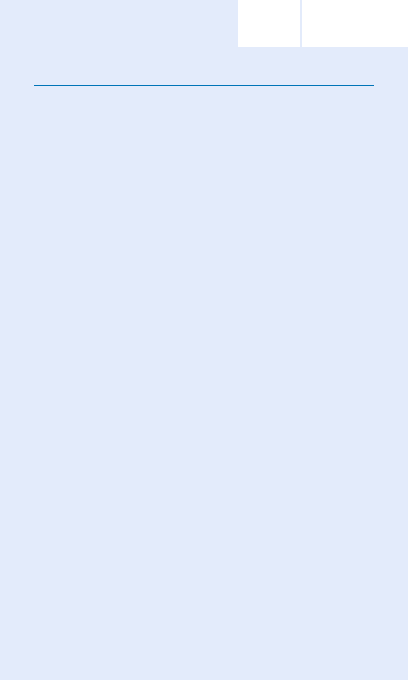
57
Meine Geschichte: Heiko Dahl
Physiotherapeut, Leiter der Arbeitsgemeinschaft Manuelle Therapie
im Deutschen Verband für Physiotherapie – Zentralverband der Physio-
therapeuten/Krankengymnasten e.V. (ZVK)
»Irgendetwas stimmt nicht«
»Irgendetwas stimmt nicht«. Mit dieser Bemerkung, dick und unter-
strichen in der Krankenakte, schloss eine aufmerksame Kollegin ihre
Bitte, mir einen Patienten einmal genauer anzuschauen. »Ich komme
da nicht weiter«, hatte sie geschrieben. Und offenbar war sie nicht
die erste, die mit dem Patienten »nicht weiter« gekommen war. Schon
einige Ärzte hatte der Mann aufgesucht, keiner hatte ihm helfen
können. Diffuse Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule plagten
den durchtrainierten Mittvierziger – einen aktiven Tennisspieler –
immer wieder, dazu kamen Schmerzen im Arm, die sich in unregel-
mäßigen Abständen vor allem beim Tennisspielen bemerkbar
machten.
Keine Besserung trotz mehrfach geänderter
Behandlungsstrategien
Beschwerden, die im Zusammenhang mit Sport auftreten oder da-
durch sogar verursacht werden, sind kein seltenes Phänomen in der
physiotherapeutischen Praxis. Nachdem ich den Patienten sorgfältig
untersucht hatte, begann ich mit der Behandlung. Leider musste ich
mir nach 10 Behandlungen aber ebenfalls eingestehen: Ich kam mit
diesem Patienten nicht weiter. Obwohl ich mehrfach meine Behand-
lungsstrategie geändert hatte, stellte sich keinerlei Besserung ein.
Die Symptome, unter denen der Patient zu Anfang gelitten hatte,
blieben hartnäckig weiterbestehen. Schließlich wendete ich mich
mit demselben Satz, den meine Kollegin in die Krankenakte ge-
schrieben hatte, nach vier Monaten hilfesuchend an den behandeln-
den Arzt: »Irgendetwas stimmt nicht«.
O
5
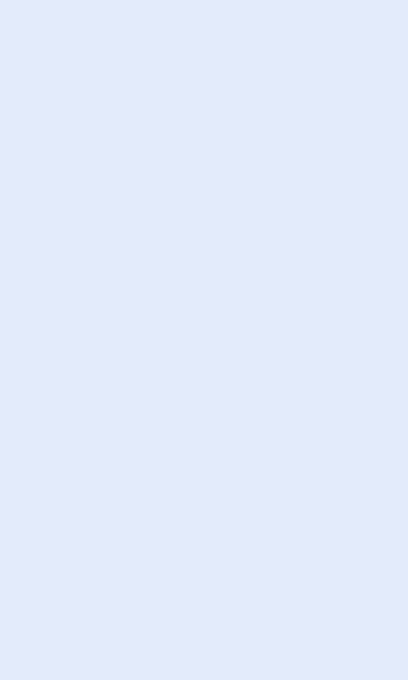
Die nun folgenden Untersuchungen führten zu einem nieder-
schmetternden Befund: ein Karzinom im fortgeschrittenen Stadium.
Die Brustwirbelsäule war stark beschädigt, Metastasen hatten sich
ausgebreitet. Die Therapie, die daraufhin eingeleitet wurde, konnte
den Patienten nicht mehr retten – nach einem Jahr verstarb er.
Seitdem habe ich mich oft gefragt, ob alles anders gelaufen wäre,
der Patient vielleicht sogar noch leben könnte, wenn ich diesen
drei Worten »irgendetwas stimmt nicht« in der Karteikarte des Pa-
tienten mehr Beachtung geschenkt hätte. Heute beziehe ich den
Arzt ganz früh mit ein, wenn ich das Gefühl habe, dass ein Behand-
lungserfolg zu lange auf sich warten lässt.

6
59
Dekubitusprophylaxe –
aber bitte richtig!
Christel Bienstein
Die Bezeichnung »Dekubitus« für ein Druckgeschwür leitet sich aus
dem Lateinischen ab – »decumbere« bedeutet so viel wie »sich nieder-
legen« und verweist damit auf die häufigste und wichtigste Ursache für
die Entstehung eines Dekubitus: das lange und womöglich bewegungs-
lose Liegen. In der Pflegepraxis hat man dieses zentrale Pflegeproblem
lange erkannt – die Zahl der an einem Dekubitus erkrankten Menschen
ist zwischen 2000 und 2008 um die Hälfte zurückgegangen, obwohl die
Zahl der potentiell gefährdeten Personen gleich geblieben ist [33].
Geht schnell, sagt viel: der Fingertest!
Beim Lagern eines Patienten bemerken Sie eine gerötete
Körperstelle. Bleibt diese Stelle auf Druck mit dem Finger rot, ist
das Gewebe bereits geschädigt! Gesunde Haut wird weiß!
6.1
Die 5 wichtigsten Fehler bei der Vermeidung
von Druckgeschwüren
Die Vermeidung von Druckgeschwüren gehört zum Alltagsgeschäft
der Kranken- und Altenpflege. Trotzdem oder gerade deswegen haben
sich hier eine Vielzahl von Mythen gebildet und gehalten, die dem
Patienten mehr schaden als nützen. Und Hand aufs Herz: Sind Sie noch
nie einer oder sogar mehreren dieser »Empfehlungen«, die allesamt
einem Druckgeschwür vorbeugen sollen, begegnet? Häufig sind dann
die entsprechenden Pflegehandlungen zu einem regelrechten Ritual ge-
worden.
>
6.1 · Die 5 wichtigsten Fehler

60
Kapitel 6 · Dekubitusprophylaxe – aber bitte richtig!
1. »Der Patient muss möglichst weich liegen.«
Falsch!
Je weicher ein Patient gelagert wird, umso weniger gut
kann er sich bewegen. Und Bewegungsmangel fördert die Ent-
stehung von Druckgeschwüren.
Richtig:
Das Gegenteil einer möglichst weichen Lagerung ist
nicht eine harte, sondern eine druckentlastende bzw. -reduzie-
rende Lagerung. Diese sollte
a. die Mobilität des Patienten nicht einschränken, sondern
fördern,
b. den Druck möglichst großflächig verteilen und
c. alle 2 Stunden durch eine Positionsveränderung geändert
werden.
2. »Fersenschoner schützen die Fersen.«
Falsch!
Auch der vermeintlich weichste Watteverband kann eine
Ferse nicht vor Dekubitus schützen.
Richtig:
Nur die konsequente Freilagerung der Ferse z. B. mit
Hilfe eines zusammengerollten Handtuchs kann einem Dekubi-
talgeschwür vorbeugen.
Immer beachten: Die Druckentlastung einer bestimmten
Körperregion geht immer mit einer Druckbelastung einer
anderen Region einher. Ziel muss daher stets sein, den Aufliege-
druck auf einer möglichst großen Fläche zu verteilen.
3. »Mit den richtigen Lagerungssystemen liegt der Patient optimal
und braucht über viele Stunden nicht umgelagert zu werden.«
Nein!
Selbst Spezialsysteme, die optimal auf den Patienten ab-
gestimmt sind, ersetzen nicht das regelmäßige Umlagern.
Nur wenn der Patient alle 2 Stunden umgelagert wird, können
Spezialsysteme dazu beitragen, dass Dekubitalgeschwüre ver-
mieden werden. Die (allgemeine) Zeitangabe von 2 Stunden
muss jedoch von Beginn der Positionsveränderung an über-
prüft werden. Denn es kann sein, dass die Position eines Pa-
tienten, der z. B. sehr kachektisch ist, häufiger verändert werden
muss.
5
5
5
5
5

6
61
Wichtig ist die sprachliche Veränderung vom »Lagerungsplan«
zum »Bewegungsplan«. Der Begriff »Lagerung« hat lange dazu
geführt, dass Patienten mittels Kissen ruhig gestellt wurden.
Gerade dieses »ruhige« Liegen führt aber zu einem Dekubitus.
Bewegung muss das primäre Mittel sein!
Richtig:
Spezialmatratzen für dekubitusgefährdete Patienten re-
duzieren bei sachgerechter Anwendung das Risiko eines Deku-
bitus. Grundprinzip jeder Lagerung ist immer, die Auflagefläche
so groß wie möglich zu halten. Besonders das gut gemeinte
Hochstellen des Kopfteils birgt spezielle Gefahren für den Pa-
tienten: die Entstehung von Scherkräften, die das aufliegende
Gesäß ganz besonders belasten. Gemeint ist damit folgender
Vorgang: Der hochgelagerte Patient rutscht im Bett infolge der
Schwerkraft langsam in Richtung Fußende. Dabei bleibt die
Haut wie an der Unterlage »kleben« und wird dadurch extrem
strapaziert.
Deswegen: Bei der Hochlagerung auf die Hüftbeugung achten.
Das Kopfteil des Bettes muss mindestens 90 cm betragen, weil
der Mensch sich nicht im BWS- oder LWS–Bereich, sondern
nur im Hüftgelenk beugen kann.
Beim Lagern darauf achten, dass der Patient im Bett gewebe-
und hautschonend nach oben gehoben wird. Schon die Reibung
der Gesäßhaut auf der Unterlage beim Hochziehen des Pati-
enten im Bett ist eine Belastung, die vermieden werden sollte.
Inzwischen verfügen wir über Bewegungskonzepte, die Pfle-
gende dazu qualifizieren, Patienten ohne Reibungs- und Scher-
kräfte zu bewegen. Hier hat sich besonders das Konzept der
Kinästhetik bewährt, das inzwischen in vielen Ausbildungsins-
tituten vermittelt wird.
Vorsicht!
Je mehr Lagerungshilfsmittel verwendet werden, umso
weniger kann der Patient sich bewegen.
>
5
5
6.1 · Die 5 wichtigsten Fehler

62
Kapitel 6 · Dekubitusprophylaxe – aber bitte richtig!
4. »Eis und Fön sorgen für eine optimale Durchblutung
und schützen so vor Druckgeschwüren.«
Falsch!
Dass Eisen und Fönen zu einer besseren Durchblutung
der Körperregionen führt, die besonderem Lagerungsdruck
ausgesetzt sind, ist wissenschaftlich widerlegt. Nicht nur, dass es
nicht zu der erwünschten verbesserten Durchblutung kommt –
Eis schädigt die Haut sogar und Fönen trocknet sie aus. Im Er-
gebnis ist die Haut sogar anfälliger für Druckgeschwüre!
Richtig:
Unumstrittenes A&O jeder Hautpflege ist, die Haut vor
Feuchtigkeit – Schweiß, Urin und Stuhl – zu schützen. Eine
Hautpflege mit Wasser und möglichst unter Vermeidung von
Seife oder Tensiden (häufig in Waschlotionen enthalten) sowie
die Anwendung einer Wasser-in-Öl-Lotion können unterstüt-
zend wirken.
5. »Sitzringe entlasten das Steißbein.«
Nur bedingt!
Denn einerseits entlasten sie zwar das Steißbein,
andererseits aber können sie dazu führen, dass sich das Blut in
den Oberschenkeln staut und Gewebe gequetscht wird. Sitz-
ringe führen zu einem Abschnüren der Steiß- und Sitzbein-
region und können nicht unter dem Gesichtspunkt der Deku-
bitusvermeidung verwendet werden.
Patienten sind in sitzender Position eher gefährdet, einen Dekubi-
tus zu entwickeln, als wenn sie über mehr Auflagefläche verfügen.
Das ist die Herausforderung: zwischen sitzenden und liegenden
Positionen den richtigen Zeitintervall zu finden. Eine jeweilige
Überprüfung der Haut ist erforderlich.
6.2
Einen guten Job machen, ist nicht alles
Dass personelle Engpässe auf Station und chronischer Personalmangel
zu Lasten der Patienten gehen ist einleuchtend, aber in Deutschland
nicht ausreichend untersucht.
5
5
5
>

6
63
Weniger Pflegekräfte – mehr Dekubitalgeschwüre
Das IQWiG, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen, hat 2006 auf Grundlage internationaler Studien ein
Arbeitspapier verfasst, das sich speziell mit dem Zusammenhang
zwischen Pflegekapazität und Ergebnisqualität in der stationären Ver-
sorgung befasst. Diesem Arbeitspapier zufolge weisen mehrere Studien
darauf hin, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Personal-
situation eines Krankenhauses und dem Auftreten von z. B. Druck-
geschwüren. Danach gibt es »einen signifikanten negativen Zu-
sammenhang zwischen der Anzahl der Stunden der amtlich zuge-
lassenen Pflegekräfte pro Pflegetag und dem Auftreten eines Dekubital-
geschwürs« [15].
Fazit
Mythen zur Vermeidung von Dekubitalgeschwüren führen leider
oft zu deren Entstehung! Die Betreuung gefährdeter Patienten
verlangt jedoch neben dem richtigen Know-how auch genügend
Zeit für dessen Umsetzung. Fehlt es an qualifiziertem Personal,
fehlt es auch an Wissen und meist auch an Zeit für die Durchfüh-
rung. Zu wenig qualifiziertes Personal ist daher ein Risikofaktor für
die Entstehung von Dekubitalgeschwüren.
4
6.2 · Einen guten Job machen, ist nicht alles
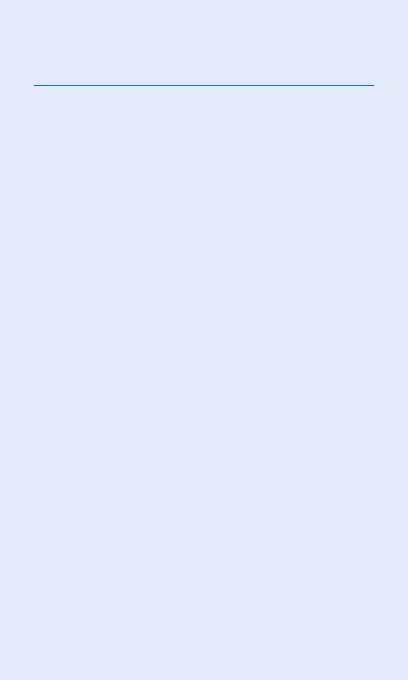
Meine Geschichte: Susanne L.*
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin
Unaufmerksamkeit + schlechte Beschriftung = Verwechslung
Wir, die Schülerin, die ich zu beaufsichtigen hatte, und ich waren
zufrieden, als wir nach Hause gingen: Wieder ein Tag auf Station,
der gut gelaufen war. Bis ich zu Hause dann einen Anruf von Station
bekam: Bei dem Kind, das eine Antibiotikakurzinfusion bekommen
sollte, war anstelle der Kochsalzlösung, mit der das aufgelöste Anti-
biotikum verdünnt werden sollte, Kochsalzlösung mit einem Anteil
Heparin genommen worden! Stutzig geworden war ein Kollege, als
er feststellte, dass etwas von der Kochsalz-Heparin-Lösung fehlte.
Nachdem er hin- und hertelefoniert hatte, war nur noch eine Erklä-
rung geblieben: Das Kind hatte das Heparin bekommen! Und die
Laborwerte bestätigten seinen Verdacht: Die Blutgerinnung war deut-
lich vermindert!
Wie auf heißen Kohlen
Am liebsten wäre ich sofort zurück in die Klinik gefahren, aber meine
Kollegen beruhigten mich erst einmal, dem Patienten gehe es soweit
gut. Die Stationsärztin sei auch schon informiert und habe sich bereits
mit dem Chefarzt in Verbindung gesetzt. Ich saß wie auf heißen Koh-
len: Wie hatte das passieren können? Ausgerechnet mir, die ich sonst
lieber zweimal zu viel kontrolliere als einmal zu wenig. Zwar war es
die Schülerin gewesen, die zu der falschen Lösung gegriffen und sie
auch beschriftet hatte, aber ich hatte daneben gestanden, hatte die
Aufsichtspflicht. Also war es mein Fehler! Ich hatte der Schülerin an
sich zu Recht vertraut, denn sie ist sehr gewissenhaft, aber ich hätte
trotzdem überprüfen müssen, was sie tat. Und ich wusste: Die Fläsch-
chen mit der Kochsalzlösung und die mit Heparin sehen praktisch
identisch aus. Nur ein winzig kleines Etikett auf der Heparinflasche
machte da den Unterschied – und das ist zu wenig!
O
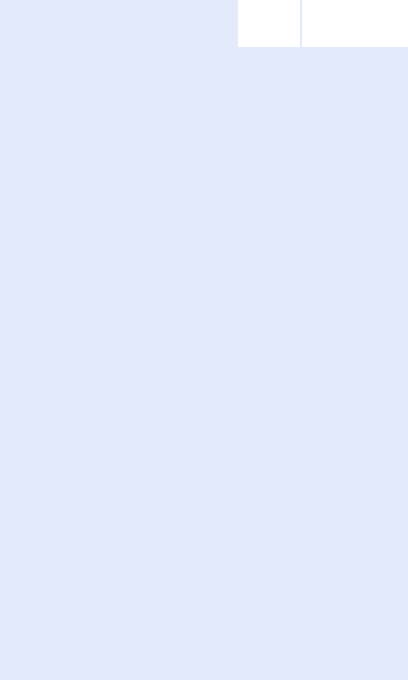
65
Tatsächlich ist das Kind nicht ernsthaft zu Schaden gekommen.
Den Eltern wurde erklärt, dass sie in den nächsten 24 Stunden auf-
passen sollten, dass ihr Kind sich nicht stößt, und auch warum. Diese
offene Art, mit einem Fehler, der nun einmal passiert war, umzuge-
hen, hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass die Eltern relativ ge-
lassen darauf reagieren konnten.
Guter Umgang mit dem Fehler und auch eine Lösung dafür
Im Anschluss an dieses Ereignis, das ja glücklicherweise glimpflich
ausgegangen ist, hat das Qualitätsmanagement unserer Klinik eine
Besprechung einberufen. Dabei sind wir noch einmal dezidiert durch-
gegangen, wie es zu der Verwechslung der beiden Fläschchen hatte
kommen können und wie man das in Zukunft vermeiden konnte. Er-
gebnis: Heparinfläschchen werden seitdem mit einem großen roten
Aufkleber versehen, sodass man sie überhaupt nicht mehr mit einer
einfachen Kochsalzlösung verwechseln kann. Am Ende war ich sehr
erleichtert: Das Kind hatte von der ganzen Aufregung gar nichts be-
merkt, die Eltern waren verständnisvoll, meine Kollegen und der Chef-
arzt sind sachlich und freundlich mit unserem Missgeschick umge-
gangen. Und schließlich ist sogar noch eine Lösung dabei herausge-
kommen, mit der eine Wiederholung des Fehlers in Zukunft ziemlich
sicher vermieden werden kann.
* Name und Anschrift der Interviewpartnerin sind den Herausgebern
bekannt.
6

66
Kapitel 7 · Kein Fehler vor dem Schnitt
Kein Fehler vor dem Schnitt
Kai Kolpatzik
Erfahrung nennt man die Summe aller unserer Irrtümer.
Thomas Alva Edison
Solche Einsichten vermögen uns in vielen Situationen helfen – gerade
im Bezug auf einen Aufenthalt im Krankenhaus und eine bevorstehen-
den Operation trösten sie uns jedoch überhaupt nicht. Denn die Vor-
stellung, aus der Narkose aufzuwachen und einen Schnitt am falschen
Knie oder einen Gips um den gesunden Arm zu haben, erleichtert nie-
mandem den Weg in den OP-Saal.
In Deutschland kommt es schätzungsweise zwischen 100- und
240-mal im Jahr zu Verwechslungsfällen mit juristischen Konse-
quenzen. Wahrscheinlich ist das aber nur die Spitze des Eisbergs.
Denn etwa ein Fünftel aller Chirurgen geben an, im Laufe ihres
Berufslebens sei ihnen mindestens einmal eine Verwechslung
passiert.
Eingriffsverwechslungen sind immer wieder einmal Gegenstand von
Krankenhauswitzen – in Wahrheit können sie für die Betroffenen
schwerwiegende und sogar katastrophale Folgen haben. Rein theore-
tisch betrachtet ist eine Eingriffsverwechslung zu 100% vermeidbar.
Die Arbeitsteiligkeit im Krankenhaus und oftmals unübersichtliche
Situationen, in denen unter Zeitdruck schnell und richtig gehandelt
werden muss, bergen jedoch das potenzielle Risiko einer Gefährdung
für den Patienten, wenn keine wirksamen und von allen Beteiligten in-
ternalisierten Sicherheitsmaßnahmen vorhanden sind.
>

7
67
7.1
Was ist eine Eingriffsverwechslung?
Wenn es bei operativen oder invasiven Eingriffen zu Verwechslungen
kommt, spricht man von Eingriffsverwechslungen. 3 Arten kann man
unterscheiden:
der Eingriff wurde an der falschen Körperseite bzw. dem falschen
Eingriffsort vorgenommen,
der Eingriff wurde am falschen Patienten vorgenommen,
es wurde der falsche Eingriff vorgenommen.
Stufenplan gegen Eingriffsverwechslung
Zwischen der Aufnahme bis hin zu dem Moment, in dem der Patient auf
dem OP-Tisch liegt, gibt es sehr viele Kontakte mit sehr vielen unter-
schiedlichen Personen des Krankenhausteams – nur dann, wenn alle die
gleichen Regeln zur Vermeidung einer Verwechslung kennen und entspre-
chend danach handeln, können Verwechslungen ausgeschlossen werden.
In einer Studie konnten 17 Fehler nachgewiesen werden, deren
Zusammenspiel zur Verwechslung einer Patientin führte.
Das Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. hat 2005 eine Arbeits-
gruppe gegründet, die sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Heraus-
gekommen ist eine Handlungsempfehlung zur Vermeidung von Ein-
griffsverwechslungen in der Chirurgie bzw. den operativen Fächern,
deren Umsetzung insgesamt über alle Prozesse maximal 3 Minuten
dauert. In diesem offiziellen Dokument werden 4 Handlungsstufen
unterschieden, deren Befolgung Patienten sowohl in Krankenhäusern
als auch in Praxen wirksam vor Verwechslungen schützen kann:
Stufe 1: Identifikation
Im Rahmen des Aufklärungsgesprächs werden die Personaldaten des
Patienten genau überprüft und ggfs. ergänzt, um auch allen beteiligten
Mitarbeitern eine exakte Identifikation zu ermöglichen. Außerdem
zeigt der Patient jeweils selbst auf die zu operierende Stelle.
4
4
4
>
7.1 · Was ist eine Eingriffsverwechslung?
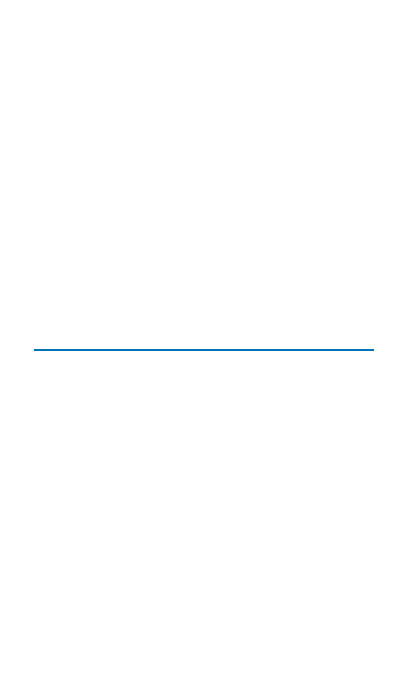
68
Kapitel 7 · Kein Fehler vor dem Schnitt
Stufe 2: Markierung
Der Eingriffsort wird mit einem nicht abwischbaren Stift klar markiert.
Stufe 3: Saal-Check
Unmittelbar bevor der Patient in den OP kommt, wird noch einmal
sicher gestellt, dass der richtige Patient in den richtigen Operationssaal
kommt und die Markierung vorhanden ist.
Stufe 4: Team-Time-Out
Bevor der erste Schnitt getan wird, nimmt das gesamte OP-Team (alle
Anwesenden!) eine kurze Auszeit – »Time Out« – und überprüft und
bestätigt auf Basis einer »Mini-Checkliste«, dass es sich um den rich-
tigen Eingriff beim richtigen Patienten und in dessen richtiger Körper-
region handelt.
7.2
Ohne Konsequenz geht es nicht
Auch die besten Handlungsempfehlungen greifen nur, wenn sie
konsequent umgesetzt werden.
Die 4 Stufen zur Vermeidung von Eingriffsverwechslungen leuchten
unmittelbar ein. Wirksam greifen können sie jedoch nur, wenn alle Be-
teiligten sie kennen und beherzigen. Dazu schlägt das Aktionsbündnis
Patientensicherheit e.V. folgende Vorgehensweise für die Einführung
der Empfehlungen im Krankenhaus oder in der Praxis vor:
Die Führungsebene muss die klare Entscheidung treffen: Wir setzen
die Handlungsempfehlungen um!
In Folge werden alle Mitarbeiter detailliert mit den einzelnen Stufen
der Handlungsempfehlung vertraut gemacht: Alle wissen Bescheid!
Patienten werden idealerweise über das Prozedere schriftlich (z. B. in
Form eines Flyers) aufgeklärt: Der Patient ist aktiv miteinbezogen!
Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass sich auf jeder einzelnen dieser
Stufen Fehler einschleichen können, die dann zur Folge haben können,
>
4
4
4

7
69
dass es zu einer Verwechslung kommt. Deswegen buchstabiert das
Aktionsbündnis genau aus, was auf jeder der einzelnen Stufen genau
passieren sollte [39].
Stufe 1: Identifikation
Der Operateur oder – wenn das nicht möglich ist – ein Arzt, an den er
diese Aufgabe delegiert, überprüft aktiv die Identität des Patienten,
vergewissert sich anhand der Patientenakte, ob Eingriffsort und Ein-
griffsart exakt beschrieben wurden und gleicht den geplanten Eingriff
noch einmal mit den vorangegangenen Untersuchungen (z. B. Einwei-
sungspapiere, bildgebende Verfahren) ab.
Was bedeutet aktiv?
Aktiv heißt in diesem Falle, dass der Arzt Fragen, auf die der Patient
nur mit »Ja« oder »Nein« antworten kann, unbedingt vermeidet.
Denn gerade, wenn ein Patient z. B. schwerhörig oder sehr aufge-
regt ist, antwortet er vielleicht auf die Frage, ob er Franz Müller
heiße, mit »Ja«, obwohl er Hans Müller heißt. Deswegen muss zum
Abgleich der Angaben in der Patientenakte gefragt werden:
Wie heißen Sie?
Wann sind Sie geboren worden? usw.
Zeigen, wo der Eingriff stattfinden soll
Der Operateur sollte nicht fragen, an welchem Arm der Patient ope-
riert werden soll, sondern den Patienten bitten, den Arm zu zeigen.
Denn wenn es um »links« oder »rechts« geht, kommt es ganz schnell
zu Missverständnissen: Was für mich links ist, ist für mein Gegenüber
rechts; und wenn ich noch, wie viele Menschen, gelegentlich links
und rechts verwechsle, ist ein Missverständnis geradezu vorprogram-
miert.
>
4
4
7.2 · Ohne Konsequenz geht es nicht

70
Kapitel 7 · Kein Fehler vor dem Schnitt
Wenn der Patient keine Angaben machen kann oder will
Etwas schwieriger gestaltet sich die Bestätigung der Patientenidentität,
wenn der Patient keine Angaben zu seiner Person machen kann oder
will. In diesem Fall sollte
dokumentiert werden, dass der Patient trotz vorheriger Aufklärung
keine Angaben machen kann oder will, und
anhand der Patientenunterlagen (z. B. auch der Röntgenbilder) vom
Operateur überprüft werden, dass die Identität die richtige ist.
Bei Kindern, Menschen, die nicht oder nur wenig Deutsch
sprechen, schwerhörigen, dementen, bewusstlosen Patienten,
aber auch bei Notfallpatienten sollten Angaben zur Person mit
dem einweisenden Arzt, Angehörigen oder einem Dolmetscher
abgeglichen werden.
Identifikation des Patienten [7]
Wer?
Operateur, aufklärender Arzt, voll informierter Arzt
Wann?
Aufklärungsgespräch vor oder nach Aufnahme
Was?
Richtiger Patient
Namen und Geburtsdatum sagen lassen und prüfen
Eingriffsart
im Gespräch mit dem Patienten bestätigen
Eingriffsort
aktiv fragen und zeigen lassen
Angehörige einbeziehen (v. a. bei Kindern und nicht urteils-
fähigen Patienten)
Abgleich mit Akten und Bildern
Stufe 2: Markierung des Eingriffsorts
Das Aktionsbündnis Patientensicherheit empfiehlt, dass der Operateur
oder ein anderer Arzt, an den er diese Aufgabe delegiert hat, die Mar-
4
4
>
4
4
4
4
4
4
–
4
–
4
–
–
4

7
71
kierung vornimmt. Dabei sollte immer nach dem gleichen Schema vor-
gegangen werden:
Überprüfung der Identität des Patienten anhand der Patientenakte
Aktive Befragung des Patienten nach Identität, geplantem Engriff
und Eingriffsort vor Gabe der Prämedikation
Markierung des Eingriffsorts/der Eingriffsorte mit einem nicht-
abwischbaren Stift (z. B. Kreuz oder Pfeil, nicht »Ja« oder »Nein«!)
Markierung möglichst beim wachen Patienten, damit dieser aktiv
miteinbezogen werden kann.
Diese zweite Überprüfung der Patientenidentität vom Operateur,
der die Markierung vornimmt, ist eine weitere Sicherungsstufe zur
Vermeidung einer Eingriffsverwechslung. Unstimmigkeiten können
aufgedeckt werden, bevor »das Kind in den Brunnen gefallen ist«.
Markierung Eingriffsort [7]
Wer?
Operateur, aufklärender Arzt, voll informierter Arzt
Wann?
außerhalb des OPs
beim wachen Patienten
Was?
Abgleich mit den Akten
richtiger Patient
Eingriffsart
Eingriffsort
Patienten aktiv einbeziehen
Eingriffsort zeigen lassen
Angehörige einbeziehen
Markierung
nur Eingriffsort
eindeutige Zeichen (Kreuz, Pfeil, Initialien)
nicht abwischbarer Stift
mehrere Eingriffsorte: alle markieren
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
–
–
–
4
–
–
4
–
–
–
–
7.2 · Ohne Konsequenz geht es nicht
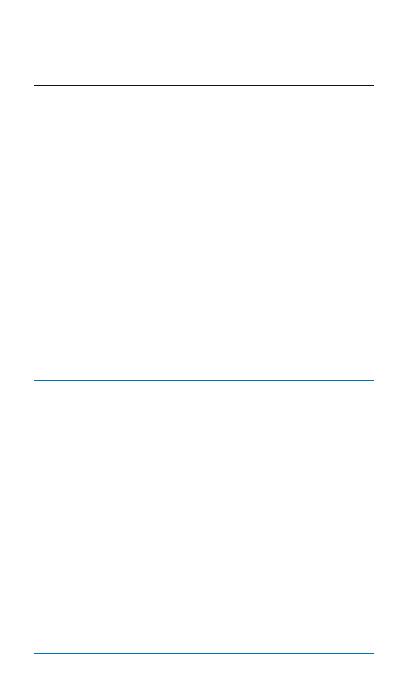
72
Kapitel 7 · Kein Fehler vor dem Schnitt
Stufe 3: Saal-Check
Häufig müssen Belegungen von Operationssälen ganz kurzfristig zu-
rückgenommen werden, und eine für OP-Saal A vorgesehene Opera-
tion wird auf OP-Saal C verschoben. Oder es erfolgt – gerade, wenn es
sich um kurze Eingriffe handelt – eine OP nach der anderen. Damit
dann nicht aus Versehen ein Patient mit einer Arthroskopie in den Saal
geschoben wird, in dem eine Struma oder ein Leistenbruch operiert
werden soll, empfiehlt das Aktionsbündnis, dass unmittelbar vor Ein-
tritt in den OP Arzt oder Pflegepersonal checken, dass der richtige
Patient für den richtigen Eingriff in den richtigen OP kommt:
Überprüfung der Patientenunterlagen (Vorname, Familienname,
Geburtsdatum, geplanter Eingriff, Eingriffsort). Zu diesen Angaben
aktiv den Patienten zu befragen, ist aufgrund der Prämedikation
meist nicht sinnvoll oder überhaupt möglich.
Überprüfung der Markierung. Ist keine Markierung des Eingriffs-
orts erfolgt, empfiehlt das Aktionsbündnis Patientensicherheit,
keine Anästhesie durchzuführen.
Zuweisung zum richtigen OP-Saal [7]
Wer?
definierte, verantwortliche Person
Wann?
unmittelbar vor Anästhesieeinleitung und vor Eintritt in den Saal
Was?
Patientenidentität
Namen und Geburtsdatum überprüfen
Eingriffsart
prüfen und bestätigen
Eingriffsort
prüfen und bestätigen
Markierung prüfen
mit Aktenabgleich
wenn möglich aktive Befragung des Patienten
Saal-Check
Zuweisung zum OP-Saal überprüfen
4
4
4
4
4
4
4
4
–
4
–
4
–
4
–
–
4
–
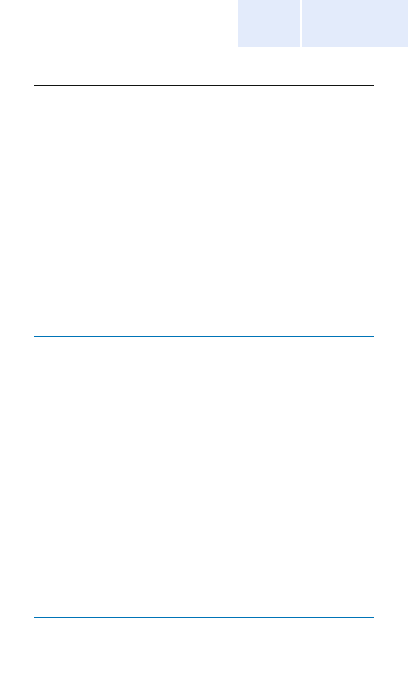
7
73
Stufe 4: Team-Time-Out
Diese halbe Minute, diese Auszeit für das OP-Team unmittelbar vor
dem ersten Schnitt, ist für die Sicherheit des Patienten außerordentlich
wichtig! Das Team-Time-Out ist keine Wartezeit auf ein fehlendes
OP-Teammitglied, sondern sollte aktiv von allen an dem Eingriff Be-
teiligten dazu genutzt werden, nochmals die einzelnen Schritte zur
Überprüfung von Patientenidentität, vorgesehenem Eingriff und Ein-
griffsort durchzugehen. Am besten geht das mit einer kleinen Check-
liste. Jemand, der für das Team-Time-Out verantwortlich ist, ruft dazu
die einzelnen Punkte auf und alle Beteiligten bestätigen sie oder ver-
neinen sie ggfs. Gibt es Uneinigkeit unter den OP-Teammitgliedern,
muss sie ernst genommen werden und, wenn keine eindeutige Klärung
erfolgen kann, der Eingriff – selbstverständlich mit einer Entschuldi-
gung an den Patienten – verschoben werden.
Team-Time-Out vor Schnitt [7]
Wer?
OP-Team
initiiert durch definierte, verantwortliche Person
Wann?
unmittelbar vor Schnitt
Was?
Letztes Innehalten – letzte Richtigkeitsprüfung
Mittels Minicheckliste
richtiger Patient (Namen und Geburtsdatum)
Eingriffsart
Eingriffsort
Aufnahmen bildgebender Verfahren
richtige Implantate verfügbar
Alle Punkte durch OK bestätigen
Durchführung des Team-Time-Out dokumentieren
4
4
4
4
4
4
4
4
–
–
–
–
–
4
4
7.2 · Ohne Konsequenz geht es nicht
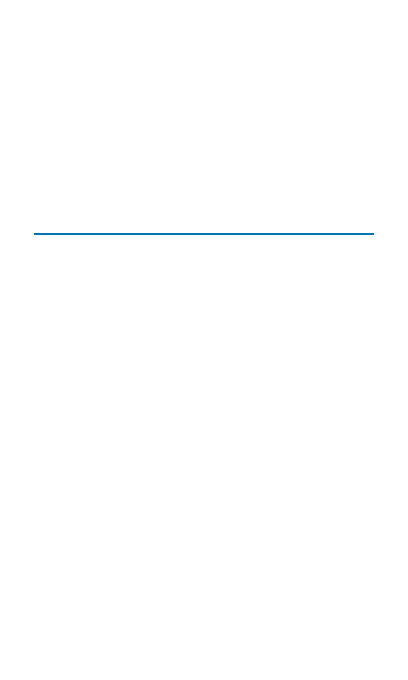
74
Kapitel 7 · Kein Fehler vor dem Schnitt
Praxistipp
Ob ein »Team-Time-Out« stattfindet oder nicht, sollte nicht dem
Zufall überlassen sein. Nur wenn jemand dafür verantwortlich ist,
in seiner Verantwortlichkeit anerkannt ist und seine Verantwor-
tung wahrnimmt, kann bei diesem letzten Schritt vor dem ersten
Schnitt noch eine mögliche Eingriffsverwechslung abgewendet
werden.
7.3
Und im Fall der Fälle?
Zunächst sollte jeweils an den entsprechenden Stellen der vier Stufen
eine umgehende Lösung des Problems gesucht werden. Muss ein Ein-
griff jedoch verschoben werden, weil auf einer der 4 Stufen zur Ver-
meidung von Eingriffsverwechslungen Unstimmigkeiten aufgedeckt
worden sind, sollte zunächst einmal der Patient darüber aufgeklärt
werden, warum eine Verschiebung notwendig wurde. Auch eine Ent-
schuldigung ist für gewöhnlich sehr am Platz, denn zu Recht sind Pa-
tienten, die einer Operation in aller Regel mit bangem Herzen ent-
gegensehen, über eine Verschiebung der gesamten Prozedur nicht
glücklich.
Eine Eingriffsverwechslung rechtzeitig zu verhindern, ist eine
Teamleistung, auf die ein Team auch stolz sein darf. Denn für den
Patienten wurden dadurch möglicherweise katastrophale Folgen
abgewehrt.
v
>
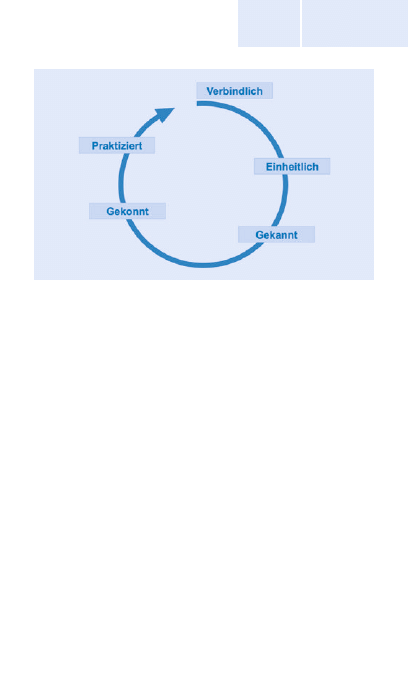
7
75
Fazit
Regeln brauchen Regeln, um zu greifen. Auch die besten Hand-
lungsempfehlungen sind nur dann erfolgreich (
.
Abb. 7.1),
wenn sie verbindlich sind – d. h. wenn sich jeder daran hält,
wenn sie einheitlich sind – d. h. dass alle Akteure sich an diesel-
ben Regeln halten,
wenn sie gekannt sind – d. h. dass alle Beteiligten umfassend
über Sinn, Zweck und Durchführung informiert sind,
wenn sie gekonnt sind – d. h. wenn alle Beteiligten in der Lage
sind, ihr Wissen auch richtig umzusetzen, und
wenn sie praktiziert werden.
4
4
4
4
4
4
Abb. 7.1. 5 Stufen der Umsetzung.
.
7.3 · Und im Fall der Fälle?
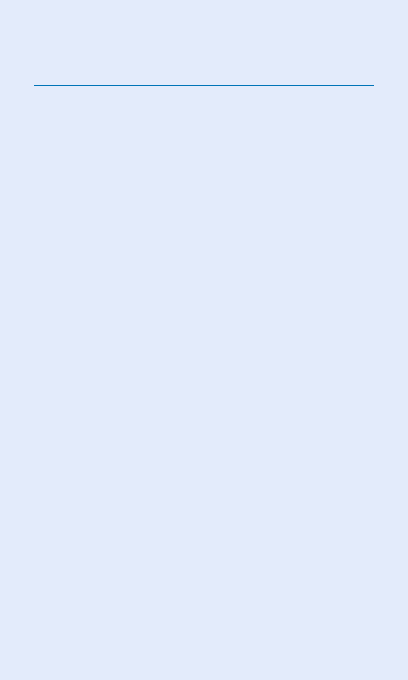
Meine Geschichte: Brigitte S.*
Pflegepädagogin
»Schule muss auch sagen: Welche Verhaltensregeln
geben wir den Schülern mit auf den Weg?«
Die Frage nach Fehlern, die schon einmal aufgetreten sind, habe ich
meinen Schülerinnen und Schülern gestellt. Und war bass erstaunt,
über wie viele Fehler berichtet wurde! Fehler, die ansonsten einfach
untergegangen wären, obwohl man so viel daraus lernen könnte!
Scheinbar harmlos: Ein Patient möchte aufstehen
Zum Beispiel, wie Handlungsketten, an deren Ende dann in Patient
(zum Glück nicht schwer) gestürzt ist, irgendwie auch ihren Ursprung
in der Ausbildungssituation haben. Die Schülerin, die mir das folgen-
de Ereignis erzählt hat, arbeitete damals auf einer der Stationen in
unserem Haus, die in verschiedene Bereiche unterteilt sind. Als
ein Patient klingelte, ging sie auf die Klingel, obwohl sie für diesen
Bereich gar nicht zuständig war. Der Patient hatte eine scheinbar
harmlose Bitte: Er wollte aufstehen. Die Pflegeschülerin setzte ihn
also, wie sie es in der Schule gelernt hatte, auf die Bettkante, streifte
ihm Schuhe über die Füße und half ihm aus dem Bett. Schon gleich
nach den ersten zwei Schritten traten dem Patienten Schweißperlen
auf die Stirn. Bevor er noch den dritten Schritt tun konnte, kollabierte
er und rutschte zu Boden. Glücklicherweise hat der Mitpatient sofort
reagiert und auf dem Gang nach Hilfe gerufen. Sogleich kamen
zwei Kollegen geeilt und mit vereinten Kräften gelang es dann, den
Patienten ins Bett zu heben. Weil der Patient langsam zu Boden ge-
rutscht war, hatte er sich zum Glück keine Verletzungen oder blauen
Flecken zugezogen. Das Ganze hätte aber auch ganz anders ausge-
hen können ...
O
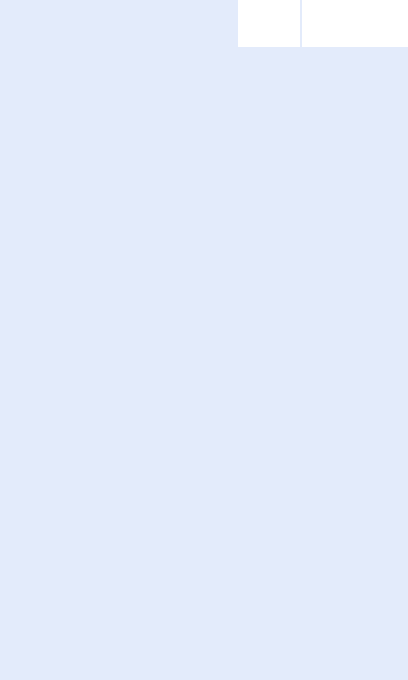
77
Informationsdefizite, wo man hinschaute
Zunächst deutete alles auf die Schülerin: Wie hatte sie dem Mann aus
dem Bett helfen können, obwohl er gar nicht hätte mobilisiert werden
dürfen? Und warum hat sie eine Erstmobilisation allein durchgeführt?
Erstmobilisationen müssen immer von zwei Pflegekräften vorgenom-
men werden, weil die Gefahr von Stürzen gegeben ist.
Der Grund dafür war ganz einfach. Die Krankenpflegeschülerin hatte
nicht die nötigen Informationen gehabt:
1. wusste sie nicht, dass der Patient noch nicht mobilisiert werden
durfte,
2. wusste sie nicht, dass man eine Erstmobilisation zu zweit macht.
Und
3. war ihr auch nicht klar, dass sie bei einem Patienten, der nicht
ihrem Bereich angehörte, die zuständigen Kollegen hätte ein-
schalten müssen.
Und dabei hatte sie doch eigentlich nur Gutes und scheinbar Nahe-
liegendes gewollt: dem Patienten dabei helfen, das Bett zu verlassen.
Viele, viele kleine und eigentlich »unscheinbare« Fehler, die, so sehe
ich das heute, im Grunde schon ihren Ausgang in der Krankenpflege-
schule hatten. Denn dort sollte man den Auszubildenden ganz klipp
und klar sagen: niemals etwas tun, ohne genaue Informationen zu
haben. Uninformiert zu handeln, heißt potenziell verantwortungslos
zu handeln, weil man die Konsequenzen nicht absehen kann. Hier ist
Schule ein Stück weit gefragt, Verhaltensregeln zu vermitteln und
deren Wichtigkeit klar zu machen.
Das bedeutet auch, ein Forum zu schaffen, wo Auszubildende
regelmäßig die Möglichkeit haben, offen darüber zu reden, wenn
etwas schief gegangen ist. Häufig kommen da Dinge zu Tage, an die
man im Traum nicht gedacht hätte. Nur so kann man gemeinsam
reflektieren, wie man Fehler vermeidet.
Ganz wichtig ist, einen Rahmen zu haben, wo das möglich ist. In
unserem Hause geht das!
* Name und Anschrift der Interviewpartnerin sind den Herausgebern
bekannt.
7

78
Kapitel 8 · Wie sage ich’s dem Patienten?
Wie sage ich’s dem
Patienten?
Marc-Anton Hochreutener
Großes Aufatmen! Der Fehler wurde bemerkt, und niemand ist ernst-
haft zu Schaden gekommen. Fehler in der medizinischen Versorgung
und Betreuung von Menschen können, selbst wenn alles noch einmal
gut gegangen ist, von den Betroffenen als Irritation oder sogar Belas-
tung empfunden werden. Zum zweiten Mal im zugigen Gang sitzen
und auf eine Untersuchung warten zu müssen oder sich für ein paar
Stunden benommen zu fühlen, weil eine Infusion zu schnell eingelau-
fen ist – beides ist für den Patienten nicht nur körperlich unangenehm,
es beeinträchtigt leicht auch sein Vertrauen in das behandelnde Per-
sonal. Um wie viel gravierender, wenn der Patient durch einen medizi-
nischen oder pflegerischen Fehler zu Schaden gekommen ist!
In diesem Fall kommt es entscheidend darauf an, wie das Ereignis
mit dem betroffenen Patienten und seinen Angehörigen kommuniziert
wird. Unerwünschte Zwischenfälle anzusprechen ist nicht nur ein
Zeichen von Professionalität, sondern zeugt auch von Respekt vor dem
Patienten. Die Beachtung seiner Würde durch den offenen Umgang
mit einem Fehler sorgt ganz entscheidend dafür, dass das Vertrauens-
verhältnis zwischen Patient und ärztlichem und Pflegepersonal auf-
recht erhalten bleibt bzw. wiederhergestellt wird.
8.1
Vorgehen bei der Fehlerkommunikation
Wie kommuniziert man richtig? Gerade in restriktiven Institutionen
des Gesundheitswesens fällt es besonders schwer, einen Fehler zuzu-
geben und damit einen möglichen Lernprozess bei Beteiligten wie auch
den Nicht-Beteiligten anzustoßen. Betroffenen Patienten und ihren
Angehörigen zu offenbaren, dass etwas schief gelaufen ist, will gelernt

8
79
sein, damit eventuelle Folgen eines Fehlers in einer Atmosphäre des
Vertrauens gemeinsam bewältigt werden können. Die Stiftung für Pa-
tientensicherheit der Schweiz hat hier Empfehlungen erarbeitet, wie
man unerwünschte Zwischenfälle den Betroffenen kommuniziert
und damit umgeht [24]. Diese Empfehlungen sind praxistauglich,
evidenzbasiert, d. h. in ihrer Tauglichkeit wissenschaftlich belegt, und
gelten fachübergreifend.
Weiteren Schaden abwehren
Oberstes Gebot nach einem Zwischenfall ist, den Patienten vor weite-
rem Schaden zu bewahren. Zwischenfälle, die folgenlos für den Patien-
ten und womöglich von ihm unbemerkt geblieben sind, sollten ihm
nicht mitgeteilt werden. In den Fällen, in dem ein Fehler Folgen für
den Patienten hatte, sollte er kommuniziert werden – und zwar be-
dacht und koordiniert:
Wann soll ein Fehler kommuniziert werden?
So schnell wie möglich – am besten innerhalb der ersten 24 Stunden
nach seinem Auftreten.
Wer sollte den Fehler kommunizieren?
Ein verantwortliches Teammitglied, zu dem der Patient auch Vertrauen
hat.
Wo sollte über den Fehler gesprochen werden?
In einer ruhigen Umgebung, in der auch die Privatsphäre des Patienten
geschützt ist.
Sind die Rahmenbedingungen für das Gespräch mit dem Patienten
und/oder den Angehörigen geklärt, schlägt die Stiftung für Patienten-
sicherheit der Schweiz insgesamt 6 Inhalte vor:
1. Darlegen, was passiert ist. Und zwar die Fakten und keine Mut-
maßungen.
2. Bedauern
ausdrücken.
8.1 · Vorgehen bei der Fehlerkommunikation

80
Kapitel 8 · Wie sage ich’s dem Patienten?
3. Darüber informieren, welche eventuellen Folgen das unerwünschte
Ereignis für den Betroffenen haben kann und zugleich Möglichkei-
ten der Bewältigung aufzeigen.
4. Dem Betroffenen das Angebot machen, von einem anderen Team
betreut zu werden.
5. Zeigen, dass Team und Institution aus dem Fehler lernen wollen
und wie.
6. Den Patienten und seine Angehörigen über neue Erkenntnisse re-
gelmäßig auf dem Laufenden halten und auf diese Weise die Bezie-
hung aufrecht erhalten.
Praxistipp
Verhalten bei schwerwiegenden Zwischenfällen
Ist es einmal zu einem schwerwiegenden Zwischenfall gekommen,
gilt es, Ausmaß und Folgen für den Betroffenen weitestmöglich zu
reduzieren und einer Wiederholung des Fehlers vorzubeugen. Das
gelingt nur, wenn der Fehler nicht nur von den beteiligten Ak-
teuren, sondern von der Institution, in oder für die sie arbeiten,
ernst genommen wird. Daraus ergibt sich:
Schwere Fehler sind Chefsache!
Gerätschaften, Verbrauchsmaterialien (auch Abfälle!), Medika-
mente und Akten sicherstellen.
Alle Beteiligten sollten schnellstmöglich ein Gedächtnisproto-
koll erstellen.
Ggf. Behörden und Haftpflichtversicherer einschalten, im Zwei-
felsfall unverzüglich den Rat eines Rechtsmediziners einholen.
Patienten und Angehörige informieren.
Ein alternatives Betreuungsteam anbieten.
Patienten und Angehörige bei der Suche nach rechtlichen und
finanziellen Hilfsangeboten unterstützen.
Follow-up-Treffen mit dem Patienten und seinen Angehörigen
planen.
Bestimmen, wie der Zwischenfall in der Institution kommuni-
ziert wird und von wem.
v
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6

8
81
Ggf. eine Strategie entwickeln, wie die Öffentlichkeit darüber
zu informieren ist.
Zwischenfall und sein Zustandekommen dokumentieren und
analysieren, um einer Wiederholung vorzubeugen.
Verbesserungsmaßnahmen auch im Sinne der Qualitätsent-
wicklung einleiten.
Fazit
Ist es zu einem unerwünschten Zwischenfall gekommen, heißt es:
Weiterem Schaden vorbeugen.
Mit dem Patienten darüber sprechen und sein Bedauern
darüber zum Ausdruck bringen.
Schritte in die Wege leiten, um eine Wiederholung des Fehlers
zu vermeiden.
4
4
4
4
4
4
4
8.1 · Vorgehen bei der Fehlerkommunikation
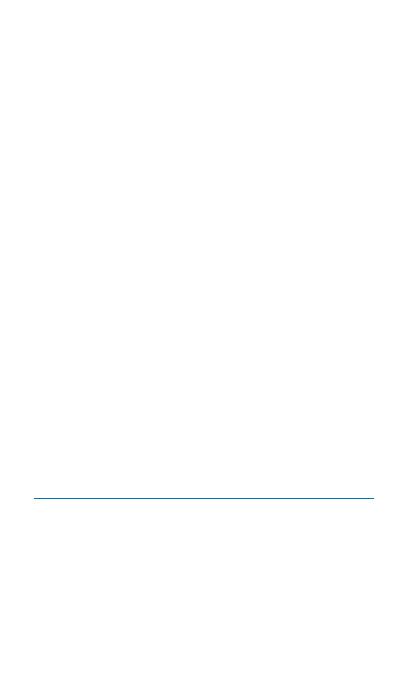
82
Kapitel 9 · Übergabefehler
Ȇbergabefehler
verursachen 6% der noso-
komialen Todesfälle.«
Andreas Lauterbach
Nosokomiale Todesfälle – also durch Infektionen, die sich Patienten
im Krankenhaus durch einen Krankenhauserreger zugezogen haben –
als Folge einer fehlerhaften Übergabe?
Diese dramatische Zahl, die zurückgeht auf eine Untersuchung
von Catchpole [11], in der die Übergabe zwischen den Stationen bzw.
Disziplinen untersucht wird, verlangt nach einem genaueren Blick auf
ein 3-mal tägliches Ritual: die Übergabe beim Schichtwechsel.
Erika: »So pass mal auf, wir fangen an! In der ..«
Uta: »Was macht denn die Frau Rupp. Ist die immer noch hier?«
Erika: »So fangen wir an in der 12.«
Olga: »Wir haben doch noch gar keine Zettel von der 12.«
Erika: »Ne, Zettel macht die Uta. Ich habe den nicht.«
Pascale: »Mach doch erst mal in der 15 weiter. Mach 15 erst mal.«
Erika: »15!« [21]
9.1
Dauer der Übergaben und Anzahl der Patienten
Von den 3 Übergaben ist die der Vormittagsschicht an die Mittags-
schicht die umfangreichste. Früh- und Abendschicht dauern in der
Regel nur etwa halb so lange. Erstaunlicherweise gibt es aber keinen
Zusammenhang zwischen der Anzahl der Patienten, ihrer Pflegebe-
dürftigkeit und der Dauer der Übergabe. Mit anderen Worten: Auf
einer Station mit 30 Patienten, von denen 10 aufwendig betreut werden
müssen, dauert die Übergabe in Etwa so lange wie auf einer Station
mit nur 16 Patienten, von denen 3 umfassender Pflege bedürfen. Die
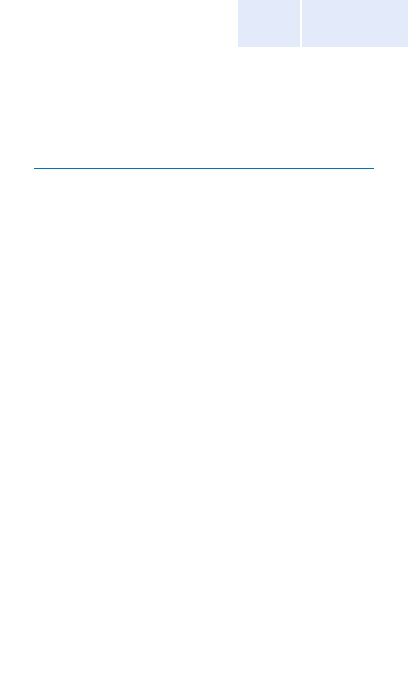
9
83
verbleibende Zeit wird mit Inhalten gefüllt, die nicht direkt in die
Betreuung der Patienten einfließen bzw. gar nichts mit ihnen zu tun
haben.
9.2
Informative Übergabe oder »Schema F«?
Die Übergabe als zentrale Einrichtung für den Informationsaustausch
innerhalb des Pflegeteams folgt, wenn man die Literatur dazu auswer-
tet, einem recht einheitlichen Schema:
Ablauf der Übergabe
Eröffnungsphase
Sie beginnt, wenn alle versammelt sind, und ...
besteht aus ritualisierten Worten und Handlungen.
Sie beginnt mit dem Ritual: »Wir übergeben uns jetzt«.
Kernphase
Eröffnung durch Berichterstattung über Patientinnen und Pa-
tienten.
Assoziative Gesprächsführung.
Sie besteht aus Patientenübergabe und »Organisatorischem«.
Sie endet fast immer durch »Auflösungserscheinungen«.
Beendigungsphase
Einzelne oder alle verlassen den Ort.
Privatgespräche beginnen.
Ende der Arbeitszeit, Phase endet durch Arbeitsdruck.
Es sind nicht mehr alle beteiligt.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9.2 · Informative Übergabe oder »Schema F«?
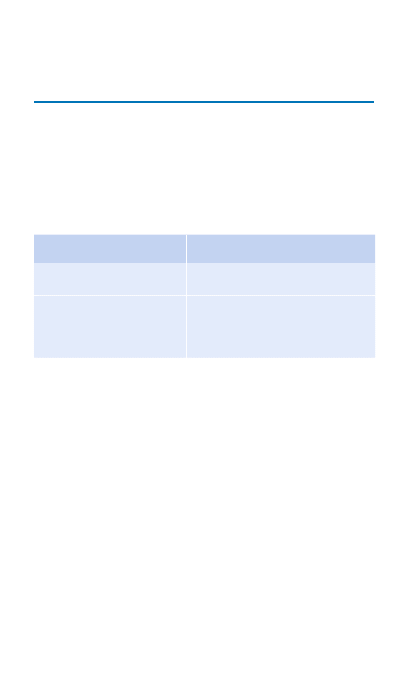
84
Kapitel 9 · Übergabefehler
9.3
Mündliche Übergabe und Dokumentation –
wie von verschiedenen Eltern
Eine Annahme hat die Untersuchung der Übergabe ins Reich der
Mythen verbannt: dass nämliche die mündliche Übergabe detaillierter
und umfassender ausfalle als die schriftliche Dokumentation. Stellt
man beide nebeneinander, so fällt eine krasse Diskrepanz auf. Hier ein
fiktives typisches Beispiel:
Tab. 9.1. Mündliche vs. schriftliche Übergabe
.
Mündliche Übergabe
Schriftliche Dokumentation
Frau Walter ... da gibt es nichts.
Der geht es gut.
Pat. geht es gut. Keine Beschwerden.
Frau Spatz, die wollte gar nichts.
Pat. möchte evtl. ein Psychosom-Konsil
bitte bis Montag abklären. Pat. fühlt sich
gut. Keine Besonderheiten. Bitte nachfra-
gen, ob Brustprothese schon bestellt ist!
Eine Übergabe kann informativ sein und dem Wohl des Patienten
dienen. Sie kann strukturiert ablaufen und Informationen umfassend
weitergeben. Eine Übergabe kann aber auch »Abhaken« sein, Informa-
tionen verkürzen oder ganz weglassen, Fragen unbeantwortet lassen,
anstatt Erklärungen zu geben und Anregungen aufzugreifen. Sie kann
Anregungen sogar dokumentieren. Damit dieser wichtigste Informa-
tionsaustausch ein Gewinn für das Team und die Patienten ist, sind
hier drei Checklisten aufgeführt. Je öfter ein Häkchen neben einem der
Punkte steht, umso größer ist die Chance, dass Patienten nicht auf-
grund eines Übergabefehlers Schaden nehmen.
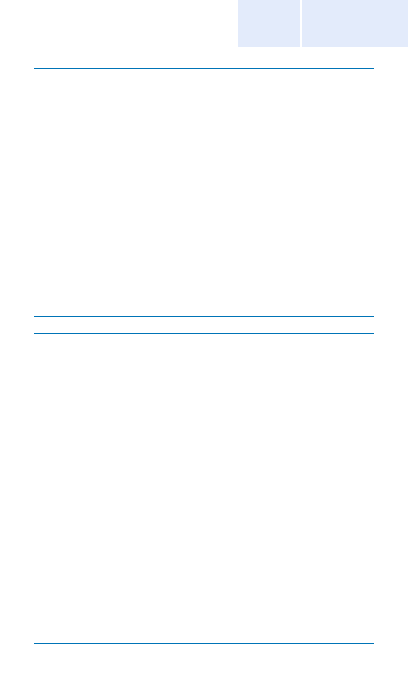
9
85
Checkliste Rahmenbedingungen für die Übergabe
1.
☑
Verschriftet – Sind die Richtlinien für Übergaben verschriftet
und für die Teammitglieder gut einsehbar?
2.
☑
Geschult – Sind alle Mitarbeiter/-innen für die Übergabe-
prozeduren geschult?
3.
☑
Gestaffelt – Sind arbeitsfreie Zeiten derart gestaffelt, dass ein
Team nicht nur aus Pflegenden besteht, die alle längere Zeit frei
hatten?
4.
☑
Computergestützt – Werden Computer-Datenbanken, Text-
verarbeitung, Programme und andere Software-Tools verwendet,
um den Umfang der Übergaben zu reduzieren?
5.
☑
Gut nutzbar – Sind die Übergabedatenbanken durchsuchbar?
6.
☑
Evaluiert – Werden Übergaben regelmäßig evaluiert?
7.
☑
Wichtig – Werden Übergaben nicht nur als notwendiges Übel
gesehen, sondern als möglicherweise vorteilhafte Situation?
Checkliste Übergabe
1.
☑
Gute Vorbereitung – Sie braucht Zeit und die richtigen Doku-
mentationsmaterialien.
2.
☑
Geeignete Übergabematerialien – Sie sind übersichtlich,
verständlich, bieten Platz für Unvorhergesehenes und können von
allen Teammitgliedern gelesen und verstanden werden.
3.
☑
Genügend Zeit – Die Schichten müssen sich so überlappen,
dass ausreichend Zeit für die Übergabe ist.
4.
☑
Alle da – Die Übergaben sind so eingerichtet, dass möglichst
alle Teammitglieder beider Schichten anwesend sind.
5.
☑
Persönlich – Rückfragen müssen möglich sein. Falls eine per-
sönliche Übergabe nicht möglich ist: Sind Alternativen (Telefon,
Telefonnummer, E-Mails) zugänglich?
6.
☑
Offen – Wichtige Beobachtungen und Anregungen des Teams
fließen in die Planung der Pflegehandlungen mit ein und fallen
nicht unter den Tisch.
7.
☑
Verantwortung liegt bei allen – Sowohl die kommende wie
auch die gehende Schicht tragen die Verantwortung für die Über-
gabe.
9.3 · Mündliche Übergabe und Dokumentation
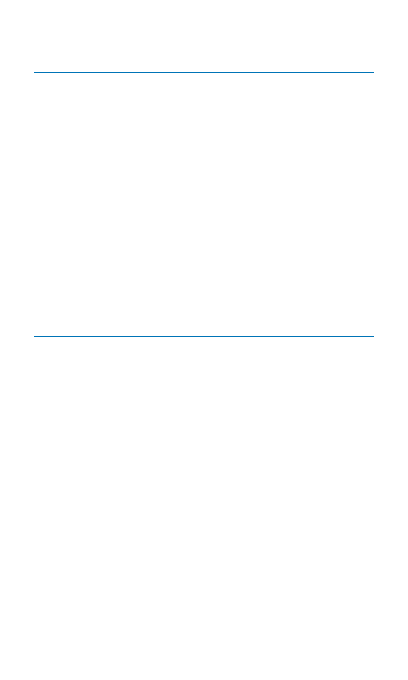
86
Kapitel 9 · Übergabefehler
Checkliste Übergabematerialien
1.
☑
Mitbeteiligung – Wurden die schriftlichen Übergabemateri-
alien mit den Pflegenden entwickelt, die am Prozess beteiligt sind?
2.
☑
Platz für Unvorhergesehenes – Bieten die schriftlichen Über-
gabeprotokolle ausreichend Platz, um ungewöhnliche Ereignisse
einzutragen?
3.
☑
Offen für Fehler – Fordert das schriftliche Übergabematerial
dazu auf, relevante Informationen einzutragen, eine Fehleranalyse
vorzunehmen oder zu überprüfen, welche Folgen ein Informati-
onsverlust nach sich zieht?
4.
☑
Evaluiert – Wurde das schriftliche Übergabematerial evaluiert,
indem die Pflegenden in einer Probezeit die Möglichkeit hatten,
Ergänzungen und/oder Streichungen vorzunehmen?
5.
☑
Leicht zugänglich – Sind die notwendigen Informationsquel-
len für alle Teammitglieder leicht zugänglich?
Fazit
Zwischen »Übergabe« und »Übergabe« können Welten liegen!
Durch das Einführen und Umsetzen von Standards lassen sich
Fehler insgesamt minimieren und zukünftig zu einem großen Teil
vermeiden.
4
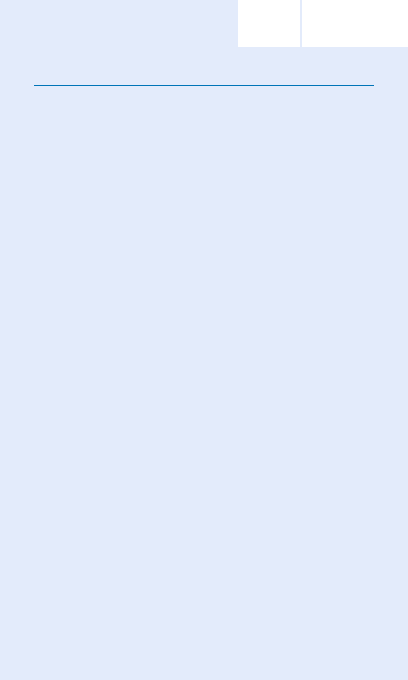
87
Meine Geschichte: Siegfried Huhn
Fort- und Weiterbildung in der Pflege mit Schwerpunkt gerontologische
Pflege, Beratung von Heimen und ambulanten Pflegediensten
»Seine eigenen Grenze zu erkennen – das kann über Leben
und Tod entscheiden!«
Es liegt schon lange zurück, aber heute könnte es genauso passieren.
Ich war damals Krankenpflegeschüler im 3. Ausbildungsjahr und in
der Anästhesieabteilung eingesetzt. Das war damals ein Privileg:
als Schüler auf die Anästhesie zu kommen! Bis zu dem nachfolgenden
Ereignis hatte ich schon eine Zeit lang dort gearbeitet und kam auch
relativ gut zurecht.
Plötzlich ein Problem mit dem Beatmungsgerät!
Bei der Patientin, die nun auf dem OP-Tisch lag, hatte ich die Braunüle
gelegt und den Tubus eingesetzt. Alles hatte prima geklappt und die
Narkose war eingeleitet worden. Die Patientin hatte bereits aufgehört,
selbstständig zu atmen. Meine Aufgabe war es, die Atmung sicher-
zustellen und das Beatmungsgerät anzuschließen. Und das funktio-
nierte nicht! Ich hatte zwar schon mit Beatmungsgeräten zu tun ge-
habt, aber dieses war ein bisschen anders. Kurz: ich wusste einfach
nicht, wie ich es bedienen sollte. »Ich komme mit dem Gerät nicht
klar, ich kann es nicht anschließen, helft mir doch mal!« – ich war
schon leicht in Panik. Aber der zuständige Anästhesiepfleger meinte
nur: »Das kannst du schon, trau dich ruhig, du musst ab jetzt selbst-
ständig arbeiten«. Und der Chefarzt kommentierte etwas süffisant:
»Es ist ja immer wieder auffallend, in welchen Situationen neue Leute
unsicher werden ...«. Ja, ich war unsicher! Und dass offenbar niemand
den Ernst der Lage erkannte, machte mich noch unsicherer. Ich wurde
immer nervöser, zweifelte an mir und meinte, dass ich es vielleicht
nur nicht erkennen würde, dass das Gerät schon einwandfrei lief. Aber
dann sah ich: Die Patientin bekam überhaupt keine Luft! In meiner
Panik rief ich: »Ich kann das nicht, ich gehe!« Erst da drehte sich der
O
9
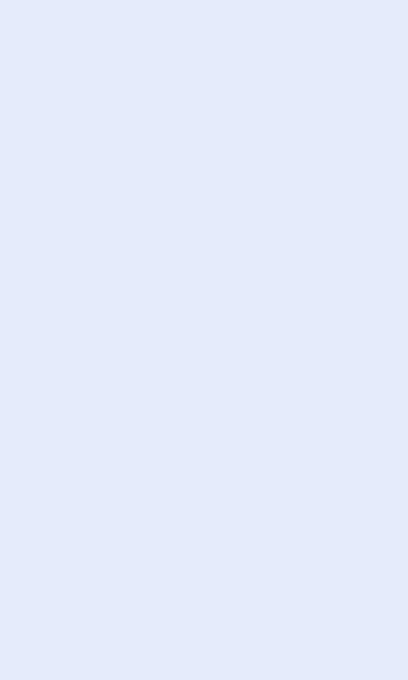
Chefarzt um, warf einen kurzen Blick auf die Patientin und schrie auch
gleich: »Um Gottes Willen, die wird ja blau!«
Auf einmal war eine Riesenhektik – alle waren in Panik, und in null
Komma nichts war das Beatmungsgerät vorschriftsmäßig ange-
schlossen und in Funktion. Der Patientin ist nichts passiert, und die OP
konnte ohne weiteren Zwischenfall zu Ende geführt werden.
Für die anderen war ich ein Versager
Später erkannte ich, dass das Beatmungsgerät tatsächlich leicht zu
bedienen war – wenn man weiß, wie! In der Zeit nach diesem Vorfall
war ich auf dieser Abteilung nur noch unglücklich. Man ließ mich
spüren, dass ich ein bisschen als Versager betrachtet wurde, als je-
mand, der seinen Aufgaben nicht gewachsen ist. Putzarbeiten – das
war das, wofür ich immer öfter eingeteilt wurde. Und zu Ärzten, die
selbst noch Anfänger waren.
Immer wenn ich an diese Situation denke, spüre ich noch die
Panik von damals. Was hätte ich anders machen sollen? Heute weiß
ich es. Ich hätte sagen sollen: »Ich werde dieses Gerät nicht bedienen,
wenn mir keiner zeigt, wie!« Ganz selbstbewusst. Denn seine Grenzen
zu kennen, ist gerade in der Pflege ein Zeichen von Fachlichkeit, von
Professionalität – nicht von Versagen. Um Hilfe zu bitten, wenn man
etwas nicht kann, ist eine Ressource. Und in der Pflege kann es über
Leben und Tod entscheiden, wenn man diese Ressource zur Verfü-
gung hat. Wenn man sagt: »Helft mir! Ich kann das nicht!«

10
89
Fehlverhalten –
zwischen Fürsorge und
Machtausübung
Karl-Heinz Wehkamp
Die systematische Aufarbeitung und Vermeidung von Fehlern wird
nach Jahrzehnte langen Forderungen zunehmend ein Thema in Medi-
zin und Pflege. Im Zuge von Verfahren zur Qualitätssicherung werden
Fehler oder Beinahe-Fehler versuchsweise erfasst, gemeldet, statistisch
aufbereitet und analysiert. Critical Incident Reporting Systems (CIRS)
systematisieren und professionalisieren die Suche nach Schwachstellen
und Gefahrenquellen. Auch so genannte Morbiditäts- und Mortalitäts-
konferenzen (MMK) kümmern sich um Fehler und suchen nach
Wegen zur Vermeidung. Eine Fehlerkultur wird als Ziel angestrebt.
Daneben wird in einigen Fällen im Rahmen Klinischer Ethikkomitees
(KEK) über »kritische Verläufe und Entscheidungen« aus ethischer
Perspektive diskutiert.
Allen Konzepten gemeinsam ist das Ziel, die Patientenversorgung
besser und sicherer zu machen. Koordiniert sind die Maßnahmen oft
unzureichend, so dass eine Vernetzung sicherlich von Vorteil wäre.
Unverzichtbar ist zudem, dass nicht nur Fehler, sondern auch Fehl-
verhalten ins Blickfeld genommen wird. Letzteres stellt oft den Unter-
grund von Fehlern dar, die dann als letzter Ausdruck eines komplexen
Feldes von Faktoren zu Schaden bei Patienten, Kollegen oder im Unter-
nehmen führen.
10.1
Fehler oder Fehlverhalten?
Ein »Fehler« passiert leicht und niemand ist dagegen gefeit. Man hat
etwas falsch eingeschätzt oder vergessen, man war abgelenkt oder hat
10.1 · Fehler oder Fehlverhalten?

90
Kapitel 10 · Fehlverhalten – zwischen Fürsorge und Machtausübung
etwas verwechselt. Wenn es nach einem solchen Vorfall schwer fällt,
sich den Fehler einzugestehen, wie viel schwerer ist es dann, wenn ein
Schaden für den Patienten oder auch für KollegInnen durch ein Fehl-
verhalten entsteht! Fehlverhalten ist offenbar mehr als ›nur‹ einen
Fehler zu begehen, denn es kann unsere moralische Integrität und da-
mit unsere Persönlichkeit in Frage stellen. Wenn ein Verhalten in einer
bestimmten klinischen Situation oder gegenüber einem Patienten als
Fehlverhalten eingeschätzt wird, so ist dies mit einer Kritik an unserer
gesamten Person verbunden. Unser Selbstwertgefühl steht dabei auf
dem Spiel, und es bedarf großer Anstrengungen und Sensibilität, um
konstruktiv, fair und solidarisch mit der Situation umzugehen.
Fehlverhalten ist mehr als ein Fehler, denn es kann die moralische
Integrität des Betreffenden in Frage stellen.
Fehlverhalten: Oft sind ganze Gruppen daran beteiligt
Fehlverhalten ist freilich keineswegs ausschließlich den einzelnen An-
gehörigen der Gesundheitsberufe anzulasten. Es kann auch Ausdruck
einer ganzen Kultur, einer mangelhaften Ausbildung, eines falschen
Managements und/oder von Überlastung und Überforderung sein.
Im Rahmen meiner Untersuchungen zur Ermittlung medizin- und
pflegeethischer Herausforderungen in Kliniken stoße ich immer
wieder auf Fälle, wo es trotz besseren Wissens zu Fehlverhalten kam.
Häufig sind es dann Gruppen von MitarbeiterInnen, die gemeinsam
gegen ethische Regeln verstoßen oder sich unkritisch dem Fehlverhal-
ten von Vorgesetzten anschließen.
Wer sich kritisch äußert, läuft oft Gefahr, als ›Nestbeschmutzer’‹ als
›unkollegial‹ oder gar als ›Verräter‹ von der Mehrheit denunziert
und ausgegrenzt zu werden.
>
>

10
91
10.2
Fehlverhalten kann viele Gesichter haben
Eine Infusion zu vertauschen ist ein klarer Fehler. Bei Fehlverhalten
im o. g. Sinne als mögliche Verletzung der moralischen Integrität ist
das schon schwieriger.
Bloß ein (schlechter) »Witz« oder sprachliches Fehlverhalten?
Oft beginnt solch kollektives Fehlverhalten mit der Sprache, die gegen-
über Patienten abfällig und diskriminierend ist. Gewählte Worte und
die Art und Weise des Sprechens sind hochaggressiv. Wenn mittels der
Sprache Patienten oder Kollegen herabgesetzt und gedemütigt werden,
dann dient dieses Reden oft unbewusst der Abfuhr aggressiver Im-
pulse, die durch Stress und selbst erlebte Herabsetzung verstärkt
werden. Schwächere werden zu Opfern allgemeiner Frustrationen. Die
Wut auf Vorgesetzte, ‚die Klinik’ oder ‚das Gesundheitswesen’ entlädt
sich auf jener Strecke, die als vielleicht einziger Machtbereich noch er-
lebt wird: gegenüber Patienten.
Eine erfahrene Pflegekraft berichtet von einer deutlichen Zunahme
verbaler Übergriffe in der Erwachsenen- und Kinderkrankenpflege im
Zuge steigender Arbeitsbelastung und Anonymisierung der Teams. Sie
spricht von einer Verrohung durch Stress und sieht eine würdevolle
Pflege nicht gewährleistet. Eigene Sensibilität würde einem selber scha-
den, so dass es besser sei, sich anzupassen als sich kritisch zu verhalten.
Patienten mit Verdacht auf Schweinegrippe werden dann zu
»Schweinen«, Patienten mit Soor werden als »eklig« tituliert, Überge-
wichtige mit vulgären Ausdrücken diskriminiert. »Die Kolleginnen und
Kollegen, die ich dann darauf anspreche, sagen mir dann glatt: ›Ja, du
hast recht! Aber wir machen es trotzdem!‹ « berichtet die Pflegekraft.
Hier handelt es sich um ein Fehlverhalten von Gruppen und auch
von Führungskräften, sofern diese davon erfahren und dieses tolerie-
ren oder sogar unterstützen. Die gängigen Konzepte zur Qualitäts-
sicherung greifen hier nicht.
10.2 · Fehlverhalten kann viele Gesichter haben
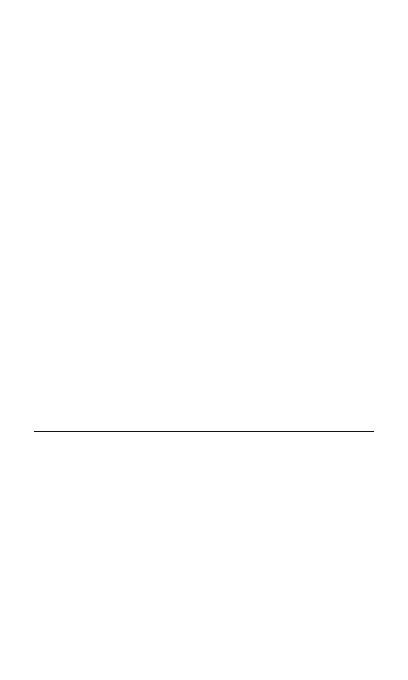
92
Kapitel 10 · Fehlverhalten – zwischen Fürsorge und Machtausübung
Appelle an die Moral greifen zu kurz
Kann man auch aus Fehlverhalten lernen? Ja, aber zunächst die Füh-
rungskräfte, die neben ihrer Verantwortung für technische und orga-
nisatorische Abläufe auch die vielfältigen Aspekte von Kommunikation
und Kultur als Bereich ihrer Zuständigkeit annehmen müssen. Sie
können daraus lernen, dass Teams in Pflege und Medizin nicht voraus-
setzungslos und jederzeit am Wohle der ihnen anvertrauten Patienten
orientiert sind und dass unter ungünstigen Rahmenbedingungen Für-
sorge in Aggressivität umschlagen kann. Oft vermischen sich beide
Aspekte und erschweren die Wahrnehmung und Beurteilung der Situa-
tion. Individuelle Moralappelle greifen in der Regel zu kurz, da die
Phänomene auch komplexe (sozial-)psychologische Wurzeln haben.
Man kann lernen, moralisch unakzeptables Sprachverhalten als Warn-
tafel für Störungen der ‚Binnenkultur’ zu deuten. Hier muss das Ge-
spräch gesucht, Kritik geführt und Vorbildfunktion gelebt werden. Es
muss aber auch Verständnis für die Hintergründe und Wurzeln solcher
Phänomene vermittelt werden. Und letztendlich gilt es, gemeinsam
Änderungen vorzunehmen oder einzufordern, um derlei Entgleisun-
gen den Boden zu entziehen.
Unwürdiges Sterben
In einem kommunalen Klinikum waren die Regeln des Umgangs mit
Sterbenden in der Mitarbeiterschaft allgemein akzeptiert. Trotzdem
konnte es passieren, dass eine fast 80-jährige Frau die letzten 3 Lebens-
tage im Badezimmer der Station verbringen musste. Aufgrund der Be-
schwerde von Angehörigen wurden die MitarbeiterInnen der Station
von Mitgliedern des Klinischen Ethikkomitees danach befragt, wie
es zu dieser allgemein als ‚unwürdig’ angesehenen Situation kommen
konnte. Es stellte sich heraus, dass die Stationsleitung befürchtete,
eine Sperrung von Betten in Mehrbettzimmern könne den Belegungs-
schlüssel vermindern und damit Personalkürzungen einleiten. Diese
Sorge war nicht unbegründet. Das kollektive Fehlverhalten war dem
Team bewusst, wurde aber in Kauf genommen, weil man die negativen

10
93
Folgen einer Bettensperrung schlimmer einschätzte als die Verletzung
moralischer Ansprüche einer Sterbenden.
... und was daraus gelernt wurde
Aus diesem Fehlverhalten wurde gelernt, dass Entscheidungen im
Rahmen des Klinikmanagements Einfluss nehmen können auf die Ver-
sorgungsqualität, dass die Lösung solcher Probleme eine enge Zusam-
menarbeit zwischen Pflege, Medizin und Verwaltung bzw. Manage-
ment erfordert und dass es wichtig ist, die Sorgen der Teams mit den
Stabsstellen des Hauses zu kommunizieren. Der geschilderte mora-
lische Verstoß wurde als ethischer Konflikt interpretiert und von einem
Klinischen Ethikkomitee bearbeitet. Der Problemlösung kam zugute,
dass diesem Komitee nicht nur Angehörige von Pflege, Medizin und
Seelsorge angehörten, sondern auch Mitarbeiter aus dem Management.
Die Lösung wurde schließlich vom Personalmanagement entwickelt.
Ergebnis war ein Konzept zur Sterbebegleitung im Mehrbettzimmer,
das Bettensperrungen ermöglichte, ohne die Statistik und damit den
Personalschlüssel zu belasten.
»Lustig« oder fatale Rituale?
Fehlverhalten kann in Ritualen des Pflegepersonals enthalten sein, die
sich über Generationen fortpflanzen und zumeist als ‚lustig’ angesehen
werden. Was für einige Personen dann ‚Spaß’ ist, wird für andere zum
Trauma.
In einem großen Klinikum war es üblich, PflegeschülerInnen nach
bestandenem Pflegeexamen zu ‚taufen’ und sie symbolisch und real
ins ›kalte Wasser‹ zu werfen. Sie wurden dabei von ihren examinierten
KollegInnen an Armen und Beinen gepackt und gewaltsam und in
voller Montur in eine Badewanne geworfen. Eine frisch examinierte
Krankenschwester wollte diese Prozedur auf keinen Fall erleben. Ihre
mehrfach und sehr deutlich geäußerte Weigerung wurde aber von
6
10.2 · Fehlverhalten kann viele Gesichter haben

94
Kapitel 10 · Fehlverhalten – zwischen Fürsorge und Machtausübung
ihren KollegInnen nicht respektiert. Sie wurde gewaltsam eingefangen
und trotz heftiger Gegenwehr in die Wanne geworfen. Dabei platzte
dann zur weiteren Belustigung einiger Beteiligter die Naht ihrer Hose
auf, so dass ihre Beschämung verstärkt wurde. Die KollegInnen waren
sauer auf sie, da sie sich als ‚Spielverderberin’ erwiesen hatte. Für das
Opfer war es nicht mehr möglich, mit diesen KollegInnen zusammen-
zuarbeiten.
In manchen Kliniken ist es üblich, Neulinge auf makabere Weise mit
dem Tod zu konfrontieren. Dies trifft besonders Pflegeschüler und
junge Studierende der Medizin während ihres Pflegepraktikums und
hat sozialpsychologisch gesehen Merkmale der ›Äquatortaufe‹ auf
Schiffen. Viele werden bereits in ihren ersten Tagen dazu eingesetzt,
Leichname frisch verstorbener Patienten in die Lagerungsräume
(zumeist im Klinikkeller) zu transportieren.
»Ich sollte ganz allein einen sehr adipösen Leichnam in die Keller
fahren. Der schwere Körper rutschte mir dabei von der Trage. Die
KollegInnen standen um mich herum und lachten, während sie er-
warteten, dass ich die Leiche alleine wieder hochhebe, was mir nicht
gelang. Das Ereignis hat mich bis heute verfolgt.«
... und was man daraus lernen kann
Zuerst, dass es so etwas gibt und dass dies von ganz normalen Men-
schen ausgeht, die sich an anderer Stelle mit größter Hingabe und
Aufopferung für andere einsetzen. Wir alle haben ‚solche’ Seiten und
scheinen uns unbewusst mit derlei Ritualen auch Erleichterungen zu
verschaffen.
Wenn wir uns eingestehen, dass Menschen (auch Angehörige der
Heilberufe) Licht- und Schattenseiten haben und dass die Grenze
zwischen ‚Gut und Böse’ manchmal fließend und oft nicht genau
zu identifizieren ist, dann ist ein erster Schritt getan zur Wahr-
nehmung und nachfolgenden Beendigung oder Vermeidung
moralisch unakzeptabler Verhaltensweise und Regeln.
>

10
95
Führungskräfte sollten auf derlei Phänomene achten und Wege finden,
ohne moralische Bloßstellung von Personen die Dinge anzusprechen
und zu ändern. Dies kann in Einzel- und in Teambesprechungen ge-
schehen. Die Personen sollten zur Einsicht kommen und mögliche
Hintergründe für das Fehlverhalten ermittelt werden.
Verletzungen der Menschenwürde
Im Rahmen eines qualitativen Leitfadeninterviews berichtet eine per
Zufall ausgewählte Seelsorgerin die folgende Szene aus einem kommu-
nalen Krankenhaus:
»In der Frühschicht kam ich auf dem Stationsflur an einer offenen Tür
vorbei. In dem mit 3 Personen belegten Zimmer stand ein alter Mann,
splitternackt, und wurde gleichzeitig von 2 Pflegern bearbeitet. Wäh-
rend der eine ihm den Schambereich wusch, putzte ihm der andere
die Zähne. Wenn die eine Waschanlage für Patienten gehabt hätten,
sie hätten sie benutzt.«
Die Sprecherin erwähnte dann Szenen von folgenloser, invasiver
Diagnostik auf einer Intensivstation und fasste zusammen: »Es kommt
immer wieder zu so viel Menschenverachtung unter dem Vorwand der
Lebensrettung oder der Fürsorge, dass dies unbedingt als eine Füh-
rungsaufgabe verstanden werden muss.«
Seit Beginn meiner klinischen Tätigkeit vor ca. 30 Jahren stoße ich
immer wieder auf Szenen wie die oben beschriebenen. Fehlverhalten
wie dieses wird offenbar zu oft toleriert. Die Hintergründe dafür sind
vielfältig, und für den Einzelfall lässt sich keine hinreichende Erklä-
rung finden. Es kann sich um Mängel der Ausbildung handeln oder
darum, dass auch für die Pflege ungeeignete Personen übernommen
werden. Es kann sich um unbewusste Aggressivität handeln, die hier
an diesem Patienten ausagiert wird. Es kann sich um eine Folge von
Desensibilisierung bei den beiden Pflegern handeln, um Burnout-
Folgen oder um Ausdruck von Langeweile, weil man seinen Spaß
haben wollte. So etwas kann passieren und es passiert immer wieder.
10.2 · Fehlverhalten kann viele Gesichter haben

96
Kapitel 10 · Fehlverhalten – zwischen Fürsorge und Machtausübung
... und was man daraus lernen kann
Dass die Sorge um Umgangsweisen mit Patienten zu den Aufgaben
nicht nur der Mitarbeiterschaft, sondern auch der Führungskräfte
gehören muss. Und man kann lernen, dass man gewisse Strukturen be-
nötigt, um derlei Phänomene anzuzeigen und zu besprechen. Schließ-
lich bedarf es positiver Kulturen in den Abteilungen und Teams, die
sich um Aspekte der Achtsamkeit und Menschenwürde drehen, die
aber neben dem Schutz moralischer Regeln auch Verständnis für die
individuellen Beweggründe der Einzelnen bereithalten.
Da die Rationalisierungen der letzten Jahre dem Personal die Zeit-
räume für informelle Gespräche drastisch reduziert haben und auch
die Übergaben auf ein Zeitminimum zusammengeschrumpft sind,
fehlt es an Orten und an Zeit für gemeinsame Reflexion. Eine Kom-
bination aus Ethischer Fallbesprechung und ›Balint-Gruppen‹ wäre
zweifellos hilfreich.
Balint-Gruppen
Die nach dem Psychiater und Psychoanalytiker Michael Balint be-
nannten Arbeitsgruppen bieten die Möglichkeit, sich im Team frei
auszutauschen und gemeinsam nach Verbesserungen im Verhält-
nis zwischen Patient und Behandlungsteam zu suchen.
Tödliches Mitleid und Selbstherrlichkeit
Es ist bekannt, dass eine hohe Identifikation von Pflegenden mit
schwerstkranken Patienten Gefühle von Mitleid erzeugen kann, die
den Wunsch erwecken, dass dieser Patient »erlöst« werden möge. In
fast allen mir bekannten Kliniken gibt es dauerhafte Kontroversen um
die Frage, wie lange und wie intensiv Patienten medizinisch behandelt
werden sollen. Da Pflegende sich oft nicht genügend in die medizini-
schen Entscheidungsprozesse eingebunden fühlen, fehlt es oft auch an
rationalen Gründen, um den Mitleidsgefühlen etwas entgegenzusetzen.
Verbinden sich dann diese Mitleidsgefühle mit einer Haltung, die ich
›moralischen Fundamentalismus‹ nenne, so kann eine gefährliche
>

10
97
Selbstherrlichkeit entstehen, mit der die betroffene Person sich zum
Richter über Leben und Tod macht.
Es gibt eine Grauzone
Glücklicherweise sind Fälle von Patiententötungen im Sinne aktiver
Sterbehilfe eher selten. Aber es gibt eine Grauzone, in der indirekt über
Leben und Sterben entschieden wird. Sowohl aus der klinischen Praxis
als auch aus eigenen empirischen Studien ist mir gut bekannt, dass
nicht immer Ärzte über lebenserhaltende Maßnahmen entscheiden,
sondern oft auch Pflegende. Dies gilt insbesondere nachts. In diesen
Fällen entscheiden Pflegende darüber, ob und wann sie einen Arzt
rufen. Auch gibt es Absprachen zwischen diensthabenden Ärzten und
Pflegenden, im Falle einer Krise (z. B. Herzstillstand) den Alarm nicht
zu früh, also eher verspätet auszulösen. Oft machen Pflegende ihre
Entscheidung davon abhängig, welcher Arzt gerade in Bereitschaft ist.
Dies mag nachvollziehbar sein und zeigt auch, dass das ›offiziell‹ medi-
zinisch Geforderte nicht von allen Pflegenden und Ärzten für gut
geheißen wird. Nur eine offene und qualifizierte Auseinandersetzung
über Therapieziele und Sterbehilfe kann dies eindämmen, verhindern
lässt es sich wohl nicht.
Indirekt können Entscheidungen über Leben und Sterben von
Patienten auch durch Personalentscheidungen und damit durch wirt-
schaftliche Aspekte mitbeeinflusst werden. Wenn die Anzahl und
Qualifikation der Pflegenden, die z. B. während der Nacht Dienst tun,
gemessen an der Anzahl der Patienten und der Schwere ihrer Erkran-
kungen nicht ausreichend ist, werden Notfälle häufiger zu spät entdeckt.
Auch das Entdecken einer lebensgefährlichen Situation bedeutet
nicht automatisch eine richtige Einschätzung, und die richtige Ein-
schätzung löst nicht automatisch die richtige Reaktion hervor.
Letztendlich sind viele Ebenen und viele Aspekte daran beteiligt, Fehl-
verhalten zu erzeugen. Ohne ausreichendes Personal, ohne Qualifika-
tion desselben und ohne gute Organisation und Kommunikation ent-
stehen ganze ‚Kulturen von Fehlverhalten’, die nicht den einzelnen Be-
teiligten zur Last gelegt werden können.
>
10.2 · Fehlverhalten kann viele Gesichter haben

98
Kapitel 10 · Fehlverhalten – zwischen Fürsorge und Machtausübung
Fazit
Was ist daraus zu lernen? Nur hinreichend gutes, motiviertes, aus-
geruhtes Personal in einem organisatorisch gut aufgestellten Team
mit guter Kommunikation und ‚Binnenkultur’ kann die Patienten-
sicherheit optimieren. Diese Erkenntnis ist ebenso banal wie sie oft
vergessen wird.
Anmerkung des Verfassers
Der vorliegende Artikel beruht auf Erfahrungen aus klinischer Tätigkeit,
eigenen sozialwissenschaftlichen Studien in Krankenhäusern sowie
aus Erfahrungen im Rahmen so genannter Ethik-Projekte. Vertiefende
Literatur beim Verfasser.
4
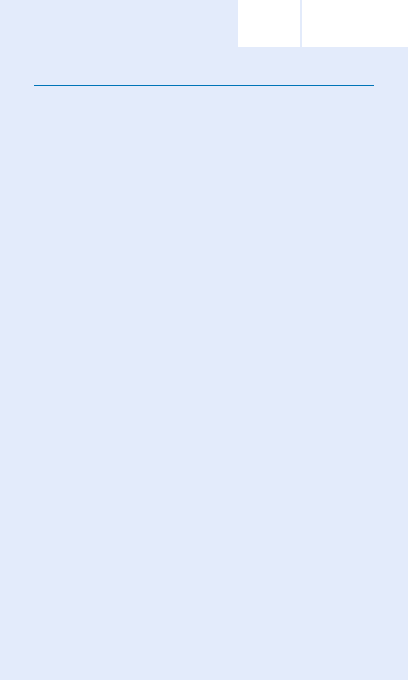
99
Meine Geschichte: Christa Olbrich
Katholische Fachhochschule Mainz
»Einfach ›blind‹ in den Medikamentenschrank greifen
genügt nicht!«
Der Junge, der zu uns in die Wundversorgung kam, war etwa 10 oder
12 Jahre alt. An seiner Hand klaffte eine gut 5 cm lange Schnittwunde,
die ärztlich versorgt und genäht werden musste. Der diensthabende
Chirurg hatte bereits alles vorbereitet, sterilisiert und abgedeckt und
auf dem Chirurgenstuhl Platz genommen. Meine Aufgabe war es, ihm
das Lokalanästhetikum anzureichen. Der Junge wartete derweil ruhig
und offensichtlich tapfer auf das, was da kommen würde. Ich hatte die
Lösung – es war 2-prozentiges Scandicain – aufgezogen und dem
Arzt in die Hand gedrückt. Als der damit begann, die ersten Spritzen
zu setzen, verzog der Junge, der bis dahin so tapfer gewesen war,
ganz fürchterlich das Gesicht. »Das tut weh, das tut weh!« jammerte
er. Vorsichtig spritzte der Arzt weiter kleine Scandicain-Dosen um den
Wundrand herum: »Das tut nur am Anfang weh, das ist der Anfangs-
piekser«, meinte er. »Gleich wird es besser, und dann spürst du nichts
mehr.« Aber der Junge litt weiter und versuchte mit zusammengebis-
senen Zähnen, seinen Schmerz zu verbergen. Ich wunderte mich im-
mer mehr: Ein so tapferer Junge und dann solche Schmerzen?? Verun-
sichert ging ich noch einmal an den Medikamentenschrank, zog die
Schublade mit dem Scandicain heraus und bemerkte es sofort: An-
statt des Lokalanästhetikums hatte ich dem Arzt Aqua dest. gereicht!
Kein Wunder, dass der Junge so zu leiden hatte! Erschrocken machte
ich dem Arzt ein Zeichen, zog gleich das Scandicain – das wirkliche
Scandicain – auf und brachte es dem Chirurgen. Die weitere Versor-
gung der Wunde war unproblematisch. Das Lokalanästhetikum wirkte
wie gewünscht, und auch der Junge freute sich: »Jetzt tut es nicht
mehr weh!«
O
10
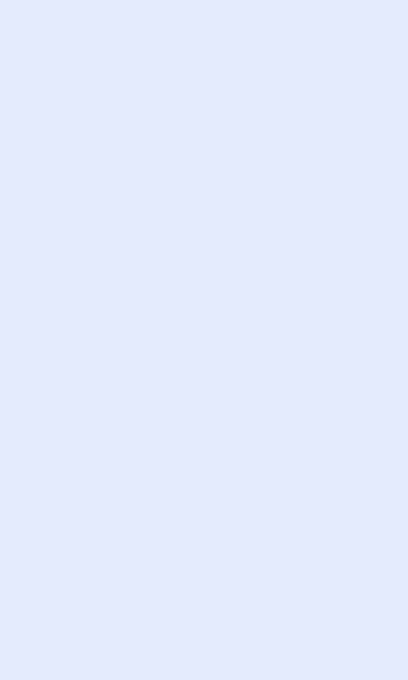
Nie ohne zweiten »Sicherheitsblick«!
Ich habe mir später schlimme Vorwürfe gemacht! Ich hätte einfach
sorgfältiger mit dem Fläschchen, das das vermeintliche Lokalanästhe-
tikum enthielt, umgehen sollen. Hätte noch ein zweites und ein
drittes Mal genau hinschauen müssen! Dann wären dem Jungen, der
doch so tapfer war, diese schmerzhaften Momente erspart geblieben.
Um ähnliche Verwechslungen ein für alle Male auszuschließen, sorgte
ich dafür, dass die beiden Flüssigkeiten – das Aqua dest. und das
Lokalanästhetikum – nicht weiterhin nebeneinander in der gleichen
Schublade aufbewahrt wurden. Später war es für mich eine Selbst-
verständlichkeit, Verwechslungsmöglichkeiten auszuschließen und
einen zweiten »Sicherheitsblick« auf ein Medikament zu werfen,
bevor es verabreicht wird!
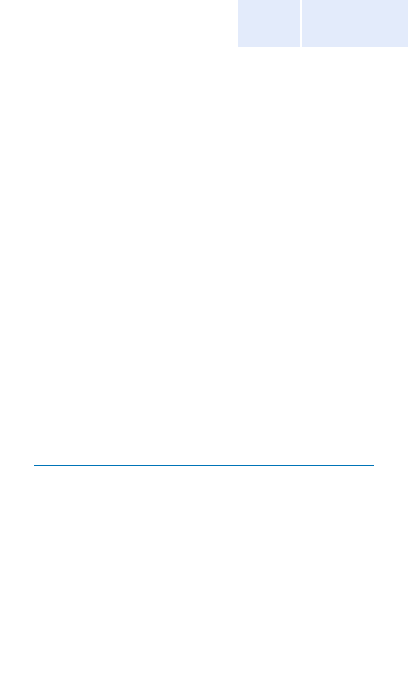
11
101
Pflege ist auch »Gefühls-
arbeit« – zur Psychoanalyse
der Pflegebeziehung
Martin Teising
Die Bedingungen für die berufliche Pflege eines anderen Menschen
sind vielfältig und haben auf das, was Pflege zu leisten vermag, einen
bedeutsamen Einfluss, der oftmals den beteiligten Akteuren nicht oder
nicht in vollem Umfang bewusst ist. Neben der Qualifikation und dem
Vermögen, Wissen in Handeln umzusetzen, sind zum Beispiel das
Teamgefüge, organisatorische Rahmenbedingungen und gesellschaft-
liche Wertschätzung wesentliche Einflussfaktoren.
Die Pflegepraxis realisiert sich stets in zwischenmenschlichen
Beziehungen, die jedoch nur unzureichend begriffen werden können,
wenn nicht auch tiefenpsychologische Aspekte mitbetrachtet werden.
Sie können in nicht unerheblichem Maße beteiligt sein, wenn es zu
einem unerwünschten Ereignis, einem »Fehler« kommt.
11.1
Unsere erste Pflegebeziehung: die (frühe) Kindheit
Menschliches Leben ist von der Fähigkeit abhängig, zunächst gepflegt
zu werden, um dann sich selbst pflegen zu können. Für sich selbst sor-
gen zu können, lernt der Mensch in einer zwischenmenschlichen Bezie-
hung, in der Regel in der frühkindlichen Beziehung zur pflegenden
Mutter, von der der »Nesthocker« Mensch existentiell abhängig ist.
Mit der eigenen Entwicklung übernimmt das Kind nach und nach
die existenzsichernden Pflegeaufgaben in eigener Regie. Und das be-
ginnt bereits mit dem ersten Atemzug bei der Ent-Bindung, mit dem
der Säugling die Aufgabe der Sauerstoffversorgung erstmalig selbst-
ständig regelt. Jeder weitere Schritt in die Selbstständigkeit entbindet
11.1 · Unsere erste Pflegebeziehung
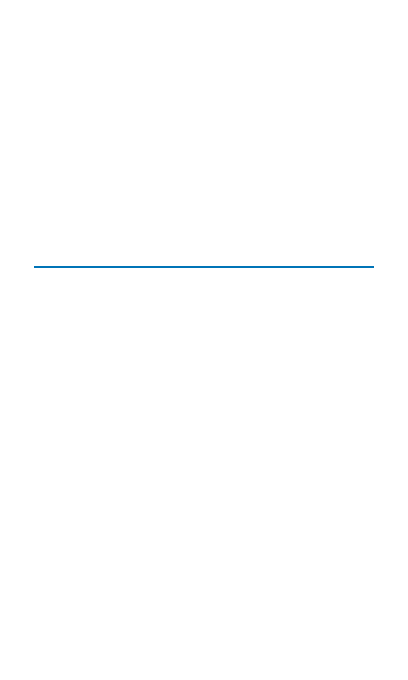
102
Kapitel 11 · Pflege ist auch »Gefühlsarbeit«
weiter von der Pflegeperson, z. B. der Durchbruch der ersten Zähne
und die Fähigkeit, kauen zu können, selbst wieder auf die Beine zu
kommen und laufen zu können usw. Alle diese Entwicklungsschritte
in die Unabhängigkeit werden von der Umgebung bejubelt und damit
gefördert. Bei der Pflege kranker, behinderter und alter Menschen
müssen die Betroffenen Teilbereiche der erreichten Unabhängigkeit
wie z. B. die Nahrungsaufnahme, die Ausscheidungsvorgänge, die
Körperpflege usw. wieder abgeben – ein Prozess, auf den ich später
noch eingehen werde.
11.2
Warum wir mitfühlen können
Die Pflege Kranker und Alter ist eine spezifisch menschliche Handlung.
Pflegende Menschen nehmen es auf sich, mit Hilflosigkeit und Krank-
heit, mit Behinderung, Altern und Sterben und damit der eigenen Zu-
kunft konfrontiert zu werden. Im Tierreich ist die Brutpflege und Auf-
zucht der Jungen bekannt. Ausgewachsene und Alttiere aber krepieren,
sie werden mit wenigen Ausnahmen nicht von Artgenossen gepflegt.
Ein Kennzeichen menschlich zivilisierter Gesellschaft ist, dass sich ihre
Mitglieder ihren kranken und hilfsbedürftigen Mitmenschen verbun-
den und verpflichtet fühlen. Dies beruht auf der Fähigkeit, sich in sie
hineinzuversetzen, sich zu erinnern und historisch zu denken.
Diese Fähigkeit, Gefühle wie z. B. Freude oder Schmerz nicht nur
einfach zu haben, sondern auch als etwas zu empfinden, das in einem
selbst entsteht, wird in der allerersten Pflegebeziehung unseres Lebens,
nämlich der zwischen Kind und hauptverantwortlichem Elternteil, in
der Regel die Mutter, entwickelt.
In dieser ersten Pflegebeziehung erfährt das Kind, wie seine Ge-
fühle und seine Körpervorgänge von seiner Pflegeperson beurteilt, ge-
steuert und benannt werden. Es lernt in dieser ersten Beziehung, dass
es die Situation aktiv beeinflussen kann.

11
103
Steuerung durch die Hauptpflegeperson
Um eine adäquate Antwort auf die Bedürfnisse des Säuglings oder
Kleinkindes überhaupt geben zu können – hat es Hunger? Tut ihm
etwas weh? Ist es müde? – muss sich die Pflegende in das Kind bzw.
den Patienten hineinversetzen, seine Gefühle in sich lebendig werden
lassen und dann den Verstand einschalten. Zum Beispiel spürt sie den
Schmerz des Kindes, lässt sich aber nicht von ihm überwältigen. Sie
benutzt denkend ihr Fachwissen, um dem Kind bzw. dem Patienten
seine Gefühle bekannt und vertraut werden zu lassen. Wenn die Mutter
dem Kind, das Bauchschmerzen hat, die Hand auf den Bauch legt und
beruhigend erklärt, dass es nichts Schlimmes ist, sind die Beschwerden
schon viel erträglicher. Sie vermittelt das sichere Gefühl, dass sie von
unangenehmen Empfindungen befreien kann. Die Pflegende bietet
eine Umwelt, ein Gerüst oder einen Orientierungsrahmen, mit dessen
Hilfe das Kind und analog die Patienten sich selbst verstehen lernen.
»So wird ein Schatz von Vorstellungen geschaffen, geboren aus dem
Bedürfnis, die menschliche Hilflosigkeit erträglich zu machen, erbaut
aus dem Material der Erinnerungen« [15].
Im günstigen Fall kann der Säugling sich zunehmend auf die Pflege-
person verlassen. Er kann Zustände des Unwohlseins und Alleinseins
immer länger ertragen. Hat er diese Erfahrung nicht in ausreichendem
Maße gemacht, wird er sich später, insbesondere in Krisensituationen –
zum Beispiel als alter hilfsbedürftiger Patient im Krankenhaus – immer
wieder vergewissern müssen, dass jemand da ist und sich um ihn küm-
mert, dass er nicht »verhungert«.
Lernen, eine Situation aktiv zu beeinflussen
Dass sich ein Mensch bereits als Säugling aktiv an der Gestaltung
der Pflegebeziehung beteiligt, mag auf den ersten Blick überraschen.
Nimmt man aber z. B. ein wenige Monate altes Kind, das den Kopf
abwendet, die Augen schließt und sich in den Schlaf zurückzieht, so
lässt sich das als Handlung interpretieren, mit der das Kind seine erste
11.2 · Warum wir mitfühlen können
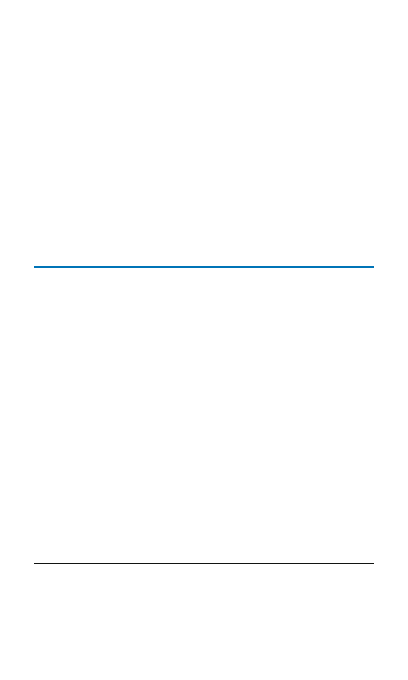
104
Kapitel 11 · Pflege ist auch »Gefühlsarbeit«
Wirkmächtigkeit ausübt und erfährt. Es zeigt damit, dass es über erste
körperliche Regulationsmechanismen in seiner Beziehung zur Umwelt
verfügt. Es beherrscht seinen Körper, wenn es einen Keks zwischen
Daumen und Zeigefinger halten und ohne Hilfe Nahrung aufnehmen
kann. Es entwickelt mit dem Erlernen motorischer Fähigkeiten, die es
ermöglichen, sich zu entfernen oder anzunähern, weitere Selbstbestim-
mung. Die Fähigkeit »Nein« zu sagen, wurde bereits von René Spitz als
»Organisator der Psyche« beschrieben [30].
11.3
Warum wir Pflegebedürftigkeit gerade im Alter
so fürchten
Wie gerade dargelegt, ist eine zentrale Erfahrung unserer Entwicklung,
eigenständig, unabhängig und autonom zu sein. Das beginnt damit,
dass der Säugling die angebotene Milchflasche ablehnt, indem er den
Kopf zur Seite dreht oder sie mit der Hand wegschlägt, führt weiter
über die Freude, ohne Hilfe auf dem Kinderfahrrad seine Runden
drehen zu können und setzt sich fort in immer weiter zunehmender
Handlungsfähigkeit in immer mehr Handlungsfeldern. Die Tatsache,
dass wir mit zunehmender Unabhängigkeit zugleich von anderen ab-
hängige Wesen bleiben, wird weitgehend verleugnet. Wir werden mit
dem Erwachsenwerden scheinbar unabhängig bei der Erfüllung un-
mittelbarer körperlicher Bedürfnisse. Wir sind aber abhängig vom
Funktionieren sozioökonomischer und technischer entpersonalisierter
Versorgungsstrukturen. Wer könnte sich schon ohne von anderen er-
zeugten elektrischen Strom ernähren?
Selbststeuerung vs. Abhängigkeit
Der subjektiven Erfahrung, sein Leben steuern zu können, korrespon-
diert die Angst vor einer Konfrontation mit Abhängigkeit, die die indi-
viduelle Autonomie zum höchsten aller gesellschaftlichen Werte der
westlichen Zivilisation hat werden lassen.
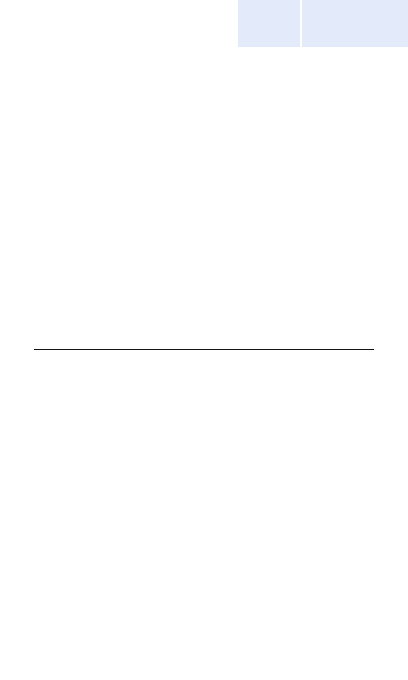
11
105
Das Alter mit dem erwartbaren Schwinden unserer Fähigkeiten
und dem zunehmenden Ausgeliefertsein an andere Personen ist für
die meisten von uns eine unerträgliche Vorstellung. Denn es führt uns
in die Abhängigkeit der frühkindlichen Pflegebeziehung – ohne jedoch
die Aussicht auf Wachstum und Autonomiegewinn.
In der letzten Lebensphase und besonders mit beginnender Pflege-
bedürftigkeit wird schmerzlich bewusst, dass der Mensch letztlich
kein autonomes Individuum, sondern ein soziales Wesen ist, dessen
Existenz auf der Beziehung zu anderen Menschen und der Existenz
seines Körpers beruht. Zeitlebens streben wir einerseits nach Unab-
hängigkeit und zeitlebens bleiben wir andererseits gebunden und
suchen nach Bindung. Angesichts abhängiger Pflegebedürftigkeit aber
kann die Idee von Selbststeuerung und Autonomie nicht länger auf-
recht erhalten werden – und das löst Angst aus.
Die wechselseitige Abhängigkeit in Pflegebeziehungen
In fast allen mir bekannten Pflegeleitbildern wird auf die Autonomie
des Individuums ganz besonderer Wert gelegt. Pflege will sich zumin-
dest auf dem Papier stets um die Erhaltung oder Wiederherstellung
größtmöglicher Selbstpflegefähigkeit und Selbstbestimmung des Pa-
tienten bemühen.
Als Pflegeperson auch abhängig vom Patienten
Die augenfällige Angst vor der Abhängigkeit als Pflegefall korrespon-
diert mit einem oft unbewussten Angewiesensein der Pflegenden
auf ihre Patienten. Psychodynamisch bedeutsam ist das Bedürfnis
Pflegender nach Anerkennung der eigenen Hilfsbereitschaft und damit
nach Stärkung des eigenen Selbstwertgefühls; der Wunsch, sich vor
sich selbst wie im Spiegel anderer als guter Mensch zu erweisen und
als solcher gewürdigt zu werden; Gutes zu tun und damit Zweifel an
der eigenen Person zu besänftigen. Wenn man so will, wird die eigene
Pflegebedürftigkeit altruistisch befriedigt. Das Angewiesensein der
Pflegenden auf ihre Patienten wird in der Regel zu wenig reflektiert.
11.3 · Furcht vor Pflegebedürftigkeit

106
Kapitel 11 · Pflege ist auch »Gefühlsarbeit«
Die Leugnung der gegenseitigen Abhängigkeit trägt dazu bei,
dass Pflegende ihren Patienten und sich selbst unbewusst deren
einseitige Abhängigkeit demonstrieren müssen. Damit erzeugen
sie genau das, was (potentiell) zu Pflegende besonders fürchten.
Versuche gegenseitiger Beherrschung
Für die Vorstellung, dass nicht nur der Patient die Pflegeperson
»braucht«, sondern diese (in psychodynamischer Hinsicht) auch den
Patienten – dafür gibt es im Pflegealltag zahlreiche Hinweise. Die
vielen Demonstrationen der Abhängigkeit der Patienten – als schein-
bare Sachzwänge verschleiert – nähren die Macht der Pflegenden und
bekämpfen ihr Ohnmachtsgefühl. Gegenseitige Beherrschungsver-
suche sind in Pflegebeziehungen immer wieder zu beobachten. Sie
werden mehr oder weniger offen ausgetragen. Ins Krankenhaus auf-
genommen, wird von einem bis dahin selbstständig agierenden Men-
schen erwartet, dass er brav sein Nachthemd anzieht, sich ins Bett legt
und wartet, was mit ihm geschieht. Er hat Anweisungen zu befolgen,
seine praktischen Fertigkeiten und manchmal auch seine kritische Ver-
nunft mit der Garderobe abzugeben. Die Pflegenden im Krankenhaus
und Pflegeheim herrschen auf mancher Station, als wäre es ihr eigenes
Haus. So kann hin und wieder der Eindruck entstehen, dass die herr-
schenden Regeln denen einer militärischen Grundausbildung nahe
kommen. In der Patientenrolle wird aber auch manch regressives Be-
dürfnis befriedigt. Jede Pflegende kennt andererseits auch Patienten,
die Krankenschwestern und Pfleger kommandieren und terrorisieren
(wollen).
11.4
Im Unbewussten abgespeichert:
die erste Pflegebeziehung
Pflege kann natürlich nicht einfach als Wiederholung frühkindlicher
Pflegebeziehungen verstanden werden. Erfahrungen, die in der ersten
Pflegebeziehung unseres Lebens ihren Ursprung haben, werden jedoch
im Unbewussten zeitlebens wie Grundbausteine bewahrt – Erfah-
>

11
107
rungen aus früheren Lebensperioden, in denen eine andere Logik und
andere Denk- und Gefühlsprozesse gelten als später. Die frühen Erfah-
rungen sind sozusagen die Fasern, aus denen wir unser psychisches
Gewebe herstellen. In Krisensituationen werden regressive frühe Denk-
strukturen, Gefühle und Verhaltensweisen aktiviert, und die Fasern
unseres psychischen Gewebes werden bei Zerreißproben sichtbar.
Nach eigenen Beobachtungen ist in Einrichtungen, in denen mit
einem psychodynamischen Hintergrund und entsprechender Haltung
gepflegt wird, die Selbstreflexionsfähigkeit und das Selbstbewusstsein
der Pflegenden besonders ausgeprägt. Beides zusammen kann helfen,
unbewusst motivierte Pflegefehler zu vermeiden.
Fazit
Im Dschungel emotionaler Erwartungen, Befürchtungen und Ver-
flechtungen ist von Gepflegten wie Pflegenden »Gefühlsarbeit« zu
leisten. Dazu bietet das Wissen um die Psychodynamik unbewuss-
ter Vorgänge Pflegenden Möglichkeiten, ihre Tätigkeit besser zu
verstehen.
4
11.4 · Im Unbewussten abgespeichert
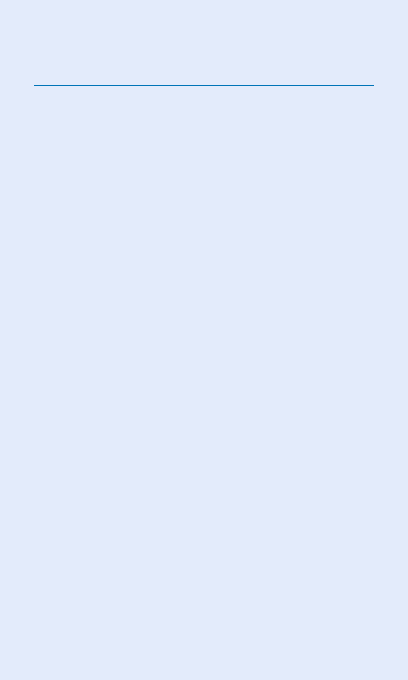
Meine Geschichte: Andreas Westerfellhaus
Fachkrankenpfleger für Intensiv- und Anästhesiekrankenpflege,
Präsident des Deutschen Pflegerates
»Fehlende Betäubungsmittel, Staatsanwaltschaft,
Kriminalpolizei und eine schlimme Woche«
Damals war ich als leitender Pfleger einer Anästhesieabteilung u. a.
verantwortlich für die Ausgabe von Betäubungsmitteln, die in einem
fest verschlossenen Tresor aufbewahrt wurden. Damit verbunden war
die akribische handschriftliche Erfassung der ausgegebenen und
verbrauchten sowie der wieder zurückgegangenen Medikamente.
Für diesen Zweck gab es eine Liste, in die ich jeden Morgen eintrug,
welche Betäubungsmittel ich wem gegeben hatte. Abends wurde
dann gegengecheckt: Stimmte die Summe der verbrauchten plus der
nicht verbrauchten und wieder an mich zurückgegebenen Medika-
mente mit der Menge überein, die ich morgens ausgegeben hatte?
Hin- und herrechnen half nicht
Lange Zeit war dieser Gegencheck völlig unauffällig gewesen. Bis ich
eines Abends feststellte, dass die Rechnung nicht aufging. Es fehlten
gleich mehrere Ampullen! Ich überprüfte noch einmal sämtliche Ein-
und Ausgänge auf der Liste, rechnete ein drittes Mal, ein viertes Mal,
aber das Ergebnis war immer dasselbe: Morgens hatte ich mehr aus-
gegeben, als bis zum Abend an Patienten verabreicht bzw. an mich
zurückgegeben worden war. Ich ging noch einmal zu allen Kollegen,
fragte nach, ob etwas vergessen worden war oder ein Patient mehr
bekommen hatte als in der Liste stand. Aber auch so kam ich nicht
weiter. Ratlos und schon ziemlich verzweifelt wendete ich mich an
den Oberarzt. Auch der überprüfte die Liste noch einmal sorgfältig,
kam aber zu keinem anderen Ergebnis als ich. Und tat dann das einzig
Richtige: Er schaltete die Staatsanwaltschaft ein.
Am Tag darauf stand die Kriminalpolizei in der Tür. Befragte mich,
befragte jeden einzelnen aus dem Team, das Pflegepersonal, die
O
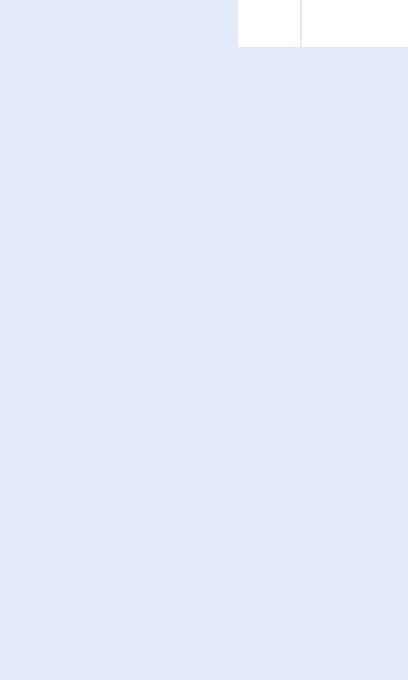
109
Ärzte. Fünf Tage lang. Aber wo die Ampullen abgeblieben waren,
konnten auch die Nachforschungen der Polizei nicht aufklären. Am
Abend des fünften Tages und mit meinen Nerven am Ende nahm
ich mir noch einmal die Betäubungsmittelliste vor. Brütete die ganz
Nacht. Verglich Zahlenkolonne um Zahlenkolonne, jede einzelne
Zeile, jede einzelne Zahl, jedes Komma, jede Mengenangabe. Bis in
den frühen Morgen hinein. Dann fand ich den Fehler: ein Zahlen-
dreher! Ein ganz simpler Zahlendreher! Unscheinbar und unspekta-
kulär – ein Fehler, wie er überall auftauchen kann, wo mit Zahlen ge-
arbeitet wird.
Die nächste Hürde: den Fehler beichten
War ich erleichtert? Ja und Nein. Erleichtert, weil damit bewiesen war,
dass keine Ampullen womöglich gestohlen worden waren. Nicht
erleichtert, weil nun anstand, diesen Fehler zu beichten. Ganze
24 Stunden brauchte ich, um den Mut dafür aufzubringen. Zuzu-
geben, dass ich auf der Karteikarte eine falsche Angabe gemacht
hatte, die niemand, und ich natürlich auch nicht, bemerkt hatte. Mir
war dieser Fehler unsäglich peinlich, und ich rechnete schon damit,
dass er negative Konsequenzen für mich haben würde. Immerhin war
eine Woche lang die Kripo in der Abteilung! Fehlermanagement gab
es damals nicht einmal in Ansätzen, geschweige denn eine Fehler-
kultur! Statt Erleichterung auf allen Seiten fürchtete ich mich vor
Kritik, womöglich Sanktionen. Bei diesem Fehler ist niemand zu
Schaden gekommen, nicht einmal in Gefahr geraten, aber für mich
war das die schlimmste Woche meiner Zeit als Krankenpfleger!
11

110
Kapitel 12 · Pflege und Betreuung
Pflege und Betreuung:
Auch eine Frage
des Patientenbildes
Karin Pöppel
Ein Patient ist nicht nur Körper, sondern vor allem Mensch und Indi-
viduum mit Empfindungen, Bedürfnissen, Ängsten, Hoffnungen und
Erwartungen. Ihre Berücksichtigung ist wichtig für den in psycho-
logischer und sozialer (auch: psycho-sozialer) Hinsicht richtigen
Umgang mit dem Patienten im Krankenhausalltag und wirkt sich im
positiven Sinne unmittelbar auf sein ganzheitliches Wohlbefinden und
damit seine Genesung aus.
Die Basis alltäglicher professioneller Handlungen im Krankenhaus
ist das zugrunde liegende Patientenbild. Denn es ist verantwortlich für
einen in psycho-sozialer Hinsicht falschen oder richtigen Umgang mit
dem Patienten.
Eine wissenschaftliche Untersuchung aus dem Jahr 2008 zum
vorherrschenden Patientenbild in acht deutschen Krankenhäusern
zeigte, dass sich in einer Zeit des permanenten Wandels der medizi-
nischen Versorgung und der Krankenhauslandschaft als solche
eines leider nicht zeitgemäß mitwandelt: das Patientenbild [26].
Zwar sind die gewonnenen Ergebnisse nicht repräsentativ für alle
deutschen Krankenhäuser, doch weisen sie in eine beunruhigende
Richtung.
12.1
Noch viel zu häufig: das Bild vom »unmündigen«
Patienten
Das vorherrschende Patientenbild ist das so genannte »paternalistische«
Patientenbild. Im Paternalismus (lat. pater = Vater) wird das vormund-
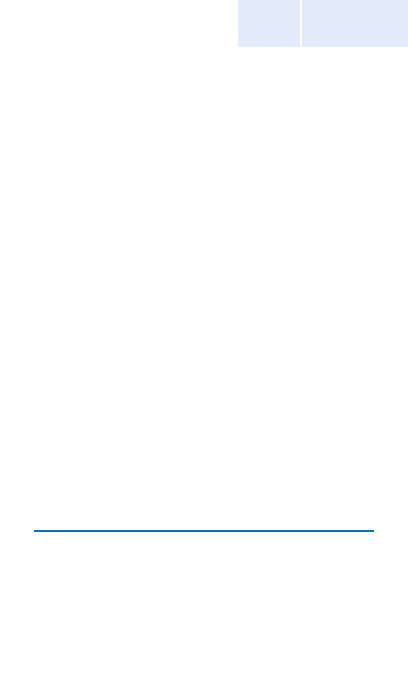
12
111
schaftliche Eltern-Kind-Verhältnis auf den außerfamiliären Bereich an-
gewendet.
Das paternalistische Verhalten unterstellt eine (nicht aufzuhe-
bende) Asymmetrie zwischen der professionellen Kraft und dem Pa-
tienten. Medizinischer Wissensvorsprung und unbeteiligte Rationalität
stehen über dem Patientenwillen, da der Patient in der Regel medizi-
nischer Laie und aufgrund seiner Erkrankung emotional betroffen ist.
Der Patient wird daher traditionell als »nicht entschlussfähig« oder
»nicht kompetent« angesehen. Es wird pauschal unterstellt, dass sich
jeder Patient gern bevormunden lässt. Wenn dem so wäre, wäre dies
natürlich ein legitimer Patientenwunsch. Bedenklich ist jedoch, dass
diejenigen Patienten, die im Gegensatz hierzu Anteil nehmen und
selbst entscheiden wollen, im paternalistischen Patientenbild meist
keine Berücksichtigung erfahren. Das paternalistische Patientenbild
beruht auf der Betonung der (medizinisch-fachlichen) Ungleichheit
der beiden Parteien, was zur Bevormundung aller Patienten führt.
Und zwar in jeglicher Frage – auch in jenen, die das Medizinfachliche
übersteigen, wie z. B. individuelle Werte, subjektives Erleben und Emp-
finden sowie private Umstände.
Die zunehmende Verwissenschaftlichung, fachliche Spezialisierung
und Technisierung der medizinischen Arbeit und nicht zuletzt Restruk-
turierungen von Arbeitsprozessen in der »Großorganisation Kranken-
haus« tun ihr übriges. Sie lassen den Patienten zu einer zunehmend
kleineren »Nummer« werden.
12.2
Zeit zum Umdenken: Der Patient ist Partner
und Mensch
Die systematische Bevormundung des Patienten im paternalistischen
Patientenbild lässt sich jedoch immer weniger mit dem modernen Bild
des aufgeklärten selbstbestimmten Patienten in Einklang bringen. Eine
wesentliche Grundlage des Miteinanders westlicher Gesellschaften ist
die Anerkennung der Rechte des Einzelnen, in Deutschland verankert
in der Verfassung. Ihr zentraler Aspekt ist die Menschenwürde. Das auf
12.2 · Zeit zum Umdenken

112
Kapitel 12 · Pflege und Betreuung
dem Grundgesetz basierende Selbstbestimmungs- und Persönlichkeits-
recht ist ein nicht mehr wegzudenkendes Ideal in einer demokratischen
Gesellschaft. Bürgerrechte gelten auch für die medizinisch versorgen-
den Lebensbereiche. Der Wille des Patienten hat das Maß der Dinge zu
sein, auch in scheinbar objektiven Fragen, die ein fachlich kompetenter
Dritter – rein sachlich betrachtet – besser beantworten könnte. Der
Patient darf, kann und soll in seine sachlichen Abwägungen auch seine
Subjektivität, Emotionen und Werte einfließen lassen. Der Patienten-
wille hat oberste Priorität! Wenngleich es in Deutschland, anders als in
anderen westlichen Ländern, bislang keine Patientenrechtsbewegung
gab, so sind Selbstbestimmung und das Recht auf Subjektivität im Be-
wusstsein der Bürger doch sehr präsent: Etwa 70 Prozent der Patienten
wünschten sich, allein oder gemeinsam mit einer fachlich kompetenten
Person zu entscheiden und mitzureden!
Die Versorgung des Patienten auf Basis des unzeitgemäßen pater-
nalistischen Patientenbildes birgt per se ein großes Fehlerpotential.
Ein zeitgemäßes, menschenfreundliches Patientenbild hingegen
hilft, Fehler im Umgang mit dem Patienten zu vermeiden. Denn es
rückt den Patienten ins Zentrum der Betrachtungen und macht zur
Bedingung, dass
die professionelle Kraft den Patienten als »Mensch auf Augen-
höhe« anerkennt und wertschätzt,
die Individualität, Emotionalität und Subjektivität des Patienten
nicht als Störfaktor, sondern als Teil der ganzheitlichen Behand-
lung eines kranken Menschen erkannt und akzeptiert werden,
die professionelle Kraft die Rechte des Patienten kennt und re-
spektiert,
diese formalen und teilweise noch abstrakten Rechte in einer
menschenfreundlichen Wese ausgelegt und umgesetzt werden,
die professionelle Kraft die Kommunikation mit dem Patienten
intensiviert, um eventuelle Wissenslücken bei sich und beim
Patienten zu schließen, seine Befindlichkeit zu berücksichtigen
und seinen Willen zu erkennen.
4
4
4
4
4
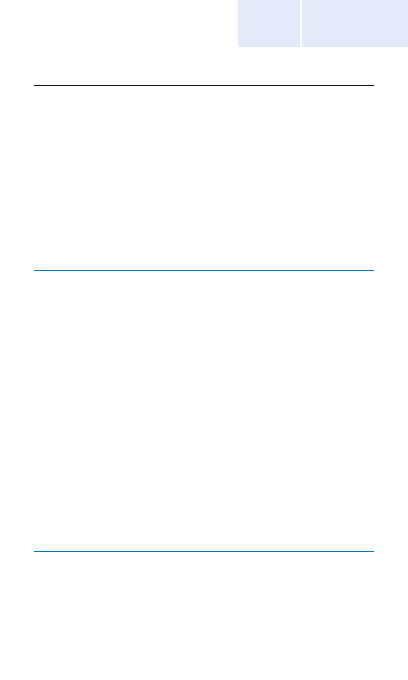
12
113
Beispiel »Patientenrecht auf Schutz der Privatsphäre«
Eines von vielen Patientenrechten ist das Recht auf den Schutz seiner
Intim- bzw. Privatsphäre. In der Krankenhauspraxis wird hierunter
der vertrauliche Umgang mit Informationen, also der Datenschutz
verstanden. Die Auslegung der Privatsphäre endet oft an diesem Punkt.
Dies ist sehr zu bedauern. Denn die private Sphäre des Patienten ist
deutlich weiter zu fassen, nämlich als ein »…räumlich abgeschirmter
Bereich persönlicher Entfaltung, in dem der Patient allein zu bleiben
wünscht, um die Wahrung seiner Intimität den Einblicken Dritter zu
entziehen« [16].
Umsetzung des Rechts auf Intim- bzw. Privatsphäre in der Praxis
Täglich und konsequent:
Das Krankenhauspersonal trägt Namensschilder (vorzugsweise
mit Funktionsangabe) an der Kleidung, damit der Patient weiß,
wer sein Zimmer betritt und Handlungen vornimmt,
vor dem Eintreten ins Zimmer sollte angeklopft werden,
der Patient sollte höflich gegrüßt werden,
vor Pflegehandlungen sollte immer sowohl eine Aufklärung
darüber als auch die Zustimmung des Patienten stattgefunden
haben,
bei körperlichen Entblößungen für Pflegemaßnahmen, für die
Körperpflege in der Intimregion und sonstige Verrichtungen am
Patienten sollte immer ein Sichtschutz verwendet werden,
pflegerelevante Gespräche mit dem Patienten sollten in diskreter
Atmosphäre, d. h. unter Ausschluss anderer Patienten und Besucher
im Zimmer stattfinden.
4
4
4
4
4
4
12.2 · Zeit zum Umdenken

114
Kapitel 12 · Pflege und Betreuung
Fazit
Das menschenfreundliche Patientenbild gibt der professionellen
Kraft Freiraum für Ideen und Kreativität im Umgang mit dem Pa-
tienten. Unterstützt werden kann es durch
die Beschäftigung mit ethischen und rechtlichen Themen rund
um die eigene Berufsarbeit,
die Verbesserung der eigenen kommunikativen Fähigkeiten
sowie
eine kritische Auseinandersetzung mit vermeintlich sachlichen
Einschränkungen.
Und all das ein ganzes Berufsleben lang!
4
4
4
4
4
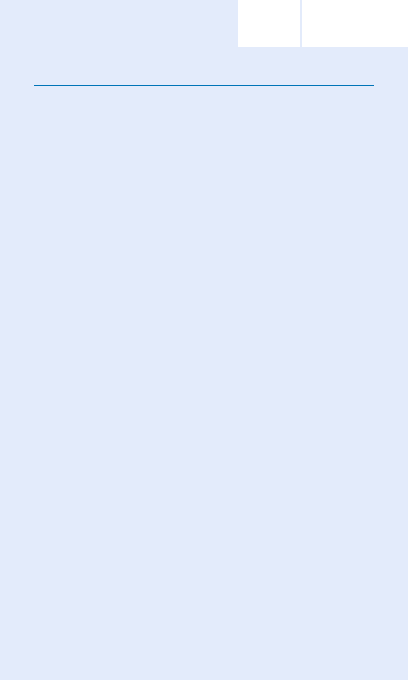
115
Meine Geschichte: Andreas Büscher
Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Pflegewissenschaft,
Universität Bielefeld
»Obwohl ich es besser wusste, ist mir ein Fehler unterlaufen,
der sehr schlimm hätte ausgehen können«
Damals war ich Krankenpfleger auf einer interdisziplinären Intensiv-
station, auf der Patienten nach größeren Eingriffen versorgt wurden.
Viele davon erhielten mehrere Infusionen gleichzeitig. Aus diesem
Grund werden die Zuleitungsschläuche mit Dreiwegehähnen verbun-
den: Eine Perfusorpumpe reguliert dabei die genaue Dosierung und
fungiert darüber hinaus auch als eine Art Sicherungssystem: Wenn
der Dreiwegehahn nicht geöffnet ist, steigt der Druck in den Zulei-
tungsschläuchen an und der Perfusor warnt mit einem Piepston. In
diesem Fall muss man zuerst den Druck von dem Gerät nehmen und
erst dann den Zugang zum Patienten wieder herstellen. Das Einhalten
dieser Schrittfolge ist sehr wichtig, um den Patienten davor zu schüt-
zen, dass zu schnell zu viele Medikamente infundiert werden. Immer
wieder weist man darauf hin, und eigentlich weiß das jeder, der auf ei-
ner Intensivstation arbeitet – ich wusste es auch.
Der Puls erhöhte sich in Sekundenschnelle auf 190
Trotzdem und wider besseres Wissen ist mir dieser Fehler bei einem
Patienten passiert, der über Infusion Katecholamine, also Medika-
mente zur Aufrechterhaltung der Kreislauffunktionen, bekam: Der
Perfusor piepst und zeigt damit an, dass der Druck zu hoch ist. Ich
öffne den Dreiwegehahn – aber ich entblocke vorher nicht – und
auf dem Monitor kann ich sehen, wie der Puls des Patienten inner-
halb von Sekunden von 80 Schlägen in der Minute auf 180, sogar
190 hochschnellt. Ich stand da, völlig gelähmt und unfähig zu
reagieren. Dass es nicht zu einem Kreislaufversagen gekommen ist,
betrachte ich heute als reines Glück. Nach zwei, drei Minuten hatte
sich der Puls des Patienten wieder normalisiert. In den kommenden
O
12
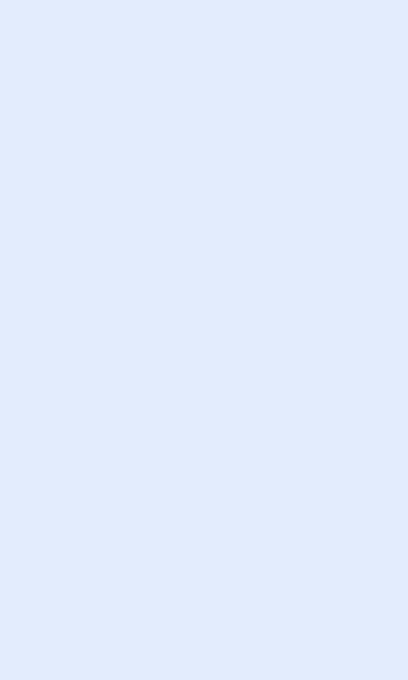
Tagen ging ich immer wieder zum Bett des Patienten, um mich zu
vergewissern, dass alles in Ordnung war.
Warum mir dieser Fehler passiert ist, weiß ich bis heute nicht
Diese wenigen Minuten, in denen ich tatenlos zusehen musste, wie
der Puls des Patienten nach oben sauste, waren für mich selbst ein
Schock. Und obwohl der Patient dabei Gott sei Dank nicht zu Schaden
gekommen ist, konnte ich im Team damals nicht über meinen Fehler
sprechen. Auch das war natürlich nicht richtig. Eine wirkliche Erklä-
rung oder gar Entschuldigung für mein Versäumnis habe ich nicht –
der Arbeitspegel auf einer Intensivstation ist immer hoch, ständig
passiert Unvorhergesehenes. Und es passieren eben auch Fehler. Mir
ist dieser passiert.
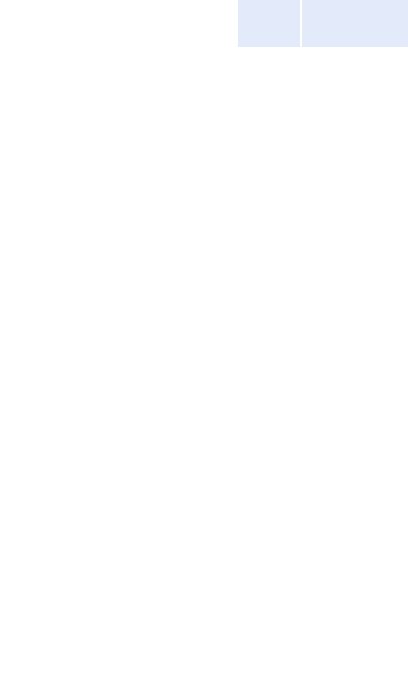
13
117
Fehlerkultur für die
Altenpflege und
den hausärztlichen Bereich
Vera Lux
Bis vor nicht allzu langer Zeit waren Begriffe wie Sicherheitskultur,
Fehlerkultur, Qualitätsmanagement und Risikomanagement im Ge-
sundheitswesen eher selten anzutreffen. Erst in den letzten 10 Jahren
hat sich das deutlich geändert. Mit zunehmendem ökonomischem
Druck auf die Gesundheitssysteme wurde die Notwendigkeit von
Qualitätsmanagements erkannt, um Fehlsteuerungen im System ent-
gegenzuwirken. Von der Gesundheitsgesetzgebung wurden die Leis-
tungserbringer verpflichtet, interne Qualitätsmanagementsysteme zu
implementieren. Ergänzt werden diese internen Systeme durch externe
Qualitätsindikatoren, die von Institutionen wie BQS, MDK und Heim-
aufsicht abgeprüft werden. Erst seit dieser Zeit hat die Auseinander-
setzung mit der Versorgungsqualität in Kliniken, stationären Pflege-
einrichtungen und in der hausärztlichen Versorgung deutlich an Fahrt
gewonnen.
BQS und MDK
Das Institut für Qualität und Patientensicherheit – kurz BQS – ist
eine unabhängige Einrichtung, die auf die Darlegung von Versor-
gungsqualität im Gesundheitswesen spezialisiert ist. Der Medizi-
nische Dienst der Krankenversicherung – kurz MDK – sind Gemein-
schaftseinrichtungen der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen,
die in den Bundesländern als eigenständige Arbeitsgemeinschaf-
ten organisiert sind. Sie agieren als gutachterliche und unab-
hängige Institutionen und beraten die Kranken- und Pflegekassen
in Bezug auf die allgemeine medizinische und pflegerische Versor-
gung und erstellen im Bedarfsfall Einzelgutachten.
>
13 · Fehlerkultur für die Altenpflege

118
Kapitel 13 · Fehlerkultur für die Altenpflege
Gar nicht so einfach: Die Verankerung einer Fehlerkultur
Sowohl in stationären Einrichtungen als auch im hausärztlichen Be-
reich gibt es bisher nur sehr wenige Einrichtungen, in denen ein
offener Umgang mit Fehlern praktiziert wird. Gründe hierfür gibt es
viele – u. a. die noch immer vorherrschenden Vorstellungen von Un-
fehlbarkeit, aber auch die Erfahrungen, wie in der Vergangenheit mit
Fehlern umgegangen wurde. Immer noch überwiegt die Angst vor
Bestrafung und Sanktionen. Die Voraussetzungen für einen offenen
Umgang mit Fehlern sind meist nicht noch gegeben. Damit wird das
Lernen aus Fehlern behindert. Im Rahmen einer der wenigen bisher
zu diesem Thema durchgeführten Projekte des »Zentrum für Pflege-
forschung und Beratung« [17] der Hochschule Bremen wurde dieser
Eindruck für die stationären Versorgungseinrichtungen bestätigt. Es
war schwierig und sehr zeitaufwändig, die Einrichtungen davon zu
überzeugen, an der Befragung teilzunehmen und Freiwillige für ein
Interview zu finden.
Für eine neue Sicherheitskultur: Alle müssen an einem Strang
ziehen
Um eine Veränderung im Umgang mit Fehlern zu erreichen, muss an
verschiedenen Stellen gleichzeitig damit begonnen werden, einen
anderen Umgang mit Fehlern zu praktizieren. Zunächst muss sich die
Haltung in den Einrichtungen selbst ändern. Hier ist die bewusste Ent-
scheidung der Geschäftsführung für einen anderen Umgang mit
Fehlern und die Einführung von Fehlermeldesystemen als präventives
Risikomanagement erforderlich. Ein wesentlicher Aspekt ist die Imple-
mentierung der Themen Fehler, Fehlerkultur und Fehlermanagement
in den Ausbildungscurricula. Weder im Curriculum der Medizinischen
Fachangestellten [10], der Gesundheits- und Krankenpflege [9] noch
in der Altenpflege [37] ist das Thema explizit aufgeführt. Dabei ist die
Auseinandersetzung mit der eigenen Fehlbarkeit und das Erlernen
eines offenen Umgangs mit Fehlern bereits in den ersten Jahren der
beruflichen Sozialisation eine wichtige Chance für die Entwicklung einer
neuen Fehlerkultur.

13
119
13.1
Berichtssysteme – damit Fehler gar nicht erst
passieren
Berichtssysteme dienen dazu, Risiken und kritische Ereignisse, die zu
einem Fehler führen könnten, zu melden, um risikoreiche Situationen
frühzeitig zu erkennen und Fehler zu vermeiden. Damit stärken Be-
richtssysteme die Patientensicherheit und erhöhen die Versorgungs-
qualität. Aus diesem Grunde haben sich auch bedeutende Institutionen
wie die WHO und der Europarat mit diesem Thema beschäftigt und
entsprechende Empfehlungen abgegeben.
Berichtssysteme gehen von der Logik aus, dass man Fehler nicht
erst machen muss, um daraus zu lernen. Aber: Risiken und Fehler
müssen erkannt und analysiert werden. Denn nur dann können
Fehler vermieden, mindestens aber vermindert werden.
Aufgrund der fehlervermindernden Wirkungen haben sich Berichts-
systeme wie z. B. »Critical Incident Reporting System« CIRS bewährt
und sind international anerkannt. Über CIRS werden wichtige Informa-
tionen gewonnen, die dann ausgewertet und im Rahmen des Risiko-
managements für Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und
der Versorgungsqualität herangezogen werden.
Arten von Berichtssystemen
Es gibt verschiedene Arten von Berichtssystemen. Man unterscheidet
zwischen geschlossenen und offenen Berichtssystemen. Geschlossene
Berichtssysteme sind in der Regel nur für eine Einrichtung wie zum
Beispiel ein Pflegeheim, eine Praxis oder ein Krankenhaus nutzbar. Es
besteht keine Verbindung zu anderen Berichtssystemen.
Geschlossene Berichtssysteme
In einem geschlossenen Berichtssystem können nur Mitarbeiter der
Einrichtung Meldungen abgeben. Und nur diese internen Informatio-
nen werden ausgewertet und stehen zur Verfügung. Je nach Größe der
Einrichtung, gelebter Fehlerkultur und Akzeptanz durch die Mitarbei-
>
13.1 · Berichtssysteme
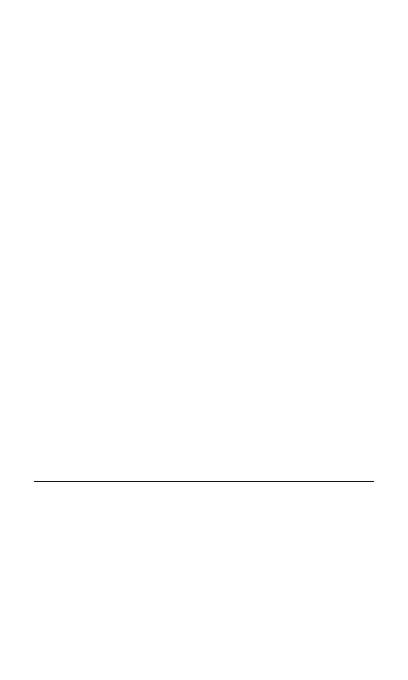
120
Kapitel 13 · Fehlerkultur für die Altenpflege
ter ist die Anzahl der Meldungen hoch oder eher gering. Wenn ein
Risiko in einer Einrichtung nur einmal oder auch gar nicht berichtet
wird, muss das noch lange nicht bedeuten, dass das Risiko nicht besteht
oder keine hohe Relevanz hat.
Denn es gibt durchaus Risiken, die in der einen Einrichtung gar
nicht erkannt und wahrgenommen, in einer anderen Einrichtung aber
sehr häufig gemeldet werden. Hierin liegt auch ein gewisses Manko
geschlossener Berichtssysteme: Da kein Austausch mit anderen Ein-
richtungen stattfindet, ist ihr Nutzen extrem abhängig von der Qualität
und der Quantität der Meldungen. Und diese sind wiederum abhängig
von mindestens drei Faktoren:
den Erfahrungen der Mitarbeiter im Umgang mit Fehlern,
ihrem Wissensstand und
ihrer Wahrnehmung von potenziellen Risiken.
Geschlossene Berichtssysteme leben davon, dass die MitarbeiterInnen
sich aktiv beteiligen. Damit das geschieht, müssen sie erstens die Mög-
lichkeit haben, ihre Meldungen anonym abzugeben, und zweitens die
Zusicherung, dass sie nicht von Sanktionen bedroht sind. Notwendig
ist auch die kontinuierliche Unterstützung durch die Geschäftsführung
und ein zeitnahes Feedback an die MitarbeiterInnen bezüglich der
Maßnahmen, die aus den Meldungen abgeleitet werden.
Offene Berichtssysteme
Ein offenes Berichtssystem ist über das Internet zugänglich. Damit hat
jeder Zugang dazu und kann Meldungen abgeben. Diese Meldungen
werden verschlüsselt und anonymisiert in einer Datenbank abgelegt
und dann zur Veröffentlichung freigegeben. In der Regel besteht auch
die Möglichkeit, Meldungen zu kommentieren. Über Berichtsdaten-
banken können die Nutzer z. B. recherchieren, welche Fehler häufig
vorkommen und welche Empfehlungen zu ihrer Vermeidung gegeben
werden.
4
4
4
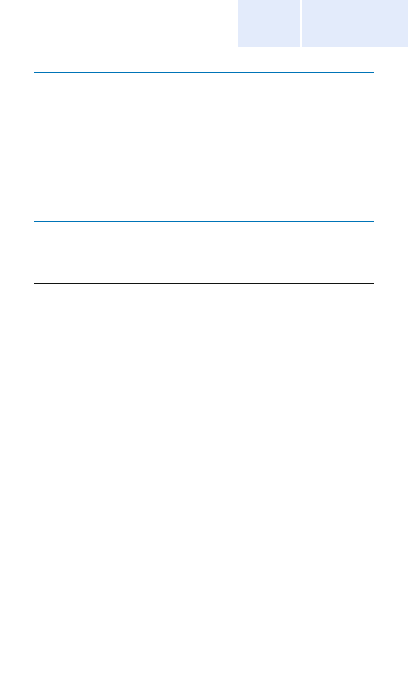
13
121
Vorteile offener Berichtssysteme
Durch eine hohe Beteiligung stehen in der Datenbank relativ schnell
repräsentative Daten und Informationen zur Verfügung.
Aus der Datenbank lässt sich schneller erkennen, ob ein Fehler
nur ausnahmsweise aufgetreten ist oder ob es sich um einen System-
fehler handelt, der häufig vorkommt. Diese Unterscheidung ist von
enormer Bedeutung, weil die Maßnahmen zur Fehlervermeidung
dann völlig unterschiedlich sein können.
Gemischte Berichtssysteme
Inzwischen gibt es auch die Möglichkeit, Fehlermeldungen aus einem
geschlossenen System anonym und verschlüsselt an ein externes Be-
richtssystem weiterzuleiten und in eine z. B. regionale oder nationale
Datenbank einzuspeisen. Auf diese Weise lassen sich Daten aus ver-
schiedenen Einrichtungen bündeln, sodass man mittelfristig eine
Datenbank aufbauen kann, in der Risiken insgesamt, national und/
oder international, erfasst werden können. Über solche Datenbanken
lassen sich Informationen generieren, die sowohl für die Gesundheits-
politik, die Gesundheitswirtschaft als auch für Akteure in den Einrich-
tungen wesentliche Daten zu Risiken und in welchen Konstellationen
sie auftreten können, liefern. Eine gute Voraussetzung, um grundlegen-
de und wegweisende Entscheidungen zur Verbesserung der Patienten-
sicherheit zu treffen!
13.1 · Berichtssysteme

122
Kapitel 13 · Fehlerkultur für die Altenpflege
13.2
Beispiele von Berichtssystemen
Frankfurter Fehlerberichtssystem für Hausarztpraxen
Egal ob man Arzt/Ärztin oder Arzthelfer/in ist – in www.jeder-fehler-
zaehlt.de [38] kann jeder Mitarbeiter in einer hausärztlichen Praxis
seine Meldungen abgeben. Und zwar online im Internet. Der Bericht
wird verschlüsselt und ist daher bei der Übertragung der Daten an die
Datenbank nicht lesbar. Die Datenbank liegt auf einem Server, der von
außen nicht zugänglich ist. Im Institut für Allgemeinmedizin werden
dann die eingegangenen Daten entschlüsselt und anonymisiert und
erst dann zur Veröffentlichung im Internet freigegeben.
Aus Kommentaren werden Tipps zur Fehlervermeidung
Nutzer haben auch die Möglichkeit, die im Internet erschienenen
Fehlerberichte zu kommentieren. Diese Kommentare werden in einer
separaten Datenbank abgelegt, ebenfalls ausgewertet und fließen
anschließend in die »Tipps zur Fehlervermeidung« ein. Diese sollen
helfen, Abläufe in der Praxis zu hinterfragen und Fehlerquellen aus-
findig zu machen. Die »Tipps zur Fehlervermeidung« entspringen
überwiegend den Kommentaren der Nutzer, die zu Fehlerberichten
abgegeben wurden. Da sie von Ärztinnen und Ärzten, Arzthelfern
und Arzthelferinnen abgegeben wurden, sind sie nicht evidenzbasiert.
Alle vier Wochen erscheinen beispielhafte Analysen des »Fehler des
Monats« im Internet und in Fachzeitschriften.
Unterstützt vom Aktionsbündnis für Patientensicherheit
www.jeder-fehler-zaehlt.de wurde vom Institut für Allgemeinmedizin
der Universität Frankfurt unter der Verantwortung von Prof. Ferdinand
M. Gerlach entwickelt und wird vom Verband Medizinischer Fach-
berufe VMF und dem Aktionsbündnis Patientensicherheit unterstützt.
Ziel ist es, aus Fehlern anderer zu lernen, nach dem Motto: »Man muss
nicht jeden Fehler selbst machen, um daraus zu lernen.«
Bei www.jeder-fehler-zaehlt.de handelt es sich um ein offenes
Berichtssystem, das für jeden zugänglich ist. Aufgrund der anonymen
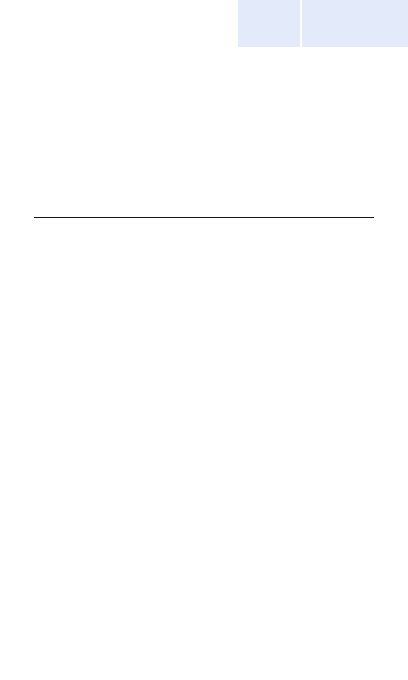
13
123
Berichtsfunktion muss niemand Angst vor Sanktionen und Repres-
salien haben. Wissen über risikobehaftete Situationen kann sich so gut
verbreiten, die Sensibilität für Risiken erhöht und die Auseinander-
setzung mit der eigenen Fehlbarkeit gefördert werden. Schon allein da-
durch verändert sich der Umgang mit Fehlern, und eine neue Fehler-
kultur kann sich entwickeln.
Online-Berichts- und Lernsystem für die Altenpflege
»Aus kritischen Ereignissen lernen« ist das erste nationale Berichtssys-
tem für die Pflege und wurde vom Kuratorium Deutsche Altershilfe –
Wilhelmine Lübke Stiftung e.V. entwickelt. Das Projekt steht unter der
Leitung von Heiko Rutenkröger und wurde über das Bundesministe-
rium für Gesundheit aus Mitteln der ARD Fernsehlotterie »Ein Platz
an der Sonne« finanziert. Unter www.kritische-ereignisse.de [39]
können alle Personen in der Altenpflege über kritische Ereignisse be-
richten, die sie entweder selbst erlebt oder beobachtet haben.
Ihre Stimme zählt!
Wesentliches Element des Berichtssystems sind Lösungsvorschläge, die
dazu geeignet sind, dass die genannten Ereignisse zukünftig vermieden
werden. Auch bei diesem Berichtssystem sind Grundlage für die Lösungs-
vorschläge die Kommentare derjenigen, die in der Altenpflege tätig sind.
»Aus kritischen Ereignissen lernen« versteht sich als Berichts- und
Lernsystem, das unerwünschte Ereignisse und aufgetretene Fehler als
Chancen sieht, zu lernen. Denn auch die Fehler anderer können sensi-
bilisieren – oft reicht es aus, Berichte zu lesen, um Erkenntnisse daraus
für den eigenen Pflegealltag zu gewinnen.
Anonymität gewahrt
Auch »Aus kritischen Ereignissen lernen« wahrt die Anonymität des
Berichtenden. Personenbezogene Daten werden nicht abgefragt und
Daten, die eine Identifizierung des Berichtenden ermöglichen, nicht
gespeichert. Eingereichte Berichte und Kommentare werden bis zu
13.2 · Beispiele von Berichtssystemen
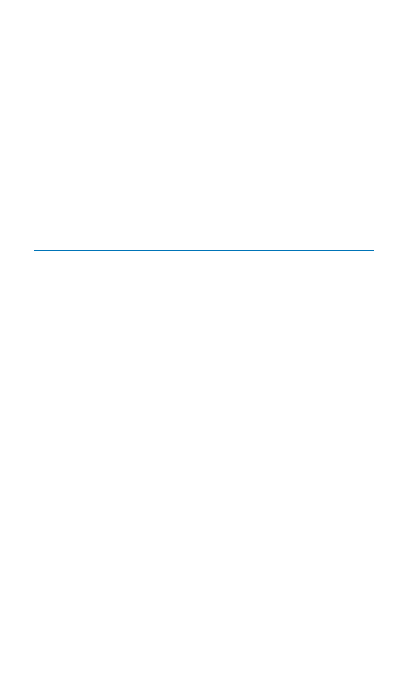
124
Kapitel 13 · Fehlerkultur für die Altenpflege
ihrer Veröffentlichung verschlüsselt in einer Datenbank abgelegt und
anschließend von einem Projektteam im KDA analysiert und ausge-
wertet. So können wichtige Erkenntnisse über Arten und Ursachen
von kritischen Ereignissen gewonnen werden. Auf der Website werden
diese als Bericht des Monats veröffentlicht. In einer Datenbank ge-
speichert können sie nach Titeln, Veröffentlichungsdatum, Arbeits-
bereichen und Schlagwörtern recherchiert werden.
13.3
Die ersten Schritte sind getan,
weitere müssen folgen
Die Einrichtung von Berichtssystemen ist noch längst nicht flächen-
deckend umgesetzt, sondern steht erst am Anfang. Erste Schritte sind
gemacht und die Auseinandersetzung mit dem Thema Risiken, Fehler
und Fehlerkultur in Gesundheitseinrichtungen ist angestoßen. Dazu
haben auch die bestehenden Berichtssysteme beigetragen. Um jedoch
nachhaltig eine Veränderung der Haltung in Bezug auf Fehler und
einen neuen Umgang mit Fehlern zu erreichen, müssen weitere
Schritte folgen.
Fazit
Für eine nachhaltige Veränderung im Umgang mit Fehlern und
kritischen Ereignissen braucht es weitere Schritte, z. B.:
Der Umgang mit Fehlern sollte als fester Bestandteil in die
Ausbildungscurricula mitaufgenommen werden.
Angebote wie Patientensicherheitstrainings sollten noch
besser kommuniziert und in der Fläche breiter angeboten
werden.
Die Implementierung von Berichtssystemen sollte nicht auf
freiwilliger Basis erfolgen, sondern im Rahmen des Qualitäts-
managements für jede Einrichtung gesetzlich verpflichtend
vorgeschrieben werden.
4
4
4
4
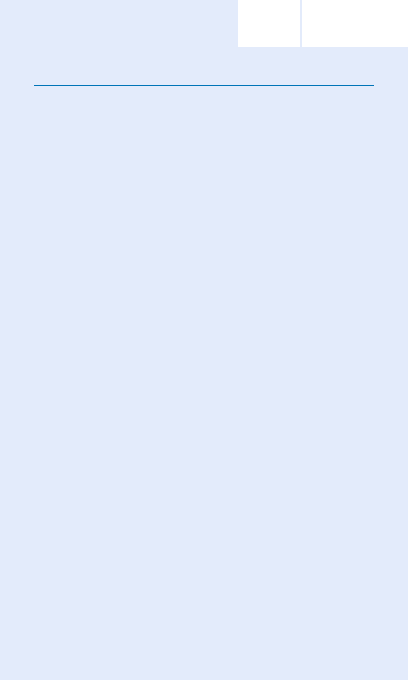
125
Meine Geschichte: Dieter Muth
Krankenpfleger, Frankfurt am Main
»Auf Station war die Hölle los!«
Es war wieder einmal so ein Tag, da kam alles zusammen. Eigentlich
sollten wir an diesem Nachmittag drei Pflegekräfte auf der Hautsta-
tion sein, dann wurde überraschend eine krank, mein Kollege, der mit
mir Dienst hatte, fühlte sich auch nicht so gut und auf Station war die
Hölle los. Eine stationäre Aufnahme nach der anderen, der Arzt wollte
etwas, die Ambulanz klingelte, Angehörige kamen mit Fragen und
die Patienten waren ja schließlich auch noch da. Man hat nur noch
reagiert. Irgendwie versuchte ich in dieser ganzen Hektik trotzdem,
alle pflegerischen Arbeiten zu erledigen. Und selbstverständlich sollte
auch der ältere Herr, der mit einer ausgeprägten Schuppenflechte zu
uns auf Station gekommen war, seine Salbenbehandlung bekommen.
Rasch warf ich einen Blick in die Krankenakte, nahm die dort ver-
meintlich angegebene Salbe aus dem Schrank und cremte den Pa-
tienten von Kopf bis Fuß damit ein. Kaum fertig damit, rannte ich,
um weitere Anordnungen auszuführen, einen neuen Patienten in
Empfang zu nehmen und ans Telefon zu gehen – am besten alles
gleichzeitig.
Starke Hautreizungen durch die falsche Salbe
Am nächsten Tag hatte sich das Hautbild des Patienten deutlich ver-
schlechtert. Die Haut war stark gereizt – fast wie nach einer Verbren-
nung, und tat natürlich entsprechend weh. Zunächst konnte ich mir
das nicht erklären. Aber als ich die Krankenakte noch einmal zur
Hand nahm und überprüfte, welche Salbe dort angeordnet war,
musste ich feststellen, dass ich zwar die richtige Salbe, aber in der
falschen Konzentration aufgetragen hatte. Statt der niedrig konzent-
rierten Salbe hatte ich zu einer deutlich höher konzentrierten ge-
griffen und bei dem Patienten damit starke Hautreizungen verursacht.
Mit einem furchtbar schlechten Gewissen entschuldigte ich mich
O
13
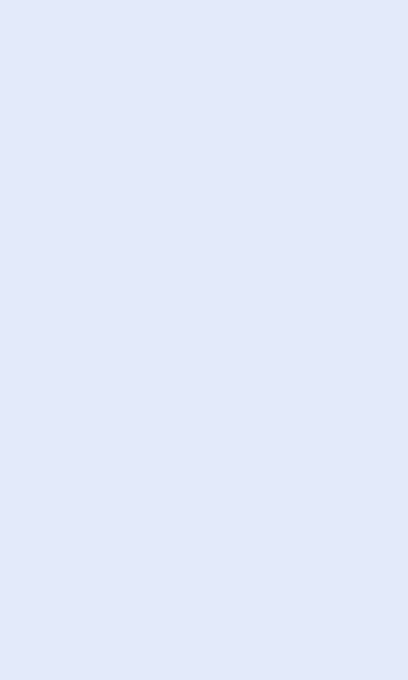
bei dem älteren Herrn, der zwar zunächst ärgerlich war, meine Ent-
schuldigung aber dann akzeptierte. Auch meinen Kollegen und dem
diensthabenden Arzt offenbarte ich mein Missgeschick. Letztendlich
hatte sich die Haut des Patienten nach ein paar Tagen wieder be-
ruhigt. Aber mich hatte noch lange mein Gewissen so gedrückt, dass
es kaum auszuhalten war.
Strukturiert arbeiten – egal wie groß die Hektik ist
Aus allem habe ich eine wichtige Lehre gezogen, nämlich Arbeits-
abläufe strukturiert durchzuführen, egal wie groß die Hektik ist. Einen
Schritt nach dem anderen tun, nicht in der Mitte anfangen oder den
letzten Arbeitsgang weglassen, lieber eine Arbeit, die man nicht
vollständig erledigen kann, auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.
Strukturiert arbeiten – das ist das A & O!

14
127
Beispiele aus dem
Sicherheitsmanagement
der Charité
Claudia Christ-Steckhan, Hedwig François-Kettner
Seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte machen Menschen Fehler, er-
kennen Menschen ihre Fehler und lernen aus ihren Fehlern. Grundsätz-
lich sind Fehler menschlich, möglich und lehrreich. Trotzdem ist es
nach wie vor schwer, im Pflege- und Behandlungsalltag offen und kon-
struktiv über Fehler zu reden und miteinander aus Fehlern zu lernen.
Umso wichtiger ist es, gemeinsam an der Entwicklung einer offenen
und lernfähigen Sicherheitskultur und Fehlerkultur zu arbeiten.
Sicherheitskultur: fachübergreifend und lebendig
Die Charité verfolgt hier gezielt einen berufsgruppenübergreifenden
Ansatz. Pflegende, Ärzte und Therapeuten arbeiten in wechselseitiger
Abhängigkeit und Ergänzung. Der Pflege- und Behandlungsprozess
der Patienten erfolgt durch eine fein abgestimmte, arbeitsteilige Ko-
operation zwischen den Berufsgruppen. Nur durch gemeinsamen
Erwerb von Sicherheitswissen und die gemeinsame Umsetzung sicher-
heitsförderlichen Verhaltens kann die Patientensicherheit, aber auch
die Sicherheit der Mitarbeiter erhöht werden.
Vorrangiges Ziel ist es, eine lebendige Sicherheits- und Lernkultur
zu schaffen. Die 3 wesentlichen Projekte aus diesem Themenkreis sind:
das Risikomanagement Weblog
das Critical Incident Reporting System CIRS Charité
die Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen
Fehler: oft noch personalisiert und sanktioniert
Von zentraler Bedeutung ist, welche Einstellungen und Bewertungs-
muster wir im Umgang mit Fehlern haben. In unserem Kulturkreis
4
4
4
14 · Beispiele Sicherheitsmanagement
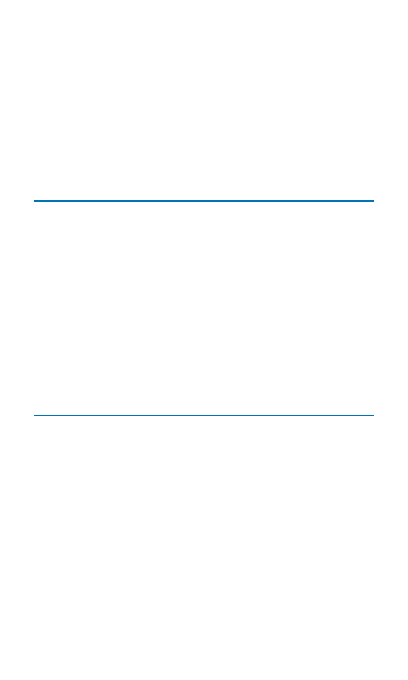
128
Kapitel 14 · Beispiele aus dem Sicherheitsmanagement der Charité
werden Fehler meist negativ gesehen und sind häufig verknüpft mit
einem Opfer-Täter-Denken und Schuldzuweisungen. In der Vergan-
genheit haben wir Fehler meist personalisiert und negativ sanktioniert.
Das Thema war häufig an Regeln und Tabus gebunden. Fehler wurden
diskret, vertraulich und nicht öffentlich bearbeitet.
14.1
Jeder Fehler ist eine Chance!
Die Entwicklung einer offenen und lernenden Sicherheits- und Fehler-
kultur macht es notwendig, dass wir diese alten Muster»entlernen« und
unsere Einstellungen, Wahrnehmungen und Bewertungsmuster im
Hinblick auf Fehler verändern [25]. Denn: In jedem Fehler steckt ein
großes Lernpotential für den zukünftigen Pflege- und Behandlungs-
prozess. Dieses Potential können wir nur nutzen, wenn wir nicht
unsere ganze Energie darauf verwenden, uns in die »Wer-ist-schuld?«-
Frage zu verbeißen. Viel interessanter und gewinnbringender ist die
Frage: »Was ist schuld?«
14.2
Fehler als »Trainingspartner«
Unvoreingenommen sollten wir analysieren, welche Faktoren an der
Entstehung des kritischen Ereignisses beteiligt waren [33]. Verein-
fachende und personalisierende Interpretationen verstellen den Blick
für die komplexe Verkettung von verursachenden Faktoren. Auf Basis
einer fundierten und systematischen Ursachenanalyse, können wir
wirksame Präventionsstrategien für die Zukunft entwickeln. Auf diese
Weise werden Fehler zu »Trainingspartnern« und Lehrmeistern auf
dem Weg zu höherer Qualität und besserer Versorgung der Patienten.
Fehleranalysen setzen Entwicklungsprozesse, Veränderungsprozesse
und Lernprozesse in Gang. Fehler zeigen uns, wo es noch Verbesse-
rungsbedarf gibt. Es ist unsere professionelle Verantwortung, die
Chance, die in jedem Fehler steckt, zu nutzen. Diesen Kulturwandel
verfolgen wir mit den nachfolgenden Projekten.

14
129
Risikomanagement Weblog
Damit man aus Schwierigkeiten und Fehlern lernen kann, müssen sie
bekannt sein. Um bekannt zu werden, müssen Schwierigkeiten und Feh-
ler offen angesprochen werden. Die Auseinandersetzung mit eigenen
Fehlern erfordert Mut. Diesen Mut und die erforderliche Offenheit wol-
len wir mit dem Risikomanagement Weblog im Intranet der Charité be-
fördern. Im Risiko-Blog werden ausgewählte Beinahe-Zwischenfälle aus
dem CIRS Charité und Probleme, die in den laufenden Morbiditäts- und
Mortalitätskonferenzen (M&M-Konferenzen, s. u.) besprochen wurden,
publiziert. Um die Mitarbeiter und das Unternehmen zu schützen,
werden hier nicht nur Charité-interne Vorkommnisse berichtet, sondern
auch relevante Fehlerberichte aus anderen Kliniken und Fehlerberichts-
datenbanken. Auf diese Weise ist nicht mehr zu erkennen, wo der Fehler
passiert ist oder wer daran beteiligt war.
Das Motto des Blog ist: Man muss nicht jeden Fehler selber
machen, um daraus zu lernen!
Gezielt suchen, lesen, lernen
Die Auswahl der Fehlerberichte und die redaktionelle Pflege des Web-
log erfolgt durch das Zentrale Qualitätsmanagement. Die einzelnen
Fehlerberichte sind klassischen Fehlerkategorien zugeordnet, wie
Schnittstellen/Kommunikation, Geräte/Material oder Medikamente.
So kann im Blog gezielt themenspezifisch gesucht, gelesen und gelernt
werden. Der Zugang zum Blog steht jedem Mitarbeiter ohne Passwort
über das Intranet offen. Jeder kann anonym oder unter seinem Namen
Kommentare zu den Fehlerberichten schreiben.
Der »Fehler des Monats«
Seit April 2008 veröffentlichen wir im Blog zusätzlich zu den laufenden
Fehlerberichten jeden Monat den »Fehler des Monats«. Dies ist eine
bewusst offensiv gewählte Form – eine paradoxe Intervention – um
auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Der Fehler des Monats ist
entweder sehr relevant, sehr häufig oder besonders lehrreich. Die Ur-
>
14.2 · Fehler als »Trainingspartner«
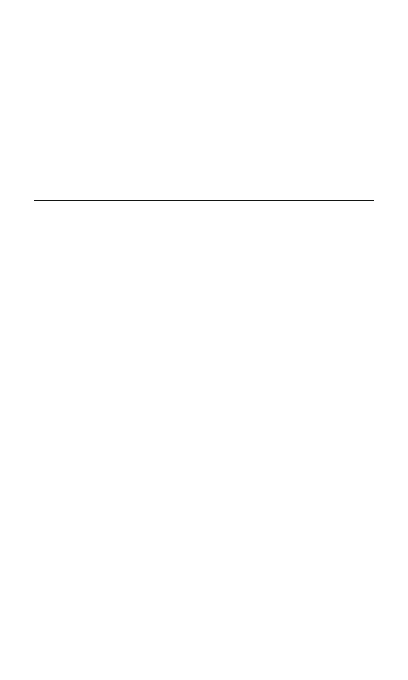
130
Kapitel 14 · Beispiele aus dem Sicherheitsmanagement der Charité
sachen des Fehlers werden detailliert analysiert und die Maßnahmen
zur Vermeidung in der Zukunft dargestellt. Der Fehlerbericht des
Monats wird regelmäßig von sehr vielen Mitarbeitern gelesen und dis-
kutiert. Im Durchschnitt gibt es pro Monat 1.500 einzelne Zugriffe auf
das Blog.
Critical Incident Reporting System: CIRS Charité
Im Jahr 2006 haben wir in der Charité ein anonymes Berichtssystem
für kritische Ereignisse eingerichtet, das CIRS Charité. Seitdem kann
jeder Mitarbeiter von jedem Rechner aus anonym über einen Fehler,
ein kritisches Ereignis oder einen Beinahe-Zwischenfall berichten.
Auf diese Weise ist es möglich, aus Beinahe-Zwischenfällen (Critical
Incidents) zu lernen, um wirkliche Zwischenfälle, bei denen ein Patient
zu Schaden kommen könnte, zu vermeiden. In CIRS werden Ereignisse
gemeldet, die gerade noch einmal gut gegangen sind. Aus diesen Er-
eignissen wollen wir lernen, damit diese Patienten und Mitarbeiter
gleichermaßen gefährdenden Situationen in Zukunft vermieden
werden können.
Garantiert freiwillig, anonym, vertraulich und sanktionsfrei
Wichtig für die Akzeptanz und Nutzung des Systems ist, dass die
Grundsätze Freiwilligkeit, Anonymität, Vertraulichkeit und Sanktions-
freiheit garantiert und eingehalten werden (s. Aktionsbündnis Patien-
tensicherheit e.V.). Die eingegangenen Berichte werden durch soge-
nannte CIRS-Moderatoren ausgewertet. Die CIRS-Moderatoren sind
Ärzte und Pflegende aus den jeweiligen Teams. Meist sind 2 Ärzte und
2 Pflegekräfte das Moderatorenteam für einen bestimmten CIRS-Mel-
dekreis [29]. Gemeinsam werten sie die eingegangen Berichte aus und
setzen Veränderungen und Präventionsmaßnahmen in Gang, die einen
solchen Vorfall in der Zukunft verhindern helfen.
Durch die in CIRS gemeldeten Berichte ist es möglich, entstandene
Fehler zu identifizieren, Ursachen abzuklären und daraus Maßnahmen
zur künftigen Verhinderung dieser Fehler zu ergreifen.
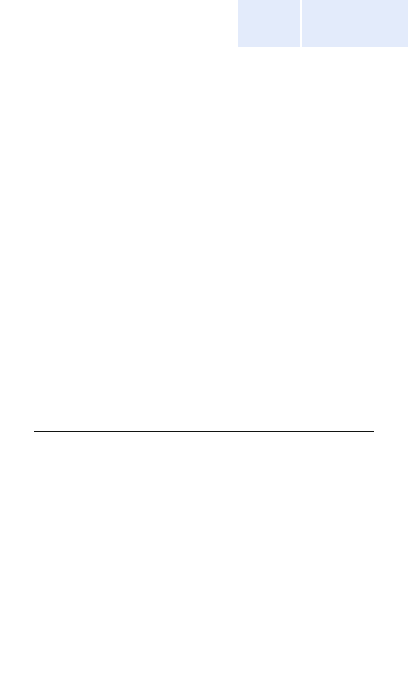
14
131
Aus Meldungen werden Verbesserungen
Nach gut 3 Jahren wurden über 650 Fehlerberichte in CIRS Charité
gemeldet. Das System wird von Ärzten und Pflegekräften gleicher-
maßen genutzt. Durch die Analyse der eingegangenen Meldungen ist
es gelungen, sehr relevante Veränderungen und Verbesserungen in
Gang zu setzen. Viele dieser Verbesserungen beziehen sich auf die Be-
reiche, aus denen die Berichte gemeldet wurden. Beispiele dafür sind
Trainings für medizintechnische Geräte und Veränderungen der Ar-
beitsabläufe im Pflege- und Behandlungsprozess. Einige CIRS-Mel-
dungen haben unternehmensweite Veränderungen in Gang gesetzt, wie
zum Beispiel Produktwechsel von Medikamenten (in Folge von Medi-
kamentenverwechslung) oder Produktwechsel von Medizinprodukten
(z. B. Handbeatmungsbeutel).
Sehr wichtig ist es, die Mitarbeiter kontinuierlich über Maßnah-
men, die durch CIRS-Meldungen erfolgen, zu informieren. Nur so
können die Mitarbeiter motiviert werden, Berichte von kritischen
Ereignissen zu melden [27]. Wenn es gelingt, CIRS in den täglichen
Arbeitsablauf zu integrieren, kann das Wissen der Mitarbeiter um
Fehlerquellen und Verbesserungspotenziale gezielt genutzt werden.
Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen
Sicherheitskultur setzt Kommunikationskultur voraus. Es muss Raum,
Zeit und die Bereitschaft gegeben sein, über Probleme, kritische Situa-
tionen oder suboptimale Handlungen miteinander zu sprechen.
Das geeignete Besprechungsformat hierfür sind die Morbiditäts-
und Mortalitätskonferenzen. Diese regelmäßigen strukturierten Be-
sprechungen besonders schwerer Krankheitsverläufe wurden primär
in den Intensivbereichen der Charité etabliert. Derzeit werden sie in
einem zweiten Schritt in den Normalstationsbereichen implementiert.
Die Besprechungsform ist ein klassisches Forum zur konstruktiven
und kritischen Auseinandersetzung mit einer eigenen Vorgehensweise.
Ärzte und Pflegekräfte, die bei der Betreuung der Patienten mitgewirkt
haben, nehmen gemeinsam an diesen Besprechungen teil. Durch die
14.2 · Fehler als »Trainingspartner«

132
Kapitel 14 · Beispiele aus dem Sicherheitsmanagement der Charité
gemeinsame Analyse der Pflege- und Behandlungsverläufe unter dem
Blickwinkel »Was hätten wir besser machen können?« wird für die
Zukunft gelernt. So kommt es zu einer ständigen Verbesserung der
Arbeitsweise und Abläufe im Klinikalltag. Therapieentscheidungen
werden für das Team nachvollziehbar gemacht und in Kenntnis der
Erfolge und Misserfolge diskutiert. Die Morbiditäts- und Mortalitäts-
konferenzen sind eine qualitätssichernde Maßnahme, die sowohl kont-
rollierend und korrigierend als auch prophylaktisch wirkt.
Strukturiert und wertschätzend
Für die Charité wurde ein Standardformat der Morbiditäts- und
Mortalitätskonferenzen entwickelt. Die Konferenzen sollen in einem
festen Rhythmus stattfinden, möglichst an einem feststehenden Ter-
min. Besonderer Wert wird auf eine zielführende Moderation gelegt.
Hierdurch wird gewährleistet, dass die Diskussion strukturiert und
sachlich verläuft und der Ton des Austauschs wertschätzend ist. Auf-
grund der Wichtigkeit der Moderation für das Gelingen der Konfe-
renzen [23] wurde ein eigenes Schulungsprogramm für Moderatoren
entwickelt. Der Fokus der Konferenz liegt immer auf den Schlussfolge-
rungen für die Zukunft: Wie können wir Maßnahmen und Abläufe
kontinuierlich verbessern, damit wir weiterhin optimale Pflege- und
Behandlungsergebnisse erreichen und sichern? Um die wichtigen
Ergebnisse der Konferenzen festzuhalten und diese auch Mitarbeitern,
die nicht teilnehmen konnten, verfügbar zu machen, wurde eine ein-
heitliche Dokumentationsvorlage entwickelt, in der die Veränderun-
gen, die in der Diskussion erarbeitet worden sind, nachgelesen werden
können.
Der offene Meinungsaustausch im geschützten Rahmen führt
idealerweise zu einer Verbesserung von problembezogener Kommuni-
kation und Teamarbeit im Pflege- und Behandlungsalltag. Zudem
wird ein teamorientierter Denkansatz im Hinblick auf die Steigerung
der Sicherheit und Qualität gefördert.
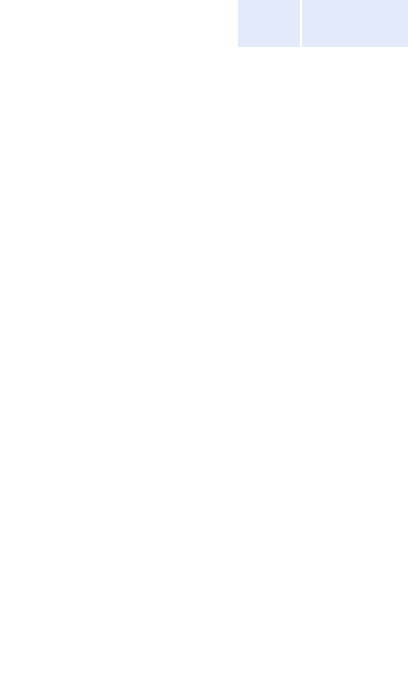
14
133
Fazit
Mit den beschriebenen Projekten wurden entscheidende Fort-
schritte auf dem Weg hin zu einer offenen, fairen und lernenden
Sicherheitskultur initiiert. In der immer komplexer werdenden
modernen Hochleistungsmedizin, in der viele Menschen in einer
hochtechnisierten Umgebung gemeinsam in kleinteiligen Arbeits-
schritten an der Versorgung der Patienten beteiligt sind, ist die
Aufgabe »Lernen aus Fehlern« ohne Alternative.
4
14.2 · Fehler als »Trainingspartner«
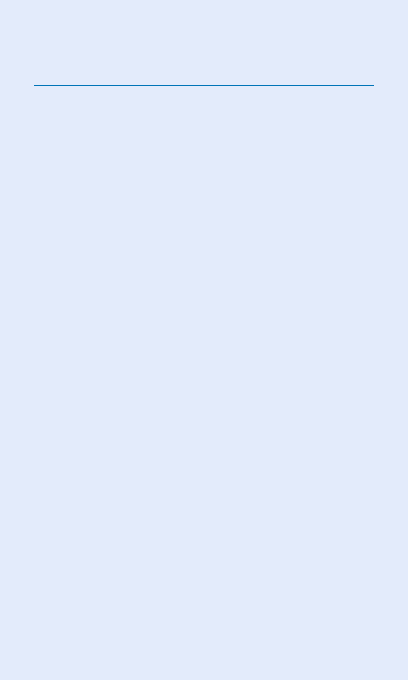
Meine Geschichte: Ulrike Steinecke
Vorsitzende des Deutschen Verbandes für Physiotherapie – Zentral-
verband der Physiotherapeuten/Krankengymnasten e.V. (ZVK)
»Mit meiner Querfriktion habe ich mehr Schaden als Nutzen
angerichtet«
Wenn der Patient nicht schon lange und gern zu uns in die ortho-
pädische Ambulanz gekommen wäre, und wenn wir nicht ein so
gutes Verhältnis zu einander gehabt hätten, hätte das alles auch
ganz anders ausgehen können. Ich war damals im Praktikum, das
gleich im Anschluss an meine 2-jährige Ausbildung zur Physiothera-
peutin folgte. Der Patient war ein älterer Herr, der wegen einer rheu-
matoiden Arthritis in unsere Praxis kam. Er wurde vor allem wegen
seiner Schmerzen im Schultergelenk behandelt, die teilweise durch
eine schon lange anhaltende Sehnenreizung verursacht wurden.
Dass er eine Woche nach meiner Behandlung mit einem riesigen Blut-
erguss wiederkommen würde, konnte keiner von uns voraussehen.
»Prima!« dachte ich. »Läuft alles bestens ... «
Dabei war ich bei der Behandlung des Patienten ganz schulmäßig
vorgegangen: Bei der Palpation hatte sich herausgestellt, dass die
lange Bizeps-Sehne schmerzhaft war. Eine sehr gute Methode zur
Schmerzlinderung in solchen Fällen ist die so genannte Querfriktion.
Dazu wird quer zum Faserverlauf gerade so viel Druck auf die Sehne
ausgeübt, wie es der Patient noch gut tolerieren kann. Um sicher zu
gehen, dass die Querfriktion auch für den individuellen Fall wirksam
ist, macht man zuerst einen Test: Man übt die Querfriktion eine
Minute lang mit gleichbleibendem Druck aus. Wenn innerhalb dieser
kurzen Zeitspanne der Schmerz nachlässt, kann man die eigentliche
Behandlung anschließen. Genauso war ich vorgegangen. Als ich
merkte, dass der Schmerz tatsächlich abgeklungen war, freute ich
mich: »Prima! Querfriktion wirkt!« Bei den nachfolgenden Übungen
zur Verbesserung von Beweglichkeit und Aktivität lief ebenfalls alles
einwandfrei und der Patient ging zufrieden nach Hause.
O
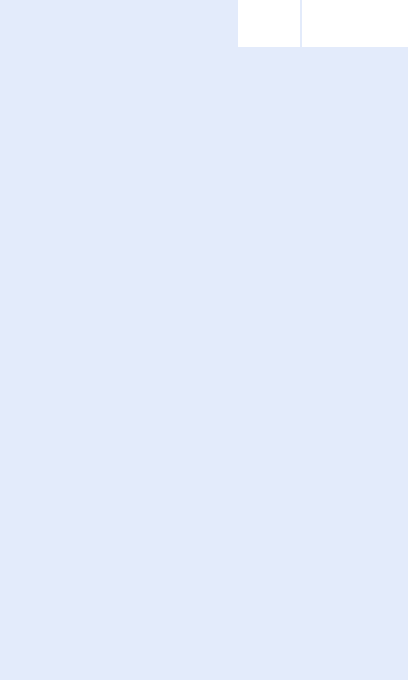
135
…»Bestens?« Von wegen!
Eine Woche später dann stand er vor mir: »An einem Schönheitswett-
bewerb kann ich jetzt nicht mehr teilnehmen! Sie haben mir die lange
Bizeps-Sehne ‚abmassiert’!« Obwohl möglicherweise ein Wirkstoff,
der an dem Patienten gerade im Rahmen einer Pilotstudie untersucht
wurde, dafür verantwortlich war, dass die Sehne trotz sachgerechter
Behandlung abreißen konnte, war ich sehr betroffen! Offenbar hatte
ich mit meiner Querfriktionsbehandlung mehr Schaden als Nutzen
angerichtet. Ich entschuldigte mich viele Male bei dem Patienten.
Auch meine Vorgesetzte kam unterstützend hinzu, stärkte mir den
Rücken, schlichtete und beruhigte den Patienten. Glücklicherweise
war das Arbeitsklima so gut, dass ich mich nicht verteidigen musste,
nichts rechtfertigen, sondern meinen Fehler rückhaltlos zugeben
konnte. Unser offener Umgang damit und die Tatsache, dass der
Patient außer dem Bluterguss keine Bewegungseinschränkungen
oder Schmerzen hatte – beides hat sicherlich dazu beigetragen, dass
der Patient die Situation nicht eskalieren ließ. Er konnte mein Miss-
geschick sogar mit einer guten Portion Humor nehmen und hat
uns weiterhin vertraut. Fehler passieren. Auch in der besten Ausbil-
dung kann man nicht lernen, wie man Fehler hundertprozentig
ausschließt. Aber man kann lernen, mit Fehlern umzugehen – offen
und ohne Angst.
14

136
Kapitel 15 · Vorbeugen ist besser als haften – Aus Fehlern lernen
Vorbeugen ist besser als
haften – Aus Fehlern lernen
Rolf Höfert
Dekubitus/Dokumentationsmangel – Schadenersatz 16.318 €
Die Krankenkasse einer Heimbewohnerin (Klägerin) forderte
Schadenersatzansprüche für Kosten, die ihr im Rahmen der Behand-
lung eines Dekubitus entstanden sind. Die Bewohnerin litt unter
seniler Altersdemenz mit Unruhe- und Verwirrtheitszuständen sowie
Harninkontinenz. Ihre Hausärztin diagnostizierte ein Dekubitalge-
schwür im Gesäßbereich und verordnete Betaisodona-Salbe. Bei
einem weiteren Arztbesuch zeigte sich das Dekubitalgeschwür ver-
größert. Die Bewohnerin wurde nachfolgend zur stationären Behand-
lung in ein Krankenhaus eingewiesen und kehrte anschließend in
die Pflegeeinrichtung zurück. Das Dekubitalgeschwür war noch vor-
handen und wurde auf telefonische Anordnung der Hausärztin durch
Spülungen mit Wasserstoff und mit Rivanol sowie Furosemid 40 be-
handelt. Erst ein chirurgischer Eingriff führte zur Abheilung des
Geschwürs. Die Krankenkasse verlangte daraufhin die Erstattung
der durch den zweiten Krankenhausaufenthalt entstandenen Kosten.
In der ersten Instanz hat das LG Duisburg die Klage dem Grunde nach
für gerechtfertigt erklärt. Vor dem OLG Düsseldorf beantragte der
Heimträger, das erstinstanzliche Urteil abzuändern und die Klage ab-
zuweisen.
Entscheidungsgründe
In der Berufungsinstanz wurde erkannt, dass der Schadenersatz-
anspruch sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach wegen schuld-
hafter Schlechterfüllung des stationären Pflegevertrages gemäß
§§ 611, 276, 278 BGB begründet ist. Die Entstehung des Geschwürs
beruhte auf einem schuldhaften Pflegefehler. Von Bedeutung war
6
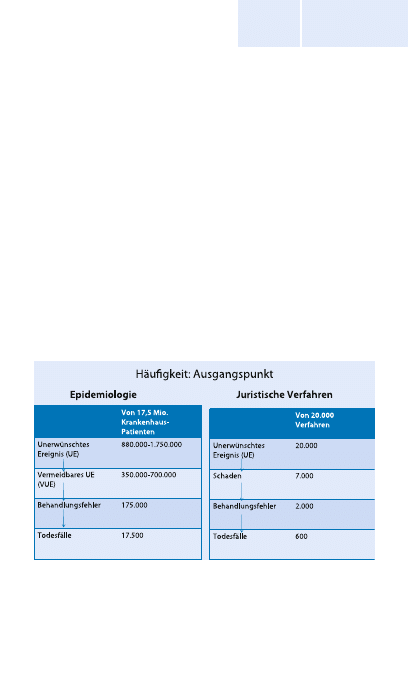
15
137
auch die unzulängliche und lückenhafte Dokumentation, die auf
schuldhafte, fehlerhafte Maßnahmen in der Dekubitusprophylaxe
schließen ließ. Ein mögliches ärztliches Mitverschulden bei der Be-
handlung des bereits aufgetretenen Geschwürs wurde ausdrücklich
ausgeschossen.
(OLG Düsseldorf, Urteil vom 16.06.2004, 1-15 U 160/03).
Sicher haben Sie im Pflegealltag schon einmal eine so genannte Schreck-
sekunde erlebt. Vergleichbar der Luftfahrt kommt es auch im medizi-
nischen und pflegerischen Leistungsbereich zu »Beinahe-Katastro-
phen«. In einer offenen Fehlerkultur und -kommunikation muss es
immer darum gehen, aus Fehlern zu lernen, um sie zu vermeiden.
Eine rigide Fehlerkultur, die vor allem mit Schuldzuweisungen ope-
riert, ist kontraindiziert, weil die Akteure dann allzu oft nicht den
Mut finden, ihre Fehler offenzumachen, damit alle daraus lernen kön-
nen (
.
Abb. 15.1
).
Abb. 15.1. Häufigkeit. Der Rechts-Links-Vergleich zeigt, dass es nur bei einem Bruch-
teil der Ereignisse tatsächlich zu einem juristischen Verfahren kommt. Mit freundlicher
Genehmigung von Professor Dr. Matthias Schrappe (modifiziert nach [40])
.
15 · Vorbeugen ist besser als haften

138
Kapitel 15 · Vorbeugen ist besser als haften – Aus Fehlern lernen
15.1
Die gesetzliche Grundlage
Mit dem Bundesaltenpflegegesetz von 2003 und dem Krankenpflege-
gesetz von 2004 wurden jeweils in § 3 die eigenverantwortlichen Auf-
gaben der Pflege klar definiert und die Verantwortung in Ausführung
ärztlich veranlasster Maßnahmen konkretisiert.
Die Pflegeprofession ist mit dem Ansatz ganzheitlicher, am Patien-
ten orientierter Konzepte und wissenschaftlicher Expertisen im Sinne
des Grundgesetzes, Artikel 74, Abs. 1 Nr. 19, als »anderer Heilberuf«
»Partner« in der Versorgungsstruktur.
Im juristischen Ernstfall sieht sich die Pflege mit dem Vorwurf
der gefährlichen Pflegehandlung konfrontiert. Strafrechtliche und
zivilrechtliche Konsequenzen können einschneidende Folgen für jeden
Einzelnen bedeuten.
Wesentlich in der Klärung der Schuldfrage sind dann die Ebenen
der Organisations-, Anordnungs- und Durchführungsverantwortung
bzw. -haftung.
Praxistipp
Häufigste Klagemomente gegen Pflegende betreffen
Dekubitus
Sturz
Fixierung
Dokumentationsmängel
Fehler in der Ausführung ärztlicher Verordnungen
Patienten erwarten, nach den neuesten Standards
betreut zu werden
Der Patient setzt im Sinne des Krankenhausaufnahmevertrages, Heim-
vertrages oder Pflegevertrages darauf, von kompetenten, konstruktiv
zusammenwirkenden Leistungserbringern im Sinne des aktuellen
Standes der Wissenschaft versorgt zu werden. Hierzu gehören auch
die wissenschaftlichen Expertenstandards »Dekubitusprophylaxe«,
v
4
4
4
4
4

15
139
»Entlassungsmanagement«, »Schmerzmanagement«, »Sturzprophy-
laxe«, »Kontinenzförderung«, »Pflege von Menschen mit chronischen
Wunden« sowie »Ernährungsmanagement«.
Im Sinne der Beweisführung vor Gericht sind Standards und Richt-
linien sowie deren belegbare Umsetzung in der Einrichtung von beson-
derer Bedeutung.
Rechtliche Verpflichtung zur Fort- und Weiterbildung
für Pflegende
Aufgrund der qualitätssichernden Anforderungen des SGB V (Kranken-
versicherungsgesetz) und SGB XI (Pflegeversicherungsgesetz) sind die
Leistungserbringer in der Pflege auch in Korrespondenz zum Alten-
pflegegesetz § 3 und Krankenpflegegesetz § 3 in Wahrnehmung der
eigenverantwortlichen Aufgaben verpflichtet, sich in aktuellen pflege-
wissenschaftlichen Erkenntnissen fort- und weiterzubilden. Im Vor-
wort zum GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) wird unter 3b) Maß-
nahmen zur Verbesserung der Qualität der Patientenversorgung gefor-
dert: »Zur Verbesserung der Qualität der Versorgung soll auch eine
Verpflichtung für alle Ärzte und sonstigen Gesundheitsberufe zur re-
gelmäßigen interessenunabhängigen Fortbildung beitragen.«
Heimträger, ambulante Pflegedienste, Krankenhäuser und deren
Mitarbeiter sind seit Jahren vermehrt mit Regressansprüchen von
Krankenkassen konfrontiert, wenn es im Rahmen der pflegerischen
Versorgung zu Schäden der Bewohner/Patienten bzw. Krankenver-
sicherten kommt.
Die Beweislast liegt beim Träger
Bei Haftungsansprüchen gegen den Träger bzw. die Mitarbeiter eines
Altenheimes, ambulanten Pflegedienstes, Krankenhauses ist die Be-
weislast bzw. Beweislastumkehr von großer Bedeutung. D. h. dass der
Träger beweisen muss, dass alles Erforderliche getan wurde, um nicht
zusätzliche Risiken für den Bewohner/Patienten aufkommen zu lassen.
Beweiserleichternd für den Bewohner, Patienten, seine Angehörigen
15.1 · Die gesetzliche Grundlage
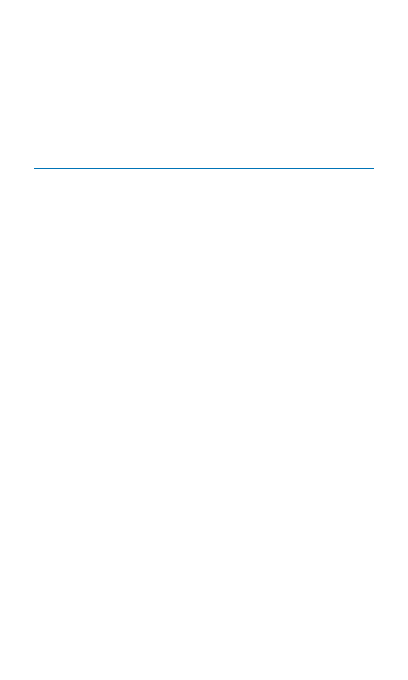
140
Kapitel 15 · Vorbeugen ist besser als haften – Aus Fehlern lernen
und die Krankenkassen sind grobe Behandlungsfehler, der Einsatz
unqualifizierten Personals sowie eine unzulängliche, lückenhafte oder
nachträglich erstellte Dokumentation (BGB NJW 1983, S. 2080, 2081).
15.2
Rechtsfälle aus der Praxis
Typische Beispiele sind:
Kaliumchlorid statt Natriumchlorid
Hirnverletzung bei Kieferhöhlenoperation
abgebrochene Operationsnadelspitze bei Bandscheibenoperation
Haken halten, Wundsekret absaugen und Gefäße koagulieren durch
OP-Pfleger
tödliche Bakterieninfektion nach Kaiserschnittentbindung
Bauchtuch bei Operation vergessen
Amputation des Daumenendgliedes beim Verbandswechsel
vertauschtes Kreuzblut
tödliche Strangulation durch Bauchgurtfixierung
Patientin verblutet nach Nierenbiopsie
Rollstuhlfahrerin stürzt ins Treppenhaus
Kontrastmitteleinlauf statt ins Rektum in die Scheide
gewaltsames Entfernen eines gefüllten Ballonkatheters
Megacillininjektion bei Penicillinallergie
tödliche Sturzverletzung einer Heimbewohnerin, weil nur von einer
Pflegekraft geführt
verspätete Reanimation mit Folge Wachkoma
Darmperforation bei Verabreichung eines Klysmas
Spritzenabszess,
Dekubitus, grobe Fahrlässigkeit
Injektion von Narkosemittel in Arterie
Badewasser über 50°C, Bewohnerin verstorben
Fehlmedikation
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

15
141
Fall 1: Darmperforation bei Verabreichung eines Klysmas,
60.000 € Schmerzensgeld
Wird ein Patient bei der Behandlung durch einen Krankenpfleger
verletzt, haftet das Pflegepersonal, ohne dass der Patient einen Be-
handlungsfehler nachweisen muss. Der Krankenpfleger verabreichte
dem Patienten einen Darmeinlauf (Klysma). Wegen plötzlich auftre-
tender Bauchschmerzen und danach festgestellten Kontrastmittelaus-
tritts aus dem Enddarm wurde der Kläger notfallmäßig laparotomiert.
Deliktische Haftung des Krankenpflegers nach §§ 253 Abs. 2, 823
Abs. 1 BGB Urteil des Pfälzischen Oberlandesgerichts (OLG) Zwei-
brücken vom 16.01.2007
OLG Zweibrücken, Az: 5 U 48/06
Fall 2: Geldstrafen für Tod eines Bewohners nach verschluckter
Zahnprothese
Der 75-jährige Patient war nach stationärer Behandlung in einem
Krankenhaus mit zwei Hüftoperationen infolge der Verschlechterung
des Allgemeinzustandes in ein Pflegeheim verlegt worden. Hier ver-
starb er nach 5 Tagen an einer Lungenentzündung. Bei der Obduktion
fand man eine in den Rachenraum gelangte Unterkieferzahnprothese
als ursächlich für die Lungenentzündung.
Hauptvorwurf gegen die zwei verurteilten Altenpflegerinnen war,
dass der tödliche Ausgang hätte verhindert oder verzögert werden
können, wenn eine sachgerechte Kontrolle und Pflege der Mund-
höhle, ein rechtzeitiges Entfernen der rachenwärts verlagerten Zahn-
prothese und das Hinzuziehen eines Arztes zur Behandlung erfolgt
wären.
Verurteilt wurde die eine Altenpflegerin wegen fahrlässiger
Körperverletzung zu einer Geldstrafe von € 2.700,-, die andere wegen
fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von € 3.000,-
(AG Bühl, AZ: Cs 200/Js 698/03).
15.2 · Rechtsfälle aus der Praxis

142
Kapitel 15 · Vorbeugen ist besser als haften – Aus Fehlern lernen
Fall 3: Sturz am Waschbecken, € 8.000,- Schadenersatz
wegen Fahrlässigkeit der Pflegerin
Zu seinem Recht und zu Schadenersatz kam der Ehemann einer in
einem privaten Altenpflegeheim untergebrachten Frau, die an den
Folgen eines Sturzes verstorben war. Die an schwerer Altersdemenz
leidende Patientin war auf ihrem Zimmer gestürzt und hatte sich eine
Armfraktur und Kopfverletzungen zugezogen, als ihre Pflegerin sie am
Waschbecken stehen ließ, um den Toilettenstuhl bereitzustellen.
Das Gericht sah darin eine fahrlässige Unachtsamkeit der Pflegerin
und somit eine Vertragsverletzung, für die auch das Pflegeheim einzu-
stehen hat. Es durfte nicht darauf vertraut werden, dass die Patientin
auch nur kurze Zeit ohne Hilfe sicher stehen bleiben würde. Die
Pflegende durfte deshalb nicht dadurch eine von ihr nicht mehr be-
herrschbare Situation herbeiführen, dass sie sich von der geflegten
Person abwandte, und sie so bei einem Sturz nicht mehr rechtzeitig
eingreifen konnte. Dem klagenden Ehemann steht somit aus über-
gegangenem Recht ein Schmerzensgeldanspruch (§§ 823 Abs. 1, 253
Abs. 2 BGB) in Höhe von € 8000,- zu.
Fall 4: Eigenmächtige Fixierung durch das Pflegepersonal
Die Ehefrau eines Patienten verlangte Schadenersatz von zwei Pflege-
personen, weil jene haftungsrechtlich für den Tod ihres Ehemannes
verantwortlich seien. Wegen eines akuten psychotischen Schubs kam
der 63-jährige Patient in das Klinikum und wurde von den zwei dienst-
habenden Pflegekräften wegen starker Unruhe mittels eines Bauch-
gurtes und Fußfesseln im Bett fixiert. Eineinhalb Stunden später wurde
eine Pflegeperson wegen eines Hilferufes darauf aufmerksam, dass in
dem Zimmer des Patienten ein mit starker Rauchentwicklung verbun-
denes Feuer ausgebrochen war. Das Bettzeug des Patienten war in
Brand gesetzt worden. Der Patient erlitt schwere Verbrennungen
zweiten und dritten Grades an Füßen und Beinen bis hinauf zu den
Genitalien. Er wurde zur stationären Behandlung in das Krankenhaus
eingeliefert, wo er nach 3 Monaten verstarb. Die Ehefrau, als Klägerin,
nahm das diensthabende Pflegepersonal, den diensthabenden Arzt
6

15
143
und den Klinikträger auf Ersatz von Haushaltshilfekosten sowie von
Aufwendungen in Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung,
dem Krankenhausaufenthalt und der Beerdigung ihres Mannes in An-
spruch.
Feststellungen des Gerichtes:
Pfleger handeln pflichtwidrig, wenn sie einen Patienten ohne vor-
herige schriftliche Anordnung des Arztes (teil-)fixieren und es darüber
hinaus unterlassen, sofort einen Arzt von dieser Maßnahme zu unter-
richten und dessen weitere Entscheidungen abzuwarten.
Eine eigenmächtige (Teil-)Fixierung durch das Pflegepersonal kann
nur zur Abwendung akuter Gefahren für den Patienten oder andere,
die keinen Aufschub dulden, zugelassen werden.
Es ist ein Behandlungsfehler, einen psychiatrischen Risikopatienten,
der medikamentös nicht ausreichend beruhigt worden war, im Bett zu
fixieren, ohne ihn ständig optisch und akustisch zu überwachen.
Fall 5: Injektion durch Nichtfachkräfte
Das Verabreichen einer Spritze stellt einen Eingriff in die körperliche
Unversehrtheit des Patienten dar und erfüllt den Tatbestand der Kör-
perverletzung im Sinne § 223 des Strafgesetzbuches. Die Einwilligung
eines Patienten erstreckt sich auch auf die Delegation von Injektionen
auf medizinisches Hilfspersonal, soweit sie nach objektiven Maßstä-
ben als zulässig anzusehen ist. Vor der Delegation ärztlicher Tätig-
keiten auf Hilfskräfte ohne pflegerische Ausbildung ist zwingend die
materielle Qualifikation durch einen Arzt festzustellen.
Zum Urteil:
Verurteilt wurde eine Heimleiterin wegen Anstiftung zur Körperver-
letzung, weil sie einen Mitarbeiter beauftragt hatte, subkutan Insulin
zu spritzen. Der Mitarbeiter war als Pflegehelfer eingestellt. Er hatte
keine pflegerische Qualifikation und war gelernter Kraftfahrzeug-
mechaniker. Eine ärztliche Anleitung oder Überwachung während der
Verabreichung fand nicht statt. Die Angeklagte hat den Mitarbeiter in
6
15.2 · Rechtsfälle aus der Praxis
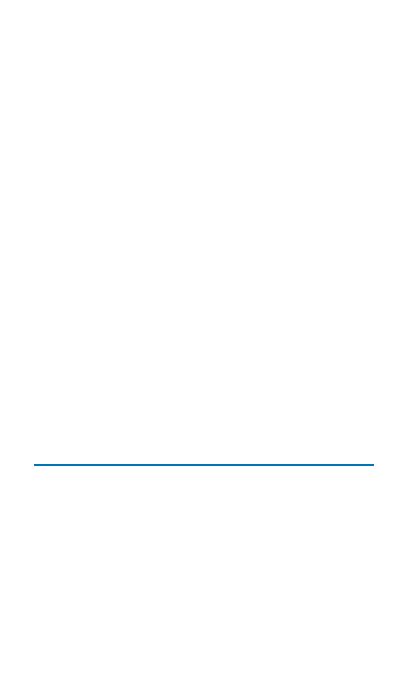
144
Kapitel 15 · Vorbeugen ist besser als haften – Aus Fehlern lernen
die Technik der subkutanen Injektion eingewiesen. Das Landgericht
Waldshut sah in den Injektionen durch den nicht (pflegerisch) qualifi-
zierten Mitarbeiter eine vorsätzliche Körperverletzung. Da die Patien-
tin nicht im Voraus über die fehlende Qualifikation des Mitarbeiters
unterrichtet wurde, konnte sie nicht wirksam in die Injektionen ein-
willigen. Der Heimträger und die Pflegedienstleitung müssten seine
»materielle Qualifikation«, d. h. sein Wissen und Können im Zusam-
menhang mit den ihm übertragenen Aufgaben, prüfen und die Dele-
gation mit dem behandelnden Arzt oder einem Beratungsarzt des
Heimes abklären (LG Waldshut-Tiengen, Urteil vom 23.03.2004, AZ: 2
Ns 13 Js 1059/99).
Diese Urteile lassen sich auf alle Leistungsbereiche der Pflege übertragen.
Praxistipp
Zur Fehlerprophylaxe gehört das Aufzeigen von Bedenken
Unter »Remonstration« (Aufzeigen von Bedenken) versteht man
das Recht und die Pflicht, eine gefahrengeneigte Versorgung
schriftlich und damit nachweislich aufzuzeigen. Damit kommt der
Mitarbeiter/die Mitarbeiterin ihrer Hinweis- und Unterrichtsver-
pflichtung nach. Die Remonstration muss im Sinne des § 121 BGB
unverzüglich erfolgen.
15.3
Mir ist ein Fehler passiert! Und jetzt?
Gerade dann, wenn in einer Institution kein offener und konstruktiver
Umgang mit Fehlern gepflegt wird, fällt es sehr schwer, einen Fehler
einzugestehen. »Warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist«,
scheint dann oft die einzig »vernünftige« Perspektive zu sein. Anzu-
raten ist diese Sichtweise nicht, denn sie kann Schaden – sowohl für
den Patienten als auch den Behandelnden/Pflegenden – noch ganz
erheblich vergrößern.
v
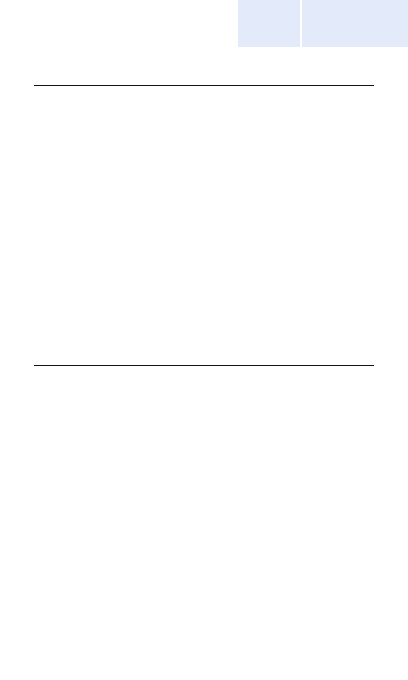
15
145
Persönliches Gedächtnisprotokoll über den Zwischenfall
Einen Fehler, der einem unterlaufen ist, offen zu machen – zum Beispiel
im Rahmen der Mitarbeiterbesprechung, ist nicht nur oberstes Gebot
eines professionellen Berufsverständnisses und einer entsprechenden
Berufsethik, sondern hat gleich mehrere positive Auswirkungen:
Nur wenn ein Fehler offenbart wird ist, können sofortige Gegen-
maßnahmen getroffen werden, die den Patienten vor möglichen
Folgen schützen.
Nur aus einem Fehler, über den man offen gesprochen hat, können
auch andere lernen.
Einen Fehler einzugestehen wirkt entlastend.
Wurde ein Fehler frühzeitig kommuniziert, wird das im Schadens-
fall entlastend berücksichtigt – auch aus juristischer Perspektive ist
eine frühe Fehlerkommunikation und -dokumentation also sinnvoll.
Anonyme Berichterstattung
Neben dem offenen Gespräch besteht auch die Möglichkeit, anonym
über einen Fehler zu berichten. Hier hat sich das Fehlerberichtssystem
CIRS – Critical Incident Reporting System – bewährt. Es geht hierbei
um die anonyme Meldung von kritischen Ereignissen und Beinahe-
Schäden im Sinne der Patientensicherheit. Nach dem Prinzip »Berich-
ten-Bearbeiten-Beheben« können erkannte Risiken bearbeitet werden
und aus den kritischen Situationen Strategien zur Vermeidung von
Fehlern entwickelt und umgesetzt werden.
Fazit
Vorbeugen ist besser als haften! Neben dem aktiven Engagement
zur Vorbeugung von Fehlern gehört auch, dass jede Pflegefach-
kraft eine persönliche Berufsrechtsschutz- und Berufshaftpflicht-
versicherung, entweder durch Mitgliedschaft in einem Pflege-
bzw. Berufsverband oder privat haben sollte.
4
4
4
4
4
15.3 · Mir ist ein Fehler passiert! Und jetzt?

146
Kapitel 16 · Ein Blick über den Tellerrand
Ein Blick über den Teller-
rand – Fehlervermeidung
durch Qualitätssicherung
in den USA
Edith Kellnhauser
Fehlervermeidung ist ein Thema, dass hierzulande als zunehmend
brisant gilt. Doch wie machen es die anderen – Amerika zum Beispiel?
Die Behandlungsqualität sicherzustellen, und zwar auf Basis klar de-
finierter Kriterien, hat in den USA eine lange Tradition und ist in den
Gesundheitseinrichtungen institutionalisiert. Entsprechende kranken-
hausexterne Kontrollorgane stellen sicher, dass festgelegte Qualitäts-
standards eingehalten und kontinuierlich verbessert werden.
16.1
Die »Joint Commission« zur Qualitätskontrolle
Das bedeutendste Qualitätskontrollorgan in den USA ist die »Joint
Commission for the Accreditation of Health Care Organisations« –
die Gemeinsame Kommission für die Akkreditierung von Gesund-
heitseinrichtungen, kurz »Joint Commission« genannt.
»Akkreditierung« kommt von dem lateinischen Wort »accredere«
und bedeutet so viel wie »Glauben schenken«, »bestätigen«.
Entsprechend bestätigt die Joint Commission die Qualität einer
Gesundheitseinrichtung – oder eben nicht.
Qualitätsstandards dieser Kommission wurden von einigen der in
jüngster Zeit in Deutschland entstandenen Qualitätssicherungsagen-
turen weitgehend übernommen.
>

16
147
Gründung der Joint Commission
Die Joint Commission wurde 1918 von einer Gruppe von Chirurgen
gegründet mit dem Zweck, ihre qualitativ hochstehenden Leistungen
den Patienten gegenüber belegen zu können. Heute, enorm vergrößert
und in ihren eingesetzten Standards sehr detailliert, werden von
diesem Kontrollorgan im 3-jährlichen Turnus landesweit Gesundheits-
einrichtungen untersucht, um den Grad der für Patienten erbrachten
Behandlungsqualität zu ermitteln.
Arbeitsweise der Joint Commission
Die Joint Commission wird von den einzelnen Krankenhäusern und
anderen Gesundheitseinrichtungen eingeladen. Diese freiwillige Be-
teiligung der Einrichtungen am Kontrollprozess erklärt sich daraus,
dass der Erwerb der Akkreditierung die Kostenübernahme durch die
privaten und gesetzlichen Kostenträger sichert – die nachweisbare Ein-
haltung von Qualitätsstandards entspricht also einem vitalen Interesse
der Gesundheitsanbieter! Außerdem ist sie aber auch hausintern von
großer Bedeutung:
Eine Einrichtung vergewissert sich so ihres aktuellen Qualitäts-
niveaus,
kann durch Beseitigung eventueller Schwachstellen das festgelegte
Niveau halten und
das nachgewiesene Qualitätsniveau als gewichtiges Mittel in der
Werbung um Patienten und der Anwerbung von kompetenten
Ärzten und Pflegepersonal einsetzen.
Praxistipp
Hohe Qualitätsstandards dienen nicht nur den Patienten und
Klienten einer Einrichtung – sie bewirken auch eine positive Iden-
tifikation der Mitarbeiter mit ihrer Arbeitsstelle und heben damit
die Arbeitsmoral.
4
4
4
v
16.1 · Die »Joint Commission«

148
Kapitel 16 · Ein Blick über den Tellerrand
Ist-Zustand = Soll-Zustand? Der Akkreditierungsprozess
Der Akkreditierungsprozess wird von einer Expertengruppe durchge-
führt, die aus einem Krankenhausbetriebswirt, einem Arzt und einer
Pflegeperson besteht. Der Prozess dauert je nach Größe der Einrich-
tung drei und mehr Tage und umfasst alle Bereiche einer Institution.
Dazu werden, ausgehend von einem allgemein gültigen Grundstan-
dard, zahlreiche Standards für die einzelnen Fachabteilungen abgeleitet
und ermittelt, inwieweit der Ist-Zustand mit dem Soll-Zustand, dem
Standard, übereinstimmt.
Werden Schwachstellen festgestellt, kommt es je, nach Schwere-
grad, zu einer mündlichen oder schriftlichen Beanstandung seitens der
Kommission. Bestehende Mängel müssen innerhalb eines bestimmten
Zeitraums beseitigt werden. Nach schriftlichen Beanstandungen
müssen die Mängelkorrekturen auch wiederum schriftlich bestätigt
werden. Wurden gravierende Missstände entdeckt, die nicht zur
Zufriedenheit der Prüfer korrigiert wurden oder korrigiert werden
konnten, erfolgt bestenfalls eine Teil-Akkreditierung, schlimmstenfalls
eine Nicht-Akkreditierung. Wird die Akkreditierung entzogen, droht
der betroffenen Einrichtung sogar die Schließung des Betriebes, wenn
sich die Kostenträger zurückziehen.
More power to You: Die Fortbildung
Qualität zu sichern ist ein nie endender Prozess, der nicht am Tag x ab-
geschlossen ist. Qualität muss immer wieder neu gesucht und hergestellt
werden. Dabei ist die über 24 Stunden mit dem Patienten direkt befasste
Abteilung des Pflegedienstes von großer Bedeutung. In der Pflegeabtei-
lung wird auf verschiedene Weise versucht, einen höchstmöglichen
Grad an Pflegequalität für Patienten zu erbringen und zu sichern. Ein
Weg zur pflegerischen Qualitätssicherung ist die Vermeidung von Feh-
lern. Dies kann durch unterschiedliche Maßnahmen erreicht werden.
Mehr wissen: Die Pflichtfortbildung
Das Risiko von Fehlern nimmt zu, je geringer der Wissensstand ist.
Diese einfache Tatsache ist eine Grundidee des Fortbildungssystems in
der Pflege in den USA, das ganz auf regelmäßige Weiterbildung setzt –
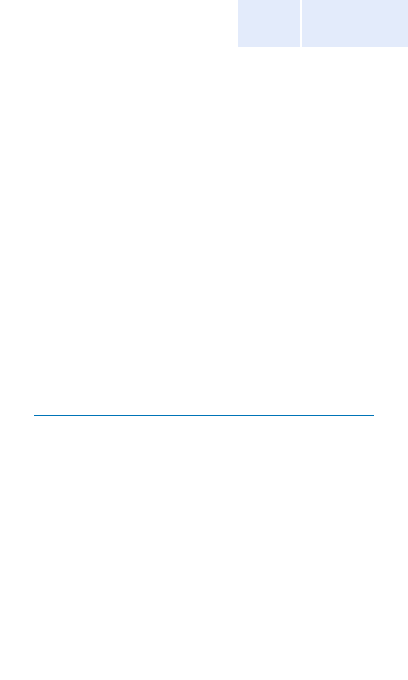
16
149
und zwar nicht als »Kann«, sondern als »Muss«. Um ihre gültige beruf-
liche Lizenz, also ihre Berufserlaubnis, zu behalten, sind Pflegekräfte
durch die Pflegekammer verpflichtet, alle zwei Jahre eine Fortbildung
an einer von der Kammer akkreditierten Fortbildungseinrichtung oder
sonstigen anerkannten Anbietern zu belegen. Eine solche Fortbildung
dauert in der Regel etwa 20 Stunden. Nur auf Basis dieser Fortbildung
wird die berufliche Lizenz auf weitere zwei Jahre erneuert. Ohne
gültige Lizenz kann man nicht in der Position weiterarbeiten, die man
bis dahin innehatte, sondern muss bis zum Wiedererwerb der Lizenz
auf die Position einer Hilfskraft zurückgestuft werden. Wer keine
gültige Berufslizenz vorweisen kann, hat kaum eine Chance – er oder
sie wird von keinem Krankenhaus eingestellt.
Niemand macht absichtlich einen Fehler
Davon gehen Arbeitgeber in Gesundheitseinrichtungen aus und finan-
zieren grundsätzlich alle Fortbildungsveranstaltungen im Haus. Ledig-
lich außerhäusige Veranstaltungen müssen zu einem kleinen Teil von
den Teilnehmern mitfinanziert werden.
16.2
Wie fit bin ich? Die Leistungsbewertung
Eine weitere Maßnahme zur Fehlervermeidung ist die jährliche Leis-
tungsbewertung, die am Jahrestag ihrer Einstellung mit den einzelnen
Pflegepersonen durch die direkte Vorgesetzte vorgenommen wird.
Übrigens: Dieses System wird nicht nur im Pflegedienst, sondern in
allen Abteilungen des Krankenhauses bis in höchste Positionen einge-
setzt. Die Leistungsbewertung ist auf die Aufgaben abgestimmt und
wird auf Basis einer detaillierten Tätigkeitsbeschreibung nach mess-
baren Kriterien durchgeführt. Bei Pflegenden auf Station z. B. so:
Grundlegende Aufgaben
Klinische Fähigkeiten
Zwischenmenschliche Beziehungen
Führungsfähigkeiten
Andere Verhaltenserwartungen
4
4
4
4
4
16.2 · Wie fit bin ich? Die Leistungsbewertung

150
Kapitel 16 · Ein Blick über den Tellerrand
Das »Finetuning« der Kategorien
Jede dieser fünf Kategorien beinhaltet zahlreiche »Items« – also Aspekte:
Zur Verdeutlichung werden nachstehend aus der ersten Kategorie
»Grundlegende Aufgaben« zwei Items vorgestellt und die Bewertung
nach messbaren Kriterien vorgenommen. Die erreichbaren Punkte
0 – 1 – 2 dienen zur Bestimmung des Qualitätsgrades, den die bewer-
tete Person bei den einzelnen Items erreicht. Zum Beispiel:
1. Nimmt die Beurteilung und Pflegedatenerfassung von neu aufge-
nommenen oder verlegten Patienten innerhalb von 15 Minuten
nach deren Ankunft auf der Station vor (ersichtlich aus der Pflege-
dokumentation). Erreichbare Punkte: 0 – 1 – 2
2. Entnimmt und prüft täglich verfügbare Daten (Laborwerte, Opera-
tionsberichte) aus der Krankenakte und leitet angemessene Pflege-
tätigkeiten ein (ersichtlich aus der Pflegedokumentation). Erreich-
bare Punkte: 0 – 1 – 2
Auf diese Weise werden alle Items der einzelnen Kategorien durch-
gegangen und abschließend die erreichten Punktwerte addiert. Die
erreichte Gesamtzahl der Punktwerte wird in drei Bewertungsstufen
eingruppiert. Je nach Eingruppierung erfolgt die damit einhergehende
Gehaltserhöhung, die gekoppelt ist an die jeweilige Inflationsrate. Bei
einer bestehenden Inflationsrate von beispielsweise 3% erhält die
unterste Bewertungsstufe »Standard nicht erfüllt« keine Gehaltser-
höhung. Die mittlere Stufe »erfüllt Standard« bekommt 3%, und die
oberste »über Standard« kann sich über mindestens 5% freuen.
Außergewöhnliche Leistungen werden auch außergewöhnlich
belohnt
Zu Zeiten der Regierung von Präsident Jimmy Carter (1977–1981)
lag die Inflationsrate zeitweilig bei 14%. Das Ergebnis der Leistungs-
bewertung einer Pflegehelferin war in einem dieser Jahre ȟber
Standard.« Folglich bekam sie eine Gehaltserhöhung von 19%.
Hervorragend gute Leistungen wurden ohne Ansehen der Position
6
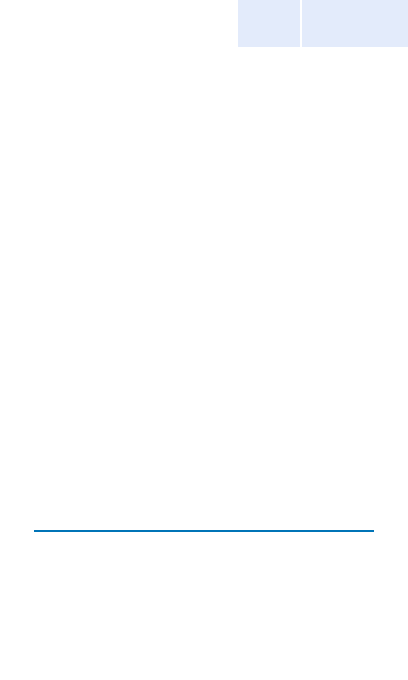
16
151
vor dem Hintergrund der persönlichen Wertschätzung und der
Leistungsanerkennung auch außergewöhnlich entlohnt – als im
wahrsten Sinne des Wortes barer Ausdruck von Wertschätzung und
Anerkennung.
Diese aufwändige Maßnahme der jährlichen Leistungsbewertung
dient zuvorderst der formalen Anerkennung der guten Leistungen
der einzelnen sowie ihrer persönlichen Wertschätzung als betrieb-
liche Mitarbeiter. Sie motiviert gleichzeitig aber auch zu weiterhin
qualitativ hochstehender Arbeit und trägt damit zur Fehlervermei-
dung bei.
»You said it all«
Aus Versehen verabreichte ich einmal einem Patienten die falschen
Medikamente. Natürlich wendete ich mich sofort, nachdem ich
meinen Fehler bemerkt hatte, an den behandelnden Arzt. Erklärte
ihm, was passiert war, und dass ich den Patienten auf mögliche
negative Auswirkungen intensiv beobachten würde. Ganz offensicht-
lich war mir das alles äußerst peinlich! Selbstverständlich würde ich
künftig alles daran setzen, derartiges zu vermeiden, indem ich den
Namen des Patienten mit dem Namen am Medikamentenschälchen
vergliche. Als der Arzt sich alles angehört und erkannt hatte, wie
unangenehm mir mein Fehler war, schloss er nur freundlich: »You said
it all – Es ist schon alles gesagt.« Keine Vorwürfe, keine Schuldzuwei-
sungen. Für ihn war nur eines wichtig: dass ich aus meinem Fehler
gelernt hatte!
16.3
Fehlern vorbeugen: Das Risikomanagement
Eine dritte Maßnahme zur Fehlervermeidung bzw. Fehlerkorrektur ist
das so genannte Risikomanagement. Gemeint ist damit ein Prozess, in
dem »entschieden wird, ein bekanntes Risiko oder eine Gefahr zu ak-
zeptieren, zu reduzieren oder abzubauen« [18].
Das Risikomanagement ist ein betriebsweites Qualitätssicherungs-
system, das neben dem Personenschutz auch andere Bereiche wie z. B.
16.3 · Fehlern vorbeugen
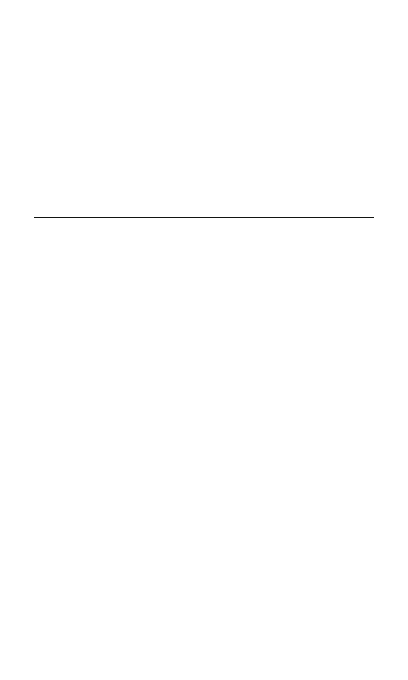
152
Kapitel 16 · Ein Blick über den Tellerrand
bauliche Gegebenheiten oder technische Anlagen miteinbezieht. In
allen Abteilungen besteht ein Meldesystem, das so genannte »unge-
wöhnliche Vorkommnisse« an die dafür zuständige innerbetriebliche
Qualitätssicherungsstelle berichtet. Wie in den anderen Abteilungen
gibt es auch im Pflegebereich Vordrucke, auf denen das ungewöhnliche
Vorkommnis erfasst wird.
Beispiel für Risikomanagement
Eine Pflegekraft verletzt sich an einer gebrauchten Kanüle.
Anzugeben sind: Datum und Anschrift der betroffenen Person.
Berichtet wird in den Kategorien: Patient, Medikament, Besucher,
Mitarbeiter, Wertsachen.
Schritt 1
Nach Ankreuzen der zutreffenden Kategorie wird der Hergang
des ungewöhnlichen Vorkommnisses objektiv und ohne Wer-
tung von der verantwortlichen Pflegeperson beschrieben.
Schritt 2
Im Anschluss daran sind Verbesserungsvorschläge zur Vermei-
dung des erfolgten Vorkommnisses einzutragen.
Schritt 3
Der Vordruck wird von der berichtenden Person unterschrieben
und der Abteilungsleitung zur Weiterleitung an die Qualitäts-
sicherungsstelle übergeben.
Dort werden die eingegangenen Berichte monatlich gesichtet, aus-
gewertet und kategorisiert. Je nach Häufigkeit wird über die Durch-
führung entsprechender Korrekturmaßnahmen entschieden.
4
4
4
4
4

16
153
Fazit
Fehler sind zum Lernen da – nicht um Schuld zuzuweisen.
Die beschriebenen Maßnahmen sind lediglich 3 Beispiele aus dem
reichhaltigen Katalog zur Fehlerberichtigung und Fehlervermei-
dung im Rahmen des Qualitätsmanagements in den USA.
Ihr eigentlicher Sinn ist die Qualitätssicherung im Pflegebereich.
Eine ihrer grundlegenden Bedeutungen: Pflegende nicht durch
Schuldzuweisungen zu verunsichern und zu entmutigen, sondern
in einem gemeinsamen Vorgehen mit den jeweiligen Vorgesetzten
Fehler zu beheben und zu lernen, sie zukünftig zu vermeiden.
4
4
4
4
16.3 · Fehlern vorbeugen

154
Literatur
Literatur
[1] Abt-Zegelin A (2004). Bettlägerigkeit. Alltagsbegriff und unbekanntes Terrain.
In: Schnell M (Hrsg) Leib, Körper, Maschine. Selbstbestimmtes Leben
[2] Abt-Zegelin A (2005). Festgenagelt sein – der Prozess des Bettlägerigwerdens.
Huber
[3] Abt-Zegelin A (2007) Bettlägerigkeit so lange wie möglich vermeiden. In:
v.d.Berg G (Hrsg) Angewandte Physiologie, Bd. 6. Thieme, Stuttgart
[4] Abt-Zegelin A (2008). Pflege, Lehrbuch, 4. Auf. Thieme, Stuttgart
[5] Abt-Zegelin A (2009): Sprache und Pflege. In: Ingensiep HW, Rehbock T (Hrsg)
Die rechten Worte finden. Sprache und Sinn in Grenzsituationen des Lebens.
Königshausen & Neumann, 247-258
[6] Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. Hrsg.(2007): Empfehlungen zur Einfüh-
rung von Critical Incident Systemen (CIRS), Praxistipps für Krankenhäuser
[7] Aktionsbündnis Patientensicherheit (2008) Faltblatt »Prävention von Eingriffs-
verwechslungen«
[8] Bomba DT, Prakash R. (2005): A description of handover process in an Australian
public hospital. Australian health Review
[9] Bundesgesetzblatt (2003) Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufe
in der Krankenpflege (KrPfAPrV) vom 10.11.2003, Teil I Nr. 55, Bonn, 19.11.2003
[10] Bundesgesetzblatt (2006) Verordnung über die Berufsausbildung zum Medi-
zinischen Fachangestellt/-en zur Medizinischen Fachangestellten vom 26. April
2006, Teil I, Nr. 22, Bonn, 05.05.2006: 1097–1099
[11] Catchpole et al. (2007) Patient handover from surgery to intensive care. Pediat-
ric Anesthesia 17: 470-478
[12] Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) (2009) Zahlen – Daten – Fakten
»Pflege«. Hintergrundinformationen als Argumentationshilfe zur Bundestagswahl
[13] Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) (2010) Balance halten im
Pflegealltag. Berlin
[14] DIP – Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung (2009) Pflege-Thermo-
meter 2009, www.dip.de
[15] Freud S(1999) Die Zukunft einer Illusion, GW 14, Frankfurt 1927
[16] Gstöttner J (2005) Der Schutz von Patientenrechten durch verfahrensmäßige
und institutionelle Vorkehrungen sowie den Erlass einer Charta für Patienten-
rechte. Lang, Frankfurt am Main; 51, 112f
[17] Habermann M (2009) Zentrum für Pflegeforschung und Beratung (ZePB): Pflege-
fehler, Fehlerkultur und Fehlermanagement in stationären Versorgungseinrich-
tungen
[18] Healy S (1088) Health Care Quality Assurance Termininology. Intern J of Health
Care Quality Assurance; No. 1
[19] Höfert R (2009) Von Fall zu Fall – Pflege im Recht. Springer, Heidelberg
[20] IQWiG (2006) IQWiG-Bericht Nr. 11 »Zusammenhang zwischen Pflegekapazität
und Ergebnisqualität in der stationären Versorgung – Eine systematische Über-
sicht
[21] Lauterbach A, Fall 1, Tag 3, FDSD, 2-8; Unterlagen beim Autor
[22] Lauterberg J, Kolpatzik K (2008) Das Schweigen brechen. Gesundheit und Ge-
sellschaft, Ausgabe 4/08: 22
[23] Orlander JD, Barber TW, Fincke BG (2002): The morbiditiy and mortality con-
ference: the delicate nature of learning from error. Acad Med. 2002; 77:1001-6

Literatur
155
[24] Patientensicherheitschweiz (2009) Schriftenreihe Nr. 1 der patientensicher-
heitschweiz: Wenn etwas schief geht – Kommunizieren und Handeln nach einem
Zwischenfall, Zürich
[25] Pfaff H et al. (2009) Sicherheitskultur: Definiton, Modelle und Gestaltung.
Z. Evid. Qual. Gesundh. Wesen (ZEFQ) 103: 493-497
[26] Pöppel K (2008) Wertwandel beim sozialen Dienstleister Krankenhaus – eine
Analyse zum Patientenbild, Diss. Lang, Frankfurt am Main
[27] Rall M, Martin J, Geldner G, Schleppers A, Gabriel H, Dieckmann P., Krier C., Volk T.,
Schreiner-Hecheltjen J., Möllemann A (2006): Charakteristika effektiver Incident-
Reporting-Systeme zur Erhöhung der Patientensicherheit, Grundlage für den
Aufbau eines bundesweiten Registers für sicherheitsrelevante Ereignisse durch
DGAI / BDA. Anästh Intensivmed 2006; 47:9-19
[28] Redicker L (2010) Stellenabbau gefährdet Patientenversorgung. In: Der Westen
– Das Portal der WAZ Mediengruppe vom 19.05.2010
[29] Rose N Germann D (2006): Resultate eine krankenhausweiten Critical Incident
Reporting System (CIRS), Das St. Gallener CIRS-Konzept. Gesundh ökon Qual
manage 2005: 10:83-89
[30] Spitz R (1974) Vom Säugling zum Kleinkind, Stuttgart 1965 (deutsch 1974)
[31] Sprenger RK (2007) Das Prinzip der Selbstverantwortung: Wege zur Motivation,
Frankfurt
[32] Sprenger RK et al. (2010) Mythos Motivation: Wege aus der Sackgasse Frankfurt
[33] Thomeczek C et al (2004): Das Glossar Patientensicherheit – Ein Beitrag zur
Definitionsbestimmung und zum Verständnis der Thematik »Patientensicher-
heit« und »Fehler in der Medizin«. Gesundheitswesen 66 (12): 833-840
[34] www.aktionsbuendnis-patientensicherheit.de/?q=veröffentlichungen-und-
downloads
[35] www.charite.de/charite/.../zahl_der_druckgeschwuere_in_heimen_und_klini-
ken_sinkt/ (Zugriff Juli 2010)
[36] www.dip.de: Pflegethermometer 2009
[37] www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/altpflaprv/gesamt.pdf
[38] www.jeder-fehler-zaehlt.de
[39] www.kda.de: Projekt »Aus kritischen Ereignissen lernen«, www.kritische-ereig-
nisse.de
[40] www.schrappe.com: Aktionsbündnis Patientensicherheit (2010), Vortrag auf
dem 10. Kurs der chirurgischen Arbeitsgemeinschaft für Qualität und Sicherheit
((AQS) der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, Köln, 23.06.2010)

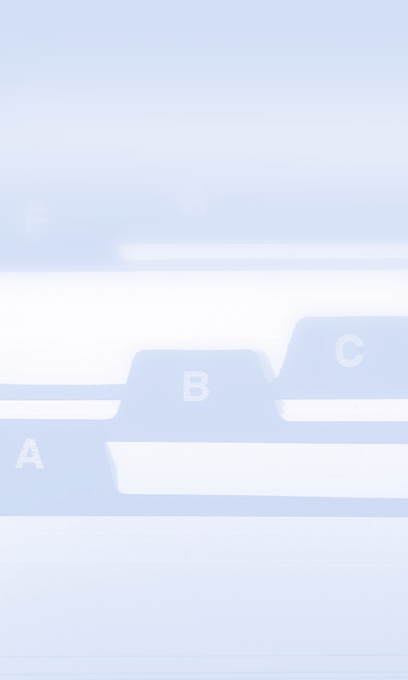
Stichwortverzeichnis
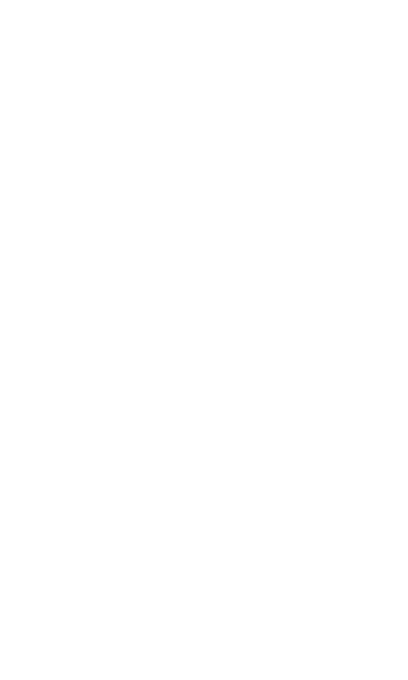
158
Stichwortverzeichnis
A
Aktionsbündnis für Patientensicherheit
2ff, 67
aktive Sterbehilfe 97
Altenpflege 117
Alterspyramide 14
Angst 36, 38
Anonymisierung der Teams 91
AOK-Bundesverband 2
Apotheker 27
Äquatortaufe 94
Arbeitsbelastung 19, 23, 27
Arbeitszeit 30
Gesetz 30
Ärzte 27
Assistenzberuf 55
Asymmetrie 47ff, 111
Aufklärungsgespräch 67, 70
Ausbildungssituation 20, 76
Autonomie 50, 51
Gewinn 105
B
B.-Braun-Stiftung 17
Balint-Gruppe 96
baua
7
Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin 31
Bauarbeiter 31
Behandlungsfehler 2, 140ff
Berichtssysteme 119ff
Berufserlaubnis 149
Berufsethik 48, 145
Betthüten 8, 12
Bettlägerigkeit 6ff
Bewegung
Konzept 61
Mangel 60
Plan 61
–
–
–
–
–
Beweisführung 139
Beweislast 139
Beweislastumkehr 139
Biografiearbeit 13
BMG
7
Bundesministerium für
Gesundheit
BQS 117
Bundesaltenpflegegesetz 138
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin
7
baua
Bundesministerium für Gesundheit 2
Burnout
Folgen 95
C
CIRS 119, 130ff
Meldekreis 130
Moderatoren 130
critical incident reporting system
7
CIRS
D
Datenschutz 113
DBfK 27ff
Umfrage 27
Dekubitus 7, 31, 40, 59ff, 136
Prophylaxe 59ff
Deliktische Haftung 141
Depression 7
Desensibilisierung 95
Deutscher Berufsverband für Pflege-
berufe
7
DBfK
Deutsches Institut für angewandte
Pflegeforschung
7
dip
dip
7
Deutsches Institut für angewandte
Pflegewissenschaft 28
Dialog 53
–
–
–
–
–

Stichwortverzeichnis
159
Dokumentation 84ff
Mangel 136, 138
Druckentlastung 60
Durchblutung 62
Durchführungsverantwortung 29,
138
E
Eigenaktivitäten 13
Eingriffsort 67ff
Eingriffsverwechslung 66ff
Eis und Fön 62
Entlassungsmanagement 139
Ereignis 9
Erholungspause 30
Ernährungsmanagement 139
Erwerbsminderung 19
Ethik 47ff
ethische Reflexion 48
Grundsätze 49
Ethikkomitee 89, 92f
F
Fahrlässigkeit 140, 142
Fallbesprechung 32, 96
Fallzahl 18
Fehler des Monats 122, 129
Fehlerkommunikation 78ff
Fehlverhalten 89ff
sprachliches 91
Fersenschoner 60
Feuerwehrleute 27
Fixierung 138, 140, 142
Fönen 62
Fortbildung 22, 139, 148
Fragebogen 36
Frühberentung 19
–
–
–
–
Fundamentalismus 96
Fürsorge 54
G
Gedächtnisprotokoll 80, 145
Gefühlsarbeit 101
Geldstrafe 141
gemischtes Berichtssystem 121
Gerechtigkeit 52
geschlossenes Berichtssystem 119
Gesundheitssystem
ökonomischer Druck 117
GKV-Modernisierungsgesetz
7
GMG 139
GMG
7
GKV-Modernisierungs-
gesetz
Grundgesetz 50, 112, 138
H
Haftungsanspruch 139
Hebetechnik, falsche 31
Heimaufsicht 117
Heimvertrag 138
Hilflosigkeit, eigene 32
Hilfsbereitschaft
falsch verstandene 13
Hilfsmittel 29, 31
Hygienevorschrift 29
I
Identifikation 67, 69
Identität
Patient 69
instabile Phase 8
–
–
–
A–I

160
Stichwortverzeichnis
Institut für Qualität und Patienten-
sicherheit
7
BQS
Institut für Qualität und Wirtschaf-
tlichkeit im Gesundheitswesen
7
IQWiG
IQWiG 63
J
Joint Commission 146ff
K
KEK 89
Kinästhetik 13, 61
Klinische Ethikkomitees
7
KEK
Kommunikation 27, 92, 97, 112
Kontinenzförderung 139
Kontraktur 7
körperliche Belastung 31
Körperverletzung 141, 143
Krankenhausaufnahmevertrag 138
Krankenhauserreger 82
Krankenhauskeim 2
Krankenpflegegesetz 138
Krankenversicherungsgesetz 139
L
Lagerung 60
Plan 61
Systeme 60
Leistungsbewertung 149, 150
Leitungsverantwortung 42
–
–
M
M&M-Konferenzen 129
Macht 48, 106
Machtausübung 89
Markierung 68, 70ff
MDK 117
Medizinische Dienst der Kranken-
versicherung
7
MDK
Mitleid 96
Mobilität 12, 60
Moral 49, 92
Morbiditätskonferenz 89, 127, 131
Mortalitätskonferenz 89, 127, 131
mündiger Patient 51
Muskel- und Skeletterkrankung 31
N
Nachtdienst 30
Namensschild 113
Nebenwirkung 2
Nosokomiale Todesfälle 82
O
offenes Berichtssystem 120
Ohnmachtsgefühl 106
Ortsfixierung 7, 10
P
Paternalismus 110
Patientenbild 110
Patientensicherheit 21, 119, 121
Patientenwille 111

Stichwortverzeichnis
161
Pause 30
Personalabbau 17, 19
Pflegebeziehung 101ff
Pflegekammer 149
Pflegeleitbild 105
Pflegestandard 29, 33, 35
Pflege-Thermometer 2009 17, 19ff
Pflegeversicherungsgesetz 139
Pflegevertrag 136, 138
Pflichtfortbildung 148
Pneumonie 7
Positionsveränderung 60
Privatsphäre 51, 79, 83
Psychische Belastung 32
Psychoanalyse 101
Q
Qualitätsmanagement 22, 117, 124,
129, 153
R
Regressanspruch 139
Risikomanagement 117, 118, 127, 151
Risikomanagement Weblog 129
Ritual 59, 82, 93
Rückenschmerz 31
Ruhepause 30
S
Saal-Check 68, 72
Schadenersatz 136, 142
Scherkräfte 31, 61
Schmerzensgeld 141, 142
Schmerzmanagement 139
Selbstbestimmtheit 50, 104
Selbstherrlichkeit 96
Selbstpflegefähigkeit 105
Selbststeuerung 104, 105
Selbstverwirklichung 51
SGB V 139
SGB XI 139
Sicherheitskultur 117, 118, 127, 131
Sicherheitsmanagement 127
Sitzringe 62
Spezialmatratzen 61
Sprache 12, 37, 91
Stammzellenentnahme 50
Stationsleitung 32, 92
Stellenabbau 17, 19, 20, 28
Sterbehilfe 50, 97
Sterben 45, 92, 93, 97, 102
aktive Hilfe 97
Begleitung 93
Stiftung für Patientensicherheit 79
Strafgesetzbuch 143
Stress 36, 38, 91
Sturzprophylaxe 139
Supervision 32, 37
T
Team-Time-Out 68, 73
Teilfixierung 143
Thrombose 7
Todesfall 2, 82
Transfer 13
U
Übergabe 39, 82ff, 96
Beendigungsphase 83
Eröffnungsphase 83
Fehler 82
Kernphase 83
–
–
–
–
–
–
I–U

162
Stichwortverzeichnis
Überstunden 19, 20, 30
Unterlassung 3, 5, 6, 9
Unwissenheit 5ff, 12
USA 146
V
Verantwortung 16, 24, 29, 33, 42, 55,
74, 85, 128, 138
verbaler Übergriff 91
Vernunftfähigkeit 50
Versagen im Job 41
Verweildauer 18
Vollzeitstellen 28
W
Wechselwirkung 2
Weiterbildung 22, 139, 148
Werte 32, 49, 104, 111, 112
Wundmanager 22
Würde 11, 49, 50, 51, 54, 55, 78, 95, 111
Verletzung 95
Z
Zeitdruck 29, 33, 66
Zeitgefühl 7
Zeitmangel 10, 11
Zentrum für Pflegeforschung
und Beratung
7
ZePB
ZePB 36, 118
Zwischenfälle
schwerwiegende 80
–
–
Document Outline
- Cover
- Aus Fehlern lernen – Fehlermanagement in Gesundheitsberufen Top im Gesundheitsjob
- Fehler – was ist das eigentlich?
- Fehler dürfen nicht individualisiert werden!
- Hohe Arbeitsbelastungen: Was Sie tun können
- Reaktionen von Pflegenden auf ein Fehlergeschehen
- Professionelles Berufsverständnis braucht Ethik
- Dekubitusprophylaxe – aber bitte richtig!
- Kein Fehler vor dem Schnitt
- Wie sage ich’s dem Patienten?
- »Übergabefehler verursachen 6% der nosokomialen Todesfälle.«
- Fehlverhalten – zwischen Fürsorge und Machtausübung
- Pflege ist auch »Gefühlsarbeit« – zur Psychoanalyse der Pflegebeziehung
- Pflege und Betreuung: Auch eine Frage des Patientenbildes
- Fehlerkultur für die Altenpflege und den hausärztlichen Bereich
- Beispiele aus dem Sicherheitsmanagement der Charité
- Vorbeugen ist besser als haften – Aus Fehlern lernen
- Ein Blick über den Tellerrand – Fehlervermeidung durch Qualitätssicherung in den USA
- Stichwortverzeichnis
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Co to jest zap³odnienie in vitro
AUS AID renewable energy in developing countries
036 rozp min infrastr w spr obowi┬╣zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno┬ťci cywil architekto╠üw ora
Armstrong; From Huponoia to Paranoia On the Secular Co optation of Homeric Religion in Vico, Feuerba
Zagadnienia-in-mat-2010
Changes in the quality of bank credit in Poland 2010
New In Chess 2010 2
Co jest urzadzeniem ppoz www katalogppoz pl 2010
New In Chess 2010 2
Ein schwerer Fehler
19 Ursachenerklärung von Fehlern ( Kontrastivhypothese, Identitäts Hypothese, Interimsprachen Hypoth
Oświadczenie w spr korzystania z uprawnien rodzicielskich, kadrowe, księgowe i in
20 Umgang mit Schülerfehlern ( Fehleranalyse, Fehlerbewertung)id 21317
inżynieria bioprocesowa, IN[1].BIOPROCESOWA, Co to jest węglomol
Dąbrowska i in Co warto wiedzieć
ADO090223 ES64U4 Fehlersuchanleitung 05 5 1 pl
co to jest bankowość - ściąga, Różne Spr(1)(4)
opel vectra c klimaautomatik irrefuehrende fehlercodes
więcej podobnych podstron