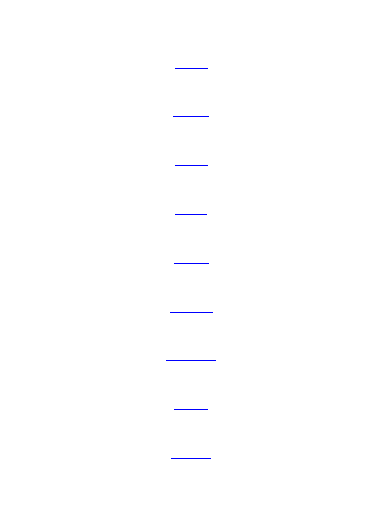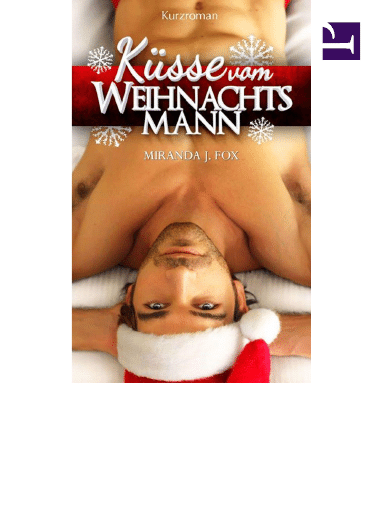
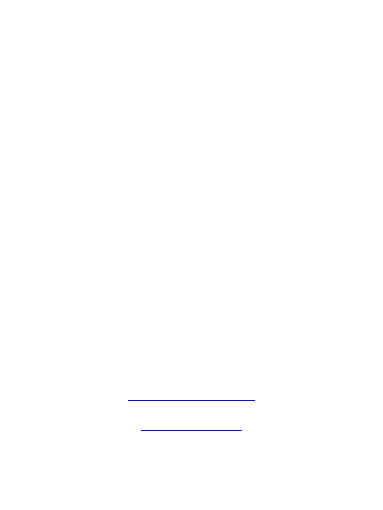
Miranda J. Fox
Küsse vom
Weihnachtsmann
Kurzroman
Deutsche Erstausgabe November 2014
Copyright © Miranda J. Fox, Berlin
Cover: Alexander Kopainski
Lektorat: Schreibbüro Buck

Eins
»Nein, ich kann das nicht«, raunte ich Nancy zu und trat einen Schritt
zurück, doch sie hatte meinen Arm gepackt, so dass ich nicht entkommen
konnte. Und eigentlich war es auch gut, dass sie mich festhielt, denn ich
hatte heute Abend schon den ein oder anderen Glühwein getrunken und
spürte meine Beine kaum noch. Nicht, dass ich mich oft betrank, aber um
genau zu sein, war ich das letzte Mal vor einem Jahr betrunken gewesen,
nur so kurz vor den Prüfungen musste man auch mal abschalten und es
einfach krachen lassen. Bei Nancy bedeutete das allerdings, dass am Ende
meist jemand leiden musste und heute war es der arme Weihnachtsmann,
der keine zehn Meter von uns entfernt war. Er saß auf einem bunt
geschmückten Schlitten, zu dessen Rädern Kunstschnee aufgehäuft war
und an dessen Gestell kleine Weihnachtsmänner und Tannenbäume
hingen.
Hinter sich hatte der Santa einen großen Sack voller Geschenke und
auf dem Schoß einen kleinen Jungen, der ihm etwas ins Ohr flüsterte. Ich
wollte das nicht tun, wollte es wirklich nicht, aber ich hatte diese blöde
Wette nun mal verloren und jetzt lag es an mir, diesen armen Kerl da
drüben zu blamieren. Wer wohl unter dem Kostüm steckte? Wahrschein-
lich ein Rentner, der sich zu seinem kläglichen Einkommen ein Zubrot
verdienen wollte und in der bibbernden Kälte als Kindertraum herhalten
musste. Und dann kam ich, eine einundzwanzigjährige Abiturientin, die
ihn vor all diesen Menschen bloßstellen würde. Das hatte er wirklich nicht
verdient. Dabei hatte der Abend doch so gut angefangen. Wir hatten den
dritten Dezember, drei Wochen vor Weihnachten und weil Laura, Nancy,
Steffi und ich in Prüfungsvorbereitungen steckten und ab nächster Woche
schwer büffeln mussten, hatten wir beschlossen, wenigstens einmal
zusammen auf den Weihnachtsmarkt zu gehen und so richtig die Sau
rauszulassen. Und nachdem wir dann eine Menge Glühwein mit Schuss
getrunken, etliche Euro für Nietenlose ausgegeben hatten und in sämt-
liche Fahrgeschäfte eingestiegen waren, war Nancy auf die Idee

gekommen, ein Wettschießen am Schießstand zu machen und wir alle
hatten mitgemacht.
Bevor wir jedoch dort ankamen, liefen wir an dem Weihnachtsmann
vorbei und da waren Nancy seine weiten Hosen aufgefallen, die ihm viel
zu groß waren und die er provisorisch mit einem Gürtel fixiert hatte. Tja
und dann kam sie auf die Schnapsidee, dass der Verlierer sie ihm
runterziehen müsse und ich hatte natürlich verloren. Und wie! Ich hatte
nicht ein Ziel getroffen, was mir viele Lacher und hämische Schulterklop-
fer eingebracht hatte und nun stand ich hier.
»Mann, ich kann ihm doch nicht einfach die Hose runterziehen! Das
ist total kindisch und peinlich«, versuchte ich es ein letztes Mal, doch ein
Blick in die Gesichter meiner Freunde sagte mir, dass ich keine andere
Wahl hatte. Argggh! Warum hatte ich auch in diese blöde Wette einges-
timmt? Während sich Laura und Steffi schon vorzeitig vor Lachen krüm-
mten, gab Nancy mir noch einen letzten Schubs und ich näherte mich
dem Schlitten.
»Oh Mann, da hast du dir ja was eingebrockt«, murmelte ich zu mir
selbst, als ich nicht mehr weit von meinem Ziel entfernt war. Ich sollte
ihm die Hosen runterziehen und wegrennen, überlegte ich, verwarf den
Gedanken aber gleich wieder. Besser, ich tat so, als würde ich ausrutschen
und mich an seinen Hosen festhalten müssen, dann könnte ich mich hin-
terher bei ihm entschuldigen und es würde vielleicht nicht so peinlich für
ihn sein. Ja, so würde ich es machen. Außerdem hatte er ja immer noch
seine Maske auf, es würde ihn also niemand erkennen, versuchte ich mein
Gewissen zu beruhigen.
»Und immer schön artig sein«, gab er dem Jungen mit und hob ihn
von seinem Schoß auf den Boden. Seine Stimme war verstellt, hörte sich
künstlich tief an, sodass ich sein wahres Alter nur erraten konnte. Sorry,
Opi, entschuldigte ich mich schon mal im Voraus und gerade, als sich der
Weihnachtsmann zu seinem Geschenkesack umdrehte, ergriff ich die Ini-
tiative und kletterte auf den Schlitten. Nicht lange nachdenken, tu es ein-
fach!, schalt ich mich und verdrängte die Schuldgefühle. Man hätte mein-
en können, dass mich der Alkohol mutiger machte, aber im Augenblick
war ich vollkommen klar im Kopf – vielleicht etwas zu klar für diese
6/117

Aufgabe! Ich hätte noch fünf weitere Schotts trinken sollen. Naja, es half
ja alles nichts. Bevor sich mein Opfer umdrehen konnte, bückte ich mich
und zog ihm mit einem Ruck die Hosen runter. Wie auf Kommando hörte
ich meine Freundinnen vor Lachen aufkreischen und die Menge um uns
herum schloss sich ihnen nach kurzem Zögern an. Doch ich schenkte
ihnen kaum Beachtung, denn lange stramme Beine erregten meine
Aufmerksamkeit. Sie steckten in einer knackigen Boxershorts und waren
viel zu muskulös, um einem Rentner gehören zu können.
Im nächsten Moment wirbelte der Weihnachtsmann herum und stieß
mit dem Geschenk gegen mich, das er in den Händen hielt. Ich geriet auf
dem wackeligen Karren ins Straucheln, klammerte mich an ihm fest und
ging mit ihm zu Boden. Die Lacher wurden lauter, doch sie verschwam-
men zu einem lauten Rauschen, das mir in den Ohren pochte, denn plötz-
lich hatte ich ein Gesicht vor mir, das ich nie im Leben erwartet hätte und
das auch nicht im Entferntesten einem Rentner ähnelte. Die Maske war
von seinem Gesicht gerutscht und entblößte eisblaue Augen. Augen, nach
denen jedes weibliche Wesen auf unserer Schule verrückt war und von
denen selbst ich schon das ein oder andere Mal geträumt hatte. Sein
dunkelbraunes Haar stand nun wirr in alle Himmelrichtungen und seine
Augen sahen mich genauso erschrocken an wie ich sie. Anders als ich, war
er aber wahrscheinlich einfach nur von der Situation überrascht und kan-
nte mich gar nicht. Ich dagegen kannte ihn nur allzu gut, denn er war
Everybody’s Darling, der wohl begehrteste Junggeselle unserer Schule
und im Moment mein schlimmster Alptraum. Ladys and Gentleman, darf
ich Ihnen Tobias aus der Parallelklasse vorstellen?
***
Ich war zu keinem klaren Gedanken fähig und konnte ihn nur anglotzen,
unfähig, mich zu bewegen. Er hatte sich dagegen ziemlich schnell wieder
im Griff, denn sein erschrockener Blick wurde wütend und eh ich mich
versah, hatten mich zwei starke Arme gepackt und unsanft von ihm
runtergestoßen. Mein Rücken knallte gegen das Fahrgestell und ich sah
dabei zu, wie er sich wütend erhob.
7/117

»Tu … tut mir leid«, stammelte ich.
»Ich wollte dich nicht … ich meine, ich wollte nur was gucken und
dann …« Sein strenger Blick brachte mich zum Schweigen und zeigte,
dass er mir kein Wort glaubte. Und wie auch? Meine Absichten waren
eindeutig gewesen und auch wenn er es nicht gesehen hatte, so hatte er
doch deutlich gespürt, wie ich ihm die Hosen runterzog. Er sagte nichts,
sondern ließ seinen Blick über die lachende Menge schweifen und zog
sich dann mit angespanntem Kiefer die Hosen hoch. Gott, er tat mir so
leid, aber ich wollte gar nicht abwarten, was er als nächstes tun würde,
also sprang ich auf und kletterte vom Wagen. So wie er gerade schaute,
befürchtete ich, dass er mich andernfalls einfach vom Schlitten stoßen
würde. Meine Beine zitterten, als ich mir einen Weg durch die Menge
bahnte, die sich mittlerweile um den Schlitten versammelt hatte und als
ich meine Mädels erreichte, klopften sie mir lachend auf den Rücken.
»Das war sensationell und ich habe sogar alles aufgenommen. Das
wird sich rasend schnell auf Facebook verbreiten «, sagte Nancy feixend,
doch ich nahm ihr das Handy aus der Hand.
»Das wirst du schön bleiben lassen. Weißt du denn nicht, wer das
ist?«, zischte ich und deutete auf Tobi. Sie kniff die Augen zusammen und
sah noch einmal zu ihm.
»Oh mein Gott, Leute, schaut mal, wer das ist«, rief sie schließlich
und deutete auf den mittlerweile wieder bekleideten Weihnachtsmann.
Aus dieser Entfernung und mit den zuckenden bunten Lichtern im Rück-
en, war es wirklich schwer, ihn zu erkennen, doch so langsam machte sich
Erkenntnis in den Augen meiner Begleiterinnen breit.
»Der ist doch in deiner Klasse, oder?«, fragte Steffi an Laura gewandt
und sie nickte erschrocken.
»Scheiße, was macht der denn hier?«, sagte sie und kehrte ihm blitz-
schnell den Rücken zu. In diesem Moment sah Tobi zu uns und sein Blick
hätte nicht totbringender sein können. Als würde das noch etwas nützen,
drückte ich Nancy erschrocken das Handy in die Hand und als ich wieder
zu Tobi sah, kletterte er gerade vom Wagen, um in einem nahegelegenen
Zelt zu verschwinden.
»Was mache ich denn jetzt? Tobias ist mein Sitznachbar und wenn er
8/117

mich erkannt hat, wird er mir nie wieder bei den Klausuren helfen«, jam-
merte Laura betreten.
»Was du jetzt machst?«, fragte ich sie ungläubig.
»Ich habe ihn vor dem gesamten Weihnachtsmarkt blamiert. Was
glaubst du wohl, was er mit mir machen wird?«, fragte ich und spürte
Panik in mir aufsteigen. Ich würde den Sportunterricht den Rest des
Jahres schwänzen müssen! Eigenartigerweise schien Nancy meine Panik
aber nicht zu teilen und verdrehte nur die Augen.
»Komm schon, was soll er denn bitte machen? Glaubst du, er lauert
dir nachts in einer Gasse auf und verprügelt dich?«, fragte sie lachend.
»Das nicht, aber er könnte mir aus Versehen einen Ball an den Kopf
werfen oder mich sonst wie verstümmeln. Wir haben Sport zusammen,
schon vergessen? Und im Sportunterricht kann man sich leicht verletzen.
Ehrlich, ich werde mir am Mittwoch eine Krankschreibung besorgen«,
sagte ich und sah noch einmal zum Schlitten rüber.
»Das wirst du schön bleiben lassen, außerdem kennt er dich doch
überhaupt nicht. Er weiß nicht mal, dass du existierst«, meinte Nancy
und steckte ihr Handy weg. Ich warf ihr einen bösen Blick zu, denn ihre
Worte waren nicht gerade aufbauend, aber dennoch wahr. Tobias war
einer jener Typen, die heißbegehrt und unnahbar waren. Ich hatte schon
viele Frauen gesehen, die sich an ihm die Zähne ausgebissen haben, aber
offenbar war ihm hier keine auf der Schule gut genug. Zumindest hatte
ich ihn noch nie mit einer Frau zusammen gesehen. Die Schicki-Micki-
Tussen ausgenommen, die ihn jeden Tag aufs Neue belagerten, mit ihren
Miniröcken und ausgeschnittenen Tops zu imponieren versuchten und
dümmlich über seine Witze lachten, in der Hoffnung, er würde sie ans-
prechend finden. Aber ich hatte zumindest noch nie gesehen, dass er
händchenhaltend mit einer Frau über den Schulhof gelaufen war oder in
einer Ecke wild rumgeknutscht hat.
Meistens spielte er mit seinen Jungs Basketball auf dem Platz oder
ging joggen, aber da hörte es auch fast schon mit meinem Wissen auf.
Von Laura wusste ich, dass er dreiundzwanzig Jahre alt war, ansonsten
war mir nichts bekannt und das beruhte sicher auch auf Gegenseitigkeit –
bis jetzt zumindest, denn sollte er mich bis zum heutigen Tage noch nicht
9/117

gekannt haben, dann tat er es jetzt und zwar als die Frau, die ihn vor all
den Leuten blamiert hatte. Oh ja, und wie ich am Mittwoch schwänzen
würde!
»Was machen wir jetzt?«, wollte Steffi wissen, als wir weiterzogen.
»Lasst uns doch nochmal ins Gruselkabinett gehen, das war lustig«,
schlug Nancy vor und niemand hatte etwas dagegen einzuwenden. Naja,
außer ich, aber mein erbärmlicher Protest wurde einfach im Alkohol er-
stickt. Als ich den anderen nämlich sagte, mir wäre die Lust am Weih-
nachtsmarkt vergangen, wurde mir ein weiterer Becher Glühwein in die
Hand gedrückt und ich wurde ungerührt mitgeschleift. Aber so war das
eben, wenn man mit so starken Persönlichkeiten wie Nancy und Steffi be-
freundet war – Widerrede zwecklos! Während die drei erneut in das
Gruselhaus einstiegen, wartete ich draußen mit den Getränken und ver-
suchte zu verstehen, was Tobias hier als Weihnachtsmann überhaupt ver-
loren hatte? Ich meine, ich hätte weiß Gott wen unter dem Kostüm erwar-
tet, aber ihn? Hatte er eine Wette verloren oder verdiente er sich damit
ein Zubrot als Weihnachtsmann? Arbeitete er hier vielleicht sogar ge-
meinnützig? Ich verstand es einfach nicht und noch weniger verstand ich,
wie ich nur wieder so viel Pech haben konnte? Andererseits hatten wir
seit gut zweieinhalb Jahren Sport zusammen und er hatte nicht einen
Blick auf mich geworfen, auch nicht in den wenigen Momenten, die wir
uns auf dem Schulhof oder im Gebäude über den Weg gelaufen waren.
Vor Rachegedanken brauchte ich mir also keine Sorgen machen, denn bis
Mittwoch würde er mein Gesicht wieder vergessen haben. Mit dieser
Zuversicht nippte ich an meinem Glühwein und hätte mich beinahe ver-
schluckt, als ich ihn von weitem zu mir herüberlaufen sah.
Er hielt direkt auf mich zu, den Blick auf mein Gesicht gerichtet –
glaubte ich zumindest. Oh Gott, was tat ich denn jetzt? Hastig drehte ich
mich weg und verschüttete dabei Glühwein auf meine Jacke, gleichzeitig
zog ich mir die Kapuze über den Kopf und hob die Schultern an. Vielleicht
hat er dich nicht erkannt, redete ich mir zu, während ich mit ange-
haltenem Atem die Sekunden zählte, die er brauchen würde, um bei mir
zu sein. Denn wegrennen würde ich ganz sicher nicht, ich hatte mich
heute schon genug zum Göppel gemacht! Ob er mich vor all den Leuten
10/117

anschreien würde? Ich wusste so gut wie nichts über Tobias, außer dass er
gut aussah und in der Schule wohl ganz nett war.
Wie er im privaten Leben tickte, war mir allerdings nicht bekannt und
weil das hier gerade zu seinem Privatleben gehörte, wollte ich es auch gar
nicht herausfinden!
»Alter, was ist denn mit dir los? Hast du dich geprügelt?«, hörte ich
den Mann neben mir fragen. Ich drehte mich nicht um, wusste aber in-
stinktiv, dass er mit Tobias sprach, der mich längst erreicht haben
müsste. Und tatsächlich hörte ich Tobis Stimme antworten.
»Schlimmer noch, so ’ne blöde Kuh hat mir vor all den Leuten die
Hosen runtergezogen und mir mit dem Ellenbogen ein Veilchen ver-
passt«, sagte er säuerlich, woraufhin der andere lachte. Dann hatte er gar
nicht zu mir kommen wollen, sondern zu meinem Nebenmann. Ich hätte
ja erleichtert ausgeatmet, aber Tobias war mir so nahe, dass ich glaubte,
ihn an meinem Rücken zu spüren.
»Was denn, war das etwa eine Verflossene?«, fragte der Typ neben
mir und Tobias antwortete schnaubend: »Ganz sicher nicht, sie und ihre
Freunde fanden das aber wohl besonders witzig. Schade, dass sie so
schnell abgehauen ist, ich hätte mich gerne revanchiert.« Es ärgerte mich,
dass er die Frage seines Freundes mit so einem spöttischen Ton abtat. Als
wäre es so abwegig, mit mir zusammen zu sein!
»Huhu Emily, willst du nicht raufkommen?«, hörte ich Nancys
Stimme plötzlich über mir. Ich warf einen Blick nach oben und sah meine
Freundinnen auf der Terrasse des Gruselhauses stehen und zu mir her-
unter winken. Oh nein, wenn Tobias Laura sieht, wird er vielleicht da-
rauf kommen, dass ich diejenige bin, die ihn blamiert hat!, dachte ich
panisch. Mit dem Rücken zu ihm konnte ich nicht sehen, was Tobias tat,
doch ich hoffte, dass er nicht nach oben sah.
»Guckt mal, Emily ist schüchtern«, sagte Steffi kichernd, als ich ihr
mit versteinerter Miene zurückwinkte. Diese blöden Kühe! Sahen sie
denn nicht, wer hinter mir stand? Glücklicherweise gingen sie dann aber
wieder hinein und von Tobias hörte ich auch nichts mehr. Als ich mich et-
liche Minuten später umdrehte, war keine Spur mehr von ihm zu sehen
und ich atmete erleichtert auf.
11/117

***
Zu Hause angekommen, gab ich meinen Eltern einen Kuss auf die Wange,
welche beide vor dem Fernseher saßen und ihre Lieblingsserie schauten
und verschwand dann in der zweiten Etage. Wir hatten eine kleine Dop-
pelhaushälfte im gemütlichen Prenzlauer Berg und einen Jack Russell na-
mens Milow. Meine Mutter hatte sich damit vor fünf Jahren einen Kind-
heitstraum erfüllt, doch irgendwie hörte der kleine Frechdachs nur auf
mich. Und frech war er wahrhaftig! Wenn wir uns alle zusammen im
Haus aufhielten, war er ein wahrer Engel und benahm sich vorbildlich,
aber sobald er mit jemandem alleine war, vergaß er plötzlich, dass er
nicht auf das Sofa springen durfte oder verteilte sein Trockenfutter in der
Wohnung.
Und da sollte mal noch einer sagen, Hunde wären nicht intelligent! Er
wusste ganz genau, was er bei wem machen konnte. Der kleine Rabauke
hielt uns ziemlich auf Trab, doch nichtsdestotrotz liebten wir ihn und
konnten uns ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen. Nachdem ich in
bequeme Sachen geschlüpft war, kochte ich das Essen auf, das meine
Mutter schon am Nachmittag für mich zubereitet hatte. Ich gebe es zu, ich
konnte weder kochen noch backen, was vielleicht einfach daran lag, dass
meine Mutter eine leidenschaftliche Köchin war und ich es einfach nie
hatte tun müssen, aber wenn es darum ging, Fertiggekochtes
aufzukochen, war ich fünf Sterne wert. Ich ließ mich mit einer Schüssel
Eintopf auf dem Sofa nieder und schaute eine Weile ihre Lieblingsserie
mit, wobei wir Neuigkeiten des Tages austauschten, ich mich aber hütete,
von meinem Weihnachtsmann-Dilemma zu erzählen. Schließlich zog ich
mir Schuhe und Jacke über und führte Milow zu seinem abendlichen
Spaziergang aus. Ich liebte diese Spaziergänge, vor allem, weil wir einen
Riesenpark vor der Tür hatten und im Winter machten Spaziergänge be-
sonders Spaß. Ich wollte die Zeit außerdem nutzen, um Fahrrad zu fahren
– so lange zumindest, bis noch kein Schnee gefallen war.
Dann bekamen Milow und ich noch etwas Bewegung, bevor die kal-
orienbelastete Weihnachtszeit begann. Ich könnte natürlich auch zum
Fitness gehen, aber irgendwie fehlte mir die Motivation dazu, vor allem,
12/117

wenn man in der kalten Jahreszeit lieber mit einem Glühwein und Leb-
kuchen vor dem Kamin sitzen konnte. Aber nächstes Jahr würde ich mit
dem Sport anfangen, ganz bestimmt!
13/117

Zwei
Heute war Montag und damit ausnahmsweise einmal kein Tag, auf den
ich mich freute. Normalerweise waren am Montag fast alle Fächer dran,
die ich mochte, wie etwa Geschichte, Deutsch, Biologie, leider aber auch
Mathe, das schlimmste Fach, das es auf dieser Welt gab! Doch heute kon-
nte ich mich so gar nicht auf die Schule freuen. Aber wer tat das schon,
wenn man einen Überfall auf seine Person erwartete? Ehrlich, ich fühlte
mich überhaupt nicht wohl bei der Sache, die Schule betreten zu müssen,
ermahnte mich auf der anderen Seite aber, dass er mich zwischen all den
Schülern ohnehin nicht entdecken würde. Als wir die ersten Blöcke hinter
uns hatten, entspannte ich mich allmählich. Zumindest so lange, bis mir
Nancy laut lachend ein Video bei Facebook zeigte.
»Sag mal, spinnst du, das Video einfach hochzuladen?!«, fragte ich sie
schockiert und riss ihr das Handy aus der Hand, um es mir anzusehen.
Darauf sah man ganz deutlich, wie ich jemandem die Hosen runterzog,
wir uns ineinander verhakten, zu Boden gingen und er schließlich seine
Maske abnahm und sein Gesicht entblößte. Ich war tot. Ich war ja sowas
von tot!
»Reg dich ab, das ist nicht von mir«, sagte sie und fühlte sich
keineswegs schuldig. Ich warf ihr einen ungläubigen Blick zu, denn wenn
nicht sie, wer dann?
»Wirklich! Ich habe es nicht hochgeladen. Hier«, sagte Nancy und
zeigte mir das Profil einer blonden Frau.
»Oder heiße ich neuerdings SabberHexe?« Ich lachte über den Na-
men und gab ihr das Handy zurück. Unbehaglich war mir aber dennoch
zumute, denn offenbar hatten das Schauspiel noch mehr Schüler verfolgt
und eben diese hatten meine Aktion nun auf Facebook verewigt. Klasse,
einfach nur klasse!
Im Laufe des Tages verbreitete sich das Video wie ein Lauffeuer.
Überall, wo ich hinsah, hatten die Leute Handys in der Hand und
schauten lachend und schmunzelnd auf die Bildschirme und paranoid wie

ich war, bildete ich mir jedes Mal ein, dass es ein ganz bestimmtes Video
war. War es wahrscheinlich nicht, aber an den Blicken und Sprüchen, die
mir manche zuwarfen, sahen es zumindest mehr, als gut für mich war.
»Coole Aktion, Emily«, rief mir doch tatsächlich eine Mitschülerin zu,
als wir uns auf den Weg zum Matheunterricht machten und in der
zweiten Pause klopfte mir ein vollkommen Fremder auf die Schulter, nur,
um mir daraufhin grinsend zuzunicken. Hallo? Gings noch? Ich kam mir
vor wie in der Grundschule! Eine Person sah ich an diesem Tag allerdings
nicht, wobei ich nicht sagen konnte, ob das gut oder schlecht war? Denn
entweder war Tobias zuhause und bekam von der ganzen Sache nichts
mit oder er lauerte mir schon in irgendeiner dunklen Ecke auf und war-
tete auf den richtigen Moment.
»Habt ihr ihn heute schon gesehen?«, erkundigte ich mich bei mein-
en Freundinnen, doch Vicky und Steffi schüttelten die Köpfe, wobei
Nancy genervt die Augen verdrehte. Steffi hatte da schon mehr Mitleid
mit mir und sagte: »Lass uns in der nächsten Pause mal zu Laura gehen,
dann kann sie uns ja sagen, ob er heute in der Schule ist oder nicht.« Ich
nickte und als wir uns in der dritten Pause auf dem Schulgelände trafen,
bestätigte Laura: »Er ist heute nicht gekommen, offenbar geht es ihm
nicht gut.« Nancy lachte.
»Das würde es mir auch nicht, wenn die ganze Schule über mich
lacht.« Ich warf ihr einen bösen Blick zu und Laura sagte:
»Ich glaube nicht, dass er deswegen fehlt. Woher soll er denn wissen,
dass das Video die Runde macht, wenn heute erst wieder die Schule ange-
fangen hat?«
»Na hör mal, das Video läuft auf Facebook. Jeder bekommt das mit,
einfach jeder«, sagte Nancy grinsend. Ich erwiderte es halbherzig und
wünschte mir manchmal etwas mehr Mitgefühl von meiner besten
Freundin.
»Vielleicht hat ihn ja irgendjemand vorgewarnt und er kommt de-
shalb nicht in die Schule, was weiß ich. Aber können wir jetzt mal über et-
was anderes reden, als über Tobias? Lasst uns lieber noch einen Kaffee
holen, bevor wir uns Frau Riebners stundenlange Anekdoten über Patrik
Süßkinds Meisterwerk anhöre müssen«, warf Steffi ein und niemand
15/117

hatte etwas dagegen einzuwenden.
Am Mittwoch war es dann soweit und der Sportunterricht stand in
der zweiten Stunde an. Und obwohl Nancy recht hatte und ich mich total
lächerlich benahm, stand ich heute mit einem mulmigen Gefühl auf.
Natürlich hatte ich mein Wort nicht gehalten und ließ Sport auch nicht
ausfallen – das traute ich mich gar nicht und leisten konnte ich mir es
auch nicht. Ich brauchte nämlich jede gute Note auf dem Zeugnis, um von
meinen miserablen Matheleistungen abzulenken. Aber ganz ehrlich, wer
brauchte dieses Fach schon? Ich wollte Literaturwissenschaften studier-
en, wen interessierte es da, was die Wurzel aus (100-x^2) war?! Nancy
war unsere Musterschülerin, wobei ich sie noch nie für irgendetwas hatte
lernen sehen, doch sie konnte überhaupt nicht gut erklären und war so
ungeduldig, dass gemeinsame Nachhilfestunden oft in Zänkereien en-
deten. Also konzentrierte ich mich auf meine starken Fächer wie Deutsch,
Geschichte, Biologie.
Warum ich mein Abi erst mit 21 Jahren machte? Der Grund war ein-
fach wie blöd: Ich hatte bereits eine kaufmännische Ausbildung hinter
mir, die ich in der Hoffnung absolviert hatte, einmal Einkäuferin einer
großen Modehandelskette zu werden. Ziemlich naiv, ich weiß, denn
nachdem mir versichert wurde, dass ich den Posten nach meiner Ausb-
ildung bekäme, wechselte ein halbes Jahr vor meinem Abschluss der Fili-
alleiter und dieser hatte keineswegs vor, mich als Einkäuferin einzustel-
len. So hatte ich ziemlich schnell die Lust am Einzelhandel verloren und
meine Leidenschaft in der Literatur gefunden.
Wie jeden Morgen traf ich mich mit Steffi, Nancy und Laura am
Bahnhof vor der Schule, um das letzte Stück zusammen zu laufen und
über Gott und die Welt zu reden.
»Und denk daran, sollte er sich auffällig benehmen oder nicht mit dir
sprechen, schreibst du mir sofort eine Nachricht«, erinnerte ich Laura
zum hundertsten Mal. Sie saß im Unterricht direkt neben Tobias und soll-
te er sich an irgendetwas vom Weihnachtsmarkt erinnern, dann würde sie
es zuerst wissen und könnte mich warnen. Ich würde mich dann vom
Sportunterricht
befreien
lassen,
sagen
wir
…
wegen
Unterleibsbeschwerden.
16/117

»Jaaa, mach ich«, versprach sie genervt und steckte sich eine Zigar-
ette an. Ich rauchte nicht, hatte es noch nie getan und ehrlich gesagt, ver-
stand ich auch nicht, wie man Geld für etwas ausgeben konnte, das einen
Tag für Tag quälend langsam tötete? Natürlich konnte man auch an einer
Überdosis Zucker oder Chemikalien sterben, aber bewusst Geld für etwas
so Schädliches auszugeben, ging irgendwie über meinen Horizont hinaus.
Zu Laura passte es aber seltsamerweise, was vielleicht daran lag, dass ich
sie nicht anders kennengelernt hatte. Als es zum Unterricht klingelte und
wir uns in der riesigen Schule zu unserem Klassenzimmer begaben,
fieberte ich bereits sehnlichst dem Ende der Stunde entgegen und das
nicht nur, weil es sich um mein Lieblingsfach handelte, sondern weil ich
Lauras Beobachtung einholen wollte. Ja, ich reagierte über, aber Vorsicht
war mein zweiter Vorname und ich wollte alle Zweifel ausräumen, bevor
ich die Sporthalle betrat.
»Nichts, er hat kein Sterbenswörtchen darüber verloren«, berichtete
Laura, als wir uns später in der Pause trafen und bevor ich überhaupt den
Mund aufmachen konnte.
»Und er war auch nicht komisch oder zickig zu dir?«, hakte ich nach.
Als sie den Kopf schüttelte, atmete ich erleichtert auf und Nancy konnte
sich ein Siehst du nicht verkneifen.
»Und jetzt lass uns in die Mensa gehen, ich verhungere«, drängte
Steffi und zog uns den Gang runter. Unser OSZ war wirklich riesig, das
größte Deutschlands, hatte ich mir sagen lassen und es bestand aus or-
angenem Backstein. Hinzu kamen die vielen geheimen Gänge, die Türme
und alten Wände im Innern, so dass man wirklich meinen könnte, in
einem Schloss zu sein. Ich liebte diese Schule und hätte kein Problem
damit gehabt, weitere zwei Jahre hier zu lernen, aber bedauerlicherweise
war mein Abitur schon in einem halben Jahr vorbei. Wobei, bedauerlich
war es nur wegen der tollen Kulisse, denn ich freute mich schon riesig auf
mein Studium. Als wir uns zum Sportunterricht aufgemacht hatten und
ich umgezogen die Halle betrat, hielt ich zuallererst nach Tobias
Ausschau und entdeckte ihn am anderen Ende Basketball spielen. Ich
musste zugeben, dass er zum Anbeißen gut aussah.
Sogar in der locker sitzenden Trainingshose hatte er einen knackigen
17/117

Hintern und sein Shirt war eng genug, um seinen wohlgeformten Körper
zu betonen. Es sollte verboten sein, so aufreizend herumzulaufen, wobei
sein Shirt ja nichts dafür konnte, dass es an ihm so lecker aussah. Doch
war ich sonst so hingerissen von seinem Körper, der so viel männlicher
wirkte als die der meisten Mitschüler, kamen mir seine starken Arme und
langen Beine mit einem Mal sehr bedrohlich vor. Was sollte seine kräfti-
gen Beine davon abhalten, mit einem Fußball nach mir zu schießen oder
seine Arme mich mit einem Medizinball zu bewerfen, während ich auf
dem Barren lief?
Okay, da ging jetzt wohl die Fantasie mit mir durch, aber für je-
manden wie ihn war es sicher keine Anstrengung, mich auszuschalten
und die schiere Auswahl an Sportgeräten und deren Equipment boten
ihm genügend Gelegenheit, um mich auf skurrilste Art und Weise zu ver-
letzen – aus Versehen natürlich. Also machte mein Herz diesmal keinen
Sprung und blieb unbehaglich ruhig, denn ich wollte ihm einfach nur aus
dem Weg gehen. Ich gesellte mich zu Nancy und den anderen, die schon
auf der Bank warteten und sich zur Anwesenheitskontrolle um unsere
Sportlehrerin versammelt hatten. Auf der anderen Seite der Halle erklang
ein Pfiff und die Schüler der Parallelklasse wurden ebenfalls zur Durch-
sicht gerufen. Ich winkte Laura von weitem zu und stellte mich dann zu
meinen Mitschülern.
»Also Leute, heute spielen wir mit der 12b Volleyball. Findet euch in
der Mitte der Halle wieder und baut die Felder auf, danach werden wir
die Klassen mischen und sechs Mannschaften bilden«, sagte sie an-
schließend und stieß einmal kräftig in ihre Pfeife.
»Oh nein, das darf doch wohl nicht wahr sein«, stöhnte ich und sah
zu Nancy rüber, die mich schadenfroh angrinste. Ich liebte sie wie eine
Schwester, aber ihre Boshaftigkeit war manchmal wirklich zum … ärgern!
»Grins nicht so blöd«, fuhr ich sie deshalb an und begab mich ge-
meinsam mit ihr und Steffi in die Mitte der Halle. Die Parallelklasse kam
ebenfalls auf uns zu und ich hielt den Blick gesenkt, nach dem Motto:
Wenn ich ihn nicht sehe, sieht er mich auch nicht. Hat als Kind im
dunklen Zimmer doch auch immer gut funktioniert! Es wurden drei
Schüler aus der Parallelklasse und drei aus unserer zum Teamchef
18/117

gewählt und natürlich musste auch Tobias einer von ihnen sein! Also ver-
steckte ich mich hinter Nancy und Steffi, wann immer er seinen Blick um-
herschweifen ließ und seine Spieler auswählte. Glücklicherweise war aber
auch Laura eine der Teamleader und so wählte sie mich und Nancy in
ihre Mannschaft, während Steffi schon von jemand anderem genommen
wurde.
Ich atmete erleichtert auf, als ich mich zu meinen Freundinnen stel-
len konnte – etwas, das ich in letzter Zeit ziemlich oft tat, wie mir auffiel.
Mein Gemüt blieb jedoch nicht lange in guten Zustand, denn als wir uns
den gegnerischen Teams auf den Feldern stellen mussten, war die erste
Mannschaft, gegen die wir spielen mussten – man rate einmal … natür-
lich Tobias seine! Ich stellte mich auf den hinteren Platz, so weit weg wie
nur irgend möglich von ihm und während ich auf den Anpfiff wartete,
betete ich, dass die Stunde schnell vorbeigehen würde. Dann erklang das
schrille Pfeifen, Laura machte den Aufschlag und der Ball flog in hohem
Bogen über das gegnerische Feld hinaus. Ein Pfiff erklang und der Punkt
galt Tobias’ Mannschaft. Entschuldigend warf sie mir einen Blick zu,
denn ich stand ihr am nächsten, doch ich hob nur die Schultern. Ich war
beim Aufschlag genauso eine Niete wie sie, deshalb war ich die Letzte, die
ihre miserable Leistung kommentieren würde.
Nancy, unsere Sportexpertin, war da aber schon weniger zurückhal-
tend und schnalzte unzufrieden mit der Zunge. Sie konnte nichts dafür,
aber wenn es um sportive Spiele ging, schaltete sie komplett ab und
machte alles und jeden zur Sau, der sich nicht wenigstens anstrengte.
Laura und ich machten uns oft darüber lustig, doch heute hatte auch ich
Interesse daran, das Spiel zu gewinnen und der Grund stand auf dem ge-
genüberliegenden Feld. Ein Pfiff erklang und wir wechselten unsere Posi-
tion, dann ging das Spiel weiter. Während es seinen Lauf nahm, erwischte
ich mich dabei, wie ich Tobias jedes Mal einen Blick zuwarf, wenn er sich
auf den Ball konzentrierte und ich musste zugeben, dass er ein äußerst
guter Spieler war. Eigentlich entschieden fast ausschließlich er und Nancy
über die Punkte unserer Mannschaften, denn sie waren mit Abstand die
besten Spieler und lieferten sich teilweise erbitterte Zweikämpfe. Manch
einer kritisierte das natürlich, denn Volleyball war nun mal ein
19/117

Mannschaftsspiel, aber niemand wagte es, Nancy in ihrem Element
zurechtzuweisen und auf Tobis Seite schien das ähnlich abzulaufen.
»Siehst du sein selbstgefälliges Grinsen? Wie schön sich doch ein
Ballabdruck darauf machen würde«, raunte sie mir säuerlich zu, als wir
wieder einmal einen Punkt verloren hatten und unsere Position wechseln
mussten. Ich sah zu Tobias hinüber, der Nancys finsteren Blick tatsäch-
lich mit einem Grinsen quittierte und dazu hatte er auch allen Grund,
denn sein Team lag fünf Punkte vor uns. Ich bewegte mich auf das Netz
zu, um dort Stellung zu beziehen und sah, dass Tobias das gleiche tat. Oh
nein, dachte ich und sah ihn wie in Zeitlupe auf mich zukommen. Bloß
keine Panik, er hat dich nicht erkannt, redete ich mir zu. Andernfalls
hätte er mich doch schon längst angesprochen, oder? Als er vor mir stand,
nur das dünne Netz zwischen uns, sah ich feige an ihm vorbei. Ich konnte
einfach nicht den Mut aufbringen und ihm in die Augen sehen. Zu groß
war die Angst, dass er mich dann erkennen würde. Doch dann sprach er
mich an und seine Stimme dröhnte in meinen Ohren, als hätte er mir ein
Megafon daran gehalten.
»Hi«, sagte er vollkommen unerwartet und ich sah erschrocken zu
ihm auf. Hatte er mit mir geredet? Beinahe hätte ich mich zu meinen
Teamkollegen umgedreht, um zu schauen, ob er jemand anderen meinte,
konnte mich aber gerade noch zurückhalten. Ich hatte bisher nur selten
die Gelegenheit gehabt, Tobias aus nächster Nähe zu betrachten. Das war
einmal in der neunten Klasse gewesen, als ich um die Ecke gebogen und
in ihn hineingelaufen war und am Freitag auf dem Weihnachtsmarkt. De-
shalb fraß sich der Anblick seiner eisblauen Augen auch direkt in mein
Herz, das nun wieder wild zu hüpfen begann. Ich konnte mir nicht vor-
stellen, dass sich jemals jemand an diesen Anblick gewöhnen konnte und
wäre ich seine Mutter, hätte ich damals das Baby stundenlang angesehen.
Ich hatte schon Lehrerinnen gesehen, die doppelt so alt wie er und den-
noch hingerissen waren.
Er war einfach ein Hingucker und ein netter noch dazu. Im Moment
sahen mich seine Augen aber mit einem fiebrigen Glanz an, so dass ich
mich fragen musste, ob er gerade Mordgedanken gegen mich hegte? Sein
linkes Auge war noch etwas gerötet, dort, wo mein Ellenbogen ihn
20/117

getroffen hatte, aber das nahm er mir doch nicht mehr übel oder? Jeder
rutschte doch mal aus Versehen aus und versenkte seinen Ellenbogen in
andere Gesichter, wirklich, das war ganz normal! Kein Grund, mich so
böse anzuschauen. Außerdem waren seine Augen trotzdem noch ein Hin-
gucker, dahingehend konnte ich ihn also beruhigen.
»Hi«, antwortete ich verzögert und sah mich dann nach meiner
Mitschülerin am Ende unseres Feldes um. Warum ließ sie sich denn so
viel Zeit mit dem Aufschlag, verdammt? Ich sah, dass sie sich hingehockt
hatte, um sich die Schuhe zu binden und verdrehte genervt die Augen.
Heute noch! Ich habe nämlich keine Lust, mich mit meinem künftigen
Mörder zu unterhalten, rief ich ihr stumm zu – was sie natürlich nicht
hörte.
»Wie geht’s dir?«, holte mich Tobias’ Stimme wieder zurück.
Stirnrunzelnd drehte ich mich zu ihm um. Hatte er mich das gerade ern-
sthaft gefragt?
»Wie … wie es mir geht?«, wiederholte ich und starrte ihn an, als
wäre ich zurückgeblieben.
»Genau, deine Gemütslage, Stimmung, Laune …«, erklärte er mit er-
heitertem Blick, so dass ich mich fragen musste, ob er sich gerade über
mich lustig machte? »Keine Ahnung, gut, denke ich«, murmelte ich
durcheinander und wandte mich wieder meiner Mitschülerin zu.
»Wir warten auf dich, Sandy! Vielleicht hättest du die Güte, uns mit
einem Aufschlag zu beehren!«, rief ich ihr zu, woraufhin sie mir einen
finsteren Blick zuwarf. Aber ich wollte, dass sie endlich anfing, denn die
Verwirrung, dass er mich angesprochen hatte, war einfach zu groß. Ich
meine, warum ausgerechnet heute, nach dem Vorfall? Da stimmte doch
was nicht. Endlich warf sie den Ball in die Luft und beförderte ihn über
das Netz, so dass ich mich wieder umdrehen und mit Erleichterung regis-
trieren konnte, dass Tobias Aufmerksamkeit wieder dem Ball gewidmet
war. Das Spiel ging weiter und dank Nancys Ehrgeiz holten wir die
Punkte schnell wieder auf, was sich Tobias aber nicht so ohne weiteres ge-
fallen ließ.
Er schlug seine Bälle immer härter und das beharrlich in meine Rich-
tung, so dass ich keine Chance hatte, sie zu halten. Blieb bloß die Frage,
21/117

ob er es tat, weil er sich an mir rächen wollte oder weil er in mir eine Sch-
wachstelle gefunden hatte, denn er holte die Punkte ziemlich schnell
wieder auf. Zu allem Überfluss war er aber auch ein verdammt guter
Trickser und leitete unser Team beständig in die Irre, indem er eine Rich-
tung andeutete, den Ball aber ganz woanders hinschlug. Als Tobias und
ich uns wieder einmal in der Mitte unserer Felder wiederfanden, nahm
ich mir vor, seine Bälle nicht mehr auf den Boden zu lassen, doch kaum
war er am Zug, schmetterte er den Ball so hart, dass ich keine Chance
hatte, ihn aufzuhalten. Ich legte die Hände übereinander und ließ mich
nach vorne fallen, um den Ball anzunehmen, doch ich war zu langsam.
Ich fiel auf die Knie und der Volleyball schlug nur Zentimeter vor meinem
Gesicht auf dem Boden auf. Mist!
Mit einem verärgerten Blick rappelte ich mich auf und sah Tobias
selbstgefällig lächeln. Nein, es gab keinen Zweifel mehr! Er wusste, wer
ich war, denn nur bei mir schlug er die Bälle so hart. Das war etwas Per-
sönliches und er hatte es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, es mir
heimzuzahlen! In der nächsten Runde waren wir am Zug und Nancy
spielte den Ball zu mir, damit ich ihn über das Netz beförderte. Unglück-
licherweise hatte ich aber einen Tobias vor mir, der meinen Ball mit
Leichtigkeit blockte. Ich sprang in die Luft, um ihn übers Netz zu schla-
gen, doch er war zu groß für mich und er streckte lediglich seinen Arm
aus, um meinen Ball aufzuhalten. Dieser prallte zurück und ich spielte ihn
zu Laura, sie zu mir und ich versuchte ihn erneut übers Netz zu bringen.
Wieder vereitelte Tobias meinen Versuch und wieder war sein Blick spöt-
tisch. So ging es noch zwei Runden weiter, bis ich so aufgebracht war,
dass ich einen Fehler beging und den Ball zu hart schlug. Tobias blockte
ihn und schmetterte ihn zu Boden.
»18 zu 15 für Team 3«, rief unsere Lehrerin und ich wanderte schlecht
gelaunt zum nächsten Platz. Arschloch!, schimpfte ich stumm und wech-
selte einen entschlossenen Blick mit Nancy. Sie hatte Tobias schon seit
Spielbeginn auf dem Kicker und nun war ich noch mehr gewillt, es ihm zu
zeigen. Anders als Nancy war ich aber nicht gut im Volleyball, also blieb
mir nichts anderes übrig, als ihr gute Bälle zuzuwerfen und zu hoffen,
dass sie diesen eingebildeten Kerl fertigmachte. Von wegen, er war nett!
22/117

Wer hatte denn diesen Blödsinn erzählt? Zum Ende des Spiels hin wurde
der Ton rauer, die Spieler riefen sich gegenseitig Befehle zu, brüllten die
Namen der anderen und verließen ihre Position, um den Ball vor dem Aus
zu retten – wie es beim Schulvolleyball eben üblich war. Plötzlich hatten
wir Gleichstand und es waren nur noch drei Punkte zum Sieg.
»Nimm ihn an, pass ihn rüber, halte ihn flach«, wies Nancy uns
ständig an. Wir alle wollten das Spiel gewinnen und vor allem ich, denn
ich wollte Tobias zeigen, dass ich mich weder von seiner Größe noch von
seiner Person einschüchtern ließ. Als der Ball von der gegnerischen
Mannschaft auf uns zuflog, nahm Laura ihn an, spielte ihn zu mir und ich
beförderte ihn übers Netz – oder hätte es zumindest getan, wäre da nicht
Tobias gewesen, der in die Höhe schnellte und ihn abblockte. Leider
schmetterte er den Ball so fest, dass er mit voller Wucht zurückkam …
und zwar direkt in mein Gesicht. Ich fiel wie ein nasser Sack nach hinten
und verdankte es meinen Reflexen, dass ich auf meinen Ellenbogen an-
statt dem Hinterkopf landete. Ich wusste, dass ich getroffen worden war,
spürte aber nichts außer einem leichten Kribbeln im Körper. Meine Beine
fühlten sich schwer an und meine Ellenbogen taub. Mehrere Stimmen
riefen durcheinander, doch ich konnte nichts verstehen, denn in meinen
Ohren rauschte das Blut. Dieser verdammte Arsch. Er hatte mir den Ball
mit voller Absicht ins Gesicht geschlagen! Jemand griff von hinten unter
meine Arme und hob mich hoch, ein kurzer Blick über die Schulter zeigte
mir, dass es Nancy war.
»Alles in Ordnung?«, fragte sie mich mit besorgtem Blick. Ich nickte.
»So siehst du aber nicht aus, du bist ganz blass«, bemerkte Laura und
kam zu mir. Frau Meier tat es ihr gleich und packte mich besorgt an den
Schultern. »Geht es dir gut, Emily?«, fragte sie und betastete mein
Gesicht.
»Ja, alles bestens«, versicherte ich ihr und bedeutete Nancy, dass sie
mich loslassen konnte. Alle starrten mich an und dieser Umstand behagte
mir überhaupt nicht. Ich sah, wie sich Tobias unter das Netz duckte und
zu mir rüberkam und funkelte ihn bitterböse an.
»Tut mir echt leid, das war keine Absicht«, sagte er und klang
täuschend aufrichtig. »Ist schwer zu glauben, so wie du mich die ganze
23/117

Zeit mit deinen Aufschlägen bombardiert hast!«, knurrte ich. Da wagte er
es doch tatsächlich, mir ein freches Grinsen zu schenken. »Was kann ich
dafür, wenn du in Volleyball so eine Niete bist?« Einige aus unserem
Team lachten, darunter auch Nancy, doch ich brachte sie mit einem
finsteren Blick zum Verstummen. Heuchlerin!
»Vielleicht solltest du mal in den Sanitätsraum gehen, du bist wirklich
blass«, schlug Frau Meier vor, doch ich schüttelte den Kopf – was keine
gute Idee war, weil sich in meinem Schädel alles zu drehen begann. »Ich
begleite sie, schließlich ist es meine Schuld«, bot sich Tobias an und
erntete nicht wenige überraschte Blicke. Nancy und Laura sahen erst sich
und dann mich an und machten dabei ein mehr als verblüfftes Gesicht.
»Auf keinen Fall!«, sagte ich und befreite mich aus Nancys Griff, als
ich etwas Feuchtes auf meinem Mund spürte.
»Du blutest«, stellte Tobias fest und das zur selben Zeit, als ich meine
feuchte Nase betastete. Als ich die Hand vor mein Gesicht hielt, sah ich
Blut auf den Innenflächen meiner Finger – jede Menge Blut.
»Oh nein«, hörte ich Nancy noch sagen, die ganz genau wusste, wie
empfindlich ich auf den roten Lebenssaft reagierte, als meine Beine auch
schon nachgaben.
»Hoppla«, sagte Tobias und fing mich auf, bevor ich den Boden er-
reichen konnte. Als Frau Meier ein erschrockenes Gesicht machte,
erklärte Nancy: »Keine Sorge, sie kann nur kein Blut sehen.« Unsere
Lehrerin nickte erleichtert.
»Ich werde sie jetzt in den Sanitätsraum bringen«, verkündete Tobi-
as, warf sich ungefragt meinen Arm um die Schulter und ging mit mir
davon. Ich wollte protestieren, wollte ihn anschnauzen, mich loszulassen,
doch der Blutgeschmack in meinem Mund lähmte meine Zunge und
außerdem fühlte sich mein ganzer Körper taub an. Während ich mir die
Nase zuhielt, damit ich nicht die ganze Sporthalle volltropfte, warf ich
einen letzten flehenden Blick zu meinen Freundinnen, doch sie sahen
nicht so aus, als würden sie meine Lage bedauern. Eher, als freuten sie
sich für mich. Hallo? Als ob ich diese Situation künstlich herbeigeführt
hatte, um endlich in seinen Armen zu liegen!
Ehrlich, ich würde im Moment viel lieber woanders sein, als bei
24/117

Tobias. Doch so sehr ich ihn auch stumm anflehte, mich loszulassen, er
erfüllte mir den Wunsch nicht. Stattdessen spürte ich seine warme Hand
auf meiner Taille, die mich fest an seinen Körper drückte und stützte. Als
sich die Tür hinter der Turnhalle schloss und die Geräuschkulisse
abgeklungen war, sagte er: »Da habe ich dir ja was eingebrockt, nicht?«
Anstatt zu antworten, warf ich ihm einen unfreundlichen Blick zu, was
ihn aus irgendeinem Grund erheiterte. Dann erinnerte ich mich wieder an
das Blut, das aus meiner Nase rann und mir wurde wieder schummrig
zumute.
»Hey, kipp mir jetzt ja nicht um!«, sagte er mahnend und drückte
mich fest an sich, doch ich konnte nicht anders. Sobald ich Blut sah, ver-
wandelten sich meine Glieder in weiche Butter und vor allem, wenn es
meines war. Nur bei Filmen hatte ich kein Problem damit, wahrscheinlich
weil ich wusste, dass es kein echtes war.
»Das Blut …«, nuschelte ich, musste aber wegen eines erneuten Sch-
windelanfalls abbrechen.
»Ich weiß«, sagte er sanft, packte mich am Arm und stieß die Tür zur
Herrentoilette auf, um sich etwas Papier aus dem Spender zu nehmen.
»Leg deinen Kopf zurück«, wies er an und fasste mir in den Nacken,
um die Bewegung auszuführen, doch ich sträubte mich und das nicht nur,
weil seine Berührung ein warmes Kribbeln in mir auslöste, sondern auch
weil es Unsinn war. Viele legten reflexartig den Kopf in den Nacken, doch
das führte höchstens dazu, dass man sich an dem widerlichen Blut-
geschmack erbrach und das war das Letzte, was ich jetzt wollte. Also
nahm ich seine Hand wieder weg und sagte: »Man muss sich nach vorne
beugen … und die Nase … ausbluten lassen«, meine Stimme klang
genauso erschöpft, wie ich mich fühlte, so als wäre ich einen stundenlan-
gen Marathonlauf gelaufen.
»Wie du meinst«, sagte er schulterzuckend und hielt mir die Papier-
tücher hin. Ich nahm sie entgegen, lehnte mich an die Wand und beugte
mich vor, um das Blut herauslaufen zu lassen. Dabei kniff ich fest die Au-
gen zusammen.
»Du kannst also kein Blut sehen, hm?«, stellte er fest und klang
belustigt.
25/117

»Gibt es dafür einen bestimmten Grund?« Ich rieb mir den Nacken
und schüttelte den Kopf. Gab es einen Grund dafür, warum sich manche
Menschen vor Insekten fürchteten? Nein und genauso war es bei mir. Ich
konnte es einfach nicht sehen und damit basta! Als ich die Augen öffnete,
um ihn anzusehen, schenkte er mir ein Grinsen, das viel zu betörend war,
um ihm weiter böse zu sein. Dennoch fragte ich:
»Warum kümmerst du dich überhaupt um mich? Wolltest du nur den
Unterricht schwänzen oder was ist der Grund dafür?« Ich konnte wieder
einigermaßen sprechen und mein Magen drohte auch nicht mehr
überzukochen. Er sah mich ehrlich betroffen an.
»Ich wollte dir helfen. Das ist ja wohl das Mindeste, nachdem ich dich
fast umgebracht habe«, sagte er und klang absolut aufrichtig. Ich musste
unbeabsichtigt schnauben, wodurch nur noch mehr Blut aus meiner Nase
trat.
»Als ob du das nicht mit Absicht getan hast!« Er schüttelte den Kopf
und machte ein Gesicht, als könnte er sich nicht zwischen Belustigung
und Kränkung entscheiden, dann sagte er: »Emily, glaubst du wirklich,
dass ich dir den Ball absichtlich ins Gesicht gehauen habe? Für wen hältst
du mich denn?« Emily?
»Woher kennst du meinen Namen?«, fragte ich misstrauisch und
ohne seine Frag zu beantworten. Die Antwort stand ohnehin gut leserlich
in meinem Blick geschrieben.
»Du meinst den Namen, den deine Freundinnen eben laut gebrüllt
haben, als du am Boden lagst?«, fragte er spöttisch. Aha, er war also ein
Klugscheißer. Na, der würde mich schon noch kennenlernen! Ich antwor-
tete nicht darauf, sondern nahm die Tücher von meiner Nase und prüfte
sie kritisch. Der Anblick sandte einen weiteren Schauder durch meine
Beine, aber wenigstens ließ die Blutung allmählich nach.
»Von hier aus komme ich alleine zurecht, du kannst zurückgehen«,
sagte ich und stieß die Toilettentür auf, um mir noch eine Ladung Papier-
tücher zu nehmen. Ich gab mir nicht einmal die Mühe, höflich zu sein,
denn ich wusste, dass er mich absichtlich umgeknockt hatte. Als ich die
gebrauchten Tücher in den Mülleimer geworfen hatte, schritt ich auf den
Ausgang zu und Tobias kam mir hinterher.
26/117
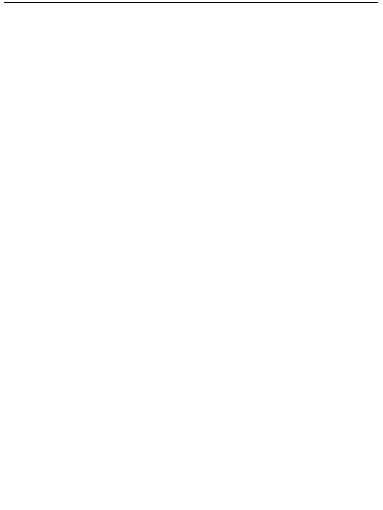
»Wo willst du hin?«, fragte er.
»An die frische Luft.« Kritisch betrachtete er mein sportliches Outfit.
»Du willst nicht ernsthaft ohne Jacke da rausgehen, oder? Wir haben
Winter und draußen herrschen fast Minusgrade!« Wo lag sein Problem,
ich hatte doch eine Sportjacke über und wollte nur für ein paar Sekunden
Luft schnappen.
»Das lass mal schön meine Sorge sein«, erwiderte ich und stieß die
Tür auf. Ohne mich noch einmal zu ihm umzudrehen, ging ich ins Freie
und schauderte, als die eisige Kälte in meine Knöchel biss. Schnee war
noch keiner gefallen, aber die Temperaturen waren ideal, um Frau Holle
zum Kissen ausschütten zu ermuntern. Ich fragte mich, warum sie diesen
Winter so lange damit wartete? Letztes Jahr war so weiße Weihnacht
gewesen, wie ich es schon lange nicht mehr erlebt hatte, zumindest nicht
in Berlin und ich hoffte inständig, dass sich das dieses Jahr wiederholte.
Kalter Wind peitschte mir ins Gesicht und stahl sich einen Weg durch
meine Sachen in die Haut, so dass ich Tobias zumindest in dieser
Hinsicht recht geben musste.
Es herrschten wirklich eisige Temperaturen, aber die Kälte half auch,
den Schwindel zu vertreiben und wieder klar im Kopf zu werden. Eine
Minute noch, dann würde ich wieder reingehen, redete ich mir zu und
trat einen Schritt vor, um das Schulgelände zu überblicken. Das OSZ best-
and aus dem Hauptgebäude, welches nahezu einem Schloss glich, zwei
Container, wie wir sie nannten und der Turnhalle. In den Containern
fanden meist Vertretungsunterricht oder Kurse statt, aber sie wurden
auch für Versammlungen oder Prüfungen genutzt. Ich sah mich nach To-
bias um, der verschwunden war und wandte mich dann wieder dem
leblosen Gelände zu. Bei diesen Temperaturen waren natürlich nur
wenige draußen – hauptsächlich die Raucher, die sich auch nicht bei
Minusgraden von ihrer Sucht abhalten ließen und selbst die zogen nur ein
paar Mal am Glimmstängel und eilten wieder hinein.
Ich sollte dasselbe tun, bevor ich mir hier draußen noch den Tod
holte, dachte ich und wollte mich wieder umdrehen, als ich jemanden
direkt hinter mir stehen sah und zusammenzuckte. Es war Tobias, in den
Händen eine Jacke haltend, die er auffordernd vor mir ausbreitete.
27/117
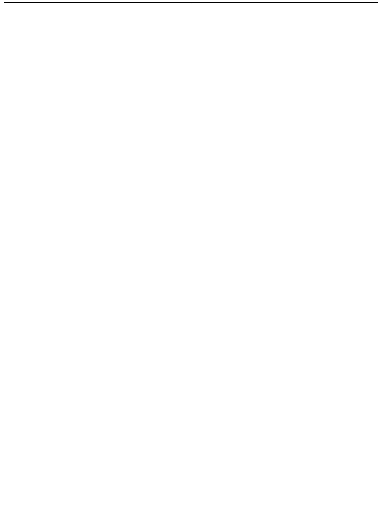
»Nicht nötig, ich wollte gerade reingehen«, sagte ich und spürte das
Adrenalin durch meine Adern jagen.
»Zum Sanitätsraum geht es aber da entlang«, sagte er und deutete
mit einem Nicken hinter mich.
»Mir geht’s gut, ehrlich. Ich brauchte nur frische Luft«, winkte ich ab,
doch dieser Kerl ließ einfach nicht locker!
»Nichts da, ich soll dich in den Sanitätsraum bringen und genau das
werde ich auch tun.« Auffordernd wackelte er mit der Jacke, weil ich in
die Ärmel schlüpfen sollte, doch ich schüttelte den Kopf.
»Können wir nicht einfach sagen, dass wir dort gewesen sind?«, ver-
suchte ich es ein letztes Mal.
»Damit ich für deinen Tod verantwortlich bin, weil du dir eine Ge-
hirnerschütterung zugezogen hast, die nicht behandelt wurde? Ganz sich-
er nicht und jetzt schlüpf rein, mir wird langsam selbst kalt.« Sein Ton
war bestimmend und normalerweise ließ ich mir nicht gerne etwas
vorsagen, aber sein Blick sagte mir, dass ich keine Wahl hatte und er mich
so oder so dorthin schleifen würde. Also gab ich mich mit einem Grum-
meln geschlagen und schlüpfte in die viel zu großen Ärmel. Wow, so
warm!, war mein erster Gedanke. Und so reichlich gefüttert. Außerdem
haftete sein Geruch daran, vermischt mit einem betörenden Parfüm. Oder
war es anders herum und sein Eigenduft war so berauschend? Wie auch
immer, die Kombination ließ mich beinahe vor Wonne einknicken. Bevor
er noch eine Reaktion in meinem Gesicht ablesen konnte, denn seine Au-
gen musterten mich eingehend, setzte ich mich in Bewegung und kehrte
ihm damit den Rücken zu.
»Danke«, sagte ich dann, weil es unhöflich gewesen wäre, diese Geste
unkommentiert zu lassen. Immerhin hätte er mich auch einfach an den
Haaren über den Hof schleifen können, um seine Pflicht zu erfüllen.
Kräftig genug war er ja. Apropos.
»Frierst du denn gar nicht?«, fragte ich und deutete auf seine train-
ierten Arme.
»Nur selten. Wenn man sich regelmäßig in Bewegung hält, hat man
eigentlich keine Probleme mit niedrigen Temperaturen«, erklärte er.
Keine Ahnung, woher ich plötzlich den Mut oder Leichtsinn dafür nahm,
28/117

aber um seine Aussage zu überprüfen, piekste ich in seine Oberarme und
überzeugte mich selbst davon.
»Hm, tatsächlich warm«, bestätigte ich, während ich mir gleichzeitig
zurief: Bist du verrückt geworden? Warum tatschst du ihn einfach an?!
Doch er ließ meine Berührung unkommentiert und schenkte mir
stattdessen ein undefinierbares Lächeln. Am Gebäude angekommen, hielt
er mir mit einer überzogenen Verbeugung die Tür auf, so dass ich mich
fragen musste, ob er mich nur begleitete, um sich über mich lustig zu
machen oder ob er heute Morgen bloß einfach einen Clown gefrühstückt
hatte? Jedenfalls bedankte ich mich, schlüpfte durch die Tür und steuerte
auf den Sanitätsraum zu. Kurz davor blieb ich stehen und drehte mich zu
ihm um.
»Danke, dass du mich hergebracht hast, aber ich denke, du kannst
jetzt wieder in den Sportunterricht gehen.« Doch anstatt meiner Auffor-
derung nachzukommen, machte er es sich auf dem Wartestuhl bequem
und sagte: »Ich denke, ich werde lieber warten, bis du zurückkommst.«
Ich starrte auf ihn herab.
»Das brauchst du nicht, wirklich«, sagte ich mit Nachdruck, doch er
hob nur die Schultern.
»Das macht mir nichts aus.« Mir aber, verdammt nochmal!, dachte
ich verärgert. Sah man es mir nicht an, dass ich ihn nicht hier haben woll-
te?! Wie begriffsstutzig konnte ein Mensch denn sein? Sein Blick war
gelassen, aber gleichzeitig auch herausfordernd, so dass ich zu der Frage
kam, was er eigentlich von mir wollte.
»Ich will nur sicher gehen, dass du in Ordnung bist«, sagte er auf
meine Frage hin und klang absolut unschuldig.
»Klar, so siehst du auch aus«, murmelte ich resigniert und öffnete die
Tür. Als ob ich seine lahme Nummer nicht längst durchschaut hatte!
Nachdem er seine Wut auf mich in das Volleyballspiel projiziert und mich
dabei verletzt hatte, war er in Erklärungsnot geraten und hatte sich
deswegen dazu bereit erklärt, mich herzubringen – was natürlich nur
scheinheiliges Getue war. Und nun machte er sich einen Spaß daraus, mir
auf den Zeiger zu gehen. Doch welchen Plan ich mir auch zurechtgelegt
hatte, um ihn abzuschütteln, Tobias ließ mir keine Zeit, ihn umzusetzen.
29/117

Als ich nämlich fünf Minuten später aus dem Sanitätsraum trat, stand er
schon bereit und hatte seine Sportsachen gegen Straßenkleidung
eingetauscht.
»Und? Was haben sie gesagt?«, fragte er. Ich hob eine Augenbraue.
Nicht, dass es ihn überhaupt etwas anging, aber wenn er es unbedingt
wissen wollte.
»Ich habe keine Gehirnerschütterung, aber mittlerweile so starke
Kopfschmerzen, dass ich nach Hause gehen darf.«
»Super, ich fahre dich«, sagte er und warf sich seine Tasche um. Äh-
hh, ganz sicher nicht!
»Das schaffe ich schon alleine, danke. Und außerdem muss ich noch
meine Sachen holen«, erwiderte ich und wollte mich schon in Bewegung
setzen, doch da hielt er mir meine Handtasche vor die Nase.
»Alles schon erledigt.« Empört nahm ich sie ihm aus der Hand.
»Bist du etwa in unsere Umkleidekabine gegangen?« Er lachte.
»Quatsch. Ich habe mich umgezogen und Nancy gebeten, mir deine
Sachen zu geben«, erklärte er gutgelaunt und hielt mir meine Straßen-
kleidung mitsamt BH hin. Puterrot riss ich sie ihm aus der Hand und
stopfte sie in meine Tasche. Nancy war tot, aber so was von! Mehr um von
meinen roten Wangen abzulenken, fragte ich: »Muss ich mir Sorgen
machen, dass du etwas aus meiner Handtasche entwendet hast?« Da hob
er lachend die Hände.
»Keine Sorge, ich habe sie nicht angerührt.«
»Hm«, machte ich nur, denn ich wurde zunehmend verwirrter. Einer-
seits wollte ich so schnell wie möglich von diesem Kerl weg, denn seine
gespielte Freundlichkeit war mir nicht geheuer, andererseits konnte ich
mich gar nicht satt genug an ihm sehen und immer wenn er lächelte, dro-
hte ich ganz unbewusst mit einzustimmen, dabei sollte ich mich lieber vor
ihm hüten. Doch diese Gefühlsungereimtheit machte mich verrückt. Als
hätte man mich an zwei Stränge gebunden, die mich jeweils in eine an-
dere Richtung zogen – einer von ihm weg und der andere zu ihm hin.
»Können wir dann?«, fragte er, als ich meine Tasche geschultert hatte
und deutete zum Ausgang.
»Äh, ich glaube nicht, dass die Befreiung für uns beide gilt«, sagte ich
30/117

und wedelte mit dem Zettel, bevor ich ihn in meiner Tasche verschwinden
ließ.
»Du musst also leider hier bleiben.«
»Müsste ich … wenn wir heute nicht sowieso nur zwei Blöcke gehabt
hätten«, sagte er gutgelaunt.
»Und das soll ich dir glauben?«, fragte ich und steuerte den Ausgang
an. Er hielt mühelos mit mir Schritt.
»Du kannst dich gerne selbst davon überzeugen«, sagte er, nahm ein-
en Block aus seiner Tasche und zeigte mir einen gezeichneten Stunden-
plan. Ich lachte.
»Den kannst du dir auch gerade ausgedacht haben, als ich im Sanität-
sraum war.« »Und warum sollte ich mir die Mühe machen? Ist mir doch
egal, ob du mir glaubst.« Ich schüttelte kommentarlos den Kopf. Als wir
das Schulgebäude verlassen hatten, sagte er, hier entlang und dirigierte
mich zu seinem Wagen, wobei ich mich mit jedem weiteren Schritt fragte,
warum ich ihm überhaupt folgte? Ich sollte lieber umkehren und alleine
nach Hause fahren. Aber verdammt, irgendwie war es auch aufregend, bei
ihm mitzufahren. Mit Tobias, dem unnahbaren Jungen aus meiner
Schule. Als wir sein Auto erreichten, staunte ich nicht schlecht. Ich kan-
nte mich mit Automarken zwar nicht aus, hatte das silberne Modell aber
schon oft gesehen und wusste, dass es teuer war. Wie konnte sich ein
Abiturient so etwas leisten? Sicher hatte er wohlhabende Eltern.
»Wer sagt mir, dass du mich nicht nur nach Hause fährst, um mir
nächstes Mal nachts aufzulauern?«, fragte ich, als wir eingestiegen waren.
Er drehte den Kopf zu mir und sah mich stirnrunzelnd an.
»Irgendwie spricht es nicht gerade für unsere Gesellschaft, dass man
eine Frau nicht mal mehr nach Hause fahren darf, ohne als Perverser
abgestempelt zu werden, findest du nicht?« Er startete den Motor und ich
schnallte mich an.
»Naja, ich wundere mich nur, warum du so freundlich zu mir bist. Du
weißt doch längst, dass ich es war, die dich auf dem Weihnachtsmarkt
angefallen hat und jetzt spricht auch noch die ganze Schule darüber«,
sagte ich. Seine Mundwinkel zuckten.
»Angefallen, so kann man es auch sagen.« Als ich nicht auf seinen
31/117

unbeschwerten Ton einging, fügte er hinzu: »Um ehrlich zu sein, wollte
ich mich auch an dir rächen und dir den Sportunterricht gründlich ver-
miesen, aber nachdem ich dich umgehauen habe und ich betone noch ein-
mal, dass das keine Absicht war, wollte ich es nicht mehr.«
»Ach«, sagte ich skeptisch.
»Und warum nicht?«
»Weil du mir leid getan hast … und weil du hübsch bist«, sagte er au-
genzwinkernd. Ich verschluckte mich an meiner eigenen Spucke.
»Bitte was? Und wenn ich nicht hübsch gewesen wäre? Hättest du
mich dann einfach liegen lassen?«
»Natürlich nicht … aber ich hätte dich nicht nach Hause gefahren«,
erklärte er grinsend. Kopfschüttelnd sah ich aus dem Fenster und ver-
suchte das Schmunzeln zu unterdrücken, das sich auf meine Lippen
stehlen wollte. Die Fahrt war gar nicht so peinlich wie anfangs befürchtet,
denn dadurch, dass ich ihn dirigieren musste, hatten wir so gut wie im-
mer etwas zu reden. Irgendwann fragte ich ihn: »Was hast du auf dem
Weihnachtsmarkt gemacht? Ist das eine Art Nebenjob, oder …?«
»Nein, ich arbeite ehrenamtlich dort«, antwortete er, was ich sehr
bewunderte.
»Wow, das ist … toll. Wie kamst du dazu?« Er zögerte einen Tick zu
lange, um es noch als normal durchgehen zu lassen und sagte dann: »Ich
arbeite eben gern mit Kindern zusammen.« Naja, ging mich ja auch ei-
gentlich nichts an, sagte ich mir schulterzuckend. Also beließ ich es dabei
und beschränkte mich darauf, ihm die Richtung zu weisen.
32/117

Drei
Als wir zwanzig Minuten später in meine Straße einfuhren, sah ich das
Auto meiner Mutter vor unserer Tür stehen.
»Wo soll ich halten?«, fragte Tobias und wurde langsamer. Ich
deutete auf die beige Doppelhaushälfte vor uns.
»Hinter dem roten Jeep wäre perfekt.« Also hielt er an der betref-
fenden Stelle und als ich ausgestiegen war und meine Tasche vom Rücks-
itz genommen hatte, beugte ich mich über das heruntergekurbelte Fen-
ster und sagte: »Danke fürs Mitnehmen.« Er schmunzelte.
»Kein Problem, aber meine Jacke hätte ich schon gern wieder.« Hä?
Ich sah an mir herab und da bemerkte ich erst, dass ich die ganze Zeit
über seine Jacke getragen hatte.
»Oh, entschuldige«, murmelte ich und schälte mich peinlich berührt
heraus, als meine Mutter auf uns zukam. Oh nein, auch das noch!, dachte
ich und beeilte mich, um ihm die Jacke durch das Fenster zu reichen. Und
jetzt wäre es ganz nett, wenn du losfährst … sofort!, dachte ich, doch da
war sie schon bei uns. Sie hatte zwei große Einkaufstüten in der Hand
und war wohl gerade aus dem Auto gestiegen und auch wenn ich meine
Mutter über alles liebte, aber wenn es um Jungs ging, konnte sie verdam-
mt peinlich sein.
»Emily, Schatz, wen hast du mir denn da nettes mitgebracht?«, fragte
sie, blieb vor mir stehen und stellte die Tüten ab.
Ȁh, einen Freund, der so nett war, mich nach Hause zu bringen.
Aber er muss auch gleich wieder …«
»Freund?«, sagte sie begeistert und lugte an mir vorbei, um ihn in
Augenschein zu nehmen.
»Dann hast du es also doch endlich geschafft, jemanden kennen-
zulernen?«, fragte sie und schob mich beiseite, um ihm die Hand zu
reichen.
»Sehr erfreut, dich kennenzulernen. Du musst wissen, dass unsere
Emily noch nie einen Freund hatte, deshalb …«

»Oh Gott, Mama! Könntest du dich bitte zurückhalten?«, rief ich
peinlich berührt und starrte sie entsetzt an. Tobias lachte in sich hinein.
»Aber das braucht dir doch nicht peinlich sein. Und was kann ich
dafür, dass du dir so viel Zeit mit einem Freund lässt. Da muss man ja
mal nachhaken!«, sagte sie grinsend und sich der Tragweite ihrer Worte
offenbar gar nicht bewusst. Warum hing sie mir nicht gleich ein Schild
mit der Aufschrift Jungfrau um den Hals? Tobias versuchte es zu
verkneifen, doch aller Mühe zum Trotz stahl sich ein schelmisches
Grinsen auf sein Gesicht, als er sagte: »Interessant, ich bin also dein er-
ster, ja?« Lässig saß er in seinem Wagen und fuhr sich mit den Fingern
über die Lippen, wobei sein Blick absolut betörend war.
»Nein!«, schnauzte ich ihn an, während meine Mutter gleichzeitig be-
jahte. Ich sah sie fassungslos an und warf die Hände in die Luft.
»Okay, das höre ich mir nicht länger mit an. Vielen Dank fürs Fahren.
Wir sehen uns bestimmt mal«, sagte ich zu Tobias und flüchtete ins Haus,
wobei ich ihre nächsten Worte hartnäckig ausblendete. Ich wollte gar
nicht hören, was sie sonst noch für Peinlichkeiten raushaute und da ich
Tobias sowieso nie wieder sprechen würde, brauchte ich es auch gar nicht
zu hören. Schon traurig, früher war sie diejenige gewesen, die sich für
ihre Mutter geschämt hatte, doch mittlerweile hatte sie sich ganz gut in
deren Rolle eingefunden. Ich würde doch nicht auch so werden, oder? Ich
öffnete die Tür und drängelte Milow zurück, der uns schon gehört hatte
und nachsehen wollte, mit wem wir uns da unterhielten.
»Nein, da draußen gibt es nichts zu sehen«, sagte ich, kraulte ihn hin-
term Ohr und zog dann die Schuhe aus. Danach lief ich direkt ins Bad, um
mir die Hände zu waschen und schließlich in mein Zimmer hinauf, das in
der zweiten Etage lag. Gott, manchmal konnte ich diese Frau nur schüt-
teln! Aber es half ja alles nichts. Ich würde mir jetzt erst einmal einen Tee
machen und ein heißes Bad nehmen – vielleicht würden dann ja auch
endlich diese leidigen Kopfschmerzen verschwinden. Ich öffnete meinen
Zopf, zerwuschelte die Haare mit den Händen, damit sie wieder in ihre
Ursprungsform zurückfielen und schlüpfte aus meinen Sportsachen in be-
queme Alltagskleidung. Als ich die Wohnungstür zufallen hörte, lief ich
mit den Worten hinunter: »Ehrlich Mama, sowas kannst du dir beim
34/117

nächsten Mal sparen! Du hast mich total …« Ich blieb schlagartig stehen,
als ich Tobias in unserem Flur stehen und sich die Schuhe ausziehen sah.
»Deine Mutter war so nett, mich auf einen Kaffee einzuladen«, sagte
er, erheitert über meinen Gesichtsausdruck und deutete auf die
braunhaarige Frau, die gutgelaunt die Einkaufstüten in die Küche bra-
chte. Das würde sie mir büßen! Und was Tobias anging, der wollte mich
wohl doch für die Weihnachtsmarktgeschichte schikanieren. Milow kam
schwanzwedeln auf ihn zu, schnupperte an seiner Hand und ließ sich
dann kraulen. Ich lief weiter die Treppe hinunter, bot ihm widerwillig ein-
en Platz im Wohnzimmer an und folgte meiner Mutter dann in die Küche,
um mich dicht neben sie zu stellen.
»Was soll das? Warum lädst du ihn ein?«, raunte ich ihr zu, während
ich ihr scheinheilig beim Auspacken half. Sie sah mich ehrlich empört an.
»Na hör mal, es ist schon schlimm genug, dass du mir deinen Freund
nicht vorstellst und dann willst du noch, dass ich ihn …«
»Er ist aber nicht mein Freund!«, zischte ich und stellte den
Orangensaft in den Kühlschrank.
»Genau genommen kenne ich ihn …«
»Schon seit sieben Jahren«, beendete Tobias meinen Satz. Überhaupt
nicht, hatte ich eigentlich sagen wollen, doch stattdessen fuhr ich ers-
chrocken herum und sah ihn lässig am Türrahmen stehen. Interessant,
dass er wusste, wie lange wir schon auf dieselbe Oberschule gegangen
sind, dachte ich verwundert.
»Kann ich helfen?«, fragte er und trat ungebeten herein. Meine Mut-
ter wirkte entzückt.
»Seit sieben Jahren und du hast ihn mir nicht einmal vorgestellt?«,
fragte sie vorwurfsvoll. Sie bedeutete ihm, sich an den Küchentisch zu set-
zen und machte sich dann weiter ans Auspacken.
»Das liegt daran, dass wir nicht in dieselbe Klasse gegangen sind und
außerdem haben wir so gut wie nie ein Wort gewechselt. Außer einmal vi-
elleicht, als wir zusammengestoßen sind und er …« Ich begriff, dass ich
ihm damit zeigte, dass ich mich ebenfalls an unsere Oberstufenzeit erin-
nerte und klappte den Mund zu. Verstohlen warf ich ihm einen Blick zu,
den er jedoch gelassen erwiderte. Ich hatte keine Ahnung, was hinter
35/117

seiner Stirn vor sich ging und wenn er jetzt dachte, dass ich eines seiner
Groupies war, das jedes unserer Gespräche in einem Tagebuch festhielt,
so ließ er es sich nicht anmerken. Ich war natürlich kein Groupie! Aber
das war das einzige Mal, dass wir miteinander gesprochen hatten und ich
besaß nun mal ein ausgezeichnetes Gedächtnis, wenn es um Menschen
ging.
»Ich hoffe, du hast Hunger mitgebracht?«, fragte meine Mutter,
nachdem der Einkauf verstaut war und warf die Kaffeemaschine an.
»Großen sogar, vor allem nach dem Sport. Wenn ich Ihre Tochter
nicht eben fast …« Er verstummte, als ich wild mit den Händen rum-
fuchtelte, um ihm das Wort abzuschneiden. Auf keinen Fall sollten meine
Eltern davon wissen. Sie würden mich zum nächsten Arzt schleifen und
tagelang unter Quarantäne setzen, so überfürsorglich waren sie. Ich
glaube, ihnen waren die letzten drei Jahre entfallen, dass ich volljährig
war – oder sie hatten es einfach ignoriert.
»Ja?«, hakte sie nach, als er nicht weiterredete und drehte sich zu
ihm um. Er sah zu mir.
»Er meint, er hätte schon längst gegessen, wenn er mich nicht ge-
fahren hätte«, warf ich schnell ein.
»Na dann sei froh, dass du es getan hast, denn andernfalls wäre dir
mein berühmter Schokokuchen entgangen«, sagte sie lächelnd und dre-
hte sich wieder um. Als er mich stirnrunzelnd ansah, hob ich nur die
Schultern und schnappte mir eine Weintraube aus dem Obstkorb. Was
denn? Nicht jeder erzählte seinen Eltern gerne von seinen Wehwehchen
und mir war ja nichts Ernstes passiert, also!
»Wie hättest du deinen Kaffee gerne? Schwarz oder mit Milch?«,
fragte meine Mutter, als wir den Tisch gedeckt hatten. Eigentlich half ich
ihr nur dabei, weil ich etwas zu tun haben und mich nicht mit Tobias un-
terhalten wollte. Was sollte ich auch großartig mit ihm quatschen? Wir
kannten uns überhaupt nicht.
»Mit viel Milch bitte«, antwortete er und das ohne sich in irgendeiner
Form unbehaglich zu fühlen. Ich meine, er saß in einer fremden
Wohnung, bei praktisch fremden Leuten und strahlte eine Gelassenheit
aus, als wären wir schon jahrelang befreundet. Wie ging das? Ich hätte
36/117

unbehaglich in der Ecke gesessen und kein Wörtchen herausgebracht,
wenn es anders herum gewesen wäre. Nicht, dass es jemals dazu kommen
würde, aber sein Selbstbewusstsein war doch schon erstaunlich. Anderer-
seits war er ja auch der Star der Schule und das schon immer gewesen. Ir-
gendwann brauchte man sich wohl einfach keine Gedanken mehr über
das Blamieren machen, denn irgendwann war man wie er.
»Emily, Schatz, gießt du unserem Gast bitte Milch ein?«, bat meine
Mutter und wickelte den Kuchen aus der Folie. Wir hatten gestern zusam-
men gebacken und unsere Kuchen in Frischhaltefolie gepackt, damit sie
noch saftig sind, wenn wir sie heute essen, nur leider war ich nicht so eine
begnadete Köchin wie meine Mutter und auch mit dem Backen tat ich
mich schwer. Und genauso sah mein Kuchen auch aus, als sie ihn aus der
Folie wickelte und auf den Tisch stellte: Eingefallen und unappetitlich.
Komisch, dabei hatte ich mich doch eins zu eins an die Anleitung
gehalten.
»Äh, vielleicht sollten wir nur deinen Kuchen essen«, schlug ich vor
und wollte meinen wieder vom Tisch nehmen, doch da fragte Tobias: »Du
hast ihn gemacht?« Als ich nickte, sagte er:
»Dann nehme ich gerne ein Stück.« Ich sah ihn zweifelnd an. »Bist du
sicher? Es sind schon Menschen gestorben, die von meinen Kuchen
probiert haben«, sagte ich, in einem letzten verzweifelten Versuch, ihn
davon abzuhalten. Doch er lachte nur.
»Ich habe einen starken Magen, ich denke, ich werde es überleben.«
Also schnitt meine Mutter ihm ein Stück ab und legte es auf seinen Teller.
Oh Gott, das sollte er lieber nicht essen!, dachte ich, während sich meine
Mutter ihren eigenen Kuchen auftat. Sie hatte es schon längst aufgegeben,
von meinen missglückten Backversuchen zu kosten, aber ich wollte ein-
fach nicht aufgeben. Irgendwann würde ich einen Kuchen hinbekommen,
der allen schmeckte! Genauso wie ich irgendwann … so in hundert Jahren
wieder mit Sport anfangen würde. Als jeder ein Stück auf dem Teller hatte
und der Kaffee eingeschenkt war, wünschten wir uns einen guten Appetit
und stürzten uns auf das Gebäck. Ich wollte es eigentlich nicht, doch als
sich Tobias ein Stück in den Mund schob, musste ich ihn dabei beobacht-
en. Leider fiel seine Reaktion genauso aus, wie es auch bei meinen
37/117

anderen Freunden der Fall gewesen war. Er zögerte, schluckte und warf
mir ein künstliches Lächeln zu.
»Schmeckt doch ganz … gut«, log er, doch ich zog nur eine Grimasse
und kostete selbst von meiner Kreation. Nun, wenn man von dem
Muskatnuss mal absah, das leider viel zu kräftig und im Überfluss
vorhanden war, dann schmeckte der Kuchen wirklich nicht so schlecht.
Doch es war nichts im Vergleich zu dem Schokokuchen meiner Mutter,
der einem auf der Zunge zerging wie warme Butter. Ich musste Tobias
zugutehalten, dass er das Kuchenstück wohlerzogen aufaß, doch als er
schließlich vom Schokokuchen kostete, leuchteten seine Augen geradezu
auf. Tja, gegen die magischen Hände meiner Mutter kam eben niemand
an.
»Wow, das ist … wirklich gut«, schwärmte Tobi und ließ sich ein
zweites Stück servieren. Er beließ es aber nicht dabei, sondern aß am
Ende sogar ein drittes Stück. Okay? Wie konnte man nur so viel Süßes es-
sen und dabei eine so gute Figur machen?, fragte ich mich neidisch.
Wenn ich einmal über die Stränge schlug, brachte ich am nächsten Tag
gleich ein Kilo mehr auf die Waage – das war doch nicht fair! Anderer-
seits machte ich auch nicht sonderlich viel Sport. Ich ging ab und an mit
Milow im Park joggen oder Fahrrad fahren, aber das war es auch schon
und mit ab und an war höchstens einmal in der Woche gemeint. Sport
konnte man das also wirklich nicht nennen und wenn Tobias regelmäßig
Sport machte, dann war es kein Wunder, dass er so viel essen konnte. Ich
war mir sogar sicher, dass er das erste Stück Kuchen schon wieder zur
Hälfte verbrannt hatte!
Mein Blick ging unwillkürlich zu dem dunkelblauen Rollkragen-
pullover, der sich über seinen strammen Körper spannte und ich fragte
mich, wie sich meine Hände auf seinem Bauch anfühlen würden. Ich be-
merkte seinen Blick und riss die Augen sofort hoch, um woanders hin-
zuschauen. Oh mein Gott, er hat es gesehen! Er starrt mich an!, dachte
ich mit pochenden Wangen, doch er wandte den Blick wieder ab und
sagte:
»Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich unheimlich gerne das
Rezept haben.« Meine Mutter und ich sahen ihn gleichermaßen erstaunt
38/117

an, doch es war meine Mutter, die fragte: »Du backst also?«
»Unheimlich gerne sogar, vor allem im Winter. Aber an Schokok-
uchen habe ich mich noch nie versucht«, antwortete er. Oh Mann, am
liebsten wäre ich im Erdboden versunken. Nicht nur, dass Tobias meinen
missratenen Kuchen überhaupt gekostet hatte, nein, jetzt konnte er auch
noch selbst backen, was mein Versagen nur noch peinlicher machte. Er
musste meine Grimasse richtig gedeutet haben, denn er sagte:
»Keine Sorge, ich habe am Anfang auch nichts hinbekommen, aber
wenn du willst, kannst du am Sonntag vorbeikommen und mir beim
Plätzchen backen zusehen. Ist wirklich einfach und ich wohne direkt auf
der anderen Seite des Parks. Du hättest es also nicht mal weit.« Ich star-
rte ihn ungläubig an. Ich hätte ihm ja sagen können, dass ich schon seit
Jahren versuchte zu backen und ich mich somit schon lange nicht mehr
am Anfang befand, aber dass er mich gerade zu sich nach Hause einge-
laden hatte, verschlug mir einfach die Sprache. Genauso wie die Tatsache,
dass er ganz in meiner Nähe wohnte.
»Na, das klingt doch wunderbar«, sagte meine Mutter verzückt, doch
ich konnte Tobias nur weiter anstarren. Vollkommen ausgeschlossen,
dass er das ernst gemeint hatte.
»Ist es doch, Emily, oder?«, fragte meine Mutter verwirrt, als ich
nicht antwortete. Ich blinzelte.
»Äh ja, aber … ich glaube nicht, dass ich dieses Jahr noch Zeit dafür
haben werde, du weißt doch, Prüfungen«, sagte ich mit einem entschuldi-
genden Lächeln und schlürfte an meinem Kaffee. Meine Mutter runzelte
die Stirn, wahrscheinlich, weil sie sich fragte, wie man einem so gutausse-
henden jungen Mann nur absagen konnte, doch Tobias sah schon beinahe
herausfordernd amüsiert aus. So, als hätte er gewusst, dass ich ablehnte.
»Also Tobias, was hast du für Zukunftspläne?«, fragte meine Mutter,
um die Stille zu durchbrechen. Er sah mich noch einen Moment an, dann
antwortete er: »Da gibt es einige Dinge, die ich machen möchte. Ich
arbeite in Richtung Eventmanagement hin, aber nach dem Abitur will ich
mich zuallererst ein paar sozialen Projekten widmen.« Meine Mutter sah
neugierig auf.
»Aha, wie kommst du denn darauf?« Auch ich maß ihn mit einem
39/117

interessierten Blick. Er hob die Schultern.
»Ich wohne in der Nähe eines Kinderheims und wurde vor Jahren
mal von einer Mitarbeiterin angesprochen, weil ihnen der Weihnachts-
mann abgesprungen war und sie so schnell keinen Ersatz fanden. Ich
habe zugestimmt und konnte seitdem nicht mehr anders, als mich für
diese Kinder zu arrangieren.« Meine Mutter warf mir einen an-
erkennenden Blick zu, so als hätte ich die richtige Entscheidung getroffen,
ihn mit nach Hause zu bringen und ich musste zugeben, auch ich war
beeindruckt. Für gewöhnlich machten Männer in seinem Alter und vor al-
lem bei seinem Aussehen Party oder beschäftigten sich vorrangig mit
Frauen, doch er half lieber bedürftigen Kindern. Das war wirklich
beeindruckend. Irgendwann kam mein Vater nach Hause und als er mit
seinem Aktenkoffer beladen die Küche betrat, erhob sich meine Mutter
und drückte ihm einen Kuss auf den Mund.
»Schau mal, Liebling, unsere Tochter hat ihren ersten Freund mit
nach Hause gebracht.« Selbst, wenn ich mit einem Zeugnis voller Einsen
gekommen wäre, hätte sie nicht annähernd so stolz geklungen!
»Ich bevorzuge das Wort Klassenkamerad«, korrigierte ich und ließ
mich von ihm in die Arme schließen. Dabei sah ich, wie er Tobias über
meinen Kopf hinweg einem prüfenden Blick unterzog. Vorbildlich hatte
sich auch Tobias erhoben, um meinem Vater die Hand zu reichen und al-
lein diese Geste schien meinem alten Herren zu gefallen, denn sein Blick
wurde augenblicklich freundlicher. Auch ich war von seinen Manieren
beeindruckt, denn Tobias benahm sich wirklich so, als wäre er mein fester
Freund. Einen Moment lang erlaubte ich mir, diese Fantasie zuzulassen
und ihn wirklich als solchen zu sehen, doch als ich spürte, wie sich Sch-
metterlinge in meinem Magen erheben wollten, ließ ich diese Illusion so-
fort wieder platzen. Ich sollte erst gar keine kindischen Fantasien zu-
lassen, denn Tobias interessierte sich für niemanden auf unserer Schule,
also auch mit Sicherheit nicht für mich! Als sich mein Vater zu uns gesetzt
hatte, stellte meine Mutter ihm einen Teller hin und deutete auf die
beiden Kuchen.
»Schoko oder Muskat?«, fragte sie und goss ihm Kaffee ein.
»Ich nehme an, den Schokokuchen hast du gemacht?«, fragte er
40/117

meine Mutter. Als sie nickte, schenkte er mir ein entschuldigendes
Lächeln und ließ sich ein Schokostückchen auftun. Tobias lachte und als
ich ihm einen bösen Blick zuwarf, biss er sich auf die Innenseite der
Wange, um es zu ersticken. Die darauffolgende Stunde verbrachten wir in
einer lustigen Runde, was daran lag, dass mein Vater wieder einmal
amüsante Geschichten von der Arbeit mitbrachte. Er war Anwaltsgehilfe
und kam stets mit den kuriosesten Fällen nach Hause.
»… und dann sagt er doch tatsächlich, er möchte Schadensersatz.
Weil der Sohn seines Kollegen auf sein Quietsche-Entchen getreten ist«,
beendete mein Vater seine Rede. Wir alle lachten, dann sagte meine Mut-
ter: »Das erinnert mich daran, wie Emily immer ihre Zahnbürsten ver-
sucht hat zu zertreten, weil sie sich nicht die …«
»Mama!«, sagte ich schockiert.
»Das muss jetzt nicht sein, oder?«, fragte ich fassungslos und hörte
Tobias leise lachen. Sie hob nur unschuldig die Schultern.
»Was denn, jeder hat peinliche Sachen in seiner Kindheit gemacht«,
verteidigte sie sich und schloss sich Tobias Lachen an. Um mich zu besän-
ftigen, nahm mich mein Vater knuffend in den Arm und ich befreite mich
kichernd. Als mein Blick zufällig zu Tobias ging, bemerkte ich sein
trauriges Lächeln, das nicht ganz seine Augen erreichte. Mein Grinsen
verblasste und ich fragte mich, was ihn betrübte? Ich hätte ihn natürlich
fragen können, doch ich traute mich nicht, und schon gar nicht vor mein-
en Eltern. Außerdem sollte ich mich keinen falschen Illusionen hingeben,
denn nur, weil er mich nach Hause gefahren hatte, hieß das nicht, dass
ich ihm so persönliche Fragen stellen konnte. Überhaupt sollte ich nicht
viel in sein Benehmen hineininterpretieren. Er hatte einfach ein schlecht-
es Gewissen, weil er mich umgehauen hatte und deshalb war er so für-
sorglich. Wenn ich morgen die Schule betrat, würde er mich sicherlich
schon wieder vergessen haben.
Nach einer Stunde Geplauder räumten wir den Küchentisch ab und
ich ging in mein Zimmer hinauf – Tobias folgte mir. Ich wollte ver-
hindern, dass meine Mutter weitere peinliche Geschichten ausgrub und
ich wollte Tobias loswerden, denn seine Anwesenheit machte mich zun-
ehmend nervöser. Um das Gespräch in die entsprechende Richtung zu
41/117

lenken, fragte ich also, kaum dass wir oben waren: »Wie geht es eigent-
lich deinem Auge? Tut es noch weh?« Er schmunzelte.
»Es braucht schon mehr, als eine verwirrte Halbwüchsige, um mich
auszuknocken.« Ich lachte fassungslos.
»Verwirrte Halbwüchsige?« Er hob die Schultern.
»Na hör mal, ich bin fast doppelt so groß wie du. Ein Wunder, dass du
mein Auge überhaut berühren konntest.« Ich lachte, weil er so schamlos
übertrieb, denn er war nicht mehr als einen Kopf größer als ich. Mein
Lachen fiel allerdings etwas gezwungen aus, denn er sondierte mein Zim-
mer aufmerksam. Lag alles an der richtigen Stelle? War es aufgeräumt
genug?
»Außerdem nehme ich das Veilchen gerne in Kauf, denn seit das
Video im Internet kursiert, bin ich vor allem bei den Frauen ziemlich be-
liebt«, fügte er augenzwinkernd hinzu. Kein Wunder, dachte ich mir, so
knackig wie er in seinen Unterhosen ausgesehen hatte. Laut sagte ich:
»Nicht, dass du von ihnen nicht schon genug Aufmerksamkeit bekommen
würdest.« Als er sich stirnrunzelnd zu mir drehte, hätte ich mir beinahe
an den Mund gefasst. Hatte ich das gerade wirklich gesagt? Als er meinen
Gesichtsausdruck sah, schenkte er mir ein schiefes Grinsen.
»Interessant. Und woher willst du das so genau wissen?« Ich lief pu-
terrot an.
»Naja …, man munkelt eben und außerdem ist es ja nicht zu überse-
hen, dass …«
»Ja?«, hakte er nach, als ich nicht weitersprach. Oh Mann, den Satz
konnte ich jetzt unmöglich so stehen lassen.
»Dass du … sehr begehrt bist«, brachte ich schließlich hervor. Es war
raus. So! Außerdem musste das ja nicht bedeuten, dass ich ihn ebenfalls
begehrte.
»Hm«, war alles, was er dazu sagte. Hm? Mehr nicht? Jeder andere
Kerl hätte sich grinsend den Nacken gerieben oder einen dummen Spruch
abgelassen, doch er ließ es einfach so stehen. Oh, wie gerne ich doch ein-
en Penny für seine Gedanken gegeben hätte.
»Deine Eltern sind wirklich sympathisch«, wechselte er das Thema.
»Sitzt ihr oft zusammen, um stundenlang zu reden?«, fragte er. Ich
42/117

konnte es mir nicht erklären, aber irgendwie klang die Frage traurig. Er
hatte sich auf meinem Bürostuhl niedergelassen und sah sich interessiert
um.
»Fast jeden Abend. Ist manchmal schon beinahe lästig«, sagte ich,
woraufhin er gedankenversunken nickte.
»Du liest sehr viel«, stellte er fest, als sein Blick auf mein gewaltiges
Bücherregal fiel. »Äh ja, aber hauptsächlich nur … Schnulzen«, sagte ich
und beobachtete mit Unbehagen, wie er sich genau der Ecke näherte, die
absolut nicht für ihn bestimmt war. Nach Shades of Grey schossen neue
Erotikromane ja praktisch aus dem Boden und ich musste eingestehen,
dass ich dem Genre seitdem haushoch verfallen war – was einzig und al-
lein Nancy, dieser Perversen zu verdanken war, denn die hatte mich erst
darauf gebracht. Nun hatte ich im Bücherregal eigens eine Ecke für die
Sparte eingerichtet und genau auf diese steuerte er nun zu. Keine Ah-
nung, warum mir das unangenehm war, aber da er über mein nicht
vorhandenes Sexualleben Bescheid wusste, sollte er nicht denken, dass
ich meine einzige Befriedigung in solchen Büchern fand. Was ja irgendwo
auch so war, aber das ging ihn ja nichts an! Er hatte die Hand schon aus-
gestreckt, als ich ihm einen anderen Roman in die Hand drückte.
»Das hier zum Beispiel, ist einer meiner Lieblingsromane«, sagte ich
mit einem nervösen Lächeln. Stirnrunzelnd sah er das Cover an.
»Mein Freund, der Vampir?« Es war das erstbeste Buch, das ich
gegriffen hatte, doch es war immer noch besser, als ein Erotikbuch.
»Äh ja, das ist wirklich … gut«, log ich, obwohl es nicht unbedingt
mein bevorzugtes Thema war. Ich hatte es eigentlich nur überflogen,
denn es war ein Geschenk von Maren, der neunzehnjährigen Tochter der
Arbeitskollegin meiner Mutter gewesen.
»Du stehst also auf Vampire«, sagte er und gab es mir wieder zurück.
»Was, wenn ich dir sage, dass ich einer bin?«, fragte er und starrte
gespielt gierig auf mich herab.
»Ähh … das glaube ich weniger«, sagte ich und nutzte den Vorwand,
um das Buch wegzustellen und um etwas Abstand zwischen uns zu
bringen.
»Warum?«, fragte er und legte den Kopf schief.
43/117
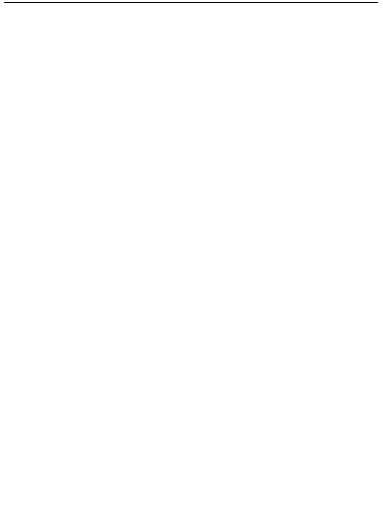
»Weil draußen die Sonne scheint und du Schokokuchen gegessen
hast, anstatt an meinem Hals zu nuckeln und das ist nicht gerade vam-
pirhaft.« Er schenkte mir ein verbotenes Lächeln.
»Naja, jetzt sind wir alleine, vielleicht will ich ja doch an deinem Hals
nuckeln.« Okay? Flirtete er etwa gerade mit mir? Bevor er noch etwas
hinzufügen konnte, sagte ich: »Ich muss noch lernen, hab morgen eine
Präsentation, deshalb muss ich dich leider rausschmeißen.« Er lachte,
wobei ich nicht sagen konnte, weshalb und nickte dann.
»Also, war schön, meine Peinigerin einmal persönlich kennen-
zulernen.« Wir liefen die Treppe hinunter und als er sich von meinen El-
tern verabschiedet hatte, fragte ich:
»Muss ich mir jetzt keine Gedanken mehr machen, dass du mir in der
Schule auflauerst?« Er tat, als müsse er darüber nachdenken und sagte
dann: »Der Schokokuchen deiner Mutter hat mich fürs erste besänftigt,
also überlege ich’s mir noch.« Nachdem ich die Tür geschlossen hatte,
hörte ich kurz darauf Reifen quietschen, dann lief ich in mein Zimmer
hinauf und ließ mich aufs Bett fallen. Heiliger Strohsack! Das werden mir
meine Mädels niemals glauben.
***
Als wir uns am nächsten Tag am Bahnhof trafen, wurde ich natürlich so-
fort belagert.
»Was hat er erzählt, als er dich nach Hause gefahren hat? Wie war
es?«, wollte Nancy wissen, doch ich hob nur die Schultern.
»Wir haben nicht viel geredet während der Fahrt, immerhin war ich
mit Navigieren beschäftigt.«
»Ach komm, über irgendetwas müsst ihr doch geredet haben«, sagte
Steffi ungläubig. »Naja, er hat sich noch mal entschuldigt und mir ver-
sichert, dass es keine Absicht war. Und als Zeichen seiner Buße hat er
mich gefahren … und ist auf einen Kaffee hereingekommen«, fügte ich
beiläufig hinzu, wissend, dass sie durchdrehen würden. Nancy und die
anderen waren einen Moment sprachlos.
»Moment mal, er war bei dir zuhause?«, fragte sie ungläubig und sah
44/117

genauso verblüfft aus wie die anderen. Ich nickte.
»Ja und? Ist doch nichts dabei.« Da lachte Nancy und sagte: »Nichts
dabei? Sorry, aber ich kann mir nur schwer vorstellen, wie du
Mauerblümchen den heißesten Typen auf einen Kaffee eingeladen hast.«
»Ich bin kein Mauerblümchen!«, sagte ich und schlug ihr auf die
Schulter.
»Und das war auch nicht meine Idee, sondern die meiner Mutter. Ei-
gentlich wollte ich ihn so schnell wie möglich loswerden, aber diese Ver-
rückte hat ihn förmlich ins Haus gezogen«, erläuterte ich.
»Und dann? Was habt ihr gemacht?«, wollte Laura wissen und drei
neugierige Augenpaare waren auf mich gerichtet. Also gab ich ihnen den
gestrigen Tag detailliert wieder, wobei ich bewusst ausließ, dass er mich
zum Plätzchenbacken eingeladen hatte. Ich war nämlich nicht erpicht da-
rauf, das Gespräch weiter auszudehnen.
»Sein schlechtes Gewissen muss aber ziemlich groß gewesen sein,
wenn er danach noch zwei Stunden geblieben ist«, meinte Laura
augenwackelnd.
»Ach kommt, ihr übertreibt doch.« Wie konnte man denn nur so ein-
en Aufruhr wegen eines einzelnen Typen machen? Ja, er sah gut aus und
ja, er war ziemlich begehrt, aber das bedeutete doch nicht, dass ich ihm
gleich hinterher sabbere!
»Irgendwie ist es total scharf, dass er sich sozial engagiert, findet ihr
nicht?«, warf Steffi verträumt ein.
»Ich meine, er ist so … reif. Ganz anders als die anderen hirnlosen
Jungs auf unserer Schule.« Da musste ich ihr ausnahmsweise recht
geben, denn es ließ ihn tatsächlich in einem guten Licht erstrahlen.
»Sieh es ein, Emily, der Typ steht auf dich«, meinte Nancy, während
sie mir auf die Schulter klopfte.
»Tut er nicht«, sagte ich.
»Also ich habe zumindest noch nie gehört, dass er bei irgendeiner
Frau zu Hause war und ich gehe schon drei Jahre in seine Klasse«, fügte
Laura nachdenklich hinzu.
»Er haut Frauen ja auch nicht regelmäßig Bälle an den Kopf, oder?«,
gab ich stichelnd zurück, als wir vor den Toren unserer Schule ankamen.
45/117

»Und jetzt wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr das Thema lassen
würdet. Es gibt noch wichtigere Dinge im Leben als ...«
»Hi Emily, so schnell sieht man sich wieder«, erklang Tobias’ Stimme
hinter mir. Ich fuhr erschrocken herum und starrte in eisblaue Augen.
»Äh hi, tja die Welt ist klein«, sagte ich und setzte ein halbherziges
Lächeln auf. Warum sprach er mich in der Schule an? Konnten wir nicht
einfach so tun, als hätte es den gestrigen Tag nicht gegeben?
»War verdammt ritterlich von dir, sie nach Hause zu bringen«, be-
merkte Nancy und pikte ihm neckisch in die Seite. Ich warf ihr einen erb-
osten Blick zu, denn das Wort ritterlich hörte sich aus ihrem Mund ir-
gendwie schmutzig an, doch sie ignorierte mich und wendete ihre
Aufmerksamkeit voll und ganz auf Tobias. Mit zuckenden Mundwinkeln
sah er zu mir.
»Nun, das war ja auch das Mindeste.« Ähhh ja, können wir dann ge-
hen?, dachte ich mir, als sein Blick mich nicht mehr losließ. Was wollte er
überhaupt hier? Hatte er keine eigenen Freunde?
»Also, was können wir für dich tun, Tobias? Oder willst du Emily
unter vier Augen sprechen?«, fragte Nancy. Schon wieder dieser anzüg-
liche Ton! Dafür würde ich ihr den Hals umdrehen. Er lachte.
»Eigentlich wollte ich euch nur Bescheid geben, dass am Freitag eine
Poolparty stattfindet und ich wurde dazu genötigt, alle Leute einzuladen,
die ich kenne«, sagte er.
»Eine Poolparty bei wem?«, erkundigte sich Nancy.
»Bei Mike. Seine Eltern sind für eine Woche verreist und da will er es
krachen lassen.«
»Mike aus der Oberstufe?«, fragte Nancy und man sah ihre Augen
förmlich aufleuchten. Tobias nickte und fragte: »Seid ihr dabei?«
»Oh, aber auf jeden Fall«, meinte Nancy grinsend und ich musste mir
ein Kopfschütteln verkneifen. Nancy stand auf ältere Jungs und Mike, der
mit seinen 25 Jahren mit der älteste auf unserer Schule war, passte somit
genau in ihr Beuteschema. Ich würde jedenfalls nicht auf diese Party ge-
hen und mich halbnackt mit Schaum einreiben lassen!
»Also … fühlt euch hiermit herzlich eingeladen.« Damit drückte er
uns ein paar Flyer in die Hand, warf sich die Tasche über die Schulter und
46/117

ging ins Gebäude. Wir sahen ihm wortlos hinterher, doch bevor auch nur
jemand das Wort ergreifen konnte, sagte ich: »Lasst es, ich will kein Wort
hören!«
47/117

Vier
Natürlich hatten sie mich ignoriert und mir Löcher in den Bauch gefragt.
Zum Beispiel wie es denn sein konnte, dass er jetzt sogar mit mir sprach,
doch ich hatte ihnen immer wieder dieselbe Antwort gegeben. Er war nur
höflich und er hatte mich ja nicht persönlich zur Party eingeladen, son-
dern unsere ganze Truppe. Sie versuchten etwas in ihm zu sehen, das er
nicht war, doch ich machte mir da, als Realistin, keine falschen Hoffnun-
gen. Ich wusste, dass er kein Interesse an mir hatte und warum auch? Ich
hatte ihn aufs Übelste blamiert, auch wenn er es eigentlich ganz gut
weggesteckt hatte. Wie sollte er sich also für so jemanden wie mich in-
teressieren? Und zum Plätzchenbacken hatte er mich nur eingeladen, um
mich aufzuziehen – das hatte ich an seinem Blick gesehen. Aber wenn ich
mir all der Dinge bewusst war, warum musste ich dann immerzu an seine
eisblauen Augen denken?
Ich hatte das Glück, noch nie von einem Mann betrogen oder belogen
worden zu sein – was dem einfachen Umstand entsprach, dass ich einfach
noch nie einen Freund gehabt habe. Aber ich kannte die leidigen Themen
einer Beziehung von meinen Freundinnen und da ich die Mädels schon
seit mehr als fünf Jahren kannte, hatte ich so ziemlich jede Beziehungs-
phase mitgemacht. Von geplatzten Kondomen und daraus resultierender
Abtreibung, von beiderseitigem Betrug, hoffnungslos naiven Denkweisen,
was die Männerwelt betraf bis hin zu sexueller Freizügigkeit und eifer-
süchtigen Aktionen. Ehrlich, ich war eine Beziehungsexpertin, ohne selbst
jemals eine geführt zu haben und wenn ich daran dachte, dass ich all
diese Dinge selbst durchmachen sollte, blieb ich doch lieber Single!
Außerdem gefiel mir die Rolle der Seelenklempnerin ganz gut. Es war
nämlich viel einfacher, vernünftige Ratschläge zu geben, wenn man selbst
nicht betroffen war.
An diesem Abend beschloss ich, Fahrrad zu fahren, denn ich musste
den Kopf frei bekommen und nichts half da besser als frische Luft und
Bewegung. Ich gab meinen Eltern Bescheid, rief Milow zur Tür und warf

einen Blick auf die Uhr. Halb acht. Ich ging nicht gerne abends in den
Park, denn mit der Dunkelheit kamen zwielichtige Gestalten aus den Ge-
büschen gekrochen, die fragwürdige Substanzen verkauften. Aber heute
hatte ich einfach das Bedürfnis, in den Park zu gehen und wenn ich mich
beeilte, war ich noch vor der Dunkelheit zurück. Außerdem war ja Milow
bei mir, mein kleiner Kampfhund. Ich zog mir einen Mantel über, setzte
Ohrenschützer gegen die stechende Kälte auf und holte mein Fahrrad aus
der Garage. Dann setzte ich Milow in das Fahrradkörbchen und fuhr das
kurze Stück zum Park. Mit dem Rad lag er nur fünf Minuten entfernt und
als wir dort ankamen, ließ ich Milow runter und schon flitzte er los.
Lächelnd kam ich seinem Beispiel nach, positionierte
meine
Ohrenschützer und setzte mich in Bewegung. Ich ließ Milow den Weg
bestimmen, fuhr ihm einfach hinterher und genoss den Wind auf meinem
Gesicht. Es war immer so befreiend, Fahrrad zu fahren und man fühlte
sich gleich viel gesünder, wenn man den Duft der Bäume und des Wald-
bodens einatmete.
Irgendwann fiel mir auf, dass ich Milow schon eine Weile nicht mehr
gesehen hatte und hielt an. Es dämmerte bereits, so dass ich schon keine
uneingeschränkte Sicht mehr hatte und ich sah mich suchend um.
»Milow?«, rief ich und legte mir die Ohrenschützer um den Hals,
damit ich besser hören konnte. Es war nichts neues, dass er hin und
wieder im Gebüsch verschwand, er ging eben gern seinen eigenen Weg,
aber da es zunehmend dunkler wurde, machte ich mir Sorgen, ihn zu ver-
lieren. Dann hörte ich etwas neben mir rascheln und ein kleiner gefleckter
Jack Russell trat aus dem Gebüsch. Erleichtert atmete ich aus und setzte
meinen Weg fort.
»Eine Runde noch, dann machen wir uns auf den Rückweg«, sagte
ich zu ihm und trat ins Pedal. Ich fuhr nicht auf Höchstgeschwindigkeit,
dafür war es schon viel zu düster, doch ich war trotzdem nicht langsam
unterwegs, als plötzlich eine Gestalt hinter dem Baum auftauchte und mir
direkt vors Fahrrad lief. Ich kreischte auf, denn in meinem Kopf spielte
sich bereits eine Szene ab, in der ich gepackt und ins Gebüsch gezerrt
wurde und wich ruckartig zur Seite aus. Doch zu schnell, denn dabei ver-
lor ich das Gleichgewicht und knallte unsanft auf den harten Pflasterweg.
49/117

Ich schaffte es, meinen Arm in letzter Sekunde zu heben und mich
abzustützen, schürfte mir dabei aber die Hand an dem rauen Boden auf.
Stöhnend kam ich zum Liegen und drehte mich mit pochendem Herzen
zu der Person um.
Seiner Größe und Statur nach zu urteilen, handelte es sich um einen
Mann, der seine Kapuze so tief übers Gesicht gezogen hatte, dass man es
kaum erkennen konnte. Als er ins Licht der Straßenlaterne trat und sich
zu mir herunter beugte, vergaß ich das Brennen an meinem Arm, denn
plötzlich durchfuhr mich Angst. Wo war bloß Milow?
»Das glaube ich ja jetzt nicht«, sagte die Kapuzengestalt und ich
zuckte zusammen. Die Stimme kannte ich doch!
»Tobias?«, fragte ich ungläubig und starrte zu ihm auf. Da schlug er
die Kapuze zurück und enthüllte sein engelsgleiches Gesicht.
»Jetzt lauerst du mir also doch auf!«, sagte ich und blieb auf dem
harten Boden sitzen. Ich wusste nicht, ob ich erschrocken oder belustigt
sein sollte. Seine Mundwinkel zuckten, auch wenn er genauso überrascht
zu sein schien wie ich.
»Auch wenn es danach aussieht, aber ich schwöre dir, dass ich nur
joggen wollte«, beteuerte er und streckte mir seine Hand entgegen. Ich
nahm sie und ließ mir hochhelfen, wobei mein linkes Bein schmerzte, weil
ich übel damit aufgekommen war. Sein Gesicht war ernsthaft besorgt, als
er fragte: »Alles in Ordnung?« Ich lauschte in mich hinein, wagte es aber
nicht, meine Hand anzuschauen, denn sie schmerzte so stark, dass sie mit
Sicherheit blutete.
»Ich bin übel mit dem Knie aufgekommen, aber ansonsten geht es«,
versicherte ich. Dann fiel sein Blick auf meine Hand und er reagierte
genauso, wie Nancy es im Sportunterricht getan hatte.
»Oh oh«, murmelte er und kam näher, um es sich anzusehen. Ich dre-
hte den Kopf weg und fragte: »Ist es schlimm?« Er nahm meine Hand
und sagte: »Nein, eigentlich nicht.« Wobei seine Stimme viel zu munter
klang – gekünstelt munter.
»Wie schlimm ist es?«, fragte ich und wollte hinsehen, doch er nahm
meine Hand wieder runter und drehte sie so, dass ich die Innenfläche
nicht sehen konnte.
50/117

»Vielleicht solltest du dir das lieber nicht ansehen«, sagte er, ohne
meine Hand loszulassen. Ich warf ihm einen forschenden Blick zu, denn
diese Berührung hinterließ ein leises Kribbeln auf meiner Haut, doch er
schien ganz und gar darauf konzentriert zu sein, dass ich sie nicht sah.
Dann erinnerte ich mich daran, wie ich mir diese Schürfung überhaupt
zugezogen hatte und wurde mir bewusst, dass ich ganz allein mit ihm war
– in einem dunklen Wald! Gut, Milow war auch irgendwo, aber der hatte
nichts weiter als einen kurzen Blick für mich übrig, bevor er wieder im
Dickicht verschwand. Toll, wie er sich um mich kümmerte, oder?!
»Was hast du hier verloren, Tobias?«, fragte ich deshalb misstrauisch
und machte mich von seiner Hand los.
»Na, ich war joggen, sieht man das nicht?«, antwortete er unschuldig
und deutete auf seine Trainingssachen.
»Aha, und du kamst wohl nur zufällig hinter dem Baum hervorge-
sprungen oder was?«, fragte ich zweifelnd. Er runzelte die Stirn.
»Was kann ich denn dafür, wenn der Baum mitten auf der Strecke
steht? Außerdem warst du diejenige, die hinter dem Baum her-
vorgeschossen kam. Wenn du dein Licht angeschaltet hättest, hätte ich
dich ja noch gesehen, aber so …« Ach, jetzt war es also meine Schuld?
»Ich? Ich bin ordnungsgemäß auf dem Weg gefahren, wie es sich ge-
hört, bis du mich vom Fahrrad geschubst hast.« Er lachte.
»Ich glaube, da verwechselst du was. Ich habe dich nicht geschubst,
du bist von selbst hingefallen. Und hör auf, mich anzusehen, als würde
ich dich jeden Moment ins Gebüsch ziehen, ich bin kein Verbrecher.«
Seine Augen blitzten amüsiert auf, aber er sah auch ein Stück weit belei-
digt aus, so dass ich mich etwas entspannte. Er hatte Recht. Ich sollte auf-
hören, eine Szene zu machen, nur weil ich mich erschrocken hatte und
hätte er mir etwas antun wollen, würde er vorher bestimmt nicht noch ein
Schwätzchen halten.
»Du hast recht, aber eigenartig ist der Zufall schon, oder?«, fragte ich.
Er hob die Schultern.
»Eigentlich nicht, denn ich jogge fast jeden Abend hier entlang.«
»Ach, echt? Ich nämlich auch, naja vielleicht nicht so oft wie du und
meistens auch nur tagsüber«, sagte ich und wollte mein Fahrrad
51/117

aufheben, doch er kam mir zuvor.
»Ich mach das schon«, sagte er und fügte dann hinzu: »Na, da haben
wir es doch. Ich jogge ausschließlich nachts und du am Tag, wir konnten
uns also nie treffen.« Hm, da konnte wirklich was dran sein.
»Warum gehst du nur nachts joggen?«, fragte ich, als wir uns auf dem
Rückweg befanden. Milow hatte sich inzwischen zu uns gesellt und lief
ganz artig neben mir, so als wollte er Tobias beweisen, dass er durchaus
Manieren hatte. Tobias hob die Schultern.
»Abends ist es so ruhig und man kann besser nachdenken. Außerdem
bin ich tagsüber entweder in der Schule oder arbeiten.«
»Wo arbeitest du denn?«, erkundigte ich mich.
»In Mickeys Bar, am Alexanderplatz. Ich bin drei Mal die Woche
dort, wenn du willst, kannst du mal auf einen Drink vorbeikommen,
gratis natürlich«, sagte er augenzwinkernd. Ich schmunzelte.
»Danke, aber ich vertrage keinen Alkohol. Ich kann aber meinen
Mädels Bescheid sagen, die schlagen das Angebot bestimmt nicht aus.«
»Apropos Mädels, du hast mir noch gar nicht gesagt, wie ihr über-
haupt auf die Schnapsidee gekommen seid, mir die Hosen
runterzuziehen«, sprach er mich an. Ich schielte zu ihm hoch und sah,
dass seine Mundwinkel leicht angehoben waren.
»Ach das, tja das war im Grunde nur eine blöde Wette. Ich habe am
Schießstand verloren und sollte dem Weihnachtsmann, dir in dem Fall,
die Hosen runterziehen. Ich dachte, du wärst ein Rentner und hättest
sowieso eine Maske auf, also habe ich mir nichts dabei gedacht.« Wobei,
eigentlich hatte ich in diesem Moment sehr viel gedacht, nämlich, wie leid
mir der Rentner gleich tun würde.
»Tja«, sagte er nur und grinsend und warf mir einen Seitenblick zu.
»Da hast du dich wohl geirrt.«
»Allerdings und ich wollte dir nochmal sagen, wie unglaublich leid
mir das tut, ehrlich. Wenn ich es rückgängig machen könnte …«
»Ach was, ich bin nicht nachtragend und da ich dich jetzt zwei Mal
fast umgebracht hätte, sehe ich es als ausreichende Gerechtigkeit an.« Ich
lachte.
»Na, dann bin ich ja beruhigt!« Wir liefen eine Weile schweigend
52/117

nebeneinander her, was ich eigenartigerweise überhaupt nicht unan-
genehm fand. Tobias strahlte einfach so eine Ruhe aus, dass wir noch bis
nach Hause so hätten weiter machen können. Dann fragte ich jedoch:
»Du hast vorhin gesagt, dass du abends besser nachdenken kannst.
Worüber denkst du denn nach?« Sein Blick schwenkte zu mir.
Ȇber Verschiedenes. Im Moment aber nur, wie ich dich dazu
bekomme, dass du Sonntag zum Plätzchen essen kommst«, sagte er mit
vollkommen ernstem Gesicht. Ich sah stirnrunzelnd zu ihm auf.
»Du nimmst mich auf den Arm, oder?« Da schenkte er mir ein wun-
derbar schiefes Lächeln.
»Nein, ich will wirklich, dass du kommst. Außerdem würdest du der
Menschheit einen großen Gefallen tun, wenn du backen lernst. Ehrlich,
dein Kuchen war ja kaum …« Lachend boxte ich ihm gegen die Schulter.
»Wage es ja nicht, über meinen Kuchen herzuziehen!«, rief ich. Er
lachte ebenfalls. »Okay, war nur ein Scherz. So schlimm war er nicht.«
Dann fragte er: »Warum kommst du her?« Ich hob die Schultern.
»Um mich wenigstens etwas sportlich zu betätigen und um
nachzudenken.«
»Was für ein Zufall. Und worüber denkst du so nach?«
»Über meine miserablen Mathenoten zum Beispiel«, sagte ich. Er sah
mich an.
»Bei welchem Thema hapert es denn?« Er klang ehrlich interessiert.
Da lachte ich laut.
»Um genau zu sein, überall. Ich bin ein hoffnungsloser Fall, was das
betrifft, glaub mir«, gab ich zu und hatte keine Ahnung, warum ich ihm
das überhaupt erzählte.
»Nun, wie es der Zufall will, ist Mathe mein Leistungsfach. Ich könnte
dir also Nachhilfe geben. Sagen wir … Sonntag, bei einem leckeren
Plätzchen?« Ich schnaubte.
»Ach komm, das nehme ich dir nicht ab.«
»Doch wirklich. Ich bin gut in Mathe. Du kannst mich alles fragen
und wenn du Sonntag kommst, verrate ich dir sogar die letzte Zahl von
Pi.« Mein Lächeln kehrte zurück. Dieser Kerl war wirklich amüsant, das
musste man ihm lassen, doch so gerne ich auch zugesagt hätte, ich tat es
53/117

nicht. Wobei ich nicht einmal sagen konnte, warum. Tobias war genau
der Mann, nachdem sich so viele Frauen die Finger lecken. Er war char-
mant, nett, lustig, aber auch frech und verdammt gutaussehend und das
war eine gefährliche Kombination. Nicht, dass ihm ein Bad Boy Image an-
haftete, aber all diese positiven Eigenschaften, die er ausstrahlte: Das hat-
ten die Exfreunde meiner Mädels auch getan, bis sich dann ihr wahrer
Charakter gezeigt hatte.
Und ich wollte keine dieser Frauen sein, die ihren Freund in flagranti
in ihrem eigenen Bett erwischte. Dass Tobias dazu noch so begehrt war,
machte sein plötzliches Interesse an mir nur noch fragwürdiger. Also hielt
ich mich an mein Motto: Wer nicht mit dem Feuer spielt, der kann sich
auch nicht verbrennen.
»So gerne ich zusagen würde, aber ich bin Sontag … mit meinen El-
tern verabredet. Sonntag ist Familientag«, log ich. Vielleicht war es mein
Zögern, doch er sah nicht aus, als würde er mir meine Notlüge abkaufen.
»Schade«, sagte er nur, doch wenn ich gedacht hatte, dass er sich so
einfach abspeisen ließ, dann hatte ich mich gewaltig in ihm geirrt.
Wir waren an meiner Haustür angekommen, als Tobias sie für mich
aufschloss und Milow hineinflitze. Ich rief nach meiner Mutter, die sofort
aus der Küche kam und deutete auf meine Hand. »Kannst du mir Verb-
andszeug holen? Ich habe mich verletzt«, sagte ich und hielt ihr die
Handfläche hin, ohne selbst einen Blick darauf geworfen zu haben.
»Ach du liebe Güte, wie ist das denn passiert?«, fragte sie, nickte To-
bias zu und zog mich ins Bad, um mir die Wunde auszuwaschen. Ich kam
mir vor wie ein Kind, als sie meine Hand unter das laufende Wasser hielt
und war froh, dass Tobias vor der Tür wartete, doch meine Mutter kannte
meine allergische Reaktion auf Blut und tat alles daran, dass ich es nicht
zu Gesicht bekam. Trotzdem war es mir vor anderen Leuten immer pein-
lich, denn es ließ mich schwach erscheinen, obwohl ich das im Grunde
genommen gar nicht war. Nachdem sie es desinfiziert hatte, klebte sie ein
Pflaster drauf und ging dann zu Tobias.
»Was wartest du denn da draußen in der Kälte? Komm rein, Junge!«,
forderte sie ihn auf und zog ihn in die Tür. Dann schien sie erst zu be-
merken, dass er eigentlich gar nicht hier sein sollte und fragte: »Wo
54/117

kommst du eigentlich her?«
»Wir haben uns beim Joggen getroffen und Emilys verletzte Hand ist
meine Schuld. Wir sind ineinander gerannt und dabei ist sie vom Fahrrad
gestürzt.«
»Oh«, machte meine Mutter und unterzog mich einem Scan.
»Ist ansonsten alles okay?«
»Ja, alles bestens«, versicherte ich ihr.
»Nun, möchtest du reinkommen? Ich habe noch etwas Schokok-
uchen?«, versuchte meine Mutter ihn zu locken, doch Tobias winkte ab.
»Nein, ich muss nach Hause, außerdem habe ich selbst noch genü-
gend Gebäck. Eigentlich wollte ich Ihre Tochter als Entschädigung zum
Plätzchenessen einladen, aber leider unternehmen Sie am Sonntag ja
schon etwas zusammen«, erklärte er. Ich warf ihm einen ungläubigen
Blick zu. War das sein Ernst?
»Nein, eigentlich nicht«, sagte meine Mutter und fragte dann an mich
gewandt: »Wir haben doch vorhin noch darüber gesprochen. Dein Vater
und ich sind bei Tante Regina eingeladen und du sagtest, dass du auf
keinen Fall mit willst.« Am liebsten hätte ich Tobias einen tödlichen Blick
zugeworfen, schlug mir dann aber gespielt gegen die Stirn.
»Ach ja richtig, das habe ich ganz vergessen.«
»Super, dann steht unserer Verabredung ja nichts im Weg, oder?«,
fragte er mich. Sein Blick war spöttisch und ganz und gar gewinnend, so
dass der nächste Satz wie Säure in meinem Mund schmeckte.
»Liebend gern!« Na warte, dir werde ich den Sonntag ordentlich
vermiesen, dachte ich mir und lief zur Tür. Ich wartete, bis er sich von
meiner Mutter verabschiedet hatte und stellte mich dann hinter die Tür,
damit er hinaustreten konnte. Kühle Luft wehte von draußen herein.
»Das wird der schlimmste Sonntag, den du je erleben wirst!«, drohte
ich ihm an, wütend, weil er mich praktisch zu der Verabredung gezwun-
gen hatte. Doch er grinste nur schief und das so hinreißend, dass sich
meine böse Miene aufzulösen drohte.
»Ich freue mich ebenfalls, Emily«, sagte er und verschwand lachend
in der Nacht. Ich machte die Tür zu und blieb mit geschlossenen Augen
davor stehen. Verdammt, irgendwie freute ich mich auch darauf!
55/117

Fünf
»Habt ihr schon einen passenden Bikini gefunden?«, fragte Steffi zwei
Tage später, mitten im Unterricht. Der Lehrer hatte uns ein gähnend
langweiliges Lernvideo über den Zellzyklus reingeschoben und war dann
aus dem Raum verschwunden – was etwa eine halbe Stunde her war. De-
mentsprechend konnten wir uns ungezwungen unterhalten.
»Nimm doch einfach denselben vom letzten Jahr«, sagte ich und
schrieb ein paar Fakten mit. Zellzyklus war vielleicht nicht mein liebstes
Thema in Biologie, aber ich würde den Teufel tun und meinen guten Sch-
nitt versauen, nur weil diese verdammte Poolparty gerade Thema Num-
mer eins war. In der ganzen Schule sprach man nämlich nur noch über
diese Party und welchen Bikini man wohl anziehen sollte. Wen in-
teressierte das? Steffi ignorierte meinen Kommentar einfach und sagte an
Nancy gewandt.
»Ich habe mir im Internet einen neuen bestellt, aber wenn er bis
heute Abend nicht ankommen sollte, borgst du mir doch einen aus, oder?
Ansonsten geh ich nackt, das ist mir sowas von egal!« Nancy lachte.
»Klar borge ich dir einen aus … und Emily ebenfalls«, fügte sie mit
einem strengen Blick auf mich hinzu. Ich beendete meinen Satz noch und
sagte dann: »Wie gesagt, ich komme nicht mit.«
»Ach komm schon, du bist so eine Spielverderberin, weißt du das?«,
meckerte Steffi. Ich hob unbeeindruckt die Schultern und sagte, ohne
vom Blatt aufzusehen.
»Ehrlich, ich habe wichtigere Dinge zu tun, als halbnackt in einem
fremden Haus rumzulaufen und mich von Männern anbaggern zu lassen.
Denn einzig und allein dafür sind diese Partys gedacht!«
»Aber Tobias wird sicher auch da sein und das wäre deine Chance,
ihm deine Schokoladenseite zu zeigen«, meinte Nancy augenwackelnd.
»Meine Schokoladenseite?«, fragte ich lachend und sah auf.
»Na, das ist die Chance, dich von ihm abchecken zu lassen, ohne dass
es billig rüberkommt. Auf einer Poolparty laufen alle im Bikini rum. Das

ist die Gelegenheit, ihm zu zeigen, was du zu bieten hast und du machst ja
nicht unbedingt die schlechteste Figur«, fügte sie hinzu.
»Na vielen Dank«, sagte ich lachend.
»Aber ich muss leider ablehnen. Die Prüfungen stehen bald an und
ich muss noch eine Menge lernen – zum Beispiel für Mathe«, hielt ich
dagegen.
»Ach komm, wir wissen doch, dass du auf ihn stehst«, sagte sie.
»Tu ich nicht«, entgegnete ich, doch sie tauschte nur einen wissenden
Blick mit Steffi. Ich hatte ihnen nicht erzählt, dass ich am Sonntag bei To-
bias sein würde, wobei er mir noch nicht einmal gesagt hatte, wo er über-
haupt wohnte. Ob ich nervös war? Bis jetzt hatte ich die Tatsache, dass
ich womöglich stundenlange mit ihm alleine sein würde, erfolgreich ver-
drängt. Aber es war ja auch erst vierzehn Stunden her, dass ich unfreiwil-
lig zugesagt hatte und wie ich mich kannte, würde ich erst kurz vorher
nervös werden. Vielleicht musste ich mir aber auch gar keine Sorgen
machen, weil seine Eltern zu Hause waren und wenn seine Mutter auch
nur halb so verrückt war wie meine, dann würde das ein ungezwungener
Tag werden. Wenn es nämlich eines gab, das meine Mutter gut konnte –
außer backen und mich blamieren -, dann war es, Gäste zu unterhalten.
Wie wohl seine Eltern tickten? Ob er Geschwister hatte? Ich würde es
bald herausfinden.
Leider blieb mein gespieltes Desinteresse an Tobias nicht lange unbe-
merkt, denn als wir uns in der dritten Pause auf dem Schulhof trafen,
kam Laura mit erhobenem Zeigefinger auf mich zu. »Emily Bergmann,
wie kannst du es wagen, uns anzulügen?« Ich setzte meine Wasserflasche
ab und schraubte sie zu, bevor ich fragte: »Was meinst du?« Steffi und
Nancy sahen neugierig von mir zu Laura.
»Wenn ich mich recht erinnere, hast du uns heute Morgen gesagt,
dass du seitdem nicht mehr mit Tobias gesprochen hast und was erzählt
er mir gerade im Unterricht? Dass ihr euch für Sonntag verabredet habt!«
Ich starrte sie mit offenem Mund an. Dieser verdammte Mistkerl! Wollte
der mich eigentlich veräppeln.
»Du Heuchlerin«, empörte sich Nancy, doch ich machte eine
beschwichtigende Geste. »Okay, habe ich, aber nur, weil er mich
57/117

praktisch dazu gezwungen hat. Ich wollte es allerdings nicht an die große
Glocke hängen.«
»Warum?«, fragte Steffi. Ich zog eine Grimasse.
»Weil das absolut nichts zu bedeuten hat, er will mich wahrscheinlich
bloß ärgern. Außerdem weiß es am nächsten Tag die ganze Schule, wenn
ich es euch erzähle. Die große Glocke seid nämlich ihr und für gewöhnlich
– auch wenn ich euch sehr liebe –, könnt ihr eure Plappermäuler nie hal-
ten!« Keine von ihnen schien beleidigt zu sein, stattdessen wurde ich über
den gestrigen Abend ausgequetscht und weil sie sonst keine Ruhe geben
würden, musste ich ihnen jedes einzelne Gespräch wiedergeben. Ehrlich,
manchmal beneidete ich Leute, die keine Freunde hatten!
Als es zum Unterricht klingelte, begaben wir uns zum Klassenraum
und gerade, als wir die Mensa verlassen hatten, sah ich Tobias in einer
Ecke stehen.
»Geht schon mal vor, ich komme gleich nach«, sagte ich an meine
Mädels gewandt und schritt auf ihn zu. Er stand lässig an der Wand
gelehnt, ein Bein angewinkelt und ein brünettes Mädchen vor ihm stehen.
Sie lachte über irgendetwas, das er sagte, dann fiel sein Blick auf mich
und er richtete sich etwas auf. Was er zu ihr sagte, wusste ich nicht, doch
sie warf einen unfreundlichen Blick in meine Richtung und ging schließ-
lich davon.
»Hallo Sonnenschein«, begrüßte er mich und sah mit einem matten
Lächeln auf mich herab. Die Hände in die Hüften gestemmt, blieb ich vor
ihm stehen.
»Nach Sonnenschein ist mir gerade gar nicht zumute, eher nach Ge-
witterwolken! Warum hast du Laura von unserer Verabredung erzählt?«
»Warum nicht? Ist es dir etwa peinlich?«, fragte er zurück.
»Natürlich nicht, aber darum geht es auch gar nicht. Sondern darum,
dass nicht die ganze Schule davon wissen muss.«
»Weil sonst alle denken, dass da was zwischen uns läuft«, vermutete
er mit einem erheiterten Blick. Machte sich der Typ etwa über mich lust-
ig. Ich verschränkte die Arme vor der Brust und sagte: »Du weißt schon,
dass ich die Verabredung jederzeit platzen lassen könnte, oder? Du soll-
test dich lieber nicht mit mir anlegen!« Er leckte sich die Lippen, was viel
58/117

zu hinreißend aussah und sagte dann: »Okay, tut mir leid. Ich werde kein
Sterbenswörtchen mehr darüber verlieren«, versprach er mit ernster
Miene, wobei ich mir einbildete, dass seine Mundwinkel minimal zuck-
ten. Ehrlich gesagt, hatte ich mit Gegenwehr oder zumindest einer
frechen Antwort gerechnet, deshalb brachte mich seine Kapitulation auch
ins Stocken.
»Äh gut, also dann … ich muss jetzt gehen«, sagte ich und rauschte
davon. Verdammt, wenn ich klug gewesen wäre, hätte ich unsere Verabre-
dung einfach platzen lassen. Aber die Wahrheit war, dass ich neugierig
war. Ich wollte wissen, wo und wie er lebte, wie seine Familie war und
was ihn im Privaten beschäftigte. Oh ja, das würde mich unheimlich
interessieren.
In der nächsten Pause fing er mich noch einmal ab, um mir meine
Handynummer zu entlocken, doch als ich zu ihm sagte, er solle sie sich
von Laura holen, lachte er nur und blieb hartnäckig. Also hatten wir mit-
ten im Gang unsere Nummern getauscht, was mir ziemlich unangenehm
war.
Ich weiß auch nicht, aber es machte immer den Eindruck,
abgeschleppt zu werden, wenn man seine Nummer an einen Kerl vergab
– dabei war das ja ein ganz harmloses Treffen. Nur wussten das die an-
deren Schüler natürlich nicht und dass es auch noch Tobias war, mit dem
ich die Nummern tauschte, ließ die Leute gleich doppelt hingucken.
***
Während sich die Mädels am nächsten Tag amüsierten, verbrachte ich
den Abend in meinem Zimmer und versuchte mich zu konzentrieren,
doch es gelang mir einfach nicht. Ich musste immerzu an Tobias denken
und wie er sich wohl mit den anderen auf der Party vergnügte. Ob er
meine Mädels nach mir fragte? Sicher nicht, so viele halb nackte Weiber
wie auf der Party herumliefen. Sicher konnte er sich vor Bewerberinnen
kaum auf den Beinen halten, also würde er mit Sicherheit keinen
Gedanken an eine so unspektakuläre Person wie mich verschwenden. Hör
verdammt noch mal auf, an ihn zu denken!, ermahnte ich mich im
59/117

nächsten Moment und starrte konzentriert auf die Aufgaben vor mir.
Denn wenn in meinem Kopf noch weitere Bilder von ihm auftauchten,
dann konnte ich es gleich mit dem Lernen lassen! Und genau dazu kam es
dann auch und ich schlug zehn Minuten später das Buch zu.
Ich konnte nicht mehr. Ich konnte mich einfach nicht konzentrieren,
ohne an diese blöde Party zu denken und so unerträglich der Gedanke
auch war, aber ich bereute es, nicht mitgegangen zu sein. Was mich noch
viel mehr ärgerte, war jedoch, dass es mich nur wegen Tobias darüber är-
gerte, dabei kannte ich ihn doch überhaupt nicht. Oder sagen wir so: Ich
hatte gerade mal seit knapp einer Woche mit ihm zu tun und das reichte
wohl schon kaum aus, um in irgendeiner Form eifersüchtige Gefühle
aufkommen zu lassen. Doch ich konnte nichts dagegen tun. Lieber wäre
ich auf dieser Party gewesen und hätte ihm meine Schokoladenseite
gezeigt, als Mathe zu büffeln. Doch nun war es zu spät. Ich war hier und
er dort – damit musste ich mich abfinden!
Am nächsten Morgen traf ich die Mädels wie gewohnt am Bahnhof
und wurde auch sofort über die gestrigen Ereignisse aufgeklärt.
»Er hat nach dir gefragt«, sagte Steffi und grinste dabei erwartungs-
voll, was irgendwie beängstigend aussah. Sie hatte wohl einen Luftsprung
erwartet, doch ich gab mich gleichgültig und fragte: »Ja und?«
»Und?«, wiederholte Nancy.
»Du weißt ja nicht, wie enttäuscht er ausgesehen hat, als wir ihm
sagten, dass du nicht kommst.«
»Und ich habe ihn den ganzen Abend nicht einmal flirten sehen«,
fügte Laura stolz hinzu.
»Und ich habe ihn beobachtet, glaub mir. Ich glaube, er hat wirklich
gehofft, dass du kommst.« Ich schnaubte unbeeindruckt und ignorierte
das leise Kribbeln in meinem Magen.
»Wisst ihr eigentlich, dass ihr euch total lächerlich macht? Wir
kennen uns überhaupt nicht und nur weil ich am Sonntag mit ihm lerne,
heißt das nicht, dass da irgendwas zwischen uns läuft.«
»Noch läuft nichts, Emily, noch«, sagte Nancy in verschwörerischem
Tonfall und hakte sich bei mir unter. So liefen wir zum Schulgebäude und
den eisigen Temperaturen nach zu urteilen, konnte vielleicht bald auf
60/117

etwas Schnee gehofft werden.
Die nächsten zwei Tage vergingen wie im Flug und es gelang mir viel
besser, mich aufs Lernen zu konzentrieren. Das lag womöglich daran,
dass ich Tobias nur selten zu Gesicht bekam und wenn, dann mit meinen
Mädels zusammen und dann kam er mir viel weniger einschüchternd vor,
als wenn wir alleine waren. Oder es lag daran, dass ich am Sonntag nicht
wie ein totaler Idiot vor ihm dastehen wollte und ich strengte mich de-
shalb so an. Was auch immer der Grund war, aber meine Lernblockade
von gestern war wie weggewischt.
Am Sonntag war es dann so weit und pünktlich wie ich war, verließ
ich schon eine halbe Stunde früher das Haus. Ich hatte nämlich das
Talent, mich schnell zu verfahren, wenn ich mich das erste Mal mit je-
mand verabredete und da ich noch nie in Tobias Umgebung gewesen war
– lustig, dabei wohnte er gerademal 10 Min. entfernt- wollte ich mir etwas
Luft lassen. Der Fahrweg stellte sich jedoch als absolut idiotensicher
heraus, denn ich musste lediglich zwei Stationen mit der U-Bahn fahren
und ein kurzes Stück laufen. Tobias wohnte im selben Bezirk wie ich,
doch die Gegend hier war weitaus rauer und ungemütlicher als bei mir.
In meiner Ecke reihten sich hübsch gepflegte Reihenhäuser,
Spielplätze und Grünanlagen aneinander, während sein Gebiet von Plat-
tenbauten, zugemüllten Straßen und fragwürdigen Gestalten bewohnt
wurde. Kaum zu glauben, dass lediglich ein Park zwischen uns lag, denn
hier kam ich mir vor wie in einer anderen Welt. Kein Wunder, dass mich
bislang nichts hierher gezogen hatte. Ich entdeckte seine Hausnummer,
stieg die zwei Treppen hinauf und wollte klingeln, als eine Bande gack-
ernder Kinder herausgeschossen kam und mir somit die Tür öffnete. Also
suchte ich lediglich nach seinem Namen, lief ohne zu klingeln hinein und
amüsierte mich mit der Vorstellung, dass er in der Wohnung hetzen
würde, wenn ich direkt an der Wohnungstür klingelte. War das nicht ge-
mein? Aber warum sollte diese Bürde nur uns Frauen auferlegt sein?
Auch im Gebäudeinneren sah es nicht besser aus, als auf der Straße. Die
Wandfarbe perlte an vielen Stellen ab und war ziemlich ausgeblichen und
auf dem Boden lagen zerrissene Zeitungen und Zigarettenstummel.
Stören tat es mich nicht, denn ich machte mir nicht viel aus der
61/117

Außenfassade von Häusern. Solange die Wohnung gemütlich war, könnte
ich auch in einer Ruine wohnen. Als ich in der achten Etage angekommen
war, klingelte ich und lauschte auf ein mögliches Poltern oder Fluchen,
doch leider erklang nichts dergleichen. Stattdessen stand plötzlich ein
halbnackter Tobias vor meiner Nase.
»Du bist fast zwanzig Minuten zu früh«, sagte er und ich konnte nicht
anders, als meinen Blick über seinen freien Oberkörper wandern zu
lassen. Nancy hätte seinen Waschbrettbauch als lecker bezeichnet und
genau das war er auch, vor allem weil ihm das Handtuch viel zu tief auf
den Hüften lag. Sein Haar war noch feucht und einige Tropfen liefen ihm
den Hals hinunter und über die Schulter. Er hätte für ein Männersham-
poo werben sollen.
»Hallo?«, fragte er belustigt, als ich nicht sofort antwortete. Ich riss
meinen Blick hoch und stotterte: »Äh ja, ich … die Bahn kam zu früh und
… tut mir leid, ich kann auch einfach hier warten.«
»Quatsch, komm rein«, sagte er und trat beiseite. Ich tat es und warf
im Vorbeigehen noch einen unauffälligen Blick auf seinen nackten
Oberkörper. Dabei fiel mir auf, dass er schwarze Schweißbänder an den
Handgelenken hatte. Es waren dieselben, die er auch immer im Sportun-
terricht trug.
»Trägst du die etwa auch beim Duschen?«, fragte ich und deutete auf
seine Handgelenke. Er folgte meinem Blick.
»Nicht unter der Dusche, aber ansonsten immer. Es ist … eine alte
Angewohnheit«, sagte er schulterzuckend und schloss die Tür. Er blieb im
Eingangsbereich stehen und wartete, bis ich mir die Schuhe ausgezogen
hatte, dann machte er eine auffordernde Geste, dass ich vorgehen solle.
Also sah ich mir die Wohnung an, die viel zu ordentlich für einen jungen
Mann war. Die Möbel waren überwiegend weiß, vermutlich von dem ber-
ühmten schwedischen Möbelhaus, doch im Kontrast zum dunklen Boden
und den Wänden sah es sehr warm und gemütlich aus. Anerkennend sah
ich mich zu ihm um und sagte: »Schöne Wohnung, wohnst du allein?«
Denn ich zählte nur ein Wohn- und zwei Schlafzimmer.
»Danke und nein, nicht ganz. Ich lebe mit meiner Schwester zusam-
men, der ich den Großteil der Dekoration zu verdanken habe. Ich glaube,
62/117

meine Bude würde nicht halb so heimisch aussehen, wenn meine Sch-
wester sie nicht ausgeschmückt hätte.«
»Du hast eine Schwester?«, fragte ich, als wir uns in einer creme-
farbenen Küche wiederfanden. Er nickte und fragte dann: »Kann ich dir
etwas zu trinken anbieten? Wasser, Saft?« Kannst du dir vielleicht erst
mal was anziehen?, dachte ich zurück. Ehrlich, das verunsicherte mich!
Ich weigerte mich jedoch, ihn auf sein fehlendes Shirt hinzuweisen, denn
dann hätte ich meine Unsicherheit zugegeben und dieser Typ war schon
selbstbewusst genug.
»Wasser bitte«, sagte ich und nahm in der Ecke Platz. Also ging er
zum Kühlschrank und holte mir gekühltes Wasser heraus und während er
mit dem Rücken zu mir stand, konnte ich ihn ungeniert betrachten. Was
für ein Prachtexemplar, dachte ich mir. Schade nur, dass sein Handtuch
so einen guten Halt hatte! Als er mir das Wasser gereicht und ich einen
Schluck genommen hatte, deutete er mit einem Kopfnicken zur Tür.
»Gehen wir in mein Zimmer.« Ich stellte das Glas ab und folgte ihm
und als wir sein Zimmer betraten, sah es schon männlicher aus, nicht
ganz so strikt geordnet wie der Rest der Wohnung. Ich entdeckte eine
Musikanlage in der Ecke, ein großes Bett gegenüber, Kommoden und Tis-
che, wie es in einem Zimmer üblich war, aber eine Sache überraschte
mich dann doch.
»Hey, du liest ja ebenfalls«, sagte ich und betrachtete das große Büch-
erregal in der Ecke. Es war bis in den letzten Winkel vollgestopft und das
keinesfalls mit Attrappen, dazu waren die Formen und Weiten einfach zu
unterschiedlich.
»Ja, ich wollte es vor dir nicht zugeben, auch ich bin den Vampir-
romanen verfallen.« Mein Kopf schnellte zu ihm und ein, zwei Sekunden
glaubte ich ihm, doch dann schüttelte er sich vor Lachen und ging zum
Regal.
»Ha ha, sehr witzig!«, sagte ich und folgte ihm.
»Gib es zu, du hast mir geglaubt«, sagte er und zog ein Buch aus dem
Regal.
»Vielleicht eine Sekunde lang«, gab ich zu und betrachtete das Buch,
das er mir in die Hand drückte.
63/117

»Das große Gesundheitsbuch?«, las ich laut vor.
»Ich bin eher der Sachbuchliebhaber«, erklärte er und deutete auf
seine große Büchersammlung.
»Ich lese alles, was mich interessiert, querfeldein. Seien es
Erziehungsbücher, Medizin-Ratgeber oder Politik.«
»Wow, das ist …«
»Ja?«, hakte er nach, als ich nicht weitersprach. Ich gab ihm das Buch
zurück.
»Das ist so ziemlich das genaue Gegenteil zu mir. Sagt man nicht,
dass sich Sachbuch – und Romanleser nicht vertragen?«, fragte ich
grinsend.
»Ich hoffe nicht, sonst müsste ich dich aus meiner Wohnung werfen
und wir haben uns nicht mal amüsiert«, antwortete er. Amüsieren? Wir
standen immer noch vor dem Regal und mit einem Mal war mir der Ab-
stand zwischen uns viel zu gering. Dass er zudem noch leicht bekleidet
war, verbesserte meine aufkommende Nervosität leider nicht. Kam es mir
nur so vor oder war es auf einmal heiß hier? Und warum sah er mich so
an, ohne etwas zu sagen?
»Vielleicht … solltest du dir erst mal etwas anziehen«, brachte ich
schließlich heraus. In seinen Augen blitzte es amüsiert auf.
»Warum, mache ich dich etwa nervös?« Ich kratzte mich am
Ellenbogen.
»Naja, wir sind hier in deinem Zimmer und du bist mehr als spärlich
bekleidet, also …« Lächelnd trat er zurück, bis er seinen Kleiderschrank
erreichte, dann holte er frische Sachen heraus und drehte sich wieder zu
mir um.
»Willst du mir vielleicht beim Anziehen zusehen? Nicht, dass es mich
stört, aber ich will ja nicht, dass du rote Ohren bekommst …«, sagte er mit
hochgezogenen Brauen.
»Äh ja, ’tschuldige«, sagte ich und drehte mich ruckartig um. Dann
überlegte ich es mir jedoch anders und lief aus dem Zimmer, wobei ich
aus den Augenwinkeln sah, dass er das Handtuch bereits fallen gelassen
hatte. Oh. Mein. Gott! Ich schloss die Tür hinter mir und blieb mit dem
Rücken davor stehen. Mein Herz schlug wild gegen meine Brust. Warum
64/117

tat er das? Um mich zu verunsichern? Machte ihm das Spaß? Um nicht
dümmlich vor seiner Tür zu stehen, sah ich mir das Zimmer gegenüber
an, welches seiner Schwester gehören musste. Als ich die angelehnte Tür
aufdrückte, wurde ich von unzähligen Postern an den Wänden erschla-
gen. Justin Biebers reihten sich neben Orlands Blooms, Keira Knightleys
und den Harry Potter-Darstellern und auch der Rest des Zimmers war
ziemlich mädchenhaft und jugendlich eingerichtet, so dass sich mir die
Frage stellte:
»Wie alt ist deine Schwester?« Ich hörte, wie er die Tür öffnete und
hinter mich trat, bevor er sagte: »Sechzehn.« Verwundert drehte ich mich
zu ihm um.
»Und sie wohnt hier bei dir?«
»Ja, unsere Eltern … verstehen sich nicht besonders gut mit ihr. De-
shalb ist sie zu mir gezogen.«
»Aha und wie steht es mit dir? Verstehst du dich mit ihnen?«, fragte
ich.
»Eher weniger, aber das ist … kompliziert«, meinte er. Ich hätte
liebend gern nachgehakt, doch sein Blick machte deutlich, dass er nicht
darüber reden wollte. Also ließ ich es bleiben und verließ das Zimmer,
auch wenn mir so einige Fragen auf der Zunge brannten. Zum Beispiel,
was geschehen sein musste, dass Eltern ihr 16jähriges Kind rausschmis-
sen? Ob er für ihre Kosten aufkam und warum auch er sich nicht mit
ihnen verstand? Wir gingen wieder ins Zimmer und er forderte mich auf,
meine Matheunterlagen hervorzuholen. Während ich das tat, bereitete er
in der Küche Kaffee zu und kam dann Minuten später mit einer großen
Schale Plätzchen und frisch aufgebrühtem Kaffee wieder.
»Hmmm, das duftet herrlich«, sagte ich und reckte meine Nase in die
Luft.
»Der Kaffee oder die Plätzchen?«, fragte er und klopfte auf sein Bett,
damit ich mich zu ihm setzte.
»Beides«, antwortete ich und hob meine Schulsachen vom Boden auf
das Bett. »Möchtest du einen?« Er reichte mir die Schale und ich griff nur
allzu gerne hinein. Die Plätzchen waren weder dekoriert noch sahen sie
besonders spektakulär aus. Eher so, als hätte man die Teigreste noch
65/117

schnell zu Plätzchen verarbeitet, um sie nicht wegschmeißen zu müssen.
Als ich jedoch hineinbiss, explodierten hunderte Geschmacksnerven auf
meiner Zunge.
»Wow, das ist …«
»Deliziös, vortrefflich, erlesen?«, hakte er nach. Ich lachte.
»Ich wollte eher köstlich sagen, aber ja, das trifft es auch.« Ich drehte
den Keks in den Fingern, als könnte ich so herausfinden, was ihn nur so
verdammt lecker machte und ließ ihn dann in meinem Mund
verschwinden.
»Darf ich noch einen?«, fragte ich. Er stellte mir die Schale hin.
»Nur zu, sind alle für dich. Ich habe gestern so viele gegessen, dass sie
mir schon zum Hals raushängen«, sagte er.
»Beim Kaffee muss ich dich allerdings enttäuschen, der ist ziemlich
gewöhnlich«, fügte er mit einem schiefen Lächeln hinzu.
»Das macht nichts. Ich trinke ihn ohnehin mit so viel Milch, dass man
den Kaffee kaum schmeckt.«
»Gut, dann sind wir schon zwei«, sagte er und goss uns ein.
***
Eine Stunde später hatten wir meine Hausaufgaben fertig und ich traute
mich gar nicht, es auszusprechen, aber ich hatte tatsächlich etwas ver-
standen. Natürlich hatte mir Tobias nicht das Matheuniversum erklären
können, aber er hatte zumindest bewirkt, dass ich begriff, worum es in
den Aufgaben ging und das war mehr, als meine Lehrer in dreizehn
Jahren geschafft hatten. Vielleicht strengte ich mich aber auch nur das er-
ste Mal in meinem Leben verbissen an, denn ich wollte nicht, dass er
mich für unterbelichtet hielt. Zehn Plätzchen später, irgendwie wurde
man gar nicht satt von den Dingern, kam seine Schwester nach Hause.
Ich stand auf und ging in den Flur, um sie zu begrüßen, doch als sie mich
sah, verdüsterte sich ihre Miene.
»Oh bitte, nicht schon wieder eine!«, stöhnte sie und lief eiskalt an
mir vorbei in die Küche. Ich blieb mit ausgestreckter Hand und offenem
Mund in der Tür stehen und sah mich nach Tobias um. Schon wieder
66/117

eine? Er verdrehte die Augen und sagte: »Hör nicht auf sie, sie übertreibt
gerne. Meine letzte Beziehung ist ein halbes Jahr her.« Damit folgte er ihr
in die Küche und zog mich mit.
Ich fand nicht, dass sich die beiden sonderlich ähnlich sahen. Sie hat-
ten dieselben blauen Augen, aber ansonsten verband sie nicht viel vom
Äußerlichen her. Vielleicht lag es aber auch nur daran, dass ihr wasser-
stoffblondes Haar, das im Übrigen unsauber gefärbt war, so im Kontrast
zu seinen dunklen Haaren stand. Oder dass ihre Kleidung eher punker-
mäßig aussah, während er stets ordentlich bekleidet war. Ich musste we-
gen ihrer Haare schmunzeln, denn in meinem Alter wollten auch alle
wasserstoffblond sein und wenn man sich keinen Friseur leisten konnte,
hatte man eben seine Freundin gefragt, ob sie einem die Haare färbt. Und
genauso sahen auch Lisas aus.
»Sei nett zu ihr, ich helfe ihr gerade beim Lernen«, sagte er und sah
mit verschränkten Armen dabei zu, wie sie im Kühlschrank herumwühlte.
Er hatte einen strengen Ton aufgesetzt, doch davon ließ sie sich nicht
beeindrucken.
»Ach, so nennt man das heutzutage, ja?« Ich hob die Brauen und ver-
suchte, den bösen Gedanken daran zu hindern, Gestalt anzunehmen,
doch schließlich gewann er die Oberhand und ich dachte mir, dass es viel-
leicht gar nicht so abwegig war, seinen Teenager rauszuschmeißen, wenn
er so unverschämt war! Andererseits hatte ich kein Recht, mir ein Urteil
zu bilden, denn ich kannte sie ja überhaupt nicht. Vielleicht war sie ja ein
Sonnenschein und hatte nur einen schlechten Tag. Dran glauben konnte
ich allerdings nicht so recht, vor allem, als ich mich ihr noch einmal mit
den Worten
»Ich bin Emily« vorstellte und sie doch tatsächlich
»Mein Beileid« sagte. Dann rauschte sie, mit Lebensmitteln beladen,
an mir vorbei und verschwand in ihrem Zimmer. Tobias’ Züge verhär-
teten sich und er wollte ihr hinterhergehen, doch ich sagte: »Wollen wir
weiterlernen?« Er stockte und sah mich an.
»Ehrlich, wegen mir musst du das nicht machen. Ich war in ihrem Al-
ter auch nicht besser, da kann dir meine Mutter ein Liedchen singen.«
Das war komplett gelogen, denn ich hatte meinen Eltern noch nie
67/117

Probleme gemacht oder war frech geworden, doch ich wollte nicht, dass
es ihm den Tag vermieste. Und außerdem tat er mir leid, denn es war
sicher nicht einfach, einen Teenager großzuziehen, wenn man selbst erst
23 Jahre jung war. Er atmete tief durch und folgte mir dann in sein Zim-
mer. Als er die Tür geschlossen hatte, sagte ich: »Ich bewundere dich
dafür, ehrlich. Nicht jeder entscheidet sich dafür, seine kleine Schwester
aufzunehmen. Vor allem kein so junger Mann in seinen Blütejahren.« Ge-
gen seinen Willen musste er lachen.
»Blütejahren?« Ich wedelte mit der Hand.
»Naja, du weißt, was ich meine. Es ist trotzdem bewundernswert.«
»Oh ja, vor allem im Moment, denn da würde ich ihr liebend gerne
den Hals umdrehen.«
»Ach, sie hat vielleicht nur einen schlechten Tag«, versuchte ich ihn
aufzumuntern. Sein Blick war auf die Tür gerichtet, als er sagte: »Ja ver-
mutlich.« Irgendwie hatte ich aber das Gefühl, dass da noch mehr war.
»Ich glaube, sie ist frustriert, weil ich ihr nicht alles bieten kann«,
sagte er.
»Wie meinst du das?«, fragte ich.
»Naja, sie will viel unternehmen, mit ihren Freundinnen weggehen
und teure Klamotten haben, aber das ist schwer realisierbar als Vollzeit-
abiturient und mit einem Nebenjob. Bevor ich sie hatte, habe ich wun-
derbar gelebt, aber Teenager können ziemlich teuer sein.« Er starrte im-
mer noch zur Tür, als rede er mit sich selbst und dann schien ihm be-
wusst zu werden, was er da gerade gesagt hatte und er sah mich schon
beinahe erschrocken an.
»Aber … das interessiert dich wahrscheinlich gar nicht und gehört
auch überhaupt nicht hierher. Entschuldige. Also, wo hapert es noch?«,
versuchte er das Thema zu wechseln, doch ich fragte: »Bekommt sie denn
kein Kindergeld? Was ist mit eurer Tante und eurem Onkel? Unterstützen
sie dich nicht?« Er sah zu mir auf und ich sah ihm an, dass ihm das
Thema unangenehm war.
»Das schon, aber … ich denke, ein bisschen mehr Taschengeld würde
ihr Gemüt definitiv aufheitern. Sie will ja unbedingt arbeiten gehen und
sich etwas dazuverdienen, aber niemand will eine Sechzehnjährige
68/117

nehmen, deshalb …«
»Meine Mutter könnte das übernehmen«, warf ich ein.
»Wie das?«, fragte er.
»Sie ist Praxisschwester und in ihrem Ärztehaus gehen Studenten
und Praktikanten ein und aus. Die haben da sicher noch was frei, Lisa
könnte Unterlagen ordnen oder die Räume reinigen, da findet sich
bestimmt etwas und aus Erfahrung kann ich sagen, dass sie dort ziemlich
gut zahlen. Ich helfe selbst ab und an dort aus.« Nachdenklich sah er
mich an.
»Und das würdest du wirklich tun, ich meine, wo sie doch so …« Un-
höflich war? »Ach, kein Problem. Das wird sie bestimmt aufmuntern und
fragen kostet ja nichts«, antwortete ich.
Den restlichen Tag kam Lisa nicht mehr aus ihrem Zimmer, doch das
störte mich nicht, denn ich amüsierte mich auch wunderbar mit Tobias
alleine. Nachdem wir gelernt hatten, fanden wir uns im Wohnzimmer ein
und zippten ziellos durch das Programm. Wir sahen uns Kriminalserien
und Tierdokus an und machten uns über Talkshow-Gäste lustig. Kurzum,
wir amüsierten uns so prächtig, wie schon lange nicht mehr, so dass ich
vollkommen die Zeit vergaß. Als der letzte Sonnenstrahl verschwunden
war, fuhr ich erschrocken hoch.
»Was hast du?«, fragte Tobias, der ebenfalls zusammengezuckt war.
»Ich muss nach Hause«, sagte ich. Ein, zwei Sekunden lang sah er
mich an, dann lachte er.
»Ist das dein Ernst? Wir haben es zwanzig Uhr!«
»Ja, aber … ich muss noch lernen.« Und ehrlich gesagt, war ich noch
nie so lange alleine bei einem Mann gewesen. Die wenigen Male, die mich
Vicky mitgeschleppt hatte, zählten nicht, denn da war es immer nur um
sie und ihre jeweilige Flamme gegangen.
»Nein wirklich, ich muss morgen früh aufstehen und …«
»Das muss ich auch«, fiel er mir ins Wort, doch ich blieb dabei.
»Ich werde jetzt gehen, Tobias«, sagte ich bestimmt und erhob mich.
Er stand ebenfalls auf.
»Okay, aber nimm bitte die restlichen Kekse mit, ich kann sie nicht
mehr sehen«, sagte er und lief mit der Schale in die Küche. Ich folgte ihm
69/117

und sah dabei zu, wie er den Inhalt in Tupperware umlagerte, dann
reichte er sie mir. Lachend nahm ich sie entgegen.
»Wow, wie eine echte Hausfrau.« Er warf mir einen gekünstelten
strengen Blick zu und sagte: »Keine Witze über männliche Hausfrauen
bitte! Ist verdammt schwer, einem Teenie hinterherzuräumen.«
»Und du machst das verdammt gut«, sagte ich und tätschelte ihm
neckend den Arm. Ich kam nicht umhin, festzustellen, dass er gut gebaut
und wohltuend warm war und als ich mich bei dem Gedanken erwischte,
mein Gesicht an seiner glühenden Haut zu reiben, zog ich die Hand ruck-
artig zurück, als hätte ich mich verbrannt. Tobias legte den Kopf schräg,
so als hätte er die veränderte Atmosphäre auch bemerkt, doch bevor er et-
was sagen konnte, war ich auch schon in den Flur gegangen und zog
meine Schuhe an. Er kam hinterher und als er dasselbe tat, hielt ich ver-
wundert inne.
»Was soll das werden?«, fragte ich, denn ich hatte da schon so eine
Vermutung.
»Na, ich bringe dich nach Hause«, antwortete er und das in einem
Ton, als wäre die Frage vollkommen absurd.
»Quatsch, das sind doch bloß drei Stationen, die schaffe ich schon
selbst.« Doch er ignorierte meine Worte und zog sich schließlich auch
eine Jacke über. Dann öffnete er die Tür und sah mich abwartend an und
mir blieb nichts anderes übrig, als seiner Aufforderung nachzukommen.
»Willst du deiner Schwester nicht Bescheid geben, dass du weggeh-
st?«, fragte ich, als wir im Fahrstuhl waren. Er schnaubte.
»Und du glaubst wirklich, das würde sie interessieren? Sie hat gerade
ihre rebellische Phase und ignoriert alles, was ich sage. Ich hoffe, das legt
sich bald«, meinte er. Nun war ich es, die lachte.
»Da kannst du noch lange warten. Willkommen in der Pubertät.«
70/117
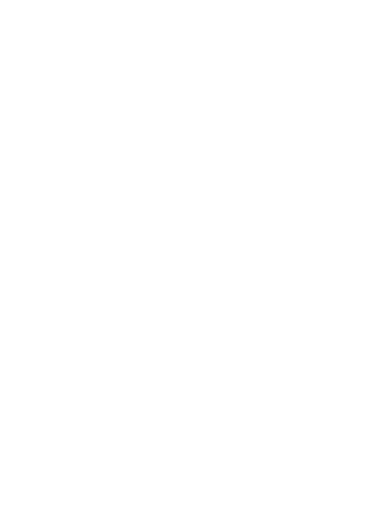
Sechs
Ich sprach noch am selben Abend mit meiner Mutter und sie versprach,
gleich am nächsten Tag in der Praxis nach einem Aushilfsjob zu fragen.
Drei Tage später unterschrieb Lisa ihren Vertrag, doch womit ich beim
besten Willen nicht gerecht hatte, war, dass ich sie einarbeiten musste.
Wir fingen eine Stunde vor ihrer eigentlichen Schicht an und wenn ich
ehrlich war, graute es mir etwas davor, die Zeit mit ihr zu verbringen.
Nicht, dass ich nicht mit zickigen Mädchen umgehen konnte, doch ich
hatte keine Lust, dass sie Tobias irgendwelche Lügengeschichten über
mich auftischte wie etwa, dass ich sie gezwungen hätte, die Toiletten zu
putzen, wenn ich nicht nett genug zu ihr war.
Andererseits würde er im Zweifelsfall wohl eher mir glauben, von da-
her … Ich musste Lisa zugutehalten, dass sie sich bei mir für den Job be-
dankte, doch ich konnte mir gut vorstellen, dass Tobias ihr dafür eine
Woche Nahrungsentzug angedroht hatte, so gequält kamen die Worte aus
ihrem Mund. Mir machte das jedoch nichts aus, denn erstens war ich nur
selten in der Praxis und zweitens würde es Tobias entlasten und das war
die Hauptsache. Ehrlich, ich konnte immer noch nicht glauben, dass er
mit seinen dreiundzwanzig Jahren einen Teenager großzog. Wenn man
bedachte, dass er dazu noch das Abitur machte und drei Mal die Woche
arbeiten ging, war es ein Wunder, dass er so ein ruhiger und anständiger
Kerl war und nicht in Alkoholexzesse ausartete. Andererseits würde er
das alles wohl kaum meistern, wenn es anders wäre. Die Einarbeitung
verlief zügig, denn trotz ihrer jungen Jahre war Lisa ein helles Köpfchen.
Dennoch trat sie mir mit kalter Höflichkeit gegenüber, die mich etwas
traurig machte.
Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, was sie gegen
mich hatte, sprach sie deshalb aber auch nicht an. Vielleicht musste sie
einfach nur auftauen und mit mir warm werden. Wer weiß?
Ȇbrigens hat Tobias uns in seine Bar eingeladen und er spendiert
uns die Drinks«, sagte ich, als wir die Schule verlassen hatten und uns auf

dem Rückweg befanden. Laura und Tobias hatten noch zwei Blöcke vor
sich, doch unsere Lehrerin war unverhofft ausgefallen und so konnten wir
früher nach Hause gehen. Hach, wie ich diese überraschenden Krankmel-
dungen unserer Lehrer immer liebte. Es war jedes Mal wie vorverlegtes
Weihnachten und mit einem Hochgefühl verbunden, denn man wusste,
dass man nach Hause gehen konnte, obwohl man noch vier Stunden die
Schulbank hätte drücken müssen.
»Na dann nichts wie hin«, sagte Steffi und klatschte in die Hände.
»Heute kann ich allerdings nicht, wenn wir es also auf morgen ver-
schieben können, bin ich gerne dabei.« Ich zog eine Grimasse. »Ihr wollt
mitten in der Woche trinken gehen? Ich hatte da eher ans Wochenende
gedacht.« Nancy lachte.
»Klar, wir sind doch keine achtzehn mehr. Erwachsene Leute gehen
auch mal unter der Woche feiern.« Ich sah die beiden an und hob dann
die Schultern. Konnte mir ja eigentlich egal sein, denn ich würde sowieso
keinen Alkohol trinken. Eine Bedingung hatte ich allerdings: »Gut, wenn
ihr alle dabei seid, sage ich ihm Bescheid, dass wir ihn morgen besuchen
kommen«, sagte ich, um ihm eine Nachricht zu schreiben. Als Nancy in
sich hinein schmunzelte, fragte ich: »Was ist?«
»Bist du schon mal auf die Idee gekommen, dich alleine mit ihm zu
treffen?«
»Auf keinen Fall!«, wehrte ich sofort ab, was mir amüsierte Blicke
einbrachte.
»Aber ihr habt euch doch schon mehrmals getroffen. Wo liegt das
Problem?«, wollte Steffi wissen.
»Das war aber zum Lernen gewesen. Wenn ich ihn alleine in der Bar
besuchen würde, keine Ahnung, dann würde das ja schon fast einem Date
gleichkommen«, sagte ich und das in einem Ton, als würde der Gedanke
unheimlich abstoßend sein.
»Und wer würde so einen unattraktiven und unzivilisierten Kerl wie
Tobias schon daten wollen?«, fragte Nancy spöttisch.
»Ehrlich, ich glaube, du bist etwas eingerostet und brauchst einen
kleinen Schubs«, fügte sie hinzu und erntete zustimmendes Nicken von
Steffi. Sie lachten beide, doch ich lachte nicht. Ich hasste es, wenn man
72/117

mich zu verkuppeln versuchte, das klappte ohnehin nie und bisher hatte
Tobias ja auch gar nichts in der Hinsicht durchblicken lassen, oder?
Stand er auf mich? Keine Ahnung, denn er hat nie Andeutungen gemacht,
soweit ich mich erinnern konnte und jemandem beim Lernen zu helfen
und Plätzchen anzubieten, war nicht gerade die moderne Art, jemanden
zu umwerben. Und so lange ich mir nicht sicher war …
»Oh oh, ich sehe es hinter ihrer Stirn arbeiten«, sagte Nancy und
blieb stehen.
»Los, spuck es aus, worüber grübelst du nach?«, fragte sie. Ich sah sie
an und sagte dann schulterzuckend: »Du bist also der Meinung, dass er
auf mich steht, ja? Warum? Ich meine, hat er denn schon jemals etwas in
die Richtung gesagt? Zu mir jedenfalls nicht.« Ich musste sagen, ich war
überrascht, denn anders als erwartet zog mich Nancy nicht auf, dass ich
endlich mit der Wahrheit rausgerutscht war, sondern antwortete nur:
»Gesagt hat er nichts, aber man merkt es an der Art, wie er dich
ansieht.«
»Ja er, wenn er mit uns spricht, hat er nicht dieses Glänzen in den
Augen und außerdem neckt er dich unheimlich gerne und wir alle kennen
ja den Spruch«, fügte Steffi hinzu.
»Hm«, machte ich nur und sah geradeaus. Aus den Augenwinkeln sah
ich, wie die beiden einen Blick tauschten.
»Hm? Das ist alles?«, fragte Nancy.
»Merkst du nicht, dass ihr aufeinander steht, aber niemand den er-
sten Schritt macht?« Ich sah sie nur an.
»Quatsch, du weißt doch gar nicht, ob er auch so empfindet.« Oh oh,
ich hatte es gerade laut zugegeben. Ich hatte das zugegeben, was ich
schon seit Wochen zu verleugnen versuchte. Nämlich, dass mir Tobias
nicht annähernd so egal ist, wie ich immer gern sage.
»Ich will trotzdem nicht, dass du irgendwelche Aktionen startest!«,
warnte ich Nancy, deren Augen geradezu aufleuchteten.
»Naaa gut, war ja nur eine Idee«, sagte sie mit erhobenen Händen.
Wie naiv ich doch war, ihr das zu glauben!
***
73/117

Am nächsten Tag stand ich pünktlich um 21 Uhr vor Mickeys Bar, doch
von meinen Mädels war weit und breit nichts zu sehen. So langsam
können sie aber aus dem Knick kommen, dachte ich mir mit zitternden
Knien und sah mich um. Ich wartete jetzt geschlagene zehn Minuten und
abgesehen davon, dass mir Laura vor einigen Minuten per SMS abgesagt
hatte, weil sie unverhofften Besuch bekommen hatte, gab es noch kein
Lebenszeichen der anderen. Und allmählich froren mir die Zehen ab!
»Was soll’s«, murmelte ich schließlich und stieß die Tür zur Bar auf.
Eigentlich hatte ich nicht alleine hineingehen wollen, aber weil mir all-
mählich Eiszapfen aus der Nase wuchsen, musste ich kapitulieren.
Ich weiß nicht warum, aber ich hatte mir Mickeys Bar irgendwie ver-
qualmter und dunkler vorgestellt, doch im Innern erwarteten mich po-
lierte Tische, angenehme Hintergrundmusik und ein verboten gutausse-
hender Barkeeper namens Tobias. Es war nicht viel los. Ich entdeckte ein
knutschendes Pärchen in der einen Ecke und eine Gruppe junger Männer
am Dartbrett in der anderen – das war’s. Deshalb überraschte es mich
auch nicht, dass Tobias mit Gläser putzen beschäftigt war.
»An dem Image müsst ihr aber noch etwas feilen«, sagte ich und set-
zte mich gegenüber an den Tresen.
»Ohne penetranten Zigarettenqualm und laut grölende Stimmen,
traut man sich ja gar nicht hier rein.« Er lachte und warf sich das
Handtuch über die Schulter.
»Wartest du deswegen schon geschlagene zehn Minuten vor dem
Lokal?« Erschrocken drehte ich mich zu den Fenstern um und sah, dass
sie von hier aus wesentlich durchsichtiger waren, als es von außen den
Anschein gemacht hatte. Okay, das war jetzt peinlich!
»Ich habe auf meine Mädels gewartet«, erklärte ich und versuchte un-
gerührt zu klingen. Tatsächlich spürte ich aber, wie sich Blut in meinen
Wangen sammelte.
»Und wo sind deine Mädels?«, fragte er mit hochgezogenen Brauen.
»Tja, wenn ich das wüsste. Laura hat abgesagt, aber die anderen kom-
men bestimmt gleich. Du weißt ja, wie das ist: Kaum wird es kälter, liegen
die öffentlichen Verkehrsmittel lahm. Dabei kommt der Winter immer so
überraschend oder?«, fragte ich. Lachend reichte er mir die Karte.
74/117

»Kann ich dich auf einen Cocktail einladen, solange wir auf die ander-
en warten?« Ich schüttelte den Kopf.
»Ich bevorzuge Cola.«
»Zitrone? Eiswürfel?«, fragte er und nahm ein Glas aus dem Schrank.
»Beides bitte.« Während er mir die Cola zubereitete, beobachtete ich
ihn unauffällig. Er trug ein dunkelblaues Shirt, das ihm bis zu den Ellen-
bogen reichte und ich musste eingestehen, dass ihm dunkle Farben her-
vorragend standen. Als er mir die Cola gereicht hatte, nippte ich daran
und sah mich befangen um. Es wäre mir lieber, wenn der Laden rappel-
voll gewesen wäre, denn dann hätte er etwas zu tun gehabt und ich kön-
nte ihn einfach beobachten. So galt seine volle Aufmerksamkeit jedoch
mir.
»Wo sind die ganzen Leute hin?«, fragte ich deshalb, um etwas zu re-
den zu haben. »Auf dem Weihnachtsmarkt oder Geschenke kaufen, denke
ich. Zu Weihnachten ist nie viel los«, sagte er und da fiel mir ein, dass ich
mich so langsam mal nach Geschenken umsehen musste. In nicht mal
mehr zwei Wochen war es soweit und ich hatte absolut noch nichts gefun-
den – wie jedes Jahr eigentlich. Feierten wir sonst Weihnachten immer
mit Verwandten und den Großeltern, so würden wir es dieses Jahr ruhig
angehen lassen. Die letzten Jahre waren wir zwischen Südtirol und unser-
em Zuhause umher geswitched, doch das war auf die Dauer ziemlich
stressig und Weihnachten sollte ja ein Fest der Liebe und Geborgenheit
sein. Deshalb freute mich dieses Jahr umso mehr.
»Wie lange arbeitest du schon hier?«, fragte ich und schälte mich aus
meinem Mantel. Es war verdammt heiß hier drin. Er ließ seinen Blick
kurz über mich gleiten und antwortete dann: »So lange, wie ich schon das
Abitur mache, seit zweieinhalb Jahren.« Ich nickte und legte den Mantel
samt Schal über die Stuhllehne.
»Macht es dir Spaß?«, fragte ich schließlich. Als er die Brauen hob
und einen demonstrativen Blick auf das leere Lokal warf, lachte ich und
fügte hinzu: »An vollen Tagen.«
»Eigentlich schon«, antwortete er.
»Es ist immer etwas zu tun und man bekommt gutes Trinkgeld. Aber
die Spätschichten sind weniger angenehm, vor allem, wenn man am
75/117

nächsten Morgen um acht in der Schule sitzen darf.« Nickend pflichtete
ich ihm bei und als sich zehn Minuten später immer noch niemand bei
mir gemeldet hatte, wurde ich sauer.
»Also das kann doch langsam kein Zufall mehr sein«, murmelte ich
und zog mein Handy aus der Tasche. Dabei warf ich ihm einen
entschuldigenden Blick zu, den er jedoch gelassen erwiderte. Es tutete
zwei Mal, dann nahm Steffi ab.
»Wo seid ihr zum Teufel noch mal?«, fragte ich. Kurzes Zögern, dann:
»Ich habe dir doch eine Nachricht geschrieben, ich kann heute nicht.« Ich
zögerte.
»Soll das ein Scherz sein? Erst sagt Laura ab und jetzt du auch noch.
Was ist denn los?«, fragte ich und sah Tobias fassungslos an. Eigenarti-
gerweise sah er aus, als müsse er sich ein Lachen verkneifen.
»Mir geht’s nicht so gut, ich glaube, ich habe was falsches gegessen«,
sagte sie und fügte dann ziemlich kurz angebunden hinzu: »Ich glaub, ich
muss mich übergeben, tschüss …« Damit tutete das Handy und ich hielt
es erstaunt von meinem Ohr weg.
»Ich glaube, die wollen mich veräppeln«, sagte ich zu mir selbst und
wählte Nancys Nummer, doch solange ich auch klingeln ließ, sie nahm
nicht ab. Kurz zweifelte ich an meiner geistigen Verfassung und fragte:
»Heute ist doch Donnerstag, oder?« Hätte ja sein können, dass ich mich
im Tag geirrt hatte. Doch er nickte und sah dann erheitert dabei zu, wie
ich Nancy erneut anrief … und wieder und wieder und wieder.
»Wo willst du hin?«, fragte er, als ich aufstand und Anstalten machte,
zur Tür zu gehen.
»Nachsehen, ob sie vor der Tür stehen. Manchmal sind sie solche
Scherzkekse …« Da lachte er und sagte: »Emily, Schatz, heute wird
niemand von deinen Mädels kommen.«
»Hä?«, fragte ich verwirrt und wandte mich zur Bar. Da beugte er
sich mit einem schiefen Grinsen über den Tisch und sagte: »Es ist ein
abgekartetes Spiel. Nancy und die anderen hatten gar nicht vor, heute
Abend herzukommen. Sie wollten … dass wir alleine sind.«
»Du veräppelst mich oder?«, fragte ich und blieb vollkommen verdat-
tert neben dem Stuhl stehen. Versöhnlich breitete er die Hände aus.
76/117

»Ein bisschen ist es auch meine Schuld. Ich habe Laura verraten, dass
du mich abblitzen lassen hast und das muss sie wohl Nancy verklickert
haben. Also hatte Nancy die Idee, dich einfach herzulocken.«
»Und da steckt ihr alle mit drin?«, fragte ich. Er nickte und ich lachte
freudlos.
»Oh, das werden sie mir büßen, aber sowas von. Gib mir einen
Scotch,«, knurrte ich. Er sah mich an, als hätte er sich verhört.
»Wie bitte?«, fragte er. »Einen Scotch«, wiederholte ich.
»Oder wie das heißt.«
»Weißt du, wie stark der ist? Du trinkst doch überhaupt keinen Alko-
hol«, sagte er. »Nicht oft, aber nachdem mich meine Freundinnen so hin-
tergangen haben, habe ich gerade große Lust, mich volllaufen zu lassen.
Also, lass rüberwachsen«, verlangte ich. Ehrlich, mich konnte jetzt sow-
ieso nichts mehr schocken und ein bisschen sah ich es auch als Rache an.
Wenn ich morgen nämlich mit einem Kater zur Schule kommen würde,
wäre es Nancys Schuld und das würde ich sie spüren lassen! Zugegeben,
nicht gerade die weiseste Form der Rache, denn ich hätte sie auch einfach
mit Stillschweigen strafen können, aber ich konnte jetzt unmöglich ein-
fach gehen und außerdem wollte ich schon immer mal Whiskey trinken.
Er sah mich noch einen Moment abschätzend an, als analysiere er meinen
Körperbau und wieviel ich demnach wohl vertragen würde und goss mir
lediglich einen Schluck ein.
»Was soll denn das sein?«, fragte ich und hielt die Pfütze vor meine
Nase.
»Den trinkt man so, vorzugsweise mit Eiswürfeln«, erklärte er.
»Na, das glaube ich aber kaum, mach noch was rein«, forderte ich ihn
auf, doch er sah mich nur mahnend an.
»Emily, du musst dich nicht volllaufen lassen, nur weil die Aussicht,
mit mir alleine zu sein so schrecklich ist. Ehrlich, trink das aus und dann
kannst du gehen, ist okay«, sagte er schulterzuckend. Konnte es sein, dass
er gekränkt war?
»Was? Nein, ich … will mich nicht deswegen zuschütten«, beteuerte
ich sofort.
»Ich will Nancy damit nur eins auswischen, sie soll leiden.« Zweifelnd
77/117

sah er mich an.
»Damit ich das richtig verstehe: Du willst dich betrinken, damit
Nancy sich schlecht fühlt?« Als ich nickte, fragte er: »Wo ist da die
Logik?«
»Ich habe nie gesagt, dass es eine Logik gibt. Kippst du mir jetzt noch
was ein?«, fragte ich und setzte ein zuckersüßes Lächeln auf. Seufzend
schüttelte er den Kopf, nahm das Glas aber entgegen.
»Du hast keine Ahnung, worauf du dich da einlässt, aber bitte.« Dam-
it machte er das Glas zum Viertel voll und reichte es mir zurück. Ich
schnupperte daran und rümpfte die Nase.
»Gott, das riecht ja wie Sprit. Muss ich das auf ex trinken?« Er schüt-
telte wieder den Kopf und schmunzelte dabei leicht.
»Normalerweise genießt man es, aber in deinem Fall: Schütte es ein-
fach runter.« Während er das sagte, reichte er mir ein neues Glas Cola
und nahm das leere vom Tresen und das gerade rechtzeitig, denn als ich
das Zeug getrunken hatte, hustete ich qualvoll und musste sofort mit Cola
nachkippen.
»Wie. Zum Teufel. Kann man. Nur so etwas. Genießen?«, würgte ich
mit gequältem Gesichtsausdruck hervor und fasste mir an den Hals. Er
lachte so laut, dass das Pärchen zu uns herübersah und als ich wieder ver-
nünftig sprechen konnte, bat ich um noch mehr Cola. Wortlos schenkte er
mir ein, doch immer mit einem leisen Schmunzeln begleitet. Wenige
Minuten später setzte dann auch schon die Wirkung ein und das vielleicht
etwas heftiger, als ich erwartet hätte. Meine Lider fühlten sich an, als
hätte man Gewichte drangehangen, in meine Zunge musste eine Wespe
gestochen haben, so geschwollen und schwer war sie und meine Sicht war
auch nicht mehr ganz so scharf.
»Geht’s dir gut?«, fragte Tobias und holte mich ins Hier und Jetzt
zurück.
»Hm? Ja ja, alles bestens«, versicherte ich und schaute wieder in
mein halb gefülltes Cola-Glas. Irgendwie war das dunkle Getränk
faszinierend.
»Darf ich dann vielleicht auch einen Blick in dein Glas werfen? Dort
scheint sich das Schicksal der Welt auszutragen, so gebannt wie du
78/117

hineinsiehst.« Fertig, wie ich war, überhörte ich seinen Sarkasmus und
reichte es ihm tatsächlich, was ihn kurz die Augen schließen ließ. Wahr-
scheinlich bereute er es, mich trinken gelassen zu haben, doch genau
diese Erkenntnis erheiterte mich unheimlich. Denn ich fühlte mich
großartig, als könnte ich alles machen … und alles fragen.
»Warum hast du keine Freundin?«, schoss es mir durch den Kopf
und so wie er mich daraufhin ansah, wohl auch aus dem Mund. Er hatte
an der Kasse gestanden und irgendetwas eingetippt und während ich
meinen Blick über seine wunderbare Erscheinung gleiten ließ, war mir
diese Frage in den Sinn gekommen. Und sie war ja auch mehr als
berechtigt, so attraktiv wie er war. Tobias kam zu mir und sah mir tief in
die Augen.
»Vielleicht sollte ich dich jetzt nach Hause bringen.« In diesem Mo-
ment kam die Billard spielende Gruppe zum Tresen und bezahlte ihre
Getränke, dann verließen sie die Bar und mir fiel auf, dass das Pärchen
ebenfalls verschwunden war und ich mit Tobias nun alleine war.
Komisch, deren Verschwinden war mir wohl entgangen. Ich drehte mich
wieder zu ihm und sagte: »Du hast nicht auf meine Frage geantwortet.«
Er lachte.
»Eigentlich wollte ich gar nicht darauf antworten, doch der Alkohol
scheint dich nicht nur mutig, sondern auch begriffsstutzig zu machen.
Glaubst du wirklich, ich würde so viel Zeit mit dir verbringen, wenn ich
eine Freundin hätte?«
»Keine Ahnung«, erwiderte ich und war begeistert, wie leicht mir
dieses Gespräch fiel. Vor einer halben Stunde noch wäre es mir nie in den
Sinn gekommen, ihm so persönliche Fragen zu stellen, doch der Whiskey
war ein wahrerer Wundertrank. Ich konnte ihn alles fragen, was ich woll-
te, ohne mich auch nur ansatzweise zu schämen – fabelhaft! Ich hoffte
bloß, dass ich mich morgen auch an all seine Antworten erinnern würde.
»So begehrt, wie du bist und so gut wie du aussiehst, wundert es
mich, dass du nicht vergeben bist.« Er hob die Brauen.
»Ich sehe also gut aus? Hm, vielleicht war es doch nicht so verkehrt,
dir Whiskey zu geben«, überlegte er und kam zu mir herum, um sich
neben mich zu setzen. Er wartete wohl auf eine Reaktion, doch ich
79/117

blinzelte nur, so dass er seufzend zu dem Entschluss kam.
»Doch, es war definitiv verkehrt! Aber um auf deine Frage zu ant-
worten: Bedeutet Begehrtsein denn, dass man vergeben sein muss?« Ich
überlegte.
»Naja, ich kenne zumindest kein Beispiel, bei dem es nicht so ist. Es
liegt am Überfluss an bereitwilligem Fleisch, das sich den Männern bietet.
Sie können gar nicht anders, als zubeißen.« Meine Metapher ließ ihn
stirnrunzeln, dann sagte er: »Na dann bin ich aber froh, dass ich nicht wie
alle Männer bin.«
»Und ich nicht wie alle Frauen«, fügte ich hinzu. Er lachte und fuhr
sich mit der Hand durchs Haar.
»Definitiv nicht«, pflichtete er mir bei, wobei ich nicht sagen konnte,
ob das nun positiv oder negativ gemeint war.
»Aber jetzt mal ehrlich, woran liegt das? Bist du … vom anderen Ufer
oder so? Ich habe dich nämlich noch nie mit einer Frau auf dem Schulhof
gesehen.« Muntere Erkenntnis machte sich in seinen Augen breit.
»Emily Bergmann. Endlich kommt mal etwas Licht in das Mysterium!
Scheint, als ob dir die Frage schon länger auf der Zunge brennt.«
»Etwas ja«, gab ich schulterzuckend zu.
»Wenn das so ist, verrate ich es dir. Ich hatte durchaus Freundinnen,
aber nie welche in der Schule. Das bringt nur Probleme, ich sehe es fast
tagtäglich bei meinen Jungs und ehrlich gesagt, habe ich keine Lust auf
Schuldramen. Außerdem sind die meisten Mädels hier hoffnungslos ober-
flächlich und – ohne deine Gattung jetzt beleidigen zu wollen – aber auch
ziemlich beschränkt, so dass ich mich auf ältere Frauen spezialisiert
habe.« Ich starrte ihn an und fragte
»Ältere Frauen?!«, noch eh ich es verhindern konnte. Mit einem Mal
war das Hochgefühl verschwunden. Hatte ich etwas missverstanden? Ich
war zwei Jahre jünger als er. Was wollte er also von mir? Er schmunzelte
über meine Reaktion und fügte hinzu: »Glücklicherweise … gibt es aber
auch die berühmten Ausnahmen«, sagte er und senkte kurz den Blick,
nur um mich daraufhin von unten anzusehen. Und wie soll diese Aus-
nahme aussehen?, fragte ich mich, während er mir diesen sonderbaren
Blick zuwarf. Als ich nicht reagierte, erhob er sich seufzend.
80/117
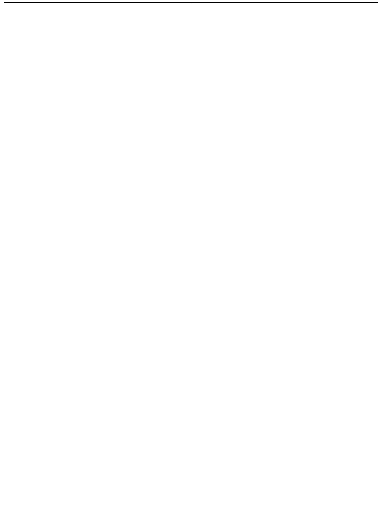
»Leider hat diese Ausnahme aber gerade etwas zu tief ins Glas
geguckt, so dass jede weitere Unterhaltung in diese Richtung sinnlos ist«,
sprach er zu sich selbst. Während sich alles in meinem Kopf drehte, fragte
ich mich, warum er so in Rätseln sprechen musste. Colaschlürfend beo-
bachtete ich, wie er hinter dem Tresen verschwand und das Geld in der
Kasse zählte. Wenige Minuten später schloss er sie dann ab, warf sich die
Jacke über die Schulter und kam zu mir.
»Komm, meine kleine Schnapsdrossel. Bringen wir dich nach
Hause«, sagte er und wollte mir beim Aufstehen helfen, doch ich machte
mich von ihm los.
»Ich kann das alleine, vielen Dank!« Abwehrend hob er die Hände.
»Na gut, aber komm mir ja nicht auf den Gedanken, Schadensersatz
zu verlangen, wenn du hinfällst und dir was brichst.« Er hielt mir den
Mantel hin, so dass ich hineinschlüpfen konnte und während ich das tat,
fiel mein Blick auf seine schwarzen Schweißbänder.
»Machst du die eigentlich auch jemals ab?« Er folgte meinem Blick
und sagte: »Nur selten.«
»Verrätst du mir irgendwann mal, was sie zu bedeuten haben? Das
würde mich unheimlich interessieren«, fügte ich hinzu. Ich hatte meinen
Mantel an und stand ihm nun dicht gegenüber. Sein Blick war nachdenk-
lich, fast schon reserviert.
»Vielleicht, irgendwann mal«, murmelte er und wollte mich voran-
schieben, doch ich rührte mich nicht. Ich sah einfach nur zu ihm hoch
und nahm den magischen Anblick seiner Augen in mich auf. Er wollte et-
was sagen, wahrscheinlich, dass ich loslaufen sollte, doch etwas an
meinem Blick ließ ihn innehalten. Plötzlich war eine Spannung zwischen
uns, die eben noch die da gewesen ist und die ich sogar in meinem Zus-
tand deutlich wahrnahm. Ich sah, wie es hinter seiner Stirn arbeitete, wie
er sich fragte, ob er mich küssen sollte und ob ich ihn wegstoßen würde
und ich tat nichts anderes, als seinen unsicheren Blick zu erwidern.
Ich konnte nicht anders, ich schien wie paralysiert zu sein. Dann
packte er mich bei den Hüften, zog mich zu sich heran und beugte sich zu
mir herab. Ich schloss jubelnd die Augen, denn der Gedanke tanzte schon
seit einer Weile in meiner Fantasie herum, doch anstatt mich auf den
81/117

Mund zu küssen, lagen seine Lippen plötzlich auf meinem Haar. Er
drückte mir einen Kuss darauf und hielt mich dann von sich weg, um
mich zu betrachten.
»Warum nicht?«, fragte ich verwundert. Lag es etwa daran dass ich
eine Whiskey-Fahne hatte? Er betrachtete mich amüsiert und sagte: »So
verlockend das Angebot auch ist, aber du bist betrunken und das will ich
nicht ausnutzen.«
»Also, ich hätte nichts dagegen, wenn du mich ausnutzt«, sagte ich,
ohne die geringste Spur von Scham. Er lachte lauter, hakte sich bei mir
ein und führte mich zur Tür.
»Das sagst du jetzt, aber wenn ich dir morgen erzählen würde, dass
ich dich geküsst hätte, würdest du vermutlich nie wieder ein Wort mit mir
reden.« Als ich eine Schnute zog, fügte er hinzu: »Wir kommen nochmal
drauf zurück, wenn du nüchtern bist.« Damit öffnete er mir die Beifahrer-
tür und dirigierte mich hinein. Als ich angeschnallt war, sagte ich: »Wenn
du weißt, dass ich nie wieder mit dir reden würde, dann weißt du auch,
dass du so schnell keine Chance mehr bekommen wirst.« Ich sah mit
einem schiefen Grinsen aus dem Fenster.
»Ich lasse es darauf ankommen«, antwortete er und startete den
Motor.
***
»Hast du gehört, was ich gesagt habe?«, fragte er und hinderte mich
daran, in den Schlaf abzudriften.
»Hm?«, machte ich und hob den Kopf. Ich wusste nicht, wie lange wir
schon fuhren oder über was wir geredet hatten, nur dass ich unheimlich
müde war.
»Nicht so wichtig, aber du solltest nicht schlafen, das macht es nur
noch schlimmer und ich weiß nicht, ob das bei deinen Eltern so gut
ankommt, wenn ich dich in dein Zimmer trage und …« Doch der Rest des
Satzes verschwamm zu einem Gemurmel. »Wach auf, wir sind da«,
weckte mich eine sanfte Stimme, begleitet von leichtem Rütteln. Meine
rechte Körperhälfte wurde von kühler Luft umschlossen, wahrscheinlich,
82/117

weil er die Beifahrertür geöffnet hatte, doch ich bekam einfach nicht
meine Augen auf. Ein leises Lachen strich über mich, vielleicht war es
aber auch nur der Wind.
»Ich habe dich gewarnt«, hörte ich ihn sagen und spürte starke
Hände unter mir. Dann drehte sich die Welt plötzlich und ich war an ein-
en warmen Körper gepresst. Ich riss die Augen auf und mit jedem Blin-
zeln wurde meine Sicht schärfer, bis ich sah, wie er meinen Schlüssel aus
der Handtasche fischte.
»Ich nehme nicht an, dass deine Eltern Wind davon bekommen sol-
len?«, fragte er belustigt. Ich riss die Augen auf.
»Auf keinen Fall!« Er nickte wissend und brachte mich zur Tür. Die
Lichter waren aus, was bedeutete, dass meine Eltern schon schliefen.
Leise schloss er die Tür auf, gab mir meine Handtasche zurück und lehnte
dann seinen angewinkelten Arm an den Türrahmen.
»Also Emily, das war eine äußerst aufschlussreiche Nacht. Ich kann es
kaum erwarten, dir morgen jedes Detail zu erläutern.« Sein breites
Lächeln konnte man nur als engelhaft bezeichnen.
»Ich kann es auch kaum erwarten«, sagte ich, woraufhin er lachte.
»Ja ganz sicher. Also dann, träum was Schönes.« Damit ging er zu
seinem Auto und ich schloss die Tür. Und wie gut ich träumen würde!
83/117

Sieben
Als ich am nächsten Tag aufwachte, konnte ich mich nur verschwommen
an den Vorabend erinnern und das beunruhigte mich. Es gab einen
Grund, warum ich nicht gerne Alkohol trank, ich vertrug ihn einfach
nicht, das hatte ich von meiner Mutter und dass ich gestern Hochprozen-
tigen getrunken hatte, trug nicht gerade zu meinem Wohlbefinden bei.
Also mal sehen. Woran konnte ich mich noch erinnern? Richtig, diese
hinterlistigen Weiber, die sich meine besten Freundinnen schimpften,
hatten mich hintergangen und mir ein Date aufgebrummt und ich hatte
mir den Hintern abgefroren, als ich vergebens auf sie gewartet hatte.
Dann war ich hineingegangen und hatte mich mit Tobias unterhalten und
als er es mir gebeichtet hatte, habe ich einen Scotch getrunken. Tja und
von da an war alles ziemlich verschwommen, um nicht zu sagen, ich hatte
keine Ahnung, was geschehen und wie ich nach Hause gekommen war.
Mit einem Mal wurde mir bewusst, dass ich nicht von meinem Weckerton
wach geworden war und dem Stand der Sonne nach war der Tag bereits
fortgeschritten. Verdammt! Mit einem Keuchen schreckte ich hoch und
sah auf mein Handy. Es war halb zehn und ich hatte neun verpasste An-
rufe! Drei von Tobias und sieben von Nancy.
»Mist, Mist, Mist!«, rief ich und stolperte ins Bad, um mir die Zähne
zu putzen. Duschen musste bis später warten, also beschränkte ich mich
auf eine Katzenwäsche, einen unordentlichen Dutt und ein bunt zusam-
mengewürfeltes Outfit. Meine Eltern waren bereits aus dem Haus, nur
Milow begrüßte mich schwanzwedelnd, als ich aus dem Zimmer gestürmt
kann.
»Keine Zeit, mein Freund«, rief ich und rannte an ihm vorbei. Schnell
an den Kühlschrank gegangen und ein Schluck Milch getrunken,
schnappte ich meine Schultasche und verließ das Haus. Der Uhrzeit nach
zu urteilen, war gerade die erste Pause angebrochen und wenn ich mich
beeilte, würde ich es sogar noch rechtzeitig zum zweiten Block schaffen.
Während ich zur U-Bahn eilte, rief ich Nancy an, die nach dem zweiten
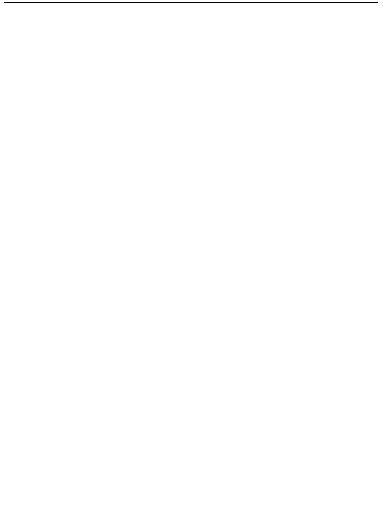
Klingeln ran ging.
»Wo bist du bloß?«, fragte sie, noch eh ich Luft holen konnte.
»Wir haben Tobias schon belagert, weil wir dachten, er hätte dich ir-
gendwo vergraben.« »Hab verschlafen, bin auf dem Weg«, sagte ich
gehetzt.
»Das glaube ich, nachdem, was du getrunken hast. Spinnst du eigent-
lich, dir Scotch reinzuziehen? Du weißt doch, dass du sowas nicht ver-
trägst!« Ich rollte mit den Augen, denn ich hatte gerade zu wenig Atem,
um ihr alles zu erklären, deshalb fragte ich nur: »Habe ich was verpasst?«
»Allerdings, wir haben einen Mathetest geschrieben.«
»Oh neeeeiiiin! Wirklich? Dann bin ich tot. Ich bin ja sowas von …«
»War nur ein Witz«, unterbrach sie mich lachend.
»Der Alte ist gar nicht da, wir hatten Vertretung.« Ich hätte sie schüt-
teln und gleichzeitig abknutschen können, stattdessen sagte ich: »Gut, ich
bin in zwanzig Minuten da.« Damit legte ich auf und hetzte die U-Bahn-
Treppe hinunter.
***
Leider kam ich fünf Minuten zu spät, doch weil ich in Deutsch Klassenbe-
ste und zufällig auch Frau Riebners Lieblingsschülerin war, heimste ich
lediglich einen mahnenden Blick ein. Während des Unterrichtes versucht-
en Nancy und Steffi mich andauernd über den gestrigen Abend auszu-
quetschen, doch ich wies sie immer wieder daraufhin, das in der Pause zu
besprechen. Wenn ich nämlich eines nicht leiden konnte, dann war es, in
einem meiner Lieblingsfächer gestört zu werden! Als Worte und strenge
Blicke nicht mehr halfen, schlug ich mit dem Ordner nach ihnen und
schließlich war Ruhe.
»Was soll das heißen, du kannst dich an nichts mehr erinnern?«,
fragte Steffi enttäuscht.
»Na das, was es bedeutet«, antwortete ich stirnrunzelnd. Was war
denn daran nicht zu verstehen?
»Ach komm, das sagst du doch bloß, weil du uns nichts erzählen
willst. Habt ihr etwa schweinische Sachen gemacht, während du
85/117

betrunken warst?«, wollte Nancy augenwackelnd wissen.
»Nein, haben wir nicht … soweit ich weiß«, sagte ich kleinlaut. Wie
aufs Stichwort kam in diesem Moment Tobias um die Ecke und ich schob
mich an meinen Mädels vorbei.
»Entschuldigt mich«, murmelte ich und fing ihn ab, indem ich ihn
packte und in eine ruhige Ecke zog. Ohne ihn zu Wort kommen zu lassen,
plapperte ich drauflos.
»Du musst mir unbedingt erzählen, was gestern passiert ist. Ich habe
totale Erinnerungslücken und das macht mich fertig. Wenn irgendetwas
Schlimmes passiert ist oder ich mich daneben benommen habe, dann
musst du …«, sagte ich eindringlich, doch er unterbrach meinen
Redefluss.
»Ganz ruhig, entspann dich erst mal. Ist alles in Ordnung?«, fragte er
und musterte mich gründlich.
»Ja«, sagte ich schulterzuckend.
»Du hast keinen Kater? Nachdem ich dich heute Morgen nämlich
nicht aus dem Bett klingeln konnte, dachte ich schon, du würdest gar
nicht mehr aufstehen«, sprach er weiter.
»Doch, alles bestens, kannst du jetzt bitte auf meine Frage ant-
worten?«, bat ich ungeduldig. Da machte sich ein verführerisches Lächeln
in seinem Gesicht breit.
»Bist du sicher, dass du das wissen willst?« Ok, jetzt war ich
verunsichert.
»Naja, so schlimm kann es doch nicht gewesen sein, oder?«, fragte
ich befangen.
»Kommt drauf an, aus welcher Perspektive man es betrachtet. Ich
persönlich fand es ja ziemlich niedlich, aber …«
»Nun sag schon!«, drängte ich ihn. Er biss sich auf die Innenseite
seiner Wange, sichtlich amüsiert über mein Unbehagen und sagte dann:
»Du wolltest mich küssen.« Ein, zwei Sekunden lang starrte ich ihn an,
dann lachte ich höhnisch.
»Niemals.«
»Oh doch, du hast mich geradezu angefleht, es zu tun.« Mein Lächeln
wankte etwas, doch ich hielt es tapfer aufrecht.
86/117

»Das glaube ich dir nicht.«
»Glaub, was du willst, aber so war es.« Hm, sein Blick war zumindest
aufrichtig und selbstsicher. Konnte das stimmen? Aber so etwas würde
ich doch nie tun, oder? Andererseits war ich gestern nicht ich selbst
gewesen – man siehe meinen Filmriss.
»Du bluffst!«, sagte ich trotzdem.
»Ich wusste, dass du so reagierst, aber glücklicherweise habe ich ja
alles auf Video.« Wie betäubt schüttelte ich den Kopf und sah ihn mit weit
aufgerissenen Augen an.
»Gut, dann sieh es dir selbst an und bei Gelegenheit kann ich es auch
gleich bei Facebook hochladen, dann wären wir zumindest quitt.« Ich
wurde weiß wie eine Wand.
»Tu das nicht«, flüsterte ich. Gespielt hob er die Brauen.
»Was, dir das Video zeigen oder es hochladen?«, fragte er.
»Beides, ich … will es gar nicht sehen«, sagte ich und drückte sein
Handy runter. Er sah mich abschätzend an und steckte es dann weg.
»Gut, aber ich werde es als Druckmittel behalten. Man weiß ja nie«,
sagte er grinsend. Doch ich lachte nicht, denn in meinem Kopf schwebte
nur eine einzige Frage umher.
»Haben wir denn … ich meine, hast du den Kuss … erwidert?« Ich
kann gar nicht beschreiben, wie mühsam es war, ihm in die Augen zu se-
hen. Sein Blick war so lastend, dass ich das Gefühl hatte, Gewichte
würden an meinen Lidern hängen, denn sie wollten ununterbrochen nach
unten klappen. Doch ich schaffte es, den Blick aufrecht zu halten. Er sah
mich lange an, dann fragte er: »Und wenn es so wäre? Was würdest du
dann tun?« Ich sackte automatisch gegen die Wand hinter mir, denn ich
konnte plötzlich nicht mehr stehen. Meine Beine hatten sich in Wack-
elpudding verwandelt, was an seinem verdammten Blick lag. Warum
schaute er auch so, als würde er mich an Ort und Stelle verschlingen
wollen?
»Ich … würde … mich entschuldigen«, stammelte ich. Verdammt
nochmal! Seit wann bist du so ein Weichei?, fragte ich mich gleichzeitig.
Ich hörte, wie seine Tasche zu Boden glitt, dann platzierte er die Hände
neben meinem Kopf und ich kam mir vor wie in einem kitschigen High-
87/117

School-Film. Mir war bewusst, dass wir uns mitten im Gang befanden
und wohl gerade hunderte Augenpaare auf uns gerichtet waren, doch es
war mir egal, denn alles, was ich sah, waren seine eisblauen Augen, die
mir viel zu nahe waren.
»Aber ich würde nicht wollen, dass du dich entschuldigst«, sagte er
und frischer Minzgeruch schlug mir entgegen. Oh Gott, ich bekam keine
Luft mehr!
»Denn das wäre mit Abstand der schönste Kuss gewesen, den ich
jemals gehabt hätte«, fuhr er fort. Ich blinzelte. Gehabt? Der magische
Moment war in dem Moment vorbei, in dem er die Hände von der Wand
nahm und sich wieder aufrichtete.
»Glücklicherweise habe ich die Stärke bewiesen und dich abblitzen
lassen«, sagte er grinsend, doch ich nahm ihm seine Gelassenheit nicht
ganz ab. Sein Brustkorb hob und senkte sich etwas zu schnell und in sein-
en Augen schimmerte ein fiebriger Glanz.
»Komm heute Nachmittag zu mir und wir kochen was Schönes«, bat
er.
»Kochen?«, wiederholte ich benommen.
»Oder wir lassen uns was kommen. Lass uns einfach nur den Tag ver-
bringen und dann erkläre ich dir noch einmal ganz in Ruhe, was ges-
chehen wäre, wenn wir uns tatsächlich geküsst hätten.« Oh Gott, das
klang einfach zu verlockend!
»Okay«, hauchte ich, ohne wirklich nachzudenken. Da schenkte er
mir sein wunderbar schiefes Lächeln und ging davon. Sekunden später
traten Nancy und die anderen an meine Seite, die natürlich alles mit-
angesehen hatten, wie mir nun beschämend bewusst wurde. Genau wie
der Rest der Schule!
»Wow, das war mal eine hollywoodreife Vorstellung«, meinte Nancy.
»Ich nehme an, dein Barbesuch ist gestern positiv verlaufen?«, fragte
sie. Ich stieß mich von der Wand ab und hakte mich dann bei ihr unter.
»Ich erzähle es euch, aber du musst mich stützen, ich habe das Ge-
fühl, Wackelpudding in den Beinen zu haben.«
88/117

Acht
Meinem Vorsatz zum Trotz, war ich Nancy und den anderen keineswegs
böse, denn den restlichen Tag verspürte ich ein berauschendes Hochge-
fühl. Platz für andere Eindrücke war da gar nicht, zumindest nicht für
negative. Und wie sollte ich Nancy auch böse sein? Sie hatte getan, wofür
ich zu feige war und mir den nötigen Anstoß gegeben und nun würde ich
mich mit Tobias treffen. Während ich auf dem Weg nach Hause war,
schickten wir uns Nachrichten und machten eine Uhrzeit aus, wobei er
mich ermahnte, nicht wieder zu früh zu kommen. Zu Hause angekom-
men, lief ich aufgeregt in mein Zimmer hinauf und durchstöberte meinen
Kleiderschrank nach etwas passendem. Es sollte nicht zu aufreizend sein,
ich wollte aber auch nicht so förmlich aussehen, als würde ich eine Oper
besuchen.
Also entschied ich mich für eine dunkle Röhrenjeans, ein blutrotes
Spaghetti-Oberteil und eine dunkle Strickjacke darüber. Meine Haare ließ
ich offen über die Schulter fallen und da ich von Natur aus große und
schwere Locken hatte, brauchte ich sie nicht einmal zu frisieren. Ich hatte
noch zwei Stunden Zeit, war aber viel zu aufgeregt, um ans Lernen zu
denken. Denn das würde das erste Mal sein, dass wir uns nicht zum Büf-
feln trafen und ich war gespannt, was er für den heutigen Tag geplant
hatte.
»Sag mal, stimmt etwas nicht, mein Schatz?«, fragte meine Mutter,
der mein hibbeliges Getue nicht entgangen war. Um mir die Zeit zu ver-
treiben, hatte ich erst gesaugt, dann Staub gewischt und nun räumte ich
die Küche auf.
»Doch doch, alles bestens«, versicherte ich und naschte nebenbei von
ihrer neuesten Kreation: Mango-Törtchen. Ich war einfach so aufgeregt,
dass ich Nervennahrung brauchte.
»Dann hast du irgendetwas vor?«, fragte sie und stellte sich neben
mich.
»Ja, ich bin mit Tobias verabredet.« Sie betrachtete mich

nachdenklich, denn für gewöhnlich war ich nicht so überdreht, wenn ich
mich zum Lernen traf. Sie wusste also, dass diesmal etwas anders war,
nur leider fasste sie es vollkommen falsch auf, wie ich ihren nächsten
Worten entnahm.
»Und brauchst du … soll ich dir Kondome geben, oder …?« Ich hatte
gerade vom Törtchen abgebissen und versuchte, nicht daran zu ersticken.
»Mann, Mama!«, rief ich schließlich und sah sie fassungslos an.
»Was denn? Da er dein erster ist …«, sagte sie schulterzuckend, doch
ich unterbrach sie.
»Ich bin 21 Jahre alt, ich glaube, ich kann mir das auch selbst ver-
schaffen. Und ich habe keinesfalls vor, heute mit ihm zu schlafen. Das ist
lediglich eine Verabredung, mehr nicht!«
»Na man weiß ja, wie schnell das heutzutage geht«, murmelte sie. Ich
lachte.
»Danke für deine Sorge, aber die ist vollkommen unbegründet.« Be-
vor sie weiterreden konnte, verließ ich die Küche und zog mich an. Gott,
ich musste hier raus. Die Information, dass sie Kondome benutzte, waren
einfach zu viel, denn das bedeutete, dass sie immer noch Sex hatte und
das war … nein, das konnte und wollte ich mir nicht vorstellen. Nicht bei
meinen Eltern! Also verließ ich das Haus früher als geplant und machte
mich auf den Weg zu Tobias, wo ich, dank der kurzen Strecke, zehn
Minuten später ankam.
Es würde ihn bestimmt nicht sonderlich überraschen, wenn ich
wieder viel zu früh vor der Tür stand, dachte ich mir, während ich in
seinem Fahrstuhl hinauffuhr. Irgendjemand hatte die Haustür aus den
Angeln gerissen und seitdem nicht repariert, so dass ich ungehinderten
Zugang zu seinem Haus hatte. So würde ich ihn erneut überraschen und
wer weiß, vielleicht empfing er mich ja wieder halb nackt, überlegte ich
grinsend. Ich klingelte drei Mal und es dauerte nicht lange, bis jemand
öffnete, doch was ich zu sehen bekam, ließ das Grinsen auf meinem
Gesicht erstarren. Es war kein spärlich bekleideter Tobias, der mich
willkommen hieß, sondern eine halbnackte Rothaarige, die in ein
Handtuch gewickelt war.
Ich starrte sie mit offenem Mund an und als ich meine Sprache
90/117

wiedergefunden hatten, sagte ich: »Ähm, ist Tobias da?« Konnte ja sein,
dass sie eine Freundin von Lisa war. Nur war Lisa heute arbeiten, soweit
ich wusste und das würde immer noch nicht erklären, warum sie im Ba-
demantel hier herumlief.
»Darf ich fragen, wer das wissen will?«, fragte sie mit gerunzelter
Stirn.
»Äh … ich bin Emily, wir … lernen zusammen«, stammelte ich.
»Tatsächlich? Tja, das ist jetzt peinlich, denn wie du siehst, waren wir
gerade beschäftigt. Du kannst gerne reinkommen und auf ihn warten,
wenn du willst?«, sagte sie und trat beiseite, um mir die Tür aufzuhalten.
Wortlos machte ich ein paar Schritte rückwärts, denn ich konnte es nicht
glauben. Da hatte ich mich endlich dazu entschieden, mich ihm zu öffnen
und dann erwartete mich genau das, was ich immer verhindern wollte!
»Tut mir leid … ich hätte …«, stammelte ich und gerade, als ich in den
Fahrstuhl steigen wollte, kam Tobias aus dem Bad. Er hatte ein Handtuch
umwickelt und war einen Moment wie erstarrt. Dann fand er seine
Sprache wieder.
»Was soll der Unsinn, warum läufst du hier im Handtuch herum?«,
fragte er sie überrascht und als sein Blick auf mich fiel, sah er mich be-
stürzt an. Ich sah es förmlich hinter seiner Stirn arbeiten, als er sagte:
»Emily …« Doch da war ich schon im Fahrstuhl verschwunden. Dieser
gespielte Gesichtsausdruck war einfach zuviel! Wie konnte er nur? Nach
allem, was gestern geschehen war? Nach allem, was er gesagt hatte? Am
liebsten wäre ich zurückgegangen und hätte mit den Fäusten auf ihn
eingedrosselt, doch was er mir gerade vorspielen wollte, war das Höchst-
maß an Dreistigkeit. Ich konnte es einfach nicht glauben. Konnte nicht
glauben, dass das eben passiert war. Mein Handy vibrierte, als ich gerade
aus dem Fahrstuhl kam, doch ich ließ es in der Tasche. Warum machte er
sich überhaupt noch die Mühe? Unschuldsbekundungen wären ohnehin
zwecklos.
Schließlich hatte ich die beiden so gut wie erwischt. Gott, was, wenn
ich fünf Minuten früher gekommen wäre, fragte ich mich, während ich
über die Straße eilte. Wäre er dann nackt zur Tür gekommen? Obwohl es
mir in den Augen brannte, weigerte ich mich, auch nur eine Träne zu
91/117

vergießen. Die eisige Kälte biss mir in die Haut und veranlasste mich
dazu, meinen Mantel enger um mich zu schlingen – so eilte ich zur U-
Bahn.
Als ich zehn Minuten später zu Hause war, sah mich meine Mutter
verwundert an. »Er musste kurzfristig arbeiten«, log ich, bevor sie den
Mund aufmachen konnte und eilte in mein Zimmer hinauf. Ich schmiss
weder die Tür zu noch warf ich mich weinend auf mein Bett, denn es war
keine Trauer, die ich empfand, sondern blanke Wut. Dieser verdammte
Mistkerl hatte die ganze Zeit mit mir gespielt und das so geschickt, dass
selbst ich, die Skepsis in Person, ihm am Ende geglaubt hatte.
Es graute mir davor, morgen seine Schwester in der Praxis sehen zu
müssen, doch eine Woche vor Weihnachten war der Patientenandrang so
groß, dass sie jede helfende Hand benötigten. Nun, jetzt würde Lisa
wenigstens bekommen, was sie wollte, dachte ich finster, denn sie hatte
ohnehin ein Problem mit mir gehabt.
***
Als ich meinen Freundinnen am nächsten Tag davon erzählte – und dies-
mal tat ich es freiwillig, denn ich musste Dampf ablassen – waren sie ver-
ständlicherweise geschockt.
»Ich kann das gar nicht glauben, ich meine, er war doch immer so …
nett«, stammelte Steffi und das mit einem Gesichtsausdruck, als hätte sie
soeben erfahren, dass der Weihnachtsmann nicht existierte.
»Tja, die netten sind immer die schlimmsten, nicht wahr?«, sagte ich
schnaubend. Pünktlich zum Weihnachtsfest hatte es heute Morgen das
erste Mal geschneit, doch so richtig konnte ich mich nicht darüber freuen.
Meine Gedanken galten ganz allein Tobias und wie er es geschafft hatte,
mich um den Finger zu wickeln. Dabei ging ich die letzten Wochen Schritt
für Schritt durch und fragte mich, warum ich ihn nicht durchschaut
hatte? Erst hatte er mich mit Hilfe der Ball-Aktion in eine hilflose Situ-
ation gebracht und sich als mein Retter aufgespielt, dann hatte er mich
nach Hause gefahren und sich gut mit meinen Eltern gestellt. An-
schließend hatte er mir Nachhilfe gegeben und mir von seinem
92/117

bedauernswerten Schicksal erzählt, um mein Mitgefühl zu wecken und
dann hatte er mich abblitzen lassen, um sich für mich interessanter zu
machen. Mann, es war fast schon, als wäre er nach einem Drehbuch
gegangen. Hätte sich in meiner Situation nicht jede Frau in ihn verguckt?
Und um meine Kapitulation zu feiern, hatte er gleich mal eine
Rothaarige genommen, doch ich hatte ihm einen Strich durch Rechnung
gemacht! Nein, ich würde keine Träne für ihn vergießen und warum
auch? Wir waren weder zusammen gewesen noch haben wir uns unsere
Liebe gestanden. Er war einfach nur ein weiteres Arschloch, das sich zum
Glück noch rechtzeitig geoutet hatte.
»Gott, dieser verdammte … und ich habe ihn auch noch gemocht. Ich
werde nie wieder ein Wort mit ihm reden!«, schwor Laura und starrte
wütend geradeaus.
»Lasst uns über was anderes reden«, bat ich und hakte mich bei ihr
unter.
»Nächste Woche ist Weihnachten und ich weiß ja nicht, wie es euch
geht, aber ich müsste allmählich Geschenke kaufen gehen.« Also gingen
wir nach der Schule shoppen und verbrachten den ganzen Tag
zusammen.
Ich hätte erwartet, dass mich Tobias in den Pausen abfing und sich zu
erklären versuchte, doch nichts dergleichen geschah, was mir genug über
ihn aussagte. Nicht, dass ich darauf gehofft hatte, aber er hätte sich
wenigstens bei mir entschuldigen können oder es zugeben. Ich bekam ihn
auch nicht zu Gesicht, doch nach Laura zu urteilen, war er heute definitiv
in der Schule. Was für ein Feigling!
Am nächsten Tag fuhr ich direkt von der Schule zur Arbeit. Noch
sechs Tage, dann war Heiligabend und in vier Tagen würden die Schule
und die Praxis schließen und die Winterferien würden beginnen. Das war-
en doch auch tolle Aussichten. Wenn Lisa irgendetwas von gestern wissen
sollte, so ließ sie es sich nicht anmerken. Sie begrüßte mich höflich, aber
distanziert und verrichtete ihre Arbeit.
Es juckte mir in den Fingern, zu ihr zu gehen und sie zu fragen, ob sie
nun glücklich sei, doch das wäre kindisch und eigentlich hatte sie ja auch
nichts mit der Sache zu tun. Wenn Tobias aufrichtig gewesen und wir
93/117

zusammengekommen wären, dann hätten wir das auch ohne ihre Zustim-
mung getan, aber wie es das Schicksal so wollte, war er nicht besser als
die meisten Kerle da draußen. Ich saß an der Rezeption, während Lisa
hinten Akten einsortierte, als Tobias durch die Tür kam. Automatisch
schlug mein Herz schneller, so wie immer, wenn ich ihn ansah, doch dann
wurde das Klopfen von den Wutgefühlen überdeckt und es verkrampfte
sich in meiner Brust. Ich nickte ihm zu und bedeutete ihm, dass er
draußen warten solle und als ich meine Patienten in den Warteraum
geschickte hatte, wandte ich mich an meine Kollegin Martha.
»Kannst du mal kurz für mich übernehmen? Ich bin gleich wieder
da«, sagte ich und erhob mich von meinem Platz.
Besser, ich redete jetzt mit ihm, bevor er mir noch vor all meinen Kol-
legen und meiner Mutter seine Unschuld beteuerte. Nein, eine Szene in
der Arztpraxis konnte ich überhaupt nicht gebrauchen! Ich stieß die Tür
auf, betrat den Flur und stellte mich ans andere Ende des Ganges, wo er
schon auf mich wartete.
»Was willst du?!«, fragte ich mit verschränkten Armen und sah kalt
zu ihm auf. Seine zerwuschelten Haare standen ihm unfassbar gut, ir-
gendwie besser als sonst und auch seine dunkle Hose und der Baumwoll-
pullover sahen an ihm zum Anbeißen aus. Als ob er mich mit dem ver-
höhnen wollte, was ich nicht mehr würde haben können. Ich wünschte,
ich hätte mich heute schicker gemacht, damit ich ihn ein letztes Mal pro-
vozieren konnte, doch mit der weißen Hose und den weißen
Berufsschuhen, die so typisch für Praxisschwestern waren, sah ich leider
wenig begehrenswert aus.
»Das weißt du ganz genau, ich will die Sache aufklären«, antwortete
er und wirkte wütend. Das ließ mich stutzen, denn wenn er etwas erklären
wollte, müsste er dann nicht unterwürfig sein?
»Da gibt es nichts zu erklären. Ich habe dich in flagranti erwischt,
genau das, was ich immer vermeiden wollte.« Er wirkte überrascht, aber
auch wütend.
»In flagranti? Du hast überhaupt nichts gesehen, außer einem ver-
dammten Teenager in einem Handtuch!«, sagte er säuerlich.
»Nun, für mich sah sie ziemlich erwachsen aus«, gab ich stur zurück.
94/117

Er lachte kopfschüttelnd und breitete versöhnlich die Hände aus.
»Emily, das Mädchen ist sechzehn! Sehe ich etwa so aus, als würde
ich mich an Kindern vergreifen? Das war eine miese Aktion, die sich
meine Schwester da ausgedacht hat und ich kann nicht glauben, dass du
überhaupt darauf reingefallen bist. Ich hatte sie gestern gefragt, ob ich die
Wohnung heute für mich haben kann, weil ich mit dir alleine sein wollte
und habe ihr sogar Geld zum Shoppen gegeben. Und gestern Morgen hat
sie sich in deiner Praxis krank gemeldet. Ich dachte, weil sie den Tag
lieber mit Einkaufen verbringen will, aber jetzt wissen wir ja, warum. Sie
wusste, dass du kommst und hat sich diese bescheuerte Idee mit ihrer
Freundin ausgedacht, um dich genau das denken zu lassen: Das ich dich
betrüge«, sprach er. Doch ich schüttelte den Kopf.
»Und welchen Anlass sollte deine Schwester wohl haben, so etwas zu
tun? Dass sie nicht besonders viel von mir hält, das wussten wir vorher,
aber zu solchen Maßnahmen zu greifen, wenn das denn überhaupt stim-
mt, muss einen Grund haben«, sagte ich. Er wollte darauf antworten, ich
sah es ihm an, doch dann überlegte er es sich anders und sagte nur:
»Keine Ahnung, vielleicht hatte sie einen schlechten Tag gehabt, oder …«
Ich lachte freudlos. »Du glaubst nicht ernsthaft, dass ich dir das abkaufe,
oder? Hör zu, Tobias, ich will gar nicht weiter darüber diskutieren. Du
bist weder mein Freund noch sonst in irgendeiner Form dazu verpflichtet,
dich mir gegenüber zu rechtfertigen. Ich weiß nur, was ich gesehen habe
und so lange du nicht bereit bist, mit der Wahrheit rauszurücken, kannst
du mir erzählen, was du willst – es hat keine Bedeutung für mich.« Zwei,
drei Sekunden lang starrten wir uns wortlos an und ich konnte nicht be-
greifen, wie sich so eine Kluft zwischen uns hatte auftun können? Gestern
war noch alles in Ordnung gewesen. Ich wollte ihn sogar küssen, herrgott
nochmal, doch jetzt war mir, als kenne ich ihn überhaupt nicht. Er ver-
heimlichte mir etwas und wenn es nicht um das Mädchen ging, dann zu-
mindest darum, dass er etwas Wichtiges verschwieg und das konnte ich
nicht akzeptieren. Er atmete tief durch, wie um sich zu beruhigen und
sagte dann mit beherrschter Stimme: »Emily, glaubst du wirklich, ich
würde dich zu mir nach Hause einladen und vorher noch eine andere
flachlegen?«
95/117
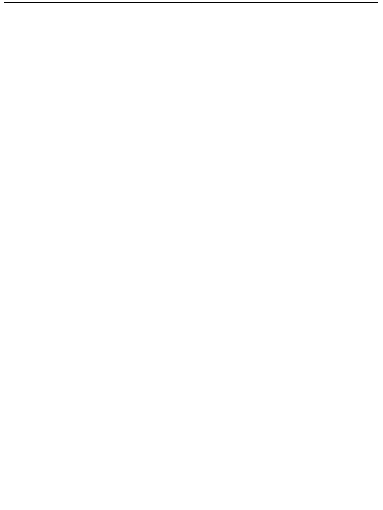
»Keine Ahnung, vielleicht wolltest du mich ja dazwischenschieben,
was weiß ich.« So wie er mich gerade ansah, zweifelte ich selbst allmäh-
lich daran, doch was sollte ich denn seiner Meinung nach tun? In den drei
Wochen hatte er so vieles über mich herausgefunden, doch ich im Gegen-
zug so gut wie nichts. Wenn ich bei ihm zu Hause war, hatten wir uns
über meine Hobbys unterhalten, über meine früheren Kindergartenfre-
unde, meine Lieblingsserien und alles, was mich noch beschäftigt hatte,
doch wenn ich in seiner Vergangenheit rumstochern wollte, hatte er
abgeblockt und das ging mir tierisch gegen den Strich. Nichts über sein
früheres Leben zu wissen, machte ihn praktisch gar nicht angreifbar,
während er doch schon so vieles über mich wusste. Außerdem machte es
ihn undurchsichtig und somit vertrauensunwürdig. Er seufzte erschöpft.
»Glaub mir, Emily …«
»Nein, Tobias, ich glaube dir überhaupt nichts und weißt du warum?
Weil ich dich überhaupt nicht kenne. Jedes Mal, wenn ich deine Vergan-
genheit oder Familie anspreche, blockst du ab und das ist mehr als verlet-
zend. Du bist zwar immer charmant und nett, aber du vertraust mir nicht
genug, um mir mehr zu erzählen – verlangst jetzt aber von mir, dass ich
dir glaube. Wie stellst du dir das vor? Wenn ich dich kennen würde, wenn
ich mehr über dich wüsste, könnte ich vielleicht über den Vorfall lachen.
Ich würde dir sogar glauben, dass es nur ein gemeiner Scherz deiner Sch-
wester war, aber das kann ich nicht, denn ich weiß nichts über dich – gar
nichts!« Daraufhin herrschte Schweigen und er sah mich mit mahlenden
Kiefern an. Ich dachte schon, es würde nichts mehr kommen und wollte
mich schon Richtung Tür wenden, doch dann sagte er: »Du willst also
alles über mich wissen, ja? Hast du vielleicht mal daran gedacht, dass es
einen Grund gibt, warum ich mich so bedeckt halte? Dass ich es nicht tue,
um dich zu verunsichern, sondern dass es Dinge in meiner Vergangenheit
gibt, für die ich mich schäme, die einfach niemand wissen soll? Nein?
Gut, dann werde ich es dir erzählen! Im Alter von fünf Jahren wurde ich
von meinen Alkoholiker-Eltern in ein Kinderheim gebracht, um dort
aufzuwachsen. Sie haben mich verprügelt, verwahrlosen lassen und mich
mit Flaschen beworfen und trotzdem bin ich jedes Mal aus dem Heim
abgehauen und wollte zu ihnen zurück, weil es immer noch meine Eltern
96/117

waren. Man ließ mich natürlich nicht, also blieb ich im Heim, wo ich
mehr als fragwürdige Leute kennenlernte und wir nichts weiter zu tun
hatten, als klauen zu gehen und uns sinnlos zu betrinken.
Im Alter von sechzehn Jahren erfuhr ich dann, dass ich eine kleine
Schwester habe, die meinen Eltern ebenfalls weggenommen wurde. Im
Gegensatz zu mir, nahmen mein Onkel und meine Tante sie jedoch auf
und Jahre später traten wir in Kontakt. Mit achtzehn zog ich dann in
meine eigene Wohnung und traf mich oft mit meiner Schwester, doch ich
war immer noch in meiner rebellischen Phase und ans Lernen wagte ich
nicht einmal zu denken. Ich wollte mir mein Geld mit Dealen verdienen
und lernte ein jüngeres Mädchen kennen, das mich in die Szene einsch-
leuste. Eine Weile ging alles gut und ich hatte sogar genug Geld, um mir
teure Klamotten und ein Auto zu kaufen, doch als sie sich von mir
trennte, wollte ich mir das Leben nehmen und hätte es auch beinahe
geschafft.« Während er das sagte, zog er seine Schweißbänder runter und
enthüllte eine Narbe, die sich längst über seine Pulsader zog.
»Deshalb trage ich die Schweißbänder, Emily, um die Narben und
somit meine Schande zu verbergen. Keine Ahnung, was da im Kranken-
haus geschehen war, aber als ich aufwachte, war ich ein anderer Mensch.
Ich wollte keine Sekunde so weitermachen, ich wollte lernen und arbeiten
gehen und ich wollte meine Vergangenheit hinter mir lassen. Das ist jetzt
fünf Jahre her und ich finde, dass ich es erfolgreich geschafft habe, mein
Leben umzukrempeln. Aber vor seiner Vergangenheit kann man nicht
fliehen, nicht wahr? Schon gar nicht, wenn man penetrant danach gefragt
wird. Also Emily, das ist meine Geschichte. Ich hoffe, du bist hinreichend
schockiert!« Damit machte er auf dem Absatz kehrt und ließ mich stehen.
Und wie schockiert ich war. So schockiert, dass ich bestimmt geschlagene
fünf Minuten auf die Stelle starrte, an der er eben noch gestanden hatte.
Gott, jetzt machte auch so vieles Sinn. Warum er so traurig gewirkt hatte,
als er das erste Mal bei mir zu Hause gewesen war, denn so harmonisch
würde es nie in seiner Familie zugehen und warum er seine Sch-
weißbänder nie abgenommen hatte und nicht über seine Vergangenheit
reden wollte. Und er hatte Recht. Ich hatte ihn oft darauf angesprochen
und jetzt, wo ich die Wahrheit wusste, verstand ich, warum er es
97/117

verschwiegen hatte. Nur jetzt war es zu spät.
»Da steckst du. Los, komm rein, Schätzchen, wir brauchen dich am
Telefon«, sagte meine Mutter, die den Kopf durch die Tür gesteckt hatte.
Ich nickte wie betäubt und ging wieder hinein. Verdammt, was hast du
nur angerichtet, Emily?!
***
Vielleicht lag es an meinem erschütterten Gemüt, aber der restliche Tag
zog sich unendlich in die Länge. Außerdem passierte es mir mehr als nur
einmal, dass ich beim Telefonieren die Kundennamen verwechselte oder
mich bei der Datenaufnahme am Computer vertippte. Jedenfalls war ich
total geschafft und mehr als durcheinander, als ich nach Hause kam. Ein-
erseits war ich betroffen über sein Schicksal, doch andererseits erklärte
das noch nicht, was das Mädchen in seiner Wohnung verloren gehabt
hatte. War sie nun eine Freundin von Lisa gewesen? Ich hatte das Gefühl,
ein entscheidendes Detail überhört zu haben, dass die Antwort klar und
deutlich vor mir lag, doch in meinem Kopf schwirrten zu viele Gedanken
herum und hinderten mich daran, klar zu denken. Die nächsten zwei Tage
sah ich Tobias nur selten in der Schule, was vermutlich auch daran lag,
dass ich explizit nicht nach ihm Ausschau hielt und vielleicht tat er ja
dasselbe. Ich erkundigte mich auch nicht bei Laura oder gar seiner Sch-
wester nach ihm, denn wenn er bisher keinen Versuch unternommen
hatte, mich mit der Sache in seiner Wohnung aufzuklären, dann war es
wohl genau das, wonach es ausgesehen hatte. Er hatte … tja, was
eigentlich?
Betrügen konnte man es nicht nennen, denn wir waren ja nicht
zusammen gewesen. Um genau zu sein, hatten wir uns noch einmal
geküsst, also sollte ich auch aufhören, mir zu viele Gedanken darüber zu
machen. Er hatte mich, zumindest was seine Vergangenheit betraf,
aufgeklärt und mehr hatte ich gar nicht gewollt. Alles war gut, versuchte
ich mir einzureden.
»Hey Mondgesicht, Achtung!«, hörte ich Nancy rufen. Sekunden
später landete eine Schneekugel in meinem Gesicht.
98/117

»Lass den Unsinn, wir sind doch nicht im Kindergarten«, sagte ich
und wischte mir den Schnee aus dem Gesicht.
»Oh seht mal, Frau Bergmann ist heute schlecht drauf«, sagte Nancy
zu den Mädels und kam zu mir. Ich war gerade aus der U-Bahn gekom-
men und so herzlich hatten mich meine Freundinnen empfangen – mit
Schneekugeln! Waren sie nicht reizend? Als Nancy mein Gesicht sah, ließ
sie die andere Kugel fallen und sagte: »Jetzt mach doch nicht so eine ern-
ste Miene. Übermorgen ist Weihnachten und ich verbiete dir, über die
Feiertage auch nur einen schlechten Gedanken zu haben. Danach können
wir uns immer noch um Tobias kümmern und wenn du willst, ziehen wir
ihm nächstes Mal alle Hosen runter«, sagte sie augenzwinkernd.
»Und ich werde diesmal voll drauf halten … auch wenn nicht viel zu
sehen sein wird«, fügte Laura hinzu. Gegen meinen Willen musste ich
lachen und zusammen liefen wir zur Schule.
99/117

Neun
Heute war Heiligabend und somit auch der letzte Arbeitstag in der Praxis.
Tobias hatte auch am letzten Schultag nichts von sich hören lassen, aber
nicht, dass mich das störte. Ich hatte mit ihm abgeschlossen und würde
mich an Nancys Rat halten und mir das Weihnachtsfest nicht versauen
lassen. Danach konnte ich mir immer noch Gedanken machen, wie ich
ihm zukünftig in der Schule begegnen sollte. Die Praxis würde heute nur
bis 14 Uhr offen haben und danach würde ich mit meinen Eltern Kuchen
essen und abends die Geschenke auspacken. Ich freute mich auf ein
gemütliches Weihnachten zu dritt und weil der Kundenandrang heute be-
sonders groß war, verging die Zeit wie im Flug. Lisa arbeitete heute eben-
falls, doch sie war sonderbar still, wie ich fand. Für gewöhnlich unterhielt
sie sich mit unseren Kollegen, während sie mich weitestgehend ignorierte,
doch heute sah sie einem nicht einmal in die Augen und wirkte auch sonst
sehr abgelenkt. Als sie mit mir an der Rezeption gesessen hatte, hat sie
zum Beispiel unentwegt auf die Briefumschläge gestarrt und es überhaupt
nicht wahrgenommen, dass die nächste Patientin an der Reihe war.
Ich hatte sie dann unauffällig angestupst und sie hatte sich
entschuldigt. Ich dachte mir jedoch nichts dabei, denn niemand wusste
besser als ich, was es bedeutete, mit den Gedanken woanders zu sein und
einen schlechten Tag konnte jeder mal haben. Wie üblich durften die
Aushilfskräfte pünktlich um 14 Uhr gehen, während die Vollzeitmitarbeit-
er und Ärzte für gewöhnlich eine Stunde länger blieben und sich um die
restlichen Patienten und Krankschreibungen kümmerten. Da ich mit
meiner Mutter nach Hause fahren würde, blieb ich ebenfalls länger und
vertrieb mir die Zeit damit, den Tresen ordentlich zu halten. Punkt 14 Uhr
lief ich in den Aufenthaltsraum, um mir einen Schluck aus meiner
Wasserflasche zu gönnen, als ich Lisa mit dem Rücken zu mir stehen sah.
»Schönen Feierabend und frohes Fest«, wünschte ich ihr höflichkeit-
shalber. Erschrocken drehte sie sich zu mir um.
»Äh ja … danke. Wünsche ich dir auch«, sagte sie und machte einen

sehr nervösen Eindruck. Ich sah, wie sie einen weißen Umschlag in der
Tasche verschwinden ließ und den Reißverschluss zuzog, als Martha den
Raum betrat.
»Lisa, bevor du gehst, brauche ich noch deine Sozialversicherungs-
nummer. Hast du sie dabei?«, fragte sie. Ich sah, wie Lisa widerwillig
nickte und die Tasche wieder öffnete.
»Muss ich dabei sein, wenn du die Daten einpflegst? Ich habe es näm-
lich leider eilig …«, sagte sie.
»Es dauert nur eine Minute«, versprach Martha und hielt die Tür of-
fen, damit Lisa hindurchgehen konnte. Sie tat es, wenn auch widerwillig
und bevor sie den Raum verlassen hatte, warf sie noch einen nervösen
Blick auf ihre Tasche. Was war nur mit ihr los? Stirnrunzelnd trank ich
von meiner Flasche und begab mich dann wieder zum Empfangstresen,
wo Schwester Ingrid, unsere Dienstälteste, auf dem Tisch herumwühlte.
Als sie mich näherkommen sah, fragte sie: »Hast du zufällig den Geldum-
schlag gesehen? Es ist ein weißer langer Umschlag und ich könnte
schwören, dass ich ihn vor einer Stunde direkt hierhin gelegt habe.« Ich
schüttelte den Kopf.
»Nein, tut mir leid, ich …« Und dann stockte ich. Oh bitte, das hat sie
nicht wirklich getan, oder?! Wortlos drehte ich mich um und lief zum
Aufenthaltsraum zurück und als ich die Tür hinter mir geschlossen hatte,
lief ich zu Lisas Handtasche. So dumm kann sie doch nicht sein, dachte
ich, während ich die Tasche durchwühlte, doch gleichzeitig wusste ich,
dass sie es getan hatte. Es passte alles zusammen. Ihre Nervosität, der
übereilte Aufbruch ... Zur Bestätigung hielt ich Sekunden später den Um-
schlag in der Hand und als ich ihn öffnete, lächelten mich mehrere
Scheine an. Stöhnend schüttelte ich den Kopf und lief mit zusammenge-
pressten Zähnen zum Empfang zurück. Schwester Margit wühlte immer
noch herum und mittlerweile standen ihr sogar Schweißperlen auf der
Stirn. Als Dienstälteste kümmerte sie sich um das Geld und es würde kein
gutes Licht auf sie werfen, wenn plötzlich der gesamte Umschlag ver-
schwinden würde. Dementsprechend war ihre Nervosität also mehr als
nachvollziehbar.
»Das kann nicht sein, irgendjemand muss den Umschlag
101/117

mitgenommen haben«, sagte sie, ohne aufzublicken. Ich hielt den Umsch-
lag seitlich an meinen Körper und tat, als würde ich die andere Seite des
Tisches absuchen.
»Vielleicht ist er hier«, überlegte ich laut.
»Vorhin habe ich gesehen, wie jemand einen weißen … ah, ist er das
nicht?«, fragte ich und hielt den Umschlag in die Höhe. Ingrids Augen
leuchteten auf, als ich ihn ihr reichte.
»Du bist ein Engel, vielen Dank«, sagte sie und nahm ihn erleichtert
entgegen.
Als Lisa fünf Minuten später den Aufenthaltsraum betrat, erwartete
ich sie mit verschränkten Armen. Sie stockte kurz, wahrscheinlich wegen
meines strengen Gesichts und ging dann zu ihrer Tasche, um ihre Unter-
lagen dort rein zu tun.
»Der Umschlag ist nicht mehr da drin. Ich habe ihn zurückgelegt«,
sagte ich und schloss hinter ihr die Tür. Sie hielt mitten in der Bewegung
inne und sah mich mit großen Augen an.
»Warum hast du das gemacht, Lisa?« Für einen kurzen Moment sah
sie mich trotzig an und ich dachte schon, sie würde es abstreiten, doch
dann begann ihre Unterlippe zu beben und sie ließ sich auf die Bank
fallen. Wortlos begann sie zu schluchzen und vergrub das Gesicht in den
Händen und überrascht wie ich war, blieb ich unschlüssig an der Tür
stehen. Dann gab ich mir jedoch einen Ruck und ging zu ihr.
»Hey, was hast du denn?« Normalerweise konnte ich es überhaupt
nicht leiden, wenn man das fragte, denn zumindest in meinem Fall bra-
chte es mich meist noch mehr zum Weinen, doch es war mir einfach so
herausgerutscht. Sie sah kurz auf, sah mich aus geschwollenen Augen an
und sagte dann mit erstickter Stimme: »Tobias hat mich rausgeschmis-
sen.« Damit senkte sie den Kopf wieder und schluchzte weiter.
»Er hat was?«, fragte ich fassungslos.
»Warum das denn?« Bestürzt setzte ich mich neben sie und beo-
bachtete ihre bebenden Schultern.
»Ich habe Mist gebaut und jetzt will er mich zu meiner Tante
zurückschicken. Dabei hassen mich meine Tante und mein Onkel«,
erklärte sie. Mit einem Mal kam mir Lisa sehr viel jünger vor, als sie
102/117

immer vorzugeben versuchte und ich empfand echtes Mitleid mit ihr.
Unaufgefordert sprach sie weiter: »Nachdem meine Eltern das Sorgerecht
verloren hatten, haben sie mich aufgenommen, doch wir haben uns nie
wirklich verstanden und ich habe sie mehr als einmal darüber sprechen
hören, dass sie es bereuten, mich genommen zu haben. Als Tobias dann
alt genug war und sich eine Wohnung leisten konnte, durfte ich in unser
aller Interesse bei ihm einziehen. Ich hatte nie viele Freunde und die
Schule war die Hölle, doch Tobias drängte mich dazu, meinen Abschluss
zu machen – ansonsten würde er mich zu ihnen zurückschicken. Jetzt hat
er mir eine Woche gegeben, um auszuziehen, aber da ich sechzehn bin
und theoretisch alleine leben könnte, brauche ich Geld, um mir eine ei-
gene Wohnung zu leisten.« Nun sah sie wieder auf und man konnte ihren
Blick nicht anders als herzzerreißend bezeichnen.
»Deshalb habe ich das Geld gestohlen. Ich weiß auch nicht, was da in
mich gefahren ist, es war eher ein Reflex.« Jetzt schnaubte sie bitter.
»Als ob ich damit über die Runden kommen würde.« Wir saßen eine
Weile schweigend da und obwohl ich am meisten Grund hatte, sie zu ver-
achten, sagte ich:
»Vielleicht hat er nur einen schlechten Tag. Du solltest noch einmal
mit ihm reden.« Sie maß mich mit einem sonderbaren Blick und lachte
dann bitter.
»Hol lieber Schwester Ingrid oder am besten gleich die Polizei.«
Stirnrunzelnd sah ich sie an.
»Denkst du wirklich, dass ich dich verpetze?« Überrascht und skep-
tisch zugleich lehnte sie sich zurück.
»Naja, du hast doch allen Grund dazu, oder? So unhöflich, wie ich im-
mer zu dir bin.« Ich lächelte.
»Deshalb renne ich doch aber nicht durch die Welt und mache ander-
en das Leben schwer. Wenn dich Tobias aus der Wohnung wirft, hast du
genug Probleme, da brauchst du nicht noch eine Anzeige, mit der du
wahrscheinlich niemals eine eigene Wohnung bekommen würdest«, sagte
ich. Sie sah mich an, als hätte sie einen ganz anderen Menschen vor sich.
»Außerdem hat das Geld die Praxis ja nicht verlassen, also brauche
ich doch auch nicht anzuzeigen«, fügte ich augenzwinkernd hinzu. Sie
103/117

wischte sich die letzten Tränen weg und sah dann wieder auf den Boden.
Ich warf ihr einen Seitenblick zu und sagte dann: »Ich habe zwar keine
Ahnung, warum du mich nicht leiden kannst, aber ich werde niemandem
etwas verraten – natürlich nur, wenn das nicht wieder vorkommt«, ver-
sicherte ich ihr.
»Gott, das ist so falsch«, sagte sie und fuhr sich mit den Händen
durchs Haar.
»Was meinst du?«, fragte ich und legte ihr einen Arm um die
Schulter.
»Du bist so nett und ich … Gott, ich war so ein Miststück«, murmelte
sie. Als ich sie nur fragend ansah, erklärte sie: »Ich habe nichts gegen
dich, Emily, nicht persönlich jedenfalls. Weißt du, als ich bei meinem
Bruder eingezogen bin, habe ich das erste Mal Geborgenheit und Liebe
empfunden, trotz seiner Probleme, die er hatte. Und dann hat seine Fre-
undin mit ihm Schluss gemacht und er ist im Krankenhaus gelandet.
Weißt du, ich … wollte nur verhindern, dass das wieder passiert. Ich woll-
te nicht zu meiner Tante zurück und als ich gesehen habe, dass er dabei
war, sich in dich zu verlieben …« Von dunkler Vorahnung gepackt, zog ich
meine Hand von ihrem Rücken zurück.
»Du weißt ja nicht, wie aufgeregt er war, wenn du zu uns kamst. Er
hat nur noch von dir gesprochen und …«
»Was soll das bedeuten? Was hast du getan?«, fragte ich und stand
langsam auf. Als sie diesmal sprach, kullerten neue Tränen aus ihren
Augen.
»Ich habe das Treffen zwischen dir und meiner Freundin eingefädelt.
Ich habe meinem Bruder gesagt, dass wir gehen, wenn du kommst und
als du geklingelt hast, habe ich ihm gesagt, dass ich an die Tür gehe. Naja,
den Rest kennst du ja selbst. Glaub mir, es tut mir so unheimlich leid. Ich
war so bescheuert …«, flüsterte sie. Ich war zu keinem Wort fähig, konnte
sie nur anstarren und unregelmäßig atmen. Wut sowie Hochgefühl trugen
in meinem Innern einen Kampf aus und ich konnte mich einfach nicht
entscheiden, welches der Gefühle stärker war.
Wut, weil der Streich eines sechzehnjährigen Mädchens dafür gesorgt
hat, dass die letzte Woche die reinste Hölle war und Hochgefühl, weil es
104/117

bedeutete, dass alles wieder gut werden konnte – wenn ich es denn in die
Hand nahm!
»Wo ist Tobias jetzt? Ist er zuhause?«, fragte ich und zog mir bereits
meine Jacke über. Lisa war so überrascht, dass sie sogar aufhörte, zu
weinen.
»Bist du … denn nicht sauer auf mich? Willst du mich nicht ans-
chreien?« Ich lachte. »Im Moment weiß ich selbst nicht genau, was ich
fühle, aber ich verspreche dir, wenn Tobias mir verzeiht, dann verzeihe
ich dir ebenfalls. Also, wo ist er?«
»Er spielt wieder Weihnachtsmann im Kinderheim, gleich bei uns um
die Ecke.« »Gut, willst du mich hinbringen?«, fragte ich und als sie
nickte, zog ich meine Alltagskleidung an und meldete mich bei meiner
Mutter mit der Begründung ab, etwas Wichtiges erledigen zu müssen.
Dann eilten wir aus der Praxis.
***
»Da sind wir«, sagte sie eine halbe Stunde später und deutete auf das Ge-
bäude vor uns. Es hatte ganz eindeutig einige Sanierungen nötig, denn die
Farbe an den Wänden blätterte stark ab und auch die Risse und Einker-
bungen gaben der Einrichtung einen recht verwitterten Anschein. Ich
hoffte, dass es im Innern freundlicher aussah, denn wenn ich mir vorstell-
te, dass Tobias an so einem trostlosen Ort aufgewachsen war und Weih-
nachten gefeiert hatte, wollten mir die Tränen hochkommen. Mit einem
Mal wurde mir bewusst, dass er allen Grund hatte, sauer auf mich zu sein,
denn ich hatte ihn praktisch dazu gezwungen, seine Vergangenheit offen-
zulegen, ja sprichwörtlich die Hosen vor mir runter zu lassen.
Und ich war mir ziemlich sicher, dass es ihm diesmal weitaus unan-
genehmer gewesen war, als auf dem Weihnachtsmarkt! Schon eigenartig,
was in drei Wochen alles geschehen konnte. Bevor ich ihn kennengelernt
hatte, habe ich nicht einmal an einen festen Freund geglaubt und nun
wollte ich Tobias unbedingt zurückhaben. Und wenn er mich nach dem
Vorfall schon nicht haben wollte, dann wollte ich mich wenigstens bei
ihm entschuldigen.
105/117

»Worauf wartest du? Er ist da drin«, sagte Lisa ungeduldig. Ich sah
sie an.
»Tja weißt du, ich war nicht wirklich nett zu ihm …«
»Er wird dir verzeihen, schließlich ist er verrückt nach dir«, antwor-
tete sie augenzwinkernd. Wir lächelten uns an, dann gab sie mir einen
Schubs und ich betrat tapfer das Gebäude.
Es brauchte eine Weile, um mich in dem großen Komplex durchzufra-
gen, doch schließlich machte ich Tobias in einem Saal aus. Er stand auf
einer Bühne, war als Weihnachtsmann verkleidet und probte mit verstell-
ter Stimme seinen Text. Die Lichter im Saal waren aus und einzig die
Bühne war beleuchtet, weshalb ich mich ihr ungesehen nähern konnte.
Als ich ihn sprechen hörte, musste ich an unsere erste Begegnung auf
dem Weihnachtsmarkt denken und ein Grinsen machte sich auf meinem
Gesicht breit. Gleichzeitig war mir aber auch zum Heulen zumute, denn
da er selbst im Heim aufgewachsen war, musste ihm das hier viel
bedeuten.
»Von draußen vom Walde komme ich her und ich muss euch sagen,
es weihnachtet sehr …«, sprach er mit verstellter Stimme. Er war in ein
Kostüm geschlüpft, das seinen Bauch um einiges fülliger machte und
auch das schlohweiße Haar, die buschigen Augenbrauen und der Bart ge-
hörten zur Verkleidung. Mit verschränkten Armen und einem Lächeln
blieb ich vor der Bühne stehen.
» … und denkt daran, Kinder, immer schön …«, er stockte, als sein
Blick auf mich fiel und wandte sich mir vollends zu.
»Hi«, sagte ich zögerlich und starrte zu ihm auf.
»Ich … weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Lisa hat mir vorhin gest-
anden, dass sie die Sache mit ihrer Freundin eingefädelt hat und ich …
deshalb wollte ich mich bei dir entschuldigen«, sprach ich. Er warf einen
Blick über meinen Kopf hinweg und sah mich dann wieder an und weil er
nichts sagte, fuhr ich fort: »Nicht nur, dass ich dir nicht geglaubt habe,
sondern auch, dass ich dich gedrängt habe, über deine Vergangenheit zu
sprechen. Hinterher ist es natürlich leicht zu sagen, aber … es war nicht
richtig und du hattest allen Grund, es für dich zu behalten.« Wieder sah
er über meine Schulter, doch ich nahm es als Zeichen, dass er mir nicht in
106/117

die Augen sehen konnte. Und wie auch? Ich hatte mich schrecklich
benommen und an seiner Stelle könnte ich meinen Anblick auch nicht er-
tragen. Doch egal, wie sehr er mich dafür hasste, dass ich seine Vergan-
genheit aus ihm rausgequetscht hatte, ich wollte mich wenigstens
aufrichtig entschuldigen.
»Weißt du … ich bin es nicht gewöhnt, einen Mann so nah an mich
ranzulassen und auch wenn wir erst seit kurzem wirklich miteinander zu
tun haben, kann ich von ganzem Herzen sagen, dass ich jeden Augenblick
mit dir genossen habe. Es ist wunderbar, was du hier für die Kinder tust
und zu wissen, dass du so eine … schwierige Vergangenheit hattest …« Ich
musste abbrechen, weil mir die Stimme zu versagen drohte. So viele Emo-
tionen kochten in mir hoch. Schuldgefühle, Scham, aber auch Mitleid und
alles gleichzeitig zu empfinden, machte mich einen Moment sprachlos. Er
wollte etwas sagen und hatte den Mund schon geöffnet, doch ich hinderte
ihn daran und kam die Bühne hochgeklettert.
»Nein, warte. Bevor du etwas sagst, wobei ich mir vorstellen kann,
wie deine Worte ausfallen und ich kann dir versichern, dass du meine
vollste Zustimmung hast, will ich, dass du weißt … ich wünschte, ich hätte
die Worte niemals zu dir gesagt. Vielleicht hättest du dich mir irgend-
wann von selbst geöffnet, aber ich war einfach so verwirrt und … als das
Mädchen in diesem Bademantel vor mir stand, habe ich einfach rot gese-
hen. Also, was ich damit sagen will … es tut mir wahnsinnig leid und
wenn ich es rückgängig machen könnte, würde ich es auf der Stelle tun.«
Ich trat näher an ihn heran, um besser sein Gesicht sehen zu können und
während ich das tat, zog er seinen falschen Bart ab.
»Mir tut es auch leid, aber du musst mich mit jemandem verwech-
seln«, sagte er und seine Stimme sowie das Gesicht ließen mich gleicher-
maßen erstarren. Das war nicht Tobias, dem ich da gerade mein Herz
ausgeschüttet hatte, sondern jemand, der mir vage bekannt vorkam.
Tut mir leid«, sagte er noch einmal, denn ich war zu nichts anderem
fähig, als dumm aus der Wäsche zu schauen. Wenn er nicht Tobias war,
wo war er dann verdammt nochmal? Da erklang Beifall aus dem Dunkel
des Saals und als ich mich zu den Zuschauersitzen drehte, kam eine
Gestalt auf uns zu. Zu ihm hat er also die ganze Zeit geschaut, dachte ich
107/117

mir, während der echte Tobias zur Bühne hochkam und nun wusste ich
auch, wer der Weihnachtsmann vor mir war: Es war Tobias’ Kumpel vom
Weihnachtsmarkt.
»Das nenne ich doch mal eine bühnenreife Vorstellung«, sagte Tobias
grinsend und blieb vor mir stehen. Er nickte seinem Kumpel zu und
dieser zog sich aus dem Raum zurück, dann richtete Tobias den Blick
wieder auf mich und sein Grinsen verschwand. Ich wollte den Mund
aufmachen und mich bei ihm entschuldigen, doch er zog mich wortlos in
die Arme und bettete meinen Kopf an seine Brust. So blieben wir eine
Weile stehen, bis ich es nicht mehr aushielt und sagte: »Es tut mir so leid
...«
»Mir nicht«, schnitt er mir das Wort ab. Nicht? Verwundert lehnte
ich mich zurück, um sein Gesicht betrachten zu können.
»Das verstehe ich nicht, ich war schrecklich zu dir«, sagte ich und sah
ihm forschend ins Gesicht. Nie waren mir sein Gesicht schöner und seine
Augen strahlender vorgekommen, als in diesem Moment, da ich in seinen
Armen war.
»Trotzdem hast du mich dazu gebracht, mich dir zu öffnen. Das habe
ich bisher bei keiner anderen Frau getan und du kannst dir gar nicht vor-
stellen, wie befreiend es ist, keine Geheimnisse mehr haben zu müssen.
Dass du jetzt hier bist, bedeutet, dass du mich trotzdem haben willst und
das ist mehr, als ich mir jemals erhofft habe. Also nein, mir tut es nicht
leid.« Damit legten sich seine Lippen auf meine und wenn ich jemals ein-
en klischeehaften ersten Kuss haben wollte, dann war das hier die per-
fekte Kulisse dafür. Alleine auf einer großen Bühne und in den Armen
eines wundervollen Mannes zu stehen – wer träumte nicht davon? Als
sich unsere Lippen berührten, gab er ein leises Stöhnen von sich und ich
glaubte, ohnmächtig zu werden. Ich schmeckte Minze heraus und spürte
seine warmen Lippen auf meinen pulsieren. Doch so berauschend der
Kuss auch war, ich konnte das schreckliche Gefühl nicht abschütteln, ihm
Unrecht getan zu haben. Er musste es gemerkt haben, denn er ließ von
mir ab und sah mich an.
»Ehrlich, Emily, ich bin nicht sauer.«
»Aber nachdem du aus der Praxis gegangen bist …«
108/117

»Habe ich über deine Worte nachgedacht«, beendet er meinen Satz.
»Und eingesehen, dass du vollkommen recht hast. Wenn schon dieser
eine Vorfall deinen Glauben an meine Aufrichtigkeit erschüttern konnte,
wie sollten wir dann jemals etwas Ernstes daraus machen? Wenn, dann
muss ich mich bei dir entschuldigen, denn ich habe allen Ernstes ge-
glaubt, dass du dich mit meinen fahlen Antworten zufrieden geben würd-
est. Ich habe keine Sekunde daran gedacht, wie du dich fühlen musst und
das war egoistisch, denn für mich war nur wichtig, dass ich endlich je-
manden gefunden hatte, mit dem ich zusammen sein will. Ich habe nur
einige Tage gebraucht, um das zu bereifen. Wenn die Feiertage vorbei
gewesen wären, hätte ich mich ohnehin bei dir entschuldigt.« Ich sah zu
ihm auf, sah in seine unendlich blauen Augen und mein ganzer Körper
schien elektrisiert.
»Aber warum überhaupt ich? Wie kannst du überhaupt Interesse an
mir haben … nachdem, was ich dir angetan habe?«, fragte ich. Ehrlich,
ich verstand es bis heute nicht. Er lachte und zog mich wieder zu sich
heran.
»Das ist es ja gerade. Du warst die erste, die mich weder angehimmelt
hat noch mir hinterhergerannt ist und das war ziemlich erfrischend. Es
hat praktisch meinen Jagdtrieb geweckt, zur Abwechslung einmal selbst
tätig werden zu müssen und ich muss zugeben, es war mir ein großes
Vergnügen, dich davon zu überzeugen, dass du mich willst«, fügte er mit
einem verwegenen Lächeln hinzu. Ich schlug ihm auf die Brust für sein
überhebliches Grinsen, dann sah ich skeptisch zu ihm auf.
»Und was passiert jetzt, wo du mich hast?«
»Jetzt werde ich dich nicht wieder gehen lassen«, sagte er, sichtlich
amüsiert über meinen unsicheren Gesichtsausdruck.
»Gott, du bist so schön und ich glaube, du weißt es nicht mal«, mur-
melte er, während er ganz sanft mit der Hand über meine Wange fuhr.
Seine Worte und der intensive Blick ließen meine Knie weich werden, so
dass ich das Gefühl hatte, auf Wackelpudding zu stehen. Schön? Er fand
mich schön?
»Siehst du, genau das meine ich«, sagte er lächelnd, als hätte er
meine Gedanken gelesen. Aber wahrscheinlich waren sie nur deutlich in
109/117

meinen Augen abzulesen. Dann sah er sich um, wie, um sich daran zu
erinnern, wo er sich überhaupt befand und fragte: »Wie hast du eigent-
lich hierhergefunden?«
»Ich bin mit Lisa gekommen, sie war so freundlich, mich herzubring-
en. Außerdem hat sie gesagt, dass du mir verzeihst, weil du verrückt nach
mir bist«, fügte ich mit einem Grinsen hinzu.
»Und da liegt sie verdammt richtig«, sagte er und küsste mich erneut.
110/117
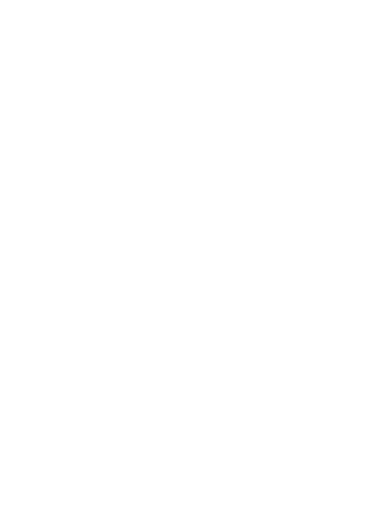
Epilog
»Haben wir auch genug Pappgeschirr und ist die Bowle schon vorbereit-
et?«, fragte meine Mutter, zum gefühlt hundertsten Mal. »Jap. Hab alles
doppelt und dreifach kontrolliert«, bestätigte ich und legte ihr einen Arm
um die Schulter. Der ganze Tag war ziemlich stressig gewesen, denn
nachdem Tobias und ich den Saal verlassen hatten, war mir die spontane
Idee gekommen, meine Eltern einzuladen und Weihnachten mit ihm und
den Kindern gemeinsam zu feiern. Die beiden hatten sich sofort dazu
bereit erklärt, doch für die perfekte Feier hatte noch einiges an Deko,
Geschirr und Gebäck gefehlt. Um letzteres hatte sich meine Mutter
gekümmert, die, abgesehen von den zwei Schokokuchen, die sie bereits
gestern gebacken hatte, noch drei Stück in Rekordzeit nachbereitete.
Sie wollte, dass alle 53 Kinder ein Stück bekamen, also hatte sie sich
ans Backen gemacht, während Tobias und ich das Pappgeschirr und die
Bowle einkaufen fuhren. Da die meisten Mitarbeiter Weihnachten mit
ihren eigenen Familien feierten, hatten wir nicht viele Helfer zur Hand,
doch Olivia und Yvonne erklärten sich dazu bereit, uns bei den Vorbereit-
ungen zu unterstützen und die Dienstältesten Agnes, Berndt und Anette
waren sowieso jedes Jahr dabei. Der große Weihnachtsbaum und die Ges-
chenke für die Kinder hatte man zum Glück schon vor einigen Tagen
beschafft, so dass wir nur noch die Buffets aufbauen und das Essen her-
schaffen mussten. Auch Lisa war mit dabei und half uns, wo sie nur kon-
nte und als wäre nie etwas zwischen uns geschehen, bereiteten wir
zusammen die Kinderbowle zu. Tobias fand es eigenartig, dass wir uns
plötzlich so gut verstanden, doch ich hatte ihm erklärt, dass wir eine
Vereinbarung getroffen hatten und sich diese in diesem Moment erfüllt
hatte, als er mich küsste. Daraufhin hatte er gesagt, dass Frauen ihm
manchmal Angst machten und wir hatten uns darüber amüsiert.
Als mir jemand auf die Schulter tippe, ließ ich von meiner Mutter ab
und sah in Tobias’ Gesicht. Meine Mutter hatte ihn und meinen Vater los-
geschickt, um Sekt und Knabbereien für uns Erwachsene zu holen und

offensichtlich waren sie wieder zurück. »Hab dir was mitgebracht«, sagte
er und hielt mir ein Kostüm vor die Nase.
»Was ist das?«, fragte ich lachend und nahm es entgegen.
»Jeder Weihnachtsmann braucht eine helfende Elfe, die ihm beim
Geschenke verteilen hilft«, erklärte er, während ich es ausbreitete.
»Sehe dich also hiermit als meine Gehilfin eingestellt«, sagte er und
reichte mir zudem noch eine Elfenmaske.
»Und bekommen Angestellte nicht für gewöhnlich einen Lohn?«,
fragte ich. Er senkte seine Stimme und sagte: »Keine Sorge, deine
Belohnung bekommst du, wenn wir alleine sind.« Damit gab er mir einen
Kuss auf den Mund und rauschte davon. Vollkommen beflügelt stellte ich
mich wieder neben meine Mutter und als ich mir Bowle einschenkte,
denn ich brauchte jetzt dringend eine Erfrischung, fragte sie doch tat-
sächlich: »Bist du sicher, dass du keine Du weißt schon brauchst?« Ich
verschluckte mich an meinem Getränk und lief davon, um ihrem ver-
rufenen Grinsen zu entkommen. Ehrlich, diese Frau war unmöglich!
Pünktlich um achtzehn Uhr hatte Tobias dann seinen Auftritt und ob-
wohl ich als Elfe nichts anderes zu tun hatte, als die Geschenke zu ver-
teilen, hatte ich in meinem Leben noch nie etwas Sinnvolleres und Erfül-
lenderes getan. Ich verstand nun, warum er es tat und dass lachende
Kindergesichter mehr waren, als man sich jemals mit Geld kaufen konnte.
Knapp zwei Stunden später war die Geschenkevergabe vorbei und
während die Kinder ihre Präsente auspackten und damit spielten, verteil-
ten wir Kuchen und Bowle an sie. Am Ende des Tages schauten wir uns
im Saal eine Theateraufführung an, welche für die Kinder organisiert
worden war und die von engagierten Darstellern vorgeführt wurde.
Wir Erwachsenen hatten uns mit unseren Sektgläsern in die hinterste
Reihe zurückgezogen, während die Kinder an der Bühne saßen und dem
Schauspiel gebannt folgten. Ich hatte mich auf Tobias’ Schoß
niedergelassen und ihm die Arme um den Hals geschlungen.
»Es muss Schicksal sein, dass wir uns getroffen haben«, sagte er
irgendwann.
»Denn wenn man bedenkt, dass ich keine Schulbeziehung wollte und
du keine Lust auf einen Freund hattest, ist es doch ein Wunder, dass wir
112/117

jetzt hier zusammen sitzen oder? Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich
auf dem Weihnachtsmarkt nur für meinen Kumpel Max eingesprungen
war.«
»Was?«, fragte ich lachend und sah ihn an.
»Nein, wirklich. Meine Schicht war eigentlich schon vorbei, aber weil
sich dieser Trottel am Bratwurststand verquatscht hatte, musste ich für
ihn übernehmen. Andererseits hätten die Kinder einen leeren Schlitten
vorgefunden«, erklärte er. Mein Lachen wurde lauter.
»Bedeutet das, dass ich jetzt auf seinem Schoß sitzen würde, wenn er
sich nicht verquatscht hätte?« Tobias zog mich fest an sich heran und biss
mir sanft in den Hals, was mich zappeln und quietschen ließ.
»Niemals«, murmelte er an meine Haut, während er mich mit Küssen
bedeckte. Ich sah, wie mein Vater uns einen verstohlenen Blick zuwarf
und schob Tobias’ Kopf eilig weg.
»Nicht hier, zu viel Publikum«, raunte ich ihm zu. Er folgte meinem
Blick und sah noch, wie mein Vater das Gesicht abwandte, dann sah er
mich an und wir lachten beide.
»Aber zurück zu meiner Erkenntnis«, fuhr er dann fort.
»Ich finde wir passen genau deshalb zusammen, weil wir eben nicht
verzweifelt nach einer Beziehung gesucht haben. Jeder hatte seine eigen-
en Gründe, einer festen Bindung abzusagen, aber jetzt habe ich keine
Angst mehr davor. Auch wir werden unsere persönlichen Dramen haben.
Jedes Paar hat welche und ich habe begriffen, dass man nicht davor we-
glaufen kann, genauso wenig wie vor seiner Vergangenheit. Also frage ich
dich, Emily Bergmann, wollen wir es versuchen?« Ich schaute in seine
strahlendblauen Augen und spürte mein Herz höher schlagen. Dieser
Mann hatte so viel Leid erlebt und dennoch hatte er sich aufgerafft und
sein Leben umgekrempelt, um sich für diese wundervollen Kinder einzu-
setzen. Er hat es vielleicht verheimlicht, aber sich selbst nie verleugnet,
wo er herkommt, denn er war für diese Kinder da und spendete ihnen
damit unvergessliche Momente.
Momente, die er in seiner Kindheit vielleicht nie gehabt hatte. Wollte
ich mit so jemandem zusammen sein? Konnte ich jemanden wie ihn
lieben? Als Antwort beugte ich meinen Kopf zu ihm herunter und küsste
113/117

ihn.
Ende
114/117

Lesen Sie auch
Eine Zugfahrt ins Glück
Um endlich von ihrer störrischen Mutter wegzukommen, zieht die 25
Jährige Sophia nach Berlin und möchte dort ein neues Leben anfangen.
Leider stellt sich die Fahrt dorthin als absolute Katastrophe heraus, denn
sie muss sich die Kabine mit einem unverschämt arroganten aber leider
auch gutaussehenden Geschäftsmann teilen, der sie fortwährend pro-
voziert. Während der Fahrt lassen die beiden ordentlich die Fetzen fliegen
und als sie Berlin endlich erreicht und den Albtraum hinter sich glaubt,
sieht sie den Mann bei ihrem ersten Arbeitstag wieder … als ihren neuen
Chef.
Eine witzige und freche Liebesgeschichte über zwei Menschen, die mehr
gemeinsam haben, als es auf den ersten Blick scheint.
Love and Fire – Eric
Eigenständiger Roman
Die neunzehnjährige Mary ist auf dem Weg zu ihrer großen Schwester
Emma, als ihr Zug auf halber Strecke stehen bleibt und sie notgedrungen
in einem Gasthaus übernachten muss. Dort angefallen, wird sie in letzter
Sekunde von dem unverschämten aber gutaussehenden Eric gerettet,
doch dieser nutzt die Gelegenheit prompt für eine Erpressung aus.
Während sie sich also gezwungenermaßen mit ihm zusammentun muss,
entwickelt sie widersprüchliche Gefühle für ihn, doch Eric scheint etwas
zu verbergen und schon bald müssen beide erfahren, dass sie enger
miteinander verbunden sind, als ihnen lieb ist.
Eine witzige und prickelnde Liebesgeschichte.

Zuckersüßes Chaos
Claire und Jason sind endlich zusammen und alles könnte schön sein,
würde Jason sich nicht plötzlich so sonderbar verhalten. Als sie ihn im-
mer wieder mit derselben Frau zusammen sieht, packt Claire die Eifer-
sucht, doch was ist in ihn gefahren, dass er auf einmal ihre Beziehung
aufs Spiel setzt? Jason muss sich bald entscheiden, was ihm wichtiger ist
und als ob Claire nicht schon genug Probleme hat, muss sie sich auch
noch mit Taylors verkorksten Exfreundin herumschlagen, die ihn in einen
Drogensumpf zu ziehen versucht.
116/117
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Fox, Miranda J Eine Zugfahrt ins Glueck
Weihnachtswunder
Cathryn Fox Blood Ties
Laser FOX
2005 FOX RearShock DHX instrukcja obsługi
Vor?r Gelegenheit?r weihnachten?r Götter Gnade
Weihnachtswunsche
weihnachten
Fox fire
zyczenia weihnachten, Ich Fröhes Weihnachten, viel Gesund, Erfolg und ein glückliches Neues Jahr
7e 24ook flirt kurs vom anbaggern zum flirten deutsch german YNLRH5E5PJFDFH7C3WYQHZMFTOWNOK
Regierungserklärung?s Bundeskanzlers Willy Brandt vom(
Dr Berrenda Fox O Nowym DNA i Jak Sobie Radzić Ze Zmianami
Denosky, Kathie Texas Cattleman Club 05 Diese Lippen muss man kuessen
WEIHNACHTEN
instrukcja do sterownika firmy FOX
The?t and the Fox
więcej podobnych podstron