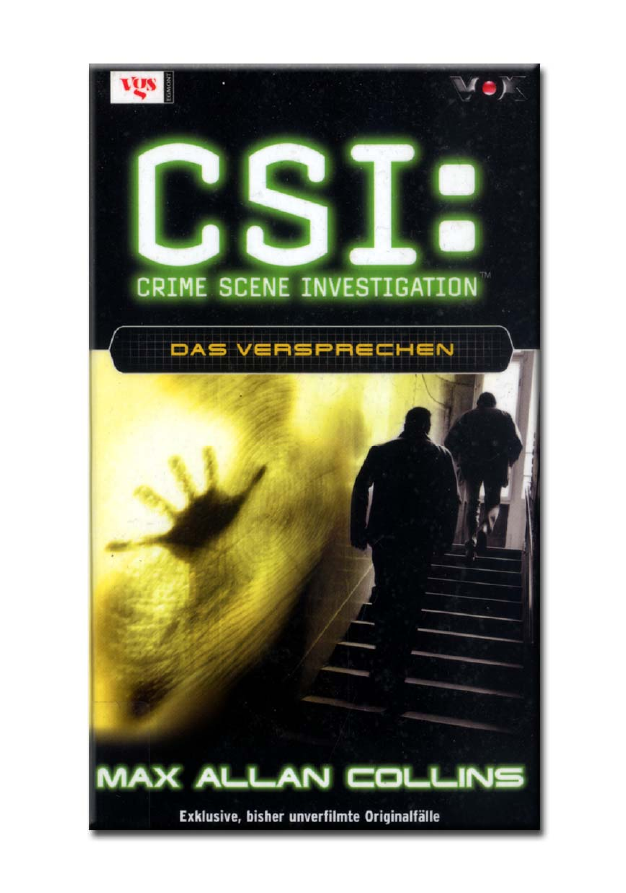

Max Allan Collins
CSI:
Das Versprechen
Aus dem Amerikanischen
von Antje Görnig
vgs

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Das Buch »CSI: Das Versprechen« entstand auf der Basis der
gleichnamigen Fernsehserie von Anthony E. Zuiker, ausge-
strahlt bei VOX.
© des VOX-Titel-Logos mit freundlicher Genehmigung
© 2005 CBS Broadcasting Inc. and Alliance Atlantis
Productions, Inc. CBS Broadcasting Inc. and Alliance Atlantis
Productions, Inc. are the authors of this program for the
purposes of copyright and other laws.
1. Auflage 2005
© der deutschsprachigen Ausgabe: Egmont vgs Verlagsgesell-
schaft mbH
Alle Rechte vorbehalten.
Lektorat: Katharina Tilemann
Produktion: Sandra Pennewitz
Umschlaggestaltung: Sens, Köln
Senderlogo: © VOX 2005
Titelfoto: © 2005 CBS Broadcasting Inc. and
Alliance Atlantis Productions, Inc.
Satz: Achim Münster, Köln
Druck: Clausen & Bosse, Leck
Printed in Germany
ISBN 3-8025-3472-7
www.vgs.de

Vor 10 Jahren hat ein Serienmörder Las Vegas un-
sicher gemacht, der nie gefasst werden konnte.
Jetzt setzt sich die bizarre Mordserie – die Opfer
werden alle stranguliert und verstümmelt – plötz-
lich fort. Die unermüdlichen Mitarbeiter vom CSI
Las Vegas vermuten, dass es sich um einen Nach-
ahmer handelt, da sich die neuen Morde in kleinen
Details von den alten unterscheiden. Dieser Ver-
dacht wird zur Gewissheit, als sich der Täter von
damals meldet und sich über die dilettantischen I-
mitationen seiner Morde beklagt. Die drehbuchhaft
schnörkellos erzählten CSI-Romane sind gewiss
kein literarisches Highlight; der vorliegende Band
mit seinem originellen Plot ist aber stimmig aufge-
baut und bis zur letzten Seite enorm spannend.

Für Terri und Rod – hübsch gebunden.
Ich möchte meinem Assistenten, dem Forensikexperten und
Co-Plotter Matthew V. Clemens danken,
der mich bei diesem Buch unterstützt hat.
M.A.C.

Der kluge Denker zieht das Unwahrscheinliche ebenso in
Betracht wie das Wahrscheinliche.
(R. Austin Freemans DR. JOHN THORNDYKE)
Nichts ist einfacher, als einen Menschen zu töten;
schwierig wird es, wenn man den Konsequenzen
zu entgehen versucht.
(Rex Stouts NERO WOLFE)

Die Panik brach über Marvin Sandred herein wie der kalte,
raue Wind aus den Bergen über die Wüste von Nevada.
Als er wieder zu sich kam, wurde ihm als Erstes seine abso-
lute Hilflosigkeit bewusst. Jemand riss ihm buchstäblich den
Arsch auf, und das Seil um seinen Hals drohte ihm die Luft
abzuschnüren. Sein Körper bebte und zuckte, wodurch die
Schlinge sich immer enger um seinen Hals legte und mit jeder
Sekunde fester zuzog.
Marvin schlug um sich und versuchte zugleich, seine At-
mung zu kontrollieren und gleichmäßig Luft zu holen. Er hatte
weder die Zeit, noch war er in der Verfassung, seine Lage
einzuschätzen. Er wusste nur, er war zu Hause, im Wohnzim-
mer seines kleinen Hauses im Norden von Las Vegas – und lag
bäuchlings auf dem Boden. Ihm taten sämtliche Knochen weh,
seine Lunge brannte und sein Widersacher saß rittlings auf
seinem Hinterteil. Die Schlinge schnürte ihm allmählich die
Luftröhre zu, und er rang japsend nach Atem.
Im Raum roch es nach seinem Schweiß, und das Seil schien
ebenso viel Druck auf seine Blase auszuüben wie auf seinen
Hals.
Das Schlimmste aber, die größte Demütigung, war seine
Nacktheit – man hatte ihm die Kleider vom Leib gerissen. Er
hatte größte Mühe, seinen Harndrang zu unterdrücken. Ihm
war kalt und heiß zugleich, er ruderte kraftlos mit den Armen,
kämpfte gegen das Ersticken und fragte sich, ob er seine Blase
nicht einfach entleeren sollte, um sich wenigstens von diesem
Schmerz zu befreien. Marvin Sandred erlebte ganz real, was
sich hinter einem abstrakten Begriff verbarg.
Terror.
Terror, dieses Wort, das täglich in den Nachrichten auf-
tauchte, war nichts Abstraktes, sondern eine sehr reale emotio-
nale und körperliche Erfahrung. Der reine Terror – Schmerz

und Hilflosigkeit und Angst und Verzweiflung – und, zu allem
Übel, Hoffnung. Er war immerhin noch am Leben. Er war
irgendwie in diese Sache hineingeraten, und er konnte wieder
herauskommen. Er konnte überleben…
Als es vorhin geklingelt hatte, war Marvin zur Tür gegan-
gen. Durch den Spion hatte er einen gut gekleideten Mann mit
einem schwarzen Anzug gesehen, der ein Zeuge Jehovas oder
ein Mormonenmissionar hätte sein können, aber diese Leute
traten immer paarweise auf, und der Mann an seiner Tür war
allein gewesen.
Marvin hatte schon vor langer Zeit gelernt, dass es in dieser
Welt vieles gab, worauf der Einzelne keinen Einfluss hatte.
Aber bei sich zu Hause war man König. Da musste man sich
nicht von Telefonwerbern und klinkenputzenden Vertretern
belästigen lassen. Wozu hatte er eigentlich das »Betteln und
Hausieren verboten«-Schild an seiner verdammten Tür?
Marvin sah in dem Mann vor seiner Tür einen von diesen
Störenfrieden, die es wagten, in seine Privatsphäre einzudrin-
gen, und so hatte er entrüstet die Tür aufgerissen, um dem Kerl
einen Tritt in den Hintern zu geben und ihn in die Wüste zu
jagen… aber er hatte kein einziges Wort sagen können, denn
alles lief ganz anders, und zwar entsetzlich und ganz schreck-
lich.
Ob man ihn unter Drogen gesetzt, ihm einen Faustschlag
verpasst oder ihm eins mit einem Schraubenschlüssel überge-
zogen hatte, wusste er nicht. Und vielleicht würde er es auch
nie erfahren. In diesem Moment lag er jedenfalls nackt auf dem
Boden, und der raue Teppich scheuerte an seinen Brustwarzen,
seinem stattlichen Bauch und den Genitalien, während sich die
Schlinge um seinen Hals immer mehr zuzog. Er hörte auf, um
sich zu schlagen und versuchte, das verdammte Seil zu lockern,
aber es gelang ihm einfach nicht, seine Finger drunterzuschie-
ben.

Der Angreifer hatte ihn in seiner Gewalt, und Marvin wuss-
te, dass die Entscheidung über sein Leben einzig von ihm ab-
hing.
Einen Hoffnungsschimmer gab es jedoch…
Marvin wusste, dass auf dem Beistelltisch ein Brieföffner
lag, unter der Morgenzeitung und einem Stapel Rechnungen.
An den musste er irgendwie herankommen. Unter großer Mühe
streckte er die linke Hand nach ihm aus, aber sein Arm war so
schwer, als lastete ein ganzer Kühlschrank darauf.
Augenblicklich schlug ihm sein Peiniger auf den Arm, und
Marvin hatte keine Kraft mehr, ihn noch einmal anzuheben.
Als das Atmen immer schwerer und das Überleben immer
unwahrscheinlicher wurde, kam ihm zwischen panischen Be-
freiungsversuchen in den Sinn, was für eine blöde Idee es
gewesen war, nach Las Vegas zu ziehen.
Dann fiel ihm seine Frau Annie ein: ihr hübsches Gesicht
und das Lächeln, das sie ihm so oft geschenkt hatte, bevor sie
ihn im vergangenen Jahr verlassen hatte.
Obwohl diese Gedanken nur kurz aufblitzten, waren sie von
nachhaltiger Wirkung: Marvin merkte, dass er seine Ex-Frau
immer noch vermisste. Er wünschte, er wäre so schlau gewe-
sen, in Eau Claire zu bleiben und seine Ehe zu kitten, statt sein
ganzes Leben wegzuwerfen und in die Stadt der Träume zu
ziehen…
Er war ein Idiot gewesen. Und er war immer noch einer.
Das war ihm klar, obwohl ihm die Luft abgedrückt wurde und
er vermutlich einen seiner letzten keuchenden Atemzüge tat…
Ein gottverdammter Idiot, der sich seine Rentenversicherung
hatte auszahlen lassen, der Annie vertrieben hatte und ein
neues Leben hatte beginnen wollen.
Marvin Sandred war an der Schwelle des Todes nicht der
Luxus einer längeren, gründlicheren Betrachtung seines Le-
bens und Scheiterns vergönnt. Viele Leute waren in die Stadt

der Träume gekommen, von Bugsy Siegel bis Howard Hughes,
von Liberace bis Penn und Teller.
Als ehemaliger stellvertretender Direktor von Eau Claire
Steelworks war Marvin Sandred einer von hunderttausenden
Träumern gewesen, die in die Neonoase gezogen waren; nicht
besuchsweise, sondern um dort zu leben.
Marvins Traum war vergleichsweise bescheiden gewesen,
jedoch ebenso unrealistisch wie der anderer Vegas-Träumer.
Als Annie in die Wechseljahre kam, setzte Marvins Midlife-
Crisis ein, und der Sechsundvierzigjährige hatte das Gefühl
gehabt, das Leben rinne ihm durch die Finger, er habe seine
Chancen nicht genutzt und seine Träume verraten, indem er
sein Leben lang danach getrachtet hatte, »das Richtige« zu tun.
Er hatte begonnen, sich Pokerturniere auf ESPN anzusehen,
dann hatte er selbst im Internet gespielt, bis seine Frau ein
Machtwort sprach, als er gerade begann, kleine Gewinne zu
machen. Danach hatte er mit einem Computerspiel für zehn
Dollar geübt und sich sehr gut geschlagen; so gut, dass er
schließlich beschloss, nach Las Vegas zu gehen, um professio-
nell Poker zu spielen.
Durch die Auszahlung seiner Rente hatte Marvin gerade ge-
nug Geld gehabt, um nach Vegas zu reisen und eine Anzahlung
für einen kleinen Bungalow zu leisten, der ein Neuanfang für
ihn und seine Frau – sie waren kinderlos – sein sollte. Für sie
war es jedoch das Ende gewesen.
Den Rest seines Geldes hatte Marvin in die Verwirklichung
seines Traums gesteckt, der nächste Amarillo Slim oder Doyle
Brunson zu werden. Der Traum hatte sich allerdings ziemlich
schnell zerschlagen, denn gegen den Computer hatte er viel
besser abgeschnitten als gegen Spieler aus echtem Schrot und
Korn. Nach zwei Turnieren nahm Sandred einen Job in der
Verkaufsabteilung einer Firma für Schweißgeräte an. Von
diesem Zeitpunkt an ging es mit seinem Traum bergab, und er

verspielte seine mageren Einkünfte regelmäßig im Casino beim
Texas Hold’em.
Dennoch hatte Marvin nicht aufgegeben, und der krankhafte
Optimismus eines Spielers war ihm erhalten geblieben bis zu
diesem Moment, in dem sein Traum von diesem verheerenden
Albtraum verschlungen wurde und sein Peiniger noch fester an
dem Seil zog…
Marvin spürte, wie sein Kopf schwer wurde. Er wäre auf
den Boden gesackt, aber das Seil um seinen Hals holte ihn
regelmäßig wieder hoch. Nur seine Stirn streifte in dem Auf
und Ab immer wieder über den rauen Teppich. Hinter seinen
Augenlidern sah er ein Feuerwerk bunter Lichter, und für
einen Moment war er in der Stadt, in der Glitzerschlucht, und
sah auf dem großen Monitor über der Straße Frank Sinatra,
der »Luck be a Lady« sang. Marvins Arme waren wie aus
Gummi, und seine Tränen vermischten sich mit Schweiß, als
sein Traum sich auflöste und sein Kopf von einem Albtraum
erfüllt wurde, der nicht enden würde, wenn er aufwachte,
sondern wenn er einschlief.
Für immer.
Und als die bunten Lichter schwanden und Finsternis über
ihn hereinbrach, sah Marvin Sandred Annie vor sich, die trau-
rig lächelnd den Kopf schüttelte, wie bei ihrem Abschied, und
sagte: »So ist das nun mal, Marvin. Des einen Traum ist des
anderen Albtraum.«

1
Der ehemals so adrette Norden von Las Vegas wurde allmäh-
lich immer schäbiger. Der Funkspruch mit dem Code 420 – die
Meldung eines Mordes – hatte nur ein Polizeifahrzeug nach
draußen gelockt. Hätte der Tatort auf dem Strip gelegen, wären
sämtliche Streifenwagen mit Blaulicht und Sirenen herbeige-
rast wie bei einem Präsidentenattentat. Aber dieser Polizeiwa-
gen parkte nun vor dem Bungalow, als wäre es das Zuhause
des Officers… und nicht der Schauplatz eines Mordes.
Aber es war ein Mord, der den Leiter des CSI der Las Vegas
Police, Gil Grissom, in dieses leicht verkommene Wohngebiet
führte, und das nicht zum ersten Mal. Noch konnte man nicht
von Gewohnheit sprechen, aber die Einsätze in dieser Gegend
nahmen eindeutig zu.
Grissom kam in das Viertel gerauscht wie der Todesengel –
wenn auch ein lässig gekleideter: Sonnenbrille, Poloshirt,
Hose, Schuhe, alles in schwarz. In sein dunkles, krauses Haar
mischten sich jedoch graue Strähnen. Und auch in den Bart,
den er sich wachsen ließ, um Zeit zu sparen – nur um festzu-
stellen, was für eine Last es war, ihn regelmäßig stutzen zu
müssen. Er hatte bestimmt schon zwanzig Mal mit dem Ge-
danken gespielt, sich das verdammte Ding wieder abzunehmen,
aber der erforderliche Zeitaufwand war ihm einfach zu groß.
Sein Leben war seine Arbeit, und seine Arbeit war der Tod.
Nick Stokes, der am Steuer saß, parkte den schwarzen Ta-
hoe des CSI hinter dem Streifenwagen. Kurz darauf traf War-
rick Brown mit dem anderen Tahoe ein. Grissom und Stokes

waren mit dem ersten Wagen vorausgefahren, während War-
rick seine CSI-Kolleginnen Catherine Willows und Sara Sidle
mitgebracht hatte.
Nick war als ehemalige College-Sportskanone gut gebaut,
hatte kurzes, dunkles Haar und meist ein unbeschwertes Lä-
cheln im Gesicht, das darüber hinwegtäuschen konnte, wie
ernst er seine Arbeit nahm. Der Spurenermittler mit dem mar-
kanten Kinn trug Jeans und ein T-Shirt mit dem aufgestickten
Abzeichen des Las Vegas Police Department.
Warrick war groß und schlank und wirkte meistens ziemlich
ernst, aber hin und wieder kam sein trockener Humor durch.
Mit seinem braunen T-Shirt, das er locker über der khakifarbe-
nen Hose trug, wirkte der schlaksige Schwarze noch lässiger
als Nick, aber Grissom wusste, dass die beiden jungen Männer
Biss hatten und ausgezeichnete Experten und engagierte Mitar-
beiter waren.
Sara Sidle macht einen resoluteren Eindruck als ihre männ-
lichen Teamkollegen. Sie trug ihr dunkles Haar schulterlang
und war mit ihrem ockerfarbenen T-Shirt und den braunen
Hosen wie immer bequem gekleidet. Dennoch war sie auf ihre
Art eine ebenso beeindruckende Erscheinung wie Catherine
Willows, eine Rothaarige mit den fein geschnittenen Zügen
eines Models und dem schlanken Körper einer Tänzerin. Trotz
ihres hellblauen Tops und den marineblauen Hosen sah sie aus,
als gehörte sie eigentlich auf die Bühne, obwohl mittlerweile
eine erstklassige Wissenschaftlerin aus ihr geworden war.
Grissoms Team hatte eigentlich immer die Nachtschicht,
doch seine Leute machten aus akutem Personalmangel Über-
stunden, um für die wegen Gerichtsterminen und Urlaub feh-
lenden Kollegen der Tagschicht einzuspringen. Normalerweise
tauchten sie ja mitten in der Nacht an einem Tatort auf, aber an
diesem trafen sie ein, als die Sommersonne bereits hoch am

wolkenlosen blauen Himmel stand. Die Hitze war trocken, aber
nicht drückend; eigentlich das schönste Urlaubswetter.
Grissom nahm seine Sonnenbrille ab und betrachtete den
Bungalow. Er war winzig und in einem für die Gegend recht
ordentlichen Zustand. Durch den kleinen Vorgarten mit einem
Fahnenmast führte ein rissiger Gehweg zur offen stehenden
Haustür. Es regte sich kein Lüftchen, und die beiden Fahnen –
eine von den Green Bay Packers, darüber die amerikanische –
hingen schlaff an dem Mast herunter. In der kiesbedeckten
Einfahrt neben dem Bungalow stand ein dunkelblauer Chevy
aus den frühen Neunzigern.
Obwohl links und rechts ebenfalls Wohnhäuser standen,
machte der Bungalow irgendwie einen einsamen, verlassenen
Eindruck auf Grissom. Auf dem Asphalt vor dem Grundstück
flirrte die Hitze, aber über dem Haus selbst lag etwas Trauri-
ges, Düsteres.
Als der CSI-Leiter aus dem Tahoe ausstieg, bemerkte er aus
den Augenwinkeln einen Ford, der gerade auf der anderen
Straßenseite anhielt. Er blieb stehen und drehte sich zu dem
Detective um, der aus dem Wagen stieg, einem hageren Kerl
von über einsneunzig in einem schlecht sitzenden grauen An-
zug: Bill Damon. Er war Ende zwanzig und seit fünf, sechs
Jahren beim Police Department von Nord Las Vegas. Vor
knapp einem Jahr war er zum Detective befördert worden.
Seine Hosen schienen immer ein paar Zentimeter zu kurz, und
in seine Jacken hätte er zweimal gepasst, aber Damon leistete
gute Arbeit. Obwohl ihm als Detective noch die Erfahrung
fehlte, war er ein guter Cop und trug das Herz am rechten
Fleck.
Nord Las Vegas hatte über hunderttausend Einwohner und
verfügte über ein eigenes Police Department. Die Spurener-
mittler der Las Vegas Police waren jedoch für den gesamten
Clark County zuständig und arbeiteten daher gelegentlich mit

Detectives aus anderen Departments zusammen. Grissom hatte
bereits bei mehreren Fällen mit Damon zu tun gehabt, aber
noch nie mit ihm als dem verantwortlichen Detective.
Der junge Polizist kam über die Straße auf Grissom zu und
streckte ihm die Hand entgegen – lange, schlanke Finger mit
dicken, knubbeligen Knöcheln. »Gil«, begrüßte er ihn. »Lange
nicht gesehen.«
»Allerdings«, entgegnete Grissom mit einem unverbindli-
chen Lächeln.
»Waren Sie schon drin?«
Der CSI-Leiter schüttelte den Kopf. »Bin gerade erst ge-
kommen. Wir wissen nur, dass es ein Code 420 war.«
Damon zuckte mit den Schultern. »So viel weiß ich auch.
Dann informieren wir uns am besten mal…«
»Gute Idee.«
Während Grissoms Leute ihre Ausrüstung aus den Fahrzeu-
gen luden, trat ein stämmiger, eher klein geratener Uniformier-
ter aus der Haustür. In der einen Hand hatte er einen Kugel-
schreiber, in der anderen ein Notizbuch. Auf seinem Namens-
schild stand LOGAN. Er war um die vierzig und hatte kurzes
Haar, in dem hier und da ein Hauch von Grau zu sehen war.
Mit seiner Größe hatte er so gerade eben noch die Vorausset-
zung für den Polizeidienst erfüllt. Der hoch aufgeschossene
Damon wirkte neben ihm wie ein Riese.
Logan nickte Grissom zu und begrüßte dann den Detective
aus seinem Department. »Hey, Bill.«
»Hey, Henry«, sagte Damon.
Damit war der Smalltalk beendet.
Logan wies auf den Bungalow. »Eine wirklich scheußliche
Sache! Ein Mann wurde in seinem Wohnzimmer ermordet –
und es sieht alles andere als gemütlich da drin aus.«
»Waren Sie schon im Haus?«, fragte Grissom alarmiert.

Logan nickte und zuckte mit den Schultern. »Aber keine
Sorge, die Beweisspuren sind alle noch da, und zwar in rauen
Mengen. Ich habe lediglich das Haus kontrolliert und mich
davon überzeugt, dass der Mörder weg ist. Er ist auf demselben
Weg raus, wie er reingekommen ist.«
»Gut«, sagte Grissom und studierte den Bungalow erneut.
Kein Fliegengitter, und die Haustür stand sperrangelweit of-
fen.
»Haben Sie die Tür aufgemacht, Officer Logan?«, fragte er.
»Nein, zum Teufel! Sehe ich etwa aus wie…«
»Haben Sie das schon mal gemacht, den Tatort eines Mor-
des gesichert?«
»Im Laufe der Jahre habe ich schon jede Menge Leichen
gehabt. Und diesen Toten hier kann man wahrhaftig nicht
übersehen – der Typ liegt mitten im Weg, wenn man herein-
kommt, und ist tot wie Scheiße.«
Grissoms Lächeln schwand. »Officer, wie viele Mordopfer
Sie auch in der Sammlung haben, der Tote verdient auf jeden
Fall mehr Respekt!«
Logan sah ihn an, als käme Grissom von einem anderen
Planeten.
»Sind Sie sicher, dass er tot ist?«, fragte ihn jetzt Damon.
Logan bedachte den Detective mit einem leicht herablassen-
den Blick. »Hey, ich mache das schon ziemlich lange, Bill.
Wie ich sagte, der Typ ist tot wie… man nur sein kann – sonst
hätte ich doch einen Krankenwagen angefordert, und er wäre
schon längst abtransportiert worden. Sehen Sie ihn sich selbst
an!«
Aber Grissom wollte noch mehr Hintergrundinformationen.
»Wer hat den Mord denn gemeldet?«
»Die Nachbarin«, antwortete der Officer und wies mit dem
Daumen über seine Schulter. »Sie ging zum Briefkasten, um
ihre Post zu holen…« Er zeigte auf die Briefkästen, die entlang

des Gehsteigs aufgestellt waren. »Dabei sah sie zufällig die Tür
offen stehen. Der Mann, der in dem Bungalow wohnt…« er
schaute in sein Notizbuch »… der hier gewohnt hat, Marvin
Sandred, hat tagsüber meistens gearbeitet. Als die Nachbarin,
die übrigens…«, Logan sah erneut in sein Notizbuch, »…
Tammy Hinton heißt, also, als sie die offene Tür sah, wurde sie
misstrauisch und ging nachsehen. Als sie die Leiche entdeckte,
hat sie uns sofort angerufen.«
»Und sie sagte, es ist Sandred?«, hakte Grissom nach.
»Ja.«
»Wir sollten mit ihr reden.«
»Ja«, sagte Damon, und es klang, als wolle er die anderen
und sich selbst daran erinnern, wer für diesen Fall zuständig
war. »Wir sollten umgehend mit ihr reden!«
»Ich kann das übernehmen«, sagte Logan. »Ich bin mir al-
lerdings nicht sicher, wie viel sie im Moment erzählen kann.
Sie stand ziemlich unter Schock. Deshalb habe ich sie auch
nach Hause geschickt. Sonst noch was?«
»Nein, Henry«, sagte Damon. »Vielen Dank.«
Logan sah Grissom stirnrunzelnd an. »Bei allem Respekt,
Dr. Grissom – ich weiß, wer Sie sind; das weiß jeder –, aber
ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir gegenüber nicht so
überheblich wären!«
»Dann sagen Sie nicht ›tot wie Scheiße‹, wenn Sie über
Mordopfer sprechen«, entgegnete Grissom ungerührt.
Logans Entrüstung schwand, und er sah Grissom verlegen
an. »Ja, okay, verstanden. Kein Schaden, kein Foul?«
»Noch nicht«, sagte Grissom.
Als Logan zum Nachbarhaus rüberging, fragte Damon.
»Wollen Sie loslegen?«
»Ja.«
Grissom ging, gefolgt von den Kollegen und dem Cop, auf
das Haus zu. »Nick, du übernimmst die Rückseite«, sagte er

über die Schulter. »Und du, Warrick, kümmerst dich um den
Vorgarten.«
»Wird gemacht, Gil«, entgegnete Nick.
Warrick nickte nur.
Während die beiden sich entfernten, ging Grissom mit Ca-
therine und Sara – und Detective Damon im Schlepptau – die
Stufen zur Haustür hoch und blieb davor stehen.
»Sara«, sagte er, während sie sich die Latexhandschuhe ü-
berstreiften, »sieh nach, ob es an der Klingel Fingerabdrücke
gibt.«
Sie nickte und trat zur Seite. Wie die anderen CSI-Kollegen
hatte auch sie ihren Koffer mitgebracht, den sie nun abstellte,
um sich ans Werk zu machen.
Grissom ging mit Catherine ins Haus, während Damon auf
der Veranda blieb und Sara bei der Arbeit zusah. Er versuchte,
Konversation zu machen, aber die Spurenermittlerin war nicht
zum Plaudern aufgelegt.
Im Haus war es dunkel; die Vorhänge waren zugezogen, und es
brannte nirgends Licht. Dennoch erkannte Grissom, dass das
Wohnzimmer sich rechts von ihm befand. Die Küche lag hinter
dem Durchgang am Ende des Flurs, und vom Wohnzimmer
führte ein weiterer Flur zu Schlafzimmern und Bad.
Catherine knipste ihre Taschenlampe an, denn das Licht
konnten sie erst einschalten, wenn sämtliche Schalter auf Fin-
gerabdrücke überprüft waren. Sie leuchtete in die Flure, dann
auf die Leiche, die rechts von ihnen lag.
Im Wohnzimmer roch es nach Tod, speziell nach Schweiß,
Urin und Exkrementen. Mit seinem spärlichen Mobiliar – ein
Sofa, ein Couchtisch und ein Fernseher in der gegenüberlie-
genden Ecke sowie ein paar Beistelltische – wirkte das Haus
von innen genauso einsam und verlassen wie von außen. Auf
dem Couchtisch lagen Zeitungen, eine Hand voll Briefe und

ein paar Fastfood-Schachteln. Ansonsten war alles ordentlich
und sauber – wenn man von der Leiche absah, die mitten im
Zimmer lag.
Als Erstes fiel Grissom die Blutlache ins Auge, die sich um
die verstümmelte Hand des Opfers gebildet hatte. Er holte
seine Taschenlampe heraus und leuchtete den Boden ab, aber
von dem abgeschnittenen Zeigefinger fehlte jede Spur. Viel-
leicht hatte ihn der Mörder als Andenken mitgenommen. »Ich
kümmere mich um die Leiche«, sagte Grissom zu Catherine.
»Du übernimmst den Rest des Hauses.«
Catherine warf einen Blick auf das Opfer. »Er gehört dir…
Seinen Tod hatte er sich wohl auch etwas anders vorgestellt.«
»Hier lässt sich doch bestimmt etwas finden«, sagte Gris-
som, ohne auf ihre Bemerkung weiter einzugehen, während er
den Boden um die Leiche ausleuchtete.
Catherine zog spöttisch eine Augenbraue hoch. »Glaubst
du?«
Sie wandte sich zum Gehen, als Detective Damon endlich
ebenfalls den Weg ins Haus fand. Er blieb wie angewurzelt
stehen, als er den Gestank bemerkte, und hielt sich rasch die
Nase zu. »Wow, also, das ist ja grässlich!«
»Das Opfer hat sich beim Eintritt des Todes entleert«, erläu-
terte Grissom sachlich.
Zwischen den gespreizten Beinen des Toten schwamm Kot
in einer Urinlache. Grissom hatte sich längst an solche Dinge
gewöhnt. Was ihm am meisten zu schaffen machte, war, dass
der strenge Geruch möglicherweise andere subtilere, wichtige-
re Gerüche überdeckte.
»Ich fange in der Küche an«, rief Catherine vom Flur aus
und verschwand mit ihrem Koffer.
Dem Detective wich die Farbe aus dem Gesicht; vielleicht
war das Wort »Küche« in diesem Zusammenhang zu viel für
ihn gewesen.

»Brauchen Sie mich hier?«, fragte er und schluckte hörbar.
»Sie sind uns nur im Weg«, entgegnete Grissom.
»Ich meine, das ist eigentlich mein Tatort…«
Grissom sah ihn bestimmt an. »Nein, es ist meiner. Lassen
Sie mich meine Arbeit tun, dann reden wir… Draußen.«
Dem Detective lag im Moment nicht besonders viel daran,
die Diskussion fortzusetzen, und er verließ fluchtartig das
Haus.
Grissom richtete seine Aufmerksamkeit jetzt auf die Leiche
selbst und verschaffte sich einen ersten Überblick.
Ein weißer Mann, schätzungsweise zwischen fünfundvierzig
und fünfzig. Das Opfer war nackt, hatte ein Seil um den Hals
und lag auf dem Bauch. Der Zeigefinger der rechten Hand war
abgetrennt und allem Anschein nach vom Tatort entfernt wor-
den. Der Kopf des Opfers war zur Seite gedreht, und Grissom
entdeckte einen ersten aufschlussreichen Hinweis: Der Mund
des Toten war mit knallrotem Lippenstift beschmiert.
Der M. O. der Modus Operandi, war für den CSI bei jedem
Mord ein wichtiger Aspekt, aber nur selten setzte ein Mörder
so ein deutliches Zeichen wie in diesem Fall. Dem sonst so
abgeklärten Grissom lief es kalt über den Rücken, aber das
hatte nichts mit Angst oder Abscheu zu tun – ihm war nur klar
geworden, dass er jemanden anrufen musste. Diese Sache
betraf einen alten Kollegen.
Aber wie es seine Art war, beschloss er, zuerst seine Arbeit
zu Ende zu machen. Das Opfer war vermutlich erdrosselt
worden, aber Grissom hütete sich, mehr als nur eine Arbeits-
hypothese daraus zu machen. Er würde das Urteil des Coroners
zu der Todesursache abwarten.
Er nahm seine Kamera aus dem Stahlkoffer und begann zu
fotografieren. Erst das Zimmer, dann die Leiche, schließlich
Nahaufnahmen von dem Toten. Es dauerte eine Weile, aber er
hatte vor langer Zeit gelernt, Geduld zu haben. Und obwohl

ihm vieles durch den Kopf ging, handelte er wie immer nach
dem Motto »schnell, aber nicht übereilt«. Er verdrängte erst
einmal den Anruf, den er zu machen hatte, und fuhr mit der
Bestandsaufnahme fort.
Nach einer Weile kam Sara in den Raum. Im Unterschied zu
Detective Damon reagierte sie überhaupt nicht auf das, was ein
Laie als Gestank bezeichnen würde, denn als professionelle
Spurenermittlerin war sie auf so etwas gefasst. »Einen unvoll-
ständigen Abdruck habe ich am Klingelknopf gefunden und
weitere am Türgriff.«
»Immerhin ein Anfang«, bemerkte Grissom.
»Wo ist Catherine?«
Grissom sah sie an und grinste verschmitzt. »Frauen gehö-
ren in die Küche.«
Sara lachte spöttisch. »Träum weiter… Das hier, das ist ein
ganz spezieller Fall, nicht wahr?«
»In der Tat.«
»Kannst du denn irgendetwas mit dem M. O. anfangen,
Grissom?«
»Das hier spricht eine deutliche Sprache«, entgegnete er und
wies mit dem Kopf auf den Toten, ohne weitere Erklärungen
zu geben.
Die erwartete Sara auch nicht. Statt nachzuhaken sagte sie:
»Okay, dann gehe ich nach nebenan zu unserem Detective und
dem Officer. Sie befragen die Nachbarin, und ich würde mir
gern ihre Fingerabdrücke holen, für den Abgleich. Der unvoll-
ständige Abdruck auf dem Klingelknopf könnte von ihr sein.«
»Möglich. Dann mach das!«
»Die Art und Weise ist einfach nie schön, oder?«
»Was meinst du?«
»Ermordet zu werden.«
»Nein«, entgegnete Grissom. »Aber das hier scheint mir ei-
ne der unschönsten Möglichkeiten zu sein.«

»Allerdings«, meinte sie und ging nach draußen.
Grissom war erfreut darüber, wie unbeeindruckt Sara sich
vom Anblick des Tatorts gezeigt hatte, und lächelte in sich
hinein. Er hatte Sara persönlich ausgewählt, als eine junge CSI-
Kollegin im Dienst getötet wurde und ein Ersatz gefunden
werden musste. Weil sie sich als ausgezeichnete Studentin in
seinen Seminaren hervorgetan und ihn beeindruckt hatte, war
sie seine erste Wahl für diesen Job gewesen. Und sie hatte ihn
nicht enttäuscht.
Von sich selbst hingegen war er manchmal enttäuscht, denn
es hatte Zeiten gegeben, in denen seine Zuneigung zu der
intelligenten jungen Frau über das Berufliche hinauszugehen
gedroht hatte.
Aber diese Grenze wollte Gil Grissom nicht überschreiten.
Der CSI-Leiter wandte sich wieder der Leiche zu. Als er ei-
ne kleine Lache auf dem Rücken des Opfers entdeckte, beugte
er sich vor, um die Flüssigkeit genauer in Augenschein zu
nehmen. Schau an!, dachte er und machte ein Foto von dem
Spermafleck. Dann legte er die Kamera zur Seite und nahm
einen Abstrich für den späteren DNS-Test. Irgendetwas störte
ihn jedoch an diesem Fleck, obwohl Spermaspuren durchaus zu
dem Modus Operandi gehörten, den er hier wiederzuerkennen
glaubte.
Dann ging ihm ein Licht auf: Das Sperma sollte suggerieren,
der Mörder habe auf den Rücken des Opfers masturbiert, aber
es gab keine Spritzer, sondern nur eine kleine, saubere Lache.
Es wurde gezielt auf dem Rücken platziert!, dachte Grissom
mit einem grimmigen Lächeln.
Hätte der Mörder bei der Tat in seinem perversen Rausch
wirklich auf das Opfer ejakuliert, hätte es wohl nicht nur eine
einzige kleine Lache gegeben. Höchstwahrscheinlich wären
mehrere Spritzer und Tröpfchen auf dem Rücken zu finden
gewesen.

Grissom tütete die Spermaprobe ein, fotografierte zu Ende,
nahm einen Abstrich von dem Blut auf dem Teppich und such-
te die Leiche weiter nach Beweisspuren ab. Doch er fand
nichts. Als Letztes entfernte er vorsichtig das Seil vom Hals
des Opfers und packte es ebenfalls in einen der Plastikbeutel
zur Sicherung von Beweismaterial. Dann zog er sein Handy
aus der Tasche und drückte eine Schnellwahltaste.
Nach dem zweiten Klingeln meldete sich eine schroffe
Stimme. »Jim Brass.«
»Ich habe etwas, das Sie sich ansehen müssen«, sagte Gris-
som, ohne ihn zu begrüßen. »Es ist zwar nicht Ihr Zuständig-
keitsbereich, aber die Sache dürfte Sie interessieren.«
»Sehr schön, Gil, aber haben Sie es nicht gehört? Ich habe
Urlaub!«
»Sie wollen wirklich mal so richtig relaxen, was?«
Schweigen. Nein, kein Schweigen: Gewieft, wie er war,
nahm Grissom ein leises Seufzen wahr…
»Sie wissen es doch genauso gut wie ich«, entgegnete der
Captain des Morddezernats. »Ich langweile mich zu Tode.«
»Wenn man nur für seine Arbeit lebt, sollte man sich ein
schönes Hobby suchen.«
»Was denn? Insektensammeln oder so? Gil, sagen Sie
schon, um was geht es?«
»Um eine alte, üble Geschichte – wir haben allerdings da-
mals noch nicht zusammengearbeitet… Es war noch vor unse-
rer Zeit.«
»Wovon reden Sie?«
»Von dem Fall, den man nie vergisst – von Ihrem alle-
rersten!«
In der langen Pause, die nun folgte, war kein Seufzen zu hö-
ren. Nicht einmal ein Atemzug. Nur eisernes Schweigen. Dann:
»Sie meinen aber nicht meinen ersten Fall in Jersey, oder?«

»Nein, ich habe hier einen Mord in Nord Las Vegas, der
mich sehr an Ihren anderen ersten Fall erinnert.«
»Du lieber Himmel! Wo sind Sie?«
»Wir haben gerade erst angefangen.«
»Ich meine die Adresse!«
»Oh«, machte Grissom und gab sie ihm durch.
»Zwanzig Minuten«, sagte Brass und beendete das Ge-
spräch.
Er schaffte es jedoch in fünfzehn. Durch die offene Tür sah
Grissom den Wagen des Captain vorfahren. Brass stieg aus und
schritt quer über den Rasen, wie ein Mann, der eine Mission
hat. Und die hatte er in der Tat, wie Grissom vermutete.
Der stämmige Kollege mit den traurigen Augen, der sonst
bei jedem Wetter Jackett und Krawatte trug, erschien heute in
Jeans und einem blauen Hemd mit offenem Kragen.
Officer Logan ging nach draußen, um Brass auf der Veranda
abzufangen, weil er ihn für einen Zivilisten hielt. Der Krimi-
nalbeamte zeigte ihm seine Marke, aber Logan ließ sich davon
nicht beeindrucken.
»Was führt Sie denn in unsere Gefilde, Captain?«
Grissom streckte den Kopf aus der Tür und rief: »Er gehört
zu mir, Officer! Schon in Ordnung!«
Logan wollte offenbar nicht noch einmal mit Grissom an-
einander geraten und ließ Brass seufzend passieren.
»Sie hätten ihm sagen können, dass ich komme«, beschwer-
te sich Brass.
»Ja, ich arbeite noch an meinen sozialen Fähigkeiten«, ent-
gegnete Grissom.
»Tatsächlich? Und wie kommen Sie voran?«
Grissom zuckte nur mit den Schultern und trat zurück, damit
Brass sich die Leiche ansehen konnte.

Er warf nur einen Blick darauf, machte große Augen und
schüttelte den Kopf. Die Farbe wich aus seinem Gesicht. »Al-
so, das ist doch…«
»Ist es CASt?«, fragte Grissom.
In diesem Augenblick kam Catherine aus der Küche zurück.
»Außer schmutzigem Geschirr habe ich da nichts gefunden…«
Als sie Brass sah, blieb sie wie angewurzelt stehen. »Sie sind
nicht im Urlaub?«
Brass nickte ihr zu. »Nicht mehr.« Dann sah er Grissom an.
»Also, das sieht allerdings nach einer Tat von CASt aus…«
»Cast?«, fragte Catherine und trat dazu. Sie hatten den To-
ten jetzt zu dritt umstellt, aber weglaufen konnte er ohnehin
nicht mehr.
Brass schloss die Augen und fasste sich mit Daumen und
Mittelfinger der rechten Hand an die Nasenwurzel. »Sie ken-
nen den Fall vermutlich nicht… vielleicht waren Sie damals
noch im Labor, keine Ahnung.«
Catherine sah Grissom eindringlich an. Hilfe!, schien ihr
Blick zu sagen. Grissom zuckte natürlich nur mit den Schul-
tern.
»Aber ich bin mir sicher, dass Sie davon gehört haben. Es
war mein erster Fall hier. Er wurde nie gelöst. Die Presse hat
ausführlich darüber berichtet. Der schlimmste Serienkiller in
der Geschichte von Las Vegas. Der zuständige Cop wurde als
unfähiger Trottel aus New Jersey beschimpft. Kommt Ihnen
das irgendwie bekannt vor?«
»Die Polizei wurde übel von der Presse verspottet«, sagte
Catherine nickend und dachte laut nach. »Es ist eine Abkür-
zung… C, A, S, t.«
»Das steht für Capture, Afflict and Strangle«, erklärte Gris-
som. »Überwältigen, quälen und strangulieren. So hatte sich
der Täter selbst genannt.«

»Ich habe damals ein paar Laboruntersuchungen für den Fall
gemacht«, sagte Catherine. »Da war ich auch schon in der
Nachtschicht. Aber es war ein Fall von der Tagschicht, oder?«
»Ja, es ist schon zehn, elf Jahre her.« Brass rieb sich die
Stirn. »Ich war gerade erst aus dem Osten hierher versetzt
worden und stand immer noch unter Schock wegen meiner…
Scheidung. Ich kannte mich noch nicht so gut in der Szene von
Vegas aus…«
»Ich kann mich nur noch sehr verschwommen an den Fall
erinnern«, räumte Catherine ein. »Und eher an die Berichter-
stattung in den Medien als an irgendetwas Dienstliches.«
»Die Medien waren ziemlich hinter der Sache her«, sagte
Grissom, »aber damals konnten wir das noch besser kontrollie-
ren. Und zum Glück hat die Sache keine weiten Kreise gezo-
gen.«
»Ja, wir haben uns so bedeckt gehalten, wie es ging. Mein
Partner Vince Champlain wollte keinen Staub aufwirbeln.«
»Guter Ansatz«, bemerkte Catherine. »Ich wünschte, das
würde uns auch heute immer gelingen.«
»Vince war der verantwortliche Detective«, fuhr Brass fort.
»Je mehr wir an die Presse weitergeben, dachte er, desto mehr
Spinner tauchen auf, mit denen wir uns herumschlagen müssen.
Das alte Lied. Und trotzdem hatten wir mehr als genug davon.
Wir hatten bestimmt zwanzig verschiedene Bekenner.«
»Und keiner von ihnen war der Richtige?«, fragte Catherine.
Brass schüttelte den Kopf. »Nein, alles nur die üblichen
Verrückten. Notorische Bekenner eben.«
»Aber irgendetwas hatten Sie doch in der Hand, oder?«,
fragte Catherine.
Brass lächelte geknickt und sah sie an. »Die Opfer, die hat-
ten wir. Fünf Tote, alle männlich, alle weiß, alle im mittleren
Alter und alle eher von der stämmigen Sorte…«

Wie aufs Stichwort schauten er und die beiden Spurener-
mittler gleichzeitig auf die Leiche.
»… Und alle mit einem laufenden Palstek erdrosselt.«
Catherine runzelte die Stirn. »Und was genau ist das?«
»Eine Schlinge, ein Laufknoten«, erklärte Grissom. »Je
nachdem, an welchem Ende des Seils man zieht, schließt sich
die Schlinge. Es ist ein klassischer Lassoknoten.«
Catherine sah Brass an. »Gab es denn damals auch echte
Verdächtige?«
»Am Anfang jede Menge, aber dann haben wir uns auf drei
konzentriert«, entgegnete Brass. »Einer gefiel mir besonders
gut, ein anderer gefiel Vince, und es gab noch einen dritten, der
ganz brauchbar schien, obwohl keiner von uns glaubte, dass er
die Morde begangen hatte.«
Grissom zeigte auf die Leiche. »Ich finde, wir sollten in die-
sem Fall vorgehen wie bei jeder anderen Ermittlung auch.«
Brass nickte. »Soll ich zuerst mal die Verdächtigen von da-
mals unter die Lupe nehmen?«, fragte er.
Grissom taxierte ihn mit prüfendem Blick. »Zuerst noch ei-
ne Frage.«
»Dann die Antwort.«
»Sollten Sie überhaupt an diesem Fall arbeiten?«
»Sollte ich nicht?«, entgegnete Brass mit leicht erhobener
Stimme.
»Jim«, sagte Catherine, »Sie schleppen diese Sache schon
ziemlich lange mit sich herum. Objektivität…«
»Darauf scheiße ich!«, platzte Brass heraus, aber dann
merkte man, dass ihm der Ausbruch peinlich war.
Grissom sah ihn eindringlich an. »Sie wollen also einen auf
Captain Ahab machen?«
»Sagen wir einfach«, entgegnete Brass, »ich will das
Schwein kriegen.«
»Aha«, machte Grissom vielsagend.

»Und…«, fuhr Brass fort, dann schluckte er und wurde wie-
der leiser, »… wir werden, wie Sie sagten, vorgehen wie bei
jeder anderen Mordermittlung auch.«
Grissom sah Catherine an. Sie lächelte skeptisch.
»Kommen Sie schon«, versuchte Brass sie zu überreden.
»Sie haben mich doch im Auge. Sie werden mir helfen…«
»Objektiv zu bleiben?«, warf Catherine ein. »Halten Sie das
für eine gute Idee, Jim?«, sagte sie, aber ihre Frage war eigent-
lich an Grissom gerichtet.
Grissom ging nicht darauf ein. »Besteht Ihrer Meinung nach
die Möglichkeit, dass der Tote hier nur zufällig aussieht wie
die ›Ge-CASt-eten‹ von damals?«
»So hat die Presse die Opfer genannt, nicht wahr?«
»Ja, und es ist kein Zufall.« Brass zeigte auf die Leiche.
»Wenn das hier nicht die Handschrift des Kerls von damals
trägt, dann muss es einen Nachahmungstäter geben, der sich
ziemlich gut mit der Materie auskennt.«
»Wieso?«, fragte Catherine.
Brass zuckte mit den Schultern. »Wenn es ein Nachahmer
ist, weiß er mehr, als damals in den Zeitungen stand.«
»Sie haben Fakten zurückgehalten, damit Sie die falschen
Bekenner aussortieren konnten. Natürlich!«, sagte Catherine
nickend.
»Ob hier die Vergangenheit grüßen lässt oder ein Vertu-
schungskünstler von heute, wir werden jede Hilfe brauchen, die
wir kriegen können«, bemerkte Grissom.
Catherine seufzte. »Alt oder neu – es ist auf jeden Fall ein
heimtückischer Killer.«
»Können Sie sich die Leiche mal genauer ansehen, Jim? Sie
sind hier der Experte.«
Brass hockte sich neben den Toten und studierte ihn einge-
hend. Dann erhob er sich wieder. »So gern ich den alten Fall

auch noch mal aufrollen würde«, sagte er bedächtig, »aber hier
handelt es sich wohl eher um einen Nachahmungstäter.«
Grissom und Catherine sahen sich an.
»Warum?«, fragte Grissom.
»Das Ganze sieht inszeniert aus. Und vor allem gibt es nicht
genug Blut.«
Catherine betrachtete den Blutfleck auf dem Teppich. »Wie-
so?«
»An den fünf Tatorten von damals«, erklärte Brass, »waren
jede Menge Blutspritzer. Hier gibt es gar keine.«
»Blutspritzer«, wiederholte Catherine zufrieden, denn das
war ihr Spezialgebiet. »Den damaligen Opfern wurde der
Finger abgeschnitten, bevor sie getötet wurden?«
»Ja«, sagte Brass und freute sich über ihre rasche Auffas-
sungsgabe.
»In diesem Fall wurde der Finger aber anscheinend
postmortal abgetrennt. Hätte das Opfer noch gelebt, gäbe es
Spritzer auf dem Boden, und er hätte vermutlich mit der ver-
stümmelten Hand herumgefuchtelt, wodurch das Blut noch
weiter gespritzt wäre.«
»Richtig«, sagte Brass mit einem Nicken. »Und mit dieser
Spermalache auf dem Rücken des Opfers stimmt was nicht…«
Grissom brachte jetzt seine Theorie zu diesem Aspekt vor.
»Ejakulat am Tatort ist immer eine heikle Sache«, sagte er am
Ende seiner Ausführungen. »Man muss die Position des Opfers
berücksichtigen und die Körperstellung des Täters, aber das
hier sieht aus wie absichtlich platziert.«
»Wie bei einer Bottleparty«, bemerkte Catherine.
Brass und Grissom sahen sie verdutzt an.
Sie zog die Augenbrauen hoch. »Jeder bringt sein eigenes
Sperma mit! Der Täter hat die Probe von zu Hause mitge-
bracht. Oder vielleicht war es eine Frau, dann blieb ihr gar
nichts anderes übrig…«

»So oder so, das ergibt Sinn«, sagte Brass. »Ein Nachahmer
inszeniert ein Verbrechen ganz kalt, während die echten Morde
aus Leidenschaft verübt werden: von einem Killer, der… auf so
etwas abfährt.«
»Ganz genau«, bemerkte Grissom. »Dennoch, dieser Mord
kommt den Originalen von damals ziemlich nah, nicht wahr?«
»Ja«, meinte Brass. »Abgesehen von den eben erwähnten
Details schon.«
»Bei einem Nachahmungstäter ist der Kreis der Verdächti-
gen ziemlich klein«, bemerkte Grissom. »Wer hatte so genaue
Informationen über diese Morde?«
Der Captain dachte nach. »Nun, der Mörder natürlich… die
mit dem Fall befassten Cops, wir selbst… und ein paar Zei-
tungsreporter.«
»Wer genau?«, fragte Catherine.
»Zwei Kriminalreporter, die für den Las Vegas Banner ar-
beiten – Perry Bell und David Paquette. Sie bekamen seinerzeit
diese Schmähbriefe von CASt. Und sie haben zusammen ein
Taschenbuch über den Fall veröffentlicht.«
»Ist Paquette nicht Redakteur beim Banner?«, hakte Cathe-
rine nach.
»Inzwischen, ja. Paquette hat eindeutig mehr von dem Er-
folg des Buches profitiert, denn er bekam bald darauf den
Redakteursposten. Aber schließlich erhielt Bell immerhin eine
eigene Kolumne.«
Die beiden CSI-Mitarbeiter nickten. Bell und seine Krimi-
nalkolumne waren den meisten bei der Las Vegas Police ein
Begriff. Grissom fand zwar nicht, dass er ein besonders guter
Autor war, aber das waren Walter Winchell und Larry King
auch nicht. Dafür stand Bell in dem Ruf, besonders ehrlich zu
sein, und man sagte ihm nach, dass er nie seine Quellen verriet
und niemanden hinterging, was ausschlaggebend dafür war,
dass er bei den Polizisten nach wie vor angesehen war. Wenn

ein Cop Bell etwas unter vier Augen mitteilte, behielt der
Kolumnist es für sich, bis der Beamte ihm die Erlaubnis gab, es
zu drucken.
»Dann sollte ich mich wohl mal mit den Pressefritzen unter-
halten«, sagte Brass.
Catherine zeigte auf die grotesk anmutende Leiche. »Glau-
ben Sie, Paquette oder Bell wären zu so etwas fähig?«
Brass zuckte mit den Schultern. »Gacy war Clown, Bundy
Jurastudent, und Juan Corona hat Leiharbeiter an Farmer ver-
mittelt und zwei Dutzend Leute aus Jux und Profitgier umge-
bracht. Schwer zu beurteilen, wozu Menschen fähig sind. Aber
eines weiß ich: Wenn wir bei diesem Fall vorgehen wie bei
jeder anderen Mordermittlung, dann sind Perry Bell und Dave
Paquette Verdächtige… und ich muss mit ihnen reden.«
Sie verließen das Wohnzimmer und trafen sich mit den an-
deren Cops und Spurenermittlern vor dem Haus, während die
Sanitäter hineingingen, um die Leiche zu holen.
Damon wirkte verärgert, als er Brass sah. »Was machen Sie
denn hier, Jim?«
Brass wollte etwas erwidern, aber Grissom schaltete sich
vermittelnd ein. »Ich habe ihn dazugeholt«, sagte er. »Als
Berater. Er hat vor Jahren einen ganz ähnlichen Fall bearbei-
tet.«
»Wie ähnlich?«, fragte Damon.
»Sehr«, entgegnete Grissom. »Genau dasselbe.«
»Auch ein Mord?«
»Mehrere Morde«, erklärte Brass. »Ein Serienkiller.«
»Ich bitte Sie!«, fuhr Damon auf. »Sind wir hier im Kino,
oder was?«
»Haben Sie hier in Nord Las Vegas etwa öfter männliche
Leichen mit Lippenstift im Gesicht und Sperma auf dem Rü-
cken?«

Damon öffnete den Mund, aber es kam kein Ton heraus.
»Der Täter nennt sich CASt«, fügte Grissom hinzu.
Damon sah ihn perplex an. Nach einer langen Pause
schluckte er. »Heilige Scheiße… an den erinnere ich mich.
Es stand in der Zeitung, als ich noch am College war! Ver-
dammt… glauben Sie etwa, er war es?«
Grissom und Brass sahen sich an, dann zuckte der CSI-
Leiter mit den Schultern. »Wir wissen es nicht. Er war seit
etwa elf Jahren nicht mehr aktiv. Wir werden sehen.«
»Sie arbeiten natürlich eng mit mir zusammen«, sagte Da-
mon. »Ich meine, es ist mein Fall.«
Brass wollte antworten, aber Grissom kam ihm erneut zu-
vor. »Selbstverständlich.«
»Nun… dann, also gut.« Damon nickte, stemmte die Hände
in die Hüften und plusterte sich ein wenig auf. »Freut mich,
dass wir uns verstanden haben. Gut.«
Grissom drehte sich zu seinen Leuten um. »Und?«
»Im Hinterhof war nichts von Belang«, entgegnete Nick.
»Der Vorgarten scheint auch sauber zu sein«, fügte Warrick
hinzu. »Ich habe einen unvollständigen Schuhabdruck, aber das
muss nichts bedeuten.«
»Muss nicht, kann aber«, erwiderte Grissom.
»Kann aber«, bestätigte Warrick grinsend.
»Ich habe die Fingerabdrücke von der Nachbarin«, sagte Sa-
ra. »Aber sie behauptet, sie hat die Klingel und den Türgriff
nicht angerührt. Sie hat nur in den Flur geschaut, die ›schreck-
liche Sache‹ gesehen und sofort die Polizei angerufen.«
Auf Grissoms Gesicht erschien ein kleines Lächeln. »Finge-
rabdrücke, Schuhabdruckspuren, DNS-Proben… Wir haben
schon mit weniger angefangen. Und wir haben einen M. O. der
an vergangene Morde erinnert. Was meint ihr, Leute? Wollen
wir unsere Netze auswerfen und den Killer an Land ziehen?«

2
Das Leben in Las Vegas hatte durchaus seine positiven Seiten.
Wenn man vor allem und jedem flüchten und irgendwo unter-
tauchen wollte, dann konnte man das hier tatsächlich tun.
Captain Jim Brass wusste dies nur zu gut.
Man brauchte sich nur auf den Strip zu begeben.
So verrückt es auch schien, der Teil von Vegas, wo am
meisten los war, war für Einheimische das beste Versteck.
Natürlich arbeiteten auch Ortsansässige in der City; aber dieje-
nigen, die dort keinen Job hatten, mieden die Gegend wie ein
Atomwaffentestgelände in der Wüste – und diejenigen, die dort
arbeiteten, taten in ihrer Freizeit genau dasselbe.
Für den endlosen Geldzufluss auf dem Strip waren allein die
Besucher verantwortlich. Wenn die Einwohner von Las Vegas
zum Essen oder zum Spielen ausgehen wollten, hielten sie sich
von diesem neonbeleuchteten Ameisenhaufen voller Touristen-
fallen fern und suchten Viertel auf, die nicht so trendy und
teuer waren.
War es Sherlock Holmes oder Poe’s Dupin, der einmal ge-
sagt hat, das beste Versteck befinde sich vor aller Augen? Nach
diesem Prinzip erschien Brass und Grissom der Strip als der
perfekte Ort für das Treffen mit Perry Bell und David Paquette
vom Banner. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie jemandem
begegneten, der sie alle vier kannte, war äußerst gering, und
Brass hielt es zu diesem Zeitpunkt für das Beste, keinen Staub
aufzuwirbeln.

Aber es ärgerte ihn, dass er gleich zu Beginn der Ermittlun-
gen mit Medienvertretern sprechen musste, denn wenn sie
vernünftig arbeiten wollten, mussten sie den Fall so lange wie
möglich vor der Öffentlichkeit geheim halten.
Auf der Treppe des Parkhauses, das direkt an das Stra-
tosphere Hotel & Casino angeschlossen war, wandte sich Brass
an Grissom. »Ich möchte Sie wirklich nicht von wichtigen
Arbeiten im Labor abhalten.«
Grissom zuckte mit den Schultern. »Ich dachte, Sie wollten,
dass Catherine und ich Sie bei dieser Sache im Auge behal-
ten?«
»Sie wollen also richtig auf mich aufpassen?«
»Damit Sie nicht voreilig Ihre Harpunen abschießen, Cap-
tain.«
»Jetzt halten Sie mal die Luft an, Gil! Ich bin seit einer
Stunde an diesem Fall, und schon denken Sie, ich würde…«
»Seit einer Stunde?« Grissoms Lächeln war freundlich und
keine Spur spöttisch. »Ich würde sagen, Sie sind schon seit
einem Jahrzehnt und länger an diesem Fall.«
Brass empfand plötzlich eine große Zuneigung für seinen
alten Kollegen. Solche Momente gab es nicht oft zwischen
ihnen; zumindest erlaubten die beiden es sich nicht allzu oft,
Gefühle zu zeigen. Dennoch konnte er eine gewisse Kränkung
nicht verbergen, als er in scherzhaftem Ton zu Grissom sagte:
»Dann sind Sie tatsächlich meinetwegen gekommen, Gil?«
»Stets zu Ihren Diensten«, entgegnete Grissom wie aus der
Pistole geschossen, jedoch ohne Brass in die Augen zu sehen.
Das Raw Shanks Diner befand sich im hinteren Teil des Kasi-
nos. Hier regierte der Geist der fünfziger Jahre – von den Fies-
taware-Tellern über die Speisekarten bis zu den singenden
Kellnerinnen und Kellnern, die den Gästen Songs von Elvis,
Little Richard und Fats Domino auftischten.

Eine zierliche Kellnerin mit Cornrowsfrisur und großer
Stimme schmetterte gerade den Etta-James-Klassiker »At
Last«, als Brass und Grissom sich an einen Ecktisch setzten,
der so weit wie möglich von der Karaoke-Kellnerin entfernt
war. Ein Kellner mit einer Haartolle, auf die Frankie Avalon
mit sechzehn neidisch gewesen wäre, brachte ihnen Kaffee,
während die beiden Männer auf die Journalisten warteten.
Ein Lokal mit derart gnadenlosem Entertainment würde kein
Einheimischer besuchen, der noch halbwegs bei Sinnen war.
»Darf ich einen Vorschlag machen?«, fragte Grissom.
»Sicher.«
»Ich würde nichts von der Nachahmer-Theorie erzählen.«
Brass nickte. »Ja, Sie haben Recht. Erst mal sehen, was die
beiden dazu sagen.«
Der Captain hatte seinen Kaffee zur Hälfte ausgetrunken, als
Kriminalkolumnist Perry Bell ihm vom Eingang aus zuwinkte.
Hinter ihm standen zwei Männer – David Paquette, der Lokal-
redakteur des Banner, und Bells Rechercheassistent Mark
Brower.
Der Captain kannte Bell und Paquette nun schon fast elf
Jahre, und Brower hatte er kennen gelernt, kurz nachdem die-
ser den Assistentenjob bei Bell angenommen hatte, was viel-
leicht sieben Jahre her war. Oder waren es acht? Brass seufzte,
als ihm bewusst wurde, wie die Jahre verflogen waren und wie
präsent ihm der alte CASt-Fall trotzdem noch war.
Brower hatte zweifelsohne alle Geschichten über CASt ge-
hört, aber damals war er noch nicht bei der Zeitung gewesen.
Er schien Anfang dreißig zu sein, und als die Morde gescha-
hen, musste er auf irgendeiner Journalistenschule oder sogar
noch auf der Highschool gewesen sein.
Die Empfangsdame – eine Sandra Dee nach den Vorstellun-
gen des Lokals (ironischerweise sang in diesem Moment ein
Kellner »Splish Splash« von Bobby Darin) – sprach mit Bell,

der auf Brass zeigte, dann an der jungen Frau vorbeiging und
mit Paquette und Brower im Gefolge auf ihren Tisch zukam.
Der Journalist strahlte über das ganze Gesicht, ganz im Ge-
gensatz zu Brass: Er fragte sich, warum Brower mitgekommen
war. Verdammt, er hatte Bell doch gesagt, dass er sich mit ihm
und Paquette allein treffen wollte!
Perry Bell war ein korpulenter Mann mit einem linksge-
scheitelten, dicken braunen Toupet und sah aus, als sei er in der
Disco-Ära hängen geblieben: brauner Anzug mit breitem Re-
vers, dazu ein gelbes Hemd, dessen obere drei Knöpfe offen
waren, damit man sein goldenes Davidsstern-Medaillon sehen
konnte, das an einer goldenen Kette in seiner Brustbehaarung
baumelte. Der breite Flatterkragen des Hemdes reichte weit
über das Revers des Jacketts, als handele es sich um zwei große
Flügel. Bells Kopf glich einem Betonklotz, an dem ein großer
Klumpen Mörtel als Nase klebte, und seine tief liegenden
dunklen Augen schauten unter breiten, dicken Brauen hervor.
»Haben Sie einen heißen Tipp für mich, Jimbo?«, fragte er
als Erstes und streckte Brass die Hand entgegen.
Wirklich, dachte der Captain, ein Meister seiner Zunft…
»Dazu kommen wir noch«, sagte er, schüttelte die feuchte
Hand und ließ sie rasch wieder los.
»Muss ja ‘ne große Sache sein«, bemerkte Bell und gab
Grissom ebenfalls die Hand. »Wenn Sie sogar den CSI aller
CSIs mitbringen – schön Sie zu sehen, Gil!«
Grissom quittierte diese gewaltigen Worte mit einem knap-
pen Nicken.
»Sie kennen ja beide meinen Boss und Kumpel Dave.«
Der Redakteur wurde mit Kopfnicken begrüßt.
Paquette hatte listige blaue Augen und immer ein Lächeln
auf den Lippen. Sein blondes Haar war eines Winters vor
langer Zeit in den Süden gezogen und machte keine Anstalten
zurückzukehren.

Brass fand die gute Laune der beiden irgendwie aufgesetzt.
Die Freundlichkeit, mit der sie einander – aber auch ihm und
Grissom – begegneten, wirkte auf ihn irgendwie gezwungen.
Als ihr Buch Der Fall CASt herauskam, hatten Paquette und
Bell noch auf einer Stufe gestanden, aber danach hatten sich
ihre Karrieren höchst unterschiedlich entwickelt. Gelassen, gut
gelaunt und mit seinem Schicksal zufrieden war Paquette nun
der Vorgesetzte seines alten Kumpels, der sich nach einem
Senkrechtstart vor über einem Jahrzehnt inzwischen ordentlich
festgefahren hatte: Seine Kriminalkolumne hatte für kurze Zeit
einen landesweiten Höhenflug angetreten, um mit einer unsanf-
ten Landung dann wieder auf die Lokalebene zurückzukehren.
Vielleicht war es sogar ein Akt der Barmherzigkeit seines
alten Freundes, dass es Bill und seine Kolumne überhaupt noch
gab.
Brass und Grissom schüttelten erst Paquette die Hand, an-
schließend Brower. Dann nahmen sie alle Platz am Tisch, Bell
neben Paquette, gegenüber von Brass und Grissom, während
Brower sich einen Stuhl vom Nebentisch heranzog.
Der junge Assistent war kräftig gebaut und muskulös, was
ziemlich ungewöhnlich für einen Bürohocker war, und hatte
kurzes, dunkelbraunes Haar. Seine dunklen Augen und die
Denkerfalte zwischen seinen kräftigen Brauen zeugten von
einem ernsten Charakter, während sein schmaler, beinahe
lippenloser Mund ihm manchmal etwas Unheimliches gab,
besonders wenn er lächelte. Aber er arbeitete nun schon ziem-
lich lange für Bell, und Brass vertraute ihm inzwischen genau-
so wie seinem Boss.
Dennoch war Brower in diesem Moment ein ungebetener
Gast, und Brass brachte es gleich zur Sprache. »Nehmen Sie es
nicht persönlich, Mark«, meinte er entschuldigend und wandte
sich an Bell: »Was macht er hier?«

Das Lächeln des Reporters schwand. »Mein Gott, Jim. Er…
er ist mein Assistent. Mark begleitet mich überallhin, das wis-
sen Sie doch.«
»Dachten Sie, wir wären nett zum Essen verabredet?«
Bell sah Paquette und Brower an. »Sind wir das nicht?«
Brass studierte das Gesicht des Journalisten eine ganze Wei-
le. »Ist Ihr Frequenzen-Scanner kaputt?«
»Nein, warum?«
»Haben Sie heute Morgen den Code 420 in Nord Las Vegas
nicht mitbekommen?«
Die Zeitungsmänner kannten natürlich alle den Funkcode
für Mord.
Bell zuckte mit den Schultern. »Ja und? Es gab nur eine
Funkmeldung, dann nichts mehr. Ich dachte, falls es eine loh-
nende Geschichte ist, würde ich im Laufe des Tages mehr
darüber erfahren. Wollten Sie darüber mit mir reden?«
»Sich einen Mord entgehen zu lassen sieht Ihnen gar nicht
ähnlich, Perry…« Brass versuchte, mit neutraler Stimme wei-
terzusprechen, und gab sich gleichgültig. »Wo waren Sie denn
den ganzen Morgen?«
Der Reporter schien nicht zu bemerken, dass er ausgehorcht
wurde. »Überwiegend im Büro.«
»Den ganzen Morgen?«
Nun schien Bell zu verstehen.
Aus Erstaunen wurde Ärger, und er wollte gerade etwas sa-
gen, als der Kellner ihm und seinen Kollegen Kaffee brachte
und Brass und Grissom nachschenkte.
»Möchten Sie auch etwas essen?«, fragte der Kellner.
»Nein«, entgegnete Brass und winkte ab.
Der Kaffee war dampfend heiß, während Bell vor Wut fast
kochte. »Was zum Teufel ist das hier für eine Scheiße,
Brass?«, fuhr er auf, fasste sich aber gleich wieder, weil er
merkte, dass er sich im Ton vergriffen hatte. Er sah sich um,

aber in dem ganzen Lärm schien niemand von den anderen
Gästen etwas mitbekommen zu haben. »Ich meine, wirklich,
Jim… habe ich mich irgendwie verdächtig gemacht? Was war
das überhaupt für ein Mord, heute Morgen?«
Brass sagte nichts.
Paquette beugte sich mit ernster Miene vor. »Hören Sie,
Captain Brass, wenn Sie einem meiner Mitarbeiter etwas vor-
zuwerfen haben, dann gehen Sie den offiziellen Weg, statt uns
mit einer fadenscheinigen Ausrede in ein Restaurant zu bestel-
len!«
Grissom sah ihn grimmig an. »Ein Mord ist keine faden-
scheinige Ausrede. Es ist sehr rücksichtsvoll von Captain
Brass, sich inoffiziell mit Ihnen zu treffen!«
Brass hob beschwichtigend die Hand. »Nein, Gil, Perry und
Dave haben Recht.«
Der Redakteur und der Kolumnist atmeten hörbar aus und
lehnten sich abwartend zurück. Brower beobachtete das Ganze
schweigend, aber äußerst konzentriert.
Brass sammelte sich, nahm einen großen Schluck Kaffee
und studierte Bell. Er überlegte, wie viel er den Journalisten
anvertrauen sollte. »Es tut mir Leid, Perry… Dave«, sagte er
schließlich. »Dieser Fall geht mir ziemlich an die Nieren, und
wenn ich Ihnen zu nahe getreten bin, dann schieben Sie es auf
den Stress. Ich schätze Sie beide sehr!«
Die beiden Journalisten zuckten mit den Schultern, zufällig
nach dem Rhythmus von »All Shook Up«, das einer der Kell-
ner gerade in schönster Elvis-Manier zum Besten gab.
»Aber«, fuhr Brass fort, »wenn dieser Fall an die Öffent-
lichkeit kommt, dann gibt es eine Menge Ärger.«
Besänftigt griff Bell in die Innentasche seiner Jacke, um
Stift und Block herauszuholen. »Also gut, dann wollen wir
anfangen…«

Brass hob verteidigend die Hände, als wollte sein Gegen-
über ihn ausrauben. »Das ist es doch gerade – ich will die
Sache noch nicht publik machen.«
Der Reporter hielt inne, dann zog er die Hand langsam wie-
der aus der Jacke – ohne Stift und Block. »Aber wozu sind wir
hier, Jim, wenn wir nicht darüber sprechen können?«
Zum ersten Mal seit langer Zeit hatte Brass wieder das Be-
dürfnis nach einer Zigarette – aber er unterdrückte den
Wunsch, schließlich hatte er das Rauchen aufgegeben. »Ich
muss einfach mal inoffiziell mit Ihnen reden.«
»Captain Brass«, sagte Paquette gereizt, »wir kooperieren
sehr gern mit den Behörden, aber genau wie Sie haben auch
wir unsere Arbeit zu tun. Wir sind der Öffentlichkeit verpflich-
tet.«
»Sie sind mir verpflichtet«, erwiderte Brass, »und das zählt
in diesem Fall mehr.«
Der Redakteur schüttelte den Kopf. »Ich wüsste nicht, wie-
so.«
»Ach, nein?«, fragte Brass. »Durch meine Kooperationsbe-
reitschaft bei einem bestimmten Fall konnten Sie einen Bestsel-
ler schreiben. Und daraufhin haben Sie beide Karriere ge-
macht.«
»Was?«, fuhr Bell auf. »Und dafür wollen Sie jetzt eine Ge-
genleistung?«
»Ganz genau«, entgegnete Brass.
Paquette überlegte eine Weile. »Wenn es wirklich so ein di-
ckes Ding ist«, meinte er dann, »und Sie unsere Hilfe brauchen
und wir sogar der Öffentlichkeit Informationen vorenthalten
sollen, auf die sie ein Recht hat… dann wollen wir etwas dafür
haben. Und zwar mehr als den Hinweis, dass Sie vor langer
Zeit etwas für uns getan haben.«
Brass und Grissom warteten schweigend darauf, dass er
fortfuhr.

»Wenn es so weit ist«, sagte Paquette und legte die Hände
flach auf den Tisch, »dann wollen wir exklusiv berichten.«
Brass schwoll der Kamm, aber bevor er etwas sagen konnte,
legte Grissom ihm seine Hand auf den Arm.
»Unmöglich«, sagte er. »Und unzulässig obendrein.«
Alle am Tisch wussten, dass die Polizei bei einem großen
Fall keine Exklusivrechte vergeben konnte. Paquette hatte
frech den ganzen Kuchen gefordert, um am Ende zumindest ein
möglichst großes Stück davon abzubekommen.
Brass lenkte ein. »Vierundzwanzig Stunden Vorsprung.«
Paquette dachte nach, dann nickte er.
»Um was geht es also?«, fragte Bell gespannt und richtete
sich auf. Abgesehen von einer Enthüllungsgeschichte über
Verbrechen in der Rapperszene, als Tupac Shakur erschossen
wurde, hatte Bell seit dem CASt-Buch keine überregionalen
Erfolge mehr gehabt. Und Brass’ Verhalten nach zu urteilen,
ging es hier offenbar um eine große Sache.
»Sie müssen es mir versprechen, Perry«, sagte Brass. »Nicht
mal eine Andeutung, bevor ich Ihnen das Okay gebe. Das gilt
für Sie alle! Sie können ganz normal über den Fall berichten,
anhand der offiziellen Pressemitteilungen… aber den wesentli-
chen Aspekt müssen wir noch unter Verschluss halten.«
Bell sah ihn durchdringend an. Ihm standen viele Fragen ins
Gesicht geschrieben, aber er sagte kein Wort und nickte nur.
»Wenn Sie sich nicht daran halten«, sagte Brass mit einem
Lächeln, das keine Spur freundlich war, »dann ist es mit unse-
rer Zusammenarbeit ein für alle Mal vorbei!«
»Hey, Jim, wann hat Sie einer von uns das letzte Mal übers
Ohr gehauen?«
Brass wischte sich mit der Hand über die Stirn. Himmel, er
machte diesen Job schon seit einer halben Ewigkeit, und nun
schwitzte er wie ein Neuling. Er hatte diese Männer, die immer
Verbündete gewesen waren, grundlos gegen sich aufgebracht.

»Sie haben Recht«, entgegnete er. »Sie waren immer ehr-
lich. Ich würde Ihnen gern eine Frage stellen. Wie lange liegt
er zurück, der Fall CASt?«
Paquette, der offenbar dachte, dies sei eine weitere Anspie-
lung auf Brass’ Hilfe bei dem Buch, zog eine Augenbraue
hoch, dann zuckte er mit den Schultern. »Ich weiß nicht. Zehn,
elf Jahre vielleicht?« Er sah Bell fragend an.
Der Kolumnist nickte. »Elf, wenn man es genau nimmt.«
Dann blickte er Brass verständnislos an. »Aber das fällt doch in
dieser Stadt schon unter Altertumsgeschichte. Soll das eine
Anspielung sein, oder was?«
Brass nahm einen Schluck Kaffee, und sein Blick wanderte
von Bell zu Paquette und wieder zurück. »Wir fragen uns bis
heute, warum er aufgehört hat – ist er bei einem Autounfall
gestorben? Wurde er irgendwo anders verurteilt? Ist er umge-
zogen und hat woanders weitergemacht?«
»Sie wissen, dass Letzteres nicht stimmen kann«, entgegne-
te Bell. »Ich habe die nationale Szene ständig im Auge und
hätte es mitbekommen, wenn so etwas irgendwo noch einmal
passiert wäre. Ich meine, der Modus Operandi ist schon ziem-
lich speziell.«
»Leicht wiederzuerkennen«, pflichtete Brass ihm bei. »Was
würden Sie dazu sagen, wenn dieser M. O. wieder in Erschei-
nung getreten wäre?«
»Dann wüsste ich gern, wo«, entgegnete Bell. »In welchem
Staat, in welcher Stadt – in welchem Land überhaupt?«
»Nevada, Nord Las Vegas, in den Vereinigten Staaten von
Amerika«, entgegnete Grissom.
»Blöd…«, setzte Bell an, aber dann richtete er sich abrupt
auf. »Das ist kein Scherz, oder?«
Brass seufzte. »Fanden Sie unser Treffen etwa bisher be-
sonders witzig?«
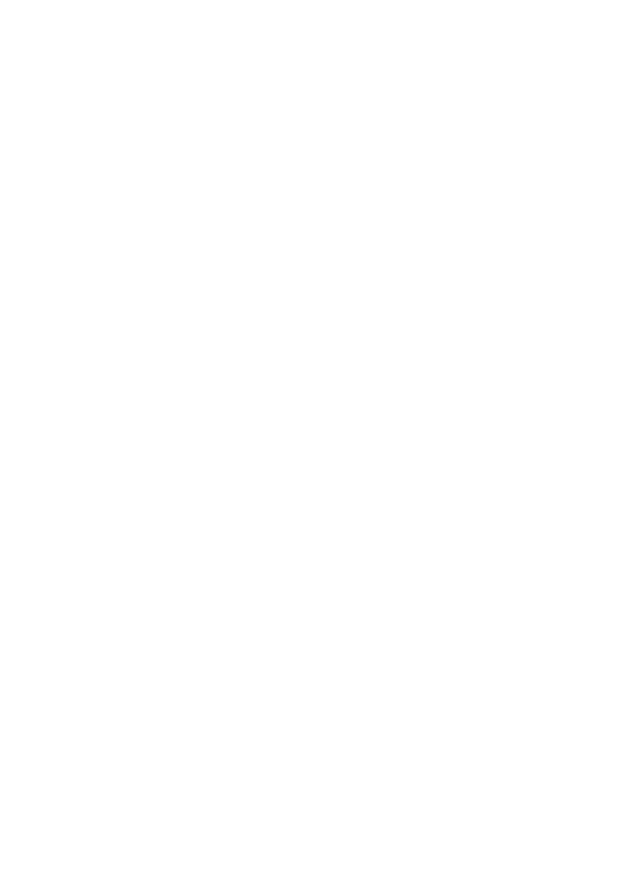
»Derselbe Täter hat wieder zugeschlagen?«, fragte Bell. »In
Nord Las Vegas, heute Morgen?«
Brass wies mit dem Kopf auf Grissom. »Wir kommen gera-
de vom Tatort, und die Sache sieht ziemlich nach CASt aus.«
»Klar und deutlich«, bemerkte Grissom.
Brower hatte die ganze Zeit geschwiegen, aber nun beugte
er sich gleichzeitig mit Bell und Paquette vor. Die drei sahen
Brass so gierig an wie Kojoten, die Blut geleckt hatten.
Die Augen des Captain wanderten von Bell zu Paquette.
»Wir wollten mit Ihnen beiden reden, weil niemand sonst so
viel über diesen Fall, über diese Morde, weiß, wie Sie… Und,
Mark, offen gesagt ist das der Grund, warum mir Ihre Anwe-
senheit nicht passt. Nehmen Sie es mir nicht übel.«
»Kein Problem«, entgegnete Brower.
Bell ging jedoch augenblicklich unter die Decke. »Deshalb
behandeln Sie mich also wie einen Verdächtigen! Weil ich
einer bin! Hören Sie, Brass, Sie wissen genauso viel wie wir,
sogar noch mehr. Sie und Vince Champlain waren unsere
Hauptinformationsquellen!«
»Das stimmt«, bemerkte Paquette.
»Wir wollen doch nicht anfangen, die Polizei zu verdächti-
gen, meine Herren!«, warf Grissom ein.
»Was soll das?«, platzte Bell heraus. »Der große Gil Gris-
som übt sich plötzlich in Zurückhaltung? Ich dachte, Sie folgen
jeder Spur, wohin sie auch führt! Anscheinend jedoch nicht,
wenn sie wie in diesem Fall zu Ihrem Kumpel Brass führt…«
Es war Grissom hoch anzurechnen, dass er die Ruhe behielt.
Die Presse ging dem CSI-Leiter ganz generell mächtig auf die
Nerven. Sie rangierte auf seiner Unbeliebtheitsliste gleich
hinter Vetternwirtschaft und Politik.
Brass wusste das und schaltete sich rasch ein. »Hören Sie,
ja, Sie haben Recht – Vince Champlain und ich wussten mehr
über diesen Fall als jeder andere.«

»Unser Buch haben Zehntausende gelesen«, entgegnete Pa-
quette. »Die kennen den Fall auch in- und auswendig, von den
nackten Opfern bis zu diesem Laufknoten im Seil. Und Mark
hat so oft dabeigesessen, wenn Perry und ich beim Bier über
CASt geredet haben, dass Sie ihn ebenfalls auf die Liste der
Verdächtigen setzen müssen. Und vielleicht auch diesen Hol-
lywood-Produzenten, der die Option auf unser Buch hat, und
dann noch…«
»Der Täter«, warf Brass ein, »weiß mehr als das, was in Ih-
rem Buch steht – er weiß auch die Dinge, die wir und Sie der
Öffentlichkeit nicht mitgeteilt haben.«
Bell stutzte. »Wie viel weiß… dieser Täter denn genau?«
»Er kennt jedes verdammte Detail«, entgegnete Brass. »Und
was Mr. Brower angeht, den setze ich gern ebenfalls auf die
Verdächtigenliste. Wie viel haben Sie ihm denn erzählt?«
»Hey, jetzt machen Sie aber mal einen Punkt«, sagte Bro-
wer. »Wenn Sie wissen wollen, was ich weiß, dann fragen Sie
mich!«
Paquette hob beschwichtigend die Hand. »Mark weiß mehr,
als in dem Buch steht, aber er weiß nicht alles. Die Dinge, die
Perry und ich bis zur Ergreifung des Täters für uns behalten
wollten, haben wir auch ihm nicht erzählt. Wir haben sie nie-
mandem erzählt!«
Brass schaute den Redakteur eine Weile an, dann wandte er
sich Bell zu, der Paquettes Aussage mit einem Nicken bestätig-
te.
Bell beugte sich wieder vor. »Hat er ihm wieder einen Fin-
ger…«
Brass brachte ihn mit einem Blick zum Schweigen. Seine
Augen wanderten zu Brower, dann zurück zu Bell, der die
Botschaft offenbar verstanden hatte.
»Mark ist nun mal mein Rechercheassistent«, verteidigte er
sich.

Kopfschüttelnd entgegnete Brass: »Sie dürfen niemandem
von den beiden Details erzählen, die wir zurückgehalten haben.
Auch jetzt nicht – besonders jetzt nicht!«
Bei diesen Details, die der Öffentlichkeit vorenthalten wur-
den, um Trittbrettfahrer zu entlarven, handelte es sich um das
Sperma auf dem Rücken des Opfers und den abgetrennten (und
vom Tatort entfernten) Zeigefinger. Diese entscheidenden
Aspekte kannten abgesehen von Brass und Grissom nur Pa-
quette und Bell, niemand sonst. Und es war wichtig, den Kreis
der Eingeweihten möglichst klein zu halten, deshalb musste
Mark Brower unter allen Umständen außen vor bleiben.
»Ich verstehe«, sagte Bell aufgebracht und frustriert
zugleich. »Ich verstehe…«
Durch das Lokal erschallte jetzt die Karaoke-Variante von
»Who’s Sorry Now?« von Connie Francis.
»Dann hat also keiner von Ihnen diese Details weitergege-
ben?«, fragte Brass durch den Gesang der Kellnerin hindurch
ganz direkt.
Paquette schüttelte den Kopf. »Nach diesem Fall hat schon
seit Jahren keiner mehr gefragt. Ein alter Hut.«
»Ich habe bei Lesungen mit verschiedenen Leuten über den
Fall gesprochen«, erklärte Bell hingegen. »Sogar dieses Jahr
noch. Wissen Sie, ich habe unser Buch noch mal nachdrucken
lassen, auf eigene Rechnung. Ich habe ein paar Kisten davon
im Kofferraum, und man kann es bei Amazon kaufen und…«
Dann erzählte er, dass er mit dem Nachdruck sogar auf Lese-
reise gegangen und bis nach Los Angeles gefahren war, um das
Buch unter die Leute zu bringen.
Es war schon traurig: Paquette hatte durch die Erstausgabe
des Buches einigen Ruhm in der Stadt erlangt, der ihm schließ-
lich den Redakteursposten beschert hatte, und der untersetzte
Bell, der weniger telegen war als Paquette, versuchte mit einem

selbst finanzierten Nachdruck seine in den Dreck gefahrene
Karriere wieder anzuschieben.
Aber Brass wusste, dass eine solche Maßnahme nicht aus-
reichte und auch viel zu spät kam, um Bells berufliches
Schicksal noch einmal herumzureißen. Doch wie der Journalist
auf seinen Rundreisen noch einmal das Rampenlicht suchte,
Bücher aus dem Kofferraum verkaufte und sich verzweifelt an
seine Kolumne klammerte, war schon ein wenig mitleiderre-
gend.
Denn auch Mittagessen in Rotary-Clubs, Lesungen in klei-
nen Büchereien und gelegentliche Veranstaltungen in Museen
würden das Feuer nicht wieder entfachen können, ein Feuer,
das im Grunde wahrscheinlich nie richtig gebrannt hatte.
»… aber ich habe natürlich nie mit jemandem über die Din-
ge gesprochen, über die wir Stillschweigen bewahren wollten«,
sagte Bell zum Schluss seiner Ausführungen.
»Ist es eine überarbeitete Ausgabe?«, fragte Grissom.
»Ich habe eine neue Einleitung geschrieben, aber ansonsten
haben wir den alten Text genommen – er wurde nicht mal neu
gesetzt oder so.«
Brass bemerkte ein Pochen hinter den Augen, aus dem sich
in kürzester Zeit solide Kopfschmerzen entwickeln würden. Sie
begleiteten ihn nun schon seit Jahren, und es hatte zu der Zeit
angefangen, als er mit dem Fall CASt befasst gewesen war…
»Entweder hat jemand Informationen rausgegeben, oder
CASt ist zurück und geht immer noch auf dieselbe Art und
Weise vor«, sagte er und studierte die Gesichter der Zeitungs-
leute.
Paquette schien über die Äußerung nachzudenken, während
Bell einen völlig schockierten Eindruck machte. Browers
Miene dagegen war unergründlich, denn er blickte eigentlich
immer so ernst wie in diesem Moment. Eine ganze Weile sagte
keiner der Männer etwas.

Schließlich brach Paquette das Schweigen. »Haben Sie
schon mit Ihrem alten Kumpel Vince geredet? Vielleicht hat er
etwas ausgeplaudert?«
»Gute Idee«, bemerkte Brower.
Brass’ Worte waren kalt und hart: »Hören Sie, Mark, Ihnen
lasse ich das durchgehen, weil Vince längst in Rente war,
bevor Sie beim Banner angefangen haben. Aber, Dave, Sie
sollten es besser wissen. Vince war immer ein guter Cop. Er
hat noch nie die Ermittlungen gefährdet, bei keinem einzigen
Fall!«
»Aber wir reden natürlich sofort mit ihm«, sagte Grissom
gelassen. »Sie haben Recht, wenn Sie ihn auf die Verdächti-
genliste setzen.«
Brass sah den CSI scharf an.
»Wir gehen vor wie bei jeder anderen Mordermittlung
auch«, fuhr Grissom fort. »Wir reden mit jedem, der uns mög-
licherweise weiterhelfen kann. Zum Beispiel gibt es mindes-
tens ein halbes Dutzend weiterer Polizisten, die eventuell Zu-
gang zu den zurückgehaltenen Informationen über die genaue
Vorgehensweise von CASt hatten.«
»Richtig!«, rief Paquette und schnippte mit den Fingern.
»Wem waren Sie und Champlain seinerzeit unterstellt?«
»Dem damaligen Sheriff«, entgegnete Brass. »Der inzwi-
schen verstorben ist.«
»Was ist mit Conrad Ecklie?«, fragte Bell. »Er war der Lei-
ter der CSI-Tagschicht. Er wusste davon!«
»Wir werden mit ihm reden«, sagte Grissom.
Brass wusste, wie sehr Ecklie und Grissom sich hassten. Ir-
gendeiner wird mit Conrad reden, dachte er, aber Gil ganz
bestimmt nicht…
»Denken Sie nach, meine Herren!«, sagte er. »Ich habe mich
Grissom anvertraut – er hatte damals nur am Rande mit dem

Fall zu tun. Vielleicht haben Sie sich auch jemandem anver-
traut, und es ist Ihnen entfallen… Denken Sie darüber nach!«
Die drei Journalisten verfielen in Schweigen.
»Ich versichere Ihnen«, fügte Brass hinzu, »wir drehen je-
den noch so kleinen Stein einzeln um, wenn es sein muss.«
Paquette und Bell funkelten ihn wütend an.
»Sorry… Das sollte keine Drohung sein. Ich meinte nur, wir
werden alles Erdenkliche tun, um diesen Kerl zu schnappen,
und zwar fix. Wenn es wirklich CASt ist… Nun, wir wissen
alle, wozu er fähig ist. Wenn er seine Serie wiederholen will,
stehen noch vier Morde aus…«
»Jesus!«, zischte Brower.
»Und wenn es ein neuer Täter ist, der ähnlich vorgeht…«,
stellte Brass in den Raum und zögerte, bevor er fortfuhr. »Da-
mit befassen wir uns erst, wenn uns nichts anderes mehr übrig
bleibt. Wie dem auch sei – wir müssen diesen Kerl kriegen,
und zwar schnell. Hören Sie, ich weiß, die Geschichte ist ein
Knüller, aber wir müssen wenigstens am Anfang damit hinter
dem Berg halten.«
Bell sah seine beiden Begleiter an, die ihm mit einem Ni-
cken ihre Zustimmung zu verstehen gaben. Dann sagte er:
»Wenn Sie etwas brauchen, Jim, lassen Sie es uns wissen. Wir
tun, was wir können.«
»Danke.«
»Aber«, fügte Paquette hinzu und drohte mit dem Zeigefin-
ger, »wir bekommen die vierundzwanzig Stunden Vorsprung,
denken Sie daran!«
Brass nickte.
»Das tun wir«, bestätigte Grissom.
Als die beiden das Restaurant verließen, sang der Elvis-
Kellner »Jailhouse Rock«.

Vince Champlain wohnte mit seiner zweiten Frau in dem A-
partment-Flügel des Seniorenheims Sunny Day in Henderson,
das nicht weit vom Lake Mead Drive entfernt war.
Am Tor wurden Brass und Grissom von einem Wachmann
angehalten, der ihre Papiere prüfte und ihre Namen auf seinem
Clipboard notierte. Die beiden kannten das Heim bereits, da
Catherine und Warrick kürzlich an einem Fall gearbeitet hat-
ten, bei dem es um Morde auf der Pflegestation ging.
Auf der linken Seite gab es ein Gebäude mit Apartments
und auf der rechten ein Hochhaus mit Stationen unterschiedli-
cher Pflegestufen. Sunny Day war für viele Alte die Krönung
des Lebensabends – oder die Endstation, je nachdem, in wel-
chem Teil der Einrichtung sie untergebracht waren.
Brass fuhr auf den linken Flügel zu und fand nicht weit vom
Eingang einen Parkplatz. Er hatte die Champlains vorher ange-
rufen, um den Besuch anzumelden. Als er nun im dritten Stock
mit Grissom den Aufzug verließ und den Flur hinunterging,
streckte eine zierliche blonde Frau bereits den Kopf aus der Tür
und winkte ihnen aufgeregt zu.
»Jimmy!«, jauchzte sie und strahlte über das ganze Gesicht.
Grissom sah Brass von der Seite an und zeigte auf ihn.
»Jimmy? Sie sind… Jimmy?«
»Behalten Sie das lieber für sich!«
»Da verlangen Sie aber einiges!«
»Sonst muss ich Sie leider erschießen.«
Grissom grinste Brass an, der wiederum die kleine Frau an-
lächelte, die mit ausgebreiteten Armen vor ihrer Tür wartete.
»Margie!«, begrüßte Brass sie und ließ sich von ihr umar-
men und herzen, was sie angesichts ihrer zarten Statur mit
überraschender Heftigkeit tat.
Margie Champlain war nicht nur klein, sondern auch
schlank – und kaum gealtert, seit Brass sie zuletzt gesehen
hatte. Ihr blondes Haar war seit jeher gefärbt gewesen, und

schon damals hatte sie mindestens ein Facelifting hinter sich
gehabt – und seitdem mindestens noch eines.
Brass hatte sie kennen gelernt, kurz bevor ihr Mann in Rente
ging. Sie war damals Barkeeperin in einer kleinen Kneipe in
der Nähe der Fremont Street gewesen – und ein heißer Feger,
dem Vince Champlain nicht hatte widerstehen können. Die
Affäre hatte zwar zum Scheitern von Vinces erster Ehe geführt,
aber er und seine Ex-Frau Sheila waren nun beide besser dran.
Aus Vinces Affäre mit Margie war echte Liebe geworden, und
Sheila war inzwischen glücklich verheiratet mit dem pensio-
nierten Geschäftsführer eines Casinos, des Golden Nugget.
Brass wusste, dass die beiden Paare sich sogar gelegentlich
zum Dinner verabredeten.
»Wieso machst du dich so rar? Wir haben uns ewig nicht
gesehen, Jimmy!«, sagte Margie und trat einen Schritt zurück,
um ihm ins Gesicht zu sehen, hielt ihn aber weiter an den
Armen fest.
»Das liegt an der verdammten Nachtschicht«, entgegnete
Brass. »Da hat man kein Privatleben. Du hattest Glück, dass du
dir Vince erst kurz vor der Rente geangelt hast.«
»Ja, der ganze Spaß, den Polizistenfrauen haben, ist mir ent-
gangen, nicht wahr?« Sie ließ Brass jetzt endlich los und wand-
te sich Grissom zu. »Sie kenne ich aus dem Fernsehen! Sie sind
der, der immer die bösen Jungs zur Strecke bringt!«
Brass sah Grissom von der Seite an, der nicht so recht zu
wissen schien, wie er reagieren sollte.
»Ich nenne ihn gern meinen kleinen Helfer«, bemerkte
Brass trocken. »Das ist Gil Grissom – die Antwort unseres
kriminaltechnischen Labors auf Sherlock Holmes.«
Grissom runzelte die Stirn. »Ich wusste nicht, dass Sherlock
Holmes eine Frage ist.«
Margie lachte auf, dann fragte sie Brass: »Sollte das ein
Witz sein?«

»Das weiß man bei ihm nie so genau«, entgegnete er.
Margie schüttelte Grissom die Hand. »Was sind Sie für ein
flotter Käfer«, säuselte sie und hielt seine Hand weiterhin fest.
Der CSI-Leiter lächelte nervös und schaute auf seine Hand
wie ein Tier, das mit der Pfote in eine Falle geraten war. Würde
er sie abbeißen müssen, um wieder frei zu kommen?
»Ist Vince schon zurück?«, fragte Brass.
»Leider nicht«, entgegnete Margie und ließ Grissoms Hand
los. »Wie ich schon am Telefon sagte, er ist seit dem frühen
Morgen unterwegs.«
»Aber er kommt bald wieder?«
»Jede Minute«, meinte sie. »Kommt doch einfach rein, Kin-
der, und wartet auf ihn. Ich mache uns einen Koffeinfreien.«
Margie hatte Brass am Telefon gesagt, dass Vince wieder zu
Hause sein müsste, bis sie einträfen. Aber weil Zeit für ältere
Leute häufig eine ziemlich abstrakte Größe war und sie sich oft
nach Gesellschaft sehnten, überlegte Brass, ob er und Grissom
tatsächlich mit hineingehen sollten. Unter Umständen ver-
schwendeten sie wertvolle Zeit, denn bei Mordfällen waren die
ersten Stunden immer die wichtigsten.
Da er wusste, dass Grissom wahrscheinlich ähnlich dachte,
sah er ihn fragend an, aber der CSI zuckte nur mit den Schul-
tern und überließ ihm die Entscheidung.
Bevor Brass gezwungen war, einen Entschluss zu fassen,
tauchte ein großer, athletischer Mann mit silbergrauem Haar im
Korridor auf.
Vince Champlain war braun gebrannt, trug eine hellgraue
Trainingshose, ein dunkelgrau-schwarz gestreiftes Poloshirt
und Tennisschuhe. Mit federndem Gang ohne jedes Anzeichen
von Schwäche oder Alter kam er auf sie zu.
Auf seinem Gesicht, das von einem silbergrauen Schnurr-
bart geziert wurde, breitete sich ein strahlendes Lächeln aus.

Seine Zähne waren ein wenig zu weiß und zu gerade, um echt
zu sein.
»Jim! Du dreckiger Hu…«
»Pssst!«, machte Margie. »Vince, bitte… die Nachbarn!«
Dann flüsterte sie Brass und Grissom zu: »Wir haben links und
rechts von uns verdammt prüde Leute. Und dann Vince mit
seiner verfickten Bullen-Klappe!«
Grissom machte große Augen, und Brass musste grinsen.
Margie hatte sehr, sehr lange hinter der Theke gearbeitet…
Champlain klopfte Brass auf die Schulter, dann nickte er
Grissom grinsend zu. »Ihr Name steht ständig in der Zeitung,
und Ihr strahlendes Gesicht sehe ich häufig in der Glotze,
Gilbert. Sie haben echt was drauf!«
Grissom zuckte mit den Schultern und lächelte verlegen.
»Gehen wir rein«, sagte der ehemalige Cop und winkte sie
zu der offenen Wohnungstür, »damit ich ›Hurensohn‹ sagen
kann, ohne dass Margie eine Herzattacke kriegt.«
»Vincent!«, schimpfte Margie, aber sie lächelte.
Sie ging als Erste hinein, und Champlain folgte ihr. Brass
sah Grissom an. »Nach Ihnen, Gilbert…«
»Nein, nein – Sie zuerst…Jimmy«, entgegnete Grissom.
Die beiden grinsten sich an, und Brass fragte sich, ob die
Flachserei Grissom angesichts dessen, was sie an diesem Tag
schon gesehen hatten, genauso gut tat wie ihm.
Champlain schloss hinter ihnen die Tür, und Brass und Gris-
som sahen sich das Wohnzimmer an. Es war nicht besonders
groß, machte aber dafür, dass es sich im Apartment-Flügel
eines Altersheims befand, einen sehr gemütlichen Eindruck.
In einer Ecke stand ein großer Fernseher, in der anderen ein
verschlissener Klubsessel und an der Wand neben der Tür ein
Sofa mit Blumenmuster. Ein zweiter Sessel und ein Beistell-
tisch, auf dem sich Zeitschriften stapelten, machten die Sitz-

gruppe komplett. Champlain lud Grissom und Brass mit einer
Handbewegung ein, Platz zu nehmen.
»Wie wär’s mit einem Bier?«, fragte er.
»Nein, danke«, sagte Brass. »Wir sind im Dienst.«
»Ich dachte, ihr arbeitet nur nachts?«
»Der Tagschicht sind die Leute ausgegangen«, erklärte
Grissom.
»Wir schieben Doppelschichten«, fügte Brass hinzu.
»Beschwer dich nicht!«, entgegnete Champlain. Er hatte zu
den Cops gehört, die mit Leidenschaft ihrem Beruf nachgingen,
und war nicht besonders scharf auf die Rente gewesen. »Ich
vermisse das, was ihr habt… obwohl die Rente auch ihre Vor-
züge hat.«
Margie stand unschlüssig in der Küchentür. »Möchtet ihr
jetzt einen Kaffee?«
»Gern«, antwortete Brass.
»Ja, danke«, sagte Grissom.
»Für mich eine Flasche Wasser bitte, Schatz«, bat
Champlain.
Margie verschwand in der Küche.
»Zwei unter Par habe ich heute geschafft«, sagte Champlain
nicht ohne Stolz. »Golf ist einer von den eben erwähnten Vor-
zügen.«
»Wo spielst du denn?«, fragte Brass pflichtschuldig.
»Rio Secco«, entgegnete Champlain, als wäre der Name je-
dem ein Begriff.
Brass nickte, obwohl er keine Ahnung hatte, und Grissom
machte ein Gesicht, als spräche Champlain Esperanto.
»Aber«, sagte der Pensionär mit einem Blick zur Küchentür,
»ihr Arbeitstiere habt sicher nicht den langen Weg ins Rent-
nerheim gemacht, damit ich euch was übers Golfen erzähle.
Was ist los?«
»Ich glaube, wir haben einen Geist«, sagte Brass.

Champlain beugte sich mit zusammengekniffenen Augen
vor. »Die Vergangenheit rasselt mit den Ketten? Ist ein alter
Kumpel von uns wieder aufgetaucht?«
Margie brachte ein Tablett mit Kaffee und einer eisgekühl-
ten Flasche Evian für ihren Mann herein.
Wieder blieb sie unschlüssig stehen und überlegte ganz of-
fensichtlich, ob sie sich zu den Männern setzten sollte oder ob
sie unerwünscht war. »Was ist eigentlich der Grund für diese
nette Überraschung?«, fragte sie schließlich.
»Etwas Dienstliches«, entgegnete Champlain.
»Oh«, machte Margie, und ihre Enttäuschung war nicht zu
übersehen. »Mir fällt gerade ein, ich muss noch im Schlafzim-
mer Ordnung machen.«
Champlain schenkte seiner Frau ein warmherziges Lächeln.
»Danke, Baby.«
Nachdem »Baby« von Anfang siebzig in den Flur gegangen
und rechts in einem Zimmer verschwunden war, sah
Champlain seine Besucher erwartungsvoll an.
»Heute Morgen wurde Gil zu einem Mordfall in Nord Las
Vegas gerufen. Der M. O. kam mir verdammt bekannt vor –
Vince, das Ganze hat mich sehr an CASt erinnert.«
Unter seiner Bräune wurde Champlain blass. »Du willst
mich wohl verarschen…«
Brass schwieg.
Champlain blies die Backen auf und stieß die Luft aus, als
stünde vor ihm eine Geburtstagstorte mit so viel Kerzen, wie er
Lebensjahre zählte, die er alle auf einmal auspusten wollte.
»Okay, Jim, dann erzähl mal, und zwar von Anfang bis Ende.«
Das tat Brass, und diesmal ließ er nichts aus, auch nicht die
Nachahmer-Theorie.
Sein Ex-Partner seufzte erneut, dann schüttelte er den Kopf.
»Aber wenn dieser Mord eindeutig die Handschrift von CASt

trägt, wie du sagst, kann es kein Trittbrettfahrer sein. Wir
haben doch damals alles unter Verschluss gehalten.«
»Einige Aspekte am Tatort deuten darauf hin, dass es sich
im Gegensatz zu der Vorgehensweise des ursprünglichen Tä-
ters hier um eine Inszenierung handelt. Aber wir können nichts
ausschließen – auch die Möglichkeit nicht, dass CASt wieder
aufgetaucht ist.«
»Und womit kann ein alter Rentner wie ich euch helfen?«,
wollte Champlain nun wissen.
Eigentlich sah der »alte Rentner« fitter aus, als Brass sich je
gefühlt hatte. »Hast du mit jemandem über diesen Fall gespro-
chen? Mit irgendjemandem?«
»Nicht mehr, seit das Thema vor Jahren aus den Zeitungen
verschwand. Und du weißt doch, wie vorsichtig wir damals
waren – nur der Sheriff, Gott habe ihn selig, und der CSI-Leiter
der Tagschicht wussten von den zurückgehaltenen Details.«
»Und in letzter Zeit?«, fragte Brass. »Ich meine, du sitzt hier
doch vielleicht mal mit neuen Freunden zusammen, und ihr
tauscht Geschichten aus dem Berufsleben aus.«
Champlain winkte ab. »Vergiss es, Jim! Wie ihr beide wisst,
gehen wir Cops nicht mit unseren Misserfolgen hausieren…
und CASt war mein größter.«
Nickend fragte Brass: »Und was ist mit Margie?«
»Nein. Sie ist zwar nicht zimperlich, aber für die harten Fak-
ten meines Jobs ist sie doch zu zart besaitet. Und ich kann mich
auch nicht erinnern, jemals ausführlicher mit Sheila über den
Fall gesprochen zu haben. Aber das ist natürlich schon sehr
lange her«, sagte Champlain mit gerunzelter Stirn. »Jungs, ich
fürchte, ich kann nichts für euch tun. Gott weiß, wie gern ich
euch helfen würde! CASt war der dickste Fisch, der mir durchs
Netz gegangen ist.«
»Ich weiß, wie dir zumute ist, Vince«, sagte Brass. »Aber
wir mussten dich danach fragen.«

»Soll ich ehrlich sein?«, entgegnete Champlain. »Ich versu-
che es zu vermeiden, überhaupt an diesen gottverdammten Fall
zu denken! Wir waren so dicht dran, den Bastard zu schnap-
pen! So dicht, Jim! Ich konnte die Arbeit immer ganz gut hinter
mir lassen, wenn ich abends nach Hause ging. Aber dieser
Fall… Diese armen Kerle, die gedemütigt und erdrosselt wur-
den… Die Bilder von den Tatorten haben mich nachts ver-
folgt…« Champlain schüttelte sich.
Brass und Grissom standen auf.
»Wenn er es war«, sagte Brass, »dann kriegen wir ihn. Kei-
ne Sorge, Vince!«
»Und wenn er es nicht war?«
»Wenn er es nicht war, sondern irgendein anderer kranker
Bastard, dann kriegen wir ihn auch. So oder so – dieser Killer
wird gefasst.«
Champlain erhob sich ebenfalls und brachte sie zur Tür. Er
klopfte Brass auf die Schulter. »Du bist wirklich nicht mehr der
junge Kerl, der in meine Fußstapfen trat, als ich in Rente ging.«
»Das waren ziemlich große Fußstapfen«, entgegnete Brass.
»Und ich kann mich nicht daran erinnern, jemals jung gewesen
zu sein.«
»Es wird dir wieder einfallen«, versicherte Champlain ihm.
»Ganz sicher!«
»Das ist schon Ewigkeiten her«, erwiderte Brass. »Viele
Jahre und viele Tode…«
Unvermittelt schaltete Grissom sich ein. »Die Bedingung,
unter der Gott dem Menschen die Freiheit gab, ist ständige
Wachsamkeit.«
»Wer hat das gesagt?«, fragte Brass ihn mit einem spötti-
schen Grinsen.
»Richter John Philpot Curran«, antwortete Champlain an
Grissoms Stelle.

Grissom war beeindruckt und verbeugte sich lächelnd vor
dem pensionierten Cop.
»Aber«, fügte dieser hinzu, »ich bezweifle, dass der Richter
dabei ausgerechnet an das Morddezernat von Las Vegas dach-
te.«
Grissom zuckte mit den Schultern. »Nun, da gibt es noch ei-
ne andere alte Redensart, die Sie bestimmt kennen, Vince.«
»Und die wäre?«
»Wem der Schuh passt, der zieht ihn sich an.«

3
Fast alle schwarzen Ledersessel an dem großen rechteckigen
Tisch im Konferenzraum des CSI waren besetzt, nur der Platz
am Kopfende war noch frei. Im Schein der Neonbeleuchtung
wirkten die Versammelten totenbleich, und sie saßen um den
Tisch wie die Angehörigen bei der Testamentseröffnung eines
verblichenen reichen Patriarchen, die alle nicht damit rechne-
ten, auch nur einen einzigen Cent abzubekommen.
Catherine Willows lehnte sich zurück, verschränkte die Ar-
me vor der Brust und taxierte unauffällig die Gesichter der
anderen. Links von ihr saß Warrick Brown und studierte mit
müden Augen und grimmiger Miene irgendwelche Papiere.
Schräg gegenüber hing Nick Stokes zusammengesunken und
ungewöhnlich deprimiert in seinem Sessel und starrte mit
verkniffenem Mund ins Leere. Direkt gegenüber von Catherine
saß Sara, die geistesabwesend mit ihrem Stift spielte. Mit
hohlem Blick ließ sie ihn auf der Tischplatte rotieren.
Das leistungsstarke CSI-Nachtschichtteam, das nicht nur für
sein Können und sein Engagement berühmt war, sondern auch
für seine Geduld, schien nach einer trostlosen Woche voller
Fehlschläge am Ende seiner Kräfte zu sein.
Links von Sara saß Greg Sanders, der erstklassige Experte
aus dem DNS-Labor, dessen unerklärlichem Wunsch, in den
schlechter bezahlten CSI-Außendienst zu gehen, Grissom
kürzlich nachgekommen war. Während er einen Bericht las,
wippte er auf und ab und nickte mit dem Kopf im Rhythmus
eines Songs, den er offenbar im Kopf hatte. Er schien der

Einzige in der Runde zu sein, der zufrieden mit seinem Stand
bei den derzeitigen Ermittlungen war.
Gegenüber von Greg, rechts von Catherine, saß Dr. Al Rob-
bins, dessen Krückstock neben ihm am Tisch lehnte. Sein Blick
war starr auf die Autopsiefotos gerichtet, die er vor sich auf
dem Tisch ausgebreitet hatte wie ein Verliererblatt beim Kar-
tenspiel, aus dem er durch Sortieren doch noch etwas herausho-
len wollte. In seinem graumelierten Bart hatte das Grau im
Laufe der Jahre die Oberhand gewonnen. Die sonst so fröhli-
chen Augen des Doktors wirkten trüb, während er sich noch
einmal ein schreckliches Foto nach dem anderen anschaute.
Dass er ebenfalls hier in der Runde saß, zeigte, wie ernst die
Lage war. In der Regel war der Coroner kaum außerhalb seiner
Autopsieräume anzutreffen.
Links von Warrick saß Brass, der geistesabwesend in die
Luft starrte, als überlegte er sich, ob er weiter sauer sein oder
sich der Verzweiflung hingeben sollte. Er war als Letzter he-
reingekommen und hatte einen großen Karton mitgebracht, der
nun neben ihm auf dem Boden stand.
Gil Grissom, der das Treffen einberufen hatte, war immer
noch nicht eingetroffen, und seine entmutigte Truppe wurde
allmählich zappelig. Sie arbeiteten seit acht Tagen an dem
Mordfall Marvin Sandred und hatten immer noch nicht viel
mehr in der Hand als den Namen des Opfers. Das einzig Er-
freuliche war im Moment die Berichterstattung in der Presse –
niemand hatte Sandred bisher mit CASt in Verbindung ge-
bracht.
Es war ihr erstes Meeting in der Gruppe, bei dem alle ihre
Erkenntnisse vorstellen und miteinander vergleichen konnten –
und sie auch über die Laborergebnisse informiert werden soll-
ten, die gerade erst fertig geworden waren.
Endlich betrat Gil Grissom den Raum. Der CSI-Leiter wirk-
te genauso ernst wie seine Kollegen, zeigte jedoch keinerlei

Anzeichen von Frustration. Catherine bewunderte vieles an
Gil, vor allem aber seine Fähigkeit, objektive Professionalität
zu bewahren, egal wie heftig es auf sie niederprasselte. Aber es
gab auch Ausnahmen; selbst Grissom hatte seine schwachen
Momente. Bei Gewalt gegen Kinder kam seine emotionale
Seite zum Vorschein, aber in der Regel bewahrte er sich ein
hohes Maß an wissenschaftlicher Distanziertheit, für das Ca-
therine ihn bewunderte, ohne jedoch selbst danach zu streben.
Sie hatte gemerkt, dass sie besser arbeiten konnte, wenn sie
sich eine gewisse Emotionalität und manchmal sogar Subjekti-
vität bewahrte. Es gab eben unterschiedliche Konzepte.
Grissom trug einen hellblauen Laborkittel über seinem
schwarzen Standardoutfit und hatte seine Brille auf. Mit einem
dumpfen Schlag ließ er einen Stapel Akten auf den Tisch fal-
len, als er an seinem Platz angekommen war. Um seine Lippen
spielte ein abschätziges Grinsen, an dem zu erkennen war, dass
er sich in einer Stimmung befand, in der jeder andere das Mo-
biliar zertrümmert und aus dem Fenster geworfen hätte.
Catherine richtete sich auf. »Lass mich raten – da oben hasst
uns jemand…«, versuchte sie zu scherzen, verstummte jedoch
gleich wieder.
»Gut erkannt, Catherine«, entgegnete Grissom nämlich mit
grimmiger Stimme.
Nick stöhnte. »Atwater?«
»Atwater«, bestätigte Grissom, und aus seinem Mund klang
es eher wie ein Schimpfwort und nicht wie der Name eines
Menschen – ihres Vorgesetzten, des Sheriffs. »Jemand hat ihn
angerufen… und auf CASt angesprochen.«
»Ach, zum Teufel«, sagte Warrick und schlug frustriert auf
den Tisch.
»Unser geschätzter Sheriff wollte meine Zusicherung, dass
niemand vom CSI der Presse etwas zugespielt hat.«

»Wer nervt denn den Sheriff?«, fragte Brass scharf. »Unser
Kumpel Perry Bell?«
»Nein«, entgegnete Grissom. »Das Fernsehen, ein Lokal-
sender.«
Catherine dachte nach. »Können wir unseren Kollegen aus
dem Norden vertrauen? Bill Damon und Henry Logan? Du hast
Logan ganz schön zugesetzt.«
»Habe ich?« Grissom schien überhaupt nicht zu wissen,
worauf Catherine anspielte.
»Ich könnte mir eher vorstellen, dass einer unserer ›Freun-
de‹ vom Banner es den Jungs vom Fernsehen gesteckt hat –
mit solchen Tipps werden Geschäfte gemacht«, erklärte Brass.
»Sobald das Stichwort CASt in den Medien gefallen ist«,
bemerkte Nick, »ist die Übereinkunft mit den Zeitungsfritzen
null und nichtig, und sie können sich nach Herzenslust darüber
auslassen.«
»Wenn diese Clowns uns übers Ohr gehauen haben«, sagte
Brass, und sein Ton war so hart wie der Tisch, auf dem seine
Hände ruhten, »bekommen sie nie wieder etwas von diesem
Department… Gil, wissen Sie, wer genau beim Sheriff angeru-
fen hat?«
Für Grissom war ein Reporter wie der andere. »Jill Ganine«,
sagte er achselzuckend.
»Vielleicht sollten wir uns mal mit ihr unterhalten«, meinte
Brass.
»Ich habe nicht vor, meine Zeit mit den Medien zu vergeu-
den«, widersprach Grissom. »Falls die vom Banner sich nicht
an die Absprache gehalten haben, kommen wir dem Mörder
keinen Schritt näher, wenn wir wissen, wer genau geredet hat.«
Brass verzog das Gesicht. »Richtig. Sie haben Recht«,
räumte er ein.

»Wir hatten eine ganze Woche ohne den Druck der Presse,
und dieser Luxus hat uns zu einem guten Start verholfen«,
sagte Grissom und zog die Augenbrauen hoch.
Warrick sah seinen Boss an, als wäre er nicht ganz dicht,
sagte aber nichts.
»Also«, sagte Grissom und setzte sich endlich auf seinen
Stuhl. »Wir arbeiten konzentriert an dem Fall, und um die
Medien machen wir uns in unserer Freizeit Gedanken… Und
wenn einer von euch freie Zeit hat, dann soll er sich bei mir
melden. So… was haben wir denn alles?«
Er schaute erwartungsvoll in die Runde, aber niemand woll-
te freiwillig den Anfang machen.
Kein gutes Zeichen, dachte Catherine. Ihr war jedoch auch
nicht danach, als Erste den Finger zu heben.
Grissom sah Greg an, der rechts von ihm saß. Offenbar
spürte der CSI-Leiter, wer als Einziger im Raum positiv ge-
stimmt war. »Machen Sie mich glücklich, Greg!«
»Das ganze Blut stammt von dem Opfer«, entgegnete Greg.
Grissom sah keine Spur glücklicher aus als vorher. »Sonst
noch was?«
»Das Sperma auf dem Rücken stammt nicht von dem Opfer.
Wir konnten es noch nicht identifizieren – CODIS läuft noch.«
Die DNS-Datenbank wuchs zwar ständig, aber Catherine
wusste nur zu gut, dass man nicht unbedingt mit einem Treffer
rechnen durfte.
»Catherine«, wandte sich Grissom jetzt an sie. Er wirkte
schon viel gelassener, sein Zorn auf den Sheriff und die Me-
dien schien verflogen. »Was wissen wir über das Opfer?«
Ohne den Bericht zu Hilfe zu nehmen, der vor ihr auf dem
Tisch lag, sagte Catherine: »Marvin Sandred, siebenundvierzig,
lebte seit etwas mehr als einem Jahr in Las Vegas. Seit sechs
Monaten hat er bei einer Firma für Schweißgeräte gearbeitet.«

Sie sah Brass an, der den Faden aufnahm. »Ich habe mit
Sandreds Boss und einem halben Dutzend Kollegen gespro-
chen. Niemand hatte etwas Schlechtes über ihn zu sagen. Al-
lerdings auch nichts Gutes – er war immer noch der Neuling
und nicht besonders gut in den Betrieb integriert. Die anderen
empfanden ihn als traurig und nicht richtig bei der Sache, als
verrichte er die Arbeit nur notgedrungen, bis er sich wieder
dem widmen konnte… was ihn wirklich interessierte.«
Nun übernahm Catherine wieder. »Er stammte aus Eau Clai-
re, Wisconsin. Seine Ex-Frau wohnt noch dort. Sie heißt And-
rea Dean, kurz Annie, und hat wieder geheiratet, nachdem
Marvin nach Las Vegas gegangen war.«
Grissom horchte auf. »Wie hast du das herausgefunden?«
Jetzt schaltete sich Brass wieder ein. »Ich habe Catherine
gebeten, für mich anzurufen. Ich weiß, das gehört nicht zu den
CSI-Aufgaben, aber ich hatte das Gefühl, bei einem Gespräch
von Frau zu Frau kriegen wir mehr heraus.«
»Sie ist regelrecht zusammengebrochen, als ich es ihr sag-
te«, erzählte Catherine. »Sie hat furchtbar geweint und mich
gebeten, fünf Minuten später noch mal anzurufen. Das tat ich,
und sie hatte sich gefasst und beantwortete alle meine Fragen.
Aber das hilft uns nicht viel weiter.«
»Hatte sie noch Kontakt zu ihrem Ex?«, fragte Grissom.
»Hat sie ihn hier besucht?«
»Sie haben ein paar Mal miteinander telefoniert. Sie hatten
keine Kinder und haben sich im Streit getrennt, als er sich seine
Rentenversicherung auszahlen ließ und hierher zog… weil er
sich im Glücksspiel versuchen wollte.«
»Das ist ihm also bei der Arbeit im Kopf herumgegangen«,
bemerkte Warrick.
Catherine und Brass nickten.
»Übrigens«, sagte Brass, »die Befragung der Nachbarn war
ein Reinfall. Die paar Leute, die zu Hause waren, haben keinen

Fremden in der Straße bemerkt und schon gar keinen Mörder
aus dem Haus kommen sehen.«
»Das war’s dann wohl mit den brauchbaren Aussagen«, sag-
te Grissom. »Was ist mit den Beweisspuren?«
»Der unvollständige Schuhabdruck stammt von einem aktu-
ellen Air-Stasis-Laufschuh«, entgegnete Warrick. »Solche
Schuhe haben wir weder in Sandreds Schrank noch irgendwo
sonst in seinem Haus gefunden… und bei den Leuten nebenan
auch nicht. Er stammt also möglicherweise von dem Täter.«
»Gut, Warrick«, sagte Grissom.
»Die unvollständigen Fingerabdrücke an der Klingel und
der Türklinke stammen nicht von Sandred«, erklärte Sara.
»Wissen wir, von wem sie sind?«, fragte Grissom.
»Ich habe sie durchs AFIS gejagt, aber Fehlanzeige«, sagte
Nick.
»Ich habe Spielbankenkommission und Armee gecheckt…
aber da war nichts zu finden«, fügte Sara hinzu.
»Sonst irgendwelche Hinweise?«, fragte Grissom.
»Nur diese schwarzen Fasern, die du gefunden hast«, sagte
Nick. »Polyester.«
Grissom sah den Coroner an.
»Das Opfer starb an Asphyxie durch Strangulation«, berich-
tete Dr. Robbins. »Es muss versucht haben, sich zur Wehr zu
setzen. Aber mehr habe ich leider nicht zu bieten.«
»Haben Sie sich die alten CASt-Akten angesehen?«
»Ja, die Todesursache ist dieselbe.«
Grissom nickte, der Coroner ebenfalls. Dann stand er auf,
hängte sich seinen Krückstock an den Arm und verließ mit
seiner dicken Fotomappe den Raum. In der Tür blieb er noch
einmal stehen. »Das war kein schöner Tod«, sagte er. »Es wäre
nett, wenn ich mir nicht noch mehr Fotos dieser Art anschauen
müsste.«

»Wir werden sehen, was wir tun können, Doc«, entgegnete
Catherine.
Robbins nickte mit ernster Miene und ging hinaus.
»Es braucht schon einen richtig perversen Übeltäter«, sagte
Nick, »um dem Coroner so die Stimmung zu vermiesen.«
Grissom sah ihn an. »Du hast die Lippenstift-Datenbank
durchgearbeitet…«
»Ja, der vom Täter verwendete heißt ›Bright Rose‹ und ist
von Ile De France. Er ist ganz ähnlich wie ›Limerick Rose‹,
den CASt damals bevorzugte, aber nicht genau gleich.«
»›Limerick Rose‹ ist auch von Ile De France«, bemerkte
Catherine.
Nick reagierte mit einem knappen Grinsen. »Da spricht die
Expertin… Das Problem mit ›Bright Rose‹ ist, dass er überall
verkauft wird – von den Kosmetikabteilungen der Kaufhäuser
bis Walgreens. Da sind unsere Chancen kaum größer als bei
einer Flasche Wasser.«
»Mit dem Seil ist es genauso«, fügte Warrick hinzu. »Das
kann man in jedem Haushaltswarenladen kaufen. Aber ich
habe Hautzellen von beiden Enden des Seils.«
»Ich bin mit der Untersuchung noch nicht fertig«, erklärte
Greg. »Ich versuche herauszufinden, welche vom Opfer stam-
men und welche von dem Killer. Wo das Seil um den Hals des
Opfers lag, war es einfach, aber was den Rest des Seils angeht,
muss man rekonstruieren, wo das Opfer daran gezerrt hat, um
sich zu befreien, und wo der Mörder es angefasst hat. Dann
wissen wir erst, welche Zellen von wem stammen.«
Grissom legte den Kopf schräg. »Und wie lange dauert
das?«
»Nicht mehr sehr lange.«
»Gut, Greg, hängen Sie sich rein, und halten Sie mich auf
dem Laufenden!«

»In diesem Zusammenhang ist Reinhängen kein schönes
Wort«, meinte Greg.
»Ich bin hier für Galgenhumor zuständig, Greg«, entgegnete
Grissom, »und ich bin jetzt nicht in der Stimmung.«
Der Laborant hob die Augenbrauen und sah überall hin, nur
nicht in Grissoms Gesicht.
»Um auf Ihre Arbeit zurückzukommen, Greg«, fuhr Gris-
som mit hinterhältigem Grinsen fort. »Haben Sie nicht drin-
gend etwas zu erledigen?«
»Ja, doch, habe ich.« Greg erhob sich mit einem Lächeln,
das zu den gequältesten in der Geschichte der Menschheit
zählte. »Hab was zu erledigen. Dringend. Bis dann, Leute!« Er
schnappte sich seine Akten und verließ den Raum.
So viel zu dem Einzigen in der Runde, der guter Stimmung
war.
Grissoms Blick wanderte von Gesicht zu Gesicht. »Also gut,
dann zu unserer Vorgehensweise.«
»Sie wollen mir sagen, wie wir vorgehen, Gil?«, fragte
Brass.
»Ja«, entgegnete Grissom nur.
Brass dachte kurz nach. »Okay.«
»Wenn Sie mit dieser Reporterin reden wollen, Jim, nur zu!
Aber vorher setzen Sie sich mit Catherine und Nick zusam-
men.«
Brass nickte zögernd.
»Cath«, fuhr Grissom fort, »ich möchte, dass du mit Nick
die alten Akten durchgehst, alle fünf Morde, alle Verdächtigen.
Findet so viel heraus, wie ihr nur könnt. Vergleicht die Fakten
ganz genau mit dem aktuellen Fall. Zuerst redet ihr mit Jim.
Und dann findet heraus, wo die Verdächtigen von damals sind.
Ob hier in der Stadt, verzogen oder verstorben – ich will wis-
sen, wo sie stecken. Und mit dem Wissen, das ihr aus den
Akten bekommt, entwickelt ihr Theorien dazu, ob einer der

Verdächtigen vielleicht mit einem leicht veränderten M. O.
wieder im Geschäft sein könnte.«
»Theorien?« Catherine traute ihren Ohren nicht.
»Ganz genau. Keine wilden Vermutungen.«
»Aber gern!«
»Warrick, Sara und ich arbeiten an den Beweisspuren aus
Sandreds Haus weiter. Vielleicht finden wir etwas, das wir
bisher übersehen haben. Nennt es eine erste Theorie, aber ich
sage es ganz offiziell: Der Kerl hat gerade erst angefangen.«
Das war nicht aus der Luft gegriffen, wusste Catherine. Sie
alle erkannten die Handschrift eines Serienkillers auf den
ersten Blick, und es war ziemlich eindeutig, dass dieser Mist-
kerl noch mehr vorhatte.
»Es gibt noch einen weiteren beunruhigenden Aspekt«, fuhr
Grissom fort. »Wenn wir es – wie seinerzeit bei unserem
Möchtegern-Jack-the-Ripper – mit einem Nachahmer zu tun
haben, dann wird es eine bestimmte Zahl von Opfern geben …
fünf, um genau zu sein, und danach hört unser mordender
Performancekünstler auf und verschwindet in der Nacht.«
»Wie der Original-Ripper«, sagte Nick.
»Zum Teufel«, sagte Warrick, »wie der Original-CASt!«
Grissom, Warrick und Sara standen auf und überließen den
Konferenzraum Brass, Nick und Catherine, die sich am Kopf-
ende des Tischs zusammensetzten.
Brass nahm sich den großen Karton vor. Geschäftsmäßig
holte er die erste Akte heraus. »Der erste Mord geschah im
November 1994. Das Opfer hieß Todd Henry. Er wohnte in
einem Apartment im Zentrum. Keine Familie, keine Freunde.
Er war fast eine Woche tot, bevor wir davon unterrichtet wur-
den.«
»Wer hat ihn gefunden?«, fragte Nick.
»Der Geruch war so schlimm, dass die Nachbarn sich bei
der Polizei beschwert haben, und dann sind wir rein. Der Mann

lag mit dem Seil um den Hals im Wohnzimmer auf dem Bo-
den.«
»War der Tathergang von Anfang an derselbe? Lippenstift,
Sperma, Seil?«
»Ja«, entgegnete Brass. »Der Täter hatte die Sache entweder
von langer Hand geplant – vielleicht hatte er schon ewig davon
geträumt –, oder er hat vorher schon woanders zugeschlagen.
So oder so, seit die Mordserie in Las Vegas begann, verlief der
Tathergang immer nach exakt demselben Muster.«
»Natürlich haben Sie und Vince auch außerhalb von Las
Vegas Erkundungen angestellt«, sagte Nick.
»Landesweit, aber wir haben nirgendwo etwas gefunden.
Wir haben sogar in Kanada und schließlich auch in Europa
nachgeforscht. Jedenfalls tauchte einen Monat nach Todd
Henrys Tod die nächste Leiche auf: John Jarvis. Alles war
genauso wie bei dem ersten Fall.«
»Gab es irgendeine Verbindung zwischen Jarvis und Hen-
ry?«
»Abgesehen von äußerlichen Ähnlichkeiten? Nein«, entgeg-
nete Brass. »Henry stammte nicht von hier, Jarvis hat von
Kindesbeinen an in Vegas gelebt. Henry war Gelegenheitsar-
beiter, Jarvis Buchhalter. Henry lebte allein, Jarvis hatte eine
Familie – Frau und Sohn. Er wohnte in einem hübschen Haus
in Boulder City, während Henry in diesem Rattenloch im
Zentrum sein Dasein fristete. Die einzige Gemeinsamkeit war
das äußere Erscheinungsbild. Weiße Männer um die fünfzig
mit Übergewicht.«
»Was ist mit den anderen?«
»George Kim, das dritte Opfer, war Halbasiate, aber abge-
sehen davon waren alle fünf – Henry, Jarvis, Kim, Clyde Gib-
son und Vincent Drake – korpulente weiße Männer um die
fünfundvierzig, fünfzig. Obwohl es Gemeinsamkeiten zwi-

schen einzelnen von ihnen gab, war dies der einzige gemein-
same Nenner.«
»Sonst nichts?«, fragte Nick ungläubig.
Brass zuckte mit den Schultern. »Kim hat im Lucky Seven
gearbeitet, Drake als Parkhauswächter, und Gibson war selbst-
ständiger Möbelbauer. Manche hatten Kinder, andere nicht.
Manche waren verheiratet, andere nicht. Das Einzige, was
variierte, war der Abstand zwischen den Morden. Ein Monat
lag zwischen den ersten beiden, kaum eine Woche zwischen
den letzten beiden. Der Täter kam eindeutig immer mehr in
Fahrt. Und dann… hat er plötzlich aufgehört.«
»Okay, so viel zu den Opfern«, sagte Catherine. »Und was
ist mit den Verdächtigen?«
Brass schnaubte. »Am Anfang waren es hunderte. Notori-
sche Bekenner riefen an, aber auch korpulente Männer, die ihre
Nachbarn verdächtigten, und alle möglichen Dummköpfe. Als
wir die Spinner aussortiert hatten, blieben drei übrig: ein Loser
namens Dallas Hanson, ein Dreckskerl namens Phillip Carlson
und dieser totale Psychopath Jerome Dayton.«
»Was heißt das genau?«
»Wenn ich Dayton als Psychopathen bezeichne, meine ich
damit nicht ›exzentrisch‹, sondern wirklich krank. Sein Vater
Thomas Dayton war ein großer Bauunternehmer, der Ende der
Achtziger, Anfang der Neunziger viele Verwaltungsgebäude
und einige Kasinos hochgezogen hat – sagt Ihnen der Name
etwas?«
»Oh ja«, entgegnete Catherine.
Nick pflichtete ihr mit einem Nicken bei.
Brass fuhr fort. »Jerome war mein persönlicher Favorit, aber
er landete in einer Privatklinik, wo er sich seit Ende 1995
aufhält. Ich hätte ein Jahresgehalt darauf gewettet, dass er der
Täter war, aber Drake kam um, nachdem Dayton in die Anstalt
gesteckt wurde.«

Catherine nickte nachdenklich. »Was ist mit den anderen?«
»Vince hatte es auf diesen Loser Dallas Hanson abgesehen.
Er war ein Cowboy aus Oklahoma. Er und seine – in Anfüh-
rungszeichen – ›Alte‹ kauften ein heruntergekommenes
Wohnwagenhaus im Nordwesten der Stadt. Als ihr der Ver-
dacht kam, Dallas betrüge sie, hat sie ihn rausgeworfen. Er
bezog schließlich ein Apartment in dem Haus, in dem Todd
Henry wohnte. Dann tauchte er auf einem Überwachungsvideo
des Lucky Seven auf, wo George Kim arbeitete.«
»Klingt viel versprechend«, bemerkte Nick.
»Gab es handfeste Beweise gegen Hanson?«, fragte Cathe-
rine.
Brass schüttelte den Kopf. »Nur einen Fingerabdruck, den
wir auf einer Tasse in Henrys Apartment fanden. Hanson be-
hauptete, er habe seinen Nachbarn besucht und lediglich etwas
mit ihm getrunken, aber mehr nicht. Danach ist Henry dann
umgebracht worden.«
»Kein Alibi?«, fragte Nick.
»Er behauptete, nach dem Besuch bei Henry sei er betrun-
ken in seiner Wohnung aus den Latschen gekippt. Natürlich
hatte er dafür keine Zeugen.«
»War er vorbestraft?«, fragte Catherine.
»Nur wegen Kleinkram«, entgegnete Brass. »In Oklahoma
wurde er ein paar Mal bei Kneipenschlägereien gefasst, und
hier hat er kurz wegen minderschwerer Körperverletzung
gesessen… aber CASt-ähnliche Neigungen hat er nie gezeigt.«
»Was ist mit dem DNS-Beweis?«, fragte Nick. »Sie hatten
doch das Sperma vom Tatort…«
Brass schüttelte den Kopf. »Wir konnten es nicht zuordnen,
aber die damalige Technologie lässt sich natürlich nicht mit der
von heute vergleichen.«
»Was war mit Phillip Carlson?«, hakte Catherine nach.

»Der Typ war ein totaler Freak. Er hat Schwule überfallen.
Er hat sich als Stricher ausgegeben, und wenn er mit dem
Freier allein war, hat er ihn zusammengeschlagen und ausge-
raubt.«
»Wie charmant«, bemerkte Nick.
»Oh, es hätte uns gut gefallen, wenn er es gewesen wäre…
Zum Teufel, er hat sogar gestanden. Aber dann stellte sich
heraus, dass er ein notorischer Bekenner war, zumindest was
Morde anging, denen irgendetwas Schwules anhaftete. Shrink
sagte damals, Carlson sei schwul oder bi und versuche, seine
Neigungen zu unterdrücken, und dass er sich selbst noch mehr
hasse als die Homosexuellen, die er zusammenschlug.«
»Klingt doch alles sehr verdächtig«, meinte Catherine.
»Sicher«, entgegnete Brass. »Aber er war nie zur richtigen
Zeit am richtigen Ort – oder am falschen Ort, besser gesagt. Er
war im Lucky Seven, das hatten wir auf Video. Das Problem
war nur, die Kamera hatte ihn ungefähr eine Stunde vor dem
Mord an George Kim erfasst. Carlson hätte also ziemlich we-
nig Zeit gehabt, um zu Kim nach Hause zu fahren, denn der
wohnte weit draußen auf der anderen Seite der Stadt. Es war
zwar nicht unmöglich, dass Carlson die Fahrt hätte schaffen
können, aber doch höchst unwahrscheinlich.«
»Und wie sieht es mit seiner Beteiligung an den anderen
Morden aus?«, fragte Nick.
»Bei dem Mord an Henry war es das Gleiche«, sagte Brass
mit einem verzweifelten und zugleich resignierten Unterton.
»Carlson wurde zwar am fraglichen Tag in der Stadt gesehen,
aber nicht zu der Zeit, als der Mord an Henry geschah. Als er
erdrosselt wurde, war Carlson mit Zeugen am Lake Mead.«
»Gute Zeugen?«, fragte Catherine.
Brass grunzte. »Halten Sie sich fest – eine ganze Biker-
gang!«

Nick grinste grimmig. »Keine idealen Zeugen, und ich wet-
te, die bringt man nicht so leicht von ihrer Geschichte ab.«
»Da haben Sie Recht, Nick – kein einziger ist davon abge-
rückt. Ein Mann, ein Wort!«
»O-kay«, sagte Catherine langsam und schlug sich auf die
Schenkel. »Dann nehmen wir uns den ganzen Fall noch einmal
vor.«
Brass schien den Tränen verdammt nahe. »Wir haben hart
an dem Fall gearbeitet, Vince und ich – ich glaube einfach
nicht, dass wir etwas übersehen haben…«
»Sie haben bestimmt Ihr Bestes gegeben«, entgegnete Ca-
therine. »Aber die Zeiten haben sich geändert – die Technolo-
gie auch. Wurde zufällig etwas von dem Sperma aufbewahrt?«
Brass’ Miene hellte sich auf. »Zum Teufel! Das habe ich ja
total vergessen. Naja, ist ja auch schon lange her…«
»Was?«, fragte Nick.
»Vince hat das Sperma in weiser Voraussicht einfrieren las-
sen«, entgegnete Brass mit neuem Elan. »Der genetische Fin-
gerabdruck steckte damals noch in den Kinderschuhen, und wir
hofften natürlich, dass die Wissenschaft Fortschritte macht.
Darauf hat Vince gebaut – schließlich wird die Akte erst ge-
schlossen, wenn der Fall gelöst ist.«
»Gut«, sagte Catherine. »Sehr gut!«
Plötzlich lächelte Brass. »Wissen Sie, daran hatte ich gar
nicht mehr gedacht… bestimmt zehn Jahre nicht. Sehen Sie im
Beweismittel-Gefrierschrank nach! Die Probe muss irgendwo
da drin sein!«
In dieser optimistischen Stimmung wollten sie die Unterhal-
tung gerade beenden, als Detective Bill Damon mit finsterer
Miene in den Konferenzraum kam.
»Was zum Teufel?«, fragte er nur. Diese äußerst vage Frage
war an Brass gerichtet.
»Was zum Teufel was, Bill?«

Damon baute sich wütend vor dem Captain auf. »Atwater
glaubt, ich und meine Jungs geben Informationen an die Me-
dien weiter!«
Brass behielt die Ruhe und erhob sich. »Nein, Bill, so wie
ich das verstanden habe, weiß unser Sheriff nicht, wo die un-
dichte Stelle ist. Er weiß nur, dass es eine gibt.«
Mit spöttischem Grinsen wies Damon auf Nick und Catheri-
ne. »Tja, ich würde sagen, sie ist hier – genau hier!«
Nick zeigte seine Zähne, ohne wirklich zu lächeln. »Ist sie
aber nicht, Bill – vielleicht hat der Sheriff ja Recht!«
Brass rügte ihn mit einem strengen Blick und wandte sich
wieder an Damon. »Hören Sie, Bill«, sagte er ruhig. »Der
Sheriff verdächtigt weder Sie noch sonst jemanden von Ihrem
Department – oder von unserem. Er will einfach nur wissen,
wo die undichte Stelle ist. Das können Sie ihm nicht verübeln.
Und ich persönlich glaube nicht, dass Sie etwas ausplaudern.«
Damon schien sich ein wenig zu entspannen.
Catherine behielt lieber für sich, dass sie Damon und Logan
vorhin selbst im Verdacht gehabt hatte. Die beiden Cops waren
anscheinend sehr verärgert darüber gewesen, dass Brass die
Ermittlungen an sich gerissen hatte.
Nachdem Damon sich vorher so aufgeregt hatte, war aber
offensichtlich noch genug Wut übrig geblieben. »Wollten Sie
mich nicht auf dem Laufenden halten?«, fragte er aufgebracht
weiter. »Ich habe nichts von Ihnen gehört, und zwar seit drei
Tagen!«
Brass hob beschwichtigend die Hand. »Ich wollte Sie gerade
anrufen. Seit heute Morgen kommen die Laborergebnisse rein,
und jetzt haben wir endlich Informationen.«
Damon schien zumindest ein wenig zufriedener zu sein.
»Gut. Nun, gut… Also, dann spucken Sie es aus!«
»Mache ich«, sagte Brass. »Im Wagen.«

»Im Wagen?«, wiederholte der jüngere Detective über-
rascht.
»Ja, wir werden mit der Fernsehreporterin sprechen, die
Sheriff Atwater angerufen und auf CASt angesprochen hat.«
Catherine merkte, dass dem jungen Cop die Richtung, die
das Gespräch nahm, langsam gefiel.
»Welche Reporterin?«, fragte er.
»Jill Ganine«, entgegnete Brass. »Die von KLAS.«
Nun schien der Frieden endgültig wiederhergestellt. Damon
und Nick lächelten sich entschuldigend an, und Brass ging mit
dem Detective zur Tür. Genau in diesem Augenblick kam
Grissom mit dem allzeit fröhlichen Greg Sanders im Schlepp-
tau zurück.
Der CSI-Leiter hingegen wirkte nicht besonders heiter. Er
machte ein ernstes Gesicht und schaute besorgt auf das Papier
in seiner Hand.
»Wer ist gestorben?«, fragte Catherine.
»CODIS hat das Sperma vom Rücken des Opfers identifi-
ziert«, entgegnete Grissom matt.
Catherine zuckte mit den Schultern. »Das ist doch eine gute
Nachricht, oder?«
»Das würde ich normalerweise auch sagen. Aber laut
CODIS stammt die DNS von einem gewissen Rudy Orloff.«
Brass sah Damon an. »Ich kenne diesen Namen irgendwo-
her – Sie auch?«
Damon schüttelte den Kopf.
»Ich kenne diesen Namen«, wiederholte Brass nachdenk-
lich.
»Wie hier steht, kommt er aus dem Strichermilieu.«
»Genau!«, rief Brass. »Jetzt erinnere ich mich. Wir haben
ihn im Fall Pierce verhört – erinnern Sie sich, Gil? Dieser
magere kleine Scheißkerl hat doch nicht den Mumm, jemanden
umzubringen, und schon gar nicht…«

»Anscheinend«, fiel Grissom ihm ins Wort, »hat er vor ei-
nem Jahr in Reno den nötigen Mumm gefunden. Er hat auf
einen Freier eingestochen, der beinahe an den Verletzungen
gestorben wäre. Seitdem sitzt er wegen versuchten Mordes in
Ely. Er hat lebenslänglich mit Chance auf Bewährung bekom-
men.«
Catherine fühlte sich, als hätte sie einen Schlag in den Ma-
gen bekommen. »Unser bester Verdächtiger sitzt in einem
Hochsicherheitsgefängnis? Schon seit einem Jahr?«
Grissom wedelte mit dem Papier. »Eigentlich erst seit zwei
Monaten – die Cops von Reno haben ihn nicht gleich ge-
schnappt. Dann kam der Prozess, er ging in Berufung, und erst
danach wurde er nach Ely gebracht. Wo er sich wohl auch
aufhielt, als Marvin Sandred ermordet wurde.«
Alle sahen sich verblüfft an. Wenn der Hauptverdächtige im
Gefängnis war, wie kam sein Sperma dann nach Nord Las
Vegas auf den Rücken eines Toten?
Im hohen Bogen wohl kaum… dachte Catherine.
»Und jetzt?«, fragte Brass entmutigt. »Wie geht es jetzt wei-
ter?«
Greg meldete sich mit hoffnungsvoller Miene zu Wort.
»Vielleicht helfen uns die Hautzellen weiter. Am besten mache
ich mich wieder an die Arbeit.«
»Tun Sie das, Greg«, sagte Grissom ohne aufzusehen.
Und Greg verschwand.
Brass stand da und schüttelte in einem fort den Kopf, und an
seiner Schläfe trat eine Ader immer stärker hervor. »Es ist gar
nicht so einfach, sich zu den größten Pechvögeln von Vegas
zählen zu können«, sagte er. »Aber wir sind etwas Besonderes
– uns gelingt das natürlich. Das Sperma am Tatort stammt von
einem Gefängnisinsassen, und bei den Hautzellen von dem Seil
stellt sich wahrscheinlich am Ende heraus, dass sie von Bugsy
Siegel stammen.«

Catherine wollte eine zynische Bemerkung machen, aber da
klingelte zum Glück ihr Handy. Als sie es aus der Tasche holte,
fingen auch die Handys von Nick, Grissom, Brass und Damon
an zu piepsen.
Es war das reinste Digitalkonzert.
Konfrontiert mit sechs ungelösten Mordfällen, die sich über
ein ganzes Jahrzehnt erstreckten, hatte Catherine Willows nur
einen Gedanken, als sie die Gesprächstaste auf ihrem Handy
drückte. Aber bevor sie ihn aussprechen konnte, nahm Brass
ihr die Worte aus dem Mund. »Und wie zum Teufel geht es
jetzt weiter?«, hörte sie ihn sagen.

4
Als der zweite Mord geschah, rückte nicht das gesamte Team
aus. Catherine und Nick blieben im Büro und arbeiteten sich
durch die alten Fälle. Nur Grissom, Sara und Warrick fuhren
hinaus in den Vorort Coronado Ranch.
Anders als im Fall Sandred, bei dem er den Vorgarten auf
Spuren untersucht hatte, arbeitete Warrick Brown diesmal
drinnen. Das Haus auf dem Buried Treasure Court gehörte
Enrique Diaz. Dem kürzlich verschiedenen Enrique Diaz, um
genau zu sein, einem erfolgreichen Fernsehproduzenten, der
für den Tourist Channel arbeitete. Der Kabelsender hatte den
Themenschwerpunkt Reisen und eine besondere Schwäche für
seinen Standort Las Vegas.
Das Haus war schick, aber nicht pompös. Es ließ Wohlstand
erkennen, ohne protzig zu wirken. Das lang gestreckte, zwei-
stöckige Gebäude mit Ziegeldach sah aus wie alle anderen
Häuser im Viertel und war trotz Wasserknappheit von einer
makellosen Rasenfläche umgeben.
Während Brass und Damon loszogen, um die Nachbarn zu
befragen, untersuchten Grissom, Sara und Warrick Haus und
Grundstück. Sara arbeitete draußen, und Grissom nahm sich
das Innere vor – bis auf das Wohnzimmer, wo sich die Tat
ereignet hatte. Dort war Warrick am Werk.
Da Warrick den Tatort des Sandred-Mordes mit eigenen
Augen gesehen und die Fotos aus dem Haus des ersten Opfers
sehr genau studiert hatte, fiel ihm sofort die verblüffende Ähn-
lichkeit zwischen den beiden Morden auf. Der Unterschied

bestand lediglich darin, dass es bei Diaz wesentlich schicker
aussah als in Sandreds schäbigem Bungalow.
Diaz’ Wohnzimmer war doppelt so groß wie das von
Sandred und im mexikanischen Stil eingerichtet: Tücher in den
Farben rot, grün und gelb waren leger, aber mit Bedacht auf
den Sitzmöbeln drapiert, in einer sonnigen Ecke stand ein Topf
mit einem Kaktus und an den Wänden und auf Beistelltischen
waren Familienfotos in Rahmen aus unbehandeltem Holz
verteilt. Ein Kruzifix aus dem gleichen Holz hing über dem
Eingang, vermutlich eher zur Dekoration als aus religiösen
Gründen. Die mexikanischen Intarsienkacheln auf dem Boden
hatten nur wenig mit dem billigen Teppich gemein, auf dem
sich das erste Opfer Hautverbrennungen zugezogen hatte,
bevor es starb.
Die großen Fenster gingen nach Süden, und – wie finster
das Verbrechen auch war – der Tatort war von Sonnenlicht
durchflutet. An der Wand hing ein Plasmafernseher und um die
Leiche standen ein riesiges Sofa, zwei Fernsehsessel und ein
Ohrensessel Wache, die alle mit dem gleichen beigen Leder
bezogen waren.
Mitten im Raum lag der korpulente Diaz, dessen dunkle Lo-
cken von einem Wet Gel in Form gehalten wurden, nackt und
bäuchlings auf dem Boden. Die rechte Hand war ausgestreckt,
der Zeigefinger abgetrennt, während sich der andere Arm unter
dem Körper befand. Die Mordwaffe – ein Seil, dessen Länge
Warrick auf fünfzig Zentimeter schätzte – lag noch um den
Hals des Opfers. Die Schlinge war fest zugezogen.
Wieder hatte der Täter auf dem Rücken des Opfers, ober-
halb des Gesäßes, eine kleine Spermalache hinterlassen. Die
Augen des Produzenten waren hervorgequollen, und die Zunge
hing ihm aus dem Mund. Sein Gesicht sah aus, als wollte er
Warrick verspotten. Dieser Eindruck wurde auf groteske Weise

durch den schlampig aufgetragenen, knallroten Lippenstift
verstärkt.
Und erneut deutete das Fehlen von Blutspritzern darauf hin,
dass der Finger dem Opfer erst abgeschnitten worden war,
nachdem das Herz aufgehört hatte zu schlagen.
Der coole, objektive Warrick gestattete sich einen kurzen
Augenblick der Subjektivität und ein halbes angewidertes
Grinsen. Er hatte schon viele Tatorte untersucht, und die unter-
schiedlichen, oftmals bizarren Arten, wie die Opfer getötet
wurden, waren für ihn nicht annähernd so überraschend wie
das, was sie über die Lebensart des Mörders aussagten.
Diaz war zwar Hispano-Amerikaner, aber extrem hellhäutig
und hätte leicht für einen Weißen durchgehen können, obwohl
das Haus nicht ohne Stolz auf seine Herkunft verwies. Der
Original-CASt hatte weiße Opfer bevorzugt, und Sandred hatte
in dieses Schema gepasst. Ob der Täter Diaz irrtümlich für
einen Weißen gehalten hatte oder ob Diaz einfach nur »weiß
genug« für ihn gewesen war, musste sich noch zeigen.
Vielleicht handelte es sich um einen Nachahmungstäter,
dem dieser Aspekt an den Serienmorden entgangen war und
der nicht wusste, dass die meisten Serienkiller bei ein und
derselben Ethnie blieben, meist bei der eigenen.
Dies war natürlich keine unumstößliche Regel, denn solche
irren Mörder gingen nach ihren ganz eigenen Regeln vor und
schrieben sie unter Umständen sogar neu, während sie ihrer
Mordlust frönten. Dennoch wiesen die CASt-Morde, die immer
nach demselben abartigen Ritual vollzogen wurden, auf eine
Detailbesessenheit hin, die sich hoffentlich bei der Tatortanaly-
se als nützlich erweisen würde.
Die Ähnlichkeit der beiden aktuellen Morde war in der Tat
verblüffend, und Warrick zweifelte nicht daran, dass sie es in
beiden Fällen mit demselben Mörder zu tun hatten – einem
neuen oder dem alten CASt.

Aber obwohl Grissom überraschenderweise seinen Ver-
dacht, der Täter habe gerade erst angefangen, laut ausgespro-
chen hatte – was durch Diaz’ Leiche sogar bestätigt worden
war –, wusste Warrick, dass sein Chef keine Vermutungen
dulden würde, selbst in einer solchen Situation nicht. Er musste
sich an die Beweise halten und Punkt.
Warrick holte seine Kamera heraus und begann zu fotogra-
fieren. Er hatte noch nicht den ersten Film voll, als Grissom
wie aus dem Nichts neben ihm auftauchte.
»Der Rest des Hauses sieht sauber aus«, erklärte der CSI-
Leiter.
»Nichts Auffälliges?«
»Auffällig ist nur, dass die anderen Zimmer unberührt
geblieben sind – und dass es im Fall Sandred genauso war.«
»Aha.«
»Ich sehe mir das Haus noch einmal genauer an, aber meine
Vermutung ist, dass der Mörder die anderen Räume nicht
betreten hat.«
»Eine Vermutung, Gris? Was kommt als Nächstes? Eine Vi-
sion?«
»Eine dritte Leiche, wenn wir unsere Arbeit nicht besser
machen als bisher.«
»Schon verstanden.« Warrick machte noch ein Foto, dann
schüttelte er den Kopf. »Dieser Kerl ist definitiv verrückt. Ist
dir klar, was er hier stehen gelassen hat? Allein der Fernseher
ist ein paar Tausender wert.«
»Je nach pathologischer Veranlagung darf der Mörder gar
nicht stehlen. Es käme einer Entweihung seiner Tat gleich.«
»Ja, ja, ich weiß«, sagte Warrick. »Aber wenn der Typ so
einen schönen Fernseher stehen lässt, dann ist er wirklich
extrem verrückt!«
Die beiden grinsten sich an, dann ging jeder wieder seiner
Arbeit nach.

Nachdem er mit den Fotos fertig war, nahm Warrick einen
Abstrich von dem Sperma. Dann entfernte er vorsichtig das
Seil und drehte die Leiche auf die Seite. Und da entdeckte er
etwas in der linken Hand des Opfers, die zuvor unter seinem
Körper verborgen gewesen war.
»Hey, Gris!«, rief er. »Das solltest du dir mal ansehen!«
Kurz darauf war Grissom bei ihm. »Hast du das fotogra-
fiert?«
Warrick hielt den Toten die ganz Zeit in der Seitenlage, und
ihm wurde allmählich der Arm schwer. Aber er beklagte sich
nicht. »Noch nicht«, entgegnete er nur.
Grissom nahm Warricks Kamera und schoss rasch drei Bil-
der.
»Dreh ihn ruhig ganz um«, sagte er dann.
Warrick rollte den Toten auf den Rücken, nahm eine Pinzet-
te aus seinem Koffer und kniete sich neben das Opfer. Als er
sich die Chipkarte in der Hand des Toten genauer ansah, stellte
er fest, dass es sich um einen elektronischen Schlüssel handel-
te, wie man sie in fast allen Hotels in der Stadt und in vielen
Firmen fand. Er erkannte nur die Rückseite, auf der ein Mag-
netstreifen und die üblichen Standardinstruktionen zu sehen
waren.
Warrick packte die Karte vorsichtig mit der Pinzette am
Rand, um eventuelle Fingerabdrücke nicht zu verwischen.
Dann nahm er sie dem Toten behutsam aus der Hand und
drehte sie um. Fünf Worte prangten in blauen Buchstaben auf
dem weißen Plastik: EIGENTUM DES LAS VEGAS BANNER.
»Also, das ist nicht gut«, bemerkte Warrick und hielt die
Karte hoch. »Obwohl wir ja eigentlich sehr gerne Hinweise
finden.«
Grissom kniff die Augen zusammen.
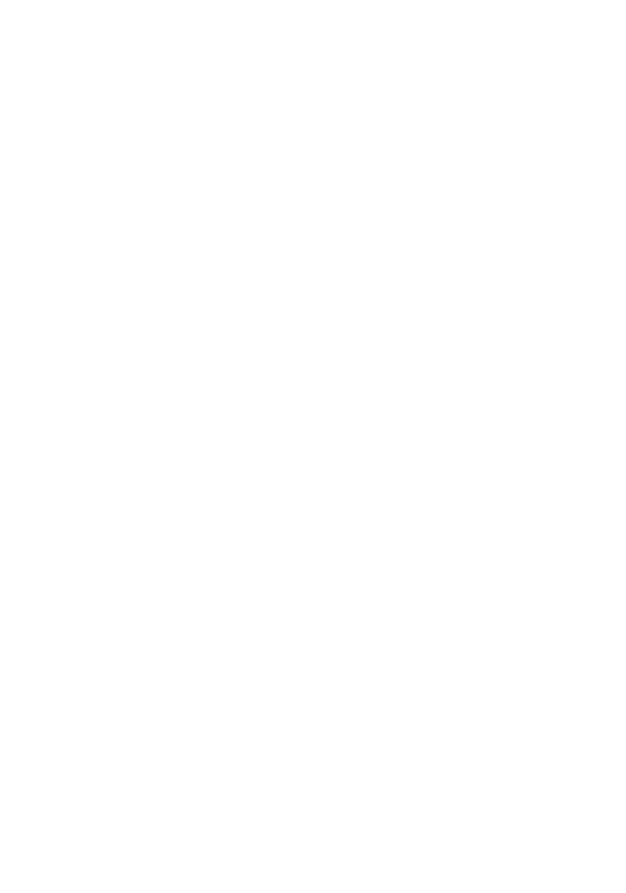
Warrick rechnete mit einem trockenen Kommentar, aber
sein Chef sagte nur: »Am besten rufen wir Brass an. Er muss
schleunigst herkommen.«
Nick Stokes war in den aquamarinblauen Fluren des CSI auf
der Suche nach Catherine. Das gedämpfte Licht war der Nacht-
schicht eigentlich nicht besonders zuträglich, denn es machte
schläfrig, aber angesichts der harten Fälle, mit denen sie häufig
befasst waren, fand Nick die beruhigende Atmosphäre eigent-
lich ganz angenehm.
Nachdem sie mit der Durchsicht der alten CASt-Akten be-
gonnen hatten, waren sie auf das Problem gestoßen, dass sie
von den zwei Verdächtigen, die nicht in der Klapsmühle wa-
ren, keine aktuellen Adressen finden konnten. Nach stunden-
langer Suche hatte Nick endlich eine ausfindig machen können,
aber nun konnte er seine Kollegin nirgends finden.
Er holte gerade sein Handy aus der Gürteltasche, als Cathe-
rine mit einem dicken Ordner unter dem Arm aus der Damen-
toilette auf den Flur trat.
Sie sah ihn und begrüßte ihn mit einem verlegenen Grinsen.
»Das stillste Örtchen im ganzen Haus. Da kann man in Ruhe
lesen.«
Nick schüttelte den Kopf. Das konnte man von der Herren-
toilette nun wirklich nicht sagen, denn es gab einen extremen
Männerüberschuss im Department.
»Hast du was gefunden?«, fragte Catherine.
»Wie wäre es mit der Adresse von Phillip Carlson?«
»Unser Schwulenverdrescher? Wo wohnt er?«
»Auf der Baltimore, nicht weit vom Stratosphere.«
»Worauf warten wir?«
»Auf die Rückkehr von Brass und Damon zum Beispiel?

Den Detectives gefällt es nicht besonders, wenn die vom
CSI sich auf eigene Faust vom Labor entfernen und draußen
rumlaufen…«
Catherine dachte nach, dann schüttelte sie den Kopf. »Gris-
som hat uns auf die alten Fälle angesetzt, und daran arbeiten
wir ja auch. Außerdem sieht Brass das nicht so eng. Glaubst
du, bei der momentanen Belastung würde er zur Aufarbeitung
des alten Krempels einen Detective von einem aktuellen Fall
abziehen?«
»Wow!«, machte Nick. »Versuchst du, mich zu überzeugen,
oder dich selbst?«
Sie lächelte und zuckte mit den Schultern. »Weiß nicht. Ich
bin auf jeden Fall schon überzeugt.«
»Ich auch.« Nick grinste.
Carlson hatte ein Apartment in einem zweistöckigen Gebäude,
das wie ein heruntergekommenes Motel aussah, um das sich
seit Jahrzehnten niemand mehr gekümmert hatte.
Nick saß hinter dem Steuer. »Was für ‘ne nette Bude der
Kerl hat!«
Er parkte den Tahoe am Straßenrand und hoffte, dass er
noch da sein würde, wenn sie zurückkamen. Dann gingen die
beiden CSI-Kollegen über die Außentreppe in den zweiten
Stock.
Irgendwo in der Nachbarschaft hatte jemand in seinem Auto
die Bässe viel zu weit aufgedreht, und obwohl Nick sich ziem-
lich gut mit den aktuellen Charts auskannte – worauf er auch
besonders stolz war –, konnte er wegen des extremen Wum-
merns nicht heraushören, um welchen Rapper es sich handelte.
Catherine klopfte an die Tür von Apartment 2 E, aber nie-
mand öffnete.
Nick legte ein Ohr an die Tür, deren rissiger, orangefarbener
Anstrich stark verwittert war. Es war nichts zu hören, und er

richtete sich wieder auf, sah Catherine achselzuckend an und
klopfte noch einmal fester.
Wieder warteten sie vergeblich.
Nick hatte gerade ein drittes Mal geklopft, als die Tür des
Nebenapartments aufflog.
»Was zum Teufel wollt ihr?«, brüllte ein rappeldürrer Mann,
der aussah wie aus den Sechzigern und ein weißes Unterhemd
und Jeans trug, die völlig ausgebleicht waren – vom jahrelan-
gen Tragen, nicht, weil es gerade Mode war. Die Hose drohte
ihm fast von den schmalen Hüften zu rutschen.
Er war ein jungenhafter Typ um die fünfzig, mit ergrauender
ungepflegter Hippiemähne, und von seinen verhangenen grü-
nen Augen konnte man auf sein benebeltes Hirn schließen.
Irgendwann im Laufe des Monats hatte er sich sicher rasiert,
aber innerhalb der letzten Woche war das ganz bestimmt nicht
gewesen.
Als Nick und Catherine auf ihn zugingen, wehte ihnen der
Geruch von Marihuana entgegen.
So breit wie lang, dachte Nick. Er zeigte seine Marke und
sagte mit einem höflichen Lächeln: »Stokes, Willows. Wir sind
vom CSI.«
Die verhangenen Augen wurden groß. »Hat hier irgendeiner
ein krummes Ding gedreht? Ich habe nichts mitgekriegt!«
Auch Catherine hatte ein höfliches Lächeln aufgesetzt.
»Würden Sie zu uns herauskommen, bitte?«
Der dürre Kerl kam auf den Gang und versuchte dann, die
Tür von Apartment 2 D ganz langsam zuzuziehen, ohne dass
die beiden es merkten.
»Wir suchen Phillip Carlson«, erklärte Catherine.
Der Mann straffte die Schultern. »Stets zu Ihren Diensten!
Wie kann ich der Polizei helfen?«
»Indem Sie ein paar Fragen beantworten«, entgegnete Ca-
therine.

Carlson sah sie an und musterte sie halb amüsiert, halb irri-
tiert, als könnte er nicht begreifen, warum eine so gut ausse-
hende Frau bei den Cops war. »Ich habe nichts zu verbergen,
Süße. Fragen Sie nur!«
»Ich heiße Willows. Können wir irgendwo ungestört re-
den?«
Carlson warf einen beklommenen Blick auf die Apartment-
tür hinter sich. »Das können wir.«
Er blieb jedoch unschlüssig stehen, und Nick wies mit dem
Kopf auf die Tür von 2D. »Da drin?«, fragte er.
Carlson schüttelte so heftig den Kopf, als wollte er sich von
Spinnweben befreien. »Da wohne ich nicht, Mann.«
Nick sah ihn mit einem freundlichen Lächeln an, das nicht
wirklich freundlich war. »Wer denn?«
»Meine Freundin. Sie ist… äh… unpässlich.«
Das konnte sich Nick sehr gut vorstellen.
Carlson zeigte auf die Tür von 2E. »Sie waren schon an der
richtigen Tür. Gehen wir in meine Bude.«
Nick und Catherine traten einen Schritt zurück, um Carlson
vorbeizulassen. Nick sah seine Kollegin amüsiert an und zog
eine Augenbraue hoch, aber sie erwiderte den Blick mit einer
gewissen Skepsis.
»Sorry«, sagte Carlson, als er seine Tür aufschloss. »Das
Dienstmädchen hat heute frei.«
Er betrat das dunkle Apartment, und Catherine und Nick
folgten ihm.
Die Vorhänge waren zugezogen, und bis auf den Lichtstrahl,
der durch die offene Tür in die Wohnung fiel, blieb alles düs-
ter. Carlson schaltete die Deckenlampe ein, die offenbar auch
als Sammelbehälter für totes Ungeziefer diente, und das winzi-
ge Wohnzimmer wurde in ein schmutziggraues Licht getaucht.
Nick sah sich in dem unglaublichen Chaos um und vermute-
te, dass in dieser Bude nicht mehr sauber gemacht worden war,

seit das Rat Pack den Strip regierte. Er hatte schon häufiger
Wohnungen von Zwangsneurotikern und Messis besucht, aber
was er hier sah, weckte in ihm das spontane Bedürfnis, sich
sofort die Latexhandschuhe überzustreifen.
Die einzigen Möbelstücke waren ein verlottertes Sofa, zwei
Fernsehtische und ein Fernseher. Die Wände waren kahl, aber
ansonsten sah es in dem Apartment aus wie nach einer Explo-
sion auf der Mülldeponie. Nicht nur die beiden Tische und der
Fernseher waren mit Imbisstüten und Plastikbechern übersät,
sondern auch der gesamte Boden. In einer Nische hinter dem
Wohnzimmer, die früher einmal als Esszimmer gedient hatte,
sah Nick einen Esstisch mit einem Berg von Fastfood-Abfällen
und zwei Stühle. Links ging ein kurzer Flur ab, der vermutlich
zum Schlafzimmer führte. Das Erstaunlichste in dem ganzen
Chaos waren die hüfthohen Zeitungsstapel, die an den Wänden
aufgereiht waren und die Wohnung noch kleiner machten, als
sie ohnehin schon war.
Gott möge verhindern, dass wir hier jemals nach Beweis-
spuren suchen müssen!, dachte Nick.
»Setzen Sie sich irgendwo«, sagte Carlson und ließ sich auf
das zugemüllte Sofa fallen.
Nick und Catherine wollten lieber stehen bleiben – sie hät-
ten sowieso nicht gewusst, wo sie Platz nehmen sollten.
In der Wohnung roch es nach Urin, Dope und Kotze, und
Nick tränten von dem beißenden Gestank fast die Augen.
Fundorte von verwesten Leichen machten ihm da weniger
zu schaffen. Er nahm sich jedoch zusammen. »Mr. Carlson,
kennen Sie einen Mann namens Marvin Sandred?«
Carlson kniff die Augen zusammen, während er im Geist
sein Adressbuch durchzublättern schien. »Nein, den kenne ich
nicht«, sagte er nach einer Weile mit ausdrucksloser Miene.
»Ist das alles? Das war ja einfach!«
»Und Enrique Diaz?«, fragte Catherine weiter.

Plötzlich blitzte etwas in Carlsons Augen auf. Er schien
wach zu werden. »Hören Sie… mit der Polizei zu kooperieren,
das war 1999 mein Vorsatz für das neue Jahr. Ich versuche also
wirklich zu helfen.«
»Das wissen wir zu schätzen«, entgegnete Nick.
»Aber bevor wir weiterreden, fände ich es fair, wenn Sie mir
erklären, um was es überhaupt geht.«
»Um einen aktuellen Fall«, sagte Nick nur. »Es ist keine
Fangfrage, Mr. Carlson – kennen Sie jemanden namens Enri-
que Diaz oder nicht?«
»Das kommt mir irgendwie spanisch vor.« Carlson grinste
in sich hinein und genoss seinen Scherz vermutlich ebenso
sehr, wie er zuvor den Inhalt der ringsum verstreuten Imbisstü-
ten genossen hatte. »Und was ist das für ein Fall?«
»Es geht um Mord«, sagte Catherine.
»Wow!« Carlson hob die Hände und schüttelte den Kopf.
»Ich habe niemanden umgebracht.«
»Da haben Sie der Polizei aber im Laufe der Jahre was ganz
anderes erzählt«, erwiderte Nick. »Sie haben einundzwanzig
Morde gestanden.«
»Hey, ich hatte ‘ne Macke als ich jung war, aber ich war in
Behandlung. Ich nehme Medikamente.«
Catherine lächelte ihn fröhlich an. »Medikamente, wie wir
sie nebenan gerochen haben?«
Carlson schlug die Hände vors Gesicht und ließ sie langsam
die Wangen hinunterrutschen. »Ich bin clean, ehrlich! Das
waren Räucherstäbchen, kein Gras.«
Die erweiterten Pupillen des Mannes erzählten jedoch eine
andere Geschichte.
»Ich vermute mal«, sagte Nick, »Sie waren das letzte Mal
clean, als die Beatles noch zusammen waren.«
Carlson sprang unvermittelt mit wildem Blick vom Sofa auf
und ging mit ausgefahrenen Krallen auf die beiden los.

Nick und Catherine wichen überrascht zurück, aber Nick
fasste sich augenblicklich und versetzte ihm einen unsanften
Stoß.
»Setzen Sie sich, Sie Charlie Manson«, sagte er, »und beru-
higen Sie sich!«
Carlson ließ die Hände fallen und sank in sich zusammen.
Seine Augenlider gingen auf halbmast. Er sah aus wie eine
Marionette, die nur noch an ein, zwei Fäden hängt. »Sie dür-
fen… nicht so mit mir reden, Mann. Das verletzt meine Gefüh-
le.«
»Dafür entschuldige ich mich aufrichtig. Und jetzt setzen
Sie sich wieder!«
Carlson schluckte und tat, wie ihm geheißen. Er stützte die
Ellbogen auf die Knie und legte den Kopf in seine Hände.
»Ich… wollte Ihnen gerade sagen, dass ich nicht mehr so bin
wie früher. Es… macht mich einfach sauer, wenn Leute…
schlecht von mir denken. Ich habe mich mit viel Mühe wieder
auf Vordermann gebracht!«
»Nun, wenn Sie nicht mehr so sind wie früher, haben Sie
bestimmt nichts dagegen, wenn wir uns hier umsehen.«
Mit einem verstohlenen Blick in den Flur fragte Carlson:
»Aber ich habe meine Rechte, nicht wahr? Oder ist das wieder
so ein Patriot-Act-Schwachsinn?«
»Ich bleibe bei ihm, Cath«, sagte Nick, »wenn du den
Durchsuchungsbefehl besorgst.«
Carlson hob erschrocken die Hände. »Hey… hören Sie… Es
ist nicht so, wie es aussieht.«
Catherine runzelte die Stirn. »Was ist nicht so, wie es aus-
sieht?«
»Nichts…« Wieder schaute Carlson in den Flur, dann grins-
te er die Spurenermittler nervös an. »Ich leide einfach an ex-
tremer Geschwätzigkeit, das ist alles. Dagegen gibt es kein
Mittel.«

Nick sah Catherine fragend an, und sie nickte.
Während sie mit Carlson im Wohnzimmer blieb, ging Nick
mit der Pistole in der rechten und der Mini-Maglite in der
linken Hand in den dunklen Flur und leuchtete ihn aus.
Es gab drei Türen.
Die beiden, die sich links und rechts von ihm befanden,
standen offen, nur die zweite auf der linken Seite war geschlos-
sen.
Nick warf rasch einen Blick in die beiden vorderen Räume:
Badezimmer links, Schlafzimmer rechts, beide schmutzig,
beide leer. Der hintere Raum war jedoch abgeschlossen.
»Haben Sie vielleicht einen Schlüssel für uns, Mr. Carl-
son?«, rief er ins Wohnzimmer. »Ich würde die Tür nur ungern
eintreten.«
Sekunden später hallte Catherines Stimme von den kahlen
Wänden wider. »Er hat den Schlüssel. Und er rückt ihn raus!«
Nick holte ihn sich ab und sah Carlson ärgerlich an. »Wa-
rum haben Sie ihn mir nicht gleich gegeben? Sie kriegen keine
Pluspunkte, wenn Sie es uns schwer machen.«
Carlson ließ den Kopf hängen und gab keine Antwort.
Weil er nicht wusste, was ihn erwartete, zog Nick seine Pis-
tole, während er den Schlüssel mit der anderen Hand, in der er
auch seine Taschenlampe hielt, ins Schloss steckte. Er machte
die Tür auf und betrat mit der Pistole im Anschlag das dunkle
Zimmer.
Vor dem Fenster zu seiner Linken hing ein dicker Vorhang,
und Nick leuchtete rasch den Raum mit der Taschenlampe aus.
Aber bis auf den Lichtstrahl bewegte sich nichts.
Nick betätigte den Schalter an der Wand, und die Decken-
lampe ging an – besser gesagt, der nächste Ungeziefer-
Sammelbehälter. Nick ließ die Pistole sinken und sah sich
verblüfft in dem Zimmer um.
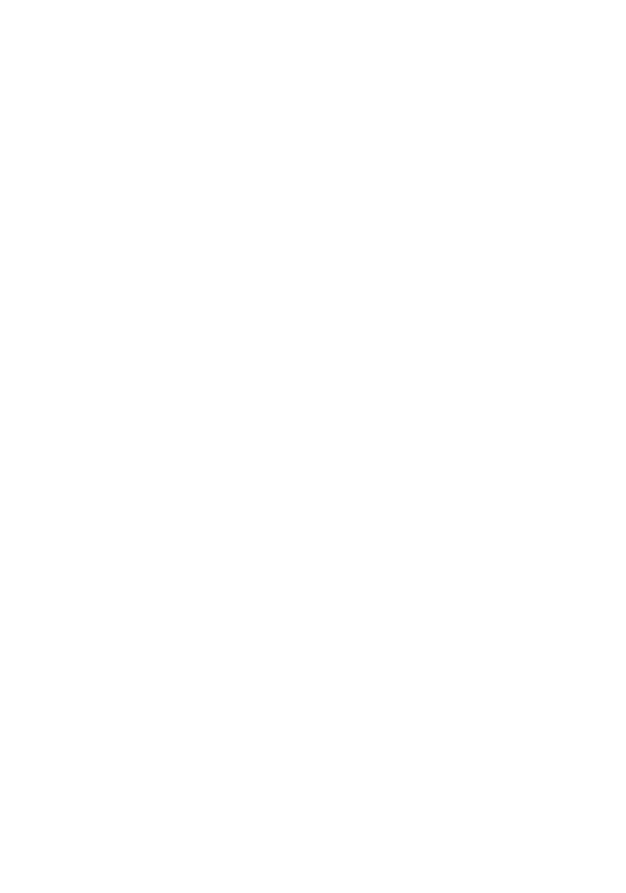
Die Wände und sogar die Decke waren mit Artikeln aus Zei-
tungen und Magazinen, Fotos und Zeichnungen gepflastert, die
alle dasselbe Thema hatten. Es sah aus wie in einem Mädchen-
zimmer, das komplett einem Popstar geweiht war. In diesem
Raum gab es allerdings kein Bett, und hier wurde auch kein
Sänger oder Schauspieler angebetet.
Es war eine Kapelle für CASt.
Ein kleiner, dunkler Holztisch in der Mitte diente als Altar
für das heilige Buch – Der Fall CASt von Perry Bell und David
Paquette. Auch ein paar Alben lagen auf dem Tisch. Von der
Decke baumelten Schlingen an unterschiedlich langen Seilen.
Als Nick das Zimmer verließ, erwartete Catherine ihn be-
reits im Flur. Nicks weit aufgerissene Augen sprachen Bände.
Carlson saß auf dem Sofa und machte ein Gesicht wie ein
Dreizehnjähriger, dessen Eltern gerade seine Pornosammlung
gefunden hatten.
»Also, Mr. Carlson«, sagte Nick fröhlich. »Haben Sie sich
mit viel Mühe wieder auf Vordermann gebracht, bevor oder
nachdem Sie das Serienmörder-Museum eröffnet haben?«
Carlson sprang auf und rannte zur Tür.
Catherine drehte sich ruckartig um, und Nick setzte ihm
nach, aber zu spät: Carlson war bereits aus der Wohnung.
Nick übernahm die Führung, als sie ihm über den Gang hin-
terherflitzten. Der magere Kerl lief die Treppe hinunter und
nahm immer zwei Stufen auf einmal, aber bis er unten ange-
kommen war, hatte Nick schon aufgeholt. Carlson hätte ver-
mutlich gern einen Zahn zugelegt, aber das konnte er nicht: Er
hatte die Kondition eines Gewohnheitskiffers, und Nick kam
ihm mit jedem Schritt näher.
Carlson hatte es gerade auf den Parkplatz geschafft, da be-
kam Nick ihn zu fassen und riss ihn zu Boden. Die beiden
rollten jetzt vom Gehsteig auf die Baltimore Avenue, und
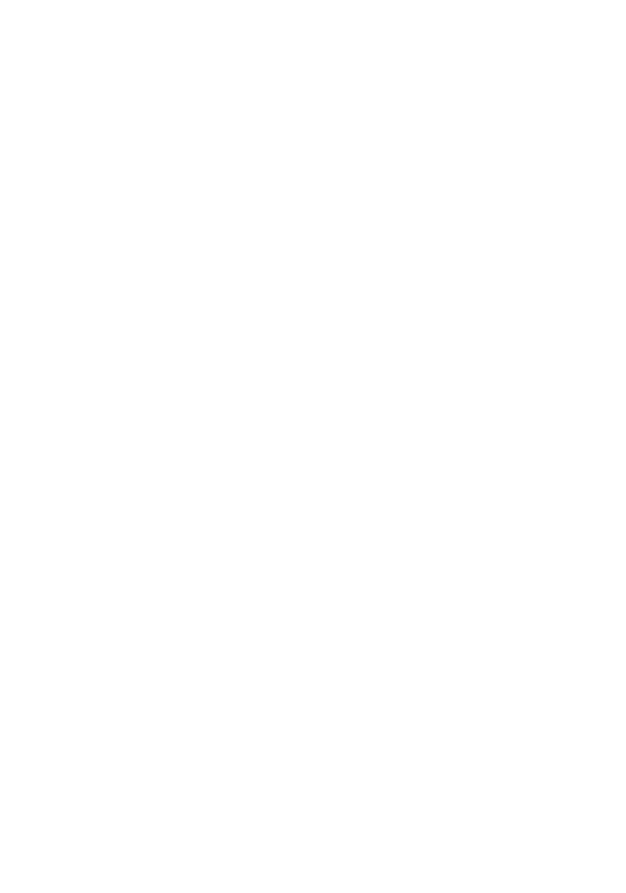
obwohl Nick sich die Haut an Händen und Ellbogen aufschürf-
te, hielt er den Flüchtigen fest umklammert.
Catherine war auf die Straße gesprungen, um die Autos an-
zuhalten, aber die beiden waren inzwischen auf der anderen
Seite in der Gosse gelandet – wo zumindest der Verdächtige
bestens aufgehoben war.
»Au, Mann!«, stöhnte Carlson, der fast von Nicks Gewicht
erdrückt wurde. Aus den Schürfwunden in seinem Gesicht
tropfte Blut. »Uncool! Extrem uncool!«
»Sich der Verhaftung zu widersetzen ist auch nicht so toll,
Kumpel«, entgegnete Nick.
»Ich bin doch gar nicht… oder etwa…?«
»Oh, ja!«
In diesem Moment hörte Nick Sirenengeheul, und erst jetzt
merkte er, dass seine Partnerin ihr Handy am Ohr hatte. Sie
hatte bereits Verstärkung gerufen, und ein Streifenwagen war
zum Glück irgendwo in der Nähe gewesen.
Kurz darauf erschienen die Beamten und verfrachteten den
ziemlich niedergeschlagenen Carlson in ihren Wagen.
»Das habe ich nun vom Beten«, bemerkte Nick missmutig,
als der Wagen davonfuhr.
Catherine sah ihn amüsiert an. »Wie bitte?«
»Ich habe den lieben Gott gebeten zu verhindern, dass wir
dieses Apartment jemals untersuchen müssen. Aber während
Carlson den Nachmittag über sein Mütchen in einer klimati-
sierten Zelle kühlt, werden wir diese furchtbare Bude wohl
Zentimeter für Zentimeter durchsuchen müssen.«
»Vielleicht hat Gott ja doch Humor«, bemerkte Catherine
mit einem leisen Lachen.
Sie gingen zurück zum Haus.
»Oh ja, natürlich hat Gott Humor«, entgegnete Nick. »Er hat
nur leider den gleichen wie Grissom.«

Sie kehrten in das Apartment zurück, um den CASt geweih-
ten Raum zu fotografieren und zu untersuchen. Und dabei
versuchten sie herauszufinden, ob Carlson sich selbst einen
Tempel errichtet hatte.
Sara Sidle klopfte an den Rahmen von Gil Grissoms offener
Bürotür.
Der CSI-Leiter saß, die Brille auf der Nase, an seinem
Schreibtisch und las in einer Akte. »Hey!«, sagte er, als er
aufsah.
»Hey«, entgegnete Sara.
Sie kam herein, legte die Beweismitteltüte mit der Schlüs-
selkarte vom Las Vegas Banner auf seinen Tisch und setzte
sich ihm gegenüber auf den Stuhl.
»Abdrücke?«, fragte er.
»Ein paar unvollständige, aber nichts, was AFIS wiederer-
kennt.«
Das Automatische Fingerabdruck-Identifikationssystem war
ein sehr nützliches Hilfsmittel, aber in der Datenbank waren
natürlich nur Fingerabdrücke von Verbrechern gespeichert, die
schon einmal geschnappt worden waren.
»Es ist also nicht so einfach«, sagte Grissom. »Überrascht
uns das etwa?«
Sara schüttelte den Kopf. »Was jetzt?«
»Ich rufe Brass an. Vielleicht können wir den Schlüssel mit
Hilfe der Zeitungsleute identifizieren.«
»Glaubst du wirklich, die Chefs vom Banner lassen uns alle
Mitarbeiter kontrollieren, die einen Schlüssel haben?«
Grissom dachte nach. »Wahrscheinlich nicht, wie ich die
Medien kenne. Ich vermute, sie tun gar nichts, bevor sie nicht
mit ihren Anwälten gesprochen haben.«
»Und die Anwälte sagen?«

»Dass hier der vierte Verfassungszusatz greift«, entgegnete
Grissom. »Obwohl es gar nicht um willkürliche Durchsuchung
und Überwachung geht.«
»Lass uns alle Anwälte töten!«
»Dieses Zitat wird übrigens immer aus dem Zusammenhang
gerissen«, bemerkte Grissom. »Shakespeare wollte in Heinrich
VI in Wirklichkeit sagen, dass Anwälte wertvolle…«
»Schon gut! Aber die Anwälte des Banner werden nicht ko-
operieren.«
»Nein.«
»Aber wir werden es trotzdem versuchen.«
»Ja.«
Eine Stunde später saß sie mit Grissom und Brass im Büro von
James Holowell, dem Herausgeber des Banner. Und dort hörte
Sara den gleichen Spruch vom vierten Verfassungszusatz noch
einmal von Holowell – nur ohne die Grissom’sche Ergänzung
durch Shakespeare.
In der Nachrichtenredaktion hinter der großen Scheibe
herrschte hektische Betriebsamkeit. Holowells Büro war spar-
sam möbliert. Der riesige Mahagonischreibtisch, auf dem außer
einem Computermonitor nicht viel stand, beanspruchte den
meisten Platz. Die Beweismitteltüte mit der Schlüsselkarte
prangte auf der Schreibunterlage wie ein dreidimensionaler
Tintenklecks.
Grissom, Brass und Sara saßen auf drei Stühlen vor dem
Schreibtisch dem breitschultrigen Holowell gegenüber, einem
Schwarzen mit kahlem Kopf und einer Brille mit Schildpattge-
stell. Er trug ein graues Hemd, die Ärmel einmal umgeschla-
gen, und eine Krawatte mit blau-silbernem Frank-Lloyd-
Wright-Muster.
Bislang war er freundlich, professionell, aber nicht sehr
hilfsbereit gewesen.

»Wie viele Mitarbeiter haben so einen?«, fragte Brass und
zeigte auf die Tüte mit dem Schlüssel.
Holowell zuckte mit den Schultern. »Das weiß ich nicht.«
»Wer weiß es denn?«, fragte Grissom.
»Das weiß ich auch nicht.«
»Könnten Sie es herausfinden?«
»Das könnte ich vermutlich.«
»Und tun Sie es auch?«, fragte Brass.
»Nicht auf der Stelle, aber natürlich kümmere ich mich dar-
um. Ich habe die feste Absicht, Ihnen zu helfen, so weit es mir
meine Verpflichtungen dieser Zeitung gegenüber erlauben.«
Mit anderen Worten: nein, dachte Sara.
Grissom hatte Holowells Gesicht genau studiert. »Wie viele
von diesen Schlüsseln gibt es denn ungefähr?«, fragte er nun.
»Vielleicht zwanzig«, antwortete der Herausgeber. »Oder
dreißig.«
Das kam Sara ziemlich wenig vor. Aber dennoch, wenn Ho-
lowell Recht hatte, waren mindestens zehn Prozent der Mitar-
beiter des Banner – der drittgrößten Tageszeitung der Stadt mit
ein paar hundert Mitarbeitern – potenzielle Verdächtige.
»Nur zwanzig bis dreißig?«, fragte Brass. »Was meinen Sie,
wer bekommt denn alles so einen Schlüssel?«
»Ich habe natürlich einen, und alle Redakteure und Repor-
ter«, sagte Holowell achselzuckend. »Und ein paar leitende
Angestellte in der Druckerei.«
Die Drei bedankten sich bei Holowell und standen auf. Die
Hände hatten sie sich schon bei der Begrüßung geschüttelt, und
niemand legte Wert darauf, das Ritual noch einmal zu wieder-
holen.
Grissom nahm die Beweismitteltüte vom Schreibtisch und
steckte sie ein, dann ging er mit Sara und dem Captain in das
Großraumbüro. Die hektische Betriebsamkeit, die dort herrsch-

te, vermittelte ihnen auf eigentümliche Weise das Gefühl,
unbeobachtet und ungestört zu sein.
Sara sah Grissom und Brass an. »Wie wäre es mit: ›Tötet
alle Zeitungsfritzen!‹?«
»Dazu hat Shakespeare nichts gesagt«, entgegnete Grissom.
»Stehen wir denn nach diesem Gespräch besser da als vor-
her?«, fragte Sara den Captain.
»Das wüsste ich auch gern«, entgegnete Brass.
»Natürlich tun wir das«, sagte Grissom. »Zwei Schritte vor
und einen zurück – das ist immerhin ein Schritt vorwärts. Als
wir kamen, hatten wir an die zweihundert potenzielle Schlüs-
selinhaber. Wenn wir den Herausgeber beim Wort nehmen
können, haben wir jetzt nur noch dreißig oder weniger. Und
vielleicht bekommen wir sogar eine Liste mit Namen.«
Sara verzog das Gesicht. »Aber vielleicht wurde die Karte
jemandem gestohlen…«
Grissom nickte. »Wenn wir feststellen können, wem sie ge-
stohlen wurde, dann haben wir einen Punkt, an dem wir anset-
zen können.«
»Okay«, sagte Sara.
»Und«, schaltete Brass sich ein, »wir wissen jetzt – wenn
wir Holowell beim Wort nehmen können, wie Sie sagten –,
dass ungefähr fünfundachtzig bis neunzig Prozent der Mitar-
beiter keinen Schlüssel haben.«
Grissom lächelte. »Genau, Jim… Information ist unsere
Währung, das weißt du, Sara. Das Guthaben wächst ganz
allmählich, Stück für Stück. Aber es wächst.«
»Klingt ganz nach meinem Sparkonto«, brummelte Brass
missmutig.
Das Trio steuerte gerade auf den Ausgang zu, als David Pa-
quette plötzlich aus seinem Büro kam. Er trug ein blaues Hemd
mit umgeschlagenen Ärmeln und eine blau-gold gestreifte

Krawatte. Das Neonlicht spiegelte sich auf seiner Glatze, und
er wirkte gestresster und derangierter als sein Chef.
»Was führt die Polizei ins feindliche Lager?«, fragte er
scherzhaft.
»Wir hatten ein Gespräch mit Mr. Holowell«, entgegnete
Grissom.
Paquette winkte sie in sein Büro, das im Vergleich zu dem
des Herausgebers winzig wirkte, kaum größer als eine Zelle.
Sein Schreibtisch war eine klobige Metallkonstruktion mit
einem wesentlich kleineren Monitor darauf und stapelweise
Papier.
Nachdem er die Tür geschlossen hatte, setzte Paquette sich
nicht an seinen Schreibtisch und bot auch seinen Gästen keinen
Sitzplatz an.
»Weshalb waren Sie bei James?«, fragte er ohne Umschwei-
fe. Er klang misstrauisch; als witterte er Verrat.
ä»Was glauben Sie denn?«, fragte Brass. »Der übliche Poli-
zeikram natürlich.«
Paquette schnaubte. »Wollen Sie mich für dumm verkaufen?
Ich weiß, dass noch ein Mord passiert ist!« Vorwurfsvoll zeigte
er der Reihe nach auf seine drei Gesprächspartner. »Und habe
ich schon einen Piep von Ihnen darüber gehört? Nein – Sie
reden nicht mit mir oder Bell oder Brower darüber. Wir hatten
doch eine Abmachung, oder etwa nicht?«
Grissom zog leicht die Augenbrauen hoch – seine Version
des Stirnrunzelns. »Wieso glauben Sie, dass es einen weiteren
CASt-Mord gab?«
Paquette lachte spöttisch. »Ich glaube es nicht, ich weiß es!
Können Sie sich vor lauter Selbstgefälligkeit und Blindheit
nicht vorstellen, dass ich noch andere Quellen im Department
habe?«
Grissom sagte etwas, das Paquette wahrscheinlich unlogisch
vorkam: »David, haben Sie Ihren Schlüssel bei sich?«

»Was?«
»Ihren Büroschlüssel!«
Paquette steckte die Hand in die Hosentasche, kramte kurz
herum und brachte tatsächlich seine Karte zum Vorschein.
»Wozu brauchen Sie die?«, fragte er.
Grissom holte die Beweismitteltüte aus seiner Tasche,
verbarg aber den Inhalt in seiner Hand. »Wenn ich Ihnen dieses
Beweisstück zeigen soll, brauche ich eine Bestätigung.«
»Was denn für eine Bestätigung?«
»Dass unsere Abmachung immer noch gilt: Sie lassen nichts
verlauten, bevor wir grünes Licht geben.«
»Nachdem Sie mich derart übergangen haben? Was ist das
für ein…«
»Hören Sie mir zu«, fiel Grissom ihm ins Wort. »Das hier
ist etwas, von dem nur mein Labor weiß – das erfährt niemand
sonst von den Medien. Und für Ihre Zeitung ist es von beson-
derem Belang.«
Paquettes journalistische Neugier gewann die Oberhand.
»Ich höre«, sagte er.
Grissom wusste, er hatte den Redakteur, aber er hakte noch
einmal nach: »Und unsere Abmachung ist nach wie vor gültig,
ja?«
»Ja doch!«, entgegnete Paquette.
Grissom entrollte den Beutel wie eine Flagge vor der Nase
des Redakteurs, so dass er die Karte mit dem Banner-
Schriftzug sehen konnte.
»Es gab tatsächlich noch einen Mord, wie Sie sagten«, er-
klärte Grissom. »Aber was weder Sie noch andere Medienver-
treter wissen, ist, dass das Opfer diese Schlüsselkarte in der
Hand hielt.«
Paquette fielen fast die Augen aus dem Kopf. »Wem gehört
sie?«
»Das wissen wir nicht«, entgegnete Brass.

»Darüber haben Sie also mit meinem Boss gesprochen?«
»Wir dürfen unsere Quellen nicht preisgeben«, sagte Gris-
som.
»Sie können mich mal, Grissom! Das… das heißt doch wohl
nicht, dass jemand vom Banner für die Morde verantwortlich
ist…« Aus Paquettes Stimme waren Wut, aber auch Frustration
herauszuhören. »Die Karte kann doch gestohlen und am Tatort
platziert worden sein.«
»Was Sie nicht sagen!«, bemerkte Brass. »Wo wären wir
ohne einen Kriminalexperten wie Sie, der für uns die Theorien
aufstellt.«
»Sie können mich auch mal, Brass!«
Der Captain machte einen Schritt auf den Redakteur zu.
»Sie und Ihr Kumpel Perry waren abgesehen von den Insidern
des Departments und den gottverdammten Opfern dichter an
dem CASt-Fall dran als jeder andere! Glauben Sie, es ist Zu-
fall, dass diese Karte in der kalten Hand des Opfers steckte?«
Paquette wollte etwas sagen, überlegte es sich jedoch an-
ders.
»Wo ist Perry?«, fragte Brass.
Paquettes Blick ruhte auf der Beweismitteltüte, und er fragte
sich vermutlich, ob sein Mitarbeiter zum Mörder geworden
war. »Er ist… für ein paar Tage verreist. Er wollte Patty besu-
chen, bevor die Uni wieder anfängt.«
»Patty?«, fragte Grissom.
Brass und Paquette antworteten gleichzeitig. »Seine Toch-
ter!«
»Sie ist im zweiten Studienjahr an der Universität von Los
Angeles«, fügte Paquette hinzu. »Die Semesterferien sind bald
zu Ende, und, hey, er ist ihr Vater – er wollte noch ein bisschen
Zeit mit ihr verbringen, bevor sie wieder büffeln muss.«
»Wann haben Sie Perry das letzte Mal gesehen?«, fragte
Brass.

»Vorgestern«, antwortete der Redakteur.
Vor dem Mord an Diaz, dachte Sara. Möglicherweise war
der Pool der Verdächtigen gar nicht so groß – vielleicht hatte er
eher die Größe einer Badewanne…
»Wie können wir Mr. Bell erreichen?«, fragte Grissom.
»Über Handy vermutlich«, sagte der Redakteur.
»Die Nummer habe ich«, bemerkte Brass.
»Hören Sie, so etwas würde er nicht tun«, erklärte Paquette.
»Das entspricht seinem Wesen in keinster Weise.«
Brass grinste spöttisch und schüttelte den Kopf. »Sie und
ich, wir wissen beide, dass Perry Bell nur hier arbeitet, weil Sie
wegen des Erfolgs, den Ihnen das Buch beschert hat, ein
schlechtes Gewissen haben. Sie sind vorwärts gekommen, aber
der gute Perry steckt in einer Sackgasse. Er ist immer noch
Reporter und klammert sich an den Ruhm, der ihm noch von
dem Buch geblieben ist… das ganz zufällig von dem CASt-
Serienmörder handelt.«
Die Schmährede des Captains schien den Redakteur eher in
Verlegenheit zu bringen als einzuschüchtern.
Er schwieg eine Weile. »Mal angenommen, Perry hätte den
Job tatsächlich meinetwegen behalten«, sagte er dann, »warum
in Gottes Namen sollte er deshalb zum Killer werden?«
»Vielleicht stimmt es ja nicht«, entgegnete Brass. »Aber der
junge Brower macht nun den Großteil der Arbeit, und er sitzt
Perry praktisch im Nacken. Wenn man lange genug denselben
Job macht, fühlt man sich wie ein Dinosaurier. Wie könnte er
seiner Karriere besser neuen Schwung verleihen als durch die
Fortsetzung der CASt-Serienmorde, die ihm sein Viertelstünd-
chen Ruhm beschert haben?«
Der Redakteur hielt dagegen. »Perry soll ein kaltblütiger
Nachahmer sein? Zum Teufel, Jim, dann wäre er ja noch irrer
als der Original-CASt! Hören Sie, ich kenne Perry, und er hat
ein Herz aus Gold. Sie kennen ihn doch nun auch schon viele

Jahre, in denen Sie mit ihm kooperiert haben und er mit Ihnen.
Ein guter, anständiger Junge. Ich sage Ihnen, er war es nicht!«
»Gut«, sagte Brass. »Und wo war er, als Sandred ermordet
wurde?«
»Woher soll ich das wissen?«, entgegnete Paquette achsel-
zuckend.
»Sie sind sein direkter Vorgesetzter.«
»Er war nicht im Büro.«
»Der zweite Mord geschah gestern Morgen. Wissen Sie, wo
er da war?«
»Ich sagte es doch schon! Er besucht seine Tochter. Wie ein
anständiger Familienvater das eben tut. Das können Sie und
Grissom sich natürlich nicht vorstellen! Und jetzt habe ich zu
tun.«
Mit einer energischen Geste scheuchte er sie aus seinem Bü-
ro.
Die Tür fiel hinter ihnen ins Schloss, und die beiden Spu-
renermittler und der Captain vom Morddezernat standen wie-
der in der hektischen Nachrichtenredaktion.
»Was denkst du, Gil?«, fragte Sara.
»Ich denke«, meinte Grissom, »wir haben auch jede Menge
zu tun.«

5
Auch nach ein paar Stunden Schlaf, einer Dusche und einem
Garderobenwechsel hatte sich Grissoms Laune nicht gebessert.
Sheriff Atwater machte ihm Druck – auf eine herablassende,
pseudofreundliche Art, die Grissoms Augen glasig werden ließ.
Der Sheriff drängte darauf, dass der Mörder gefasst werden
müsse, bevor sich Panik in der Stadt ausbreite und am Ende
noch die Touristen durch die Berichterstattung in den Medien
abgeschreckt würden.
Atwater hatte wirklich interessante Vorstellungen: Er ver-
langte von Grissom, »seinen Hintern zu bewegen« und etwas
zu unternehmen – aber gleichzeitig schien er zu denken, der
CSI-Leiter habe nichts Besseres zu tun, als an seinem Schreib-
tisch zu sitzen und sich am Telefon eine Gardinenpredigt anzu-
hören, die er sowieso schon auswendig konnte.
Grissom legte auf und starrte das Telefon an, als wäre das
arme Gerät schuld an Atwaters Tirade und daran, dass der
Sheriff anscheinend alle seine Schnellwahltasten mit nur einer
Nummer belegt hatte – mit der von Grissom.
Die Fernsehsender kramten bereits Videomaterial von den
alten CASt-Fällen aus den Archiven, und der CSI-Leiter wuss-
te, dass sämtliche Zeitungen in der Morgenausgabe darüber
berichten würden. Auch der Fall Enrique Diaz war kein Ge-
heimnis mehr, und Grissom fragte sich, ob irgendjemand den
Inhalt der beiden kurzen Gespräche beim Banner hatte durchsi-
ckern lassen.

Grissom verabscheute die Medien – nicht das Konzept an
sich, grundsätzlich hielt er Pressefreiheit für richtig und sinn-
voll. Ihn nervten vielmehr die lästigen Auswirkungen auf seine
Arbeit. Ebenso sehr hasste er die Politik – nicht die Regierung
oder irgendeine spezielle Partei, sondern die eigennützige
Heuchelei derjenigen, die – wie die Medien – vorgaben, sich
für seine Arbeit zu interessieren und ihm zuarbeiten zu wollen,
während sie ihn im Grunde nur behinderten.
Brass kam herein und warf drei Tageszeitungen auf Gris-
soms Schreibtisch. »Extrablatt! Extrablatt!«, rief er spöttisch.
Die Sun und die Journal-Review titelten beide mit CASt und
berichteten auf der ersten Seite über die neuen Morde, im
Innenteil auch ausführlicher über die alten Fälle. Dem Banner
musste man hoch anrechnen, dass er lediglich über die aktuel-
len Morde berichtete und CASt offenbar nur der Form halber
erwähnte, damit es nicht so aussah, als hätte die Redaktion
keine Ahnung. Die Schlagzeile lautete jedoch: »ROMANOV
VERKAUFT – DER MILLIARDENDEAL!« Das Bisschen,
was über die aktuellen Mordfälle geschrieben wurde, nahm
Grissom dem Blatt nicht übel. Schließlich hatte es seinen Le-
sern (und seinen Aktionären) gegenüber eine Verpflichtung.
»Anscheinend hält sich der Banner doch an unsere Abma-
chung«, sagte er.
»Ja, aber was nützt uns das«, entgegnete Brass, »wenn die
anderen alle mit CASt titeln… Den Fernseher schalten Sie
besser gar nicht erst ein. Und Dave Paquette ruft mich ungefähr
alle halbe Stunde an, seit wir gestern bei ihm waren.«
»Warum?«
»Oh, keine Ahnung – wahrscheinlich, weil er nachhören
will, ob wir etwas für ihn haben, womit er seinen Posten retten
kann.«
»Um ihm etwas sagen zu können, müssen wir erst mal etwas
finden«, entgegnete Grissom.

Brass ließ sich auf den Besucherstuhl fallen. »Apropos fin-
den – Bell habe ich noch nicht erwischt. Aber ich versuche
gerade herauszubekommen, wo seine Tochter wohnt. Und
irgendwie werde ich sie heute noch aufspüren, egal wie. Mal
sehen, ob ich über sie an Perry rankomme.«
»Guter Plan. Und machen Sie es sich nicht zu bequem auf
diesem Stuhl…«
»Gil, ich habe noch nie auf einem härteren Stuhl gesessen.
Es ist fast, als wollten Sie keinen Besuch!«
Grissom grinste. »Dann erheben Sie sich! Gehen wir nach-
sehen, wie es bei den anderen läuft.«
Brass stand auf und zuckte dabei zusammen, als täten ihm
sämtliche Knochen und Muskelfasern weh. »Ja… tun wir das.«
Sie fanden Catherine und Nick im Pausenraum. Die beiden
sahen aus, als hätten sie in den vergangenen Tagen höchstens
sechs Stunden geschlafen. Nick lehnte an der Theke und warte-
te darauf, dass sein Bagel in der Mikrowelle fertig würde.
Catherine saß am Tisch und hielt einen Pappbecher mit Kaffee
in den Händen. Sie schaute in das schwarze Getränk, als würde
sie versuchen, eine glücklichere Zukunft daraus zu lesen. Trost
schien allein der Erdbeerplunder zu bieten, der auf einer Ser-
viette vor ihr lag.
»Was Neues?«, fragte Grissom.
»Ja und nein«, entgegnete Catherine, nahm ihren Kaffeebe-
cher an den Mund und pustete.
»Ich hatte mir ein paar Details mehr erhofft«, bemerkte
Brass.
»Wie wäre es damit? Phillip Carlson ist ein totaler Freak,«
wurde Nick nun etwas genauer.
»Freak im Sinne von körperlich missgebildet? Oder im Sin-
ne von promiskuitiv? Bitte etwas präziser, Nick.«

»Freak in dem Sinn, dass er eine freakige Kapelle für einen
gewissen fingerabschneidenden, spermaverteilenden Serienkil-
ler errichtet hat.«
Grissom und Brass setzten sich zu Catherine an den Tisch,
Nick kam mit seinem Kaffee und dem aufgebackenen Bagel
mit Ei dazu, und die beiden erzählten ihre Geschichte.
»Aha«, sagte Grissom. »So ein Freak also.«
Catherine grinste freudlos und schüttelte den Kopf. »Ja, aber
leider scheint er nicht der richtige Freak zu sein…«
Davon wollte Brass nichts hören. »Für mich klingt das, als
hätte er die Wände mit seinen eigenen Zeitungsausschnitten
tapeziert!«
»Er scheint nicht der Richtige zu sein, Jim. Zumindest nicht,
was die neuen Morde angeht.«
»Warum?«, hakte Grissom nach.
»Seine DNS stimmt mit keiner der Proben von den Tatorten
überein.«
»Sie passt auch zu keiner Probe von den Original-CASt-
Fällen.«
»Und wir hatten jede Menge DNS-Proben zu überprüfen«,
ergänzte Nick und legte seinen Bagel auf den Teller.
»Wieso das?«, fragte Grissom.
»Wir sind mit der Quarzlampe durch Carlsons CASt-
Tempel gegangen…«, erklärte Catherine. Diese Lampe macht
es möglich, alle eiweißhaltigen Spuren an einem Tatort sicht-
bar zu machen. »… und der ganze Boden war voller fluoreszie-
render Spritzer.«
Grissom runzelte die Stirn. »Er benutzt das CASt-Material
als Masturbationsvorlage?«
Brass nickte mit dem Kopf. »Verdammt, das ergibt Sinn…
Er ist ein notorischer Bekenner. Er identifiziert sich mit dem
kranken Bastard.«
»Aber er ist nicht der kranke Bastard«, erwiderte Nick.

»Nicht der, nach dem wir suchen«, fügte Catherine hinzu.
»Sind alle Beweisspuren untersucht?«, fragte Grissom.
»Nein«, entgegnete Catherine. »Wir warten noch auf einige
Laborergebnisse, aber es ist mehr als eine Ahnung, Gil, wenn
ich sage, dass Carlson nicht der Täter ist.«
»Wir nehmen uns jetzt die anderen beiden Verdächtigen
vor, Dallas Hanson und Jerome Dayton«, erklärte Nick.
»Das solltet ihr auch«, sagte Grissom.
In diesem Augenblick kam Greg Sanders herein. Er schenk-
te sich einen Kaffee ein und baute sich lächelnd vor Grissom
auf.
»Sie haben etwas gefunden«, folgerte der CSI-Leiter.
Greg zog die Augenbrauen hoch. »Unser Killer… ist ein
Nachahmer.«
Grissoms Stimmung besserte sich augenblicklich. »Sind Sie
sicher? Ist das mehr als eine wohlbegründete Vermutung?«
»Ganz sicher«, entgegnete Greg.
»Warum?«
Greg wurde ernst und erklärte sachlich: »Ich habe die DNS-
Proben von den Originalfällen bekommen – die eingefrorenen
Spermaproben, die wir dem inzwischen pensionierten, aber
immer noch hoch geschätzten Detective Champlain verdanken.
Jedenfalls stimmt keine der Proben mit denen von Rudy Orloff
überein, die wir auf den Opfern fanden… und mit der DNS von
den Hautzellen am Seil auch nicht.«
»Rudy Orloff«, sagte Brass und seufzte. »Verdammt, den
hatte ich in dem ganzen Trubel um den Mord an Diaz fast
vergessen!«
»So ein Trubel kann ganz schön störend sein«, bemerkte
Greg.
»Greg!«, sagte Grissom warnend.
»Sorry.«
»Greg?«

»Hmmm?«
»Gute Arbeit.«
Von diesem Lob beflügelt, nahm Greg seinen Kaffee und
verzog sich umgehend in sein Labor, damit er nicht auch gleich
wieder eine Rüge kassierte.
»Also gut«, sagte Grissom zu den anderen. »Besprechen
wir, wie wir jetzt vorgehen.«
»Ich knöpfe mir Orloff vor«, sagte Brass. »Ich werde unse-
rem Kollegen Damon das Gefühl geben, wichtig zu sein, und
nehme ihn mit. Unterwegs könnte ich noch einmal bei dieser
Fernsehreporterin Halt machen, letztes Mal haben wir sie nicht
erwischt. Vielleicht können wir ja doch noch in Erfahrung
bringen, wer gequatscht hat.«
»Du solltest mit ihr reden, Gil«, schaltete sich Catherine
jetzt ein. »Sie mag dich.«
»Okay, ich rufe sie an«, meinte Grissom gequält. »Aber ich
werde nur mit ihr telefonieren – wenn ein persönliches Ge-
spräch nötig scheint, dann…«
»Ich danke Ihnen, Gil«, sagte Brass.
»Nick und ich, wir machen uns über Hanson und Dayton
schlau«, erklärte Catherine.
»Okay«, sagte ihr Chef. »Und was habt ihr mit Carlson ge-
macht?«
Nick grinste. »Der sitzt erst mal. Wir haben Pot in der
Nachbarwohnung gefunden, die auch ihm gehört – allerdings
nicht in dealerverdächtigen Mengen. Und er hat versucht abzu-
hauen.«
Grissom dachte nach. »Haltet ihn so lange fest, bis alle La-
borergebnisse da sind und ihr ganz sicher seid, dass er außer
Verdacht ist. Ich will auf gar keinen Fall einen Serienkiller
freilassen.«

»Wenn Carlson noch sitzt, wenn der nächste Mord passiert,
dann wissen wir wenigstens, dass er es nicht war«, bemerkte
Brass.
Alle sahen ihn mit großen Augen an.
»Habe ich das gerade wirklich gesagt?«, fragte Brass ent-
setzt. »Ich habe doch wohl nicht angenommen, dass noch ein
Mord passiert, bevor wir den Kerl kriegen…«
»Ich habe nichts gehört«, sagte Catherine.
»Was gehört?«, fragte Nick und knabberte an seinem Bagel.
»Haben Sie inzwischen mit Perry Bell gesprochen, Jim?«,
hakte Catherine nach.
Der Captain schüttelte den Kopf. »Ich habe es fast bis Mit-
ternacht probiert«, erzählte er jetzt auch ihr. »Über Handy ist er
einfach nicht zu erreichen. Aber ich habe jetzt die Nummer des
Wohnheims bekommen, in dem seine Tochter lebt.«
»Versuchen Sie, so viel wie möglich aus diesem Orloff he-
rauszubekommen«, meinte Grissom zu ihm. »Ich bleibe wäh-
renddessen an Bell und seiner Tochter dran.«
»Was machen wir mit Paquette?«, fragte Brass.
Bevor Grissom etwas sagen konnte, klingelte Brass’ Handy.
Er schaute auf das Display, als er es aufklappte. »Wenn man
vom Teufel spricht!«, rief er und nahm das Gespräch an. »Was
gibt’s, David?«
Während Brass eine ganze Weile zuhörte, spannte sich sein
Gesicht immer mehr an. Sein Blick war starr und verriet Beun-
ruhigung. »In zehn Minuten ist jemand von uns da«, sagte er
schließlich. »Fassen Sie bloß nichts an… Ja, ja, natürlich wis-
sen Sie das! Und halten Sie alle fest, die irgendwie damit zu
tun hatten, und sperren Sie sie in einen Raum, denn wir werden
von allen Fingerabdrücke brauchen.«
Er lauschte weiter, und die anderen wechselten besorgte
Blicke.

»Zehn Minuten«, bestätigte Brass. »Verlassen Sie sich
drauf. Und noch etwas – danke, Dave!« Damit beendete er das
Gespräch und sah Grissom an. »Er hat einen Brief von CASt
bekommen.«
»Oder von dem Nachahmer«, warf Nick ein.
»Das glaube ich nicht – die Leute vom Banner haben den
Brief schon gelesen, weil ihnen anfangs gar nicht klar war, um
was es sich handelt. Der Witz ist, das Original ist höchst unzu-
frieden mit der Nachahmung.«
Catherine seufzte und schüttelte den Kopf.
Brass fuhr fort: »Paquette hat die Originalbriefe gesehen,
die die Zeitung vor elf Jahren bekommen hat – und er sagt, er
glaubt, dass der von heute echt ist.«
»Alle verfahren so, wie wir es gerade besprochen haben«,
erklärte Grissom. »Ich werde Warrick und Sara sofort zum
Banner schicken.«
»Mir wäre es lieber, wenn Dave sich irren würde«, meinte
Brass. »Wir haben mit dem Nachahmer schon genug Probleme.
Was wir als Letztes gebrauchen können, ist, dass der Irre von
damals wieder aus der Versenkung auftaucht.«
»Vielleicht um den Neuen zu toppen?«, fragte Nick mit ei-
nem säuerlichen Lächeln.
Es war nur eine flapsige Bemerkung gewesen, aber ihr mög-
licherweise wahrer Kern traf alle wie ein Schlag vor den Kopf,
und sie erschauderten angesichts dieser furchtbaren Vorstel-
lung.
Sogar Gil Grissom.
Als Warrick Brown mit Sara die Eingangshalle des Banner
betrat, dachte er, dass es ganz ähnliche Gesichter gewesen sein
mussten, die den Ermittlern entgegengeschaut hatten, als sie
seinerzeit wegen der Anthrax-Briefe, die massenhaft nach dem

11. September aufgetaucht waren, in die Büros gerufen worden
waren.
Die Mitarbeiter, die auf der Treppe an ihnen vorbeigingen,
sahen sie allerdings mehr gequält als verängstigt an. Es war
klar, dass die Nachricht bereits die Runde gemacht hatte: Der
berüchtigte CASt hatte erneut den Banner zu seinem persönli-
chen Sprachrohr auserkoren.
Und als Warrick und Sara an der geschlossenen Tür des
Herausgebers James Holowell vorbeikamen, der sich anschei-
nend in seinem Büro verbarrikadiert hatte, beobachteten die
Reporter sie von ihren Schreibtischen aus, als wären sie Ge-
spenster, die das Gebäude heimsuchten. Verstohlen, aber unab-
lässig behielten sie die beiden Kriminalisten im Auge.
Vor Paquettes Büro hatte sich eine Menschentraube gebildet
– so ähnlich, wie man sie sah, wenn jemand vom Dach eines
Hochhauses zu springen drohte. Auf der rationalen Ebene
wollten solche Leute selbstverständlich, dass der Selbstmörder
gerettet wurde, schließlich hatten die Passanten ja den Ret-
tungsdienst verständigt. Aber in ihrem Unbewussten, auf der
Ebene des Es, wünschten sie sich, dass die arme Seele den
Sprung ins ewige Vergessen wagte. Diese animalische Faszina-
tion für den Tod, der in der Tiefe des menschlichen Wesens
schlummerte, würden sie sich allerdings niemals eingestehen.
Dieselbe Faszination trieb auch die Leute um, die sich vor
Paquettes Büro versammelt hatten, das spürte Warrick. Sie
wussten, dass der Tod hinter der verschlossenen Tür lauerte.
Keine Leiche, sondern etwas noch Aufregenderes: eine Bot-
schaft aus dem Reich des Todes…
… von einem Serienmörder, dem Superstar aller Killer.
Sara blieb dicht hinter Warrick, als sie auf das Büro zugin-
gen. Sie hatten beide ihren Stahlkoffer dabei. Warrick ahnte,
dass Sara die Schwingungen ebenfalls spürte, dieses morbide
Frohlocken der fiebernden Menschen.

»Paquettes Büro ist das erste rechts«, sagte sie.
Da praktisch alle Augen auf diese Tür gerichtet waren,
wunderte Warrick sich, warum Sara auf so etwas Offensichtli-
ches hinwies – aber vielleicht wollte sie einfach in der Stille,
die sich im Flur ausbreitete, irgendeine Stimme hören, und sei
es ihre eigene.
Warrick klopfte an, und die Tür ging einen Spalt auf. Er hat-
te David Paquette ein, zwei Mal getroffen und erkannte ihn
sofort wieder, obwohl er jetzt nur ein Stück von seinem Ge-
sicht zu sehen bekam.
»Sie sind… Brown, Warrick Brown«, stellte Paquette fest.
»Wir sind zu zweit, Mr. Paquette. Ich habe Sara Sidle mit-
gebracht.«
Die Tür ging auf, aber Paquette stellte sich ihnen in den
Weg, statt sie hineinzulassen. »Wo ist Jim Brass?«, fragte er
irritiert.
»Das hier ist Aufgabe des kriminaltechnischen Labors…
Dürfen wir?«
Paquette trat zurück und ließ sie herein. Dabei öffnete er die
Tür gerade so weit wie nötig, und sobald die beiden drin wa-
ren, schloss er sie wieder und lehnte sich dagegen, als befürch-
tete er, die Menge könnte versuchen, sein Büro zu stürmen –
möglicherweise mit einer Bank als Ramme und zusammenge-
rollten brennenden Zeitungen als Fackeln…
Das Schreckgespenst Serienkiller hatte den Monstern aus
Sagen und Filmen inzwischen längst den Rang abgelaufen.
Und weil Las Vegas eine so einzigartige, vergnügungsreiche,
sonnige Wüstenoase war, die Menschen aus aller Welt anzog,
hatte die Polizei hier vermutlich mehr von diesen modernen
Monstern zu Gesicht bekommen als jedes andere Department
in den Vereinigten Staaten.
Dennoch war es kaum mehr als eine Hand voll. Und nicht
einmal für Warrick Brown – abgesehen von Grissom der abge-
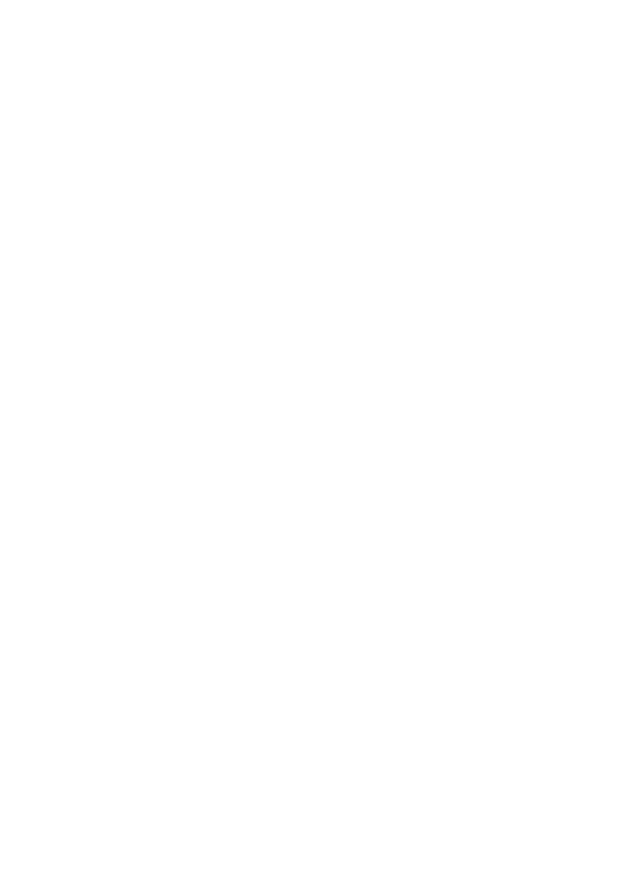
brühteste aller CSI-Mitarbeiter – waren die Morde, die buch-
stäblich monströsen Egos und die Extreme dessen zur Routine
geworden, was früher einmal »das Böse« genannt wurde und
mittlerweile pathologisch zu sein schien.
Aber diese »Stadtleute« hier auf dem Flur, sie blieben auf
Abstand, das wusste Warrick aus Erfahrung. Wie fasziniert sie
auch waren, sie wollten dem Brief, den ihnen der Verrückte ins
Haus geschickt hatte, nicht näher kommen als bis zu dieser
Tür.
In Paquettes Büro waren noch zwei weitere Männer. Der ei-
ne sah noch sehr jung aus, hatte strähniges, blondes Haar und
große blaue Augen. Er trug ein schwarzes Slipknot-T-Shirt und
hatte die Hände tief in den Taschen seiner Jeans vergraben. Der
andere war Perry Bells Rechercheassistent Mark Brower.
»Ich glaube, Sie kennen Mark«, meinte Paquette zu War-
rick.
»Wir haben uns schon mal gesehen«, sagte Warrick nickend
und schüttelte Brower die Hand.
»Und Sara ist eine alte Freundin«, bemerkte Brower und
schüttelte auch ihr die Hand.
Nach Saras Gesichtsausdruck zu urteilen war dies stark ü-
bertrieben. Aber die Atmosphäre war insgesamt sehr ange-
spannt und irgendwie unnatürlich.
Paquette ging zu seinem Schreibtisch und zeigte dabei auf
den blonden Jungen. »Jimmy hat den Brief als Erster entdeckt.
Jimmy Mydalson, er arbeitet in der Poststelle.«
Der Junge nickte, ließ aber die Hände in den Hosentaschen
stecken. Für ein ausführliches Begrüßungsritual war er viel zu
beschäftigt: Er behielt den braunen Umschlag auf Paquettes
Schreibtisch argwöhnisch im Auge wie eine Schlange, vor
deren plötzlichem Biss er sich fürchtete.
»Ist das der Brief?«, fragte Sara und machte einen Schritt
auf den Umschlag zu.

»Und der Rest«, sagte Paquette.
»Was für ein Rest?«
Paquette brachte ein grotesk wirkendes Lächeln zustande.
»Das, was in dem Umschlag ist, das ist… äh… nur ein Teil der
Sendung. Das haben wir aber nicht angerührt, das Päckchen da
drin.«
»Oooo-kay«, machte Sara.
»Der Brief liegt unter dem Umschlag. Da vor Ihnen! Wir
haben ihn alle drei angefasst, und den Umschlag auch.«
»Jetzt mal langsam«, meinte Warrick. »Erzählen Sie uns der
Reihe nach, was passiert ist.«
Paquette und Brower sahen Mydalson an.
Der Junge sah aus, als wollte er weglaufen oder sich über-
geben oder beides gleichzeitig. Schließlich holte er tief Luft
und wies mit zitternden Fingern auf den Umschlag. »Das ist
heute Morgen in der Post gewesen. Ich habe den Brief gelesen,
und dann bin ich sofort zu Mr. Brower gelaufen.«
»Mark ist nicht mal Reporter«, sagte Sara. »Warum haben
Sie sich nicht an einen Redakteur gewendet, an jemanden, der
in der Nahrungskette weiter oben steht?«
Mydalson zuckte mit den Schultern. »Ich vertraue Mark. Er
ist immer nett zu mir.«
»Okay, Mark«, sagte Warrick. »Dann zu Ihnen…«
Der Junge von der Poststelle seufzte erleichtert und sah
Brower erwartungsvoll an.
»Jimmy hat mir den Brief gebracht«, erzählte Brower, »ich
habe ihn gelesen, und dann haben wir beide ihn schnellstens
hierher gebracht, um ihn David zu zeigen.«
»Warum haben Sie ihn nicht Ihrem Boss gezeigt, Mark? Sie
sind doch Perry Bells Assistent, nicht wahr?«
»Perry ist in Kalifornien, er besucht seine Tochter. David ist
der Redakteur, dem Perry unterstellt ist, also ist David im
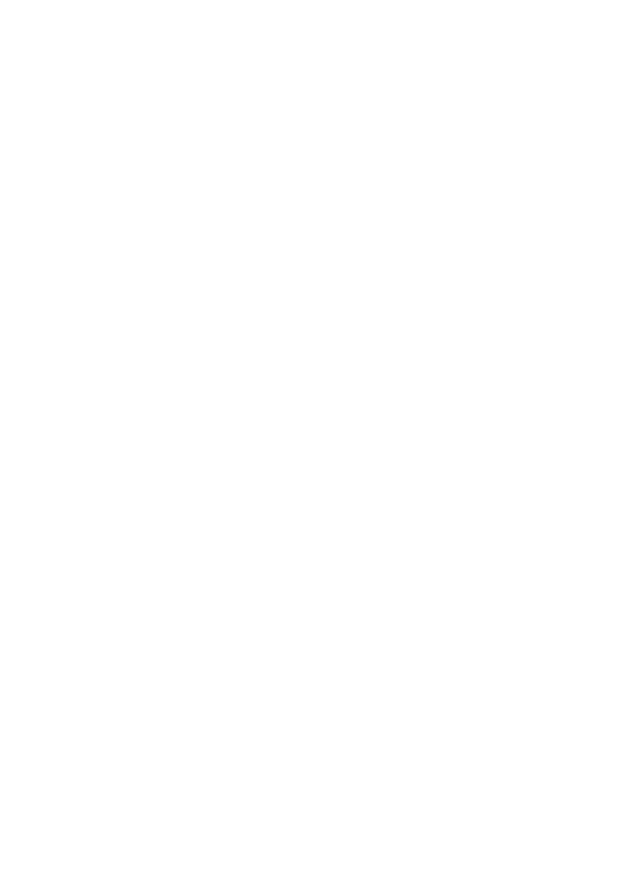
Moment mein Boss… und ihm habe ich den Umschlag ge-
bracht.«
»Hat außer Ihnen noch jemand den Brief angefasst?«
Kopfschütteln auf allen Seiten.
»Okay, kein Grund zur Panik, aber wir müssen Ihre Finge-
rabdrücke nehmen. Damit wir wissen, welche Abdrücke auf
dem Brief von Ihnen stammen und welche möglicherweise von
dem Täter sind. Okay?«
Nicken auf allen Seiten.
Die beiden Spurenermittler streiften sich Latexhandschuhe
über. Während Warrick zuerst Fingerabdrücke von Paquette,
dann von Mydalson nahm, schob Sara den Umschlag zur Seite
und faltete den Brief vorsichtig mit einer Pinzette auseinander,
um keine Beweisspuren zu zerstören. Das Blatt war mit einem
blauen Stift beschrieben, die Handschrift war klein und sauber,
und der Abstand zwischen den Zeilen extrem gleichmäßig.
Sara überflog den Brief, dann begann sie, ihn Warrick vor-
zulesen: »Captain Brass, so viele Jahre sind vergangen, und Sie
sind immer noch nicht befördert worden. Es ist, als wäre die
Zeit stehen geblieben. Bei Ihnen hat sich nichts verändert. In
dieser Hinsicht sind wir uns durchaus ähnlich – auch bei mir
hat sich nichts verändert. Auch für mich ist die Zeit stehen
geblieben.«
Warrick war inzwischen mit Mydalson fertig und wollte
sich Brower vornehmen.
»Leute, ist das wirklich nötig?«, fragte Brower. »Ich habe
das Ding kaum angefasst, und ich bin im Redaktionsschluss.«
Warrick lächelte den Mann an. »Entspannen Sie sich, Mark,
es dauert nur ein paar Sekunden, und es hilft uns, die Finge-
rabdrücke des Täters zu identifizieren.«
»Ach, was soll’s«, meinte Brower kichernd und trat vor.
»Ich nehme es einfach als Recherche.« Er streckte die rechte
Hand aus.

Sara las weiter vor: »Es heißt, Nachahmung sei das größte
Lob. Aber ich fühle mich alles andere als geschmeichelt. Ich
fühle mich geschändet, und so wende ich mich an Sie, Captain,
damit mir Gerechtigkeit widerfährt. Sie sollen wissen, Captain
James Brass, dass ich nichts mit diesen rücksichtslosen, dum-
men Verbrechen zu tun habe. Um Ihnen meine Aufrichtigkeit
zu beweisen, trenne ich mich von einem wertvollen Erinne-
rungsstück.«
Sara hörte auf zu lesen und sah nachdenklich den braunen
Umschlag an, der ungefähr zwanzig mal dreißig Zentimeter
groß war und in dem offensichtlich noch etwas Eckiges steckte.
Als Warrick mit Browers Fingerabdrücken fertig war, trat er
zu Sara. Er beugte sich vor, spähte in den offenen Umschlag
und entdeckte eine weiße Schachtel von vielleicht zehn mal
zehn Zentimetern mit einer roten Schleife drumherum. Sara
warf jetzt ebenfalls einen Blick in den Umschlag und blickte
Warrick auffordernd an.
Vorsichtig nahm dieser die Schachtel zwischen Daumen und
Mittelfinger und zog sie aus dem Umschlag, um sie sich ge-
nauer anzusehen. Dann machte er sowohl von der Schachtel als
auch von dem Brief Fotos und untersuchte das rote Band auf
Fingerabdrücke. Er fand keine und schnitt es durch.
Nun kam die Bescherung: Warrick nahm den Deckel ab.
In der Schachtel lag auf Watte gebettet ein mumifizierter
Finger.
Paquette und Brower wichen erschrocken zurück. Der Junge
von der Poststelle schlug sich die Hand vor den Mund, rannte
zur Tür, riss sie auf und stieß beim Hinauslaufen einige der
neugierig Wartenden zur Seite wie Bowlingkegel – und das
alles in ungefähr zwei Sekunden.
Mach’s gut, Junge!, dachte Warrick.

Der weiße Zeigefinger war so verschrumpelt, dass Warrick
sich unwillkürlich fragte, ob man davon überhaupt einen Ab-
druck erstellen konnte.
Während er weiter fotografierte, las Sara den Brief zu Ende
vor:
»Wenn Sie mein Andenken identifiziert haben, werden Sie
feststellen, dass ich der bin, der ich zu sein behaupte – dass ich
in der Tat der einzig Wahre bin, das Original und keine billige
Imitation. Ich habe nichts mit den beiden Morden zu tun, die
kürzlich in unserer Stadt verübt wurden. Derjenige, der hinter
diesen Taten steckt, ist ein erbärmlicher Hochstapler, der ver-
sucht, sich auf meine Kosten wichtig zu machen. Das kann ich
nicht zulassen. Mein Ruf steht auf dem Spiel, und ich muss ihn
wahren. Wenn Sie meinen guten Namen nicht schützen kön-
nen, werde ich es selbst tun.« Sara sah auf. »Unterschrieben ist
das Ganze mit: ›Capture, Afflict, Strangle‹.«
Warrick schüttelte den Kopf und wechselte vielsagende Bli-
cke mit Sara. Vor den Journalisten wollten sie nicht darüber
sprechen, aber sie fragten sich in diesem Moment beide, wie
CASt seinen guten Namen wohl schützen wollte.
»Was für ein egozentrischer Irrer!«, bemerkte Paquette ent-
geistert.
Um Warricks Lippen spielte ein kleines Lächeln. »Diese Ti-
tulierung war vielleicht noch nie so zutreffend wie in diesem
Fall, Mr. Paquette.«
Das Gespräch mit Jill Ganine verlief ungefähr so, wie Grissom
es sich vorgestellt hatte.
»Ms Ganine«, sagte er ins Telefon, und das Bild, das er von
der attraktiven brünetten Nachrichtensprecherin im Kopf hatte,
war keineswegs unerfreulich. »Wenn bei einem Mordfall wie
diesem vertrauliche Informationen den Weg in die Medien
finden, gibt uns das aus vielerlei Gründen Anlass zur Sorge.«

»Sie fragen sich, wem Sie vertrauen können, Gil? Um
Himmels willen, nennen Sie mich Jill! Wie oft habe ich Sie
schon interviewt? Habe ich je etwas falsch dargestellt, das Sie
mir gesagt haben? Habe ich Ihr Vertrauen jemals miss-
braucht?«
»Nein, Jill, das haben Sie nicht, und das weiß ich zu schät-
zen.«
»Gut, dann werden Sie auch verstehen, dass ich meine Quel-
len nicht preisgeben kann.«
Grissom seufzte tonlos. »Sie behindern die Ermittlungen in
einem Fall, bei dem es um einen brutalen Killer geht, der im-
mer noch…«
»Meinen Sie CASt… oder einen Nachahmungstäter?«
»Jill, bei den Personen, von denen Sie Ihre Informationen
haben, handelt es sich möglicherweise um Tatverdächtige!«
»Interessant. Darf ich Sie zitieren?«
»Dieses Gespräch führt zu nichts, oder?«
»Wissen Sie, Gil, ich glaube nicht.«
»Muss ich mir erst eine gerichtliche Verfügung holen?«
»Damit dieses Gespräch zu etwas führt oder damit ich mei-
ne Quelle preisgebe? Glauben Sie wirklich, das funktioniert?«
»Wahrscheinlich nicht«, räumte er ein.
»Sehen Sie es doch mal so, Gil: Sie können Jim Brass sa-
gen, dass Sie auf Ihre unnachahmliche CSI-Art Ihr Bestes
gegeben und alles versucht haben. C – S – Ei-ei-ei-ei-ei-ei…
Dabei kommt eben nicht mehr raus.«
»Auf Wiederhören, Jill.«
Perry Bell war immer noch nicht über Handy zu erreichen,
und Grissom hatte alle Mühe, die Tochter des Reporters aufzu-
spüren. Als er endlich jemanden in ihrem Zimmer im Wohn-
heim erreichte, wurde er von Pattys ehemaliger Mitbewohnerin
darüber informiert, dass die junge Frau in diesem Semester ein

Apartment bezogen hatte. Grissom fragte nach der Telefon-
nummer, aber die Ex-Mitbewohnerin sagte, sie habe sie nicht.
»Wir haben uns nicht gut verstanden«, erklärte sie. »Sie war
total sauer auf mich, weil ich ihr mal auf den Teppich gekotzt
habe. Ich meine, als wäre das meine Schuld!«
»Es war nicht Ihre Schuld, dass Sie ihr auf den Teppich ge-
kotzt haben?«
»Natürlich nicht! Ich war doch betrunken!«
Grissom legte das Gespräch als soziologische Kuriosität zu
den Akten und bedankte sich bei der jungen Frau. Dann pro-
bierte er auf anderen Wegen, die Nummer von Bells Tochter
herauszubekommen, doch er kam nicht richtig weiter. Schließ-
lich gab ihm Sergeant O’Riley die Nummer seines alten Kum-
pels Tavo Alvarez in Los Angeles, den Grissom sofort kontak-
tierte. Und nach einer halben Stunde konnte dieser ihm auch
schon weiterhelfen: Anscheinend hatte Patty sich unter dem
Mädchennamen ihrer Mutter – Lang – an der Universität ein-
geschrieben. Mit dieser Information war es ein Klacks, ihre
Telefonnummer ausfindig zu machen.
Grissom rief zuerst in ihrem Apartment an, aber da ging
niemand an den Apparat. Als Nächstes wählte er Pattys Han-
dynummer, und sie meldete sich beim dritten Klingeln.
»Hallo?«
Sie hatte eine angenehme, fröhliche Stimme. An dem ge-
dämpften Verkehrslärm im Hintergrund war zu erkennen, dass
sie im Auto saß.
»Patty Lang?«
»Ja. Wer spricht da? Ich kenne Ihre Stimme nicht.«
Grissom stellte sich vor und erklärte ihr, dass er versuche,
ihren Vater zu finden.
»Ich wünschte, ich könnte Ihnen helfen, Mr. Grissom. Dad-
dy hat mich vorgestern angerufen, um mir zu sagen, dass er
nicht kommen kann.«

Der singende Tonfall des Mädchens erinnerte Grissom an
Saras Art zu sprechen. Er mochte diesen California-Girl-
Singsang, obwohl es eigentlich keinen vernünftigen Grund
dafür gab.
»Hat er Ihnen gesagt, warum er nicht kommen kann?«, frag-
te er.
»Ja. Er sagte, er sei an einer heißen Story dran, vergleichbar
mit der CASt-Geschichte, und mit der würde er ganz groß
rauskommen.«
»Hat er gesagt, was für eine Geschichte das ist?«
Sie lachte. »Wie gut kennen Sie meinen Vater, Mr. Gris-
som?«
»Ganz gut.«
»Hat er Ihnen je von einer Geschichte erzählt, bevor sie ge-
druckt wurde?«
»Nein, da haben Sie Recht, Patty.«
Plötzlich wurde sie ernst. »Stimmt etwa irgendetwas nicht?
Mit meinem Vater, meine ich. Ist er in Schwierigkeiten oder in
Gefahr?«
Da ihr Vater Kriminalreporter war, fand Grissom Pattys Re-
aktion ganz normal.
»Nein, ich denke nicht. Ich wollte nur über einen aktuellen
Fall mit ihm sprechen. Und alle waren der Ansicht, er sei bei
Ihnen in Los Angeles.«
»Tja, das war ja auch geplant. Aber jetzt ist er einem Knül-
ler auf der Spur – was das genau ist, kann man bei meinem
Vater nie wissen.«
Sie lachte, und Grissom schmunzelte, aber er nahm den be-
sorgten Unterton in ihrer Stimme war.
»Kann ich Ihnen sonst irgendwie behilflich sein, Mr. Gris-
som?«
»Nein«, entgegnete er. »Ich danke Ihnen.«
»Würden Sie… mir einen Gefallen tun?«

»Natürlich, Patty.«
»Wenn Sie meinen Vater sehen, sagen Sie ihm, er soll mich
anrufen. Sie haben mich irgendwie beunruhigt.«
»Sorry, das war nicht meine Absicht.«
»Aber auf der Welt geht es übel zu, nicht wahr?«
Grissom wollte ihr nichts vormachen. »Ja, in der Tat, Patty.
Vielen Dank und auf Wiederhören!«
»Bye!«
Er legt auf und lehnte sich in seinem Sessel zurück.
Wenn Bell nicht in Los Angeles war, wenn er in Vegas hin-
ter einer »heißen Geschichte« her war… warum war er dann
seit zwei Tagen nicht im Büro gewesen?
War die Geschichte vielleicht nur eine Erfindung, damit er
Enrique Diaz in Ruhe umbringen konnte, während alle dachten,
er sei verreist? Aber Perry kannte sich äußerst gut in Ermitt-
lungsfragen aus, und wenn er sich ein Alibi verschaffen wollte,
dann hätte er doch vermutlich kaum eins gewählt, das so leicht
zu widerlegen war? Ein Anruf bei der Tochter – und es war
geplatzt.
Je länger der Kolumnist unauffindbar blieb, desto mehr Fra-
gen stellten sich. Immerhin war Bell einer der wenigen Men-
schen, der möglicherweise tatsächlich Vorteile aus dem Come-
back des brutalen Serienkillers ziehen konnte. Und er hatte
kein Alibi für den ersten Mord, unmittelbar vor dem zweiten
war er abgetaucht… Und dann hatten sie eine Schlüsselkarte
für seinen Arbeitsplatz in der Hand des zweiten Opfers gefun-
den. Hatte Diaz sie Bell geistesgegenwärtig aus der Tasche
gezogen, um einen stummen Hinweis auf den Täter zu geben?
Grissom hatte für solche ausgesprochen praktischen und
cleveren »Hinweise« à la Ellery Queen oder Agatha Christie
allerdings wenig übrig, und ihm fiel eine abgedroschene Phrase
aus alten Krimis ein: »Draußen war alles ruhig…zu ruhig.«
Perry Bell war verdächtig.

Zu verdächtig.
Die Fahrt auf der 93 durch die Delamar Mountains war noch
langweiliger, als Brass befürchtet hatte. Landschaftlich interes-
sierten ihn Berge überhaupt nicht; die Begeisterung, die man-
che Leute für Gesteinsformationen entwickelten, ging ihm
völlig ab. Viel unterhaltsamer als die Berge war sein Begleiter
Damon allerdings auch nicht. Der Detective vom Department
Nord hatte nur zwei Themen: die Arbeit und Profi-Wrestling.
Brass interessierte sich genauso wenig für das, was bei den
Jungs im Norden von Las Vegas los war, wie für sportliche
Wettkämpfe mit Drehbuch…
Nach einer halben Ewigkeit kamen sie endlich am Haupttor
des Staatsgefängnisses von Ely an. Die Hochsicherheitsanlage
bestand aus acht Gebäuden, die zu vier miteinander verbunde-
nen Zweierblöcken gruppiert waren. Das Gelände war von
einem vier Meter hohen Maschendrahtzaun mit Stacheldraht-
schlaufen umgeben, und in allen vier Ecken standen dreistö-
ckige Wachtürme.
Ein Wachmann kam mit einem Clipboard in der Hand aus
dem klimatisierten Häuschen neben dem Tor. In seinem Gang
lag die unverwechselbare Mischung aus Amtsgewalt und
Gleichgültigkeit, die charakteristisch für seine Spezies war. Er
trug eine Sonnenbrille und hatte seine Schirmmütze tief ins
Gesicht gezogen. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte er, was im
Klartext so viel bedeutete wie: Was soll ich hier draußen in
dieser Hitze?
Brass und Damon zeigten ihre Ausweise vor.
»Wir müssen mit einem Häftling reden«, sagte Damon.
Ohne Scherz?, schien der Blick des Wachmanns zu sagen.
»Wir stehen auf der Liste«, erklärte Brass.
Der Mann überflog das Papier auf dem Clipboard. »Ja, hier
sind Sie! Sie kennen das Prozedere?«

»Ich schon«, entgegnete Brass.
Der Wachmann schlenderte davon.
»Was für ein Prozedere?«, fragte Damon.
»Nun, es beginnt mit Abwarten und keinen Tee trinken.«
Sie mussten fast fünf Minuten in der Sonne schmoren, bevor
der Wachmann endlich wieder aus seinem Häuschen kam und
sie vorbeiwinkte. Wie von Zauberhand öffnete sich das große
Tor und Brass steuerte den Wagen hinein.
Der Rest der Prozedur dauerte fast eine halbe Stunde, dann
saßen die Kriminalbeamten endlich in einem winzigen Raum
mit kahlen Betonwänden an einer Art Picknicktisch aus Stahl.
Ihre Pistolen hatten sie zuvor am Eingang in Schließfächern
deponieren müssen. Beide schwiegen und betrachteten die
abstrakten Muster, die von den durch das vergitterte Fenster
hereinfallenden Sonnenstrahlen auf den Tisch gemalt wurden,
während sie ungeduldig auf ihren Gesprächspartner warteten.
Nach einer Zeit, die Brass fast ebenso lang vorkam wie die
Fahrt, hörten sie, wie ein Schlüssel ins Schloss gesteckt wurde,
dann ging die Tür auf. Der junge Mann, der gefolgt von einem
Wärter hereinkam, sah eigentlich nicht wie ein Killer aus, aber
Brass wusste nur zu gut, dass Mörder viele Gesichter hatten.
In diesem Fall handelte es sich um einen hageren, blonden
Jungen mit großen blauen Augen, der ganz gut aussehend war.
Sein orangefarbener Overall war tadellos gebügelt, und obwohl
ihm Handschellen angelegt worden waren, bewegte sich Rudy
Orloff mit einer lässigen Anmut. Ohne Aufforderung setzte er
sich den beiden Männern gegenüber an den Tisch.
Er lächelte und zeigte seine gepflegten, weißen Zähne. »Ich
erinnere mich an Sie«, sagte er zu Brass. »Aber Ihren Namen
weiß ich nicht. Sie haben mir vor ein paar Jahren zusammen
mit diesen Angebern vom CSI wegen irgendeinem Mord die
Hölle heiß gemacht.« Dann bedachte er Damon mit einem

unverschämten Blick. »Sie sind niedlich, aber Sie kenne ich
nicht… Das ist nicht fair, oder? Sie wissen, wer ich bin.«
Brass und Damon zeigten ihre Ausweise vor.
»Muss ja wichtig sein, wenn Sie extra von Vegas nach Ely
kommen«, sagte Orloff. »Wenn auch nur für einen Nachmittag.
Wie Sie vielleicht bemerkt haben, dieser Ort ist das dreckigste
Loch der Welt.«
»Rudy, wir haben den weiten Weg gemacht, nur um Sie zu
sehen. Um mit Ihnen zu reden.«
»Was für eine große gottverdammte Ehre! Und wen, glau-
ben Sie, habe ich getötet, den ich gar nicht getötet habe?«
»Ihre DNS wurde an den Tatorten zweier Morde gefunden«,
erklärte Damon.
»Meine DNS?«, fuhr Orloff auf. »Was denn? Haare? Haut?«
»Sperma«, entgegnete Brass.
Orloff setzte ein gehässiges Grinsen auf. »Ihr seid doch echt
pervers, was?«
»Passen Sie mal auf, Sie Besserwisser«, entgegnete Brass.
»Ihr Sperma wurde an den Leichen zweier ermordeter Männer
gefunden – in Vegas, letzte Woche.«
Der Häftling stutzte und lächelte irritiert. »Wie bitte?«
Brass erklärte es ihm noch einmal.
Nun wirkte Orloff amüsiert, wenn nicht gar interessiert. »Ich
bin seit fast einem Jahr im Bau – wie soll ich das denn ge-
schafft haben? Per Fax aus der Knastbücherei? Mit viel Ziel-
wasser?«
»Wir haben es bereits überprüft. Sie waren auf keiner Beer-
digung und hatten auch sonst keinen Freigang. Sie haben Ihren
Hintern nicht aus diesem Gefängnis bewegt.«
»Sie sind hier der Kriminale, Captain Brass. Was glauben
Sie, wie es dazu gekommen ist?«

Die beiden Polizeibeamten schwiegen eine ganze Weile,
dann sagte Brass: »Wir haben gehofft, das könnten Sie uns
sagen.«
»Warum sollte ich Ihnen helfen?«
»Ich rede mit dem Direktor und schreibe einen Bericht, der
Ihnen ein paar Sternchen für Ihr Führungszeugnis einbringt.«
»Nun… das ist doch schon was…«
»Wir sind hinter einem brutalen Typen her.«
Orloff wich zurück und hob die Hände wie Al Jolson, wenn
er »Mammy« sang. »Wow, brutal! Das ist ja mal ganz was
Neues!«
»Wir reden von einem Serienkiller. Erinnern Sie sich an
CASt?«, fragte Brass.
»Der startet ein Comeback? Und ich sitze hier und hoffe auf
die Fortsetzung von Seinfeld.«
Brass’ Mund lächelte, seine Augen jedoch nicht. »Ihre Soße
– wie ist die dahin gekommen?«
Orloff zuckte mit den Schultern. »Was ich sicher weiß, ist,
dass ich die zwei nicht umgebracht habe. Darüber hinaus kann
ich nur spekulieren.«
»Dann spekulieren Sie!«, entgegnete Brass.
Orloff schien sich irgendwie geschmeichelt zu fühlen. Er
richtet sich auf, faltete die Hände und fragte in verschwöreri-
schem Ton, wie von Experte zu Experte: »Sind Sie sicher, dass
es meine DNS ist?«
»CODIS irrt nie.«
»Dann hat es jemand eingefroren.«
»Mensch, daran hatten wir noch nicht gedacht! Haben Sie
Ihr Sperma an eine Klinik verkauft?«
»Nein, und mein Blut auch nicht, obwohl ich das früher
schon mal versucht habe. Sehen Sie, man muss vorher in einen
Becher pinkeln, und ich bin mit meinen Testergebnissen ein-
fach nicht durchgekommen.«

»Was uns zu der Frage führt«, meinte Brass, »wer Spaß dar-
an haben könnte, Rudy Orloffs Sperma einzufrieren.«
Der junge Mann lehnte sich nachdenklich zurück.
Brass versuchte, ihm auf die Sprünge zu helfen. »Hören Sie,
Sie sind jetzt schon eine Weile im Knast, das wissen wir. Aber
wir wissen nicht, wann Sie zuletzt in Vegas waren.«
»Das ist bestimmt achtzehn Monate her, mehr oder weni-
ger.«
»Sie haben Männern Ihre Dienste angeboten. Irgendwas
Ungewöhnliches?«
Orloff schnaubte. »Wenn ein Mann einen anderen für Sex
bezahlt, was könnte da schon Ungewöhnliches passieren?«,
fragte er ironisch.
»Hat Ihnen vielleicht jemand… das Zeug abgekauft?«
Orloff verschränkte lächelnd die Arme vor der Brust. »Sie
meinen, ein Sammler?«
»Gibt es so etwas?«
Orloff beugte sich wieder vor, und sein Grinsen war längst
nicht so hübsch wie sein Gesicht. »Da draußen gibt es nichts,
was es nicht gibt.«
»Das will ich gern glauben. Wie war das in Vegas…«
Der Häftling zuckte mit den Schultern und lehnte sich wie-
der mit verschränkten Armen zurück. »Ich habe damals einen
Haufen Leute kennen gelernt. Aber ich kann mich nicht mehr
so gut erinnern. Wenn was für mich drin wäre, dann fällt mir
vielleicht was ein.«
Brass klopfte Damon auf die Schulter und die beiden erho-
ben sich.
»Was?«
»Wir sind weg«, sagte Brass.
»Was, Sie wollen nicht handeln?«, fragte Orloff erstaunt
und fing regelrecht an zu schmollen. »Ich dachte, Sie sind zum
Spielen gekommen!«

»Wir sind zum Arbeiten gekommen«, entgegnete Brass.
»Und ich glaube sowieso, Sie haben nichts zu verkaufen.«
»Jetzt seien Sie doch nicht beleidigt! Setzen Sie sich! Wenn
ich Ihnen etwas an die Hand gebe, bekomme ich dann auch
etwas dafür?«
Die beiden Cops setzten sich wieder.
»Zum Beispiel?«, fragte Brass.
»Einzelhaft.«
»Sie wollen Einzelhaft?«, fragte Damon verblüfft.
»Hören Sie, ich hoffe, ich komme wegen guter Führung frü-
her raus. Ich sitze wegen versuchten Mordes, nicht wegen
Mord, Leute! Ich sehe Licht am Ende des Tunnels, und wenn
ich Ihnen helfe, wird das positiv in meiner Akte vermerkt. Aber
wir haben hier Fernsehen und wir haben Zeitungen. Wenn
diese Tiere hier herausfinden, dass ich den Bullen geholfen
habe, auch wenn es um einen irren Serienmörder geht, dann ist
die Jagdsaison eröffnet. Das werde ich nicht überleben, wenn
Sie mich nicht schützen.«
Brass nickte. »Sie geben mir etwas, das mir weiterhilft, und
ich verschaffe Ihnen Einzelhaft.«
»Und während ich in Einzelhaft bin, lassen Sie mich verle-
gen.«
»Rudy, ich weiß nicht, ob mir das gelingt.«
»Es gibt viel angenehmere Orte als diesen. Ich habe hier in
der dünnen Gebirgsluft Atemprobleme.«
Brass überlegte, ob Orloff sich vielleicht in Ely Feinde ge-
macht hatte, denen er zu entkommen suchte. Vielleicht konnten
sie sich das zunutze machen…
»Ich tue, was ich kann«, sagte er.
Orloff sah ihm prüfend ins Gesicht. »Ich glaube Ihnen. Und
ich zähle auf Sie. Aber denken Sie daran, wenn Sie mich als
Zeugen wollen, dann brauchen Sie mich lebendig! Leichen
können im Zeugenstand nichts mehr ausrichten.«

»Ist klar.«
»Okay. Also, da waren mal zwei Typen. Die Namen kenne
ich leider nicht.«
»Au, super Anfang, Rudy«, bemerkte Brass.
»Hey, wo ich herkomme, da nennt man keine Namen«, sag-
te Orloff. »Wenigstens nicht die richtigen. Dachten Sie etwa,
ich sage Ihnen: ›Suchen Sie Smith und Jones‹?… Jedenfalls, da
waren diese beiden Typen. Einer war schon älter.«
»Wie alt?«
Orloff zuckte mit den Schultern. »Fünfzig vielleicht, so um
den Dreh.«
»Wie sah er aus?«
»Glatze, Brille – und Klamotten, als wäre er seit Saturday
Night Fever nicht mehr Shoppen gegangen.«
»Glatze?«
»Ja, er hatte nur noch… ein paar Strähnen auf dem Kopf,
mehr nicht. Er trug jede Menge Polyester. Sie wissen schon:
Schöne Jacke, wäre auch ein hübscher Sofabezug!«
»Okay«, sagte Brass. »Und der war ein… Sammler?«
»Ja. Er stand darauf, mir beim Wichsen zuzugucken. Er hat
mir den Becher gehalten, und dann… hat er es mit nach Hause
genommen. Was er damit gemacht hat, kümmerte mich nicht.
Mich hat nur der Hunderter interessiert, den er mir gab. Der
andere Typ hat das Gleiche gewollt. Er hat sich nur mehr…
daran beteiligt. Mir geholfen.«
»Was war das für einer?«, fragte Brass.
»Um die dreißig, dunkles Haar. Er gefiel mir – gut gebaut,
schöne Augen.«
»Farbe?«
»Braun, glaube ich. Ja, irgendwie braun. Man konnte sich
verlieren in seinem Dackelblick.«
»Narben oder Tattoos?«

Orloff schüttelte den Kopf. »Nicht, so weit ich sehen konn-
te. Keiner von beiden hat sich ausgezogen – das waren meis-
tens solche Spannergeschichten. Ich habe gewichst, der Typ hat
zugeguckt, hier hast du den Becher, hier hast du deinen Hut –
und das war’s.«
»Die beiden Kerle waren nicht zusammen?«, fragte Damon.
»Nein, sie hatten nur zufällig den gleichen Spleen. Das ist…
ungewöhnlich, aber es kommt vor.«
Schicken Sie Ihre Frage einfach an Dr. Orloff, und er be
antwortet sie in der nächsten Ausgabe von Bizarre Brieffreunde
aus aller Welt, dachte Brass.
»Fällt Ihnen sonst noch etwas dazu ein, Rudy?«
»Zwei Spermasammler genügen Ihnen nicht?«
Brass stand auf und winkte dem Wärter. Dann sagte er zu
dem Häftling: »Ich kümmere mich sofort darum – Sie kommen
innerhalb von vierundzwanzig Stunden in Einzelhaft. Danke,
Rudy, das waren wertvolle Infos.«
»Danke«, entgegnete Orloff ungerührt. »Sagen Sie mir viel-
leicht, was genau an meinen Äußerungen so wertvoll für Sie
war?«
»Nein.«
Sie saßen bereits wieder im Wagen, da fragte Damon: »Ich
komme einfach nicht dahinter – was hat er denn Nützliches
gesagt?«
Brass ließ den Motor an und fuhr rückwärts aus dem Park-
platz. »Die Beschreibungen, die er von den beiden Kerlen
gegeben hat, passen fast auf jeden.«
»Eben«, sagte Damon ratlos.
»Bei dem Älteren könnte es sich allerdings um Perry Bell
handeln, ohne Toupet.«
»Ohne…?« Damon stutzte. »Verdammt! Ich habe Perry nie
ohne Toupet gesehen – ich hatte ganz vergessen, dass er darun-
ter ‘ne Glatze hat.«

»Ja, und vielleicht verbirgt sich unter dem Toupet auch ein
Mörder. Ich rufe in Vegas an, damit sie ein Foto von Bell
rüberfaxen und man es unserem kleinen Helfer Rudy Orloff
vorlegt. Wenn er Bell erkennt, haben wir unseren Täter…
jedenfalls den Nachahmungstäter.«

6
Catherine Willows und Nick Stokes hatten die ganze Nacht
versucht, Dallas Hanson ausfindig zu machen. Sie hatten sich
von einer ungültigen Adresse zur nächsten gehangelt, bis sie
schließlich am frühen Morgen zu einem Obdachlosenheim in
Nord Las Vegas fuhren.
Nick saß am Steuer des Tahoe, und während sie sich durch
den ersten Berufsverkehr kämpften, bemerkte Catherine: »Ist
schon merkwürdig, oder?«
»Was denn?«, fragte Nick. Er hatte einen Plastikbecher mit
Kaffee in der Hand, denn sie kamen gerade von einem hekti-
schen, ungesunden Fünf-Minuten-Frühstück.
»Wie dieser Job das Alltägliche mit dem Ungewöhnlichen
verbindet.«
»Du bist müde…«
»Nein, im Ernst. Ich meine: Kommt jetzt wieder eine Sack-
gasse wie bei Carlson? Oder steht uns die Konfrontation mit
einem irren Mörder bevor?«
»Ich verstehe, was du meinst«, entgegnete Nick. »Aber ich
muss sagen, ich fand diese Serienkillerkapelle nicht besonders
alltäglich.«
Catherine lachte auf. »Vielleicht habe ich schon zu viel die-
ser Art gesehen.«
Nick nahm einen Schluck Kaffee, ohne die Straße aus den
Augen zu lassen, und wechselte das Thema. »Ist es schwer für
dich? Zu wissen, dass sich deine Tochter jetzt für die Schule
fertig macht und du nicht bei ihr sein kannst?«

»Für einen unverheirateten Kerl mit einem kleinen schwar-
zen Büchlein voller Telefonnummern«, entgegnete sie mit
einem liebevollen Grinsen, »haben Sie wirklich Tiefgang, Mr.
Stokes! Sehr sensibel!«
Er grinste wie Jack Nicholson und imitierte Elvis’ Stimmla-
ge, als er sich für das Kompliment bedankte.
»Die Antwort ist Ja«, sagte Catherine. Sie hatte unterwegs
vom Imbissrestaurant aus noch mit Lindseys Babysitterin
telefoniert. »Irgendwann in nächster Zeit muss ich wohl zur
Tagschicht wechseln.«
Sie fuhren schweigend weiter. »Glaubst du wirklich, wir
finden im Obdachlosenheim einen Serienmörder?«, fragte Nick
etwas später.
»Das passt irgendwie nicht, oder?«
»Wenn die Opfer Landstreicher oder Penner wären, sähe es
anders aus.«
»Wie bei Jack the Ripper«, sagte Catherine. »Oder bei dem
irren Schlachter von Cleveland.«
»Aber die Opfer von CASt sind weiße Männer aus der Mit-
telschicht oder der gehobenen Mittelschicht.«
»Ich weiß, ich weiß. Aber wir überprüfen ihn – wir müssen
einfach jedem Verdacht nachgehen.«
»Ganz deiner Meinung, Cath.«
Sie wussten beide, dass die meisten Serienmörder es vorzo-
gen, in abgelegenen Häusern zu wohnen, um ungestört ihrer
speziellen Tätigkeit nachgehen zu können. Und in einem
Wohnheim der Heilsmission hatte Dallas Hanson so gut wie
null Privatsphäre.
Andererseits war CASt nicht wie die meisten Serienmörder.
Er drang in die Wohnungen seiner Opfer ein. Er nahm keine
Anhalter mit wie Bundy, und lockte auch keine jungen Männer
zu sich nach Hause, wie Gacy es getan hatte. Nur weil Hanson

in einem Heim wohnte, hieß das noch lange nicht, dass er als
Täter nicht in Frage kam.
Eigentlich war es – aus der Sicht eines geisteskranken Tä-
ters – gar keine schlechte Idee, sich bei den namenlosen Un-
glückseligen der Stadt zu verstecken.
Catherine hoffte, dass die anderen inzwischen mit den aktu-
ellen Morden weitergekommen waren. Dieser Fall drohte außer
Kontrolle zu geraten, und Sheriff Rory Atwater – eine noch
ausgebufftere Politbestie als sein Vorgänger Brian Mobley –
würde ihnen pausenlos im Nacken sitzen.
Sie respektierte den neuen Sheriff zwar, aber sie konnte sich
nicht dazu durchringen, ihn zu mögen – das mochte sich viel-
leicht noch ändern, aber sein Stil missfiel ihr ziemlich: Er war
ein noch viel gewiefterer Politiker als Mobley, der seine Bür-
germeisterkandidatur seinerzeit in den Sand gesetzt hatte.
Catherine hatte guten Grund zu glauben, dass der neue Sheriff
nicht zögern würde, das CSI oder Brass und seine Männer als
Sündenböcke zu benutzen, wenn es seinem beruflichen Fort-
kommen diente.
»Meinst du, wir sollten von hier aus gleich zu dem Dritten
im Bunde fahren?«, fragte Nick.
Catherine zuckte mit den Schultern. »Nicht so voreilig! A-
ber wenn Hanson tatsächlich eine Niete ist, können wir uns
überlegen, ob wir Dayton besuchen. Überstunden sind in die-
sem Fall genehmigt. Bist du motiviert?«
»Motiviert ist gar kein Ausdruck.«
»Faszinierend, was eine kleine Tasse Kaffee bei einem
strammen Burschen wie dir bewirken kann.«
Nick grinste nur. »Glaubst du wirklich, wir hätten eine
Chance, diese zehn, elf Jahre alten Morde aufzuklären?«, fragte
er kurz darauf. »Ich meine, CASt kommt immer wieder in
diesen Sendungen über ungelöste Mordfälle vor. Er steht zu-
sammen mit Judge Crater und Jon Benet auf einer Liste.«

Catherine dachte kurz darüber nach. »Ja«, meinte sie dann.
»Ich glaube, wir haben eine echte Chance. Wir sind besser
ausgerüstet als Brass und Champlain es damals waren, als die
Morde geschahen.«
»Ja, und viele alte Fälle werden mit Hilfe der modernen
Technologie gelöst – aber Cath, abgesehen von diesen DNS-
Proben, die Champlain zum Glück aufbewahren ließ, haben wir
nur eine sehr, sehr kalte Spur.«
»Du hast natürlich Recht, Nick, aber andererseits sind wir
auch sehr, sehr gut.«
Nick kicherte. »Ja, das hätte ich fast vergessen…«
Als sie in der Miller Avenue angekommen waren, parkte
Nick den Tahoe vor einem flachen, einstöckigen Gebäude, das
an der Westseite kirchturmartig um eine Etage aufgestockt war.
In dem vorderen flachen Teil war ein großes Fenster, auf dem
in dicken Buchstaben »OBDACHLOSENHEIM DER
HEILSMISSION« stand. An dem aufgestockten Teil prangte
ein Wandgemälde: die idealisierte Darstellung eines betenden
Jesus, die reichlich dilettantisch anmutete und vielleicht von
einem Missionsmitglied gemalt worden war. Dennoch war
Catherine von der Eindringlichkeit des Bildes für einen kurzen
Augenblick gerührt.
Sie gingen durch den Haupteingang und betraten einen
Raum, der aussah wie die Empfangshalle eines herunterge-
kommenen Hotels: Stühle und Sofas vom Sperrmüll und Ti-
sche, auf denen sich Zeitschriften häuften, die so alt waren,
dass sie mit weniger Eselsohren bestimmt Sammlerwert beses-
sen hätten; dazwischen hier und da eine Bibel. Im Stil des Film
noir fiel das Sonnenlicht im schrägen Winkel durch das halb
heruntergelassene Rollo, dessen Lamellen lang gezogene
Schatten warfen. Rechts befand sich ein breiter Treppenauf-
gang aus Holz mit Eichengeländer, der vermutlich das einzig

Rettenswerte war, wenn dieser Schuppen eines Tages abgeris-
sen werden würde.
In einem Sessel saß ein hagerer Mann um die sechzig mit
silbergrauem Haar, dessen Sechs-Tage-Stoppeln fast schon
lang genug für einen Bart waren. Er war in den Sportteil der
Morgenzeitung vertieft und trug ein verwaschenes, möglicher-
weise echtes Star-Wars-T-Shirt und ausgebleichte Jeans. Allem
Anschein nach hatte er ihr Kommen nicht bemerkt. Am Emp-
fangsschalter gegenüber dem Eingang stand eine eher un-
scheinbare junge Frau mit braunem Haar und einer Brille mit
schwarzem Rand. Als Nick und Catherine eintraten, blickte sie
von einer religiösen Zeitschrift auf, in der sie gerade las. Ihr
ovales, ungeschminktes Gesicht war nicht unattraktiv. Sie trug
ein frisch gestärktes, weißes Herrenhemd und eine schwarze
Hose. Das einfache goldene Kreuz an ihrer Halskette sprach
Bände.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte sie freundlich.
Catherine trug auch eine Kette um den Hals und hielt der
Frau den daran befestigten Ausweis hin. »Catherine Willows,
Nick Stokes.«
»Oh«, sagte die Frau. »Vom kriminaltechnischen Labor?
Nun, wir hatten hier seit langer Zeit keine Vergehen mehr. Wir
haben nichts… Unerwünschtes gemeldet.«
»Normalerweise wäre ein Detective zu Ihnen gekommen«,
sagte Catherine. »Aber das Department ist momentan etwas
dünn besetzt, und wir arbeiten an einem wichtigen Fall.«
»Verstehe.« Die Frau faltete wie zum Gebet die Hände auf
dem Tresen. »Nun, die Mission ist natürlich bestrebt, den
Behörden auf jede erdenkliche Weise zu helfen, aber wir res-
pektieren auch die Privatsphäre und Würde unserer Gäste.«
»Wir wollen ja niemanden festnehmen«, erklärte Catherine.
»Wir stellen lediglich Nachforschungen zu einem alten Fall an,
der vielleicht in Zusammenhang mit einem aktuellen steht.«

Nick zuckte mit den Schultern und schenkte der jungen Frau
ein freundliches Lächeln. »Wir möchten nur mit einem Ihrer
Gäste reden. Ein paar Auskünfte einholen.«
Diplomatie und Charme – mit vereinten Kräften gelang es
den beiden, die Frau zu überzeugen.
»Mit wem möchten Sie denn sprechen?«
»Mit Dallas Hanson«, antwortete Catherine.
Die Frau schaute zu dem Sessel, in dem der alte Herr mit
der Zeitung gesessen hatte, aber als Catherine sich umdrehte,
war er verschwunden.
»Wo ist Obi-Wan Kenobi denn hin?«, fragte sie Nick.
Er zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung – wir haben
ihm den Rücken zugekehrt. Vielleicht hat er sich rausge-
beamt.«
»Da verwechselst du was«, sagte Catherine und drehte sich
wieder zu der Frau um. »War das Dallas Hanson?«
»Unsere Gäste…«
»Ich weiß schon, Privatsphäre und Würde. Aber wir ermit-
teln in einem Mordfall. War er das nun oder nicht?«
Die Frau atmete tief durch und versuchte, sich als Respekts-
person zu behaupten, aber innerhalb von drei Sekunden knickte
sie unter Catherines durchdringendem Blick ein. »Nein. Nein,
das war er nicht.«
Die beiden Spurenermittler entfernten sich vom Empfang.
»Geh du nach draußen«, sagte Catherine zu Nick und wies
zur Tür. »Wenn Obi-Wan jemanden warnen wollte, macht
derjenige vielleicht einen überstürzten Abgang aus dem Fens-
ter.«
»Was ist mit der Treppe?«
»Die nehme ich.«
Nicks Miene verriet, dass ihm dieser Plan nicht schmeckte,
aber Catherine war seine Vorgesetzte, und so verschwand er
nach draußen.

Catherine stürzte die Treppe hoch und nahm je zwei Stufen
auf einmal, bis sie im zweiten Stock ankam. Sie spähte um die
Ecke.
Nichts.
Nichts außer einer offenen Tür auf der linken Seite des Kor-
ridors. Die Zimmer auf dieser Seite gingen vermutlich auf den
Hinterhof hinaus, und Catherine hoffte, dass Nick inzwischen
auf der Rückseite des Gebäudes angekommen war. Für einen
allein war es ziemlich schwierig, ein Haus von allen vier Seiten
gleichzeitig zu bewachen…
Instinktiv legte sie die Hand auf ihr Pistolenholster und ging
den Flur hinunter. Der stechende Geruch von Desinfektions-
mittel brannte ihr in der Nase.
Als sie die geöffnete Tür erreichte, streckte sie den Kopf
hinein und sah, wie der grauhaarige Mann aus der Eingangshal-
le sich über ein Bett beugte, das links an der Wand stand und in
dem ein Mann lag. Am Fenster standen ein kleiner zer-
schrammter Holztisch und zwei Küchenstühle, an der Wand
rechts befand sich eine niedrige Kommode.
Catherine hörte, wie der Grauhaarige den Mann im Bett fra-
ge: »Bist du sicher, dass du das willst, Dal?«
Der bettlägerige Mann nickte anscheinend, denn der Grau-
haarige zuckte mit den Schultern. »Wie du willst, Kumpel.«
Als er einen Schritt zurücktrat, konnte Catherine den Mann
in dem Bett zum ersten Mal sehen. Er sah aus wie eine ausge-
mergelte Vogelscheuche und hatte fast genauso graue Haare
wie sein Freund. Allerdings schien er sich kürzlich noch rasiert
zu haben, vielleicht sogar erst am Vortag. Aber seine Haut war
so grau wie sein Haar, und seine Augen flehten förmlich um
Gnade – um Gottes Gnade.
»Dallas Hanson?«, fragte Catherine.
Der Mann in dem Bett nickte angestrengt.
»Ich würde gern mit Ihnen reden.«

Seine Wangen waren eingefallen und er hatte eine hervor-
stehende Stirn, durch die sein schmales Gesicht aussah wie ein
kantiges, verzogenes Metallgestell, das mit sehr dünner Haut
bespannt war.
»So eine hübsche Frau wie Sie?«, sagte Hanson freundlich
und mit überraschend tiefer Stimme. »Warum nicht. Ich be-
komme nicht viel Besuch von Ihrem… Kaliber.«
Unter der weißen Decke wirkte er sehr klein und knochig.
Catherine zog ihr Funkgerät aus der Tasche und drückte ei-
nen Knopf. »Nick, unser Mann ist nicht weg. Wir sind in…«
Sie schaute zur Tür, auf deren Plastikschild »218« stand. Ca-
therine gab Nick die Nummer durch, und er machte sich sofort
auf den Weg.
Dann blickte sie den grauhaarigen Mann mit dem Star-
Wars-T-Shirt an, der einen verlegenen Eindruck machte. »Sie
wollten Ihrem Freund wohl helfen, durch die Hintertür zu
verschwinden, hm?«
»Es ist ja wohl nicht verboten, bei einem Kumpel vorbeizu-
schauen«, entgegnete der alte Mann mit zitternder Stimme.
»Oder ist bei uns schon der Faschismus eingekehrt?«
»Wir ermitteln in einem Mordfall. Halten Sie es wirklich für
eine gute Idee, uns bei der Arbeit zu behindern?«
Er gab keine Antwort, schlug die Augen nieder und ging mit
gesenktem Kopf zur Tür.
»Ihretwegen hätten viele Leute verletzt werden können«,
bemerkte Catherine, als er an ihr vorbeiging.
Der Mann blieb stehen und sah sie mit seinen blutunterlau-
fenen, wässrigen Augen an. »Verletzungen haben sich die
Leute hier schon vor langer Zeit zugezogen. Sie haben eine
Marke und wirklich hübsche Klamotten, Lady. Wir haben
uns.«
Catherine wollte etwas erwidern, aber dann dachte sie daran,
was die Frau am Empfang über Privatsphäre und Würde der

»Gäste« gesagt hatte, und schwieg. Der alte Mann verließ mit
gebeugtem Haupt den Raum.
»Nehmen Sie es Bruce nicht übel«, sagte Hanson. Er stützte
sich mühsam auf die Ellbogen und zeigte lächelnd seine gelben
Zähne. »Die meisten von uns hatten schon mal Ärger mit der
Polizei – wir passen sozusagen aufeinander auf.«
»Ich verstehe.«
»Wirklich?«
»Ja, wirklich. Möchten Sie sich hinsetzen?«
»Das würde ich sehr gern.« Er warf die Decke zurück, und
Catherines Blick fiel auf seine Beine, die wie geschwärzte
Zahnstocher aussahen. »Aber der Krebs macht es mir so gut
wie unmöglich, wenn mir nicht jemand hilft.«
Sie half ihm beim Aufsitzen, und in diesem Moment kam
Nick auch schon ins Zimmer.
»Das ist mein Partner«, sagte Catherine und zeigte Hanson
ihren Ausweis. »Catherine, Nick. Wir sind vom kriminaltech-
nischen Labor. Wir möchten gern mit Ihnen reden, über…«
»CASt«, warf Hanson ein.
Nick stemmte überrascht die Hände in die Hüften. »Sie wis-
sen davon?«
»Der Krebs frisst meinen Körper auf, nicht mein Gehirn. Ich
kann immer noch Zeitung lesen, und wir haben mehrere Fern-
seher in diesem Jesusladen. Und nachdem irgendjemand den
alten CASt wieder hat aufleben lassen, habe ich mir schon
gedacht, dass die Bullen bald wieder auftauchen und rum-
schnüffeln.«
»Wann haben Sie das letzte Mal Ihr Bett verlassen?«, fragte
Catherine.
»Abgesehen von Mahlzeiten und Toilettengang? Ich glaube,
bei meiner letzten Chemotherapie. Das muss vor ungefähr drei
Wochen gewesen sein.«
»Wie kommen Sie zur Chemo?«

»Lori, das Mädchen vom Empfang, hat mich hingebracht.
Wissen Sie, ich kann seit sechs Monaten nichts mehr allein
machen, und wenn ich Glück habe – oder Pech –, dann habe
ich noch mal sechs vor mir. Ich habe weder die Zeit noch die
Energie für so ein anstrengendes Hobby wie Morden.«
Catherine nickte. »Und vor elf Jahren?«
Hanson schüttelte den Kopf. »Ich war damals unschuldig,
und ich bin es heute. Dieser Cop, Champlain, der hatte es auf
mich abgesehen. Er hatte nichts in der Hand außer ein paar
Indizien. Ich habe Todd Henry nicht umgebracht, und die
anderen auch nicht. Der Bulle war ein scharfer Hund. Er muss-
te irgendjemanden festnageln, wahrscheinlich hat er Druck von
oben gekriegt. Und da hat er gedacht, er probiert es mit mir.«
»Mr. Hanson«, sagte Nick. »Wenn Sie Zeitung lesen, wissen
Sie, dass man spekuliert, die neuen CASt-Morde seien mögli-
cherweise das Werk eines Nachahmungstäters.«
»Ach, dann stehe ich wegen der alten Fälle also immer noch
unter Verdacht? Was für ein Schwachsinn!«
Catherine hielt ein Wattestäbchen hoch. »Wie würde es Ih-
nen gefallen, wenn Sie sich von diesem Verdacht befreien
könnten?«, fragte sie.
Hanson sah das Wattestäbchen skeptisch an. »Wie denn?«
»DNS.«
»Wollen Sie mich ent- oder belasten?«, fragte Hanson mit
einem Anflug von Sarkasmus in der Stimme.
Catherine sah ihm in die Augen. »Ich will nur die Wahrheit
herausfinden.«
»Ich weiß nicht…«
»Darf ich Sie freundlich darauf hinweisen, Sir«, sagte Nick,
»dass Sie es angesichts Ihrer Krankheit vielleicht in Erwägung
ziehen sollten zu kooperieren.«
»Warum denn das?«

Nick zuckte mit den Schultern. »Wie Sie im Moment daste-
hen, wird die Nachwelt Sie als mutmaßlichen berüchtigten
Serienmörder in Erinnerung behalten. Sie können sich von
diesem Makel befreien, und dann haben Sie eine weiße Wes-
te.«
Hanson seufzte. »Hm, das ist natürlich ein Argument, Mann.
Ich habe irgendwo da draußen ein paar Kinder, vielleicht sogar
Enkelkinder. Es passt mir natürlich nicht, dass meine Nachfah-
ren mich für einen irren Mörder halten. Okay, gekauft – was
muss ich tun?«
»Öffnen Sie den Mund«, entgegnete Catherine. »Sie müssen
nicht mal ›Aaah‹ machen…«
Gil Grissom saß immer noch an seinem Schreibtisch, als sein
Handy klingelte. Er griff danach und drückte auf die Ge-
sprächstaste. »Grissom.«
»Ich bin’s«, sagte Brass.
»Wo?«
»Auf dem Rückweg.«
Grissom hörte Motorenlärm im Hintergrund. Die Sirene war
nicht eingeschaltet, aber Brass fuhr eindeutig einen heißen
Reifen. »Irgendwas erfahren?«
»Gut möglich, dass Perry Bell unser Trittbrettfahrer ist.«
»Und warum?«
Brass legte ihm seine Theorie dar. Es dauerte eine Weile, bis
er das Gespräch mit Orloff zusammengefasst hatte.
»Das klingt alles sehr gut«, sagte Grissom. »Aber wo ist der
Beweis?«
»Ich dachte, es sei Ihr Job, Beweise zu finden!«, entgegnete
Brass etwas gereizt.
»Nein, das ist Ihrer. Ich untersuche die Beweise.«
»… Sorry.«

»Kein Problem. Dafür habe ich vorhin mit Bells Tochter ge-
sprochen.«
»Gut! Sehen Sie, Sie finden doch Beweise!«
»Wenn Sie so wollen. Aber ich habe auf alle Fälle Informa-
tionen.«
Grissom erzählte Brass, was Patty Lang ihm gesagt hatte.
»Haben wir genug für einen Durchsuchungsbefehl?«, fragte
der Captain.
»Dafür reicht es noch nicht. Aber ich versuche, Bell aufzu-
treiben, bis Sie wieder hier sind.«
»Danke! Gott segne Sie!«
»Ich höre auch mal nach, wie weit die anderen sind. Warrick
und Sara untersuchen gerade diesen Brief an den Banner,
Catherine und Nick machen Jagd auf die Verdächtigen von
damals. Bis Sie zurück sind, haben wir vielleicht genug für
einen Durchsuchungsbefehl zusammen.«
Grissom verbrachte die nächsten zwei Stunden mit der Su-
che nach Perry Bell. Er rief die Freunde und Mitarbeiter des
Reporters an, gab eine Fahndung nach seinem Auto heraus und
beorderte einen Streifenwagen zu seinem Haus. Der Polizist,
der diesen Auftrag bekam, traf niemanden an, obwohl er es
auch an der Hintertür probierte, und meldete, dass alle Vorhän-
ge zugezogen waren und Bells Wagen nicht in der Garage
stand. Grissom gab ihm die Anordnung, sich bis auf weiteres
vor dem Haus zu postieren.
Da kein hinreichender Tatverdacht bestand, konnten sie
nicht gewaltsam in das Haus eindringen. Wenn Bell drinnen
war, mussten sie ihn fassen, wenn er herauskam. Und falls er
tatsächlich der Täter war, stand nicht zu befürchten, dass er
sich mit einem Opfer im Haus aufhielt. Der Trittbrettfahrer
hatte zwei Mal zugeschlagen, aber wie der Original-CASt
immer nur in den Wohnungen der Opfer.

Wenn Bell unterwegs war, dann hatten sie allerdings
schlechte Karten. Der Reporter konnte überall sein, und wenn
sie nicht zufällig einen heißen Tipp bekamen, würden sie nicht
erfahren, was Bell im Schilde führte, bis… tja, bis sie schluss-
endlich an den nächsten Tatort gerufen wurden.
Grissom fiel noch eine dritte, beunruhigende Variante ein:
Bell war möglicherweise unschuldig. Der Kriminalkolumnist
arbeitete unter Umständen tatsächlich an einer großen Ge-
schichte, wie er seiner Tochter gesagt hatte, und diese Ge-
schichte musste nicht unbedingt mit dem CASt-Fall zu tun
haben. Aber falls es zutraf, wo war der Reporter dann? Warum
war er nirgends aufzufinden?
Nachdem er alles erledigt hatte, was er vom Schreibtisch aus
tun konnte, verließ Grissom sein Büro und suchte als Erstes die
Gerichtsmedizin auf, wo Dr. Robbins gerade die Autopsie an
Enrique Diaz beendete.
»Zwei Tage musste Diaz warten?«, fragte Grissom mit ei-
nem leicht verblüfften Gesichtsausdruck.
Der Coroner warf ihm einen genervten Blick zu und arbeite-
te weiter. »Ich weiß, dass Sie nur diesen Serienkiller im Kopf
haben, aber in den zwei Tagen haben in dieser Stadt abgesehen
von Mr. Diaz fast zwei Dutzend Menschen ihr Leben unter
verdächtigen Umständen gelassen!«
Der CSI-Mann hatte Robbins gar nicht angreifen wollen.
Dass der Doktor seine Frage in den falschen Hals bekommen
hatte, lag wohl an Grissoms Art, mit Leuten umzugehen – für
die er ständig von allen kritisiert wurde.
»Haben Sie etwas gefunden?«, fragte er.
»Vorläufig kann ich nur sagen, dass Diaz mit der Schlinge,
die Sie an seinem Hals gefunden haben, erdrosselt wurde. Alles
andere ist wie bei dem Mord an Sandred… außer, dass es
diesmal keine durch Teppich verursachten Verbrennungen gab.
Ansonsten alles identisch.«
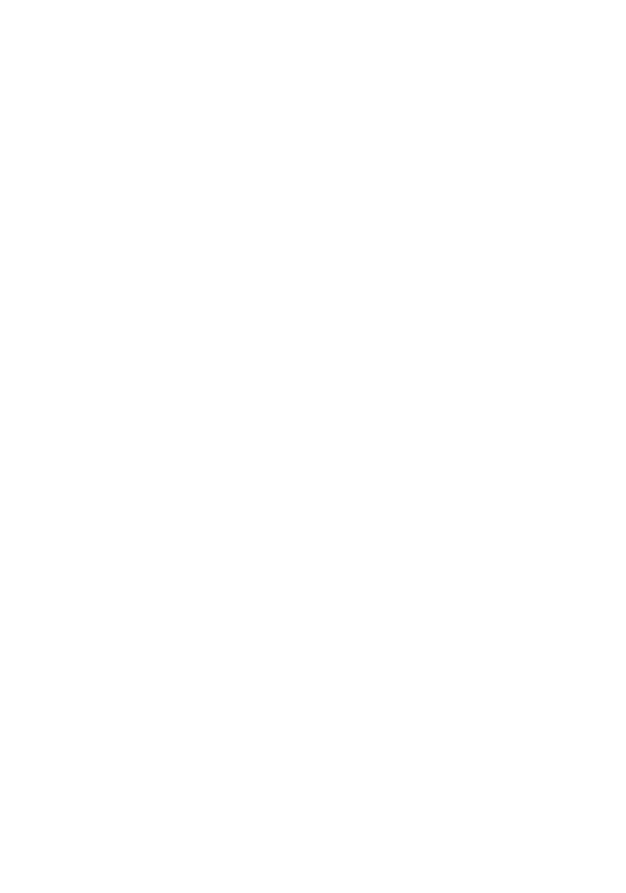
»Gar nichts Neues?«
Robbins reichte ihm einen kleinen Umschlag. »Das hier ha-
be ich gefunden.«
Grissom nahm den Umschlag und machte ihn vorsichtig auf.
Er sah dunkle Fasern oder Haare. »Und was ist das?«, fragte er
und verschloss den Umschlag wieder.
»Künstliche Haare… Mein Tipp? Sie sind von einem
schlechten Haarteil.«
»Inwiefern schlecht?«
»Billig… aber dazu kann Ihnen Greg mehr sagen als ich.«
Grissom horchte auf. »Stammen sie von dem Mörder?«
»Vielleicht«, entgegnete Robbins.
»Haben Sie Zweifel?«
Der Coroner zuckte mit den Schultern. »Eher ein ungutes
Gefühl.«
»Nach Locard gibt es keinen sauberen Kontakt zwischen
zwei Objekten oder Körpern. Es gibt immer einen Austausch
von Spuren.«
Robbins trat von der Leiche zurück und sah sich um, als sei
er nicht sicher, ob er und Grissom wirklich allein waren –
vielleicht waren ja ein, zwei Leichen im Raum, die nur simu-
lierten.
»Gil, Sie und ich, wir kennen Perry Bell. Er ist in Ordnung,
wahrscheinlich der ehrlichste, hilfsbereiteste Mann bei den
Medien, was unsere Arbeit angeht. Ganz bestimmt harmlos.«
»Das ist kein Argument.«
»Durch die künstlichen Haare wird der Verdacht auf ihn ge-
lenkt.«
»Ja. Wir ermitteln ohnehin schon in diese Richtung, Al.«
Robbins schüttelte den Kopf. »Einen Serienmörder nachah-
men, um seine Karriere wieder anzukurbeln? Dazu wären ein
genialer Geist und die Weltanschauung eines Soziopathen

nötig. Gil, mal ehrlich – finden Sie, das klingt nach Perry
Bell?«
»Nein, das tut es nicht. Aber ich bin immer noch ein Student
der Psychologie und kein Experte. Und im Augenblick zählt
für mich nur, ob die Beweise auf Perry Bell hindeuten. Und das
tun sie. Und mein nächstes Anliegen ist, dafür zu sorgen, dass
niemand in Gefahr gerät.«
Robbins legte Grissom eine Hand auf den Arm. »Ich verste-
he. Aber hören Sie bei dieser Sache nicht auf Ihren Kopf. Sie
haben ein gutes Herz, Gil. Haben Sie keine Angst, auch darauf
zu hören.«
»Das… haben Sie nett gesagt, Al. Aber ich höre nur auf die
Beweise.«
»Nein, Sie interpretieren sie. Und bei inszenierten Verbre-
chen sind die Beweise ebenso verdächtig wie die Verdächti-
gen.«
Grissom dachte kurz darüber nach. »Ob ich auf mein Herz
hören werde, weiß ich nicht, Doc, aber ich werde niemals den
Fehler machen, nicht auf Sie zu hören.«
Die beiden Männer lächelten sich an, dann verließ Grissom
den Raum.
Die Indizienbeweise gegen Perry Bell mehrten sich von Se-
kunde zu Sekunde, und Grissom glaubte, dass er nun genug in
der Hand hatte, um bei einem Richter einen Durchsuchungsbe-
fehl zu erwirken. Obwohl er Bell nicht direkt mit den Morden
in Verbindung bringen konnte, deutete alles, was er hatte, auf
den Journalisten hin: künstliche Haare, die möglicherweise mit
Bells Toupet übereinstimmten, die Schlüsselkarte für das Ban-
ner-Büro und das Sperma, das von einem »Sammler« kam,
dessen Beschreibung auf Bell passte. Wenn man hinzunahm,
dass der Reporter vor dem zweiten Mord verschwunden war
und niemand – weder Freunde noch Kollegen, noch seine

Tochter – wusste, wo er steckte, und er obendrein kein Alibi
für den ersten Mord hatte, waren in der Tat alle Voraussetzun-
gen für einen Durchsuchungsbefehl erfüllt.
Einzeln betrachtet waren diese Dinge zwar keine zwingen-
den Beweise, aber in ihrer Gesamtheit fügten sich die Puzzle-
teile zu einem Bild zusammen, das bislang verdammt nach
Perry Bell aussah.
Richter Goshen war wie immer sehr beschäftigt. Und wie
immer wollte er nach allen Regeln der Kunst überzeugt wer-
den, bevor er den Durchsuchungsbefehl herausrückte. Das
Gute an einer Anordnung von ihm war, dass sie auch einer
genaueren Überprüfung standhielt, falls der Fall vor Gericht
kam – das Schlechte daran war, dass man den Fall verhandeln
musste, als wäre er bereits vor Gericht…
Außerdem war Bell im ganzen Strafrechtssystem bekannt
und beliebt, und auch Richter Goshen schätzte ihn sehr. Letzt-
lich setzte Grissom sich jedoch durch, obwohl es ganze zwei
Stunden dauerte, bis er das Amtszimmer des Richters mit dem
kostbaren Papier verlassen konnte.
Kaum war er draußen, rief er Brass auf seinem Handy an.
»Sind Sie bald da?«
»Ja. Was gibt’s?«
Grissom setzte Brass ins Bild, und die beiden verabredeten,
sich eine halbe Stunde später vor Bells Haus zu treffen. Der
CSI-Leiter wollte Warrick und Sara mitnehmen, und deshalb
fuhr er vom Gericht zurück zum Labor, wo die beiden an dem
CASt-Brief arbeiteten. Sara saß am Tisch und untersuchte die
Schachtel, während Warrick sich mit dem mumifizierten Fin-
ger beschäftigte. Grissom wandte sich zuerst an ihn. »Irgend-
welche Hinweise?«
Grinsend hielt dieser die rechte Hand hoch. »Er zeigt in jede
beliebige Richtung…«, meinte er. Warrick hatte sich die Haut
des abgeschnittenen Fingers über seinen latexgeschützten

Zeigefinger gestülpt. »Ich habe die Haut rehydriert, so gut es
ging, dann habe ich sie abgezogen und mir übergestreift.«
»Und bestimmt einen schönen, sauberen Abdruck hinge-
kriegt.«
»Oh ja. Der Finger stammt von Vincent Drake, dem letzten
Opfer von damals.«
Grissom spürte, wie sich sein Magen zusammenzog. »Also
ist die Botschaft wirklich von CASt.«
»Man kann es kaum anders interpretieren.«
»Der Original-Killer ist also immer noch irgendwo da drau-
ßen. Und das bedeutet, wir müssen ihn finden, bevor der Nach-
ahmer ihn dazu anstachelt, mit ihm zu wetteifern. Bleib dran
und ruf mich an, wenn du noch etwas findest.«
Warrick nickte.
Grissom ging zu Sara, die ohne Aufforderung loslegte. »Es
handelt sich um eine ganz normale weiße Schachtel, wie man
sie in jeder Drogerie, in jedem Geschenkladen und einem
halben Dutzend anderer Läden in jedem Einkaufszentrum
kaufen kann. Das Gleiche gilt für das Band – ganz normales
Rot, überall erhältlich. Der Umschlag ist auch nichts Besonde-
res, aber er wird gerade noch auf Fingerabdrücke untersucht.«
»Was ist mit der Watte?«
»Daran arbeite ich noch.«
Grissom nickte. »Sara, leg das erst mal auf Eis und schnapp
dir deinen Koffer – ich brauche dich.«
Sie lächelte ihn erfreut an, denn sie mochte zwar das Labor,
aber der Außendienst war ihre wahre Leidenschaft. »Wo geht’s
denn hin?«
»Wir haben einen Durchsuchungsbefehl für Perry Bells
Haus.«
Saras Lächeln schwand. »Ich hatte fast gehofft, wir lägen
mit ihm falsch. Irgendwie mag ich den Kerl. Er tut mir Leid.«

»Wenn er unser Killer ist«, entgegnete Grissom, »dann heb
dir dein Mitgefühl für die Opfer auf.«
Bell hatte ein hübsches zweistöckiges Häuschen am Beacon
Point, nicht weit von der Gilmore Road und gleich in der Nähe
des El Capitan Way. Ein paar Blocks weiter südlich war der
Durango-Hills-Golfplatz, auf dem er häufig anzutreffen war. Er
hatte das Haus behalten, als seine Frau nach der Scheidung
nach Los Angeles gezogen war, und es war sehr gut in Schuss.
Der Vorgarten war ganz nach der Devise des Wassersparkon-
zepts Xeriscape mit speziellen Wüstenpflanzen verschönert
worden, die die Trockenheit wesentlich besser vertrugen als
Gras und mittlerweile in vielen Mittelklassevierteln von Las
Vegas die Rasenflächen ersetzten.
Vor dem Haus stand ein Streifenwagen und der uniformierte
Polizeibeamte lehnte mit dem Rücken zum Haus am Kotflügel
und rauchte eine Zigarette. Als der Tahoe hinter ihm anhielt,
warf er den Stummel rasch hin, trat ihn aus und kam an das
Fahrerfenster.
»Hier hat sich nichts gerührt«, meldete er.
Grissom kannte Carl Carrack von vielen Einsätzen und
wusste, dass er ein guter Streifenpolizist und genauer Beobach-
ter war. Carrack war um die fünfunddreißig, knapp einsachtzig
groß und die hundert Kilo, die er auf die Waage brachte, waren
gut auf seinen kompakten Körper verteilt.
»War irgendjemand hier?«, fragte Grissom.
»Keine Nachbarn, keine Vertreter, nicht mal der Zeitungs-
junge.«
Grissom und Sara luden noch ihre Ausrüstung aus, als
Brass’ Taurus hinter ihnen anhielt.
Brass und Damon stiegen aus, und der Captain warf einen
Blick auf das Haus. »Ist Bell zu Hause?«

»Anscheinend nicht. Carrack ist seit zwei Stunden hier, und
es hat sich nichts gerührt.«
»Und er ist nirgendwo aufgetaucht?«
Grissom schüttelte den Kopf. »Ich habe leider nichts Neues
gehört.«
»Was ist bei der Fahndung nach seinem Wagen herausge-
kommen?«, fragte Damon.
»Noch nichts«, entgegnete Grissom. »Vielleicht hat er sich
zum Schreiben in sein Haus verkrochen, oder er ist irgendwo
auf Sauftour oder… oder… Warum hören wir nicht auf zu
spekulieren und gehen einfach rein?«
Der Eingang befand sich an der Seite des Hauses und war
durch eine Doppelgarage vor den Blicken der Nachbarn ge-
schützt. Vor der Tür streifte Grissom Latexhandschuhe über,
Sara ebenfalls. Die Cops nicht.
Brass baute sich neben Grissom auf, hinter ihnen standen
Damon und Carrack, und Sara bildete die Nachhut. Dann
klopfte Grissom an die grüne Tür.
»Wie wäre es mit Klingeln?«, fragte Damon.
Grissom schüttelte den Kopf. »Nein, dabei könnten Finge-
rabdrücke draufgehen.«
Der Detective runzelte die Stirn. »Wieso? Ist das denn ein
Tatort?«
»Wissen wir, dass es keiner ist?«
Darauf hatte Damon keine Antwort. Und auf Grissoms
Klopfen reagierte niemand.
Er klopfte erneut, diesmal fester, und stellte dann mit einem
Griff an den Knauf fest, dass die Tür abgeschlossen war –
keine wirkliche Überraschung.
Sie warteten kurz, dann rückten Carrack und Grissom dem
Eingang mit einer Ramme zu Leibe. Das Schloss barst, der
Rahmen splitterte und die demolierte Tür flog auf.

Vom Flur aus ging es rechts in das Wohnzimmer, zur Lin-
ken befand sich eine Treppe. Geradeaus sah Grissom direkt die
Küche.
Brass trat als Erster ein, aber er kam nicht sehr weit. Er zeig-
te auf einen dunklen Fleck auf dem Boden. »Blut! Alles stehen
bleiben!«, rief er.
Es war dunkel im Haus, und Grissom holte seine Taschen-
lampe heraus und leuchtete auf den Boden: Tatsächlich, ein
kleiner Tropfen geronnenes Blut auf den Dielen!
»Sehr gut, Jim! Sieht trocken aus.«
Brass zog mit der rechten Hand seine Pistole und schaltete
mit der linken jetzt auch eine kleine Taschenlampe ein. »Wie
immer – wir checken das Haus, bevor Sie reinkönnen.«
»Aber es ist niemand rein- oder rausgegangen, Captain«, be-
tonte Carrack noch einmal. »Ich schwöre!«
»Checken wir erst mal das Haus«, sagte Brass zu dem Strei-
fenpolizisten und zog seine Pistole. »Hinterher haben Sie noch
genug Zeit, sich rauszureden…«
Damon und Carrack zogen ebenfalls ihre Waffen, dann gin-
gen sie die Treppe hoch und nahmen sich den oberen Stock
vor.
Grissom und Sara betraten zögernd das Haus.
»Stehen bleiben!«, rief Brass ihnen zu, dann verschwand er
im Wohnzimmer, um das Erdgeschoss zu prüfen.
Grissom kniete sich hin und betrachtete den Blutfleck im
Schein seiner Taschenlampe.
»Das Blut ist in der Tat getrocknet«, sagte er.
»Was immer hier passiert ist, es ist schon eine Weile her,
oder?«, meinte Sara.
Von oben waren die Stimmen von Carrack und Damon zu
hören. Die Männer gingen von Raum zu Raum, und ein Wort
flog hin und her wie ein Tennisball:
»Sauber!«

»Sauber!«
»Sauber!«
»Sauber!«
Brass kam aus der Küche. »Vom Wohnzimmer geht es ins
Esszimmer, dann nach links in die Küche – alles sauber.«
Vom oberen Ende der Treppe meldete Damon ebenfalls:
»Alles sauber!«
Grissom ließ den Lichtstrahl seiner Taschenlampe über den
Boden Richtung Küche wandern. Er fand einen weiteren Blut-
fleck, dann noch einen, und so weiter. Die Spur – nicht aus
Brotkrumen wie bei Hänsel und Gretel, sondern aus Blut –
führte in die Küche und von dort nach links zu einer Tür.
»Was ist hinter der Tür?«, fragte Grissom.
»Sie ist verschlossen«, entgegnete Brass. »Wahrscheinlich
kommt man von hier in eine Art Wirtschaftsraum und die
Garage.«
»Sehen wir nach!«
Brass war nicht sehr angetan von diesem Vorschlag. »Viel-
leicht sollte ich erst mal mit einem bewaffneten Officer vorge-
hen…«
»Ist schon in Ordnung«, sagte Grissom.
»Unter einer Bedingung«, willigte Brass ein.
Grissom wusste, was die Bedingung war: Er nahm seine Ta-
schenlampe in die linke Hand und zog seine Pistole. Sara folgte
seinem Beispiel.
Rechts von der Küche war hinter einem offenen Durchgang
das Esszimmer zu sehen. Grissom wandte sich nach links und
öffnete die Tür zu einem kleinen Raum, in dem an der gegenü-
berliegenden Wand zwischen zwei Türen eine Waschmaschine,
ein Trockner und ein kleiner Tisch zum Wäschelegen standen.
Grissom vermutete, dass die zweite Tür in die Garage führ-
te.

Da Carrack zuvor schon durch das Garagenfenster geschaut
hatte, konnten sie relativ sicher sein, dass sich dort niemand
aufhielt. Die Blutspur endete vor der ersten Tür zu Grissoms
Linken.
Er zögerte, bevor er die Tür öffnete.
Ihm ging es immer in erster Linie darum, beim Betreten ei-
nes Raumes keine Beweisspuren zu zerstören, aber darauf
durfte er in diesem Moment keine Rücksicht nehmen, denn es
befand sich möglicherweise jemand hinter dieser Tür, der
vielleicht noch am Leben war.
Vergiss die Abdrücke!, dachte Grissom, legte seine latexge-
schützte Hand auf die Klinke und öffnete die Tür. Er sah eine
Holztreppe mit einem Geländer an der rechten Seite, die nach
unten führte. Ohne zu zögern drückte Grissom auf einen Schal-
ter an der Wand, und das Licht ging an.
»Verdammt, Gil«, rief Brass von hinten. »Da hat noch kei-
ner nachgesehen!«
Grissom drehte sich zu Sara um. »Bleib erst mal hier!«
Dann ging er, die Warnung des Captains ignorierend, mit der
Pistole in der einen und der Taschenlampe in der anderen Hand
die Treppe hinunter.
Es gab nur wenige Häuser in Las Vegas, die einen Keller
hatten, und der CSI-Leiter war überrascht, dass Bells Haus zu
diesen Ausnahmen zählte. Als er langsam und vorsichtig die
knarrenden Stufen hinunterstieg, entdeckte er noch mehr Blut –
mehr als nur kleine Tropfen –, und auf dem Boden links vor
der Treppe war eine kleine Pfütze zu sehen.
Grissom achtete darauf, nicht in das Blut zu treten, und als
er im Keller ankam, fand er eine noch größere Lache, die sich
vor der Nische unter der Treppe gebildet hatte. Es sah fast so
aus, als blutete die Erde.
Aber die rote, gerinnende Flüssigkeit hatte einen ganz ande-
ren Ursprung.
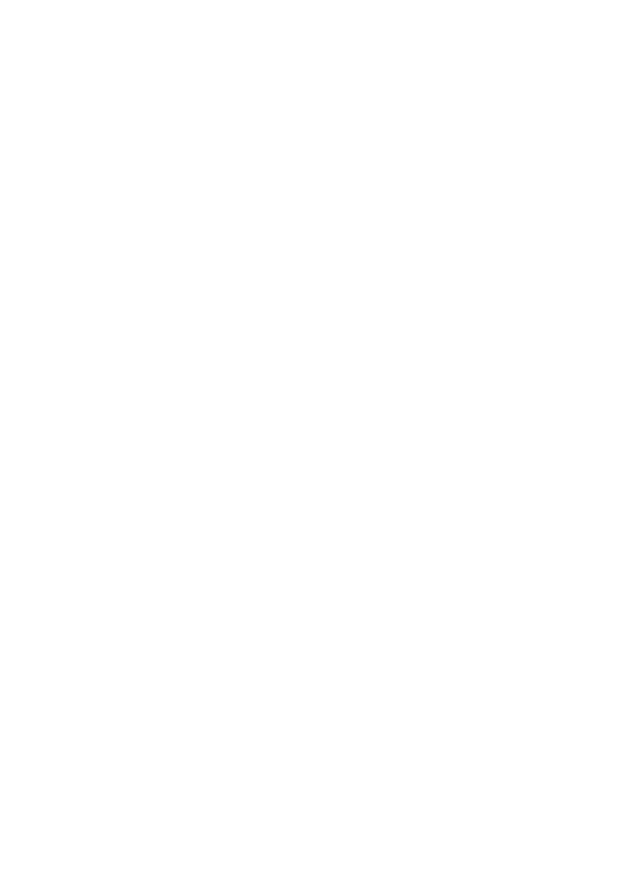
Gil Grissom leuchtete mit der Taschenlampe in die Ecke –
und strich Perry Bell von der Verdächtigenliste.

7
Nachdem er Officer Carrack und Detective Damon im Erdge-
schoss postiert hatte, kam Jim Brass in den Keller. Sein sechs-
ter, in fünfundzwanzig Dienstjahren geschärfter Polizistensinn
verriet ihm nichts Gutes, und er bemühte sich wie Grissom,
keine Beweisspuren zu zerstören. Sein Radar registrierte keine
Gefahr; er verspürte vielmehr ein Kribbeln, das ihm verriet,
dass etwas nicht in Ordnung war. Zwar hielt er die Pistole in
der Hand, aber er ahnte, dass er keinen Gebrauch von ihr ma-
chen würde, denn das, was nicht in Ordnung war, war bereits
geschehen.
Und aufgrund der ritualisierten Vorgehensweise des Täters,
mit dem sie es bei diesem Fall zu tun hatten, ahnte er, noch
bevor er das Ende der Treppe erreichte, was ihn erwartete.
Unten angekommen, leuchtete er in die Nische unter der
Treppe. Der Lichtstrahl fiel auf eine große Blutlache, dann
wanderte er zu dem abgeschnittenen rechten Zeigefinger und
von dort über den fülligen, nackten, toten Körper. Als Nächstes
erfasste er das Gesicht von Perry Bell.
In diesem Moment erkannte Brass, dass er sich getäuscht
hatte. Er hatte gedacht, er wisse ganz genau, wie der Tatort
aussehen würde, denn die Morde an Sandred und Diaz waren
sorgfältig inszeniert gewesen. Der Anblick der Leiche versetzte
Brass jedoch regelrecht einen Schock.
Es bestand kein Zweifel: Der echte CASt war zurück!
Der Mund des Reporters war mit Lippenstift beschmiert, der
sich mit dem Blut vermischt hatte, das ihm aus der gebroche-

nen Nase gelaufen und inzwischen getrocknet war. Bell war
fast bis zur Unkenntlichkeit verprügelt worden und hatte ein-
deutig mehr gelitten als alle anderen Opfer von CASt oder dem
CASt-Nachahmer. Auf seinem Rücken befanden sich Sper-
maflecken, und anders als bei den Amputationen, die der
Nachahmer durchgeführt hatte, war hier das Blut im ganzen
Keller verspritzt.
»Gott-ver-dammt!«, platzte es Brass heraus. Er hätte vor
Wut fast seine Taschenlampe in die Ecke geknallt, hielt jedoch
im letzten Moment inne, schaltete sie aus und steckte sie in die
Tasche.
»Ich habe die Tatorte damals ja nicht untersucht, Jim«, sagte
Grissom ruhig. »Aber hier war wohl das Original am Werk.«
Brass schüttelte schwer atmend den Kopf und stieß noch ein
paar Flüche aus. »Wenigstens wissen wir jetzt, dass er immer
noch da draußen ist«, sagte er dann. »Und zwar in unserem
Zuständigkeitsbereich. Er ist weder weggezogen noch überfah-
ren worden, noch… Scheiße, Gil, das…«
Grissom fasste Brass unbeholfen am Arm. »Konzentrieren
Sie sich auf die Arbeit, Jim. Sie müssen alles andere verdrän-
gen.«
Brass nickte und schluckte. »Das hier ist noch brutaler als
die alten Morde. Es ist, als wäre CASt… besonders wütend auf
Perry gewesen. Immerhin war er der Reporter, der ein Buch
über die Mordserie geschrieben hat. Er hat mit CASt Geld
verdient und ›böse‹ Sachen über ihn gesagt.«
Grissom zuckte mit den Schultern. »Da ist er nicht der Ein-
zige.«
Brass hatte bereits sein Handy aus der Tasche gezogen und
eine Kurzwahltaste gedrückt. »Hier ist Captain Jim Brass – wer
ist da?«
Eine weibliche, ruhige Stimme meldete sich. »Laurel
Thompson, Captain.«

Brass war erleichtert. Laurel war durch nichts aus der Ruhe
zu bringen – sie war einer der besten Dispatcher in der ganzen
Stadt. »Laurel, Sie müssen einen Streifenwagen zum Banner
schicken. Die Beamten sollen David Paquette in Gewahrsam
nehmen. Es geht um den CASt-Fall. Wenn er nicht im Büro ist,
schicken Sie einen Wagen zu seinem Haus.«
»Ja, Sir. Mordanklage?«
Brass sah Grissom in die Augen und kämpfte mit dem Ver-
langen, ja zu sagen.
Das Problem war, er hatte keinen richtigen Beweis, obwohl
es nach dem Mord an Bell logisch schien, dass Paquette der
Nachahmungstäter sein musste. Wer außer den beiden käme
sonst in Frage? Brass wünschte sich in diesem Moment, Gris-
som würde einen Beweis finden, damit sie den Redakteur
festnehmen konnten – aber er sprach es nicht laut aus, um nicht
das Missfallen des CSI-Leiters zu erregen.
»Sie sollen ihn in Schutzhaft nehmen«, meinte er stattdessen
zu der Beamtin in der Funkzentrale »Pardon?«
»Laurel, sagen Sie den Männern, dass Paquette ein wichti-
ger Zeuge ist und ich um seine Sicherheit besorgt bin… Inzwi-
schen rufe ich David an und sage ihm selbst, was los ist.«
»Der Wagen wird sofort rausgeschickt. Roger, Captain.«
»Danke, Laurel.«
Brass schaltete sein Handy aus.
»Ein wichtiger Zeuge?«, fragte Grissom.
»Haben wir genug, um ihn festzunehmen?«
»Nein.«
»Der Punkt ist, ich will ihn von der Straße haben, bis wir
Bescheid wissen. Wenn Bell nicht der Nachahmer ist, dann ist
Paquette der nächstbeste Tipp.«
»Ein kleiner Vorschlag meinerseits«, bemerkte Grissom.
»Keine Tipps und Vermutungen!«

»Dann finden Sie einen verdammten Beweis für mich!«,
fuhr Brass auf.
»Das sollte eigentlich nicht so schwer sein…« Grissom
beugte sich vor, um die Leiche in Augenschein zu nehmen. Die
Unterschiede zwischen diesem Mord und den Taten des Nach-
ahmers waren subtil, aber vielfältig.
»Als der Finger abgetrennt wurde, lebte das Opfer noch«,
erklärte er und ging in die Hocke.
Das hatte auch Brass bereits erkannt. Bells Herz hatte defi-
nitiv noch geschlagen, als ihm der Finger abgeschnitten wurde.
»Was Sie nicht sagen«, entgegnete er. »Hier ist mehr Blut als
an den beiden anderen Tatorten zusammen.«
»Die Farbe des Lippenstifts scheint mir etwas dunkler als
bei Sandred und Diaz«, sagte Grissom. »Aber ob das wirklich
stimmt, wird sich im Labor zeigen. Vielleicht spielen die
Lichtverhältnisse und das viele Blut meiner Wahrnehmung
einen Streich.«
»Ich würde auch sagen, er ist dunkler«, erklärte Brass.
Grissom zeigte auf die Leiche und fuhr fort. »Die gebroche-
ne Nase hat er sich wahrscheinlich geholt, als er dem Mörder
die Tür öffnete. Doc Robbins wird Genaueres dazu sagen
können, aber so brutal haben weder CASt noch der Nachahmer
bisher zugeschlagen. Aus unbekannten Gründen – wenn man
von unseren Spekulationen in Bezug auf seinen Groll gegen
den Autor von Der Fall CASt einmal absieht – hat CASt Bell
viel härter angefasst als die anderen Opfer.«
Brass nagte schweigend an seiner Unterlippe.
Grissom sah ihn an. »Können Sie sich vorstellen, wie es ab-
gelaufen ist, Jim?«
Bell ist allein zu Hause. Er sitzt in seinem Arbeitszimmer und
studiert seine alten Unterlagen über CASt. Er freut sich, dass
der alte Fall seine eingeschlafene Karriere zu neuem Leben

erweckt. Als es an der Tür klingelt, geht er die Treppe hinunter.
Beim zweiten Klingeln ist er unten und öffnet.
Die Haustür liegt in einer dunklen Nische, die vom Nach-
barhaus nicht einsehbar ist. Entweder schlägt der Mörder
sofort zu, oder Bell kennt ihn und bittet ihn hinein, und er
schlägt zu, sobald er im Haus ist.
Capture – Überwältigen.
An der Tür oder im Flur bekommt Bell also einen Schlag ins
Gesicht – einen heftigen Schlag, der ihm die Nase bricht und zu
den Blutstropfen führt, von denen die Polizei später in den
Keller gelockt wird.
Während ihm das Blut aus der Nase läuft, wird Bell von dem
Mörder in den Keller geschleppt. Bell ist nackt.
Afflict – Quälen.
Die Schlinge liegt um seinen Hals und zieht sich langsam
zusammen. Als sie ihm die Luft abschnürt, verliert Bell das
Bewusstsein. Er kommt wieder zu sich, als er einen Schlag ins
Gesicht bekommt, auf den weitere folgen, immer schneller, bis
die Schläge nur so auf ihn niederprasseln. Er duckt sich und
versucht, sich ganz klein zu machen, um den Schlägen zu ent-
gehen, aber der Mörder reißt an dem Seil, die Schlinge zieht
sich fester zu, und Bell muss sich notgedrungen fügen.
Der Mörder zieht Bells Kopf mit dem Seil hoch und verpasst
ihm einen weiteren heftigen Schlag ins Gesicht. Nun verliert
der Reporter endgültig das Bewusstsein; die Schmerzen sind
einfach zu stark. Er kommt nach einer gewissen Zeit wieder zu
sich, als er merkt, wie sich etwas um seinen Zeigefinger
schließt.
Der Mörder hält Bells Finger mit einer Blechschere fest.
Bell fühlt die Kälte des Stahls, dann drückt der Mörder zu. Ein
warmer Blutschwall. Bell spürt einen glühend heißen Schmerz,
und der Finger ist ab. Bell sieht ihn zu Boden fallen, bevor er
verzweifelt die Augen zukneift. Solche Schmerzen hat er noch

nie in seinem Leben gehabt, und er vergisst sogar für einen
Moment das Seil um seinen Hals, aber der Täter erinnert ihn
mit einem festen Ruck wieder daran, und die Schlinge schließt
sich um seinen Hals.
Strangle – Strangulieren.
Er versucht vergeblich, sich zu wehren. Er bekommt keine
Luft mehr. Seine ganze Brust brennt und schmerzt, während
seine Lunge um die letzten Sauerstoffmoleküle kämpft.
Dann gibt es keine mehr; jede Faser seines Körpers brennt.
Langsam schwindet nun jedoch der Schmerz, das Brennen lässt
nach, und ihn umfängt eine warme, angenehme Finsternis. Bell
treibt in einem tiefschwarzen Meer, und die Wärme, die ihn
zunächst in Wellen, dann dauerhaft überkommt, beruhigt ihn.
Er lässt sich fallen. Nun erfüllt die Finsternis auch sein Inne-
res, und Bell driftet davon. Kampf und Schmerzen sind vorbei.
Alles ist vorbei.
Sara kam zu Brass und Grissom in den Keller. Sie kniff die
Augen zusammen, als sie sich umschaute. »Das… sieht gleich
und doch anders aus.«
Grissom kniete noch neben der Leiche und sah auf. »Ganz
genau.«
»Wir müssen seine Telefonate überprüfen«, sagte Brass zu-
sammenhanglos.
Grissom nickte. »Vielleicht können wir herausfinden, ob der
Mörder ihn gezwungen hat, seine Tochter anzurufen, oder ob
er wirklich von sich aus abgesagt hat, um an seiner Geschichte
zu arbeiten.«
»Vielleicht hat die Geschichte ihn bearbeitet.«
»Wie es aussieht, war der Täter eine ganze Weile mit Bell
beschäftigt«, sagte Grissom und erhob sich. »Sobald uns Al
den Todeszeitpunkt nennt, können wir prüfen, wie dicht Bells

Anruf bei seiner Tochter und der Überfall zeitlich zusammen-
liegen.«
»Daran hatte ich gedacht«, sagte Brass.
»Sieh in seinem Schlafzimmer nach«, sagte Grissom zu Sa-
ra, »ob er vielleicht beim Packen war.«
»Okay. Und dann… Fingerabdrücke?«
Grissom nickte. »Nimm dir alles im Erdgeschoss vor, was
der Täter vielleicht angefasst hat – das Treppengeländer zum
Beispiel.«
»Ich versuche es auch an der Haustür.«
»Sag Carrack und Damon, sie sollen sich nicht vom Fleck
rühren und nichts anfassen, damit uns möglichst viele Beweis-
spuren erhalten bleiben.«
Brass hatte bereits wieder sein Handy am Ohr und rief Da-
vid Paquette an.
Der Redakteur meldete sich beim zweiten Klingeln.
»David, Jim Brass hier. Ich habe einen Streifenwagen losge-
schickt, der Sie abholen soll.«
»Warum das denn?«
»Wir nehmen Sie als wichtigen Zeugen in Schutzhaft.«
»Den Teufel werden Sie tun! Ich habe eine Zeitung heraus-
zubringen!«
»Die Lage ist ernst, David. Da müssen Sie die Arbeit schon
hintenanstellen.«
»Nennen Sie mir einen guten Grund!«
»Perry Bell ist tot.«
Paquette sagte kein Wort, aber an seinem stockenden Atem
erkannte Brass, dass diese Nachricht ein Schock für ihn war…
es sei denn, er zog nur eine Show ab.
»CASt hat wieder zugeschlagen«, erklärte Brass.
»Oh, mein Gott…«
Einen Moment lang hatte Brass den Eindruck, Paquette habe
angefangen zu weinen. Er und Bell waren Freunde gewesen,

Kollegen. Und der Mord stand in direktem Zusammenhang mit
dem Buch, das sie zusammen geschrieben hatten und das sie
bekannt gemacht hatte.
»Hören Sie, Dave«, fuhr er fort, »machen Sie den Beamten
keine Schwierigkeiten. Lassen Sie sich mitnehmen. Wir kön-
nen Sie schützen. Und vielleicht können Sie uns helfen.«
»Oh… okay.«
»Keine Sorge, das ist völlig in Ordnung.«
»Das… das glaube ich nicht, Jim. Wir sind für die Bericht-
erstattung zuständig und sollten nicht selbst in die Schlagzeilen
geraten.«
»Nun, dann kooperieren Sie mit uns, und wir halten Sie da
raus!« Mit diesen Worten unterbrach Brass die Verbindung.
»Glauben Sie wirklich, er war es?«, fragte Grissom.
Brass schüttelte den Kopf. »Seine Reaktion hat mich ver-
wundert – ich glaube, er hat geweint, Gil.«
»Sie waren befreundet.«
»Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll! Ich glaube, ich
werde mir von jetzt an gar nichts mehr zu diesem gottver-
dammten Fall überlegen, bis Sie mich dazu anhalten.«
»Denken ist erlaubt. Nur vor Vermutungen und Spekulatio-
nen sollten wir uns hüten.«
In diesem Moment klingelte Brass’ Handy. Es war O’Riley.
Brass lauschte, bedankte sich bei dem Sergeant und sagte zu
Grissom: »Orloff hat gesagt, das Foto von Bell, das wir nach
Ely gefaxt haben, zeige keinen der beiden ›Sammler‹, mit
denen er zu tun hatte… Dann war Bell wohl nicht der Nach-
ahmer…«
»Geben Sie uns ein bisschen Zeit, damit wir den Tatort un-
tersuchen können«, sagte Grissom. »Wir werden etwas fin-
den.«
Selbst für Vegas-Verhältnisse hatten sie erbärmlich viel Pech.

Welche Richtung sie auch wählten, der CASt-Fall schlug
immer neue Haken. Irgendwie war es dem Killer – einem
Verrückten, der seine Mordserie beendet hatte, als Nick Stokes
noch ans College ging – gelungen, eine Zeitreise von der Ver-
gangenheit in die Gegenwart zu machen und die aktuellen
Ermittlungsbemühungen völlig zu vereiteln.
Nach dem unergiebigen Besuch bei Dallas Hanson in der
Mission waren Nick und Catherine kurz ins Labor gefahren,
um Hansons Speichelprobe abzugeben und den DNS-Test zu
veranlassen. Doch Nick ging eigentlich davon aus, dass sie das
gleiche Ergebnis zu erwarten hatten wie bei Phillip Carlson –
keine Übereinstimmung –, aber in ihrem Job ging es um Be-
weise, nicht um Glauben.
Inzwischen waren sie auf der Blue Diamond Road Richtung
Pahrump zur Sundown-Klinik unterwegs. Im Unterschied zu
Sunny Day auf der anderen Seite des Tals in Henderson, wo
Warrick und Catherine kürzlich dem »Todesengel« das Hand-
werk gelegt hatten, war Sundown jedoch eine geschlossene
Anstalt.
Nick saß hinter dem Steuer. »Also, was haben wir überse-
hen?«, fragte er irgendwann.
»Mir fällt nichts ein«, meinte Catherine. Sie schwieg eine
Weile und dachte nach. »Wir haben die Beweise durchgearbei-
tet«, resümierte sie. »Vielleicht waren Brass und Champlain
damals komplett auf der falschen Fährte, und der echte CASt
steht gar nicht auf ihrer Verdächtigenliste.«
»Ja, aber Brass und Champlain sind erstklassige Cops…«
»Natürlich! Aber uns ist das auch schon mal passiert. Das
geht schnell – man beginnt, an seine Theorien zu glauben,
bevor die Beweise vorliegen.«
»Kommt vor«, räumte Nick ein. »Und wenn keiner von die-
sen drei Verdächtigen tatsächlich CASt ist, was haben wir dann
zu den Ermittlungen beigetragen?«
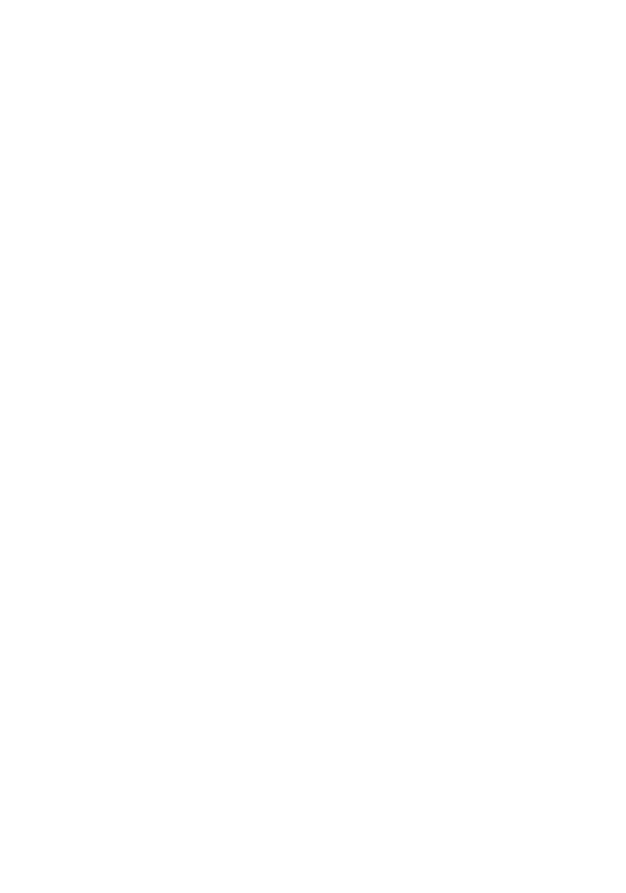
»Wir haben sie als Verdächtige ausgeschlossen«, entgegnete
Catherine. »Das ist auch wichtig.«
Ihr Kollege nickte widerstrebend.
Als sie über die Amargosa Road die Last Chance Range er-
reichten, musste Nick unwillkürlich über den Standort der
Anstalt grinsen. Letzte Chance, wie treffend!, dachte er. Die
meisten Patienten von Sundown waren entweder für sich selbst
oder für andere eine Gefahr und verbrachten daher den Groß-
teil ihrer Zeit hinter verschlossenen Türen. Sie nahmen sogar
die Mahlzeiten in ihren Räumen, die im Grunde Zellen waren,
ein und hatten nur einmal am Tag Ausgang, um – einer nach
dem anderen – in einem kleinen Hof eine Viertelstunde lang
ein paar Runden zu gehen.
Nick fuhr auf den Parkplatz, auf dem ungefähr ein Dutzend
Autos standen, die meisten davon in der Nähe des Mitarbeiter-
eingangs am anderen Ende des lang gestreckten, einstöckigen
Gebäudes. Die Einrichtung war größer, als sie von vorn aussah.
Das wusste Nick, weil er die riesige fünfeckige Anlage einmal
mit dem Hubschrauber überflogen hatte. Er hatte bei einem
früheren Besuch auch das Innere des Gebäudes gesehen, das
ihm wie ein immenses Labyrinth mit endlos langen Flügeln
vorgekommen war, wie aus einem bizarren Albtraum.
Wenn man bei der Einlieferung noch nicht geisteskrank war,
dann hatte man alle Chancen, es im Laufe der Zeit zu wer-
den…
Sie stiegen aus dem Auto und gingen zum Haupteingang.
»Wenn ich irgendwann durchdrehe«, sagte Catherine, »er-
schieß mich bitte, falls man mich hier einliefern will.«
»Einverstanden – würdest du das im umgekehrten Fall auch
für mich tun?«
»Abgemacht«, entgegnete Catherine.

Die Flügeltür war aus Sicherheitsglas mit eingelegtem
Drahtnetz – und natürlich fest verschlossen. Nick versuchte
vergeblich, sie zu öffnen.
Catherine zeigte auf das Schild an der Tür: BITTE
KLINGELKNOPF AN DER SPRECHANLAGE DRÜCKEN!
»Okay, du hast eine bessere Beobachtungsgabe als ich«,
bemerkte Nick.
Catherine ging zu der Sprechanlage neben der Tür und
drückte auf den Knopf.
Nach einer Weile sah sie Nick stirnrunzelnd an, als wollte
sie fragen, ob sie noch einmal klingeln sollte, doch da meldete
sich eine weibliche Stimme. »Sie wünschen?«
»Catherine Willows und Nick Stokes für Dr. Jennifer Royer.
Wir sind vom kriminaltechnischen Labor.«
»Haben Sie einen Termin?«
»Nein, aber ich habe ihr eine Nachricht auf Band gespro-
chen.«
»Einen Moment, bitte!«
Es folgte eine lange Pause, und Nick und Catherine sahen
sich unentschlossen an. Waren sie abserviert worden?
Endlich meldete sich die Frau zurück. »Kommen Sie herein
und halten Sie Ihre Ausweise bereit.«
Der Summer ertönte, und Nick hielt Catherine die Tür auf.
Als sie im Gebäude waren, hörte er hinter sich das Klicken
eines elektronischen Schlosses.
»Und wir sind freiwillig hergekommen«, kommentierte er.
»Das ist kein schöner Ort…«, entgegnete Catherine mit gro-
ßen Augen.
Die Eingangshalle war leer und sauber; die Wände waren in
einem zarten Minzgrün gekachelt, die Böden in Hellgrün, und
das einzige dekorative Element war der Bauplan der Anlage,
der in einem schlichten Rahmen an der Wand hing.

Alles schien von einer dicken Patina aus Traurigkeit über-
zogen zu sein. Obwohl das Sonnenlicht durch die Glastür
hereinfiel, war die Halle in ein trübes, graues Licht getaucht,
was zum Teil sicher an den Neonröhren in den verfärbten
Kunststoffhauben unter der Decke lag. Am anderen Ende der
Halle standen ein dunkelgrünes Sofa, ein paar dazu passende
ungepolsterte Stühle und ein niedriger Tisch, auf dem Ausga-
ben der Zeitschrift Psychology Today lagen. In der Luft lag
Kiefernnadelduft, der jedoch den Geruch von Krankheit und
Tod nicht verdrängen konnte, den die Wände, die Luftschächte,
ja sogar die Möbel zu verströmen schienen.
Diese Eindrücke waren natürlich subjektiv, aber Nick sah an
Catherines stummem Entsetzen, dass sie ähnlich empfand wie
er.
Dies bestätigte sie ihm, als sie ihm zuraunte: »Hier ist man
kein Gast, nicht einmal ein Insasse – hier ist man ein Gefange-
ner.«
Eine stämmige Frau in Weiß saß hinter dem Empfangsschal-
ter. Sie hatte rot gefärbtes Haar und trug mit ihrer schroffen,
finsteren Ausstrahlung ihre ganze Unzufriedenheit mit dem
Schicksal nach außen.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte sie, aber es klang eher wie
eine Drohung.
Catherine erkannte die Stimme aus der Sprechanlage wie-
der. »Wir sind von der Las Vegas Police und möchten zu Dr.
Jennifer Royer«, sagte sie.
Sie traten vor und hielten der Frau ihre Dienstausweise hin.
Die Empfangsschwester beugte sich vor und studierte sie.
Dann sah sie skeptisch auf. »Haben Sie noch etwas anderes?«
Gehorsam zeigten Nick und Catherine der Pförtnerin auch
ihre Personalausweise und ihre Marken.
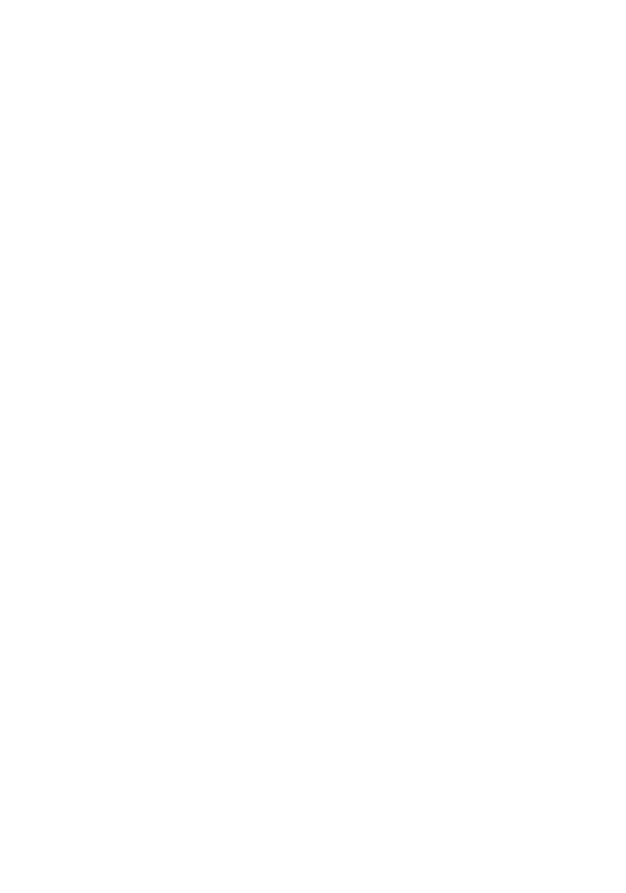
Sie bedachte die beiden mit einem Lächeln, als wollte sie
sagen: Gratuliere zur bestandenen Einlassprüfung, aber werden
Sie nicht übermütig – Sie wollen ja auch wieder raus!
Es war aber auch möglich, dass dieser Eindruck nur einer
gewissen Paranoia entsprang…
»Auf der linken Seite des Korridors«, sagte die Pförtnerin,
ohne sie noch einmal anzusehen. »Die dritte Tür.«
Die Tür stand offen und Nick klopfte an den Rahmen.
Eine Frau um die vierzig mit – echten – roten Haaren und
einer aparten Kurzhaarfrisur sah von ihrem Schreibtisch auf,
der mit Akten überhäuft war. Allem Anschein nach ging sie
nicht oft an die Sonne, aber das war bei ihrem hellen Teint
wahrscheinlich auch ganz vernünftig. Sie hatte ein schmales
Gesicht, eine lange, gerade Nase, blaue, mandelförmige Augen
und einen breiten Mund – ausgeprägte, aber attraktive Züge.
»Ah, Sie sind die Leute vom kriminaltechnischen Labor«,
sagte sie, und in ihrer Stimme schwang ein leiser Südstaaten-
akzent. »Ich habe Ihre Nachricht erhalten, aber ich konnte Sie
noch nicht anrufen. Gut, dass Sie dem vorgegriffen haben und
gleich gekommen sind… Setzen Sie sich!«
Nick und Catherine nahmen auf den zwei Chromstühlen vor
dem Schreibtisch Platz.
Das Büro war klein und ordentlich – bis auf den Schreib-
tisch, der auf ein enormes Arbeitspensum schließen ließ. Er
war wie die beiden Aktenschränke an der Wand aus Stahl. Der
Sessel der Ärztin wirkte bequem, aber nicht übertrieben ku-
schelig. Die Ausstattung in Sundown war nicht luxuriös, aber
ausreichend.
»Ich bin Catherine Willows und das ist Nick Stokes.«
Die Frau lächelte sie an, und es wirkte echt – von Profi zu
Profi. »Ich bin Dr. Jennifer Royer, die Chefärztin. Was kann
ich für Sie tun?«

»Wir würden gern mit einem Ihrer Patienten reden«, sagte
Catherine.
»Herzlichen Glückwunsch«, entgegnete die Ärztin mit ei-
nem Hauch von Belustigung. »Damit gehören Sie zu einem
illustren kleinen Kreis.«
»Wie bitte?« Catherine runzelte die Stirn.
Dr. Royer schürzte die Lippen. »Die Patienten von Sundown
bekommen in der Regel überhaupt keinen Besuch, nicht einmal
von der Polizei.«
»Und von der Familie?«, fragte Nick.
»Das variiert von Fall zu Fall«, entgegnete Dr. Royer. Sie
seufzte und schüttelte den Kopf. Ihr trockener Humor war
offensichtlich ihre Art, mit diesem deprimierenden Ort fertig
zu werden. »Die Patienten werden aus den unterschiedlichsten
Gründen hier eingewiesen. Aber in Wahrheit gibt es nur einen
Grund, weshalb unsere Patienten sich hier aufhalten: weil
irgendjemand – vielleicht sogar die Gesellschaft – will, dass sie
eingesperrt werden.«
»Ausgelagert«, warf Catherine ein.
Die Ärztin, deren überraschende Offenheit äußerst erfri-
schend war, nickte. »Genau – weggeschlossen, damit man sie
nicht sieht.«
»Aber wenn sie schon hier sind, versuchen Sie, ihnen zu
helfen.«
Dr. Royer gefror das Lächeln. »Wir versuchen es.«
»Wie ist Ihre Erfolgsquote?«
Mit einem abschätzigen Schulterzucken entgegnete die Ärz-
tin: »Dazu machen wir generell keine Angaben – es handelt
sich schließlich um eine private Einrichtung.«
Nick wechselte einen viel sagenden Blick mit Catherine. Ei-
ne Erfolgsrate, die so niedrig war, dass man sie der Öffentlich-
keit vorenthielt?

»Sicherlich wird ein beachtlicher Prozentsatz Ihrer Patienten
als geheilt entlassen und findet in ein normales Leben zurück«,
sagte Catherine.
»Manche schon. Die meisten von ihnen verlassen uns je-
doch in einem Zustand, mit dem Sie sich beim CSI bestens
auskennen sollten… Aber wie kann ich Ihnen helfen?«
Catherine rutschte auf dem Stuhl hin und her. »Wie ich
schon sagte, wir würden gern mit einem Ihrer Patienten spre-
chen.«
»Mit wem?«
»Mit Jerome Dayton.«
»Einen Jerome Dayton gibt es hier nicht«, entgegnete Dr.
Royer wie aus der Pistole geschossen.
Catherine traute ihren Ohren nicht. »Pardon… Wie bitte?«
Dr. Royer schüttelte den Kopf. »Wir haben hier niemanden
mit diesem Namen.«
»Wissen Sie das ganz genau?«, fragte Nick.
»Das sollte ich – ich bin verantwortlich für alle Patienten
von Sundown.«
Catherine sah Nick an, dem sofort auffiel, dass seine Partne-
rin sich ärgerte. »Wir hatten die Information, Dayton sei hier
Patient.«
»Nun, jetzt ist er jedenfalls nicht hier.«
Nick bemerkte die Zweideutigkeit ihrer Aussage und hakte
nach. »Aber er war hier? Jerome Dayton war Ihr Patient?«
Das Lächeln von Dr. Royer war längst verschwunden. Ihre
Miene war versteinert. »Wir haben zur Zeit um die hundert
Gäste hier in Sundown, und keiner von ihnen heißt Jerome
Dayton.«
»Hat er die Anstalt in einem Leichensack verlassen, wie Sie
vorhin andeuteten?«
Die Ärztin dachte kurz nach, dann sagte sie: »Ich glaube
nicht, dass ich Ihnen weiterhelfen kann. Tut mir Leid.«

»Könnten Sie die Krankenakten prüfen?«
»Nein.« Die Bestimmtheit in der zuvor so freundlichen
Stimme der Ärztin war nicht zu überhören. »Das wäre eine
Verletzung der Rechte unserer Patienten.«
»Aber wenn er kein Patient mehr ist…«
»Wir wahren auch die Rechte ehemaliger Patienten.«
Catherine schüttelte den Kopf und lächelte gezwungen. »Dr.
Royer, es geht um Mord. Wir haben gerade von dem dritten
Mord im Zeitraum von etwas mehr als einer Woche erfahren.«
Die Miene der Ärztin blieb versteinert.
»Jerome Dayton zählte zu den Tatverdächtigen im Fall
CASt… Vielleicht erinnern Sie sich? Und wenn er jetzt nicht in
diesem Krankenhaus ist… dann ist er in Bezug auf die Morde,
die sich gerade in Las Vegas ereignet haben, der Hauptver-
dächtige!«, erklärte Nick.
Dr. Royer schien nicht sehr beeindruckt von Nicks leiden-
schaftlicher Argumentation zu sein. »Das gibt weder der Poli-
zei von Las Vegas noch mir die Befugnis, die Rechte dieses
Patienten zu verletzen«, sagte sie nur.
Catherine nickte mit eisiger Miene. »Da haben Sie Recht.
Also besorgen wir uns eine richterliche Anordnung.«
Die Ärztin nahm achselzuckend eine Visitenkarte zur Hand,
notierte eine Nummer darauf und gab sie Catherine.
»Das ist unsere Faxnummer«, sagte sie. »Lassen Sie das Pa-
pier direkt hierher schicken. In der Zwischenzeit sehen wir
schon mal, ob wir Mr. Daytons Akte finden.«
Catherine stutzte und hätte wohl ein ebenso verblüfftes Ge-
sicht gemacht, wenn Dr. Royer ihr eine Ohrfeige verpasst hätte.
»Sie… wollen uns helfen?«
»Besorgen Sie die richterliche Anordnung«, entgegnete die
Ärztin knapp, »und während wir darauf warten, suchen wir die
Akte.«
»Ich verstehe nicht…«

»Natürlich tun Sie das. Sie sind beide Profis, das sehe ich.
Nun, und ich bin auch einer… und ich nehme es sehr genau mit
den Rechten unserer Patienten, Ms Willows.«
Catherine wirkte fast verlegen, als sie sagte: »Selbstver-
ständlich, Frau Doktor.«
»Gibt es einen Grund anzunehmen, dass Sie das Papier nicht
bekommen könnten?«
»Nein, das ist kein Problem.«
»Also gut«, meinte die Ärztin. »Wenn dieser Mann ein
Mörder ist, dann haben wir keine Zeit zu verlieren.«
Während Catherine den Anruf erledigte, beobachtete Nick
Dr. Royer dabei, wie sie einen der Aktenschränke durchsuchte.
Anscheinend waren die alten Akten noch nicht in den Compu-
ter eingelesen worden – was nicht sonderlich überraschend
war.
Als Catherine den Anruf beendet hatte, saß die Ärztin be-
reits wieder an ihrem Schreibtisch und studierte mit nachdenk-
licher Miene den Inhalt eines Aktenordners.
»Sobald der Richter unterschrieben hat«, sagte Catherine,
»wird die Anordnung rübergefaxt.«
»Vielleicht reine Zeitverschwendung«, bemerkte Dr. Royer
ohne aufzusehen.
»Warum?«, fragte Nick.
Die Ärztin sah ihn an. »Ich glaube nicht, dass Jerome Day-
ton der gesuchte Killer ist.«
»Warum?«, fragte Catherine.
»Jerome Dayton kam vor ungefähr zehn Jahren hierher. Das
war übrigens lange vor meiner Zeit.«
»Nun, das deckt sich mit dem, was wir über Dayton wissen
– er wurde in der Tat vor zehn Jahren hier eingeliefert.«
»Ja, und zwar mit paranoider Schizophrenie.«
»Das heißt, er hat Stimmen gehört?«, fragte Nick.

»Das ist nur ein Symptom von vielen«, erklärte die Ärztin.
»Halluzinationen, sowohl akustische als auch visuelle, können
ebenfalls Symptome von Schizophrenie sein. Aber die Patien-
ten leiden unter Umständen auch an Verfolgungswahn.«
»War das bei Jerome Dayton der Fall?«, fragte Catherine.
»Ja, er litt unter solchen Wahnvorstellungen.«
Dr. Royer las konzentriert weiter. Es waren inzwischen
schon gut fünf Minuten vergangen, ohne dass sie irgendetwas
sagte.
Nick und Catherine warteten geduldig. Weitere zehn Minu-
ten verstrichen, bevor die mürrische Schwester mit dem Fax
hereinkam, es auf Dr. Royers Schreibtisch legte und wieder
verschwand. Die Ärztin warf einen Blick auf das Papier, nickte
und widmete sich wieder ihrer Lektüre.
Nach ein paar Minuten sah sie endlich auf. »Jerome hat of-
fenbar geglaubt, dass sein Vater ihn erniedrigt und missbraucht
hat.«
»Wissen wir, ob es sich dabei tatsächlich um Wahnvorstel-
lungen handelte?«, fragte Catherine.
Nick nahm den Faden auf. »Wurde er auf sexuellen Miss-
brauch untersucht?«
»Dieser Akte zufolge gab es solche Untersuchungen«, sagte
Dr. Royers, »und es wurde nichts gefunden, was die Behaup-
tungen des jungen Mannes gestützt hätte. Der Vater, Thomas
Dayton, war damals einer der größten Bauunternehmer der
Stadt.«
Nick runzelte die Stirn. »Seit wann ist Schizophrenie eigent-
lich heilbar?«
»Vier von fünf unserer Patienten sprechen gut auf bestimm-
te Medikamente an«, erklärte Dr. Royers. »Jerome konnte mit
Haldol geholfen werden. Der Akte zufolge wurde er, während
er hier war, in Einzel- und Gruppentherapie behandelt.«

Catherine wirkte beunruhigt. »Dann war er also unter Kon-
trolle… wenn schon nicht geheilt.«
»Ja.«
»Und er wurde entlassen?«
»Das wurde er«, bestätigte Dr. Royer.
Nick schüttelte ungläubig den Kopf. »Wann war das?«
»Vor sieben Jahren.«
Nick richtete sich auf. »Er wurde innerhalb von drei Jahren
geheilt?«
Dr. Royer sah die beiden an. »Ich sagte ja bereits, dass er
nicht ›geheilt‹ war. Aber er bekam Medikamente und hatte
seine Krankheit unter Kontrolle. Wie ich der Akte entnehme,
hat er unglaubliche Fortschritte gemacht, nachdem mein Vor-
gänger das Problem diagnostiziert hatte. Jerome durfte sogar
Tages- und Wochenendbesuche bei seinen Eltern machen.«
»Ist das normal?«, fragte Catherine.
Zum ersten Mal, seit sie auf Jerome Dayton zu sprechen ge-
kommen waren, lächelte die Ärztin wieder. »›Normal‹ ist kein
wissenschaftlicher Begriff, Ms. Willows. Und da Sie selbst
Wissenschaftlerin sind, können Sie sich denken, wie selten das
Wort ›normal‹ in einer Anstalt wie dieser Erwähnung findet…
Nein, solche Besuche sind nicht ›normal‹, aber auch nicht
ausgeschlossen. Bedenken Sie, dass Jerome freiwillig herge-
kommen ist. Er hat kooperiert, als seine Eltern ihn zu uns
brachten.«
»Wurde er vielleicht auf eigene Verantwortung entlassen?«
»Das ist möglich, obwohl es dazu keinen Vermerk in der
Akte gibt… Manchmal braucht ein Patient nur die richtige
Diagnose und Medikation, um genesen zu können, Ms. Wil-
lows, und es tritt bemerkenswert schnell Besserung ein. Zeit
mit der Familie zu verbringen – einzelne Tage und Wochenen-
den – kann sich positiv auf den Heilungsprozess auswirken.«

»Sieben Jahre«, sagte Nick und schüttelte wieder den Kopf.
»Ich kann nicht glauben, dass keiner von seiner Entlassung
wusste.«
Dr. Royer zuckte mit den Schultern. »Wenn er ein Verdäch-
tiger im Fall CASt war… Wann endete die Mordserie? Vor elf
Jahren?«
»Zehn«, sagte Catherine. »Er kam kurz vor dem letzten
Mord hierher.«
»Und deshalb glaube ich auch nicht, dass er der Gesuchte
ist«, erklärte Dr. Royer. »Außerdem ist er jetzt seit sieben
Jahren draußen, und es gab keine Morde.«
»Bis vor kurzem«, bemerkte Catherine.
»Natürlich«, sagte die Ärztin nickend, »bis vor kurzem. A-
ber Sie sind die Kriminalisten – sagen Sie es mir: Machen
Serienmörder normalerweise Pausen von sieben Jahren?«
Catherine schüttelte den Kopf. »Nein, aber als Wissen-
schaftler verwenden wir das Wort ›normalerweise‹ auch nicht
sehr oft bei unserer Arbeit… Wissen Sie, wo wir Jerome Day-
ton finden können?«
Royer blätterte in der Akte. »Ah, hier ist es… Wahrschein-
lich bei seinen Eltern. Er wurde in ihre Obhut entlassen.«
»Der Vater ist tot«, sagte Nick. »Starb vor zwei, drei Jahren.
Die Presse hat groß darüber berichtet.«
»Daran erinnere ich mich«, entgegnete die Ärztin. »Mr.
Dayton war ein berühmter Mann, wenigstens hier in der Ge-
gend. Dann wird Jerome Dayton vermutlich noch bei seiner
Mutter leben.«
»Kann man sicher sein, dass er seine Medikamente
nimmt?«, fragte Catherine.
»Relativ sicher. In den ersten Jahren hat er noch weiter Ein-
zel- und Gruppentherapien gemacht und seine Medikamente
von uns bekommen. Danach hat er sich die Medikamente bei

einer Schwestereinrichtung abgeholt, und damit endet unsere
Akte. Am besten holen Sie sich die Akte von dort.«
Nun las die Ärztin die richterliche Anordnung aufmerksam
durch.
»Alles in Ordnung«, sagte sie. »Haben Sie etwas dagegen,
wenn ich die Akte kopiere, bevor ich sie Ihnen aushändige?«
»Überhaupt nicht«, entgegnete Catherine. »Wer weiß, wie
lange wir sie behalten.«
»Richtig… Ich wünschte, ich könnte Ihnen mehr sagen, aber
alles, was ich hier lese, deutet auf Jeromes Unschuld hin. Und
wie Sie sehen werden, gab es keine Hinweise auf Gewalttätig-
keit in seiner Vorgeschichte.«
»Soweit bekannt«, bemerkte Catherine.
Die Ärztin wiederholte Catherines Worte, dann verließ sie
das Büro, um die Akte zu kopieren.
»Ich kann es nicht glauben«, sagte Nick zu Catherine. »Die-
ser Typ wurde vor sieben Jahren entlassen – wahrscheinlich
der verdächtigste aller CASt-Verdächtigen –, und niemand
wusste, dass er draußen war!«
»Nun… vielleicht spielt das gar keine Rolle.«
»Keine Rolle?«
»Ja, Nick. Ich meine, er war hier eingesperrt, als der letzte
der CASt-Morde geschah.«
Dr. Royer kam zurück und händigte Catherine die Original-
akte aus.
»Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mühe.«
»Wir tun, was wir können.«
Als sie das Gebäude verließen, fragte Nick: »Weißt du noch
das genaue Datum des Mordes an Drake?«
»Das habe ich mir aufgeschrieben«, sagte Catherine, holte
ihr Notizbuch hervor und zeigte ihm das Datum.
Nick zog den Autoschlüssel aus der Tasche. »Und was steht
zu diesem Datum in der Akte?«

Catherine blätterte, dann fand sie es und sah Nick entsetzt
an. »Oh… mein… Gott! Da war Jerome übers Wochenende bei
seinen Eltern.«
Nick war zwischen Übelkeit und Siegesfreude hin und her
gerissen. »Vielleicht sollten wir Jerome Dayton aufsuchen und
mal gucken, wie es ihm heute geht. Vor allem, wie es mit den
Medikamenten klappt.«
»Ja, tun wir das«, sagte Catherine. »Von einer Sache können
wir ihn auf jeden Fall heilen.«
»Und zwar?«
»Er ist nicht paranoid. Wir sind wirklich hinter ihm her.«

8
Sara Sidle saß auf einem Hocker an der Arbeitsplatte im Labor
und nahm den Packen Testergebnisse, den Greg ihr überreich-
te, wie ein Geburtstagsgeschenk in Empfang.
»Das wird dir gefallen«, sagte er und ging zur Tür.
»Mir gefällt alles, was konkret ist«, meinte Sara. »Ich bin es
leid, immer nur Luft zu verarbeiten…«
»Nimm dich dabei bloß vor Wasserstoff in Acht!«
Sara grinste. »Danke für den Tipp!«, sagte sie, und dann war
Greg auch schon wieder verschwunden.
Endlich!, dachte sie und machte sich über den Stapel Papier
her. Auf dem ersten Blatt stand, dass der Lippenstift, der bei
Diaz verwendet wurde, exakt mit dem Farbton übereinstimmte,
der bei Marvin Sandred gefunden worden war: »Bright Rose«
von Ile De France. Dieses Ergebnis bestätigte die Theorie, dass
es sich um ein und denselben Täter handelte, was außerdem
dadurch gestützt wurde, dass – wie auf dem nächsten Blatt zu
lesen war – die Seile, die in beiden Mordfällen verwendet
worden waren, exakt dieselbe chemische Zusammensetzung
hatten.
Als Nächstes fand Sara ein Foto, das zeigte, dass die Enden
der Seile, mit denen Diaz und Sandred erdrosselt worden wa-
ren, auch noch ganz genau zusammenpassten.
»Besser geht’s ja gar nicht!«, rief sie in das leere Labor.
»Was?«, fragte Grissom, der in diesem Augenblick herein-
kam.

»Wir wissen, dass Sandred und Diaz von ein und derselben
Person umgebracht wurden.«
Grissom trat zu Sara, und sie zeigte ihm die Testergebnisse.
»Unser wichtigstes Produkt«, sagte er. »Fortschritt.« Dann
holte er sich einen Stuhl. »Und was ist mit dem Umschlag vom
Banner?«
»Die Fingerabdrücke stammen von den drei Mitarbeitern
David Paquette, Mark Brower und Jimmy Mydalson. Ihre
Abdrücke wurden auch auf dem Brief gefunden. Das bestätigt
natürlich nur, was wir bereits wussten. Und wie läuft’s bei dir?
Irgendwas über die Handschrift rausgefunden?«
»Ich bin gerade auf dem Weg zu Jenny. Willst du mitkom-
men? Dann können wir beide unseren Wortschatz erweitern.«
Jenny Northam war die Handschriftenexpertin, die jahrelang
freiberuflich für den CSI gearbeitet hatte, kürzlich aber fest
angestellt worden war. Früher hatte sie ständig wie ein wüten-
der Hafenarbeiter geflucht, aber in den Räumen des CSI musste
sie sich, wie Grissom ihr nahe gelegt hatte, in Zurückhaltung
üben.
Auf dem Weg zu Jennys Kabuff war Grissom tief in Gedan-
ken versunken, was bei ihm nicht ungewöhnlich war. Sara
machte das Schweigen nichts aus – auch ihr ging so manches
durch den Kopf.
Plötzlich blieb sie jedoch stehen. »Bell wurde nicht von
demselben Täter getötet wie Sandred und Diaz, nicht wahr?«
Grissom horchte auf und bedachte sie mit einem Blick, aus
dem eine leise Hoffnung sprach. »Haben wir Beweise dafür?«
»Ja – die Brutalität der Schläge und die große Menge Blut.
Hat Doc Robbins bestätigt, dass der Finger abgeschnitten
wurde, als das Opfer noch lebte?«
»Hat er.«
»Und auf den Fotos kann man sehen, dass das Sperma eher
willkürlich verspritzt wurde und nicht wie bei den vorangegan-

genen beiden Morden sorgfältig hingegossen, wie du es so
treffend beschrieben hast.«
Grissom nickte. »Alles gute Beobachtungen, Sara, aber nur
Indizien. Wir brauchen bessere Ergebnisse, bevor wir unsere
Schlüsse ziehen können. Zum Beispiel müssen wir wissen, ob
das Sperma, das bei Bell sichergestellt wurde, nicht wie in den
anderen beiden Fällen von Orloff stammt.«
»Und ich nehme an, daran arbeitet Greg schon.«
»Ja, aber der DNS-Test braucht seine Zeit.«
»Schade, dass wir nicht in einer Fernsehserie sind«, entgeg-
nete Sara. »Dann hätten wir die Ergebnisse gleich nach der
Werbung…«
Kurz darauf erreichten sie die offen stehende Tür der CSI-
Graphologin Jenny Northam. Grissom klopfte und betrat ohne
abzuwarten den Raum.
Jenny jagte auf ihrem Bürostuhl durch das kleine Labor wie
ein besoffener Rennfahrer, dessen Gaspedal klemmte. Sie war
zierlich, gerade mal einsfünfzig groß, wog vielleicht fünfzig
Kilo und hatte dunkles Haar. Die Handschriftenexpertin
herrschte über diverse teure Geräte, die an den Wänden aufge-
reiht waren und auch den meisten Platz auf dem großen
Leuchtpult in der Mitte des Raums einnahmen, dem Innenfeld
von Jennys improvisierter Rennstrecke.
»Was gefunden?«, fragte Grissom ohne lange Vorrede.
»Ja, verflucht«, entgegnete Jenny mit einer Stimme, die viel
zu tief für ihre zierliche Statur war. »Oder lieber: Ja, verflixt?«
»Beides ist besser als die dritte Alternative«, sagte Grissom.
»Aber eigentlich wären mir Ergebnisse am liebsten.«
»Ergebnisse kannst du verdammt noch mal haben!«, ent-
gegnete Jenny.
Sara schmunzelte und hielt sich rasch die Hand vor den
Mund. Jenny gab ihr Bestes, um sich in ihr zuweilen politisch

sehr korrektes CSI-Arbeitsumfeld einzufügen, aber gelegent-
lich hatte sie immer noch Ausrutscher.
»Ich habe den aktuellen Brief an den Banner mit den Brie-
fen verglichen, die der CASt-Täter seinerzeit geschrieben hat.«
»Und?«, fragte Grissom.
»Das Papier ist unterschiedlich, obwohl es sich in beiden
Fällen um normales Kopierpapier handelt, und der Verfasser
hat mit Kugelschreiber geschrieben. Die Schrift ist klein und
ordentlich, aber kindlich – wie bei einem genialen Wunderkind
oder so.«
»Ich habe den Brief als Erste gelesen«, sagte Sara, »und mir
sind sofort die akkuraten Abstände und die geraden Zeilen
aufgefallen.«
»Verdammt gerade! Dabei ist das Papier nicht liniert! Da-
hinter verbirgt sich eine Art… Genialität.«
»Das ist doch bestimmt übertrieben«, bemerkte Grissom.
»Also, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ich noch nie
so eine eindeutige Übereinstimmung gesehen habe. Dieser
Beweis hält vor jedem Gericht stand. Dass der Verfasser der-
selbe ist, würde euch sogar ein blinder Affe bestätigen.«
»Nicht nötig, Jenny«, sagte Grissom. »Dein Urteil genügt
mir voll und ganz.«
Während die Graphologin noch über seine Worte nachdach-
te, verließ Grissom bereits wieder den Raum. Sara eilte hinter
ihm her.
»Du wusstest, dass die Briefe von demselben Verfasser
stammen!«, sagte sie.
»Wenn nicht«, entgegnete Grissom, »dann wäre es eine aus-
gezeichnete Fälschung… Und wie viele Leute hatten ausrei-
chend Zugang zu den Originalbriefen, um so etwas zustande zu
bringen?«
Sie gingen zurück in sein Büro, wo Warrick bereits auf sie
wartete.

»Ich habe die Liste der Telefonate von Bell«, sagte er.
»Al hatte anhand der noch nicht eingetretenen Leichenstarre
festgestellt, dass Bell seit ungefähr achtundvierzig Stunden tot
war.«
Warrick nickte. »Todeszeitpunkt zirka eine Stunde nach
dem Telefonat mit seiner Tochter.«
»Wenn er gezwungen wurde, sie anzurufen«, bemerkte Sara,
»muss seine Nase schon gebrochen gewesen sein. Hat sie nicht
gesagt, dass er merkwürdig klang?«
»Wenn Perry bei dem Gespräch mit seiner Tochter bereits
wusste, dass CASt ihn töten würde… hat er es vielleicht ge-
schafft, ihr irgendeinen versteckten Hinweis zu geben«, über-
legte Warrick.
»Ruf sie an und finde es heraus«, sagte Grissom zu Sara,
zog sein Notizbuch aus der Tasche, blätterte eine Weile und
riss dann eine Seite heraus.
»Hier!«, sagte er.
»Grissom«, sagte Sara, »ich halte es nicht für angemessen,
wenn das arme Ding vom CSI erfährt, dass ihr…«
»Sie weiß es schon. Brass hat sie angerufen.«
Damit verließ Grissom den Raum.
Sara sah Warrick an, der mit einem schiefen Grinsen rea-
gierte. »Ich kann das erledigen«, sagte er, »wenn es dir unan-
genehm ist.«
»Nein, danke, das schaffe ich schon. Ich muss es schaf-
fen…«
Sara ging zurück ins Labor, holte ihr Handy heraus und
wählte die Nummer, die Grissom ihr gegeben hatte.
Patty Lang reagierte beim ersten Klingeln. Sie klang müde –
und etwa auch eine Spur verärgert? »Hallo?«
»Ms Lang?«
»Ja.«

»Hier ist Sara Sidle. Ich bin vom kriminaltechnischen La-
bor. Ich belästige Sie nur ungern in dieser schweren Stunde.«
»Sie belästigen mich nicht«, erwiderte Patty mit einem ge-
reizten Unterton. »Sie arbeiten an dem Mord an meinem Vater,
nicht wahr? Nun, das höre ich gern.«
Sara schluckte. »Ich möchte Ihnen sagen, wie sehr ich Ihren
Verlust bedauere. Wir alle hier mochten Ihren Vater. Nicht
jeder Journalist hat einen Fanclub bei der Polizei, wissen Sie?
Aber Ihr Vater war einer von den Guten.«
»Ich danke Ihnen. Wie kann ich Ihnen helfen, diesen
Scheißkerl zu finden, der meinen Vater umgebracht hat?«
»Hat ihr Vater am Telefon normal geklungen, als er seinen
Besuch absagte?«
»Ich fürchte, ich verstehe Ihre Frage nicht. Was meinen Sie
mit ›normal‹?«
»Wie klang seine Stimme?«, fragte Sara. »Wie war seine
Verfassung? Kam Ihnen irgendetwas an dem Anruf ungewöhn-
lich vor oder anders als sonst?«
Patty Lang schwieg eine Weile, bevor sie antwortete. »Das
ist gar nicht so leicht zu beantworten«, sagte sie schließlich.
»Wissen Sie, Ms Sidle, ich habe schon oft erlebt, dass mein
Vater nicht ›normal‹ klang, wenn ich mit ihm telefonierte.
Manchmal war er total aufgedreht wegen einer Geschichte, an
der er arbeitete, und manchmal deprimiert wegen seiner festge-
fahrenen Karriere oder der Trennung von Mom. Und es kam
häufiger vor, dass er mich anrief, wenn er ein paar Cocktails zu
viel intus hatte.«
»Klang er bei seinem letzten Anruf betrunken?«
»Nein«, antwortete Patty. »Eigentlich nicht. Aber er klang
ein bisschen… seltsam, wenn ich es mir recht überlege. Ir-
gendwie steif. Geradezu gestelzt.«
»Als hätte man ihm vorgegeben, was er sagen sollte?«

»Das ist ein merkwürdiger Gedanke… Glauben Sie, der
Mörder war bei ihm?«
Sara sah keinen Grund, Patty etwas vorzuenthalten. »Unse-
rer Vermutung nach wusste der Täter, dass Ihr Vater verreisen
wollte und dass Sie ihn erwarteten.«
»Und er hat ihn gezwungen, mich anzurufen und abzusa-
gen?«
»Ja.«
»Aber warum?«
»Um den Fund der Leiche hinauszuzögern, Ms Lang. Um
uns die Arbeit zu erschweren.«
»Sie meinen, ich wäre besorgt gewesen, wenn mein Vater
nicht aufgetaucht wäre, und Sie hätten früher angefangen, nach
ihm zu suchen?«
»Ja.«
»Ms Sidle, ich habe das Buch meines Vaters über diesen…
diesen Bastard gelesen. Ich habe eine sehr genaue Vorstellung
davon, wie er vor seinem Tod gelitten haben muss. Und ich…
ich komme damit nur klar, weil ich weiß, dass mein Vater nun
in Frieden ruht und diese Kreatur geschnappt wird!«
»Wenn jemand CASt stoppen kann, dann wir.«
»Das… das höre ich sehr gern. Aber… Oh mein Gott! Jetzt
verstehe ich…«
»Was verstehen Sie, Ms Lang?«
Aber die junge Frau hatte angefangen zu weinen.
Sara schluckte und wartete ab.
Schließlich ergriff Patty wieder das Wort. »Als er sich von
mir verabschiedet hat, am Ende des Gesprächs, da hat er mich
Pat-Pat genannt. Das… das war mein Spitzname, als ich noch
klein war. Ich fand es merkwürdig, dass er mich so genannt
hat, nach all den Jahren.«
»Ich verstehe.«
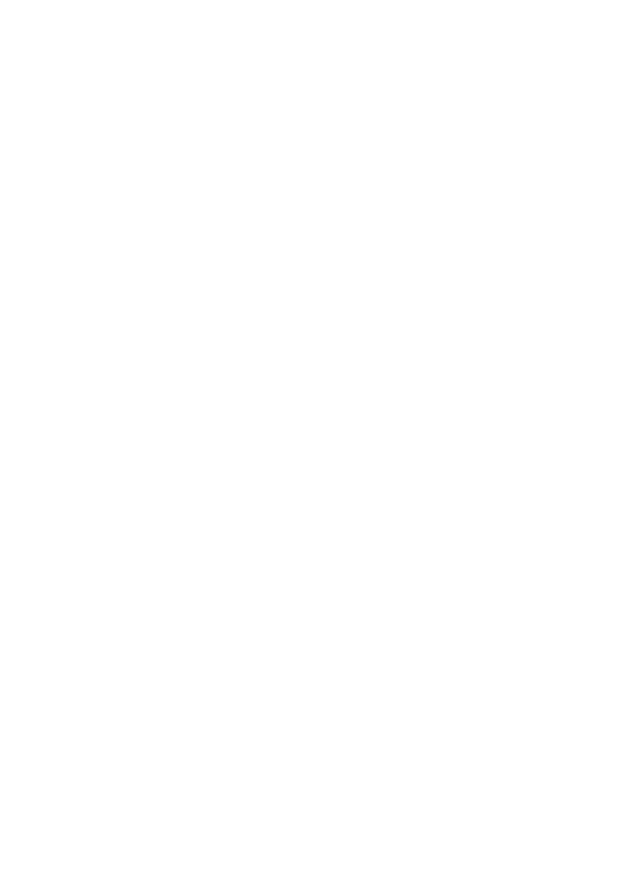
»Wirklich? Ms Sidle, er hat mir auf diese Weise Lebewohl
gesagt… für immer.«
Patty begann wieder zu weinen, und Sara sagte ein paar
tröstende Worte, bevor sie sich schließlich voneinander verab-
schiedeten.
Catherine Willows saß an ihrem Schreibtisch und versuchte,
Brass zu erreichen. Sie hoffte, dass sie nicht den Anrufbeant-
worter erwischte.
»Ich bin’s!«, platzte sie gleich heraus, als Brass an den Ap-
parat kam.
»Was haben Sie in dieser Anstalt erfahren? Wie heißt sie
noch?… Sundown?«
»Wir haben herausgefunden, dass Jerome Dayton dort nicht
mehr zu Gast ist.«
»Was?«
»Schon lange nicht mehr. Seit sieben Jahren.«
Das war Brass offensichtlich neu, wie das lange Schweigen
am anderen Ende der Leitung zeigte.
Catherine fuhr fort. »Anscheinend ist er therapiert und me-
dikamentiert worden und wurde wieder in die Freiheit entlas-
sen, als es ihm besser ging.«
»Schön für ihn«, sagte Brass kühl. »Ich nehme an, sein Va-
ter hat ihn rausgeholt?«
»Bingo! Er wurde in die Obhut seiner Eltern entlassen.«
»Zum Teufel… Aber eigentlich überrascht mich das nicht.
Tom Dayton war ein einflussreicher Mann in dieser Stadt.«
»Wie Sie natürlich wissen, ist er inzwischen tot. Ich nehme
an, Jerome lebt bei seiner Mutter«, sagte Catherine.
»Aber nur, wenn er jetzt einen auf Norman Bates macht«,
erwiderte Brass. »Sie ist vor sechs, sieben Monaten gestorben.
Es stand dick in der Zeitung. Haben Sie das nicht mitbekom-
men?«

Catherine lief es kalt über den Rücken. »Soll das heißen…
Jerome steht nicht mehr unter Aufsicht?«
»Sieht nicht so aus.« Der Zorn des Captains darüber, dass
Dayton frei herumlief und er es nicht gewusst hatte, schien
allmählich zu verrauchen. Aus seiner Stimme klang Hoffnung:
»Cath, das bedeutet, wir haben einen Verdächtigen für die
Nachahmungstaten. Einen verdammt guten Verdächtigen…«
»Vielleicht. Vielleicht müssen Sie aber auch noch weiter in
die Vergangenheit zurückgreifen.« Sie atmete tief durch. »Jim,
da ist noch etwas, was Sie wissen sollten.«
»Spannen Sie mich nicht auf die Folter, Catherine!«
»Als Dayton eingewiesen wurde, hat er tage- und wochen-
endweise Freigang bekommen, um seine Familie besuchen zu
können.«
»Gott-ver-dammt! Wollen Sie damit sagen, er war…«
»Nicht in Sundown, als sich der letzte CASt-Mord ereignete,
ganz genau. Er war in der Stadt, als Vincent Drake ermordet
wurde.«
Wieder Schweigen in der Leitung. Catherine befürchtete
fast, Brass habe aufgelegt oder das Telefon an die Wand ge-
worfen.
»Jim?«, fragte sie zögernd.
»Ich bin noch da.«
»Hat Dayton Geschwister?«
»Nein, er ist ein Einzelkind.«
»Dann hat er ja alles geerbt? Zum Beispiel das Haus seiner
Eltern?«
»Das steht in der Proud Eagle Lane.«
Ein Lächeln huschte über Catherines Gesicht. »Tatsächlich?
Und wo zum Teufel ist die Proud Eagle Lane?«
»In der TPC-Anlage direkt am Canyons-Golfplatz.«
»Ah, die Gegend kenne ich. Da kostet eine Runde Golf
mehr als ein armer CSI in der Woche verdient.«

»Cath, stellen Sie sich vor, was für ein Haus das sein muss,
das an so einem Golfplatz liegt!«
»Das würde ich mir gern ansehen, Jim!«
»Gut, dann schnappen Sie sich Nick, und wir treffen uns
dort. Aber Sie brauchen Ihre Schläger nicht mitbringen – wir
werden nicht zum Golfen kommen.«
»Was ist mit einem Durchsuchungsbefehl?«
»Es gibt keinen Richter im ganzen Bezirk, der uns zu die-
sem Zeitpunkt Gehör schenken würde.« Brass’ Laune besserte
sich, oder er tat zumindest so. »Sehen wir einfach mal nach,
wie Jerry Dayton zurechtkommt, so ganz allein. Es war be-
stimmt ein schwerer Schlag für den Jungen, Mom und Dad zu
verlieren.«
Catherine fand Nick bei Greg Sanders im Labor. Sie nickte
ihrem Partner von der Tür aus zu und er kam zu ihr in den Flur.
»Strike Nummer zwei«, sagte er statt einer Begrüßung.
»Bei?«
»Bei der DNS. Dallas Hanson ist weder der Nachahmungs-
täter noch der Original-CASt.«
»Das wussten wir.«
»Das dachten wir. Greg hat es bewiesen.«
Catherine erzählte Nick von ihrem Gespräch mit Brass.
»Hey, super!« Nick grinste. »Ich habe schon öfter daran ge-
dacht, Mitglied im TPC zu werden. Dann könnte ich mir da ein
Haus kaufen und hätte den Golfplatz direkt vor der Tür.«
»Guter Plan! Du könntest als Caddie anfangen.« Sie grins-
ten sich an und gingen beschwingt zum Parkplatz. Vielleicht
gelang ihnen nun endlich der Durchbruch in diesem verdamm-
ten Fall…
Das Wachhäuschen an der Einfahrt zum TPC war nicht ganz so
groß wie Catherines erstes Apartment, jedoch wesentlich bes-
ser ausgestattet. Die Klimaanlage summte leise, und der

Wachmann, der zu ihnen an den Wagen kam, trug eine Hose
mit messerscharfen Bügelfalten und ein perfekt gebügeltes
Hemd ohne das geringste Anzeichen von Transpiration. Er war
groß, muskulös und mit seinem kantigen Kinn recht gut ausse-
hend. Er sah eher wie ein Golfprofi als wie ein Wachmann aus.
Um seine Lippen spielte ein Lächeln, aber sein Blick war
streng und kalt.
»Schöner Tag, was? Und was kann ich für Sie tun?«
Nick zeigte seinen Ausweis und stellte sich und Catherine
vor.
Wie die Empfangsschwester in Sundown wollte auch der
Wachmann noch mehr Referenzen, und Nick sah Catherine
verstohlen an und rollte mit den Augen. Sie lachte, und sie
reichten die gewünschten Ausweise aus dem Fenster.
»Alles in Ordnung«, sagte der Wachmann. »Tut mir Leid,
dass ich so pingelig sein muss, aber wir haben hier ein paar
sehr wichtige Leute unter den Clubmitgliedern und Anwoh-
nern. Wo wollen Sie denn genau hin?«
Nick nannte Daytons Adresse.
»Vielleicht sollte ich Sie anmelden«, sagte der Wachmann.
Wie aus dem Nichts tauchte Brass neben dem Wagen auf
und hielt dem Mann seinen Dienstausweis vor die Nase, der
unwillkürlich einen Schritt zurückwich.
»Melden Sie uns nicht an!«, sagte Brass.
»Also, äh… Captain Brass? Das ist bei uns Usus.«
»Bei uns nicht.«
Catherine schaute in den Seitenspiegel und sah den Taurus
von Brass hinter ihnen in der Einfahrt stehen.
»Sir, wir sind nicht nur ein Country Club. Wir sind eine be-
wachte Wohnanlage, und unsere Anwohner…«
»Wenn Sie uns anmelden, komme ich zurück und verhafte
Sie wegen Behinderung. Haben Sie das verstanden?«

Der Wachmann nickte widerstrebend, zog sich in sein kli-
matisiertes Häuschen zurück und öffnete das Tor, um sie in die
Anlage zu lassen.
Hier im Inneren sah alles nach Wohlstand aus – die Häuser,
die Rasenflächen, die Autos, sogar die Briefkästen. Alles war
größer, schöner, teurer, protziger. Sie kamen am Clubhaus
vorbei, vor dem Golfcarts standen, die ungefähr so viel koste-
ten wie Catherines Auto. Nick fuhr rechts ran und ließ Brass
vorbei, um dann dem Taurus des Captain durch die Anlage
hinterherzufahren, bis sie die Proud Eagle Lane erreichten.
Die Redewendung »My home is my castle« war für ge-
wöhnlich eine Übertreibung, aber in Jerome Daytons Fall traf
es die Sache auf den Kopf: Das ausgedehnte zweistöckige
Haus war doppelt so groß wie die Häuser, die Catherine bisher
in den Wohnanlagen von Las Vegas gesehen hatte, immerhin
einer Stadt, in der es mehr als genug reiche und berühmte
Leute gab. Das riesige Haus hatte einen blasskorallenroten Putz
und hob sich allein dadurch schon von den anderen Häusern
ab, die allesamt etwas kleiner und einheitlich sandfarben ver-
putzt waren.
Mit Brass an der Spitze ging das Trio zur Haustür. Der Cap-
tain hatte schon seit Tagen größte Mühe damit, seine Wut und
Frustration im Zaum zu halten und die CASt-Morde als das zu
sehen, was sie waren: nämlich als Morde, und nicht als einen
persönlichen Affront. Nun war er jedoch regelrecht zornig und
enttäuscht von sich selbst – als hätte er wissen müssen, dass
Jerry Dayton schon vor Jahren aus der Anstalt entlassen wor-
den war. Aber Einrichtungen dieser Art mussten die Polizei
nicht über die Gefahren informieren, die sie auf die Welt los-
ließen. Und den Daytons war es offenbar gelungen, ihren Sohn
in Schach zu halten. Vielleicht war er in einem Zimmer dieser
Burg eingesperrt gewesen wie der Mann mit der Eisenmaske

und hatte als medikamentierter, wenn auch verwöhnter Gefan-
gener in seinem eigenen Haus gelebt.
Aber was war in jüngster Zeit passiert? Nachdem seine bei-
den »Gefängniswärter« das Zeitliche gesegnet hatten?
Nun war der Verrückte der Anstaltsleiter, wenn man so
wollte.
Es konnte natürlich Zufall gewesen sein, dass Dayton an
dem Wochenende Freigang hatte, als Vincent Drake ermordet
wurde. Aber Brass glaubte ebenso wenig an Zufälle wie Gris-
som.
Zufälle waren Gottes Art, einem Kriminalbeamten zu sagen,
dass er Mist gebaut hatte und ihm wahrscheinlich etwas ent-
gangen war, etwas Wichtiges. Vor allem aus diesem Grund war
Captain Brass stinksauer, als er den geschwungenen Gehweg
zu der großen zweiflügeligen Eingangstür von Daytons Haus
hinaufstürmte.
Er ignorierte die Klingel und hämmerte mit der Faust gegen
die Eichentür. Als nicht gleich jemand öffnete, hämmerte er
weiter. Er merkte, dass Nick und Catherine hinter ihm standen,
und er merkte auch, dass ihre Anspannung wuchs.
Dachten sie etwa, er sei dabei, die Nerven zu verlieren?
Nun, vielleicht stimmte es ja – und verdammt, vielleicht
stand ihm das auch zu. Acht Männer waren im Laufe von elf
Jahren getötet worden, und was hatte er dagegen getan? Er und
Vince Champlain, sie hätten CASt schon vor einem Jahrzehnt
schnappen müssen, und sie hatten total versagt!
Und nun war dieser irre, bösartige Dreckskerl wieder unter-
wegs. Aber möglicherweise stand Brass jetzt doch an der
Schwelle zur Lösung des Falls.
Er wollte gerade wieder loshämmern, als die Tür unvermit-
telt aufgerissen wurde. Ein großer, dünner, dunkelhaariger
Mann mit dem Gesicht eines Raubvogels, grünen Augen und

stechendem Blick trat ihnen entgegen. Er trug ein blaues But-
ton-down-Hemd und schwarze Jeans.
Jerome Dayton.
In all den Jahren hatte er sich kaum verändert. Das schmale
Gesicht war weitgehend faltenfrei; in seinem Haar zeigten sich
keine grauen Strähnen. Die einzige Veränderung, die Brass
auffiel, war ein Ohrring an Daytons linkem Ohrläppchen: ein
»D« aus kleinen Diamanten.
Dayton kniff die Augen zusammen, schürzte verächtlich die
Lippen und sagte nur ein einziges Wort. »Brass!« Sein Ton
sprach Bände.
»Lange nicht gesehen, Jerry«, sagte Brass lässig, obwohl
ihm der Magen brannte wie verrückt.
»Wie sind Sie am Tor vorbeigekommen?«, fragte Dayton.
Seine Stimme war ebenso eisig wie der Blick, mit dem er
Catherine und Nick bedachte, bevor er Brass wieder ins Visier
nahm.
»Wissen Sie, Jerry«, begann Brass, »es schmeichelt mir,
dass Sie sich an mich erinnern. Ihr Anwalt war immer darauf
bedacht, uns voneinander fernzuhalten, nicht wahr?«
»Wer sind Ihre Lakaien?«
»Das sind Spurenermittler vom kriminaltechnischen Labor,
Catherine Willows und Nick Stokes. Ich habe ihnen alles über
Sie erzählt. Wir möchten mit Ihnen über… die alten Zeiten
reden. Und die neuen.«
»Nicht ohne meinen Anwalt«, sagte Dayton und wollte dem
Captain die Tür vor der Nase zumachen.
Brass stemmte sich dagegen und konnte es im letzten Mo-
ment verhindern.
Daytons Augen verengten sich zu Schlitzen und auf seinem
Gesicht erschien ein höhnisches Lächeln. »Und ich glaube, ich
sollte umgehend mit meinem Anwalt sprechen – wegen einer
Belästigungsklage.«

Brass setzte sein typisches zerknittertes Lächeln auf.
»Kommen Sie, Jerry, Sie müssen es doch in den Zeitungen und
im Fernsehen gesehen haben. Sie wissen bestimmt, weshalb
wir hier sind. Früher oder später müssen Sie sowieso mit uns
reden. Wir streichen nur die alten Namen von unserer Liste,
und das können Sie genauso gut sofort hinter sich bringen
und…«
»Die alten Verdächtigen, meinen Sie.« Das spöttische Ad-
lergesicht sah sie der Reihe nach an, bevor es sich mit einem
hämischen Lachen erneut Brass zuwandte. »Glauben Sie, ich
wüsste nicht, was Sie wollen? Sie sind wegen C – A – S – t
hier. Hat es Ihnen nicht gereicht, mir einmal das Leben zu
ruinieren?«
Brass reagierte mit einem knappen Lächeln. »Der Ohrring
ist wirklich hübsch, Jerry«, bemerkte er dann. »Ich wusste gar
nicht, dass Sie auf solchen Glitzerkram abfahren.«
Daytons Lächeln wurde breiter, und er zeigte seine perfek-
ten weißen Wolfszähne. »Er ist von meiner Mutter – ein Ring,
den ich umarbeiten ließ. Normalerweise habe ich für Protziges
nichts übrig, das wissen Sie, Captain. Aber ich habe meine
Mutter geliebt.«
»Und Ihren Vater?«
Dayton runzelte die Stirn. »Das Gespräch ist beendet.«
Catherine trat einen Schritt vor. »Mr. Dayton, die Taten, die
Ihnen angelastet wurden, stehen nicht im Zentrum unserer
Ermittlungen. Wir sind nicht hinter dem echten CASt her –
viele glauben sowieso, dass er tot ist oder zumindest weit weg
von Las Vegas lebt.«
»Wirklich«, sagte Dayton denkbar uninteressiert.
»Wir sind hinter dem neuen Killer her – dem Trittbrettfah-
rer.«
»Ja, hinter dem neuen, verbesserten CASt sozusagen«, warf
Nick ein.

»Aber wir mussten uns natürlich noch einmal die alten Ak-
ten vornehmen. Alles nur Routine.«
Brass begriff, worauf Catherine und Nick hinauswollten:
Wenn Dayton der echte CASt war, dann hatten sie ihn ganz
schön geärgert.
Dayton taxierte Catherine und kratzte sich mit der rechten
Hand am Kinn. Der Handrücken war angeschwollen und mit
einem violetten Bluterguss verunziert.
Brass wies mit dem Kopf darauf. »Da haben Sie aber ein
schönes Ehrenabzeichen, Jer.«
Dayton ließ die Hand sinken. »Hab ich mir in der Autotür
eingeklemmt.« Er zuckte mit den Schultern. »Wenn man zer-
streut ist, dann passiert einem manchmal so was Blödes. Ihnen
etwa nicht, Captain?«
»Doch, doch, das kommt mir bekannt vor. Aber warum las-
sen Sie sich nicht von uns helfen? Einer von meinen Kollegen
hier schießt ein Foto von Ihrer Pfote, wir stellen uns als Zeugen
zur Verfügung, und Sie können den Autohersteller verklagen.«
»Lahmer Versuch«, sagte Dayton und schüttelte den Kopf.
»Viel zu lahm. Sind wir fertig?«
»Wenn Sie uns eine DNS-Probe nehmen lassen, ja«, sagte
Nick.
»Dann sind Sie ein für alle Mal sauber«, fügte Catherine
hinzu.
Die Adleraugen nahmen Catherine ins Visier. »Mein Name
brauchte gar nicht reingewaschen zu werden, wenn der Captain
es sich nicht zum Hobby gemacht hätte, mich zu jagen, als ich
noch ein wehrloser Jugendlicher war. Dieser Kerl hat schon
damals meine Familie schikaniert. Ich bin fast froh, dass meine
Eltern tot sind, damit sie diese Demütigung nicht noch einmal
ertragen müssen.«
»Apropos«, sagte Brass. »Wer betreut Sie denn jetzt? Sie
schlucken immer noch Medikamente, nehme ich an…«

»Ich bin ein großer Junge, Captain. Ich kann selbst auf mich
aufpassen, und ja, ich nehme Medikamente – und zwar seit ich
Ihretwegen in diese Anstalt gesteckt wurde.«
»Wenn Sie so dagegen waren«, sagte Catherine, »warum
nehmen Sie die Medikamente dann überhaupt noch?«
Dayton hob sein spitzes Kinn. »Ich streite ja nicht ab, dass
ich gewisse gesundheitliche Probleme habe. Ich leide an einer
Störung der Gehirnchemie, die sich gelegentlich durch etwas
äußert, das Sie Schwachköpfe Geisteskrankheit nennen. Aber
ich überwache meinen Zustand jetzt selbst.«
»Und wie läuft das so?«
»Sehr gut. Es funktioniert. Ich nehme meine Tabletten täg-
lich zu festen Zeiten. Ich habe eine Pillendose mit Fächern für
die einzelnen Tage, wie ein alter Rentner.«
»Dafür muss man sich nicht schämen«, bemerkte Nick.
Daytons grüne Augen blitzten auf und er blähte die Nasen-
flügel. »Wer zum Teufel schämt sich denn hier?«
Nick hob beschwichtigend die Hände. »Wow, wir sind wohl
ein bisschen empfindlich, was?«
Ihr widerspenstiger Gesprächspartner schluckte. Dann sagte
er gefasst: »Ich habe meine Eltern verloren. Sie haben sich nie
von dieser CASt-Katastrophe erholt. Ich habe sie alle beide
sterben sehen, ganz langsam, und dieser Prozess begann bereits
lange bevor sie tatsächlich aufhörten zu atmen.« Dayton richte-
te seinen Blick wieder auf Brass. »Er begann, als sie mich in
diese… Anstalt einweisen mussten. Nun, ich will Ihnen sagen,
welche Fortschritte ich im Kampf gegen meine Krankheit
gemacht habe, Captain. Ich habe Sie lange für den Tod meiner
Eltern verantwortlich gemacht.« Er zeigte mit seinem violett
verfärbten Finger auf den Captain. »Aber jetzt weiß ich… dass
Sie nur Ihre Arbeit gemacht haben. Sie haben versucht, das
Beste für die Gesellschaft zu tun, wie irregeleitet und fehlin-

formiert Sie auch waren. Mein Psychiater hat mich mittlerweile
fast davon überzeugt, dass es nicht Ihre Schuld war.«
»Dann sind Sie nicht mehr sauer auf mich, Jerry?«
Dayton zuckte mit den Schultern. »Nun… die Therapie ist
noch nicht zu Ende.«
»Wie heißt eigentlich Ihr Psychiater?«
»Dass muss ich Ihnen nicht sagen.«
Brass’ schmallippiges Grinsen teilte sein Gesicht beinahe in
zwei Hälften. »Ich kann auch eine richterliche Anordnung
besorgen, Jerry, und dann kommen wir wieder.«
»Sie wollen einen Namen? Ich gebe Ihnen einen!«
»Danke.« Brass holte sein Notizbuch aus der Tasche und
zückte den Stift, um mitzuschreiben.
»Carlisle Deams. D-E-A-M-S. Mein Anwalt.«
Brass steckte das Notizbuch wieder weg.
»Und ich garantiere Ihnen, Captain«, fuhr Dayton mit einem
breiten Grinsen fort, »er ist schneller im Gericht als Sie. Wäh-
rend Sie sich um die Anordnung bemühen, um an meine DNS
zu kommen, wird mein Anwalt bereits eine gerichtliche Verfü-
gung erwirken, damit Sie mich nicht weiter belästigen.«
»Wann haben Sie so viel über das Justizsystem gelernt, Jer-
ry?«
»Ich habe in Sundown angefangen zu studieren. Ich hatte
viel Zeit – und Motivation.«
Brass studierte den Mann. »Was halten Sie davon, wenn ich
einen Streifenwagen vor dem Haus abstelle, bis wir mit unserer
richterlichen Anordnung wieder da sind?«
Dayton holte sein Handy aus der Hosentasche und drückte
eine Taste. Während er wartete, sagte er: »Captain, Captain…
So einfach geht das alles nicht!«
Brass machte auf dem Absatz kehrt, drängte sich an Cathe-
rine und Nick vorbei, die ihn verdutzt ansahen, und marschierte
davon. Schweigend gingen sie hinter ihm her.

Auf dem Weg zum Wagen hörte Brass Dayton sagen: »Car-
lisle? Jerry Dayton.« Dann, nach einer Pause: »Ausgezeichnet.
Ich rufe nur an, um Sie daran zu erinnern, warum Sie so ein
saftiges Honorar von mir bekommen…«
Brass war froh, dass er es geschafft hatte, den Kerl nicht
windelweich zu prügeln. Als er den Tahoe erreichte, waren
Nick und Catherine zu seiner Überraschung direkt hinter ihm.
»Er wirkt gar nicht so verrückt«, sagte Nick.
»Er ist clever«, bemerkte Catherine.
Brass schüttelte den Kopf. »Ich möchte nicht darüber reden
– wir kommen im Labor darauf zurück, okay?«
Er stieg in seinen Wagen und fuhr mit quietschenden Reifen
davon. Einen Block weiter rief er in der Zentrale an und beor-
derte einen Streifenwagen vor Jerry Daytons Haustür.
Wenn der Junge dachte, Brass hätte es nicht ernst gemeint,
dann war er verrückt…
Warrick fand Grissom und Sara im Büro des CSI-Leiters. Sie
sahen sich noch einmal die Tatortfotos von dem Mord an Bell
durch. Warrick ließ sich auf den Stuhl vor Grissoms Schreib-
tisch fallen und seufzte laut und vernehmlich.
»Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht«, verkün-
dete er. »Welche willst du?«
»Die gute«, sagte Grissom.
»Ich habe endlich die Fingerabdrücke auf der Banner-
Schlüsselkarte identifiziert.«
»Sie sind von Perry Bell.«
Grissoms Feststellung nahm Warrick den Wind aus den Se-
geln. »Woher weißt du das?«
»Ich weiß auch, dass die schlechte Nachricht lautet, dass
keine anderen Fingerabdrücke auf der Karte sind.«
Warrick setzte sich auf. Es machte ihn wahnsinnig, wenn
Grissom so mit ihm redete, und das tat der CSI-Leiter sehr oft

– nicht nur mit ihm. »Hat Greg dir schon die Ergebnisse ge-
bracht?«
Grissom schüttelte den Kopf.
Das war die zweite Sache, die Warrick kirre machte: Gris-
som sagte ihm nie, wie er auf diese Dinge kam.
Er ging zur Tür, drehte sich um und drohte seinem Boss mit
dem Finger. »Wehe, wenn das wieder geraten war…«
Auf Grissoms Gesicht erschien ein jungenhaftes Grinsen.
»Kein Grund, sauer zu sein.«
Warrick ging wieder ins Labor und knöpfte sich die restli-
chen Fingerabdrücke von den Tatorten vor. Er musste sie
auseinander sortieren und herausfinden, welche von wem
stammten. Und das wollte er wissen, bevor Grissom es wuss-
te…
Er las alle Abdrücke in den Computer ein und ließ das Pro-
gramm klären, welche gleich waren. Während er wartete,
arbeitete er die Ergebnisberichte auf. Er begann mit dem Be-
richt von Greg, in dem stand, dass das getrocknete Blut in Bells
Haus komplett von Bell stammte.
In dem nächsten Bericht stand, dass die künstlichen Haare,
die bei Enrique Diaz gefunden wurden, mit denen vom Toupet
des ermordeten Perry Bell übereinstimmten.
Wenn Bell wirklich der Nachahmer gewesen war – worauf
seine Banner-Schlüsselkarte, die am Tatort gefunden wurde,
und die künstlichen Haare an Diaz’ Leiche hindeuteten –,
mussten sie dann nur noch nach einem Mörder suchen? Hatte
CASt sich eingeschaltet, um dem Trittbrettfahrer zu zeigen,
wer in dieser Stadt der Böseste der Bösen war – und um ihm
das Handwerk zu legen?
Warrick wusste nicht, was er denken sollte.
Zum Glück hatte er keine Zeit, sich weiter den Kopf zu zer-
brechen. Sein Telefon klingelte und Grissom bat ihn, mit sei-

nem Koffer vorbeizukommen. Ein Polizist hatte das Auto von
Perry Bell gefunden.
Das Parkhaus des Big Apple Casino & Hotel lag auf der Rück-
seite des Hauptgebäudes, das sich an der Kreuzung von Tropi-
cana und Las Vegas Boulevard befand. Das sechsstöckige
Parkhaus war der perfekte Ort, um unauffällig ein Auto loszu-
werden. Der Wagen mit einheimischem Kennzeichen, der fast
mutterseelenallein auf der sechsten Etage stand, war einem
Polizisten erst nach Tagen bei einer Routinerunde durch das
Parkhaus aufgefallen. Als der Beamte das Kennzeichen über-
prüfte, war er auf Brass’ Fahndung gestoßen und hatte den
Fund sofort gemeldet.
Der blaue 2003er Cadillac stand einsam in einer Ecke, als
die drei eintrafen. Während Grissom sich den Kofferraum
vornahm, widmete Sara sich dem Rücksitz, und Warrick arbei-
tete vorn.
Er fand mehrere Haare, die sich in den Nähten der Kopfstüt-
ze verfangen hatten. Vorsichtig nahm er sie mit der Pinzette ab
und tütete sie ein. Dann suchte er das Zündschloss, das Arma-
turenbrett, das Lenkrad und das Handschuhfach nach Finger-
abdrücken ab, staubsaugte sorgfältig den Boden wegen mögli-
cher Fasern und anderer Rückstände und stellte mit Hilfe von
elektrisch aufgeladenen Mylarfolien die Schuhabdrücke an
Gas- und Bremspedal sicher.
Als er damit fertig war, untersuchte er noch einmal die Sit-
ze. An der Vorderkante des Fahrersitzes fand er einen rötlich-
braunen Fleck vom Durchmesser eines Bleistifts, den man nur
sehen konnte, wenn man auf alle Viere ging.
Zuerst fotografierte er den Fleck, dann kratzte er das ge-
trocknete Blut in einen Beweismittelumschlag. Er hoffte, es
stammte nicht von Bell.

Als er Grissom zeigte, was er gefunden hatte, sagte sein
Chef: »Guter Fang!«
Warrick musste grinsen. Aus Grissoms Mund war dies ein
wahrhaft überschwängliches Lob. »Ist doch mein Job.«
»Fahr zurück ins Labor und mach weiter mit deinem Job!
Finde etwas, das uns hilft, den Mörder von Perry Bell aufzu-
spüren!«
»Wird gemacht, Gris.«
Als sie ihre Ausrüstung in den Tahoe luden, bedachte Sara
ihn mit einem schiefen Lächeln. »Schleimer!«, zischte sie.
Aber Warrick grinste nur.

9
Nachdem er von dem Ausflug ins Parkhaus zurückgekehrt war,
katalogisierte Warrick Brown zunächst die Beweisspuren aus
Bells Wagen und schickte die Tüten in die entsprechenden
Labors. Anschließend verglich er den Schuhabdruck von Bells
Bremspedal mit dem Abdruck, den er im Vorgarten von Mar-
vin Sandred sichergestellt hatte.
Fehlanzeige.
Er verglich den Abdruck vom Bremspedal mit Bells Schu-
hen.
Fehlanzeige.
Er verglich Bells Schuhe mit dem Abdruck aus Sandreds
Garten.
Fehlanzeige.
Gut Ding will Weile haben, redete er sich zu.
Hatte Grissom nicht gesagt, Ausdauer sei entscheidend für
gute kriminaltechnische Arbeit? Andererseits hatte der CSI-
Leiter mit Sicherheit nichts für die so genannte »Spielerlogik«
übrig, jene Volksweisheit, die Warrick erworben hatte, bevor
er mit dem Zocken Schluss gemacht hatte: Je länger man nicht
gewann, desto näher war man dem nächsten Gewinn.
Was unter Spielern ein weit verbreiteter Trugschluss war,
war für Warrick eine Theorie.
Sara kam herein und winkte mit einem Bericht. Sie wirkte
putzmunter, was angesichts der Doppelschichten, die sie leiste-
ten, entweder ein Wunder war oder pure Hysterie.

»Ich habe die Ergebnisse von den Haaren, die du an der
Kopfstütze in Bells Wagen gefunden hast«, sagte sie und setzte
sich neben ihn.
Er sah sie fragend an und zog eine Augenbraue hoch.
»Bis auf eins passen alle zu Bells Toupet.«
»Und was ist mit dem einen kleinen haarigen Teufel?«
Sara zuckte mit den Schultern. »Unbekannt.«
»Stammt vielleicht von dem Mörder.«
»Wir wissen mehr, wenn Greg mit dem Haar fertig ist – die
Wurzel war noch dran.«
»Sehr schön.«
Sara nickte fröhlich. »Greg vergleicht die DNS mit der von
dem Blutfleck, den du an dem Sitz gefunden hast.«
»Der vielleicht auch von unserem Mörder stammt. Mensch,
kaum zu glauben! Wir kommen ja tatsächlich weiter.« Warrick
rutschte auf seinem Stuhl hin und her und runzelte nachdenk-
lich die Stirn. »Sara, vergleicht Greg diese DNS auch mit den
Proben von den Original-CASt-Morden?«
»Ja, aber es wird dauern, bis wir die Ergebnisse haben.« Sie
lächelte ihn an. »Ich mache mich auch wieder an die Arbeit.
Ich wollte dich nur schnell informieren.«
»Das freut mich«, sagte er, und das war ehrlich gemeint,
denn es war sehr leicht, sich im Labor in seine Arbeit zu vertie-
fen und sich nicht die Zeit zu nehmen, die anderen auf den
neusten Stand zu bringen. Tunnelblick und das Arbeiten im
luftleeren Raum waren erklärliche, aber viel zu häufig auftre-
tende Störfaktoren in jedem CSI-Labor.
Warrick widmete sich wieder seiner Arbeit und startete das
AFIS zur Überprüfung der Fingerabdrücke aus dem Cadillac.
Während das Programm lief, stattete er Greg Sanders einen
kleinen Besuch ab. Es schadete nie, ein wenig Druck zu ma-
chen.

Greg lümmelte sich auf seinem Schreibtischstuhl, hatte die
Füße auf dem Tisch, den Rolling Stone auf dem Schoß und die
Ohrhörer seines iPods in den Ohren.
Warrick wedelte mit beiden Händen wie ein Fluglotse, und
als Greg ihn endlich bemerkte, warf er seine Zeitschrift hin,
nahm die Füße vom Tisch und die Ohrhörer aus den Ohren.
»Und das willst du alles aufgeben, um mit uns in den Au-
ßendienst zu gehen?«, fragte Warrick.
Greg verschränkte die Arme und lehnte sich zurück. »Weißt
du, Warrick, wenn man in seinem Beruf ein Ass ist und das
Ende der Fahnenstange erreicht hat, muss man damit aufhören
und sich neue Herausforderungen suchen… damit man nicht
versauert.«
»Stimmt.« Warrick nickte und lehnte sich an eine Arbeits-
platte. »Das tust du also im Moment? Versauern?«
»Ich arbeite. Und zwar schwer.«
»Vielleicht solltest du mal Pause machen. Sonst überarbei-
test du dich noch.«
Greg legte den Kopf schräg und zog die Augenbrauen hoch.
»Im Augenblick checke ich deine DNS-Proben.«
»Und was hast du gefunden?«
»Noch nichts. Perfektion braucht ihre Zeit.«
»Verstehe.«
»Die DNS ist noch in der Replikation.«
Warrick nickte und ging zur Tür. »Ich komme in einer
Stunde oder so noch mal vorbei.«
»Sicher, komm nur. Dann können wir noch ein paar Gehäs-
sigkeiten und Witzchen austauschen.«
Warrick blieb in der Tür stehen. »Dann in zwei Stunden?«
»Eher morgen – gegen Schichtende. Aber auch das ist ziem-
lich knapp kalkuliert.«
Warrick verzog das Gesicht. »Und was hast du heute für
mich?«

»Wie wäre es damit: Das Seil, mit dem Perry Bell erdrosselt
wurde, ist anders als die Seile von den vorangegangenen bei-
den Morden. Nützt dir das was?«
Warrick kam noch einmal zurück. »Ja, das muntert mich er-
heblich auf… Inwiefern anders?«
»Es ist vor allem älter.«
Warrick runzelte die Stirn. »Ein älteres Seil?«
»Wahrscheinlich gut zehn Jahre alt. Mit dem Lippenstift ist
es das Gleiche: Die Marke ist zwar auch Ile De France, aber
der Farbton heißt ›Limerick Rose‹, und genau den hat damals
der Original-CASt verwendet.«
»Ich dachte, so was könnte man heute gar nicht mehr kau-
fen.«
Greg nickte. »Ist schon seit mindestens sieben Jahren nicht
mehr auf dem Markt. Der Nachahmer hat den Farbton ›Bright
Rose‹ verwendet – ein neueres Produkt, aber sehr ähnlich.«
Warrick stutzte. »Willst du mir weismachen, dass man einen
zehn Jahre alten Lippenstift noch verwenden kann?«
Greg zuckte mit den Schultern. »Warum nicht? Wenn ihn
jemand gut aufbewahrt hat – fachgerecht gelagert unter kon-
trollierten Bedingungen –, dann ist alles möglich.«
»Warum sollte jemand so etwas tun?«
»Warum sollte jemand ein Opfer ausziehen, quälen und er-
drosseln, es mit Lippenstift beschmieren und das Ganze mit
einer DNS-Probe garnieren?«
»Ich habe noch eine bessere Frage: Warum sollten zwei
Leute so etwas tun?«
»Diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Ich kann dir
nur sagen: altes Seil und alter Lippenstift bei dem neuen
Mord… Glaubst du, der alte Drecksack ist wieder in der Stadt?
Der Original-CASt, meine ich?«

Warrick zuckte mit den Schultern. »Sieht ganz danach aus.
Oder kannst du dir erklären, wieso der Nachahmer plötzlich zu
altem Seil und altem Lippenstift greift?«
»Sag bloß nicht, wir haben hier so etwas wie Freddy gegen
Jason!«
»Greg, das könnte wirklich sein.«
»Vielleicht solltest du Ash holen, damit er für Ordnung
sorgt.«
»Wen?«
»Tanz der Teufel? Kettensäge? Warrick, du hast wirklich
keine Ahnung von großem Kino!«
»Allerdings«, sagte Warrick und verließ den Raum.
Als er wieder im Labor für Fingerabdrücke war, sah er sich
die Ergebnisse des ersten Schwungs Abdrücke an, die er in den
Computer eingelesen hatte. Auf dem Umschlag des CASt-
Briefs an den Banner waren natürlich die Abdrücke von Pa-
quette, Brower und Mydalson. Bells Abdrücke fanden sich in
seinem ganzen Haus und auf der Schlüsselkarte. Abgesehen
von den Fingerabdrücken des Eigentümers gab es keine Finge-
rabdrücke im Haus von Diaz; das Gleiche galt für Sandreds
Haus. Aber das war alles keine Überraschung.
Dann verpasste der Computer Warrick jedoch einen regel-
rechten Schlag ins Gesicht.
Die Abdrücke auf den Klingelknöpfen von Sandred und Di-
az stimmten überein. Und das Schockierende daran war, von
wem sie stammten…
Warrick nahm das Ergebnisprotokoll aus dem Drucker und
machte sich im Eiltempo auf den Weg zu Grissom. Er wusste
nicht, was ihn mehr begeisterte: die Hoffnung, dass der Fall
endlich geknackt war, oder die Tatsache, dass er etwas in der
Hand hatte, das Grissom noch nicht wissen konnte.
Gil Grissom und Jim Brass saßen David Paquette an dem
Tisch im Verhörraum gegenüber. Der Redakteur sah ebenso

zerknittert und mitgenommen aus wie sein grauer Anzug. Seine
roten Augen ließen erkennen, dass Schlaf ein Luxus war, den
er sich nicht gegönnt hatte, seit er in Schutzhaft war.
»Weshalb glauben Sie, dass Perry nicht dem Nachahmungs-
täter zum Opfer gefallen ist?«, fragte er. »Warum halten Sie
den echten CASt für seinen Mörder?«
Brass und Grissom sahen sich an. Grissom nickte und gab
Brass eine Mappe. Der Captain stand auf und reichte sie an
Paquette weiter.
»Ich weiß«, sagte er, »dass ein alter Kriminalreporter wie
Sie schon viele Tatortfotos gesehen hat… aber diese sind wirk-
lich heftig. Das erste Päckchen ist Sandred, dann kommt Di-
az… und dann Perry Bell. Er war ein guter Freund von Ih-
nen…«
Paquette öffnete die Mappe und wurde totenblass, als er die
Fotos durchsah. Bei dem letzten Päckchen angekommen,
schüttelte er den Kopf und stammelte: »Perry… Oh Gott,
Perry…«
Dann schloss er die Mappe und gab sie Brass, der wieder
auf dem Stuhl neben Grissom Platz nahm.
»Ich… Ich verstehe, was Sie meinen«, sagte Paquette. »Die
ersten beiden Morde sind… eindeutig inszeniert. Und der
letzte… Der letzte ist mir nur allzu… vertraut.« Der Redakteur
stützte sich auf einen Ellbogen, schlug die Hand vors Gesicht
und fing an zu weinen.
Brass stand wieder auf und schob eine Packung Taschentü-
cher über den Tisch. Dann warteten er und Grissom ein paar
Minuten.
Paquette nahm zwei Taschentücher, tupfte sich die Augen
ab und putzte sich die Nase. Dann sammelte er sich und fragte:
»Wie kommen Sie zu der Annahme, dass dieser… dieser
Wahnsinnige es auch auf mich abgesehen haben könnte?«

»Sie sind der Koautor des CASt-Buchs! Und nachdem der
Täter sich an Perry vergriffen hat, ist es nur wahrscheinlich,
dass Sie auch auf seiner Liste stehen.« Brass ließ seine Worte
bei Paquette sacken. »Aber es ist natürlich auch möglich«, fuhr
er dann fort, »dass Perry der Trittbrettfahrer war.«
Paquettes gerötete Augen wurden riesengroß. »Ist das Ihr
Ernst? Das darf doch wohl nicht wahr sein! Perry? Perry Bell?«
»Perry war ein guter Reporter, der schon bessere Zeiten er-
lebt hatte, und anscheinend hatte er ein Alkoholproblem«,
erklärte Grissom. »CASt wieder in die Schlagzeilen zu bringen,
hätte ihm zu neuem Ruhm verholfen. Verzweifelte Menschen
sind zu allem fähig.«
»Gil«, entgegnete Paquette, »Sie kannten Perry. Er war ein
guter Mensch. Er hatte gar nicht den nötigen Irrsinn und schon
gar nicht den Mumm, um diese zwei Morde zu verüben.«
»John Wayne Gacy hat Kinder im Krankenhaus besucht und
sie mit seiner Clownnummer aufgeheitert. Und er war bei der
Industrie- und Handelskammer«, bemerkte Brass.
»Nein, Perry war es nicht. Auf keinen Fall.«
»Dave, ich bin geneigt, Ihnen zuzustimmen. Gil vermutlich
auch. Aber das ist vielleicht zu kurz gedacht.«
Der Redakteur stutzte. »Wie meinen Sie das?«
»Ich meine, der echte CASt könnte, als er merkte, dass ein
Nachahmer ihm die Schau stahl, zu der logischen Annahme
gelangt sein, dass Sie oder Perry dahinter stecken.«
»Perry als Trittbrettfahrer? Oder ich? Warum, zum Teufel?«
»Abgesehen von einer kleine Schar Polizisten wussten Sie
und Perry mit Abstand am meisten über die CASt-Morde…
zum Beispiel das mit dem abgeschnittenen Finger und dem
Sperma.«
Paquette wusste nicht, was er sagen sollte. Nachdenklich
rieb er sich das stoppelige Kinn. »Dann… glauben Sie wirk-
lich, dass ich der Nächste auf seiner Liste bin?«

In diesem Moment betrat Warrick leise den Raum.
Grissom sah ihn scharf an, denn dies war nicht nur eine un-
zulässige Störung, sondern auch ein Verstoß gegen die Etikette,
aber Warrick kam auf ihn zu und raunte ihm ins Ohr: »Ich
weiß, ich weiß, tut mir Leid… aber das hier kann nicht war-
ten.« Er warf Paquette einen Blick zu, dann übergab er seinem
Chef den Ausdruck.
Grissom überflog das Blatt und reichte es an Brass weiter,
der sich ebenso rasch mit dem Inhalt des Berichts vertraut
machte. Warrick verließ inzwischen wieder den Raum.
Brass sah Paquette an. »Reden wir über Mark Brower.«
»Was ist mit Mark?«, fragte Paquette.
»Ist es möglich, dass er Zugang zu den zurückgehaltenen
Details der Originalmorde hatte?«
»Meines Wissens nicht – er war ja damals, als die Morde
geschahen und als Perry und ich das Buch geschrieben haben,
noch gar nicht dabei.«
»Hat Mark Bell vielleicht unauffällig ausgehorcht… als Bell
betrunken war oder so?«
Paquette dachte darüber nach. »Möglich. Als Perry das
Buch nachdrucken lassen wollte, war die Rede davon, es zu
überarbeiten, aber dazu kam es nicht, weil die Sache so schon
kostspielig genug für ihn war.«
Nach kurzer Überlegung fragte Grissom: »Dann haben Per-
ry und Mark, als die Überarbeitung noch im Raum stand, mög-
licherweise über die Details gesprochen, die in der ersten Aus-
gabe nicht erwähnt wurden?«
»Das weiß ich nicht, Gil. Aber es ist möglich. Sie verdächti-
gen doch jetzt nicht Mark?«
»Warum nicht?«, entgegnete Brass.
»Er ist einer meiner besten Mitarbeiter. Er ist ein verlässli-
cher Kerl.«
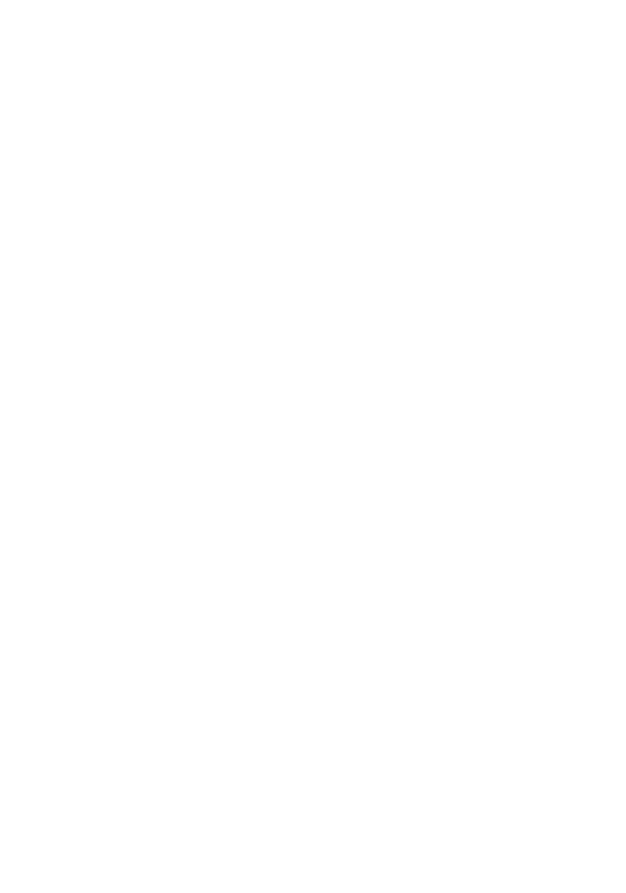
Grissom legte den Kopf schräg und zog eine Augenbraue
hoch. »Wirklich? Vielleicht können Sie mir erklären, wie seine
Fingerabdrücke auf die Klingel von Marvin Sandred gelangt
sind?«
»Und auf die von Enrique Diaz?«, ergänzte Brass.
Paquette sah sie ungläubig an und schüttelte den Kopf. »Oh
nein, das ist einfach zu verrückt… das glaube ich keine Sekun-
de!«
»Überlegen Sie es sich noch mal«, entgegnete Brass und gab
dem Redakteur den Bericht.
David Paquette beugte sich vor und hielt sich das Blatt mit
beiden Händen vor die Nase. In seinem Gesicht spiegelte sich
erst Fassungslosigkeit, dann Wut, während er den Bericht las,
der die Übereinstimmung der Fingerabdrücke von beiden
Klingelknöpfen mit denen bestätigte, die Warrick im Büro des
Banner genommen hatte.
»Verfluchter kleiner Bastard!«, rief Paquette und wedelte
mit dem Papier. »Dieser psychotische, miese Dreckskerl!«
Grissom und Brass wechselten vielsagende Blicke. Sie fan-
den beide, dass die Meinung des Redakteurs über Brower
ziemlich rasch umgeschlagen war.
»Wie erklären Sie sich das?«, fragte Brass.
»Was könnte Mark Brower dazu gebracht haben, CASt
nachzueifern?«
»Soll das ein Scherz sein?«, fuhr der Redakteur auf. »Das ist
ja wohl sonnenklar! Mark wollte CASt reaktivieren und Perry
die Schuld in die Schuhe schieben.«
»Wozu denn?«, fragte Brass.
»Denken Sie doch mal nach! Er übernimmt die Kolumne
und bringt sich in die perfekte Position, um selbst die Fortset-
zung des Buchs zu schreiben… als der Kriminalreporter, der
mit Perry ›dem CASt-Nachahmer‹ Bell zusammenarbeitete.«

Insgeheim entsetzt fragte Grissom: »Für etwas Vergängli-
ches und Bedeutungsloses wie Ruhm wäre Brower zu derart
bizarren, bösartigen Taten in der Lage?«
»Sie sind doch nicht naiv, Gil. Natürlich wäre er das.«
Brass verzog angewidert den Mund. »Kein Wunder, dass
Ihnen Insekten lieber sind«, raunte er Grissom zu.
»Ich würde gern, äh… noch eine Weile in Schutzhaft blei-
ben, wenn Sie nichts dagegen haben.«
»Ganz und gar nicht«, entgegnete Brass. In diesem Moment
klingelte sein Handy. Er verließ den Raum, um ungestört zu
telefonieren.
»Perry Bells Kolumne war auf dem absteigenden Ast. Wa-
rum sollte Mark Brower sie als Aufstiegschance sehen, für die
es zu töten lohnt?«, setzte Grissom die Befragung fort.
Paquette schüttelte traurig lächelnd den Kopf. »Bell war am
Ende seiner Karriere, seines Lebens. Für Brower wäre es ein
Sprungbrett. Man muss bedenken, dass wir heute in einer
anderen Welt leben als damals, als Perry und ich das Buch
geschrieben haben. Heute hat man viel größere Chancen bei
Film und Fernsehen, und zusätzlich zu dem Gewinn aus dem
Buchverkauf bekäme er Redehonorare, die Talkshows würden
das Thema aufgreifen, und er würde vielleicht sogar bei Leno
oder Letterman landen. Mark Brower wäre – wenn der Plan
aufgegangen wäre – ein Star gewesen!«
»Das wird er vielleicht auch«, bemerkte Grissom leise,
»wenn wir ihn festnehmen.«
»Verdammt richtig!«, entgegnete der Redakteur. »Siehe Ri-
chard Ramirez, David Berkowitz, Aileen Wuornos. Mit all den
Filmen, Dokumentationen, Fernsehsendungen und Büchern,
die es über sie gibt, haben sie mehr Publicity als so mancher
Mega-Star!«
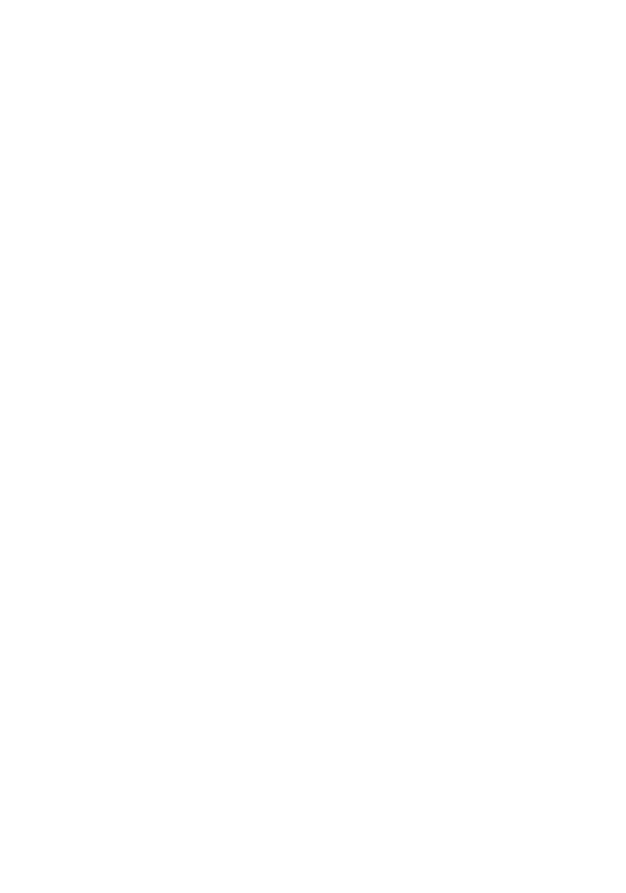
Grissom fragte sich, ob er nun in der Grauzone der Infamie
angekommen war, und sah zur Tür, als Brass auch schon wie-
der hereinkam. Er machte ein stinksaures Gesicht.
»Was ist?«, fragte Grissom.
Brass war beinahe außer sich vor Wut. »Ich hatte doch einen
Streifenwagen zur Beobachtung von Dayton abgestellt! Er ist
ihnen entwischt! Er ist aus dem Haus gekommen und wegge-
fahren, und unsere Männer wurden lange genug am Tor auf-
gehalten, damit Dayton sie abschütteln konnte. So ein Mist!«
Paquette faltete die Hände und schlug die Augen nieder.
Sein Verhalten – dieses Bemühen, sich unsichtbar zu ma-
chen – war Brass verdächtig. Er ging auf den Redakteur los.
»Sie wussten, dass er draußen war! Nicht wahr, Dave?«
Der Redakteur zuckte mit den Schultern und schaute auf
seine Hände.
»Sie wussten es!«, schrie Brass, und seine Stimme hallte
von den Wänden wider.
Paquette wandte sich ab, dann platzte er heraus: »Also gut!
Ja!« Er warf die Hände in die Luft. »Ja, verdammt, ich wusste
es!«
Brass atmete tief durch. »Hat Perry Bell gewusst, dass einer
der Hauptverdächtigen im Fall CASt frei herumlief?«
»Nein.«
»Und Brower?«
»Soweit ich weiß, nicht. Aber bei diesem Bastard ist an-
scheinend alles möglich.«
»Wie lange wussten Sie, dass Dayton draußen war?«
Paquette ließ den Kopf hängen. »Ich erfuhr es… nicht lange
nach seiner Entlassung. Vielleicht einen Monat später.«
»Sieben Jahre«, bemerkte Grissom.
Der Redakteur nickte.
»Und es ist Ihnen nie in den Sinn gekommen, es uns zu sa-
gen?«

»Ich dachte nicht, dass es für Sie von Belang ist.«
Brass schlug mit der flachen Hand auf den Tisch, und Pa-
quette zuckte zusammen.
»Nicht mal, als es wieder mit den Morden losging?«, fragte
der Captain.
»Wir dachten doch alle, es wäre ein Nachahmer.« Der Re-
dakteur zuckte mit den Schultern. »Sehen Sie, die Morde hat-
ten aufgehört. Dayton kam aus dem Irrenhaus, und es passierte
nichts Schlimmes. Sie wissen vielleicht noch, was in unserem
Buch stand. Sie haben es doch gelesen?«
»Ich habe es gerade noch einmal gelesen«, entgegnete Gris-
som. »Sie hielten Dayton nicht für tatverdächtig. Sie haben ihm
ein ganzes Kapitel gewidmet, in dem Sie schilderten, dass die
Polizei auf der falschen Fährte war.«
Brass stützte sich auf den Tisch. »Oh… Dave, das hätte ich
fast vergessen. Sie haben geschrieben, Vince und ich… Wie
war noch die Formulierung? Wir würden Jagd auf Jerome
Dayton machen, einen Unschuldigen mit psychischen Proble-
men, oder so?«
Paquette richtete sich mit rotem Gesicht auf. »Verdammt,
Brass, Dayton ist unschuldig! Das wissen Sie. Er war schließ-
lich schon in Sundown, als Drake ermordet wurde.«
Grissom hatte noch nie ein furchtbareres Lächeln bei Brass
gesehen. »Wirklich, Dave? Ihr Enthüllungsjournalisten wisst ja
immer alles besser, was? Aber leider ist euch ein nicht unwe-
sentliches Detail entgangen: Jerome Dayton hatte an dem
Wochenende Freigang, als Drake getötet wurde.«
»Was? Oh nein! Oh, zum Teufel… nein…«
»Doch, zum Teufel, Dave.«
Paquette sank erschüttert auf seinem Stuhl zusammen, und
ihm kamen erneut die Tränen. »Ich schwöre, Jim, ich dachte, er
sei unschuldig.«
Brass reagierte nicht.
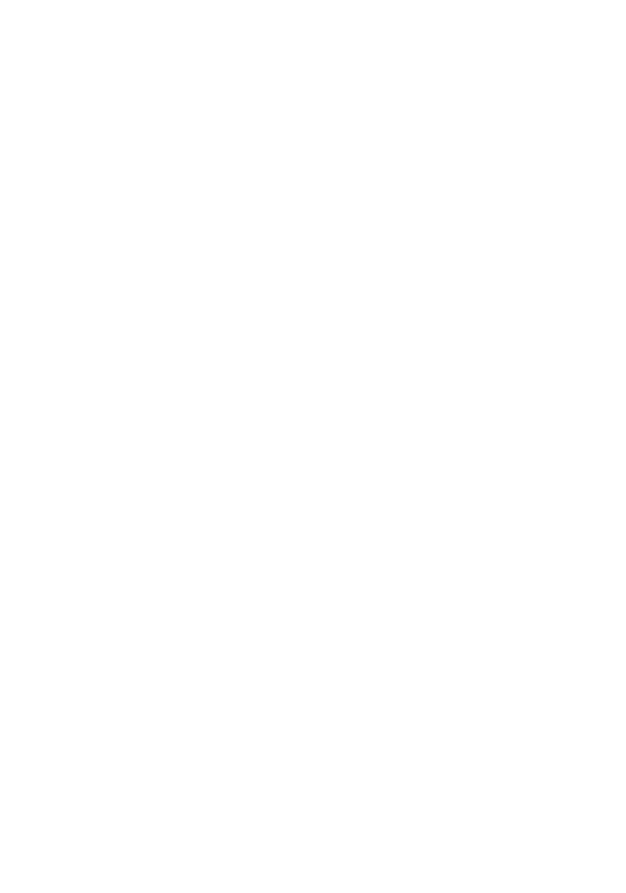
»Wo ist Brower jetzt, Dave? Ist er im Büro?«, fragte Gris-
som.
Der Redakteur seufzte. »Normalerweise schon… Aber wenn
er an einer Geschichte arbeitet, kann er auch irgendwo unter-
wegs sein.«
»Um Bericht zu erstatten?«, fragte Brass sarkastisch. »Oder
um selbst Schlagzeilen zu machen?«
Dann schickte er den kreidebleichen Reporter zurück in sei-
ne Zelle.
Als er mit Grissom den Korridor hinunterging, holte er sein
Handy heraus und setzte Detective Sam Vega darauf an, Bro-
wer beim Banner ausfindig zu machen. Dann forderte er zwei
Streifenwagen an.
»Wollen Sie sich Brower schnappen?«
»Allerdings. Falls er der Nachahmer ist, schreit sein Haus
förmlich nach einem Besuch des CSI. Würden Sie Sara und
Warrick zusammentrommeln und mitkommen?«
»Nichts lieber als das!«
Mark Brower wohnte in Paradise in der Boca Grande, nicht
weit von der Hacienda Avenue. Boca Grande – Großmaul,
dachte Brass. Wer kam eigentlich auf die Idee, einer Straße so
einen Namen zu geben?
Den kleinen Bungalow mit angebauter Garage hätte ein
Makler vermutlich als gemütlich bezeichnet und auf die Nähe
zur Tomiyasu-Grundschule verwiesen; ein potenzieller Käufer
hingegen fände ihn wahrscheinlich winzig. Von der Straße sah
es so aus, als sei niemand zu Hause. Die Vorhänge waren
zugezogen, alle Türen verschlossen. Der Rasen vor dem Haus
war seit einiger Zeit nicht gemäht worden, aber das spielte im
Grunde keine Rolle, denn er war braun und vertrocknet.
Brass blockierte die Einfahrt mit dem Taurus, während War-
rick den Tahoe des CSI am Straßenrand parkte. Er und Gris-

som stiegen aus und gingen zu Brass, der an seinem Wagen
wartete. Die beiden Streifenwagen waren bereits eingetroffen,
und die uniformierten Beamten kamen rasch zu ihnen herüber.
»Sie übernehmen die Rückseite!«, wies Brass die beiden Po-
lizisten an, aber bevor er fortfahren konnte, klingelte sein
Handy. »Brass.«
»Vega hier. Brower ist nicht im Büro, und seit gestern Mit-
tag hat ihn niemand mehr gesehen.«
Brass stieß einen Fluch aus. »Gut, Sam – danke! Hoffen wir,
dass er zu Hause ist.« Er beendete das Gespräch und setzte die
anderen ins Bild.
»Dann haben wir wohl hier die zweitgrößte Chance«, sagte
Warrick.
Die beiden Streifenpolizisten – Carl Carrack und ein anderer
Veteran namens Ray Jalisco – waren links und rechts um den
Bungalow nach hinten verschwunden. Jalisco gab über Funk
durch, dass er in das Garagenfenster geschaut habe und Bro-
wers Auto weg sei.
Brass wartete, bis die beiden Männer auf der Rückseite des
Hauses angekommen waren und sich erneut gemeldet hatten,
bevor er mit Warrick, Sara und Grissom zum Haus ging.
Sara und Grissom blieben an der Garage stehen, während
Brass und Warrick zur Tür vorrückten. Warrick stellte sich
links davon auf, Brass auf der anderen Seite.
Dann klopfte Brass kräftig an die Tür. »Mark Brower, ma-
chen Sie auf! Polizei!«
Nichts rührte sich.
»Irgendwas gesehen?«, fragte Brass in sein Funkgerät.
Carrack meldete sich sofort. »Nichts, Captain, ziemlich tote
Hose hier hinten.«
Brass klopfte erneut an die Tür.
Sie warteten.
Nichts geschah.

Warrick wies mit dem Kopf Richtung Tür, um Brass zu sig-
nalisieren, dass er prüfen wollte, ob sie abgeschlossen war.
Brass gab nickend seine Zustimmung. Er hielt seine Pistole
mit beiden Händen und richtete den Lauf in den Himmel.
Warrick hatte seine Pistole in der linken Hand und legte die
rechte an den Türknauf.
Zu ihrer Überraschung war die Tür nicht abgeschlossen und
ließ sich mühelos öffnen.
Warrick gab ihr einen kleinen Schubs, und Brass betrat mit
der Pistole im Anschlag als Erster das Haus.
Durch die offene Tür und die zugezogenen Vorhänge drang
nur wenig Licht in den dunklen Raum, aber Brass sah auf den
ersten Blick, dass sich das Haus in einem chaotischen Zustand
befand.
Scheiße!, dachte er. Der nächste verdammte Tatort…
Warrick war dem Captain gefolgt und knipste sofort den
Lichtschalter neben der Tür an. Wenn Gefahr im Verzug war,
durfte man auf eventuelle Fingerabdrücke keinerlei Rücksicht
nehmen.
Als die Deckenlampe anging, offenbarte sich ihnen ein klei-
nes Wohnzimmer mit umgekippten, zertrümmerten Möbeln
und verstreut herumliegenden Zeitschriften, Zeitungen, Bilder-
rahmen und Nippes. Auch der Fernseher war demoliert und
umgestoßen worden.
Brass lauschte, lauschte und lauschte, aber außer dem Ti-
cken von ein, zwei Uhren war nichts zu hören. Vom Wohn-
zimmer ging es geradeaus ins Esszimmer, wo drei umgekippte
Stühle um einen runden Tisch lagen. Der vierte Stuhl war
komplett aus dem Leim und vermutlich als Waffe benutzt
worden. Brass und Warrick schlichen mit ihren Pistolen im
Anschlag schweigend durch das Wohnzimmer. Vom Esszim-
mer ging ein Flur nach links ab, und die Tür auf der anderen
Seite führte in die Küche.

Sie bemühten sich, keine Beweisspuren zu zerstören, doch
zunächst bestand ihre Aufgabe darin, das Haus komplett zu
kontrollieren und Brower – falls er da war – in Gewahrsam zu
nehmen. Brass bedeutete Warrick, den Flur im Auge zu behal-
ten, und bewegte sich auf die Küche zu. Warrick folgte ihm. Er
achtete darauf, wohin er seine Füße setzte, beobachtete aber
sorgsam den Flur, damit sie nicht überraschend von dort ange-
griffen werden konnten.
Die Küche, in die durch die Fenster über der Spüle das Son-
nenlicht hereinfiel, sah noch chaotischer aus als die anderen
Zimmer. Es war fast, als sei ein Tornado durch das Haus ge-
fegt, ohne Wände und Dach zu beschädigen. Brass entdeckte
auch Blutflecken auf dem Boden und den Arbeitsflächen – die
jedoch eher auf eine Schlägerei hindeuteten als auf einen abge-
hackten Finger. Und er kam nicht umhin, den Geruch von
verdorbenem Essen wahrzunehmen, der aus dem offen stehen-
den Kühlschrank kam.
Rechts befand sich eine geschlossene Tür, vermutlich zur
Garage, und die Tür links führte möglicherweise in ein Schlaf-
zimmer. Da Jalisco bereits in das Garagenfenster geschaut
hatte, ging Brass zuerst auf die andere Tür zu.
Während Warrick Küche und Flur im Auge behielt, öffnete
Brass die Tür und betrat ein aufgeräumtes Gästezimmer, in
dem auf der einen Seite ein Einzelbett stand, auf der anderen,
neben dem Fenster, ein Schreibtisch mit Computer. Brass sah
im Schrank nach, fand aber nur ein paar Kleiderbügel und eine
Kiste Kopierpapier.
»Sauber!«, rief Brass und kam wieder in die Küche.
Als Nächstes nahmen sie sich die Garage vor, aber auch dort
war niemand. Sie gingen durch das Esszimmer wieder zurück
in den Flur und kontrollierten die beiden Schlafzimmer, das
Badezimmer und sämtliche Schränke und Abstellkammern.
Mark Brower war nicht zu Hause, aber es war mehr als eindeu-

tig, dass irgendjemand dort gewesen war – zwei Personen, um
genau zu sein.
Als sie sich vor dem Haus mit den anderen trafen, sagte
Brass: »Es hat eine üble Schlägerei da drin gegeben, aber jetzt
ist niemand mehr im Haus… Und wie es in der Küche riecht,
war auch schon eine ganze Weile niemand mehr da.«
»Glauben Sie, CASt hat herausgefunden, dass Brower der
Nachahmer ist?«, fragte Warrick.
Brass zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht, aber ir-
gendetwas war hier los… oder der Kerl ist noch schlechter in
Haushaltsführung als ich. Wir werden weiter nach ihm suchen.
Ich erkundige mich bei der Kfz-Zulassungsstelle nach seinem
Auto und gebe eine Fahndung raus.«
Grissom wandte sich an Warrick und Sara. »Wo wir schon
mal da sind, nehmen wir uns das Haus vor. Vielleicht finden
wir etwas. Sara, Schlafzimmer und Bad. Warrick, Ess- und
Wohnzimmer. Ich helfe euch, sobald ich die Küche erledigt
habe.«
Brass ging zu seinem Wagen, während Grissom seine Aus-
rüstung aus dem Tahoe lud. Als die drei Spurenermittler auf
das Haus zugingen, sagte Grissom: »Warrick, du warst schon
drin, also geh du bitte nach hinten und mach das Garagentor
auf, damit ich von dort in die Küche kann.«
»Sofort.«
Es waren schon genug Leute durch das Haus getrampelt,
und weil auch Sara nichts anderes übrig blieb, als den Vorder-
eingang zu nehmen, um ihre Aufgabe zu erledigen, wollte
wenigstens Grisson nicht auch seine Abdrücke noch an unnöti-
gen Stellen im Haus hinterlassen.
Keine Minute später öffnete sich langsam das Garagentor,
und Grissom schlüpfte mit eingezogenem Kopf darunter hin-
durch. Die Garage war sauber und aufgeräumt. An der rechten
Wand hing ein Fahrrad, hinten stand eine kleine Werkbank,

links standen ein Rasenmäher und ein Mülleimer aus Plastik.
Wo normalerweise das Auto stand, prangte ein frischer Ölfleck
von der Größe eines Softballs auf dem Betonboden.
Grissom betrat die Küche und machte sich ein Bild von dem
Ausmaß der Zerstörung.
Ein kleiner Tisch, gerade groß genug für zwei, war von sei-
nem Platz am Fenster in die Ecke geschoben worden, ein Stuhl
war umgekippt. Ein anderer, dessen Lehne abgebrochen und
unter den Kühlschrank gerutscht war, lag neben der Tür zur
Garage. Außerdem standen die Schranktüren offen, und Un-
mengen von Gewürzen und Pülverchen waren auf den Boden
und die Arbeitsflächen verschüttet worden. Auch ein Glas
Gelee war zu Bruch gegangen, und man hätte fast meinen
können, in der Küche sei eine rote Splitterbombe hochgegan-
gen.
Der geflieste Boden war eine erstklassige Fundgrube für
Schuhabdrücke, und Grissom packte hochmotiviert seine My-
larfolien aus. Er breitete die erste auf dem Boden aus und legte
die beiden Elektroden an. Insgesamt verbrauchte er fünf lange
Folien, bis er mit der Küche fertig war.
Als Nächstes fotografierte er den Raum aus unterschiedli-
chen Perspektiven, bevor er auf alle Viere ging und die Dinge
unter die Lupe nahm, die bei dem Kampf auf dem Boden ge-
landet waren. Dann sammelte er Glasscherben ein, auf denen
sich möglicherweise Fingerabdrücke befanden, und packte
auch Teile des kaputten Mobiliars und den Toaster ein. Er
stellte Proben von den Blutflecken sicher und pickte akribisch
Fasern und diverse Pülverchen auf, bei denen es sich jedoch
vermutlich nur um Gewürze handelte.
Dann sah er sich noch einmal aufmerksam um. Er hatte den
Boden untersucht, die Arbeitsflächen, den kleinen Tisch und
die Stühle und hatte sogar in den offenen Schränken nach
Fingerabdrücken gesucht. Nachdem er bereits alles zusammen-

gepackt hatte und gehen wollte, fiel sein Blick auf die Spüle.
Er hatte doch hineingeschaut, oder etwa nicht? Grissom ging
seine Arbeitsschritte noch einmal in Gedanken durch, und
dabei wurde ihm klar, dass er sich in der Hoffnung auf Finge-
rabdrücke ganz auf die Blutschmierer auf der Arbeitsfläche
konzentriert hatte.
Er zog seine Mini-Maglite aus der Tasche und ging noch
einmal an die Spüle. Auf der Seite, wo sich der Mülleimer
befand, war der Abfluss mit einem fest sitzenden Plastikdeckel
verschlossen. Das Becken selbst war leer, und der Mülleimer,
in den die ganze Schweinerei gehört hätte, war vollkommen
unberührt, aber Grissom waren schon ganz andere Merkwür-
digkeiten begegnet.
In dem rechten Spülbecken befand sich ein Mikrowellenge-
fäß mit Hühnersuppe, das offenbar von dem Abtropfbrett hin-
eingekippt war. Den Siebkorb hatte Grissom auf der anderen
Seite der Küche gefunden und bereits eingepackt. Wahrschein-
lich hatte ein Kontrahent den anderen damit beworfen.
Als Grissom den Klumpen Nudeln betrachtete, der den Ab-
fluss verstopfte, sah er plötzlich etwas glitzern.
Vorsichtig schob er die Nudeln zur Seite und leuchtete mit
der Taschenlampe in die Spüle, während er den glitzernden
Gegenstand mit der Pinzette zu fassen versuchte.
Das Ding durfte ihm auf keinen Fall in den Abfluss rut-
schen. Er würde natürlich den Siphon abschrauben, wenn es
sein musste, aber darauf konnte er gut verzichten. Langsam,
ganz behutsam drückte er die Pinzette zusammen, und als er
das Fundstück hochhob, stellte er fest, dass es sich um ein
kleines, mit Diamanten besetztes »D« handelte. Er drehte es
um und sah auf der Rückseite eine Stelle, an der offenbar ein
Metallstift abgebrochen war. Das war wohl mal ein Ohrstecker,
dachte er. Aber warum hatte Brower einen Ohrring mit einem
»D«?

Grissom tütete das Schmuckstück ein. Jerome Dayton war
ein möglicher Kandidat für dieses »D«, aber es war ein unge-
wöhnliches Schmuckstück für einen Mann. Er würde es Brass
später zeigen. Nun brauchten Sara und Warrick erst einmal
seine Hilfe bei den restlichen Zimmern.

10
Jim Brass ging nervös vor Browers Haus auf und ab. Zum
ersten Mal hatte er bei diesem Fall, der bis an die Anfänge
seiner Laufbahn in Las Vegas zurückreichte, das Gefühl, dass
das Ende in Sicht war. Zwar hatten sie in Browers Haus weder
den Trittbrettfahrer noch den echten CASt gestellt, aber die
Kampfspuren deuteten darauf hin, dass alle beide dort gewesen
waren.
Würde ihm CASt noch einmal entwischen? Würde er in
zehn Jahren immer noch mit diesem Fall beschäftigt sein?
Bisher war ihnen jedes Mal, wenn sie der Lösung näher ge-
kommen waren, der Teppich unter den Füßen weggezogen
worden…
Und so schritt Jim Brass auf und ab, wütend und euphorisch
zugleich, frustriert und zufrieden, besorgt und hoffnungsvoll.
Als die Kollegen vom CSI ihre Ausrüstung im Wagen verstau-
ten, blieb Brass schließlich neben dem SUV stehen.
Grissom nahm eine Beweismitteltüte aus seinem Koffer und
kam nachdenklich auf ihn zu. »Du kennst Brower doch«, sagte
er. »Steht ihm irgendjemand nahe, dessen Name mit ›D‹ an-
fängt? Jemand, der so etwas tragen könnte?«
Brass warf einen Blick auf die Tüte: Der glitzernde Dia-
mantohrring war beschädigt, aber er erkannte ihn auf Anhieb
wieder.
»Die einzigen Namen, die mir im Zusammenhang mit CASt
einfallen, sind David Paquette und Jerome Dayton«, sagte
Grissom. »Aber das hier sieht mir eher nach einer Frau aus.«

»Es gehörte Daytons Mutter«, entgegnete Brass. »Unser
Sonnyboy hat sich einen Ohrring davon machen lassen… und
ich habe das Ding heute noch an seinem Ohr gesehen.«
Die beiden Männer sahen sich eine Sekunde lang in die Au-
gen, um ihre Lippen spielte ein leises Grinsen, und sie nickten
sich entschlossen zu… und dann setzten sie sich in Bewegung.
Grissom knallte die Hecktüren des Tahoe zu, Brass lief zu
seinem Taurus und befahl Carrack und Jalisco, ihm zu folgen.
Die anderen Polizisten ließen sie zur Bewachung des Hauses
zurück.
»Einsteigen!«, rief Grissom Warrick und Sara zu. »Kann
sein, dass CASt jetzt vor den Vorhang tritt!«
Die Fahrzeugkolonne – Brass mit seinem Tahoe, der SUV
des CSI und ein Streifenwagen – raste mit heulenden Sirenen
durch die Stadt; Hacienda, Sandhill, dann nach Norden Rich-
tung Tropicana und wieder nach Osten auf die 1-515. Brass
forderte Verstärkung an und jagte mit 130 Sachen die Auto-
bahnauffahrt hoch. Als er in nördlicher Richtung davonbretter-
te, hatte er fast 160 drauf.
Auf der Höhe von Pecos Road und Steward Avenue machte
die Interstate einen Bogen nach Westen, und Brass schlängelte
sich im Eiltempo durch den Verkehr auf Daytons Prachtbude
zu. Inzwischen hatten sich hinter Grissom zwei weitere Strei-
fenwagen der Kolonne angeschlossen. Brass fegte mit über 80
die Abfahrt zum Town Center Drive hinunter, flitzte am Town
Center vorbei und erreichte endlich das TPC am Canyons-
Golfplatz. Der Wachmann am Tor war so weise, die Schranke
zu öffnen, als er die Sirenen hörte und ihm klar wurde, dass die
heranbrausenden Wagen nicht das Tempo drosseln, geschwei-
ge denn an seinem Häuschen anhalten würden.
Als sie sich der Wohnanlage des Clubs näherten, schaltete
Brass die Sirene ab; Grissom und die Beamten in den Streifen-
wagen folgten umgehend seinem Beispiel. Brass kam als Erster

mit quietschenden Reifen vor Daytons Einfahrt zum Stehen.
Das Garagentor war zu, und vor dem palastähnlichen Gebäude
parkte ein ihm wohlbekannter schwarzer SUV.
Als Brass quer über den Rasen auf das Haus zulief, spran-
gen Sara und Warrick aus dem Tahoe und rannten hinter ihm
her. Grissom schlug einen anderen Weg ein und lief die Ein-
fahrt hoch. Auf der Veranda vor der Haustür standen Catherine
und Nick, die sich verblüfft zu ihren Kollegen umdrehten.
Brass blieb an der Treppe stehen und sah die beiden fragend
an. Er dachte, sie hätten seinen Funkspruch mit der Bitte um
Verstärkung gehört. »Wie haben Sie es geschafft, vor mir da zu
sein?«
»Wir wussten gar nicht, dass Sie hierher unterwegs waren«,
sagte Catherine und zog die Augenbrauen hoch. »Wir wollten
uns eine DNS-Probe von Dayton holen.«
»Haben Sie denn eine richterliche Anordnung?«, fragte
Brass erstaunt.
»Ja, von Richter Landry«, entgegnete Catherine.
Brass runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf. »Wir hat-
ten doch nur die verletzte Hand…«
»Und die Info, dass Dayton an dem Wochenende Freigang
hatte, als Vincent Drake getötet wurde.«
»Daytons Vater hat seinerzeit dafür gesorgt, dass dem Rich-
ter eine Position am Bundesgericht verwehrt blieb«, bemerkte
Nick. »Und Carlisle Deams, der Anwalt der Daytons, hatte
auch seine Finger im Spiel.«
Brass musste unwillkürlich grinsen. »Sehr pfiffig, Cath.«
Sie lächelte verschmitzt. »Gil hasst zwar solche Winkelzü-
ge, aber ich bin in dieser Hinsicht sehr flexibel, Jim.«
»Ich habe schon geklopft und geklingelt«, sagte Nick und
wies mit dem Daumen zur Tür. »Der Knabe scheint nicht da zu
sein. Weshalb sind Sie eigentlich hergekommen?«

»In Browers Haus gab es eine üble Schlägerei«, erklärte
Brass. »Und Grissom hat bei der Spurensuche Daytons Ohrring
gefunden.«
»Was? Das ›D‹ mit den Diamanten?«
»Genau das«, entgegnete Brass.
Nick drückte wieder auf die Klingel, aber nichts rührte sich.
Sie warteten, und Brass ließ Carrack und Jalisco mit der Ram-
me heraufkommen.
Grissom rief von der Straße: »Spuren von frischem Öl! An-
scheinend hat Mark Brower seinen Wagen noch nicht reparie-
ren lassen.«
Carrack und Jalisco stießen die Ramme jetzt mit Schwung
gegen die Tür, die mit einem geräuschvollen Knirschen auf-
flog.
»Ich möchte, dass alle Handschuhe anziehen«, sagte der
CSI-Leiter streng zu Brass. »Es handelt sich vielleicht um
einen Tatort. Wir wollen doch keine Beweisspuren verwischen,
mit denen wir einen Serienkiller hinter Gitter bringen können.«
»Sehe ich auch so«, entgegnete Brass, und alle streiften sich
Handschuhe über, bevor sie mit den Pistolen im Anschlag das
Haus betraten – auch Grissom, der bekanntlich nichts für Waf-
fen übrig hatte.
Hinter einem überraschend kleinen Eingangsflur tat sich ein
Wohnzimmer mit hoher Decke auf, das in schlichtem Weiß mit
teuren, jedoch merkwürdig nichtssagenden Möbeln eingerichtet
war. Hinter einem offenen Durchgang lag rechts eine große
Küche, links führte ein Flur zu der Treppe, die nach oben und
in den Keller ging. Durch die Tür auf der linken Seite gelangte
man wahrscheinlich in die Garage, und am Ende des Flurs
befand sich ein Badezimmer, das fast so groß wie ein Ballsaal
war. Ein weiterer Flur ging nach rechts ab.
Sara und Nick gingen in die Küche, Jalisco und Catherine
nach oben. Warrick und Carrack übernahmen das Wohnzim-

mer, und Brass und Grissom stiegen die Treppe in den Keller
hinunter.
Beim Betreten der Küche hielt Nick in leicht geduckter Hal-
tung die Pistole im Anschlag und sah sich um, während Sara
aufrecht stehen blieb und in die entgegengesetzte Richtung
zielte.
Die große, modern eingerichtete Küche war leer, und sie
kam Sara extrem sauber vor, obwohl ihre eigene, die allerdings
erheblich kleiner war, auch schon immer sehr ordentlich aus-
sah. Die auf Hochglanz polierten Chrom- und Stahlflächen
erinnerten eher an einen Operationssaal, und das war keine
besonders angenehme Assoziation.
Links befanden sich eine Durchreiche und eine Tür zum
Esszimmer.
Das einzig Ungewöhnliche in der Küche war ein Handtuch
mit roten Flecken, das in der Spüle lag. Sarah hörte Nicks
schnelles Atmen; natürlich war er ebenso angespannt wie sie.
Sie wies mit dem Kopf auf das Handtuch. »Blut?«
»Kann sein«, entgegnete er leise. Dann sagte er in sein
Funkgerät: »Küche sauber.«
Sie traten den Rückzug an, und Sara ging Nick voran durch
den Flur zur Garagentür.
Im oberen Stockwerk schaute Jalisco in das Zimmer zur
Linken, während Catherine Willows die beiden Türen auf der
rechten Seite im Auge behielt – das fehlte noch, dass ihnen ein
wahnsinniger Serienmörder von hinten ins Kreuz sprang.
Oder gab es auch Serienmörder, die nicht wahnsinnig wa-
ren?
»Gästezimmer sauber«, meldete Jalisco.
Catherine ging an der Treppe vorbei zu der ersten Tür auf
der rechten Seite. Das Herz schlug ihr bis zum Hals, aber sie
bewahrte einen kühlen Kopf und hielt ihre Pistole fest um-

klammert. Sie war in solchen Situationen immer ein wenig
nervös – Respekt vor möglicher Gefahr war grundsätzlich nicht
verkehrt –, Angst hatte sie jedoch nie. Von allen CSI-
Mitarbeitern, die in der Nachtschicht arbeiteten, hatte sie am
häufigsten im Dienst von ihrer Waffe Gebrauch machen müs-
sen und auch einige Todesschüsse zu verbuchen, obwohl sie
beileibe nicht stolz darauf war. Sie war gut ausgebildet und
trainiert und fühlte sich der Situation gewachsen, auch wenn
sie keine Ahnung hatte, was sich hinter der nächsten Ecke oder
der nächsten Tür verbarg.
Zum Beispiel hinter der zu ihrer Rechten, die offen war.
Catherine ging rasch mit der Pistole im Anschlag hinein und
sah sich in einem großen Badezimmer. Alles war weiß – Wän-
de, Handtücher, Armaturen, Teppich – und von erlesener Qua-
lität. Es war nichts Auffälliges zu entdecken. Catherine schob
den weißen Duschvorhang zurück, um sich zu vergewissern,
dass niemand in der Wanne lag. »Sauber!«, rief sie Jalisco zu.
Der letzte Raum in der oberen Etage war das Arbeitszim-
mer. Die Hälfte der Fläche wurde von einem L-förmigen
Schreibtisch beansprucht, unter dem ein riesiger Computer
verstaut war. Der ebenfalls gewaltige Monitor stand auf der
Arbeitsplatte.
Jalisco kontrollierte den Schrank, während Catherine sich
im Zimmer umsah. Die Wände waren kahl und weiß, der
Schreibtisch und der Computer hellgrau, und es sah nicht so
aus, als würde der Raum häufig benutzt. Ein paar Wörterbü-
cher und Lexika standen ordentlich zwischen zwei Buchstüt-
zen, daneben eine Kiste Papier. Die Atmosphäre war reichlich
unpersönlich, fast institutionell, als hätte Dayton sie sich von
Sundown mit nach Hause gebracht.
Jalisco zog seinen Kopf wieder aus dem Wandschrank her-
aus. »Sauber!« Dann drückte er auf den Sprechknopf seines
Funkgeräts und meldete: »Obere Etage sauber!«

Warrick Brown und Carrack drehten sich wie bewaffnete
Tänzer in dem riesigen Wohnzimmer im Kreis. Warrick er-
blickte zu seiner Rechten ein elegantes Esszimmer. Zu seiner
Linken checkte Carrack einen Kamin, der keine feste Rück-
wand hatte und in ein Schlafzimmer führte. Warrick bewegte
sich nach rechts und warf einen Blick hinter die weiße Leder-
couch, um sich davon zu überzeugen, dass niemand im Raum
war.
Er konnte sich nicht erinnern, schon einmal ein derart farb-
loses Zimmer gesehen zu haben: Teppiche, Möbel, Wände,
Decke – alles war weiß. Die einzige Ausnahme bildeten der
schwarze Plasmafernseher an der Wand und die schwarze,
teure Stereoanlage mit roten LEDs.
Die Leere und Ausdruckslosigkeit der Einrichtung erschüt-
terte Warrick, und er war nicht leicht zu erschüttern. Hatten die
Daytons etwa so gelebt? Oder hatte Jerome sich vielmehr nach
dem Tod seiner Eltern neu eingerichtet, um sich diesen Palast
ganz zu Eigen zu machen?
In diesem Augenblick bemerkte Warrick, dass etwas fehlte:
Familienfotos. Weder im Eingangsflur noch im Wohnzimmer,
wo solche Fotos üblicherweise aufgehängt oder -gestellt wur-
den, gab es Andenken an die Eltern.
Wie teuer die Ledermöbel und die Video- und Stereoanlage
auch waren, Warrick hatte schon Hotelsuiten mit mehr Charak-
ter gesehen.
Entweder hatte Jerome keine Persönlichkeit, oder er wusste
sie sehr gut zu verbergen… sogar zu Hause.
»Sauber!«, meldete Carrack, dann setzten sie ihren Kon-
trollgang fort.

Brass stürmte so schnell die Treppe in den Keller hinunter,
dass Grissom kaum mitkam.
Sie gelangten in einen kleinen Flur, von dem Türen nach
links und rechts abgingen. Brass drehte den Knauf der linken
Tür, und Grissom blieb zurück, während der Captain den Raum
betrat: ein Wohnzimmer mit dickem, braunem Teppich und
braunen Anbaumöbeln unter einer Fensterreihe, die auf den
Garten hinausging.
An der Wand rechts stand ein 80-cm-Fernseher auf einem
Podest. An der Wand zur Linken standen Regale voller Ta-
schenbücher, und auf der gegenüberliegenden Seite befand sich
noch eine Tür.
Zum Teufel!, dachte Brass, hier gibt es mehr Zimmer als in
manchen Hotels auf dem Strip…
Und sie mussten alle kontrollieren.
Sara öffnete die Tür zur Garage und tippte mit dem latexge-
schützten Handballen auf den Lichtschalter, wie sie es sich
angewöhnt hatte, um eventuelle Fingerabdrücke nicht zu ver-
wischen.
Zwei Autos waren dort abgestellt: ein weißer Lexus neueren
Baujahrs, und ein älterer blauer, sehr schmutziger Dodge. Sara
wunderte sich, dass noch niemand auf die Idee gekommen war,
mit dem Finger »Wasch mich!« auf die Motorhaube zu schrei-
ben. Sie und Nick sahen sich aufmerksam um und schauten
auch hinter Kisten und unter der Werkbank nach, um sicherzu-
gehen, dass sich dort niemand versteckte.
Schließlich kniete Nick sich auf den Boden, um unter den
Dodge zu schauen. »Der verliert Öl«, stellte er fest.
Er stand wieder auf und öffnete die Beifahrertür. »Schlüssel
steckt!«, rief er über seine Schulter, dann klappte er das Hand-
schuhfach auf und nahm den Fahrzeugbrief heraus. Laut las er
den Namen des Besitzers vor: »Mark Brower!«

Sara drückte auf den Sprechknopf ihres Funkgeräts. »Gara-
ge sauber. Wir haben Browers Wagen, einen sehr schmutzigen
Dodge.«
Brass nahm Saras Meldung mit einem Nicken zur Kenntnis. Er
drehte sich kurz zu Grissom um, der ihm inzwischen gefolgt
war; dann ging er zu der Tür auf der anderen Seite des Raumes,
atmete tief durch, hob seine Pistole und drehte den Türknauf.
Warrick und Carrack waren inzwischen an der Garagentür
vorbei durch den Flur gegangen und bogen nach rechts in das
Zimmer ab, das sie bereits durch die Kamintür gesehen hatten.
Hier hielt sich ebenfalls niemand auf, zumindest sah es auf
den ersten Blick so aus. Es handelte sich offensichtlich um das
Schlafzimmer, und auch in diesem Raum war alles weiß:
Schrank, Kommode, Himmelbett.
Carrack kontrollierte den begehbaren Kleiderschrank, wäh-
rend Warrick in das angrenzende riesige Badezimmer ging. Es
dauerte nicht lange, bis er den fleckigen Waschlappen in der
Duschkabine entdeckte. Auch ohne Labortests wusste der CSI-
Mitarbeiter sofort, dass es sich um Blutflecken handelte.
»Warrick!«, rief Carrack aus dem begehbaren Schrank.
Als Warrick zu ihm kam, zeigte er auf einen Kleiderhaufen
neben dem Wäschekorb: eine Jeans und ein blaues T-Shirt mit
dunklen Flecken, die ebenfalls Blut zu sein schienen.
Carrack meldete über Funk: »Schlafzimmer sauber!«
Danach griff Warrick zu seinem Funkgerät. »Gris, hörst du
mich? Wir haben hier Kleidung mit Blutflecken.«
»Verstanden«, entgegnete Grissom.
Nach Warricks Nachricht über die blutbefleckte Kleidung
schaltete Brass sein Funkgerät aus. Er hätte zwar gern den
Informationsaustausch zwischen den einzelnen Teams aufrecht

erhalten, aber es war besser, wenn er und Grissom sich still
verhielten und ihre Position nicht verrieten.
Von dem Wohnzimmer in Braun war er inzwischen in ein
Schlafzimmer gelangt. Aber es war nicht irgendein Schlafzim-
mer und es war auch nicht in unschuldigem Weiß gehalten wie
die anderen Räume in diesem nichts sagenden Haus. »Gil!«,
rief Brass. »Das wird dir gefallen…« Dieses »Schlafzimmer«
glich eher einem Verlies. Es stand zwar tatsächlich ein Bett
darin – ein einfaches, schwarzes Bett mit schwarzen Seidenla-
ken mitten im Raum –, aber es gab keine Fenster, und als die
Männer ihre Taschenlampen einschalteten, trat die Schwärze
des Raums nur noch deutlicher zu Tage.
Die Wände waren schwarz angestrichen, auf dem Boden lag
ein schwarzer Kunststoffteppich. Von den vier Bettpfosten
hingen Fesseln herunter, und an der Wand zur Linken gab es
eine unglaubliche Ansammlung von Rough-Trade-
Gerätschaften – das komplette Werkzeuglager eines Sadisten.
Auf der anderen Seite des Raums sahen sie die Klinken von
zwei Türen schimmern.
Grissom kam näher und stellte sich neben Brass.
»Tür Nummer eins«, flüsterte Brass ihm zu, »oder Tür
Nummer zwei?«
»Schöne Lady oder hungriger Tiger?«, entgegnete der CSI-
Leiter mit einem Furcht erregenden Grinsen.
Aber Brass wurde die Entscheidung abgenommen.
Die linke Tür ging auf, und Jerry Dayton betrat blutbe-
schmiert den Raum. Bis auf eine knappe Unterhose war er
nackt und blieb wie angewurzelt stehen, als er sich zwei Pisto-
lenläufen gegenüber sah. Er schirmte seine Augen mit der
linken Hand gegen das grelle Licht der Taschenlampen ab.
Die rechte Hand versteckte er hinter dem Rücken.
»Nehmen Sie die Hände hoch, Jerry!«, sagte Brass be-
stimmt.

»Lampe weg!«, erwiderte Dayton. »Ich kann überhaupt
nichts sehen!«
Die Taschenlampen bewegten sich nicht.
»Ich will Ihre verdammten Hände sehen!«, rief Brass und
machte einen Schritt auf den Verdächtigen zu.
Dayton hob die Hand, aber dann schleuderte er unvermittelt
etwas durch den Raum…
… etwas Warmes, Klebriges, das Brass an der Wange traf.
Der Captain feuerte augenblicklich. Der Schuss klang wie ein
Donnerschlag, und Dayton sprang nach rechts. Das Wurfge-
schoss landete derweil auf dem Boden.
Grissom suchte mit der Taschenlampe nach dem Ding, das
dem Captain ins Gesicht geflogen war, und der Lichtstrahl
erfasste einen abgetrennten, blutigen menschlichen Zeigefin-
ger, der auf den CSI-Leiter zu deuten schien.
In diesem Moment sah Brass, wie Dayton durch die rechte
Tür flitzte, ohne sie hinter sich zu schließen.
»Stehen bleiben!«, brüllte Brass.
Aber der Verdächtige war bereits verschwunden.
»Dayton gehört Ihnen«, sagte Grissom und ging an ihm vor-
bei durch die linke Tür.
Brass leuchtete mit der Taschenlampe in die rechte Tür,
dann nahm er die Verfolgung auf.
Noch bevor die blutbeschmierte, fast nackte Gestalt in den
schwarzen Raum gekommen war, hatte Gil Grissom ein Stöh-
nen gehört.
Obwohl seine Waffe schussbereit war, hatte er nicht gefeu-
ert, als Dayton Brass den Finger an den Kopf geworfen hatte,
weil er befürchtete, Brass zu treffen, der in diesem Moment
zurückgezuckt und in die Schusslinie geraten war.

»Grissom! Grissom!«, hörte er Sara über Funk rufen. »Wir
haben einen Schuss gehört – alles in Ordnung bei dir? Was ist
los?«
»Bleibt, wo ihr seid!«, antwortete Grissom. »Brass ist hinter
Dayton her – blockiert alle Ausgänge!«
Dann schaltete er ab.
Ihm hallte noch der Schuss in den Ohren, als er den schwar-
zen Raum verließ, aber das Stöhnen hörte er trotzdem.
Das Zimmer, in das er gelangte, war nicht schwarz.
Es war rot.
Die Wände, der Boden und die Decke – und sogar die Roh-
re, die daran entlangliefen – waren in einem glänzenden Knall-
rot gestrichen. Die einzige Lichtquelle war eine rote Glühbirne
an der linken Wand. Von der gegenüberliegenden Seite ging,
wie in jedem anderen Zimmer in diesem Haus, eine Tür ab.
Mitten in dem roten Zimmer, über einem Abfluss im Boden,
hing Mark Brower – nackt, mit dem Kopf in einer Schlinge, die
gerade so stramm war, dass er sich nicht bewegen konnte, aber
nicht eng genug, um ihm die Luft komplett abzuschnüren.
Seine Hände waren offenbar auf dem Rücken gefesselt. Blut
tropfte hinter ihm auf den Boden, aber auf dem roten Boden
war die Lache kaum zu sehen. Gil Grissom brauchte keinen
weiteren Beweis, um zu dem Schluss zu gelangen, dass der
Finger, den Brass ins Gesicht bekommen hatte, von Mark
Brower stammte. Der junge Mann hatte den Mund geöffnet
und schien irgendetwas zu sagen, das Grissom mit seinen
klingenden Ohren jedoch nicht hören konnte.
Mit vor Angst geweiteten Augen flehte Brower jetzt seinen
Retter an. »Hilfe!«, brachte er mühsam hervor, aber Grissom
konnte das Wort nur als schwaches Flüstern wahrnehmen.
Außer Brower hielt sich niemand in dem roten Raum auf,
aber Grissom wollte seine Waffe nicht wegstecken, es wäre ja
möglich, dass Dayton durch die andere Tür wieder hereinkam.

Aber er musste Brower helfen, auch wenn nicht zu befürchten
war, dass er an einer durchtrennten Fingerarterie verblutete.
Aber jede schwerere Verletzung konnte zu einem Schock
führen. Außerdem würde Brower sich definitiv verletzen oder
gar umbringen, wenn er nicht aufhörte, mit der Schlinge um
seinen Hals herumzuzappeln.
Grissom nahm die Pistole in die linke Hand und zückte mit
der rechten sein Taschenmesser. Er klappte es auf und fing an,
das Seil über Browers Kopf durchzuschneiden.
»Hilfe, Hilfe!«, stöhnte der CASt-Nachahmer die ganze Zeit
wie die Fliege mit Menschenkopf in dem alten Horrorfilm, und
genauso fern klangen die Worte für Grissom mit seinem Knall-
trauma im Ohr.
Aber je länger der CSI das Seil bearbeitete, je mehr das E-
cho des Schusses und auch das Klingeln in seinen Ohren nach-
ließ, desto lauter und eindringlicher wurden Browers Rufe.
»Still!«, raunte Grissom ihm leise zu. »Wir wissen nicht, wo
er ist.«
»Sie haben doch eine verdammte Waffe, Grissom!«, sagte
Brower mit schmerz- und angstverzerrtem Gesicht. »Holen Sie
mich endlich hier raus!«
Grissom sägte weiter mit seinem Taschenmesser. Als er den
letzten Strang durchschnitten hatte, plumpste Brower zu Boden
und rollte sich zusammen.
»Gris!«, ertönte Warricks Stimme jetzt aus dem Funkgerät.
»Bitte melden! Brauchst du Hilfe?«
Grissom steckte das Messer ein und nahm das Funkgerät
von seinem Gürtel. »Ich habe Brower gefunden. Er lebt, aber
ihm fehlt ein Finger.«
»Ich komme mit Carrack und Jalisco runter…«
»Nein!«, unterbrach Grissom leise, aber mit Nachdruck.
»Bleibt oben! Hier unten ist es dunkel, da erschießen wir uns
am Ende noch gegenseitig. Umstellt das Haus und überwacht

Türen und Fenster – alle Ausgänge. Brass ist immer noch
hinter Dayton her, der nackt und blutbeschmiert ist… aber
wahrscheinlich inzwischen bewaffnet und gefährlich.«
»Gris, willst du wirklich…«, schaltete Nick sich ein.
»Nein!«, sagte Grissom und stellte sein Funkgerät ab.
Dann holte er einen Standardschlüssel für Handschellen aus
der Tasche und befreite den Mann auch an den Handgelenken,
obwohl er ihn lieber gefesselt gelassen hätte, nicht zuletzt, um
bei der Verhaftung Zeit zu sparen.
»Setzen«, sagte er dann.
Brower blieb wimmernd liegen – wie es vermutlich auch
Sandred und Diaz getan hatten, dachte Grissom, als dieser
Fiesling seine grausamen Performance-Künste an ihnen voll-
führt hatte.
»Setzen!«, sagte er noch einmal mit Nachdruck.
»Helfen Sie mir…«
Grissom wollte Brower nicht anfassen, denn schließlich war
auch sein Körper Beweismaterial. Es war also nicht nur man-
gelndes Mitgefühl, das Grissom veranlasste, nein zu sagen.
Mühevoll richtete Brower sich schließlich auf, und Grissom
reichte ihm ein Taschentuch.
»Was soll ich damit?«, fragte Brower benommen.
»Üben Sie Druck auf Ihren Finger aus.«
»Auf welchen Finger? Dieser Irre hat mir den verdammten
Finger abgeschnitten!«
»Üben Sie Druck auf die Wunde aus… und bleiben Sie
hier!«
Aufgebracht entgegnete Brower: »Wo soll ich denn auch
hin?«
»Nun, wenn Sie nach oben gehen, werden Sie wahrschein-
lich mit Dayton verwechselt und erschossen.« Eine kuriose
Vorstellung angesichts der Tatsache, dass Brower Dayton
mordenderweise nachgeeifert hatte.

»Ich gehe nirgendwohin«, wimmerte er.
»Nur ins Gefängnis«, entgegnete Grissom.
Dann ging er zu der Tür auf der anderen Seite des Raums,
lauschte angestrengt und hoffte, dass es das letzte Zimmer in
diesem Gruselkabinett war. Er griff nach dem Türknauf.
Auf der Jagd nach Dayton arbeitete Brass sich langsam durch
die Dunkelheit vor und leuchtete mit der Taschenlampe den
Weg aus.
Er wäre gern schneller vorgegangen, weil er befürchtete,
dass Dayton ihm entkam, andererseits aber waren die anderen
ja alle oben postiert, und etwas Vorsicht konnte nicht schaden,
wenn er am Leben bleiben wollte. Vermutlich lag Dayton
irgendwo auf der Lauer…
Der Captain ließ den Lichtstrahl seiner Taschenlampe über
die Wände wandern.
Er befand sich in einer Art Abstellkammer – leere Kartons,
Regale mit kleineren Kisten ohne Aufschrift, aber kein Ver-
dächtiger.
Brass durchquerte den Raum und stieß… auf noch eine ver-
dammte Tür. Sie stand offen.
So leise wie möglich schlüpfte Brass hindurch und sah im
Schein seiner Taschenlampe eine Werkstatt mit einer Werk-
bank zu seiner Linken. Rechts befanden sich eine Lochwand
mit Werkzeugen, eine Standbohrmaschine, eine Tischkreissäge
und eine kleinere Werkbank mit einer Schleifmaschine und
einem Schraubstock. Hinter der Werkbank auf der linken Seite
befand sich am anderen Ende des Raums… eine weitere Tür,
was sonst? Brass roch Sägemehl und war schon fast an der
Werkbank vorbei, als er einen Schlag gegen das linke Bein
verspürte, dicht unterhalb des Knies, dann einen unglaublichen
Schmerz.

Pistole und Taschenlampe fielen ihm aus den Händen. Die
Waffe schlug rechts von ihm klappernd auf dem Boden auf, die
Taschenlampe prallte von irgendetwas ab, bevor sie zu Boden
fiel. Sie drehte sich im Kreis und blieb schließlich so liegen,
dass der Lichtstrahl ihn erfasste.
Er schaute an sich herunter auf das Messer, das in seinem
Bein steckte. Ein dunkler Fleck verfärbte seine graue Hose.
Brass verlor das Gleichgewicht, aber bevor er einknickte, kam
Dayton unter der Werkbank hervor und verpasste Brass einen
Kopfstoß, durch den er mit Sternen vor den Augen nach hinten
stürzte. Er krachte gegen etwas Hartes, dann ging er zu Boden.
Als er sich aufzurappeln versuchte, klickte es, und ein Teil
des Raumes wurde in grelles Licht getaucht.
Dayton stand an der Werkbank – mit roten Spritzern im Ge-
sicht, die wie Ketchup aussahen, weit aufgerissenen Augen und
einem animalischen Knurren, bei dem er seine weißen Wolfs-
zähne bleckte – und hatte gerade eine Arbeitsleuchte einge-
schaltet.
Brass war im Laufe seines Arbeitslebens schon von vielen
Tätern mit Missfallen beäugt worden, aber noch nie mit so viel
Verachtung und Hass.
»Du… du nerviger, idiotischer Scheißkerl… du miese, klei-
ne Bullenzecke… du bist mir zum letzten Mal in die Quere
gekommen!«
Dayton stürzte sich wie ein verrückt gewordener Zahnarzt,
der seinem Patienten einen Zahn ziehen will, auf ihn und riss
ihm das Messer aus dem Bein.
Brass durchzuckte von Kopf bis Fuß ein glühend heißer
Schmerz, aber es gelang ihm dennoch, mit seinem unverletzten
Bein nach der blutbeschmierten Gestalt zu treten. Dayton
taumelte rückwärts, und Brass gelang es immerhin, sich auf ein
Knie zu stützen, bevor er erneut attackiert wurde.

Als der Angriff kam und Dayton mit dem Messer ausholte,
duckte Brass sich. Die Klinge schoss auf ihn zu, und er hechte-
te nach links, so dass das Messer nur sein Sakko streifte – und
Dayton das Gleichgewicht verlor. In diesem Moment rammte
Brass das Knie des Killers mit seiner Schulter.
Zufrieden nahm er das Knirschen wahr, als Daytons Knie
nachgab und der Killer vor Schmerz gekrümmt zu Boden ging.
Dann stürzte sich Dayton jedoch mit einem lauten Schrei
auf Brass, und sie kämpften keuchend und ineinander ver-
schlungen um das Messer.
Grissom gelangte erneut in ein dunkles Zimmer und schaltete
die Taschenlampe ein.
Dieser Raum war klein, ungefähr wie ein Vorratskeller, und
die Regale an der Wand zur Linken erinnerten in der Tat an
einen Lagerraum. Drei von den fünf Regalen waren jedoch mit
Büchern, Magazinen und Alben gefüllt, darunter mehrere
Exemplare von Der Fall CASt, auch in der nachgedruckten
Version von Perry Bell. Grissom gestattete sich die Vermu-
tung, dass die anderen Bücher und Zeitschriften Kapitel oder
Artikel über die Morde enthielten, und die Alben natürlich
Zeitungsausschnitte zum Thema CASt.
Auf dem Regalbrett darüber lagen mehrere Rollen Seil und
ein Dutzend Lippenstifte des Farbtons »Limerick Rose«. Und
auf dem obersten Regalbrett standen mehrere kleine Gläser,
wie man sie in einem normalen Vorratskeller wohl nicht finden
würde, außer vielleicht auf der Farm von Ed Gein.
In jedem Glas lag nämlich ein vertrockneter, verschrumpel-
ter Zeigefinger.
Moment, nicht in jedem.
Einer der Finger sah ziemlich frisch aus. Wahrscheinlich
war er von Perry Bell.

Und das fünfte Glas von links war leer – vermutlich war
Vincent Drakes Finger darin gewesen, bevor CASt ihn an den
Banner geschickt hatte, um seine Ehre zu retten.
Während Grissom dieser Gedanke durch den Kopf ging,
hörte er plötzlich Geräusche.
Er schaute in die Richtung, aus der sie kamen – wieder eine
Tür. Was blieb ihm anderes übrig, als sie zu öffnen? Mit drei
Schritten hatte er den kleinen Raum durchquert, drückte die
Klinke runter – und erblickte im Schein einer Lampe den nack-
ten, blutigen Dayton und Brass, die mit dem Rücken zu ihm
um ein Messer rangen, das sie beide umklammert hielten.
Brass war ebenfalls voll Blut, und möglicherweise stammte
es nicht nur von Dayton.
Grissom stürzte in die Werkstatt, als Dayton Brass gerade
einen Kinnhaken verpasste und der Kopf des Captains auf dem
Betonboden aufschlug. Brass schien nicht bewusstlos zu sein,
aber er war zumindest kurzzeitig außer Gefecht gesetzt, und
Dayton konnte das Messer an sich reißen. Er hielt Brass an
seinem linken Handgelenk fest und drückte dessen Hand auf
den Boden. Als er gerade die Klinge an der Wurzel des Zeige-
fingers ansetzte, hielt Grissom ihm die Pistole an den Kopf.
»Messer fallen lassen!«, sagte er.
Dayton hielt Brass das Messer an die Kehle.
»Zurück!«, rief er, »sonst steche ich zu!«
»Wenn ich abdrücke«, entgegnete Grissom gelassen, »ma-
chen Sie gar nichts mehr!«
Dayton erstarrte.
»Das ist kein leeres Gerede«, sagte Grissom.
CASt legte das Messer weg.
Grissom wich zwei Schritte zurück. »Aufstehen und Hände
hinter den Kopf legen!«
Dayton erhob sich langsam und breitete die Arme wie für
eine Kreuzigung aus. Dann legte er langsam die Hände hinter
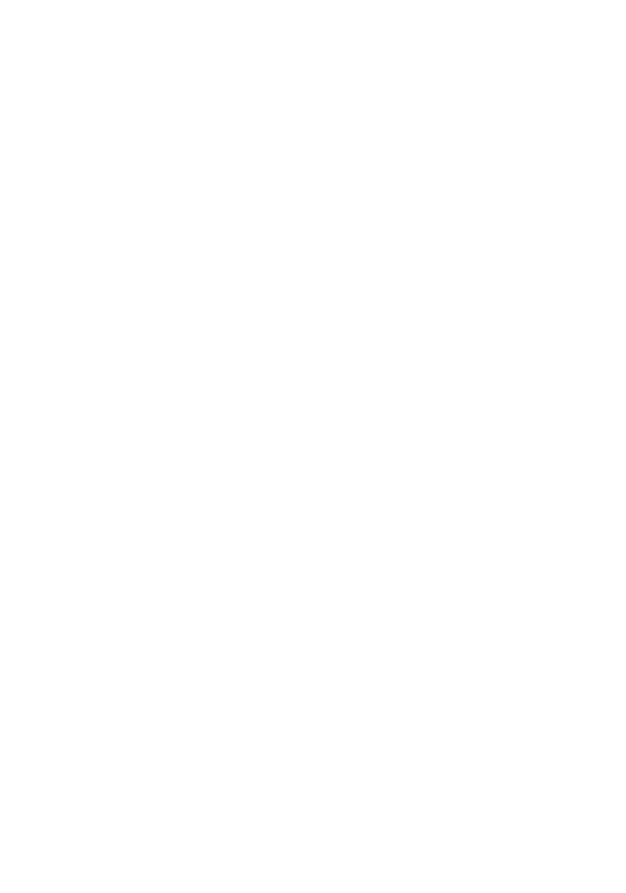
den Kopf und verschränkte die Finger, während er Grissom
trotzig angrinste.
»Umdrehen!«, sagte Grissom.
Dayton folgte dem Befehl.
Grissom steckte die Waffe weg und holte die Handschellen
heraus, um Dayton die Hände zu fesseln, aber der duckte sich,
wirbelte um die eigene Achse und brachte den CSI mit einem
gezielten Tritt aus dem Gleichgewicht.
Grissom stürzte und schlug hart auf dem Boden auf.
Mit rasenden Schmerzen im Bein rappelte Brass sich jetzt
auf, rutschte jedoch aus und stieß mit den Fingern gegen etwas
Kaltes…
Seine Pistole!
Er umklammerte sie und stemmte ein Knie fest auf den Bo-
den.
Dayton schlug Grissom ins Gesicht, einmal, zweimal, aber
als der nackte Killer zu seinem dritten Schlag ausholte, kam
Brass wieder auf den Beinen, und Jerome Dayton hatte schon
wieder den Lauf einer Pistole am Hinterkopf.
»Wissen Sie übrigens«, sagte Brass, »was der Unterschied
zwischen mir und Grissom ist? Er hat sich alle Mühe gegeben,
Sie nicht zu erschießen… Jerry, Jerry, Jerry – ich wünschte,
Sie gäben mir einen Grund!«
Dayton schluckte.
Die Vernunft gewann die Oberhand über den Verrückten. Er
hob die Hände und machte keine Schwierigkeiten mehr.

11
Während er im Verhörraum saß, spürte Jim Brass unentwegt
den Druck des Verbands unter seinem Hosenbein und das
Pieksen der genähten Wunde. Links und rechts von ihm am
Tisch saßen Sara und Warrick, die mit allen Facetten des Falls
vertraut waren: mit den alten und den neuen.
Zum ersten Mal seit dem Fund von Marvin Sandreds Leiche
hatte Brass weder mit Wut noch Frustration zu kämpfen. Ihm
ging es gut – er war ruhig und gelassen und wollte seine Re-
vanche genießen, denn schließlich schmeckte Rache kalt ser-
viert am besten.
Ihm gegenüber saß Jerry Dayton in einem orangen Gefäng-
nisoverall und mit Handschellen. Missmutig schweigend,
drohte er den Captain mit seinen Blicken förmlich zu erdol-
chen, aber darüber konnte Brass nur schmunzeln. Neben Day-
ton saß sein Anwalt Carlisle Deams, der so ehrbar und distin-
guiert aussah wie ein Universitätsdekan, von Kopf bis Fuß in
Grau, inklusive Haare und Schnurrbart. Er blätterte immer
wieder in den Papieren, die er vor sich liegen hatte, und konnte
anscheinend gar nicht genug reden, um Brass klarzumachen,
dass sein Klient nicht reden würde.
Die Augen des Anwalts jedoch waren verräterisch, wie Ex-
Zocker Warrick sofort bemerkte: Sie waren schwarz und tot
und sahen aus wie die eines Hais.
»Mein Klient hat Ihnen nichts zu sagen – verstehen Sie? Gar
nichts.«

Daytons Hände waren nicht auf die übliche und sicherere
Methode am Rücken gefesselt, sondern vor dem Bauch, da sein
Anwalt anwesend war.
»Vor einer Weile war er noch ziemlich gesprächig«, ent-
gegnete Brass. »Als er mit nicht viel mehr als Mark Browers
Blut am Körper herumrannte und mir das Messer ins Bein
gestochen hat.«
»Nun, Sie werden sich wohl mit Ihren Erinnerungen zufrie-
den geben müssen, Captain Brass«, sagte Deams mit einem
gehässigen Grinsen.
Brass parierte mit einem kalten Lächeln. »Wie ich Ihren
Klienten einschätze, hat er dazu eine eigene Meinung. Dieses
Gespräch ist nur ein höfliches Angebot.«
Die toten, schwarzen Augen des Anwalts blinzelten. »Ein
höfliches Angebot?«
»Ja, um Jerry die Gelegenheit zu geben, sich zu erklären und
das Ganze aus seiner ganz persönlichen Sicht zu schildern.«
»Mr. Dayton ist offensichtlich stolz auf sein… Hobby«, er-
gänzte Warrick. »Wir dachten, er würde uns gern dabei helfen,
seine Taten und die von diesem… dahergelaufenen Nachahmer
auseinander zu sortieren.«
»Wenn Sie uns nicht helfen, Mr. Dayton«, warf Sara ein,
»kommt es unter Umständen zu Verwechslungen.«
Dayton runzelte die Stirn, und der Anwalt klopfte seinem
Klienten beschwichtigend auf den Arm. »Sehr clever!«, sagte
er. »Aber Ihre Bemühungen, an den Stolz meines Klienten zu
appellieren, werden an seinem Entschluss nichts ändern. Er hat
Ihnen nichts zu sagen, und uns interessiert auch nicht, was Sie
zu sagen haben.«
Brass zuckte mit den Schultern. »Nun, dann lassen wir die
Beweise sprechen… vor Gericht.«
Deams kicherte verächtlich. »Ich freue mich schon auf die
Auseinandersetzung mit dem Staatsanwalt!«

»Gut.« Brass strahlte ihn an. »Sie sind zufrieden. Ich bin zu-
frieden.«
Deams grinste. »Sie haben doch nicht mehr gegen meinen
Klienten in der Hand als eine Anklage wegen ganz banaler
Körperverletzung.«
»So banal ist die nicht«, bemerkte Warrick. »Er hat Mark
Brower gekidnappt, ihm einen Finger abgeschnitten und ihn in
seiner Folterkammer aufgehängt.«
»Mark Brower kam zu meinem Klienten nach Hause und
hat ihn angegriffen.«
Sara lächelte. »Wirklich? Dann hat Mr. Dayton ihm den
Finger aus Notwehr abgeschnitten? Und seinen Kopf in eine
Schlinge gesteckt? Ich bin gespannt, wie Sie das vor Gericht
durchkriegen wollen.«
Dayton sah seinen Anwalt stirnrunzelnd an. Doch der beug-
te sich nur etwas weiter nach vorne. »Was immer Sie im Fall
Brower vorzuweisen haben, ist nebensächlich. Sie glauben
doch nicht, dass Sie meinen Klienten für Taten belangen kön-
nen, die ein Jahrzehnt zurückliegen?«
»Die DNS von Mr. Dayton hat sich in den zehn Jahren nicht
verändert – und wir haben seine DNS von damals und heute«,
entgegnete Brass.
»Aufbewahrt unter welchen Bedingungen?«, fragte Deams
und machte eine Handbewegung, als wollte er eine lästige
Mücke verscheuchen.
»Wir haben jede Menge handfester Beweise, Mr. Deams«,
sagte Warrick. »Zum Beispiel die Finger, die Ihr Klient von
seinen Opfern erbeutet hat. Wir haben sie aus seinem kleinen
Kellermuseum geholt.«
Sogar das tat Deams ab. »Wir glauben, dass Mark Brower
diese Beweisstücke im Haus meines Klienten platziert hat.«

»Nun, dann hat Brower sich von Ihrem Klienten aber helfen
lassen«, entgegnete Warrick, »denn an den Gläsern waren nur
die Fingerabdrücke von Jerome Dayton.«
Der Anwalt hob die Hände. »Alles Indizien. Sie haben über-
raschend wenig zu bieten. Sonst noch was?«
»Sie meinen, abgesehen davon, dass Ihr Klient unbekleidet
und blutverschmiert herumlief«, entgegnete Brass, »und auf
einen Polizeibeamten eingestochen hat, der das Haus mit einem
Vollziehungsbefehl betrat?«
Deams verzog spöttisch den Mund. »Mein Klient… hat es
nicht leicht. Er ist in psychiatrischer Behandlung und nimmt
Medikamente, mit denen er… sein Problem ganz gut im Griff
hat.«
»In letzter Zeit nicht«, bemerkte Brass.
»Wir werden zeigen, dass meinem Klienten von ärztlicher
Seite empfohlen wurde, die Medikamente für eine gewisse Zeit
abzusetzen. Das ist ein übliches Verfahren bei Patienten mit
veränderter Gehirnchemie, die jahrelang Medikamente neh-
men. Aber mein Klient war offenbar mit dieser Pause schlecht
beraten.«
»Schlecht beraten?«, fragte Brass. »Dann sollten wir dem
Arzt Ihres Klienten vielleicht auch eine Giftspritze verschrei-
ben?«
»So etwas Barbarisches wird meinem Klienten nicht wider-
fahren, Captain Brass. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass
dieser Fall niemals vor Gericht kommt.«
»Ihr ›armer‹ Klient wurde in eine Anstalt eingewiesen«,
sagte Brass, »aber nach drei Jahren war er wieder draußen. Und
nun, da Mama und Papa ihn nicht mehr mit Medikamenten
benebeln können, ist sein ›barbarisches‹ Naturell wieder zum
Vorschein gekommen. Selbst wenn es Ihnen gelingt, Richter
und Geschworene davon zu überzeugen, dass unser Jerry nicht
den Unterschied zwischen Recht und Unrecht kennt – und er ist

in der Tat ein gemeingefährlicher Soziopath –, wird er in eine
staatliche Einrichtung gesteckt, neben der Sundown sich aus-
nimmt wie der Club Med.«
Endlich machte Dayton den Mund auf. Drei Worte schleu-
derte er Brass entgegen: »Ich hasse Sie!«
»Nun, das können Sie demnächst zu Ihrem Hobby machen,
Jerry«, entgegnete Brass. »In Ihrer neuen Gummizelle.«
Das war’s.
Trotz der Handschellen machte Dayton einen Hechtsprung
über den Tisch auf Brass zu, aber der war auf den Angriff
gefasst gewesen und wich rasch zur Seite aus. Der Killer trat
seinen Anwalt versehentlich gegen den Kopf, bevor er mit der
Nase voran vom Tisch stürzte. Deams kippte vom Stuhl und
ging ebenfalls zu Boden.
Ein uniformierter Beamter fegte in den Raum, aber Brass
schickte ihn wieder fort. Er packte Dayton am Kragen und hob
ihn auf wie einen großen Müllsack. Warrick kam dazu und half
ihm, den benommenen Häftling wieder auf seinen Stuhl zu
setzen.
Sara hatte inzwischen dem aufgebrachten Anwalt auf die
Beine geholfen. Deams bedankte sich knurrig und klopfte
seinen teuren grauen Anzug ab, als wäre er von dem Ausflug
auf den Boden des makellos sauberen Verhörraums furchtbar
schmutzig geworden.
Die beiden Spurenermittler und der Captain vom Mordde-
zernat schienen nicht sonderlich beeindruckt von diesem für
einen bekannten Serienmörder vergleichsweise lahmen An-
griff. Sie wirkten eher amüsiert.
»Jerry«, sagte Brass in mahnendem Tonfall, als rede er mit
einem widerspenstigen Kind, »Sie müssen Ihr Temperament
zügeln – sonst tun Sie eines Tages etwas richtig Schlimmes,
und wer weiß, in was für Schwierigkeiten Sie sich dann brin-
gen.«

»Einspruch!«, rief der Anwalt. Er hatte endlich aufgehört,
sich den nicht vorhandenen Staub vom Anzug zu klopfen.
»Sie sind hier nicht vor Gericht, Herr Anwalt«, entgegnete
Brass. »Setzen Sie sich!«
Deams holte mit zusammengebissenen Zähnen Luft, aber er
setzte sich.
Leise sagte er zu Dayton: »Sie müssen nichts sagen. Wir
können dieses Gespräch jederzeit beenden.«
Dayton schmollte regelrecht. Er sah aus wie ein Sechsjähri-
ger, der gegen die Tränen ankämpft. Mit einem Blick in Brass’
Richtung murmelte er: »Ich habe keine Angst vor ihm.«
Deams drohte ihm mit dem Zeigefinger. »Das sollten Sie
aber!«
Dayton hielt die Hand des Anwalts fest und biss ihm kräftig
in den Finger.
Deams schrie, und Warrick und Brass stürzten sich auf Day-
ton. Der Uniformierte, der vor der Tür postiert war, kam wie-
der herein, diesmal mit der Pistole im Anschlag.
Erst als Warrick ihn von hinten packte, gab Dayton den Fin-
ger des Anwalts wieder frei, der entsetzt seine Hand fortzog.
Die Haut war durchgebissen, aber immerhin war der Finger
noch dran.
»Sie sind nicht mein Vater!«, schrie Dayton.
Seinem Anwalt standen Angst und Schmerz ins Gesicht ge-
schrieben. »Jerry, Sie müssen sich beruhigen… Beruhigen Sie
sich…«
»Sie sind so was von gefeuert!«
»Jerry, bitte…«
»Ich habe Ihnen gesagt, was er mir angetan hat, Deams, und
Sie haben nichts dagegen getan!« Dayton wollte auf seinen
Anwalt losgehen, aber Warrick hielt ihn an den Schultern fest.
»Sie hätten mir helfen können! Aber Sie haben mich wieder in
dieses Haus geholt. Sie können von Glück sagen, dass ich nicht

auch an Ihnen ein Exempel statuiert habe! Gehen Sie mir aus
den Augen!«
Deams hob beschwichtigend seine unverletzte Hand. »Be-
ruhigen Sie sich, Jerry – Sie wissen ja nicht, was Sie tun und
sagen. Ihre Gefühle gehen mit Ihnen durch. Sie müssen sich
beruhigen und Vernunft annehmen. Es steht so viel auf dem
Spiel…«
»Dass Sie mich weiter schröpfen können, steht auf dem
Spiel, Sie mieses Arschloch!« Dayton sah Brass an. »Werfen
Sie ihn raus – sofort!«
Sara trat neben den Anwalt. »Wir sollten den Finger verarz-
ten lassen, was meinen Sie?«
Deams schluckte und nickte. Nachdem er sich Papiere und
Aktenmappe unter seinen unverletzten Arm geklemmt hatte,
ließ er sich von Sara zur Tür führen. Dort blieb er jedoch noch
einmal stehen. »Wenn Sie trotz der momentanen seelischen
Verfassung meines Klienten das Gespräch in meiner Abwesen-
heit fortsetzen, werde ich…«
»Er ist nicht Ihr Klient«, bemerkte Brass.
»Ja, genau!«, rief Dayton wie ein Kind, als wäre er plötzlich
der beste Kumpel von Brass. »Ich bin nicht Ihr Klient!«
Der Anwalt streckte die Hand mit dem verletzten Finger
aus, als wollte er ein Taxi heranwinken. »Morgen kommt er
wieder zur Vernunft. Dann wird er mich wieder engagieren!«
»Aber heute vertreten Sie ihn nicht«, entgegnete Brass. »Al-
les Gute für den Finger!«
Sara brachte den Anwalt hinaus.
Brass nickte dem uniformierten Beamten kurz zu, und der
Mann verließ ebenfalls den Raum. Nun waren sie nur noch zu
dritt. Brass, Dayton und Warrick.
Dayton hatte gekeucht wie ein Sprinter an der Ziellinie, aber
nun verlangsamte sich seine Atmung, und seine Schultern
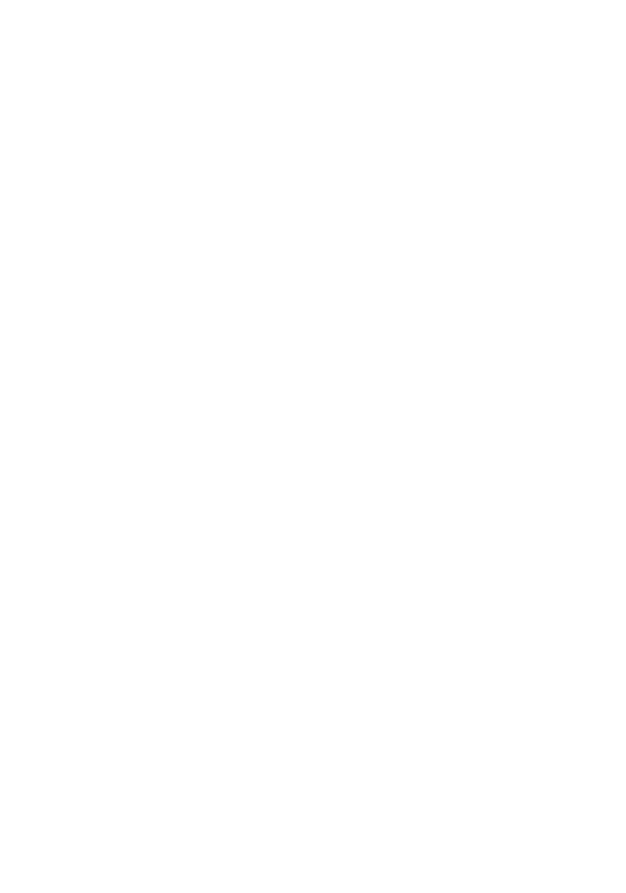
entspannten sich unter Warricks Händen. Es machte fast den
Eindruck, als massiere der CSI den Häftling.
»Ich bin okay«, sagte Dayton mit einem Blick über seine
Schulter.
Warrick ließ ihn los.
Dayton sank etwas in sich zusammen und legte die gefessel-
ten Hände auf den Tisch. Er wirkte nun ganz friedlich und ein
bisschen müde.
»Sie und ich«, sagte er zu Brass. »Wir sind zwar Gegner,
aber… wir verstehen uns. Wir respektieren uns… oder?«
Brass und Warrick wechselten viel sagende Blicke.
»Sicher, Jerry«, entgegnete Brass.
»Ich werde mit Ihnen reden. Ich sage Ihnen, was Sie wissen
wollen. Von Anfang bis Ende, okay?«
»Dafür wäre ich Ihnen dankbar.«
»Aber nur Ihnen, Captain. Ich will nicht…« Dayton sah
Warrick an. »Nichts für ungut, aber Sie kenne ich nicht. Der
Captain und ich, wir kennen uns schon sehr lange.«
»Kein Problem«, sagte Warrick.
Er nickte Brass zu und verließ den Raum. Er würde auf der
anderen Seite des Spionspiegels warten, und der Uniformierte
wachte immer noch vor der Tür. Außerdem schien Daytons
Widerstand gebrochen.
Er wollte reden.
»Ich hasse diesen Kerl«, sagte er, kaum dass der CSI-
Mitarbeiter aus dem Raum war.
»Warrick?«
»Was, den Langen? Nein, nein – diesen verdammten Anwalt
von meinem Vater. Er hat dafür gesorgt, dass ich in Sundown
eingewiesen wurde. Das war der reinste Albtraum für mich.«
»Wirklich.«

»Man wird eingesperrt und unter Drogen gesetzt, nach zehn
gibt es kein Fernsehen mehr, und es wurde alles kontrolliert,
was man las – die haben sogar mein Hustler-Abo gekündigt!«
»Das klingt nach einer ungewöhnlich grausamen Strafe, Jer-
ry«, sagte Brass, und seine Stimme klang keine Spur ironisch.
»Wissen Sie, was das Schlimmste war?«
»Sagen Sie es mir.«
»Da waren nur Verrückte. Jeder Einzelne war ein verdamm-
ter… Irrer! Wissen Sie, wie es ist, wenn man den ganzen Tag
nur mit Wahnsinnigen zu tun hat?«
»Ich kann es mir vorstellen.«
»Das glaube ich nicht.«
»Aber Ihr Vater und sein Anwalt, die haben Sie doch aus
der Anstalt rausgeholt. Warum sind Sie dann so wütend?«
Dayton schüttelte den Kopf und starrte ins Leere. »Ich habe
Deams erzählt, was mein Vater mir angetan hat, und er hat
gesagt, er glaubt mir. Aber das war gelogen. Sonst hätte er
mich doch nicht wieder nach Hause geholt.«
»Erzählen Sie mir von Ihrem Vater.«
»Muss ich?«
»Nein. Aber dann verstehe ich Sie vielleicht noch besser.«
Brass beugte sich vor. »Wir zwei verstehen uns, Jerry – Sie
haben es selbst gesagt. Und ich glaube wirklich, dass Sie mich
verstehen. Ich musste jemanden stoppen, der sehr raffiniert und
clever vorging und Leute getötet hat. Es ist mein Job, solche
Sachen zu unterbinden.«
»Sicher. Ich… Ich war nur sauer auf Sie, weil… Ich will Sie
nicht beleidigen, Captain.«
»Nein, Jerry. Wir können ehrlich zueinander sein.«
»Ich komme nicht gut klar mit… Respektspersonen.«
»Wie Ihrem Vater?«
Dayton stützte die Ellbogen auf und schlug mit klirrenden
Handschellen die Hände vors Gesicht. Dann stieß er einen

langen Seufzer aus. »Sagen wir einfach, er war jemand, dem
man es nicht recht machen konnte.«
Brass nickte. »Ja, das kenne ich.«
»Ihr Vater war gemein zu Ihnen?«
»Sehr streng. Und wie Sie sagten, Jerry, man konnte es ihm
nie recht machen.«
»Ich wette, er war nicht so schlimm wie meiner!« Dayton
richtete sich auf und zeigte über den Tisch auf Brass. »Du bist
eine Enttäuschung junger Mann«, ahmte er seinen Vater nach,
»eine Enttäuschung!« Ihm stiegen die Tränen in die Augen.
»Wir versorgen dich mit allem, du hast alle Chancen, und du
enttäuschst uns immer wieder! Du bist ein richtiger Schwäch-
ling… ein schwaches kleines Mädchen. Und weißt du, was
schwache kleine Mädchen brauchen, Jerry? Weißt du, was sie
brauchen?«
Die ganze Zeit fuchtelte Dayton mit dem Zeigefinger vor
Brass’ Nase herum, und der Captain brauchte kein psychiatri-
sches Gutachten, um zu begreifen, warum Dayton seinen Op-
fern diesen Finger abgeschnitten und als grausiges Andenken
an seinen Triumph über sie aufbewahrt hatte.
Dayton lehnte sich erschöpft zurück. Die Tränen kullerten
ihm über die Wangen und zeichneten feuchte Linien in sein
Adlergesicht.
»Er hat Sie geschlagen?«, fragte Brass. »Auf den… nackten
Hintern?«
Dayton lachte bitter. »Oh, so etwas hat Ihnen Ihr ›schlim-
mer‹ Vater angetan, Captain? Da hatten Sie aber Glück! Ich
musste mich nämlich bücken… Viele, viele Male musste ich
mich vor meinem Vater bücken…«
Brass runzelte die Stirn. Catherine und Nick hatten ihm be-
richtet, was die Ärztin in Sundown über Daytons Missbrauchs-
vorwürfe gesagt hatte.
»Ihr Vater… hat Sie missbraucht?«

»Das ist eine nette Umschreibung!« Dayton beugte sich vor
und schrie: »Er hat mich gefickt!«
Brass schüttelte den Kopf.
Dann sagte er etwas, das er nicht im Traum für möglich
gehalten hätte, aber er meinte es ehrlich: »Jerry, es tut mir sehr
Leid, was Sie erleiden mussten.«
Thomas Dayton, der Vater des Mörders, war Jahrzehnte
lang eine Säule der Gesellschaft gewesen, und niemand wäre
auf die Idee gekommen, ihm kriminelle Neigungen zu un-
terstellen. Dies war allerdings nicht ungewöhnlich – es gab
einige hoch angesehene Leute, die Leichen im Keller hatten. Je
größer das Geheimnis, desto aufwändiger die Vertuschung.
Und als Brass sich Tom Dayton in Erinnerung rief – er war
ihm nur wenige Male begegnet, zum Beispiel bei dem alljährli-
chen Gebetsfrühstück des Bürgermeisters –, wurde ihm plötz-
lich klar, dass der korpulente weiße Bauunternehmer die Vor-
lage für sämtliche CASt-Opfer geliefert hatte.
»Ihre Opfer«, sagte er, »die waren alle Ihr Vater.«
»Ja…ja. Diese Bastarde, ich habe sie alle fertig gemacht!«
»Aber dann haben Sie aufgehört. Als Sie von Sundown nach
Hause zurückkehrten. Hat Ihr Vater Sie in Ruhe gelassen, oder
weshalb?«
»Er hat tatsächlich damit aufgehört. Ich war zu alt. Und…
Nun, er wusste, was ich getan hatte, und er hatte irgendwie
Angst vor mir. Zumindest diese Genugtuung hatte ich. Aber
ich bekam weiterhin diese Medikamente, und ich war wie ein
Hund mit einem Elektroschock-Halsband, wissen Sie?«
»Haben Sie deshalb aufgehört, die Medikamente zu neh-
men, Jerry?«
»Vielleicht. Und wegen der Ärzte. Ich meine, ich habe nie
wirklich offen über das gesprochen, was ich getan habe, nicht
wirklich. Aber wie Sie sagten, ich bin raffiniert und clever. Ich
habe bestimmte Dinge herausgefunden, indem ich einfach

hypothetisch mit den Ärzten redete. Und ich habe tatsächlich
etwas gelernt bei der Therapie.«
»Und das war?«
»Dass ich es nicht richten kann. Dass ich nicht ungeschehen
machen kann, was mein Vater getan hat, selbst wenn ich tau-
sende Männer wie ihn erledige.«
»Haben Sie jemals daran gedacht, ihn zu erledigen?«
»Captain, haben Sie nicht richtig zugehört? Jeder der Män-
ner war mein Vater!«
»Ich meine… in echt, Jerry. Haben Sie nie daran gedacht,
ihn zu töten?«
»Daddy umbringen?« Dayton stutzte. Er schien verwirrt.
»Wie hätte ich das tun können? Er war mein Daddy. Haben Sie
Ihren Daddy nicht geliebt, Captain?«
»Doch, Jerry, das habe ich. Aber hören Sie, wenn selbst das
Töten von tausenden Ersatz-Vätern Sie nicht heilen konnte,
vielleicht… ist es ja ein Anfang, darüber zu reden.«
»Mit Ihnen? Sie sind kein Arzt!«
»Möchten Sie mit einem Arzt reden, Jerry?«
Dayton schnaubte. »Wohl kaum. Die stecke ich doch alle in
die Tasche.«
»Dann reden Sie mit mir.« Brass zuckte mit den Schultern.
»Kann doch nicht schaden. Sehen Sie, wir wissen beide, dass
Sie für eine lange Zeit verschwinden werden. Wollen Sie in
eine Klinik oder ein Gefängnis? Vielleicht kann ich Ihnen bei
dieser Entscheidung helfen.«
»Klinik!«, sagte Dayton mit einem höhnischen Lachen.
»Das kenne ich schon… Darf man im Gefängnis abonnieren,
was man will?«
»Das hängt von der jeweiligen Einrichtung ab. Sagten Sie
nicht, Ihr Vater wusste, was Sie getan haben? Dass Sie CASt
waren?«
»Natürlich wusste er das!«

»Woher?«
»Er… er hatte mich mal wieder wegen irgendetwas zusam-
mengestaucht. Er hatte aufgehört… diese Sache mit mir zu
machen. Ich war zu groß, zu alt und viel stärker als er. Aber er
hat mir immer noch gesagt, was ich zu tun habe und was für
eine Enttäuschung ich bin. Davon hatte ich die Nase voll, und
da habe ich gesagt: ›Sieh dich vor, Alter!‹, aber er hat mich nur
ausgelacht. Also habe ich es ihm gesagt. Und gezeigt.«
»Was haben Sie ihm gezeigt?«
»Die Finger. In den Gläsern. Ich hatte vier, glaube ich, als
ich es ihm gesagt habe.«
»Also wusste er es.«
»Er wusste es sehr genau.«
»Und er und Ihr Anwalt haben Sie in eine Anstalt gesteckt,
wo die Justiz nicht an Sie herankam.«
»Ja. Sehen Sie, der Alte dachte, dass Sie mir dicht auf den
Fersen wären. Dass Sie mich schnappen würden. Er sagte, Sie
seien ein richtig guter, cleverer Kriminaler, und zwar aus dem
Osten, wo die Cops noch hart wären. Und in diesem Punkt
muss ich ihm tatsächlich zustimmen – Sie sind gut. Und dieser
Grissom auch.«
»Danke. War Ihr Vater… böse auf Sie wegen der Taten, die
CASt begangen hat?«
Dayton schloss die Augen. »Er wusste, was ich getan hatte,
und er hat wohl auch begriffen, warum ich es gemacht habe.
Aber das Einzige, was ihm Sorgen bereitete, war der drohende
›Skandal‹. Sie wissen schon, die Schande. Also hat er mich in
dieses Dreckloch gesperrt, bis sich die Aufregung wieder ge-
legt hatte.«
»Und dann hat er sie heimlich wieder rausgeholt.«
Dayton fing an, den Oberkörper hin und her zu wiegen. »Ja.
Das war nicht schwer, weil die Einweisung auf freiwilliger
Basis erfolgt war.«

»Hat außer den Ärzten noch jemand gewusst, dass Sie tage-
und wochenendweise Freigang hatten?«
Dayton überlegte. »Deams ganz bestimmt. Ich meine, er hat
meinem alten Herrn geholfen, mich da rauszuholen – die Ärzte
waren dagegen.«
»Aber sie wussten nichts von Ihrem Hobby?«
»Bitte nennen Sie es nicht Hobby, Captain. Damit beleidi-
gen Sie mich. Es ist ein Statement und eine Art… Katharsis.«
»Tut mir Leid, Jerry.«
»Nein, die Ärzte wussten nicht, dass ich CASt bin. Ich habe
ihnen erzählt, was mein Vater mir angetan hat, aber ich denke,
sie haben mir nicht geglaubt. Wem würden Sie glauben? Einem
der wichtigsten Männer der Stadt oder seinem verrückten
Sohn? Jedenfalls fanden sie, dass ich noch zu krank war, um
entlassen werden zu können. Sie wollten mich dabehalten, bis
sie besser über das Bescheid wussten, was mir fehlte.«
Brass reimte sich allmählich die ganze hässliche Geschichte
zusammen. »Und Ihr Vater wollte Sie natürlich möglichst
schnell dort herausholen, weil er nicht wollte, dass die Ärzte
die Ursache für Ihre Erkrankung erfuhren.«
Dayton machte endlich die Augen wieder auf und sah Brass
überrascht an. »Deshalb also?«
Brass seufzte. »Jerry, ich bin Ihnen dankbar für Ihre Offen-
heit.«
»Ich war ehrlich zu Ihnen, nicht wahr?«
»Das will ich meinen.«
»Dann darf ich Ihnen jetzt vielleicht eine Frage stellen, Cap-
tain?«
»Okay.«
»Waren Sie derjenige?«
»Derjenige, der… was?«
»Ich meine, Sie sind clever. Richtig gut. Aber ich konnte nie
glauben, dass Sie derjenige sind… Sie wissen schon.«

Brass richtete sich auf. »Nein, ich weiß es nicht, Jerry. Ehr-
lich.«
Dayton seufzte. Dann lächelte er. »Gut. Das hätte mir auch
nicht gefallen.«
»Jerry, bitte erklären Sie mir, wovon Sie reden!«
Dayton rieb sich die von den Handschellen wund gescheuer-
ten Gelenke. »Irgendein Cop wusste über mich Bescheid. Ich
meine, einer muss etwas gewusst haben. Mein alter Herr hat
sich nämlich jahrelang darüber beschwert, dass er Geld abdrü-
cken musste, ›für den Witwen- und Waisenfonds‹, wie er im-
mer sagte.«
Brass zog sich der Magen zusammen. »Was, glauben Sie,
hat er damit gemeint?«
Dayton zuckte mit den Schultern. »Irgendeiner von Ihrer
Truppe muss vor Jahren herausgefunden haben, dass ich CASt
bin… und mein Vater hat demjenigen Schweigegeld gezahlt.
Ich habe lange geglaubt, Sie wären es, Captain. Und ich bin
froh, dass es nicht wahr ist.«
Brass spürte, wie in seinem tiefsten Innern etwas starb.
»Wollen Sie sonst noch was wissen, Captain?«, fragte Day-
ton.
»Warum haben Sie wieder angefangen? Und Perry Bell ge-
tötet?«
»Sie wissen warum. Jemand hatte mir etwas sehr Kostbares
geraubt – meine Identität. Meine… wie bei Superman! Meine
geheime Identität.«
»Warum ausgerechnet Perry?«
»Also… Ich bin kein cleverer Kriminaler wie Sie. Ich gehö-
re wohl eher auf die andere Seite des Zauns. Aber ich war mir
ganz sicher, dass Perry der Trittbrettfahrer wäre.«
»Aber er war es nicht.«
»Mein Fehler«, sagte Dayton. »Wollen Sie die Geschichte
hören?«

»Ja«, antwortete Brass, obwohl er am liebsten nein gesagt
hätte.
»Ich bedauere diesen Fehler nicht besonders«, erklärte Day-
ton. »Perry Bell war ein fetter, alter Alkoholiker ohne Stolz.
Das Bisschen, was er hatte, habe ich ihm gegeben… weil er
sich mit seinem Buch an meine ruhmreiche Geschichte drange-
hängt hat. Er hatte nicht den Mumm, das zu tun, was ich getan
habe.« Während er sprach, kam immer stärker CASt zum
Vorschein und Jerry Dayton trat in den Hintergrund. Er richtete
sich auf und seine Augen leuchteten. Zum ersten Mal seit sie
den Verhörraum betreten hatten, hatte Brass das Gefühl, dem
blutbeschmierten Widersacher gegenüberzusitzen, der ihm ins
Bein gestochen hatte.
»Er hat natürlich um sein Leben gebettelt«, erklärte CASt
kalt und unbeteiligt. »Er hat gesagt, er sei unschuldig… dass
jemand anders es getan haben musste. Das Witzige ist, er
wusste im Grunde, wer der Nachahmer war, aber der blöde
Alki hat nicht mal gewusst, dass er es wusste.«
»Ich glaube, ich kann Ihnen nicht folgen.«
»Nun, er hat Brower erst verdächtigt, als ich ihm… auf die
Sprünge geholfen habe.«
»Wie haben Sie das gemacht?«
»Wie wohl? Ich habe ihm den Finger abgeschnitten. So ma-
che ich das doch immer.«
»Aber warum haben Sie weitergemacht, Jerry, wenn Sie
gemerkt haben, dass Bell nicht der Nachahmer war?«
»Captain, wenn Sie etwas anfangen, bringen Sie es doch
auch zu Ende, oder? Ich hasste Bell für die Dinge, die er in
seinem Schundbuch über mich geschrieben hat. Bei ihm klang
es, als hätte ich sie nicht alle.«
»Das Buch hat Sie berühmt gemacht.«
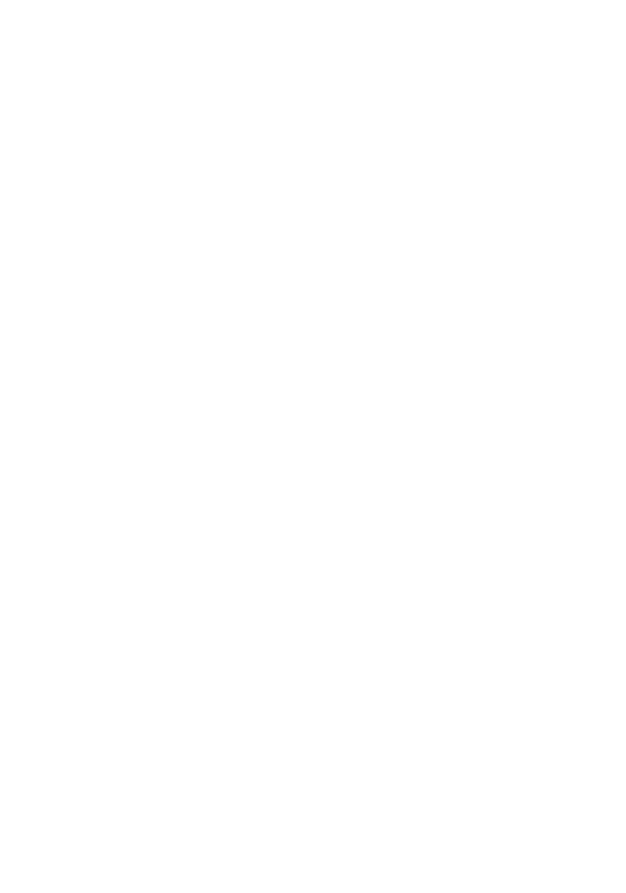
»Stimmt. Und vielleicht habe ich ihn deshalb so schonend
behandelt… Sie haben doch an einem der Tatorte eine Schlüs-
selkarte gefunden, nicht wahr?«
CASt warf diese Frage so beiläufig ein, als bitte er den Cap-
tain, ihm das Salz zu reichen.
»Ja«, antwortete Brass.
»Sie war natürlich von Bell. Aber erst als ich mit ihm
sprach, begriff er, dass Brower sie ihm geklaut haben musste.«
Brower war Bells Assistent gewesen und hatte die Karte oh-
ne Probleme an sich bringen können.
»Warum haben Sie Bell verdächtigt und nicht seinen Kolle-
gen Paquette? Er war doch auch an dem Buch beteiligt.«
CASt schüttelte den Kopf. »Bell ist derjenige, der durch die
Gegend gerannt ist und Lesungen gehalten hat. Er ist mit dem
beschissenen alten Schinken hausieren gegangen. Paquette war
erfolgreich, er ist weitergekommen. Aber ich habe immer
vermutet, dass mein Vater auch ihn bestochen hat, genau wie
diesen Cop.«
»Ihr Vater hat nie erwähnt, wer dieser Cop war?«
»Nein. Aber wir beide wissen es, nicht wahr, Captain?«
Brass antwortete nicht.
CASt sank auf seinem Stuhl zusammen und wurde wieder
Jerome Dayton. Er wirkte erschöpft.
Das konnte Brass ihm gut nachempfinden, auch er war
ziemlich kaputt.
»Habe ich alles gesagt, was Sie hören wollten?«, fragte
Dayton.
»Das haben Sie sehr gut gemacht, Jerry.«
»Sie sind nicht enttäuscht?«
»Nein. Ich würde gern wieder mit Ihnen reden. Die Sache ist
ziemlich umfangreich. So viele alte Fälle.«
»Kein Problem. Ich rede gern mit Ihnen.«
»Gut. Das freut mich«, sagte Brass.

»Wissen Sie, was mir an Ihnen gefällt, Captain?«
»Was denn, Jerry?«
»Dass Sie mir nie mit dem Finger drohen.«
»So etwas würde ich niemals tun, Jerry«, entgegnete Brass.
Der behandelnde Arzt gewährte Grissom und Catherine nur
ungern Zugang zu seinem Patienten. Obwohl er ziemlich viel
Blut verloren hatte, war Brower jedoch außer Lebensgefahr
und durfte sprechen. Der Arzt beschränkte die Zahl der Besu-
cher allerdings auf zwei, und so blieb Nick auf dem Flur bei
dem Polizeibeamten, der vor der Tür Wache schob.
Als sie das kahle weiße Krankenzimmer betraten, fühlte sich
Grissom auf seltsame Weise an das Zuhause des echten CASt
erinnert.
Der CASt-Nachahmer lag unter einer weißen Decke, auf der
seine dick verbundene linke Hand ruhte wie eine riesige Gaze-
keule. Abgesehen davon schien Brower körperlich keine weite-
ren Schäden von seinem Besuch in CASts Schloss davongetra-
gen zu haben.
Als sie hereinkamen, hatte Brower sich zum Fenster umge-
dreht, das nach Süden hinausging, auf den Strip.
»Glauben Sie wirklich, dass es etwas nützt, wenn Sie in die
andere Richtung schauen, Mark?«
Der Patient antwortete nicht und starrte schweigend aus dem
Fenster.
Catherine ging um das Bett, machte die Jalousie ganz zu
und stellte sich in sein Blickfeld.
Brower sah sie finster an, dann drehte er sich um, aber auf
der anderen Seite des Betts stand Grissom mit verschränkten
Armen und einem freundlichen Lächeln.
Nun schaute der Patient stur geradeaus, hob die rechte
Hand, in der er die Fernbedienung hielt, schaltete den Fernse-
her ein und drehte die Lautstärke auf.

Grissom nahm ihm die Fernbedienung aus der Hand und
schaltete das Gerät ab. Brower starrte unverwandt auf die
schwarze Mattscheibe.
»Sie müssen uns nicht ansehen, Mark«, sagte Grissom. »Ich
habe damit kein Problem. Aber Sie müssen mit uns reden.«
»Ich habe nichts zu sagen.«
Catherine beugte sich über ihn. »Nun, aber wir haben Ihnen
etwas zu sagen.«
»Ich muss Ihnen nicht zuhören. Ich bin hier das Opfer, und
Sie behandeln mich, als hätte ich etwas Unrechtes getan.«
»Sie sind der CASt-Nachahmer, Mark«, entgegnete Catheri-
ne. »Und das ist etwas sehr Unrechtes.«
»Ich habe die alten Fälle untersucht«, sagte er. »Sie sollten
mir eine Belohnung dafür geben, dass ich Ihnen geholfen habe,
den echten CASt zu schnappen.«
»Danke«, sagte Grissom ungerührt, »aber ich fürchte, die
Zweitbesetzung hat keine Chance, noch mal auf die Bühne zu
kommen und berühmt zu werden. Sehen Sie, Mark, wir waren
in Ihrem Haus. Wir haben die Blechschere gefunden – an der
sich Blutspuren befanden –, mit der Sie Ihren Opfern die Fin-
ger abgeschnitten haben. Wir haben das Seil, das Sie benutzt
haben, den Lippenstift, das komplette CASt-Zubehör.«
Brower entgleisten die Gesichtszüge, aber dann spielte er
den Empörten. »Was zum Teufel nützt Ihnen das ohne Durch-
suchungsbefehl?«
»Deshalb sind wir hier, Mark«, sagte Grissom freundlich
und hielt Brower das Dokument hin, der es entgeistert ansah.
»Auf welcher Grundlage?«, fragte er.
Grissom warf die Papiere auf das Bett, während Catherine
den Patienten mit einem besänftigenden Lächeln bedachte.
»Wir haben Ihre Fingerabdrücke an den Klingelknöpfen von
Marvin Sandred und Enrique Diaz gefunden.«

»Die… Die muss jemand dort platziert haben. Ich bin Kri-
minalreporter! Ich würde doch nie so etwas…«
»Dummes tun?«, warf Grissom ein. »Wollen Sie uns davon
erzählen?«
»Nein.«
»Also gut. Dann erzähle ich es Ihnen. Paquette wollte Bell
nicht feuern, und solange der auf seinem Posten saß, konnten
Sie nicht weiterkommen. Wenn Mark Brower es jemals zu
einer eigenen Kolumne bringen und sich einen Namen machen
wollte, dann musste Perry Bell verschwinden. Aber warum
haben Sie nicht nur Bell getötet?«
Brower antwortete nicht.
Catherine schaltete sich ein: »Dann hätten Sie ihn ja nur
zum Märtyrer gemacht! Aber Sie wollten ihn diskreditieren,
Mark, und sich zugleich einen Logenplatz bei einer großen
Kriminalstory sichern und Ihr eigenes CASt-Buch schreiben.«
Plötzlich begann Brower zu sprechen; leise, sehr leise. »Ich
habe diesen fetten, besoffenen Bastard die letzten fünf Jahre
mitgeschleppt. Jetzt war ich an der Reihe… Ich wollte endlich
als Starreporter zum Zuge kommen.«
»Das können Sie vielleicht immer noch«, bemerkte Grissom
fröhlich. »Die Ely Hard Times sucht immer nach guten Schrei-
bern!«
Brower wusste offensichtlich nicht, wovon Grissom redete.
Catherine tätschelte dem Patienten behutsam die bandagierte
Hand. »Die Gefängniszeitung, Mark. Sie könnten den Posten
des Todestrakt-Korrespondenten übernehmen… für eine Wei-
le.«
Brass hatte keine Ahnung, wie lange er schon durch die Ge-
gend fuhr. Es war inzwischen dunkel geworden, und er hatte
immer noch nicht den Weg nach Hause gefunden.

Die Dinge hatten sich geklärt, und Grissom hatte die Bewei-
se zu einem überzeugenden Gesamtbild zusammengesetzt.
Mark Brower würde wahrscheinlich die Giftspritze bekom-
men, obwohl er kooperiert und vor Catherine und Grissom ein
komplettes Geständnis abgelegt hatte – durch das er vielleicht
auch nur in den Genuss eines lebenslänglichen Mietvertrags für
eine Zelle im Hochsicherheitstrakt von Ely kam. Vielleicht.
Jerry Dayton würde vermutlich nicht die Höchststrafe erhal-
ten, zumindest nicht die, die man in dieser Welt bekommen
konnte. Mindestens sechs Männer waren tot, aber Dayton
würde den Rest seines Lebens in einer psychiatrischen Anstalt
verbringen, und zwar in einer, die ihre Wochenendfreigänge
nicht so verschleuderte wie ein Supermarkt seine Gratisproben.
Obwohl er es selbst kaum glauben konnte, hatte Jim Brass
Mitleid mit Dayton und hoffte, dass der Mann innerhalb der
Mauern, in denen er sein Leben fristen würde, echte Hilfe
bekommen und ein gewisses Maß an Frieden finden würde.
Es kam wahrlich nicht jeden Tag vor, dass ein Cop zwei Se-
rienkiller auf einmal festnehmen konnte, aber statt zu feiern,
fuhr der Captain ziellos in Henderson umher, ohne die Adresse
anzusteuern, die er eigentlich aufsuchen wollte. Irgendwann
gab er jedoch auf und fuhr am Wachhäuschen von Sunny Day
vor.
Der Wachmann meldete ihn an, und als Brass das Gebäude
am anderen Ende der Anlage erreichte, saß sein alter Partner in
einem dunklen Bademantel und Latschen auf der Eingangs-
treppe und rauchte eine Zigarette.
»Willst du eine?«, fragte er Brass.
Der Captain schüttelte den Kopf. »Hab aufgehört.«
»Ich hätte oben auch was zu trinken für dich.«
»Damit habe ich auch aufgehört.«
»Du bist verdammt langweilig geworden, Jim.«

Brass studierte das Gesicht von Vince Champlain. In dem
schwachen Licht, das aus den Fenstern neben dem Eingang
fiel, sah er sehr alt aus, fast gebrechlich. Seltsam, wie sich das
Blatt gewendet hatte. Champlain war Brass immer so stark
vorgekommen, als sie noch Partner waren. Er war fast eine
Vaterfigur für ihn gewesen. Aber der Mann, der ihm jahrelang
den Rücken gedeckt hatte, wirkte nun sehr schwach.
Brass setzte sich neben seinen alten Freund.
Vince nahm einen tiefen Zug von seiner Zigarette. Er blies
den Rauch aus und kicherte, dann hustete er. »Margie hat mir
verboten, in der Wohnung zu rauchen. Ich muss nach draußen.
Sie behandelt mich manchmal wie ein Kleinkind.«
»Wir haben Dayton heute eingesperrt.«
»Habe ich gehört. War schon im Fernsehen. Und Mark
Brower. Wer hätte das gedacht!«
»Ja, wer hätte das gedacht!!«
Champlain sah Brass von der Seite an. »Dann nehme ich
mal an, du hast den irren Dayton selbst verhört?«
»Habe ich.«
»Unglaublich, was diese Spinner einem für Behauptungen
auftischen, nicht wahr?«
»Ist das deine Art, es zu leugnen?«
Der pensionierte Cop zuckte mit den Schultern. »Wenn du
glaubst, du weißt es, dann glaubst du es eben. Was kann ich
dagegen tun?«
»Bis jetzt habe ich immer noch gedacht, dass ich mich viel-
leicht irre. Wir waren nicht die Einzigen, die an diesem Fall
gearbeitet haben.«
»Aber fast. Also…« Champlain holte noch einmal tief Luft
und atmete langsam aus. Er sah Brass nicht an. »Was willst du
jetzt machen?«
Brass schaute in die Sterne. »Weiß noch nicht.«

»Du könntest es vergessen. Es als Hirngespinst eines Irren
abschreiben.«
Brass senkte den Blick und sah seinem ehemaligen Partner
in die Augen.
»Sorry«, sagte Champlain und schaute weg. »Ich hätte es
besser wissen sollen.«
»Wusste Margie davon?«
Champlain schüttelte den Kopf. »Warum? Willst du es ihr
sagen?«
»Das steht mir nicht zu.«
»Aber was willst du jetzt machen? Ich habe ein Recht dar-
auf, es zu erfahren?«
»Du hast das Recht zu schweigen und dir einen Anwalt stel-
len zu lassen, wenn du dir keinen leisten kannst. Obwohl du
mit dem Geld, das Tom Dayton dir im Laufe der Jahre gegeben
hat, bestimmt einen guten bekommst. Vielleicht sogar Carlisle
Deams.«
In Champlains Gesicht spiegelten sich Wut, Enttäuschung
und Empörung. »Dann… willst du mich festnehmen? Obwohl
wir so lange Partner waren?«
»Vielleicht will ich es dir nur in Erinnerung rufen. Ich weiß
nicht, wie du erfahren hast, dass Dayton CASt war, und wie du
es geschafft hast, ohne dass die Presse – oder ich – Wind davon
bekam. Aber du hattest offenbar genug in der Hand, um Tom
Dayton trotz seines großen Einflusses unter Druck setzen zu
können.«
»Seit wann bist du so verdammt selbstgerecht?«, fragte
Champlain und trat seinen Zigarettenstummel aus. Dann steck-
te er sich sofort eine neue an.
»Nenn es, wie du willst, Vince. Ich habe einen Eid ge-
schworen, und ich bekam eine Marke. Ich habe keine Frau. Ich
habe außerhalb der Arbeit nur wenige kostbare Freunde. Es

gibt also nicht viel, was mir abgesehen von einem ruhigen
Schlaf etwas bedeutet. Aber das genügt mir.«
»Hör doch auf, Jim! Es geht doch nur um ein bisschen Geld,
verdammt.«
»Wenn dir das beim Einschlafen hilft, ist das deine Sache.
Aber es sind Menschen umgekommen, Vince. Vincent Drake
und Perry Bell wurden beide von dem echten CASt getötet,
nachdem du Tom Daytons Geld genommen und weggesehen
hast. Diese Morde hätten verhindert werden können… Warum,
Vince? Nur für einen komfortablen Ruhestand?«
Champlain warf seine Zigarette fort und Funken stoben in
die Nacht. Er sah Brass durchdringend an. »Ja.«
»So einfach?«
»Eine einfache Entscheidung: mit Daytons Geld als kleinem
Polster in den Ruhestand gehen oder nach dreißig Jahren mit
einer Rente aufhören, von der ich kaum allein leben könnte,
geschweige denn meine Frau ernähren. Ich habe nämlich eine
Frau. Und ein Leben.«
»Ein Leben, für das mehrere Menschen sterben mussten?«
Champlain starrte in die Dunkelheit. »Stolz bin ich darauf
nicht. Ich dachte, der Dreckskerl wäre einfach nur ein Beklopp-
ter, den man wegsperrt und von dem man nie wieder etwas
hört.«
»Du hast dich geirrt.«
»Denkst du, das weiß ich nicht? Aber als ich es merkte, war
es zu spät. Ich konnte nichts mehr tun!«
»Wirklich? Oder hast du dir von Daddy Dayton einfach ein
höheres Taschengeld auszahlen lassen? Was kosten diese
Apartments eigentlich? Ihr seid hier gesundheitlich rundum
versorgt, richtig?«
»Richtig. Was willst du denn jetzt machen, Jim?«
Brass dachte nach. »Gib mir eine Zigarette.«

Champlain entsprach seiner Bitte und gab ihm Feuer. »Ich
dachte, du hättest aufgehört.«
»Habe ich auch. Aber deinetwegen will ich nicht wieder mit
dem Trinken anfangen. Das bist du nicht wert.«
Der Captain nahm mehrere tiefe Züge.
»Was willst du machen, Jim?«, fragte Champlain erneut.
Brass sah seinen ehemaligen Partner scharf an. »Ich werde
darüber schlafen. Wer weiß, was die Nacht bringt. Du weißt
doch, wie es in unserer Branche ist, Vince – man weiß nie, was
als Nächstes passiert, wann das nächste Geständnis zur Tür
hereinspaziert kommt oder wann irgendein armer Bastard
beschließt, in seine Pistole zu beißen… Was willst du denn
jetzt machen?«
Damit schnippte Brass die Zigarette fort, stand auf und ent-
fernte sich, ohne Vince noch einmal anzusehen.
Champlain sprang auf. »So willst du mich hier stehen las-
sen? Nach all den Jahren? Nachdem ich dich immer unterstützt
habe?«, rief er Brass hinterher.
Aber Brass gab keine Antwort. Er ging einfach weiter.
Und Vince Champlain sah seinem alten Partner entgeistert
hinterher, bis er in der Dunkelheit verschwunden war.

Es ist eitel, etwas mit mehr zu erreichen,
was mit weniger zu erreichen möglich ist.
William Ockham
Document Outline
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
CSI Collins, Max Allan Killing Game
Collins Max Allan Na linii ognia
Collins Max Allan Wodny świat
Collins Max Allan Na linii ognia
Collins Max Allan Na linii ognia
Collins Max Allan Wodny świat
CSI Kryminalne Zagadki Las Vegas poradnik do gry
CSI Kryminalne Zagadki Las Vegas Niezbite dowody poradnik do gry
CSI Kryminalne Zagadki Las Vegas Mroczne Motywy poradnik do gry
CSI Kryminalne Zagadki Las Vegas Mroczne Motywy
CSI Kryminalne zagadki Las Vegas SOLUCJA
Michaels Fern Światła Las Vegas 03 Żar Vegas
GODZILA EAST LAS VEGAS GUION
rozdział 3, Las Vegas
GODZILA EAST LAS VEGAS PAPELES
rozdział 10, Las Vegas
VIVA LAS VEGAS propozycja zabawy, ZHP
więcej podobnych podstron