

1
Dieser Band sammelt zwei Prosaarbeiten, von Fer-
nando Pessoa, dem bedeutensten Dichter der Moderne
in der portugiesischen Literatur.
Zunächst muß sich ein fassungsloser Zuhörer von
seinem Freund, einem berühmten Bankier (und über-
zeugten Anarchisten), über das Rätsel der Welt als Fik-
tion und über die machtvollste aller Fiktionen, das Geld
belehren lassen. Eine verwirrende Predigt, die in der
selbstverständlichen Folgerung gipfelt: Der wahre
Anarchist wird Bankier, der wahre Bankier ist konse-
quenter Anarchist.
›Ein ganz ausgefallenes Abendessen‹ ist ein Nacht-
stück in Poe'scher Manier. Es führt in ein fiktives Ber-
lin, wo vor dem Auditorium einer gastronomischen
Gesellschaft ein unerhörtes Versprechen eingelöst wird.
Reinhold Werners Nachwort, das sich mit Leben und
Werk Fernando Pessoas beschäftigt, ist zugleich eine
editorische Erläuterung über zwei ungewöhnliche und
lange selbst Pessoa-Kennern unbekannt gebliebene
Prosatexte.

2

3
FERNANDO PESSOA
Ein anarchistischer Bankier
Ein ganz ausgefallenes Abendessen
Übersetzt und mit einem
Nachwort versehen von Reinhold Werner
scanned by macska
ö
2001
Verlag Klaus Wagenbach Berlin

4
1986, 1988 Verlag Klaus Wagenbach Ahornstr. 4 1000 Berlin 30

5
INHALT
Ein anarchistischer Bankier
9
Ein ganz ausgefallenes Abendessen
49
Nachwort
77

6
Pessoa im ›Abel Pereira da Fonseca‹
Am Rossio-Platz in Lissabon 1929

7
Ein anarchistischer Bankier
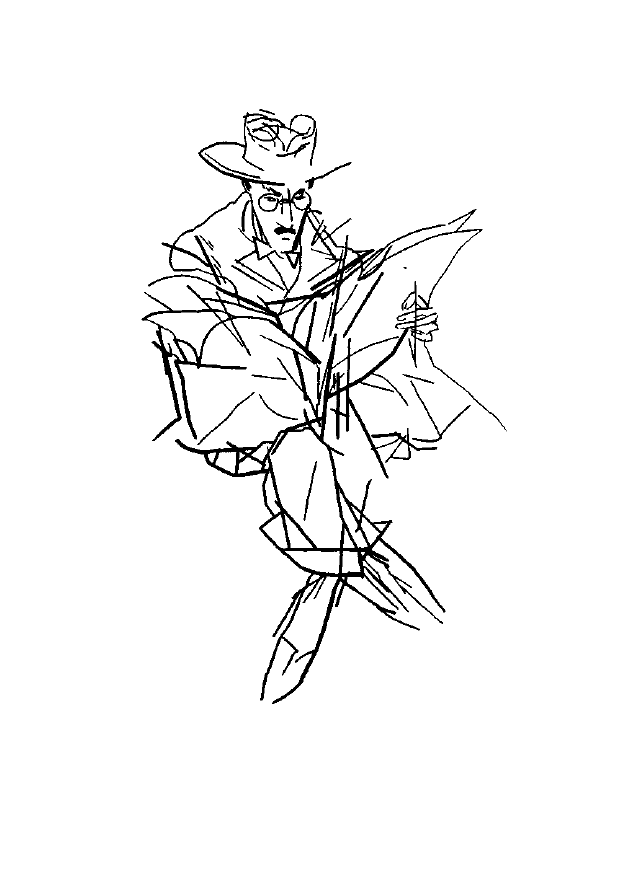
8
Fernando Pessoa,
Zeichnung von Pomar

9
Wir
hatten das Abendessen beendet. Mir gegenüber saß mein
Freund, der Bankier, ein großer Händler und namhafter Schie-
ber; er rauchte wie einer, der nicht denkt. Die Unterhaltung
war allmählich ins Stocken geraten und erstarb schließlich
ganz. Ich versuchte auf gut Glück, sie wieder in Gang zu brin-
gen und bediente mich dabei der erstbesten Idee, die mir durch
den Kopf ging. Lächelnd wandte ich mich ihm zu:
»Richtig! Mir wurde erzählt, Sie seien früher Anarchist gewe-
sen.«
»Ich bin es nicht nur gewesen, ich bin es noch immer. In die-
ser Hinsicht habe ich mich nicht geändert. Ich
bin Anarchist.«
»Was Sie nicht sagen! Sie und Anarchist? Und wieso wären
Sie Anarchist?... Sie verstehen das Wort vielleicht anders...»
»Anders als im gewöhnlichen Sinn? Nein, keineswegs. Ich
gebrauche es im ganz gewöhnlichen Sinn.«
»Sie wollen also sagen, Sie seien Anarchist im selben Sinne
wie diese Typen von den Arbeiterorganisationen? Es gäbe also
keinen Unterschied zwischen Ihnen und diesen Bombenlegern
und Gewerkschaftstypen?«
»Doch doch, es gibt einen Unterschied... Natürlich gibt es
einen Unterschied. Es ist aber nicht der, an den Sie denken. Sie
glauben vielleicht, ich hätte andere Gesellschaftstheorien als
sie?«

10
»Ach so, ich verstehe! Sie sind Anarchist in der Theorie, aber
in der Praxis sind Sie...«
»Ich bin in der Praxis ebensosehr Anarchist wie in der Theo-
rie. Und das sogar noch mehr, viel mehr als jene Typen, von
denen Sie sprachen. Mein Leben ist der Beweis dafür.«
»Wie bitte?«
»Mein Leben ist der Beweis dafür, jawohl, mein Lieber. Sie
haben offenbar diesen Dingen nie besondere Aufmerksamkeit
geschenkt. Deshalb glauben Sie, ich würde dummes Zeug re-
den oder mich über Sie lustig machen.«
»Jetzt verstehe ich gar nichts mehr! Es sei denn... es sei
denn, Sie gehen davon aus, das Leben, das Sie führen, sei zerset-
zend und asozial; nun, wenn Sie Anarchismus so verstehen...«
»Ich habe Ihnen schon gesagt: nein! Ich habe Ihnen schon
gesagt, daß ich dem Wort Anarchismus keinen anderen als den
gewöhnlichen Sinn unterlege.«
»Gut! ... Aber ich verstehe immer noch nicht... Wollen Sie
mir erzählen, es gäbe keinen Unterschied zwischen Ihren wahr-
haft anarchistischen Ideen und Ihrer Lebenspraxis? - ich
meine: Ihrer jetzigen Lebenspraxis? Wollen Sie mir denn weis-
machen, Ihr Leben stimme in allen Punkten mit dem der ge-
wöhnlichen Anarchisten überein?«
»Nein! nein, das ist es nicht. Was ich sagen will, ist, daß
meine Theorien in keiner Weise von meiner Lebenspraxis ab-
weichen; ganz im Gegenteil, beide stimmen absolut überein.
Daß ich nicht das Leben der Bombenleger und Gewerkschafts-
typen führe, stimmt. Doch deren Leben spielt sich jenseits
des Anarchismus, jenseits ihrer Ideale ab. Meines nicht. In
mir - jawohl, in mir, dem Bankier, dem großen Händler und
Schieber, wenn Sie es so hören wollen — in mir vereinigen sich
beide, Theorie und Praxis des Anarchismus, aufs genaueste. Sie
haben mich mit diesen Idioten von Bombenlegern, mit denen
von der Gewerkschaft verglichen, um zu beweisen, ich sei an-
ders als sie. Das bin ich auch, nur ist der Unterschied folgender:
die da (jawohl, die da, nicht ich) sind nur in der Theorie Anar-
chisten, ich bin es in der Theorie und in der Praxis. Die da sind
Anarchisten und Dummköpfe, ich bin Anarchist und gescheit.
Darum, mein Guter, bin ich der wahre Anarchist. Die von den
Gewerkschaften und die Bombenleger (ich war ja auch einer
von ihnen und habe sie gerade um des wahren Anarchismus

11
willen verlassen) - sie stellen ja nur den Abfall des Anarchis-
mus dar, sie sind die Drohnen der großen anarchistischen
Lehre.«
»Nicht einmal der Teufel würde seinen Ohren trauen! Das ist
einfach umwerfend! Und wie bringen Sie Ihr Leben - ich meine
Ihr Leben als Bankier und Händler — und die Theorie des Anar-
chismus auf einen Nenner? Wie bringen Sie beide auf einen
Nenner, wenn Sie sagen, Sie verstünden unter anarchistischer
Theorie dasselbe wie die gewöhnlichen Anarchisten? Und noch
dazu möchten Sie mir weismachen, Sie unterschieden sich von
ihnen dadurch, daß Sie
mehr Anarchist sind als jene, - ist dem
nicht so?«
»In der Tat.«
»Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr!«
»Liegt Ihnen denn daran, zu verstehen?«
»Unbedingt!«
Die Zigarre in seinem Mund war ausgegangen; er nahm sie und
zündete sie langsam wieder an, betrachtete das Streichholz bis
es abgebrannt war, legte es behutsam in den Aschenbecher,
dann hob er den Kopf, den er eine Zeitlang gesenkt hatte und
sagte:
»Hören Sie! Ich komme aus dem Volk, ich stamme aus der Ar-
beiterklasse der Stadt. Wie Sie sich vorstellen können, ist mir
nichts Förderliches in die Wiege gelegt worden, weder Rang
noch entsprechende Verhältnisse. Es ergab sich lediglich, daß
ich einen von Natur aus hellen Verstand besaß und einen hin-
reichend starken Willen. Doch hatte ich damit zwei Gaben, die
mir meine niedrige Herkunft nicht streitig machen konnte.
Ich wurde Arbeiter, habe gearbeitet und ein bedrückendes
Leben geführt, wie die meisten Leute aus jenem Milieu. Nicht
daß ich Hunger gelitten hätte, doch hätte oft nicht viel daran
gefehlt. Das hätte übrigens an allem, was daraus folgte und was
ich Ihnen jetzt erzählen werde, nichts geändert, nichts an mei-
nem früheren und nichts an meinem jetzigen Leben.
Ich war alles in allem ein ganz gewöhnlicher Arbeiter: ich
habe gearbeitet, weil ich arbeiten mußte, aber so wenig wie
eben möglich. Ich war nämlich gescheit. Bei jeder Gelegenheit
las und diskutierte ich alles Mögliche, und weil ich nicht auf

12
den Kopf gefallen war, machten sich in mir große Unzufrieden-
heit und große Entrüstung breit über mein Los und über die
gesellschaftlichen Bedingungen, die es so haben wollten. Ich
habe Ihnen schon gesagt, es hätte schlimmer kommen können;
aber damals schien mir, als sei ich ein Mensch, dem das Schick-
sal alle erdenklichen Ungerechtigkeiten angetan hatte, und als
habe es sich dazu der gesellschaftlichen Konventionen bedient.
Damals war ich wohl zwanzig oder höchstens einundzwanzig
Jahre alt, und in jener Zeit wurde ich Anarchist.«
Er schwieg eine Weile, beugte sich noch mehr vor und fuhr fort.
»Ich war immer schon mehr oder weniger aufgeweckt. Ich
spürte diese Entrüstung in mir und wollte sie verstehen. So
wurde ich zu einem bewußten und überzeugten Anarchisten -
zu dem bewußten und überzeugten Anarchisten, der ich heute
noch bin.«
»Und Ihre heutige Theorie, ist das dieselbe wie damals?«
»Dieselbe. Die anarchistische Theorie, die wahre Theorie,
das ist doch ein und dasselbe. Ich habe an ihr festgehalten, seit-
dem ich mich zum Anarchisten gemacht habe, Sie werden
gleich sehen... Wie ich Ihnen schon sagte, war ich von Natur
aus helle und wurde so zu einem bewußten Anarchisten. Nur,
was heißt das, Anarchist sein? Das heißt, sich gegen die Unge-
rechtigkeiten auflehnen, die darin bestehen, daß wir
gesell-
schaftlich gesehen ungleich zur Welt kommen - das ist es, was
einen Anarchisten ausmacht. Daraus folgt, wie sich zeigen läßt,
die Auflehnung gegen die gesellschaftlichen Konventionen, die
diese Ungleichheit erst ermöglichen. Was ich Ihnen jetzt erklä-
ren will, ist der psychologische Weg: wie wird einer zum Anar-
chisten? Ich komme gleich auf die Theorie zurück. Versuchen
Sie jetzt einmal, die Entrüstung eines gescheiten Typen unter
solchen Umständen nachzuvollziehen. Wie sieht er die Welt?
Der eine wird als Millionär geboren und ist von Geburt an ge-
feit gegen Mißgeschicke - und davon gibt es mehr als genug -,
Mißgeschicke, die das Geld verhindert oder immerhin ab-
schwächt; ein anderer kommt armselig zur Welt und ist von
Kind an ein Mund zuviel in einer Familie, die mehr Münder
stopfen muß, als sie kann. Der eine kommt als Graf oder Mar-
quis zur Welt und genießt die Hochachtung der Menschen, egal
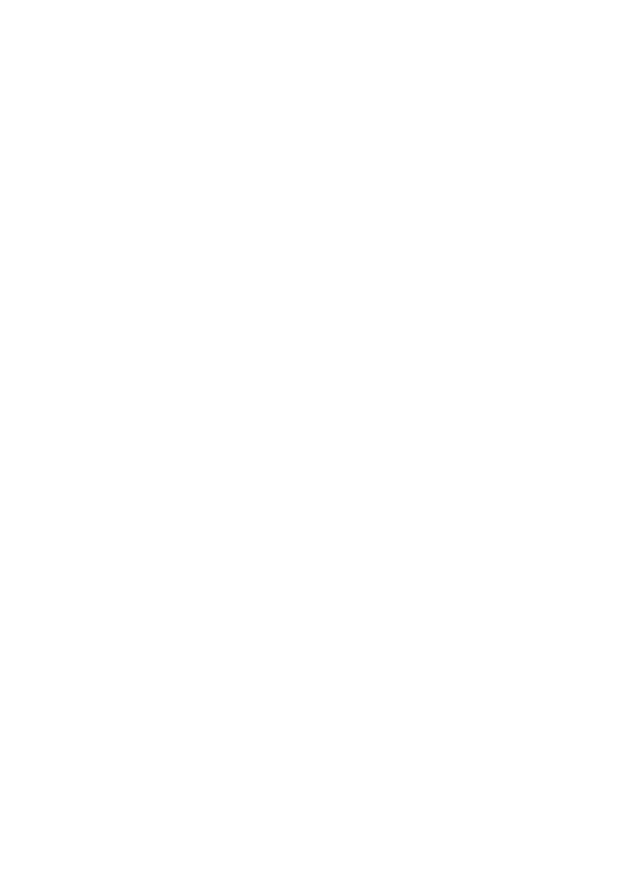
13
was er tut; ein anderer, wie ich, muß klein beigeben, will er wie
ein Mensch behandelt werden. Manche werden so geboren,
daß sie studieren, reisen und sich bilden können - sich intelli-
genter machen können (sagen wir es ruhig so) als andere, die es
von Natur aus wären. So ist es und so wird es alles in allem
weiterhin sein...
Die Ungerechtigkeiten der Natur - sei's drum! Wir können
sie nicht abschaffen. Aber die der Gesellschaft und ihrer Ver-
hältnisse - warum schaffen wir sie nicht ab? Ich nehme es hin,
— und ich habe gar keine andere Wahl —, daß mir jemand über-
legen ist, weil ihm die Natur gewisse Gaben geschenkt hat: Ta-
lent, Kraft, Energie. Ich nehme nicht hin, daß er mir aufgrund
solcher Eigenschaften überlegen sein soll, die erst später hinzu-
gekommen sind und die er nicht hatte, als er den Bauch seiner
Mutter verließ, die vielmehr ein glücklicher Zufall ihm verlie-
hen hat, kaum daß er draußen war - Reichtum, eine gesell-
schaftliche Stellung, Erleichterungen im Leben usw. Und aus
dieser Auflehnung, die ich Ihnen hier darzulegen versuche, ging
damals mein Anarchismus hervor - jener Anarchismus - ich
sagte das schon — zu dem ich mich nach wie vor unverändert
bekenne.«
Wieder schwieg er eine Weile, als müsse er erst überlegen, wie
er fortfahren könnte. Er rauchte und blies den Rauch langsam
an mir vorbei. Dann wandte er sich mir wieder zu und wollte
gerade fortfahren, als ich ihn unterbrach.
»Eine Frage, aus purer Neugier... Warum sind Sie eigentlich
Anarchist? Sie hätten ebensogut Sozialist werden können oder
auf sonst etwas Fortschrittliches, aber weniger Entlegenes zu-
rückgreifen können. Das hätte sich doch auch mit Ihrer Aufleh-
nung vereinbaren lassen... Ich schließe aus dem, was Sie mir
gesagt haben, daß Sie Anarchismus (und ich finde, das wäre
eine gute Definition) als Auflehnung gegen alle gesellschaft-
lichen Konventionen und Formeln verstehen, als den Wunsch
und das Bemühen, sie alle abzuschaffen...«
»Genau das.«
»Und warum haben Sie sich für diese extreme Lösung ent-
schieden und nicht für irgendeine andere... eine irgendwo da-
zwischen?...«

14
»Das werde ich Ihnen gleich sagen. Ich habe über all das
lange nachgedacht. Selbstverständlich kam ich durch die Flug-
blätter, die ich las, mit all diesen Theorien in Berührung. Ich
entschied mich für die anarchistische Theorie — eine extreme
Theorie, wie Sie ganz richtig bemerkt haben -, aus Gründen,
die ich Ihnen in ein paar Worten verraten will.«
Er starrte eine Zeitlang ins Leere. Dann wandte er sich wieder
mir zu.
Das wahre Übel, das Übel schlechthin, sind die gesellschaft-
lichen Konventionen und Fiktionen, die sich über die natür-
lichen Gegebenheiten legen - angefangen von der Familie bis
hin zum Geld, von der Religion bis zum Staat. Man wird als
Mann oder als Frau geboren — ich will damit sagen, man wird
geboren, um als Erwachsener einmal Mann oder Frau zu sein;
man wird aber nach den Gesetzen der Natur nicht geboren, um
Ehemann oder um reich oder arm zu sein, ebensowenig kommt
man als Katholik oder Protestant, als Portugiese oder Englän-
der zur Welt. All das wird man nur unter dem Einfluß gesell-
schaftlicher Fiktionen. Warum aber sind diese gesellschaft-
lichen Fiktionen schlecht?
Weil es sich um Fiktionen handelt,
weil sie nicht natürlich sind. Der Staat taugt ebensowenig wie
das Geld, die Religionen ebensowenig wie eine Familiengrün-
dung. Gäbe es andere Fiktionen dieser Art, wären sie genauso
schlecht,
weil es auch nur Fiktionen wären, weil sie sich auch
nur über die natürlichen Gegebenheiten legen würden und die-
sen im Wege wären. Und jedes System - außer dem rein anar-
chistischen, das ja all diese Fiktionen samt und sonders ab-
schaffen will -
ist auch nur eine Fiktion. All unser Wünschen
und all unser Bemühen, unsere ganze Intelligenz darauf zu ver-
wenden, eine gesellschaftliche Fiktion durch eine andere zu er-
setzen, wäre absurd, wenn nicht ein Verbrechen,
weil das dar-
auf hinausliefe, Aufruhr in die Gesellschaft zu tragen, und das
einzig und allein mit dem Ziel, nichts zu verändern. Wenn wir
schon die gesellschaftlichen Fiktionen ungerecht finden, weil

15
sie das Natürliche im Menschen niederhalten und unterdrük-
ken, warum dann unsere Kraft damit verschwenden, sie durch
andere zu ersetzen, wo wir sie doch alle vernichten könnten?
Mir scheint, das ist schlüssig. Doch nehmen wir einmal an,
dem wäre nicht so; nehmen wir einmal an, man hielte dem
entgegen, das alles sei ja ganz richtig, aber das anarchistische
System sei in der Praxis nicht zu verwirklichen, prüfen wir ru-
hig diese Seite des Problems.
Warum wäre das anarchistische System nicht zu verwirk-
lichen? Wir Fortschrittler gehen alle von dem Grundsatz aus,
daß das gegenwärtige System ungerecht ist, darüber hinaus
aber meinen wir, daß es durch ein gerechteres ersetzt werden
muß, damit Gerechtigkeit herrschen kann. Dächten wir an-
ders, wären wir keine Fortschrittler, sondern Bourgeois. Woher
kommt nun das Kriterium für
Gerechtigkeit? Aus dem, was
natürlich und wahr ist, im Gegensatz zu den gesellschaftlichen
Fiktionen und den Lügen der Konvention. Wenn aber etwas
natürlich ist, dann ist es das ganz und gar nicht nur zur Hälfte,
zu einem Viertel oder zu einem Achtel. Na schön! Dann aber
eines von beiden: entweder läßt sich das, was natürlich ist,
gesellschaftlich verwirklichen oder es läßt sich nicht verwirk-
lichen; anders gesagt: entweder kann eine Gesellschaft etwas
Natürliches sein oder die Gesellschaft ist im wesentlichen Fik-
tion, dann kann sie in keiner Weise etwas Natürliches sein.
Wenn eine Gesellschaft etwas Natürliches sein kann, dann
kann es auch eine anarchistische oder freie Gesellschaft geben,
muß es sie geben, weil sie eine ganz und gar natürliche Gesell-
schaft wäre. Kann eine Gesellschaft aber nicht etwas Natür-
liches sein, sollte sie (aus welchem Grund auch immer) Fiktion
sein müssen, dann sollten wir sie als das kleinere Übel betrach-
ten und sie innerhalb dieser unvermeidlichen Fiktion so natür-
lich wie möglich gestalten, damit sie auch so gerecht wie mög-
lich ist. Und welches ist denn die natürlichste Fiktion? Keine ist
an sich natürlich, da sie ja Fiktion ist; am natürlichsten wäre in
diesem Fall noch die, welche am natürlichsten
erscheint, wel-
che als am natürlichsten
empfunden wird. Und welche er-
scheint am natürlichsten oder welche empfinden wir als am
natürlichsten? Die, an welche wir gewöhnt sind. (Verstehen
Sie: etwas ist natürlich, wenn es aus dem Instinkt kommt, und
was zwar nicht aus dem Instinkt kommt, was ihm aber alles in

16
allem ähnelt, ist die Gewohnheit. Rauchen ist weder natürlich
noch eine Notwendigkeit des Instinkts, doch haben wir uns
erst einmal ans Rauchen gewöhnt, kommt es uns natürlich vor,
wird es wie eine Notwendigkeit des Instinkts empfunden.) Und
welche gesellschaftliche Fiktion ist uns zur Gewohnheit gewor-
den? Nun, das jetzige System, das bürgerliche System. Daraus
ergibt sich, logisch betrachtet: entweder wir halten eine natür-
liche Gesellschaft für möglich, dann müßten wir den Anarchis-
mus vertreten, oder aber wir meinen, sie sei nicht möglich,
dann müßten wir das bürgerliche Regime verteidigen. Eine Hy-
pothese dazwischen gibt es nicht. Konnten Sie mir folgen?...
»Ja, das ist durchaus schlüssig.«
»Noch nicht ganz schlüssig... Noch gilt es einen anderen
Einwand derselben Art auszuschalten... Man könnte darin
übereinstimmen, daß das anarchistische System zwar verwirk-
licht werden kann, man könnte aber bezweifeln, daß es
mit
einem Mal verwirklicht wird — bezweifeln, daß es einen Über-
gang von der bürgerlichen zur freien Gesellschaft gibt, ohne
daß sich ein oder mehrere Stadien bzw. Regimes dazwischen-
schalten. Wer einen solchen Einwand vorbringt, hält die anar-
chistische Gesellschaft zwar für gut und machbar; doch
schwant ihm, daß es ein Übergangsstadium geben muß zwi-
schen bürgerlicher und anarchistischer Gesellschaft.
Na schön. Nehmen wir einmal an, daß dem so sei. Was für
ein Übergangsstadium wäre das? Unser Ziel ist die anarchisti-
sche oder freie Gesellschaft. Folglich kann das Übergangssta-
dium nur eines sein, das die Menschheit auf die freie Gesell-
schaft vorbereitet. Diese Vorbereitung ist entweder materieller
oder geistiger Art; das heißt, entweder handelt es sich um eine
Reihe materieller bzw. gesellschaftlicher Errungenschaften,
mit deren Hilfe sich die Menschheit auf die freie Gesellschaft
einzustellen lernt, oder es handelt sich um bloße Aufklärung,
die immer mehr an Boden und Einfluß gewinnt und die die
Menschheit
geistig dahin bringt, diese freie Gesellschaft zu
wünschen und zu akzeptieren.
Nehmen wir einmal den ersten Fall an, die allmähliche mate-
rielle Umstellung der Menschheit auf die freie Gesellschaft.
Das wäre unmöglich - mehr als unmöglich, es wäre absurd.
Materiell kann man sich nur auf etwas
schon Existierendes
umstellen. Niemand von uns kann sich materiell auf das gesell-

17
schaftliche Milieu des 2.3. Jahrhunderts umstellen, auch wenn
er wüßte, wie es beschaffen wäre; und er kann sich deshalb
nicht materiell darauf umstellen, weil das 13. Jahrhundert mit
seinem gesellschaftlichen Milieu
materiell noch nicht existiert.
Und so kommen wir zu dem Schluß, daß beim Übergang von
der bürgerlichen zur freien Gesellschaft von Umstellung,
Wandlung oder Wechsel nur
geistig die Rede sein kann, näm-
lich so, daß sich die Leute geistig allmählich auf die Idee einer
freien Gesellschaft einstellen... Was dagegen die materielle
Umstellung anbelangt, gäbe es noch die Hypothese...«
»Zum Kuckuck mit all Ihren Hypothesen!«
»Lieber Mann! Jemand mit einem wachen Verstand muß
doch erst alle denkbaren Einwände prüfen und widerlegen, be-
vor er dann behaupten kann, er sei sich seiner Lehre sicher.
Überdies ist das alles die Antwort auf eine Frage, die Sie mir
gestellt haben.«
»Schon gut.«
»Was also die materielle Umstellung anbelangt, gibt es je-
denfalls, wie ich schon sagte, noch eine andere Hypothese. Und
zwar die einer revolutionären Diktatur.«
»Wie? Einer revolutionären Diktatur?«
»Wie ich vorhin schon dargelegt habe, kann es keine mate-
rielle Umstellung auf etwas geben, das materiell noch gar nicht
existiert. Wenn aufgrund einer plötzlichen Erschütterung eine
gesellschaftliche Revolution stattfände, würde nicht eine freie
Gesellschaft errichtet (die Menschheit wäre darauf ja noch
nicht vorbereitet), sondern die Diktatur derer, die die freie Ge-
sellschaft einführen wollen. Es existierte somit schon
materiell
etwas von der freien Gesellschaft, wenn auch nur im Entwurf,
in der Anlage. Es gäbe folglich etwas Materielles, auf das sich
die Menschheit einstellen könnte. Und genau das ist das Argu-
ment, das jene Schwachköpfe vertreten würden, die eine »Dik-
tatur des Proletariats« vertreten, wenn sie nur in der Lage wä-
ren, zu argumentieren oder zu denken. Selbstverständlich
stammt das Argument nicht von ihnen: es stammt von mir. Ich
führe es als Einwand gegen mich selber an. Und, wie ich Ihnen
jetzt zeigen werde - es ist falsch.
Ein revolutionäres Regime, welches Ziel es auch immer an-
steuern mag, von welchen Ideen es sich auch immer leiten läßt,
ist
materiell gesehen, solange es existiert, nur eines — ein revolu-

18
tionäres Regime. Nun bedeutet revolutionäres Regime aber
Kriegsdiktatur oder, um es genauer zu bezeichnen, ein militäri-
sches Gewaltregime, weil nämlich der Kriegszustand über die
Gesellschaft verhängt würde, und zwar von einem Teil ihrer
selbst — jenem Teil, der mit der Revolution die Macht über-
nommen hat. Und was kommt dabei heraus? Heraus kommt
dabei, daß derjenige, der sich auf ein solches Regime einstellt,
das
materiell und umstandslos ein militärisches Gewaltregime
ist, sich auf ein militärisches Gewaltregime einstellt. Die Idee,
von der sich die Revolutionäre hatten leiten lassen, und das
Ziel, das sie angesteuert hatten, sind jetzt vollständig aus der
gesellschaftlichen
Wirklichkeit verschwunden, die vielmehr
ausschließlich von kriegerischem Geschehen in Anspruch ge-
nommen wird. So entspringt also einer revolutionären Dikta-
tur — und das um so mehr, je länger diese Diktatur dauert — eine
kriegerische Gesellschaft von der Art einer Diktatur, mit ande-
ren Worten, eine militärische Gewaltherrschaft. Wie könnte
dem auch anders sein? Es ist ja nie anders gewesen. Ich kenne
mich in der Geschichte nicht besonders aus, doch das, was ich
weiß, bestätigt das alles nur und hat es immer wieder bestätigt.
Was ist aus den politischen Unruhen Roms hervorgegangen?
Das römische Imperium und seine militärische Gewaltherr-
schaft. Was ist aus der Französischen Revolution hervorgegan-
gen? Napoleon und seine militärische Gewaltherrschaft. Und
Sie werden noch sehen, was die russische Revolution hervor-
bringen wird... Etwas, das die Verwirklichung der freien Ge-
sellschaft um Jahrzehnte verzögern wird. Aber was darf man
schon von einem Volk von Analphabeten und Mystikern er-
warten?...
»Doch das gehört nicht hierher... Haben Sie meinen Argu-
menten folgen können?«
»Durchaus.«
»Dann verstehen Sie auch, warum ich zu folgender Schluß-
folgerung gekommen bin; Ziel: die anarchistische Gesell-
schaft, die freie Gesellschaft. Mittel:
übergangsloser Wechsel
von der bürgerlichen zur freien Gesellschaft. Dieser Wechsel
könnte vorbereitet und ermöglicht werden mit Hilfe einer
intensiven, totalen, allumfassenden Aufklärungsarbeit; sie
würde die Leute empfänglich machen und jeden Widerstand
schwächen. Selbstverständlich verstehe ich unter ›Aufklä-

19
rungsarbeit‹ nicht nur das geschriebene oder gesprochene
Wort: ich verstehe darunter jede direkte oder indirekte Aktion,
sofern sie dazu beiträgt, die Leute für die freie Gesellschaft
empfänglich zu machen und den Widerstand gegen ihre Her-
aufkunft zu schwächen. Wenn es dann quasi keinen Wider-
stand mehr gibt, könnte sich die gesellschaftliche Revolution,
wenn sie denn stattfindet, rasch und leicht vollziehen, und sie
hätte keine revolutionäre Diktatur nötig, denn gegen wen
sollte sie sich überhaupt richten? Wenn sich aber die Dinge so
nicht ereignen können, hieße das, daß sich der Anarchismus
nicht verwirklichen läßt; und wenn sich der Anarchismus
nicht verwirklichen läßt, dann ist, wie ich schon nachgewiesen
habe, nur die bürgerliche Gesellschaft verteidigenswert und
gerecht.
Sie sehen also, warum und wie ich zum Anarchisten wurde
und warum und wie ich die übrigen, weniger kühnen Sozialleh-
ren als falsch und naturwidrig verworfen habe.
Das war's! ...Nehmen wir jetzt meine Geschichte wieder
auf.«
Er ließ ein Streichholz aufflammen und zündete sich langsam
seine Zigarre an. Dann konzentrierte er sich, um nach einer
kleinen Pause fortzufahren.
Es gab eine Reihe anderer junger Burschen, die meine Ansich-
ten teilten. Bei den meisten handelte es sich um Arbeiter, doch
nicht bei allen; alle aber waren arm und, soweit ich mich erin-
nere, nicht gerade dumm. Alle wollten wir uns in gewissem
Sinne weiterbilden, Dinge kennenlernen und gleichzeitig Auf-
klärungsarbeit machen, unsere Ideen unter die Leute bringen.
Wir wollten für uns und für die anderen — für die ganze
Menschheit - eine neue Gesellschaft, eine Gesellschaft frei von
all diesen Vorurteilen, die auf künstliche Weise die Menschen
für ungleich erklären und ihnen Minderwertigkeiten, Gebre-
chen und Beschränktheiten andichten, mit denen die Natur
nichts im Sinn hat. Was mich betrifft, so wurde ich durch die

20
Lektüre in meinen Ansichten bestärkt. Von den preiswerten an-
archistischen Veröffentlichungen jener Zeit, es gab davon da-
mals schon mehr als genug, las ich fast alles. Ich ging zu den
Vorträgen und Versammlungen derer, die damals Aufklärungs-
arbeit betrieben. Jedes Buch und jede Rede überzeugten mich
nur noch mehr von der Richtigkeit und Wahrheit meiner Ideen.
Und wovon ich damals überzeugt war- mein lieber Freund, ich
sage das gerne noch einmal —, davon bin ich noch heute über-
zeugt; der einzige Unterschied ist, daß ich damals von Ideen
überzeugt war, heute aber bin ich von ihnen überzeugt und lebe
gleichzeitig danach.«
» Nun j a, das mag j a angehen, schön! Wahrscheinlich sind Sie
so zum Anarchisten geworden und ich gestehe Ihnen zu, daß
Sie Anarchist waren. Es sind keine weiteren Beweise vonnöten.
Ich würde nur gern wissen, wie daraus der Bankier entstanden
ist..., wie das ohne Widerspruch vor sich gehen konnte... Ich
könnte mir zum Beispiel vorstellen, daß...«
»Sie können sich gar nichts vorstellen. Ich weiß schon, was
Sie sagen wollen... Sie stützen sich auf die Argumente, die Sie
soeben vernommen haben und Sie glauben, ich sei der Mei-
nung, der Anarchismus ließe sich nicht verwirklichen, und daß
deswegen, wie ich eben sagte, einzig die bürgerliche Gesell-
schaft verteidigenswert und gerecht sei — stimmt's...«
»Ja, so oder ähnlich dachte ich mir das...«
»Und wie sollte das möglich sein, wo ich Ihnen doch zu Be-
ginn unserer Unterhaltung gesagt und auch wiederholt habe,
daß ich Anarchist bin, daß ich nicht nur einer war, sondern
immer noch einer bin? Wenn ich aus dem Grund, den Sie in
Rechnung stellen, Bankier und Händler geworden wäre, wäre
ich nicht Anarchist, sondern Bourgeois.«
»Ja, da haben Sie wohl Recht... Aber wie zum Teufel... ?
Also, schießen Sie los!...«
»Wie ich Ihnen schon sagte, bin ich (war ich immer) jemand
mit einem wachen Verstand und außerdem ein Mann der Tat.
Dabei handelt es sich um natürliche Eigenschaften; sie wurden
mir nicht erst in die Wiege gelegt (wenn ich jemals eine Wiege
hatte), höchstens habe ich sie da reingelegt. Als Anarchist fand
ich es unerträglich, nur passiv Anarchist zu sein, nur immer
Reden anzuhören und mit den Freunden darüber zu diskutie-
ren. Nein: es mußte etwas geschehen! Es mußte gearbeitet wer-

21
den und für die Sache der Unterdrückten und der Opfer gesell-
schaftlicher Konventionen gekämpft werden! Ich beschloß, im
Rahmen des Möglichen, die Sache in die Hand zu nehmen. Ich
überlegte mir, wie ich der anarchistischen Sache dienlich sein
könnte. Ich ließ mir einen Aktionsplan durch den Kopf gehen.
Was will denn ein Anarchist? Freiheit - Freiheit für sich und
die anderen, für die ganze Menschheit. Er möchte sich vom
Einfluß und dem Druck der gesellschaftlichen Fiktionen be-
freien, er möchte frei sein, wie damals, als er geboren wurde
und ins Leben trat, so frei, wie er es eigentlich immer sein sollte,
ginge es gerecht zu, und diese Freiheit will er für sich und die
anderen. Nur können vor der Natur nicht alle gleich sein: die
einen kommen groß, die anderen klein zur Welt; die einen sind
von Geburt an stark, die anderen schwach; manche sind intelli-
gent, andere sind es weniger... Doch von diesem Tatbestand
aus könnten alle gleich sein, nur - die gesellschaftlichen Fiktio-
nen verhindern es, und so galt es, die gesellschaftlichen Fiktio-
nen zu vernichten.
Es galt, sie zu vernichten. Doch eines entging mir dabei
durchaus nicht: es galt, sie zu vernichten,
aber zugunsten der
Freiheit, die Errichtung einer freien Gesellschaft mußte im
Auge behalten werden. Denn man kann gesellschaftliche Fik-
tionen um der Freiheit willen vernichten, um ihr den Weg zu
ebnen, aber auch, um neue gesellschaftliche Fiktionen herauf-
zubeschwören, die schon insofern nichts taugen können, als es
sich auch wiederum nur um Fiktionen handelt. Vorsicht war
also geboten. Es galt, einen Aktionsplan zu entwerfen - ob mit
oder ohne Gewalt, egal (denn angesichts der herrschenden Un-
gerechtigkeiten war alles erlaubt) -, einen Plan, der dazu bei-
tragen würde, die gesellschaftlichen Fiktionen zu vernichten,
ohne deshalb die Schaffung künftiger Freiheit zu behindern;
also mußte im Rahmen des Möglichen schon etwas von der
zukünftigen Freiheit geschaffen werden.
Bei dieser Freiheit, die nicht behindert werden durfte, han-
delte es sich selbstverständlich um eine
Freiheit in der Zukunft
und, in der Gegenwart, um
die Freiheit derer, die von den ge-
sellschaftlichen Fiktionen unterdrückt wurden. Es versteht sich
von selbst, daß wir nicht darauf achtzugeben brauchten, ob wir
vielleicht die »Freiheit« der Mächtigen, der Gutsituierten, all
jener behinderten, die die gesellschaftlichen Fiktionen reprä-

22
sentierten und von ihnen profitierten. Ihre Freiheit ist keine
Freiheit, es ist die Freiheit zu tyrannisieren, also das Gegenteil
von Freiheit. Eben die, die es im Gegenteil unter allen Umstän-
den zu verhindern und zu bekämpfen galt. Das ist doch ein-
leuchtend - oder?«
»Durchaus einleuchtend... Fahren Sie fort...«
»Für wen will ein Anarchist Freiheit? Für die ganze Mensch-
heit. Und wie erreicht man Freiheit für die ganze Menschheit?
Indem man alle gesellschaftlichen Fiktionen völlig vernichtet.
Und wie lassen sich die gesellschaftlichen Fiktionen völlig ver-
nichten? Ich habe Ihnen vorhin schon die Erklärung dafür ge-
geben, als ich auf Ihre Frage hin die anderen fortschrittlichen
Systeme erörterte und Ihnen erklärte, warum und wie ich zum
Anarchisten wurde... Erinnern Sie sich noch an die Schlußfol-
gerung?«
»Ich erinnere mich...«
»Eine überwältigende Revolution, plötzlich und unerwartet,
Ergebnis: die Gesellschaft geht mit einem Sprung vom bürger-
lichen Regime in eine freie Gesellschaft über. Diese gesell-
schaftliche Revolution, von langer Hand und mittels direkter
und indirekter Aktionen intensiv vorbereitet, um die Leute für
die Heraufkunft der freien Gesellschaft empfänglich zu ma-
chen und um die Widerstände der Bourgeoisie bis hin zur Be-
wußtlosigkeit zu schwächen... Ich brauche Ihnen nicht all die
Gründe zu wiederholen, die, auf den Anarchismus bezogen,
unweigerlich zu dieser Schlußfolgerung führen. Ich habe sie Ih-
nen schon auseinandergesetzt, und Sie haben sie ja begriffen.«
»Eben.«
»Eine solche Revolution könnte günstigenfalls eine Welt-
revolution sein, die gleichzeitig an allen Ecken der Welt - oder
zumindest an den wichtigsten Ecken - ausbrechen würde;
oder, falls nicht, die immerhin von einer Ecke auf die andere
übergreifen würde, - sie wäre auf jeden Fall fulminant und
fände überall, d. h. in jeder Nation statt.
Na schön! Aber welchen Beitrag könnte ich dazu leisten? Ich
allein könnte sie nicht machen, die große Weltrevolution, ich
könnte nicht einmal in meinem eigenen Land eine ganze Revo-
lution auslösen. Einzig und allein könnte ich mit all meinen
Kräften mithelfen, diese Revolution vorzubereiten. Ich habe
Ihnen schon erklärt, wie: indem ich mit allen verfügbaren Mit-

23
teln die gesellschaftlichen Fiktionen bekämpfe, indem ich
weder diesen Kampf bzw. die Aufklärungsarbeit für eine freie
Gesellschaft behindere, noch die zukünftige Freiheit oder die
jetzige Freiheit der Unterdrückten beeinträchtige, indem ich
jetzt schon, wenn möglich, etwas von dieser zukünftigen Frei-
heit schaffe.«
Er zog den Rauch ein, machte eine kurze Pause und fuhr dann
fort.
Dabei, lieber Freund, konnte ich meinen ganzen Scharfsinn
ins Werk setzen. Für die Zukunft zu arbeiten, ist gut, dachte
ich; für die Freiheit der anderen zu arbeiten, ist rechtens. Doch
wo bleibe ich bei all dem? Zähle ich nicht? Wäre ich ein Christ
gewesen, hätte ich mich rüstig für die Zukunft der anderen ein-
gesetzt, denn dann hätte ich ja meine Belohnung im Himmel
erhalten. Nur, wäre ich Christ gewesen, wäre ich nicht auch
Anarchist gewesen, denn derlei Ungerechtigkeiten hätten in
diesem kurzen Leben kein Gewicht gehabt: sie wären nur Teil
der irdischen Prüfungen gewesen, und das ewige Leben hätte
einen für sie entschädigt. Doch ich war ja nicht Christ und bin
nicht Christ; also fragte ich mich: für wen soll ich mich eigent-
lich aufopfern? Mehr noch:
warum soll ich mich überhaupt
aufopfern?
Mir kamen Momente des Zweifelns; Sie verstehen wohl,
warum... Ich bin Materialist, dachte ich; ich habe nur dieses
eine Leben; warum also soll ich mich mit Aufklärungsarbeit,
sozialen Ungleichheiten und anderen Geschichten herumschla-
gen, wo ich mich doch an allem Möglichen erfreuen, mich zer-
streuen könnte, statt mich mit all dem zu befassen? Warum soll
einer, der nur dieses eine Leben hat, der nicht an das ewige
Leben glaubt, der kein anderes Gesetz als das der Natur aner-
kennt, der sich dem Staat widersetzt, weil er unnatürlich
ist, und der Ehe, weil sie unnatürlich ist, dem Geld, weil es
unnatürlich ist, all den gesellschaftlichen Fiktionen, weil sie
unnatürlich sind, warum zum Kuckuck soll der eigentlich für
Selbstlosigkeit eintreten und sich für andere, für die ganze

24
Menschheit aufopfern, wo doch Selbstlosigkeit und Aufopfe-
rung auch unnatürlich sind? Jawohl, dieselbe Logik, die mir
vor Augen geführt hatte, daß der Mensch nicht geboren wird,
um zu heiraten oder um Portugiese, um reich oder arm zu sein,
dieselbe Logik sagte mir, daß er ebensowenig geboren wird, um
solidarisch zu sein, daß er einzig und allein geboren wird, um er
selber zu sein, also das Gegenteil von selbstlos und solidarisch,
kurz: ein vollkommener Egoist.
Ich habe diese Frage mit mir selber diskutiert. Denke daran,
sagte ich mir, daß du mit deinem Eintritt ins Leben zum Men-
schengeschlecht gehörst, also die Pflicht hast, mit allen anderen
Menschen solidarisch zu sein. Aber ist denn die Idee der
»Pflicht« natürlich? Woher kommt überhaupt diese Idee?
Wenn mich diese Pflichtidee dazu verpflichtet, mein Wohlerge-
hen, meine Annehmlichkeiten, meinen Selbsterhaltungstrieb
und andere natürliche Triebe aufs Spiel zu setzen, unterscheidet
sich dann noch die Ausführung dieser Idee von der Ausführung
irgendeiner gesellschaftlichen Fiktion, die in uns genau die-
selbe Wirkung hervorruft?
Diese Idee der Pflicht, der Solidarität mit den Menschen
könnte man nur dann als eine natürliche betrachten,
wenn sie
mit einer Entschädigung für das Ich einherginge, weil sie dann
im Prinzip zwar immer noch dem natürlichen Egoismus wider-
sprechen würde, ihm letzten Endes aber nicht widerspräche,
weil eine Entschädigung gewährt wird. Ein Vergnügen preiszu-
geben, es so ohne weiteres preiszugeben, das wäre nicht natür-
lich; ein Vergnügen jemand anderem zuliebe preiszugeben,
liegt schon im Rahmen des Natürlichen: es gilt also, von zwei
natürlichen Dingen, die man nicht gleichzeitig haben kann,
eines zu wählen, und zwar das bessere. Und welche eigennüt-
zige bzw. natürliche Entschädigung wird mir gewährt, wenn
ich mich der Sache der freien Gesellschaft und des zukünftigen
Glücks der Menschheit verschreibe? Einzig das Bewußtsein,
meine Pflicht getan zu haben, mich für einen guten Zweck ein-
gesetzt zu haben; und das hat nichts mit eigennütziger Entschä-
digung, nichts mit einem Vergnügen an sich zu tun, es könnte
allenfalls ein Vergnügen sein, wenn es denn eines ist, das einer
Fiktion entspringt, so wie es ein Vergnügen sein kann, unend-
lich reich zu sein oder in eine gute gesellschaftliche Position
hineingeboren zu werden.

25
Ja, ich gestehe, mein Lieber, daß es Momente des Zweifelns
gab... Ich empfand wie einer, der seine Überzeugungen verra-
ten hat, ich fühlte mich wie ein Verräter... Doch damit habe ich
bald aufgeräumt. Ich war der Meinung, daß ich wußte, was
Gerechtigkeit bedeutet. Ich empfand sie wie etwas Natürliches.
Ich spürte, daß es eine Pflicht gab, die mehr galt, als sich mit
dem eigenen Schicksal zu beschäftigen. Also bohrte ich wei-
ter. «
»Mir scheint nicht, daß dieses Vorhaben von großem Scharf-
sinn Ihrerseits zeugte... Sie haben die Schwierigkeit nicht
gelöst... Sie machten aus einem ganz sentimentalen Antrieb
heraus weiter...«
»Zweifelsohne. Aber ich erzähle Ihnen hier, wie ich zum An-
archisten wurde, warum ich es blieb und immer noch bin. Ich
setze Ihnen ehrlich mein Zögern und meine Schwierigkeiten
auseinander und wie ich sie überwunden habe. Ich gestehe, daß
ich seinerzeit die logischen Schwierigkeiten gefühlsmäßig über-
wunden habe und nicht mittels Überlegung. Doch Sie werden
sehen, daß ich später, als ich zum völligen Verständnis des An-
archismus gelangt war, diese Schwierigkeit, die bis dahin ohne
logisch befriedigende Antwort geblieben war, voll und ganz lö-
ste.
»Seltsam...«
»Vielleicht... Aber lassen Sie mich in meiner Geschichte
fortfahren! Ich hatte diese Schwierigkeit und ich habe sie gelöst
so gut ich konnte, wie ich Ihnen schon sagte. Doch bald darauf
tauchte eine andere Schwierigkeit auf, die immer noch damit
zu tun hatte und die mich reichlich verwirrte.
Es mochte ja angehen — warum nicht? —, daß ich bereit war,
mich aufzuopfern, und das, ohne persönlich dafür belohnt zu
werden, d.h. ohne eine wirklich
natürliche Belohnung. Aber
nehmen wir einmal an, die zukünftige Gesellschaft würde sich
nicht so gestalten, wie ich es von ihr erhoffte, sie hätte nichts
von der freien Gesellschaft an sich, für die ich mich doch, zum
Teufel noch mal, aufopfern wollte. Mich ohne jede persönliche
Belohnung aufzuopfern, mich ohne jeden Eigengewinn für eine
Idee einzusetzen, mochte ja noch angehen; aber mich aufzuop-
fern ohne die geringste Gewißheit, daß das, wofür ich arbei-
tete, eines Tages auch existieren würde,
daß also die Idee, für
die ich mich einsetzte, an Boden gewinnen würde, - das ging zu
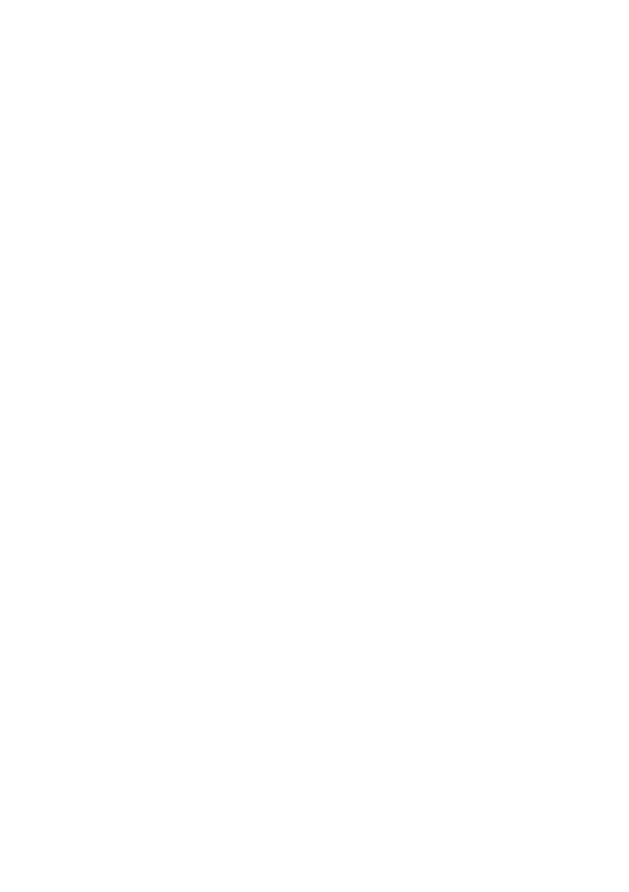
26
weit... Ich sage Ihnen gleich, daß ich auch diese Schwierigkeit
mit Hilfe des Gefühls überwunden habe, so wie ich schon die
anderen überwunden hatte; doch gebe ich Ihnen auch zu be-
denken, daß ich sie, ebenso wie die andere, automatisch mit
Hilfe der Logik überwand — von dem Moment an, wo der An-
archismus in mir zu vollem Bewußtsein gelangte... Sie werden
noch sehen... Doch zu jener Zeit, von der die Rede war, half
ich mir mit ein paar leeren Phrasen aus der Patsche: ›Ich habe
meine Pflicht gegenüber der Zukunft getan, soll die Zukunft
nun die ihre mir gegenüber erfüllen‹... so oder ähnlich...
Ich setzte meine Schlußfolgerung, vielmehr meine Schlußfol-
gerungen den Genossen auseinander, und alle stimmten mir zu;
sie stimmten mir darin zu, daß es darauf ankam, voranzu-
schreiten und sich ganz für die freie Gesellschaft einzusetzen.
Zwei oder drei allerdings, und zwar von den Intelligentesten,
blieben schwankend, nicht etwa, daß sie mir nicht zugestimmt
hätten, nur hatten sie die Sache noch nie so klar gesehen und
auch nicht die Kniffligkeiten in diesen Dingen... Am Ende aber
waren alle mit mir einig... Wir würden alle für die große gesell-
schaftliche Revolution, für eine freie Gesellschaft arbeiten, die
Zukunft würde uns Recht geben - oder auch nicht! Wir waren
eine Gruppe von überzeugten Leuten und fingen mit der gro-
ßen Aufklärungsarbeit an — groß, na ja, im Rahmen des uns
Möglichen. Eine geraume Zeit waren wir ungeachtet aller
Schwierigkeiten und Zerwürfnisse und trotz so mancher Ver-
folgung für das anarchistische Ideal tätig.«
An dieser Stelle machte der Bankier eine etwas längere Pause.
Die Zigarre, die wieder einmal ausgegangen war, zündete er
nicht mehr an. Ein flüchtiges Lächeln trat plötzlich auf seinen
Mund, und er sah aus wie jemand, der am entscheidenden
Punkt angelangt ist, richtete seinen Blick noch fester auf mich
und fuhr dann mit klarer Stimme und mit mehr Nachdruck
fort.

27
Zu jenem Zeitpunkt tauchte ein neues Problem auf. ›Zu je-
nem Zeitpunkt‹ ist so eine Redensart. Ich will sagen, daß ich
nach ein paar Monaten Aufklärungsarbeit allmählich eine
neue Verwicklung wahrnahm, und zwar die bedenklichste von
allen, eine, die ins Gewicht fiel.
Sie erinnern sich doch noch, nicht wahr?, wie ich dank stren-
gen Nachdenkens die Methode anarchistischen Handelns fest-
gelegt hatte... Eine Methode bzw. Methoden, mit deren Hilfe
die gesellschaftlichen Fiktionen zerstört werden sollten, ohne
daß deswegen die Errichtung einer freien Gesellschaft beein-
trächtigt würde, ohne daß also im geringsten das bißchen Frei-
heit derer beeinträchtigt würde, die gegenwärtig von den ge-
sellschaftlichen Fiktionen unterdrückt werden; eine Methode,
die, wenn eben möglich, schon etwas von der zukünftigen Frei-
heit vorwegnehmen würde...
Na schön! nachdem dieses Kriterium nun einmal feststand,
verlor ich es nicht mehr aus den Augen... Nun, zu der Zeit, als
wir Aufklärung betrieben, ich sprach gerade davon, fiel mir
etwas auf. In der Propagandagruppe — wir waren nicht zahl-
reich, etwa vierzig, ich kann mich auch irren - stellte sich fol-
gendes heraus:
es entstand eine Tyrannei.«
»Es entstand Tyrannei? - Tyrannei? Wie denn das?«
»Auf folgende Weise... ein paar befehligten den Rest und
lenkten ihn nach ihrem Willen; ein paar beherrschten den Rest
und verpflichteten ihn, sich nach ihnen zu richten; ein paar
schafften es mit List und Tücke, sich den Rest gefügig zu ma-
chen. Ich will nicht behaupten, daß davon wichtige Angelegen-
heiten berührt waren. Es gab im übrigen auch gar keine wichti-
gen Angelegenheiten. Tatsache aber ist, daß stets und ständig
dieses Phänomen auftrat, und zwar nicht nur in Zusammen-
hang mit der Aufklärungsarbeit, auch außerhalb, in den ganz
gewöhnlichen Dingen des Lebens. Die einen wurden unmerk-
lich zu Anführern, die anderen unmerklich zu Untertanen. Die
einen wurden Anführer, weil sie Machtworte, andere, weil sie
Kniffe anwendeten. Das zeigte sich in den läppischsten Situa-
tionen. Zum Beispiel: zwei Jungs gehen gemeinsam durch eine
Straße; am Ende der Straße angekommen, soll der eine rechts,
der andere links weitergehen; jeder hat gute Gründe, seine
Richtung einzuschlagen. Doch der, welcher links einbiegt, sagt
zum anderen: »Komm mit, hier lang!«, und der andere ant-

28
wortet, und das stimmte ja auch: »Mensch, das kann ich doch
nicht! Ich muß doch da lang!« — aus diesem oder jenem
Grunde... Schließlich aber biegt der andere gegen seinen Wil-
len und Vorteil mit nach links ein... Und das geschah mal auf-
grund von Überredungskünsten, mal auf Drängen hin, ein an-
deres Mal aus irgendeinem anderen Grund... jedenfalls nie aus
logischen Gründen; immer lag diesem Sichdurchsetzen und
Sichunterordnen etwas Spontanes, irgend etwas Instinktives
zugrunde... Und so wie in den banalen Fällen ging es auch in
allen anderen Fällen zu, von den nichtssagendsten bis hin zu
den wichtigsten... Begreifen Sie die Situation?«
»Durchaus. Aber was zum Teufel ist daran so seltsam? Das
ist doch das Natürlichste von der Welt!... «
»Mag sein! Wir werden sehen, warten Sie nur! Halten Sie
jetzt aber einmal fest,
daß es sich um das Gegenteil dessen han-
delt, was der Anarchismus lehrt. Machen Sie sich einmal klar,
daß das alles in einer kleinen Gruppe geschah, einer Gruppe
ohne Einfluß und Bedeutung, einer Gruppe, die nicht mit der
Lösung eines schwerwiegenden Problems oder mit der Ent-
scheidung über eine bedeutende Angelegenheit betraut war.
Und machen Sie sich klar, daß es sich um Leute handelte, die
sich ausdrücklich zusammengefunden hatten, um im Rahmen
des ihnen Möglichen für die anarchistische Sache zu arbeiten -
das heißt, um so gut wie möglich die gesellschaftlichen Fiktio-
nen zu bekämpfen und so gut wie möglich die zukünftige
Gesellschaft zu schaffen. Haben Sie sich diese zwei Punkte ge-
merkt?«
»Habe ich.«
»Ich bitte Sie, was heißt das aber? Eine kleine Gruppe auf-
richtiger Leute (ich stehe dafür ein, daß sie aufrichtig waren!),
die sich ausdrücklich zusammengetan und vereint hatte, um
sich für die Sache der Freiheit einzusetzen, konnte nach ein
paar Monaten nichts anderes an Konkretem und Handfestem
vorweisen als —
Tyrannei in den eigenen Reihen. Und machen
Sie sich einmal klar, um was für eine Tyrannei es sich dabei
handelte... Es handelte sich nicht um eine Tyrannei, die das
Ergebnis gesellschaftlicher Fiktionen gewesen wäre; man hätte
so etwas, wenn es auch bedauerlich gewesen wäre, bis zu einem
bestimmten Punkte entschuldigen können, allerdings weniger
bei uns, die wir ja diese Fiktionen bekämpfen wollten, als bei

29
anderen; doch schließlich lebten wir mitten in einer Gesell-
schaft, die auf diesen Fiktionen errichtet war und es konnte
nicht ausschließlich uns angelastet werden, wenn wir ihren
Auswirkungen nicht gänzlich zu entgehen vermochten. Aber
das war ja nicht das Eigentliche. Die, welche die anderen befeh-
ligten bzw. sie nach ihrem Willen lenkten, taten das nicht mit
Hilfe von Geld oder kraft ihres Ranges oder irgendeiner fikti-
ven Autorität, die sie sich angemaßt hätten, — nein, es geschah
aus einem Handeln heraus, das mit gesellschaftlichen Fiktio-
nen nichts zu tun hatte. Das heißt: gemessen an den gesell-
schaftlichen Fiktionen handelte es sich dabei um
eine neue Art
Tyrannei. Diese Tyrannei wurde auf Menschen ausgeübt, die
ihrerseits ganz wesentlich von den gesellschaftlichen Fiktionen
unterdrückt wurden. Obendrein wurde sie in den eigenen Rei-
hen ausgeübt, und zwar von Menschen, deren erklärte Absicht
es war, Tyrannei abzuschaffen und Freiheit zu schaffen.
Jetzt übertragen Sie einmal den Fall auf eine viel größere, viel
einflußreichere Gruppe, die sich mit viel wichtigeren Fragen
und mit grundlegenderen Entscheidungen befaßt hätte. Neh-
men Sie einmal an, diese Gruppe richtete ihre ganze Kraft dar-
auf, eine freie Gesellschaft zu schaffen, wie das bei unserer
Gruppe der Fall war. Und jetzt sagen Sie mir, ob Sie hinter die-
ser erdrückenden Anhäufung einander überschneidender Ty-
ranneien noch etwas von einer zukünftigen Gesellschaft sehen,
die einer freien oder menschenwürdigen Gesellschaft äh-
nelte ...«
»Ja, das ist sehr seltsam...«
»Seltsam, nicht wahr? ...Und schauen Sie, es gab auch äu-
ßerst seltsame Nebenerscheinungen... zum Beispiel: die Hel-
fertyrannei ...«
»Die was?«
»Die Helfertyrannei. Es gab welche bei uns, die, statt die
anderen zu befehligen, statt sie zu beherrschen, ihnen im Ge-
gensatz halfen, wo sie nur konnten. Das sieht doch wie ein Ge-
gensatz aus, nicht wahr? Doch weit gefehlt! Es lief auf dasselbe
hinaus. Es war dieselbe neuartige Tyrannei und dieselbe Art
von Verstoß gegen anarchistische Prinzipien.«
»Also, das ist ja... und wieso?«
»Jemandem helfen, lieber Freund, heißt jemanden für unfä-
hig erklären; wenn dieser Jemand gar nicht unfähig ist, läuft

30
das darauf hinaus, ihn entweder unfähig zu machen oder vor-
auszusetzen, er sei unfähig; im ersten Fall handelt es sich um
Tyrannei, im zweiten um Verachtung. In dem einen wird die
Freiheit des anderen beschnitten, im anderen wird, wenigstens
unbewußt, davon ausgegangen, der andere sei verachtenswert
und unwürdig oder zur Freiheit unfähig.
Kommen wir auf unsere Frage zurück... Sie sehen also, es
geht hier um etwas Schwerwiegendes. Es mochte noch ange-
hen, daß wir uns für eine zukünftige Gesellschaft einsetzten,
ohne darauf bauen zu können, daß diese uns auch dankbar
aufnimmt, oder Gefahr laufend, daß es sie nie gäbe. All das
mochte noch angehen. Doch was wirklich zu weit ging, war die
Tatsache, daß wir an einer zukünftigen Freiheit arbeiteten,
aber praktisch nichts anderes zu Wege brachten als Tyrannei,
als eine neuartige Tyrannei, eine Tyrannei, die von uns Unter-
drückten auf uns Unterdrückte ausgeübt wurde. Das ging ent-
schieden zu weit...
Mir gab das zu denken. Es mußte da einen Fehler, irgendeine
Verirrung geben. Unsere Absichten waren in Ordnung, unsere
Lehren überzeugend; gab es in unserem Vorgehen vielleicht
einen Irrtum? Bestimmt! Aber wo zum Teufel steckte der Feh-
ler? Ich zerbrach mir den Kopf und wurde fast verrückt dabei.
Eines Tages plötzlich, wie das meistens in solchen Fällen ge-
schieht, fand ich die Lösung. Es war der hohe Tag meiner anar-
chistischen Theorien: der Tag, an dem ich sozusagen die Tech-
nik des Anarchismus entdeckte.«
Er schaute mich eine Weile an, ohne mich wirklich anzu-
schauen. Dann fuhr er im selben Ton fort:
»Ich dachte also nach... Wir hatten es mit einer neuartigen
Tyrannei zu tun, mit einer Tyrannei, die nicht das Ergebnis ge-
sellschaftlicher Fiktionen war. Aber woher kam sie dann ? Etwa
aus natürlichen Eigenschaften? Wenn ja, dann gute Nacht,
freie Gesellschaft! Denn wenn eine Gesellschaft, in der nur die
natürlichen Eigenschaften der Menschen am Werk sind — jene
Eigenschaften, mit denen sie zur Welt kommen, die naturgege-
ben sind und gegen die niemand ankommt—, wenn eine solche
Gesellschaft nichts als eine Anhäufung von Tyranneien ist, wer
wird dann noch den kleinen Finger rühren und zu ihrer Herauf-
kunft beitragen wollen? Tyrannei auf Tyrannei? - dann soll

31
gleich die bleiben, die nun schon einmal da ist, an die wir uns
gewöhnt haben und die wir fatalerweise weniger spüren, als
wir eine neue zu spüren bekämen, trotz des Schrecklichen, das
allen Schikanen der Natur anhaftet — gegen sie aufzubegehren
ist zwecklos, wie man ja auch gegen den unumgänglichen Tod
keine Revolution anzetteln kann oder wegen einer niederen
Abstammung, wo man doch eine höhere gewünscht hätte. Und
ich hatte Ihnen ja schon auseinandergesetzt, daß, sollte aus
irgendeinem Grunde eine anarchistische Gesellschaft nicht zu
verwirklichen sein, eben die bürgerliche bestehen bleiben muß,
weil sie — von der anarchistischen Gesellschaft abgesehen — na-
türlicher ist als jede andere Gesellschaft.
Aber war denn die Tyrannei, die in unserer Mitte entstanden
war, wirklich das Ergebnis natürlicher Eigenschaften? Was
sind denn überhaupt natürliche Eigenschaften? Es ist der Grad
an Intelligenz, an Vorstellungskraft, an Willen, mit dem einer
zur Welt kommt - was das Geistige anbelangt, selbstredend,
denn mit den natürlichen physischen Eigenschaften ist das
etwas anderes. Ein Typ nun, der einen anderen befehligt, unab-
hängig von den gesellschaftlichen Fiktionen, tut das zwangs-
läufig, weil er ihm in dieser oder jener natürlichen Eigenschaft
überlegen ist. Er beherrscht ihn, weil er sich seine natürliche
Eigenschaft zunutze macht. Bleibt die Frage, ob ein solcher Ge-
brauch der natürlichen Eigenschaften rechtens, d. h.
natürlich
ist.
Was aber wäre nun der natürliche Gebrauch unserer natür-
lichen Eigenschaften? Er müßte den natürlichen Bestrebungen
unserer Persönlichkeit dienen. Jemanden beherrschen, wäre
das ein natürliches Bestreben unserer Persönlichkeit? Es
könnte sein: es gibt eine Situation, wo dieser Fall eintreten
könnte: dann nämlich, wenn dieser Jemand mein Feind ist. Für
einen Anarchisten ist selbstverständlich der ein Feind, der die
gesellschaftlichen Fiktionen und deren Tyrannei vertritt, und
sonst niemand, weil alle anderen Menschen sind wie er, näm-
lich natürliche Genossen. Sie sehen selbst, daß die Art von Ty-
rannei, die in unseren Reihen entstanden war, anderer Art war;
sie richtete sich gegen unseresgleichen, gegen Genossen von
Natur aus und obendrein gegen Menschen, die in einem dop-
pelten Sinn unsere Genossen waren, insofern sie dasselbe Ideal
teilten. Daraus ziehe ich den Schluß: wenn unsere Tyrannei

32
nicht das Ergebnis von gesellschaftlichen Fiktionen war, so war
sie ebensowenig das Ergebnis natürlicher Eigenschaften; sie
war das Ergebnis einer verirrten Anwendung, einer Pervertie-
rung der natürlichen Eigenschaften. Nur, wie konnte es zu die-
ser Pervertierung kommen?
Sie mußte von einem der zwei folgenden Sachverhalte her-
rühren: entweder daher, daß der Mensch von Natur aus
schlecht ist, dann wären auch alle natürlichen Eigenschaften
von Natur aus pervertiert, oder von einer Pervertierung, die
das Ergebnis andauernden Verweilens der Menschheit in einer
Welt gesellschaftlicher Fiktionen ist, Fiktionen, die alle nur zur
Tyrannei führen konnten und so tendenziell und unwillkürlich
den allernatürlichsten Gebrauch der allernatürlichsten Eigen-
schaften tyrannisch werden ließen. Und welche von den zwei
Hypothesen kommt der Wahrheit am nächsten? Unmöglich,
darauf befriedigend, d. h. streng logisch und wissenschaftlich
zu antworten. Überlegungen führen bei einem solchen Problem
nicht sehr weit, weil es sich um ein historisches, ein wissen-
schaftliches Problem handelt, also vom Verständnis bestimm-
ter
Fakten abhängt. Die Wissenschaft ihrerseits hilft uns auch
nicht viel weiter, denn wie weit wir uns auch in die Geschichte
zurückbegeben, wir stoßen immer wieder auf Menschen, die in
irgendeinem System gesellschaftlicher Tyrannei leben mußten,
folglich stoßen wir immer wieder auf Phasen, die uns nicht ge-
statten zu überprüfen, wie je ein Mensch unter reinen und ganz
und gar natürlichen Bedingungen gelebt hat. Wenn wir aber
nicht die Möglichkeit haben, etwas mit Gewißheit zu ermit-
teln, sollten wir uns an die größere Wahrscheinlichkeit halten.
Und die größere Wahrscheinlichkeit spricht für die zweite Hy-
pothese. Es ist natürlicher, davon auszugehen, daß das äußerst
lange Verweilen der Menschheit in den gesellschaftlichen, Ty-
rannei verursachenden Fiktionen bewirkt hat, daß jeder
Mensch schon mit pervertierten natürlichen Eigenschaften zur
Welt kommt, so daß er spontan zum Tyrannisieren neigt, auch
wenn er behauptet, kein Tyrann zu sein -, als vielmehr davon
auszugehen, natürliche Eigenschaften könnten von Natur aus
pervertiert sein, was in gewisser Hinsicht einen Widerspruch
darstellt. Deshalb sollte sich jemand, der denkt, mit fast abso-
luter Sicherheit für die zweite Hypothese entscheiden; ich habe
es getan.

33
Gehen wir doch davon aus, daß eines augenscheinlich ist: Im
gegenwärtigen gesellschaftlichen Zustand ist es nicht denkbar,
daß Menschen — wie wohlwollend ihre Absichten auch sein
mögen, wie sehr sie sich auch ganz allein dem Kampf gegen die
gesellschaftlichen Fiktionen und für die Freiheit hingeben mö-
gen - sich zusammenschließen, ohne daß spontan eine Tyran-
nei entsteht, eine neuartige Tyrannei, zusätzlich zu der durch
die gesellschaftlichen Fiktionen verursachten, ohne daß in der
Praxis all das zerstört würde, was in der Theorie angestrebt
wird, ohne daß unwillkürlich die eigenen Bestrebungen, die es
zu fördern gälte, maximal behindert würden. Also was tun?...
Ganz einfach... Am selben Ziel weiterarbeiten,
aber ge-
trennt.«
»Getrennt?«
»Natürlich, können Sie meinem Argument nicht folgen?«
»Doch, doch!«
»Finden Sie meine Schlußfolgerung denn nicht schlüssig? Sie
ist doch unabweisbar!«
»Doch, doch! Nur sehe ich nicht, wie Sie...«
»Das werde ich gleich erklären... Ich sagte Ihnen schon: am
selben Ziel weiterarbeiten, aber getrennt. Wenn alle dasselbe
anarchistische Ziel ansteuern, trägt jeder auf seine Weise mit
seinem Bemühen zur Vernichtung der gesellschaftlichen Fiktio-
nen und zur Errichtung einer zukünftigen, freien Gesellschaft
bei; und getrennt laufen wir
in keiner Weise Gefahr, eine wei-
tere Tyrannei zu schaffen, da ja niemand über den anderen ver-
fügt, folglich kann auch niemand den anderen beherrschen und
ihm die Freiheit beschränken, kann ihm nicht helfen und ihn
nicht besänftigen.
Mit einer solchermaßen getrennten Arbeit am selben anar-
chistischen Ziel sind zwei Vorteile gegeben — die Kräfte sind
vereint, eine weitere Tyrannei wird verhindert. Wir sind weiter-
hin vereint, weil wir moralisch miteinander verbunden sind
und in der gleichen Weise am selben Ziel arbeiten; wir sind
weiterhin Anarchisten, weil ein jeder von uns für eine freie Ge-
sellschaft kämpft; wir sind aber nicht mehr — willentlich oder
unwillentlich - Verräter an der eigenen Sache, ja wir könnten
gar nicht mehr zu Verrätern werden, weil wir uns im Rahmen
der vereinzelten anarchistischen Tätigkeit außerhalb des
schädlichen Einflusses der gesellschaftlichen Fiktionen bewe-

34
gen, sozusagen im ererbten Widerschein der naturgegebenen
Eigenschaften.
Selbstverständlich kann eine solche Taktik nur auf eine Pe-
riode angewandt werden, die ich als die
Periode der Vorberei-
tung auf die gesellschaftliche Revolution bezeichnet habe. Ist
die bürgerliche Abwehr erst einmal zerbrochen und die ge-
samte Gesellschaft in einem Zustand, in dem sie die anarchisti-
sche Lehre nur noch hinnehmen kann, wenn also nur noch die
gesellschaftliche Revolution zu machen bleibt, dann, beim letz-
ten Streich, kann man nicht mehr getrennt handeln. Doch dann
besteht ja auch schon virtuell die freie Gesellschaft, die Dinge
sehen dann schon anders aus. Die Taktik, auf die ich anspiele,
bezieht sich allein auf anarchistisches Handeln in einer bürger-
lichen Gesellschaft, mit der es meine Gruppe ja zu tun hatte.
Damit war also - endlich! - die wahre anarchistische Me-
thode gefunden. Gemeinsam waren wir nichts wert, obendrein
tyrannisierten wir uns, behinderten uns und unsere Theorien.
Getrennt erreichten wir zwar wenig, doch immerhin behinder-
ten wir uns nicht und schufen auch keine neue Tyrannei; und
was wir erreichten, mochte wenig sein, aber es war erreicht
ohne Nachteil und Verlust. Und in dem Maß, wie wir getrennt
arbeiteten, lernten wir auch, in uns selbst mehr Vertrauen zu
setzen, uns nicht gegenseitig zu behindern, lernten, freier zu
werden und uns selbst sowie — dank unseres Beispiels — die
anderen auf die Zukunft vorzubereiten.
Ich war hocherfreut über die Entdeckung. Sofort lief ich zu
meinen Genossen, um sie ihnen zu erklären. Das war eines der
wenigen Male in meinem Leben, wo ich mich wirklich dumm
benommen habe. Stellen Sie sich vor, ich war so stolz auf meine
Entdeckung, daß ich annahm, sie würden mir zustimmen.«
»Natürlich stimmten sie nicht zu...«
»Sie haben widersprochen, sie haben alle widersprochen,
mein Lieber! Die einen mehr, die anderen weniger, doch alle
protestierten! ...Das konnte nicht wahr sein! ...Das durfte
nicht wahr sein! ...Niemand aber konnte sagen, was wahr
wäre oder wahr sein sollte. Ich argumentierte und argumen-
tierte, und als Antwort auf meine Argumente bekam ich nur
Phrasen zu hören, Mist, Dinge, wie sie Minister in der Abge-
ordnetenkammer vorbringen, wenn sie nichts zu sagen ha-
ben ... Da sah ich, von welchen Hornochsen und Feiglingen ich

35
umgeben war! Sie zeigten ihr wahres Gesicht. Dieses Pack war
zum Sklavendasein geboren. Sie wollten auf Kosten anderer
Anarchisten sein. Sie wollten Freiheit, sofern andere sie für sie
besorgten, sofern sie ihnen verliehen würde, wie ein König
einen Titel verleiht! Fast alle sind so! Mächtige Lakaien!«
»Sie haben sich wohl geärgert?«
»Und ob ich mich geärgert habe! Ich wurde wütend, ich re-
bellierte, ich stampfte mit den Füßen auf. Fast wäre ich mit
einigen aneinandergeraten. Schließlich habe ich mich von ih-
nen getrennt. Ich zog mich zurück. Sie können sich gar nicht
vorstellen, wie sehr mich diese Hammelherde anwiderte. Fast
hätte ich dem Anarchismus entsagt. Ich war drauf und dran,
mich um all das nicht mehr zu kümmern. Nach ein paar Tagen
kam ich wieder zu mir. Ich ging davon aus, daß das anarchisti-
sche Ideal weit über diesem Gezänk stand. Wenn sie keine An-
archisten sein wollten, ich würde einer sein. Wenn sie nur auf
Anarchismus machten, ich würde es nicht nur beim Spiel belas-
sen. Wenn sie nur kämpfen konnten, indem sie aneinander-
klebten und die Tyrannei nachahmten, die sie zu bekämpfen
vorgaben, sollten diese Esel dabei bleiben, zu etwas anderem
taugten sie ja nicht. Ich jedenfalls würde wegen solch einer
Nichtigkeit nicht zum Bourgeois.
Im wahren Anarchismus muß sich jeder mit seinen Kräften
für die Freiheit einsetzen und die gesellschaftlichen Fiktionen
bekämpfen, das stand fest. Ich würde mich also mit meinen
Kräften für die Freiheit einsetzen und die gesellschaftlichen
Fiktionen bekämpfen. Auch wenn niemand bereit war, mir auf
dem wahren anarchistischen Pfad zu folgen. Ich würde also
allein gegen die gesellschaftlichen Fiktionen vorgehen, mit mei-
nen Mitteln, mit meinem Glauben, sogar ohne den geistigen
Beistand derer, die einmal meine Genossen waren. Ich will
nicht behaupten, daß es sich dabei um eine edle Geste handelte,
nicht einmal um eine heroische. Es war nur eine natürliche Ge-
ste. Wenn der Weg jeweils getrennt verfolgt werden mußte, so
hatte ich niemanden nötig. Mir genügte mein Ideal. Angesichts
dieser Grundsätze und Umstände beschloß ich also, die gesell-
schaftlichen Fiktionen allein zu bekämpfen.«
Er unterbrach für kurze Zeit seinen Redefluß, der sehr lebhaft
geworden war; dann fuhr er mit ruhiger Stimme fort..

36
Zwischen mir und den gesellschaftlichen Fiktionen, so dachte
ich, herrscht Kriegszustand. Na schön! Was kann ich gegen
diese gesellschaftlichen Fiktionen ausrichten? Ich gehe allein
vor, um nur ja keine Tyrannei aufkommen zu lassen. Welchen
Beitrag kann ich also allein zur Vorbereitung der gesellschaft-
lichen Revolution leisten, zur Vorbereitung der Menschheit auf
eine freie Gesellschaft? Ich muß mich für eine von zwei Metho-
den entscheiden, für eine von den beiden, die es gibt, es sei
denn, ich könnte von beiden Gebrauch machen. Die beiden
Methoden sind die indirekte Aktion, d. h. Aufklärungsarbeit
und die wie auch immer beschaffene direkte Aktion.
Ich dachte zunächst an die indirekte Aktion, also an Aufklä-
rungsarbeit. Doch welche Aufklärungsarbeit hätte ich ganz
allein leisten können, sieht man einmal von der Aufklärung ab,
die darin besteht, bei der erstbesten Gelegenheit mit diesem
oder jenem aufs Geratewohl zu reden. Mir ging es aber darum
zu wissen, ob die indirekte Aktion der Weg wäre, den ich einzu-
schlagen hätte, um als Anarchist wirkungsvoll zu sein, d. h. um
zu spürbaren Ergebnissen zu gelangen. Ich sah aber bald, daß
er es nicht war. Ich bin kein Redner und ich bin kein Schriftstel-
ler. Na ja, ich würde sagen: wenn es sein muß, kann ich in der
Öffentlichkeit reden und kann ich auch einen Zeitungsartikel
schreiben. Doch wollte ich prüfen, ob mein naturgegebener
Charakter mir nahelegte, mich eher im Rahmen der indirekten
Aktion auf das eine oder andere oder auch auf beides zu spezia-
lisieren, um so zu
handfesten Ergebnissen im Sinne der anar-
chistischen Idee zu kommen, statt meine Kräfte in einer ande-
ren Richtung auszubilden. Nun bringt aber eine Aktion immer
mehr ein als Aufklärungsarbeit, außer bei Menschen, deren
Charakter sie zu Aufklärern bestimmt — große Redner, fähig
die Massen zu begeistern und mitzureißen, oder große Schrift-
steller, die mit ihren Büchern zu faszinieren und zu überzeugen
verstehen. Ich glaube nicht, daß ich besonders eitel bin, und
wenn doch, so weist jedenfalls nichts darauf hin, daß ich mir
etwas auf Eigenschaften einbilde, die ich nicht habe. Und, wie
ich Ihnen schon sagte, nichts legt mir nahe, mich als Redner
oder Schriftsteller zu betrachten. Darum ließ ich den Gedanken
an die indirekte Aktion fallen, für mich war sie nicht der ge-
eignete Weg anarchistischen Handelns. So kam ich auf dem
Ausschlußweg dazu, die direkte Aktion zu wählen, meine

37
Kräfte also auf das praktische Leben, das reale Leben zu ver-
wenden. Nicht Intelligenz war gefragt, sondern Aktion. Na
schön! Dann sollte es so sein.
Es galt jetzt, die fundamentale Methode anarchistischen
Handelns, über die ich Sie schon aufgeklärt habe, auf das prak-
tische Leben anzuwenden, also: die gesellschaftlichen Fiktio-
nen zu bekämpfen, ohne erneut Tyrannei zu schaffen, wenn
möglich aber auch etwas zu schaffen, das die zukünftige Frei-
heit vorausnahm. Wie zum Teufel war so etwas in der Praxis
möglich ?
Was heißt nun aber: in der Praxis kämpfen? In der Praxis
kämpfen bedeutet Krieg,
einen Krieg zumindest. Und wie führt
man Krieg gegen gesellschaftliche Fiktionen? Vor allem aber:
wie wird überhaupt Krieg geführt? Wie besiegt man den Geg-
ner in einem Krieg? Auf eine der beiden Weisen: entweder tötet
man ihn, d. h. man vernichtet ihn, oder man nimmt ihn gefan-
gen, d. h. man bezwingt ihn und verdammt ihn zur Tatenlosig-
keit. Die gesellschaftlichen Fiktionen zu
vernichten, war ich
nicht in der Lage;
vernichten könnte die gesellschaftlichen Fik-
tionen nur eine gesellschaftliche Revolution. Bis dahin konnten
sie zwar so geschwächt werden, daß sie nur noch an einem
seidenen Faden hingen; doch
vernichtet würden sie erst mit der
Heraufkunft der freien Gesellschaft und dem praktischen Fall
der bürgerlichen Gesellschaft. Allerhöchstens hätte ich unter
diesem Gesichtspunkt das eine oder andere Mitglied jener
Klassen vernichten können, aus denen die Repräsentanten der
bürgerlichen Gesellschaft stammen, und zwar vernichten im
physischen Sinne von töten. Ich überdachte den Fall und sah
ein, es war Blödsinn. Nehmen Sie einmal an, ich tötete ein, zwei
oder ein Dutzend Vertreter der Tyrannei gesellschaftlicher
Fiktionen... Und das Ergebnis? Gingen die gesellschaftlichen
Fiktionen geschwächt daraus hervor? Nein. Gesellschaftliche
Fiktionen haben ja nichts mit einer politischen Situation ge-
mein, die von einer geringen Anzahl von Menschen oder
manchmal auch nur von einer einzigen Person abhängt. Das
Schlechte an den gesellschaftlichen Fiktionen sind sie selber in
ihrer Gesamtheit, nicht aber Individuen, die sie vertreten, abge-
sehen davon daß sie sie vertreten. Außerdem erzeugt ein Atten-
tat gesellschaftlicher Natur immer eine Reaktion. Es bleibt
nicht nur alles beim alten, es steht hinterher manchmal noch

38
schlechter. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, ich würde
obendrein beim Attentat erwischt, was denkbar wäre, ich
würde erwischt und auf die eine oder andere Weise ausgeschal-
tet. Und stellen Sie sich vor, ich hätte ein Dutzend Kapitalisten
umgelegt. Was wäre bei all dem schließlich herausgekommen?
Mit der Ausschaltung meiner Person, auch wenn ich nicht tot,
sondern lediglich in Gefangenschaft oder in die Verbannung
geraten wäre, verlöre die anarchistische Sache ein kämp-
ferisches Element; die zwölf Kapitalisten dagegen, die ich zur
Strecke gebracht hätte, wären ihrerseits nicht zwölf Elemente,
die die bürgerliche Gesellschaft verloren hätte, weil die Ele-
mente, aus denen sich eine bürgerliche Gesellschaft zusammen-
setzt, keine kämpferischen Elemente sind, sondern rein passive
Elemente; denn der »Kampf« geht ja nicht von den Mitgliedern
der bürgerlichen Gesellschaft aus, sondern von der Gesamtheit
der gesellschaftlichen Fiktionen, auf denen diese Gesellschaft
beruht. Nun sind aber die gesellschaftlichen Fiktionen keine
Leute, auf die man Schüsse abgeben könnte... Verstehen Sie
mich? Ich war ja kein Soldat, der zwölf Soldaten des gegneri-
schen Heeres umgebracht hatte; ich wäre ein Soldat gewesen,
der zwölf Zivilpersonen der Nation des anderen Heeres umge-
bracht hätte. Und das wäre nichts als dummes Abschlachten
gewesen, weil damit kein Kämpfer beseitigt worden wäre...
Folglich konnte ich nicht daran denken, die gesellschaftlichen
Fiktionen ganz oder zum Teil zu
vernichten. So mußte ich sie
also bezwingen, mußte sie, indem ich sie bezwang, besiegen
und zur Wirkungslosigkeit verdammen.«
Plötzlich richtete er den rechten Zeigefinger auf mich.
»Und genau das habe ich getan!«
Er zog seine Hand zurück und fuhr fort.
»Ich wollte wissen, welches die größte, die gewichtigste gesell-
schaftliche Fiktion wäre. An dieser wollte ich mich mehr als an
irgendeiner anderen versuchen, wollte sie bezwingen und zur
Wirkungslosigkeit verdammen. Die gewichtigste Fiktion in un-
serer Zeit ist nun einmal das Geld. Wie aber das Geld bezwin-
gen oder — genauer gesagt — wie die Macht bzw. die Tyrannei

39
des Geldes bezwingen? Indem ich mich von seinem Einfluß,
seiner Macht befreien würde, seinen Einfluß also besiegen und
es, jedenfalls auf meine Person bezogen, zur Wirkungslosigkeit
verdammen würde. Auf
meine Person bezogen, verstehen Sie?
Weil
ich es war, der es bekämpfte; hätte ich es zur Wirkungslo-
sigkeit in Hinblick auf alle anderen verdammt, hätte ich es
nicht nur bezwungen, sondern schon
vernichtet, denn ich hätte
dann ja mit der Fiktion Geld überhaupt Schluß gemacht. Nun
habe ich Ihnen aber schon nachgewiesen, daß eine gesellschaft-
liche Fiktion nur durch eine gesellschaftliche Revolution »ver-
nichtet« werden könnte, in deren Verlauf diese Fiktion mitsamt
den anderen in den Sog der einstürzenden bürgerlichen Gesell-
schaft geraten würde.
Wie sollte ich nun die Macht des Geldes besiegen? Die ein-
fachste Methode wäre gewesen, mich aus seiner Einflußsphäre,
das heißt, aus der Zivilisation zurückzuziehen; ich hätte aufs
Land gehen können, Wurzeln essen und Wasser aus den Quel-
len trinken, nackt herumlaufen, wie ein Tier leben können.
Doch selbst wenn mir das keine Schwierigkeiten bereitet hätte,
hätte ich damit keine gesellschaftliche Fiktion bekämpft; ich
hätte überhaupt nicht gekämpft, ich wäre geflohen. Natürlich:
wer sich vor einer Schlacht drückt, kann in ihr nicht geschlagen
werden. Doch moralisch ist er geschlagen, weil er nicht ge-
kämpft hat. Ich mußte also anders vorgehen - was ich
brauchte, war eine Kampf- und keine Fluchtmethode. Wie das
Geld bekämpfen und es dabei noch bezwingen? Wie sich sei-
nem Einfluß und seiner Tyrannei entziehen, ohne ihm aus dem
Weg zu gehen? Die einzige Methode war —
es zu erwerben, es in
so großer Menge zu erwerben, daß sein Einfluß nicht mehr
spürbar werden konnte; und je größer die erworbene Menge
wäre, desto freier würde ich von seinem Einfluß. Als mir das
mit der ganzen Kraft meiner anarchistischen Überzeugung und
der Logik meines Scharfsinns vor Augen stand, trat ich, lieber
Freund, in die jetzige Phase — in die Kommerz- und Bankphase
meines Anarchismus ein.«
Er schwieg einen Augenblick und suchte der Erregung Herr zu
werden, in die ihn die Begeisterung für seine Darlegungen hatte
zunehmend geraten lassen. Dann fuhr er, immer noch lebhaft,
in seiner Erzählung fort.

40
»Erinnern Sie sich jetzt bitte: ich hatte Ihnen von den zwei logi-
schen Schwierigkeiten erzählt, die sich mir zu Beginn meiner
Karriere als bewußtem Anarchisten in den Weg gestellt hat-
ten... Und erinnern Sie sich auch, daß ich Ihnen sagte, ich hätte
sie zu jenem Zeitpunkt künstlich, nämlich mit Hilfe des Ge-
fühls und nicht logisch gelöst! Sie selbst hatten ja ganz zu Recht
angemerkt, ich hätte sie nicht logisch gelöst...«
»Jawohl, ich erinnere mich.«
»Und erinnern Sie sich auch, daß ich Ihnen sagte, ich habe sie
später, nachdem ich die wahre anarchistische Methode endlich
herausgefunden hatte, mit einem Schlag gelöst, und zwar lo-
gisch?«
»Ja.«
»Passen Sie auf, das geschah so! ... Die Schwierigkeiten wa-
ren damals folgende: es sei nicht
natürlich, für etwas zu arbei-
ten, was es auch sei, ohne dafür eine
natürliche, d. h. eine eigen-
nützige Entschädigung zu erhalten; und es ist
natürlich, seine
Kräfte für irgendein Ziel zu verausgaben, ohne als Entschädi-
gung dafür zu wissen,
daß dieses Ziel erreichbar ist. Soweit die
beiden Schwierigkeiten; jetzt schauen Sie einmal, wie ich sie
mit Hilfe einer anarchistischen Arbeitsmethode gelöst habe,
auf die mich meine Überlegungen gebracht hatten und die ich
als die einzig wahre erkannt habe... Die Methode führt zu
meiner Bereicherung, folglich zu einer
eigennützigen Entschä-
digung. Die Methode zielt darauf ab, Freiheit zu erringen; in
dem Maße nun, wie ich die Macht des Geldes besiege, d. h.
mich von ihm befreie,
erringe ich Freiheit. Selbstverständlich
erringe ich diese Freiheit nur für mich; doch wie ich schon
nachgewiesen habe, kann Freiheit für alle nur durch Vernich-
tung der gesellschaftlichen Fiktionen erreicht werden, durch
eine gesellschaftliche Revolution, und ich allein kann keine ge-
sellschaftliche Revolution machen. Lassen Sie es mich konkret
sagen: ich ziele auf Freiheit ab und erringe Freiheit; ich erringe
die Freiheit, die ich erringen kann, denn ich kann ja nicht errin-
gen, was ich nicht erringen kann ...Und schauen Sie: einmal
abgesehen von den Überlegungen, die diese anarchistische Me-
thode als die einzig wahre festsetzen, Tatsache ist, daß sie auto-
matisch die logischen Schwierigkeiten löste, die sich einem an-
archistischen Vorgehen in den Weg stellen konnten, und das
beweist noch mehr, daß sie die richtige ist.

41
Also verfolgte ich diese Methode. Ich machte mich daran,
die Fiktion Geld zu bezwingen, indem ich mich bereicherte.
Und ich schaffte es. Es brauchte eine gewisse Zeit, weil der
Kampf hart war, aber ich schaffte es. Ich verschone Sie mit
einem Bericht über mein vergangenes und gegenwärtiges Le-
ben im Handel und im Bankgeschäft. Er könnte zwar interes-
sant sein, ich denke da an bestimmte Punkte, aber er tut nichts
zur Sache. Ich habe gearbeitet, gekämpft, Geld gewonnen,
habe noch mehr gearbeitet, habe noch mehr gekämpft, noch
mehr Geld gewonnen; ich gewann schließlich viel Geld. In den
Methoden war ich nicht wählerisch — ich gestehe ganz offen,
mein Lieber, daß ich in den Methoden nicht wählerisch war, ich
habe mich aller Mittel bedient - wucherischen Aufkaufs, fi-
nanzieller Tricks, selbst unlauterer Konkurrenz. Ja und? Ich
bekämpfte schließlich die gesellschaftlichen, unmoralischen
und par excellence unnatürlichen Fiktionen, und da sollte ich
auf die Methoden achten? Ich arbeitete für Freiheit, und da
sollte ich auf die Waffen achten, mit denen ich die Tyrannei
bekämpfte?! Der dumme Anarchist, der Bomben wirft und
Schüsse abgibt, weiß genau, daß er tötet, und weiß ebensogut,
daß seine Lehre die Todesstrafe ausschließt. Etwas Unmorali-
sches greift er mit einem Verbrechen an, weil er meint, daß die
Vernichtung des Unmoralischen ein Verbrechen wert ist. Eine
idiotische Methode, weil die Methode selbst, wie ich gezeigt
habe, irrig ist und das Gegenteil von dem bewirkt,
was anarchi-
stisches Vorgehen bezweckt; moralisch gesehen, mag sie intelli-
gent sein. Ich hatte eine sichere Methode und als Anarchist
bediente ich mich rechtmäßig aller Mittel, um mich zu berei-
chern. Heute habe ich den genau umschriebenen Traum eines
praktischen und verständigen Anarchisten verwirklicht. Ich
bin frei. Ich mache, natürlich nur im Rahmen des Möglichen,
das, was ich will. Meine Devise als Anarchist war die Freiheit;
gut, jetzt habe ich Freiheit, die Freiheit, die man vorderhand in
unserer unvollkommenen Gesellschaft haben kann. Ich wollte
die gesellschaftlichen Fiktionen bekämpfen und ich habe sie
bekämpft, mehr noch, ich habe sie besiegt.«
»Halt, halt! Warten Sie! Das ist alles gut und schön, aber
etwas ist Ihnen entgangen. Ausgangspunkt für Ihr Vorgehen
war, wie Sie selbst gesagt haben, nicht nur Freiheit zu schaffen,
sondern auch
Tyrannei zu vermeiden. Nun haben Sie aber

42
Tyrannei geschaffen. Sie als Wucherer, als Bankier, als skrupel-
loser Finanzmann — entschuldigen Sie, aber das sind Sie doch —,
Sie haben Tyrannei geschaffen. Sie haben genausoviel Tyrannei
geschaffen wie irgendein Vertreter gesellschaftlicher Fiktionen,
den Sie zu bekämpfen vorgaben.«
»Nein, nein, mein Guter, da täuschen Sie sich. Ich habe keine
Tyrannei geschaffen. Die Tyrannei, die vielleicht aus meiner
kämpferischen Aktion gegen die gesellschaftlichen Fiktionen
hervorgegangen ist, ist nicht von mir ausgegangen; ich habe sie
also nicht geschaffen;
sie steckt ja in den gesellschaftlichen Fik-
tionen selbst, und ich habe ihnen nichts hinzugefügt. Bei jener
Tyrannei handelt es sich ja um
die Tyrannei der gesellschaft-
lichen Fiktionen als solchen; und ich konnte doch nicht und
wollte auch nicht die gesellschaftlichen Fiktionen
vernichten.
Ich wiederhole zum hundertsten Male: nur eine gesellschaft-
liche Revolution könnte die gesellschaftlichen Fiktionen
ver-
nichten; vorher aber kann eine perfekte anarchistische Aktion
wie die meine die gesellschaftlichen Fiktionen höchstens
be-
zwingen, und bezwingen auch nur in dem Maße, wie ein Anar-
chist diese Methode in die Praxis umsetzt, denn diese Methode
erlaubt nicht die Unterwerfung der Fiktionen im größeren
Rahmen. Es geht nicht darum, keine Tyrannei zu schaffen, son-
dern darum, keine
zusätzliche Tyrannei zu schaffen, da wo vor-
her keine war. Die Anarchisten, die gemeinsam arbeiten und
sich gegenseitig beeinflussen, schaffen, wie ich Ihnen schon ge-
sagt habe,
unter sich, jenseits und außerhalb der gesellschaft-
lichen Fiktionen, Tyrannei;
das verstehe ich unter zusätzlicher
Tyrannei; und so etwas habe ich nicht geschaffen. Ich konnte
sie gar nicht ins Leben rufen
aufgrund der Ausgangsbedingun-
gen meiner Methode. Nein, mein Lieber, ich habe Freiheit ge-
schaffen. Ich habe
jemanden befreit. Mich habe ich befreit.
Weil meine Methode, die ja, wie ich nachgewiesen habe, die
einzig wahre anarchistische Methode ist, mir nicht gestattete,
auch andere zu befreien. Wen ich befreien konnte, habe ich
befreit.«
»Schon gut... einverstanden... Aber schauen Sie, bei sol-
chen Argumenten könnte man ja fast zu der Ansicht neigen,
überhaupt kein Vertreter gesellschaftlicher Fiktionen übe Ty-
rannei aus.«
»Stimmt auch! Die Tyrannei kommt von den Fiktionen und

43
nicht von den Menschen, die sie verkörpern; sie sind sozusagen
das Werkzeug, dessen sich die Fiktionen bedienen um zu tyran-
nisieren, so wie ein Messer das Werkzeug sein kann, dessen sich
ein Mörder bedient. Und Sie werden doch nicht annehmen,
daß man die Mörder abschafft, indem man die Messer ab-
schafft. Schauen Sie... Sie können
alle Kapitalisten der Welt
vernichten, doch
vernichten Sie damit das Kapital? Am näch-
sten Tag wird das Kapital in den Händen anderer liegen und
mittels
ihrer weiterhin seine Tyrannei ausüben. Vernichten Sie
nicht die Kapitalisten, sondern das Kapital; wieviel Kapita-
listen bleiben dann noch übrig? ...Na?«
»Ja, da haben Sie recht.«
»Höchstens, aber auch allerhöchstem könnte man mir vor-
werfen, die Tyrannei der gesellschaftlichen Fiktionen ein klei-
nes bißchen — aber nur ein ganz kleines bißchen — vergrößert zu
haben. Doch das Argument ist absurd, weil, wie ich Ihnen
schon sagte, die Tyrannei, die ich nicht erschaffen durfte und
die ich nicht geschaffen habe, ganz anders aussieht. Es gibt
noch einen weiteren schwachen Punkt: Sie können aus dersel-
ben Überlegung heraus einem General, der für sein Land eine
Schlacht führt, vorwerfen, er füge seinem Land Schaden zu,
weil er eine gewisse Anzahl von Männern
aus seinem eigenen
Heer opfert, um zu siegen. Wer in den Krieg zieht, muß geben,
um zu nehmen. Siegen ist die Hauptsache, der Rest...«
»Schön und gut... Aber sehen Sie mal, da ist noch etwas
anderes... Der wahre Anarchist will ja Freiheit nicht nur für
sich, sondern auch für die anderen... Mir scheint, er will Frei-
heit für die gesamte Menschheit...«
»Zweifelsohne. Doch ich habe Ihnen ja schon gesagt, bei der
Methode, die sich für mich als die einzige anarchistische Me-
thode herausstellte, muß sich jeder selbst befreien. Ich habe
mich befreit; ich habe meine Pflicht getan, für mich und für die
Freiheit. Warum also tun die anderen, meine Genossen, nicht
dasselbe? Ich hindere sie ja nicht daran. Das wäre allerdings ein
Verbrechen gewesen, wenn ich sie daran gehindert hätte. Ich
habe sie nicht einmal in dem Sinne behindert, daß ich ihnen die
wahre anarchistische Methode verheimlicht hätte, ich habe ih-
nen die Methode, nachdem ich sie herausgefunden hatte, klar
mitgeteilt. Dieselbe Methode aber hinderte mich, mehr zu tun.
Was hätte ich denn noch tun können? Hätte ich sie zwingen

44
sollen, ihren Weg zu gehen? Selbst wenn ich es gekonnt hätte,
ich hätte es nicht getan, denn ich hätte ihnen ja damit die Frei-
heit genommen, und das geht gegen meine anarchistischen
Grundsätze. Härte ich ihnen helfen sollen? Auch das hätte sich
aus demselben Grunde verboten. Ich habe nie geholfen und
helfe niemandem, denn das liefe darauf hinaus, die Freiheit des
anderen zu beschneiden, und auch das geht gegen meine
Grundsätze. Sie tadeln an mir, daß ich nicht mehr als nur eine
Person bin. Wollen Sie mich dafür tadeln, daß ich meiner
Pflicht gegenüber der Freiheit so weit wie möglich nachgekom-
men bin? Warum tadeln Sie nicht jene, die die ihre nicht erfüllt
haben?«
»Nun ja! Natürlich können diese Menschen das, was Sie
getan haben, nicht tun; sie sind einfach nicht so intelligent
wie Sie, weniger willensstark oder...«
»Ach, mein Freund: das sind eben die natürlichen Ungleich-
heiten, aber keine gesellschaftlichen... Gegen sie kann der
Anarchismus nicht an. Der Grad an Intelligenz oder an Wil-
lensstärke, den jemand hat, ist etwas, das ihn und die Natur
angeht, die gesellschaftlichen Fiktionen mischen sich da nicht
ein. Wie ich Ihnen schon sagte, es gibt natürliche Eigenschaf-
ten, bei denen man annehmen darf, daß sie aufgrund des lan-
gen Verweilens der Menschheit in gesellschaftliche Fiktionen
pervertiert wurden; doch liegt die Perversion nicht im
Ausmaß
einer Eigenschaft - diese ist ausschließlich naturgebunden -,
sondern in der
Anwendung dieser Eigenschaft. Nun haben
aber Dummheit oder mangelnder Wille nichts mit der Anwen-
dung solcher Eigenschaften zu tun, sondern lediglich mit ihrem
Ausmaß. Lassen Sie es sich gesagt sein: es handelt sich da um
absolut natürliche Ungleichheiten, und gegen die kann nie-
mand an, keine gesellschaftliche Veränderung vermöchte da
etwas zu tun, so wie Sie mich nicht größer, ich Sie nicht kleiner
machen kann...
Mag sein... mag sein, daß bei diesen Typen die ererbte Per-
vertierung der natürlichen Eigenschaften so weit geht, daß sie
bis zum Wesen des Temperaments vorstößt... daß also ein Typ
zum Sklaven geboren wird, ganz natürlich zum Sklaven gebo-
ren wird, also nicht die geringste Kraft aufwenden kann, um
sich zu befreien... Dann aber... was haben die dann aber mit
einer freien Gesellschaft, mit Freiheit überhaupt zu tun?

45
... Wenn jemand zum Sklaven geboren wird, so wäre die Frei-
heit das Gegenteil seiner Anlage, sie wäre für ihn Tyrannei.«
Es gab eine kleine Pause. Plötzlich mußte ich lachen.
»Wirklich, Sie sind Anarchist, sagte ich. Jedenfalls bringen Sie
einen zum Lachen; wenn man Sie so hört und dann mit den
übrigen Anarchisten vergleicht...«
»Mein lieber Freund, ich sagte Ihnen ja schon, ich habe es
Ihnen nachgewiesen, und ich wiederhole noch einmal... Der
einzige Unterschied ist der: die da sind nur in der Theorie Anar-
chisten, ich bin es in der Theorie und in der Praxis; die da sind
mystische Anarchisten, ich bin ein wissenschaftlicher Anar-
chist; die da sind Anarchisten, die sich ducken, ich bin ein An-
archist, der kämpft und befreit... Mit einem Wort: das da sind
Pseudoanarchisten, ich aber bin Anarchist.«
Daraufhin erhoben wir uns von der Tafel.

46
Fernando Pessoa in der ›Baixa‹, dem Handelsviertel von Lissabon

47
Ein ganz ausgefallenes Abendessen
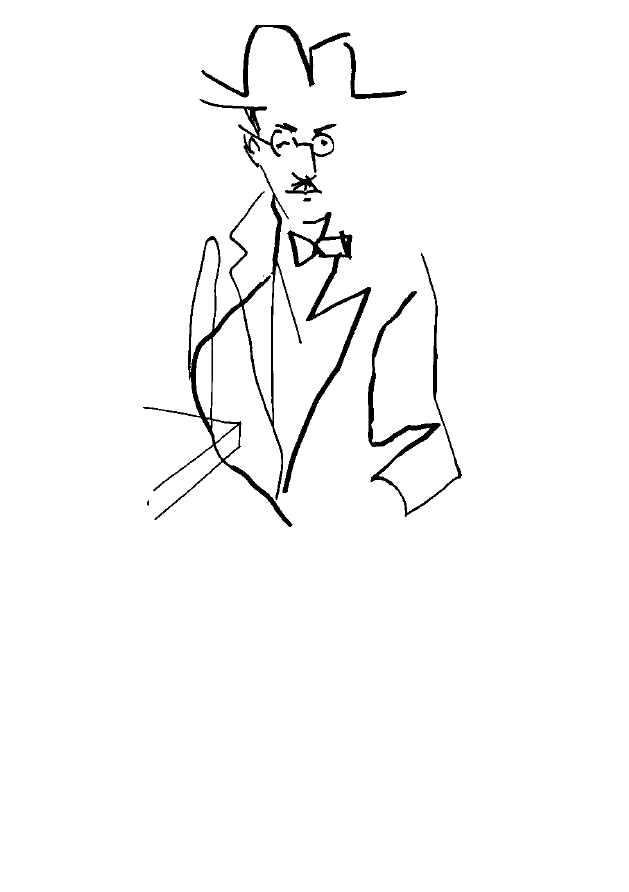
48
Fernando Pessoa,
Zeichnung von Pomar

49
Sag mir, was du ißt, und ich sag dir, wer du bist
(Jemand)
I
Es geschah während der fünfzehnten Jahressitzung der Ga-
stronomischen Gesellschaft von Berlin: Ihr Präsident, Herr
Prosit, sprach den Mitgliedern seine berühmte Einladung aus.
Die Sitzung bestand natürlich aus einem Festessen. Beim Des-
sert war eine große Diskussion über Originalität in der Kunst
des Kochens aufgekommen. Die Zeiten standen schlecht für
alle Künste. Das Originelle war im Verfall begriffen. Auch in
der Gastronomie herrschten Verfall und Schwäche. Die Er-
zeugnisse jener Küche, die man als »neu« bezeichnete, waren
lediglich Abwandlungen längst bekannter Gerichte. Eine an-
dere Sauce, eine geringfügige Abwandlung beim Würzen oder
Anrichten - und schon war das neueste Gericht anders als alle
voraufgegangenen. Aber es gab nichts wirklich Neues. Es gab
lediglich Neuerungen. All das wurde während des Festessens
einstimmig, wenn auch in mannigfaltigen Tonfällen und mit
unterschiedlicher Lautstärke, bedauert.
Obwohl viel Eifer und Überzeugung in die Diskussion ein-
flossen, blieb einer unter uns schweigsam, gerade der, dessen
Schweigen besonders auffiel, weil man von ihm am ehesten
eine Einmischung erwartet hätte. Es handelte sich natürlich um
Herrn Prosit, den Präsidenten der Gesellschaft und Vorsitzen-
den dieses Treffens. Herr Prosit war der einzige, der auf die
Diskussion nicht achtete - er war eher gleichmütig als unauf-

50
merksam. Es fehlte die Autorität seiner Stimme. Ausgerechnet
er, Prosit, war nachdenklich; er, Prosit, war schweigsam; er,
Wilhelm Prosit, der Präsident der Gastronomischen Gesell-
schaft, blieb ernst.
Für die meisten war ein schweigsamer Herr Prosit etwas Sel-
tenes. Er ähnelte (der Vergleich sei mir gestattet) einem Sturm.
Schweigen gehörte nicht zu seinem Wesen. Gleichmut war
nicht seine Natur. Und wie bei einem Sturm (um bei dem Ver-
gleich zu bleiben), so war es auch bei ihm; jedesmal, wenn er
sich in Schweigen hüllte, war es wie die Ruhe vor dem Sturm,
wie das Vorspiel zu einer Explosion, die alles in den Schatten
stellte. Das war das Bild, das man sich von ihm machte.
Der Präsident war ein in mancherlei Hinsicht bemerkens-
werter Mann. Er war ein fröhlicher und geselliger Mann, wenn
auch von abnormer Munterkeit und lärmendem Betragen, das
wie eine beständige Unnatürlichkeit erschien. Seine Gesellig-
keit hatte etwas Pathologisches; sein Witz und seine Spaße
wirkten nicht gerade gezwungen, vielmehr so, als entsprängen
sie einer Fähigkeit des Geistes, die nicht unbedingt eine Fähig-
keit zum Witz ist. Sein Humor war wie auf falsche Weise echt,
und seine Ruhelosigkeit lebte er wie etwas Natürliches vor.
In Gesellschaft seiner Freunde - und er hatte viele - war er
beständig zu Frohsinn aufgelegt, immer lustig, immer lachend.
Bemerkenswert ist dabei, daß auf dem gewöhnlichen Gesicht
dieses seltsamen Menschen keine Spur von Frohsinn oder
Freude zu sehen war. Wenn er zu lachen aufhörte, wenn er zu
lächeln begann, war es, als verfiele er aufgrund des Gegensat-
zes, den sein Gesicht verriet, in etwas dem Schmerz Verwand-
tes.
Lag das an einem wesentlich unglücklichen Charakter, an
Sorgen aus dem früheren Leben oder an irgendeiner anderen
Krankheit des Gemüts? - Ich, der ich all das erzähle, wäre
kaum imstande, eine Vermutung auszusprechen. Davon abge-
sehen, wurde dieser Widerspruch in seinem Charakter oder
zumindest in dessen Offenbarungen nur von einem aufmerk-
samen Betrachter wahrgenommen, die anderen bemerkten ihn
gar nicht, es gab auch keinen Grund dazu, j
So wie in einer stürmischen Nacht, in der, wenn auch in be-
stimmten Abständen, ein Sturm dem anderen folgt, der, wel-
cher sie erlebt hat, die ganze Nacht eine Sturmnacht nennt und

51
die Pausen zwischen den Ausbrüchen vergißt, weil er die Nacht
nach dem benennt, was ihn am meisten beeindruckt hat - ge-
nauso bezeichneten die Leute Prosit, wobei sie einer Neigung
der Menschheit gehorchten, als einen fröhlichen Menschen,
weil bei ihm am meisten der lärmende Frohsinn, die laute
Freude auffielen. So wie bei dem Sturm die, welche ihn erleben,
die große Stille davor und danach vergessen, vergaßen wir bei
diesem Mann ganz einfach, wenn er laut auflachte, sein trauri-
ges Schweigen, seine mürrische Niedergedrücktheit in den Pau-
sen seiner geselligen Natur.
Das Gesicht des Präsidenten, ich sage das noch einmal, ver-
riet diesen Widerspruch, es trug ihn in sich. Sein lachendes Ge-
sicht wirkte unbeseelt. Sein ständiges Lächeln erschien wie das
eigenartig verzerrte Grinsen jener, auf deren Gesicht plötzlich
Sonnenschein fällt; doch was
hier eine natürliche Muskelkon-
traktion angesichts starken Lichteinfalls ist, war
da eine dau-
ernde, höchst unnatürliche und höchst groteske Grimasse.
Im allgemeinen wurde behauptet (von denen, die ihn so
kannten), er habe sich auf ein fröhliches Leben verlegt, um
einer familienbedingten Nervosität oder, bestenfalls, einer ge-
wissen Morbidität zu entgehen, und es habe unter seinen Vor-
fahren, von zahlreichen mehr als zügellosen Wüstlingen ganz
zu schweigen, etliche unverkennbare Neurotiker gegeben. Er
selber könnte ein Nervenleidender gewesen sein. Doch kann
ich darüber nichts Sicheres sagen.
Was dagegen außer Zweifel steht und was ich als wahr be-
haupten kann, ist, daß Prosit in die Gesellschaft, von der die
Rede ist, durch einen jungen Offizier eingeführt wurde, einen
Freund auch von mir und lustigen Burschen, der ihn irgendwo
aufgelesen hatte, nachdem er sich an einem von Prosits hand-
greiflichen Spaßen auf das schönste ergötzt hatte.
Die Gesellschaft, in welcher sich Prosit bewegte, war, um die
Wahrheit zu sagen, eine jener zweifelhaften Randgesellschaf-
ten, die nicht selten sind und die eine seltsame Zusammenset-
zung aus hohen und niedrigen Elementen aufweisen, ganz von
der Art einer chemischen Verbindung, weil sie oft einen ihnen
eigenen Charakter haben, der sich von dem ihrer Elemente un-
terscheidet. Hier handelte es sich um eine Gesellschaft, deren
Künste — Kunstfertigkeiten müßte man sie eher nennen — darin
bestanden, zu essen, zu trinken und zu lieben. Er war zweifels-

52
ohne
künstlerisch veranlagt, und er war, daran besteht noch
weniger Zweifel, grob. Alle diese Eigenschaften vereinten sich
auf harmonische Weise in der Gesellschaft.
Der Anführer dieser Vereinigung von gesellschaftlich gese-
hen wertlosen und menschlich gesehen nichtsnutzigen Indivi-
duen war Prosit, weil er von allen der Gröbste war. Ich kann
nicht ohne weiteres auf die einfache und doch komplizierte
Psychologie dieses Tatbestands eingehen. Auch ist mir nicht
bekannt, warum der Anführer dieser Gesellschaft ausgerech-
net aus deren niedrigster Sphäre gewählt worden war. In der
gesamten Literatur ist viel Spitzfindigkeit und Einfühlungsver-
mögen auf Tatbestände dieser Art verwendet worden. Augen-
scheinlich sind sie pathologischer Natur. Poe gab den komple-
xen Gefühlen, aus denen sie sich nähren, den allgemeinen
Namen
Verderbtheit, weil er glaubte, sie bildeten ein Ganzes.
Ich möchte meinen Bericht auf den vorliegenden Fall beschrän-
ken. Um es in etwas herkömmlichen Worten auszudrücken:
Das weibliche Element der Gesellschaft kam von unten, das
männliche von oben. Pfeiler dieser chemischen Verbindung
war mein Freund Prosit. Die Gesellschaft hatte zwei Mittel-
punkte, zwei Treffpunkte; ein bestimmtes Restaurant oder das
angesehene Hotel X, je nachdem, ob es sich bei dem Festmahl
um ein stumpfsinniges Gelage oder aber eine züchtige, männ-
liche, künstlerische Sitzung der Gastronomischen Gesellschaft
von Berlin handelte. Was das erstere angeht, so verbietet sich
jede Andeutung; nichts wäre geeignet, um den Eindruck des
zutiefst Unanständigen zu zerstreuen. Denn Prosits Grobheit
war nicht mehr normal; sein Einfluß erniedrigte die Ziele noch
der niedrigsten Lüste seiner Freunde. Um die Gastronomische
Gesellschaft war es besser bestellt; sie verkörperte die geistige
Seite der konkreten Bestrebungen jener Vereinigung.
Wie gesagt, Prosit war grob; ja, das war er. Sein Über-
schwang war grob, sein Humor äußerte sich auf grobe Weise.
Ich möchte all dem mit Sorgfalt nachgehen. Ich möchte weder
Lobeshymnen schreiben, noch möchte ich verleumden. Ich
skizziere so unverfälscht wie möglich einen Charakter und
folge dabei, so gut es mir die Bilder meiner Erinnerung erlau-
ben, den Spuren der Wahrheit.
Doch, Prosit war ohne jeden Zweifel grob. Selbst in der Ge-
sellschaft, wo er gelegentlich zu leben gezwungen war, und wo

53
er mit gesellschaftlich hochstehenden Elementen in Berührung
kam, legte er nicht viel von seiner angeborenen Roheit ab, der
er sich teilweise bewußt hingab. Seine Spaße waren nicht im-
mer angenehm und harmlos; sie waren fast immer grob, auch
wenn sie denen, die der ›Pointe‹ solcher Darbietungen etwas
abgewinnen konnten, recht lustig, recht witzig und fein ausge-
dacht vorkamen.
Der bessere Aspekt seiner Gemeinheit lag in ihrer Leiden-
schaftlichkeit, insofern es sich bei ihr um Inbrunst handelte.
Denn der Präsident packte alles, was er unternahm, mit In-
brunst an, besonders wenn es sich um kulinarische Unterneh-
mungen und Liebesaffären handelte; im ersteren Fall war er ein
Dichter des Geschmacks, der täglich neue Eingebungen hatte;
im letzteren erreichte die Niedrigkeit seines Charakters ihren
scheußlichen Höhepunkt. Dessen ungeachtet, konnte an seiner
Inbrunst und an der Leidenschaftlichkeit seines Frohsinns
nicht gezweifelt werden. Mit seiner gewaltigen Energie steckte
er die anderen an, entfachte ihre Begeisterung, erregte ihre Lei-
denschaft, ohne daß er sich dessen bewußt war. Dennoch galt
seine Begeisterung ihm selbst, sie war für ihn da, sie war für ihn
ein organisches Bedürfnis und war eigentlich nicht für seine
Beziehungen zur Außenwelt gedacht. Allerdings konnte er
diese Inbrunst nicht lange aufrechterhalten; doch solange sie
dauerte, war sie als Beispiel, wenn auch unbewußt, sehr an-
steckend.
Es muß auch noch angemerkt werden, daß der Präsident
zwar ein feuriger, leidenschaftlicher Mann mit einem groben
und rohen Kern war, daß er aber nie verdrießlich war. Niemals.
Niemand vermochte ihn in Wut zu versetzen. Außerdem war er
stets bemüht, angenehm zu sein und Streitigkeiten zu vermei-
den. Es hatte den Anschein, als wünsche er, sich mit allen gut zu
verstehen. Es war seltsam, ihm zuzusehen, wenn er seinen Zorn
unterdrückte, wenn er ihn standhaft bezwang, was ihm nie-
mand so recht zutraute, am wenigsten jene, die ihn als leiden-
schaftlich und feurig kannten, seine engsten Freunde.
Das war vor allem der Grund, nehme ich an, warum Prosit
so beliebt war. Wir wußten, daß er grob, brutal, impulsiv war,
aber auch, daß er sich nie brutal benahm, wenn er wütend oder
aggressiv war, daß er in seinem Zorn nie impulsiv war, und
möglicherweise war, wenn auch unbewußt, dieses Wissen das

54
Fundament unseres Wohlwollens. Außerdem war da die Tatsa-
che, daß er immer willens war, angenehm und lustig zu sein.
Und was seine derbe Art angeht, so zählt das unter Männern
nicht viel, denn ansonsten war der Präsident ein prächtiger
Bursche.
Man wird also einsehen, daß Prosits Anziehungskraft (um es
einmal so zu nennen) in folgendem lag: in seinem Eifer, ange-
nehm zu sein, in der besonderen Faszination, die von seiner
sprudelnden, wenn auch groben Laune ausging, und nicht zu-
letzt vielleicht in der unbewußten Ahnung eines kleinen Rät-
sels, das sein Charakter aufgab.
Genug! Meine Analyse von Prosits Charakter, so ausführlich
sie auch in Einzelheiten sein mag, muß dennoch unzulänglich
bleiben, weil, wie ich vermute, Elemente fehlen oder im unkla-
ren belassen sind, die sich für eine abrundende Synthese
geeignet hätten. Ich habe mich in Gefilde jenseits meiner Fähig-
keiten vorgewagt. Ich möchte nicht, daß mein Erkenntnisver-
mögen mit der Klarheit verwechselt wird, die ich mir wünsche.
Darum werde ich nichts mehr dazu sagen.
Nur, dessen ungeachtet, etwas bleibt doch nach all dem Ge-
sagten zurück, und zwar das äußere Erscheinungsbild von Pro-
sits Charakter. Es bleibt dabei: Herr Prosit war aus jeder nur
denkbaren Absicht und zu jedem nur vorstellbaren Zweck ein
fröhlicher Mann, ein wunderlicher Geselle, ein Mann, der im
allgemeinen lustig war, der andere mit seinem Frohsinn beein-
druckte, ein Mann, der sich in seiner Gesellschaft tadellos auf-
führte und viele Freunde hatte. Sein Hang zum Groben, in dem
Maße wie er den Charakter der Menschen prägte, mit denen er
verkehrte, das heißt, wie er seine Umwelt schuf, kam durch
seine übermäßige Deutlichkeit zum Verschwinden und geriet
allmählich in den Bereich des Unbewußten; er wurde nicht
mehr wahrgenommen, war schließlich nicht mehr wahrnehm-
bar.
Das Abendessen neigte sich seinem Ende zu. Die Unterhaltung
hatte sich belebt, sowohl in Hinblick auf die Anzahl der Spre-
chenden als auch auf den Lärm der Stimmen, die miteinander
harmonierten, Mißklänge erzeugten, sich gegenseitig durch-
drangen. Prosit hüllte sich immer noch in Schweigen. Der
Hauptredner, Kapitän Greiwe, hielt einen lyrischen Vortrag. Er

55
beharrte auf dem unergiebigen Mangel an Phantasie (so
drückte er es aus), was die neuartigen Gerichte anging. Dabei
redete er sich in Begeisterung. Die Kunst der Gastronomie, be-
merkte er, lebe von stets neuen Gerichten. Seine Auslegungen
waren borniert und beschränkten sich auf die Kunst, die er
kannte. Er argumentierte ganz falsch, indem er zu verstehen
gab, allein das Neue sei in der Gastronomie von hervorragen-
dem Wert. Vielleicht war es auch eine schlaue Art zu sagen, die
Gastronomie sei die einzige Wissenschaft, die einzige Kunst.
»Eine heilige Kunst«, rief der Kapitän, »deren Konservatismus
fortwährende Revolution ist. Ich könnte von ihr sagen«, fuhr
er fort, »was Schopenhauer von der Welt gesagt hat, nämlich
daß sie sich bewahrt, indem sie sich zerstört.«
»Warum, Prosit«, fragte ein Mitglied am äußersten Ende des
Tisches, welches das Schweigen des Präsidenten bemerkt hatte,
»warum haben Sie noch nicht Ihre Meinung kundgetan, Pro-
sit? Kommen Sie, sagen Sie endlich was! Oder sind Sie geistes-
abwesend? Sind Sie schwermütig? Sind Sie krank?«
Alle blickten auf den Präsidenten. Der Präsident richtete wie
üblich ein Lächeln auf sie, sein übliches, boshaftes, geheimnis-
volles, beinahe humorloses Lächeln. Doch auch
dieses Lächeln
hatte etwas zu bedeuten; in gewisser Weise nahm es die be-
fremdlichen Worte des Präsidenten vorweg.
Der Präsident durchbrach die Stille, die in Erwartung seiner
Antwort aufgekommen war.
»Ich habe einen Vorschlag zu machen, es geht um eine Einla-
dung«, sagte er. »Habe ich Ihre Aufmerksamkeit? Darf ich re-
den?«
Es war, als ob sich bei diesen Worten noch größere Stille aus-
gebreitet hätte. Alle Augen waren auf ihn gerichtet, Handlun-
gen und Gesten, die gerade ausgeführt wurden, verharrten
augenblicklich; Aufmerksamkeit hatte sich der Anwesenden
bemächtigt.
»Meine Herren«, begann Prosit, »ich beabsichtige, Sie zu
einem Abendessen einzuladen, zu einem Abendessen, möchte
ich behaupten, wie Sie es noch nicht erlebt haben. Mit dieser
Einladung ist eine Herausforderung verbunden. Ich werde
mich später noch dazu äußern.«
Er machte eine kleine Pause. Niemand bewegte sich, außer
Prosit, der ein Glas Wein austrank.

56
»Meine Herren«, wiederholte er in einer beredt direkten
Weise, »meine Herausforderung geht alle an, sie besteht darin,
daß ich in zehn Tagen, von heute ab gerechnet, eine neue Art
Abendessen,
ein ganz ausgefallenes Abendessen, geben werde.
Betrachten Sie sich als eingeladen!«
Überall erhob sich Erklärung heischendes Gemurmel, tauch-
ten Fragen auf. Warum diese Art der Einladung? Wieso die un-
verständliche Ausdrucks weise? Worin bestand, unumwunden
gesagt, die angekündigte Herausforderung?
»In meinem Haus am Platz«, sagte Prosit.
»Gut.«
»Sie werden doch nicht den Treffpunkt unserer Gesellschaft
in Ihr Haus verlegen wollen?«, erkundigte sich ein Mitglied.
»Nein, nur zu diesem Anlaß.«
»Und handelt es sich wirklich um etwas so Ausgefallenes,
Prosit?«, erkundigte sich hartnäckig ein neugieriges Mitglied.
»Um etwas sehr Ausgefallenes. Etwas ganz und gar Neues.«
»Bravo!«
»Die Originalität des Abendessens«, sagte der Präsident wie
jemand, der einen Hintergedanken ausspricht, »liegt nicht in
der Art seines Ausdrucks, seiner Erscheinung, sondern in seiner
Bedeutung, in seinem Inhalt. Ich fordere hier jeden heraus, mir
zu sagen (und ich könnte bei diesem Anlaß sagen »jeden über-
haupt, wo er auch sei«), wenn er das Essen beendet hat, was an
ihm ausgefallen war. Ich wage zu behaupten, daß niemand dar-
auf kommen wird. Darin liegt meine Herausforderung. Sie
glauben vielleicht, es ginge mir darum zu beweisen, daß nie-
mand ein ausgefalleneres Abendessen geben könnte. Aber
nein, dem ist nicht so; es ist, wie ich gesagt habe. Wie Sie sehen,
ist alles noch viel ausgefallener, so ausgefallen, daß es Ihre Er-
wartungen übersteigt.«
»Dürften wir den Grund Ihrer Einladung erfahren?«, fragte
ein Mitglied.
»Es treibt mich dazu«, erklärte Prosit, wobei sein Gesicht
mit dem entschlossenen Blick einen sarkastischen Zug an-
nahm, »wegen einer Diskussion, die ich vor dem Abendessen
hatte. Einige meiner Freunde, die hier anwesend sind, haben
vielleicht den Streit mitangehört. Sie können diejenigen infor-
mieren, die Näheres wissen wollen. Meine Einladung ist hier-
mit ausgesprochen. Nehmen Sie sie an?«

57
»Natürlich! Natürlich!«, tönte es von allen Seiten des
Tisches.
Der Präsident nickte und lächelte; irgendeine geheime
Vision nährte seine Belustigung, und er verfiel wieder in
Schweigen.
Nachdem Herr Prosit die erstaunliche Herausforderung und
seine Einladung ausgesprochen hatte, drehten sich die Gesprä-
che unter den Mitgliedern um den wahren Beweggrund. Einige
waren der Ansicht, es handele sich bloß um einen weiteren
Scherz des Präsidenten; andere meinten, Prosit habe den
Wunsch, wieder einmal seine kulinarischen Fähigkeiten unter
Beweis zu stellen, was, rational betrachtet, unbegründet war,
da (wie es hieß) ihn niemand herausgefordert hatte, was aber
der Selbstgefälligkeit eines jeden Künstlers behagen würde.
Wieder andere versicherten, die Einladung sei in Wirklichkeit
wegen gewisser junger Leute aus Frankfurt ausgesprochen
worden, die mit dem Präsidenten gastronomisch wetteiferten.
Bald aber stellte sich heraus, wie der Leser dieser Zeilen sehen
wird, daß der Anlaß für die Herausforderung mit letzteren zu
tun hatte — ich spreche von dem unmittelbaren Anlaß, denn da
der Präsident ein Mensch war, und ein sehr ausgefallener dazu,
hatte seine Einladung, psychologisch gesehen, mit allen drei
Absichten, die ihm unterstellt wurden, zu tun.
Der Grund, warum man nicht sofort glauben wollte, Prosits
wahrer Grund für die Einladung sei der Streit (wie er ja selber
gesagt hatte), war folgender: Die Herausforderung war einfach
zu ungenau, zu geheimnisvoll, um wie nach einer Erwiderung
auf eine Provokation auszusehen, um als bloße Rache zu er-
scheinen. Schließlich aber mußte man daran glauben.
Die Diskussion, welche der Präsident erwähnt hatte, hatte
sich (sagten die, die Bescheid wußten) zwischen ihm und fünf
jungen Männern aus der Stadt Frankfurt abgespielt. Es hatte
weiter nichts Besonderes mit den jungen Männern auf sich, nur
daß sie auch Gastronomen waren; und nur dadurch, meine ich,
verdienen sie unsere Aufmerksamkeit. Die Diskussion mit ih-
nen hatte lange gedauert. Der Streitpunkt war, wie man sich
noch erinnern konnte, ein Gericht, das einer von ihnen erfun-
den hatte, oder ein Abendessen, das sie gegeben hatten und das
irgendeine gastronomische Leistung des Präsidenten übertrof-
fen haben sollte. Darüber war ein Streit ausgebrochen, und um

58
diesen Mittelpunkt hatte die Spinne des Zanks betriebsam ihr
Netz gesponnen.
Die Diskussion war hitzig verlaufen auf selten der jungen
Männer, sanft und moderat auf seilen Prosits. Wie ich schon
erwähnt habe, war es seine Gewohnheit, sich nie aus der Ruhe
bringen zu lassen. Bei jener Gelegenheit allerdings war er fast in
Zorn geraten wegen der heftigen Erwiderungen seiner Wider-
sacher. Doch es war ihm gelungen, die Ruhe zu bewahren. Dies
alles inzwischen bekannt, glaubte man, der Präsident beabsich-
tige, den jungen Leuten einen gewaltigen Streich zu spielen,
sich also in seiner üblichen Art für den stürmischen Streit zu
rächen. Die Erwartungen wurden diesbezüglich in die Höhe
geschraubt; man munkelte schon über einen Riesenscherz, Ge-
schichten über eine Rache von frappierender Originalität
machten die Runde. Angesichts des Tatbestandes als solchem
und angesichts des Mannes nährten sich die Gerüchte von
selbst, nichts weiter als plumpe Bauten mit der Wahrheit als
Fundament. Alle drangen sie früher oder später an Prosits Ohr;
doch wenn er sie hörte, schüttelte er nur den Kopf, und wäh-
rend er so tat, als übe er Gerechtigkeit an ihrer Absicht, be-
klagte er in Wirklichkeit die Grobheit ihrer Form. Niemand,
meinte er, hätte richtig geraten. Es wäre auch unmöglich,
meinte er, daß jemand richtig mutmaßen würde. Es würde eine
große Überraschung geben. Mutmaßungen, Ratespiele und
Hypothesen wären lächerlich und zwecklos.
Aber die Gerüchte kamen natürlich erst später auf. Kehren
wir zum Abendessen zurück, in dessen Verlauf die Einladung
ausgesprochen worden war. Es war eben zu Ende gegangen.
Wir begaben uns gerade in den Rauchsalon, als wir den fünf
jungen Männern von wirklich raffiniertem Äußeren begegne-
ten; sie grüßten Prosit recht kühl.
»Meine Freunde, das übrigens sind die fünf jungen Herren
aus Frankfurt«, erklärte Prosit, indem er sich uns zuwandte,
»ich habe sie einst bei einem Wettstreit in gastronomischen An-
gelegenheiten geschlagen...«
»Ach, wissen Sie, ich glaube kaum, daß davon die Rede sein
kann«, entgegnete lächelnd einer der jungen Männer.
»Nun gut, sei es, wie es sei oder wie es war. Tatsache, meine
Freunde, ist, daß die Herausforderung, die ich heute an die
Gastronomische Gesellschaft gerichtet habe« - mit einer aus-

59
holenden Geste seiner Hand wies er auf uns — »von weit größe-
rer Bedeutung und weitaus künstlerischerer Art ist.« Diese Er-
klärung galt den Fünfen. Sie hörten sie sich so unhöflich an, wie
sie konnten.
»Als ich gerade eben diese Herausforderung aussprach,
dachte ich an Sie, meine Herren!«
»Was Sie nicht sagen! Und was haben wir damit zu tun?«
»Das werden Sie bald sehen! Das Essen findet in der über-
nächsten Woche, am siebzehnten, statt.«
»Wir möchten das Datum gar nicht wissen. Wir brauchen es
nicht zu wissen.«
»Ja, das stimmt eigentlich!«, kicherte der Präsident. »Das
brauchen Sie nicht. Es wird auch gar nicht nötig sein. Den-
noch«, fügte er hinzu, »werden Sie beim Abendessen dabei
sein.«
»Wie denn!«, rief einer der jungen Männer aus, neben ihm
grinste einer, ein anderer starrte vor sich hin.
Der Präsident grinste zurück.
»Sie werden einen höchst materiellen Beitrag liefern.«
Die Mienen der fünf jungen Männer spiegelten ihre Zweifel
und ihr geringes Interesse an der ganzen Angelegenheit.
Als sie weitergingen, sagte der Präsident: »Also, wenn ich
etwas will, will ich es auch, und ich will, daß Sie beim Abend-
essen dabei sind, ich will, daß Sie zu seinem Wert beitragen.«
Er hatte das in einem so offen und nachdrücklich höhnischen
Ton gesagt, daß die jungen Männer verärgert die Treppe hinun-
tereilten.
Der letzte drehte sich noch einmal um.
»Im Geiste werden wir vielleicht da sein«, sagte er, »und an
Ihre Schlappe denken.«
»Nein, nein; Sie werden sehr wohl da sein. Sie werden leib-
haftig da sein — leibhaftig, das versichere ich Ihnen. Keine
Sorge! Überlassen Sie nur alles mir!«
Eine Viertelstunde später, nachdem alles erledigt war, ging
ich mit Prosit die Treppe hinunter.
»Glauben Sie wirklich, Sie können veranlassen, daß sie dabei
sind, Prosit?«, fragte ich ihn, als er seinen Überrock anzog.
»Gewiß«, sagte er, »dessen bin ich sicher.« Wir traten ge-
meinsam hinaus - ich und Prosit - und trennten uns vor dem
Eingang des Hotels.

60
II
Es kam der Tag, an dem Prosits Einladung in Erfüllung gehen
sollte. Das Essen fand um halb sieben abends in Prosits Haus
statt.
Das Haus - von dem Prosit gesagt hatte, es läge am Platz -
war, genau genommen, nicht
sein Haus, sondern das eines al-
ten Freundes, der außerhalb von Berlin lebte und Prosit sein
Haus lieh, wenn der Präsident es wünschte. Es stand immer zu
seiner Verfügung. Doch benutzte er es nur selten. Einige der
frühesten Festessen der Gastronomischen Gesellschaft hatten
dort stattgefunden, bis alle von der größeren Bequemlichkeit
des Hotels - Komfort, Ausstattung, Räumlichkeiten - über-
zeugt waren. Prosit war im Hotel kein Unbekannter; die Ge-
richte wurden nach seinen Anweisungen zubereitet. Er hatte
dort seine eigenen Köche oder die von Mitgliedern oder auch
Köche, die aus irgendwelchen Restaurants hinzugezogen wur-
den, und verfügte für seinen Erfindungsgeist über ebensoviel
Spielraum wie im Hause; abgesehen davon, konnten seine Vor-
haben im Hotel rascher und besser ausgeführt werden; sie wur-
den ordentlicher und exakter verwirklicht.
Was aber das Haus angeht, in dem Prosit wohnte, so kannte
es niemand, und niemand wollte es kennenlernen. Für be-
stimmte Festessen wurde das Haus benutzt, von dem ich er-
zählt habe; für seine Liebesaffären hatte er eine Zimmerflucht,
dann war er in einem Club - was sage ich, in zwei Clubs -, und
oft ließ er sich im Hotel blicken.
Prosits Haus kannte niemand, wie ich schon sagte; daß er
eines besaß, abgesehen von den Orten, an denen er sich auf-
hielt, galt als allgemein sicher. Aber wo sich dieses Haus be-
fand, davon hatte niemand eine Ahnung. Auch mit wem er dort
lebte, war uns nicht bekannt. Prosit hatte uns nie einen Hin-
weis gegeben, wer ihm in seiner Abgeschiedenheit Gesellschaft
leistete. Ob es überhaupt solche Leute gab, auch darüber hatte
er nichts verlauten lassen. Unsererseits war es nichts weiter als
die schlichte und einfache Schlußfolgerung aus unseren Überle-
gungen. Wir hatten nämlich erfahren — von wem, weiß ich
nicht mehr -, daß Prosit in den Kolonien gelebt hatte - in
Afrika oder Indien oder sonstwo — und daß er dort viel Geld

61
gemacht hatte, von dem er jetzt lebte. Soviel war weiterhin be-
kannt, den Rest herauszufinden war ohne Belang.
Ich denke, der Leser kennt jetzt hinreichend die Lage der
Dinge und kann auf weitere Beobachtungen meinerseits ver-
zichten, sowohl was den Präsidenten selbst als auch sein Haus
betrifft. Ich gehe daher zum Schauplatz des Festmahls über.
Der Raum, in welchem man die Tafel gedeckt hatte, war
breit und lang, wenn auch nicht sehr hoch. An den Seiten be-
fanden sich keine Fenster, sondern nur Türen, die in verschie-
dene Räume führten. An seinem äußersten Ende, auf der Seite,
die zur Straße hinging, war ein hohes und großes Fenster einge-
lassen, das so prächtig war, daß es selber die Luft einzuatmen
schien, die es hineinlassen konnte. Es nahm gut und gern den
Platz von drei gewöhnlichen Fenstern ein, und die Rahmenun-
terteilungen machten drei Fenster aus ihm. Obwohl der Raum
groß war, genügte dieses eine Fenster, um ausreichend Licht
und Luft zu verschaffen; so war keine der Ecken der natürlich-
sten Dinge der Natur beraubt.
Man hatte für das Festessen inmitten des Speisesaals einen
langen Tisch aufgestellt, an dessen oberem Ende der Präsident
mit dem Rücken zum Fenster saß. Ich, der ich als ältestes Mit-
glied das Protokoll führte, saß zu seiner Rechten. Weitere De-
tails sind unwesentlich. Anwesend waren zweiundfünfzig Per-
sonen.
Der Raum wurde von drei Kandelabern erleuchtet, die über
dem Tisch thronten. Dank einer geschickten Anordnung ihrer
Verzierungen war das Licht in erster Linie auf den Tisch gerich-
tet, und der Raum zwischen ihm und den Wänden lag eher im
Dunkeln. Von der Wirkung her ähnelte das der Lichtverteilung
über Billardtischen. Was dort allerdings erreicht wird, wurde
hier nicht erreicht, nämlich mit Hilfe eines Kunstgriffs die Ab-
sicht eines Gebrauchs offenbar werden zu lassen; die Beleuch-
tung im Speisesaal konnte höchstens ein Gefühl des Befremdens
hervorrufen. Hätte es auf den Seiten noch andere Tische gege-
ben, hätte man die Dunkelheit zwischen ihnen als etwas Aufge-
zwungenes empfunden. Dem war aber nicht so, es gab nur die-
sen einen Tisch. Ich selbst bemerkte das erst später, wie man
noch sehen wird. Obwohl ich, wie auch alle anderen Anwesen-
den, beim Eintreten überall nach Befremdlichem Ausschau ge-
halten hatte, war mir das irgendwie nicht weiter aufgefallen.

62
Wie die Tafel gedeckt, zurechtgemacht, geschmückt war,
erinnere ich einerseits nicht mehr, andererseits braucht es auch
gar nicht erinnert zu werden. Der mögliche Unterschied zu an-
deren, ähnlichen Tafeln blieb im Rahmen des Normalen und
verdankte sich nicht etwas Ausgefallenem. Eine Beschreibung
wäre hier unfruchtbar und ohne Ende.
Die ersten Mitglieder der Gastronomischen Gesellschaft
— zweiundfünfzig insgesamt, wie ich schon sagte — tauchten um
Viertel vor sechs auf. Drei oder vier erschienen erst eine Minute
vor Beginn des Abendessens, wie ich erinnere. Einer - der letz-
te — traf ein, als wir schon bei Tisch saßen. Wie unter Künstlern
üblich, wurde bei solchen Anlässen wie auch bei dieser Sitzung
auf jedes Zeremoniell verzichtet. Niemand war deswegen über
den Zuspätgekommenen verärgert.
Wir hatten mit einem unterdrückten Fieber aus Erwartung,
prüfender Neugier und gesundem Mißtrauen Platz genommen.
Es sollte ja, wie jeder erinnerte,
ein ganz ausgefallenes Abend-
essen werden, und jeder war aufgefordert worden herauszufin-
den, worin das Ausgefallene des Abendessens bestand. Das
war das schwierige Endziel. War es etwas Verstecktes oder
etwas Auffälliges? Würde es in einem der Gerichte, in einer
Sauce, in irgendeinem Arrangement zu finden sein? War es nur
irgendein triviales Detail des Essens? Oder hatte es vielleicht
etwas mit der allgemeinen Beschaffenheit des Festmahls zu
tun?
Jeder von uns befand sich in diesem Geisteszustand, und so
ist es nicht verwunderlich, daß alles nur Mögliche, alles wenig
Wahrscheinliche, alles durchaus Unwahrscheinliche und Un-
mögliche zu Mißtrauen, Selbstzweifel, Verwirrung führte. War
das schon das Ausgefallene, der Scherz?
So begannen wir alle, wir, die Gäste, kaum hatten wir Platz
genommen, eingehend und neugierig die Blumen auf dem
Tisch und das Dekor zu prüfen, ach, was sage ich, sogar das
Muster auf den Tellern, die Anordnung von Messern und Ga-
beln, die Gläser und die Weinflaschen. Manche hatten auch
schon die Stühle untersucht. Nicht wenige machten mit gleich-
gültiger Miene eine Runde um den Tisch und durchschritten
den Raum. Einer guckte unter den Tisch. Ein anderer tastete
rasch und sorgfältig mit seinen Fingern dessen Unterseite ab.
Ein Mitglied ließ seine Serviette fallen und bückte sich sehr tief,

63
um sie wieder aufzuheben, was er mit lachhafter Anstrengung
besorgte, nur weil er wissen wollte, wie er mir später gestand,
ob es nicht eine Falltür gäbe, die uns zu einem gegebenen Zeit-
punkt des Festmahls verschlingen würde, uns oder nur den
Tisch oder uns mitsamt dem Tisch.
Ich erinnere nicht mehr ganz genau, welche Hypothesen
oder Mutmaßungen ich damals anstellte. Ich erinnere nur, daß
sie reichlich lächerlich waren, ganz von der Art wie die der
anderen Gäste. Phantastische und ausgefallene Vorstellungen
lösten sich in meinem Kopf dank rein mechanischer Gedanken-
assoziationen ab. Dabei war jede einzelne gleichzeitig vielsa-
gend und unbefriedigend. Genaugenommen steckte in jeder
etwas ganz Besonderes (wie ja immer irgend etwas irgendwo
steckt). Nichts aber gab sich deutlich, klar und fraglos als ein
Zeichen, als Schlüssel zum Problem, als das verborgene Wort
des Rätsels zu erkennen.
Der Präsident hatte uns alle herausgefordert, das Ausgefal-
lene an diesem Abendessen herauszufinden. Angesichts dieser
Herausforderung und seiner Fähigkeit zu Spaßen, für die Prosit
berühmt war, vermochte niemand zu sagen, wie weit das Ver-
wirrspiel ging, ob es sich bei dem Ausgefallenen absichtlich um
etwas lächerlich Unbedeutendes handelte oder um etwas vor-
dergründig Verborgenes oder aber, und auch das war denkbar,
ob es überhaupt nichts Ausgefallenes gab. So stand es um den
Geisteszustand aller Gäste — und ich stelle hier keine übertrie-
bene Behauptung auf -, als sie Platz nahmen zu
einem ganz
ausgefallenen Abendessen.
Die Aufmerksamkeit galt allem und jedem.
Als erstes fiel auf, daß fünf schwarze Diener den Dienst ver-
sahen. Ihre Gesichter waren nicht gut zu erkennen, was nicht
nur an der ungewöhnlichen Kostümierung lag, in der sie steck-
ten (dazu gehörte auch ein eigentümlicher Turban), sondern
auch an der besonderen Lichtverteilung.
Die fünf Diener waren gut auf ihre Aufgabe vorbereitet,
nicht ausgezeichnet vielleicht, aber doch gut. Das zeigte sich in
vielem, und es mußte besonders Leuten unseres Schlages auf-
fallen, die wir, aufgrund unserer Kunst, täglich wichtigen Um-
gang mit Leuten wie ihnen hatten. Sie wirkten, als habe man sie
irgendwo für ein Abendessen trainiert und als sei dieses das
erste, bei dem sie bedienten. Das war jedenfalls der Eindruck,

64
den ihre Art zu bedienen auf meinen erfahrenen Verstand
machte, ich achtete aber nicht weiter darauf und sah darin
nichts Ungewöhnliches. Diener konnte man schließlich nicht
überall auftreiben. Vielleicht, dachte ich, hat Prosit sie aus
Übersee mitgebracht, wo er gelebt hatte. Die Tatsache, daß ich
sie nicht kannte, hätte dem nicht widersprochen, da ja, wie ich
bereits erwähnt habe, Prosits eigentliches Privatleben wie auch
seine Wohnung, uns nicht bekannt waren, vielmehr von ihm
geheimgehalten wurden aus Gründen, die er vermutlich hatte
und die herauszufinden oder zu würdigen uns nicht anstand.
Meine Meinung über die fünf dunklen Diener jedenfalls war,
als ich sie zum erstenmal bemerkte, die eben geschilderte.
Das Abendessen hatte also begonnen. Es sollte noch für wei-
tere Verwirrungen sorgen. Die Eigentümlichkeiten, die zu-
nächst auffielen, waren, bei klarem Kopf besehen, so bedeu-
tungslos, daß sich eigentlich jede weitere Deutung erübrigte.
Das kam in den Bemerkungen angemessen zum Ausdruck, die
einer der Gäste humorvoll gegen Ende des Essens machte.
»Das einzige, was mein wacher und scharfer Verstand hier
an Ausgefallenem entdecken kann«, sagte ein adeliges Mitglied
anmaßend pompös, »ist primo, daß unsere Dienerschaft dun-
kel ist und mehr oder weniger im Dunkeln bleibt, obwohl doch
eigentlich wir dort tappen, secundo, daß so etwas, wenn es
überhaupt etwas bedeutet, gar nichts bedeutet. Ich kann nir-
gends den Braten riechen, außer den vor meiner Nase.«
Diese leichtfertigen Bemerkungen trafen auf Zustimmung,
obwohl ihr Witz mehr als kümmerlich war. Nur hatte jeder
dieselbe Feststellung gemacht. Niemand aber glaubte — wenn
auch viele sich nicht festlegen wollten -, daß sich Prosits Scherz
darauf beschränkte. So schauten alle auf den Präsidenten, um
zu sehen, ob sein lächelndes Gesicht irgendeine Regung, den
Anflug einer Regung oder überhaupt irgend etwas verriet -
doch sein Lächeln blieb wie immer ausdruckslos. Möglicher-
weise geriet es etwas breiter, möglicherweise zwinkerte er, als
der Adelige seine Beobachtungen vorgetragen hatte, möglich
auch, daß es noch verschlagener wurde, doch nichts ist Unge-
wisser.
»Ich freue mich«, sagte Prosit schließlich zu dem Mitglied,
das soeben gesprochen hatte, »aus Ihren Worten eine unbe-
wußte Anerkennung meiner Talente heraushören zu dürfen,

65
meines Talents etwas zu verbergen oder anders erscheinen zu
lassen, als es ist. Denn ich sehe, der Schein hat Sie getrogen. Ich
sehe, daß Sie noch weit davon entfernt sind, die Wahrheit, den
Scherz, entdeckt zu haben. Sie sind noch weit davon entfernt,
das Ausgefallene an diesem Abendessen erraten zu haben. Und
ich darf hinzufügen, daß, wenn jemand den Braten riechen
sollte, was ich nicht ganz ausschließen mag, das gewiß nichts
mit dem Geruch in seiner Nase zu tun hat. Nichtsdestoweniger,
haben Sie vielen Dank für Ihr Lob!«
»Mein Lob?«
»Ihr Lob, weil Sie nichts erraten haben. Insofern Sie nichts
erraten haben, unterstreichen Sie mein Talent. Ich danke
Ihnen!«
Gelächter setzte dieser Episode ein Ende.
Während der ganzen Zeit hatte ich nachgedacht und war
plötzlich zu einem seltsamen Schluß gekommen. Ich hatte
nämlich noch einmal die Gründe für das Abendessen erwogen,
dabei waren mir die Worte der Einladung wieder eingefallen
und das Datum, an dem es stattfinden sollte, und plötzlich erin-
nerte ich mich, daß das Abendessen von allen als ein Ergebnis
der Diskussion betrachtet worden war, die der Präsident mit
den fünf Gastronomen aus Frankfurt hatte. Mir fielen wieder
Prosits Äußerungen von damals ein. Er hatte zu den fünf jun-
gen Männern gesagt, sie würden beim Abendessen anwesend
sein, sie würden »materiell« dazu beitragen. Das genau waren
seine Worte gewesen. Nun befanden sich diese fünf Männer
aber nicht unter den Gästen... In diesem Moment fielen sie mir
beim Anblick eines der schwarzen Diener wieder ein und un-
mittelbar darauf die Tatsache, daß sie fünf waren, eine Entdek-
kung, die mich stutzig machte. Ich schaute dahin, wo sie sich
gerade befanden; ich wollte sehen, ob ihre Gesichter irgend
etwas verrieten. Doch die ohnehin dunklen Gesichter waren in
Dunkel gehüllt. Da erst erkannte ich die außergewöhnliche
Kunstfertigkeit, die darin bestand, die Beleuchtung so einzu-
richten, daß alles grelle Licht auf den Tisch fiel und daß der
Raum um ihn herum, besonders nach oben hin, wo sich die
Köpfe der aufwartenden fünf Diener befanden, in relativer
Dunkelheit blieb. So seltsam und verblüffend war diese Tatsa-
che, daß ich keine Zweifel mehr hatte. Ich war felsenfest davon
überzeugt, daß hier und jetzt beim Abendessen aus den fünf

66
jungen Herren aus Frankfurt fünf schwarze Diener geworden
waren. Das völlig Unglaubliche daran ließ mich doch noch eine
Zeitlang schwanken, aber meine Schlußfolgerung war zu
schlüssig, zu augenfällig. Es konnte sich gar nicht anders ver-
halten.
Mir fiel auch gleich wieder ein, daß fünf Minuten zuvor,
während desselben Festessens, auf dem die schwarzen Diener
natürlich die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatten, eines
der Mitglieder, Herr Kleist, ein Anthropologe, Prosit nach ihrer
Rasse und Herkunft gefragt hatte (er konnte überhaupt nichts
von ihren Gesichtern sehen). Die Verärgerung, mit welcher der
Präsident reagierte, war zwar nicht sehr deutlich, ich hatte sie
aber durchaus bemerkt, auch wenn meine Aufmerksamkeit
noch nicht so geschärft war wie nach meiner Entdeckung, ich
hatte Prosits Verlegenheit wahrgenommen und mich gewun-
dert. Ich hatte auch unbewußt aufgenommen, wie kurz darauf
einer der Diener Prosit ein Gericht reichte und wie letzterer mit
leiser Stimme etwas sagte; die fünf »Schwarzen« hielten sich
daraufhin noch mehr abseits im Dunkeln, was jemandem, der
dieses Täuschungsmanöver aufmerksam verfolgte, als Distan-
zierungsmaßnahme recht übertrieben vorkommen mußte.
Die Furcht des Präsidenten war nur allzu verständlich. Ein
Anthropologe wie Herr Kleist, jemand, der sich in den Men-
schenrassen, ihren Typen, ihren Gesichtsmerkmalen aus-
kannte, hätte den Schwindel zwangsläufig sofort durchschaut,
wenn er die Gesichter zu sehen bekommen hätte. Deswegen die
Unruhe Prosits auf die Frage hin, deshalb sein Befehl an die
Diener, sich noch mehr im Dunkeln zu halten. Wie er der Frage
auswich, habe ich vergessen; ich habe allerdings den Verdacht,
daß er einfach erklärte, es seien nicht seine Diener, und daß er
beteuerte, er kenne ihre Rasse nicht und wisse auch gar nicht,
wie sie nach Europa gelangt seien. Bei seiner Erwiderung war
ihm jedenfalls höchst unbehaglich zumute, wie ich beobachten
konnte; er fürchtete offenbar nichts mehr, als daß Herr Kleist
plötzlich den Wunsch äußern könnte, die Schwarzen in Augen-
schein zu nehmen. Auch wenn er nicht geleugnet hätte, daß sie
zu ihm gehörten, er hätte nicht sagen können: »diese Rasse«
oder »jene«, da er ja, wie er selbst am besten wußte, in dieser
Hinsicht nicht Bescheid wußte, und sich womöglich auf einen
Typus festgelegt hätte, dessen sichtbarste Hauptmerkmale, wie

67
zum Beispiel die Statur, in offenem Widerspruch zu denen der
fünf schwarzen Bediensteten standen. Ich erinnere vage, daß
Prosit seine Erwiderung in irgend etwas Handfestes münden
ließ und die Aufmerksamkeit auf das Abendessen und die Ga-
stronomie lenkte - was nichts mit den Dienern zu tun hatte.
Es wurde über das vollendete Würzen von Speisen geredet,
über die scheinbar neue Art, sie zu servieren (...) - für mich
waren diese Äußerungen nichts als Bagatellen, mit denen die
Aufmerksamkeit abgelenkt werden sollte, denn sie waren, wie
ich fand, unwichtig und abgeschmackt, ziemlich erbärmlich
und gewollt unkonventionell. Ich darf hinzufügen, daß nie-
mand sie besonders ernst nahm, nachdem er sie sich angehört
hatte.
Der Sachverhalt selbst war allerdings äußerst seltsam, un-
sagbar seltsam: Ein Grund mehr, sagte ich mir, daß es sich hier
um Prosits Scherz handelte. Doch verblüffend, ging es mir
durch den Kopf, wie er ausgeführt werden konnte. Wie nur?
Wie hatte man fünf junge Männer, die dem Präsidenten feind-
lich gesonnen waren, dazu bringen können, dazu abrichten,
verpflichten können, die Rolle von Dienern bei einem Abend-
essen zu übernehmen, also etwas zu tun, was jedem Menschen
von einer gewissen gesellschaftlichen Stellung an zuwider sein
mußte? Der Gedanke daran war grotesk und erschreckend, so
als würde ein Frauenkörper mit Fischschwanz plötzlich Wirk-
lichkeit. Man hätte meinen können, die Welt schreite auf ihren
Absätzen daher.
Das schwarze Aussehen war leicht zu erklären. Natürlich
konnte Prosit die fünf jungen Männer den Mitgliedern der Ge-
sellschaft nicht mit ihren wirklichen Gesichtern vorführen. Es
war nur verständlich, daß er von den vagen Kenntnissen profi-
tieren würde, die er sich in den Kolonien zugelegt hatte, um
seinen Scherz mit den schwarzen Männern durchzuführen. Die
quälende Frage aber blieb, wie er das bewerkstelligt hatte, und
das konnte nur Prosit selbst verraten. Ich konnte noch verste-
hen - wenn auch nicht sehr gut -, daß jemand einen Freund-
schaftsdienst tut und bei einem Scherz den Diener spielt, um
einen Gefallen zu erweisen. Aber in diesem Fall!
Ja länger ich nachdachte, desto außergewöhnlicher, aber
auch wahrscheinlicher kam mir der Fall vor; angesichts all der
Beweise, über die ich verfügte, und angesichts des Charakters

68
des Präsidenten mußte es sich hierbei um den Scherz Prosits
handeln. Da war es ein Leichtes, uns herauszufordern, das Aus-
gefallene an diesem Festmahl ausfindig zu machen. Nun hatte
dieses Ausgefallene, wie ich herausgefunden hatte, eigentlich
nichts mit dem Essen selbst zu tun, immerhin aber mit den Die-
nern, die ihrerseits durchaus mit dem Essen zu tun hatten. Als
ich an diesem Punkt meiner Überlegungen angelangt war, wun-
derte ich mich, warum ich nicht schon früher darauf gekom-
men war: Da das Festmahl (wie man jetzt wußte) wegen der
fünf jungen Männer stattfand, als Rache sozusagen, mußte es
in Zusammenhang mit ihnen stehen, und dieser Zusammen-
hang konnte nicht unmittelbarer hergestellt werden, als wenn
sie die Diener wären.
All diese Argumente und Überlegungen, die ich hier in meh-
reren Abschnitten dargelegt habe, gingen mir in nur wenigen
Minuten durch den Kopf. Ich war von etwas überzeugt, dann
verblüfft, dann zufrieden. Der Fall lag klar auf der Hand, und
diese Klarheit verscheuchte in mir jeden Gedanken an seine
außerordentliche Beschaffenheit. Ich durchschaute die Angele-
genheit in aller Deutlichkeit und Genauigkeit. Ich hatte Prosits
Herausforderung angenommen und den Sieg davongetragen.
Das Abendessen war jetzt fast zu Ende, nur das Dessert stand
noch aus.
Ich fand, mein Talent verdiene Anerkennung, und so be-
schloß ich, Prosit meine Entdeckung mitzuteilen. Ich ging noch
einmal alle Einzelheiten durch, um nur ja Unzulänglichkeiten
und Fehler zu vermeiden, zumal sich das Merkwürdige der
ganzen Angelegenheit, so wie ich sie begriff, in meine Unbeirr-
barkeit einschleichen wollte. Schließlich wandte ich meinen
Kopf Prosit zu und sagte ihm leise:
»Prosit, lieber Freund, ich kenne ein Geheimnis. Diese fünf
schwarzen Leute und die fünf jungen Männer aus Frank-
furt ...«
»Ach so! Sie glauben also, zwischen ihnen gäbe es einen Zu-
sammenhang.« Er sagte das halb spöttisch, halb zweifelnd; ich
bemerkte aber, daß ihm meine Worte unangenehm waren, und
daß ihn die Exaktheit meiner Schlußfolgerung, mit der er wohl
nicht gerechnet hatte, wütend machte. Ihm war unbehaglich
zumute, aufmerksam sah er mich an. »Die Gewißheit«, dachte
ich mir, »ist auf meiner Seite.«

69
»Natürlich!«, erwiderte ich. »Das
sind die fünf. Ich habe
daran keinen Zweifel. Aber wie, um alles in der Welt, haben Sie
das nur geschafft?«
»Rohe Gewalt, mein Lieber. Aber sagen Sie den anderen
nichts.«
»Natürlich nicht! Aber was heißt das, rohe Gewalt, Prosit?«
»Nun, das ist ein Geheimnis. Man kann es nicht erzählen. Es
ist geheim wie der Tod.«
»Aber wie fangen Sie es an, daß die es nicht erzählen? Ich
muß sagen, ich bin erstaunt. Warum laufen sie nicht davon,
warum sträuben sie sich nicht?«
Der Präsident wurde von einem Lachkrampf durchschüttelt.
»Das steht nicht zu befürchten«, sagte er und zwinkerte bedeu-
tungsschwer. »Sie werden nicht weglaufen — die nicht. Ganz
unmöglich.« Und er blickte mich gelassen, verschlagen, ge-
heimnisvoll an.
So gelangten wir schließlich — nein, nicht am Ende des
Essens - am Endzweck des Essens an, mit einer weiteren Merk-
würdigkeit, die offenbar beabsichtigt war — Prosit wollte einen
Trinkspruch ausbringen. Alle waren über einen Trinkspruch
gleich nach dem letzen Gang und noch vor dem Dessert er-
staunt. Alle wunderten sich, nur ich nicht, der ich darin nur
eine weitere, in sich belanglose Überspanntheit erblicken
wollte, welche die Aufmerksamkeit ablenken sollte. Jedenfalls
wurden die Gläser gefüllt, und während sie gefüllt wurden, än-
derte sich das Verhalten des Präsidenten. Er rückte sehr erregt
auf seinem Stuhl umher, ungeduldig wie jemand, der sprechen
will, der ein großes Geheimnis zu enthüllen, eine wichtige Mit-
teilung zu machen hat.
Dieses Betragen wurde sogleich bemerkt. » Prosit möchte sei-
nen Scherz verraten -
den Scherz. Das ist ganz Prosit! Heraus
damit, Prosit!«
Während der Augenblick für den Trinkspruch näherrückte,
schien es, als würde der Präsident verrückt vor Erregung; er
rutschte auf seinem Stuhl umher, wand sich, grinste, lächelte,
zog Grimassen, lächelte grundlos und endlos in sich hinein.
Alle Gläser waren gefüllt. Ein jeder war gespannt. Tiefe Stille
breitete sich aus. Ich erinnere noch, daß ich in der Spannung
des Augenblicks von der Straße her Fußtritte vernahm und daß
ich mich über zwei Stimmen ärgerte - die eines Mannes und die

70
einer Frau —, die sich unten auf dem Platz unterhielten. Ich ach-
tete dann nicht weiter auf sie. Prosit stand auf, nein, was sage
ich, er sprang auf, so daß er beinahe den Stuhl umgeworfen
hätte.
»Meine Herren«, sagte er, »ich werde Ihnen jetzt mein Ge-
heimnis, meinen Scherz, meine Herausforderung verraten. Das
ist sehr lustig; Sie wissen doch noch, daß ich zu den fünf jungen
Männern aus Frankfurt sagte, sie würden bei diesem Festmahl
anwesend sein, ja, sie würden auf höchst materielle Weise zu
ihm beitragen? Da liegt das Geheimnis, ich meine, darin.«
Der Präsident sprach hastig, und in seiner Eile, zur Pointe zu
kommen, redete er unzusammenhängend.
»Meine Herren, das ist alles, was ich zu sagen habe. Nun
aber der erste Trinkspruch, der erhabene Trinkspruch. Er gilt
meinen fünf Rivalen... Da niemand die Wahrheit herausgefun-
den hat, nicht einmal Meyer (das bin ich), nicht einmal er.«
Der Präsident machte eine Pause; danach erhob er seine
Stimme und rief laut: »Ich trinke auf das Andenken der fünf
jungen Herren aus Frankfurt, die leibhaftig bei diesem Essen
anwesend waren und höchst materiell zu ihm beigetragen ha-
ben.«
Und verstört, rasend, vollends verrückt wies er aufgeregt mit
einem Finger auf die Fleischreste eines Gerichts, das man auf
seinen Befehl hin auf dem Tisch hatte stehen lassen.
Kaum waren diese Worte ausgesprochen, als sich auch schon
mit geisterhafter Kälte unbeschreibliches Entsetzen ausbrei-
tete. Die unvorstellbare Offenbarung hatte alle für eine Weile
niedergeschmettert. Es herrschte eine entsetzte Stille, als habe
niemand etwas vernommen, als habe niemand verstanden. Ein
Irrsinn, der alle Phantasien überstieg, hatte sich schauerlich in-
mitten der Wirklichkeit niedergelassen. Es herrschte eine Stille,
die Jahrhunderte zu dauern schien, aber in Wirklichkeit nur
einen Augenblick währte, eine Stille, wie sie noch niemand er-
träumt und erdacht hatte. Ich habe keine Vorstellung mehr von
dem Ausdruck, der auf dem Gesicht eines jeden von uns, auf
allen Gesichtern lag. Ich weiß nur, daß keine Vorstellungskraft
sich je hat solche Mienen ausmalen können.
Alles währte einen Augenblick - kurz, alternd, tief.
Mein eigenes Entsetzen, der Aufruhr in mir lassen sich nicht
ausdenken. All die komischen Äußerungen und Unterstellun-

71
gen, die ich ganz natürlich und unschuldig in Hinblick auf
meine Hypothese von den fünf schwarzen Dienern vorgetragen
hatte, lieferten jetzt ihre tiefere, höchst grausige Bedeutung.
Der hämische Unterton, das Vielsagende in Prosits Stimme
- all das - ja, es erschien mir jetzt in seinem wahren Licht und
ließ mich schaudern; ich zitterte vor unaussprechlicher Furcht.
Allein das Ausmaß meines Schreckens bewahrte mich vor einer
Ohnmacht. Wie alle anderen, so lehnte auch ich mich eine
Weile, allerdings mit noch größerer - und begründeter -
Furcht, auf meinen Stuhl zurück, Prosit anstarrend, mit einem
Entsetzen, das sich nicht in Worte fassen läßt.
Das währte einen Augenblick, einen Augenblick und nicht
länger. Dann stürzten sich alle Gäste außer einigen, den Schwä-
cheren, die ohnmächtig geworden waren, wie rasend und
außer sich vor gerechter und unbändiger Wut auf den Kanni-
balen, den Urheber dieser grausigen Tat. Für einen Außenste-
henden mußte das ein entsetzliches Schauspiel gewesen sein, all
die wohlerzogenen, gutgekleideten, gepflegten Quasikünstler
zu sehen, wie sie von einer mehr als tierischen Raserei erfaßt
wurden. Prosit war wahnsinnig, doch in diesem Augenblick
waren auch wir es. Er hatte keinerlei Chance gegen uns — keine.
In diesem Moment waren wir in der Tat verrückter als er. Bei
dieser Wut hätte ein einziger von uns genügt, um den Präsiden-
ten entsetzlich zu bestrafen.
Ich selbst war es, der dem Verbrecher als erster einen Schlag
versetzte. Mit einer so fürchterlichen Wut, daß es mir vorkam,
als sei sie die eines anderen - und es scheint mir noch heute so,
denn die Erinnerung ist doch nur ein trübes Bild —, ergriff ich
die Weinkaraffe, die in meiner Nähe stand, und schleuderte sie
in einem schrecklichen Triumphgefühl zornig gegen Prosits
Kopf. Sie traf ihn mitten ins Gesicht, auf dem sich Blut und
Wein vermischten. Ich bin ein sanfter, feinfühliger Mensch, der
Blut verabscheut. Wenn ich heute daran zurückdenke, begreife
ich nicht, wie es mir möglich war, eine Tat zu begehen, die mei-
nem eigentlichen Ich so grausam erscheinen muß, wenn auch
gerecht; es war eine grausame, eine sehr grausame Tat, vor al-
lem wegen der Wut, aus der sie sich nährte. Wie mächtig müs-
sen damals meine Raserei und meine Tollheit gewesen sein!
Und die der anderen, wie ungeheuer mächtig!
»Aus dem Fenster mit ihm!«, schrie eine gräßliche Stimme.

72
»Aus dem Fenster!«, kreischte ein furchterregender Chor.
Allein wie das Fenster geöffnet wurde, ist bezeichnend für die
Roheit jenes Augenblicks: es wurde einfach zerschlagen. Einer
mit einer starken Schulter stellte sich davor auf und zerschmet-
terte den Mittelteil (es war dreigeteilt), der auf den Platz fiel.
Mehr als ein Dutzend tierischer, begieriger, streitender
Hände packte Prosit, dessen Wahnsinn von unsäglicher Furcht
durchdrungen wurde. Mit einer kraftvollen Bewegung wurde
er gegen das Fenster geschleudert, durch das er nicht hindurch-
fiel, er hielt sich krampfhaft an einem Rahmenteil fest.
Die Hände umklammerten ihn fester, brutaler, noch roher.
Und mit herkulischer Vereinigung aller Kräfte, nach stummer
Vereinbarung und in einem Zusammenspiel, das in solchen Au-
genblicken geradezu teuflisch ist, wurde Prosit erst in die Luft
und dann mit unbeschreiblicher Gewalt nach draußen ge-
schleudert. Mit einem dumpfen Aufprall, der noch beim Stärk-
sten Ekel hervorgerufen hätte, der aber unseren unruhigen und
erwartungsvollen Herzen die Ruhe wiedergab, schlug der Prä-
sident auf den Platz.
Danach wurde kein Wort, kein Zeichen ausgetauscht. Ein
jeder schloß sich in das Entsetzen vor sich selber ein, alle verlie-
ßen das Haus. Als wir erst draußen waren, verflogen Raserei
und Schrecken, alles wurde ein Traum, wir erlebten den unaus-
sprechlichen Schauder wiedergewonnener Nahrhaftigkeit.
Ausnahmslos allen wurde schlecht, und viele fielen früher oder
später in Ohnmacht. Mich verließen die Kräfte gleich am Aus-
gang.
Prosits fünf dunkle Diener - sie waren wirklich dunkel, es
handelte sich um ehemalige asiatische Piraten, um Abkömm-
linge eines blutrünstigen, abscheulichen Stammes - hatten alles
durchschaut und waren während der Rauferei geflohen, dann
aber — mit einer Ausnahme — wieder eingefangen worden. Es
kam uns vor, als habe Prosit bei der Durchführung seines unge-
heuerlichen Scherzes mit geradezu teuflischem Geschick nach
und nach in ihnen tierische Instinkte geweckt, die zivilisiert vor
sich hingeschlummert hatten (...) Ihnen war befohlen worden,
sich so weit wie möglich vom Tisch entfernt an dunklen Plätzen
aufzuhalten, wegen Prosits dummer und verbrecherischer
Angst vor Herrn Kleist, dem Anthropologen, der, und das war
alles, was Prosit von seiner Wissenschaft wußte, womöglich in

73
der Lage gewesen wäre, in den schwarzen Gesichtern die üblen
Kennzeichen des Verbrecherischen zu entdecken. Die vier wur-
den einer angemessenen und passenden Strafe zugeführt.

74
Fernando Pessoa um 1914

75
REI NOLD W ERNER
Die Gleichgültigkeit der Gegensätze
Über Fernando Pessoa
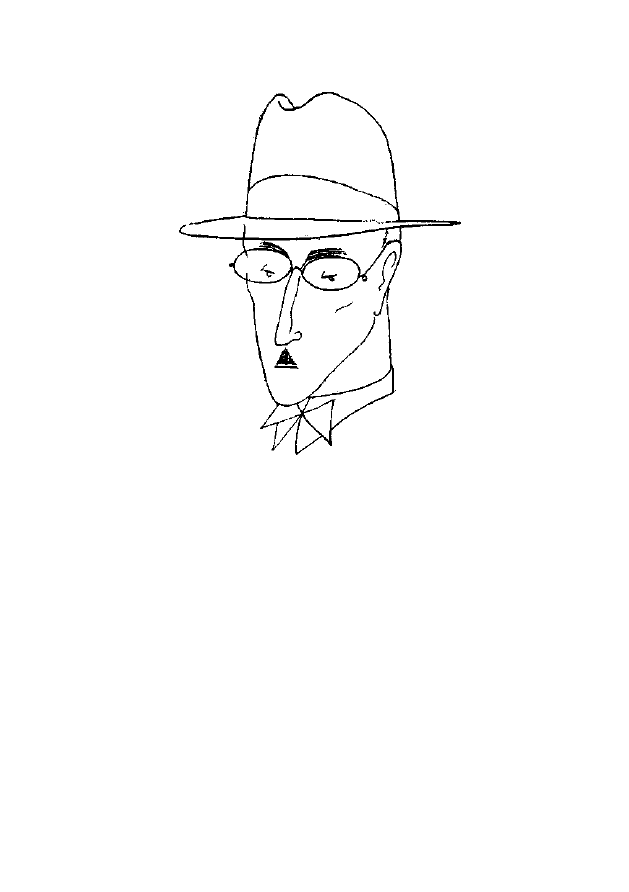
76
Portrait Pessoas von Jose Almada Negreiros,
entstanden 1935, am Tag von Pessoas Begräbnis

77
O
Fernando Pessoa sente as cousas
mas nao se mexe mesmo por dentro.
»Fernando Pessoa empfindet die Dinge,
aber nichts rührt sich, nicht einmal innerlich.«
(Alvaro de Campos ~ Fernando Pessoa)
Als hätte der Name eine Botschaft bedeutet: »Pessoa«, Per-
son, Mensch -, als hätte der Name auf ein Programm verpflich-
tet: nichts zu sein als die Abstraktion Mensch, ein beliebtes
Exemplar der Gattung, — »uma pessoa«, irgendwer. Fernando
Pessoa hat seinen Zeitgenossen ein Leben vorgeführt, in dem
man vergeblich nach schillernden Attributen, nach großarti-
gen, spektakulären Gesten suchen würde. Das Bild, das die
Nachwelt von ihm jetzt seit mehr als fünfzig Jahren aufbe-
wahrt, ist die Gestalt eines unscheinbaren, bebrillten Mannes,
der in stets gleicher Aufmachung durch die Straßen der Lissa-
boner Unterstadt geht oder sich in einem der Cafés oder klei-
nen Speiselokale aufhält: immer derselbe, mit Hut, Mantel,
Fliege oder Krawatte. Pierre Hourcade, der den Dichter noch
persönlich in Lissabon kennenlernte und ihn in französischen
Zeitschriften vorgestellt hat, sagte von ihm: »Wenn ich ihn ver-
ließ, habe ich mich nie nach ihm umgedreht: ich hatte allzu sehr
Angst, er könnte verblassen, durchsichtig werden oder sich in
die abendliche Luft auflösen.«

78
Rückblickend zeichnen sich im Leben Pessoas zwei Phasen ab:
die erste umfaßt die Kindheit, zunächst in Portugal, dann in
Südafrika, die definitive Rückkehr nach Lissabon (1905), die
frühen literarischen Aktivitäten und ersten Veröffentlichungen
bis hin zum Jahr 1914. In jenem Jahr präsentiert Pessoa den
von ihm angekündigten Super-Camões in Gestalt seiner wich-
tigsten Heteronyme: Alberto Caeiro, Ricardo Reis und Alvaro
de Campos (»Heteronyme« nannte Pessoa seine Pseudonyme,
doch unterschieden sich erstere von letzteren dadurch, daß Pes-
soa ihnen ein eigenes Leben zusprach, in das er sich selbst gele-
gentlich verirrte als sein eigenes Heteronym, ansonsten hob er
sich von ihnen als »Orthonym« ab).
Fortan — die zweite Phase hat begonnen — ist dieser größte
portugiesische Dichter des 2.0. Jahrhunderts die literarische
Wirkungsstätte, in der sich Caeiro, Reis, de Campos und auch
Bernardo Soares, jener Hilfsbuchhalter, der
Das Buch der Un-
ruhe geschrieben hat, einrichten; jeder auf seine Weise, mit dem
ihm eigenen literarischen Profil und jeweils verschiedener
ästhetischer Ausrichtung, wenn auch untereinander verbun-
den, physisch und metaphysisch in der Person Fernando Pes-
soas.
Doch in dem Maße wie sich Pessoa sozusagen in mehrere
Dichtergestalten auseinanderfaltet, schrumpft die äußere Exi-
stenz zu dem nichtssagenden Wesen zusammen, als das ihn die
Nachwelt, sieht sie von seinem Werk ab, in Erinnerung behält,
und auf das Pessoa sich selber mit Absicht reduzierte. Pessoa —
»Person« - wurde in dem Maße zur Allperson, wie die eine
Person in einen offenen Plural überging, und zwar in einen
höchst dramatischen Plural - »drama em gente« nannte Pessoa
seine Heteronymendichtung. Sein Kopf wurde das Theater, in
dem das Stück »drama em gente« bis an sein Lebensende mit
den immer identischen Hauptfiguren durchgespielt wurde -
wobei »gente« im Portugiesischen nicht nur Leute meint, son-
dern auch die ganz neutralen Indefinitpronomen »man«, »je-
mand« ...
Man kann das Phänomen der Heteronyme sicherlich kli-
nisch untersuchen, wie es einige Lebensdeuter Pessoas versucht
haben. Er selbst hatte sich nach dem 1. Weltkrieg brieflich an
die französischen Psychiater Hector und Henri Durville ge-
wandt, um Auskünfte über eine mögliche Weiterentwicklung

79
seines, wie er es nannte, Personenmagnetismus zu erhalten.
Und noch im Jahre seines Todes bekannte er in einem Brief an
den Kritiker Adolfo Casais Monteiro: »Seit meiner Kindheit
gab es bei mir die Tendenz, um mich herum eine fiktive Welt zu
schaffen, mich mit Freunden und Bekanntschaften zu umge-
ben, die nie existiert haben (selbstverständlich weiß ich nicht,
ob sie nie wirklich existiert haben oder ob ich es bin, der nicht
existiert. In diesen Dingen wie überhaupt sollte man nicht dog-
matisch sein). Seitdem ich mich als das kenne, was von mir ich
genannt wird, erinnere ich mich, geistig die Gestalt, die Bewe-
gungen, den Charakter und die Lebensgeschichte mehrerer un-
wirklicher Figuren entworfen zu haben, die für mich so sicht-
bar und die mir so vertraut waren wie jene Dinge, die dem
angehören, was wir vielleicht verkehrterweise als das wirkliche
Leben bezeichnen.«
Die erste Phase: Fernando António Nogueira Pessoa wird am
13. Juni 1888 in Lissabon geboren. Der Vater war Staatsbeam-
ter im Justizministerium und in seiner Freizeit Musikkritiker.
Die Vorfahren gehörten, so scheint es, zu jenen jüdischen Por-
tugiesen, die zum Christentum konvertierten und dafür von
der Inquisition verurteilt wurden. Der Vater stirbt, als Pessoa
gerade fünf Jahre alt ist. Die Mutter, sie stammt von den Azo-
ren, verheiratet sich zwei Jahre später wieder, und die Heirat
mit dem portugiesischen Konsul in Durban, in der damaligen
britischen Kapprovinz, leitet die ganz entscheidende englische
Phase im Leben Pessoas ein: Mutter und Sohn verlassen den
geschichts- und gedichtsträchtigen Hafen Lissabon, den der
Dichter in seinem späteren Leben nur noch als Standort wahr-
nehmen wird, von dem aus der Blick in imaginäre Fernen und
Unfernen schweift; sie verlassen Portugal und verbringen die
nächsten neun Jahre, abgesehen von einem längeren Aufent-
halt in Lissabon und auf den Azoren 1901/1901, in Südafrika.
Fernando Pessoa wächst zweisprachig auf, macht also eine der
radikalsten Gegensatzerfahrungen des Menschen. Schon in
den ersten Jahren in Lissabon war ein Heteronym entstanden,
der »Chevalier de Pas« (1894), ein Gegenüber, mit dem der
kleine Fernando Briefe austauschte. In Südafrika entstehen
weitere Heteronyme (Alexander Search — der fern von Durban
›Ein ganz ausgefallenes Abendessen‹ schreiben wird - Charles

80
Robert Anon, H. M. F. Lecher), die später den großen Hetero-
nymen Platz machen. Viel ist aus der Zeit, die Pessoa in Süd-
afrika verbracht hat, nicht bekannt; man weiß von Schulbesu-
chen (u.a. die »Commercial School of Durban«), man weiß
von seiner Sprachbegabung auch im Englischen: 1903, also mit
fünfzehn Jahren, erhält er den »Queen Victoria Memorial
Prize«, der für ausgezeichneten Stil in der englischen Sprache
vergeben wird. Über die ersten Leseerfahrungen urteilte Pessoa
später: »Die erste literarische Nahrung meiner Kindheit be-
stand aus zahlreichen Romanen mit Geheimnissen und
schrecklichen Abenteuern. Die für Jungen bestimmten Bücher,
in denen spannungsvolle Abenteuer erzählt wurden, interes-
sierten mich wenig. Das gesunde und natürliche Leben reizte
mich nicht. Ich verspürte keinen Hang zum Wahrscheinlichen,
eher zum Unglaublichen, zum Unmöglichen; nicht einmal zum
teilweise Unmöglichen, sondern zum von Natur aus Unmög-
lichen. «
Der konstitutive Gegensatz: englisch-portugiesisch, der - als
ein Gegensatz unter anderen — Pessoas späteres Leben und
Schreiben prägen wird, bedeutet nicht nur die Koexistenz
zweier Sprachen und die damit verbundene Spannung, bedeu-
tet nicht nur die Koexistenz zweier Literaturtraditionen und
deren jeweilige Einflußnahme auf Pessoas Literatur. Es handelt
sich auch um zwei erlebte Welten, deren Harmonisierung nicht
ohne weiteres gelingt: die viktorianische Welt des britischen
Empire und ihr Niederschlag im Dominion der südafrikani-
schen Union, — aus dieser Welt prägt sich die Lektüre von
Shakespeare, Milton, Byron, Shelley, Keats und E. A. Poe ein
— dessen ›Rabe‹ er unter anderem übersetzt—aus jener Zeit auch
sein ausgeprägter Sinn für (schwarzen) englischen Humor. Auf
der anderen Seite die entfernte Nähe Portugals als verblassende
lusitanische Metapher, die Pessoa wiederbeleben möchte.
Portugal ist um die Jahrhundertwende das Land einer von in-
nen und außen erschütterten Monarchie -, die Braganças wer-
den 1910 hinweggefegt zugunsten einer Republik, die sich
nicht halten kann - Land einer England zugewandten Bour-
geoisie und eines erbärmlich dahinlebenden Landvolks aus
Analphabeten (Pessoas Bemerkungen im »anarchistischen
Bankier« über Rußland wären auch für sein Land gültig gewe-

81
sen) -, Land vergangener Größe, das den einstigen Ruhm in
Schwermut und Wehmut, in der »Saudade« wie eine Kostbar-
keit aufriebt und pflegt. Diesem Land und seinem Geschick ver-
schreibt sich der junge Pessoa nach seiner Rückkehr aus Afrika
im Jahre 1905.
In einem hinterlassenen Fragment äußert sich Pessoa zum
Ende der portugiesischen Monarchie: »Es gibt drei Gründe für
den Zusammenbruch der portugiesischen Monarchie: 1. weil
sie sich nicht nur institutionell, sondern auch spirituell dem
Katholizismus wesensgleich gemacht hat; 2. weil sie es nicht
geschafft hat, eine portugiesische Gestalt anzunehmen, denn
nachdem sie die Tradition der alten absolutistischen Mon-
archie zertrümmert hatte..., bemühte sie sich nicht einmal, sie
durch eine portugiesische Spielart zu ersetzen, sondern im-
portierte über Frankreich die äußere Form einer englischen,
konstitutionellen Monarchie; 3. weil sie nie nach Ideologien
geschiedene Parteien gehabt hat, sondern immer nur Gruppen
mit unterschiedslosen Ansichten, weil sie folglich wie immer,
wenn nicht die Intelligenz herrscht, bloß aus dem Instinkt her-
aus im Sinne einer Bierbankpolitik von Bonzen regiert hat.«
In einem Brief aus dem Jahre 1915 schreibt Pessoa an seinen
Freund Cortes-Rodrigues: »... Die patriotische Idee, die immer
mehr oder weniger in meinen Bestrebungen vorhanden war,
herrscht jetzt bei mir vor; und ich denke nicht daran, Kunst zu
machen, ohne gleichzeitig daran zu denken, damit den Namen
Portugals in allem, was ich verwirklichen werde, zu erhöhen.
Das ist nur konsequent, wenn man die Kunst und das Leben
ernst nimmt.«
Dieser Patriotismus äußert sich bei Pessoa auf vielfältige
Weise; die kurioseste ist sicherlich ein Horoskop für sein Land,
aus dem Berechnungen für die Ankunft des Fünften Reiches
(»O Quinto Imperio«) hervorgehen. Dieses mythische Fünfte
Reich ist mit der Rückkehr jenes sagenhaften portugiesischen
Königs Dom Sebastião verbunden, der 1578 in Nordafrika ge-
fallen war, ohne daß man jemals seinen Leichnam gefunden
hätte. Pessoa hat sich von diesem messianischen Glauben an
die Wiederkehr des Königs Sebastian inspirieren lassen und der
Idee des Sebastianismus ein ganzes Buch gewidmet -
Mensa-
gem (»Botschaft«); es ist das einzige zu Lebzeiten veröffent-
lichte Buch Pessoas mit Dichtungen in portugiesischer Sprache.

82
In ihm feiert er die Helden der portugiesischen Vergangenheit
und beginnt dabei mit — Odysseus, dem mythischen Gründer
Lissabons.
Im Jahre seines Todes - 1935 - gesteht Pessoa dem Mither-
ausgeber der Zeitschrift »Presença«, Adolfo Casais Monteiro,
in einem Brief: »Ich stimme mit Ihnen überein, daß mein Debüt
mit einem Buch von der Art ›Mensagem‹ nicht sehr glücklich
war. Ich bin, das stimmt, ein mystischer Nationalist, ein ratio-
naler Sebastianist. Doch außerdem bin ich bis hin zum Wider-
spruch vieles andere mehr. Und von diesem vielen anderen ist in
›Mensagem‹, weil es von eben dieser Art ist, nichts enthalten.«
Immerhin hat dieses Debüt erst ein Jahr vor seinem Tode,
1934, stattgefunden. »Ich habe meine Veröffentlichungen aus
dem einfachen Grunde mit diesem Buch begonnen«, heißt es in
demselben Brief, »weil es, ich weiß nicht warum, das erste war,
das ich beenden und in eine Form bringen konnte. Da es fertig
war, bat man mich, es zu veröffentlichen, und ich habe akzep-
tiert.« Es wurde schließlich mit dem zweiten Preis im Rahmen
eines Wettbewerbs ausgezeichnet, den das staatliche Sekreta-
riat für Propaganda veranstaltet hatte — unter Salazar. Pessoa
erhielt 1000 Escudos, die einzige Summe, die er wohl je mit
seiner literarischen Arbeit verdient hat. Über Salazar sind fol-
gende Worte von Pessoa überliefert: »Man hält ihn für einen
großen Mann von scharfer Intelligenz und mit starkem Willen;
das ist zwar nicht logisch, aber menschlich, und bei den Men-
schen zählt das, was menschlich ist.«
Wenn man dem hinzufügt, daß im Jahre 192.8 ein Pamphlet
von Pessoa mit dem Titel O
Interregna — Defesa et Justificação
da Ditadura Militar em Portugal erscheint (»Das Interregnum
— Verteidigung und Rechtfertigung der Militärdiktatur in Por-
tugal«), stellt sich die Frage, in welchen politischen Bahnen
sich Pessoas patriotischer Nationalismus bewegt hat. Doch
empfiehlt es sich, zunächst andere Daten aus dem Leben Pes-
soas bis hin zu jenem Stichtag preiszugeben, an dem die großen
und verbleibenden Heteronyme eine zwingende Gestalt ange-
nommen haben.
Nach der definitiven Rückkehr aus Afrika (1905) bleibt der
schreibende Pessoa der englischen Sprache erst einmal treu. Ein
Projekt, das er nie verwirklicht, das er aber noch unter dem in

83
Durban entstandenen Heteronym Alexander Search ankün-
digt, ist ein Essay über
The Portuguese Regicide and the Politi-
cal Situation in Portugal. In derselben Zeit entstehen ebenfalls
mit ›Alexander Search‹ gezeichnete Erzählungen: Das in die-
sem Band enthaltene
A Very Original Dinner und eine weitere
an Poe orientierte Erzählung
The Door. Ein Literaturstudium,
für das er sich 1906 eingeschrieben hat, bricht er nach einem
Jahr wieder ab. Mit Hilfe einer Erbschaft versucht er, eine
Druckerei auf die Beine zu stellen: »Empresa Ibis — Tipografica
e Editora‹; der Versuch mißlingt. Ab 1908 verdient er sein Brot
— bis an sein Lebensende — als Außenhandelskorrespondent. In
jene Zeit fällt die Lektüre eines Buches, das ihn zutiefst beein-
druckt: Max Nordaus »Entartung«. »In meiner sogenannten
dritten Jugend«, schreibt er rückblickend in einem Brief aus
dem Jahre 1932, »die ich hierin Lissabon verbracht habe, lebte
ich umgeben von griechischen und deutschen Philosophen so-
wie von den französischen ›Decadents‹, deren Wirkung auf
mich jäh hinweggefegt wurde... durch die Lektüre von Max
Nordaus ›Entartung‹.« Bei den erwähnten deutschen Philo-
sophen handelte es sich in erster Linie um Schopenhauer und
Nietzsche.
War zuvor der Einfluß der französischen Symbolisten auf ihn
beträchtlich, so änderte sich mit der Lektüre Nordaus sein Ur-
teil ganz und gar. Pessoa hatte nach seiner Rückkehr aus Afrika
Baudelaire und die französischen Symbolisten gelesen, die
auch die portugiesische Literatur um die Jahrhundertwende
beeinflußt hatten, an der sich Pessoa orientierte (Gomes Leal,
António Nobre, Camilo Pessanha).
Wenn der leicht zu beeindruckende Pessoa die französischen
Symbolisten nun verurteilte, so erreichte er damit in erster Li-
nie den Effekt, seinen eigenen Stil, seine eigene Sprache freizu-
legen, und daran lag ihm sicherlich in jener Zeit, als er begann,
Gedichte in portugiesisch zu schreiben. Kurioserweise er-
scheint eines der wesentlichen Merkmale seiner Sprache, näm-
lich die Vorliebe für das Paradoxe, für Oxymora, für unhalt-
bare Gegensätze und scheinbare Antithesen auch und gerade in
ästhetischen Urteilen und Kommentaren. So findet sich z. B. in
seinen ästhetischen Aufzeichnungen
(Paginas de Estetica, Teo-
ria e Critica Literarias) folgendes Urteil über die eben erwähn-
ten französischen Symbolisten: »Ich frage den größten Schwär-

84
mer für französische Symbolisten, ob Mallarme ihn ebenso be-
rührt wie eine gewöhnliche Melodie, ob die Ausdruckslosig-
keit eines Verlaines je die legitime Ausdruckslosigkeit eines ein-
fachen Walzers erreicht hat. Sie hat es nicht, und wenn man mir
antwortet, man zöge in dieser Hinsicht Verlaine und Mallarme
der Musik vor, so sagt man mir damit, daß man Literatur als
Musik der Musik selber vorzieht. Man sagt also damit etwas,
was keinen Sinn hat, abgesehen davon, daß eine solche Mei-
nung beklagenswert ist.«
In der Zeit nach dem Umsturz (1910) kommt Pessoa in den
Lissaboner Cafés — wie dem »Martinho da Arcada«, dem
»Brasileiro do Chiado« - mit anderen jungen Literaten in Be-
rührung, mit denen er später die Zeitschrift »Orpheu« heraus-
geben wird. Doch vorher (um 1912.) wird er für eine andere
Zeitschrift - »A Águia« - Aufsätze schreiben, die das Organ
einer in Porto entstandenen republikanischen Bewegung mit
dem Namen »Renascença Portuguesa« um den Dichter Tei-
xeira de Pascoaes ist, dem Begründer des »Saudosismo« (abge-
leitet von »Saudade«). Wie in den anderen europäischen Län-
dern jener Zeit löst auch in Portugal ein -ismus den anderen ab,
und Pessoa nimmt mit viel Eifer an den Debatten teil. In einem
seiner in »A Águia« abgedruckten Essays über die neue portu-
giesische Poesie unter psychologischem Aspekt kündigt sich
der für Pessoa — auch sprachlich — so charakteristische Dualis-
mus an: Pessoa spricht, anläßlich der Poesie des »Saudo-
sismo«, von »pantheistischem Transzendentalismus«, welcher
der »Vergeistigung der Materie« und der »Materialisierung des
Geistes« innewohne.
Im selben Aufsatz vollzieht Pessoa noch einmal die Schritte
einer solchen Bewegung, die keineswegs eine bloße Synthese
ist. Er vermerkt, daß die neue poetische Sprache den symboli-
schen »Subjektivismus« überwunden hat, ohne daß der in der
Tendenz vorhandene »Objektivismus« auch schon erreicht sei;
die Verwirklichung eines maximalen Gleichgewichts zwischen
Subjektivität und Objektivität, so Pessoa, würde das Werk
eines »großen, bald zu erwartenden Dichters« sein -, jenes Su-
per-Camões, von dem schon die Rede war und als der sich we-
nig später Pessoa entpuppt. Neue Heteronyme sagen sich an,
besetzen schon einen Sprachraum. Als erster gibt sich Ricardo
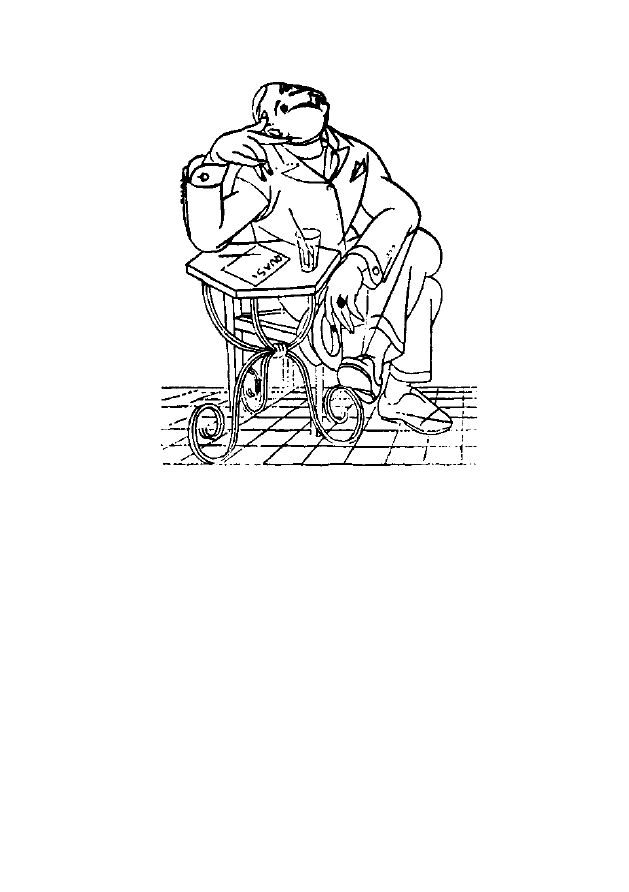
85
Mario de Sá-Carneiro,
Zeichnung von José Almada Negreiros
Reis zu erkennen. Dann, am 5. März 1914, schlägt die große
Stunde. Die Befreiung von der dualen Fessel, die auf ihm lastet
-Natur/Geist, Ich/Nicht-Ich, englisch/portugiesisch, Patriot/
Kosmopolit, Mann/Frau, etc. — hin zu einer offenen Pluralität
wird Wirklichkeit:
».. .ich wollte eines Tages Sá-Carneiro [einer der engsten Dich-
terfreunde Pessoas] einen Streich spielen - einen bukolischen
Dichter von der komplizierten Art erfinden und ihn auf irgend-
eine wirklichkeitsnahe Weise ihm vorstellen, ich weiß nicht
mehr genau wie... An dem Tag, als ich davon wieder Abstand
nahm - es war der 5. März 1914 -, näherte ich mich einer ho-
hen Kommode, nahm ein Blatt Papier und begann zu schrei-
ben, im Stehen, wie immer, wenn es mir möglich ist. Und so

86
schrieb ich mehr als dreißig Gedichte hintereinander, in einer
Ekstase, deren Natur ich nicht zu erklären vermag. Das war ein
Tag des Triumphes in meinem Leben, wie ich ihn nie mehr wie-
der erleben würde. Es begann mit einem Titel, ›O Guardador
de Rebanhos‹ [›Der Hüter der Herden«]. Und was dann folgte,
war die Erscheinung von jemandem in mir, dem ich sofort den
Namen Alberto Caeiro gab. Verzeihen Sie mir das Absurde des
Satzes: in mir war mein Meister zum Vorschein gekommen.
Das war die unmittelbare Empfindung, die ich hatte...
Jetzt, da Alberto Caeiro zum Vorschein gekommen war, ver-
suchte ich gleich, instinktiv und unterbewußt, Schüler für ihn
zu finden. Ich entriß den latent vorhandenen Ricardo Reis sei-
nem falschen Heidentum und gab ihm einen Namen, der zu
ihm paßte, denn in jenem Augenblick sah ich ihn schon vor mir.
Dann plötzlich tauchte aus einer Ricardo Reis entgegengesetz-
ten Abzweigung jäh ein neues Individuum auf. An der Schreib-
maschine entstand in einem Wurf ohne Unterbrechung oder
Verbesserung die
Ode Triumfal von Alvaro de Campos — ent-
standen also die Ode mit diesem Titel und der Mann mit dem
Namen, den er trägt.«
In dieser Geburtsstunde, möchte man sagen, ist Fernando Pes-
soa zu sich selber gekommen - und zu einer Familie. Fortan
stellt sich ein frauenloses Familienleben ein, eine literarische
Mönchsgemeinschaft, weitere Mitglieder werden aufgenom-
men — Bernardo Soares, der Hilfsbuchhalter, z. B., der den
Rang eines »Halbbruders« von Pessoa einnimmt (»Mein Halb-
heteronym Bernardo Soares, der übrigens in vielen Punkten Al-
varo de Campos ähnelt, er erscheint immer, wenn ich müde bin
oder vor mich hindämmere...«). Der eine nimmt Anteil am
Leben des anderen, an seinen Dichtungen und ästhetischen
Auffassungen, und nichts Bewegenderes als die Trauer Alvaro
de Campos über den Tod seines Meisters in den
Notizen zum
Gedächtnis meines Meisters Caeiro:
»Jedenfalls gehörte es zu den Ängsten meines Lebens — zu den
realen Ängsten unter so vielen fiktiven -, Caeiro könnte ster-
ben und ich wäre nicht bei ihm. Das ist dumm, aber mensch-
lich, das ist nun mal so. ...Ich war in England, Ricardo Reis
seinerseits war auch nicht in Lissabon, er war nach Brasilien

87
zurückgekehrt. Fernando Pessoa war wohl da, doch das ist ge-
nau so, als ob er nicht dagewesen wäre. Fernando Pessoa emp-
findet zwar die Dinge, aber nichts rührt sich, nicht einmal
innerlich.«
Sein-Nichtsein, Wirklichkeit-Fiktion: Pessoa hob in seiner
Dichtung dieses »Entweder-oder« (aut-aut) auf in ein dem gan-
zen All sich öffnendes »mehr« (et-et) und begab sich dennoch
immer wieder zurück in das irdische alltägliche Entweder-oder,
Ja-aber, in die Beschränktheit seiner Existenz als Außenhan-
delskorrespondent in Lissabon, einer Stadt, die sich dem Meer
öffnet, die Pessoa aber nach jenem sagenhaften 5. März 1914
nicht mehr verließ. Er richtete sich mit den Heteronymen im
Kopf und auf dem Papier in friedlicher Koexistenz ein, ließ sie
allenfalls untereinander über Fragen der Poesie streiten; mag
sein, daß er sonst wirklich verrückt geworden wäre (wie seine
Großmutter), und davor hatte er Angst, eine reale und nicht
fiktive Angst, die er an sich schon als Wahnsinn empfand.
Entsprechend seiner Vorliebe für stellare Konstellationen
fertigte er für jedes seiner Heteronyme Horoskope an, für die er
jeweils ein Geburtsdatum und einen Geburtsort (er)-finden
mußte. Auf diese Weise kam jedes Heteronym zu seiner Biogra-
phie, zu seiner »Existenz«.
So erblickte Alberto Caeiro am 16. April 1889 um 13.45 Uhr
das Licht der Welt, er starb 1915 in Lissabon, hielt sich aber zu
Lebzeiten nur auf dem Land auf. Caeiro wurde von den zwei
anderen großen Heteronymen als Meister anerkannt. Als
Dichter der Natur verkörpert er den »Objektivismus«, in dem
die Empfindungen so beschrieben werden wie sie sind, ohne
daß die Sprache »einen Gang zwischen den Worten und den
Gedanken« benötigte.
Ricardo Reis ist ein Jahr älter als Pessoa. Er wird von Jesui-
ten erzogen und erhält eine klassische Ausbildung, entspre-
chend vertritt er eine klassizistische, u. a. an Horaz geschulte
Sprache. Von Beruf ist er Arzt. Mit de Campos diskutiert er
über Rhythmus und Versmaß, und beide ziehen jeweils unter-
schiedliche Lehren aus der vorbildlichen Dichtung ihres Mei-
sters. Weil er Monarchist ist, begibt sich Reis 1919 ins Exil.
Alvaro de Campos, der jüngste von allen, geboren am
15.10.1890 in Tavira (Algarve), erinnert äußerlich »vage an

88
den Typen eines portugiesischen Juden«; er läßt sich in Glas-
gow zum Ingenieur ausbilden, unternimmt eine Reise in den
Orient und kehrt dann nach London zurück. Pessoa kenn-
zeichnete Campos als »einen Whitman, der einen griechischen
Dichter in sich hat«, und über die von de Campos verfaßte
Ode
Maritima sagte Pessoa, es habe »kein deutsches Regiment je-
mals die innere Disziplin besessen, die dieser Komposition zu-
grunde liegt«.
Alles in allem verkörpern die drei jeweils eine zeitgenössische
Ausrichtung der portugiesischen Literatur: Caeiro den »Sensa-
tionismus«, Reis den Klassizismus, de Campos den Futurismus
und später—wie Soares auf seine Weise—einen Existentialismus
avant la lettre. Pessoa und vor allem A. de Campos tauchen in
zahlreichen Zeitschriften in den zehner und zwanziger Jahren
auf. Von der Zeitschrift »Orpheu«, die viel Aufsehen erregte
und Polemiken auslöste, erscheinen nur zwei Nummern
(1915), die zweite wird von Pessoa zusammen mit Mario de Sá-
Carneiro herausgegeben. Hervorgehoben seien hier noch die
einzige Nummer von »Portugal Futurista« (1917) mit Gedich-
ten von Pessoa und dem heftigen
Ultimatum von de Campos
(»...zieht vorbei Nationen, damit ich euch verachten kann!
...Dich, deutsche Kultur, du verfaultes Sparta mit deinem Öl
aus Christentum und Essig aus Vernietzschung, du Bienenkorb
aus Blech, imperialoider Erguß aus verklammerter knechti-
scher Gesinnung...«) und schließlich die erste Nummer der
Zeitschrift »Contemporanea« (Mai 1922), in welcher O
Ban-
queiro anarquista (geschrieben im Januar 1922.) erscheint.
Pessoa hält sich zunehmend aus den geschäftigen und lauten
Kunstdebatten heraus, schickt Alvaro de Campos vor, so für
»das futuristische Portugal«, so auch um befreundete Schrift-
steller (Raul Leal, António Botto) gegen reaktionäre Attacken
und staatliche Zensur zu verteidigen (1923). Hingegen be-
schäftigt sich Pessoa, der nie einen Hehl aus seinen okkulten
Neigungen gemacht hat, mit Esoterik, dem Studium der Alchi-
mie, der Rosenkreuzer und des Freimaurertums. Ein Obsku-
rant ist er dennoch nie gewesen, ein Mythomane vielleicht,
Mystiker vielleicht auch und Stoiker. Doch was heißt das alles
bei einem, der dank seiner vielen Facetten für kein Dogma
tauglich ist und sich in keinem Spiegel erkennt, der in einen
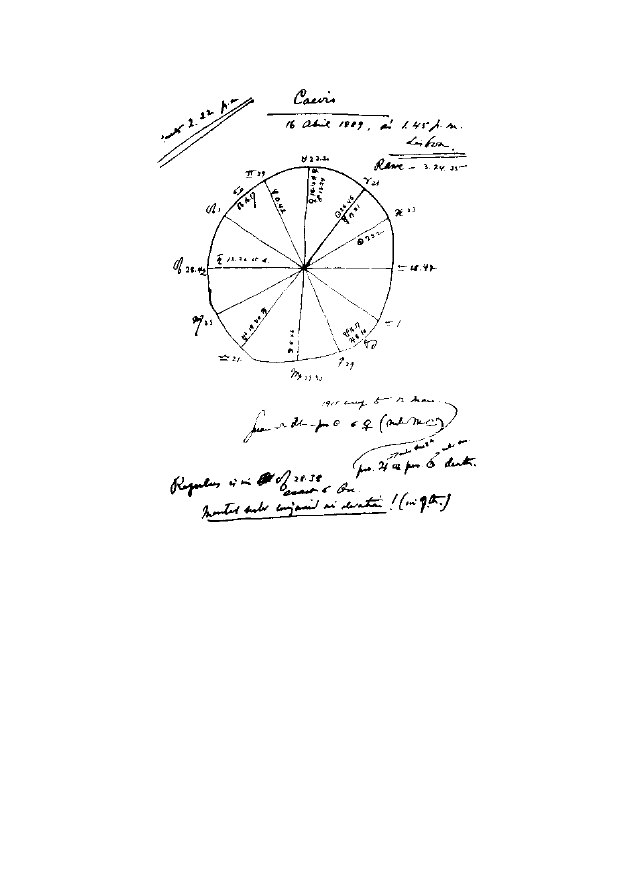
89
Von Pessoa ausgestelltes Horoskop
für sein Heteronym Alberto Caeiro
dunklen Humor versinkt, aus dem ihn seine Heteronyme em-
porziehen?
Seine kleinen Vorlieben, Geheimnisse - waren es
seine': - es
waren Nichtigkeiten, hätte Pessoa, hätte Alvaro de Campos
geantwortet. In einem Gedicht, das
Autopsicografia über-
schrieben ist, sagt Pessoa: »Der Dichter ist ein Vortäuscher. / Er
täuscht so vollendet vor, / daß er schließlich vortäuscht,
Schmerz / sei der Schmerz, den er wirklich spürt.«

90
Ein anarchistischer Bankier zeugt davon, daß Pessoa auch Fi-
guren vortäuschen konnte. Aber hinter dem unaufhörlich de-
duzierenden und dozierenden Bankier verbirgt sich auch Pes-
soa selbst, ein Teil von ihm. Das
Spiel mit den Gesetzen der
Logik lag ihm ohne weiteres, und nur insofern er mit
diesen
Gesetzen spielte, hatte er etwas von einem Anarchisten an sich.
Der radikale Egoismus des Bankiers entspricht Pessoas radi-
kalem (pluralisierten) Individualismus, aus dem die Forderung
nach der Unantastbarkeit individueller Freiheit spricht — in
weltanschaulichen, religiösen, sexuellen, ja auch in nichtssa-
genden Angelegenheiten. Nichts war ihm wohl verhaßter, als
die Selbstgefälligkeit und Selbstgerechtigkeit von Mehrheiten,
die sich mit Individuen anlegten und die ihren Konsens so
wortgewaltig wie zahlenmäßig ausspielten: viele gegen einen.
In solchen Fällen schritt er ein - wie im Fall Leal/Botta -, ris-
kierte er wortgewaltig den Eklat.
Dummheit bestand für ihn darin, die Spannung von Gegen-
sätzen, von Anderssein nicht aushaken zu können. Wie hätte es
auch anders sein können bei jemand, der Gegensätze, Gegen-
setzungen erzeugte und mit ihnen, den Heteronymen, lebte?
Der Rest, die zeitpolitischen Äußerungen, war mutterländi-
sches Engagement, durchaus im Bewußtsein möglichen Ver-
blendetseins und mit der Bereitschaft, Licht auch woanders zu
orten.
Radikaler (aber schauerlich bestrafter) Egoismus auch im
zweiten Text dieses Bandes:
Ein ganz ausgefallenes Abend-
essen in Preußen Anfang des Jahrhunderts, betrachtet von
Durban/Lissabon aus, von Alexander Search alias Fernando
Pessoa: kein Prosit der Gemütlichkeit, vielmehr Mord und Tot-
schlag und Anthropophagie. Die Umkehrung aller Werte, die
Nietzsche am Ende des neunzehnten Jahrhunderts proklamiert
hatte — hier wird sie im Kopf des einundzwanzigjährigen Pes-
soa nachvollzogen, indem sie ganz einfach einer Verkehrung
der Verhältnisse zugeführt wird. In englischer Sprache entwirft
er als Alexander Search — eines seiner frühesten Heteronyme —
eine Schauergeschichte, deren Schauplatz Berlin ist - ein imagi-
näres Berlin, weil sich die deutschen Lande so gut den Visionen
schwarzer Romantik anpassen, und weil manchem Europäer
am Ende des letzten Jahrhunderts Berlin als Destillat alles
Deutschen vorkommen mochte.

91
So genügte es Pessoa, diesem Destillat bestimmte Essenzen
hinzuzufügen, die alle dem deutschen oder preußischen Boden
entstammen, um seiner Schauergeschichte das eine, entsetz-
liche Lokalkolorit zu verschaffen, auf das jedes Ent-Setzen,
jedes Un-Heimliche angewiesen ist: Schopenhauer wird als
Meister zitiert, Kleist taucht auf als namentlicher Nachklang
zwischen Berlin und Frankfurt (Oder?) und der Erzähler,
der weitgehend anonym bleibt, trägt einen der anonymsten
deutschen Namen: Meyer—oder Meier oder Maier oder Mayer.
Und ausgerechnet in dem protestantisch-preußischen, eis-
beinversessenen Berlin soll sich eine »Gastronomische Gesell-
schaft« Anfang dieses Jahrhunderts der
Kunst des Kulinari-
schen verschrieben haben. Daß Pessoa Kleist als Anthropologen
mit in die Geschichte hineingezogen hat, liegt wahrscheinlich an
der — unter furchterregenden, aufständischen Schwarzen auf
Haiti spielenden - › Verlobung in Santo Domingo‹, und der Rest
könnte ›Penthesilea‹ sein. Hinter Prosit verbirgt sich jenes Bild,
das sich Pessoa von Nietzsche gemacht haben dürfte, über den
es in einem Fragment heißt: »Sein Temperament war das eines
Asketen und eines Wahnsinnigen.« Nietzsches Proklamation
der Umkehrung aller Werte nahm er literarisch beim Wort,
nicht nur im Hinblick auf den »Übermenschen« Prosit. Pessoa
zeigt, daß der Mensch ist, was er ißt, und daß er seinesgleichen
frißt, auch wenn er es nicht weiß oder nicht wahrhaben will.
Die Symbolik der Verkehrung schließt auch ein, daß der weiße
Herr nicht weiß, was er, der Kolonialherr, verzehrt, wo doch
die Kolonisierten immerhin wußten, daß sie ihresgleichen ver-
zehrten, wenn sie es denn im Rahmen ganz bestimmter Ri-
tuale überhaupt taten; daß der Weiße nicht wissen wollte, daß
er mit seinen kolonialen Unternehmungen die Schwarzen bis
aufs Blut aussaugte,
wie man so sagt, wo ihm doch seine reli-
giösen und ethischen Überzeugungen dieses Wissen hätten
einbleuen müssen.
Der Schein trügt, wenn es ums Essen geht; das stellt auch
schon der Übermensch »Herr Prosit« fest, wenn er die vergeb-
lichen Versuche der Mitglieder kommentiert, Licht ins Dunkel
zu bringen, wie es so schön heißt. Eben diese abendländische
Metapher wird in ihrer Aussage verkehrt. Denn wenn am Ende
der Geschichte die wahre Substanz des Verspeisten ans Licht
kommt, werden aus denen, die nach ihm gesucht haben, fin-

92
stere Gesellen, die — umnachtet — einen Menschen opfern, eben
den Übermenschen »Herrn Prosit«.
Die Wissenschaft ihrerseits, um Licht ins Dunkel zu bringen,
hat im neunzehnten Jahrhundert, als Anthropologie ausgewie-
sen, damit begonnen, sich Gedanken über das Opfern und
auch das Verspeisen von Menschen zu machen. Es scheint, daß
die Nebenbeiforscher, die Missionare, sich sentimentaler mit
diesem Phänomen befaßt haben als die eigentlichen Forscher,
die nicht umhinkonnten, ihre Furcht vor diesem Phänomen in
verurteilende Phrasen zu kleiden, wobei ihnen oft der wahre
Charakter des Kannibalismus entgehen mußte, daß es sich
nämlich nicht um nackten Hunger oder wilde Fleischeslust,
sondern um ein symbolisches Ritual handelte, in welches im-
mer schon das fleischgewordene Wort involviert war. Die vor-
liegende Erzählung ist meines Wissens nie im Original, auf
Englisch, veröffentlicht worden. Es hat zwei portugiesische
Ausgaben gegeben, die letzte — ohne Jahresangabe — ist unter
dem Titel ›Um jantar muito original in der Reihe
Crime imper-
feito erschienen. Es gibt — wie Pessoa-Kenner wissen — vieles,
das der große portugiesische Dichter lieber vorzugsweise in
englischer Sprache verfaßte, so auch das eindeutig an Poe
orientierte ›A very original dinner‹. Der amerikanische Dichter
als großes Vorbild Pessoas in jungen Jahren wird auch au s-
schlaggebend gewesen sein für den Impuls, eine
Groteske auf
Englisch zu schreiben. Poe nannte »grotesk« ein Werk, in dem
»ein burleskes oder satirisches Moment vorherrscht« (K. Schu-
mann u. H. D. Müller im Vorwort zum ersten Band von Das
gesamte Werk in zehn Bänden S. 9, M. Pawlak Verlagsgesell-
schaft, Herrsching 1979). Eine solche
Groteske in Poes Werk
ist die Erzählung ›Du bist der Mann‹ (›Thou are the Man‹), das
einer Studie von Maria Leonor Machado de Sousa zufolge, der
Übersetzerin des vorliegenden Alexander-Search-Textes ins
Portugiesische, Parallelen zu ›A very original dinner‹ aufweist.
Merkwürdige, in keinem englischen Wörterbuch auffind-
bare, dennoch eindeutig englische Wortbildungen wie »invi-
tal« anstelle von »invitation« markieren hier und da Pessoas
Text. Südafrikanismen und/oder Lusitanismen sind nicht aus-
zuschließen bei einem, der einen Teil seiner Kindheit und Ju-
gend in Durban und englischsprachigen Schulen verbracht hat
und 1903 — sechs Jahre bevor er, einundzwanzigjährig, seine
.

93
Berliner Schauergeschichte schrieb - den ›Queen Victoria Me-
morial Prize‹ für ausgezeichneten Stil in der englischen Sprache
errungen hat. Das Manuskript von Pessoas Hand, gezeichnet
»Alexander Search —June 1909«, befindet sich in der Natio-
nalbibliothek von Lissabon. Eine oder zwei unlesbare Stellen
sind in der deutschen Fassung durch Auslassungspunkte ge-
kennzeichnet.
Am 19.November 1935 starb Fernando Pessoa an einer Le-
berkolik. Vor seinem Tod kritzelte er auf ein Blatt Papier die
Worte:
»I know not what tomorrow will bring.« Zu seinen Plänen
gehörte unter anderem eine erweiterte, englische Version des
»anarchistischen Bankiers«, an der er arbeitete; wie er in dem
erwähnten Brief an Adolfo Casais Monteiro schrieb, rechnete
er sich damit gute Chancen beim europäischen Lesepublikum
aus, fügte aber dann (schmunzelnd?) hinzu: »Verstehen Sie die-
sen Satz nicht so, als stünde ein Nobelpreis ins Haus!«
Den Neophyten, den Eingeweihten, hatte er, der sich selbst
als »Ein Trugbild seiner selbst« bezeichnete (im
Buch der Un-
ruhe), in dem orthonymen Gedicht Iniciaciao Unsterblichkeit
bescheinigt: ».. .nao ha morte« (es gibt keinen Tod). Natürlich
machte er sich nichts vor: Im selben Gedicht lautet eine Stro-
phe:
»Kommt eine Nacht, ist der Tod
Geht der Schatten hinüber, was war er?
Du, nur ein Umriß, dein eigenes Gleichnis,
Gehst in die Nacht, egal, sowieso.«

94
»Eine verspielte Reihe mit kleinen Kostbarkeiten — wer
anspruchsvollen
Leuten
ein
anspruchsvolles
Buchmitbringsel überreichen will, der liegt hier richtig.«
ALFRED MARQUARDT IM SÜDDEUTSCHEN RUNDFUNK
CARLO EMILIO GADDA
Cupido im Hause Brocchi
Gigi, ansehnlicher und behüteter Sproß einer Mailänder Patrizierfamilie,
bekommt was er will, obwohl er zunächst gar nicht weiß, daß er es will:
die Liebe in Gestalt eines Dienstmädchens...
»Eine witzige, sprühende Kostbarkeit.«
Wolfram Schütte, Frankfurter Rundschau
ARBASINO, CALVINO, CERONETTI,
MALERBA, ECO, SANGUINETI, SCIASCIA, MANGANELLI
Unmögliche Interviews
Italienische Schriftsteller nehmen Personen unter die Lupe,
mit denen sie schon immer einmal reden wollten und verraten
so auch ihre eigenen Vorlieben und geheimen Obsessionen.
»Schmuckstücke voller Witz und Esprit.« Live
STEPHAN HERMLIN
Abendlicht
Hermlin, der große Schriftsteller der DDR, erinnert sich an die 3oer Jahre.
Ein glänzend geschriebenes Portrait deutscher Irrungen,
das uns unsere jüngste Geschichte in absurden, bitteren und
außergewöhnlichen Bildern erzählt.
»Die Reinheit dieser Prosa ist fast vergleichslos, seit Eich tot ist.«
Hans Mayer
ALEXANDER KLUGE
Fontane, Kleist und Anna Wilde
Zur Gr a mmatik der Zeit
»Diese in der bestechend schön ausgestatteten SALTO-Reihe
erscheinenden Texte bilden ein Kernstück von Kluges Werk.«
Neue Zürcher Zeitung
DJUNA BARNES
Paris, Joyce, Paris
Die schönsten Texte von Djuna Barnes über Paris und James Joyce,
mit vielen Fotos aus dem aufregenden Paris der 20er Jahre.
SALTO
Rotes Leinen.
96 Seiten, zum Teil mit Abbildungen, DM 19.80

95
Lesen Sie mal
Spanische Reise
Ein literarischer Führer durch das heutige Spanien
»Ein gelungener Reiseführer, unentbehrlicher
als der Baedeker.« Göttinger Woche
Quartheft 155. 192 Seiten, DM 19.80
JA VIER TOMEO
Der Löwenjäger
Der neue Roman Tomeos: ein langes Telefonat
über die Unmöglichkeit der Liebe.
Quartheft 156. uz Seiten, DM 16.80
(April 1 9 8 8 )
CARLO EMILIO GADDA
List und Tücke
Die wichtigsten Erzählungen des -Vaters der modernen
italienischen Literatur‹ zum erstenmal auf deutsch.
Quartheft 134. 144 Seiten, DM 19.80
(Mai
J
BORIS VIAN
Der Herzausreißer
Erwachsene Monster, fliegende Kinder, Männer, die von Schiffen,
Frauen, die von Mauern träumen, ein eiliger Psychiater -
der Roman eines respektlosen Klassikers.
Wagenbachs Taschenbücherei 158. i9z Seiten, DM 16.50
OLIVER LAWSOK DICK
Das Leben: ein Versuch
John Aubrey und sein Jahrhundert
Ober das Leben eines gelehrten und sehr neugierigen
Exzentrikers im England des 17. Jahrhunderts.
Englische Broschur. 191 Seiten mit vielen
zeitgenössischen Abbildungen, DM 29.80
EDITH SITWELL
Englische Exzentriker
Galerie höchst merkwürdiger und bemerkenswerter Damen und Herren
»Man sollte das Buch wie eine kostbare Torte behandeln - nur zu
besonderen Anlässen ein Stück.« TIP
Englische Broschur, 176 Seiten mit vielen
zeitgenössischen Abbildungen, DM 2.9.80
DJUNA BARNES
New York
Geschichten und Bilder aus einer Metropole
»Die Geschichten sind meisterhaft erzählt, Djuna Barnes ist eine
phantastische Schriftstellerin. Das Buch ist schön ausgestattet - die Fotos
sind eine Lust.« Frankfurter Allgemeine Zeitung
Englische Broschur, 192 Seiten mit vielen Fotos, DM 29.80

96
Ein anarchistischer Bankier
Ein ganz ausgefallenes Abendessen
erschien als sechster SALTO im April 1988
Der Umschlag verwendet das Bild
Fernando Pessoa Heteronimo von Costa Pinheiro
mit freundlicher Genehmigung des Centro de Arte Moderna
da Fondacao Calouste Gulbenkian, Lissabon
Gesamtherstellung durch Clausen &T Bosse in Leck
Gesetzt aus der Borgis Sabon Antiqua
Leinen von Hubert Herzog, Dornstadt
Printed in Germany. Alle Rechte vorbehalten
ISBN
3 80311106 6
Document Outline
- page1
- page2
- page3
- page4
- page5
- page6
- page7
- page8
- page9
- page10
- page11
- page12
- page13
- page14
- page15
- page16
- page17
- page18
- page19
- page20
- page21
- page22
- page23
- page24
- page25
- page26
- page27
- page28
- page29
- page30
- page31
- page32
- page33
- page34
- page35
- page36
- page37
- page38
- page39
- page40
- page41
- page42
- page43
- page44
- page45
- page46
- page47
- page48
- page49
- page50
- page51
- page52
- page53
- page54
- page55
- page56
- page57
- page58
- page59
- page60
- page61
- page62
- page63
- page64
- page65
- page66
- page67
- page68
- page69
- page70
- page71
- page72
- page73
- page74
- page75
- page76
- page77
- page78
- page79
- page80
- page81
- page82
- page83
- page84
- page85
- page86
- page87
- page88
- page89
- page90
- page91
- page92
- page93
- page94
- page95
- page96
- page97
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Administrando Pessoas Fernando Antonio da Silva
35 Sonnets by Fernando Pessoa
Największy szwindel bankierów
Ein lab
Ein schwerer Fehler
Ein Schweizer Rezept FONDUE
138318439 The Anarcho Positivist Perspective
Interpretacja wymagań normy ISO, SONS OF ANARCHY SEZON 5, domy pasywne, zarządzanie jakością
Libia pogrążyła się w anarchii, Ideologie totalitarne
Jak żydowscy bankierzy z USA wypromowali Adolfa Hitlera
WPB, współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
Ein altchinesisches Rezept
Was ist ein Text
Anarchist Cookbook
zyczenia weihnachten, Ich Fröhes Weihnachten, viel Gesund, Erfolg und ein glückliches Neues Jahr
Lade deine Freunde zur Geburtstagsparty ein, Lade deine Freunde zur Geburtstagsparty ein
BFG w praktyce (bankier pl)
06-Bankierzy, J. Kaczmarski - teksty i akordy
więcej podobnych podstron