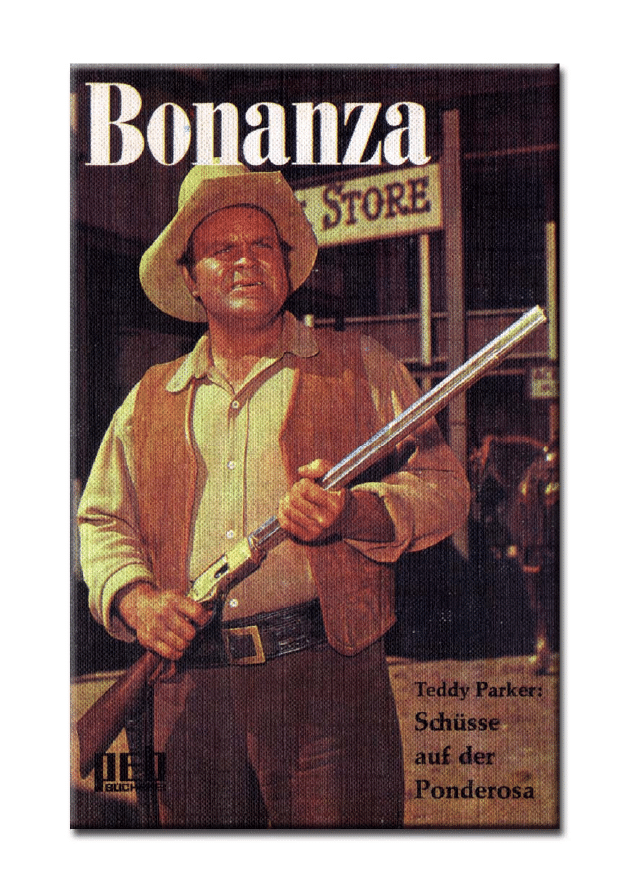

Teddy Parker
Schüsse auf der Ponderosa
Bonanza
Band 4
Engelbert-Verlag • Balve/Westf.

Verlags-Nr. 701
1. Auflage 1969
Illustrationen: Werner Kulle
Textauswahl: Kurt Vethake
(c) 1969 by National Broadcasting Company, Inc.
Alle Rechte vorbehalten
Veröffentlicht mit Genehmigung von
Western Publishing Company, Inc. Wisconsin, USA
Alle Rechte der deutschen Buchausgabe
1969 by Engelbert-Verlag, Balve
Nachdruck verboten – Printed in Germany
Satz, Druck und Einband: Gebr. Zimmermann,
Buchdruckerei und Verlag GmbH, Balve/Westf.

Eine Kampfansage
Die Möwen, die über dem Tahoe-See kreisten, blitzten im
Sonnenlicht. Ein Schwarm Pelikane schaukelte auf den blauen
Wellen und flog aufgeschreckt hoch, als zwei Reiter am Ufer
entlanggebraust kamen.
Der See lag am Rande grüner Hügel, auf denen schwarze,
windzerzauste Douglastannen wuchsen. An der einen Seite
erhob sich das Bergland mit zerklüfteten Hängen, an der
anderen dehnte sich bis zu den fernen, blauen Bergen eine
weite braune Ebene, ein riesiges, baumloses Weideland. Dort
grasten die Rinderherden der großen Ranches.
Die beiden Reiter trieben ihre Pferde zur Eile an, Staub wallte
unter den stampfenden Hufen auf, während sie nebeneinander
am Fuße der Hügel dahingaloppierten.
Ben Cartwright und sein jüngster Sohn hatten sich lange bei
der Herde aufgehalten, zu lange, um noch pünktlich zum
Mittagessen auf die Ponderosa-Ranch zu kommen.
Die Sonne, die sengend auf den See und das Grasland
brannte, hatte längst den Zenit überschritten. Die Schatten der
Tannen wurden bereits wieder länger.
Little Joe dachte an Hop Sing, ihren chinesischen Koch, der
wieder laut jammern würde, weil er das gute Essen aufwärmen
mußte. Little Joe dachte auch daran, daß sein Bruder Hoss
sicher vor Hunger schon Höllenqualen litt. Dieser Gedanke
entlockte ihm ein Lächeln.
Plötzlich schreckte Little Joe auf. Vor ihm hatte sich etwas
bewegt. Sofort zügelte er sein Pferd, richtete sich im Sattel auf
und musterte prüfend seine Umgebung.

Ungefähr hundert Yards entfernt, dicht neben einer einsamen
Kiefer, die ihre knorrigen Äste trotzig reckte, war ein Cowboy
damit beschäftigt, das Land zu vermessen. Er war groß und
schlank und etwa ebenso alt wie Little Joe.
„Nanu!“ wunderte sich der jüngste Cartwright. „Was macht
denn Ted dort?“
„Sieht so aus, als wollte McKarens Sohn sein Land neu
vermessen“, stellte Ben Cartwright fest, nachdem er sein Pferd
ebenfalls gezügelt hatte.
„Warum tut er das?“ fragte Joe.
„Keine Ahnung!“ Sein Vater zuckte die Achseln.
Die Einwanderer hatten das Land unter sich aufgeteilt, gleich
nachdem sie hier seßhaft geworden waren. Einige hatten ihren
Anteil später wieder verkauft, andere ein Stück Land dazu
erworben. So waren im Laufe der Zeit unterschiedlich große
Besitzungen entstanden. Nicht alle hatten so klug
gewirtschaftet wie die Cartwrights, die heute zu den reichsten
Familien im Lande gehörten mit dem größten Grundbesitz und
der größten Herde.
„Am besten fragen wir Ted“, schlug Joe vor. „Bin schon jetzt
auf seine Antwort gespannt!“
„Gut!“ nickte Ben Cartwright. „Fragen wir ihn!“
Sie ritten im Trab auf den jungen Cowboy zu, der ganz in
seine Arbeit vertieft war. Als er die Reiter endlich bemerkte,
verfinsterte sich seine Miene.
„Hallo – Ted!“ begrüßte ihn Joe. „Eine schöne Beschäftigung
hast du dir da ausgesucht!“
„Hör zu, Joe!“ Nichts in Teds Stimme erinnerte daran, daß er
einmal mit Joe die gleiche Schulbank gedrückt hatte. „Ich habe
nichts anderes von euch erwartet! Ich wußte, daß ihr eure Nase
da hineinstecken würdet! Zum Glück kann ich auf unserem
Land machen, was ich will!“

„Schon gut, Ted!“ beschwichtigte ihn Ben Cartwright.
„Niemand will dir dieses Recht streitig machen! Wir wundern
uns nur! Schließlich liegen die Grenzen zwischen unseren
Weiden seit vielen Jahren fest!“
„Das ist wahr!“ gab Ted zu. „Ich hätte mir die Arbeit auch
gern erspart. Das können Sie mir glauben, Mr. Cartwright!
Aber unser Käufer verlangt, daß wir das Land neu vermessen!“
„Euer Käufer?“ Ben Cartwright war überrascht. „Dein Vater
will verkaufen?“
„Ich!“ belehrte ihn Ted. „Ich will verkaufen. Nicht mein
Vater! Und zwar an Len Keith!“
„An Len Keith?“ staunte Joe. „Der kauft doch nur Land, wo
er Silber vermutet.“
„Na und?“ Ted lächelte geheimnisvoll. „Wer sagt, daß es bei
uns kein Silber gibt?“
Seit man in einem Berg in der Nähe von Virginia City Silber
gefunden hatte, wurde überall im Carson Valley nach dem
Edelmetall gesucht.
Im Laufe der Zeit waren lange Stollen in den Berg getrieben
worden. Zum Abstützen hatte man das gesamte Holz aus der
Umgebung verbraucht, so daß die Virginia Railroad Company
neue Baumstämme aus abgelegenen Gegenden herbeischaffen
mußte.
Nur wenige beuteten ihren Claim selbst aus, die meisten
verkauften ihn, sobald sie auf Silber gestoßen waren. Len
Keith war einer der Männer, die diese Silberminen aufkauften,
natürlich nur, wenn er sich einen Gewinn davon versprach.
„Das geht nicht“, sagte Ben Cartwright. „Du kannst euer
Land nicht an Len Keith verkaufen!“
„So?“ fragte Ted. „Und warum nicht?“
„Dein Vater und ich haben einen Vertrag“, erinnerte ihn Ben
Cartwright, „und zwar wegen des Flusses, der durch unser
Weideland fließt!“

Das Carson Valley lag mitten im Großen Becken, das von,
den Blauen Bergen im Norden bis zu dem roten Boden der
Sonora-Wüste im Süden reichte, zwischen der Sierra Nevada
im Westen und der Prärie im Osten. Dieses Land eignete sich
nicht für den Ackerbau, sondern nur zur Viehzucht.
Auch die Rinder, die mit den Einwanderern ins Land
gekommen waren, durften nicht immer an der gleichen Stelle
grasen. Die Herden mußten ständig weiterziehen. Sonst wäre
das dürre Grasland bald verdorrt und ebenfalls zur Wüste
geworden.
Die Rinder aber brauchten Wasser – und große Herden
brauchten sehr viel Wasser. Die meisten Seen waren zu
salzhaltig, als daß sie als Tränke hätten benutzt werden
können. Also blieben nur die Flüsse.
„Wenn Len Keith auf eurer Weide eine Silbermine errichtet
und später seine Abwässer in den Fluß leitet, wird mein bestes
Land vergiftet“, erklärte Ben Cartwright. „Außerdem würde
meinen Rindern dann die Tränke fehlen!“
„Tut mir leid, Mr. Cartwright!“ Teds Stimme strafte seine
Worte Lügen. Offenbar freute es ihn, den mächtigen
Cartwrights eine Abfuhr zu erteilen. Er hatte schon lange auf
diese Gelegenheit gewartet. „Falls Len Keith seine Abwässer
tatsächlich in den Fluß leitet, haben Sie eben Pech gehabt!“
„Rede nicht so mit meinem Vater!“ Joe glitt vom Pferd und
stürzte sich wütend auf den Jugendfreund.
„Rühr mich nicht an!“ rief Ted, der erschrocken zurückwich.
„Warte!“ sagte Joe. „Wir beide sind noch nicht fertig
miteinander!“
„Natürlich!“ schrie Ted, außer sich vor Wut. „Hier darf nichts
geschehen, ohne daß die Cartwrights vorher ihren Segen dazu
gegeben haben. Wehe, wenn nicht alle nach eurer Pfeife
tanzen! Seit zwanzig Jahren spielt ihr euch hier wie die
Herrscher auf!“

„Das ist nicht wahr!“ protestierte Joe. „Das ist eine gemeine
Lüge! Auf der Stelle nimmst du das zurück!“
„Ich denke nicht daran!“ brüllte Ted. „Nichts nehme ich
zurück. Kein einziges Wort! Es wird höchste Zeit, daß euch
mal einer die Meinung sagt!“
„Okay!“ rief Joe. „Du hast es nicht anders gewollt!“
„Faß mich nicht an!“ warnte ihn Ted.
„Hört auf, Jungs!“ befahl Ben Cartwright.
Joe und Ted starrten sich feindselig an.
„Ich werde die Sache mit deinem Vater regeln“, versprach
Ben Cartwright.
„Da gibt’s nichts mehr zu regeln, Mr. Cartwright“, erklärte
Ted mit Nachdruck. „Der Verkauf ist so gut wie perfekt!“
Auf einen Wink seines Vaters schwang sich Joe wieder in
den Sattel. Dann ritten sie davon. Im Galopp ging es nach
Hause, zur Ponderosa…

Hoss kommt auf den Hund
„Na endlich!“ Hoss atmete erlöst auf, als sein Vater und sein
Bruder wohlbehalten zurückkehrten. Er hatte sich bereits
Sorgen gemacht. „Warum kommt ihr so spät?“
„Wir haben uns zu lange bei der Herde aufgehalten“, erklärte
Ben Cartwright, während er seinen Stetson an den Haken
hängte.
„Außerdem haben wir uns noch eine Weile mit Ted McKaren
unterhalten“, ergänzte Joe.
Hoss machte ein verklärtes Gesicht.
„Ihr habt ein tolles Mittagessen verpaßt“, sagte er.
Joe blickte ihn mitleidig an.
„Wie traurig, daß du alles allein aufessen mußtest“, stellte er
spöttisch fest.
„Woher weißt du das?“ Hoss starrte ihn verblüfft an.
Hop Sing erschien jammernd in der Küchentür.
„Oh, Mastel!“ rief er mit heller, singender Stimme. „Walum
kommen so spät zulück? Ahnes Hop Sing müssen kochen jetzt
alles noch einmal! Schade um Essen, das Hop Sing gekocht
flühel! El nicht können längel walm halten!“ Wie alle
Chinesen sprach er statt des für ihn unaussprechlichen R ein L.
Joe grinste frech.
„Wie ich Hoss kenne, hat er nichts verderben lassen“,
vermutete er.
„Das stimmt!“ gab Hoss zu. „Wäre wirklich schade gewesen
um das gute Essen! Schöne goldgelbe knusprige Eierkuchen
mit Pflaumenmus! Falls ihr euch etwas darunter vorstellen
könnt…?“ Noch bei der Erinnerung daran schien ihm das
Wasser im Munde zusammenzulaufen.
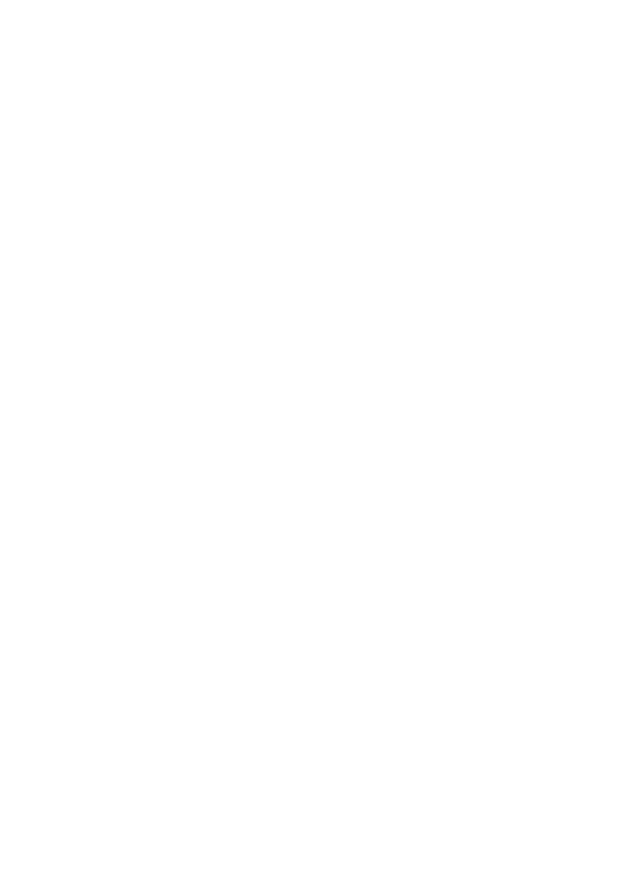
„Oh, Mastel, ich sein untlöstlich!“ versicherte Hop Sing unter
zahlreichen Verbeugungen. „Mastel müssen walten halbe
Stunde. Dann neues Essen sein feltig!“ Er verschwand eilig in
der Küche.
„Nanu“, staunte Joe. Er hatte das Buch entdeckt, das
aufgeschlagen vor Hoss lag. „Seit wann kann mein großer
Bruder lesen?“
„Ein interessantes Buch“, belehrte ihn Hoss. „Nach den
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen geschrieben.
Enorm bildend! Man nennt das – äh – psychologisch! Ich
borge es dir gern, wenn du es auch lesen willst!“
Joe nahm das Buch prüfend in die Hand.
„Anleitung für den kleinen Hundefreund“, las er laut den
Titel vor. „Hör mal, Bruderherz… Klingt das nicht etwas
untertrieben? Wenn ich dich so ansehe…“
Hoss war nicht viel größer als Little Joe. Dafür aber
mindestens doppelt so dick. Sein volles rundes Gesicht strahlte
vor Gutmütigkeit.
„Mir ist da ein Hund zugelaufen“, berichtete er. „Und ich
möchte versuchen, ihn fachmännisch zu erziehen. Gleich vom
ersten Augenblick an!“
„Und dazu brauchst du ein Buch?“ wunderte sich Ben
Cartwright, der bisher schweigend zugehört hatte. „Du kannst
doch auch so mit Tieren umgehen.“
„Natürlich!“ nickte Hoss. „Natürlich kann ich mit Tieren
umgehen. Aber man soll auch bei der Hundepflege nicht hinter
der Zeit zurückbleiben. Die haben jetzt ganz neue Methoden!“
Aus der Küche klang das Klirren von Tellern und Töpfen,
und der Duft von gebratenen Speck verbreitete sich verlockend
durch das ganze Haus.
Hoss klappte das Buch zu.
„Ihr habt doch nichts dagegen, wenn ich noch einmal
mitesse?“ erkundigte er sich.

„Natürlich nicht!“ erklärte sein Vater lachend.
„Du denkst wahrhaftig nur ans Essen!“ stellte Joe belustigt
fest.
„Ich wüßte nicht, an was ich sonst denken sollte“, gestand
Hoss. „Da lohnt es sich wenigstens! Oder weißt du etwas
Besseres?“
„Ted McKaren hat uns gerade eine harte Nuß zu knacken
gegeben“, berichtete Joe.
„Ted McKaren?“ Hoss dachte angestrengt nach. „Du bist
doch mit ihm befreundet, oder?“
„Wir sind zusammen zur Schule gegangen“, sagte Joe. „Eine
Zeitlang sind wir auch ganz gut miteinander ausgekommen.
Aber Ted hat sich zu seinem Nachteil verändert!“
„Etwa seit er mit Virginia Keith verlobt ist?“ forschte Hoss.
„Klar!“ rief Joe. „Das ist es! Daß ich nicht selber darauf
gekommen bin!“
„Du solltest öfter deinen großen Bruder fragen“, schlug Hoss
vor.
„Nichts für ungut, Bruderherz“, erklärte Joe gönnerhaft.
„Manchmal hast du wirklich gute Einfälle!“
„Nur manchmal?“ erkundigte sich Hoss.
„Ich glaube, das hängt mit dem Essen zusammen“, vermutete
Joe. „Nach einer guten Mahlzeit ist man besonders träge!“
„Ich nicht!“ behauptete Hoss. „Aber nun erzähl endlich! Du
hast mich richtig gespannt gemacht! Was ist los?“
Bevor Joe antworten konnte, erschien Hop Sing mit dem
Essen. Ben Cartwright und seine Söhne setzten sich im
Speisezimmer an den großen Tisch und aßen schweigend. Es
schmeckte so gut, daß Hoss noch einmal die doppelte Portion
verzehrte.
Nach dem Essen machten sie es sich im Wohnraum in den
Ledersesseln vor dem Kamin bequem. Ben Cartwright stopfte
seine Pfeife.

Dann berichtete er über Ted McKarens sonderbares
Benehmen.
„Seit der alte McKaren krank ist und Ted die Ranch allein
leitet, übertreibt der Junge ein bißchen“, schloß er seinen
Bericht.
„Wir lassen uns das natürlich nicht gefallen!“ empörte sich
Hoss.
„Natürlich nicht!“ bestätigte Joe.
Ben Cartwright war zu der alten holzgeschnitzten
Eichenkommode gegangen. Er schien etwas zu suchen, denn er
zog eine Schublade nach der anderen auf.
„Möchte wissen, wo der Tabak geblieben ist“, brummte er.
„He!“ rief Hoss. „Was siehst du mich dabei an, Pa? Ich habe
ihn nicht geraucht!“
„Wolltest du den Tabak nicht dem alten McKaren zum
Geburtstag schenken?“ erinnerte sich Joe.
„Ja“, nickte Ben Cartwright. „Das wollte ich! Aber nun muß
Andy seinen Geburtstag schon heute feiern. Denn ich fahre zu
ihm ‘rüber, um die Sache mit Ted klarzustellen!“
„So etwas soll man nicht auf die lange Bank schieben“,
stimmte ihm Hoss zu.
„Na also! Da ist er ja!“ Ben Cartwright hatte den Tabak
endlich gefunden. „Dann kann ich ja losfahren!“
„Vergiß nicht, ihm Grüße von uns auszurichten, Pa!“ trug
ihm Hoss auf. „Wir wünschen ihm zum Geburtstag alles
Gute!“
„Mach’ ich!“ versprach Ben Cartwright.
Joe und Hoss blickten ihrem Vater nach, als er eilig das Haus
verließ. Nach einer Weile hörten sie ihn mit dem Wagen
davonfahren. Plötzlich kamen Hoss Bedenken.
„Wir hätten ihn nicht allein fahren lassen sollen“, überlegte
er.

„Unsinn!“ winkte Joe ab. „Pa weiß, was er tut!“ Irgend etwas
hatte sich verändert. Es war die Ahnung des kommenden
Unheils…

Die Aussprache
„Wer ist da?“ Der alte Mann in dem Lehnstuhl hob lauschend
den Kopf. Ihm war, als hätte er draußen Schritte gehört. „Ist da
jemand?“ fragte er mit matter Stimme.
„Ich bin’s, Andy“, gab sich der Besucher zu erkennen. „Ben
Cartwright!“
„Warum kommst du nicht herein, Ben?“ erkundigte sich
Andy McKaren. „Die Tür ist nicht verschlossen!“
Das Zimmer war nicht sehr groß. Auf einem abgetretenen
roten Teppich standen inmitten der Roßhaarmöbel ein runder
Tisch und ein altes Plüschsofa. An den Wänden leuchteten die
abblätternden Goldrahmen mit den Porträts der McKarens, die
die weite Reise in die neue Heimat mitgemacht hatten: lauter
Männer mit kühnen, energischen Gesichtern. Die wurmstichige
Eichenkommode zierten bunte Porzellanteller und eine
verbeulte silberne Teekanne. Die Vorhänge an den Fenstern
waren verblichen.
Mit Ben Cartwright kam Kraft und Zuversicht ins Zimmer.
Man sah dem stämmigen grauhaarigen Mann an, wie gut er
sein Leben meisterte. Er warf einen besorgten Blick auf den
alten Mann, der hilflos und bleich in seinem Lehnstuhl saß,
nicht weit vom Fenster entfernt, durch das er einen Blick auf
den Hof der Ranch werfen konnte.
„Hallo, Andy!“ rief er. „Wie geht’s? Höchste Zeit, daß ich
dich mal besuche!“
Andy McKaren hatte seine gichtigen Beine mit einer alten
Militärdecke verhüllt. Sein linker Arm hing kraftlos herab.
Die rechte, rote Hand mit den frostrissigen Knöcheln und den
krummen Fingern ruhte auf der riesigen Familienbibel, die

aufgeschlagen auf seinem Schoß lag. Er hob das leidvolle
Gesicht.
„Nett, daß du mich mal besuchen kommst, Ben!“ krächzte er.
„So ein alter, kranker Mann wie ich ist zu nichts mehr nutze
und den anderen nur im Wege.“ Er lachte heiser auf.
„Unsinn, Andy!“ widersprach ihm Ben Cartwright. „Du bist
niemandem im Wege. Du wirst hier noch gebraucht. Vor allem
von Ted! Was soll dein Junge denn ohne dich anfangen? Er ist
doch noch auf deinen Rat angewiesen!“
„Irrtum, Ben!“ Andy McKaren schluckte nervös. Sein
Adamsapfel begann zu zucken. „Ein alter Mann, der von
morgens bis abends im Lehnstuhl sitzt, kann keinem mehr
helfen! Schon gar nicht Ted! Der Junge pfeift auf meinen Rat!
Ja, ja – ich mache mir nichts vor! Ich bin hier überflüssig! Ich
gehöre zum alten Eisen! Muß mich damit abfinden! Ist nichts
mehr daran zu ändern, Ben!“
Der Besucher wechselte das Thema.
„Ich habe dir einen Beutel Tabak mitgebracht“, sagte er.
„Rauchen wirst du ja noch können! Oder schmeckt dir die
Pfeife etwa auch nicht mehr?“
„O ja, die schmeckt mir noch!“ bestätigte der Kranke. Er roch
an dem Tabak. „Hm – der riecht aber gut!“
„Echter Virginia-Tabak“, erklärte der Spender. „Eigentlich
solltest du ihn erst zu deinem Geburtstag bekommen…“
„Der ist erst nächste Woche“, belehrte ihn der Mann im
Lehnstuhl.
„Ich weiß!“ nickte Ben Cartwright. Er blickte seinen alten
Freund forschend an. Andy McKaren hatte zwei große rote
Flecken in seinem bleichen Gesicht, wahrscheinlich vor Freude
über den unerwarteten Besuch. Seine große, fast farblose
Unterlippe stand leicht vor.

Unter seinen tiefliegenden Augen lagen dunkle Schatten. Ben
Cartwright zögerte einen Moment, dann fuhr er entschlossen
fort: „Ich habe heute deinen Sohn getroffen!“
„Ja!“ Der Kranke lächelte stolz. „Ted ist ständig unterwegs!
Der Junge muß sich jetzt ganz allein um die Ranch kümmern.
Irgendwann müssen unsere Jungs ja mal ‘ran! Du wirst das
auch noch erleben, Ben!“
„Ted hat mir erzählt, daß er Land verkaufen will“, berichtete
Ben Cartwright.
Andy McKaren spreizte die krummen Finger, die auf der
Familienbibel lagen. Er bewegte sie in einem langsamen,
verzweifelten Rhythmus auf und zu. Es schien ihn viel Mühe
zu kosten.
„Die Jugend hat ihre eigenen Ideen“, sagte er. „Sie will alles
besser machen! Genau wie wir damals, Ben! Und wenn es
dann soweit ist, bleibt doch alles beim alten…“
„Hoffentlich!“ Ben Cartwright schien davon nicht so
überzeugt zu sein. „Es wäre schade um den Besitz, Andy!
Offen gesagt, ich war ein bißchen überrascht, als Ted mir
erzählte, daß er euer gutes Weideland ausgerechnet an Len
Keith verkaufen will.“
„Ich wäre überrascht gewesen, wenn er es nicht an Len Keith
verkauft hätte“, gestand der Mann im Lehnstuhl. „Er ist doch
bis über beide Ohren in Lens Tochter verknallt. Sie ist seine
erste große Liebe, Ben! Da kann man nichts machen!“
„Virginia ist ein hübsches Mädchen“, gab der Besucher zu.
„Nicht wahr?“ Der Kranke lächelte glücklich.
„Demnach ist Ted fest entschlossen, zu verkaufen?“
vergewisserte sich Ben Cartwright.
„Hör zu, Ben…“ sagte Andy McKaren. „Du hast doch auch
ein paar Jungs großgezogen. Sie müssen solche Dinge eines
Tages selbst entscheiden! Auch wenn sie zuerst mal etwas
falsch machen! Auch aus Fehlern kann man lernen!“

„Da hast du natürlich recht“, gab Ben Cartwright zu. „Jeder
von uns muß mal anfangen. Aber in diesem speziellen Fall ist
die Sache etwas komplizierter!“
„Wieso?“ Der Mann im Lehnstuhl blickte fragend zu ihm
auf. Sein Adamsapfel bewegte sich krampfhaft.
„Überleg mal, Andy…“ sagte Ben Cartwright. „Denk an die
Folgen! Wenn Len Keith erst mal Silber auf deinem Land
abbaut, dann führt er die Abwässer natürlich in den Fluß.
Dadurch würde das Wasser vergiftet. Alles Vieh würde
verenden. Ich hätte nur die Wahl, ob ich meine Rinder
vergiften oder verdursten lassen will!“
Die beiden roten Flecken, welche die Freude auf Andy
McKarens Backenknochen gezeichnet hatten, verflossen über
das ganze bleiche Gesicht.
„Das kommt überhaupt nicht in Frage!“ polterte er los. „Das
vergiftete Wasser würde auch meine Herde verderben! Nicht
nur deine, Ben!“
„Bestimmt!“ bestätigte Ben Cartwright. „Unsere Rinder
würden in kürzester Zeit verenden! Alles, was wir in
jahrelanger Arbeit aufgebaut haben, wäre vergebens gewesen.
Wir wären wieder da, wo wir angefangen haben!“
„Daß ich daran nicht gedacht habe!“ Der Kranke starrte
gedankenverloren vor sich hin. „Da siehst du es, Ben! Ich habe
keine Sekunde über die Folgen nachgedacht! Der Gedanke ist
mir überhaupt nicht gekommen!“ Er schüttelte mißbilligend
den Kopf, dann fuhr er verbittert fort: „Nicht nur der Körper,
auch der Geist gehorcht mir nicht mehr!“
„Weißt du noch, Andy?“ erinnerte ihn Ben Cartwright.
„Damals, als wir den Vertrag machten…“
„Das waren noch Zeiten, was, Ben?“ Andy McKaren lächelte
glücklich.
Ben Cartwright nickte.

„Ja“, sagte er. „Damals hat keiner von uns geahnt, daß es
über diese Abmachung noch einmal Streit zwischen uns geben
würde. Wir glaubten, alles bestens geregelt zu haben!“
„Wir werden uns auch jetzt nicht deswegen streiten“,
behauptete der Mann im Lehnstuhl. „Ich werde Ted verbieten,
unser Land an Len Keith zu verkaufen!“
„Moment mal!“ vernahmen sie eine wütende Stimme. „Da
habe ich auch noch ein Wort mitzureden! Sie haben schnell
geschaltet, Mr. Cartwright! Alle Achtung! Trotzdem werden
Sie diesmal kein Glück haben!“
Die beiden Männer blickten überrascht auf.
In der Tür stand Ted und starrte sie feindselig an…
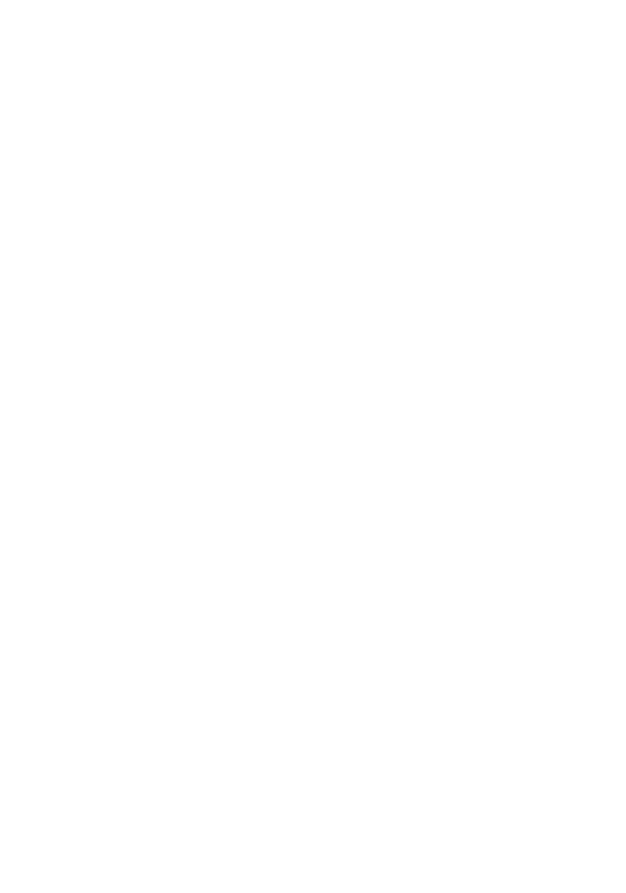
Einer sucht Streit
Andy McKaren hielt den Atem an. Seine Lippen zuckten. Sein
Adamsapfel hüpfte nervös auf und ab. Plötzlich hörte das
Zucken auf. Der Kranke hatte die Sprache wiedergefunden.
Seine Stimme klang kalt und herrisch.
„Ted“, sagte er. „Was ist das für eine Begrüßung?“
„Ich mag es nicht, wenn hinter meinem Rücken verhandelt
wird“, erklärte der Sohn, der hochaufgewachsen an der Tür
stand. Sein Gesicht trug einen Ausdruck von Abscheu und
verzweifeltem Zorn.
„Wir haben nichts zu verheimlichen“, belehrte ihn der Mann
im Lehnstuhl. „Ben hat mir etwas mitgeteilt, was auch für dich
bestimmt ist!“
Ted winkte ärgerlich ab.
„Ich will es gar nicht hören“, begann er hitzig. „Ich weiß
auch so, was er will!“
„Ted!“ rief ihn sein Vater zur Ordnung. „Du sprichst von Ben
Cartwright! Falls du das vergessen haben solltest!“
„Wie könnte ich das, Vater?“ Teds Gesicht rötete sich
oberhalb der blonden Bartstoppeln. „Wie könnte ich das je
vergessen? Weit und breit gibt es keinen Mann wie Ben
Cartwright!“
Voller Groll erinnerte er sich daran, wie sehr auch ihn früher
die Haltung äußerer Sicherheit und Achtbarkeit bei Ben
Cartwright beeindruckt hatte.
Höhnisch platzte er heraus: „Solange ich ihn kenne, hat Mr.
Cartwright nichts anderes getan, als dich zu maßregeln. Er
sorgte dafür, daß keine Entscheidung ohne ihn gefällt wurde.

Er war immer der Boß, und du hast ihm dein Leben lang
gehorcht, Vater!“
Ben Cartwright hatte dem Gespräch zwischen Vater und
Sohn schweigend zugehört. Jetzt ergriff er zum ersten Male
das Wort.
„Du irrst dich!“ wandte er sich an Ted. „Dein Pa hat sich
niemals und von keinem Menschen beeinflussen lassen. Das
solltest auch du gemerkt haben!“
„Typisch Cartwright!“ Ted lachte höhnisch auf. „Merkst du
es wirklich nicht, Vater? Zuerst lobt er deinen Mut. Dann
spricht er von den guten alten Zeiten und davon, was du ihm
alles schuldig bist. Aber das dicke Ende kommt zum Schluß!
Wenn er dir sagt, was du zu tun hast. Daß du zum Beispiel
niemals ein Stück Land verkaufen darfst, wenn es den
Cartwrights nicht in den Kram paßt!“
Andy McKaren blickte hilflos zu seinem Sohn auf.
„Ted!“ flehte er. „Hör auf! Ich bitte dich! Ich kann es nicht
ertragen, wenn du so redest!“
Ted lächelte verächtlich. Er wußte, daß er seinen Vater mit
Worten nie überzeugen würde. Aber gerade das machte ihn
zornig. Und die Ruhe, mit der Ben Cartwright seine Anklage
zur Kenntnis nahm, stachelte ihn nur noch mehr auf.
„So macht es Ben Cartwright mit allen Leuten“, behauptete
er. „Keiner in Carson Valley hat jemals den Mut gehabt, ihm
zu widersprechen. Außer mir! Eines Tages werde ich ihm die
Maske vom Gesicht reißen, und dann…“
„Schweig!“ fiel ihm der Mann im Lehnstuhl ins Wort.
„Niemals!“ schrie Ted. „Niemals werde ich aufhören, dir die
Wahrheit über die Cartwrights zu sagen!“ Sein Gesicht war
von Wut entstellt.
Andy McKaren hatte seine gichtigen Hände über der
Familienbibel gefaltet. Scharfe Falten zeichneten sich zu

beiden Seiten seines Mundes ab. Er starrte seinen Sohn in
aufsteigendem Zorn an.
„Jetzt reicht es mir aber!“ explodierte er. „Hör endlich auf,
dir Flausen in den Kopf zu setzen! Ben Cartwright ist mein
bester Freund, und ich verbiete dir, ihn zu beleidigen!“
„Schon gut, Vater!“ gab Ted verächtlich zurück. „Ich habe
verstanden. Mr. Cartwright ist dein Freund. Trotz allem, was er
dir angetan hat! Aber meiner ist er nicht. Daran solltest du
ebenfalls denken!“
„Du brauchst mir nichts weiszumachen, mein Junge!“ Der
Mann im Lehnstuhl fühlte sich plötzlich müde. Nur mit
äußerster Anstrengung gelang es ihm, weiterzusprechen: „Ich
bin alt und krank, aber wer mein Freund ist, das vermag ich
noch zu erkennen.“
Ted zog verächtlich die Brauen hoch.
„Leider sind wir in diesem Punkt verschiedener Ansicht“,
sagte er. „Ich bedaure das sehr, Vater! Ehrlich! Ich wünschte,
ich könnte dich überzeugen!“
„Du wirst dich auf der Stelle bei Mr. Cartwright
entschuldigen“, verlangte sein Vater.
„Nein, Andy!“ mischte sich Ben Cartwright ein. „Das ist
nicht nötig!“
„Doch, Ben!“ Diesmal blieb der Mann im Lehnstuhl hart.
„Der Junge muß sich entschuldigen. Schließlich ist das hier
noch immer mein Haus!“
Sein Sohn starrte ihn haßerfüllt an.
„Dein Haus! Dein Land!“ schrie er. „Für diese altmodischen
Phrasen hat Mama sich zu Tode geschuftet und du dich zum
Krüppel gearbeitet. Von mir aus kannst du das alles weiter
anbeten! Mir ist es egal! Ich pfeife auf dein Haus und auf dein
Land!“
Er drehte sich auf dem Absatz um und lief aus dem Zimmer.
Die Tür schlug laut polternd hinter ihm ins Schloß.
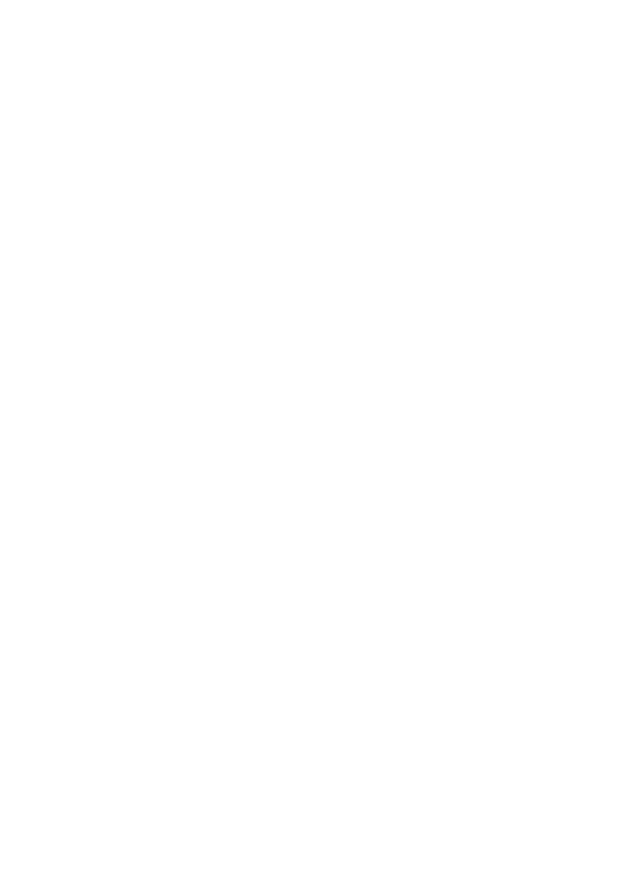
„Ted! Junge!“ Andy McKaren wollte aufspringen, aber Ben
Cartwright drückte ihn mit sanfter Gewalt auf den Sitz zurück.
„Reg dich nicht auf, Andy“, sprach er beruhigend auf ihn ein.
„Bleib sitzen! Bitte!“
Der Kranke sank erschöpft in den Lehnstuhl zurück.
„Ich schäme mich für den Jungen“, murmelte er.
„Du darfst das nicht so ernst nehmen“, erklärte Ben
Cartwright. „In dem Alter brausen die Jungs schnell auf. Das
gibt sich bald wieder!“
Andy McKaren stöhnte. Die Kehle schien ihm wie
ausgedörrt. Er starrte seinen Freund forschend an, als suche er
in dessen Zügen zu lesen. Aber Ben Cartwright zeigte keinerlei
Erregung.
Er strahlte die Besonnenheit aus, die ihn stets in solchen
Situationen auszeichnete. Der Kranke umklammerte mit den
Händen die Stuhllehnen so fest, daß seine Knöchel weiß
hervortraten.
„Ben“, ächzte er. „Wenn Ted es nicht tut, dann muß ich mich
eben für ihn entschuldigen!“
„Nein, Andy!“ widersprach Ben Cartwright. „Das mußt du
nicht! Es ist allein meine Schuld! Ich wünschte, ich hätte nicht
davon gesprochen. Wenn ich gewußt hätte, was dabei
herauskommt, wäre ich bestimmt nicht hergekommen. Es tut
mir sehr leid, Andy! Das mußt du mir glauben!“
„Natürlich glaube ich dir das, Ben!“ Der Kranke blickte
dankbar zu ihm auf. „Mach dir deshalb keine Sorgen. Du hast
wie immer richtig gehandelt. Schließlich geht es um unsere
Herden. Ich möchte wirklich wissen, was sich der Junge dabei
gedacht hat, als er unser bestes Weideland an Len Keith
verkaufen wollte…“
Vom Hof drang Hufschlag herein. Durch das Fenster konnten
sie Ted im Galopp davonreiten sehen. Sein Vater blickte ihm
kopfschüttelnd nach.
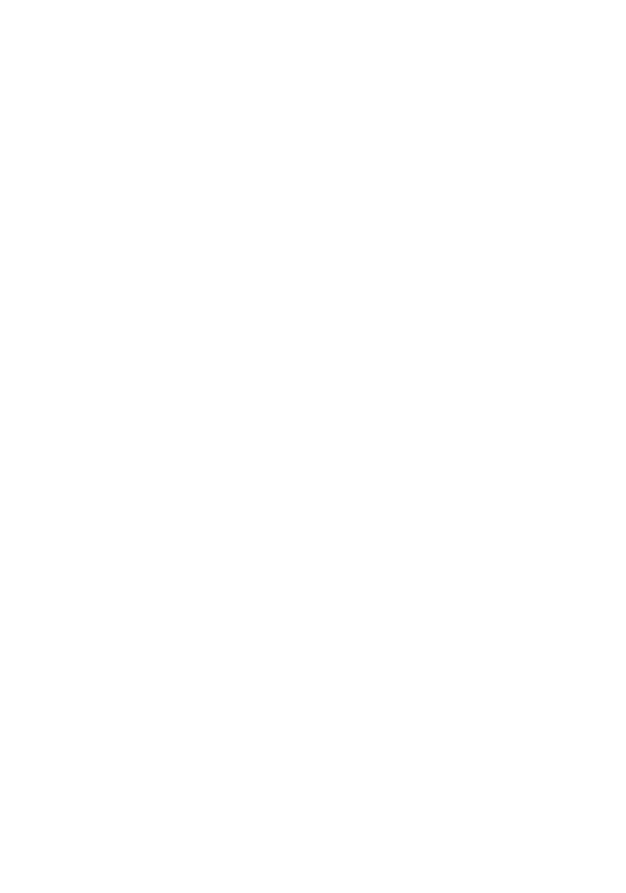
„Ich weiß nicht, was in den Jungen gefahren ist“, seufzte er.
„Vielleicht braucht Ted Geld“, vermutete Ben Cartwright.
„Wir haben zwar um diese Jahreszeit wenig Bargeld im Hause,
außerdem ist der Kaufbetrag für die neuen Rinder aus Texas
fällig, aber wenn Ted nötig Geld braucht, könnte ich ihm
natürlich aushelfen.“
„Ted würde niemals Geld nehmen“, erklärte Andy McKaren.
„Vor allem nicht von Ben Cartwright!“
„Natürlich nicht!“ Der Besucher nickte zustimmend. „Ted
würde sofort denken, daß ich euch von mir abhängig machen
und euren Besitz kassieren will. Ich hätte nicht gedacht, daß
zwei alte Freunde wie wir noch einmal über solche Probleme
sprechen müßten!“
„Ja“, gab Andy McKaren betrübt zu, „ein Problem ist es
schon! Wenn Ted das Land wirklich an Len Keith verkauft…“
„Vielleicht will Len Keith das Land als Weide für seine
Rinder“, überlegte Ben Cartwright.
„Da kennst du Len Keith schlecht!“ Der Mann im Lehnstuhl
seufzte auf. „Len Keith will Ted zu seinem Partner machen!
Man sollte es nicht für möglich halten, aber der Junge hat die
fixe Idee, eines Tages genauso ein Silberbaron zu sein wie Len
Keith!“
Ben Cartwright sah ihn fragend an.
„Glaubst du wirklich, daß sie auf deinem Land Silber finden
werden?“
Andy McKaren schüttelte den Kopf.
„Nein“, sagte er. „Das glaube ich nicht! Genauso wenig wie
du!“
„Na also!“ stellte Ben Cartwright befriedigt fest.
„Aber Len Keith ist ein Fachmann“, gab der Mann im
Lehnstuhl zu bedenken. „Und Ted glaubt fest an das, was er
sagt. Er glaubt immer, was er glauben will.“

„Aber Len Keith spekuliert doch nur!“ behauptete Ben
Cartwright. „Er kauft überall Land auf, aber nicht, um darauf
seine Rinder grasen zu lassen, sondern um nach Silber zu
graben. Dabei ruiniert er den Boden! Das müßte doch auch
Ted begreifen!“
„Er macht nicht nur das Land kaputt“, sagte Andy McKaren,
„sondern auch die Menschen, die ihm im Wege sind. Len
Keith denkt nur an sich selbst!“
„Daran ist etwas Wahres“, gab Ben Cartwright zu.
„Diesmal ist mein Junge an der Reihe“, befürchtete der Mann
im Lehnstuhl.
„Das wollen wir nicht hoffen!“ Ben Cartwright nickte dem
Kranken aufmunternd zu. „So schlimm ist es auch wieder
nicht! Ich glaube, du siehst da etwas zu schwarz!“
„Ich wünschte, du hättest recht“, seufzte Andy McKaren.
Ben Cartwright wollte seinen alten Freund nicht noch mehr
aufregen. Insgeheim aber befürchtete er, daß die
Angelegenheit noch lange nicht erledigt war. Len Keith war
ein Mann, der beharrlich seine Ziele verfolgte und dabei vor
nichts zurückschreckte.
Daran mußte Ben Cartwright auf der Rückfahrt denken,
während er den Wagen über die ausgefahrene Spur in Richtung
Ponderosa lenkte…

Zwei verbünden sich
„Du?“ Virginia blickte überrascht, als sie die Haustür öffnete
und Ted sah. „Ich dachte, du kommst erst heute abend?“
„Das wollte ich auch, aber…“ Er brach mitten im Satz ab und
starrte sie wütend an. „He! Du scheinst dich gar nicht zu
freuen, daß ich so früh komme.“
„Natürlich freue ich mich“, sagte Virginia. „Aber ich bin für
das Fest heute abend noch gar nicht angezogen.“
Das lange
blonde Haar fiel ihr offen bis auf die Schultern hinab. Im Licht
der untergehenden Sonne leuchtete es wie Gold.
Ted konnte es immer noch nicht fassen, daß sie seine Braut
war. Er war bis über beide Ohren in sie verliebt. In ihrer
Gegenwart fühlte er sich schwach und hilflos. Alles Rauhe fiel
von ihm ab. Er sah sie bewundernd an.
„Du bist immer schön“, gestand er.
Virginia nahm das Kompliment lächelnd entgegen. Trotzdem
ließ sie sich nicht täuschen. Sie kannte Ted bereits so gut, daß
sie jede seiner Regungen wahrnahm. Er schien sich über irgend
etwas geärgert zu haben. Ihre großen, blauen Augen richteten
sich forschend auf ihn.
„Was hast du?“ fragte sie.
„Nicht hier!“ Ted blickte sich ängstlich um. Dann betrat er
schnell das Haus und drückte die Tür mit einer entschlossenen
Bewegung hinter sich zu.
„Ich muß dringend mit deinem Vater reden“, erklärte er.
„Mit Vater?“ Virginia war enttäuscht. „Du bist also gar nicht
meinetwegen so früh gekommen?“
„Nein“, gab Ted zu. Er machte plötzlich einen gehetzten
Eindruck. Irgend etwas schien ihn zu beunruhigen. Er wirkte

nervös und zerfahren. Das blonde Haar hing ihm wild in die
Stirn, die von der Präriesonne tief gebräunt war.
„Ist etwas passiert?“ erkundigte sich Virginia besorgt.
Ted nickte.
„Ja, leider!“ bestätigte er. „Wo ist dein Vater?“
„In der Wohnstube“, sagte Virginia.
Ted wandte sich abrupt von ihr ab und stürmte davon.
Virginia hatte Mühe, mit ihm Schritt zu halten.
„Um Gottes willen!“ rief sie. „Ist es so schlimm?“
Len Keith, eine hohe, stattliche Gestalt, kam ihnen entgegen.
„Hallo – Ted!“ begrüßte er den Besucher. „Du kannst wohl
ohne deine Braut nicht mehr leben, was?“ Er lachte schallend
auf, als habe er einen guten Witz gemacht.
„Ted kommt deinetwegen“, erklärte Virginia.
„Meinetwegen?“ Ihr Vater schien verwundert. „Nanu? Etwas
Geschäftliches?“
„Ich habe Ärger gehabt“, gestand Ted.
„Ärger?“ Zwischen Len Keiths Augenbrauen stand eine steile
Falte. Er schien nicht sehr erfreut. Bei ihm mußte alles glatt
gehen. Er liebte keine Komplikationen. Auf keinen Fall durfte
sein Name damit in Verbindung gebracht werden.
Leute vom Schlage eines Len Keith hatten Helfer, die ihm
alles Unerfreuliche abnahmen und auch mit dem Colt
nachhalfen, falls es nötig war. Hauptsache, die Weste vom Boß
blieb weiß.
Der Silberbaron, wie er im ganzen Tal genannt wurde, war
stets korrekt und nach der neuesten Mode gekleidet. Über
seiner modisch gestreiften Weste baumelte eine goldene
Uhrkette. Man sah ihm den wohlhabenden und erfolgreichen
Mann an. Er nahm die schwarze Brasilzigarre, die zwischen
seinen schmalen Lippen steckte, beim Sprechen aus dem
Mund.
„Was für Ärger?“ fragte er.

Wie immer, wurde Ted unter seinem forschenden Blick
verlegen.
„Eine dumme Geschichte“, stammelte er. „Aber ich habe das
vorausgesehen!“
„Rede!“ befahl sein zukünftiger Schwiegervater. „Komm,
pack aus! Vielleicht kann ich dir helfen.“
„Mr. Keith“, sagte Ted entschlossen. „Ich darf Ihnen unser
Land nicht verkaufen!“
„So?“ Len Keith lächelte ungläubig. „Und warum nicht? Ist
dein Vater mit dem Preis nicht einverstanden? Daran soll es
nicht scheitern, mein Junge. Ich bin bereit, noch etwas
dazuzulegen!“
„Es wird also alles gut werden?“ Virginia atmete erleichtert
auf.
„Das kommt darauf an“, erklärte ihr Vater. Er blickte Ted
fragend an. „Liegt es wirklich am Preis?“
„Nein“, sagte Ted. „Darum geht’s nicht!“
Len Keith führte den Besucher in die Wohnstube.
„Setz dich erst mal!“ forderte er Ted auf. Er selbst zog sich
einen Stuhl heran und ließ sich ächzend darauf nieder.
Ted nahm zögernd in einem Lehnstuhl Platz.
Len Keith hielt die Brasil lässig zwischen zwei Fingern.
„Also, worum geht es?“ wollte er wissen.
„Vater hat mit Ben Cartwright vor zwanzig Jahren einen
Vertrag über die Wasserrechte abgeschlossen“, berichtete Ted.
„Soso“, sagte der Silberbaron. „Mit Ben Cartwright! Der hat
natürlich Angst, daß meine Silberminen ihm seinen kleinen
Bach verschmutzen werden.“
„Wenn das so weitergeht, darf man hier nichts mehr machen,
ohne vorher die Genehmigung von Ben Cartwright
einzuholen“, erklärte Ted ärgerlich.

„Kannst du’s dem Mann übelnehmen?“ hielt ihm Len Keith
vor. „Ist doch verständlich, daß er bei allem, was er tut,
zunächst an seine eigenen Interessen denkt. Oder etwa nicht?“
„Ich habe auch eigene Interessen“, gestand Ted hitzig. „Ich
möchte Virginia heiraten. Aber zum Heiraten gehört Geld!“
„Ich werde dich auch heiraten, wenn du kein Geld hast“,
versprach Virginia.
Ted blickte sie strafend an.
„Du sprichst genau wie meine Mutter“, sagte er. „Sie hat
meinen Vater auch ohne Geld geheiratet. Dafür starb sie mit
sechsundzwanzig Jahren, sie hat sich für ihn totgeschuftet!“
„Armer Ted!“ Virginia betrachtete ihn voll Mitgefühl. „Es ist
schlimm, wenn man so früh die Mutter verliert!“
Sie konnte
ihm das nachfühlen, denn sie war auch noch klein gewesen, als
ihre Mutter starb.
„Du brauchst deinen Vater doch gar nicht“, wandte sich Len
Keith an Ted. „Du kannst ebensogut in meinen Silberminen
arbeiten!“
„Nein!“ winkte Ted ab. „Ich will nicht auf das Geld meines
Schwiegervaters angewiesen sein! Ich möchte es allein zu
etwas bringen!“
„Schon gut, mein Junge!“ Der Silberbaron nickte
anerkennend. „Ich habe nichts anderes von dir erwartet! Aber
Kopf hoch! Wir werden die Sache schon ins reine bringen!“
„Wenn Sie mir helfen, werde ich es bestimmt schaffen.“
erklärte Ted hoffnungsvoll.
„Dein Vater wird sicher in den Kauf einwilligen, wenn ich
erst mit ihm gesprochen habe“, vermutete Len Keith.
„Das mag sein!“ gab Ted zu. „Aber viel wichtiger ist, daß
Ben Cartwright zustimmt!“
„Das laß nur meine Sorge sein!“ sagte der Silberbaron. Seine
grauen Augenbrauen hoben sich, und er blickte
gedankenverloren auf den Rauchring, den sein Mund blies.

„Vater!“ Virginias Stimme bebte vor Angst. „Was hast du
vor?“
„Es wird höchste Zeit, daß Ben Cartwright mal einen
Denkzettel erhält“, erklärte Ted.
„Es wird nicht mehr lange dauern“, prophezeite sein
zukünftiger Schwiegervater. „Einmal hat die Geduld der Leute
ein Ende!“
Virginia blickte die Männer erstaunt an.
„Ich weiß wirklich nicht, was ihr auf einmal gegen Ben
Cartwright habt.“
„Das verstehst du nicht“, sagte Ted. „Hier geht es nicht um
Freundschaft, sondern um harte Geschäfte unter Männern!“
„Du kannst dich auf mich verlassen, mein Kind!“ Len Keith
sah seine Tochter väterlich an. „Wer deinem Glück im Wege
steht, bekommt es mit mir zu tun! Das gilt für alle! Auch für
Ben Cartwright!“
In solchen Fällen kannte Len Keith keine Skrupel. Um sein
Ziel zu erreichen, war ihm jedes Mittel recht. Das sollten auch
die Cartwrights bald zu spüren bekommen…

Seife für Stinktiere
Hoss schleppte einen Holzzuber in die Wohnstube. Das
Wasser schwappte leicht über, als er ihn auf den Boden stellte.
Anschließend holte er Schwamm und Seife. Dann blickte er
sich suchend um.
„Wo ist denn mein kleines Hundili?“ fragte er.
Der Hund, der mitten im Zimmer stand, bettelte mit
schräggestellten Augen um Hilfe. Seine Rute wedelte. Aus
dem makellosen Gebiß kam hechelnd eine rote Zunge hervor.
„Na, komm schon!“ lockte Hoss.
Der Hund rührte sich nicht von der Stelle. Es war kein
reinrassiges Tier, sondern eine Promenadenmischung, nicht
sehr groß, mit einem struppigen Fell.
„Komm zu deinem Papi!“ befahl Hoss.
Der Hund gehorchte wieder nicht. Er winselte leise.
„Warum kommst du nicht zu deinem Papi, hm?“ Hoss kratzte
sich nachdenklich hinter seinem rechten Ohr. Endlich begriff
er. „Ach so! Das Herrchen ist so groß und so dick, und du bist
so klein. Du fürchtest dich vor mir! Habe ich recht?“
Der Hund bellte laut auf.
„In Ordnung!“ sagte er. „Wenn mein kleines Hundili nicht
zum lieben Hoss kommen will, dann kommt der liebe Hoss
eben zu seinem kleinen Hundili!“
Er ging in die Hocke, ließ sich auf die Knie fallen, setzte die
Hände vor seine Füße auf den Boden und kroch auf allen
vieren über den Teppich.
„Siehst du!“ rief er. „Dein Herrchen ist auch nur ein großer
Hund! Er läuft genau wie du auf vier Pfoten!“
Der Hund knurrte böse, als Hoss sich ihm näherte.

„Schön sitzen bleiben!“ befahl der Dicke. „Ganz ruhig!
Gleich bin ich bei meinem kleinen Hundili…“
Der Hund knurrte weiter und zeigte die Zähne.
„Nanu!“ rief Hoss keuchend. „Du wirst doch deinem
Herrchen nichts tun?“
Der Hund stand mit zitternden Flanken, die blanken Zähne
entblößt, zum Äußersten bereit.
Hoss zögerte.
Der Hund sprang mit einem Satz an ihm vorbei in die hintere
Zimmerecke.
„Verdammter Köter!“ schimpfte Hoss. „Ich werd’ dir schon
noch beibringen, wie man sich als Hund zu benehmen hat.
Komm sofort hierher! Kannst du nicht hören?“
Sein Kopf wurde zusehends rot. Das kam von dem
ungewohnten Bücken. Aber sein Zorn verrauchte schnell.
„Komm her! Komm zu Herrchen!“ lockte er mit
einschmeichelnder Stimme. „Sei lieb!“
Der Hund knurrte gar nicht lieb.
Hoss kroch auf allen vieren auf die Zimmerecke zu.
„Warte!“ rief er. „Gleich ist dein Papi bei dir! Gleich habe
ich dich! Bleib schön sitzen!“
Bevor Hoss heran war, entfloh der Hund in die
gegenüberliegende Ecke.
„Was ist mit dir los?“ schimpfte Hoss. Er keuchte vor
Anstrengung. Schließlich war er es nicht gewohnt, auf allen
vieren durch das Zimmer zu kriechen. „Wie kannst du bloß vor
deinem Papi davonlaufen, der es so gut mit dir meint! Ist das
Dankbarkeit?“
Mit diesen Worten näherte sich Hoss zum dritten Male dem
Hund, der, die Stirn in tiefe Kummerfalten geteilt, unglücklich
auf seinen neuen Herrn blickte.
„Bleib sitzen!“ keuchte Hoss. „Lauf nicht wieder fort!“

Plötzlich hatte der Hund das Ausweichen satt. Er überwand
seine Hemmungen und umkreiste Hoss mit kurzen, festen
Schritten, während er von allen Seiten Witterung nahm.
Hoss ließ ihn eine Weile gewähren. Dann packte er zu.
„So!“ rief er triumphierend. „Jetzt habe ich dich! Jetzt
entkommst du mir nicht mehr! Und nun wollen wir mal ein
bißchen Plansche-plansche machen, damit sich das Hundili
überhaupt unter Menschen sehen lassen kann.“
Hoss setzte den Hund in den Waschzuber. Dann seifte er ihn
vom Schwanzende bis zur Nasenspitze ein, ohne sich auch nur
im geringsten um sein Widerstreben zu kümmern.
Der Hund winselte ängstlich, als ihm die Seife in Augen und
Nasenlöchern stach. Aber befreien konnte er sich nicht. Hoss
hielt ihn fest. Der Dicke ließ sich durch kein noch so lautes
Winseln rühren. Zum Schluß trat der Schwamm in Aktion.
Ströme von Wasser ergossen sich auf das eingeseifte Fell.
„Na?“ fragte Hoss. „Ist das schön, was Papi da macht?“
Der Hund jaulte kläglich.
„Wirklich schön, Papi!“ kam prompt die Antwort.
Little Joe hatte das Zimmer betreten. Er grinste.
Hoss sah ärgerlich auf.
„Stör mich jetzt nicht!“ bat er seinen Bruder.
„Nur eine Frage“, sagte Little Joe. „Hast du dein Raubtier
schon dressiert?“
„Er gehorcht mir bereits aufs Wort“, behauptete Hoss. „Er tut
alles, was ich will! Sogar waschen läßt er sich von mir, wie du
siehst!“
„Du solltest zum Zirkus gehen“, schlug Little Joe vor.
Die Luft war plötzlich verpestet, als ob tausend faule Eier im
Zimmer zerplatzt wären. Hoss rümpfte die Nase.
„He!“ rief er. „Was stinkt denn hier so fürchterlich?“

„Das ist mein neues Parfüm“, erklärte Little Joe. „Ich habe
ein paar Wolfsfallen gelegt und sogar etwas gefangen! Leider
war es nur ein Stinktier.“
Der Gestank ist die Waffe der Stinktiere, mit Gestank
schlagen sie alle Feinde in die Flucht. Kein Angreifer kann das
Sekret aus ihren Stinkdrüsen ertragen, das sie mehrere Meter
weit sprühen können.
Als Little Joe sich über die Falle beugte, hatte ihm das Tier
plötzlich den Rücken zugekehrt, und der buschige Schwanz
war steil in die Höhe geschnellt. Bevor Little Joe
zurückspringen konnte, traf ihn ein Strahl der stinkenden
Flüssigkeit.
Little Joe wünschte allen Tieren den Tod, die aus Stinkdrüsen
stänkern. Sein Gesicht brannte unerträglich. Am meisten aber
litt er unter dem aufdringlichen Gestank.
„Du hast es doch nicht getötet?“ erkundigte sich Hoss.
„Nein“, sagte Little Joe. „Warum willst du das wissen?“
„Stinktiere sind sehr nützlich“, erklärte Hoss. „Sie vertilgen
eine Menge Klapperschlangen und würgen mehr Ratten und
Mäuse als die besten Katzen. Sie fressen auch Käfer und
allerhand Gewürm…“
„Das rechtfertigt noch nicht ihre Stinkdrüsen“, warf Little Joe
ein.
„Stinken tun sie nur, wenn ein Greenhorn wie du sie dazu
zwingt!“ Hoss lächelte schadenfroh.
„So was nennt sich Bruderliebe!“ stellte Little Joe betrübt
fest.
„Ich werde dich abschrubben“, versprach Hoss. „Sobald ich
mit dem Hund fertig bin!“
„Ich glaube nicht, daß du meinen Wohlgeruch mit Seife
wegkriegst“, befürchtete Little Joe.
„Moment!“ rief Hoss. „Das ist eine ganz besondere Seife! Da
ist Schwefel drin! Ich habe sie gestern bei Baker gekauft. Er

sagt, es sei das Allerneueste! Eine Spezialseife, die Würmer,
Käfer und alles Ungeziefer mit Stumpf und Stiel ausrottet!“
„Wirklich?“ Little Joe schien nicht so recht daran zu glauben.
„Bestimmt!“ versicherte Hoss.
„Ist ja auch egal“, sagte sein Bruder. „Schließlich habe ich
weder Würmer noch Käfer! Auch keine Flöhe!“
„Wer weiß?“ Hoss betrachtete ihn abschätzend.
„Du machst dich doch nicht etwa über mich lustig?“ Little
Joe wollte sich auf seinen Bruder stürzen.
Hoss wich entsetzt zurück.
„Bleib, wo du bist!“ rief er. „Komm mir nicht zu nahe!
Hilfe!“
„Nanu!“ sagte eine sonore Stimme. „Was ist denn hier los?“
Die beiden Brüder fuhren erschrocken herum und starrten
überrascht zur Tür, wo ihr Vater stand. Sie waren so
miteinander beschäftigt gewesen, daß sie überhört hatten, wie
der Wagen vorfuhr.
„Hallo, Pa!“ rief Hoss. „Wie war’s bei Andy?“
„Er wird natürlich unseren Vertrag einhalten“, berichtete Ben
Cartwright. „Ich habe auch nichts anderes von Andy McKaren
erwartet!“
„Ich auch nicht“, gestand Hoss. „Möchte nur wissen, wie Ted
so was machen konnte!“
„Es sieht so aus, als suche Ted absichtlich Streit“, erklärte
Little Joe.
„Wie wär’s, wenn du heute abend mal mit ihm sprechen
würdest?“ schlug Ben Cartwright vor.
„Richtig!“ sagte Hoss. „Wir treffen ihn ja heute abend auf
dem Fest!“
„Ihr seid doch zusammen zur Schule gegangen“, erinnerte
sich Ben Cartwright. „Damals sah es so aus, als ob ihr euch
anfreunden würdet!“

„Ich werde mit ihm reden“, versprach Little Joe. „Aber ich
glaube nicht, daß viel dabei herauskommt! Ted ist nicht mehr
der alte!“
„Vergiß nicht, dich vorher gründlich zu waschen“, riet ihm
Hoss. „Sonst wirst du nicht lange auf dem Fest sein!“
„Wer weiß?“ lachte Little Joe. „Vielleicht tanzen die Damen
gern mal mit einem Stinktier.“
„Schon möglich!“ gab Hoss zu. „Aber ich schlafe auf keinen
Fall mit einem Stinktier unter einem Dach!“
„Stinktier?“ horchte Ben Cartwright auf. „Wo ist denn hier
ein Stinktier?“
„Das Stinktier bin ich!“ meldete sich Little Joe.
„Deshalb stinkt es hier so!“ stellte Ben Cartwright fest. „Ich
habe mich schon gewundert! Der Gestank ist ja nicht mehr
auszuhalten!“
„Mich stört es nicht“, behauptete Little Joe.
„Nun aber ‘raus!“ befahl sein Vater. „Zieh dich um! Wirf die
verpesteten Kleider und Stiefel fort! Geh unter die Pumpe und
spül dich gründlich ab! Los!“
Little Joe wurde von seinem Vater und seinem Bruder wie
ein Aussätziger behandelt. Beide wichen entsetzt zurück, als er
an ihnen vorbeikam. Auch der Hund winselte ängstlich. Für
seine empfindliche Nase mußte der Gestank ja noch viel
schlimmer sein.
Ben Cartwright runzelte die Stirn, als er den Waschzuber
entdeckte.
„Was ist das?“ fragte er.
„Moderne Hundepflege“, belehrte ihn Hoss.
„Steht wohl auch in deinem Buch?“ vermutete sein Vater.
„Die Seife ist wirklich prima“, erklärte Hoss. „Du solltest sie
auch mal ausprobieren! Ist Schwefel drin!“
„Danke!“ Ben Cartwright unterdrückte nur mit Mühe ein
Lächeln.

Hoss wandte sich wieder dem Hund zu, der mit gesträubtem
Fell in dem Holzzuber stand.
„Fertig, der Herr“, sagte er. „Einmal Waschen und Legen!
Das macht einen halben Dollar! Wünschen der Herr auch noch
rasiert zu werden?“ Er hob den Hund aus dem Wasser und
stellte ihn neben sich auf den Boden. Dann trocknete er ihn mit
einem Handtuch ab.
„He – Hoss!“ Little Joe steckte noch einmal den Kopf ins
Zimmer. „Wenn ich dir einen guten Rat geben darf… Tanz
heute mal auf deinen eigenen Füßen! Und nicht auf denen der
Damen!“
Hoss blickte verwundert zu ihm auf.
„Komisch!“ erklärte er kopfschüttelnd. „Ausgerechnet du
willst mir gute Ratschläge geben, wie man eine Dame zu
behandeln hat. Dabei hast du selbst keine Ahnung! Du bist drei
Jahre lang hinter Virginia Keith hergelaufen! Und zur
Belohnung heiratet sie Ted!“
„Dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung“, gestand Little
Joe. „Ich habe immer vergessen, sie zu fragen, ob sie mich
will!“
„Raus!“ brüllte Ben Cartwright. „Verschwinde! Befreie uns
endlich von dem Gestank!“
Little Joe entfernte sich lachend.
„Drei Jahre!“ Hoss verzog das Gesicht, als habe er
Zahnschmerzen. „Unser Jüngster braucht eine Menge Zeit, um
ein Mädchen zu fragen, nicht wahr, Pa?“
Vor dem Haus erklangen Hufgetrappel und Kettenklirren.
Laut ratternd fuhr ein Wagen vor.
„Nanu!“ wunderte sich Ben Cartwright. „Erwartet ihr
jemanden?“
„Nein!“ Hoss schüttelte den Kopf.
„Wer kann das sein?“ überlegte sein Vater.

„Keine Ahnung!“ Hoss zuckte die Achseln.
Draußen erklangen Schritte. Die Tür öffnete sich knarrend.
Dann erkannten sie den Besucher…

Ein überraschender Besuch
„Störe ich?“ fragte Len Keith.
„Nein“, sagte Ben Cartwright. „Komm nur herein!“
Der Besucher lächelte arrogant, als er über die Schwelle trat.
Hoss starrte ihn feindselig an. Der Silberbaron tat, als bemerke
er es nicht.
„Guten Abend, Hoss!“ grüßte er freundlich.
Hoss wollte nicht unhöflich sein.
„‘n Abend, Mr. Keith“, brummte er.
Len Keith ging mit ausgestreckten Armen auf den Hausherrn
zu.
„Hallo – Ben!“ rief er. „Wie geht’s?“
„Ich bin zufrieden“, gestand Ben Cartwright.
„Ich werde dich nicht lange aufhalten“, versprach der
Besucher.
„Das würde dir auch nicht gelingen“, erklärte Ben
Cartwright. „Wir haben heute noch etwas vor!“
„Wir wollen auf das Fest“, ergänzte Hoss.
„Richtig!“ lächelte der Silberbaron. „Ich gehe mit Virginia
auch hin! Vorher hätte ich gern noch etwas mit dir besprochen.
Wenn möglich, unter vier Augen!“
„Verstehe!“ Hoss machte Anstalten, den Raum zu verlassen.
„Ich muß das hier sowieso noch wegräumen!“ Er packte den
Holzzuber mit beiden Händen und trug ihn mühelos hinaus.
Der Hund folgte ihm bellend.
„Nimm Platz!“ forderte Ben Cartwright den Besucher auf.
„Danke!“ Der Silberbaron setzte sich in einen der
ledergepolsterten Lehnstühle.

Ben Cartwright lehnte am Kamin, die rechte Hand auf das
Sims gestützt.
„Also – was hast du auf dem Herzen?“ erkundigte er sich.
„Ted McKaren war vorhin bei mir“, sagte Len Keith. „Der
Junge war ziemlich aufgeregt, weil er Krach mit seinem Vater
gehabt hat…“
„Ich weiß!“ nickte Ben Cartwright. „Ich war gerade bei
Andy, als es passierte. Aber das hat dir Ted sicher erzählt.“
„Weißt du, Ben“, versicherte der Besucher, „ich mag Ted. Er
ist ein netter Junge. Vielleicht ein bißchen zu ehrgeizig, aber
das ist in meinen Augen kein Fehler…“
„Da bin ich anderer Ansicht“, widersprach ihm Ben
Cartwright. „Falscher Ehrgeiz hat schon vielen geschadet!
Gerade jungen Menschen! Ich kenne eine Menge Existenzen,
die dadurch vernichtet wurden!“
„Die Gefahr besteht bei Ted nicht“, erklärte der Silberbaron.
„Ich kann das beurteilen. Ich kenne ihn bereits gut genug. Du
weißt ja, der Junge wird demnächst mein Schwiegersohn.
Deshalb werde ich besonders auf ihn aufpassen, damit er nicht
allzu viele Dummheiten macht! Du könntest mir übrigens
dabei helfen!“
„Ich?“ Ben Cartwright blickte ihn verwundert an. „Warum
gerade ich?“
„Ted hält sehr viel von dir“, behauptete der Besucher. „Auch
jetzt noch, nach allem, was heute zwischen euch passiert ist.“
„Ich weiß nicht!“ Ben Cartwright schien davon nicht so
überzeugt. „Früher mag das richtig gewesen sein. Aber heute?“
„Ted ist noch etwas jung“, entschuldigte Len Keith seinen
zukünftigen Schwiegersohn. „Noch nicht ganz trocken hinter
den Ohren, wie man so schön sagt. Er schießt leicht über das
Ziel hinaus. Aber das können wir doch verstehen, nicht wahr,
Ben?“ Er lächelte gewinnend. „Wir sind doch auch mal jung
gewesen!“

„Stimmt!“ gab Ben Cartwright zu. „Wir waren auch keine
Engel!“
„Wir wollten auch mit dem Kopf durch die Wand“, erinnerte
sich der Besucher. „Aber dann haben wir uns langsam die
Hörner abgestoßen. Wir haben gearbeitet. Und jetzt haben wir
es geschafft! Ich denke, wir können zufrieden sein.“
„Es gibt eine Menge Möglichkeiten, zu Geld zu kommen“,
gab Ben Cartwright zu.
Der Silberbaron lachte nervös.
„Wie schön, daß wir heute in der Lage sind, den jungen
Leuten eine vernünftige Starthilfe zu geben“, erklärte er. „Ich
jedenfalls werde Ted helfen, wo ich kann. Und du solltest es
auch tun, Ben!“
„Das war eine großartige Rede“, sagte Ben Cartwright. „Aber
du konntest ja schon immer gut reden, Len! Warum bist du
wirklich gekommen?“
„Das habe ich dir doch gerade gesagt.“ Len Keith lächelte
liebenswürdig. „Ich bin Teds wegen gekommen! Nicht
meinetwegen, wie du jetzt vielleicht annimmst.“
„Also gut“, sagte Ben Cartwright. „Du willst, daß ich Ted
helfe. Vielleicht erklärst du mir dann auch, wie ich das machen
soll.“
„Ted will ein Stück Land verkaufen!“ Der Besucher bemühte
sich, ohne Anteilnahme zu sprechen, als ob er nur einen
Tatbestand darstellte. „Aber sein Vater ist dagegen. Deshalb
braucht der Junge deine Hilfe. Ich weiß, daß der alte McKaren
meistens das tut, was du ihm rätst!“
„Da irrst du dich“, sagte Ben Cartwright. „Andy McKaren
weiß allein, was er zu tun hat. Dazu braucht er nicht meinen
Rat. Er hat das oft genug bewiesen!“
Der Silberbaron verzog die Lippen zu einem spöttischen
Lächeln.

„Aber, Ben!“ Die Stimme klang belustigt. „Du willst
hoffentlich nicht bestreiten, daß Andy McKaren meistens auf
dich hört. Also mach ihm klar, daß er die Zukunft seines
Sohnes gefährdet, wenn er mir dieses Land nicht verkauft!“
„Wirklich?“ Diesmal war es Ben Cartwright, der spöttisch
lächelte. „Es ist rührend, wie du dich für den Jungen einsetzt!
Sicher hast du dabei nur sein Wohl im Auge.“
„Das bin ich den beiden schuldig“, versicherte der Besucher
salbungsvoll. „Dem Jungen und meiner Tochter, die ihn einmal
heiraten wird!“
„Das hast du wirklich schön gesagt“, lobte ihn Ben
Cartwright. „Man könnte vor Rührung Tränen vergießen.
Leider kenne ich dich besser! Du bist alles andere als ein
Wohltäter! Vergiß das nicht!“
„Was soll ich nicht vergessen?“ fragte Len Keith verwundert.
„Du hast hier ein Vermögen gemacht“, sagte Ben Cartwright.
„Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn du bei deinen
Methoden etwas wählerischer gewesen wärest! Du hast nie
gefragt, was aus den Menschen wird, die du ausgenutzt und
betrogen hast…“
„Das ist eine Verleumdung!“ Der Besucher sprang wütend
auf.
„Hör zu, Len!“ Ben Cartwright trat ganz nahe an ihn heran.
„Falls Ted McKaren dein nächstes Opfer werden soll! Ich
werde nicht zulassen, daß dem Jungen etwas passiert! Ich
hoffe, du hast mich verstanden.“
Auf den ersten Blick konnte Len Keith leicht etwas lächerlich
wirken, schon wegen seiner stutzerhaften Kleidung. Jetzt war
nichts Lächerliches an ihm. Alles an ihm war drohend und
böse. Seine Lippen bewegten sich kaum.
„Gut!“ sagte er. „Du hast es nicht anders gewollt! Wir hätten
die Sache in Frieden miteinander regeln können. Aber es gibt
auch eine andere Möglichkeit!“

Das war eine offene Drohung. Ben Cartwright war nicht der
Mann, der sich durch Worte einschüchtern ließ. Er nahm sie
aber auch so ernst, wie sie gemeint waren. Sein
Gesichtsausdruck verriet nichts von seinen Gedanken. Er
strahlte noch immer überlegene Ruhe aus.
Der Besucher verbeugte sich mit kalter Höflichkeit.
„Guten Abend, Ben! Ich hoffe, du bereust deinen Entschluß
nicht eines Tages.“
Len Keith verließ eilig das Zimmer. Die Tür fiel krachend
hinter ihm ins Schloß. Eine Weile war es still, dann tönte von
draußen Peitschenknallen. Ein Wagen fuhr polternd an. In das
Wiehern der Pferde tönte Hufgetrappel. Die Geräusche
verloren sich schnell in der Ferne.
„Was hat er gewollt, Pa?“ Hoss stand fragend am Fuße der
Treppe.
Ben Cartwright hatte dem davonfahrenden Wagen durch das
Fenster nachgeschaut. Jetzt drehte er sich langsam um und
blickte seinen Sohn an.
„Ich sollte Andy McKaren überreden, damit er Len Keith das
Land verkauft“, sagte er. „Um Ted zu seinem Glück zu
verhelfen!“
„Das hört sich gut an“, meinte Hoss. „Aber Len Keith denkt
immer bloß an sich!“
Es wurde dunkel. Die Sonne verschwand mit überraschender
Schnelligkeit.
Die Kerze auf dem Kaminsims brannte mit ruhiger, stetiger
Flamme. Sie flackerte unruhig in dem Luftzug, als plötzlich
die Haustür geöffnet wurde.
Little Joe kam herein. Er strahlte vor Sauberkeit.
„Seid ihr fertig?“ erkundigte er sich.
Hoss ging vorsichtig auf ihn zu, die Nase weit vorgestreckt.
Er schnupperte eifrig.
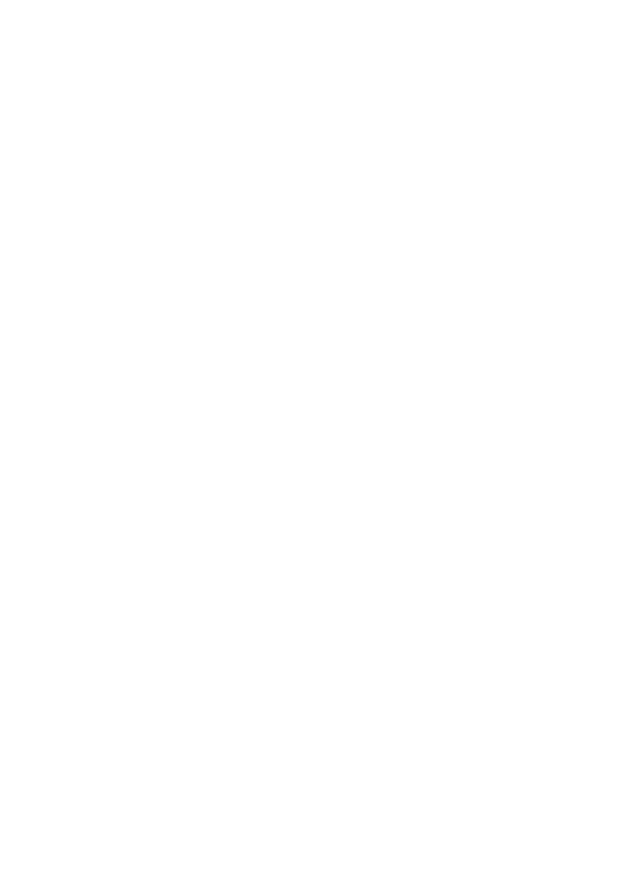
„Wahrhaftig!“ rief er. „Man riecht nichts mehr! Unser
Stinktier hat gebadet!“
Ben Cartwright blickte auf die Uhr.
„Wir wollen aufbrechen“, sagte er.
Es wurde wirklich höchste Zeit, wenn sie den Beginn des
Festes nicht verpassen wollten…

Ohne Prügel geht es nicht
Einmal im Jahr veranstalteten die Rancher aus dem Carson
Valley ein Tanzvergnügen, das sie mit ihren Frauen, Töchtern
und Söhnen besuchten.
Die Männer fachsimpelten an der Theke. Die Frauen saßen
an den Tischen, tauschten Erfahrungen über Kindererziehung
und Haushalt aus und beobachteten stolz die Söhne und
Töchter, die sich auf der Tanzfläche amüsierten.
Hoss hielt sich zunächst an der Seite seines Vaters auf.
Nachdem er mehrere Gläser Whisky getrunken hatte, wagte
auch er sich auf die Tanzfläche. Seine Wahl fiel auf eine
Partnerin, die fast ebenso groß und dick war wie er.
„Wie zwei Elefantenbabys“, grinste Little Joe respektlos, als
er die beiden sah. Er selbst ließ keinen Tanz aus, aber er
wechselte stets die Tänzerin.
Ted McKaren tanzte nur mit seiner Braut. Virginia trug das
Haar zu einem dicken Nackenknoten aufgesteckt. Sie strahlte
vor Glück. Ihre Wangen glühten. Sie seufzte leise auf.
„Ich kann nicht mehr“, erklärte sie atemlos. „Es tut mir leid,
Ted, aber wir wollen eine Pause machen. Laß uns etwas
trinken!“
„Entschuldige!“ Ted blickte bestürzt. „Ich bin ein Scheusal,
weil ich nicht selbst daran gedacht habe! Aber für mich gibt es
nichts Schöneres, als mit dir zu tanzen!“
Die Kapelle spielte unermüdlich. Die drei Musiker standen
auf einer winzigen Estrade. Der Geiger fiedelte mit wiegendem
Oberkörper. Der Klarinettenspieler verdrehte verzückt die
Augen, während er mit vollen Backen blies. Der Mann am
Kontrabaß schob seinen Bogen wie eine Säge hin und her.

In die Musik mischten sich grölende Männerstimmen,
Frauenlachen, Geklirr von Flaschen, Gläsern und Bechern. Der
Raum war erfüllt von bläulichem Zigarrenrauch.
Ted trat mit Virginia an die Theke.
„Was willst du trinken?“ fragte er.
„Wie wär’s mit einem Glas Punsch?“ schlug Virginia vor.
„Okay!“ sagte Ted McKaren. Er gab die Bestellung an den
Barkeeper weiter.
„Hallo – ihr beiden!“ Little Joe kam auf sie zu.
„Hallo, Joe!“ begrüßte ihn Virginia. „Lebst du noch? Ich
habe dich lange nicht gesehen!“
„Dem ist leicht abzuhelfen“, grinste der jüngste Cartwright.
Der Barkeeper stellte zwei dampfende Gläser vor Ted und
Virginia auf die Theke.
„Mir einen Whisky“, sagte Little Joe.
Der Barkeeper nahm einen großen Becher vom Bord und
füllte ihn aus einer Flasche halbvoll mit einer goldgelben
Flüssigkeit. Dann stellte er ihn vor den Gast hin.
Joe blickte das Mädchen an seiner Seite bewundernd an.
„Du siehst großartig aus, Virginia“, sagte er.
Das Mädchen schenkte ihm ein strahlendes Lächeln.
„Danke, Joe!“
„Freut mich, daß dir meine Braut gefällt!“ mischte sich Ted
ein.
„Ich beneide dich um Virginia“, erklärte Little Joe. „Du bist
mir leider zuvorgekommen. Wann heiratet ihr eigentlich?“
„Wir heiraten, sobald dein Vater sich nicht mehr in meine
Angelegenheiten mischt“, erklärte Ted.
Er starrte Little Joe wütend an.
„Ted!“ flehte Virginia. „Mußt du mir unbedingt das Fest
verderben?“
„Ted hat es nicht so gemeint“, entschuldigte Little Joe den
Schulfreund.

„Hör zu, Joe!“ Ted trat wütend auf ihn zu. „Ich meine immer,
was ich sage! Falls du daran zweifeln solltest, werde ich es dir
gern beweisen!“
„Ted!“ sagte Virginia. Ihre Stimme bebte vor Angst. „Ich
möchte tanzen!“
„Dann laßt euch nicht länger stören!“ Little Joe wandte sich
gleichmütig ab.
Ted packte ihn wütend an der Schulter.
„Dreh mir nicht den Rücken zu, Cartwright!“ schrie er.
Little Joe blickte starr auf einen Schnapsfleck auf der Theke.
Es kostete ihn große Anstrengung, Ted nicht gebührend zu
antworten. Er hielt sich nur mit Mühe zurück.
„Hast du nicht gehört?“ ‘brüllte Ted McKaren. „Du hast doch
nicht etwa Dreck in den Ohren?“
Little Joe drehte sich langsam um.
„Gut!“ sagte er. „Wenn du dich unbedingt prügeln willst,
dann komm mit nach draußen. Es muß nicht gerade hier sein!“
„Warum nicht?“ höhnte Ted. Dann schlug er überraschend
zu.
Aber Little Joe hatte sich blitzschnell geduckt, so daß ihn die
Faust verfehlte.
„Warte!“ schrie Ted, außer sich vor Wut. „Das sollst du mir
büßen! Jetzt rechnen wir miteinander ab!“
Virginia war schreckensbleich zu einer Gruppe eifrig
diskutierender Männer gestürmt.
„Mr. Cartwright!“ rief sie. „Ted und Joe prügeln sich!“
Ben Cartwright drängte sich sofort zwischen die beiden
Kämpfer.
„Aufhören!“ befahl er. „Ihr seid wohl verrückt geworden!“
Die drei Musiker hatten aufgehört zu spielen. Alle im Saal
starrten entsetzt auf Ted und Little Joe, die sich schwer atmend
gegenüberstanden.
Hoss’ mächtige Gestalt tauchte vor Ted auf.

„Willst du unbedingt Ärger haben, mein Junge?“ erkundigte
er sich.
Ted verzog das Gesicht zu einer Grimasse.
„Hau ab, Cartwright!“ sagte er. „Der Teufel soll euch holen!
Ich kann keinen von euch mehr sehen!“
Hoss holte tief Luft.
„Komm, Vater!“ sagte Virginia. „Wir gehen!“
Len Keith verließ mit seiner Tochter den Saal.
Ted starrte ihnen ungläubig nach. Dann trat er an die Theke
und trank mit einem Zug sein Glas leer.
„Noch einmal dasselbe!“ bestellte er.
„Hast du etwas abgekriegt?“ fragte Hoss seinen Bruder.
Little Joe schüttelte den Kopf.
Auf einmal setzte die Musik wieder ein. Die Geige
schluchzte. Die Klarinette dudelte, und der Kontrabaß
brummte den Takt dazu. Die Paare tanzten wieder.
Ben Cartwright blickte seinen Sohn strafend an.
„Ich verstehe dich nicht, Joe“, sagte er. „Ja, ja – ich weiß!
Ted hat dich zuerst geschlagen! Aber ob eine Schlägerei das
richtige Mittel ist, Ted zur Vernunft zu bringen, das möchte ich
bezweifeln!“ Er schüttelte mißbilligend den Kopf.
„Tut mir leid, Pa!“ erklärte Little Joe. „Ich wollte die
Schlägerei nicht, aber er hat mich herausgefordert!“
„Ted ist nicht schlecht“, meinte Ben Cartwright. „Irgend
jemand hat ihn aufgehetzt!“
„Ich weiß auch, wer“, sagte Hoss.
„Ich glaube, wir wissen alle, daß Ted ganz unter Len Keiths
Einfluß steht“, stellte Little Joe fest.
„Das ist auch kein Wunder“, hielt ihm sein Vater vor.
„Schließlich will er Virginia heiraten. Kannst du es ihm da
übelnehmen, wenn er auf seinen Schwiegervater hört?“

„Das nimmt für Ted noch ein schlimmes Ende“, prophezeite
Hoss. „Ich kann mir nicht denken, daß es Len Keith nur um die
Ranch geht! Der hat etwas anderes vor, glaub’ mir, Pa!“
„Wahrscheinlich will er das ganze Tal in eine einzige
Silbermine verwandeln“, vermutete Ben Cartwright.
„Einschließlich der Ponderosa“, warf Little Joe ein.
„Das ist durchaus möglich“, gab sein Vater zu. „Aber wir
drei wissen, daß es niemals dazu kommen wird!“
Darin waren sich Ben Cartwright und seine Söhne einig…

Eiliger Aufbruch
Virginia blieb in der Dunkelheit stehen. Die Musikfetzen, die
aus dem Tanzsaal klangen, erweckten in ihr ein Gefühl der
Verlassenheit. Sie drehte sich um.
Die Fenster leuchteten in sattem Goldgelb. Dahinter konnte
sie die wogende Menge sehen. Helles Lachen und laute
Stimmen drangen an ihr Ohr. Sie seufzte auf.
„Was hast du?“ fragte ihr Vater, der ebenfalls
stehengeblieben war.
„Ich glaube, es ist besser, wenn ich wieder hineingehe“, sagte
Virginia. „Ich darf Ted jetzt nicht allein lassen!“
„Nein, Ginny“, widersprach ihr Len Keith. „Das! würde ich
nicht tun! Laß ihn jetzt lieber in Ruhe, dann renkt sich die
Sache ganz von allein wieder ein!“
„Ich weiß nicht!“ Virginia blickte ihn zweifelnd an.
„Manchmal frage ich mich, ob deine Ratschläge wirklich gut
für uns sind.“
„Aber, Ginny!“ Ihr Vater lachte heiser auf. „Ich kann mich
nicht erinnern, dich jemals schlecht beraten zu haben.“
„Ich spreche auch nicht von mir“, belehrte ihn Virginia. „Ich
spreche von Ted! Er hat sich sehr verändert, seitdem du ihn
berätst! Er ist ein ganz anderer Mensch geworden!“
„Er ist ein Mann geworden“, erklärte Len Keith nicht ohne
Stolz. „Das ist kein Fehler, wenn du mich fragst. Wenn er so
weitermacht, werde ich eines Tages einen würdigen
Nachfolger haben!“
„Das interessiert mich nicht“, gestand Virginia.
„Liebes Kind!“ Ihr Vater lächelte nachsichtig. „Das sagst du
jetzt! Später wirst du anders darüber denken!“

„Mich interessiert nur, ob ich mit Ted glücklich werde“, sagte
Virginia.
Der Mond war hinter den Wolken hervorgekommen. Die
Sterne flimmerten blaß. Nicht weit von Len Keith und seiner
Tochter entfernt stand eine mächtige Eiche. Unter ihrem
schützenden Blätterdach stand der Wagen. Die Pferde
scharrten unruhig mit den Hufen.
Vater und Tochter waren jetzt so weit von dem Saal entfernt,
daß sie den Lärm des Festes nicht mehr hörten. Virginia
erschrak, als in der Ferne ein Hund bellte.
„Komm“, sagte ihr Vater. „Laß uns nach Hause fahren!“
Virginia zog den dunklen Kaschmirschal fröstelnd’ über ihre
Schultern. Die Brillanten, die in ihrem Haar wie in einem Nest
steckten, schimmerten hell, ihr Kleid leuchtete
phosphoreszierend im Mondlicht, als sie ihrem Vater zum
Wagen folgte.
Plötzlich tauchte eine Gestalt vor ihr auf.
„Gott sei Dank“, keuchte Little Joe, „daß ich dich noch
gefunden habe. Ich möchte mich noch bei dir entschuldigen!“
„Wieso?“ Virginia sah ihn verwundert an. „Es war doch nicht
deine Schuld.“
„Nett, daß du das sagst!“ Little Joe lächelte erlöst.
„Der Fall ist für uns erledigt“, erklärte Len Keith.
Little Joe hatte es plötzlich eilig.
„Wiedersehn, Virginia!“ Er reichte ihr zum Abschied die
Hand. „Komm gut nach Hause!“
„Amüsiere dich noch gut“, lächelte Virginia unter Tränen.
Little Joe ging zum Tanzsaal zurück.
„Komm, Ginny! Steig ein!“ Ihr Vater öffnete den
Wagenschlag.
„Warte!“ sagte Virginia. „Ich möchte dich noch etwas
fragen!“

„Nicht jetzt! Und nicht hier!“ erklärte Len Keith. „Zu Hause
stehe ich dir gern Rede und Antwort!“
„Gut!“ nickte Virginia. „Warten wir, bis wir wieder zu Hause
sind!“
Len Keith hob sie auf den gepolsterten Wagensitz. Dann stieg
er ebenfalls ein. Virginia rückte zur Seite, um ihm Platz zu
machen. Ihr Vater ergriff die Zügel. Die Peitsche in der Hand,
zögerte er einen Augenblick.
„Bist du sehr unglücklich?“ fragte er.
Sie sah mit Tränen in den Augen zu ihm auf.
Ihr Anblick erschreckte ihn.
„Es wird bestimmt wieder alles gut“, versprach er.
Virginia lehnte sich schweigend zurück, den Kopf fest gegen
das Polster gepreßt. Ihr Vater schnalzte mit der Zunge. Die
Pferde zogen an, und der Wagen rollte schnell davon.
Der holperige Weg wand sich durch Täler und über weite
Hänge, vorbei an dichtbewaldeten Hügeln. Die Kronen der
Tannen zeichneten gespenstische Schatten in das Mondlicht.
Eine Zeitlang führte der Weg am Rande des sumpfigen
Graslandes entlang, das im vergangenen Sommer
trockengelegt worden war. Ab und zu kamen sie an einem
einsamen Holzhaus vorbei.
Weder Virginia noch ihr Vater sprach ein Wort. Das
Rumpeln des Wagens und der Hufschlag ihrer Pferde waren
die einzigen Geräusche in der Stille der Nacht.
Als sie in die Einfahrt zu ihrem Haus einbogen, hörten sie
wütendes Hundegekläff. Ein paar schemenhafte Gestalten
huschten eilig über den Hof.
„Nanu?“ wunderte sich Len Keith. „Was ist denn hier los?“
Er zog heftig an der Leine, um die Pferde zum Stehen zu
bringen, als sie vor dem Haus angelangt waren.
Virginia sprang aus dem Wagen, bevor ihr der Vater helfen
konnte. Eilig rannte sie die Stufen zur Veranda hinauf.

Len Keith war gerade ausgestiegen, als ein Mann neben ihm
auftauchte. Zuerst konnte er ihn in der Dunkelheit nicht
erkennen. Dann sah er, daß es einer seiner Leute war.
„Entschuldigen Sie, Mr. Keith“, sagte Sam Tucker, „wenn
ich Sie jetzt noch störe. Aber ich muß Sie unbedingt
sprechen!“
„Jetzt?“ Len Keith runzelte die Stirn. „Hat das nicht bis
morgen Zeit?“
„Ich fürchte nein“, bedauerte Sam Tucker.
Virginia stand albwartend auf dem Treppenpodest vor der
Haustür.
Ihr Vater überlegte kurz.
„Geh schon hinein!“ sagte er. „Ich komme gleich nach!“
Virginia gehorchte schweigend. Leise fiel die Haustür hinter
ihr ins Schloß…

Eine schlechte Nachricht
„Was ist los, Tucker?“ wandte sich Len Keith an den Cowboy.
„Mr. Keith“, sagte Sam Tucker. „Sie haben doch die zwanzig
Kühe aus Texas gekauft.“
„Wieso?“ fragte der Silberbaron. „Ist mit ihnen etwas nicht in
Ordnung?“
Sam Tucker nickte bekümmert.
„Sie sind alle krank“, erklärte er.
„Krank?“ Len Keith glaubte nicht richtig zu hören.
„Kommen Sie mit ‘rüber!“ Sam Tucker führte ihn zur
Scheune, die auf der anderen Seite des Hofes stand.
Der Silberbaron folgte ihm schweigend. Nur wer durch lange
Vertrautheit jeden Zollbreit der Scheune kannte, konnte hier
auf eine Laterne verzichten. Das Mondlicht sickerte nur
spärlich herein.
Aus einer Ecke tönte lautes Stöhnen. Sie gingen den Lauten
nach und sahen, was geschah: Ein Mann schlug wütend auf
einen anderen ein, der gefesselt im Heu lag.
„Aufhören!“ befahl Len Keith.
Der Schläger gehorchte sofort. Sein Opfer ächzte. Der
Silberbaron wandte sich ab.
„Das genügt, Roy“, sagte er.
„Der Kerl hat einen Denkzettel verdient“, erklärte Sam
Tucker. „Er hat uns die kranken Kühe verkauft! Sie hätten
unser ganzes Vieh angesteckt, wenn wir es nicht rechtzeitig
gemerkt hätten!“
„Wo habt ihr die kranken Tiere hingebracht?“ erkundigte sich
Len Keith.

„Wir haben sie ins Nordgehege getrieben“, berichtete der
Cowboy. „Morgen früh wollen wir die Tiere töten und
eingraben.“ Er wies mit dem Kopf auf den Mann, der gefesselt
im Heu lag. „Wenn es nach mir ginge, würde ich es mit dem
da genauso machen!“
„Bring ihn ‘raus!“ befahl der Silberbaron dem zweiten
Cowboy. „Ich will ihn nicht mehr sehen! Und sprich mit
niemandem über die kranken Kühe.“
„Keine Angst, Boß!“ versicherte Roy Wilkins.
Er zog ein Messer aus der Tasche und schnitt dem Mann, der
vor Schmerzen leise wimmerte, die Fußfesseln durch. Dann
führte er ihn auf den Hof hinaus.
Len Keith nahm Sam Tucker beiseite.
„Der Mann hat bestimmt gesagt, daß er nichts von der
Krankheit wußte“, vermutete der Silberbaron.
„Stimmt!“ nickte der Cowboy. „Er hatte keine Ahnung!
Wahrscheinlich hat er die Kühe irgendwo gestohlen.“
„Sind alle zwanzig krank?“ wollte Len Keith wissen.
„Keine Frage!“ sagte Sam Tucker. „Eine Kuh, die das
Texasfieber hat, steckt die anderen an.“
„Du meinst, eine kranke Kuh kann eine ganze Herde
anstecken?“ Der Silberbaron starrte gedankenverloren vor sich
hin.
„So ist es“, bestätigte der Cowboy. „Deshalb ist die Sache ja
so gefährlich!“
„Tucker“, sagte Len Keith. „Sorge dafür, daß der Mann, der
uns die Kühe verkauft hat, verschwindet und nie wieder
hierherkommt!“
„Das kann ich machen“, versprach der Cowboy. Er lächelte
verschlagen. „Aber wie soll ich das verstehen? Das mit dem
Verschwindenlassen?“
„Das ist deine Sache“, erklärte der Silbenbaron. „Du wirst es
bestimmt nicht bereuen!“

„Das weiß ich, Herr“, versicherte Sam Tucker eifrig. Durch
die offene Scheunentür kam die Nachtkühle herein.
Er spürte den Luftzug kalt in seinem schweißnassen Nacken.
„Und noch etwas, Tucker“, sagte Len Keith. „Du wirst die
kranken Kühe erst töten, wenn ich dir Bescheid gebe!“
„Das ist gefährlich für Ihre ganze Herde“, warnte der
Cowboy.
„Nicht für meine“, verbesserte ihn der Silberbaron, „sondern
für die Herde der Cartwrights! Vielleicht möchte ich ihnen ein
paar kranke Kühe schenken.“
„Das werden sich die Cartwrights kaum gefallen lassen“,
befürchtete Sam Tucker.
„Sofern sie es bemerken“, schränkte Len Keith ein.
„Ich verstehe!“
Der Cowboy blickte seinen Herrn bewundernd an. Er hatte
endlich begriffen.
„Du darfst dich natürlich dabei nicht erwischen lassen“,
erklärte der Silberbaron.
„Eine schwere Aufgabe“, sagte Sam Tucker. Er zählte im
Geiste schon die Silberdollars, die er damit verdienen würde.
„Es wird sich für dich lohnen“, versprach ihm Len Keith.
„Vorausgesetzt, du machst deine Sache gut!“
„Auf mich können Sie sich verlassen!“ Der Cowboy lächelte
selbstsicher. „Was ich in die Hand nehme, das klappt! Bis
morgen früh ist alles erledigt!“
„Ein schöner Gedanke!“ freute sich der Silberbaron. „Bisher
haben hier alle nach Ben Cartwrights Pfeife getanzt. Das wird
sich jetzt endlich ändern!“
„Darauf können Sie sich verlassen, Mr. Keith!“ Sam Tucker
grinste schadenfroh.
„Ich möchte das Gesicht von Ben Cartwright sehen“, sagte
Len Keith, „wenn er morgen früh aufwacht und feststellt, daß
seine Herde über Nacht größer geworden ist!“
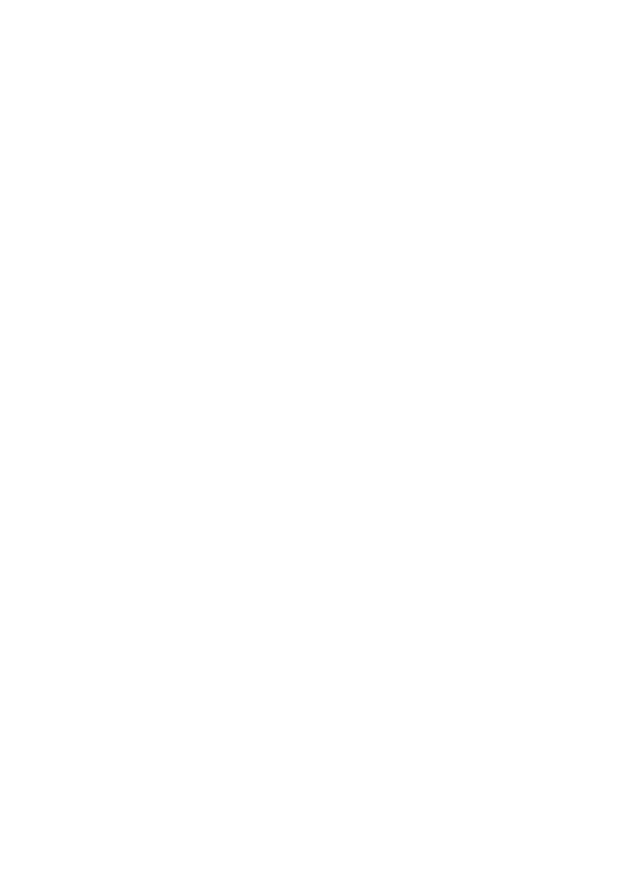
„Schade, daß wir das nicht miterleben können“, bedauerte der
Cowboy. „Seine Freude wird allerdings nur kurz sein!“
„Du weißt, was für dich und mich auf dem Spiel steht,
Tucker“, erinnerte ihn der Silberbaron. „Also mach deine
Sache gut!“
Len Keith trat, ohne eine Antwort abzuwarten, auf den Hof
hinaus.
Der Mond war wieder hinter den Wolken verschwunden. Es
war so finster, daß man nicht die Hand vor Augen sehen
konnte. Die Gelegenheit war günstig. Die Nacht war wie
geschaffen für dunkle Pläne…

Hoss entdeckt etwas
Die Luft flimmerte über der weiten Grasfläche, die mit
Sträuchern und Weidengestrüpp dürftig bewachsen war.
Mitten darauf stand die dunkle Masse der Herde.
Die Rinder stoben aufgeschreckt hoch, als die drei Reiter
heransprengten. Die Kühe blieben unschlüssig stehen und
warfen die Köpfe hoch. Dann zogen sie langsam weiter. Die
Bullen scharrten zornig mit den Hufen auf dem Boden und
warfen Rasenstücke umher, bevor sie wild davonstampften.
Ben Cartwright blieb etwas zurück, während seine Söhne an
der rechten und linken Flanke der Herde entlanggaloppierten.
Hoss pfiff seinem Hund, der weit zurückgeblieben war.
Plötzlich scheute seih Pferd und sprang laut wiehernd zur
Seite.
Vor ihm lag der Körper einer Kuh. Dahinter warfen einige
große Kühe die Köpfe .hoch und stürmten in die
Weidenbüsche. Eine strauchelte, lief taumelnd im Kreise
herum und fiel schließlich ebenfalls in das Gras.
Hoss sprang vom Pferd und ging zu der leblos daliegenden
Kuh. Er berührte sie leicht am Kopf. Ihre schön gezeichnete
Stirn hatte eine krankhaft graue Farbe. Die Zunge hing aus
dem Maul, schwarz und geschwollen.
Ben Cartwright kam besorgt herangesprengt.
„Was ist mit der Kuh?“ fragte er.
„Tot“, sagte Hoss. „Ich tippe auf Texasfieber!“
Sein Vater erschrak.
„Bist du dessen sicher?“
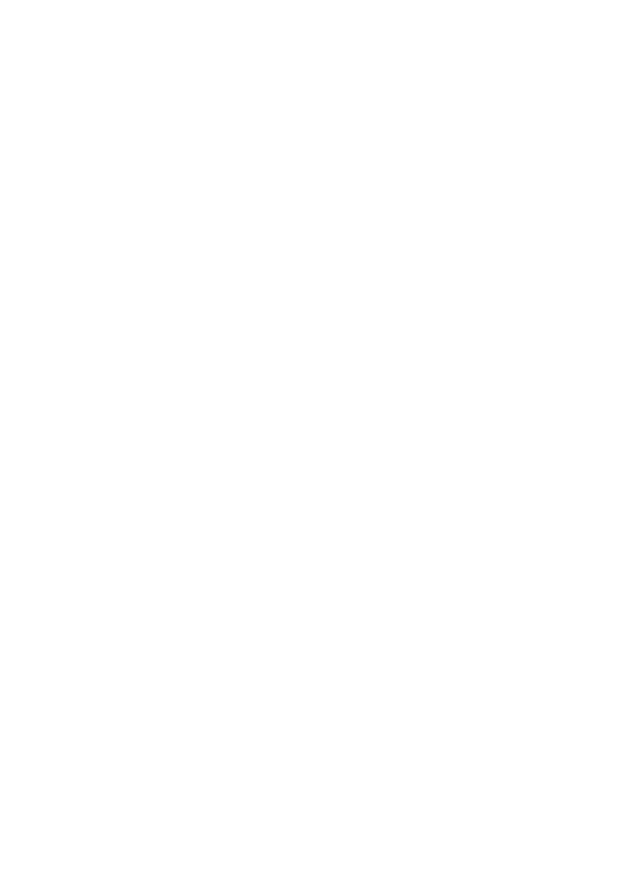
„Ich glaube schon!“ Hoss hatte sich wieder aufgerichtet. Er
schob seinen Stetson ins Genick. „Alle Anzeichen sprechen
dafür!“
„Die Rinder, die wir aus Texas gekauft haben, waren doch
gesund“, erinnerte sich Ben Cartwright. Er blickte sich prüfend
im Sattel um. „Was ist mit den anderen Tieren?“
„Ich habe auch ein paar kranke Rinder gefunden“, meldete
Little Joe.
Ben Cartwright überlegte kurz.
„Da hilft nur eines“, sagte er. „Wir müssen die kranken Tiere
von den gesunden trennen.“
„Und dann?“ fragte Little Joe.
„Wahrscheinlich werden wir die kranken Tiere töten
müssen“, vermutete Hoss.
„Bestimmt sogar“, bestätigte sein Vater. „Es gibt nichts
Ansteckenderes als Milbenfieber! Die Herden der ganzen
Umgebung sind in Gefahr!“
„Eine schöne Bescherung!“ Hoss kratzte sich wütend hinter
dem Ohr. „Wenn man den armen Tieren bloß helfen könnte.“
Er blickte betrübt auf die tote Kuh vor seinen Füßen.
Sie mußte unter fürchterlichen Qualen verendet sein. Ein paar
Meter weiter hatte sich die andere Kuh wieder taumelnd auf
die Beine gestellt. Blutiger Schaum troff ihr aus dem Maul.
„Paß auf!“ rief Hoss seinem Bruder zu. „Sie darf nicht zur
Herde zurück!“
Der Hund kam hechelnd näher. Er umkreiste neugierig die
tote Kuh und schnupperte an dem schwarzweiß gefleckten
Leib.
„Hau ab!“ schrie Hoss. „Mach, daß du fortkommst!“ Er
scheuchte den Hund wütend davon. „Das fehlte mir gerade
noch, daß sich der Hund auch noch ansteckt!“
brummte er.
„Moment mal!“ rief Ben Cartwright. „Du hast doch damals
den Hund mit Schwefelseife gewaschen…“

„Ja!“ Hoss blickte erstaunt auf. „Was willst du damit sagen?“
„Überleg mal“, sagte sein Vater. „Wenn diese Seife das
Ungeziefer bei Hunden abtötet – warum nicht auch beim
Vieh?“
„Habe ich dich richtig verstanden?“ Little Joe starrte seinen
Vater ungläubig an. „Du willst jede Kuh und jeden Bullen
einzeln abwaschen?“
„Ja“, nickte Ben Cartwright. „Warum nicht? Wenn es
hilft…?“
„Viel Vergnügen“, stöhnte Little Joe.
„Das ist gar keine schlechte Idee“, kam Hoss seinem Vater zu
Hilfe.
„Außerdem brauchen wir nicht jedes Tier einzeln
abzuwaschen“, erklärte Ben Cartwright. „Wir graben einfach
ein Loch, so groß, daß ein Rind hineinpaßt. Das füllen wir mit
einer Lauge aus Wasser und Schwefelseife. Und dann treiben
wir die kranken Rinder einzeln hindurch!“
„Für so ein Bad würde eigentlich Schwefel genügen“,
überlegte Hoss.
„Stimmt!“ gab ihm sein Vater recht.
„Okay!“ Hoss war Feuer und Flamme. „Ich fahre gleich mal
zu Baker und hole so viel Schwefel, wie er am Lager hat!“
„Gut!“ nickte Ben Cartwright. „Aber vorher holen wir die
kranken Tiere aus der Herde ‘raus! Alle, die irgendwie krank
aussehen!“
„Einverstanden!“ Little Joe nahm sein Lasso vom Sattelhorn.
„Nein“, sagte Ben Cartwright. „Das machen wir anders. Wir
treiben die Herde erst mal in unser Gehege!“
Das Gehege war ein mit Korralzäunen umgebenes Stück
Grasland, durch das sich der Bach zwischen Weidenbüschen
hindurchwand. Es gab dort auch ein Blockhaus mit
aufgetürmten Heustapeln.

Ohne ein weiteres Wort zu wechseln, machten sich die drei
Männer an die Arbeit. Der Hund half ihnen dabei. Er umbellte
die Rinder wütend, schnappte nach ihren Hinterbeinen und
trieb sie vorwärts.
Mehrere Rinder standen wiederkäuend in einer Gruppe
zusammengedrängt an einem Wasserloch, die Bäuche gedehnt,
auf ihren weißgekräuselten Gesichtern lagen Behagen und
Sattheit. Sie ließen sich nur widerwillig von der Tränke
treiben.
Nicht nur die Bullen, auch die Kühe waren widerspenstig und
störrisch. Sie formierten sich nur zögernd zu einem Zug,
einzeln oder zu zweit oder dritt nebeneinander. Schwerfällig
schoben sie sich durch das Gras zum Gehege hin.
Die Rinder brüllten und keuchten. Die Schreie der Reiter, das
Stampfen der galoppierenden Pferde, das wütende
Hundebellen, das alles vermischte sich zu einem grandiosen
Lärm, der weit über die Ebene hallte.
Die beiden Reiter, die das Schauspiel aus der Ferne
beobachteten, sahen sich ratlos an.
„Sie haben etwas vor“, vermutete Sam Tucker.
„Unsinn!“ widersprach ihm Roy Wilkins. „Sie können nichts
anderes machen, als die kranken Rinder töten!“
„Meinst du?“ Sam Tucker schien nicht so sicher. „Wir
werden sehen! Den Cartwrights ist alles zuzutrauen!“
Schließlich befand sich die ganze Herde im Gehege.
Keuchend, mit fliegenden Flanken und gesenkten Köpfen,
stand Rind an Rind in der Umzäunung. Bald würden sie den
aufgetürmten Heustapeln zu Leibe gehen.
Die Cartwrights zählten schnell durch. Die Herde war
vollzählig. Kein Tier befand sich mehr außerhalb der
Korralstangen.
„Hat prima geklappt!“ freute sich Little Joe.
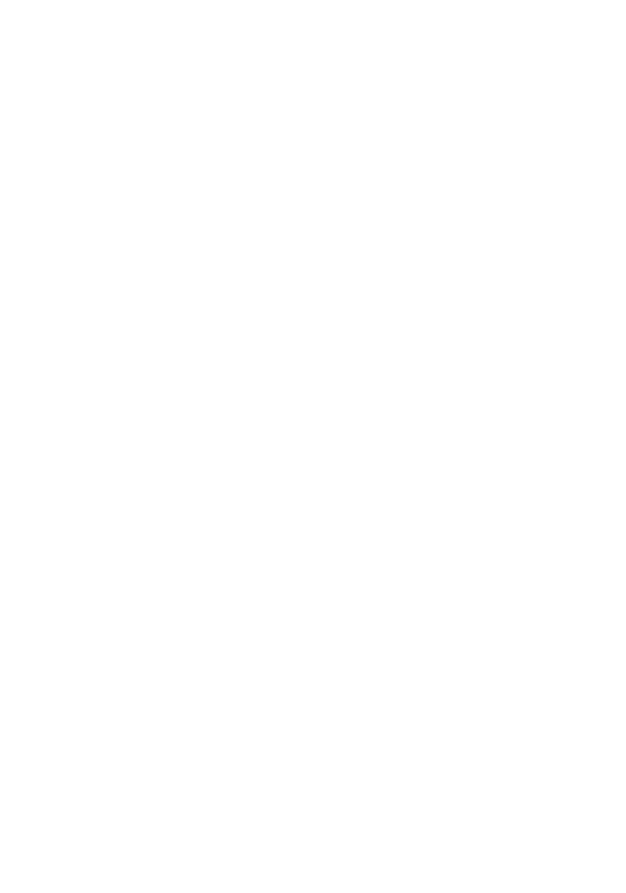
„Wir beide trennen jetzt die kranken Tiere von den
gesunden“, erklärte Ben Cartwright.
„Und ich fahre zu Baker“, sagte Hoss.
„Beeil dich“, ermahnte ihn sein Vater, „damit du vor
Einbruch der Dunkelheit wieder zurück bist!“
„Okay!“ Hoss galoppierte davon.
Sam Tucker und Roy Wilkins warteten, hinter einem Busch
verborgen, bis der Reiter vorbei war. Dann folgten sie ihm
heimlich…

Eine Strafpredigt
Die Männer, die an dem Schanktisch lümmelten, gegenüber
dem riesigen Spiegel und dem Bord mit den vielen Flaschen,
starrten Virginia verwundert an, als sie durch die Pendeltür den
Saloon betrat.
Es war nicht sehr hell in dem Raum. Das Sonnenlicht drang
nur spärlich durch die hinteren Fenster. Virginia mußte sich
erst an das Halbdunkel gewöhnen. Nach der strahlenden Helle
draußen war sie wie geblendet. Sie blieb verwirrt stehen.
„Kommen Sie nur herein, Miß!“ rief einer der Zecher.
Die anderen Männer lachten grölend. Der Barkeeper wischte
einen Fleck von der Theke. Jemand trommelte mit seinem
Becher ungeduldig auf dem Schanktisch.
Auf einmal erkannte Virginia den Mann. Sie fragte sich, ob
sie sich nicht irre. Aber es war tatsächlich Ted McKaren. Er
stützte sich mit den Ellbogen auf die Theke. Sein Anzug war
zerknittert, und er trug die Spuren einer durchzechten Nacht im
übermüdeten, unrasierten Gesicht.
Der Barkeeper nahm eine Flasche vom Bord und schenkte
den Becher bis zum Rand mit einer goldgelben Flüssigkeit
voll. Ted goß den Drink mit einem Zug hinunter und schob den
Becher dem Barkeeper wieder hin, der ihn von neuem füllte.
Virginia stand wie erstarrt.
„Ted!“ rief sie. „Um Gottes willen…“
Ted, der gerade wieder den Becher an seine Lippen setzen
wollte, hielt mitten in der Bewegung inne. Er drehte sich
langsam um.

„Du – Ginny?“ staunte er. „Was machst du denn hier?“ Seine
Stimme klang vorwurfsvoll. Er drohte ihr mit dem Finger.
„Das ist kein Ort für kleine Mädchen!“
Virginia ging entschlossen auf ihn zu.
„Seit wann trinkst du?“ fragte sie.
„Seit mich meine Braut verlassen hat“, gestand Ted lallend.
Dann trank er den Becher in einem Zug aus.
„Trink nicht so viel!“ flehte Virginia. „Bitte!“
Ted blickte sie forschend an.
„Was machst du eigentlich hier?“ wollte er wissen.
„Ich habe dich überall gesucht“, erklärte Virginia. „Daß du
im Saloon sitzen würdest, daran habe ich zuletzt gedacht!“
„Und ich dachte, du seiest ein kluges Mädchen“, seufzte Ted.
Virginia blickte flehend zu ihm auf.
„Bedienung!“ rief Ted.
„Nein!“ sagte Virginia. „Du trinkst nichts mehr!“
„Zahlen!“ rief Ted. Er warf ein paar Münzen auf die Theke.
Dann drehte er sich zu seiner Braut um. „Komm! Wir gehen!
Das hier ist nichts für Damen!“
Er ging mit schwankenden Schritten neben ihr her. Virginia
mußte ihn stützen, sonst wäre er gefallen. Die anderen Männer
blickten ihnen lachend nach.
Die Pendeltür schwang hinter ihnen mehrmals auf und zu, als
sie auf die Mainstreet hinaustraten.
Ein Wagen fuhr ratternd vorüber. Ein Pferd, das an einem der
vor den Häusern in den Boden gerammten Pfähle angebunden
war, wieherte laut. Der Leichenbestatter saß auf der Veranda in
der Sonne. Auf der anderen Straßenseite lungerten ein paar
Mischlinge.
„Ted“, seufzte Virginia. „Warum hast du dich so verändert?“
„Verändert?“ Ted blickte sie verwundert an. „Wieso?“
„Du sitzt am Vormittag im Saloon und betrinkst dich“, sagte
Virginia. „Und du prügelst dich mit Joe. Was hast du? Rede!“

„Daran bist nur du schuld“, behauptete Ted.
„Ich?“ Virginia war überrascht.
„Anstatt deinem zukünftigen Mann beizustehen, verteidigst
du die Cartwrights, diese eingebildete Bande“, schimpfte Ted.
„Was heißt verteidigen?“ Virginia sah ihn verständnislos an.
„Ich verstehe kein Wort!“
Ted blieb vor ihr stehen.
„Hör zu“, sagte er. „Dein Vater möchte unbedingt unser Land
kaufen. Er bietet dreimal mehr, als es wert ist. Aber die
Cartwrights sind dagegen! Sie verderben mir das Geschäft!“
„Du solltest darauf verzichten, wenn es deswegen Streit mit
den Cartwrights gibt“, riet ihm Virginia.
„Ich will nicht mein ganzes Leben lang tun, was diese
Cartwrights wollen“, beklagte sich Ted. „Ich will endlich
unabhängig sein! Ist das so schwer zu verstehen?“
„Nein“, sagte Virginia. „Ich verstehe dich. Trotzdem solltest
du Geduld haben!“
„Jetzt redest du genau wie mein Vater!“ Ted stöhnte auf. „Ich
halte das nicht mehr aus! Ich möchte endlich meine
Entscheidungen selbst treffen!“
„Wenn die Entscheidung der Cartwrights aber zu deinem
Besten ist?“ hielt ihm Virginia vor.
„Ich kann dich nur heiraten, wenn ich selbständig bin“,
erklärte Ted.
Virginia lächelte verständnisvoll.
„Du willst dir dein Leben selber aufbauen“, sagte sie. „Das
finde ich sehr vernünftig. Aber darum geht es hier nicht!“
„Nein?“ höhnte Ted.
„Du willst ein Mann sein“, stellte Virginia fest. „Dann
benimm dich auch so! Aber was tust du? Du prügelst dich und
betrinkst dich, nur weil alles nicht gleich so klappt, wie du es
dir vorgenommen hast. So erreichst du dein Ziel nie!“

„Irrtum!“ lachte Ted. „Ich werde es euch beweisen!“ Der
reichlich genossene Alkohol ließ ihn alle Zurückhaltung
vergessen. Er starrte sie wütend an. „Eines Tages werden die
Leute bewundernd zu mir aufblicken!“
„Wenn du so weitermachst, wirst du bald nur noch Feinde
haben“, prophezeite ihm Virginia.
„Hör auf!“ rief Ted. „Ich kann das nicht mehr hören!
Predigten! Nichts als Predigten! Erst von Vater! Jetzt von dir!
Wie ich das hasse! Aber ich werde euch beweisen, daß ich
richtig gehandelt habe! Ihr werdet es noch erleben! Dann
werdet ihr mir auf den Knien danken!“
Virginia wandte sich traurig ab. Dann ging sie eilig davon. Es
war wie eine Flucht…

Zwei verstehen sich
„Nett, daß du mich wieder mal besuchen kommst, Virginia!“
Der Mann im Lehnstuhl blickte freundlich lächelnd zu dem
Mädchen auf. „Jetzt, wo du fast schon zur Familie gehörst,
sehe ich dich überhaupt nicht mehr!“
Das stimmte. Ihre Pflichtbesuche waren in der letzten Zeit
immer seltener geworden. Virginia hatte deswegen plötzlich
ein schlechtes Gewissen.
„Ich wollte dich schon immer mal besuchen“, entschuldigte
sie sich.
„Schon gut!“ winkte Andy McKaren ab. „Ich weiß, wie das
ist! Vor der Hochzeit gibt es tausend Dinge zu erledigen!“
Virginia schwieg beschämt.
„Nimm Platz!“ forderte der alte Mann sie auf. Er sprach
unbeirrt weiter, während sich das Mädchen auf das alte
Plüschsofa setzte. „Weißt du, Virginia… Ich bin richtig
glücklich, daß du meine Schwiegertochter wirst!“
Das Mädchen schluckte nervös.
„Was hast du?“ Andy McKaren betrachtete sie forschend.
„Hattet ihr Streit?“
„Ja“, antwortete Virginia zögernd. Sie schwieg, fuhr dann
aber entschlossen fort: „Mr. McKaren, ich bin zu Ihnen
gekommen, weil ich keinen Ausweg mehr weiß!“
Sie
schluchzte plötzlich laut auf.
Der Mann im Lehnstuhl erschrak.
„Kind!“ rief er. „Was hast du?“
Virginia rang verzweifelt nach Fassung.

„Das geht wieder vorüber“, beruhigte sie Andy McKaren.
„So schlimm kann es doch nicht gewesen sein? Streit gibt es
überall mal! Sogar unter Verliebten!“
Virginia hob ihr tränennasses Gesicht.
„Es war mehr als ein Streit“, sagte sie.
„Auch das geht vorbei“, tröstete sie ihr zukünftiger
Schwiegervater.
Virginia wischte sich mit einem Taschentuch die Tränen aus
den Augen.
„Mr. McKaren“, sagte sie entschlossen. „Ich mache mir
große Sorgen um Ted!“
„Das also ist es!“ Der alte Mann sah kummervoll vor sich
hin. Er nickte besorgt. „Da hast du freilich recht!“
„Ich fühle, daß etwas Schreckliches passieren wird“, gestand
Virginia. „Etwas, was uns alle vernichten kann. Nicht nur Ted
und mich! Auch Sie und Vater! Wahrscheinlich auch die
Cartwrights!“
„Jetzt weiß ich, was du meinst“, erklärte Andy McKaren.
„Du denkst an das Stück Land, das Ted verkaufen will.“
„Mr. McKaren!“ Virginia blickte ihn erwartungsvoll an.
„Warum gibt es ausgerechnet bei diesem Verkauf so viele
Schwierigkeiten? Können Sie mir das sagen?“
„Die Sache ist etwas kompliziert“, gab Andy McKaren zu.
„Es kommt darauf an, von welcher Seite man es betrachtet…“
„Auch von der Seite der Cartwrights?“ wollte Virginia
wissen.
Der Mann im Lehnstuhl schüttelte den Kopf.
„Nein“, sagte er. „Die Cartwrights haben damit nichts zu tun.
Es geht dabei einzig und allein um unsere Ranch. Leider haben
Ted und ich ganz verschiedene Auffassungen!“
„Würden Sie mir das bitte etwas näher erklären?“ bat
Virginia.

„Siehst du, Kind…“ begann Andy McKaren bereitwillig.
„Man soll einen Besitz nicht ohne einen zwingenden Grund
teilen. Jedenfalls ist das meine Meinung. Man muß dabei auch
an die Zukunft denken. Schließlich soll die Ranch einmal euer
Zuhause sein!“
„Genau dasselbe habe ich Ted gesagt“, warf Virginia ein.
„Wenn mein Vater doch auch so dächte! Aber er unterstützt
Ted sogar bei seinen Plänen.“
„Da hilft nur eines“, erklärte ihr zukünftiger Schwiegervater.
„Wir beide müssen Ted helfen, wieder zu sich selbst
zurückzufinden. Das sollte uns eigentlich nicht schwerfallen,
denke ich. Was der Junge vor allem braucht, ist Vertrauen!“
Virginia hatte ihre Fassung wiedergefunden.
„Sie haben recht“, nickte sie. „Ted muß wissen, daß ich fest
zu ihm stehe!“
„Der Junge verdient unser Vertrauen“, sagte der alte Mann.
„Letztlich wird er doch den richtigen Weg gehen. Dessen bin
ich ganz sicher!“
Virginia schöpfte neue Hoffnung.
„Das glaube ich auch“, sagte sie.
Andy McKaren blickte gedankenverloren vor sich hin,
nachdem sich Virginia eilig verabschiedet hatte. Er lauschte
ihren Schritten nach, und als er sie nicht mehr hören konnte,
lehnte er sich seufzend in seinem Lehnstuhl zurück, ein alter,
kranker Mann, der nur noch hoffen konnte…

Der Überfall
Hoss kaufte die gesamte Schwefelmenge, die William Baker
vorrätig hatte. Sein Wagen war bis oben hin mit Säcken
beladen.
Er schob aufatmend den Stetson ins Genick und wischte sich
den Schweiß aus der glänzenden Stirn, bevor er auf den
Kutschbock kletterte und mit Peitschenknall die Pferde
antraben ließ.
William Baker blickte zufrieden lächelnd dem Wagen nach,
der unter der hochgetürmten Last schwankend davonfuhr,
vorbei an der langen Reihe der Holzhäuser, deren Fassaden
hell in der Sonne leuchteten.
Roy Wilkins hatte alles aus der Nähe beobachtet. Jetzt
schlenderte er gemächlich heran. Neben dem Ladenbesitzer
blieb er stehen.
„Eine schöne Fuhre, was?“ sagte er anerkennend.
„Er hat den ganzen Schwefel gekauft, den ich am Lager
hatte“, erklärte William Baker händereibend.
„Nanu!“ wunderte sich der Cowboy. „Was machen die
Cartwrights mit so viel Schwefel?“
„Was sie damit machen?“ Der Ladenbesitzer lächelte
geheimnisvoll. „Ihr Vieh wollen sie damit abwaschen.“
„Mit Schwefel?“ wunderte sich Roy Wilkins.
„Ja“, nickte William Baker. „Mit einer Schwefellauge!
Jedenfalls hat Hoss das gesagt!“
Der Cowboy hatte genug gehört. Er band sein Pferd los und
schwang sich in den Sattel. Dann galoppierte er eilig davon,
hinter dem Wagen mit den Schwefelsäcken her.

Kein Lüftchen regte sich. Auch die Häuser warfen keine
Schatten.
Die Mainstreet lag verlassen im grellen Licht der Sonne, die
fast senkrecht vom Himmel stach.
Trotz der Hitze trieb Hoss seine Pferde zur Eile an. Er war
glücklich, daß alles so gut geklappt hatte, und achtete nicht auf
den Reiter, der an ihm vorbeigaloppierte.
Vor der Stadt wurde Roy Wilkins von Sam Tucker
ungeduldig erwartet.
„Nun? Was ist?“ fragte er.
„Er kommt“, berichtete Roy Wilkins. „Er hat bei Baker einen
Haufen Säcke mit Schwefelpulver gekauft.“
„Was will er denn damit?“
„Keine Ahnung!“ Roy Wilkins zuckte die Schultern. „Ich
habe William Baker gefragt…“
„Und?“ Sam Tucker blickte ihn forschend an.
„Es sieht so aus, als wollten die Cartwrights ihr krankes Vieh
mit einer Schwefellauge abwaschen“, erklärte Roy Wilkins.
„Als ob das etwas nützen würde!“
„Trotzdem sollten wir etwas dagegen unternehmen“, schlug
Sam Tucker vor.
Roy Wilkins war blond und bärenstark, aber geistig etwas
zurückgeblieben. Wenn es darum ging, Entschlüsse zu fassen,
war der kleine, untersetzte Sam Tucker zuständig. Er nickte
seinem Gefährten aufmunternd zu.
„Komm!“ rief er.
Die beiden Cowboys jagten im Galopp auf die Hügel zu und
folgten der ausgefahrenen Wagenspur, die sich zwischen den
Höhen hindurchwand.
Es waren die einzigen Erhebungen in der weiten Grasebene,
deren Gleichförmigkeit nur hier und da durch Buschwerk und
Dornengestrüpp belebt wurde. Ein paar Weiden markierten das
Ufer eines Baches, der sich quer durch das Weideland

schlängelte. Wo der Bach die Straße kreuzte, befand sich eine
primitive Holzbrücke.
Gleich dahinter standen zu beiden Seiten Hügel mit steilen
Hängen, die mit Fichten und Zedern bewachsen waren. Die
Straße wurde zu einem Hohlweg. An einem besonders steilen
Hügelhang trat das nackte Gestein hervor, leuchteten gelbe,
mit schieferblauen Streifen durchzogene Felswände.
Hier parierte Sam Tucker sein Pferd. Er stellte sich in seinen
Steigbügeln auf und musterte prüfend die Umgebung.
„Hier passiert’s!“ erklärte er.
„Was hast du vor?“ fragte Roy Wilkins, der sein Pferd
ebenfalls gezügelt hatte.
„Steig ab!“ befahl Sam Tucker.
Roy Wilkins gehorchte schweigend.
Sam Tucker zeigte auf die bewaldete Höhe.
„Du versteckst dich dort oben“, sagte er. „Aber paß auf, daß
dich der Dicke nicht sieht. Du sollst mir den Rücken decken
und greifst nur ein, wenn es nötig wird!“
Roy Wilkins band sein Pferd an den Stamm einer Fichte,
nahm sein Gewehr aus dem Sattelschuh und lief hangaufwärts.
Sam Tucker blieb im Sattel. Als er den Wagen näher
kommen hörte, lenkte er sein Pferd mitten auf den Weg. Er
band sich ein Halstuch vor das Gesicht.
Hoss fuhr mit seinem Wagen ahnungslos heran.
„Halt!“ rief Sam Tucker, der ihm mit schußbereitem Gewehr
den Weg versperrte.
Hoss hielt den Wagen an.
„Was soll das?“ fragte er ärgerlich.
„Wirf dein Gewehr weg!“ befahl der Maskierte. „Los! Beeil
dich, Dicker! Ich bin nicht allein, du hast gegen uns keine
Chance!“

Oben am Hang jagte Roy Wilkins einen Schuß in die Luft,
um den Worten seines Spießgesellen mehr Nachdruck zu
verleihen.
„Ich habe kein Schießeisen bei mir“, erklärte Hoss. Er
schnaufte verächtlich. Sein bereits von der Sonne gerötetes
Gesicht lief vor Zorn dunkelrot an.
„Hände hoch!“ rief Sam Tucker.
Hoss gehorchte und schöpfte zugleich neue Hoffnung. Er
hatte den Reiter entdeckt, der hinter dem Maskierten heranritt.
Hoss bemühte sich, seine Freude nicht zu verraten und die
Aufmerksamkeit des Mannes auf sich zu lenken.
„He!“ rief er. „Was fällt euch ein? Auf der Stelle sagt ihr mir,
warum ihr mich hier aufhaltet. Was wollt ihr von mir?“
Sam Tucker fixierte ihn drohend mit seinen schwarzen
Augen.
„Halt die Klappe, Cartwright!“ schrie er.
„Vorsicht, Sam!“ warnte eine laute Stimme.
Zwei Schüsse krachten fast gleichzeitig. Von der Höhe tönte
ein gellender Schrei. Der Maskierte drehte sich blitzschnell
um.
„Keine falsche Bewegung!“ warnte ihn Little Joe, der mit
schußbereitem Gewehr herangeritten kam.
Sam Tucker riß sein Pferd herum und ritt in wilder Flucht
davon. Little Joe schickte ihm noch eine Kugel nach, ohne
allerdings auf den Flüchtling zu zielen.
„Lauf nur!“ lachte er. „Und laß dich nie mehr hier sehen!“ Er
senkte sein Gewehr und ritt auf den Wagen zu. „Alles in
Ordnung, Bruderherz?“ erkundigte er sich.
Hoss starrte ihn verblüfft an.
„Little Joe!“ sagte er. „Welcher Engel hat dich
hierhergeschickt? Du kommst wie gerufen, genau im rechten
Augenblick.“
„Du sagst es!“ Little Joe lächelte selbstbewußt.

Hoss wischte sich den Schweiß von der Stirn.
„Du brauchst keine Angst mehr zu haben“, beruhigte ihn
Little Joe. „Dein Bruder beschützt dich! Er ist immer in deiner
Nähe!“
„Wahrhaftig!“ schnaufte Hoss. „Trotzdem könntest du mir
sagen, aus welchem Grunde du mir entgegengeritten bist.“
„Pa und ich haben die kranken Rinder von den gesunden
getrennt“, berichtete Little Joe. „Als wir damit fertig waren,
wollte ich sehen, wo du bleibst. Und das weiß ich ja nun.“
„Steckte ziemlich in der Klemme“, gab Hoss zu. „Ohne dein
Eingreifen wäre es mir schlimm ergangen.“
„Ich vermute, sie hatten es mehr auf den Schwefel als auf
dich abgesehen“, sagte Little Joe.
„Es waren zwei Männer“, erklärte Hoss. „Der eine ist
geflohen. Den anderen hat deine Kugel getroffen.“
„Er muß irgendwo dort oben liegen“, vermutete Little Joe.
„Ich habe übrigens unterwegs zwei Rinder gefunden, die
ebenfalls an Texasfieber verenget sind. Es waren aber keine
von der Ponderosa!“
„He!“ rief Hoss. „Dann waren die kranken Tiere gar nicht
von uns?“
„Man hat sie in unsere Herde eingeschmuggelt“, erklärte
Little Joe. „Wir haben es leider zu spät bemerkt, erst, nachdem
sie unsere Herde angesteckt hatten.“
Hoss und Little Joe stiegen den Steilhang hinauf. Sie
zwängten sich mühsam zwischen den Bäumen hindurch. Nur
langsam, Schritt für Schritt, kamen sie auf dem felsigen Boden
vorwärts.
Der Tote lag unterhalb der Hügelkuppe, vor einer dünnen
Fichte, die im Schatten der größeren Bäume verkümmert war.
„Er hat zuerst geschossen“, sagte Little Joe. „Ich mußte mich
wehren, sonst hätte er mich erschossen.“
„Ich weiß“, nickte Hoss.

„Da sie anscheinend verhindern wollten, daß du mit dem
Schwefel auf die Ponderosa kommst, sind sie es vermutlich,
die unsere Herde angesteckt haben“, überlegte Little Joe.
„Das glaube ich auch“, stimmte ihm Hoss zu.
„Fahr weiter“, riet ihm Little Joe. „Pa wartet schon auf dich!
Ich kümmere mich inzwischen um den Toten!“
„Okay!“ Hoss machte sich vorsichtig an den Abstieg.
Als er wieder unten ankam, entdeckte er das Pferd, das an der
Fichte angebunden stand. Er tätschelte ihm den Hals.
„He – Joe!“ rief er. „Bring auch das Pferd mit, das hier unten
steht!“
„Mach’ ich!“ versprach sein Bruder.
Hoss kletterte auf den Kutschbock.
„Hü!“ rief er. „Hooo…“
Die Pferde zogen gehorsam an. Der Wagen rollte mit seiner
hochgetürmten Last weiter, aus dem Hohlweg hinaus und auf
die Ponderosa zu…

Eine Hiobsbotschaft
Es war kurz vor Sonnenuntergang. In den Fenstern des
Ranchhauses spiegelte sich das Abendrot. Die Stallungen,
Scheunen und Unterkünfte der Cowboys warfen lange
Schatten auf den Hof.
Len Keith erschrak, als Sam Tucker sein Pferd vor ihm
parierte.
„Kannst du nicht aufpassen?“ herrschte er ihn an.
Der Cowboy war mit einem Satz aus dem Sattel.
„Mr. Keith“, keuchte er. „Ich bringe eine schlechte
Nachricht! Es ist leider schiefgegangen!“
Der Silberbaron blickte sich ängstlich um.
„Wovon sprichst du?“ fragte er.
„Als die Cartwrights heute morgen entdeckten, daß ihre
Rinder verseucht sind, halben sie den dicken Hoss zu William
Baker in die Stadt geschickt“, berichtete Sam Tucker. „Er
sollte so viel Schwefel kaufen, wie er kriegen konnte.“
„Und?“ Len Keith stand groß und breitbeinig vor dem
Cowboy. „Wozu brauchen die Cartwrights den Schwefel?“
„Sie wollten ihre kranken Rinder mit einer Schwefellauge
abwaschen“, erklärte Sam Tucker. „Das mußten wir natürlich
verhindern!“
Der Silberbaron ahnte, was nun kam.
„Aber es ist euch nicht gelungen“, vermutete er.
„Nein“, gestand der Cowboy, „und sie haben Roy
erschossen!“
„Erschossen?“ Len Keith starrte ihn bestürzt an. „Wie konnte
das geschehen?“
Sam Tucker senkte den Kopf.

„Der jüngste Cartwright, den sie Little Joe nennen,
überraschte uns, als wir den dicken Hoss mit dem Wagen im
Hohlweg anhielten“, berichtete er. „Roy ließ sich
dummerweise sehen und wurde von Little Joe erschossen.“
„Du hast anscheinend mehr Glück gehabt“, stellte der
Silberbaron fest.
„Ich konnte ihnen entwischen“, gestand der Cowboy mit
verschlagenem Grinsen. „Mich kriegt man nicht so leicht.“
„Haben sie dich erkannt?“
„Natürlich nicht!“ Sam Tucker schien gekränkt. „Für wie
dumm halten Sie mich? Ich hatte mir vorsorglich ein Halstuch
vor das Gesicht gebunden!“
„Das war klug von dir“, gab der Silberbaron zu. „Trotzdem
wirst du jetzt in dein Quartier gehen und dort bleiben, bis ich
dich rufen lasse. Wir dürfen kein Risiko eingehen! Hast du
mich verstanden?“
Der Cowboy nickte, packte sein Pferd am Zügel und führte es
in den Stall.
Len Keith machte ein nachdenkliches Gesicht.
„Hallo – Vater!“ Virginia winkte von der Veranda her.
Der Silberbaron drehte sich lächelnd zu seiner Tochter um.
„Was gibt es, Ginny?“ erkundigte er sich.
„Das Essen ist, fertig!“ rief Virginia. „Ich warte seit einer
Viertelstunde auf dich!“
Ihr Vater machte ein paar Schritte zum Haus hin.
„Entschuldige“, sagte er. „Aber ich kann jetzt nicht essen! Ich
muß dringend in die Stadt!“
„So spät noch?“ wunderte sich seine Tochter.
„Leider!“ Len Keith zuckte bedauernd die Schultern.
Virginia kam leichtfüßig die Verandastufen herab. Vor ihrem
Vater blieb sie stehen. Sie sah forschend zu ihm auf.
„Muß das sein?“

„Hör zu, Ginny…“ wandte sich der Silberbaron an seine
Tochter. „Tucker hat mir soeben gemeldet, daß hier in der
Gegend das Texasfieber ausgebrochen ist. Deshalb muß ich
Ted und die anderen Nachbarn warnen, bevor es zu spät ist.
Wenn wir nicht sofort etwas unternehmen, breitet sich die
Seuche im ganzen Tal aus!“
„Das ist allerdings wichtig“, gab Virginia zu. „Ich, hoffe, du
reitest auch bei den Cartwrights vorbei.“
„Ich hätte es dir gern verschwiegen“, gestand Len Keith.
„Aber ich fürchte, du wirst es doch erfahren! Man hat die
ersten kranken Rinder bei der Herde der Cartwrights
entdeckt!“
„Weißt du das sicher?“ Virginia konnte es nicht glauben.
„Ganz sicher“, bestätigte ihr Vater.
„Die schöne Herde!“ seufzte Virginia. „So ein Unglück!“
Die Sonne war hinter den Bergen versunken. Auch das
Abendglühen erlosch, und die Schatten der Dämmerung
senkten sich auf den Hof.
„Ich muß mich beeilen“, erklärte Len Keith. „Mach dir keine
Sorgen, wenn es heute spät wird! Ich komme so schnell wie
möglich zurück!“ Er ging eilig davon.
Virginia blickte ihm besorgt nach…
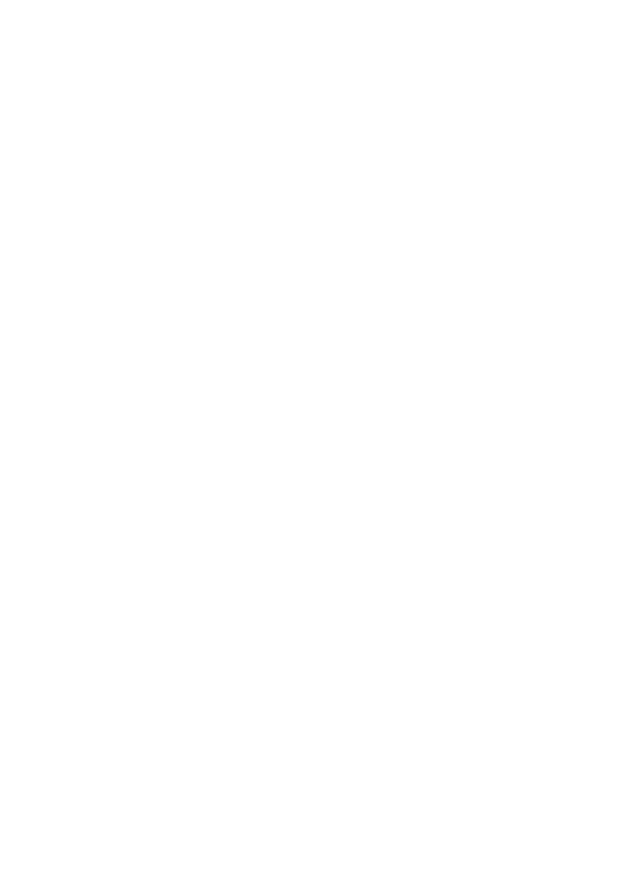
Es wird ernst
Len Keith atmete auf, als er Ted McKaren im Saloon
entdeckte, nachdem er ihn seit einer Stunde an allen möglichen
Orten gesucht hatte. Er legte ihm erfreut die Hand auf die
Schulter.
„Ted! Junge!“ sagte er. „Gut, daß ich dich endlich gefunden
habe!“
Ted drehte sich unwillig um.
„Ach, Sie sind’s!“ lallte er. „Wenn Virginia Sie geschickt
hat…“
„Ich habe dich überall gesucht“, gestand der Silberbaron.
„Nicht wegen Virginia, sondern weil etwas passiert ist!“
„Passiert?“ Ted horchte auf. „Was ist passiert?“
Len Keith musterte ihn prüfend.
„Bist du sehr betrunken?“ forschte er.
„Unsinn!“ winkte Ted ab. „Ich kann eine Menge vertragen!
Mehr als die paar Whisky! Also reden Sie! Was ist passiert?“
„Du sollst es als erster wissen!“ Sein zukünftiger
Schwiegervater lächelte geheimnisvoll.
„Woll’n Sie ‘n Drink?“ erkundigte sich Ted.
„Du sollst mir jetzt zuhören!“ Der Silberbaron wurde
ärgerlich. „Es ist wichtig! Hörst du?“
Len Keith vergewisserte sich mit einem schnellen Blick, daß
ihnen niemand zuhörte, dann sagte er leise: „Ich habe soeben
erfahren, daß auf der Ponderosa jedes Stück Vieh verseucht
ist!“
„Wovon verseucht?“ fragte Ted.

„Texasfieber“, flüsterte der Silberbaron. „Die Cartwrights
versuchen alles, um ihre Herde zu retten. Sie verheimlichen die
Sache, damit keiner etwas gegen sie unternimmt.“
„Texasfieber?“ Ted war mit einem Schlage nüchtern. „Bei
wem hat es angefangen?“
„Bei dem, der hier seit Jahren als einziger Texasrinder
züchtet“, erklärte Len Keith.
„Also bei den Cartwrights!“ Ted machte ein grimmiges
Gesicht.
„Endlich bist du aufgewacht, Junge!“ freute sich sein
zukünftiger Schwiegervater. „Wir müssen sofort etwas
unternehmen! Dieses Fieber ist für uns alle sehr gefährlich!“
„Natürlich!“ nickte Ted. „Jede Herde im Carson Valley kann
angesteckt werden!“
„Kennst du ein Gegenmittel?“ erkundigte sich der
Silberbaron.
„Dagegen ist kein Kraut gewachsen“, behauptete Ted. „Da
hilft nur eines! Die kranken Tiere müssen sofort getötet
werden!“
„Kann man die kranken Tiere überhaupt von den gesunden
unterscheiden?“ wollte Len Keith wissen.
„Schwer“, sagte Ted. „Außerdem geht es verdammt schnell
mit dem Anstecken!“
„Demnach müßten die Cartwrights alle Tiere ihrer Herde
töten?“ überlegte der Silberbaron.
„Das werden die Cartwrights ganz bestimmt nicht tun“,
vermutete Ted. „So, wie ich die kenne, werden sie mit allen
Mitteln versuchen, zu retten, was noch zu retten ist!“
„Das haben sie bereits bewiesen“, erwiderte Keith.
„Wieso?“ fragte Ted. „Ist noch mehr passiert?“
„Ein paar von meinen Leuten ritten zur Ponderosa“,
berichtete sein zukünftiger Schwiegervater. „Sie wollten

drüben helfen. Aber das ist ihnen schlecht bekommen. Die
Cartwrights haben einen von ihnen erschossen!“
„Erschossen?“ Ted starrte ihn entsetzt an. „Warum haben sie
das getan?“
„Das liegt doch auf der Hand!“ Der Silberbaron lachte
höhnisch. „Der Mann wurde erschossen, damit er keinem
erzählen kann, daß auf der Ponderosa die Seuche ausgebrochen
ist.“
„Weiß der Sheriff schon davon?“ fragte Ted.
„Von dem Mord? Nein!“ Len Keith schüttelte den Kopf.
„Das hat auch keinen Zweck! Der Sheriff würde da niemals
eingreifen! Aus lauter Angst vor den Cartwrights! Zum Glück
sind wir nicht auf ihn angewiesen! Wir können uns auch selbst
helfen!“
„Richtig!“ nickte Ted. „Wir dürfen uns das nicht gefallen
lassen! Ich jedenfalls werde alles tun, um zu verhindern, daß
auch meine Herde verseucht wird!“
„So gefällst du mir, mein Junge!“ lobte ihn sein zukünftiger
Schwiegervater. „Meine Unterstützung hast du! Aber ich
fürchte, das genügt noch nicht!“
„Keine Sorge“, beruhigte ihn Ted. „Wir werden bald mehr
Hilfe haben, als wir brauchen! Wie ich meine Nachbarn kenne,
wird keiner untätig zusehen, bis seine Herde verseucht ist. Ob
es den Cartwrights nun paßt oder nicht!“
Der Silberbaron blickte ihn bewundernd an.
„Junge“, sagte er, „wenn du das schaffst, wenn du tatsächlich
die anderen Rancher für deinen Plan gewinnst, dann kann noch
alles gut werden!“
„Sie werden alle mitmachen“, prophezeite Ted. „Ich hole sie
noch heute nacht zusammen!“
Er stürmte mit raschen Schritten aus dem Saloon und überließ
es Len Keith, seine Zeche zu bezahlen.

Aber der Silberbaron hätte in diesem Augenblick freiwillig
noch mehr als nur ein paar Silberdollar gezahlt, jetzt, wo seine
Saat endlich aufging…

Ted setzt sich durch
„Endlich!“ Der Mann im Lehnstuhl atmete erleichtert auf, als
sein Sohn ins Zimmer trat. „Da bist du ja endlich! Ich habe mir
schon Sorgen um dich gemacht!“
„Vater!“ rief Ted ärgerlich. „Ich brauche keinen, der auf mich
aufpaßt! Ich bin alt genug! Wie oft muß ich dir noch sagen,
daß ich erwachsen bin?“
„Freilich bist du erwachsen“, gab Andy McKaren zu.
„Niemand bestreitet das. Genauso wenig kannst du mir
verbieten, daß ich mir deinetwegen Sorgen mache. Ich fühle,
daß um mich herum etwas im Gange ist…“
„So? Das fühlst du?“ Ted starrte ihn wütend an. „Da geht es
dir genauso wie Virginia! Die hat auch Gefühle! Sie fürchtet,
daß etwas Schreckliches passiert!“ Der Sohn lachte schallend
auf. „Ihr zwei paßt zueinander!“
„Junge!“ ermahnte ihn sein Vater. „Virginia und ich, wir
wollen nur dein Bestes!“
„Ich weiß!“ schrie Ted. Blinde, vom Whisky angeheizte Wut
flammte in seinem Gesicht auf. „Vorschreiben lassen soll ich
mir, was ich tun muß! Vor den Cartwrights kriechen, als ob sie
die Herren im Tal wären!“
„Wir sollten uns mal richtig aussprechen“, schlug Andy
McKaren vor.
„Dazu ist es jetzt zu spät!“ erklärte der Sohn.
Der alte Mann erschrak.
„Junge“, flehte er. „Stürze dich nicht ins Unglück! Ich weiß
nicht, was passiert ist… Aber nichts ist so schlimm, daß es sich
nicht wieder einrenken läßt! Sei vorsichtig! Tu nichts
Unüberlegtes! Versprich es mir!“

Ted kümmerte sich nicht mehr um das Geschwätz seines
Vaters. Er ging zum Gewehrschrank und riß nacheinander alle
Schubfächer auf. Das Licht der Petroleumlampe warf seinen
Schatten riesengroß an die Wand. Endlich hatte er gefunden,
was er suchte. Er füllte damit eilig seine Taschen.
Andy McKaren, der alles von seinem Lehnstuhl aus
beobachtet hatte, starrte seinen Sohn entsetzt an.
„Junge!“ rief er. „Was willst du mit den Patronen?“
Ted ließ sich nicht stören.
„Es hat Ärger gegeben“, sagte er, ohne aufzusehen.
„Ärger?“ Sein Vater blickte starr vor sich hin. „Mit wem?“
Ted riß ein Gewehr aus dem Ständer.
„Das erkläre ich dir später!“ rief er.
„Nein! Du sagst es mir sofort!“ verlangte Andy McKaren.
„Ich will es augenblicklich wissen!“
Ted stand bereits an der Tür.
„Ich muß gehen!“ rief er ungeduldig. „Du wirst es noch früh
genug erfahren!“
„Es handelt sich also um die Cartwrights?“ vermutete sein
Vater.
„Um wen sonst?“ erklärte Ted auffallend ruhig. „In dieser
Gegend dreht sich doch alles um diese prächtige Familie.“
„Du wirst dieses Zimmer nicht verlassen, ehe du mir alles
erzählt hast!“ Andy McKaren versuchte aufzustehen, sank aber
aufstöhnend in den Lehnstuhl zurück. Die Familienbibel, in der
er gerade gelesen hatte, fiel polternd zu Boden.
Ted konnte die Bibel nicht dort liegen lassen. Also hob er sie
auf und legte sie seinem Vater wieder auf den Schoß. Der
Anblick des alten, kranken Mannes flößte ihm plötzlich
Mitleid ein.
„Also gut!“ gab er nach. „Damit du endlich Ruhe gibst! Auf
der Ponderosa ist eine Seuche ausgebrochen. Wir müssen

sofort etwas dagegen tun, sonst werden unsere Herden auch
noch angesteckt!“
„Was für eine Seuche?“ fragte der Mann im Lehnstuhl.
„Texasfieber“, erklärte Ted.
„So, so! Texasfieber!“ Andy McKaren sann diesem Wort
nach. „Wer hat das denn eingeschleppt?“
„Die Cartwrights! Wer sonst?“ behauptete Ted. „Sie sind hier
die einzigen, die ihre Rinder in Texas kaufen! Unter den neuen
Tieren muß ein krankes gewesen sein!“
„Ausgeschlossen!“ winkte sein Vater ab. „Das hätte Ben
sofort gemerkt!“
„Natürlich!“ schrie Ted. „Das hätte ich mir ja denken können,
daß du nichts auf deine Freunde kommen läßt!“ Der Jähzorn
übermannte ihn. „Geh zum Teufel mit den Cartwrights! Aber
ohne mich!“
„Ted!“ beschwor ihn der alte Mann. „Die Sache läßt sich
bestimmt in Frieden regeln. Geh zu den Cartwrights! Sprich
mit ihnen…“
„Es wäre Sache der Cartwrights gewesen, die Sache mit uns
zu besprechen“, hielt ihm sein Sohn vor.
„Sprich mit den Cartwrights!“ flehte sein Vater. „Bitte!“
„Damit sie mich auch erschießen, was?“ Ted lächelte
verächtlich. „So, wie sie den anderen erschossen haben!“
Andy McKaren horchte auf.
„Was redest du da?“ fragte er. „Wer hat wen erschossen?“
„Die Cartwrights“, sagte Ted. „Einen von Len Keiths Leuten.
Weil er ihr Geheimnis entdeckt hatte! Um zu verhindern, daß
er es weitererzählt! Da siehst du, was deine Cartwrights wert
sind!“
Ted stürmte, ohne sich weiter um seinen Vater zu kümmern,
mit dem Gewehr aus dem Haus.
Der Mann im Lehnstuhl stöhnte auf, als er Ted im Galopp
davonreiten hörte…

Tod den Milben
Die Grube, die die Cartwrights mitten auf der Ponderosa
ausgehoben hatten, erinnerte an eine riesige Badewanne, in die
man an der einen Seite auf sanft abfallender Fläche hinein- und
an der anderen ebenso bequem wieder herauskam.
Sie hatten die Grube mit Wasser gefüllt und das
Schwefelpulver darin aufgelöst. Die so entstandene Lauge
sollte die Rinder von den Milben und der Seuche befreien.
„Warum sollen Rinder nicht auch mal baden?“ hatte Hoss
augenzwinkernd erklärt, als sie mit den Vorbereitungen fertig
waren.
„Hoffentlich gewöhnen sich die Tiere nicht daran“,
lachte
einer der Cowboys.
Die anderen stimmten in das Lachen ein.
„Seht mal, wer dort kommt!“ rief Hoss plötzlich.
Little Joe kam eilig herangesprengt. Er führte ein zweites
Pferd am Zügel.
„Wo hast du das her?“ fragte Ben Cartwright.
Little Joe sprang aus dem Sattel.
„Das Pferd gehört dem Mann, der Hoss überfallen hat“,
erklärte er. „Seht es euch mal an! Es ist auch krank!“
„Wahrhaftig!“ bestätigte sein Vater. „Die Haut ist voll von
Milben!“
„Und?“ Little Joe sah ihn forschend an. „Was schließt du
daraus?“
„Das Pferd muß mit verseuchtem Vieh zusammengekommen
sein“, vermutete Ben Cartwright.
„Also ist die Seuche gar nicht bei uns ausgebrochen!“
rief
einer von den Cowboys, die alles mit angehört hatten.

„Nein“, bestätigte Little Joe. „Zuerst scheint sie auf eine
andere Herde übertragen worden zu sein.“
„Das war mir eigentlich von Anfang an klar“, sagte Ben
Cartwright.
„Wehe, wenn ich die Kerle erwische!“ Hoss ballte drohend
die Faust.
„Einen haben wir bereits!“ erinnerte ihn sein Bruder.
„Schade, daß er an deiner Kugel gestorben ist“, bedauerte
Hoss. „Er hätte uns bestimmt einiges erzählen können!“
„Wißt ihr, wie der Tote heißt?“ erkundigte sich ihr Vater.
„Er hatte einen Brief bei sich“, berichtete Little Joe.
„Adressiert an einen Roy Wilkins!“
„Es ist anzunehmen, daß der Mann so heißt“, vermutete Ben
Cartwright.
„Moment!“ rief Hoss. „Es war noch ein zweiter Mann
dabei!“
„Hör zu, Joe…“ wandte sich der Rancher an seinen jüngsten
Sohn. „Du reitest sofort nach Virginia City. Versuche
herauszufinden, wer der zweite Mann war. Solltest du ihn
finden, dann bringe ihn hierher!“
„Mach’ ich!“ versprach Little Joe.
Er schwang sich wieder in den Sattel und ritt im Galopp
davon.
Hoss packte das zweite Pferd am Zügel.
„Und du nimmst jetzt ein Bad“, erklärte er.
Sie machten mit dem Pferd den Anfang. Dann begannen sie
mit der Arbeit.
Es dauerte nicht lange, bis die Männer trotz der Abendkühle
ins Schwitzen kamen.
Ein Rind nach dem anderen wurde von den Cowboys
herangetrieben und sprang, stürzte oder plumpste in die Grube
hinein. Hoss paßte auf, daß jedes Tier ganz untertauchte. Nach

einer Weile jagte er es mit einem liebevollen Klaps wieder
hinaus.
Auf der anderen Seite nahmen ein paar Cowboys die
erschrockenen Tiere wieder in Empfang, damit sie nicht in alle
vier Winde davonliefen.
Noch befanden sich die meisten Rinder innerhalb der
Umzäunung und drängten mit mahlenden Kiefern und
schnuppernden Nasen zur engen Öffnung des Geheges.
Der dort postierte Cowboy hatte Mühe, immer nur ein Rind
herauszulassen, damit die Herde nicht wie ein Sturzsee durch
das offene Gatter strömte.
Das Brüllen und Keuchen, das aus dem wilden Knäuel
ineinander verschlungener Tierleiber kam, fand ein Echo auf
der anderen Seite der Weide, wo sich die bereits behandelten
Rinder wie schwarze Ungetüme vom hellen Nachthimmel
abhoben.
Die beiden großen Reisigfeuer, die man bei Einbruch der
Dunkelheit neben der Grube entzündet hatte, loderten hell in
die Nacht. Ihre Flammen flackerten im Wind, der über die
Ebene wehte.
„Das nächste!“ schrie Hoss. „Los! Beeilt euch!“
Jetzt gab es nur eines: das Rind scharf antreiben, ihm einen
tüchtigen Schrecken einjagen und es dann in die mit
Schwefellauge gefüllte Grube zu scheuchen, bevor es begriff,
was los war.
Die beiden Cowboys richteten sich in ihren Steigbügeln auf,
bereit, neben dem Rind herzugaloppieren, sobald es aus dem
Gehege stürmte. Der Mann am Gatter ließ das nächste Tier
heraus.
Zuerst ging alles gut. Aber dann blieb die Kuh auf einmal
stehen und warf bockend den gehörnten Kopf hoch. Das war
ein schlimmes Zeichen.

Die beiden Cowboys rissen ihre Pferde herum und ritten ganz
nahe an die störrische Kuh heran. Sie drehte sich laut muhend
zur Seite und stieß so wild mit den Hörnern um sich, daß eines
der Pferde erschrocken zurückwich.
Plötzlich hatte die Kuh freie Bahn und lief ungestüm davon.
Sie stampfte, aus vollem Halse brüllend, in wildem Galopp an
der Grube und den Reisigfeuern vorbei auf die unschlüssig
dastehenden Rinder los.
Auf einmal kam Bewegung in die Masse der Tiere. Ein Rind
nach dem anderen machte kehrt und jagte erschrocken davon.
Auf einmal war die Hölle los.
Dann begann eine wilde Jagd. Die Cowboys ritten in höchster
Eile seitlich an den gescheckten Tierleibern vorbei und
drängten sie Schritt für Schritt zu einem Haufen zusammen.
Aber noch immer bestand die Gefahr, daß die Tiere einzeln,
paarweise oder in kleinen Gruppen ausbrachen.
Lassos wirbelten durch die Luft, Rinder brüllten, Hufe
stampften, Männer überschrien den Tumult. Schließlich kreiste
die Herde in einem weiten Kreis herum. Das Tempo
verlangsamte sich, bis die Tiere endlich wieder zum Stehen
kamen. Auch die übergeschnappte Kuh wurde wieder
eingefangen.
„Wer nicht baden will, muß sterben“, sagte Hoss, als er die
Kuh untertauchte. „Kopf ‘runter! So ist’s gut!“ Er scheuchte
das Tier mit einem Klaps aus der Grube.
Die Kuh lief brüllend davon.
„Weiter!“ schrie Hoss. „Das nächste Rind!“

Little Joe spielt Detektiv
Kein Laut war zu hören, kein Hundegebell erschreckte Little
Joe, als er auf den Hof der Ranch ritt. Das Viereck zwischen
dem Herrenhaus und den übrigen Gebäuden lag in silbrigem
Mondlicht.
Im Schatten der Bäume, die tagsüber Schutz vor der
Sonnenglut bieten sollten, stieg Little Joe von seinem Pferd. Er
band die Zügel locker um einen Baumstamm. Dann blickte er
an der Fassade des Hauses empor.
Es war ein großartiges Haus, eines Silberbarons würdig. Der
Granit schimmerte mattweiß. Goldgelb leuchtete ein
dreiteiliges Fenster in die Nacht.
Es schien also noch jemand auf zu sein. Little Joe fühlte, daß
das Glück heute auf seiner Seite war. Das hatte er bereits
vorhin im Saloon erfahren.
Der Barkeeper hatte sich sofort erinnert.
„Roy Wilkins? Den Namen habe ich schon gehört! Roy war
früher oft hier! In letzter Zeit weniger! Immer in Begleitung
eines anderen Mannes…“
Little Joe war mit dieser Auskunft noch nicht zufrieden
gewesen.
„Kennst du seinen Namen?“ hatte er sich erkundigt.
„Warte mal…“ Der Barkeeper hatte angestrengt nachgedacht.
„Er war nicht sehr groß, etwas untersetzt und schwarzhaarig…
Wie hieß er bloß? Ich komme noch drauf!“
Der Name war dem Barkeeper tatsächlich noch eingefallen.
„Tucker! Richtig! Sam Tucker! So hieß der Mann! Möchte
wissen, warum ich nicht gleich darauf gekommen bin!“
„Weißt du auch, wo er arbeitet?“ hatte Little Joe gefragt.

Auch daran hatte sich der Barkeeper erinnert.
„Bei Len Keith! Wo sonst? Ist dort Vormann, glaube ich.“
Die Spur führte also zum Haus des Silberbarons!
Little Joe ging langsam die Stufen zur Veranda hinauf. Bevor
er ganz oben war, öffnete sich, wie von Geisterhand, die
Haustür. In der dunklen Öffnung stand eine helle Gestalt.
„Du – Joe?“ Virginia starrte den Besucher überrascht an. „Ich
dachte, Vater käme zurück. Ich hörte Hufgetrappel und…“ Sie
schwieg verstört. „Ist etwas passiert?“
„Nein!“ Little Joe winkte ab. „Ich muß nur dringend mit
deinem Vater sprechen. Schade, daß er nicht da ist!“ Er drehte
seinen Stetson verlegen in der Hand.
„Vater ist in die Stadt geritten“, berichtete Virginia. „Aber
vielleicht kann ich dir helfen.“
„Okay!“ sagte Little Joe. „Versuchen wir es!“ Er blickte sie
forschend an. „Kennst du einen Mann namens Roy Wilkins?“
„Ja“, nickte Virginia, „er ist bei uns angestellt. Ein Freund
von Sam Tucker!“
„Und wer ist Sam Tucker?“ wollte Little Joe wissen.
„Unser Vormann“, erklärte das Mädchen.
„Weißt du, wo ich diesen Tucker jetzt finde?“ erkundigte sich
Little Joe.
„Er wird drüben in seinem Quartier sein“, vermutete
Virginia. „Du brauchst nur quer über den Hof zu gehen. Die
Baracke ist dort drüben!“
„Danke!“ sagte Little Joe. „Und entschuldige die Störung!“
Er ging über die Veranda davon.
„Joe!“ rief Virginia. „Warum fragtest du danach?“
Der Besucher drehte sich noch einmal um.
„Besser, du hältst dich da heraus“, riet er ihr.
„Joe!“ flehte Virginia. „Bitte, sag mir, was passiert ist!“
„Also gut!“ gab er nach.

„Warum hast du dich nach den beiden Männern erkundigt?“
wiederholte Virginia.
„Roy Wilkins hat heute mittag meinen Bruder Hoss
überfallen“, berichtete Little Joe. „Es war noch ein zweiter
Mann dabei – wahrscheinlich dieser Tucker.“
„Ausgeschlossen!“ rief Virginia. „Da irrt ihr euch. Mein
Vater beschäftigt keine Mörder.“
„So? Meinst du?“ Little Joe lächelte spöttisch, „übrigens –
ich glaube dir gern, daß dich dein Vater nicht in seine
schmutzigen Geschäfte eingeweiht hat!“
„Wovon sprichst du?“ Virginia war schreckensbleich.
„Du solltest dich lieber schlafen legen!“ Little Joe sah sie
besorgt an. „Das hier ist Männersache!“ Er wandte sich
schweigend ab und ging eilig die Verandastufen hinab.
Virginia fühlte Tränen in ihren Augen. Der Kaschmirschal
entglitt ihrer Hand. Die Träume von Sicherheit und Stille in
diesem Haus zerrannen.
Mit klopfendem Herzen blickte sie Little Joe nach, wie er
quer über den mondhellen Hof ging…
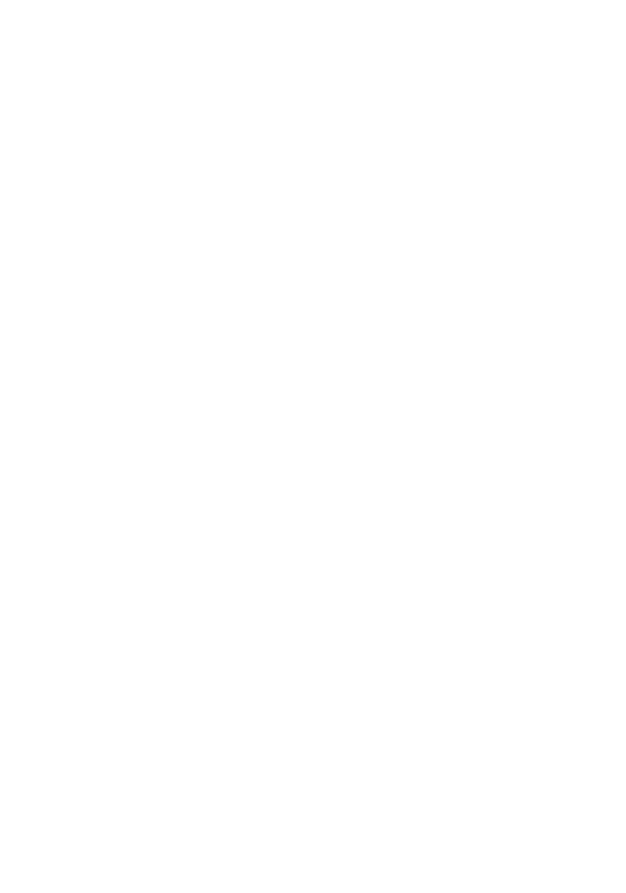
Einer muß dran glauben
Der Mann, der verschlafen die Tür der Baracke öffnete, war
klein, untersetzt und schwarzhaarig.
„Sind Sie Sam Tucker?“ fragte Little Joe.
„Erraten!“ Der Vormann grinste verschlagen. „Und Sie sind
sicher einer von den Cartwrights.“
„Stimmt!“ gab Little Joe zu.
„Wollen Sie zu mir?“ erkundigte sich Sam Tucker.
„Ich suche einen Mann, der heute mittag zusammen mit Roy
Wilkins meinen Bruder Hoss überfallen hat“, sagte Little Joe.
„Tut mir leid!“ Der Cowboy zuckte bedauernd die Schultern.
„Da sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Mir ist davon
nichts bekannt!“
„Würden Sie das auch vor dem Sheriff wiederholen?“
„Warum nicht?“ Sam Tucker grinste herausfordernd. „Woll’n
wir gleich zu ihm reiten? Oder erst morgen früh?“
„Holen Sie Ihr Pferd, Tucker!“ befahl Little Joe. „Wir reiten
sofort zum Sheriff!“
„Okay!“ Der Cowboy nickte ergeben. „Wie Sie wollen!“ Er
trat bereitwillig auf den Hof hinaus.
Little Joe ließ sich durch Tuckers Benehmen täuschen.
Dessen Fausthieb kam völlig überraschend für ihn und traf ihn
so hart an der Schläfe, daß er zu Boden stürzte.
Der Cowboy floh quer über den Hof. Er war noch keine zehn
Yards entfernt, als Little Joe wieder auf die Beine kam. Schon
beim Aufspringen riß er den Colt aus dem Halfter.
„Halt!“ schrie er. „Bleiben Sie stehen, Tucker!“

Der Flüchtling befolgte den Zuruf nicht, sondern lief unbeirrt
weiter. Sein Ziel war das Pferd, das angepflockt neben dem
Baum stand.
Little Joe feuerte zwei Schüsse in die Luft, während er hinter
dem Fliehenden dreinstürmte. Beim dritten Schuß fehlte er mit
Absicht nur knapp. Damit hatte er endlich Erfolg. Sam Tucker
blieb stehen.
Little Joe ging mit schußbereitem Colt auf den Cowboy zu.
Plötzlich hörte er hinter sich Hufgetrappel. Dann peitschte ein
Schuß auf.
Sam Tucker begann wie ein Trunkener zu taumeln. Sein
Hemd färbte sich rot. Nach einigen Schritten stürzte er
vornüber zu Boden.
Little Joe drehte sich ärgerlich nach dem Schützen um.
„Warum haben Sie das getan?“ fragte er.
Len Keith parierte sein Pferd, steckte das Gewehr, mit dem er
geschossen hatte, lässig in den Sattelschuh und schwang sich
vom Rücken seines Reittieres.
„Ich wollte dir helfen, Joe“, erklärte er.
Virginia, die alles mit angesehen hatte, kam aufgeregt über
den Hof gelaufen. Vor der leblosen Gestalt blieb sie stehen.
„Um Gottes willen!“ rief sie. „Ist er schwer verletzt? Kann
ich helfen?“
Niemand konnte Sam Tucker mehr helfen.
„Er ist tot“, sagte Little Joe.
„Mein Gott!“ Virginia bedeckte ihr Gesicht mit den Händen.
Dann blickte sie starr zu ihrem Vater auf. „Warum hast du ihn
erschossen, Dad?“
„Es blieb mir nichts anderes übrig“, entschuldigte sich der
Silberbaron. „Ich mußte Joe helfen!“
„Hören Sie, Mr. Keith…“ mischte sich Little Joe ein. „Ich
hatte absichtlich vorbeigeschossen, weil ich ihn lebend haben
wollte!“

„Warum wolltest du ihn lebend?“ fragte Virginia.
„Sam Tucker hätte mir eine Menge erzählen können“,
erklärte Little Joe. „Aber dein Vater war schneller als ich. So
viel ist sicher: der Sheriff wird diesen Vorfall noch genau
untersuchen.“
Er ließ Vater und Tochter allein und ging zu seinem Pferd.
Nachdem er es losgebunden hatte, stieg er in den Sattel und ritt
eilig davon.
Len Keith legte seiner Tochter den Arm um die Schultern.
„Tut mir leid, Ginny“, sagte er, „daß du das mit ansehen
mußtest!“
„Leider halbe ich zuviel gesehen“, gestand sie. „Mehr, als dir
lieb ist!“
„Was soll das heißen?“ fuhr ihr Vater sie an. „Was willst du
gesehen haben außer den tatsächlichen Vorgängen? Tucker
wollte Joe töten! Darum habe ich geschossen! Um Joes Leben
zu retten!“
„Nein!“ rief Virginia. „Das ist nicht wahr! Tucker
wollte sich
ergeben, er hatte schon die Hände erhoben, als du auf ihn
abdrücktest. Du hast es absichtlich getan, Vater!“
„Was redest du da?“ Der Silberbaron lachte heiser auf. „Du
hast das nicht richtig gesehen, Ginny! Das ist auch kein
Wunder! Das alles war ein bißchen viel für dich! Für ein
Mädchen in deinem Alter!“
„Ich bin kein Kind mehr!“ Virginia riß sich wütend von ihm
los. „Was ich gesehen habe, stimmt!“
„Schön!“ gab ihr Vater nach. „Nehmen wir einmal an, es
wäre wirklich so gewesen. Was geht das dich an? Wieso
schläfst du noch nicht? Du gehst jetzt augenblicklich ins
Haus!“
„Nein, Vater!“ protestierte die Tochter. „Von nun an tue ich,
was mir paßt! Endlich weiß ich, wie du wirklich bist! Nicht die
Cartwrights, sondern du willst hier im Tal herrschen!“

„Ginny! – Kind!“ Len Keith sah sie bestürzt an. „Das alles
tue ich doch nur für dich!“
„Um so schlimmer!“ rief Virginia.
Sie kehrte schluchzend ins Haus zurück. Ihr Entschluß stand
fest: Sie wollte keine Stunde länger bei ihrem Vater bleiben…

Die Verschwörung
„Und das wissen wir schließlich alle“, schloß Ted McKaren
seine Rede, „wenn einer von uns eine kranke Herde hätte, dann
wären die Cartwrights die ersten, die etwas dagegen
unternehmen würden!“
Die Männer, die sich im Saal versammelt hatten, bekundeten
lärmend ihre Zustimmung. Nur einer protestierte.
„Das stimmt ja gar nicht!“ rief Quentin Dobbs empört. „So
etwas würde Ben Cartwright niemals tun!“
„Natürlich stimmt es!“ behauptete Frank Dunbar.
Die anderen Rancher unterstützten ihn mit Zurufen.
„Ted hat recht!“ rief Henry Rogers.
„Keiner von uns zweifelt daran, daß die Cartwrights
einschneidende Maßnahmen fordern würden, wenn unsere
Herden verseucht wären“, stellte Tom Curgill mit Nachdruck
fest. „Wir müßten alle Tiere töten.“
„Wenn Ben Cartwright wirklich der Mann wäre, für den er
sich ausgibt, dann hätte er seine Rinder schon längst getötet“,
erklärte John Copley.
„Wieso?“ fragte Quentin Dobbs. „Er versucht, wenigstens die
gesunden Tiere zu retten. Das würde jeder von uns tun, wenn
er an Ben Cartwrights Stelle wäre! Oder etwa nicht?“
Alle im Saal protestierten.
„Das schafft Ben Cartwright nie“, prophezeite Henry Rogers.
„Es ist Unsinn, das überhaupt zu versuchen.“
„Oder kannst du uns sagen, wie er das machen will?“ Frank
Dunbar blickte Quentin Dobbs spöttisch an.
„Gegen das Texasfieber ist kein Kraut gewachsen“,
behauptete Henry Rogers. „Das weiß doch jeder!“

„Wir alle wären froh, wenn es ein Mittel gegen diese Seuche
gäbe“, sagte John Copley.
Damit hatte er ausgesprochen, was alle dachten. Die Rancher
fürchteten nichts so sehr wie das Texasfieber, das immer
wieder ihre Existenz bedrohte.
„Sprich weiter, Ted!“ rief Tom Curgill. „Was sollen wir jetzt
tun?“
„Liebe Nachbarn“, fuhr Ted fort. „Wir alle wissen, daß man
bei dieser Seuche nicht zwischen kranken und gesunden Tieren
unterscheiden kann. Darum gilbt es nur einen Schutz gegen
weitere Ausbreitung: Jedes Tier der verseuchten Herde muß
auf der Stelle getötet werden!“
Mit diesen Worten erntete er starken Beifall.
„Liebe Nachbarn“, sagte Ted, nachdem sich der Lärm wieder
gelegt hatte. „Die Ponderosa ist reich. Die Cartwrights haben
genug Geld, um sich neues Vieh zu kaufen. Was hindert sie
also daran, so zu handeln, wie es ihre Pflicht ist?“
„Sie wollen keinen Cent verlieren!“ sagte ein Zuhörer.
„Sie glauben, hier die Herren zu sein!“ behauptete ein
anderer.
„Das bilden sie sich nur ein!“ rief eine schrille Stimme.
Ted nickte zustimmend.
„Im Gegensatz zu den Cartwrights leben die meisten von uns
nur von ihrer Herde“, fuhr er in seiner Rede fort. „Wenn diese
Rancher ihre Herde durch eine Seuche verlieren, dann sind sie
am Ende. Dann müssen sie ihr Land verkaufen. Keiner von
ihnen hat genug Geld, um noch einmal von vorn beginnen zu
können.“
Die Erregung im Saale wuchs. Die Versammelten redeten
aufgeregt durcheinander. Ted McKaren hatte absichtlich die
Sorge vor der Zukunft heraufbeschworen.
Quentin Dobbs versuchte, sich in diesem Hexenkessel Gehör
zu verschaffen.

„Leute! Nachbarn!“ schrie er. „Es ist dumm, sich gegen die
Cartwrights zu stellen! Wir können nicht…“
Höhnisches Gelächter übertönte seine Worte. Es fehlte nicht
viel, und die im Saal versammelten Rancher hätten sich auf ihn
gestürzt. Quentin Dobbs schwieg erschrocken.
Ted McKaren hatte alle bis auf einen überzeugt.
„Wir müssen endlich den Mut zu einer befreienden Tat
halben!“ forderte er. „Wir dürfen nicht länger nach der Pfeife
der Cartwrights tanzen! Aber ich will euch nicht bevormunden.
Es steht jedem frei, ob er mitmachen will oder nicht!“
„Natürlich machen wir alle mit“, versprach ihm John Copley.
„Ohne mich!“ rief Quentin Dobbs.
„Wir haben von dir auch nichts anderes erwartet“, bemerkte
Henry Rogers unter dem Gelächter der anderen.
„Ich mache mit!“ rief Frank Dunbar.
„Ich auch!“ tönte es von allen Seiten.
„Keiner von uns könnte den Verlust seiner Herde ertragen. Es
wäre sein Ende“, sagte Tom Curgill.
„Höchste Zeit, daß die Cartwrights mal einen Denkzettel
erhalten!“ Jim Avery hatte es Hoss nicht verziehen, daß er ihn
einmal einen Pferdeschinder genannt hatte.
Ted blickte sich triumphierend um.
„Wir sind uns also einig?“ fragte er.
„Völlig einig“, bestätigte John Copley.
„Gut!“ nickte Ted. „Wir treffen uns morgen bei
Sonnenaufgang am Nordende der Stadt!“
Alle versprachen zu kommen.
„Vergeßt eure Gewehre nicht!“ rief John Copley. „Wir
werden sie vielleicht brauchen.“
„Selbstverständlich nehmen wir unsere Schießprügel mit“,
antwortete jemand.
Die Männer verließen in Gruppen den Saal.
John Copley wandte sich lächelnd an Ted.

„Bin gespannt“, sagte er, „was die Cartwrights für Gesichter
machen werden, wenn sie uns plötzlich kommen sehen.“
„Sie werden es nicht für möglich halten, daß jemand etwas
gegen sie zu unternehmen wagt“, sagte Ted.
„So was hat es hier noch nicht gegeben“, stellte Frank
Dunbar fest.
„Hut ab vor Ted McKaren“, erklärte Tom Curgill. „Ich hätte
das dem Jungen gar nicht zugetraut.“
„Stimmt!“ nickte Henry Rogers. „Nachdem er so lange mit
Little Joe befreundet war.“
„Anscheinend hat er jetzt die Nase voll von den Cartwrights“,
vermutete Jim Avery.
Die Männer waren so sehr im Gespräch vertieft, daß sie nicht
auf das Mädchen achteten, das an ihnen vorbei in den Saal
drängte…

Eine warnende Stimme
Virginia atmete erleichtert auf, als sie Ted unter den Männern
entdeckte.
„Endlich!“ rief sie, ganz außer Atem vor Glück. „Endlich
habe ich dich gefunden!“
Ted starrte sie verblüfft an.
„Nanu!“ wunderte er sich. „Was machst du so spät hier?
Noch dazu in diesem Aufzug?“
Virginia trug Reithosen und eine weiße Bluse, Ihr langes
Haar wurde von einem schwarzen Band zusammengehalten.
Der breitkrempige Hut hing ihr im Nacken.
„Ich bin hergeritten“, sagte sie.
„Warum?“ fragte Ted verwundert. „Warum schläfst du
nicht?“
Ihre großen glänzenden Augen blickten ihn ängstlich an.
„Was habt ihr vor?“ forschte sie. „Was bedeutet diese
Versammlung?“ Ted wich ihrem Blick aus.
„Wir haben beschlossen, morgen früh zur Ponderosa zu
reiten“, berichtete er. „Ich weiß nicht, ob es dir dein Vater
erzählt hat. Das Vieh der Cartwrights hat Texasfieber. Dadurch
sind alle Herden im Tal gefährdet. Es gibt nur eine
Möglichkeit, sie vor Ansteckung zu bewahren. Cartwrights
Rinder müssen so bald wie möglich getötet werden.“
„Darüber werden die Cartwrights anderer Meinung sein“,
vermutete Virginia.
„Wir werden sie zwingen, zu tun, was wir für richtig halten“,
erklärte Ted. „Wenn nötig, mit Waffengewalt!“
„Weißt du überhaupt, wodurch das Vieh der Cartwrights
infiziert wurde?“ fragte Virginia.

Ted winkte ärgerlich ab.
„Das spielt jetzt keine Rolle mehr“, sagte er. „Wenn wir nicht
sofort etwas unternehmen, breitet sich die Seuche im ganzen
Tal aus.“
Virginia begann zu weinen.
„Ted“, schluchzte sie. „Ich glaube, mein Vater hat heimlich
kranke Tiere zur Herde der Cartwrights bringen lassen!“
Ted war sichtlich erschrocken.
„Hat er dir das erzählt?“ fragte er.
„So was würde Vater nie zugeben.“
„Woher weißt du es?“ Ted sah sie zweifelnd an.
„Little Joe verdächtigt ihn“, sagte Virginia. „Aber er hat
keine Beweise!“
„Hör mal, Ginny!“ Teds Stimme klang heiser. „Es ist doch
jetzt völlig gleichgültig, wo die Seuche zuerst ausgebrochen
ist.“
„Aber es ist doch ein Verbrechen, mit Absicht das Vieh
anderer zu infizieren!“ hielt ihm Virginia entgegen.
Ted holte eine Brasil aus der Tasche. Er hielt das
Schwefelholz, das er an seiner Stiefelsohle entzündet hatte,
lässig an das schwarze Stäbchen. Dann stieß er heftig den
Rauch aus.
„Verbrechen oder nicht“, sagte er zwischen zwei Zügen.
„Erst müssen wir mit der Seuche fertig werden!“
„So begreife doch!“ rief Virginia empört. „Die Cartwrights
sind völlig unschuldig! Sie haben nicht verdient, daß ihr sie
bedroht; sie brauchen eure Hilfe!“ Sie schüttelte bekümmert
den Kopf. „Ich verstehe dich nicht! Ihr wart doch jahrelang
befreundet. Was ist nur aus dir geworden?“
Ted war überrascht.
„Ich soll anderen helfen?“ fragte er schweratmend. „Ich habe
alle Hände voll zu tun, um mir selbst zu helfen!“
Virginia blickte enttäuscht.

„Du denkst nur an dich!“ behauptete sie. „Genau wie Vater!
Ich hätte also ruhig zu Hause bleiben können!“
Ted starrte sie verständnislos an.
„Du bist…?“
„Fortgelaufen, ja!“ bestätigte Virginia.
„Wie konntest du das nur tun?“ fragte Ted kopfschüttelnd.
„Ich hasse meinen Vater“, gestand Virginia. „Er ist gemein
und rücksichtslos! Und du wirst bald genauso sein wie er,
wenn du so weitermachst!“
Ted wurde rot vor Zorn.
„Ich habe es dir heute schon einmal gesagt“, stellte er wütend
fest. „Ich weiß auch ohne deine Belehrungen, was ich zu tun
habe!“
„Das glaube ich dir gern“, gab Virginia erregt zurück. „Aber
erzähl mir nur nicht, daß du dich für die anderen Rancher
aufopferst! Ich kenne dich besser! Du willst doch nur den
großen Mann spielen!“
Ted atmete schwer.
„Weißt du überhaupt, was du da sagst?“ fragte er.
„Ich meine es doch nur gut“, beschwor ihn Virginia. „Ich will
nicht, daß du so wie mein Vater wirst!“
„Machst du mir deshalb ständig Vorschriften?“ erkundigte
sich Ted wutentbrannt.
„Laß die Finger davon“, bat ihn Virginia. „Reite morgen
nicht mit den Ranchern zur Ponderosa…“
„Dazu ist es jetzt zu spät!“ Ted drückte die Brasil an seiner
Stiefelsohle aus.
„Es ist nie zu spät“, sagte Virginia.
„Hör auf!“ schrie Ted. „Ich lasse mich nicht länger von dir
bevormunden!“
Virginia drehte sich schweigend um und stürmte ziellos in die
Nacht hinaus…

Virginia gibt nicht auf
Andy McKaren las in der Familienbibel, obgleich es lange
nach Mitternacht war. Er wartete voller Ungeduld auf die
Rückkehr seines Sohnes.
Die Petroleumlampe warf zuckende Lichtfiguren auf sein
Gesicht, als er lauschend den Kopf hob. Der Hufschlag war
verstummt. Dafür vernahm er jetzt Schritte, die sich eilig dem
Haus näherten.
Der Mann im Lehnstuhl blickte erwartungsvoll zur Tür.
„Wer ist da?“ fragte er.
„Ich bin’s! Virginia!“ meldete sich eine helle Stimme.
Andy McKaren sank enttäuscht auf seinen Sitz zurück.
„Komm nur herein, Kind!“ forderte er die späte Besucherin
auf. „Die Tür ist nicht verschlossen!“
Virginia kam aufgeregt ins Zimmer gestürmt.
„Mr. McKaren!“ rief sie. „Sie müssen mir helfen! Sie sind
der einzige, der es noch kann! Ted ist im Begriff, eine große
Dummheit zu machen!“
„Ich habe es geahnt“, seufzte der Rancher.
„Sie dürfen Ted jetzt nicht allein lassen“, beschwor ihn
Virginia. „Nur Sie können ihn noch von seinem Entschluß
abbringen!“
„Liebes Kind…“ Andy McKaren blickte hilflos lächelnd zu
ihr auf. „Ich bin ein alter, kranker Mann…“
„So begreifen Sie doch!“ rief Virginia eindringlich. „Ted ist
in großer Gefahr!“
„Ich habe ihn mehr als einmal gewarnt“, sagte der alte Mann.
„Aber der Junge hört nicht mehr auf mich!“
„Trotzdem müssen Sie Ted helfen!“ flehte Virginia.
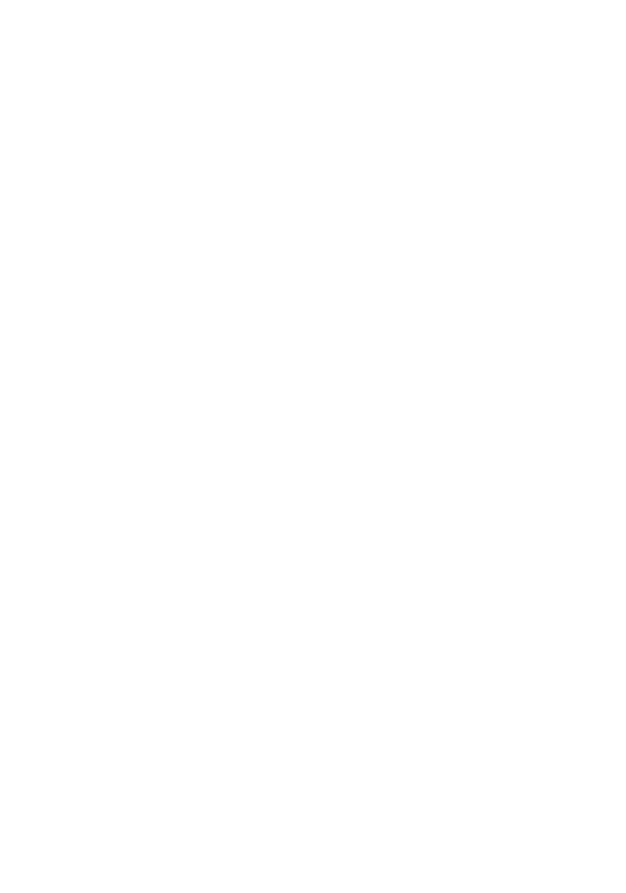
„Ted ist kein Kind mehr“, erklärte der Mann im Lehnstuhl.
„Er ist alt genug, um selbst zu entscheiden.“
„Das glaubt er! Aber das stimmt nicht!“ behauptete Virginia.
„Ich weiß, daß er blindlings in sein Unglück rennt!“
„Ich habe es befürchtet“, gestand Andy McKaren. „Ich ahnte,
daß etwas passieren würde! Aber ich war nicht ganz sicher!
Bis heute abend! Bis er das Gewehr und die Patronen holte!“
„Ein Gewehr?“ fragte Virginia schreckensbleich. „Oh, Mr.
McKaren! Warum haben Sie das nicht verhindert?“
„Ich habe es versucht“, – der alte Mann lächelte bitter – ,
„aber es ist mir nicht gelungen!“
„Noch können Sie das Schlimmste verhindern“, beschwor ihn
Virginia. „Sie müssen es tun! Sie lieben Ted doch auch!“
Andy McKaren beugte sich mit ernstem Gesicht vor.
„Söhne wollen frei entscheiden! Niemand kann sie davon
abhalten, wenn sie erwachsen sind. Schon gar nicht der Vater.
Es muß alles seinen Lauf nehmen. Es ist…“ Er ließ den Satz
unvollendet.
Virginia wurde unruhig. Die Minuten verrannen. Sie hatte
nicht mehr viel Zeit.
„Mr. McKaren“, begann sie von neuem. „Sie dürfen nicht
zulassen, daß Ted ein Verbrechen begeht.“
„Ein Verbrechen?“ Der alte Mann starrte sie entsetzt an.
„Nein, mein Kind, das würde Ted nie tun. Mein Sohn mag
verblendet sein, aber er ist kein Verbrecher!“
Virginia hatte dem Kranken die wahren Vorgänge
verheimlichen wollen, um ihn nicht unnötig aufzuregen. Doch
jetzt half nur eines: Sie mußte ihm alles erzählen.
„Mein Vater ist an allem schuld“, berichtete sie. „Er hatte
zwei unserer Leute dazu angestiftet, die kranken Rinder
heimlich in die Herde der Cartwrights zu schmuggeln. Die
Männer, die das getan haben, heißen Roy Wilkins und Sam
Tucker. Roy Wilkins wurde von Little Joe überrascht, als er

Hoss überfiel, und eine Kugel traf ihn tödlich. Sam Tucker
wurde heute nacht von meinem Vater erschossen! Und es wird
noch mehr Blut vergossen werden, wenn wir es nicht
verhindern, Mr. McKaren!“
„Eine schöne Geschichte“, knurrte der Mann im Lehnstuhl.
„Aber ich kann daran nichts ändern! Selbst wenn ich es wollte,
könnte ich es nicht. Du weißt doch, daß ich an diesen Stuhl
gefesselt bin.“
Virginia fühlte, daß sie den alten Mann beinahe überzeugt
hatte.
„Sie können mit mir zur Ponderosa fahren“, sprach sie in
beschwörendem Ton weiter. „Sie können es! Sie müssen es nur
ganz fest wollen! Bitte, versuchen Sie es!“
Sie wandte ihm absichtlich den Rücken zu. Er sollte sich bei
seinem inneren Ringen nicht beobachtet fühlen.
Einen Moment war es ganz still im Zimmer. Dann vernahm
Virginia ein Ächzen und Grollen und wußte, schon bevor sie
sich umdrehte, daß der Kranke sich mit einem Ruck erhoben
hatte.
Andy McKaren stand auf seinen gichtigen Beinen.
„Auf geht’s!“ rief er grimmig. „War’ doch gelacht, wenn wir
zwei den Jungen nicht zur Vernunft brächten!“
„Warten Sie hier“, sagte Virginia. „Ich gehe den Wagen
anspannen. Nachher hole ich Sie!“
„Du bist ein Prachtmädel!“ Der alte Mann blickte sie
bewundernd an. „Ich glaube, du wirst sogar mit zwei
Dickschädeln fertig.“
Virginia verließ eilig das Haus. Als sie auf den Hof
hinaustrat, blickte sie prüfend zum Himmel empor.
Hoffentlich kommen wir nicht zu spät, dachte sie…

Auf der Ponderosa
„Unser Schwefelbad scheint Erfolg zu haben“, meldete Little
Joe, während er sein Pferd vor seinem Vater parierte. „Von den
behandelten Tieren ist keines mehr erkrankt!“
„Ich habe nichts anderes erwartet“, erklärte Ben Cartwright.
„Auf mich könnt ihr euch verlassen!“ ließ sich Hoss
vernehmen, der, mit dem Rücken an ein Rad gelehnt, im
Schatten des Wagens saß und mit Wohlbehagen kaute.
Der Dicke hatte sich diese Mahlzeit nach der anstrengenden
Arbeit redlich verdient. Jetzt war alles überstanden. Sie hatten
das letzte Rind durch die Grube getrieben.
„Was ich empfehle, ist gut“, behauptete Hoss.
Die beiden großen Reisigfeuer neben der Grube waren
heruntergebrannt. Dafür loderte jetzt nicht weit von dem
Wagen entfernt ein Lagerfeuer.
Darüber hing ein großer Kübel mit heißem Kaffee und
erfüllte die kühle Nachtluft mit köstlichem Wohlgeruch.
„Weißt du, was ich mir überlegt habe?“ Ben Cartwright, der
gedankenverloren in das zu roter Glut niederbrennende Feuer
gestarrt hatte, hob den Kopf und blickte seinen Sohn an. „Wir
werden unsere Nachbarn auffordern, ihr Vieh ebenfalls durch
unser Schwefelbad zu treiben.“
„Das ist keine schlechte Idee“, gab Little Joe zu.
„Ich schlage vor, du reitest gleich los und sprichst mit den
Leuten“, riet ihm sein Vater.
„Okay!“ Little Joe wendete sein Pferd und verschwand wie
ein Gespenst in der Dunkelheit.
Aus der Ferne klang das Muhen und Brüllen der Rinder, die
sie ein Stück abseits getrieben hatten, damit sich die Tiere

lagern konnten. Ein paar Cowboys hielten bei der Herde
Wache.
Die Sterne flimmerten blaß. Nebelschwaden stiegen spukhaft
über dem Tahoe-See auf. Seltsame, unwirklich anmutende
Laute drangen von fern her.
Ben Cartwright war zufrieden. Das Gras war in diesem
Sommer gut gewesen, auch Wasser gab es reichlich. Erst die
Seuche hatte ernstliche Sorgen gebracht. Aber sie schien
glücklich überstanden zu sein.
Hufgetrappel schreckte ihn aus seinen Gedanken auf. Ein
Reiter erschien groß im Lichtkreis des Feuers. Little Joe
zügelte sein Pferd.
„Vater!“ rief er. „Unsere Herde ist in Gefahr! Ted McKaren
und Len Keith haben alle Nachbarn gegen uns aufgehetzt. Sie
kommen bis an die Zähne bewaffnet zur Ponderosa und wollen
uns zwingen, unsere Rinder zu töten!“
„Was höre ich da?“ Hoss sprang wütend auf.
„Nur keine Aufregung!“ beruhigte Ben Cartwright seine
Söhne. „Wir werden ihnen zeigen, daß wir alles getan haben,
um das Ausbreiten der Seuche zu verhindern.“
„Ja“, sagte Little Joe. „Aber sie bezweifeln, daß unsere
Methode wirkt! Sie wollen sichergehen und verlangen, daß wir
die ganze Herde töten!“
„Das können sie nicht!“ erklärte Hoss. Er stand groß und
breitbeinig vor dem Reiter.
Im flackernden Schein des Feuers erschien Joes schmales
Gesicht müde und hager. Seine tiefliegenden Augen verliehen
ihm ein gespenstisches, fremdes Aussehen.
„Sie werden sich kaum mit unseren Erklärungen
zufriedengeben“, befürchtete er.
„Dann werden wir sie eben entsprechend empfangen“,
erklärte Ben Cartwright entschlossen.
„Sie werden etwas erleben!“ Hoss lächelte begeistert.

„Hol für alle Fälle unsere Gewehre“, wandte sich Ben
Cartwright an seinen jüngsten Sohn. „Aber paß auf, daß zu den
Männern nicht begegnest!“
„Keine Angst“, beruhigte ihn Little Joe. „Ich reite am
jenseitigen Ufer des Sees entlang.“
„Beeil dich!“ rief Hoss.
„Nanu!“ wunderte sich Little Joe. „Ich dachte immer,
deine
Fäuste wären deine beste Waffe?“ Er sprengte, ohne eine
Antwort abzuwarten, davon.
Ben Cartwright sah besorgt über die breite Ebene, die man
meilenweit überblicken konnte. Bald würde der Tag
anbrechen. Dann konnte es nicht mehr lange dauern, bis die
Männer kamen…

Der Kampf beginnt
Ben Cartwright entdeckte sie als erster.
„Sie kommen, Jungs!“ rief er. „Nehmt die Gewehre!“
In der Morgendämmerung sahen sie zahlreiche Reiter
herankommen.
„Es wird erst geschossen, wenn ich euch ein Zeichen gebe“,
erklärte Ben Cartwright. „Ich will zuerst mit ihnen reden!“
„Vielleicht wollen sie gar nicht erst reden“, befürchtete Hoss.
„Aber ich will es“, wiederholte sein Vater mit Nachdruck.
Die Reiter waren inzwischen so nahe herangekommen, daß
man sie erkennen konnte. Es waren die Rancher aus dem Tal,
die von Ted McKaren und Len Keith angeführt wurden.
Die Cartwrights erwarteten sie mit schußbereiten Gewehren
vor ihrer Herde.
„Halt!“ warnte Ben Cartwright. „Keinen Schritt weiter!“
Der Silberbaron ließ den Reitertrupp anhalten.
„Keith!“ rief Ben Cartwright. „Seit wann gehörst du zu uns
Ranchern?“
Der Silberbaron starrte ihn feindselig an.
„Ich bin dir keinerlei Erklärung schuldig, Cartwright!“ schrie
er. „Wenn du es aber unbedingt wissen willst: Ich begleite
meinen zukünftigen Schwiegersohn!“
„Ted McKaren ist unser Wortführer!“ bestätigten die
Rancher.
„Irrtum!“ widersprach Ben Cartwright. „Ted ist nur das
Sprachrohr von Len Keith. Er schiebt den Jungen vor, um
seine dunklen Pläne zu tarnen!“
„Das ist eine Verleumdung!“ schrie der Silberbaron.

„Nicht von Len Keith wollen wir hier reden“, schrie John
Copley, „sondern von Ben Cartwright!“
„Mr. Cartwright!“ rief Ted. „Sagen Sie uns, was Sie mit Ihren
kranken Rindern gemacht haben!“
„Das wißt ihr doch!“ erklärte Ben Cartwright.
„Wir verlangen, daß Sie Ihre Herde sofort töten!“ forderte
Ted im Namen aller.
„Das ist nicht nötig“, versicherte Ben Cartwright. „Unser
Schwefelbad tötet alle Milben ab! Ihr könnt euch gleich selbst
davon überzeugen!“
„Kannst du uns garantieren, daß die Rinder davon wirklich
gesund werden?“ wollte John Copley wissen.
„Nein!“ Ben Cartwright schüttelte den Kopf. „Garantieren
kann ich euch das nicht!“
Seine Widersacher lachten höhnisch auf.
„Ich garantiere euch aber“, fuhr Ben Cartwright unbeirrt fort,
„daß ich jedes Tier aus meiner Herde töten werde, das morgen
noch krank ist.“
„Und das sollen wir Ihnen glauben?“ fragte Ted. „Nein, Mr.
Cartwright! Wir lassen uns nicht mehr mit leeren
Versprechungen abspeisen. Wir sind in dieser Beziehung etwas
mißtrauisch geworden!“
„He!“ Hoss trat wütend vor. „Soll das heißen, daß du meinen
Vater für einen Lügner hältst?“
„Sei ruhig“, ermahnte ihn sein Vater. „Ich werde schon allein
mit ihm fertig!“
„Du hast es mit uns allen zu tun“, erinnerte ihn John Copley.
„Nicht nur mit Ted McKaren!“
Die Rancher nahmen eine drohende Haltung ein.
„Reitet ihn über den Haufen!“ schrie Jim Avery.
„Auf sie!“ tönte es von allen Seiten.
„Wenn ihr meine Herde anrührt, wird geschossen“, warnte
sie Ben Cartwright. „Ich hoffe, das ist euch allen klar.“

Seine Widersacher antworteten mit Schmährufen.
„Wir kennen uns seit vielen Jahren“, sprach Ben Cartwright
unbeirrt weiter. „Wenn es zum Kampf kommt, wird es
Verletzte, vielleicht sogar Tote geben. Ihr werdet sie
verantworten müssen. Denkt in Ruhe nach, ehe ihr euch
entscheidet.“
„Für das, was jetzt hier geschieht, tragen allein Sie die
Verantwortung“, behauptete Ted.
„Nein!“ widersprach Ben Cartwright. „Das ist Len Keiths
Werk!“
„Knall ihn ab, Ted!“ schrie der Silberbaron. „Worauf wartest
du noch? Wir sind doch in der Übermacht!“
„Sie haben es gehört, Mr. Cartwright!“ sagte Ted. „Jeder
Widerstand ist zwecklos! Geben Sie endlich den Weg frei!“
„Junge!“ rief Ben Cartwright. „Das meinst du doch nur im
Spaß!“
„Nein!“ schrie Ted. „Diesmal ist es ernst!“
Ben Cartwright hob sein Gewehr.
„Keine Bewegung, Männer!“ warnte er.
In die Stille, die diesen Worten folgte, klang ein lautes
Rumpeln. Die Männer wandten überrascht die Köpfe.
In eine Staubwolke gehüllt, jagte ein Buggy heran. Seine
Räder sprangen holpernd über Schlaglöcher und Bodenwellen.
Das leichte Gefährt kam genau auf sie zu.
Auf dem Kutschbock saß mit wehenden blonden Haaren ein
Mädchen und trieb die Pferde mit Peitschenknall zu höchster
Eile an.
Zwischen den beiden feindlichen Parteien brachte Virginia
den Wagen zum Stehen. Der Mann, der neben ihr auf dem
Kutschbock saß, richtete sich steif auf.
„Gottlob!“ rief er aufatmend. „Ich bin noch nicht zu spät
gekommen!“

Andy McKarens große Stunde
Man sah es Len Keith an, daß er mit dieser Entwicklung der
Ereignisse ganz und gar nicht einverstanden war. Er lenkte sein
Pferd dicht an den Wagen heran.
„Mr. McKaren“, sagte er. „Sie sind hier völlig überflüssig!“
„Ich bin gekommen, um meinen Sohn vor einem Mord zu
bewahren“, erklärte Andy McKaren.
„Vater!“ rief Ted. „Misch dich hier nicht ein! Wir müssen
endlich mit den Cartwrights abrechnen!“
„Junge!“ sagte sein Vater. „Wenn du unbedingt jemanden
erschießen mußt, dann fang am besten gleich bei mir an!“
„Sie können Ihrem Sohn nichts mehr befehlen“, belehrte ihn
der Silberbaron. „Ted läßt sich von niemandem etwas
vorschreiben! Auch nicht von den Cartwrights!“
„Glaub mir, Vater“, versicherte Ted. „Das hier ist mehr als
nur ein harmloser Streit!“
„Ich weiß genau, worum es hier geht“, sagte Andy McKaren.
„Ich weiß es sogar besser als du!“
Die Rancher wurden ungeduldig. Sie waren nicht auf die
Ponderosa gekommen, um einer Auseinandersetzung zwischen
Vater und Sohn beizuwohnen.
„Kommt endlich zur Sache!“ forderte John Copley. „Wir
können hier nicht ewig stehen!“
„Da hast du recht!“ antwortete ihm Andy McKaren. „Und
wenn ich dir einen guten Rat geben darf, John: Reite, so
schnell du kannst, nach Hause. Dein Vieh hat das Texasfieber!
Aber nicht nur deine Rinder! Auch die von Tom Curgill und
Henry Rogers! Ich fürchte, alle Herden im Tal sind verseucht,
meine nicht ausgenommen!“

Die Rancher blickten entsetzt.
„Dafür könnt ihr euch bei Ben Cartwright bedanken!“ schrie
der Silberbaron.
„Leute!“ rief John Copley. „Laßt uns die Sache schnell zu
Ende bringen!“
„Wartet!“ sagte Ben Cartwright. „Hört mir noch einen
Augenblick zu! Ihr könnt natürlich unser Vieh töten! Aber was
habt ihr damit gewonnen? Eure Rinder werden trotzdem
verenden!“
„Weil dein Vieh sie angesteckt hat!“ warf John Copley ein.
„John!“ rief Ben Cartwright beschwörend. „Keiner von euch
braucht seine Herde zu verlieren! Ich weiß, daß unser
Schwefelbad hilft! Es hat meine Rinder gesund gemacht! Auch
deine Herde kann gerettet werden! Statt uns zu streiten, sollten
wir uns schleunigst an die Arbeit machen!“
„Hört euch das an!“ schrie Len Keith. „Er gibt euch schon
wieder Befehle!“
„Damit ist es jetzt vorbei“, erklärte Jim Avery.
„Niemand will deinen Rat hören“, sagte auch Henry Rogers.
Die Rancher schienen sich in ihrer Ablehnung einig zu sein.
Nur Ted wirkte plötzlich unentschlossen.
„Du mußt dich jetzt entscheiden“, wandte sich der
Silberbaron an seinen zukünftigen Schwiegersohn. „Also?
Wohin gehörst du – zu mir oder zu den Cartwrights?“
„Ted gehört zu mir“, behauptete Virginia.
„Schweig!“ fuhr Len Keith seine Tochter wütend an.
„Niemand hat dich nach deiner Meinung gefragt!“
Virginia stand schweratmend auf dem Kutschbock.
„Leute!“ rief sie. „Damit ihr es endlich wißt: Mein Vater
interessiert sich überhaupt nicht für eure Herden!
Es ist ihm gleichgültig, ob sie an Texasfieber verenden oder
nicht! Was er will, ist euer Land! Weil er damit große Gewinne
erzielen kann!“

„Es geht hier nicht um unser Land, sondern um die Seuche“,
belehrte sie Ted.
„Gut!“ nickte Virginia. „Reden wir von der Seuche! Auch
darüber kann ich einiges berichten. Zum Beispiel, daß mein
Vater sie eingeschleppt hat!“
„Virginia!“ schrie der Silberbaron. „Du weißt nicht, was du
da sprichst!“
„Doch! Virginia weiß genau, was sie redet“, kam ihr Little
Joe zu Hilfe. „Sie war dabei, als ihr Vater Sam Tucker
erschoß! Der Vormann mußte sterben, weil er zuviel wußte,
weil Len Keith befürchtete, daß er ihn eines Tages verraten
würde. Aber ich kenne das Geheimnis und kann Keiths Schuld
sogar beweisen!“
„Vorsicht!“ rief Virginia.
Len Keith zielte mit seinem Colt auf Little Joe. Aber bevor er
abdrücken konnte, traf ihn Andy McKarens Kugel. Der
Silberbaron stürzte mit einem Aufschrei vom Pferd…

Ein großzügiges Angebot
Mit dem Schuß auf Little Joe hatte sich Len Keith selbst
entlarvt. Es hätte keines Geständnisses mehr bedurft. Trotzdem
hatte der Silberbaron seine Schuld eingestanden, als er die
Augen wieder aufschlug.
Die Rancher fühlten sich beschämt und ernüchtert. Sie
konnten es plötzlich nicht mehr begreifen, daß sie sich hatten
aufhetzen lassen.
„Steht hier nicht untätig herum!“ rief Ben Cartwright.
„Mein Angebot gilt noch immer! Bringt eure Rinder so
schnell wie möglich hierher, damit wir sie durch unser
Schwefelbad treiben können!“
„Gilt dein Angebot auch für unsere Herde?“ erkundigte sich
Andy McKaren.
„Natürlich, Andy!“ sagte Ben Cartwright. „Das heißt, wenn
es Ted recht ist.“
„Und ob mir das recht ist!“ erklärte Ted.
„Paß auf“, sagte Virginia. „Jetzt wird noch alles gut!“
„Dank deiner Hilfe!“ gab Ted zu. „Ohne dich hätte ich die
größte Dummheit meines Lebens gemacht!“
„Ich werde auch in Zukunft auf dich aufpassen“, versprach
Virginia. „Aber jetzt muß ich dich verlassen!“
Sie wollte ihren Vater zum Doktor bringen.
„Laß mich nicht zu lange allein“, bat Ted.
Virginia winkte ihm lächelnd zu. Dann stieg sie auf den
Kutschbock und gab den Pferden die Zügel frei. Diesmal
mußte sie ganz langsam fahren, um den Verletzten, der hinten
im Wagen lag, nicht zu sehr durchzuschütteln.

Ted blickte ihr verliebt nach; aber das Licht der aufgehenden
Sonne blendete ihn so stark, daß er nach einer Weile die Augen
schließen mußte.
Das Brüllen der Kühe brachte ihn wieder in die Gegenwart
zurück. Er schwang sich in den Sattel seines Pferdes und ritt
davon, um die Herde zu holen.
Nach den Rindern der McKarens kam die Herde von John
Copley an die Reihe. Sie trieben gerade die Rinder von Henry
Rogers durch das Schwefelbad, als es wieder zu dämmern
begann.
Das war für Hoss ein Grund, zu protestieren.
„He!“ rief er. „Gibt es hier nichts zu essen?“ Er stand noch
immer an der Grube und achtete darauf, daß die Rinder ganz
untertauchten.
„Zu essen?“ Little Joe glaubte nicht richtig zu hören. „Erst
müssen alle Rinder hindurch sein!“
„So lange halte ich es nicht mehr aus“, befürchtete Hoss.
„Du mußt durchhalten“, erklärte sein Bruder. „Niemand kann
so gut auf die Rinder aufpassen wie du!“
„Das stimmt“, gab Hoss zu. „Es würde mir auch gar nichts
ausmachen! Wenn ich keinen Hunger hätte!“
„Wie kannst du Hunger haben“, wunderte sich Little Joe,
„wenn du ständig auf Vorrat ißt?“
„Auf Vorrat? Wieso?“ Hoss starrte ihn verständnislos an.
„Du willst doch nicht behaupten, daß du die drei Portionen,
die du ständig verdrückst, als eine Mahlzeit betrachtest?“
vergewisserte sich Little Joe.
„Natürlich!“ behauptete Hoss. „Was sonst?“
„Dann kannst du ruhig mal zwei Tage fasten“, meinte sein
Bruder.
„Ausgeschlossen!“ Hoss schüttelte entsetzt den Kopf. „Ich
habe schon jetzt so ein flaues Gefühl in der Magengegend!“

Little Joe grinste spöttisch. Aber Ted McKaren hatte Mitleid
mit dem Dicken.
„Geh ruhig essen“, sagte er. „Ich übernehme deine Arbeit
solange!“
„Ihr solltet euch ruhig eine Weile ausruhen“, wandte sich
Henry Rogers an Ben Cartwright. „Den Rest schaffen wir
schon allein!“
„Ja“, nickte Ben Cartwright. „Etwas Ruhe könnte jetzt nicht
schaden. Wir sind seit sechsunddreißig Stunden
ununterbrochen auf den Beinen.“
„Reitet ruhig nach Hause“, mischte sich John Copley ein.
„Ihr könnt uns ja morgen früh wieder ablösen! Dann ist die
Herde von Quentin Dobbs an der Reihe.“
„Okay!“ sagte Ben Cartwright. Er winkte seinen Söhnen.
„Kommt, Jungs! Wir reiten nach Hause!“
„Schätze, Hop Sing kennt uns gar nicht mehr“, vermutete
Hoss. „Weil er uns so lange nicht gesehen hat!“
„Das könnte bei dir zutreffen“, gab ihm Little Joe recht.
„Nachdem du mindestens zehn Pfund abgenommen hast!“
„Jungs!“ lachte ihr Vater, „übertreibt nicht so!“
Sie bestiegen ihre Pferde und ritten in einer Linie davon.
Bald hörten sie das Brüllen und Keuchen der Rinder nicht
mehr. Vor ihnen lag, in Wellen wie ein wogendes Meer,
Übergossen vom Abendrot, die Ponderosa, das Reich der
Cartwrights.
Ende
Document Outline
- Eine Kampfansage
- Hoss kommt auf den Hund
- Die Aussprache
- Einer sucht Streit
- Zwei verbünden sich
- Seife für Stinktiere
- Ein überraschender Besuch
- Ohne Prügel geht es nicht
- Eiliger Aufbruch
- Eine schlechte Nachricht
- Hoss entdeckt etwas
- Eine Strafpredigt
- Zwei verstehen sich
- Der Überfall
- Eine Hiobsbotschaft
- Es wird ernst
- Ted setzt sich durch
- Tod den Milben
- Little Joe spielt Detektiv
- Einer muß dran glauben
- Die Verschwörung
- Eine warnende Stimme
- Virginia gibt nicht auf
- Auf der Ponderosa
- Der Kampf beginnt
- Andy McKarens große Stunde
- Ein großzügiges Angebot
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Bonanza 6 Parker, Teddy Eine heiße Spur
Bonanza 3 Parker, Teddy Ritt ins Abenteuer
Bonanza 7 Parker, Teddy Gefahr für Little Joe
Bonanza 5 Parker, Teddy Einer spielt falsch
Mozart auf der Reise nach Prag
Auf der Post, ściągi
31 Methodische Prinzipien der Einführung (Präsentation) einer neuen lexikalischen Einheit auf der Gr
53 Methodologische Grundsätze der Einführung von Präsentationstexten (Lerntexten) auf der Grundstufe
Mozart auf der Reise nach Prag
Auf der Sonnenseite des Lebens
Biedermeier, Mörike Mozart auf der Reise nach Prag
53 Methodologische Grundsätze der Einführung von Präsentationstexten (Lerntexten) auf der Grundstufe
Albert Einstein Auf der Suche
Wortschatz Auf der Alm
Wortschatz Auf der Alm leer
Auf Der Maur Followed The Waves [T]
Moerike, Eduard Mozart auf der Reise nach Prag
więcej podobnych podstron