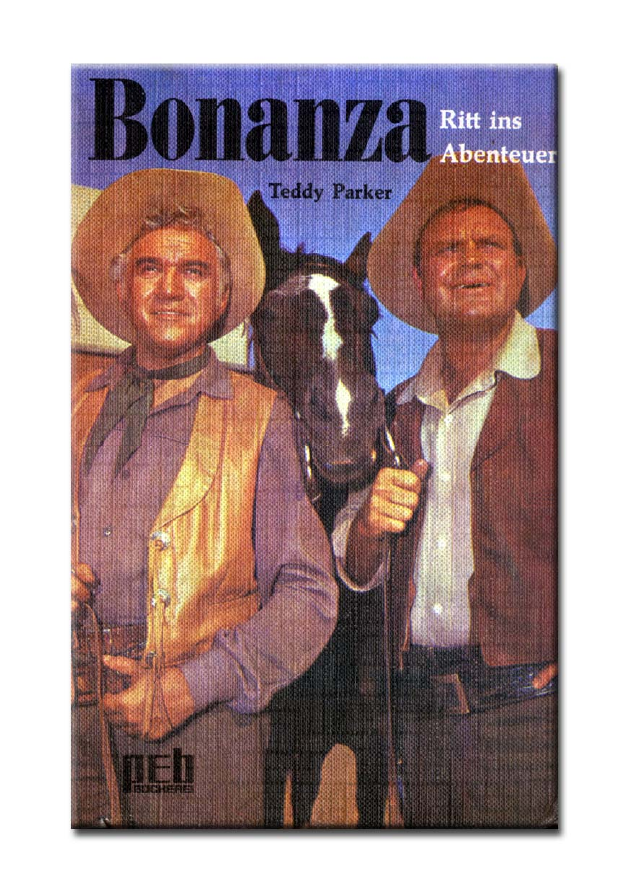

Teddy Parker
Ritt ins Abenteuer
Bonanza
Band 3
Engelbert‐Verlag • Balve/Westf.

Verlags-Nr. 778
1. Auflage 1969
Textauswahl: Kurt Veihake
(c) 1969 by National Broadcasting Company, Inc.
Alle Rechte vorbehalten
Veröffentlicht mit Genehmigung von Western Publishing
Company, Inc. Wisconsin, USA
Alle Rechte der deutschen Buchausgabe 1969 by
Engelbert-Verlag, Balve
Nachdruck verboten – Printed in Germany
Satz, Druck und Einband: Gebr. Zimmermann
Buchdruckerei und Verlag GmbH, Balve/Westf.

Ein unerwartetes Wiedersehen
Der Tag, an dem die Soldaten auf die Ranch Ponderosa kamen,
würde den Bewohnern unvergeßlich bleiben; denn damit
begann für sie ein neues aufregendes Abenteuer.
Es waren ein Colonel, ein Sergeant und acht Mann, die in den
Hof geritten kamen; inmitten des Trupps rumpelte ein alter
Planwagen, auf dessen Kutschbock ein ergrauter Korporal saß.
Auf dem großen freien Platz zwischen dem soliden
Ranchhaus, den festgefügten Ställen und dem Pferch hielten
die Reiter ihre Pferde an. Der Korporal fuhr seinen Wagen bis
vor die Remise. Die Soldaten sprangen auf ein Zeichen ihres
Anführers aus dem Sattel und blieben abwartend neben ihren
Pferden stehen, während der Sergeant mit gemessenen
Schritten auf das Haus zuschritt. Er war noch nicht bis zur Tür
gekommen, als sie aufsprang und ein kleiner, dürrer schlitz-
äugiger Mann mit einem langen schwarzen Zopf heraushüpfte.
Hop Sing, der chinesische Koch der Ponderosa, trug als
Zeichen seiner Würde über dem engen schwarzen Gewand eine
weiße Küchenschürze. In seiner rechten Hand blinkte ein
großes Küchenmesser. Er stellte sich schützend vor die
Schwelle.
„Niemand zu Hause“, verkündete er mit heller, singender
Stimme. „Mastel mit Söhne weggelitten!“ Wie viele Chinesen
sprach er statt des schwer aussprechbaren R ein L.
„Wir werden warten“, sagte der Sergeant.
„Es sein möglich, daß Mastel bald zulückkommen“, erklärte
Hop Sing. „Es sein abel auch möglich, daß lange wegbleiben!
Sehl lange! Ich nicht wissen!“

Es war September, und die Tage wurden bereits kürzer. Jetzt,
um vier Uhr nachmittags, schien noch die Sonne. Aber die alte
Eiche am Hoftor warf schon einen langen Schatten.
„Wir werden trotzdem warten“, sagte der Sergeant.
„Oh, Mastel!“ Hop Sing atmete erleichtert auf, als er die drei
Reiter in den Hof galoppieren sah.
Der Sergeant ging eilig auf die drei Männer zu, die vor dem
Ranchhaus absaßen.
„Mr. Cartwright?“ wandte er sich an den Älteren.
Der stämmige grauhaarige Mann, dem man ansah, daß er mit
Kraft und Zuversicht sein Leben meisterte, nickte.
„Ich bin Ben Cartwright“, bestätigte er. „Und das sind meine
Söhne Hoss und Joe.“
„Sergeant Devlin“, stellte sich der Fremde vor. „Darf ich Sie
bitten, mit mir zu kommen, Sir?“
Falls Ben Cartwright überrascht war, ließ er es sich nicht
anmerken. Er folgte dem Sergeanten bereitwillig.
Hoss schob seinen Hut in die Stirn und kratzte sich hinter
dem Ohr.
Er war hochgewachsen, breitschultrig und von gutmütiger
Wesensart.
„Weißt du, was das bedeutet?“ fragte er seinen Bruder.
„Wollen sie uns am Ende etwa zum Militär einziehen?“
„Keine Angst!“ beruhigte ihn Joe. „Die wollen ihre Kriege
gewinnen und nicht verlieren!“
Über das gutmütige Gesicht des Bruders glitt ein Lächeln.
„Da hast du recht“, gab er zu.
Gegen die riesige Gestalt seines Bruders Hoss wirkte Little
Joe fast klein; dabei war er ebenfalls von stattlicher Größe, nur
wesentlich schlanker.
„Ich bin ja auch neugierig, was die von uns wollen“, gestand
er.

Die beiden Brüder ließen ihren Vater nicht aus den Augen.
Sie beobachteten, wie er plötzlich stehenblieb und den Offizier
ungläubig anstarrte.
„Nanu?“ wunderte er sich. „Sehe ich recht?“
„Ja“, bestätigte der Colonel. „Ich bin es wirklich, Ben!“
„Keith!“ rief Ben Cartwright. „Keith Jarell! Colonel Keith
Jarell!“ verbesserte er sich. „Mann, ist das eine Überraschung!
Hätte nicht gedacht, dich noch einmal wiederzusehen!“
Die beiden alten Freunde lagen sich lachend in den Armen.
Die Soldaten, die Zeuge dieses unerwarteten Wiedersehens
wurden, lächelten. Hoss und Joe tauschten einen vielsagenden
Blick.
„Siebzehn Jahre sind eine verdammt lange Zeit, nicht wahr,
Ben?“ sagte der Colonel. „Waren damals ziemlich stürmische
Zeiten, was?“
„Ja“, nickte Ben Cartwright. „Lagen fast ständig im Kampf
mit den Indianern!“
„Apachen, Comanchen“, erinnerte sich Keith Jarell.
„Rothäute, wohin man sah!“
Ben Cartwright blickte den Freund aus alten Tagen gerührt
an.
„Wahrhaftig, Keith“, sagte er. „Die Überraschung ist dir
gelungen! Kann es noch immer nicht glauben, daß du leibhaftig
vor mir stehst! Und nun sollst du meine Jungs kennenlernen!“
Er kehrte mit seinem Gast zum Ranchhaus zurück, wo seine
Söhne noch immer neben den Pferden standen und ihm
erwartungsvoll entgegenblickten.
„Das ist Little Joe“, stellte er seinen jüngsten Sohn vor.
„Tag, Colonel“, grüßte Joe. „Und das ist Hoss, mein
Ältester“, erklärte Ben Cartwright.
„Hallo!“ Hoss zerdrückte mit seinen großen Händen verlegen
seinen Hut.
Plötzlich stand Hop Sing vor ihnen.

„Mastel!“ rief er. „Oh, sein ich floh, daß Mastel gekommen
so flüh zulück! Flemde Soldaten kommen, ein, zwei, dlei – ich
nicht wissen, wie viele. Almes Hop Sing…“
Ben Cartwright deutete auf seinen Gast. „Das ist Colonel
Jarell“, sagte er. „Ein alter Freund von mir!“
Der Chinese verneigte sich ehrfürchtig vor dem Offizier.
„Altel Fleund gut“, sagte er. „Sehl gut!“
„Hör zu“, wandte sich der Rancher an den Koch. „Du machst
jetzt für uns alle ein gutes Essen!“
„Sehl gutes Essen“, versprach Hop Sing.
„Nicht nur für uns“, sagte Ben Cartwright. „Auch für die
Männer, die mit dem Colonel gekommen sind.“
Der Chinese blickte entsetzt auf die Soldaten.
„Fül alle?“ fragte er. „Fül ganze Almee?“
„Ja“, nickte der Rancher. „Für die ganze Armee.“
„Ganzes Haus vellückt“, stöhnte der chinesische Koch. „Hop
Sing bald auch vellückt! Essen kochen fül ganze Almee! Oh,
almes Hop Sing!“ Er verschwand kopfschüttelnd in der Küche.
Die Männer blickten ihm lächelnd nach.
„Wir wollen ins Haus gehen“, schlug Ben Cartwright vor.
Auf einen Wink des Colonels ließ der Sergeant die Soldaten
wegtreten. Hoss und Joe brachten die Pferde in den Stall. Der
Rancher hielt seinem Gast einladend die Tür auf.
„Willkommen in meinem Hause“, sagte er.
Ben Cartwright konnte nicht ahnen, daß er seine
Gastfreundschaft noch einmal verwünschen würde…

Der Auftrag
„Und nun sag mir, was dich auf die Ponderosa führt.“ Ben
Cartwright sah den Colonel erwartungsvoll an.
Er saß mit seinem Gast und seinen Söhnen in der großen
Wohnstube vor dem prasselnden Kaminfeuer. Das von Hop
Sing zubereitete Essen war ausgezeichnet gewesen. Danach
hatten sie mit echtem amerikanischem Whisky auf die alte
Freundschaft angestoßen.
Auf dem Marmorsims flackerte eine Kerze. Ihr Licht fiel auf
den hellen Holzfußboden, den breiten alten Tisch, die
bequemen Holzstühle mit den gepolsterten Lehnen und die
große Anrichte.
Draußen, auf dem Hof, hatten die Soldaten ein Biwak
errichtet. Die Gewehre waren zu Pyramiden zusammengestellt.
Die Pferde standen im Pferch. Hell loderte das Lagerfeuer in
der Nacht, die sich wie ein schwarzes Tuch über die Ranch
breitete.
„Also“, wiederholte Ben Cartwright, „wie kommen wir zu der
Ehre deines Besuches? Es ist doch kein Zufall?“
„Nein“, sagte Colonel Jarell. „Es ist kein Zufall!“ Hoss und
Joe horchten auf.
„Ich bin gekommen, weil ich deine Hilfe brauche“, fuhr der
Colonel fort.
„Meine Hilfe?“ fragte Ben Cartwright erstaunt.
Hoss und Joe sahen sich bedeutungsvoll an.
„Major Cartwright war ein guter Soldat“, stellte Colonel
Jarell mit Nachdruck fest. „Ein Mann, auf den man sich
unbedingt verlassen konnte…“
„Moment mal!“ unterbrach ihn der Rancher. „Das ist jetzt
siebzehn Jahre her, Keith!“

„Richtig!“ gab der Colonel zu. „Aber ich kenne dich gut
genug, Ben, um zu wissen, daß du dich in der Zwischenzeit
nicht verändert hast! Oder irre ich mich?“
„Nein“, bestätigte Ben Cartwright. „Du irrst dich nicht,
Keith!“
„Na, also!“ Colonel Jarell atmete hörbar auf. Dann fuhr er mit
beschwörender Stimme fort: „Ich brauche einen zuverlässigen
Mann! So einen wie dich, Ben, der hier wohnt und dem die
Indianer vertrauen…“
„Ich will nicht bestreiten, daß ich mich hier in der Gegend
auskenne“, sagte der Rancher. „Aber…“
„Das genügt!“ fiel ihm der Colonel ins Wort.
„Wozu?“
„Du sollst mich und meine Männer zu den Jarbridge
Mountains führen“, erklärte der Colonel.
Der Rancher hatte seine Pfeife gestopft. Er hielt ein
brennendes Streichholz an den Tabak und machte ein paar
paffende Züge.
„Ein militärischer Auftrag?“ erkundigte er sich.
„Ich habe den Auftrag, Elkoro in den Bergen ausfindig zu
machen“, antwortete Colonel Jarell.
„Elkoro?“ Hoss hatte den Namen schon gehört. „Das ist doch
der Häuptling der Paiutes, die bei Pyramid Lake den Soldaten
eine blutige Schlacht geliefert haben.“
„Damals vernichteten die Indianer fast ein ganzes Bataillon
der Miliz“, erinnerte sich Joe.
Er nahm eine von seinen langen, dünnen schwarzen Zigarren
aus der Tasche und biß nach alter Gewohnheit die Spitze ab.
Dann ließ er sich von Hoss Feuer geben. Nachdem er mit
Genuß den ersten Zug getan hatte, sprach er weiter.
„Der Stamm hat sich später geteilt“, berichtete er. „Viele
Indianer gingen in die von der Regierung errichteten
Reservationen. Nur Elkoro blieb mit Frauen, Kindern und

sämtlichen Kriegern in den Bergen. Über achtzig
schwerbewaffnete, zu allem entschlossene Männer, die die
Autorität der Vereinigten Staaten nicht anerkennen wollen.“
„Und was geschieht, wenn du Elkoro gefunden hast?“
„Ich will Frieden“, erklärte Colonel Jarell. „Ich will Elkoro
davon überzeugen, daß Rote und Weiße ohne Haß
nebeneinander leben können. Zuvor aber muß ich ihn in den
Bergen gefunden haben!“
„Colonel!“ ließ sich Hoss vernehmen. „Mit den paar
Männern, die Sie begleiten, haben Sie nicht die geringste
Chance zu überleben, falls die Indianer Sie angreifen sollten.“
„Das stimmt!“ pflichtete ihm der Colonel bei. „Ich habe
absichtlich so wenig Männer mitgenommen, um meine
Friedfertigkeit glaubhaft zu machen.“
„Ich weiß nicht!“ Hoss schüttelte bedenklich den Kopf. „Das
erscheint mir ziemlich gefährlich!“
„Ich habe keine andere Wahl“, sagte Colonel Jarell. „Im
letzten Jahr hatten wir zwei Reiterschwadronen ausgesandt. Sie
wurden blutig zurückgeschlagen. Es wird höchste Zeit, daß das
Blutvergießen endlich aufhört!“
„Da bin ich ganz Ihrer Ansicht“, stimmte ihm Hoss zu.
„Es ist auch die Ansicht der Regierung“, erklärte der Colonel.
„Wir alle wollen in Frieden mit den Indianern leben!“
„Ein hohes Ziel“, sagte der Rancher. „Und eine schöne
Aufgabe!“
„Ja“, nickte Colonel Jarell. „Es lohnt sich, dafür alles
einzusetzen und alles zu wagen. Ich hoffe, du bist derselben
Ansicht, Ben.“
„Wir waren schon früher immer der gleichen Meinung“,
erinnerte ihn Ben Cartwright. „Auch das scheint sich noch
nicht geändert zu haben!“
Er trat ans Fenster und blickte hinaus in die vom Lagerfeuer
erhellte Nacht. Im Abglanz der lodernden Flammen tanzten

gespenstische Schatten über die Stallwände. Die Soldaten
saßen am Feuer und reichten einander den Branntweinbecher
zu.
„Wirst du uns führen, Ben?“ fragte Colonel Jarell.
„Ja“, sagte der Rancher. „Ich werde euch zu Elkoro führen!“
Auch diesen Entschluß sollte Ben Cartwright noch bereuen…

Freiwilliger Hoss
Der weiße Hengst stand still auf einem Felsen, so reglos wie
ein Denkmal, als wittere er nicht den Reiter, der ihn beharrlich
verfolgte.
Jetzt habe ich ihn! dachte Hoss. Jetzt kann er mir nicht mehr
entkommen! Er schwang sein Lasso. Die Schlinge senkte sich
bedrohlich auf sein Opfer.
Da galoppierte der weiße Hengst plötzlich wie ein
Wirbelwind davon, im allerletzten Augenblick, so, wie er sich
bisher immer der Gefangennahme entzogen hatte.
Hoss stöhnte leise auf. Er hörte den Schimmelhengst gellend
wiehern, es klang wie Triumphgeschrei. Dann vernahm Hoss
eine laute Männerstimme.
Er erwachte und fühlte sich schweißnaß. Nur langsam
gewöhnten sich seine Augen an das Halbdunkel im Zimmer. Es
dauerte eine Weile, bis er begriff, daß er alles nur geträumt
hatte.
Aber das Pferdewiehern drang noch immer an sein Ohr. Auch
die Männerstimme war wirklich.
Hoss, der sich zögernd aufgerichtet hatte, sprang mit einem
Satz aus dem Bett. Sein weißes Nachthemd umwallte lang
seine mächtige Gestalt.
Im Osten färbte sich der Horizont bereits rot. Ein heller
Streifen wuchs am Himmel empor.
Im ersten Licht des anbrechenden Tages huschten
schemenhafte Gestalten über den Hof. Pferde wurden getränkt,
Decken zusammengerollt und an die Sättel geschnallt und die
Spuren des Biwaks beseitigt. Sergeant Devlin brachte mit
lauter Stimme Ordnung in das Durcheinander.

„Verdammte Schlamperei!“ schimpfte Hoss, der vergessen
hatte, am Abend seinen Wecker zu stellen, und daran war
natürlich der zu reichlich genossene Whisky schuld.
Bestimmt hätte ihn niemand geweckt, und er würde den
Aufbruch der Soldaten verschlafen haben, wenn er nicht
zufällig aufgewacht wäre. Nein, nicht zufällig, sondern von den
Befehlen des Sergeanten. Hoss beschloß, sich später dafür bei
Devlin zu bedanken. Jetzt mußte er sich beeilen.
Hoss prustete, als er sich am Waschtisch den halben Krug mit
kaltem Wasser über den Kopf goß. Dann wusch er sich flüchtig
und zog sich schnell an.
Leise, um Joe nicht zu wecken, schlich er die Treppe hinab in
die Küche. Dort herrschte ein ständiges Kommen und Gehen.
Die Soldaten füllten ihre Feldflaschen mit Tee, den Hop Sing
in einem riesigen Kessel zubereitet hatte.
Hoss frühstückte im Stehen. Er schlang eilig ein paar
Butterbrote hinunter. Noch mit vollem Munde kauend, ging er
zum Gewehrschrank und prüfte sorgfältig die Büchsen.
Plötzlich legte sich ihm eine Hand auf die Schulter.
„Guten Morgen, Bruderherz“, sagte Joe. „Ich sehe, wir haben
denselben Gedanken.“
„So?“ Hoss drehte sich langsam um. „Dann sag deinem
großen Bruder mal, was du denkst!“
„Der Ritt in die Berge ist gefährlich“, erklärte Joe. „Deshalb
sollten wir Vater nicht allein reiten lassen.“
„Richtig!“ stimmte ihm Hoss zu.
„Also werden wir beide ihn begleiten“, sagte Joe.
„Nicht wir beide“, verbesserte ihn Hoss. „Ich!“ Er richtete
sich zu seiner vollen Größe auf.
„Hör zu, Bruderherz…“ Joe verzog das Gesicht zu einem
Grinsen. „Wir werden diese Streitfrage in einem sportlichen
Wettkampf klären.“
Hoss war auf der Hut.

„Und wie?“ wollte er wissen.
Joe hielt plötzlich einen Pasch Karten in der Hand.
„Hiermit“, sagte er.
Hoss stellte das Gewehr, das er in der Hand gehalten hatte,
neben dem Gewehrschrank auf den Boden. Er schob seinen
Hut aus der Stirn und atmete schwer.
Joe breitete die Karten fächerförmig aus.
„Wer die hohe Karte zieht, begleitet Vater“, erklärte er. „Wer
die niedrige zieht, bleibt auf der Ranch!“
„Moment mal!“ Hoss betrachtete die Karten mißtrauisch.
„Damit haben wir doch vorgestern abend gepokert, nicht
wahr?“
„Ja“, nickte Joe. „Etwas dagegen?“
„Eine ganze Menge“, sagte Hoss.
„Wieso?“ Joe tat überrascht.
„Die hübschen Dingerchen sind gezinkt“, behauptete Hoss.
„He!“ fuhr ihn Joe an. „Soll das heißen, daß ich dich
betrüge?“
„Ja“, brummte Hoss. „Du bist kein Gentleman!“
„Du kannst dir die Karten ansehen“, sagte Joe. „Du wirst
keine finden, die gezinkt ist!“
„Na, schön!“ gab Hoss nach. „Ich bin einverstanden! Unter
einer Bedingung! Daß ich die erste Karte ziehen darf.“
„Okay!“ Joe nickte gönnerhaft.
Hoss ließ sich Zeit. Er betrachtete eingehend das Muster, das
die Rückseite der Karten zierte. Schließlich kratzte er sich
hinter dem Ohr und schnaufte laut, bevor er endlich eine Karte
zog. Er warf nur einen kurzen Blick darauf, dann zeigte er sie
triumphierend seinem Bruder. „Karo-As“, stöhnte Joe.
„Na also!“ Hoss strahlte. „Was sagst du jetzt?“
„Zufall!“ behauptete Joe.
„Moment!“ Hoss zog eine zweite Karte. „Wetten, daß es eine
Pik-drei ist?“ Es war eine Pik-drei. Hoss grinste schadenfroh.

„Glaubst du nun, daß die Karten gezinkt sind?“ fragte er.
„Du hast recht“, gab sich Joe geschlagen.
„Seinen Bruder betrügen! Pfui Teufel!“ Hoss tat wie ein
Lehrer, der einen Schüler beim Abschreiben ertappt hat. Er
schüttelte betrübt den Kopf. „Das hätte ich nicht von dir
erwartet!“
„Knobeln wir mit einem Geldstück“, schlug Joe vor.
„Kopf oder Adler?“ erkundigte sich Hoss, der ein
Zehncentstück aus seiner Tasche geholt hatte.
„Adler“, sagte Joe.
Das Geldstück fiel klirrend auf den Boden. „Kopf“,
verkündete Joe. „Gewonnen!“ jubelte Hoss.
„Hör zu, Bruderherz…“ versuchte es Joe von neuem.
„Warum wollen wir nicht beide Vater begleiten? Anstatt hier
alberne Spiele zu veranstalten!“
Hoss sah ihn mit deutlichem Vorwurf im Blick an.
„Das weißt du doch“, brummte er. „Einer muß hierbleiben
und sich um die Ranch kümmern!“
„Ach was!“ winkte Joe ab. „Alles nur Gerede!“
„Mach dir keine Sorgen“, beruhigte ihn Hoss. „Ich achte
schon auf Pa!“
„Und wer achtet auf dich?“ fragte Joe grinsend.
Hoss schnaufte verächtlich.
Ben Cartwright kam eilig die Treppe herab.
„Nanu!“ wunderte er «sich. „Was ist denn hier los?“
„Little Joe und ich haben gerade ausgeknobelt, wer dich
begleitet“, berichtete Hoss. „Ich habe gewonnen. Also werde
ich mit dir reiten!“
„Interessant!“ Der Rancher sah seine Söhne forschend an.
„Ich werde anscheinend überhaupt nicht gefragt, ob ich
Begleitung wünsche.“

„Pa“, sagte Hoss, „es ist nicht unbedingt notwendig, daß zwei
auf der Ranch sind. Ich meine, es reicht, wenn – äh – einer…“
Er schwieg verwirrt.
„Ich verstehe“, erklärte Ben Cartwright. „Einer von euch
bleibt hier und hütet die Ranch, und der andere paßt auf den
armen, schwachen alten Mann auf. Ist es so?“
„Ja“, nickte Hoss. „Das heißt…“ Er verstummte, als er
erkannte, was er angerichtet hatte. Er hatte die Frage arglos
bejaht, ohne sich etwas dabei zu denken. Jetzt wäre er vor
Scham am liebsten im Boden versunken. „Tut mir leid, Pa“,
stotterte er.
„Wirklich?“ Der Rancher blickte ihn prüfend an.
Hoss machte ein unglückliches Gesicht.
„Anscheinend gehöre ich schon zum alten Eisen“, knurrte
Ben Cartwright.
„Vergiß, was Hoss gesagt hat“, riet ihm Joe. „Hoss hat es
nicht so gemeint!“
„Nein“, stammelte Hoss. „Natürlich nicht! Ich habe mich – äh
– falsch ausgedrückt. Wir dachten…“
„Schon gut!“ unterbrach ihn der Rancher. „Ich will gar nicht
wissen, was ihr gedacht habt. Hier gilt immer noch, was ich
denke. Und ich denke nein!“
„Was heißt nein?“ wollte Joe wissen.
„Nein heißt nein“, erklärte Ben Cartwright. „Ich dachte, das
sei klar!“
Plötzlich fand Hoss die Sprache wieder.
„Hör mal, Pa…“ begann er eifrig. „Du könntest mir befehlen,
daß ich mit Hop Sing tanzen gehen soll, und ich würde es
sofort tun. Bestimmt, Pa! Aber das hier ist etwas anderes. Joe
und ich haben geknobelt, und ich habe gewonnen. Damit habe
ich das Recht erworben, dich zu begleiten. Wenn du mir das
nicht erlaubst, melde ich mich sofort als Freiwilliger beim
Colonel. Also… Du hast die Wahl!“

Der Rancher lächelte belustigt.
„Habe gar nicht gewußt, daß du so gut reden kannst, Hoss“,
gestand er. „Wenn du so mit Elkoro sprichst, ergibt sich der
ganze Stamm mit Freuden.“
Hoss strahlte.
„Das heißt, daß ich mitreiten kann, ja?“ Sein
Vater nickte.
„Na ja“, gab er zu. „Zwei Cartwrights sind in jedem Fall
besser als einer.“
Die alte Standuhr in der Wohnstube schlug mit dumpfen
Schlägen fünf. Vom Hof tönte die Stimme des Sergeanten, der
seine Männer zur Eile antrieb.
Colonel Jarell betrat das Haus.
„Morgen, Ben“, grüßte er. „Bist du fertig?“
„Wir können aufbrechen“, sagte Ben Cartwright. „Aber ich
habe noch eine Überraschung für dich!“
„Eine Überraschung?“ Der Colonel horchte auf.
„Ab sofort haben wir einen Freiwilligen“, erklärte der
Rancher.
„Einen Freiwilligen?“ Colonel Jarell runzelte die Stirn. Er
schien darüber nicht sehr erfreut zu sein. „Wen?“
„Ich bin der Freiwillige“, meldete sich Hoss.
Der Colonel musterte ihn abschätzend.
„Ich hoffe, Sie bereuen diesen Entschluß nicht, junger Mann“,
sagte er. „Es kann sehr gefährlich werden. Darüber sind Sie
sich doch im klaren.“
„Jawohl, Sir“, erklärte Hoss unbeeindruckt.
Joe grinste verstohlen.
„Wiedersehen, Little Joe!“ verabschiedete sich Colonel Jarell
von dem jüngsten Cartwright-Sohn, bevor er wieder auf den
Hof hinausging.
„Viel Glück, Colonel!“ rief ihm Joe nach. Dann wandte er
sich an seinen Vater. „Sei vorsichtig, Pa!“

„Keine Angst“, beruhigte ihn der Rancher augenzwinkernd.
„Hoss paßt ja auf mich auf!“
„Darauf kannst du dich verlassen“, versicherte Hoss.
Dann nahm auch er von seinem Bruder Abschied. „Mach’s
gut, du Betrüger. Und verkauf nicht die Ranch, während wir
fort sind.“
„Das kann ich dir nicht versprechen“, erwiderte Joe grinsend.
„Aber einen guten Rat will ich dir noch mit auf den Weg
geben: Vergiß nie, daß du neben dem Wagen die größte
Zielscheibe für die Indianer bist!“
Hoss kehrte seinem Bruder beleidigt den Rücken zu. Er trat
hinter seinem Vater auf den Hof hinaus und steckte sein
Gewehr in den Sattelschuh, bevor er auf sein Pferd stieg.
Ben Cartwright und der Colonel schwangen sich ebenfalls in
den Sattel. Die Soldaten standen in einer Reihe neben ihren
Pferden, die unruhig mit den Hufen scharrten. Der ergraute
Korporal saß bereits auf dem Kutschbock des Planwagens.
„Fertigmachen zum Aufsitzen“, befahl Sergeant Devlin.
„Aufgesessen!“
Die Soldaten bestiegen ihre Pferde.
„In Zweierreihen vorwärts – hooo!“
Die Soldaten formierten sich zu einer Doppelreihe. Die
beiden letzten Reiter blieben etwas zurück, damit der
Planwagen einschwenken konnte.
Die Standarte flatterte im leichten Wind, als die Soldaten aus
dem Hof ritten. Der Korporal auf dem Planwagen ließ die
Peitsche knallen.
Ben Cartwright nahm mit dem Colonel die Spitze. Hoss ritt
neben dem Sergeanten. Die Räder des Planwagens knirschten
und holperten. Der Hufschlag klirrte.
Sie ritten auf die blauen Berge zu, die in der Ferne
aufragten…

Der erste Späher
Die beiden ersten Tage verliefen ohne Zwischenfall. Mittags
machten sie kurz Rast, und am Abend errichteten sie an einem
geeigneten Ort das Lager.
Am dritten Tag erreichten sie eine breite Schlucht. Steil
ragten die Felswände zu beiden Seiten empor. Die Sonne stand
hoch am Himmel, nur selten spendete ein Baum oder ein Busch
Schatten.
„Achtung!“ warnte Ben Cartwright, der noch immer neben
dem Colonel an der Spitze ritt. „Es ist soweit, Keith!“
„Was hast du entdeckt?“ erkundigte sich Colonel Jarell.
„Indianer“, sagte der Rancher. „Wo?“
„Über deiner linken Schulter!“
Der Colonel blickte unauffällig nach oben. Hoch über ihnen
auf dem Felsgrat stand, sich deutlich vom blauen Himmel
abhebend, ein Reiter. Bunt leuchteten die Federn seines
Kriegsschmuckes.
„Wir befinden uns jetzt in ihrem Gebiet“, erklärte Ben
Cartwright. „Aber noch droht uns keine Gefahr. Niemals würde
sich ein Indianer auf dem Kriegspfad so auffällig zeigen!“
Colonel Jarell zügelte sein Pferd. Auf sein Zeichen hielten der
Reitertrupp und der Planwagen an.
„Sergeant Devlin!“ rief der Colonel.
Der Sergeant, der zusammen mit Hoss hinter dem Planwagen
am Schluß des Zuges geritten war, kam eilig nach vorn
gesprengt. Sein gelbes Halstuch über der blauen Uniform
leuchtete genauso hell wie die drei Winkel an seinem Ärmel
und die blanken Knöpfe. Er salutierte vor Colonel Jarell.
„Sergeant Devlin“, sagte der Colonel. „Lassen Sie einen
Mann als Späher vorausreiten. Sorgen Sie außerdem für

Flankendeckung in dreihundert Yards Entfernung entlang des
Vorgebirges!“
„Zu Befehl, Sir!“
„Und noch etwas, Devlin“, fuhr Colonel Jarell fort. „Es wird
nur auf Befehl geschossen. Ich möchte, daß Sie noch einmal
mit Nachdruck darauf hinweisen. Schärfen Sie es jedem Mann
ein: Wir kommen in friedlicher Absicht! Ist das klar?“
„Jawohl, Sir!“
„Wegtreten!“ entließ ihn der Colonel.
Der Sergeant machte sich sofort an die Ausführung des
Befehls. Der Gemeine Wiggins wurde als Späher ausgeschickt.
Der Gemeine Shaw und der Gemeine Buntley sollten die rechte
beziehungsweise die linke Flanke sichern.
„Paßt gut auf“, ermahnte sie Sergeant Devlin.
Ben Cartwright wandte sich an Colonel Jarell.
„Es wäre gut, wenn wir die Standarte durch eine weiße Fahne
ersetzen würden“, schlug er vor. „Wie ich die Indianer kenne,
werden sie uns von nun an nicht mehr aus den Augen lassen. Je
deutlicher sie erkennen, daß wir in friedlicher Absicht
kommen, desto besser!“
Der Sergeant war noch damit beschäftigt, seine Männer
einzuteilen. Colonel Jarell drehte sich im Sattel um und winkte
dem nächsten Soldaten.
„Gemeiner Lowell!“ rief er. „Melden Sie Sergeant Devlin,
daß ich einen Mann mit einer weißen Fahne an der Spitze
haben möchte!“
„Zu Befehl, Sir!“ Der Gemeine Lowell sprengte davon, um
dem Sergeanten den Befehl zu überbringen.
Hoss hatte die Pause dazu benutzt, um seinen Hut zu lüften
und sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. Dann ritt er
langsam nach vorn, zu seinem Vater.
„Hör mal, Pa“, sagte er. „Findest du nicht auch, daß es bisher
ein bißchen zu ruhig gewesen ist?“

„Ich bin sehr froh darüber“, erklärte der Rancher.
„Ich weiß nicht!“ Hoss blickte besorgt. „Vielleicht sehe ich
Gespenster, aber ich habe so ein komisches Gefühl in der
Magengegend…“
„Nanu!“ sagte Ben Cartwright lächelnd. „Du hast doch genug
gegessen, oder?“
„Bitte, Pa!“ Hoss’ Stimme klang beschwörend. „Mir ist jetzt
nicht zum Spaßen zumute!“
„Mir auch nicht“, sagte der Rancher. Er sah seinen Sohn
prüfend an. „Du hältst die Ruhe also für verdächtig?“
Hoss ließ seinen Blick besorgt über die weite, mit verdorrtem
Gras bewachsene Ebene und die steil aufragenden Felswände
schweifen.
„Wenn Elkoro uns hier angreift, sind wir verloren“, stellte er
fest. „Die Rothäute können uns von den Höhen wie Kaninchen
abknallen.“
„Tja“, nickte Ben Cartwright. „Wollen hoffen, daß sie es
nicht tun!“
Colonel Jarell, der aufmerksam zugehört hatte, schüttelte
ungläubig den Kopf.
„Diese Gefahr besteht nicht“, behauptete er. „Elkoro wird
unmöglich annehmen, daß wir ihn überfallen wollen. Ein
Trupp von zehn Männern stellt doch für die Paiutes keine
Bedrohung dar!“
„Das sollte man annehmen“, gab der Rancher zu. „Aber du
weißt genauso gut wie ich, wie unberechenbar die Indianer
sind!“
Das stimmte. Der Colonel hatte es mehr als einmal am
eigenen Leibe erfahren. Auf keinen Fall wollte er jetzt ein
Risiko eingehen. Deshalb ließ er einen Reiter mit einer weißen
Fahne vor dem kleinen Trupp herreiten.

Sie hatten die Standarte eingerollt, als sie weiter durch die
Schlucht ritten, einen Späher weit voraus, je einen an der
rechten und linken Flanke.
Es war spät am Nachmittag, als sie aufschreckten.
„Seht mal!“ rief Hoss. „Dort oben!“
Alle blickten erschrocken zur Höhe hinauf…

Sergeant Devlin verliert die Nerven
Von den Höhen vor, neben und hinter ihnen stiegen
Rauchsignale in den Himmel. Die Indianer hatten sie also
eingeschlossen.
Colonel Jarell hielt sein Pferd an und spähte in alle
Richtungen.
„Jetzt können wir nicht mehr zurück“, stellte er fest.
Zu Ben Cartwrights Überraschung schien er darüber eher
erfreut als besorgt zu sein. Der Rancher wußte nicht, was er
davon halten sollte. Noch schöpfte er keinen Verdacht.
Rauchzeichen waren ein Verständigungsmittel der Indianer,
das wußte jeder. Aber was genau diese Rauchzeichen
bedeuteten, wie die Nachricht lautete, konnte keiner der
Weißen sagen. Niemand hielt sie für etwas Erfreuliches.
Wahrscheinlich waren es Alarmzeichen. Die Krieger der
Paiutes wurden zusammengerufen.
Ein Reiter nach dem anderen hatte sein Pferd gezügelt. Alle
starrten schweigend zu den Höhen empor, wo dünn und
zitternd wie bei einem Kartoffelfeuer der Rauch aufstieg.
Einen Augenblick saßen sie wie erstarrt, ein kleiner Trupp
Reiter, der sich in der Weite der Schlucht fast verlor. Auf einen
Wink des Colonels setzten sie ihren Ritt fort; diesmal im
Galopp, so, als wollten sie sich zur Attacke auf den
unsichtbaren Feind stürzen.
Der Planwagen hatte Mühe, nicht den Anschluß zu verlieren.
Seine Räder glitten zuweilen wie Schlittenkufen über das
ausgedörrte Gras, während er, in eine Staubwolke gehüllt, über
die Prärie raste.

Der Weg führte allmählich aufwärts. Eine Stunde später ritten
die Reiter einen Bergpfad hinauf, der an Abgründen
entlanglief. Der Planwagen folgte ihnen mühsam.
Auf dem Kutschbock ließ Korporal Poker die Peitsche
knallen und trieb sein Gespann mit lauten Zurufen an.
Gefährlich schaukelnd holperte der Wagen auf der tückischen
Spur zur Höhe hinauf.
Plötzlich scheute das Pferd des Gemeinen Lowell, der als
letzter vor dem Planwagen ritt. Der Hengst stieg wiehernd auf
die Hinterbeine und schlug wild mit den Vorderhufen.
Beinahe wäre der Reiter aus dem Sattel gestürzt. Er
versuchte, sein Pferd zu beruhigen. Und da sah er eine
Schlange hinter einem Felsblock hervorschießen. Darum also
scheute das Pferd.
Der Hengst keilte wütend nach dem Feind aus. Endlich
gelang es ihm, das Reptil durch einen Hufschlag zu
zerschmettern.
Lowell atmete auf. Aber da war das Unglück bereits
geschehen.
Korporal Poker hatte dem bockenden Pferd ausweichen
wollen. Dabei verlor das rechte Hinterrad den Boden und hing
plötzlich über dem Abgrund. Der Wagen drohte in die Tiefe zu
stürzen.
„Vorsicht!“ schrie Sergeant Devlin, der alles beobachtet hatte.
Im Nu war er aus dem Sattel und eilte dem gefährdeten Wagen
zu Hilfe.
Die Soldaten folgten seinem Beispiel. Auch Hoss legte mit
Hand an. Nicht zuletzt dank seiner Bärenkräfte gelang es, den
Wagen wieder auf festen Boden zu schieben.
Alle atmeten auf, als sie es endlich geschafft hatten.

Korporal Poker saß mit bleichem Gesicht auf dem
Kutschbock.
Der Sergeant trat wütend vor ihn hin.
„Gemeiner Lowell!“ schrie er. „Ihretwegen hätten wir
beinahe den Wagen verloren! Das hätte unser aller Tod
bedeutet! Ich werde dafür sorgen, daß so etwas nicht noch
einmal passiert!“ Er schlug den Soldaten ins Gesicht.
Lowell starrte seinen Vorgesetzten fassungslos an, während
sein Gesicht von den Schlägen brannte. Der junge blonde
Bursche war sich keiner Schuld bewußt.
Sergeant Devlin geriet immer mehr in Wut.
„Sie Unschuldslamm!“ brüllte er. „Warten Sie! Ich werde Sie
lehren, in Zukunft besser aufzupassen!“ Er wollte von neuem
zuschlagen.
Aber da war Hoss zur Stelle. Er stellte sich schützend vor den
Soldaten.
„Jetzt reicht es aber!“ herrschte er den Sergeanten an.
„Mr. Cartwright!“ rief Colonel Jarell, der eilig herangeritten
kam. „Das ist eine militärische Angelegenheit. Es ist besser,
wenn Sie sich da heraushalten!“
Hoss atmete erregt. Der Sergeant maß ihn mit einem
vernichtenden Blick.
„Davon verstehen Sie nichts, Cartwright“, sagte er betont
ruhig. „Oft sind Prügel das einzige Mittel, um jemandem etwas
beizubringen. Der Mann hatte die Strafe verdient. Ohne den
Wagen wären wir verloren gewesen! Das werden Sie bald
merken!“
Hoss fand die Worte des Sergeanten übertrieben. Es sei denn,
der Wagen erforderte etwas anderes, als man ihnen erzählt
hatte. Hoss begann darüber nachzudenken.
Ben Cartwright zügelte sein Pferd neben dem Colonel.
„Keith“, sagte er. „Der Sergeant hat den Soldaten völlig
grundlos geschlagen!“
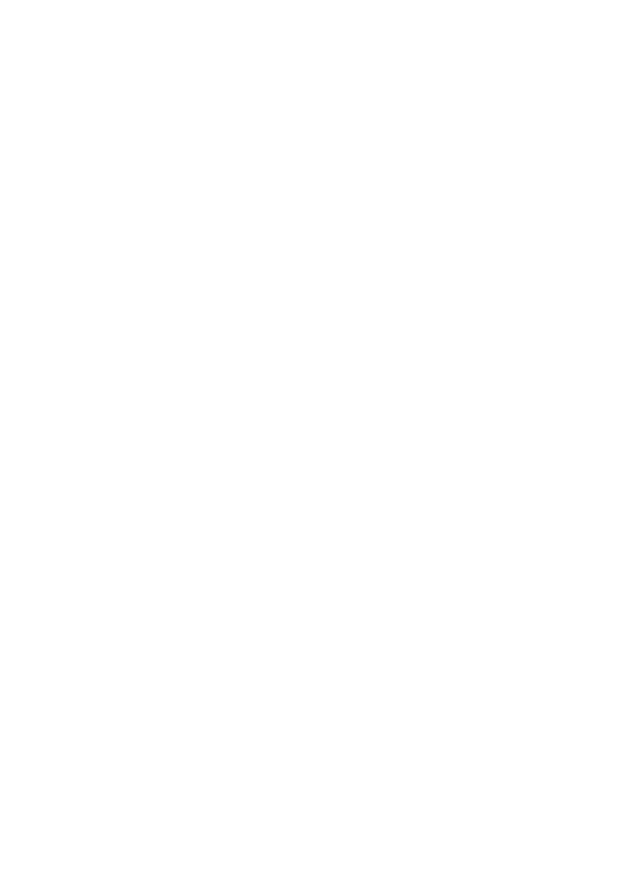
„Schon gut, Ben!“ nickte Colonel Jarell. „Ich habe auch
Augen im Kopf!“
Der Rancher blickte ihn erstaunt an.
„Leider geschieht so etwas öfter, als man gemeinhin denkt“,
erklärte er. „Ich brauche mich nur an meine Militärzeit zu
erinnern…“
„Hör zu, Ben!“ unterbrach ihn der Colonel. „Ich kenne mich
auch in militärischen Dingen aus. Falls du das vergessen haben
solltest! Außerdem befehle ich hier. – Sergeant!“
„Sir?“ Sergeant Devlin nahm vor ihm Haltung an.
„Noch so ein Vorfall und ich bringe Sie unweigerlich vor ein
Kriegsgericht“, verwarnte ihn Colonel Jarell. „Wegtreten!“
Sergeant Devlin kehrte wie ein geprügelter Hund zu seinem
Pferd zurück. Die Soldaten waren inzwischen wieder
aufgesessen. Niemand lächelte, sie waren sichtlich betroffen
und schienen den Sergeanten zu fürchten.
Hoss sah Lowell prüfend an.
„Alles in Ordnung?“ erkundigte er sich.
„Alles okay!“ Der junge Soldat nickte Hoss dankbar zu. Dann
stieg er schweigend wieder in den Sattel.
Hoss ritt langsam an das Ende des Zuges. Als er an dem
Planwagen vorbeikam, beugte sich Korporal Poker von der
Höhe des Kutschbockes zu ihm herab.
„Danke, Mr. Cartwright“, sagte er.
„Wofür?“ Hoss blickte erstaunt auf.
„Dafür, daß Sie Lowell vor dem Sergeanten in Schutz
genommen haben“, erklärte der Korporal.
„Nicht der Rede wert!“ winkte Hoss ab.
„Sehen Sie sich vor“, warnte ihn Korporal Poker. „An Ihrer
Stelle würde ich dem Sergeanten von jetzt an aus dem Wege
gehen. Der Bursche ist Gift!“
„Ich auch!“ grinste Hoss.
Der Korporal ließ die Peitsche knallen.
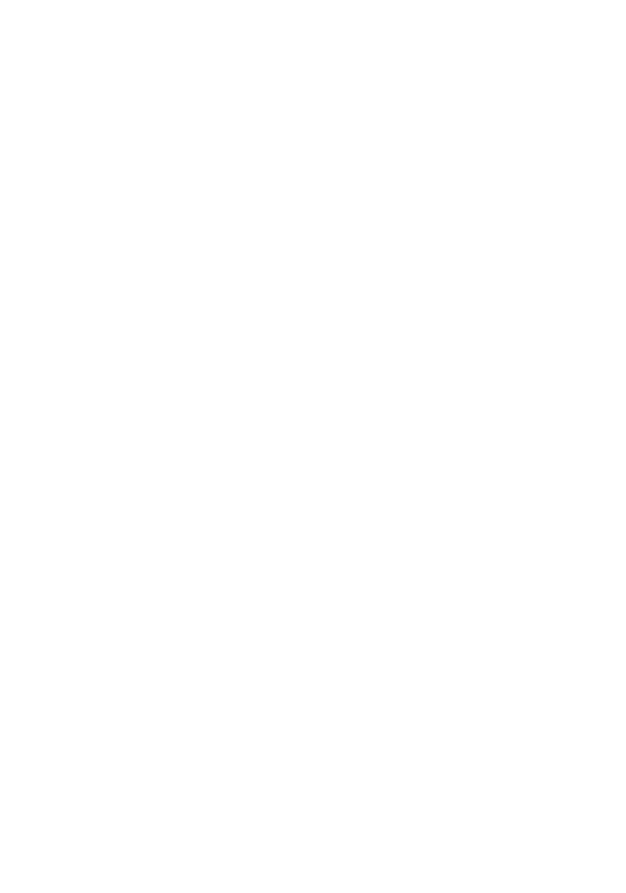
„Hü! Vorwärts!“ schrie er. „Hooo…“
Der Wagen holperte knarrend und quietschend weiter.
An der Spitze des Zuges ritt der Soldat mit der weißen Fahne.
Dann kamen der Colonel und Ben Cartwright. Hinter ihnen ritt
der Sergeant, der die Soldaten anführte. Hoss bildete allein den
Schluß.
Sie ritten nach Westen, genau auf die sinkende Sonne zu.
Kurz bevor es zu dämmern begann, schlugen sie das Lager
auf…

Schreie in der Nacht
„Noch etwas Tee, Colonel?“ erkundigte sich Korporal Poker,
der nicht nur den Planwagen fuhr, sondern auch Koch und
Bursche bei Colonel Jarell war.
„Nein, danke!“ winkte Colonel Jarell ab.
„Mr. Cartwright?“ Poker stand mit dem dampfenden
Kochgeschirr fragend vor dem Rancher.
Ben Cartwright schüttelte den Kopf. Er wollte ebenfalls
keinen Tee mehr.
Der Colonel und der Rancher saßen sich auf zwei Feldstühlen
an einem winzigen Klapptisch gegenüber, unter einem
schützenden Zeltdach, das von der Höhe des Planwagens
schräg bis auf den felsigen Boden reichte. Eine blakende
Petroleumlampe spendete ein trübes, flackerndes Licht.
„Sie können jetzt zu den anderen gehen“, wandte sich
Colonel Jarell an den Korporal.
Poker nahm die beiden Trinkbecher vom Tisch und verließ
eilig das Zelt. Der Colonel war aufgestanden. Er wartete, bis
der Korporal verschwunden war. Dann beugte er sich zu dem
Rancher hin.
„Ben“, sagte er, „ich möchte mit dir noch einmal über die
Sache von heute nachmittag reden. Du hattest natürlich recht.
Devlin durfte Lowell nicht schlagen. Aber ich brauche den
Sergeanten. Er ist ein guter Soldat…“
„Ein guter Soldat schlägt keinen Untergebenen“, stellte Ben
Cartwright fest.
„Devlin war wütend“, entschuldigte Colonel Jarell das
Verhalten des Sergeanten. „Mit Recht, wie ich zugeben muß.
Lowells Unachtsamkeit hätte uns beinahe den Wagen
gekostet.“
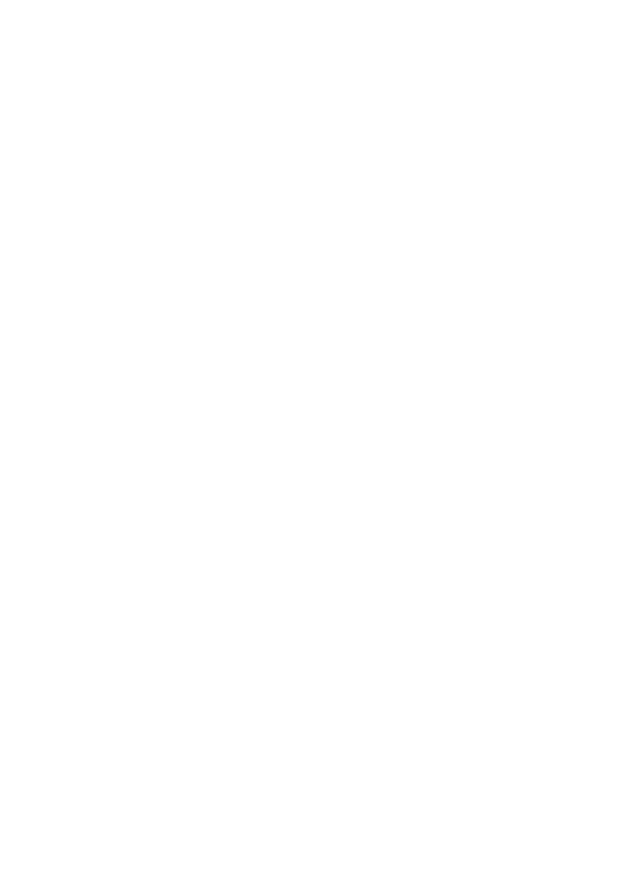
„Ein schwerer Verlust“, gab der Rancher zu, „aber kein
Grund zum Prügeln!“
„In dem Planwagen befinden sich Lebensmittel, Decken und
Medikamente“, erinnerte ihn der Colonel. „Mehr als genug, um
Elkoros Stamm durch den Winter zu bringen. Das weiß
Devlin.“
„Auch Lowell hat das gewußt“, vermutete Ben Cartwright.
„Schon deshalb bin ich sicher, daß er nicht achtlos war. Es
kann dem besten Reiter passieren, daß sein Pferd plötzlich
bockt.“
„Devlin hat einfach die Nerven verloren“, erklärte Colonel
Jarell.
„Wir sind alle etwas gereizt“, gab der Rancher zu. „Es war
ein verdammt harter Ritt. Also reden wir nicht mehr davon!“
„Ich freue mich, daß du es so siehst“, gestand der Colonel
erleichtert. Er breitete die Karte auf dem Tisch aus. „Und nun
wollen wir uns noch kurz über die Lage unterhalten.“
Ben Cartwright beugte sich über die Karte.
„Im Augenblick befinden wir uns hier!“ Er tippte mit dem
Zeigefinger auf die Stelle. „Das heißt, wir werden morgen
abend die Jarbridge Mountains erreichen…“
„Falls uns die Indianer in Ruhe lassen“, schränkte Colonel
Jarell ein.
„Wie ich Elkoro kenne, wird er uns nicht ohne Grund
angreifen“, erklärte der Rancher.
„Was meinst du?“ fragte der Colonel. „Wo sollen wir unser
letztes Lager aufschlagen?“
Ben Cartwright überlegte kurz.
„Hier“, sagte er und zeigte Colonel Jarell den Ort auf der
Karte. „Ich bin schon mehrere Male in dieser Gegend gewesen.
Einen besseren Platz gibt es nicht!“

„Einverstanden!“ nickte der Colonel. „Wir werden dort unser
Lager aufschlagen und die weiße Fahne hissen. Alles andere
wird sich dann ergeben!“
„Nein!“ widersprach der Rancher. „Wir dürfen nichts dem
Zufall überlassen. Wir müssen jeden unserer Schritte genau
planen!“
„Und?“ fragte Colonel Jarell. „Wie soll es weitergehen?“
„Ich werde zu Elkoro reiten“, sagte Ben Cartwright. „Das ist
gefährlich“, gab der Colonel zu bedenken. „Nicht für mich“,
behauptete der Rancher. „Elkoro kennt mich!“
„Wirst du deinen Sohn mitnehmen?“ forschte Colonel Jarell.
„Nein!“ Ben Cartwright schüttelte den Kopf. „Hoss wird bei
dir im Lager bleiben. Wenn Elkoro verhandeln will, genügt ein
Mann. Und wenn er es ablehnt, dann – tja, dann ist es sinnlos,
daß auch Hoss seine Haare opfert.“
Der Colonel ging nachdenklich in dem Zelt hin und her. Sein
Schatten wuchs ins Riesengroße, sooft er an der
Petroleumlampe vorbeikam. Dann blieb er plötzlich vor dem
Rancher stehen.
„Ben“, sagte er. „Ich brauche dir nicht erst zu sagen, was
unser Auftrag für unser Land bedeutet.“
„Ich weiß“, nickte Ben Cartwright, der sich nichts sehnlicher
wünschte, als daß Frieden herrschte zwischen Menschen
weißer und roter Hautfarbe. Das war sein Wunsch gewesen, als
er mit dem Treck in dieses Land gekommen war. Er hatte es
auch noch gewünscht, nachdem ein Indianerpfeil seine junge
Frau getötet hatte.
„Ich konnte dich nicht darum bitten“, fuhr Colonel Jarell fort,
„aber ich habe im stillen gehofft, daß du mir diesen Vorschlag
machen würdest. Ich bin sehr glücklich darüber, Ben!“
„Schon gut, Keith!“ winkte der Rancher verlegen ab.

Der Colonel hielt plötzlich eine Feldflasche in der Hand. Er
nahm den Trinkbecher ab und füllte ihn halb. Dann reichte er
ihn Ben Cartwright.
„Da! Probier mal!“
Ben Cartwright trank einen Schluck.
„Donnerwetter!“ staunte er.
Colonel Jarell strahlte, weil ihm die Überraschung gelungen
war. Er nickte dem Freund lächelnd zu.
„Mexikanischer Brandy“, erklärte er. „Jahrgang
achtundvierzig! Damals waren wir mit unserem Regiment in
Mexiko. Erinnerst du dich?“
Natürlich erinnerte sich der Rancher. Es war kurz vor
Kriegsende gewesen, im Krieg zwischen Amerika und Mexiko.
Der Colonel nahm einen Schluck aus der Flasche.
„Weißt du, Ben…“ fügte er wehmütig hinzu. „Manchmal
frage ich mich, wo die Zeit geblieben ist.“
„Das habe ich geahnt“, sagte Ben Cartwright. „Um ehrlich zu
sein, ich hatte dich schon immer im Verdacht…“
Colonel Jarell nahm die Flasche vom Mund. Er merkte nicht,
daß er etwas Brandy verschüttete. Er starrte den Rancher
erschrocken an.
„Du hast mich im Verdacht?“ fragte er. „In was für einem
Verdacht?“
„… daß sich in der Uniform ein Mann versteckt, der schamlos
sentimental ist“, erklärte Ben Cartwright lachend.
„Ach so!“ Der Colonel atmete erleichtert auf. Dann nahm er
einen neuen Schluck aus der Flasche.
„Pflicht ist eine unbequeme Sache“, gestand er. „Eines Tages
wachst du auf und kommst dir schrecklich überflüssig vor. Und
du fragst dich, was du all die Jahre getan hast.“
„Du bist ein guter Soldat gewesen“, erklärte der Rancher.
„Das ist ziemlich wenig“, behauptete Colonel Jarell.
„Ziemlich wenig für einen Mann von über fünfzig!“ Er hob die

Feldflasche. „Auf unsere Freundschaft, Ben!“ Er nahm wieder
einen tüchtigen Schluck.
Auch Ben Cartwright leerte seinen Becher. Bevor er es
verhindern konnte, hatte ihm der Colonel wieder eingeschenkt.
„Wenn man dagegen dich betrachtet, Ben…“ Colonel Jarell
schien seinen Freund zu beneiden. „Du hast etwas, was du stolz
vorzeigen kannst!“
„So?“ fragte der Rancher. „Und was ist das?“
„Du hast deine Söhne“, erklärte der Colonel. „Dazu die
Ponderosa! Und was habe ich?“
„Du bist ein guter Soldat“, sagte Ben Cartwright. „Man hat
dich zum Colonel befördert und dir eine schwierige Aufgabe
übertragen…“
„Ja“, nickte Colonel Jarell, „das stimmt! Ich habe eine
Aufgabe! Und was für eine!“ Er hob erneut die Flasche. „Prost,
Ben! Auf unsere gemeinsame Aufgabe!“ Er trank wie ein
Verdurstender.
„Ich wünsche dir, daß du deine Mission erfolgreich zu Ende
führst“, sagte der Rancher, bevor er seinen Becher leerte. Dann
holte er seine Pfeife und den Tabaksbeutel hervor.
Der Colonel sah schweigend zu, wie der Freund seine Pfeife
stopfte. Ab und zu nahm er einen Schluck aus der Feldflasche.
„Brandy ist Medizin für mich“, gestand er, als er Ben
Cartwrights besorgten Blick spürte. „Ohne Brandy wäre das
Leben für mich nicht mehr zu ertragen.“
Plötzlich horchten die beiden Männer auf. Aus der Ferne
drang ein langgezogener, gellender Schrei durch die Nacht.
„Hast du gehört?“ fragte Colonel Jarell. „Was meinst du?
War das ein Kojote?“
„Wahrscheinlich einer mit Federn auf dem Kopf“, antwortete
der Rancher.
„Indianer?“ Der Colonel erschrak.

„Ich werde besser mal draußen nachsehen“, erklärte Ben
Cartwright.
„Sei vorsichtig“, warnte ihn Colonel Jarell.
Der Rancher stand auf. Er steckte den Tabaksbeutel wieder
ein und griff nach seiner gestopften Pfeife.
„Nicht nur ihr!“ lachte er. „Auch meine Jungen brauchen
mich noch! Was meinst du, was sie ohne mich anstellen
würden?“
„Ja“, nickte der Colonel. „Söhne brauchen ihren Vater. Das
ist nichts Neues! Und Väter ihre Söhne!“ fügte er leise hinzu.
Aber das hörte Ben Cartwright schon nicht mehr. Er war vor
das Zelt getreten, das sie auf einem kleinen Plateau errichtet
hatten. Nicht weit entfernt saßen die Soldaten rund um das
Lagerfeuer.
Im Abglanz der lodernden Flammen konnte er die beiden
Wachtposten erkennen, die mit schußbereitem Gewehr hinter
ein paar Felsblöcken kauerten.
Aus der Dunkelheit hinter ihm tönte leises Wiehern und das
Schlagen von Hufen, wenn die Pferde sich bewegten, die unter
der überhängenden Felswand angepflockt standen.
Die steile Felswand hinter dem Plateau verbarg die
Dunkelheit. Zu den anderen Richtungen hin fiel das Gelände
sanft ab. Der Wald, der die Berge vor ihnen bedeckte, wirkte
im Licht der bleichen Mondsichel drohend und unheimlich.
Wieder ertönte der gellende Schrei eines Kojoten. Diesmal
fand er auf der anderen Seite der Schlucht ein Echo.
Ben Cartwright schritt gemächlich zum Lagerfeuer und setzte
mit einem glimmenden Span seine Pfeife in Brand. Plötzlich
stand, wie aus dem Boden gewachsen, Sergeant Devlin vor
ihm.
„Haben Sie es auch gehört?“ erkundigte er sich. „Den
Kojotenschrei, meine ich!“
„Das war kein Kojote“, belehrte ihn der Rancher.

„Sie meinen Indianer?“ Der Sergeant erschrak.
„Wir dürfen kein Risiko eingehen“, sagte Ben Cartwright.
„Deshalb halte ich es für besser, wenn die Männer nicht dort
am Lagerfeuer sitzen bleiben.“
Sergeant Devlin beeilte sich, nach diesem Ratschlag zu
handeln. Anscheinend wollte er den Fehler von heute
nachmittag wiedergutmachen.
„In Deckung, Männer!“ rief er.
Die Soldaten sprangen erschrocken auf.
„Was ist los?“ fragte Jim Johnson, ein noch junger Bursche.
„Kann man nicht mal in Ruhe seine Pfeife rauchen?“
schimpfte Arthur Hull, der mit seinem schwarzen Bart wie ein
Seeräuber aussah.
„Ihr sitzt dort wie auf dem Präsentierteller“, erklärte der
Sergeant.
Die Soldaten ließen sich murrend im Schatten der Felsblöcke
nieder…

Korporal Poker erzählt eine Geschichte
Hoss ließ sich nicht stören. Er lehnte mit dem Rücken an einem
mächtigen Felsblock und löffelte eifrig seine Erbsen mit Speck.
Es war bereits der dritte Schlag. Er blickte kurz auf, als sich
Korporal Poker neben ihn setzte.
„Ist ein verdammt gutes Essen, Poker“, lobte Hoss.
„Bekomme ich zu Hause auch nicht besser!“
„Danke, Mr. Cartwright!“ Der Koch lächelte verlegen.
Hoss aß auch das dritte Kochgeschirr leer. Korporal Poker
sah ihm dabei respektvoll zu. Das Lagerfeuer war fast
heruntergebrannt.
Die letzten züngelnden Flammen verbreiteten nur noch einen
schwachen Lichtschein.
Der Korporal räusperte sich.
„Sie und Ihr Vater kennen Colonel Jarell schon lange“, sagte
er leise. „Habe ich recht?“
„Ja“, nickte Hoss, während er die letzten Erbsen aus dem
Kochgeschirr kratzte. „Pa schon! Ich nicht! Aber Sie sind
sicher auch schon lange mit ihm zusammen, stimmt’s?“
„Bald zehn Jahre“, erklärte der Korporal. „War immer dabei!
In Texas, Kansas und Montana! Überall, wo Soldaten
gebraucht wurden. Es ging jedesmal gegen die Rothäute!“
„Ich kann verstehen, daß der Colonel Sie immer bei sich
haben wollte“, sagte Hoss. „Sie kochen wirklich ausgezeichnet,
Mr. Poker!“
„Der Colonel war ein feiner Offizier“, fuhr der Korporal fort.
„Er hat jeden Riegel auf seiner Schulter verdient. Das heißt, bis
damals – bis zum Gefecht am Sumnit Creek…“
„Am Sumnit Creek?“ überlegte Hoss. „Da haben die Indianer
doch fast ein ganzes Regiment vernichtet.“

„Ja“, nickte Poker. „Elkoros Krieger kämpften alles nieder,
was sich ihnen in den Weg stellte. Kaum einer kam mit dem
Leben davon. Seitdem ist der Colonel so verändert. Hat
natürlich seinen Grund! Hängt mit seinen Söhnen zusammen!“
Hoss horchte auf.
„Söhne?“ fragte er. „Der Colonel hat Söhne?“
„Kamen gerade von der Kriegsschule“, berichtete der
Korporal. „Sollten unterwegs zum Regiment stoßen. Waren nur
noch einen Tagesritt von uns entfernt, als sie von den
Rothäuten überfallen wurden. Haben sie am nächsten Tag
gefunden, das heißt, wir fanden das, was noch von ihnen übrig
war…“
„Muß ein schwerer Schlag für den Colonel gewesen sein“,
vermutete Hoss.
„Ich dachte, er würde wahnsinnig“, sagte Poker. „Habe ihn
nie wieder so gesehen! Er brüllte die ganze Zeit, daß wir alle
Rothäute töten sollten. Konnten aber nicht schießen, weil
nirgends ein Indianer zu sehen war. Nur tote Soldaten und
ausgebrannte Wagen…“ Er schwieg erschöpft.
Hoss starrte schweigend in die Dunkelheit. Was er soeben
gehört hatte, stimmte ihn nachdenklich. Es paßte nicht zu dem
Bild, das er sich von dem Colonel gemacht hatte.
Auch sein Vater schien ihn zu verkennen.
Die beiden Männer schreckten auf, als sie ein lautes Lachen
hörten. Vor ihnen stand Sergeant Devlin. Er lächelte höhnisch.
„Na, Poker?“ erkundigte er sich. „Erzählst du wieder mal
Märchen?“
„Ich – ich habe nur die Wahrheit gesagt, Sergeant“, stotterte
der Korporal. „Die reine Wahrheit! Ehrenwort! Wir haben nur
ein bißchen – na ja – gequatscht! Über alte Zeiten! Das war
alles! Stimmt’s, Mr. Cartwright?“ Er sah Hoss flehend an.
„Ja, das stimmt“, bestätigte Hoss.

Korporal Poker nahm das Kochgeschirr und huschte eilig
davon. Der Sergeant sah ihm kopfschüttelnd nach.
„Diese alte verdammte Kasernenratte lügt von Jahr zu Jahr
mehr“, stellte er fest.
„Er hat mir von den Söhnen des Colonels erzählt“, sagte
Hoss.
„Natürlich!“ lachte Sergeant Devlin. „Das habe ich erwartet!
Das erzählt er immer, wenn er getrunken hat. Eine rührselige
Geschichte, wie die Söhne des Colonels von Indianern
umgebracht wurden…“
„Ja“, nickte Hoss. „Ein schreckliches Schicksal!“
„Aber es ist kein Wort davon wahr“, behauptete der Sergeant.
„Wie?“ Hoss starrte ihn fassungslos an.
„Poker hat Sie genauso belogen wie viele andere vor Ihnen“,
erklärte Sergeant Devlin. „Der Colonel war niemals
verheiratet. Er hatte auch keine Söhne!“
Hoss schluckte erregt.
„Sie meinen, das war alles…“ Er konnte nicht wei-
tersprechen, so überrascht war er.
„… erstunken und erlogen“, ergänzte der Sergeant. „Deshalb
möchte ich Ihnen jetzt einen guten Rat geben, Cartwright…
Lassen Sie in Zukunft meine Männer in Ruhe!“
Hoss lächelte unschuldig.
„Sergeant“, sagte er betont liebenswürdig. „Ich kann es mir
selbst nicht erklären, aber Sie werden mir immer
sympathischer!“
„Sie sollten sich trotzdem merken, was ich Ihnen gesagt
habe“, riet ihm Sergeant Devlin. „Vielleicht bin ich in Ihren
und Ihres Vaters Augen kein guter Soldat. Aber das ist mir
gleichgültig! Ich diene nur einem Herrn, und das ist Colonel
Jarell. Verstehen Sie? Ich tue meine Pflicht und stelle keine
dummen Fragen. Gerade das gefällt dem Colonel an mir!“
„Gut“, sagte Hoss. „Ich habe verstanden!“

„Und noch etwas, Cartwright“, fuhr der Sergeant fort.
„Kommen Sie mir nie wieder in die Quere, Sie zwingen mich
sonst, offen gegen Sie vorzugehen!“
„He!“ rief Hoss. „Soll das eine Drohung sein?“
„Nein“, erklärte Sergeant Devlin. „Ich drohe Ihnen nicht,
Cartwright! Ich sage Ihnen das nur in Ihrem eigenen
Interesse!“ Nach diesen Worten ging er rasch davon, ohne sich
noch einmal umzublicken, und verschwand in der Dunkelheit.
Nachdem die Soldaten das Lagerfeuer gelöscht hatten,
wickelten sie sich in ihre Decken. Auch Hoss legte sich
schlafen. In der Nacht ertönte noch mehrmals der
Kojotenschrei. Sonst geschah nichts. Kein Indianer störte ihre
Ruhe…

Ein überraschender Befehl
Früh am Morgen, im ersten Dämmerlicht des neuen Tages,
wurden die Soldaten geweckt. Verschlafen krochen sie unter
ihren Decken hervor und entfachten wieder das Lagerfeuer.
Auch Hoss richtete sich gähnend auf.
Einen Augenblick sah er dem geschäftigen Treiben der
Soldaten zu, die ihre Decken zusammenrollten, die Pferde
tränkten und das Zelt abbrachen.
Hoss legte seine Decke zusammen und setzte sich darauf.
Dann schlürfte er mit Wohlbehagen den heißen Kaffee, den
ihm Poker in einem Trinkbecher reichte. Das Frühstück
verzehrte er mit großem Appetit.
Colonel Jarell stand mit eingeseiftem Gesicht vor einem
Spiegel, den er am Planwagen befestigt hatte. Die
Petroleumlampe verbreitete ein trübes Licht.
„Möchte wissen, warum ich morgens immer so friere“, sagte
der Colonel. „Früher hat mir die Kälte doch nichts
ausgemacht.“
„Wir werden alle nicht jünger“, antwortete Ben Cartwright,
der auf dem Feldstuhl vor dem Klapptisch saß und heißen
Kaffee trank. „Uns fehlt das heiße Blut der Jugend.“
Hoss, der eifrig kauend zugehört hatte, wandte sich fragend
an den Koch, der ihm neuen Kaffee einschenkte. „Kann nicht
behaupten, daß das bei mir hilft! Ich friere morgens immer wie
ein Schneider! Wie ist es mit Ihnen, Poker?“
„Mir macht die Kälte morgens nichts aus“, brummte der
Korporal. „Fragt auch keiner danach! Bin Soldat! Muß
gehorchen!“
Hoss half seinem Vater, die Decke zusammenzurollen.
„Du – Pa…“ flüsterte er.

„Ja?“ Ben Cartwright blickte fragend auf.
„Du hast doch den Colonel ‘ne ziemlich lange Zeit nicht
gesehen. Wieviel Jahre genau?“
„Ungefähr siebzehn“, sagte der Rancher. „Wieso?“
„Poker hat mir gestern etwas erzählt“, begann Hoss zögernd.
„Aber ich bin nicht sicher, ob es stimmt. Von den Söhnen des
Colonels, die bei dem Gefecht am Sumnit Creek gefallen sind.
Weißt du etwas davon?“
„Nein!“ Ben Cartwright schüttelte den Kopf.
„Hätte ja sein können!“ Hoss rollte die Decke zu Ende auf.
Colonel Jarell hatte sich fertig rasiert. „Sergeant!“ rief er.
„Lassen Sie aufsitzen!“
„Fertigmachen zum Aufsitzen!“ kommandierte Sergeant
Devlin.
Die Soldaten eilten zu ihren Pferden und stellten sich neben
ihnen in einer Reihe auf.
„Gemeiner Hull!“ rief der Sergeant.
Der Soldat mit dem schwarzen Seeräuberbart schlug die
Hacken zusammen. Sergeant Devlin trat nahe an ihn heran.
„Sie fahren heute den Planwagen“, befahl er. „Übergeben Sie
Ihr Pferd Korporal Poker.“
„Zu Befehl, Sir!“
Die Pferde waren bereits vor den Planwagen gespannt. Der
Klapptisch und die beiden Feldstühle waren aufgeladen. Heller
Rauch quoll von dem Lagerfeuer empor, dessen Flammen ein
Wasserguß gelöscht hatte. Die Soldaten saßen auf.
Colonel Jarell schwang sich in den Sattel seines Pferdes, das
der Korporal am Zügel herangeführt hatte.
„Poker“, sagte er. „Sie reiten heute als Späher voraus.
Außerdem tragen Sie die weiße Fahne.“
„Zu Befehl, Sir!“ Der kleine grauhaarige Korporal stand
unglücklich inmitten der Reiter.

„Beeilen Sie sich!“ rief Sergeant Devlin, der eilig
herangesprengt kam.
Poker nahm Hulls Pferd und die weiße Fahne in Empfang.
Ben Cartwright und sein Sohn, die bereits ebenfalls im Sattel
saßen, tauschten einen vielsagenden Blick. Hoss tat der
Korporal leid, der von seinem Kutschbock verbannt worden
war. Er ahnte, daß Poker für seine Gesprächigkeit am Abend
durch diese Maßnahme bestraft werden sollte. Beruhte die
Geschichte, die er erzählt hatte, etwa doch auf Wahrheit?
Der Gemeine Hull war unterdessen auf den Kutschbock des
Planwagens geklettert. Er schwang die Peitsche.
„Hü!“ schrie er. „Vorwärts! Hooo…“
Die Pferde zerrten im Geschirr. Aber der Wagen rührte sich
nicht. Die Räder blieben auf dem geröllhaltigen Felsboden
stehen, sosehr der Kutscher sein Gespann auch antrieb.
„Alle Mann absitzen!“ schrie der Sergeant. „Den Wagen
anschieben!“
Die Soldaten sprangen von den Pferden und griffen mit den
Händen in die Speichen der Räder.
„Vorwärts!“ schrie Sergeant Devlin.
„Hü!“ brüllte Hull.
Die Räder begannen sich langsam zu drehen und rollten
holpernd über das Geröll. Dann hatten sie die unwegsame
Stelle passiert.
„Aufsitzen!“ befahl der Sergeant.
Der Reitertrupp formierte sich.
An der Spitze, schon weit voraus, ritt Korporal Poker mit der
weißen Fahne. Gut dreihundert Yards dahinter führten Colonel
Jarell und Ben Cartwright die Soldaten an. Hoss ritt am Schluß,
hinter dem schaukelnden Planwagen, während Sergeant Devlin
neben dem Zug hin und her sprengte.
Korporal Poker ritt mit der weißen Fahne unerschrocken
vorwärts. Der Weg führte bergauf und bergab. Immer wieder

schob sich ein Hügel zwischen den Späher und den
Reitertrupp.
Wieder ritt Poker einen Berghang hinan. Oben angelangt,
richtete er den Blick nach Westen über die in der Ferne
verschwimmenden Bergketten. Bis dorthin wechselten höhere
und niedrigere Waldstreifen mit ausgedehnten Lichtungen.
Der Korporal ritt ruhig weiter und hielt auch nicht inne, als er
auf der nächsten Höhe einen Indianer erspähte. Der Hufschlag
seines Pferdes war das einzige Geräusch, das an sein Ohr
drang.
Plötzlich zerriß ein Knall die Stille…

Das erste Opfer
Die Kavalleristen, die den Hügelhang hinanritten, sahen oben
ein Pferd, das einen Sattel trug, aber keinen Reiter. Bei diesem
Anblick trieben die Soldaten unwillkürlich ihre Pferde an.
Sergeant Devlin sprengte an dem Reitertrupp vorbei zur Höhe
hinauf. Er packte das gesattelte Pferd am Zügel und hielt es
fest, bis die anderen heran waren.
„Es ist Pokers Pferd“, erklärte er überflüssigerweise. Das
sahen die anderen auch. Und sie ahnten, was das bedeutete.
Keiner sprach ein Wort, während Sergeant Devlin das
herrenlose Pferd hinten am Planwagen festband. Dann setzten
sie ihren Ritt fort.
Als sie den Hügel auf der anderen Seite hinabritten, sahen sie
Korporal Poker. Er lag mitten in der Schlucht bäuchlings
ausgestreckt. Die weiße Fahne steckte neben ihm im Boden.
Hoss war als erster bei ihm. Er schwang sich mit einem Satz
aus dem Sattel und beugte sich besorgt über den leblosen
Mann. Als er den Blick wieder hob, drückte sein Gesicht
Betroffenheit aus.
„Tot“, sagte er. „Erschossen!“
„Fangen Sie bloß nicht an zu heulen!“ herrschte ihn der
Sergeant an, der neben ihm vom Pferd stieg.
Hoss richtete sich zu voller Größe auf. Der Vater warnte ihn
mit einem raschen Blick vor Torheiten, aber es kostete Hoss
große Selbstbeherrschung, sich nicht auf den Sergeanten zu
stürzen.
Colonel Jarell ritt nahe an den Toten heran.
„Er war unser Koch“, erklärte er. „Aber er ist wie ein Soldat
gestorben. – Sergeant!“
„Sir?“ Sergeant Devlin blickte erwartungsvoll zu ihm auf.

„Stellen Sie ein Beerdigungskommando zusammen“, sagte
der Colonel. „Zu Befehl, Sir!“
Die Soldaten schaufelten ein Grab, was in dem felsigen
Boden gar nicht so leicht war. Bevor sie den Toten in die
Grube legten, würdigte Colonel Jarell in einer kurzen
Ansprache noch einmal die Verdienste des Korporals. Danach
sprach der Gemeine Hull ein Gebet.
Hoss steckte ein Holzkreuz, das er aus zwei dicken Ästen
geschnitzt hatte, in den Grabhügel. Dann stieg er wieder in den
Sattel. Er nahm die weiße Fahne auf und ritt damit zum
Colonel.
„Jetzt werde ich vorausreiten“, erklärte er.
„Sie sind Zivilist“, sagte Colonel Jarell. „Sie müssen das nicht
tun!“
„Ich melde mich freiwillig“, beharrte Hoss. „Sie brauchen
doch einen neuen Mann, oder?“
„Gut!“ nickte der Colonel. „Wie Sie wollen!“
„Mach’s gut, Pa!“ Hoss winkte seinem Vater kurz zu. Dann
ritt er im Galopp davon. Die weiße Fahne flatterte über seinem
Kopf im Wind.
Colonel Jarell drehte sich im Sattel zu dem Rancher um, der
sein Pferd ebenfalls wieder bestiegen hatte.
„Du kannst stolz auf deinen Jungen sein, Ben“, sagte er. „Ich
beneide dich um Hoss!“
Ben Cartwright ritt nahe an den Colonel heran.
„Du hast doch auch zwei Söhne gehabt, Keith“, sagte er.
„Warum hast du mir verschwiegen, daß sie am Sumnit Creek
von Elkoro und seinen Kriegern umgebracht worden sind?“
Colonel Jarell antwortete nicht. Er preßte die Lippen
zusammen und blickte starr geradeaus.
„Keith“, sagte der Rancher leise. „Ich habe dich etwas
gefragt.“
Der Colonel tat, als hätte er die Worte nicht gehört.

„Wir müssen weiter“, erklärte er. „Sonst erreichen wir unser
heutiges Tagesziel nicht mehr. Den Platz, den du als Lager für
uns ausgesucht hast, Ben!“
Der Rancher blickte zum Himmel empor. Die Sonne stand
schon ziemlich hoch, und sie hatten noch einen langen Ritt vor
sich. Es wurde tatsächlich höchste Zeit, wenn sie noch vor
Einbruch der Dunkelheit die Jarbridge Mountains erreichen
wollten.
„Gut!“ nickte er. „Verschieben wir das Gespräch darüber bis
zum Abend. Dann wünsche ich eine Antwort auf meine Frage.“
„Du wirst eine Antwort erhalten“, versprach Colonel Jarell.
„Aber erst dann, wenn ich es für richtig halte. Hier ist sowieso
nicht der richtige Ort dafür!“
„Wie du willst“, nickte Ben Cartwright.
Auf ein Zeichen des Colonels wurde der Ritt fortgesetzt. Die
Soldaten waren lauter harte Burschen, denen es nichts
ausmachte, daß sie bei karger Kost von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang im Sattel saßen.
Colonel Jarell blickte den neben ihm reitenden Rancher
bewundernd an.
„Du scheinst keine Angst um deinen Jungen zu haben“, stellte
er fest.
„Nein“, sagte Ben Cartwright. „Ich habe keine Angst. Warum
auch? Die Indianer töten nicht ohne Grund!“
„Denk an Poker“, erinnerte ihn der Colonel.
Gerade Korporal Pokers Tod hatte den Rancher mißtrauisch
gemacht. In Anbetracht der Umstände konnte man argwöhnen,
der Colonel habe den Tod des Mannes gewünscht oder gar
veranlaßt. Ben Cartwright beschloß, die Augen offenzuhalten.
„Die Indianer töten alle“, behauptete Colonel Jarell. „Alle, die
in ihr Land kommen.“
Die Stimme hatte anders als sonst geklungen, nicht so ruhig,
sondern haßerfüllt. Der Rancher blickte den Freund prüfend an.

„Irgend etwas hat dich ungerecht gemacht“, sagte er. „Du
siehst die Dinge mit Eifer falsch!“
„Du wirst mir bald recht gelben“, erwiderte Colonel Jarell
heftig. „Es wird nicht mehr lange dauern. Das verspreche ich
dir!“
Ben Cartwright erkannte in diesem Augenblick, was er bisher
nur vermutet hatte: Der Colonel wollte keinen Frieden mit
Elkoro. Dann aber war dieser Ritt erst recht töricht. Was
konnten zehn Männer gegen einen ganzen Stamm ausrichten?
Der Rancher fand keine Antwort auf diese Frage, obgleich er
fortwährend darüber nachdachte.
Bald sahen sie die schneebedeckten Gipfel der Jarbridge
Mountains in klaren Konturen vor sich. Im Vordergrund des
eindrucksvollen Bildes standen mehrere Rauchsäulen.
Sie waren nur noch wenige Stunden von den Dörfern der
Paiutes entfernt. Kurz bevor es dunkel wurde, erreichten sie ihr
vorgesehenes Lager…

Nur Tote schweigen
„Nun?“ fragte Hoss leise. „Wie sieht’s aus?“
Er war im Dunkeln zu Wiggins geschlichen, der hinter einem
mächtigen Felsen Wache hielt. Nicht weit davon entfernt
standen ein paar Bäume. Der Mond war hinter den
wildgezackten Berggipfeln hervorgekommen und hatte die
grünen Hänge am Fuße der Jarbridge Mountains in ein fahles,
unwirkliches Licht getaucht.
„Alles ruhig!“ meldete der Wachtposten.
Das Lagerfeuer war erloschen. Die meisten Soldaten hatten
sich bereits schlafen gelegt. Kein Laut störte die Stille. Auch
kein Kojotenschrei.
Wiggins kam mit schußbereitem Gewehr von dem Felsen
herab. Er spähte wachsam in die Runde.
„Was haben Sie?“ flüsterte Hoss.
„Mr. Cartwright“, sagte der Soldat. „Sie und Ihr Vater – na ja,
die meisten von uns…“ Er suchte nach Worten. „Also, wir
finden Sie und Ihren Vater ganz in Ordnung“, bekannte er.
Hoss Cartwright lächelte. „Freut mich, daß Sie das sagen!“
„Sie sind unsere letzte Hoffnung“, erklärte Wiggins. Hoss sah
ihn forschend an.
„Haben Sie etwas auf dem Herzen? Los! Reden Sie! Sie
können mir vertrauen! Ich verrate Sie nicht! Seien Sie
unbesorgt!“
„Pst! Nicht so laut!“ Der Soldat blickte sich ängstlich um.
„Wovor haben Sie Angst?“ fragte Hoss leise. „Hat Lowell,
mit Ihnen gesprochen?“ erkundigte sich Wiggins.
„Nein!“ Hoss schüttelte den Kopf. „Wieso?“
„Poker war ein Freund von mir und Lowell“, berichtete der
Soldat. „An dem Abend, bevor es ihn erwischte, sagte er, daß

der Colonel etwas übles vorhätte. Er wolle da nicht mitmachen.
Deshalb wollte er mit Ihnen sprechen.“
„Er hat mir nur von den Söhnen des Colonels erzählt“,
erklärte Hoss.
„Poker konnte nicht weitersprechen, weil Devlin dazukam“,
sagte Wiggins. „Der Sergeant erkannte, was Poker vorhatte.
Deshalb wurde er am nächsten Tag als Späher vorausgeschickt.
Der Colonel und Devlin wollten verhindern, daß Poker Ihnen
noch mehr erzählte…“
„Hm!“ Hoss atmete erregt. „Ich wünschte, ich könnte
verstehen, was Sie mir da sagen, Wiggins!“
„Hören Sie!“ Die Stimme des Soldaten klang beschwörend.
„Sie müssen uns helfen… Sie und Ihr Vater!“
„Wobei?“ fragte Hoss.
„Der Colonel will keinen Frieden mit den Indianern“, erklärte
Wiggins. „Das hat er dem General im Hauptquartier in
Washington nur eingeredet, damit er ihn hierher schickte. In
Wahrheit beabsichtigt er etwas ganz anderes…“
„So?“ sagte Hoss. „Und was ist das?“
Der Soldat zögerte. Er musterte verstohlen seine Umgebung.
Als er nirgends etwas Verdächtiges bemerkte, wurde er wieder
mutiger.
„Der Colonel will Elkoro und alle Krieger töten“, flüsterte er.
„Er wird nicht ruhen, bis der ganze Stamm ausgerottet ist!“
Hoss blickte ungläubig.
„Mit einer Handvoll Soldaten?“ warf er ein.
„Ich wußte, daß Sie mir nicht glauben würden“, erklärte
Wiggins. „Aber ich kann es beweisen!“
„Wirklich?“ Hoss wirkte unentschlossen.
„Kommen Sie!“ winkte der Soldat. „Ich werde Ihnen etwas
zeigen, was Sie überzeugen wird!“
Während Hoss hinter Wiggins dem Lager zuschlich, war er
gespannt, welcher Art der ihm versprochene Beweis sein

würde. Was konnte ein Dutzend Männer in die Lage versetzen,
siegreich gegen einen ganzen Indianerstamm zu kämpfen?
Plötzlich klopfte ihm das Herz schneller. Sein alter Verdacht,
daß der Planwagen ein Geheimnis bergen müsse, wurde wieder
wach.
Ein Geräusch schreckte Hoss aus seinen Gedanken auf. Ihm
war, als hätte in der Nähe ein trockener Zweig geknackt. Auch
Wiggins blieb stehen und hob lauschend den Kopf.
„Haben Sie gehört?“ flüsterte er ängstlich.
Bevor Hoss antworten konnte, stürzte der Soldat mit einem
gurgelnden Schrei zu Boden. Erschrocken beugte sich Hoss
über ihn.
„He!“ rief er. „Was haben Sie?“
In der Brust des Soldaten steckte ein Indianerpfeil.
„Mit mir ist es aus“, stöhnte Wiggins. „Jetzt hat es auch mich
erwischt. Ausgerechnet jetzt – wo ich – es Ihnen – zeigen –
wollte…“
„Was wollten Sie mir zeigen?“ Hoss hatte sich neben ihn
gekniet.
„Mr. Cartwright…“ Der Soldat blickte flehend zu Hoss auf.
„Sagen Sie – Ihrem Vater – sagen – Sie – ihm, daß…“ Die
Stimme versagte. Der Kopf fiel zur Seite.
Wiggins war tot.
„Alarm!“ schrie Hoss.
Die Soldaten fuhren erschrocken aus dem Schlaf. Ben
Cartwright kam mit einem Revolver in der Hand aus dem Zelt
gestürmt. Hinter ihm erschien die hohe Gestalt des Colonels.
„Was ist geschehen?“ fragte er.
„Jemand hat Wiggins erschossen“, erklärte Hoss.
„Wer?“ fragte Colonel Jarell.
„Das weiß ich nicht!“ Hoss zuckte die Achseln.
„Offensichtlich ein Indianer“, sagte Sergeant Devlin, der mit
dem Gewehr in der Hand herankam.

Hoss starrte ihn feindselig an.
„Woher wollen Sie das wissen?“
Der Sergeant zeigte auf den Pfeil, der in der Brust des Toten
steckte.
„Brauchen Sie noch mehr Beweise?“
Obgleich sie die Umgebung des Lagers gründlich absuchten,
fanden sie keine Spuren von Indianern. Hoss hatte nichts
anderes erwartet. Zwei Männer waren getötet worden. Beide in
dem Augenblick, als sie ein Geheimnis preisgeben wollten.
Das konnte kein Zufall sein!
Hoss wußte, was er morgen tun würde…

Die Lage wird ernst
Hoss hatte sein Pferd ebenfalls gesattelt, als sein Vater zu
seinem Ritt zu Elkoro aufbrach. Ben Cartwright blickte
erstaunt.
„Würdest du mir erklären, was das bedeutet?“ wollte er
wissen.
Hoss schob verlegen seinen Hut ins Genick.
„Tja – weißt du, Pa…“ Er kratzte sich nachdenklich hinter
dem Ohr. „Also – äh – ich habe mich entschlossen, dich zu
Elkoro zu begleiten!“
„Nein!“ Der Rancher schüttelte ärgerlich den Kopf. „Ich habe
dir bereits gestern gesagt, daß das nicht in Frage kommt!“
„Gestern war alles noch ganz anders“, behauptete Hoss.
„Das mag sein“, gab Ben Cartwright zu. „Trotzdem bleibt es
bei meinem Entschluß. Ich reite allein, so, wie es ausgemacht
war. Auch du wirst mich davon nicht abbringen!“
Hoss blickte sich verstohlen um.
Colonel Jarell war vor das Zelt getreten. Er schien etwas mit
Sergeant Devlin zu besprechen. Aber Hoss fühlte, daß die
beiden Männer sie beobachteten.
Lowell und Hull hielten Wache. Die anderen Soldaten
schaufelten unterhalb des Lagers das Grab für Wiggins, der am
Vormittag begraben werden sollte. Sie hatten lange suchen
müssen, bis sie ein Stück weichen Boden landen.
Der Morgen war trübe und wolkenverhangen. Nebel stieg aus
den Tälern auf. Immer neue graue Wolkenmassen quollen
hinter den Berggipfeln hervor.
„Pa“, sagte Hoss leise. „Ich habe das Gefühl, daß hier etwas
faul ist. Alles ist so merkwürdig, findest du nicht auch?“

„Nanu“, wunderte sich der Rancher, „seit wann gibst du
etwas auf Gefühle?“
„Seit gestern“, gestand Hoss. „Überleg doch mal, Pa… Irgend
etwas stimmt hier nicht! Du willst mir doch nicht erzählen, daß
du es nicht gemerkt hast?“
„So?“ fragte Ben Cartwright. „Und was soll ich gemerkt
haben?“
„Zuerst war es Poker, dann Wiggins“, zählte Hoss auf. „Beide
wollten mir etwas sagen. Beide starben vorher. Niemand kann
mir weismachen, daß das Zufall war. Auch du nicht, Pa!“
„Jetzt hör mir einmal gut zu“, sagte der Rancher leise. „Wenn
hier etwas faul ist, dann ist es auf jeden Fall besser, daß einer
von uns im Lager bleibt und die Augen offenhält, während ich
mit Elkoro spreche…“
„Vielleicht hast du recht“, gab Hoss nach.
„Natürlich habe ich recht“, sagte Ben Cartwright.
Nicht weit von ihnen entfernt flatterte die weiße Fahne.
Hoss blickte zu den Bergen empor, vor denen auch heute
mehrere Rauchsäulen aufstiegen.
„Sei vorsichtig“, warnte Hoss seinen Vater.
„Keine Angst! Ich passe auf“, versprach der Rancher.
„Inzwischen halte ich hier die Stellung“, erklärte Hoss
augenzwinkernd.
„Mach keine Dummheiten“, riet ihm Ben Cartwright. „Nimm
dich vor allem vor dem Sergeanten in acht!“
„Der Colonel ist noch gefährlicher“, behauptete Hoss.
Der Rancher widersprach nicht; obgleich er seinen alten
Freund gern vor seinem Sohn in Schutz genommen hätte. Im
Augenblick erschien auch ihm das Verhalten des Colonels
verdächtig.
Colonel Jarell und Sergeant Devlin blickten jetzt offen zu
ihnen herüber. Das lange Gespräch zwischen Vater und Sohn
schien sie zu beunruhigen.

Ben Cartwright schwang sich in den Sattel.
Erst jetzt bemerkte Hoss, daß sein Vater unbewaffnet war.
„Du solltest wenigstens dein Gewehr mitnehmen“, riet er.
„Nein“, widersprach der Rancher. „Ich kann meinen Auftrag
nur erfüllen, wenn ich unbewaffnet bin. Nur so kann ich Elkoro
davon überzeugen, daß ich in friedlicher Absicht komme.“
Das leuchtete Hoss ein.
„Viel Glück, Pa“, sagte er.
„Mach’s gut!“ winkte Ben Cartwright.
Dann ritt er im Galopp aus dem Lager, an dem Wachtposten
vorbei, den grünen Hang hinan, auf die aufsteigenden
Rauchsäulen zu, die ihm den Weg ins Dorf der Paiutes und zu
Häuptling Elkoro wiesen.
Hoss blickte seinem Vater lange nach, bis der Reiter hinter
dem nächsten Hügel verschwunden war. Als er sich schließlich
umwandte, war seine Miene ungewöhnlich ernst…

Ein Geheimnis wird gelüftet
„Nun, junger Freund“, wandte sich Colonel Jarell an Hoss, „Sie
haben doch nicht etwa Sorgen?“ Hoss blickte überrascht auf.
„Ich hätte Sie bestimmt nicht damit behelligt“, sagte er. „Aber
da Sie mich danach fragen… Ja, ich habe Sorgen, Colonel!
Eine ganze Menge sogar!“
„Darf man erfahren, was Ihnen Sorgen bereitet?“ erkundigte
sich Colonel Jarell. Er stand lächelnd vor Hoss, während
Sergeant Devlin in der Nähe lauerte, bereit, sofort einzugreifen,
falls es nötig sein sollte.
„Es gibt eine Reihe Fragen, auf die ich gern eine Antwort
wüßte“, gestand Hoss. „Am meisten interessiert mich, wie Sie
zu Elkoro stehen.“
„Wollen Sie das wirklich wissen?“ Der Colonel sah ihn
forschend an.
„Ja“, nickte Hoss. „Um jeden Preis!“
„Gut“, sagte Colonel Jarell. „Sie sollen nicht länger darüber
im unklaren bleiben…“
„Also?“ fragte Hoss, der allmählich ungeduldig wurde. „Was
haben Sie mit Häuptling Elkoro vor? Sie wollen doch Frieden
mit ihm schließen, oder?“
„Die Antwort finden Sie dort drüben im Planwagen“, erklärte
der Colonel.
„Das habe ich geahnt“, gestand Hoss. „Leider ließen mich
Ihre Wachen nie an den Wagen heran.“
„Das geschah auf meinen Befehl“, sagte Colonel Jarell. „Aber
jetzt dürfen Sie sich dort gründlich umsehen. Mit meiner
ausdrücklichen Erlaubnis!“
„Nein!“ schrie Sergeant Devlin erschrocken. „Das lasse ich
nicht zu, Colonel!“

„Sergeant!“ rief der Colonel mit Schärfe in der Stimme.
„Noch führe ich hier das Kommando! Ich sage Ihnen das für
den Fall, daß Sie es vergessen haben sollten!“
„Colonel“, stammelte Sergeant Devlin. „Er wird unser
Geheimnis verraten, sobald er es kennt.“
„Keine Angst!“ beruhigte ihn Colonel Jarell. „Eine Stunde
früher oder später… Darauf kommt es jetzt nicht mehr an. Ich
bin sicher, daß wir unser kleines Geheimnis sowieso bald
aufdecken müssen.“
Hoss hatte den Worten mit wachsender Besorgnis gelauscht.
Er war unwillkürlich stehengeblieben, während sein Blick von
einem zum anderen wanderte.
„Na, gehen Sie schon!“ forderte ihn der Colonel auf. „Oder
interessiert es Sie nicht mehr, was sich unter der Plane
befindet?“
Hoss lief zum Wagen und öffnete eilig die Riemen, mit denen
die Plane an dem hölzernen Unterteil festgemacht war.
Endlich konnte er in das Innere blicken.
Enttäuscht stellte er fest, daß das, was da mitten im Wagen
aufragte, mit einer Plane zugedeckt war. Er war also so klug
wie zuvor.
„Nehmen Sie die Plane ruhig weg“, sagte Colonel Jarell, der
neben ihn getreten war.
Bevor Hoss den Rat befolgen konnte, hatte der Colonel die
Plane bereits fortgezogen. Zum Vorschein kam ein langer
stählerner Lauf, der auf einem Dreifuß ruhte und von einer
großen runden Trommel mit Patronen gespeist werden konnte.
„Mein Gott!“ stöhnte Hoss.
Colonel Jarell nickte.
„Eine hübsche Waffe, nicht wahr?“ Er strahlte vor
Besitzerstolz, „Sie schießt Dauerfeuer, sobald man am Abzug
zieht. So lange, bis der Munitionsvorrat erschöpft ist.“
Hoss atmete erregt.

„So etwas habe ich noch nicht gesehen“, gestand er.
„Das glaube ich Ihnen gern“, versicherte der Colonel. „Sie ist
auch erst kürzlich erfunden worden! Von einem Mann namens
Gatling!“
„Wahrscheinlich hat sie auch einen Namen“, vermutete Hoss.
„Was Sie hier sehen, ist ein Maschinengewehr“, belehrte ihn
Colonel Jarell. „Es wird meinen Männern die Feuerkraft einer
ganzen Kompanie verleihen…“
Hoss starrte ihn entsetzt an.
„Sie – Sie wollen diese Waffe tatsächlich gebrauchen?“
„Natürlich!“ sagte der Colonel. „Natürlich werde ich damit
schießen. Ich kann es kaum noch erwarten. Es ist meine
Überraschung für Elkoro!“
„Sie dürfen damit nicht auf die Indianer schießen!“ beschwor
ihn Hoss.
„Nur so können wir unseren Auftrag erfolgreich ausführen“,
behauptete Colonel Jarell. „Erst wenn alle Rothäute tot sind,
wird in diesem Land Frieden herrschen!“
„Das ist heller Wahnsinn!“ Hoss schüttelte den Kopf. „Sie
müssen den Verstand verloren haben!“
„Nein!“ rief der Colonel. „Ich bin Realist! Der einzige, der
die Verhältnisse richtig sieht!“ Sein Gesicht bekam einen
fanatischen Ausdruck. Seine Stimme klang schrill. Er redete
sich in eine wachsende Erregung: „Diese wilden rothäutigen
Horden müssen ausgerottet werden! Weil sie der Zukunft
dieses Landes im Wege stehen! Weil sie unsere Entwicklung
hemmen!“
„Solange ich lebe, werde ich das verhindern“, sagte Hoss.
„Sergeant Devlin!“ rief Colonel Jarell.
„Sir?“ Der Sergeant kam eilig herbei.
„Nehmen Sie Mr. Cartwright in Gewahrsam“, befahl der
Colonel. „Machen Sie von Ihrer Schußwaffe Gebrauch, falls er

versuchen sollte zu fliehen. Lassen Sie ihn auf keinen Fall
entkommen!“
Sergeant Devlin zog den Revolver aus dem Gürtel und
richtete ihn drohend auf den Gefangenen.
„Vorwärts!“ befahl er.
Statt dem Befehl Folge zu leisten, drehte sich Hoss zu
Colonel Jarell um.
„Was ist mit meinem Vater?“ fragte er.
„Der arme Ben“, sagte der Colonel. „Er wird leider für die
Sache des Friedens geopfert werden müssen. Eine
Entscheidung, die mir nicht leichtgefallen ist. Im Gegenteil,
junger Freund! Ich bedaure es außerordentlich…“
„Das alles wird Ihnen noch einmal sehr leid tun“, prophezeite
Hoss.
„Was wollen Sie?“ Colonel Jarell sah ihn verständnislos an.
„Ihr Vater ist bei der Erfüllung einer wichtigen Aufgabe
gefallen!“
Hoss fuhr überraschend herum. Er schlug dem verdutzten
Sergeanten mit dem Fuß den Revolver aus der Hand. Dann
sprang er mit einem mächtigen Satz auf sein Pferd, das noch
immer gesattelt neben den anderen Reittieren stand.
Er stieß seinem Pferd die Absätze in die Seiten, und schon
galoppierte der Hengst mit wildem Wiehern aus dem Lager,
genau auf Lowell zu, der mit schußbereitem Gewehr Wache
hielt.
„Aufhalten!“ schrie Sergeant Devlin. „Lassen Sie ihn nicht
entkommen!“
Der Wachtposten dachte nicht daran, dem Befehl zu
gehorchen. Er ließ den Reiter lächelnd passieren.
Der Sergeant stürzte sich wütend auf Lowell.
„Warten Sie!“ schrie er. „Das werden Sie büßen! Ich bringe
Sie vor ein Kriegsgericht!“

Die Soldaten, die das Grab für den toten Wiggins aushoben,
blickten bei dem Lärm erschrocken auf. Colonel Jarell stand
wie erstarrt. Bevor Lowell es verhindern konnte, hatte ihm
Sergeant Devlin das Gewehr aus der Hand gerissen. Er legte
kurz an und schoß zweimal hinter dem Flüchtling her.
Hoss hörte die erste Kugel dicht an seinem Kopf vor-
beipfeifen. Dann traf ihn ein Schlag in den Rücken. Ein
glühender Schmerz durchzuckte ihn.
Hoss biß die Zähne zusammen. Er hatte Mühe, sich im Sattel
zu halten. Bei jedem Galoppsprung seines Pferdes quoll neues
Blut aus der Schußwunde. Es lief ihm warm den Rücken hinab.
Bald waren Pferd und Reiter außer Schußweite. Aber Hoss
hatte auch nicht die Kraft mehr, sein Reittier anzutreiben. Er
ließ es einfach laufen in der Hoffnung, daß es ihn zu Elkoro
und seinem Vater tragen würde.
Hoss wußte nicht, wie lange er so geritten war. Immer stärker
schwankte er im Sattel. Plötzlich wurde ihm schwarz vor den
Augen, und er fiel kopfüber zu Boden…

Bei Elkoro
„Ich bin zu dir gekommen, weil ich mit dir reden muß,
Elkoro“, erklärte Ben Cartwright, als er neben dem Häuptling
vor dem Zelt auf dem Boden hockte.
Das Dorf der Paiutes befand sich in einem winzigen Tal, das
von hohen Felsen eingeschlossen war. Man gelangte nur durch
zwei Felsentore hinein. Die Höhen wurden ständig von den
Kriegern bewacht.
Die Späher hatten den Reiter sofort bemerkt und zum Zelt des
Häuptlings gebracht, als Ben Cartwright Elkoro zu sprechen
begehrte, und der Häuptling der Paiutes hatte den Rancher wie
einen alten Freund empfangen.
Von den Lagerfeuern stieg kerzengerade weißer Rauch auf.
Rund um die Feuer waren viele Frauen und Kinder beschäftigt.
Ben Cartwright sah nur wenige Krieger.
Elkoro hatte schweigend die Friedenspfeife gestopft. Jetzt
setzte er sie an dem Lagerfeuer in Brand. Nach einigen Zügen
reichte er sie seinem Besucher.
„Dieses Kalumet stammt noch von meinem Vater, dem
Großen Büffel, dessen Name an den Lagerfeuern der roten
Männer mit Hochachtung genannt wurde“, sagte er. „Jetzt
brennen nur noch wenige Lagerfeuer. Immer mehr rote Männer
gehen in die ewigen Jagdgründe. Kein Krieger spricht mit
Hochachtung von Elkoro…“ Er starrte sinnend in den Rauch,
der von der Pfeife aufstieg.
Der Rancher tat ein paar schnelle Züge, bevor er das Kalumet
an den Häuptling zurückgab.
„Ich bin gekommen, um mit dir über den Frieden zu
sprechen“, erklärte er.

„Die Krieger der Paiutes wünschen sich nichts sehnlicher als
den Frieden“, sagte Elkoro. „Leider hat man sie bisher immer
getäuscht. Aber das gilt nicht für meinen weißen Bruder, der
nicht mit doppelter Zunge spricht.“
„Wir begegnen uns heute nicht zum ersten Male“, sagte Ben
Cartwright. „Und du weißt, daß du mir vertrauen kannst.“
„Ich weiß, daß keine Lüge über deine Lippen kommt,
Bleichgesicht“, bestätigte der Häuptling.
„Du wirst also tun, was der weiße Vater in Washington von
dir verlangt?“ forschte der Rancher.
„Das Volk der Paiutes verhungert“, beklagte sich Elkoro. „Es
hat weder genug Nahrung noch Munition. Die Berge sind
grausam. Jeden Tag gehen viele meiner Brüder in die ewigen
Jagdgründe. Wer nicht von den Kugeln der weißen Männer
getötet wird, stirbt an einem bösen Fieber. Die Zahl meiner
Krieger nimmt ab wie die Blätter der Bäume kurz vor dem
ersten Schnee.“
„Wir bieten dir Frieden“, sagte Ben Cartwright. „Dazu
Lebensmittel, Decken und Munition…“
„Das alles braucht mein Volk“, gab der Häuptling zu. „Aber
es wird niemals die Gefangenschaft ertragen.“
„Ihr werdet nicht gefangen sein“, erklärte der Rancher,
„sondern frei. Colonel Jarell, der weiße Krieger, der mit mir
gekommen ist, hat vom weißen Vater in Washington den
Auftrag erhalten, einen ehrenvollen Frieden mit dir zu
schließen. Keinem deiner Krieger wird ein Haar gekrümmt. Ich
bürge dafür mit meinem Wort!“
„Uff“, sagte Elkoro. „Mein weißer Bruder möge mir erklären,
was mit meinem Volk geschieht.“
„Nichts“, antwortete Ben Cartwright. „Überhaupt nichts! Ihr
werdet ins Reservat am Pyramid Lake gehen. Dort könnt ihr
euch völlig frei bewegen und tun und lassen, was ihr wollt…“

„Einst gehörte den roten Männern das ganze Land“, erinnerte
sich der Häuptling. „Sie konnten reiten, wohin sie wollten, und
überall jagen. Das ist vorbei, seit die weißen Männer zu uns
gekommen sind. Trotzdem ist Elkoro froh, daß endlich Frieden
herrschen soll. Ich habe gesprochen. Howgh!“
Der Häuptling nahm das Kalumet, das während der ganzen
Unterredung zwischen den beiden Männern hin und her
gewandert war, und klopfte die Asche aus dem Pfeifenkopf.
Plötzlich näherte sich ihm ein Krieger und flüsterte aufgeregt
mit ihm. Elkoro hörte den Stammesbruder geduldig an. Dann
wandte er sich wieder Ben Cartwright zu.
„Meine Krieger haben einen toten weißen Mann gefunden“,
berichtete er, „der von seinen eigenen Brüdern erschossen
worden ist.“
„Wo?“ fragte der Rancher.
„Nicht weit von hier“, erwiderte der Häuptling.
„Ich möchte ihn sehen“, bat Ben Cartwright.
Elkoro stand auf.
„Mein weißer Bruder möge mir folgen. Meine Krieger
werden uns zu dem toten Bleichgesicht führen.“
Der Häuptling und der Rancher bestiegen ihre Pferde. Von
mehreren Kriegern begleitet, ritten sie durch das Felsentor im
Osten aus dem Dorf.
Bereits eine Viertelstunde später waren sie am Ziel. Ben
Cartwright erschrak, als er das Pferd erkannte, das ruhig neben
der reglosen Gestalt stand.
„Es ist mein Sohn!“ rief er.
Er war mit einem Satz aus dem Sattel und beugte sich besorgt
über Hoss, der noch schwach atmete. Der Rancher schöpfte
wieder Hoffnung.
„Er ist nicht tot“, erklärte er. „Nur bewußtlos! Wahrscheinlich
hat er eine Menge Blut verloren!“

Hoss’ Hemd war blutdurchtränkt. In der Lederweste sah man
deutlich das Loch, das die Kugel gerissen hatte. Der
Verwundete stöhnte leise. Dann bewegte er plötzlich die
Lippen.
„Es ist eine Falle“, murmelte er. „Der Colonel haßt alle
Indianer! Er – will – alle – töten…“
Ben Cartwright blickte erschrocken zu dem Häuptling auf.
Elkoro hatte die Worte auch gehört.
„Wir sind beide betrogen worden“, stellte er fest. Dann gab er
seinen Kriegern einen Befehl. Die Indianer stiegen auf ihre
Pferde.
„Warte!“ rief der Rancher.
„Du hast gehört, was dein Sohn gesagt hat?“ Die Stimme des
Häuptlings klang bitter. „Aber die Krieger der Paiutes sind
keine Squaws, die ihr Schicksal laut beklagen; sie sind Männer,
die zu kämpfen verstehen!“
„Ihr werdet in eine Falle reiten“, gab Ben Cartwright zu
bedenken.
„Elkoro weiß, daß es nur wenige Bleichgesichter sind“,
erklärte der Häuptling.
„Laß mich mit ihnen reden“, bat der Rancher. „Nein!“ winkte
Elkoro ab. „Du kannst sie nur noch begraben!“
Der Häuptling sprengte an der Spitze seiner Krieger davon.
Ben Cartwright blieb allein bei seinem verwundeten Sohn
zurück…

Auf Leben und Tod
„Ich höre sie kommen“, flüsterte Colonel Jarell.
Er stand mit Sergeant Devlin auf dem Planwagen hinter dem
schußbereiten Maschinengewehr, dessen Lauf auf die grünen
Hänge gerichtet war.
Sie hatten den Wagen dicht an die steil aufragende Felswand
gefahren, um freies Schußfeld zu haben.
Die Soldaten lagen mit dem Gewehr im Anschlag hinter den
Felsblöcken verborgen, die den Boden vor dem Planwagen
bedeckten. Alle außer Lowell, der von Sergeant Devlin
entwaffnet worden war.
„Sie kommen“, wiederholte der Colonel leise. „Ich höre es an
der Art, wie sie reiten. Sie kommen den Abhang hinter dem
Hügel herauf. Gleich werden sie da sein!“
Das Hufgetrappel kam rasch näher. Der Sergeant stellte sich
hinter das Maschinengewehr. Sein Zeigefinger suchte den
Abzug.
„Achtung, Männer!“ rief Colonel Jarell. „Es wird erst
geschossen, wenn ich den Befehl dazu gebe. Wir wollen sie
möglichst nahe herankommen lassen!“
Dann waren die ersten indianischen Reiter oben auf der
Hügelkuppe zu sehen. Mit einem gellenden Kriegsschrei jagten
sie auf ihren kleinen Pferden heran.
Kurz vor dem Feind teilte sich die Schar der indianischen
Krieger nach rechts und links. Sie ritten im Halbkreis um das
Lager und schossen ihre Pfeile und Flinten auf die Soldaten ab.
Die Männer in den blauen Uniformen kauerten still hinter den
Felsblöcken. Sie zielten mit den Gewehren auf die Indianer,
schossen aber noch nicht.

Doch nun hielt der Colonel den günstigsten Augenblick für
gekommen.
„Feuer!“ kommandierte er.
Sofort zog Sergeant Devlin am Abzug des Maschinen-
gewehrs. Es bellte los und spie Tod und Verderben in die
Reihen der Angreifer. Wie hingemäht stürzten mehr und mehr
Indianer aus dem Sattel, teils tot, teils verwundet. Pferde jagten
herrenlos davon.
Der Gemeine Lowell suchte hinter einem Felsblock Schutz
und starrte mit brennenden Augen auf das Gemetzel.
Plötzlich loderten über dem MG-Schützen helle Flammen.
Ein Brandpfeil hatte die Wagenplane entzündet. Der Sergeant
riß fluchend die brennenden Stoffetzen von dem eisernen
Gerippe und warf sie auf den Erdboden, wo sie, ohne Schaden
anzurichten, völlig verbrannten.
Währenddessen bediente Colonel Jarell das
Maschinengewehr. Ein Gefühl höchsten Triumphes erfüllte
ihn, als ein Indianer nach dem anderen von seiner Hand fiel.
So überraschend, wie die Indianer gekommen waren,
verschwanden sie auch wieder. Plötzlich rissen sie ihre Pferde
herum und flohen hinter die Hügelkuppe.
„Feuer einstellen!“ befahl der Colonel.
In der Hitze des Gefechts hatte er überhört, daß zuletzt nur
noch das Maschinengewehr geschossen hatte. Das Krachen der
Büchsen war längst verstummt.
Hull, Johnson und die anderen Soldaten waren tot. Nur
Lowell hatte den Kampf überlebt. Aber auf ihn wartete in der
Heimat der Strick.
„Ein großer Sieg, Sir“, sagte Sergeant Devlin.
„Das ist nur der Anfang“, erklärte Colonel Jarell. „Sie
kommen bestimmt wieder!“
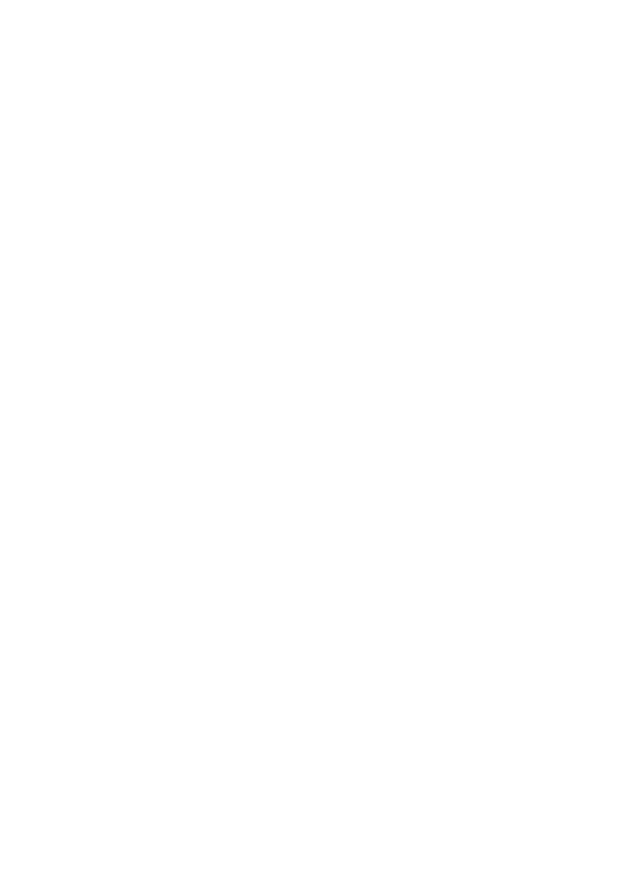
Der Sergeant lud die Trommel des Maschinengewehrs nach,
damit sie für etwaige weitere Angriffe der Indianer gerüstet
waren.
Lowell stand, nicht weit von dem Planwagen entfernt, mit
dem Rücken an den Felsen gelehnt und blickte entsetzt auf die
Verwüstungen. Seine Kameraden lagen leblos hinter den
Felsblöcken, die grünen Hänge waren mit toten und
verwundeten Indianern besät.
Der Colonel nahm einen tüchtigen Schluck Brandy aus seiner
Feldflasche.
„Das ist eine Arbeit, von der man Durst bekommt“, gestand
er. „Wenn ich hier fertig bin, wird es keinen Indianer mehr
geben! Nichts kann mich aufhalten! Gar nichts! Ich werde sie
alle töten!“
„Mit dem Maschinengewehr werden wir es schaffen“,
stimmte ihm Sergeant Devlin zu.
Colonel Jarell trank von neuem. Es war, als müßte er sich
Mut antrinken. Ein verächtlicher Blick traf Lowell.
„Sie kommen auch noch an die Reihe“, sagte er. „Aber es
wird schnell vorbei sein! Falls Ihnen das ein Trost ist!“
„Achtung!“ warnte der Sergeant.
Auf der Hügelkuppe erschien ein einzelner Reiter.
„Das ist Mr. Cartwright“, meldete Sergeant Devlin.
„Habe ihn bereits erkannt!“ Der Colonel ließ sein Fernglas
sinken.
Ben Cartwright kam im Schritt den grünen Hang
heruntergeritten. Vor dem Lager zügelte er sein Pferd.
„Jarell!“ rief er. „Jetzt komme ich!“
„Ben, tu’s nicht!“ flehte Colonel Jarell laut.
Der Rancher ritt weiter, genau auf den Planwagen und das
drohend auf ihn gerichtete Maschinengewehr zu.
„Geh in Deckung, Ben!“ schrie der Colonel. „Gib es auf,
Keith!“ rief Ben Cartwright. „Es ist sinnlos!“
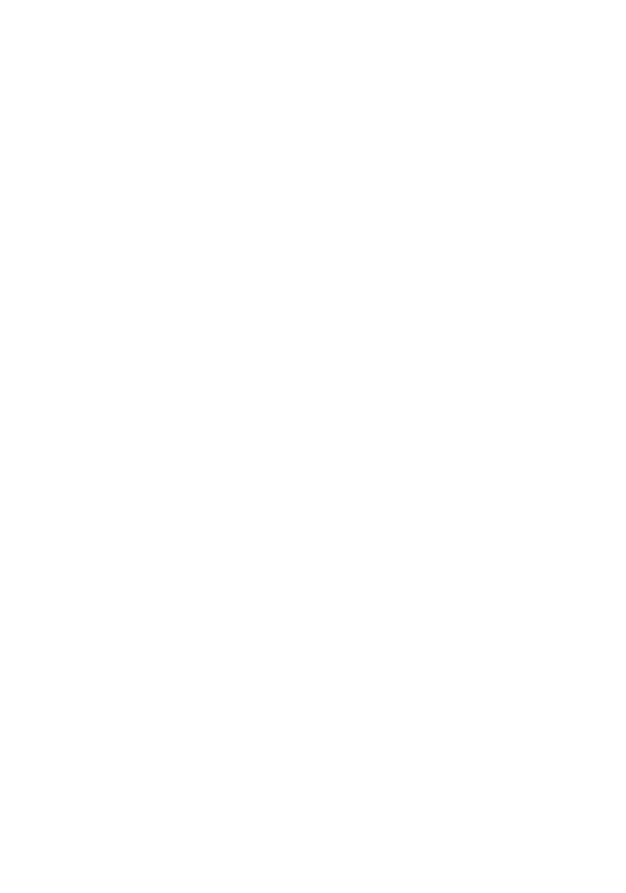
„Das war ein Befehl, Ben!“ schrie Colonel Jarell. „Oder willst
du, daß ich dich töte?“
„Wir sind hierhergekommen, um Frieden zu schließen“,
erinnerte ihn der Rancher. Er war jetzt höchstens noch zehn
Yards von dem Planwagen entfernt.
„Es gibt keinen Frieden“, sagte der Colonel. „Nicht eher, bis
alle Indianer tot sind!“
„Du weißt nicht, was du redest, Jarell!“ Ben Cartwright
sprach in beschwörendem Ton.
„Ich will sie alle tot sehen!“ schrie Colonel Jarell. „Alle!
Keiner darf entkommen!“
„Dann mußt du mich auch töten“, sagte der Rancher. Er ritt
furchtlos näher.
„Halt! Bleib stehen!“ warnte ihn der Colonel. „Diese Waffe
schießt automatisch. Sie tötet alle, die sich auf Schußweite
nähern. Auch dich, Ben! Glaube nicht, daß ich bei dir eine
Ausnahme mache! Keiner wird mich aufhalten! Keiner!“
„Hast du den Verstand verloren?“ fragte Ben Cartwright.
„Meine Söhne!“ schrie Colonel Jarell. „Ich habe geschworen,
daß ich sie rächen werde!“ Seine Stimme klang schrill. Irrsinn
leuchtete aus seinen Augen. „Ich werde euch alle töten! Alle!
Hörst du? Nicht nur die Indianer! Alle, die mich nicht
verstehen wollen! Alle! Auch dich!“ Seine Hand fuhr zum
Abzug.
Der Rancher war nur noch fünf Yards entfernt, als Lowell mit
einem Satz auf den Planwagen sprang und die Trommel von
dem Maschinengewehr riß. Ohne Magazin war die Waffe
ungefährlich.
Sergeant Devlin wollte sich auf den Soldaten stürzen. Aber da
war Ben Cartwright bereits ganz nahe. Er hielt einen Revolver
schußbereit in der Hand.
„Keine falsche Bewegung!“ warnte er.

Der Colonel war aufschluchzend hinter dem Maschi-
nengewehr zusammengebrochen. Auf einen Wink des
Ranchers entwaffnete Lowell den Sergeanten.
Dann kam Elkoro mit dem Rest seiner Krieger in das Lager
geritten. Vor Ben Cartwright verhielt er sein Pferd.
„Ich danke meinem weißen Bruder“, sagte er. „Ohne seine
Hilfe wären die Krieger der Paiutes von dem feuerspeienden
Ungeheuer vernichtet worden.“
„Wirst du dein Versprechen halten?“ fragte der Rancher.
„Von nun an soll Frieden herrschen zwischen den Paiutes und
den weißen Männern“, versprach der Häuptling.
„Ja“, nickte Ben Cartwright. „Das Blutvergießen ist zu Ende.
In Zukunft werden wir friedlich nebeneinander leben!“
Während dies am Fuße der Jarbridge Mountains geschah,
wurde viele hundert Meilen weiter östlich ein Verbrechen
verübt, das nicht ohne Folgen für die Cartwrights sein sollte…

Der fremde Reiter
Der Reiter, der sich von Osten her Pine City näherte, drehte
sich immer wieder im Sattel um. Er schien zu befürchten, daß
er verfolgt werde.
In der Main Street, der Hauptstraße von Pine City – es war
zugleich auch die einzige Straße der Stadt – , stieg der Reiter
vom Pferd und führte es in die Lücke zwischen zwei
Holzhäusern. Dort blieb es wartend stehen.
Nicht weit davon entfernt lockte in grellen Farben der Prärie-
Saloon. Das Haus gegenüber war das City Hotel. Außerdem
befanden sich in der Main Street noch die Posthalterstation, die
Druckerei des „City Herald“ und das Büro des Sheriffs.
Die Häuser waren fast alle alt und verwittert, die Farben auf
den Schildern verblaßt und von Wind und Regen
weggewaschen. Trotzdem war Pine City eine blühende,
aufstrebende Stadt. Im Augenblick wurde sie allerdings von
einer Serie von Raubmorden heimgesucht.
Der Fremde brauchte nicht lange zu warten, bis sein
Verfolger kam. Dieser zweite Reiter hätte sein Zwillingsbruder
sein können, so ähnlich sahen sich beide. Sie hatten die gleiche
kräftige Gestalt und trugen denselben schwarzen, struppigen
Bart.
Natürlich war der zweite Reiter dem Fremden nicht
unbekannt. Er hatte erwartet, daß Slim Jenner ihn verfolgen
würde, obgleich er seine Spuren geschickt zu verwischen
versucht hatte.
Der Verfolger machte hier ebenfalls halt und band sein Pferd
an einen der Pfähle, die vor den Häusern in den Boden
gerammt waren. Dann blickte er sich forschend um und ging
mit schnellen Schritten in den Saloon.

„Guten Morgen!“ grüßte er.
Der Kellner hinter dem Schanktisch sah überrascht auf.
„Tut mir leid, Gentleman…“ sagte er. „Ich darf Ihnen noch
nichts ausschenken. Wir öffnen erst um zehn Uhr!“
„Will nichts trinken“, erklärte der frühe Gast. „Will nur ‘ne
Auskunft! Bin auf der Suche nach jemandem…
Ist ein Freund von mir! Müßte eben in die Stadt gekommen
sein! Hat ungefähr meine Größe, schwarze Haare und genauso
einen Bart wie ich…“
„Die Beschreibung trifft auf die meisten Männer in dieser
Stadt zu“, behauptete der Kellner.
„Wirklich?“ Jenner blickte ihn prüfend an. „Überlegen Sie
mal! Soll Ihr Schaden nicht sein!“
„Bedaure!“ Der Kellner schüttelte den Kopf, während er
eifrig Gläser spülte. „Bei mir ist heute noch niemand gewesen.
Vielleicht versuchen Sie es mal drüben im Hotel.“
„Danke!“ Der Mann, der seinen Freund suchte, tippte lässig
an seinen Hut und verließ gemächlich den Schankraum. Die
beiden Flügel der Pendeltür schwangen hinter ihm hin und her.
Bis zum City Hotel waren es nur wenige Schritte. Plötzlich
bemerkte Jenner das Pferd in der Lücke zwischen den Häusern.
Dann sah er den Reiter hinter ein paar Holzkisten lauern.
„Hallo – Will!“ rief er.
„Komm ruhig näher“, forderte ihn der andere auf.
Slim Jenner war, die Hand am Colt, stehengeblieben. Jetzt
ging er zögernd auf den Mann zu, dem er viele Meilen gefolgt
war. Er grinste verschlagen.
„Habe ich dich endlich erwischt?“
„Ich habe hier auf dich gewartet“, antwortete sein Gegenüber.
„Wo sind die anderen?“
„Sind auf die falsche Spur ‘reingefallen, die du in Rim
Springs für uns gelegt hast“, erklärte Jenner. „Zum Glück habe

ich eine bessere Nase. Besonders, wenn es um fünftausend
Piepen geht!“
„So viel bin ich Butler wert?“ staunte der Mann, der mit
Vornamen Will hieß.
„Nicht du, die Platten“, belehrte ihn Jenner. „Aber ich habe
eine bessere Idee.“
„So?“ Der andere blickte ihn erwartungsvoll an.
„Wirst zufrieden sein“, versprach Jenner. „Allerdings müßte
ich dazu noch etwas näher kommen…“
„Einverstanden“, nickte der andere. „Aber mach keine
Dummheiten! Laß deine Hände vom Colt!“
Slim Jenner kam vorsichtig näher.
„Das genügt“, sagte der andere.
Die beiden Männer standen sich jetzt im Abstand von fünf
Yards gegenüber. Keinem war ganz wohl in seiner Haut. Beide
belauerten sich ängstlich.
„Also, was gibt es?“ Die Stimme klang gelangweilt.
„Möchte dir ein Geschäft vorschlagen“, verkündete Jenner.
„Was für ein Geschäft?“
„Werden uns beide zusammentun“, schlug Jenner vor. „Dabei
springen mehr als fünftausend heraus. Und zwar für jeden von
uns! Na, ist das ein Vorschlag?“
„Das geht nicht“, sagte der andere.
„Warum nicht?“ Jenner starrte ihn wütend an.
„Weil ich die Druckstöcke nicht mehr habe“, erklärte sein
Gegenüber.
„Tut mir leid, Will!“ Jenner machte ein enttäuschtes Gesicht.
„Werde mich wohl oder übel mit den fünftausend begnügen
müssen. Butler will dich tot oder lebendig. Nehme an, du ziehst
lebendig vor.“
Der andere lächelte belustigt.
„Um mich zu erschießen, bist du nicht schnell genug“,
behauptete er.

„Wetten?“ Jenner lachte heiser auf.
„Versuch’s nur!“ Der andere schien seiner Sache sicher.
Sie schossen fast gleichzeitig. Beide Kugeln trafen; die eine
mitten ins Herz, die andere dicht daneben. Der Überlebende
beugte sich über den Toten. Dann taumelte er mit
schmerzverzerrtem Gesicht zu seinem Pferd und schwang sich
stöhnend in den Sattel.
Die Bewohner von Pine City, die, von den Schüssen
erschreckt, aus den Häusern gelaufen kamen, sahen einen
Mann im Galopp davonreiten. Dann fanden sie den Toten.
„Hilfe! Mord!“ schrie der Portier des City Hotels, der als
erster zur Stelle war.
„Dort reitet der Mörder!“ rief der Kellner, der mit wehender
Schürze am Tatort erschien.
Im Nu hatte sich eine große Menschenmenge um den Toten
versammelt. Der Sheriff hatte Mühe, sich hindurchzuzwängen.
„Wer ist der Tote?“ erkundigte er sich.
„Keine Ahnung.“ Der Hotelportier zuckte die Schultern. „Auf
jeden Fall ein Fremder!“
„Vor ein paar Minuten war er noch bei mir im Saloon“,
erinnerte sich der Kellner. „Er war auf der Suche nach einem
Freund.“
„Freund?“ Der Sheriff horchte auf.
„Ein schöner Freund“, meinte der Redakteur des „City
Herald“, der zugleich auch Reporter war.
„Wahrscheinlich hatten die beiden Streit“, vermutete der
Sheriff.
„Ich habe gesehen, wie der Mörder seinem Opfer die Taschen
ausleerte“, berichtete der Hotelportier.
„Also ein neuer Raubmord“, stellte der Sheriff fest.
„Das ist bereits der fünfte in einem Monat!“ Der Redakteur
des „City Herald“ blickte durch seine Nickelbrille anklagend in
die Runde.

„Wenn ich mich nicht irre, hat auch der Mörder eine Kugel
abgekriegt“, erklärte der Hotelportier.
„Richtig!“ erinnerte sich der Kellner. „Es waren zwei
Schüsse!“
Die Untersuchung ergab, daß es sich sowohl bei dem Toten
als auch bei seinem Mörder um Fremde handelte, die erst am
Morgen in die Stadt gekommen waren. Allerdings sollte das
Opfer nicht lange namenlos bleiben.
„Vielleicht trägt er Papiere bei sich“, überlegte der Redakteur
laut.
Der Sheriff, der bereits die Brieftasche des Toten in der Hand
hielt, blickte gekränkt auf.
„Mr. Hawkens“, sagte er, „ich weiß Ihren Rat zu schätzen.
Aber ganz so dumm, wie Sie glauben, bin ich nicht!“
„So verraten Sie es uns endlich“, bat der Redakteur. „Was?“
fragte der Sheriff. „Was soll ich Ihnen verraten?“
„Den Namen“, flehte der Redakteur. „Den Namen des
Opfers! Ich brauche ihn dringend für meinen Artikel!“
„Der Tote heißt Will Cartwright“, sagte der Sheriff…

Eine schlechte Nachricht
„Einen Bärenhunger hab’ ich“, stöhnte Hoss. Joe betrachtete
ihn mitleidig.
„Du scheinst bei den Paiutes nicht genug zu essen bekommen
zu haben“, vermutete er.
Sie saßen in der Küche der Ponderosa. Es war noch keine
Stunde vergangen, seit Ben Cartwright mit seinem Sohn auf die
Ranch zurückgekehrt war. Seitdem aß Hoss ununterbrochen. Er
leerte einen Teller Erbsen mit Speck nach dem anderen.
Hop Sing, der am Herd das Abendessen zubereitete, blickte
immer wieder lächelnd zu ihnen herüber. Er strahlte übers
ganze Gesicht, weil es Hoss so gut schmeckte. Nichts konnte
den Koch glücklicher machen!
Joe mußte an das Wettessen denken, bei dem Hoss
überraschend nur Zweiter geworden war. Heute hätte er
spielend gewonnen.
Hoss’ Schußwunde war erstaunlich gut verheilt, nachdem der
Medizinmann der Paiutes die Kugel entfernt und Kräuter auf
die blessierte Stelle gelegt hatte.
„Ein Glück, daß die Kugel nicht deinen rechten Arm
getroffen hat“, sagte Joe grinsend. „Sonst müßte ich dich jetzt
füttern!“
„Du solltest etwas mehr Respekt vor deinem Bruder haben“,
erklärte Ben Cartwright, der in diesem Augenblick mit einem
Brief in der Hand in die Küche kam.
„Ich weiß“, gab Joe zu. „Er ist ein Held!“
„Del alme Mastel Hoss“, jammerte Hop Sing. „Sein
untelwegs fast velhungelt!“
„Hallo, Pa!“ Hoss winkte mit dem Löffel. Dann aß er
seelenruhig weiter.

„Ich habe eine schlechte Nachricht erhalten“, berichtete sein
Vater. „Der Sheriff von Pine City teilt mir mit, daß Will
Cartwright, mein Neffe, dort erschossen worden ist.“
„Ermordet?“ wollte Joe wissen.
„Der Sheriff hat nichts weiter geschrieben“, sagte Ben
Cartwright. „Nur, daß der Fremde erschossen worden ist. Man
hat ihn anhand seiner Papiere identifiziert.“
„Und?“ fragte Joe.
„Ich soll hinkommen“, erklärte der Rancher, „falls der Tote
mit uns verwandt ist.“
„Ist das nicht der Vetter, der verschollen gewesen ist?“
erinnerte sich Joe.
„Ich habe meinen Bruder John einmal drüben, in Ohio,
besucht“, erzählte Ben Cartwright. „John war einer von den
Männern, die immer in irgendwelche Geschäfte verwickelt
sind, die nichts einbringen… übrigens – Hoss hat mich damals
begleitet. Nicht wahr, du erinnerst dich doch daran.“
„He! Pa hat dich was gefragt!“ Joe stieß seinen Bruder
wütend in die Seite.
Hoss blickte ärgerlich auf.
„Was hast du gesagt?“
„Ich möchte wissen, ob du dich noch an den Besuch bei
meinem Bruder in Ohio erinnerst“, sagte der Rancher. „Und an
Will. Ich glaube, er ist etwas älter als du.“
„Keine Ahnung!“ Hoss schüttelte den Kopf. „Kann mich
weder an Onkel John noch an Will erinnern. Tut mir leid!“
„Du hättest ihn fragen sollen, was ihr damals gegessen habt“,
schlug Joe vor. „Vielleicht hätte er sich dann erinnert.
Vorausgesetzt, daß das Essen gut war!“
„Und so was nennt sich Bruder“, seufzte Hoss, während er
einen neuen Löffel mit Erbsen in den Mund schob.
„Später bin ich noch einmal in Ohio gewesen“, berichtete Ben
Cartwright. „Zur Beerdigung meines Bruders. Damals war Will

bereits verschollen. Niemand wußte, wo er sich aufhielt. Es
hieß, er sei zur See gegangen.“
„Endlich satt?“ fragte Joe, als Hoss seinen Löffel auf den
leeren Teller legte.
„Schrecklich, diese Bevormundung!“ klagte Hoss. „Da sitzt
man über eine Woche im Sattel, reitet quer durch die Staaten
und kämpft bis zum Umfallen. Und was ist der Dank? Man
kann nicht mal in Ruhe essen!“
Joe blickte seinen Bruder strafend an.
„Ich glaube, du weißt überhaupt nicht, was los ist“, vermutete
er.
„Und?“ fragte Hoss. „Was ist los?“
„Pa muß wieder fort“, erklärte Joe.
„Schon wieder?“ wunderte sich Hoss.
„Ich fahre nach Pine City“, sagte der Rancher. „Dein Vetter,
Will Cartwright, ist dort erschossen worden!“
„Moment! Hat der nicht immer so gern Maisflocken
gegessen?“ erinnerte sich Hoss.
„Da hast du’s!“ lachte Joe. „So was vergißt er nicht!“
Hoss schnaufte verächtlich.
„Soll ich dich begleiten?“ fragte er seinen Vater.
„Nicht nötig!“ winkte Ben Cartwright ab.
„Wann fährst du?“ fragte Joe.
„Morgen früh. Mit der Postkutsche“, sagte der Rancher…

Neue Rätsel
„Mr. Cartwright?“
Der Mann, der ihn mit dieser Frage vor der Posthalterstation
in Pine City empfing, war groß und breitschultrig und hatte ein
offenes, ehrliches Gesicht.
Der Rancher nickte.
„Ich bin Sheriff Hollister“, stellte sich der große,
breitschultrige Mann vor.
Das hatte sich Ben Cartwright bereits gedacht, denn der
Sheriffstern war nicht zu übersehen gewesen. Natürlich hatte er
diesen Empfang nicht erwartet.
„Danke fürs Abholen“, sagte er.
Es war für den Sheriff nicht schwer gewesen, ihn aus der
Menge der Reisenden herauszufinden; außer ihm hatte kein
männlicher Fahrgast die Postkutsche in Pine City verlassen.
„Ich habe vor zwei Stunden Ihr Telegramm erhalten“, sagte
Sheriff Hollister. „Dachte, wir könnten sofort alles erledigen.“
„Das ist auch mein Wunsch“, erklärte der Rancher.
„Mein Büro ist nur wenige Schritte von hier entfernt“, sagte
der Sheriff. „Wenn Sie von der Reise nicht zu müde sind,
können wir gleich anfangen.“
„Einverstanden!“ nickte Ben Cartwright.
Inzwischen hatte der Postillion den Koffer des Ranchers vom
Dach der Postkutsche heruntergeholt.
„Hank!“ winkte Sheriff Hollister dem Hausdiener des City
Hotels. „Bring das Gepäck von Mr. Cartwright schon ‘rüber!
Er kommt später nach!“
„Okay, Sheriff!“ Der Hausdiener nahm den Koffer auf und
schleppte ihn quer über die Straße.

Die beiden Männer verließen die Posthalterstation. Sie gingen
nebeneinander her, an den alten, verwitterten Häuserfronten
entlang, vorbei an der Druckerei des „City Herald“, in dessen
Schaukasten die neuesten Meldungen über den jüngsten Mord
ausgehängt waren.
„Den Mörder haben wir leider noch nicht erwischt“,
berichtete der Sheriff. „Wir hatten sofort ein Aufgebot
zusammengestellt, aber ein paar Meilen vor der Stadt verloren
sich alle Spuren. Nur sein Pferd, das haben wir gefunden. Lag
mit einem gebrochenen Bein in der Prärie. Vermutlich hat der
Kerl sich ein anderes gestohlen. Diese Burschen schrecken vor
nichts zurück.“
„Ja“, nickte Ben Cartwright. „Wer erst einmal einen Mord auf
dem Gewissen hat…“
„Es ist nicht ausgeschlossen, daß dieser Mann schon mehrere
Menschen getötet hat“, meinte Sheriff Hollister. „Allein in
diesem Monat wurden in Pine City fünf Raubmorde
begangen…“
„Dann möchte ich nicht in Ihrer Haut stecken“, gestand der
Rancher.
Ein Wagen fuhr ratternd an ihnen vorüber. Der Sheriff blieb
stehen.
„Wissen Sie, Mr. Cartwright…“ sagte er. „Die Beschreibung,
die ich von dem Täter habe, ist leider nicht sehr gut. Trotzdem
hoffe ich, daß sie uns weiterhilft!“
„Ich wünschte, der Mörder würde bald gefaßt“, hoffte der
Rancher. „Wie ist es eigentlich zu dem Verbrechen
gekommen?“
„Auch darüber wissen wir nur sehr wenig“, bedauerte Sheriff
Hollister. „Für die Tat selbst haben wir keine Zeugen.“
„Das war auch kaum zu erwarten“, sagte Ben Cartwright.

„Immerhin gibt es ein paar glaubwürdige Zeugen, die gesehen
haben wollen, wie der Mörder die Taschen seines Opfers
durchsucht hat“, erklärte der Sheriff.
„Dann war es also ein Raubmord“, stellte der Rancher fest.
„Ja“, nickte Sheriff Hollister. „Jedenfalls sah es zunächst so
aus!“
„Nur zunächst?“ wunderte sich Ben Cartwright.
„Bis wir die Kleider des Toten noch einmal gründlich
durchsuchten“, sagte der Sheriff. „Dabei fanden wir eine
goldene Uhr und zweiundzwanzig Dollar. Möglich, daß der
Mörder beides übersehen hat…“
„Vielleicht haben ihn die Zeugen verjagt“, vermutete der
Rancher.
„Das wäre eine Erklärung“, gab Sheriff Hollister zu. Aber er
schien nicht daran zu glauben.
„Wenn es kein Raubmord war“, überlegte Ben Cartwright,
„was war es dann?“
„Das müssen wir noch herausfinden“, sagte der Sheriff.
„Bestimmt werden wir den Mörder leichter finden, wenn wir
das Motiv kennen.“ Er sann, in Gedanken verloren, vor sich
hin.
Auch der Rancher war nachdenklich geworden.
Den Rest des Weges legten sie schweigend zurück. Eine
Minute später hatten sie das Büro des Sheriffs erreicht…

Eine traurige Pflicht
Zuerst übergab Sheriff Hollister Ben Cartwright den Besitz des
Toten, alles, was sein Neffe bei sich getragen hatte: die
Brieftasche, die goldene Uhr mit der langen goldenen Kette
und die zweiundzwanzig Dollar.
„Zählen Sie nach“, sagte er, nachdem er die blinkenden
Goldstücke auf den Tisch gelegt hatte.
„Nicht nötig!“ winkte der Rancher ab. „Ich glaube Ihnen auch
so, daß es genau zweiundzwanzig Dollar sind.“
An der Wand tickte leise eine Uhr. In einer Ecke prasselte in
einem Kanonenofen ein Holzfeuer. Es wurde langsam kalt. Die
Herbstsonne schien nur noch matt durch das Fenster.
Ben Cartwright betrachtete wehmütig die goldene Uhr.
„Die hat sein Vater mal von mir geschenkt bekommen“,
erklärte er. „Ist schon eine Ewigkeit her!“
„Wenn Sie bitte dieses Papier unterschreiben würden…“ Der
Sheriff schob ihm ein Schriftstück hin.
Der Rancher überflog kurz den Inhalt, dann unterschrieb er
mit der kratzenden Feder, die ihm Sheriff Hollister gereicht
hatte. Damit waren alle Formalitäten erledigt.
„Wo befindet sich mein Neffe jetzt?“ erkundigte sich Ben
Cartwright.
„Ich habe ihn vorläufig bestatten lassen“, sagte der (Sheriff.
„Wir wußten ja nicht, ob wir irgendwelche Verwandten des
Toten ausfindig machen würden.“
„Dann kann ich also im Augenblick nichts weiter tun?“ fragte
der Rancher.
„Nein“, bestätigte Sheriff Hollister. „Das war alles!“
„Gut!“ Ben Cartwright stand auf. „Dann will ich Sie jetzt
nicht länger aufhalten!“

„Ich habe mich gefreut, Sie kennengelernt zu haben“, gestand
der Sheriff, der ebenfalls aufgestanden war. „Wenn auch der
Anlaß kein Grund zur Freude war.“
Der Rancher blickte starr an dem Sheriff vorbei auf die
Gitterstäbe der Arrestzellen, die für die inhaftierten Verbrecher
bestimmt waren. Alles in dem Raum war ihm vertraut. Er
erinnerte ihn an das Sheriffbüro in Virginia City, wo er oft zu
Besuch geweilt hatte. An der Wand standen die gleichen
Gewehrständer. Auch die Steckbriefe waren dieselben.
„Überlassen Sie alles Weitere ruhig mir“, schlug Sheriff
Hollister vor. „Ich gebe Ihnen im Hotel Bescheid, sobald ich
alles erledigt habe. Vermutlich können Sie den Leichnam
bereits morgen früh nach Virginia City überführen.“
„Ich würde gern meinem Neffen die letzte Ehre erweisen, ehe
ich ins Hotel gehe“, gestand Ben Cartwright.
„Der Friedhof liegt im Westen, auf einem Hügel vor der
Stadt“, erklärte der Sheriff.
„Vielen Dank!“ Der Rancher ging zur Tür.
„Warten Sie!“ rief Sheriff Hollister. „Zu Fuß ist es zu weit!“
„Wird mir kaum etwas anderes übrigbleiben“, meinte Ben
Cartwright.
„Nehmen Sie mein Pferd“, schlug der Sheriff vor. „Den
Braunen, der draußen angebunden ist!“
„Danke“, sagte der Rancher, nun schon zum zweiten Male.
„Sie brauchen mir nicht zu danken“, wehrte Sheriff Hollister
ab. „Ich helfe Ihnen gern! Habe sowieso viel zuwenig für Sie
tun können!“
„Sie meinen, weil Sie den Mörder noch nicht verhaftet
haben?“ Ben Cartwright blickte ihn forschend an.
„Ja“, nickte der Sheriff. „Fünf Verbrechen in einem Monat!
Das ist eine schlechte Bilanz! Für mich und für alle, die in
dieser Stadt wohnen.“

Nach einem kurzen Abschied schwang sich der Rancher auf
die braune Stute und ritt zum Friedhof…

Auf dem Friedhof
Der Friedhof von Pine City war größer, als Ben Cartwright es
erwartet hatte. Hier hatte man die Pioniere, die einst mit den
Trecks in das Land gekommen waren, zur letzten Ruhe gebettet
und dazu viele ihrer Söhne und Töchter.
Der Rancher band sein Pferd draußen an einen Baum, bevor
er den Friedhof durch das schmiedeeiserne Portal betrat.
Langsam ging er auf dem schmalen Weg zwischen den
Gräbern hindurch.
Ein paar alte Ulmen spendeten etwas Schatten. Dazwischen
wuchsen auf winzigen Grünflächen dichte Büsche.
Buchsbaumhecken umschlossen einen Teil der Gräber.
Die Namen auf den Holzkreuzen und Grabsteinen waren Ben
Cartwright unbekannt. Er mußte lange suchen, bis er das Grab
seines Neffen fand. Endlich entdeckte er den frisch
aufgeworfenen Hügel.
Einen Augenblick stand er schweigend vor dem schlichten
Holzkreuz, das den Namen Will Cartwright trug. Er las die
Jahreszahlen. Trauer überfiel ihn, weil sein Neffe so jung
gestorben war.
Nichts störte den Frieden der Toten. Nur zuweilen krächzte
ein Vogel.
„Keine Bewegung!“ sagte plötzlich ein Mann hinter ihm.
„Revolver weg, Butler!“
Der Rancher fühlte sich mit einem Stück Eisen angestoßen.
„Mein Name ist nicht Butler“, erklärte er. „So?“ tönte es
höhnisch an sein Ohr. „Umdrehen! Aber langsam!“
Ben Cartwright gehorchte.
Der Mann, der ihn mit einem Revolver bedrohte, machte ein
überraschtes Gesicht. „Wer sind Sie?“ fragte er.

„Mein Name ist Cartwright“, erklärte der Rancher. „Ben
Cartwright?“ Sein Gegenüber musterte ihn argwöhnisch.
„Ja“, nickte Ben Cartwright. Der
andere lachte heiser auf.
„Hast dir einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht, um deinen
Neffen zu besuchen, Onkel!“
„Will?“ Der Rancher traute seinen Ohren nicht. „Bist du das
wirklich, Junge?“ Der schwarze Bart ließ den Neffen älter
erscheinen, als er tatsächlich war.
Will sackte ächzend zusammen.
„Was hast du?“ Ben Cartwright beugte sich besorgt über ihn.
Sein Neffe blickte aus glasigen Augen zu ihm auf. Sein
ganzes Gesicht glühte wie im Fieber.
„Wie ist das eigentlich“, wollte er wissen, „wenn man
jemanden trifft, den man für tot hält, he?“
„Ich weiß nicht, was du getan hast“, sagte der Rancher.
„Sicher wirst du mir alles erklären… Trotzdem solltest du Gott
danken, daß du nicht in diesem Grab liegst!“
„Kann dir gar nicht sagen, wie froh ich darüber bin“, gestand
der Neffe. „Habe mir auch alle Mühe gegeben. Leider habe ich
kaum eine Chance, das alles zu überleben.“ Er stöhnte laut auf.
„Bist du schwer verwundet?“
„Trage eine hübsche kleine Kugel in der Brust“, stöhnte Will.
„Wollte noch eine Rechnung begleichen, bevor ich abkratze…“
Er zitterte vor Schüttelfrost.
„Ich schaffe dich zu einem Arzt“, versprach der Rancher.
„Der bringt dich wieder auf die Beine.“
„Nein“, sagte der Neffe. „Das wirst du nicht tun!“
„Die Kugel muß entfernt werden“, erklärte Ben Cartwright.
„Sonst gibt es eine Blutvergiftung.“
„Möglich, daß ich sie schon habe“, meinte Will ächzend.
„Aber darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Mit mir ist’s
sowieso aus! Das heißt, ich habe noch eine winzige Chance…“
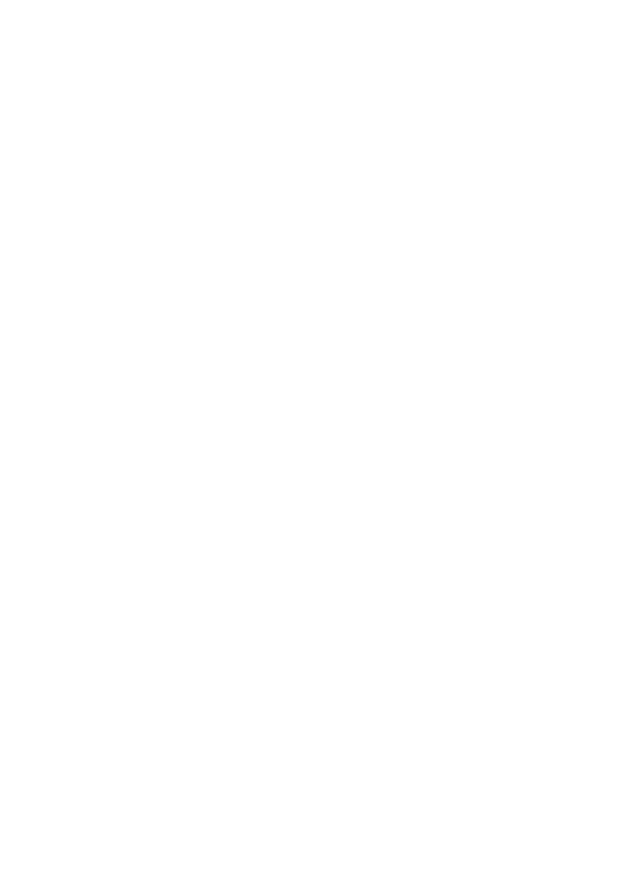
„Rede keinen Unsinn!“ empörte sich der Rancher. Er wollte
seinem Neffen aufhelfen.
„Nein!“ wehrte Will ab. „Laß mich! Es hat keinen Zweck!“
„Wieso?“ fragte Ben Cartwright. „Was hast du getan?“
„In dem Grab, vor dem du gestanden hast, bevor ich dich mit
dem Revolver bedrohte… In dem Grab liegt ein Mann namens
Slim Jenner. Er hatte den Auftrag, mich umzubringen!“ Der
Neffe schluckte nervös. „Aber er ist nicht der einzige. Es gibt
ein halbes Dutzend Verbrecher, die denselben Auftrag
haben…“
„Warum?“ wollte der Rancher wissen. „Warum wollen sie
dich töten?“
„Es ist eine lange Geschichte“, sagte Will. „Es würde zu weit
führen, wenn ich dir das alles jetzt hier erzählte. Immerhin ist
ein Kopfgeld von fünftausend Dollar ausgesetzt. Verstehst du
nun, warum ich tot sein muß? Warum ich mich nirgends mehr
sehen lassen kann? Ich habe vor ihnen nur Ruhe, solange sie
glauben, daß ich hier begraben bin.“
„Und was tust du hier auf dem Friedhof?“ erkundigte sich
Ben Cartwright.
„Ich habe mich hier auf die Lauer gelegt, um zu sehen, ob sie
es nachprüfen werden“, antwortete der Neffe. Er sah fragend
zu seinem Onkel auf. „Wieso bist du eigentlich hier
aufgekreuzt?“
„Der Sheriff hat mich benachrichtigt“, erklärte der Rancher,
„weil der Tote deine Ausweispapiere trug.“
„Die habe ich ihm in die Tasche gesteckt“, sagte Will.
„Zusammen mit der goldenen Uhr, Raffiniert, nicht?“
„Du solltest mit zum Doktor kommen“, drängte Ben.
„Hör zu, Onkel…“ Der Verwundete hatte sich etwas
aufgerichtet. Er lehnte jetzt mit dem Rücken an einem
Grabstein. Er konnte nur noch mit großer Anstrengung
sprechen. „Es ist besser, wenn du von hier verschwindest.

Butler und seine Männer sind gegen den Namen Cartwright
allergisch. Du könntest leicht in die Sache hineingezogen
werden…“
„Das bin ich schon“, stellte der Rancher fest.
„Das tut mir leid“, bedauerte der Neffe. „Wirklich, Onkel! Ich
habe das nicht gewollt! Bestimmt nicht! Ich habe einfach nicht
daran gedacht! An die Folgen, meine ich!“
„Wer ist Butler?“ wollte Ben Cartwright wissen.
„Ein Mann, der etwas gegen Leute hat, die Cartwright
heißen“, erwiderte Will.
Der Rancher hatte einen Entschluß gefaßt.
„Ich werde dir helfen, von hier fortzukommen“, sagte er.
„Keine Widerrede!“
Der Verletzte war viel zu schwach, um noch zu wider-
sprechen. Er stöhnte leise.
„Aber zuerst bringe ich dich zu einem Doktor“, erklärte Ben
Cartwright.
Die Sonne war bereits untergegangen. Die Dämmerung
breitete sich langsam über die Gräber aus. Nebel stieg von den
benachbarten Feldern auf.
Die beiden Männer waren hier sicher. Niemand würde jetzt
noch auf den Friedhof kommen. Höchstens der Sheriff, falls er
nachforschen wollte, wo der Rancher so lange blieb.
Ernste Gefahr aber drohte ihnen nur von Butler und seinen
Kumpanen. Vielleicht hatten sie Verdacht geschöpft und
lauerten irgendwo in der Nähe.
Trotzdem war Ben Cartwright zuversichtlich.
Er hoffte, den Neffen im Schutz der Dunkelheit unbemerkt
nach Pine City und zu einem Doktor schaffen zu können.
Endlich konnten sie aufbrechen…

Ein Arzt kombiniert
„Noch einen Tag länger, und er wäre an Sepsis gestorben“,
empfing Dr. Pinter Ben Cartwright, als er ihm zum zweiten
Male die Haustür öffnete.
Der Rancher hatte dem Sheriff das Pferd zurückgebracht,
nachdem er seinen Neffen bei Dr. Pinter abgeliefert hatte. Jetzt
sprach er noch einmal mit dem Arzt.
Der Doktor war ein kleiner, weißhaariger Mann, dessen rote
Nase vermuten ließ, daß er den angenehmen Seiten des Lebens,
vor allem einem guten Tropfen, nicht abgeneigt war.
„Die Kugel hat mindestens zwei Tage im Körper gesteckt!“
Dr. Pinter schüttelte besorgt den Kopf. Aus seiner Stimme
klang ein deutlicher Vorwurf. Er sah prüfend zu seinem
Besucher auf. „War das wirklich ein Jagdunfall?“
„Ja“, nickte Ben Cartwright, der dem Arzt in den Be-
handlungsraum gefolgt war. „Es ist in den Bergen passiert!“
„Merkwürdig!“ wunderte sich Dr. Pinter. „Die Kugel stammt
aus einem Vierundzwanziger! Geht man neuerdings auch mit
einem Revolver auf die Jagd?“
Der Rancher wußte darauf keine Antwort.
„Na ja“, lenkte der Arzt ein. „Man kann einen Rehbock auch
mit dem Revolver erlegen statt mit dem Gewehr… Man muß
nur nahe genüg herankommen!“ Er lächelte vielsagend.
Ben Cartwright konnte auch dazu nichts sagen.
Aber der Arzt schien auch keine Antwort erwartet zu haben.
Er ging zu einer Waschschüssel und bürstete sich gründlich die
Hände. Dann trocknete er sie sorgfältig ab. Als er sich wieder
umwandte, war sein Gesicht unerwartet ernst.
„Sie stammen nicht aus dieser Gegend.“ Das war keine Frage,
sondern eine Feststellung.

„Wir stammen aus Virginia City“, erklärte der Rancher.
Dr. Pinter rollte seine Hemdsärmel herab, die er sich vor dem
Eingriff hochgekrempelt hatte.
„Vor ein paar Tagen hatten wir hier eine Schießerei“,
erinnerte er sich. „Dabei wurde ein Mann namens Cartwright
getötet. Zeugen haben ausgesagt, daß auch den Mörder eine
Kugel getroffen hat.“
„So?“ Ben Cartwright zeigte ein höfliches Interesse.
„Wahrscheinlich ein Racheakt zwischen zwei Satteltramps“,
vermutete der Arzt.
„Schon möglich!“ gab der Rancher erleichtert zu.
Dr. Pinter war die Erleichterung seines Besuchers nicht
entgangen. Er blickte augenzwinkernd zu ihm auf.
„Ich halte es nicht für ausgeschlossen, daß der Mörder diesen
Cartwright aus Notwehr erschossen hat!“ sagte er.
„Das kann man in einem solchen Fall nie ausschließen“,
stimmte ihm Ben Cartwright zu.
„Der Mann müßte das natürlich beweisen können“, schränkte
der Arzt ein.
„Nein!“ widersprach ihm der Rancher. „Das ist Sache des
Gerichts!“
„Nicht in Pine City“, sagte Dr. Pinter.
„Wieso ist da ein Unterschied?“ Ben Cartwright wunderte
sich. „Ich dachte, es würde überall nach dem gleichen Recht
gerichtet.“
„Tja – wissen Sie…“ Der Arzt senkte den Blick. „Wir hatten
hier im letzten Monat vier Raubüberfälle. Da fackelt man nicht
lange mit dem Hängen!“
Der Rancher starrte ihn zweifelnd an.
„Wollen Sie damit sagen, daß man auch einen Unschuldigen
hängen würde?“
„Ich will damit sagen, daß es besser wäre, wenn der Fall von
ruhigen, besonnenen Männern untersucht würde – in einer

friedlichen Stadt – in Virginia City zum Beispiel…“ sagte Dr.
Pinter. „Immer vorausgesetzt, daß es sich wirklich um Notwehr
gehandelt hat!“
„Danke, Doktor!“
Ben Cartwright hatte den Wink des Doktors verstanden.
„Als Arzt bin ich mehr dafür, das Leben zu erhalten, als es
mit Hilfe eines Strickes ins bessere Jenseits zu befördern“,
erklärte Dr. Pinter. „Außerdem bin ich zu alt, um an einem
Mann Gefallen zu finden, der mit einem Strick um den Hals an
einem Ast baumelt!“
„Ich bin sicher, daß Sie auch in Ihrer Jugend keinen Gefallen
daran gefunden haben“, versicherte der Rancher.
Die beiden Männer tauschten einen Blick des Einver-
ständnisses.
„Gehen Sie in Virginia City sofort zu Ihrem Hausarzt“, sagte
Dr. Pinter, „und lassen Sie gleich den Verband wechseln.“
„In Ordnung, Doktor! Werde es nicht vergessen!“ versprach
Ben Cartwright. „Auch nicht, was Sie für uns getan haben!“
„Nicht der Rede wert“, winkte der Arzt ab.
„Wann werden wir Weiterreisen können?“ erkundigte sich
der Rancher.
„Morgen früh“, sagte Dr. Pinter. „Solange kann Ihr Neffe bei
mir bleiben. In der Kammer nebenan. Dort steht ein Bett für
Notfälle!“
„Sie haben wirklich an alles gedacht!“ Ben Cartwright war
von soviel Gastfreundschaft überwältigt. „Doktor, ich…“
„Keine langen Reden“, unterbrach ihn der Arzt. „Ich müßte
schon längst im Bett liegen! Habe morgen früh eine Menge
Krankenbesuche zu machen, Sie werden mich bis zum Mittag
in Anspruch nehmen. Danach gehe ich zum Sheriff und melde
ihm, daß ich heute abend eine Schußwunde versorgt habe. So
verlangt es die Vorschrift!“

„Morgen mittag?“ vergewisserte sich der Rancher. „Länger
kann ich es nicht hinausschieben“, erklärte Dr. Pinter.
„Das genügt“, sagte Ben Cartwright. „Auf diese Weise
gewinnen wir einen großen Vorsprung!“
Der Arzt reichte ihm eine Decke.
„Bringen Sie die unserem Patienten, damit er heute nacht
nicht friert!“
Der Rancher nahm die Decke. Dr. Pinter ergriff die blakende
Petroleumlampe und ging damit zur Treppe, die in das obere
Stockwerk führte.
„Übrigens…“ Er blieb noch einmal stehen. „Sie brauchen
keine Angst zu haben, daß ich es mir wieder anders
überlege…“
„Das habe ich keinen Augenblick angenommen“, versicherte
Ben Cartwright.
„Und noch etwas“, sagte der Arzt. „Gleich neben der
Kammer ist eine Hintertür. Für alle Fälle! Sie können sie auch
benutzen, wenn Sie nachher fortgehen. Und nun: gute Nacht!“
„Gute Nacht, Doktor!“
Der Lichtschein wanderte langsam höher, während Dr. Pinter
die Treppe emporstieg. Der Rancher öffnete die Tür zur
Kammer.
„Doktor?“ klang es leise aus der Dunkelheit.
„Ich bin’s“, flüsterte Ben Cartwright.
„Was gibt es, Onkel?“ fragte der Neffe.
„Ich bringe dir eine Decke“, sagte der Rancher. „Verhalte
dich ganz ruhig und versuche zu schlafen. Morgen früh hole
ich dich hier ab.“ Er breitete die Decke über den Verwundeten.
„Du gibst wohl nie auf“, meinte Will leise. Seine Stimme
klang bewundernd. „Du setzt deinen Kopf immer durch, nicht
wahr, Onkel?“
„Sobald du wieder bei Kräften bist, kannst du die Sache so zu
Ende führen, wie es dir paßt“, antwortete Ben Cartwright.
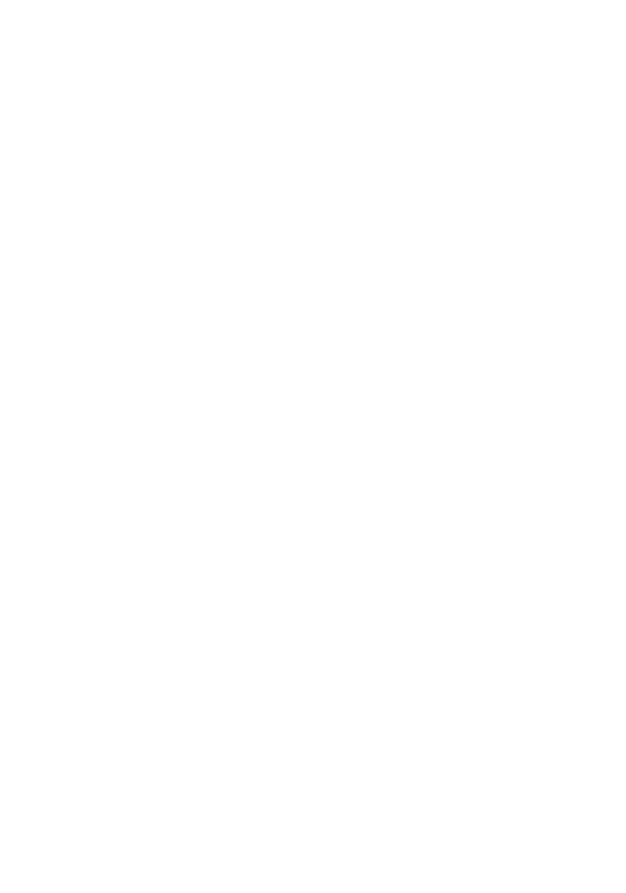
„Auch ohne meine Hilfe. Bis dahin aber mußt du dir gefallen
lassen, daß ich für dich sorge. Einverstanden?“
„Einverstanden!“ sagte der Neffe.
Der Rancher verließ durch die Hintertür das Haus des Arztes
und kehrte auf dem schnellsten Wege ins Hotel zurück. Er
ahnte nicht, daß er dort bereits sehnsüchtig erwartet wurde…

Besuch am Abend
Ben Cartwright hatte sein Zimmer im City Hotel kaum
betreten, als es leise klopfte. Da der Rancher niemanden
erwartete, öffnete er die Tür nur einen Spalt. Er wollte sich
nicht unnötig in Gefahr begeben. Draußen stand ein Fremder.
„Mr. Cartwright“, sagte der späte Besucher. „Der Portier ließ
mich wissen, daß Sie zurückgekommen sind. Ich muß dringend
mit Ihnen sprechen. Darf ich eintreten?“
„Bitte! Kommen Sie herein!“ Ben Cartwright öffnete
einladend die Tür.
Der Besucher war wie ein Geck gekleidet. Er trug
taubengraue Hosen, einen langen roten Rock und eine gelbe
Weste, über der eine goldene Uhrkette baumelte. Der Mann sah
aus wie ein Glücksspieler, die sich überall im Westen in den
Saloons niederließen und das Kartenspiel berufsmäßig
betrieben. Als der Rancher seinen Namen erfuhr, wußte er, daß
der Besucher etwas viel Schlimmeres war.
„Ich heiße Butler“, stellte sich der Fremde vor.
Ben Cartwright ließ sich nicht anmerken, daß er den Namen
kannte. Er schloß leise die Tür.
„Entschuldigen Sie, daß ich Sie noch so spät störe“, erklärte
Butler. „Ich weiß, daß Sie jetzt andere Sorgen haben, so kurz
nach dem Tode Ihres Neffen. Aber was ich mit Ihnen zu
besprechen habe, ist wichtig!“
„Also“, sagte der Rancher, „um was handelt es sich?“
„Ich weiß nicht, ob es Ihnen bekannt ist“, fuhr Butler fort.
„Ihr Neffe und ich waren Geschäftspartner. Ich bin
Effektenhändler, müssen Sie wissen. Ich arbeite mit
Investmentzertifikaten, mit Aktien und ähnlichen Wert-
papieren…“

„Ihr Besuch hängt also mit dem Tod meines Neffen
zusammen“, stellte Ben Cartwright fest.
„Ihr Neffe ist kurz vor seinem tragischen Tod völlig
überraschend aus unserer Firma ausgeschieden“, berichtete
Butler. „Dabei hat er, wohl versehentlich, ein paar wichtige
Papiere mitgenommen, Unterlagen, die für uns von großem
Wert sind. Unser Rechtsanwalt meinte sogar, Ihr Neffe könnte
sie gestohlen haben…“
„Mr. Butler“, sagte der Rancher. „Überlegen Sie sich genau,
was Sie da behaupten… Mein Neffe hat noch nie eine
unehrenhafte Handlung begangen.“
„Davon bin auch ich überzeugt“, lenkte Butler ein. „Übrigens
– es ließe sich leicht feststellen. Sie, als sein einziger
Verwandter, haben doch sicher seinen Nachlaß ausgehändigt
bekommen.“
„Allerdings“, gab Ben Cartwright zu.
„Ich würde ihn mir gern einmal ansehen“, bat Butler. „Nur
um sicherzugehen, eine Klärung liegt ja auch in Ihrem
Interesse. Dadurch könnten wir – äh – verhindern, daß der
Name Cartwright durch falsche Anschuldigungen beschmutzt
wird…“
„Hier – bitte!“ Der Rancher hatte den Besitz des Toten auf
den Tisch gelegt. Alles, was ihm der Sheriff übergeben hatte:
die Brieftasche, die goldene Uhr und die Golddollars.
Butler warf nur einen kurzen Blick darauf.
„Ist das alles?“ erkundigte er sich. „Kein Koffer? Kein
Päckchen?“
„Das ist alles, was mir der Sheriff ausgehändigt hat“,
versicherte Ben Cartwright. „Genügt Ihnen mein Wort?“
„Selbstverständlich!“ erklärte Butler. „Sehe keinen Grund,
warum Sie mich belügen sollten. Weiß, wen ich vor mir habe!“
„Vielleicht waren Ihre Geschäftsunterlagen der Grund dafür,
daß mein Neffe ermordet wurde“, vermutete der Rancher.

„Ja“, nickte Butler. „Das wäre gut möglich!“
„Vielleicht sollte man dem Sheriff einen Tip geben“, schlug
Ben Cartwright vor.
„Nicht nötig!“ winkte Butler ab. „Wir können ja nicht mit
Bestimmtheit sagen, ob Ihr Neffe im Besitz dieser Unterlagen
war. Wie gesagt, es ist nur eine Vermutung!“
„Wie Sie wollen.“ Der Rancher betrachtete die Unterredung
als beendet.
Auch Butler hatte es plötzlich eilig.
„Ich möchte Sie jetzt nicht länger aufhalten“, sagte er.
„Entschuldigen Sie noch einmal die Störung. Der Tod Ihres
Neffen ist auch mir sehr nahegegangen. Ich versichere Sie
meines Beileids!“
„Danke“, sagte Ben Cartwright, der seinem Besucher zur Tür
gefolgt war. „Es tut mir leid, daß ich Ihnen nicht helfen
konnte!“ Die Lüge ging ihm glatt über die Lippen.
„Möchte mich trotzdem bei Ihnen bedanken, daß Sie mich
angehört haben“, erklärte Butler. „Gute Nacht, Mr.
Cartwright!“ Er verließ eilig das Zimmer.
Der Rancher schloß nachdenklich die Tür…

Zwei schmieden ein Komplott
Butler ging sofort in sein Zimmer, das am anderen Ende des
Korridors lag. Er schlug ärgerlich die Tür hinter sich zu.
„Nun?“ fragte Jim Ganett, der hier auf seinen Boß gewartet
hatte.
„Nichts!“ sagte Butler.
„Du hast also nicht herausgefunden, wo die Platten sind“,
stellte Ganett enttäuscht fest. „Stimmt!“ versicherte Butler.
„Wie wär’s, wenn ich den Alten mal ausquetschen würde?“
schlug Ganett vor.
„Euer Auftrag lautet, die Druckplatten so unauffällig wie
möglich wieder herbeizuschaffen“, erinnerte ihn Butler. „Mit
dem blödsinnigen Herumballern ist jetzt Schluß! Ich wünsche
hier im Hotel weder einen neuen Mord noch eine Schlägerei!
Was wir dringend brauchen, sind die Druckplatten!“
„Wie steht es mit unserem Anteil?“ erkundigte sich Ganett.
„Ihr bekommt euer Geld“, versprach Butler. „Niemand ist
mehr daran interessiert als ich! Aber erst müssen die
Druckplatten herangeschafft werden.“
„Schon gut!“ winkte Ganett ab, „Wollte es bloß noch mal
hören! Man will schließlich wissen, woran man ist. War kein
Mißtrauen, falls du das denken solltest!“
„Hart du Jenner inzwischen gefunden?“ wollte Butler wissen.
„Nein!“ Ganett schüttelte den Kopf. „Keine Spur von ihm!
Habe die ganze Stadt nach ihm durchsucht!“
„Merkwürdig!“ wunderte sich Butler.
„Vielleicht hat er die Platten bei Will gefunden und ist damit
auf und davon“, überlegte Jim Ganett. „Könnte auf die Idee
kommen, selber ‘ne Druckerei aufzumachen.“

„Ich weiß nicht!“ Butler schien nicht daran zu glauben.
„Wäre doch möglich!“ sagte Ganett. „Möglich schon!“ gab
Butler zu. „Na also!“ Ganett lächelte befriedigt. „Jenner ist
habgierig“, stellte Butler fest. „Aber blöd ist er nicht.“
„Wieso?“ Ganett blickte ihn irritiert an. „Was willst du damit
sagen?“
„Jenner hat keine Druckerpresse, keine Farben und kein
Spezialpapier“, zählte Butler auf. „Und selbst wenn er das alles
hätte, so könnte er doch nicht damit umgehen!“
Das sah Ganett ein. „Vielleicht haben sie ihn irgendwo
eingebuchtet“, vermutete er.
„Dann kann er unmöglich die Platten bei sich gehabt haben“,
erklärte Butler.
„Wieso?“ fragte Ganett. „Das verstehe ich nicht!“
„Das sieht dir ähnlich!“ Das brutale Gesicht des Bandenchefs
verzog sich zu einem Grinsen. „Ohne mich wäret ihr alle
verraten und verkauft! Bin der einzige, der kein Stroh im Kopf
hat!“
„Halt keine langen Reden“, unterbrach ihn Ganett. „Sag mir
lieber, wieso du annimmst, daß Jenner die Druckplatten nicht
bei sich gehabt hat.“
„Wenn sie Jenner mit den Druckplatten erwischt hätten,
würden es die Zeitungen groß hinausposaunt haben“, sagte
Butler. „So einen Knüller lassen die sich nicht entgehen!“
„Also gut! Nehmen wir an, Jenner hat die Druckplatten nicht!
Wer hat sie dann?“
„Keine Ahnung!“ Butler zuckte die Achseln.
„Du gibst also zu, daß dein Verstand auch nicht ausreicht, um
die Druckplatten wieder herbeizuschaffen?“ feixte Ganett.
„Irrtum!“ widersprach Butler.
„Also?“ fragte Ganett. „Was schlägst du vor?“

„Du hältst ab sofort den Alten im Auge“, befahl Butler.
„Vielleicht hat er bei seinem Neffen doch mehr gefunden, als
er mir gegenüber zugegeben hat.“
„Das glaube ich auch“, stimmte Ganett zu.
„Sei morgen früh zeitig vor dem Hotel“, ermahnte ihn Butler.
Ganett versprach, rechtzeitig dort zu sein. Er ahnte noch
nicht, daß er einen anstrengenden Ritt vor sich hatte…

Einer paßt auf
Ben Cartwright ahnte nicht, daß er an diesem Tage einen
Beobachter hatte, der ihm ständig auf den Fersen blieb. Er war
ganz früh aufgestanden. Gleich nach dem Frühstück verließ er
das Hotel. Er begab sich zu dem Mietstall, den ihm der Sheriff
empfohlen hatte, um einen Wagen und zwei Pferde zu mieten.
Es war ein strahlender Herbstmorgen. Die Sonne schien vom
blauen, wolkenlosen Himmel.
Im Hof des Mietstalls erwartete ihn nicht nur Mr. Bixby, der
Besitzer dieses Unternehmens, sondern auch Sheriff Hollister,
der bereits alles Nötige veranlaßt hatte.
Ben Cartwright brauchte nur noch die Leihgebühr und die
Kaution zu entrichten und auf den Kutschbock zu klettern, um
loszufahren. Die Pferde standen schon angespannt vor dem
Wagen.
„Ich lasse Ihnen sofort Nachricht zukommen, wenn ich den
Mörder erwischt habe“, versprach der Sheriff.
„Achten Sie auf das Handpferd“, empfahl Mr. Bixby dem
Rancher. „Ist ein Dickschädel! Braucht ab und zu die Peitsche!
Dann geht es fromm wie ein Lamm!“
„Keine Angst!“ sagte Ben Cartwright. „Ich komme bestimmt
mit ihm zurecht!“
„Sie wurden übrigens von einem Mr. Butler gesucht“,
erinnerte sich der Sheriff. „Habe ihn ins Hotel geschickt!
Hoffe, es war Ihnen recht.“
„Ja“, nickte der Rancher. „Ich habe mit ihm gesprochen. Es
war ein Geschäftsfreund meines Neffen!“
„Ihres Neffen?“ Sheriff Hollister horchte auf. „Vielleicht
sollte ich mich einmal mit Mr. Butler unterhalten.“

„Er wird kaum etwas über den Mord aussagen können“, log
der Rancher, der vermeiden wollte, daß sich der Sheriff näher
mit Mr. Butler befaßte. „Er ist, genau wie ich, erst gestern in
Pine City eingetroffen!“
Mr. Bixby hatte einen neuen Kunden bekommen. Jim Ganett
lieh sich vor aller Augen ein Pferd, damit er später dem Wagen
folgen konnte. Niemand schöpfte Verdacht.
„Sie können gleich zum Friedhof fahren“, wandte sich Sheriff
Hollister von neuem an Ben Cartwright, der inzwischen auf
den Wagen gestiegen war. „Der Totengräber weiß Bescheid!“
„Vielen Dank!“ sagte der Rancher. „Sie haben mir sehr
geholfen! Ohne Ihre Hilfe hätte ich das alles nicht so schnell
geschafft.“ Es behagte ihm ganz und gar nicht, daß er dem
Sheriff nicht die Wahrheit sagen durfte. Deshalb wollte er
möglichst schnell fort. Er ließ die Peitsche knallen. „Hü!“
Die Pferde zogen an. Der Wagen fuhr ratternd aus dem Hof.
„Gute Fahrt!“ rief Sheriff Hollister hinter ihm her. „Kommen
Sie gut nach Hause!“
„Auf Wiedersehen!“ Ben Cartwright winkte mit der Peitsche.
Der Rancher fuhr mit dem Wagen zum Friedhof. Er achtete
nicht auf den Reiter, der ihm in gehörigem Abstand folgte. Er
trieb die Pferde zu größter Eile an.
Vor dem Friedhof ließ Ben Cartwright den Wagen halten. Die
Männer, die das Grab aufgeschaufelt hatten, halfen ihm, den
Sarg auf den Wagen zu heben. Er deckte ihn mit einer Plane
zu. Dann kehrte er nach Pine City zurück.
Er fuhr zum City Hotel. Dort bezahlte er seine Rechnung. Der
Hausdiener bekam ein Trinkgeld, nachdem er den Koffer auf
den Wagen gestellt hatte.
Das nächste Mal hielt der Rancher vor dem Haus des
Doktors. Auch dorthin war ihm Jim Ganett gefolgt und in der
Nähe des Hauses vom Pferd gestiegen.

Ben Cartwright betrat das Haus des Doktors durch die
Hintertür. Aber er kam nicht weit.
„Hände hoch!“ tönte es ihm entgegen.
Ein Revolver war drohend auf ihn gerichtet…

Heimlicher Aufbruch
Will lachte heiser auf, als er erkannte, wen er mit dem
Revolver bedrohte. Er ließ die Waffe sinken.
„Onkel Ben!“ rief er. „Jetzt bist du schon wieder vor meine
Kanone gelaufen!“
Der Neffe sah besser aus als gestern. Seine Augen blickten
wieder klar. Er hatte kein Fieber mehr, und die Wunde schien
ihm keine Schmerzen mehr zu bereiten. Ben Cartwright war
sehr froh, als er das feststellte.
„Los! Beeil dich!“ sagte er. „Draußen steht ein Wagen!“
Will schüttelte den Kopf.
„Tut mir leid, Onkel“, gestand er. „Ich muß dich leider
enttäuschen!“
„Wieso?“ Der Rancher machte ein erstauntes Gesicht.
„Weil ich nicht mitfahren werde“, erklärte der Neffe.
„So?“ wunderte sich Ben Cartwright. „Gestern warst du doch
noch einverstanden.“
„Da war ich auch noch krank“, behauptete Will. „Jetzt fühle
ich mich schon wieder besser!“
„Das freut mich“, sagte der Rancher. „Dann können wir
sofort aufbrechen!“ Er wollte das Haus durch die Hintertür
verlassen.
„Einen Moment noch, Onkel!“ Der Neffe hielt ihn zurück.
„Wir müssen uns beeilen“, mahnte Ben Cartwright.
„Hör zu, Onkel…“ sagte Will. „Dafür, daß du mir aus der
Klemme geholfen hast, bin ich dir sehr dankbar. Das kann ich
dir am besten dadurch beweisen, daß ich zwischen uns eine
möglichst große Strecke Weges lege…“
„Ich werde dich zu nichts zwingen“, erklärte der Rancher.
„Aber eines mußt du noch wissen, bevor du dich endgültig

entscheidest… Dein Freund Butler ist in der Stadt. Er hat mich
gestern abend im Hotel besucht. Wenn ich richtig informiert
bin, hat er einige seiner Leute mitgebracht.“
Der Neffe erschrak.
„Ist das wahr?“ erkundigte er sich. „Oder willst du mir nur
Angst machen?“
„Du brauchst nur im Hotel nachzufragen“, sagte Ben
Cartwright. „Der Portier wird dir gern Mr. Butlers Zim-
mernummer nennen!“
„Ich weiß, daß du mich nicht belügen würdest!“ Will dachte
angestrengt nach.
„Worüber denkst du nach?“ fragte der Rancher.
„Über meine Lage“, gestand der Neffe.
„Es gibt nur zwei Möglichkeiten“, sagte Ben Cartwright.
„So? Sei so freundlich und nenne sie mir!“
„Du kannst Mr. Butler und seine Männer bitten, dich so lange
zu schonen, bis deine Wunde verheilt ist, oder dich unter der
Plane meines Wagens verstecken“, schlug der Rancher vor.
„Du mußt dich allerdings jetzt entscheiden.“
„Wenn das so ist, dürfte die Wagenplane wohl das beste
sein“, überlegte der Neffe.
„Das finde ich auch“, stimmte Ben Cartwright zu.
Dr. Pinter hatte, wie verabredet, bereits früh am Morgen das
Haus verlassen, um nach seinen Patienten zu sehen, nachdem
er noch einmal Wills Verband erneuert hatte.
Nichts hinderte den Rancher und seinen Neffen daran, sofort
aufzubrechen.
Will trug ein Päckchen unter seiner Jacke; offensichtlich
wollte er es vor den Augen des Onkels verbergen. Ben
Cartwright vermutete, daß es dasselbe war, nach dem sich Mr.
Butler so auffällig erkundigt hatte. Natürlich ließ er davon
nichts verlauten.

Sie traten durch die Hintertür. Draußen half der Rancher
seinem Neffen hinten auf den Wagen, wo Will sofort unter der
Plane verschwand, so schnell, daß Jim Ganett, der in der Nähe
lauerte, kaum etwas bemerkte.
Dann fuhren sie eilig zur Stadt hinaus, ohne zu ahnen, daß
ihnen ein Reiter folgte…

Alarm durch ein Telegramm
Mitten auf der Strecke, in einem weiten Tal, hielt Ben
Cartwright den Wagen an, dicht neben einem Wegweiser, der
zugleich nach Osten und Westen wies.
Auf den Schildern war vermerkt, wie viele Meilen es bis Pine
City und bis Virginia City waren. Danach hatten sie genau die
Hälfte des Weges zurückgelegt. Wenn nichts dazwischenkam,
würden sie kurz vor Einbruch der Dunkelheit auf der
Ponderosa sein.
„He – Will!“ rief der Rancher. „Du kannst herauskommen
und etwas Luft schnappen! Wir machen eine kurze Rast!“
Der Neffe kam unter der Plane hervor. Er atmete tief die
frische Luft ein. Dann nahm er einen tüchtigen Schluck aus der
Feldflasche, die ihm sein Onkel reichte.
Sie konnten den Reiter nicht sehen, der ihnen bis hierher
gefolgt war. Jim Ganett hielt sich mit seinem Pferd auf der
Höhe hinter einer Baumgruppe verborgen.
Will hatte sich neben Ben Cartwright auf den Kutschbock
gesetzt und biß mit Heißhunger in ein Stück Brot.
„Heute abend bekommst du etwas Gutes zu essen“, versprach
der Rancher. „Hop Sing, unser chinesischer Koch, wird sich
selbst übertreffen. Er gibt sich immer besonders große Mühe,
wenn ein Gast auf die Ponderosa kommt!“
„Die Ponderosa!“ Will lauschte wehmütig dem Klang dieses
Wortes nach. „Wie oft hat Vater davon gesprochen!“
„Richtig!“ erinnerte sich Ben Cartwright. „Er hat uns einmal
dort besucht. Lange hat er es aber nicht ausgehalten!“
„Vater meinte, Ponderosa sei ein viel zu hübscher Name für
so eine unwirtliche und rauhe Gegend“, berichtete der Neffe.

„Stimmt!“ nickte der Rancher. „Sie war rauh und unwirtlich,
als wir uns dort ansiedelten. Und sie ist es noch immer!“
„Weißt du, was Vater über dich gesagt hat?“ Will sah seinen
Onkel fragend an. „Dir gelänge alles, was du anfaßtest. Und du
führtest es auch immer zu Ende. Leider kann man das von
Vater nicht behaupten. Er war ein Träumer, der alles anfing
und nichts zu Ende führte. Aber er war nie unglücklich…“
„Ich weiß“, sagte Ben Cartwright.
„Er war stets voller Pläne“, berichtete der Neffe. „Auch
seinen letzten konnte er nicht zu Ende führen… Er wurde beim
Goldgraben verschüttet…“
„Nach deines Vaters Tod habe ich lange nach dir gesucht“,
erklärte der Rancher. „Aber du warst wie vom Erdboden
verschwunden.“
„Ich hätte nicht bei einer fremden Familie leben können“,
gestand Will. „Dazu bin ich meinem Vater zu ähnlich. Sicher
bin ich deshalb durch die halbe Welt gereist – immer hinter
meinen Träumen her… Aber auch ich hatte keinen Erfolg, so
wenig wie Vater…“
Ben Cartwright hatte diesem Geständnis schweigend
gelauscht. Jetzt drängte er zum Aufbruch.
„Wir müssen weiter“, sagte er. „Sonst kommen wir nicht
rechtzeitig nach Hause!“
Der Neffe war damit einverstanden.
„Ehrlich gesagt, Onkel… Ich bin schon mächtig gespannt auf
die Ponderosa“, versicherte er. Dann kroch er wieder unter die
Plane.
Der Rancher knallte mit der Peitsche.
„Hü!“ rief er. „Vorwärts! Hooo!“
Quietschend und knarrend holperte der Wagen auf dem
steinigen Weg weiter.

Auf der Höhe hatte auch Jim Ganett sein Pferd wieder
bestiegen. Er brauchte den Wagen nicht länger zu beobachten.
Er wußte nun genug.
Er ritt auf dem schnellsten Wege nach Virginia City. Vor dem
Postoffice band er sein Pferd an einen Pfahl. Dann betrat er
eilig den Schalterraum.
Der Postbeamte blickte fragend auf.
„Ich möchte ein Telegramm aufgeben“, sagte Jim Ganett.
„Wohin?“ fragte der Mann hinter dem Schalter.
„Nach Pine City“, erklärte Jim Ganett. „An Mr. E. J. Butler,
zur Zeit City Hotel!“
Der Postbeamte schrieb die Adresse mit einer kratzenden
Feder auf ein Formular. Dann blickte er wieder auf.
„Wie lautet der Inhalt?“ fragte er. „Onkel Will krank, aber
lebend gefunden“, diktierte Jim Ganett…

Wieder auf der Ponderosa
Joe und Hoss spielten in der Wohnstube Dame. Die ersten
beiden Partien hatte Joe bereits gewonnen. Bei der dritten
schien sich das Glück zu wenden. Hoss gewann.
Er hatte gerade seinen zweiten Stein in das letzte Feld seines
Gegners gebracht und dafür eine Dame eingetauscht, als
draußen ein Wagen vorfuhr.
„Nanu!“ wunderte sich Joe.
„Spiel weiter!“ forderte ihn Hoss auf. „Du möchtest wohl
kneifen, was? Tu bloß nicht so, als ob du etwas gehört hättest!
Du suchst nur einen Grund, damit du nicht weiterzuspielen
brauchst!“
Joe stand entschlossen auf.
„Hör zu, Bruderherz…“ sagte er tadelnd. „Niemand kann
mich daran hindern, meinen Vater zu empfangen.“
„Das ist nicht Pa“, behauptete Hoss. „Das war eine fremde
Stimme!“
„He!“ rief Joe. „Du hast also doch etwas gehört?“
„Sieht so aus, als wäre jemand vor der Haustür“, gab Hoss zu.
„Na, dann will ich den Besucher mal begrüßen!“ Joe verließ
eilig den Raum.
Hoss seufzte gramerfüllt. Dann folgte er seinem Bruder nach
draußen. Vor dem Haus stand ein Wagen mit zwei Pferden.
Ben Cartwright kletterte gerade vom Kutschbock.
„Hallo, Pa!“ rief Joe erfreut von der Haustür.
„Hallo!“ winkte der Rancher.
Will kam unter der Plane hervorgekrochen und machte
Anstalten, vom Wagen zu steigen.
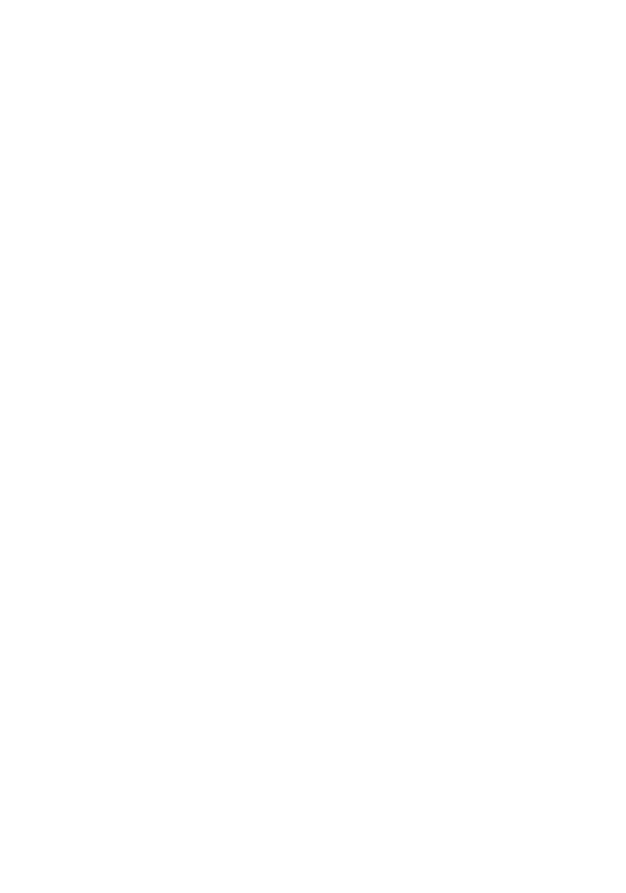
„Sei vorsichtig!“ warnte ihn Ben Cartwright. „Denke an deine
Verwundung!“
Er wollte dem Neffen vom Wagen helfen. Aber seine Söhne
waren schneller.
„Warte!“ rief Joe. „Wir helfen ihm!“
„Sekunde, Pa!“ Hoss kam hilfreich herbeigestürmt.
Sie hoben den Fremden vom Wagen. Will bedankte sich, als
er wohlbehalten auf dem Hof stand. Ben Cartwright lächelte
geheimnisvoll.
„Ich habe eine Überraschung für euch“, wandte er sich an
seine Söhne.
„So!“ Hoss bemühte sich, unbeteiligt auszusehen, obwohl er
vor Neugier zu platzen drohte.
Joe blickte erwartungsvoll auf.
Der Rancher wies auf den Neffen.
„Das ist euer Vetter, Will Cartwright“, erklärte er.
„Ja, aber…“ Hoss starrte Will mit offenem Munde an.
„Ich denke, der ist tot“, erinnerte sich Joe.
„Der Sheriff in Pine City hat sich geirrt“, berichtete Ben
Cartwright. Dann stellte er dem Neffen seine Söhne vor. „Das
ist Hoss! Und das Little Joe!“
Will schüttelte beiden die Hand.
„Willkommen auf der Ponderosa“, sagte Joe. „Ich freue mich,
daß sich der Sheriff geirrt hat.“
„Ich auch“, versicherte Hoss.
„Wir haben Hunger“, gestand der Rancher.
„Hop Sing muß geahnt haben, daß du heute abend
zurückkommst“, antwortete Hoss. „Er hat eine Menge saftige
Steaks gebraten!“
„Ihr habt wirklich Glück“, bestätigte Joe grinsend. „Es sind
noch ein paar Steaks übrig. Hoss hat nicht alle geschafft!“
„Nanu!“ rief Hoss.
„Was ist das?“ fragte Joe.

Sie hatten den Sarg auf dem Wagen entdeckt.
„Den könnt ihr vorläufig in die Scheune tragen“, erklärte Ben
Cartwright.
Joe und Hoss rührten sich nicht von der Stelle. Sie blieben
wie angewurzelt stehen.
„Worauf wartet ihr noch?“ fragte der Rancher.
„Wir möchten wissen, was darin ist“, erwiderte Joe.
„Ja“, nickte Hoss. „Du solltest uns darüber nicht im unklaren
lassen, Pa!“
„Ich werde euch später alles erklären“, versprach Ben
Cartwright.
Er kehrte seinen Söhnen den Rücken zu und betrat mit seinem
Neffen das Haus.
Joe und Hoss tauschten einen vielsagenden Blick. Dann
hoben sie den Sarg vom Wagen und trugen ihn in die Scheune.
„Verdammt schwer, was?“ wunderte sich Joe.
Hoss kratzte sich nachdenklich hinter dem Ohr.
„Möchte wirklich wissen, was darin ist.“
„Wir brauchen den Deckel nur aufzuschrauben“, schlug Joe
vor.
„Nein!“ Hoss schüttelte den Kopf. „Das können wir Pa nicht
antun!“
„Dann nicht!“ Joe verließ eilig die Scheune.
„Warte!“ rief Hoss. „Ich komme mit!“
„Was meinst du, was in dem Sarg ist?“ fragte Joe.
„Keine Ahnung“, sagte Hoss. „Aber wir werden es sicher
bald erfahren!“
Es sollte tatsächlich nicht mehr lange dauern…

Der Familienrat
„Der Tote in dem Sarg ist also Slim Jenner“, stellte Joe fest, als
sie nach dem Essen um den Kamin versammelt waren. Ben
Cartwright hatte seinen Söhnen alles berichtet.
„Eine tolle Geschichte“, gestand Hoss. „Also – wenn ich
richtig verstanden habe, willst du den Mann hier, in Virginia
City, wieder unter deinem Namen begraben?“ Er sah seinen
Vetter fragend an.
„Das war meine Absicht“, gab Will zu. „Aber euer Vater ist
dagegen…“
„Will meint, er wäre aus allem ‘raus, wenn dieser Mr. Butler
fest glaubt, daß man Will umgebracht hat“, mischte sich der
Rancher ein.
„Irrtum!“ rief Joe. „Dann steckt er nur noch tiefer drin! Unter
dem Namen Jenner müßtest du das Leben eines gesuchten
Verbrechers führen“, wandte er sich direkt an den Vetter.
„Weißt du, was das bedeutet? Ich für meine Person würde auf
ein solches Leben verzichten!“
„Ich würde mir natürlich einen neuen Namen zulegen“,
erklärte Will. „Zum Verbrecher hab’ ich nämlich kein Talent.
Das hat sich bereits gezeigt.“
„Soll das heißen, daß dieser Mr. Butler krumme Sachen
macht?“ fragte Joe.
„Aus Versehen macht man bestimmt keine falschen
Zwanzigdollarnoten“, sagte Will.
„Willst du damit sagen, er betreibe eine Falschmünzerei?“
Hoss starrte den Vetter entsetzt an.
„Hm“, sagte Will, „Mr. Butler nennt das im Wert-
papiergeschäft arbeiten.“

„Richtig!“ erinnerte sich Ben Cartwright. „Das hat er mir
gegenüber auch erklärt.“
„Junge, Junge“, staunte Hoss. „Das ist ein Ding!“
„Tja“, gestand Joe grinsend. „Wir Cartwrights sind eben
gründlich! Auch dann, wenn wir auf die schiefe Ebene
geraten!“
„Habe das eigentlich gar nicht gewollt“, erklärte Will.
„Sag mal…“ wandte sich der Rancher an seinen Neffen. „Wie
bist du überhaupt an diesen feinen Mr. Butler geraten?“
„Sehr einfach“, sagte Will. „Wenn man dringend Arbeit
sucht, nimmt man, was sich einem bietet.“
„Alles?“ fragte Joe. „Auch krumme Sachen?“
„Meinst du, er hätte mir gesagt, daß er ein Falschmünzer ist?“
Will lächelte belustigt. „Butler suchte einen Leibwächter und
bot mir dafür gutes Geld. Erst als ich es bekam, merkte ich, daß
es gar nicht so gut war. Da habe ich mich heimlich
davongemacht.“
„Und deshalb wollte er dich umlegen lassen?“ Hoss schüttelte
bekümmert den Kopf.
„Nein“, sagte Will. „So kleinlich ist Mr. Butler nicht!“
„Weshalb wollte er dich dann umbringen?“ wollte Joe wissen.
„Weil ich seine Druckplatten mitgehen hieß“, gestand Will.
„Ist das wahr?“ Hoss strahlte übers ganze Gesicht.
„Donnerwetter! Das muß eine schöne Überraschung für Mr.
Butler gewesen sein!“
„Deshalb hat er sich bei mir erkundigt, ob sich ein Päckchen
unter deinem Nachlaß befindet“, erklärte Ben Cartwright.
„So“, sagte Will, „jetzt wißt ihr alles!“ Er reckte die Arme.
„Ah – nach dem guten Essen fühlt man sich wieder wie ein
Mensch. Wenn mir jemand jetzt noch ein Rasiermesser leihen
würde, könnte ich dafür sorgen, daß ich auch wieder
menschlich aussehe!“

„Du kannst meines haben“, bot ihm Joe an. Er stand auf.
„Komm, ich gebe dir alles, was du brauchst!“
Will folgte seinem Vetter bereitwillig die Treppe hinauf in
das obere Stockwerk zu den Schlafräumen.
„Gib ihm lieber meines!“ rief Hoss hinter ihnen her. „Das ist
an einen richtigen Männerbart gewöhnt und nicht an den
weichen Flaum eines Jünglings!“
Joe beugte sich über das Treppengeländer.
„Du Angeber“, grinste er.
Hoss wartete, bis die Schritte verstummt waren.
„Ich habe das Gefühl, unser Vetter sitzt ganz schön in der
Tinte“, wandte er sich an seinen Vater. „Allerdings kann ich
nicht leugnen, daß mir Will gefällt. Nur eines stimmt mich
nachdenklich…“
„Und?“ fragte der Rancher. „Was ist das?“
„Will hat kein Wort darüber verloren, was mit den
Druckplatten geschehen soll“, erwiderte Hoss. „Ich meine, ob
er sie den Behörden aushändigen will. Ich hoffe, du wirst nicht
zulassen…“
„Natürlich nicht!“ unterbrach ihn sein Vater. „Ich habe ihn
nur deshalb heimlich hierhergebracht, weil man ihn in Pine
City gelyncht hätte…“
„An deiner Stelle hätte ich ihm auch geholfen“, gab Hoss zu.
„Wenn es wirklich Notwehr war“, sagte Ben Cartwright,
„was ich übrigens nicht bezweifle, dann kann sich Will hier
unserem Sheriff stellen.“
„Ist er damit einverstanden?“ erkundigte sich Hoss.
„Noch nicht“, sagte der Rancher. „Aber er wird seine
Meinung bestimmt noch ändern.“
„Notfalls müssen wir ihn zur Vernunft bringen“, schlug Hoss
vor. Joe kam die Treppe herab.
„Es hat den Anschein, daß wir etwas mehr für unseren Vetter
tun müssen, als ihm nur das Rasiermesser zu borgen“, sagte er.

„Wir haben gerade darüber nachgedacht, wie wir Will helfen
könnten“, berichtete Ben Cartwright.
„Hoffentlich läßt er sich überhaupt helfen“, meinte Joe,
während er wieder in einem Lehnstuhl Platz nahm.
„Stimmt!“ pflichtete ihm Hoss bei. „Seine eigenen Pläne
scheinen ihm gut zu gefallen!“
„Wir können nicht einmal sagen, ob er die Wahrheit spricht“,
stellte Joe fest. „Mit Sicherheit wissen wir nur, daß Will mit
uns verwandt ist.“
Der Rancher machte ein entschlossenes Gesicht.
„Also – ich weiß nicht, ob ich mich auf meine Men-
schenkenntnis verlassen kann. Aber ich bin fest davon
überzeugt, daß Will nicht schlecht ist. Das hat nichts damit zu
tun, daß er der Sohn meines Bruders ist oder daß er unseren
Namen trägt…“
„Pa?“ Hoss sah seinen Vater forschend an. „Glaubst du im
Ernst, daß wir ihn dazu bringen, sich freiwillig zu stellen?“
Ben Cartwright zuckte die Achseln.
„Das weiß ich nicht“, gab er zu. „Trotzdem sollten wir ihm
vertrauen. Ich…“ Er brach ab, als er in der Nähe ein leises
Räuspern hörte.
Die drei Männer am Kamin blickten erschrocken auf.
Am Fuße der Treppe, nur wenige Schritte von ihnen entfernt,
stand Will…

Das geheimnisvolle Päckchen
Will sah viel jünger aus, nachdem er sich den Bart abrasiert
hatte. Aber sein Gesicht wirkte jetzt blaß und schmal. Er
lächelte bitter.
„Ich verstehe, daß ihr euch Sorgen macht“, sagte er. „Nicht
nur um mich! Auch um euren Ruf!“ Er übergab Ben Cartwright
das Päckchen, das er die ganze Zeit in der Hand gehalten hatte.
„Vielleicht hilft euch das.“
Hoss und Joe sahen gespannt zu, wie ihr Vater zunächst den
Bindfaden und dann das Packpapier entfernte. Zum Vorschein
kamen zwei Druckplatten.
„Was ist das?“ Hoss zeigte auf zwei Löcher, die mitten durch
die Druckplatten gingen.
„Die Löcher stammen von Kugeln“, vermutete Joe.
„Erraten!“ rief Will. „Ich habe die Druckplatten
durchschossen! Um sie unbrauchbar zu machen für den Fall,
daß es mir nicht gelänge, sie den Behörden zu übergeben.“
„Du wolltest sie also den Behörden übergeben?“ stellte Ben
Cartwright fest. „Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr mich
das freut! Das heißt, eigentlich hatte ich gar nichts anderes von
dir erwartet!“
„So!“ sagte Will. „Und nun gebt mir ein Pferd, damit ich
weiterreiten kann!“
„Nicht so eilig!“ erklärte Hoss.
„Du kannst ruhig noch bleiben“, meinte Joe.
„Zumindest, bis der Sarg unter der Erde ist“, schlug der
Rancher vor.
Will starrte ihn überrascht an. „Du bist also einverstanden?“
„Womit?“ fragte Ben Cartwright.

„Daß der Tote unter meinem Namen begraben wird“, sagte
Will.
„Nein!“ Der Rancher schüttelte den Kopf. „Ich glaube nicht,
daß das richtig ist!“
„Es ist das Beste, was ich tun kann!“ verteidigte Will seinen
Plan. „Butler wird sicher hierherkommen. Aber erst, nachdem
er lange genug auf Jenner gewartet hat. Also in ein paar Tagen.
Dann findet er hier das Grab mit meinem Namen…“
„Und wenn er den Sarg öffnen läßt?“ gab Ben Cartwright zu
bedenken. „Kannst du mir sagen, was es dir hilft, wenn Butler
seinen Freund Jenner in einem Grab findet, auf dem dein Name
steht?“
„Es verschafft mir zumindest einen Vorsprung“, erklärte Will.
„Dann kann er mich nicht mehr erwischen!“
„Der findet dich überall“, behauptete der Rancher.
„Ich werde Amerika verlassen“, versprach Will. „Ich wollte
schon immer mal nach China. Die Welt ist groß.“
„Ja“, nickte Ben Cartwright. „Das stimmt!“
„Siehst du!“ Will lächelte zuversichtlich.
„Es fällt dir also leicht, deine Heimat zu verlassen?“ forschte
der Rancher. „Gibt es hier keinen Menschen für dich?“
„Was soll diese Frage?“ Will wurde unsicher.
„Ich will nur herausfinden, was für ein Mensch du wirklich
bist“, sagte Ben Cartwright.
„Das ist doch nicht schwierig.“ Will lachte heiser auf. „Ich
liebe das Meer, schätze die französische Küche und tanze gern
Fandango, wenn ich ein hübsches Girl habe. Natürlich ist das
noch nicht alles. Ich trinke gern und spiele leidenschaftlich
Karten. Zu Hause bin ich immer da, wo etwas los ist! Mit
anderen Worten: Ich bin der echte Sohn meines Vaters!“
„So? Meinst du?“ Sein Onkel war anderer Ansicht. „Hast du
vergessen, daß ich deinen Vater kannte? Er war mein Bruder.
Wir sind zusammen aufgewachsen. Später, als ich zur See fuhr,

haben wir uns immer wieder getroffen, wenn ich an Land war.
Wir haben zusammen Pläne geschmiedet und von der Zukunft
geträumt. Aber irgendwann muß ein Mann aufhören zu
träumen, er muß damit beginnen, seine Träume zu ver-
wirklichen, so wie ich! Und wie es dein Vater gemacht hätte,
wenn er nicht so bald gestorben wäre. Wann wirst du endlich
damit anfangen?“
„Vermutlich nie“, gestand Will. „Ich bin genau wie Vater!“
„Dein Vater war ein stolzer Mann“, behauptete der Rancher.
„Stolz auf seinen Namen! Er hätte niemals getan, was du
vorhast! Den Namen eines Verbrechers annehmen und damit
nach China auswandern. Das ist keine Abenteuerlust! Das ist
Feigheit!“
Will schwieg beschämt.
„Glaubst du noch immer, du wärst wie dein Vater?“ Ben
Cartwright sah seinen Neffen forschend an. „Du bist nicht wie
er! Dir fehlen sein Mut und sein Stolz!“
„Vielleicht hast du recht“, gab Will nach. „Ich möchte gern
über deine Worte nachdenken. Man soll eine wichtige
Entscheidung immer überschlafen…“
„Gut!“ nickte der Rancher. „Gehen wir zu Bett!“
Will fand lange keinen Schlaf. Die Worte seines Onkels
hatten ihn mehr getroffen, als er zugeben wollte.
Die anderen Bewohner der Ponderosa lagen schon in tiefem
Schlaf, als Will endlich die Augen zufielen. Wahrscheinlich
hätte keiner der Cartwrights so ruhig geschlafen, wenn er
geahnt hätte, daß Butler auf dem Wege zur Ranch war…

Die Entscheidung
„Ich hoffe, wir haben Will das Richtige geraten“, sagte Hoss,
nachdem er mit Joe den Sarg auf den Wagen gehoben hatte.
„Warum nicht?“ fragte Joe. „Wahrscheinlich bekommt er für
die Ablieferung der Druckplatten sogar noch ‘ne Belohnung!“
„Und was wird aus diesem Mr. Butler?“ erkundigte sich
Hoss.
„Der wird bestimmt seinen Namen ändern, wenn er erfährt,
daß Will beim Sheriff war“, vermutete Joe.
Es war noch früh am Morgen. Die Sonne war gerade
aufgegangen. Über den Hof wehte ein kalter Wind.
Wahrscheinlich würde es nicht mehr lange dauern, bis der erste
Schnee fiel.
Hoss holte die Pferde aus dem Stall und spannte sie vor den
Wagen, während Joe in den Speicher ging, um einen Sack Heu
zu holen.
Ben Cartwright trat mit Will aus dem Ranchhaus.
„Wir sind fertig, Pa“, meldete Hoss.
„Freue mich, daß du dich so entschieden hast, Will“, wandte
sich der Rancher an seinen Neffen.
„Es gibt eben noch ein paar Leute, die klüger sind als ich“,
lachte Will.
Plötzlich kamen zwei Reiter in den Hof geritten. Vor den drei
Cartwrights zügelten sie ihre Pferde.
„Hallo – Will!“ rief Mr. Butler. „Das ist eine Überraschung,
was? Du bist also von den Toten auferstanden?“
Will gab keine Antwort. Auch der Rancher und Hoss
schwiegen.

Mr. Butler hatte einen Gürtel über seinen eleganten roten
Rock geschnallt. Sein Revolver war drohend auf die drei
Männer gerichtet, genau wie die Waffe seines Begleiters.
„Keine falsche Bewegung!“ warnte er. „Mich kennen Sie ja,
nicht wahr, Mr. Cartwright? Also brauche ich Ihnen nur noch
meinen Geschäftsfreund, Mr. Ganett, vorzustellen, der mich
hierher begleitet hat. Der Mann dort oben ist nur der
Dachdecker. Außerdem habe ich noch drei Gentlemen zu
meiner persönlichen Sicherheit mitgebracht. Ich hoffe, sie
brauchen sich Ihnen nicht vorzustellen. Sind alles
Meisterschützen!“
Eine Kugel schlug dicht über Ben Cartwrights Kopf in die
Tür des Ranchhauses.
„Nur eine kleine Probe!“ lächelte Mr. Butler. „Damit Sie
nicht übermütig werden!“
„Hör zu, Butler“, sagte Will. „Du willst doch mich haben.
Also laß meinen Onkel und seinen Sohn in Ruhe!“
„Das ist nur zum Teil richtig“, erklärte Mr. Butler. „Was ich
vor allem zurückhaben möchte, sind die Druckplatten.“
„Die habe ich vergraben“, gestand Will. „Wenn du auf
meinen Vorschlag eingehst, zeige ich dir, wo!“
„Nein!“ protestierte Ben Cartwright.
Er hatte das Wort kaum ausgesprochen, als eine Kugel dicht
an seinem Kopf vorbeipfiff.
„Überleg dir’s, Butler!“ rief Will.
Plötzlich peitschte ein Schuß auf. Etwas stürzte polternd vom
Dach. Es war der Bandit, der hinter dem Schornstein der
Remise gelauert hatte, Joes Kugel hatte ihn aus der Luke des
Speichers getroffen.
Die beiden Reiter schossen sofort wie wild auf den Schützen.
Aber Joe war längst wieder hinter der dicken Mauer des
Speichers verschwunden.

Ben Cartwright und sein Sohn waren mit raschen Sprüngen
hinter einem abgestellten Wagen in Deckung gegangen.
„Will!“ schrie Hoss. „Hierher! Schnell!“
Der Vetter landete mit einem Hechtsprung neben ihm. Er
stöhnte leise auf, als die kaum verheilte Wunde wieder
aufbrach. Nicht weit von ihm entfernt fuhren ein paar Kugeln
in den Sand.
Hoss’ Hut war von einer Kugel durchbohrt worden. Aber der
Dicke hatte den Schützen bereits hinter einer Hausecke erspäht.
Sein Schuß war ein Treffer. Der Bandit stürzte zu Boden.
Jetzt hagelte es Kugeln von allen Seiten. Die Banditen
schossen pausenlos, trafen aber nicht. Die Cartwrights hatten
sich gut verschanzt.
Dann stürzte Jim Ganett mit einem Schrei aus dem Sattel. Joe
hatte im richtigen Augenblick abgedrückt und war danach
sofort wieder in Deckung gegangen.
Den nächsten Banditen erwischte Ben Cartwright. Er hatte
einen Kopf hinter dem Wassertrog auftauchen sehen. Das
genügte.
Dann war wieder Hoss an der Reihe. Einer der Banditen war
auf das Stalldach geklettert in der Hoffnung, von dort bessere
Möglichkeiten zu haben. Bevor er einmal abdrücken konnte,
hatte ihn Hoss’ Kugel bereits getroffen.
Butler, der wie wild geschossen hatte, riß sein Pferd herum.
„Halt!“ schrie Will. „Bleib stehen, Butler!“ Er war hinter dem
Wagen aufgesprungen und lief mit dem Revolver in der Hand
hinter dem Fliehenden her.
Butler drehte sich noch einmal im Sattel um und schoß – doch
zu spät. Will hatte eine Sekunde früher abgedrückt. Der
Bandenchef fiel tödlich getroffen von seinem Pferd.
Auf einmal herrschte Ruhe. Die Cartwrights kamen
aufatmend aus ihren Verstecken hervor. Sie sahen sich
forschend um. Der Hof glich einem Schlachtfeld.

Sie legten die toten Banditen auf den Rasen vor der Scheune.
Hop Sing, der in der Küche von den Schüssen überrascht
worden war, sah ängstlich zu.
„Warum habt ihr mich nicht gehen lassen?“ erkundigte sich
Will. „Sie hätten euch alle töten können.“
„Wir haben von dir verlangt, mit dem Namen Cartwright
weiterzuleben“, erklärte sein Onkel. „Also mußten wir auch
dafür sorgen, daß du deinen Entschluß ausführen konntest…“
„Außerdem wollten wir unseren Vetter nicht gleich wieder
verlieren“, gestand Hoss.
„Zumindest nicht, bevor wir ihn richtig kennengelernt
haben“, ergänzte Joe.
„So!“ sagte Ben Cartwright. „Und jetzt reiten wir zum
Sheriff!“
Die vier Männer stiegen in die Sättel. Sie ritten
nebeneinander aus dem Hof, über die Wiese, auf die Sonne zu,
die strahlend über den Wäldern im Osten aufging.
Es war der Weg nach Virginia City.
Ende
Document Outline
- Ein unerwartetes Wiedersehen
- Der Auftrag
- Freiwilliger Hoss
- Der erste Späher
- Sergeant Devlin verliert die Nerven
- Schreie in der Nacht
- Korporal Poker erzählt eine Geschichte
- Ein überraschender Befehl
- Das erste Opfer
- Nur Tote schweigen
- Die Lage wird ernst
- Ein Geheimnis wird gelüftet
- Bei Elkoro
- Auf Leben und Tod
- Der fremde Reiter
- Eine schlechte Nachricht
- Neue Rätsel
- Eine traurige Pflicht
- Auf dem Friedhof
- Ein Arzt kombiniert
- Besuch am Abend
- Zwei schmieden ein Komplott
- Einer paßt auf
- Heimlicher Aufbruch
- Alarm durch ein Telegramm
- Wieder auf der Ponderosa
- Der Familienrat
- Das geheimnisvolle Päckchen
- Die Entscheidung
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Bonanza 6 Parker, Teddy Eine heiße Spur
Bonanza 7 Parker, Teddy Gefahr für Little Joe
Bonanza 5 Parker, Teddy Einer spielt falsch
Bonanza 4 Parker, Teddy Schüsse auf der Ponderosa
Apache Cochise 15 Ritt ins Inferno
p ins tabelka, instalacje budowlane
Ins refl cz1
(wytyczne geo inĹĽ
opel vivaro ins klimatyzacyjna tyl
Ins tlum swiatl
ins obs RRTC1
Bonanza
Fiz Ins m02
INS LAB PEWN 5 12 13
INS S A3000Dv15
przyk ins bezp poz
projektowanie ins gazowej
więcej podobnych podstron