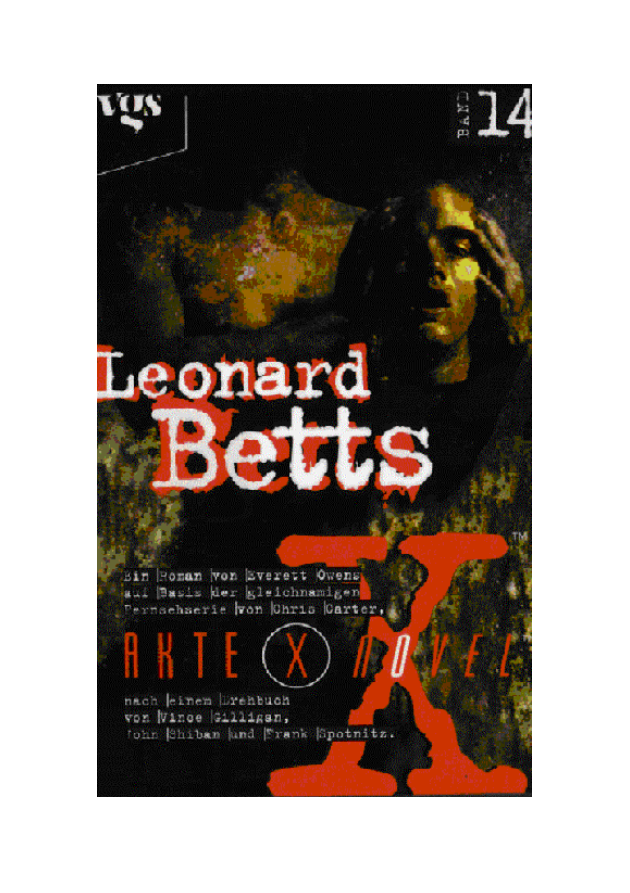

Klappentext:
Michele Wilkes ist Rettungssanitäterin, und sie liebt Ihren Job
hinter dem Lenkrad der Ambulanz. Gemeinsam mit ihrem
Kollegen Leonard Betts bildet sie ein Team, das schon mach
aussichtslosem Fall das Leben gerettet hat. Doch dann kommt
der Abend, an dem Michele einen heranrasenden
Abschleppwagen übersieht. Leonard ist auf der Stelle tot.
Als Leonards Leiche aus dem Kühlhaus des Hospitals
verschwindet, schalten sich Mulder und Scully ein. Eine
abenteuerliche Suche beginnt. Eine Suche, die sie an makabre
Orte führt und zu ungewöhnlichen Ermittlungsmethoden
greifen läßt. Eine Suche, an deren Ende sich Mulders kühne
Theorie zum Fall Betts zu bestätigen scheint, während Scully
einer furchtbaren Gewißheit ins Auge blicken muß...

Everett Owens
Leonard Betts
Roman
auf Basis der gleichnamigen Fernsehserie
von Chris Carter, nach einem Drehbuch von
Vince Gilligan, John Shiban und Frank Spotnitz
Aus dem Amerikanischen von
Thomas Ziegler
digitalisiert von Vlad

Erstveröffentlichung bei:
HarperTrophy – A Division of HarperCollins Publishers, New York
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
The X-Files – Regeneration
The X-Files™ « 1998 by Twentieth Century Fox Film Corporation
All rights reserved
Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme
Akte X Novels – die unheimlichen Fälle des FBI. – Köln : vgs
Bd. 14. Leonard Betts : Roman / Everett Owens. Aus dem Amerikan. von
Thomas Ziegler. – l. Aufl. – 1999
ISBN 3-8025-2596-5
1. Auflage 1999
© der deutschen Übersetzung
vgs Verlagsgesellschaft, Köln 1999
Coverdesign: Steve Scott Umschlaggestaltung der deutschen Ausgabe:
Papen Werbeagentur, Köln © des ProSieben-Titel-Logos mit freundlicher
Genehmigung
der ProSieben Media AG
Satz: ICS Communikations-Service GmbH, Bergisch Gladbach
Druck: Clausen & Bosse
Printed in Germany
ISBN 3-8025-2596-5
Besuchen Sie unsere Homepage im WWW:
http://www.vgs.de

5
1
Der Krankenwagen des Pittsburgh City Hospitals raste mit
flackerndem Blaulicht und schrillem Sirenengeheul den Hügel
hinauf. Die Rettungssanitäterin hinter dem Lenkrad, Michele
Wilkes, steuerte das Fahrzeug routiniert durch den dichten
Verkehr, scherte energisch nach links aus, dann wieder nach
rechts. Trotz des Lärms und der Hektik um sie herum ließ
Wilkes die Straße niemals aus den Augen – eine Ange-
wohnheit, die ihr nach all den Jahren in diesem Job zur zweiten
Natur geworden war. Sie wußte, daß sie in der Nacht von
Freitag auf Samstag besonders vorsichtig sein mußte. Wilkes
nahm das Funkmikrofon vom Halter und schaltete es ein.
„Wir sind mit einem männlichen Herzanfall unterwegs, Alter
zweiundsechzig. Geschätzte Ankunft zwölf Minuten“, meldete
sie knapp.
Die Zentrale antwortete ebenso bündig. „Verstanden, Ankunft
in zwölf. Notteam steht bereit.“
Wilkes erlaubte sich einen Blick in den Rückspiegel. „Wie
geht’s ihm, Leonard?“
Wilkes’ älterer Kollege, Leonard Betts, beugte sich im Fond
des Krankenwagens über einen männlichen Schwarzen, dessen
Herzschlag mit einem digitalen Herzmonitor überprüft wurde.
„Er steckt bis zum Arsch im Alligator“, erwiderte Betts ruhig.
Während er sprach, gab der Monitor eine Reihe von kurzen,
durchdringenden Tönen von sich. Der Patient keuchte laut und
schnappte dann nach Luft. Wilkes hörte, daß der Monitor wie
rasend piepte. „Was ist los? Hat er einen Herzstillstand?“
Betts ignorierte die Frage, riß sich das Stethoskop vom Kopf
und drückte sein Ohr an die Brust des Mannes. Zufrieden mit
dem, was er hörte, wandte er sich wieder an seine Kollegin und
gab Entwarnung: „Nein.“
Dann griff er in eine Schublade und nahm eine große

6
Subkutanspritze heraus. Er entfernte die Schutzkappe und stieß
die Spritze in die Luftröhre des Mannes – sofort pfiff Luft aus
dem Röhrchen, und die Pieptöne des Monitors wurden wieder
regelmäßig. Die Atmung des Patienten normalisierte sich.
Wilkes hörte den regelmäßigen Signalton aus dem Fond und
fragte sich, was gerade passiert war. „Was hast du gemacht?“
rief sie über ihre Schulter hinweg.
Mit geübten Bewegungen befestigte Betts die Spritze mit
einem Klebeband. Er ließ den Patienten keinen Moment aus
dem Auge. „Ich habe seine Brust aspiriert“, entgegnete er dann.
„Er hat einen Spannungspneumothorax, der auf sein Herz
drückt. Es sah nur aus wie ein Herzanfall.“
Beeindruckt schüttelte Wilkes den Kopf. Es erstaunte sie
immer wieder, daß Leonard selbst in den brenzligsten
Situationen klang, als würde er einen verstauchten Zeh
behandeln.
„Gute Arbeit“, lobte sie. „Wie bist du darauf gekommen?“
Betts starrte so durchdringend auf seinen bewußtlosen
Patienten, als könne er durch dessen Haut sehen. Schließlich
murmelte er: „Weil er an Krebs stirbt. Er zerfrißt bereits einen
Lungenflügel.“
Wilkes kannte die technische Ausstattung des
Krankenwagens genau. Keines der Geräte konnte Leonard
diese Information geliefert haben.
„Woher weißt du das, Leonard?“ fragte sie mit verwundertem
Kopfschütteln.
Doch Betts antwortete nicht; er starrte weiter auf die Brust
des Mannes. Wilkes drehte den Kopf und sah für einen
Moment nach hinten. Sie wollte wissen, wie er es jedes Mal
schaffte, im voraus die Diagnose zu stellen, die Stunden später
von den Ärzten im Krankenhaus bestätigt wurde. Und so
bemerkte sie nicht, wie die Ampel vor ihr von Grün auf Rot
sprang.

7
Keith Talent haßte diese Art Job. Eine College-Party. Die
Kids parkten auf der ganzen Länge der stillen Vorstadtstraße
Stoßstange an Stoßstange. Wahrscheinlich würden außer
seinem eigenen Abschleppwagen noch drei oder vier andere
zur Stelle sein und die Miatas und Range Rovers davonkarren,
die die Auffahrten der Nachbarn blockierten. Dies war bereits
Talents dritter Einsatz, und beim letzten Mal hatte er seine 9-
mm-Automatik ziehen und einen dreisten Halbstarken
vertreiben müssen, der um jeden Preis verhindern wollte, daß
sein Jeep abgeschleppt wurde. Immerhin kam er jetzt zügig
vorwärts. Er war diese Strecke schon so oft gefahren, daß er
die Ampelphasen im Schlaf beherrschte – bei Sechsundsechzig
Kilometern pro Stunde brauchte er nicht einmal zu bremsen.
Talent sah das Blaulicht einen Sekundenbruchteil, bevor der
Krankenwagen auf die vor ihm liegende Kreuzung schoß. Er
trat mit beiden Füßen auf das Bremspedal, doch er wußte, daß
er zu schnell war. Im letzten Moment hieb Talent auf die Hupe.
Als Wilkes die Autohupe hörte, warf sie ruckartig den Kopf
herum. Die Scheinwerfer des Abschleppwagens tauchten die
eine Hälfte ihres Gesichts in grelles Licht, und bevor sie noch
reagieren konnte, krachten die beiden Fahrzeuge aufeinander.
Die Wucht des Aufpralls zerfetzte Metall und Fleisch wie eine
Bombenexplosion. Der Krankenwagen wurde an der Seite
getroffen, rutschte in einem Schauer von Glasscherben über die
Straße und prallte schließlich gegen einen Laternenpfahl, der
halb aus seinem Sockel gerissen wurde. Der Lampenaufsatz
schwankte. Dann sackte er nach unten und erhellte die Kabine
des Abschleppwagens, in der Keith Talent bewußtlos über dem
Lenkrad hing.
Benommen stieß Wilkes die Tür des Wagens auf und
stolperte nach draußen. Von einer tiefen Stirnwunde tropfte
Blut auf ihre Uniform. Sie schwankte leicht und griff
haltsuchend nach der eingedrückten Tür des

8
Rettungsfahrzeugs.
„Leonard?“ rief sie leicht zittrig, doch sie bekam keine
Antwort. Bis auf das Hupen des Abschleppwagens war es auf
der menschenleeren Downtown-Straße still wie in einer Gruft.
Wilkes schleppte sich zum Heck des Krankenwagens und
erkannte, daß die beiden hinteren Türen sperrangelweit offen
standen. Nervös blickte sie ins Innere: Der Patient war tot;
immer noch lag er angeschnallt auf der blutbefleckten Trage,
die zur Seite geschleudert worden war. Der Herzmonitor zeigte
nur noch eine blaue Linie. Die gesamte medizinische Aus-
rüstung – Verbände, Flaschen, Pumpen, Infusionsbeutel – war
durch den Aufprall wild durcheinandergeworfen worden. Doch
ihren Partner konnte Wilkes nirgendwo finden.
„Leonard!“ schrie sie.
Sie wandte sich von dem Wrack ab und suchte die Umgebung
ab. Schließlich fiel ihr Blick auf zwei Beine, die zehn oder
zwölf Meter weiter auf dem Bürgersteig lagen. Eine Reihe von
Zeitungsständern verbargen den Körper von der Hüfte
aufwärts. Wilkes stolperte zu den Beinen, duckte sich unter
einem Kabel durch und bog mehrere Ständer zur Seite. Der
Rest des Körpers kam in Sicht.
Zumindest der Großteil davon.
Wilkes’ Magen rumorte, und sie mußte die Hand vor den
Mund schlagen, um sich nicht zu übergeben. Sie wankte, lehnte
sich an einen der Zeitungsständer und zwang sich, noch einmal
hinzusehen. Leonard Betts’ blauweiß uniformierter Körper lag
bäuchlings auf dem Boden, in einer Lache Blut, das hellrot aus
seinem Halsstumpf sprudelte.
„Oh Gott, Leonard!“ schluchzte Wilkes unkontrolliert.
Und dann sah sie ihn, nur ein paar Meter weiter, eingeklemmt
zwischen einem Autoreifen und dem Bordstein. Leonard Betts’
abgetrennter Kopf starrte sie mit offenen Augen an.
Michele Wilkes stand in der Tür der Leichenhalle des

9
Monongahela Medical Centers. Sie verfolgte, wie ein
Mitarbeiter der Nachtschicht ein Laken von der Leiche des
Patienten zog, den sie vor fünf Stunden in der Notaufnahme
hätte einliefern sollen. Doch statt auf der Intensivstation lag der
Mann jetzt auf dem rostfreien Stahl eines Kühlschubfachs in
der Leichenhalle. Routiniert schloß der Angestellte das
Schubfach und schlug die Tür zu; die Verriegelung rastete mit
einem Klicken ein, das für Wilkes etwas Endgültiges hatte.
Der schlimmste Tag in Wilkes’ Leben war fast vorüber. Die
Verwaltung des Hospitals hatte ihr gesagt, daß sie freinehmen
könne, doch nichts erschien ihr abwegiger, als in ihr leeres
Haus zurückzukehren. Lieber wollte sie so lange auf den
Beinen bleiben, bis sie so erschöpft war, daß sie vielleicht ein
paar Stunden Schlaf finden konnte.
Wilkes war in die Leichenhalle hinuntergekommen, um sich
von Leonard zu verabschieden, dem besten Partner, den eine
Rettungssanitäterin haben konnte: immer ruhig, immer
hilfsbereit, immer mit der richtigen Diagnose zur Stelle.
Leonard mußte ein Einzelgänger gewesen sein, denn in ihrer
Freizeit hatten sie nie etwas gemeinsam unternommen.
Trotzdem hatte sie ihn gemocht und sich glücklich geschätzt,
ihn zum Partner zu haben. Als sie die Halle betrat, wußte
Wilkes nicht, ob sie erleichtert oder enttäuscht sein sollte, daß
seine Leiche bereits präpariert und weggeschlossen worden
war. Sie beobachtete, wie der Angestellte zwei
Namensschildchen beschriftete und sie in die kleinen Rahmen
unter den Griffen der Schubfächer steckte. Dann wartete sie,
bis der Mann in einem angrenzenden Büro verschwunden war,
und betrat die Leichenhalle. Sie wußte, daß es dem
Angestellten wahrscheinlich nicht gefallen würde, doch diese
letzte Geste war sie Leonard schuldig.
Wilkes huschte über die glänzend weißen Bodenfliesen zu der
Reihe von Schubfächern, in denen die kürzlich Verstorbenen
aufbewahrt wurden. Dort stand der mit Filzstift geschriebene
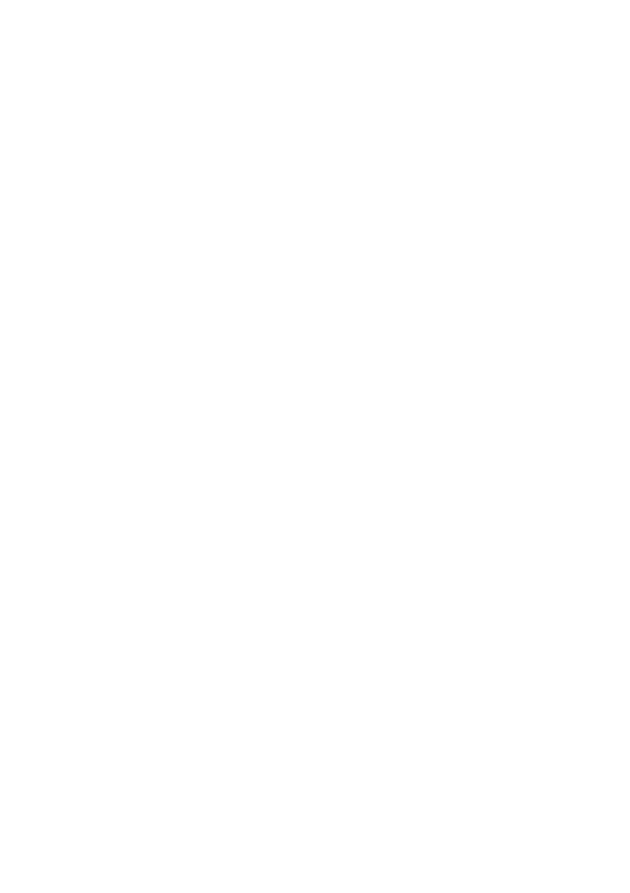
10
Name Betts, Leonard M. Sie preßte ihre Fingerkuppen gegen
die Schublade aus rostfreiem Stahl und flüsterte: „Es tut mir
leid, Leonard. Es tut mir so leid.“
Greg Jones war Medizinstudent im ersten Semester. Und im
Gegensatz zu manchen seiner Freunde nahm er seine
Ausbildung ernst – sehr ernst. Vielleicht war das der Grund,
warum er als einziger Erstsemesterstudent bereit war, den
morbidesten Praktikantenjob zu übernehmen: die Aufsicht in
der Leichenhalle. Inzwischen hatte er sich an die Witze
gewöhnt. Wenn er von der Arbeit nach Hause kam, legten
seine Zimmergenossen, die gerade erst gefrühstückt hatten,
sofort los.
„Hast du die letzte Nacht wieder die Zeit totgeschlagen?“
pflegte einer stets zu fragen und damit den Ball ins Rollen zu
bringen.
„Was sollte er auch sonst totschlagen?“ warf daraufhin ein
anderer ein. „Alle anderen in der Leichenhalle sind ja sowieso
schon tot.“
„Er hat’s leicht“, spottete ein dritter. „Ich meine, was ist das
Schlimmste, was passieren könnte? Daß einer von ihnen
wieder zum Leben erwacht?“
Jones störte es nicht; ihm gefiel sein Job. Meistens konnte er
während des Dienstes eine Menge anderen Kram erledigen,
und nirgendwo konnte er so ungestört lernen wie im Büro der
Leichenhalle. Allerdings machte ihm manchmal die Stille zu
schaffen. Deshalb nahm er auch meist seinen Walkman mit:
Ein wenig Rachmaninoff schuf die richtige Atmosphäre, wenn
er sich mit Anatomie befassen mußte.
Auch heute nacht blätterte Jones in seinem Lehrbuch und
markierte gerade eine Kapitelüberschrift, als er etwas
Ungewöhnliches hörte, ein metallisches Klirren, das die Musik
übertönte. Er drehte die Musik leiser und lauschte.
Ein Poltern.

11
Er schaltete den Walkman aus und nahm die Kopfhörer ab.
Jones setzte sich kerzengerade auf.
„Hallo?“ rief er in das Halbdunkel der Leichenhalle.
Mann, meine Zimmergenossen lachen sich tot, dachte er. Jetzt
bin ich doch noch paranoid geworden. Ich benehme mich wie
ein verängstigtes...
Ein Krachen aus der Halle ließ Jones von seinem Stuhl
auffahren. Zitternd holte er tief Luft, bevor er wieder rief:
„Hallo? Ist da jemand?“
Als er keine Antwort erhielt, machte er ein paar zögernde
Schritte und betrat vorsichtig den großen Raum. Er blieb abrupt
stehen, als er entdeckte, daß eins der Kühlschubfächer offen
stand. Es war leer. Aufgrund der Dunkelheit konnte er das
Namensschild nicht erkennen, doch er erinnerte sich an den
Namen – er hatte ihn erst vor einer Stunde auf das Schild
geschrieben: Betts, Leonard M.
Während er sich weiter in den Raum hineintastete, kam er an
einem Seziertisch vorbei. Darunter, auf dem Boden neben dem
Kühlfach, lag ein etwa volleyballgroßer Klumpen, der mit
einem weißen Laken zugedeckt war.
Jones blickte sich hastig um, bevor er sich bückte, um das
Laken wegzuziehen, das den übel zugerichteten und fast völlig
gefrorenen Kopf von Leonard Betts freigab.
Als Jones das Laken wieder senkte, spürte er, wie sich
jemand näherte. Er fuhr herum, doch er war nicht schnell
genug. Nur noch aus dem Augenwinkel registrierte er die
glänzende Stahlstange über seinem Kopf – ein Leichenhal-
lenwerkzeug, mit dem man Knochen brach –, da sauste sie
auch schon nieder.
Jones ging in die Knie. Das letzte, was er bewußt wahrnahm,
war das verzerrte Spiegelbild eines Mannes im rostfreien Stahl
der Kühl Schubfächer. Und obwohl das Spiegelbild
verschwommen war, konnte er eines deutlich erkennen: Die
Gestalt hatte keinen Kopf.

12
2
Der Mann von der Spurensicherung beugte sich über den
Boden der Leichenhalle, richtete seine Kamera auf das blutige
Laken und machte aus den verschiedensten Winkeln eine Reihe
von Fotos. Der Kopf, der vergangene Nacht unter dem Laken
gelegen hatte, war nicht mehr da. Ein weiblicher Police
Detective in Zivil lehnte an einer überdimensionalen Spüle aus
rostfreiem Stahl und befragte den Verwalter, der Greg Jones
vor sechs Monaten eingestellt hatte.
„Ein tüchtiger Arbeiter“, erklärte der Verwalter. „Ein guter
Junge.“
Die Polizistin notierte diese Aussagen aus reiner Höflichkeit.
Dies brachte sie nicht weiter. Einer ihrer uniformierten
Kollegen, der am nächsten Untersuchungstisch stand, bekam
ähnliche Antworten von einem Pfleger zu hören, der
behauptete, in der letzten Nacht nichts Ungewöhnliches
bemerkt zu haben. Die Polizistin war kaum überrascht. Das
Monongahela Medical Center war eines der ältesten
Krankenhäuser der Stadt und wurde straff geführt. Eine
verschwundene Leiche war zweifellos etwas Ungewöhnliches,
doch schließlich ging es hier nicht um die Entführung des
Lindbergh-Babys. Das einzig wirklich mysteriöse Element in
diesem Fall, dachte sie zum wiederholten Male, ist diese
rothaarige FBI-Agentin. Die Frau stöberte in dem leeren
Kühlfach herum, in dem sich der verstorbene Leonard Betts bis
etwa 3.30 Uhr befunden hatte.
Was die Polizistin nicht ahnen konnte, war, daß Special
Agent Dana Scully durchaus ähnliche Gedanken durch den
Kopf schossen, obwohl sie ihrer Pflicht mit der gewohnten
Gründlichkeit nachging. Scully drückte die rechteckige
Silbertür zur Seite und spähte in das leere Kühlfach. Mit ihrer
Stifttaschenlampe leuchtete sie das dunkle Schubfach aus und

13
bemerkte das Blut, das sich an der Stelle gesammelt hatte, wo
normalerweise der Kopf ruhte. Scully hatte schon mehr
Leichenhallenfächer geöffnet, als sie zählen konnte, doch dies
war das erste Mal, daß sie bewußt die Ausmaße wahrnahm.
Das Fach war tief – etwa zwei Meter fünfzig, schätzte sie –,
hatte aber nur eine Höhe von rund fünfundvierzig Zentimetern.
Nicht viel Bewegungsspielraum – aber natürlich brauchte ein
Toter nicht viel Platz. Die Fußabdrücke an der Innenseite der
Fachtür kamen ihr allerdings ausgesprochen merkwürdig vor.
Einer der Männer von der Spurensicherung hatte sie entdeckt,
als er die Tür mit einem roten Puder präparierte. So
unwahrscheinlich es auch erscheinen mochte, doch diese
Spuren sahen aus, als wäre die Tür des Schubfachs von innen
aufgetreten worden.
Scullys Partner, Special Agent Fox Mulder, gesellte sich zu
ihr und spähte ebenfalls in den sterilen Hohlraum.
„Gemütlich“, scherzte er. „Wer würde da wohl freiwillig
ausziehen?“
„Ich schätze, derjenige, der gestern nacht hier eingesperrt
wurde“, erwiderte Scully.
Mulder öffnete die Fallakte in seiner Hand. „Das müßte dann
Leonard Morris Betts gewesen sein, vierunddreißig. Aber
vielleicht sollte man auch erwähnen, daß Mr. Betts, als er
gestern nacht hier eingeliefert wurde, keinen Kopf mehr hatte.“
Mulder überflog die Daten. „Er wurde bei einem Unfall mit
seinem Krankenwagen verstümmelt. Arbeitete als Sanitäter im
Rettungsdienst für dieses Krankenhaus. Offenbar genoß er
hohes Ansehen; die Lokalzeitung ist voller Kondolenzen und
Nachrufe.“
Scully hörte zu, obwohl sie nicht wußte, was sie von all dem
halten sollte. Keine einzige von Mulders Informationen schien
ihr besonders interessant zu sein. „Was ist mit dem Angestell-
ten, der zu diesem Zeitpunkt Dienst hatte?“ fragte sie
gelangweilt.

14
Erneut warf Mulder einen Blick in die Akte. „Jemand hat ihn
von hinten niedergeschlagen und seine Kleidung gestohlen. Er
hat nicht gesehen, wer es war. Es wurde kein Alarm ausgelöst,
also ist niemand eingebrochen.“
Scully nickte und wartete, doch Mulder hatte nichts mehr zu
sagen. Sie zuckte die Schultern. „Und?“
„Unheimlich, was?“
Noch einmal überdachte Scully alle Fakten, doch die
Wahrheit war, daß sie nichts Unheimliches daran finden
konnte. „Mulder... was zum Teufel machen wir hier
eigentlich?“
Er lächelte. „Habe ich schon erwähnt, daß Mr. Betts keinen
Kopf mehr hatte?“
„Ja, das haben Sie“, erwiderte Scully leicht gereizt. „Und ich
hoffe, Sie wollen nicht andeuten, daß eine kopflose Leiche aus
einem verriegelten Kühlfach dieser Leichenhalle ausgebrochen
ist.“
Mulder zuckte unschuldig die Schultern.
„Wollen Sie das?“ setzte Scully mit hochgezogenen Brauen
nach. „Denn dies ist offensichtlich nur ein bizarrer
Vertuschungsversuch.“
„Was sollte denn Ihrer Meinung nach vertuscht werden?“
fragte Mulder leise.
„Ich vermute, daß es sich um gewerbsmäßigen
Leichendiebstahl handelt. An den medizinischen Fakultäten
herrscht ein Mangel an Leichen zu Studienzwecken.“
Mulder nickte, als hätte er dies bereits in Erwägung gezogen,
doch Scully ließ sich davon nicht stören und brachte ihren
Gedankengang zu Ende. „Ein skrupelloser Händler für Medi-
zinbedarf könnte Höchstpreise dafür zahlen, ohne Fragen zu
stellen.“
„Aber warum sollten die Diebe einen kopflosen Mann stehlen
und so viele vollständige Leichen zurücklassen?“
Bevor Scully antworten konnte, trat ein junger uniformierter

15
Police Officer auf Mulder zu. „Sir?“ Es war offensichtlich, daß
er das Gespräch der beiden Bundesagenten nur ungern störte.
Mulder drehte sich zu ihm um. „Es geht um die
Videoaufnahmen, die Sie angefordert haben. Ich glaube, wir
haben etwas gefunden.“
Mulder und Scully folgten dem Cop, der mit schnellen
Schritten zu einem der Untersuchungstische ging und sechs
Schwarzweißfotos im Format 8x10 ausbreitete. Die grobkörni-
gen Aufnahmen zeigten die Rückansicht eines Mannes, der
durch das menschenleere Krankenhaus schlurfte und draußen
in der Nacht verschwand.
„Die hier sind um 4.13 Uhr heute morgen von der Kamera in
der Notaufnahme gemacht worden“, erläuterte der Polizist.
Scully tippte auf das deutlichste Foto. „Das ist Ihr Übeltäter“,
sagte sie zu Mulder. „Er trägt die gestohlene Uniform.“
Ihr Partner nahm das Foto vom Tisch und betrachtete es aus
der Nähe. „Sieht so aus“, brummte er, „aber leider verraten uns
diese Fotos nicht das allermeiste.“
Irgend etwas an diesen Aufnahmen störte Mulder. Auf jedem
verbarg eine Art Nebel oder Reflexlicht den Mann und
umhüllte vor allem seinen Kopf. Der Nebel war allein auf den
Mann konzentriert und zeigte sich sonst nirgendwo auf den
Fotos.
Mulder zeigte es dem Beamten. „Was sind das für Reflexe?“
Der Cop beugte sich tiefer über die Aufnahmen. „Schlechtes
Video“, erwiderte er schließlich. „Das Überwachungssystem ist
nicht gerade das neueste Modell.“
Mulder nickte dem jungen Mann zu, doch Scully kannte diese
Geste. Sie bedeutete: „Sie irren sich, doch ich werde meine
Zeit nicht verschwenden und mit Ihnen herumstreiten.“
In diesem Moment fiel Mulder etwas ein, das nichts mit den
unscharfen Fotos zu tun hatte. „Wenn das unser Mann ist, was
hat er dann mit der gestohlenen Leiche gemacht? Er hat sie
nicht dabei.“

16
„Vielleicht hat er Angst bekommen und war gezwungen, sie
zurückzulassen“, vermutete Scully.
„Die Klinik ist gründlich durchsucht worden, Scully. Wo
hätte er die Leiche eines erwachsenen Mannes verstecken
können, ohne daß sie entdeckt wird?“
Scully dachte einige Sekunden über diese Frage nach und
erkannte dann, daß die Antwort auf der Hand lag – zumindest
für sie, die viel Zeit mit Leichen verbracht hatte.
„Ich zeige es Ihnen“, verkündete sie.
Ein paar Minuten später fand sich Mulder in einem kleinen
weißen Raum im Keller des Krankenhauses wieder und starrte
ein gelbschwarzes Warnschild an, auf dem „Gefährliches
Biomaterial – medizinische Abfälle“ stand. Ein Müllschlucker,
der wie ein riesiges Faß aussah, nahm den Großteil des
winzigen Raumes ein. Scully band sich eine blaue Kran-
kenhausschürze um und wandte sich an Mulder.
„Alle Krankenhäuser verfügen über Entsorgungssysteme für
medizinische Abfälle“, erklärte sie, klappte einen Augenschutz
nach unten und streifte schulterlange Gummihandschuhe über.
„In dieser Einheit werden OP-Abfälle beseitigt – amputierte
Gliedmaßen, entfernte Tumore. Sie werden kleingemahlen,
dann mit Mikrowellen erhitzt. Das Resultat ist sterile Asche,
die als Straßenbelag verwendet wird.“
Mulder verschränkte die Arme vor der Brust und trat
unbehaglich von einem Fuß auf den anderen. „Dann werden
wir hier wohl nichts mehr finden“, meinte er.
„Das hängt davon ab, wie oft der Abfall verarbeitet wird.
Wenn wir Glück haben, dann nur alle paar Tage einmal.“
Scully entriegelte die luftdichte Tür des Müllschluckers, die
sich leise zischend öffnete. Sie schwang die schwere Tür auf
und leuchtete mit ihrer Taschenlampe in das Innere. Das Licht
enthüllte zahllose versiegelte Plastikbeutel, von denen jeder
blutige Körperteile unterschiedlicher Größe enthielt.
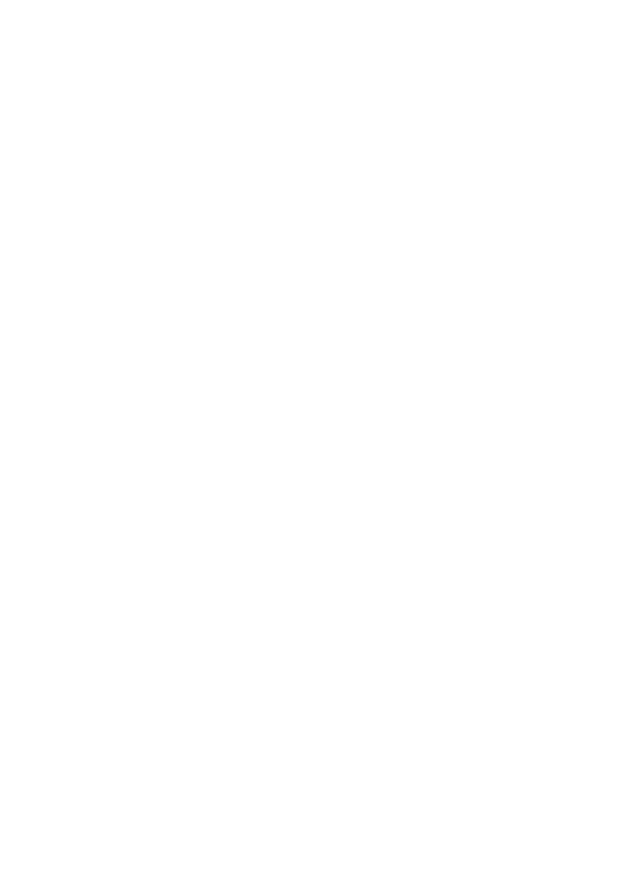
17
„Wir haben Glück“, urteilte Scully.
Diesen Ansicht konnte Mulder nicht teilen. Er verspürte nicht
die geringste Neigung, in diesen Vorhof der Hölle zu sehen,
doch schließlich siegte die Neugier. Als er einen großen Zeh zu
erkennen glaubte, schauderte er vor Abscheu. „Wie sicher sind
Sie, Scully? Absolut sicher?“
Scully biß die Zähne zusammen, griff bis zum Ellbogen
hinein und tastete suchend umher. Die schmatzenden
Geräusche, die ihre Suche verursachten, versetzten Mulders
Magen in Aufruhr. Offenbar frustriert, beugte sich Scully noch
tiefer hinein.
„Um Gottes Willen... seien Sie vorsichtig!“
Doch Scully ignorierte Mulders Mahnung und intensivierte
ihre Suche. „Ich denke, Sie werden mir helfen müssen“, befand
sie schließlich. „Ihre Arme sind länger.“
Mulder öffnete den Mund und wollte protestieren. Doch er
änderte seine Meinung, als Scully den Kopf wandte und ihn
streitlustig anfunkelte.
Wenige Minuten später trug Mulder ebenfalls
Schutzkleidung. Widerwillig trat er neben Scully vor den
offenen Müllschlucker. Nur zögernd griff er hinein und ließ
seine Hände durch den zähen Brei wandern. Mehrere Minuten
suchte er mit zusammengebissenen Zähnen, um dann plötzlich
zusammenzuzucken.
„Ich glaube, ich habe was gefunden“, meldete er. Leise
ächzend fischte er das Objekt vom Boden der Kammer.
Scully richtete ihre Taschenlampe darauf. „Leonard Betts“,
bestätigte sie, nachdem sie das Gesicht anhand der Fotos aus
der Fallakte wiedererkannt hatte.
„Zumindest sein Kopf, ergänzte Mulder, „aber wo ist sein
Körper?“ Mulder legte den Kopf beiseite und tastete zusammen
mit Scully noch einmal das Innere des Müllschluckers ab,
durchwühlte den mit Fleisch gefüllten Bottich.

18
„Er ist nicht hier unten, Scully“, stellte er dann fest und zog
seine Arme heraus. „Hier ist einfach nicht genug Platz dafür.“
Während Mulder seine Handschuhe abstreifte, setzte Scully
die Suche fort. Nachdenklich biß er sich auf die Lippen.
„Scully... was ist, wenn er den Körper gar nicht versteckt hat?
Was ist, wenn es ihm irgendwie gelungen ist, ihn aus dem
Krankenhaus zu schaffen?“
„Aber warum hat er sich dann die Zeit genommen, den Kopf
hier unten zu deponieren?“
Mulder schlüpfte aus seiner Laborschürze. „Vielleicht finden
Sie die Antwort dort...“ Er wies auf den zerschundenen Kopf,
der auf einem Stoß von Körperteilen lag. „Ich schlage vor, Sie
untersuchen ihn.“
Ohne mit ihrer gründlichen Inspektion des Müllbehälters
innezuhalten, bedachte Scully ihren Partner mit einem wenig
erfreuten Schulterblick. „Wir wissen bereits, wie er gestorben
ist – bei einem Autounfall. Was soll dabei herauskommen?“
„Vielleicht nichts“, räumte Mulder ein. „Aber er ist alles, was
wir im Moment haben. Also... warum suchen wir uns nicht
einen ruhigen Ort, wo Sie Leonard Betts’ Kopf unter die Lupe
nehmen können?“
Scully wandte sich endgültig zu Mulder um. Ihm war
anzusehen, daß er es kaum erwarten konnte, diesen Raum zu
verlassen. „Und was werden Sie in der Zwischenzeit tun?“
„Ich sehe mir Betts’ Wohnung an. Wir wissen, wie er
gestorben ist. Ich will auch wissen, wie er lebt.“
„Gelebt hat“, korrigierte Scully.
„Gelebt hat“, wiederholte Mulder langsam.

19
3
Die Digitalanzeige der Laborwaage flackerte und zeigte
schließlich das Gewicht an. Scully hob Leonard Betts’ Kopf
von der Schale und legte ihn auf den Autopsietisch. Dann
schaltete sie das Diktiergerät ein und begann mit ihrem Bericht.
Das Mikrofon nahm sowohl Scullys Stimme als auch das leise
Klirren von Stahl auf, als sie ihre Instrumente auf dem Tisch
ordnete.
„Fall Nummer 2268-97, Leonard Betts“, sagte Scully
ausdruckslos. „Da die Überreste unvollständig sind, bezieht
sich die Untersuchung allein auf einen abgetrennten Kopf.
Gewicht: Elf Pfund, sechsundfünfzig Gramm.“
Scully nahm eine visuelle Untersuchung des Kopfes vor und
drehte ihn in ihren Händen, die von Latexhandschuhen
geschützt wurden. „Die Überreste zeigen keine Anzeichen von
Rigor mortis oder Nekrose.“ Sie zog die Augenlider hoch. „Die
Corneae scheinen auch nicht getrübt zu sein. Dies scheint nicht
zum beglaubigten Zeitpunkt des Todes zu passen, der jetzt“ –
Scully warf einen Blick auf die Uhr an der Laborwand – „jetzt
neunzehn Stunden zurückliegt.“
Scully dachte über das Phänomen nach. Sie hatte von Fällen
gelesen, bei denen die Leichen der Verstorbenen noch Tage
nach ihrem Tod erstaunlich gut erhalten waren, allerdings hatte
es sich dabei um Fälle von Mumifizierungen unter speziellen
klimatischen Bedingungen gehandelt. Vorerst hatte sie keine
plausible Erklärung dafür, daß dieser Kopf so... Scully suchte
nach dem passenden Adjektiv... daß dieser Kopf so gut aussah.
Sie griff nach einem Skalpell und diktierte: „Ich werde jetzt mit
dem intermastoiden Einschnitt beginnen.“
Routiniert setzte Scully die Spitze des Skalpells hinter
Leonard Betts’ rechtem Ohr an, doch als die Klinge die kalte
Haut berührte, riß Leonard Betts die Augen auf.

20
Scully sprang zurück, schnappte nach Luft und ließ das
Skalpell fallen, das klirrend gegen ein in den Boden
eingelassenen Abfluß schepperte. Sie preßte ihre Hand gegen
die Brust und atmete tief durch, um ihren rasenden Herzschlag
zu beruhigen. Entsetzt starrte sie den Kopf auf dem Tisch an.
Er stierte mit weit aufgerissenen Augen und ohne jede Regung
zurück.
Nichts.
Scully wußte, daß sie sich das nicht nur eingebildet hatte.
Betts’ Augen fixierten sie weiter. Als sie einen Schritt nach
vorn trat und ihren Mut sammelte, um mit der Autopsie
fortzufahren, öffnete Betts den Mund. Zunächst war die
Bewegung kaum wahrnehmbar, doch dann legten sich die
Lippen wieder aufeinander.
Fassungslos verfolgte Scully, wie sich auch Leonard Betts’
Augen langsam wieder schlossen.
Der Verwalter des kleinen Komplexes, in dem Leonard Betts
gewohnt hatte, forderte Agent Mulder auf, ihm eine
Treppenflucht hinaufzufolgen. Er erzählte Mulder dieselbe
Geschichte, die er dem Police Officer schon am Telefon mit-
geteilt hatte: Daß Betts ein ruhiger Mieter gewesen war, seine
Miete stets pünktlich bezahlt hatte und daß er sich wünschte,
mehr Mieter wie ihn zu haben.
Vor einer Tür im zweiten Stock blieb er stehen.
„Die hier?“ fragte Mulder.
Der Verwalter brummte zustimmend und nahm einen
Schlüssel von einem Bund an seinem Gürtel.
Die gedämpften Stimmen der Männer, gefolgt vom Klicken
eines Schlüssels im Schloß, waren deutlich hörbar – auch für
die Gestalt, die sich in den Schatten des dunklen Apartments
verbarg. Bevor die Tür geöffnet wurde, huschte sie lautlos
durch das Wohnzimmer und verschwand im Bad.

21
Einen Moment später betrat Agent Mulder das Apartment,
erleichtert, daß der Verwalter nicht darauf bestanden hatte, ihn
zu begleiten.
„Danke“, sagte er zu dem älteren Mann, der nickte und zum
Treppenhaus zurückschlurfte.
Mulder schaltete das Licht ein und schloß die Tür, bevor er
sich umsah. Leonard Betts’ kleines Apartment war nicht gerade
luxuriös zu nennen. Das bunt zusammengewürfelte Mobiliar –
ein Bett, ein Tisch und drei Stühle – gehörte zu der Sorte, die
man auf Flohmärkten oder in Second-Hand-Läden für zehn
Dollar das Stück kaufen konnte. Mit viel Wohlwollen hätte
man die Einrichtung spartanisch nennen können, wären nicht
die Bücherregale gewesen, die eine ganze Wand des
Apartments einnahmen. In den Regalen standen hauptsächlich
gebundene medizinische Fachbücher. Mulder fuhr mit den
Fingern über einige der Buchrücken, durchquerte dann den
Wohnbereich und betrat die Küche. Auf der Anrichte, die die
beiden Räume teilte, lag ein kleiner umrandeter
Zeitungsausschnitt. Mulder nahm ihn in die Hand. Die
Schlagzeile lautete: „Betts zum Rettungssanitäter des Jahres
gewählt.“ Zum Artikel gehörte ein Foto, das einen ernsten
Leonard Betts mit Kittel und Krawatte zeigte. Mulder legte den
Ausschnitt wieder zurück und ging durch die Küche ins Bad.
Er knipste das Licht an – und blieb wie angewurzelt stehen.
Die Badewanne war mit einer trüben, rötlichbraunen
Flüssigkeit gefüllt. Zuerst hielt Mulder sie für Blut, dann aber
bemerkte er Spuren der Flüssigkeit auf dem gefliesten Boden
und konnte erkennen, daß sie dünner als Blut und leicht
teefarben war. Mulders Augen folgten den Tropfspuren. Sie
führten vom Badezimmerboden auf den Toilettensitz und von
da auf die Bank eines offenen Fensters. Neben der Wanne lag
ein Häuflein fleckiger Kleidungsstücke auf dem Boden. Er
wußte, wo er sie schon einmal gesehen hatte.
Mulder trat ans Fenster. Die Gazevorhänge wiesen ebenfalls

22
bräunliche Flecke auf. Er blickte nach draußen und suchte die
umzäunten Hinterhöfe der Nachbarhäuser ab. Hunde bellten,
und er fragte sich, ob er denjenigen, der die Spuren hinterlassen
hatte, knapp verpaßt hatte.
Mulder wandte sich vom Fenster ab und kniete neben der
Wanne nieder. Zögernd tauchte er einen Finger in die
Flüssigkeit, rieb sie zwischen den Fingern und roch daran. Er
glaubte, den Geruch zu kennen. Dann beugte er sich nach vorn
und öffnete das Schränkchen unter dem Waschbecken. Im
Inneren entdeckte er mehrere Literflaschen antiseptischer
Povidon-Jod-Lösung.
Während Mulder noch überlegte, warum die Badewanne
voller Jod-Lösung war, klingelte sein Handy.
„Hallo“, meldete er sich abwesend und sah zum offenen
Fenster hinüber.
Am anderen Ende der Leitung marschierte Scully im
Pathologie-Labor des Monongahela Hospitals nervös auf und
ab.
„Ich bin’s“, sagte sie hastig, als Mulder abnahm. „Ich habe
hier etwas Seltsames entdeckt.“
„Und was?“
„Ich habe eine Computertomographie von Leonard Betts’
Überresten gemacht – insgesamt viermal. Jedesmal war das
Bild unbrauchbar. Als wäre es von einem Schleier überzogen.“
„Wie bei den Überwachungsfotos“, bemerkte Mulder.
„Ja, aber das Gerät ist ein Spitzenprodukt und arbeitet laut
den Technikern einwandfrei.“ Scully seufzte – diese Resultate
waren einfach frustrierend. „Sie meinen, nur eine Art Strahlung
könnte die Bildverzerrung erklären, obwohl ich mir nicht
vorstellen kann, woher die Strahlung kommen soll.“
Geduldig wartete Scully auf Mulders Antwort. Sie wußte, daß
er diese neue Information erst einmal verdauen mußte.
„Was haben Ihre anderen Untersuchungen ergeben?“ fragte er

23
schließlich.
Scully senkte den Blick. Sie war froh, daß Mulder ihren
verlegenen Gesichtsausdruck nicht sehen konnte.
„Ich, äh, bin noch nicht dazu gekommen.“
„Warum nicht?“ fragte Mulder. Er klang neugierig, nicht
vorwurfsvoll.
„Ich habe...“ Scully zwang sich, tief Luft zu holen und noch
einmal von vorn zu beginnen. „Ich habe eine extrem
ungewöhnliche postmortale galvanische Reaktion beobachtet.“
„Der Kopf hat sich bewegt“, übersetzte Mulder sofort, und
Scully wußte nicht, ob sie verärgert oder dankbar sein sollte,
daß er nicht überrascht klang.
„Er...“ – Scully schüttelte den Kopf, als könne sie nicht
glauben, daß diese Worte tatsächlich aus ihrem Mund kamen –
„... hat mir zugeblinzelt.“
Sie nahm ihre unruhige Wanderung wieder auf und
schwächte ihre Bemerkung sofort ab. „Ich meine, es war nur
eine galvanische Reaktion – eine elektrische Restspannung, die
chemisch in den toten Zellen gespeichert war. Aber, äh...“
„Hat er geblinzelt oder Ihnen zugezwinkert?“
Scully malte sich das verschmitzte Grinsen auf dem Gesicht
ihres Partners aus. Als Mulder seine Sticheleien fortsetzte,
runzelte sie verärgert die Stirn.
„Sie wollen doch nicht etwa behaupten, daß er lebt, oder,
Scully?“
Scully atmete hörbar in ihr Handy. „Nein, Mulder. Das will
ich keineswegs behaupten.“
„Oder ist Ihnen vielleicht auch der Gedanke gekommen, daß
er noch nicht ganz tot ist?“
„Wie meinen Sie das?“
„Ich bin in Leonard Betts’ Apartment. Die Kleidung, die die
Person auf diesen Überwachungsfotos trug, liegt hier auf dem
Boden, Scully. Und es sieht so aus, als hätte es sich derjenige,
der sie getragen hat, hier gemütlich gemacht.“

24
Noch einmal ging Mulder suchend durchs Wohnzimmer und
kehrte dann wieder ins Bad zurück, bevor er schloß: „Vielleicht
ist er zu Hause gewesen.“
Scully starrte ausdruckslos ins Leere. „Leonard Betts?“ fragte
sie gedehnt. „Ohne seinen Kopf?“
Tausend schlechte Pointen kamen ihr in den Sinn, doch
plötzlich hatte sie den beunruhigenden Verdacht, daß ihr
Partner sie gar nicht aufzog – daß er es ernst meinte. „Mulder,
ich weiß nicht einmal, was ich dazu sagen soll.“
Mulder zuckte die Achseln. Er wußte selbst, wie es klang.
„Vorsichtshalber“, erklärte er, „werde ich die Ortspolizei
bitten, das Haus zu überwachen. Wer auch immer hier war,
könnte zurückkehren. Ich melde mich wieder.“ Er beendete das
Gespräch und steckte sein Handy in die Tasche. Dann verließ
er den Raum und ließ die Badezimmertür mit einem Knall ins
Schloß fallen. Durch die Erschütterung kräuselte sich die
dunkle Flüssigkeit in der Wanne.
Momente später stieg eine Blase an die Oberfläche. Dann
zwei Blasen. Dann drei.
Irgend etwas bewegte sich in der Jod-Lösung und schlug
Wellen. Schließlich tauchte ein fischbauchweißer Kopf auf,
und das Gesicht eines Mannes wurde sichtbar – das Gesicht
von Leonard Betts.
Doch seine Züge waren merkwürdig deformiert. Die Ohren
lagen flach am Kopf, die Nase hob sich kaum vom Rest des
Gesichts ab. Die Haut war wächsern, der Mund lippenlos, und
die Augenbrauen fehlten. Die Augen selbst waren winzig –
aber als er die Lider öffnete, bewegten sich seine Pupillen
blitzartig hin und her und nahmen ihre Umgebung wachsam in
sich auf.

25
4
Michele Wilkes wurde für zwei Wochen krankgeschrieben
und nach Hause geschickt, um sich von den Verletzungen zu
erholen, die sie sich beim Unfall zugezogen hatte. Einen Tag
lang hielt sie es aus, daheim herumzusitzen und vor sich hin zu
grübeln, dann rief sie an und gab Bescheid, daß sie am
nächsten Morgen wieder zur Arbeit erscheinen würde. Ihr
Gesicht war um die Augen und am rechten Wangenknochen
noch immer bläulich verfärbt. Ein Schmetterlingsverband
bedeckte die Wunde an ihrer Stirn.
Im Pausenraum des Krankenhauses hatte sie sich einen
Styroporbecher mit Kaffee gefüllt und passierte gerade die
äußere Doppeltür der Notaufnahme, als sie hörte, wie ihre
Name gerufen wurde.
„Michele?“
Die Stimme ließ Wilkes zusammenfahren. Sie war noch
immer ein wenig schreckhaft. Ein gutaussehender Mann in
einem langen dunklen Trenchcoat kam auf sie zu, klappte seine
Brieftasche auf und zeigte ihr seine Dienstmarke.
„Michele Wilkes?“
„Ja?“ Während sie in ihren Krankenwagen kletterte, warf
Wilkes einen neugierigen Blick auf das Foto neben der Marke.
„Ich bin Special Agent Mulder vom FBI. Sie waren Leonard
Betts’ Partnerin?“ Wilkes’ Gesichtsausdruck verriet Mulder,
wie verstört sie war. Mit sanfter Stimme sprach er weiter.
„Man hat mir gesagt, daß Sie heute wieder Ihren Dienst
angetreten haben.“
Wilkes nickte und rang sich ein mattes Lächeln ab. „Ja. Ich
dachte mir, es wäre das Beste, sofort wieder aufs Pferd zu
steigen“, erklärte sie.
Mulder erwiderte das Lächeln. Er wußte, daß die Befragung
für sie nicht leicht sein würde, doch sie hatte Informationen,

26
die er dringend benötigte. „Laut den Akten sind Sie für die
Bestattung von Leonard Betts’ sterblichen Überresten
verantwortlich.“
Erneut nickte Wilkes. „Er hatte keine Familie – auch keine
Freunde, soweit ich weiß.“
„Abgesehen von?“
Wilkes dachte ein paar Sekunden über die Frage nach. Ihre
eigene Antwort machte sie traurig. „Ich mochte ihn, aber
eigentlich war ich nicht seine Freundin. Er ließ niemanden an
sich heran.“ Für einen Moment wandte Wilkes die Augen ab
und erhaschte einen Blick auf ihr Bild im Rückspiegel des
Krankenwagens. Die Blutergüsse erinnerten sie wieder an den
Unfall. „Ich bin mir nicht sicher, ob man mich überhaupt seine
Partnerin nennen könnte. Die meiste Zeit habe ich bloß
versucht, ihm nicht im Weg zu stehen.“
Die Bemerkung kam Mulder seltsam vor – nicht unbedingt
die Worte, aber das Unbehagen, mit dem sie sie aussprach.
„Warum das?“
„Er hat mich nicht gebraucht“, sagte sie ohne Bitterkeit. „Im
Grunde hat er niemanden gebraucht. Leonard war ein äußerst
begabter Rettungssanitäter. Er konnte Krankheiten besser
diagnostizieren als jeder Arzt, den ich kenne. Sie wissen doch,
daß man von manchen Menschen sagt, daß sie einen nur
ansehen müssen, um zu erkennen, was einem fehlt, oder?“
„Hmmm.“
„Leonard konnte das. Vor allem bei Krebs. Ich habe ihm
immer gesagt, er hätte Onkologe werden sollen. Er hat sogar
freiwillig Wochenenddienst auf der Krebsstation gemacht. Den
Patienten vorgelesen und so weiter.“
Diese Neuigkeit erregte Mulders Aufmerksamkeit. Er prägte
sich die Information ein und setzte die Befragung fort. „Gibt es
sonst noch etwas über ihn zu berichten? Irgend etwas
Ungewöhnliches?“
„Nein“, erwiderte Wilkes kopfschüttelnd. Sie dachte kurz

27
nach und fügte dann hinzu: „Doch. Er ist nie krank gewesen.
Das war ziemlich ungewöhnlich. Ich meine, wenn man unseren
Beruf bedenkt. Er war die Gesundheit in Person.“
„Wurde er im Dienst je verletzt?“ hakte Mulder nach.
„Nein. Niemals. Ich meine, bis...“ Wilkes’ Stimme versagte,
und Mulder nickte eilig.
„Ja, ich weiß“, murmelte er mitfühlend.
Wilkes fing sich wieder und ließ ihren Blick forschend über
Mulder gleiten. „Verzeihen Sie... ich verstehe wirklich nicht,
was das alles mit dem Diebstahl von Leonards Leiche zu tun
hat. Ich meine, es klingt fast so, als hätten sie Leonard in
Verdacht.“
Mulder bedachte sie mit einem nervösen Blick, der im
krassen Widerspruch zu seinem ungezwungenen Lachen stand.
„Nein, nein. Sie waren mir eine große Hilfe“, erklärte er
gestikulierend. „Danke, daß Sie mir Ihre Zeit geopfert haben.“
Mit diesen Worten machte der Agent auf der Achse kehrt und
ging davon. Und Michele Wilkes konnte ihm nur nachsehen
und sich fragen, was das nun wieder zu bedeuten hatte.
Im Krankenhaus verfolgte Scully, wie Leonard Betts’
abgetrennter Kopf aus einem trommelgroßen Stahlbottich
auftauchte, der mit einer dicken, sirupartigen Flüssigkeit gefüllt
war. Dampf stieg aus dem Bottich auf, während eine über dem
Tank angebrachte elektrische Winde das abgetrennte Haupt in
die Höhe hievte. Der Kopf war jetzt mit einer Schicht aus einer
Art durchsichtigem Plastik überzogen.
Scully hatte den ganzen Morgen im Pathologie-Labor des
Monongahela Hospitals mit der Vorbereitung dieser Prozedur
verbracht. Sie hatte eigentlich nicht damit gerechnet, daß Mul-
der auftauchen würde, doch sie und der Pathologe des
Krankenhauses – ein humorloser Mann – hatten kaum mit dem
Test begonnen, als ihr Partner erschienen war. Gemeinsam
musterten sie den tropfenden Kopf.

28
„Werden hier auch die Donuts glasiert?“ fragte Mulder.
Scully ignorierte die Bemerkung und erklärte ihre weitere
Vorgehensweise. „Diese Prozedur wird Biopolymerisation
genannt. Es handelt sich im Grunde um einen High-Tech-
Mumifizierungsprozeß. Die Überreste werden in Kunstharz
getaucht. Sobald der Harz hart geworden ist, kann die Probe in
Scheiben geschnitten und untersucht werden.“
„Oder man kann sie als Briefbeschwerer benutzen...“
Scully warf ihrem Partner einen Seitenblick zu und seufzte.
„Jedenfalls sollte ich in Kürze ein paar Autopsie-Ergebnisse für
Sie haben.“
Schließlich präsentierten sie und der Pathologe die Probe, die
sie untersuchen wollten: einen Querschnitt durch Leonard
Betts’ Kopf, hauchfein geschnitten. Der Pathologe hielt die in
Glas gerahmte Probe hoch – in Mulders Augen erinnerte sie
beunruhigend an ein schädelförmiges Stück Frühstücksfleisch.
„Ich beginne mit einem Querschnitt des Vorderhirns Ihres
Mr. Betts“, erläuterte der Pathologe, „genauer gesagt des
vorderen Stirnlappens.“
Während er sprach, plazierte er die Probe unter einem großen
stereoskopischen Mikroskop und beugte sich über das Okular.
Er drehte am Schärferegler und zog verwirrt die Brauen hoch.
„Nun, das ist wirklich seltsam“, murmelte er.
„Was?“ fragte Scully alarmiert.
„Ist mit dem Bild etwas nicht in Ordnung?“ wollte Mulder
wissen.
„In gewissem Sinne, ja“, bestätigte der Pathologe. „Hier,
sehen Sie selbst.“ Er schaltete einen Videomonitor ein, der an
das Mikroskop angeschlossen war. Mulder und Scully lehnten
sich nach vorn, als das Bild der vergrößerten Probe sichtbar
wurde. Mulder konnte wenig damit anfangen – er sah lediglich
eine Ansammlung purpurn eingefärbter Zellen, die an
Hüttenkäse erinnerte. Scully verriet das Bild wesentlich mehr.
„Oh, mein Gott“, stieß sie verblüfft hervor. „Sein ganzes

29
Gehirn sieht wie ein einziges riesiges Gliom aus.“
Das war ein Wort, das Mulder kannte. „Er hatte Krebs?“
fragte er überrascht.
„Er war davon förmlich durchsetzt“, erwiderte Scully. „Jede
Zelle dieser Probe, im Grunde jede Zelle in seinem Kopf und
Gehirn, alle scheinen kanzerös zu sein. Der Krebs hat alles
durchdrungen.“
Für Mulder ergab das keinen Sinn. „Könnte jemand in diesem
Zustand am Leben bleiben?“
„Am Leben bleiben?“ schnaubte der Pathologe. „Dieser
Zustand ist meines Wissens nach nicht einmal möglich. Dieser
Mann wäre längst tot gewesen, bevor er einen derart extremen
metastasischen Zustand erreicht hätte.“
„Und wie erklären Sie sich dann das Ergebnis?“
Der Pathologe hob die Schultern. „Vielleicht hat der
Polymerisierungsprozeß die Probe irgendwie verfälscht.“ Er
blickte wieder durch das Mikroskop. „Vielleicht sehen wir gar
nicht das, was wir zu sehen glauben.“
Mulder nagte an seinem Daumen und starrte auf den
Videoschirm. „Oder vielleicht“, spekulierte er, „sehen wir es
zum ersten Mal deutlich.“
„Was wollen Sie damit andeuten?“ fragte Scully.
Mulder grinste und zog die Brauen hoch. Er wies auf die
Querschnittprobe. „Daß diese Probe die Wahrheit sagt.“
Michele Wilkes blinkte und bog links in die Straße ein, die
zum Parkplatz des Krankenhauses führte. Für den
Rettungsdienst war es ein hektischer Tag gewesen; ständig
hatten die Zentrale und die Einsatzwagen über Funk Meldun-
gen ausgetauscht. Aus dem Lautsprecher drang die Stimme
eines Fahrers, den Wilkes kannte, und sie hörte zu.
„Monongahela, 136 hier, unterwegs mit männlichem
Patienten, Alter zwanzig. Keine sichtbaren Verletzungen.
Atemstillstand. Keine Reaktion auf CPR. Bitte um Rat.“

30
Unwillkürlich mußte Wilkes daran denken, daß Leonard mit
Sicherheit gewußt hätte, was zu tun war.
Der Operator in der Zentrale machte dem Fahrer einen
Vorschlag. „Einssechsunddreißig. Vergewissern Sie sich, daß
seine Luftröhre nicht blockiert ist.“
Das Standardverfahren,
dachte Wilkes. Jeder
Rettungssanitäter, der etwas von seinem Beruf verstand, hätte
dies als erstes überprüft.
Während sie den Krankenwagen direkt vor die Tür zur
Notaufnahme steuerte, lauschte sie weiter den Stimmen aus
dem Funkgerät. Ihr neuer Partner saß im Fond und kümmerte
sich um einen dreißig Jahre alten Feuerwehrmann, der sich eine
Rauchvergiftung zugezogen hatte. Wilkes hielt den Wagen an,
während ihr Kollege die Entladung des Patienten vorbereitete.
Als Wilkes den Schlüssel aus dem Zündschloß zog, drang
wieder die Stimme des ratlosen Fahrers aus dem Funkgerät.
„Luftröhre ist frei“, meldete er. „Patient reagiert nicht. Puls ist
schwach.“
Wilkes betete im stillen für die Rettungssanitäter und ihren
Patienten – im selben Moment kam eine vertraute Stimme aus
dem Lautsprecher und ließ sie regungslos verharren.
„Wagen 208 an Zentrale. Betrifft Anfrage von Einheit 136.“
Wilkes zögerte. Sie beugte sich nach vorn und drehte die
Lautstärke auf.
Das war unmöglich.
Die Stimme fuhr fort: „Eins-sechsunddreißig, hier ist
Allegheny Catholic 208. Ich weiß, daß ihr bis zum Arsch im
Alligator steckt, aber es klingt, als hätte euer Patient einen
anaphylaktischen Schock erlitten.“
Wilkes konnte es nicht fassen. Es war Leonard.
„Überprüft es“, hörte sie die Stimme – Leonards Stimme –
sagen, „und gebt ihm nullkommadrei Milliliter Epinephrin.“
Nach ein paar Momenten bestätigte Wagen 136 Betts’
Diagnose und bat dann um eine Wiederholung der
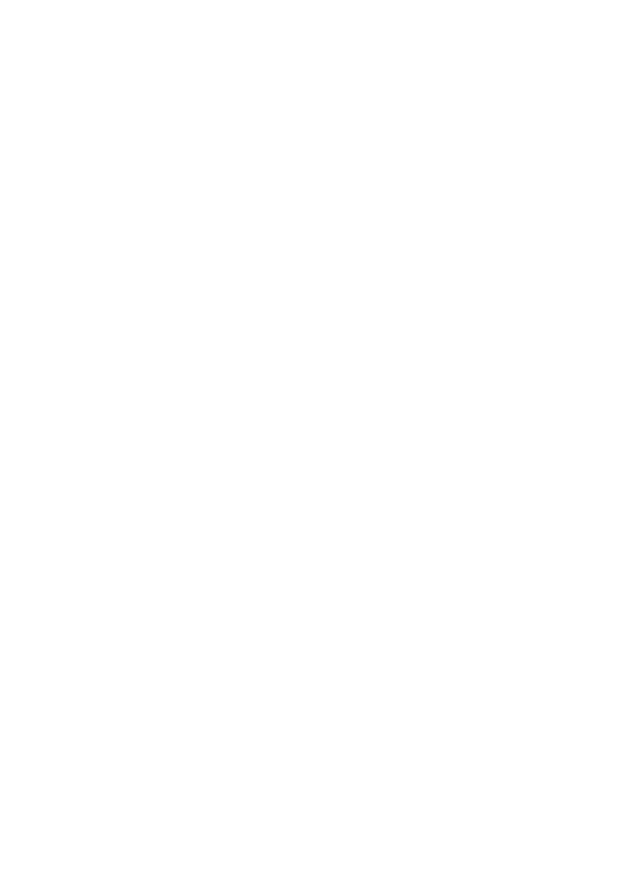
31
empfohlenen Behandlung.
„Das kann nicht sein...“, flüsterte Wilkes. „Leonard?“
Hinter ihr im Krankenwagen zog Wilkes’ neuer Partner die
Trage mit dem Patienten aus dem Fahrzeug. Er bemerkte, daß
Wilkes wie angewurzelt hinter dem Lenkrad saß.
„Michele!“ fauchte er. „Helfen Sie mir gefälligst!“
Wilkes riß sich zusammen und sprang aus dem Wagen, doch
sie ließ die Tür offen und lauschte weiter der gespenstischen
Stimme ihres ehemaligen Partners. Beunruhigt fragte sie sich,
ob dies die ersten Symptome einer Demenz waren.
Leonard würde es wahrscheinlich wissen.
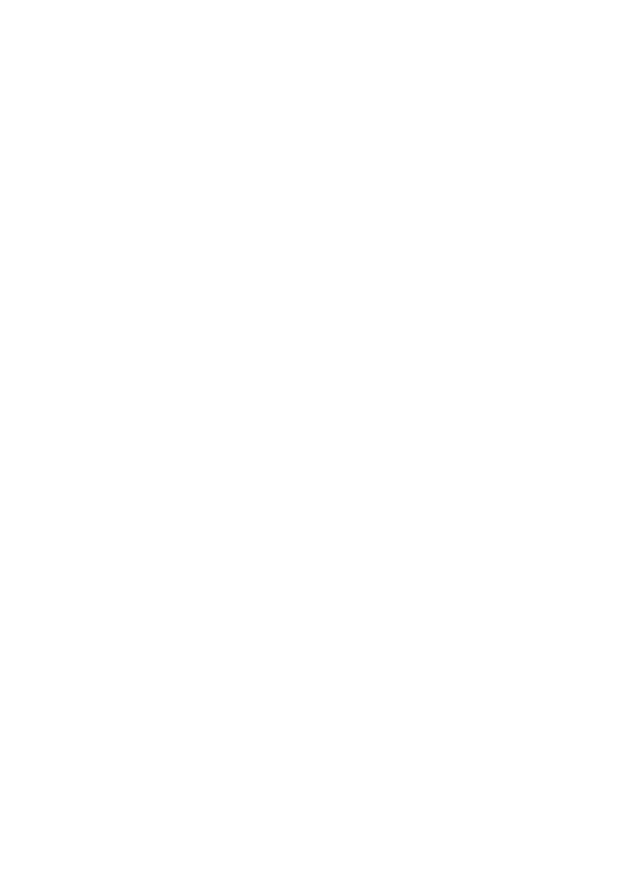
32
5
Professor Charles Burks von der University of Maryland war
sich bewußt, daß ihn bestimmte Leute für verrückt hielten. Im
besten Fall sahen sie in seinen Forschungen eine Art
Pseudowissenschaft. Zu diesen bestimmten Leuten gehörten
eine Reihe seiner Kollegen von der biologischen Fakultät und
die meisten Verwaltungsangestellten der Universität, doch zum
Glück hatte er einen unkündbaren Vertrag. Außerdem machte
es ihm nichts aus, ebensowenig wie dem FBI-Agenten, der ihm
diese Gewebeprobe gebracht hatte. Seine Partnerin hingegen
war da von einem ganz anderen Kaliber. Burks konnte an
ihrem Gesichtsausdruck erkennen, daß sie – vorsichtig gesagt –
eine Skeptikerin war.
Burks schaltete das Licht aus, und im Labor wurde es dunkel.
Dann legte er einige andere Schalter um, die den Raum in rotes
Licht tauchten, und machte sich an die Arbeit. Obwohl er klein
und rundlich war, bewegte sich Burks so schnell, daß sich
Scully und Mulder beeilen mußten, um ihm durch das
abgedunkelte Labor zu folgen. Burks war aufgeregt. Diese
Probe war anders als das Material, mit dem er bisher gearbeitet
hatte – ein kompletter Querschnitt eines menschlichen
Schädels. Er legte die Probe auf ein 50 x 60 cm großes Stück
Fotopapier.
„Ich habe noch nie mit menschlichem Gewebe gearbeitet“,
sagte er zu den FBI-Agenten, während er die Probe mit einem
Draht erdete. „Wonach suchen Sie genau?“
„Das werde ich Ihnen sagen, sobald wir es finden“, erwiderte
Mulder. Er wollte nicht, daß das Experiment durch
irgendwelche Erwartungen verfälscht wurde.
Scully konnte ihre Neugierde nicht länger im Zaum halten.
„Hat man eigentlich schon einmal die Wissenschaftlichkeit
dieses Verfahrens in Zweifel gezogen, Dr. Burks?“ fragte sie

33
vorsichtig.
Burks war an derartige Einwände gewöhnt. Inzwischen
machte er sich nicht mehr die Mühe, sich zu rechtfertigen, und
reagierte statt dessen mit Humor auf seine Gegner.
„Nur wenn man mit den Ergebnissen nicht zufrieden war“,
entgegnete er grinsend.
Mulder wußte, daß seine Partnerin mit dieser Antwort nicht
zufrieden sein würde. Er kam dem Professor zu Hilfe. „Chuck
hat hier in den Staaten einen Großteil der Pionierarbeit in
Sachen Kirlian-Fotografie geleistet“, eröffnete er Scully.
„Allerdings ziehe ich den Oberbegriff Aura-Fotografie vor“,
fügte Burks hinzu und schaltete eine Reihe von Geräten ein,
die leise zu summen begannen. Dann wandte er sich wieder an
Scully und erklärte das Verfahren. „Ich kann die koronale
Entladung eines Organismus fotografieren, indem ich ihn
hochfrequenter Elektrizität aussetze.“
Scully kannte den Begriff nicht. „Koronale Entladung?“
wiederholte sie.
Mulder warf ein: „Die Lebenskraft. Was die Chinesen als Chi
bezeichnen. Ihre Existenz ist in östlichen Kulturen eine
akzeptierte Tatsache.“
„Und die theoretische Basis der holistischen Medizin, der
Akupunktur“, nickte Scully und ignorierte Mulders
belehrenden Tonfall. „Aber ich verstehe nicht, was das mit
diesem Fall zu tun hat.“
„Es könnte die undeutlichen Ergebnisse Ihrer
computertomographischen Untersuchung von Betts’ Kopf
erklären“, meinte Mulder.
An der Maschine leuchtete eine rote Diode auf. Burks drückte
einen Knopf, und eine Induktionsspule knisterte. Winzige
Elektrizitätsströme sprangen über die Oberfläche der Probe.
Eine fahle Aura, deutlich sichtbar, umgab sie für zwei oder drei
Sekunden, um dann zu verblassen. Burks grinste. Dies war ein
wichtiger Moment.

34
„Mit diesen Geräten kann ich Phantombilder von ganzen
Blättern machen, die vorher zerschnitten wurden“, strahlte er
und griff nach dem belichteten Fotopapier. Er eilte durchs
Labor und legte es in ein Entwicklerbad. „Oder das
rudimentäre Bild eines Eidechsenschwanzes, der kurz zuvor
abgetrennt wurde. Was, wie Sie zugeben müssen,
bemerkenswert ist.“
Burks klang mehr als nur ein wenig stolz, während er das
Negativ im Entwicklerbad bewegte. Scully warf Mulder einen
skeptischen Blick zu, als der Professor das Bild aus der Schale
nahm und hochhielt.
„Ich glaube, da ist etwas.“
Mulder beugte sich vor, und trotz ihrer Zweifel folgte Scully
seinem Beispiel.
„Ich weiß zwar nicht, wonach Sie suchen, aber wir haben es
hier eindeutig mit energetischer Aktivität zu tun.“ Burks
befestigte das Negativbild an einer Lichtleiste. Er legte einen
Schalter um, und die Neonröhren flammten flackernd auf.
Der Querschnitt von Betts’ Kopf war als Silhouette sichtbar,
deren Ränder von einem leuchtenden elektrischen Kranz
gesäumt waren.
Aber die Silhouette endete nicht wie die Probe: Sie ging in
einen gut sichtbaren Phantomhals und gut erkennbare
Schultern über, die bis zum Rand des Fotos und weiter
reichten. Mulder ergriff als erster das Wort.
„Würden Sie glauben, daß das Haupt dieses Mannes
abgetrennt wurde, Chuck?“
Dr. Burks schien dies für einen Scherz zu halten. „Kommen
Sie“, kicherte er, bevor ihm dämmerte, daß Mulder es ernst
meinte. „Unmöglich.“
„Oh doch“, konterte Mulder. Dann wandte er sich an seine
Partnerin: „Sind wir mit den Ergebnissen zufrieden?“
Doch Scully konnte Mulder nur anstarren und sich fragen,
welch seltsamen Hypothesen wieder einmal in seinem Kopf

35
herumspukten.
Scully hielt den Umschlag mit Leonard Betts’ Gewebeprobe
in der einen und das von Dr. Burks angefertigte Aurafoto in der
anderen Hand, als sie und Mulder das Labor verließen. Sie
mußte nicht lange warten, bis er ihr seine Gedanken verriet.
„Ich weiß nicht, wie Sie dazu stehen“, erklärte Mulder, „aber
für mich sah das verdammt nach Schultern aus.“
Widerwillig schüttelte Scully den Kopf. „Ich bin mir nicht
sicher, wie ich dieses Foto erklären soll oder was es beweist.“
„Was ist, wenn es beweist, daß Leonard Betts noch am Leben
ist?“
„Mulder!“
Mulder blieb stehen und sah seine Partnerin an. „Sie sagten
vorher, daß Betts’ Gewebe von Krebs zerfressen war“,
erinnerte er sie. „Was sind Krebszellen denn anderes als
normale Zellen, die aufgrund einer gestörten DNA rasend
schnell und unkontrolliert wachsen?“
„Ich habe keine Ahnung, worauf Sie hinauswollen...“
„Hören Sie einfach zu“, verlangte Mulder. „Es könnte doch
einen Fall geben, bei dem Krebs nicht durch eine geschädigte
DNA entstanden ist. Was ist, wenn dieser Krebs kein
aggressiver oder destruktiver Faktor, sondern ein ganz
normaler Seinszustand wäre?“
Scully schüttelte den Kopf. Sie entschied sich, Mulder keine
ausführliche medizinische Belehrung über die Unmöglichkeit
einer derartigen Mutation zu erteilen. „Selbst wenn dies
möglich wäre, Mulder... Leonard Betts ist enthauptet worden.“
„Ja, aber was ist, wenn die Lebenskraft – sein Chi oder wie
Sie es nennen wollen – irgendwie eine Blaupause seines
Trägers gespeichert hat und das rapide Wachstum der Zellen
kein Krebs, sondern eine Art... Regeneration ist?“
Scully fixierte ihr Gegenüber. „Sie glauben, daß Leonard
Betts ein neuer Kopf gewachsen ist?“ rief sie entgeistert.

36
Doch Mulder ließ sich nicht beirren. „Die Flüssigkeit, die ich
in Betts’ Badewanne entdeckt habe, war Povidon-Jod. Sie wird
oft von Laborforschern bei Reptilien und Amphibien
eingesetzt, um die Regeneration zu beschleunigen. Wir beide
wissen doch, daß Salamander in der Lage sind, sich neue
Gliedmaßen wachsen zu lassen.“
Der mitleidige Blick, den Scully ihrem Partner zuwarf, sprach
Bände. Dieses Mal war er endgültig zu weit gegangen. Für
einen Moment schloß sie gottergeben die Augen und seufzte
dann: „Salamander sind die eine Sache. Aber kein Säugetier
verfügt über diese Art von Regenerationsfähigkeit. Und es gibt
auf dieser Erde keine Kreatur, die sich einen neuen Kopf wach-
sen lassen kann.“
„Manche Würmer können es“, hielt Mulder dagegen. „Wenn
man sie zerschneidet, bekommt man zwei Würmer.“
„Mulder, es sind Würmer!“
„Ich will damit nur sagen, daß so etwas in der Natur
vorkommt.“
Scully schwieg und schob Mulders Theorie für den Moment
beiseite. Es gab Dringlicheres. „Ganz gleich, ob so etwas
vorkommt oder nicht – irgend jemand gibt sich größte Mühe,
das Beweismaterial zu beseitigen.“
Auch hierfür hatte Mulder eine Erklärung. „Vielleicht
versucht Betts nur, sein Geheimnis zu bewahren.“
Als Scully antworten wollte, klingelte ihr Handy. Sie nahm
den Anruf entgegen, ohne die Augen von Mulder zu wenden.
„Scully“, meldete sie sich. Mulder beobachtete, wie eine
Gruppe von müde aussehenden Studenten aus einem nahen
Hörsaal kam, und wartete geduldig, daß Scully ihr Telefonat
beendete. „Wunderbar. Danke“, sagte sie schließlich,
unterbrach die Verbindung und steckte ihr Handy in die
Tasche.
Mulder zog fragend die Brauen hoch.
„Tja, Leonard Betts hatte offenbar mehrere Geheimnisse.

37
Eins davon ist, daß er ein Alter ego namens Albert Tanner
hatte“, informierte ihn Scully.
Der Name sagte ihm nichts.
„Ich habe Betts’ Fingerabdrücke von Danny überprüfen
lassen. Das Ergebnis waren zwei Namen. Der erste war
Leonard Betts, der zweite Albert Tanner. Aber im Gegensatz
zu Leonard hat Albert eine lebende Verwandte. Seine Mutter,
Elaine Tanner. Interessanterweise leben – oder lebten – alle
drei in Pittsburgh.“
Mulder und Scully fuhren zu dem ruhigen Wohngebiet, wo
Elaine Tanner laut ihren letzten Informationen lebte. Schmale,
zweistöckige Holzhäuser säumten die Straßen. Im Haus unter
der Adresse, die man Scully genannt hatte, brannte kein Licht,
aber Mulder bestand darauf, zur Tür zu gehen und zu läuten.
Schließlich flammte hinter dem winzigen Sichtfenster der Tür
ein Licht auf. Eine Frau, ungefähr Ende Fünfzig, öffnete.
„Ja?“ sagte sie lächelnd und nur leicht überrascht, daß zu
dieser späten Stunde noch Fremde an ihrer Tür klingelten.
Mulder musterte die hellrosa Schürze der Frau und ihr
fröhliches Gesicht.
„Elaine Tanner?“ fragte Scully. „Ich bin Agent Scully, und
dies ist Agent Mulder. Wir sind vom FBI.“
Selbst dies schien die Frau nicht zu beunruhigen, obwohl ihr
Erstaunen offensichtlich war. „Oh... was kann ich für Sie tun?“
„Ihr Sohn ist Albert Tanner?“
Diese Frage schien Mrs. Tanner allerdings zu verwirren, doch
nach einer Pause nickte sie bedächtig, und Scully fuhr fort:
„Können wir Ihnen ein paar Fragen stellen?“
Erneut nickte Mrs. Tanner und öffnete die Tür zur Gänze.
Scully und Mulder folgten ihr ins Wohnzimmer.
„Entschuldigen Sie mich bitte einen Moment“, sagte Mrs.
Tanner, „ich habe etwas auf dem Herd stehen.“
Nachdem die Frau durch eine Tür im hinteren Teil des Raums

38
verschwunden war, ließ Mulder seinen Blick durchs Zimmer
wandern und stutzte.
„Scully...“ Er wies auf ein gerahmtes Foto, das auf einer
Mahagonikommode stand.
Scully folgte der Richtung von Mulders ausgestrecktem
Finger – das Foto zeigte den Mann, den sie als Leonard Betts
kannten. Scully nahm das Bild von der Kommode und
betrachtete es genauer.
Als Mrs. Tanner ins Wohnzimmer zurückkehrte, zeigte ihr
Scully das Foto. „Ma’am, ist das Ihr Sohn?“
Mrs. Tanner lächelte stolz. „Ja“, strahlte sie, „das ist Albert.“
Scully zögerte; sie wußte nicht, wie sie ihre nächsten Fragen
formulieren sollte. „Wir kennen diesen Mann unter dem
Namen Leonard Morris Betts“, begann sie. „Haben Sie diesen
Namen schon einmal gehört?“
Mrs. Tanners Lächeln verblaßte langsam. „Nein...“
Mulder hakte nach. „Hat Ihr Sohn vielleicht Decknamen
benutzt, von denen Sie wissen?“
„Warum stellen Sie mir all diese Fragen?“ erwiderte Mrs.
Tanner. Mittlerweile war alle Fröhlichkeit aus ihrem Gesicht
gewichen.
Für einen Moment herrschte Stille. Den Agenten wurde
langsam klar, daß Mrs. Tanner möglicherweise nicht wußte,
was ihrem Sohn zugestoßen war. Als Scully wieder das Wort
ergriff, sprach sie so sanft wie möglich. „Ma’am, wissen Sie,
daß Ihr Sohn vor kurzem gestorben ist?“
Mrs. Tanner starrte Scully an, als wäre sie verrückt. „Was
meinen Sie mit ,vor kurzem’, Agent Scully?“
Scully und Mulder wechselten einen irritierten Blick. „Mrs.
Tanner, wann ist Ihr Sohn gestorben?“ stellte Mulder die
nächstliegende Frage.
„Vor sechs Jahren“, erklärte sie. Die Gesichter der Agenten
verrieten ihr, daß sie damit nicht gerechnet hatten. „Er starb bei
einem Autounfall. Warum?“

39
„Mrs. Tanner“, fragte Scully ruhig, „könnten Sie uns
vielleicht die Sterbeurkunde zeigen?“
„Natürlich“, versicherte Mrs. Tanner mit zunehmend verwirrt
klingender Stimme.
Als sich die Frau abwandte und in einem der Nebenzimmer
verschwand, blickte Scully ihr leicht ratlos hinterher.
Mulder pfiff leise durch die Zähne. „Schönes Durcheinander,
was?“

40
6
Im Vergleich zum Allegheny Catholic Hospital wirkte das
Monongahela wie aus dem Mittelalter. Das moderne Gebäude
war erleuchtet wie ein Casino in Las Vegas, und als Michele
Wilkes über den Parkplatz schlenderte, fiel ihr der alte Witz
wieder ein: „Eine todschicke Klinik!“ Auch wenn das
Allegheny Catholic selbst bei dichtem Verkehr nur eine halbe
Stunde Fahrt vom Stadtkern entfernt war, hätte es für manche
arme Seelen auch auf dem Mond liegen können – für jene, die
zum Monongahela geschickt wurden, da sie eben keine
Versicherung hatten und nicht in der Lage waren, die privaten
Krankenhaussätze zu bezahlen. Allerdings war es nicht nur das
Gebäude, das Wilkes’ Arbeitgeber deklassierte. Michele
bemerkte auch die glänzenden Ambulanzen: Keines der
Fahrzeuge war älter als zwei Jahre.
Vor zwei Stunden hatte sie ihre Schicht beendet. Sie hatte
geduscht und Freizeitkleidung angezogen und war dann zum
Allegheny Catholic gefahren. Die Stimme aus dem Funkgerät
verfolgte sie noch immer.
„Bis zum Arsch im Alligator.“
Sie hatte diesen Ausdruck bisher erst von einem Menschen
auf diesem Planeten gehört: Leonard. Und es war auch seine
Stimme gewesen, darauf ging sie jede Wette ein. Heute abend
würde sie Leonard Betts finden – oder erkennen, daß sie
tatsächlich langsam verrückt wurde. Gemächlich spazierte
Wilkes durch die Reihen der Krankenwagen und blickte sich
aufmerksam um. Sie entdeckte zwei Rettungssanitäter, die in
ihrem Fahrzeug auf einen neuen Einsatz warteten. Wilkes trat
ans Beifahrerfenster der Ambulanz.
„Entschuldigung“, begann sie nervös, „ich... äh... ich suche
nach einem Rettungssanitäter. Den Fahrer von Wagen 208.“
Die Sanitäter wechselten einen Blick. Die schwarze Frau auf

41
dem Beifahrersitz wandte sich an ihren Partner. „Der Neue?“
Der Fahrer nickte, und sie drehte sich wieder zu Wilkes
herum. „Ja, 208 steht dort drüben. Er hat gerade seine Schicht
beendet, aber wenn Sie sich beeilen, erwischen Sie ihn noch.“
Wilkes dankte ihr und marschierte zu Wagen 208, der
ungefähr dreißig Meter weiter im Schatten zwischen zwei nur
spärlich leuchtenden Straßenlaternen geparkt war. Als sie sich
näherte, entdeckte Wilkes einen einzelnen Mann, der mit einem
Erste-Hilfe-Koffer aus dem Fahrzeug stieg. Obwohl seine
Gesichtszüge nicht zu erkennen waren, kamen ihr seine Statur
und sein Gang bekannt vor. Wilkes klopfte das Herz bis zum
Halse, als sie sich zwang, seinen Namen zu rufen.
„L-Leonard?“
Der Mann blickte kurz in Wilkes’ Richtung und ging dann
schnell, aber gelassen davon. Wilkes lief ihm nach, aber als sie
die Stelle erreichte, wo sie ihn zum letzten Mal erblickt hatte,
war niemand mehr zu sehen. Vielleicht ist es doch ein Irrtum
gewesen, sagte sie sich. Doch dann bemerkte sie etwas: eine
Eiche, die zwölf Meter weiter am Rand des Parkplatzes stand –
der ungleichmäßige Schatten des Stamms verriet Wilkes, daß
sich dahinter jemand verbarg.
Vorsichtig trat Wilkes näher und wählte einen Weg, der es ihr
erlaubte, den Schatten im Auge zu behalten, ohne selbst
gesehen zu werden. Fünf Meter vor dem Baum blieb sie stehen
und unterdrückte den Impuls, kehrtzumachen und
davonzulaufen. Dann, widerwillig, trat der Mann ins Licht.
Es war Leonard Betts.
Als Wilkes sprach, waren ihre Worte kaum hörbar. „Oh, mein
Gott, Leonard! Bist du das wirklich?“
Betts schenkte ihr ein mattes, melancholisches Lächeln.
Wilkes hatte jetzt keine Angst mehr – sie konnte nur nicht
fassen, was sie sah. Sie mußte sich daran erinnern, daß dies
kein Traum, daß Leonard kein Geist war.
„He, Michele.“ Leonards trat auf seine ehemalige Partnerin

42
zu, um sie zu umarmen. Wilkes wich zurück, obwohl sie nicht
wußte, warum sie sich plötzlich fürchtete.
„Es ist okay“, meinte Betts beruhigend.
Er machte einen weiteren Schritt auf sie zu und nahm sie in
die Arme. Zögernd erwiderte sie seine Umarmung, während
sich alles um sie drehte. Ein Teil von ihr wollte es ohne zu
fragen akzeptieren. Während Leonard sie in seinen Armen
hielt, spürte Wilkes, wie ihre Schuldgefühle schwanden. Er
lebte, und sie, sie hatte ihn nicht umgebracht.
Betts schluckte hart. In seinen Augen schwammen Tränen. Er
konnte spüren, wie sich ihre Furcht in Freude verwandelte, er
konnte ihre Erleichterung fühlen – und er wollte nicht tun, was
er tun mußte.
„Es ist okay“, wiederholte er sanft. „Ich wünschte nur, du
hättest mich nicht gefunden.“
„Wovon redest du?“ flüsterte sie zurück.
Betts löste eine Hand von Wilkes’ Rücken. Eine gefüllte
Injektionsspritze blitzte auf.
„Leonard?“ Verwirrt sah ihn Wilkes an und wartete auf seine
Antwort.
Doch Betts’ einzige Antwort bestand darin, ihr die Nadel
zwischen die Schulterblätter zu rammen. Die Spritze pumpte
ihren tödlichen Inhalt in Wilkes’ Körper, während Betts seine
ehemalige Partnerin unerbittlich festhielt. Es dauerte nur ein
paar Sekunden, bis sie von Krämpfen geschüttelt wurde.
„Es tut mir leid“, flüsterte Betts. „Es tut mir so leid.“
Taumelnd versuchte Wilkes, sich aus Betts’ Griff zu befreien,
aber einen Moment später war schon alles vorbei. Sie verdrehte
die Augen und erschlaffte. Betts legte Wilkes’ Leiche
behutsam auf den laubbedeckten Boden.
„He, Sie da!“
Betts fuhr herum und blinzelte in den Strahl einer
Taschenlampe. Er schirmte seine Augen ab und sah einen
stämmigen Wachmann aus Richtung des Krankenhauses auf

43
sich zustürmen. Betts richtete sich auf, schwang sich über ein
Geländer und rannte den Weg hinunter. Als der Wachmann die
Stelle erreichte, wo er Betts zuerst entdeckt hatte, verharrte er.
Der Strahl seiner Taschenlampe fiel auf Michele Wilkes’
Leiche. Einen Moment lang starrte er in ihre toten Augen und
setzte dann dem Täter nach, der noch immer in Sichtweite war.
„HALT!“ befahl er. „BLEIBEN SIE SOFORT STEHEN!“
Betts ignorierte die Zurufe und erreichte den Parkplatz, wo er
im Zickzack durch die geparkten Autos lief und schließlich bei
seinem klapperigen Dodge Dart anlangte. Fieberhaft suchte er
nach seinen Schlüsseln. Er konnte die Schritte des Wachmanns
hören. Endlich fand er sie! Betts steckte den Schlüssel in die
Wagentür, doch kaum hatte er ihn gedreht, wurde er auch
schon von seinem Verfolger angesprungen. Betts schlug
schwer auf dem Pflaster auf, und bevor er sich aufrappeln
konnte, war der Wachmann über ihm. Das nächste, was Betts
sah, war die Taschenlampe, die auf seinen Kopf niedersauste:
Das wuchtige Batterieende traf seine Stirn, und ihm schwanden
die Sinne.
Verzweifelt kämpfte Betts gegen die Bewußtlosigkeit, die
sich seiner bemächtigen wollte. Es gelang ihm, den zweiten
Schlag mit dem Unterarm abzuwehren, er war jedoch nicht
stark genug, um zu verhindern, daß der kräftige Wachmann
sein Handgelenk packte und ihm Handschellen anlegte.
Verschwommen nahm Betts wahr, wie der Wachmann den
zweiten Schellenring am Türgriff des Wagens befestigte.
„Du bleibst hier, Hurensohn!“ Der Wachmann tastete Betts
ab, fand aber nichts. Er zog den Schlüssel ab, der noch immer
in der Autotür steckte, und schob ihn in seine Tasche. Betts lag
blutend am Boden. Beide Männer keuchten wie
Schwergewichtsboxer. Der Wachmann löste sein Walkie-talkie
vom Gürtel und drückte den Sendeknopf.
„Ronnie, nimm ab, Mann!“
Während er auf die Antwort wartete, blickte der Wachmann

44
zu den Bäumen hinüber. Ein paar Momente später drang eine
blecherne Stimme aus dem Lautsprecher des Walkie-talkies.
„Was ist?“
„Wir haben einen Notfall auf dem Personalparkplatz.“ Der
Wachmann warf seinem Gefangenen einen grimmigen Blick zu
und lief dann den Weg zurück zu der Stelle, wo er die Leiche
der Frau gefunden hatte.
Sobald sein Bezwinger außer Sichtweite war, rappelte sich
Betts mühsam auf. Er zerrte heftig an den Handschellen. Dann
rüttelte er am Türgriff, allerdings ohne Erfolg. Betts warf einen
langen, forschenden Blick in die Richtung, in der der
Wachmann verschwunden war – er wußte, daß ihm nicht viel
Zeit blieb, bis jemand kam, um ihn abzuführen. Er mußte
schnell handeln.
Mit der freien Hand packte er den Daumen der gefesselten
Hand und zog. Schweiß glänzte auf seiner Stirn. Betts schloß
die Augen und biß die Zähne zusammen, um nicht zu schreien.
Er versuchte, sich ganz auf die Stimmen in der Ferne zu
konzentrieren und seine Schmerzen einfach zu ignorieren.
„Jemand soll eine Trage holen.“ „Ich kann keinen Puls
feststellen.“ „Ich muß nach diesem Kerl sehen.“ Dann ein
Geräusch näher an seinen Ohren – das seines Daumens, der
sich mit einem Ruck aus dem Gelenk löste – gefolgt von dem
übelkeitserregenden Knirschen von Knochen und Knorpel und
zerreißendem Fleisch.
Weniger als dreißig Meter weiter kniete der Wachmann
neben Michele Wilkes. Sein Kollege und ein Notarzt waren
ihm zu Hilfe geeilt. Am Gesichtsausdruck des Arztes konnte
der Wachmann erkennen, daß die Diagnose negativ war. Hier
war nichts mehr tun, und so kehrte er zum Parkplatz zurück
und wünschte sich im stillen, er hätte dem Mörder ein paar
Schläge mehr verpaßt. Der Mistkerl hätte es verdient.
Als sich der Wachmann dem Auto näherte, verlangsamte er
seine Schritte. Er richtete seine Taschenlampe auf die Stelle,

45
wo er Betts zurückgelassen hatte – und hielt verwirrt inne. Das
Auto war da, und auch die Handschellen baumelten noch am
Türgriff. Doch der Gefangene war verschwunden.
Vorsichtig pirschte der Wachmann um das Auto herum. Als
er in die Lücke zwischen dem Dart und dem daneben
parkenden Sportwagen bog, konnte er die Handschellen besser
erkennen, und bei genauerem Hinsehen bemerkte er das frische
Blut, das an der Tür hinunterrann. Die Blicke des Wachmanns
folgten der Blutspur zum Boden, und was er sah, ließ ihn erst
fassungslos den Kopf schütteln, danach wurde ihm schlagartig
schlecht.
Auf dem Pflaster lag Leonard Betts’ Daumen. Er sah aus, als
wäre er am Gelenk abgerissen worden.

46
7
Im Morgengrauen schneite es. Kleine, feuchte Flocken
wehten in Agent Mulders Gesicht, als er sich auf dem
Personalparkplatz des Allegheny Catholic Hospitals bückte.
Durch Latexhandschuhe geschützt, hob er den abgetrennten
Daumen auf, untersuchte ihn und steckte ihn in einen
Plastikbeutel. Im Hintergrund plärrten lautstark
Polizeifunkgeräte, während uniformierte Cops den Tatort mit
gelbem Polizeiband absperrten. Wachmänner des
Krankenhauses erklärten den von der Nachtschicht erschöpften
Angestellten, warum sie noch nicht in ihre Autos steigen
durften.
Mulder verfolgte die Blutspur vom Boden hinauf zu den
Handschellen, die noch immer am Türgriff hingen. Als er
aufblickte, entdeckte er Scully, die sich mit einem
Regenschirm von der Stelle näherte, wo man Michele Wilkes’
Leiche gefunden hatte. Er zeigte ihr den Plastikbeutel mit dem
Daumen.
„Unglaublich, was manche Leute so verlieren“, scherzte er,
doch Scully zeigte keinerlei Reaktion, und er wurde wieder
ernst. „Was haben Sie herausgefunden?“
„Michele Wilkes wurde ermordet, aber wenn der Wachmann
die Tat nicht beobachtet hätte, hätten wir es vielleicht nie
festgestellt.“
„Warum nicht?“
„Ich habe eine gebrauchte Injektionsspritze im Gras entdeckt.
Man hat ihr eine tödliche Dosis Kaliumchlorid verpaßt“,
erklärte Scully. „Da es sich dabei um einen Elektrolyten han-
delt, der auf natürliche Weise im Körper vorkommt, suchen die
Gerichtsmediziner normalerweise nicht danach.“
Der Schnee fiel dichter, und auch Mulder spannte seinen
Schirm auf. „Betts war hier, Scully. Wilkes muß ihn aufgespürt

47
haben. Dann hat er sie umgebracht, um sein Geheimnis zu
schützen.“
Unter anderen Umständen hätte Scully ihm mit Sicherheit
widersprochen. Statt dessen nickte sie mit wachsender
Überzeugung. „Ja, der Wachmann hat ihn als den Täter
identifiziert. Allerdings haben seine Kollegen ausgesagt, sein
Name sei Truelove.“
„Scully, wissen Sie, wie dieser Mann entkommen ist?“
Mulder wies auf die blutbefleckte Autotür. „Er hat seinen
Daumen ausgerissen. Weil er wußte, daß er sich einen neuen
wachsen lassen kann.“
„Mulder, so funktioniert das nicht“, protestierte sie matt.
„Aber ist es unvorstellbar?“
Scully warf Mulder einen Blick zu, der verriet, daß sie es in
der Tat für unvorstellbar hielt.
Doch noch gab sich Mulder nicht geschlagen. „Vielleicht ist
Betts’ Regenerationsfähigkeit kein größerer
Entwicklungssprung als der aufrechte Gang oder die
Kommunikation durch Sprache“, spekulierte er.
„Sprache... Evolution – es handelt sich dabei um einen
Prozeß, der in Schritten abläuft, Mulder. Nicht in Sprüngen.“
Mulder schüttelte den Kopf. „Die neueste Evolutionstheorie
widerspricht dem. Die Wissenschaftler nennen das Phänomen
,Punktualismus’ oder ,punktuelles Gleichgewicht’. Nach dieser
Theorie laufen evolutionäre Fortschritte kataklysmisch ab,
nicht graduell. Die Evolution erfolgt nicht gleichmäßig,
sondern in großen, abrupten Sprüngen. Und das Unerklärliche
spielt sich in den Lücken ab – der Lücke zwischen dem, was
wir sind, und dem, was Leonard Betts geworden ist.“
Scully dachte eine Weile über Mulders Argumente nach.
Dann sagte sie: „Ihre Theorie setzt einen Menschen voraus, der
so radikal weiterentwickelt ist, daß man ihn kaum noch als
Menschen bezeichnen könnte.“
Mulder hob die Schultern und lächelte. „Andererseits – wie

48
entwickelt ist ein Mensch, der einen Dodge Dart fährt?“
Scully musterte das Auto, schien den Scherz aber nicht zu
verstehen. Mulder seufzte und zog einen weiteren Plastikbeutel
mit einem Beweisstück aus der Tasche seines Trenchcoats: Es
waren die Wagenschlüssel, die der Wachmann Betts
abgenommen hatte. Mit einem leisen Klimpern hielt er sie vor
Scullys Gesicht.
Mulder nahm die Schlüssel aus dem Beutel und schloß den
Kofferraum auf, der lediglich eine mittelgroße Kühlbox
enthielt. Als er die Box geöffnet hatte, trat Scully an seine
Seite. Die Box enthielt versiegelte Plastikbeutel voller Tumore,
dieselbe Art, die sie auch in der Bio-Entsorgungseinheit im
Monongahela Hospital gesehen hatten. Die Beutel waren in Eis
gepackt, das teilweise geschmolzen war. Voller Unbehagen
griff Scully nach einigen der Beutel und las die Etiketten.
„Myeloides Sarkom. Epitheliales Karzinoid. Das sind
Krebstumore.“ Scully sah ihren Partner an. „Das ist alles OP-
Abfall, der entsorgt werden sollte. Was hatte er damit vor?“
Mulder hatte eine Erklärung parat, doch allein der Gedanke
daran erfüllte ihn mit Übelkeit. „Sie werden es vielleicht nicht
wissen wollen“, sagte er knapp.
Der Ausdruck von Abscheu, der über Scullys Gesicht
huschte, verriet Mulder, daß sie dieselbe Vermutung hatte.
„Scully, es besteht die Möglichkeit, daß Leonard Betts nicht
nur Krebs hat...“
Scully beendete den Satz. „... sondern daß er Krebs zum
Leben braucht? Sie wollen damit sagen, daß das hier...“
„... sein Imbiß ist“, schloß Mulder und sprach damit aus, was
sie beide dachten. „Das könnte auch erklären, warum die
Evolution, die natürliche Auslese, Krebs – die größte Gefahr
für die Gesundheit unserer Spezies – in unseren genetischen
Bauplan integriert hat.“
Was Mulder damit andeutete, widersprach jeder anerkannten
Theorie zu diesem Thema. Scully machte eine hilflose Geste.

49
„Warum... warum denke ich die ganze Zeit, daß sich Darwin in
diesem Moment in seinem Grab herumdreht?“
„Dann fragen Sie sich doch mal“, argumentierte Mulder
hitzig, „warum Betts Rettungssanitäter ist? Warum besucht er
regelmäßig Krebsstationen?“ Mulder nickte auf die Box mit
den Tumoren hinunter. „Weil er so Zugang zu seinem
bevorzugten Nahrungsmittel bekommt.“
Während Scully über diese Vermutung nachdachte, schaltete
ein uniformierter Police Officer in der Nähe sein Funkgerät ab
und trat auf sie zu. Er warf einen Blick auf sein Notizheft. „Das
Fahrzeug ist auf eine Elaine Tanner, 3108 Old Bank Road,
zugelassen.“
Mulder und Scully wechselten einen Blick.
„Ob Mom wohl weiß, daß ihr toter Sohn mit ihrem Wagen
unterwegs ist?“ fragte Mulder sarkastisch. Beide Agenten
kannten die Antwort auf die Frage.
Die alte Frau hatte gelogen.
Elaine Tanner hörte das Hämmern an der Tür, und obwohl
der Besuch für sie nicht völlig unerwartet kam, überraschte sie
die Anzahl der Police Officers, die sich vor ihrer Haustür
drängten, dann doch. Trotzdem hielt sie es für das Beste, sie
mit einem Lächeln zu begrüßen. Die FBI-Agentin, die schon
vor zwei Tagen bei ihr gewesen war, zeigte ihr ein Blatt Papier.
„Elaine Tanner, wir haben einen Durchsuchungsbefehl für Ihr
Haus.“
Der eisige Tonfall der FBI-Agentin war zuviel für Mrs.
Tanner. Ihr freundlicher Gesichtsausdruck verdüsterte sich.
Wenige Momente später wimmelte es in ihrem Wohnzimmer
von Polizisten, die die Schränke und Schubladen
durchwühlten. Mulder informierte Scully, daß er nach oben
gehen und sich dort umschauen wollte, während sie Mrs.
Tanner verhörte.
„Mrs. Tanner, wir wissen, daß Ihr Sohn noch lebt und daß Sie

50
Kontakt zu ihm haben. Sagen Sie uns, wo wir ihn finden
können.“
Scully wartete auf eine Antwort, doch die alte Frau wagte
noch nicht einmal, ihr in die Augen zu sehen. Statt dessen
verfolgte sie stumm, wie einer der Police Officers einige ihrer
kostbaren antiken Figurinen zur Seite schob.
„Gestern nacht hat Ihr Sohn eine Frau ermordet“, versuchte es
Scully noch einmal. „Wenn Sie lügen, um ihn zu schützen,
machen Sie sich der Mittäterschaft an diesem Mord schuldig.“
Diesmal bekam Scully eine Reaktion. Mrs. Tanner hob den
Kopf und blickte sie an. Doch bevor sie etwas sagen konnte,
kam Mulder mit einer Flasche Povidon in der Hand zurück.
„Mrs. Tanner“, unterbrach er, „darf ich Sie fragen, wofür Sie
das hier benutzen?“
Die alte Frau verzog keine Miene, und Mulder fuhr fort: „Das
ist eine ziemlich große Flasche. Schneiden Sie sich oft?“
An Mulders Tonfall erkannte die alte Frau, daß er es
herausgefunden hatte, daß er – zumindest teilweise – Bescheid
wußte. Wenn dies der Fall war, dann wollte sie, daß er
verstand. Daß er verstand und Leonard in Ruhe ließ.
„Als mein Sohn acht Jahre alt war“, begann sie bedächtig,
„gab es zwei Jungen, die ihn ständig ärgerten, weil er anders
war. Er hat sie einfach ignoriert. Er wußte, daß er besser war
als sie. Eines Tages lauerten sie ihm auf dem Heimweg auf. Sie
verprügelten ihn... und er, er hat nicht einmal versucht, sich zu
wehren. Er lag einfach da und steckte die Schläge ein.“
Mrs. Tanner wandte den Kopf und sah Scully direkt in die
Augen. „Deshalb glaube ich nicht, daß er jemand getötet hat“,
schloß sie. „Und wenn er es getan hat, dann hatte er seine guten
Gründe.“
„Was für Gründe, Mrs. Tanner?“
„Gott hat etwas mit ihm vor“, erklärte die alte Frau trotzig.
„Gott will, daß er bleibt – auch wenn die Leute es nicht
verstehen... Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe.“

51
Und Mulder und Scully wußten, daß sie nicht mehr aus ihr
herausbekommen würden.
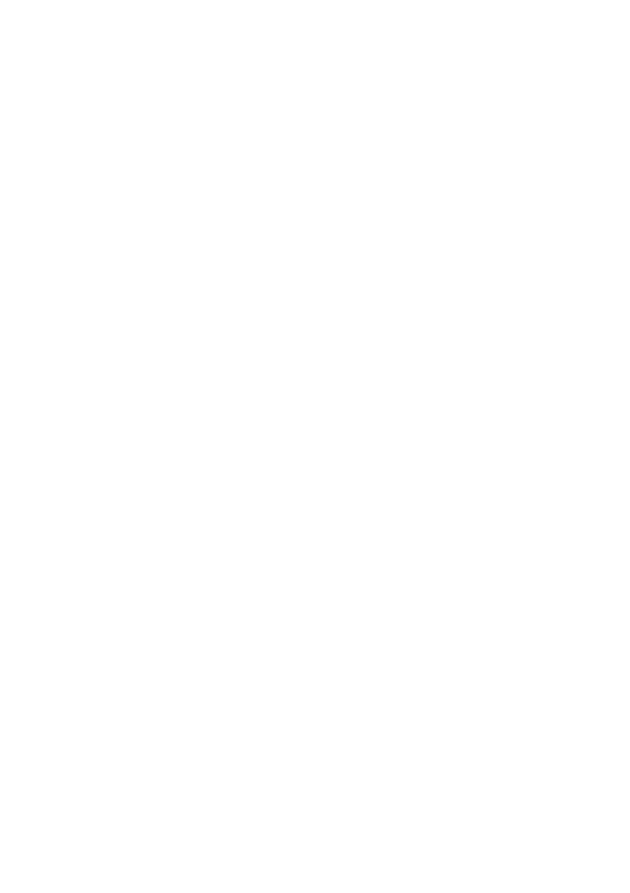
52
8
Normalerweise trank John Gillnitz vor Sonnenuntergang
keinen Whisky. Bis zur Dämmerung blieb er gewöhnlich bei
Bier – das war gesünder. Aber Emily trieb ihn zu den harten
Sachen. Emily war der Grund, warum John schon zwanzig
Minuten vor Steve, dem Besitzer, im Club Tip Top
eingetroffen war. Sie war der Grund für die sieben Pintchen
Jack Daniels, die er vor dem dritten Viertel des Steelers-Spiels
hinuntergekippt hatte.
John saß auf seinem Barhocker, nahm einen letzten Zug von
seiner Camel und drückte die Kippe im überquellenden
Aschenbecher aus. Er zog die letzte Zigarette aus der Packung
und hatte sie schon angezündet, bevor er den Rauch der
vorherigen ausgeatmet hatte. Mit einer energischen Geste
knüllte er die leere Packung zusammen und versuchte, sie in
den Abfalleimer auf der anderen Seite des Tresens zu werfen,
den er jedoch um Armeslänge verfehlte.
John nahm einen weiteren Zug und behielt den Rauch ein
paar Momente in der Lunge. Er bestellte bei Steve ein weiteres
Glas. Der Whisky half immer. Gedankenverloren fuhr er mit
den Fingern durch seinen langen Bart. Emily wollte, daß er ihn
abrasierte, und damit hatte der Streit angefangen.
„Du wirst nie einen neuen Job finden, John.“
„Wer wird dich schon einstellen, wenn du so aussiehst,
John?“
Und so weiter.
Aber John gefiel der Bart. Alle paar Monate fragte ihn
jemand, ob er ein Bandmitglied von ZZ Top sei, und John log
stets und sagte ja. Dann bekam er die ganze Nacht Drinks spen-
diert, während er Geschichten über das Leben auf Tournee
erzählte: die Groupies in Atlanta, die verwüsteten Hotelzimmer
in Manhattan. Außerdem hatte Emily der Bart gefallen, als sie

53
ihn kennengelernt hatte... natürlich hatte er damals einen Job
gehabt. Heute morgen hatte er einen Zwanziger aus ihrem
Portemonnaie klauen müssen, um hierherkommen zu können,
und jetzt waren ihm auch noch die Zigaretten ausgegangen. Er
haßte Emilys Virginia Slims, doch wenn man drei Packungen
am Tag rauchte, mußte man manchmal nehmen, was man
kriegen konnte. Vielleicht sollte er doch noch nicht nach Hause
gehen und stattdessen versuchen, jemand in der Bar anzu-
schnorren.
Er sah sich um. Die Bar war fast leer. In einer Nische saßen
ein paar Burschen, die er gerade beim Pool-Billard abgezockt
hatte. Die ließ er besser in Ruhe. Und am anderen Ende des
Tresens hockte ein magerer Kerl mit schütterem Haar, der ihm
schon den ganzen Morgen komisch vorgekommen war.
Erstens, weil der Kerl nicht trank – nun ja, Club Soda, aber das
zählte nicht. Zweitens, weil John den Kahlkopf mehr als
einmal dabei ertappt hatte, wie er ihn anstarrte. Am besten ging
er doch nach Hause. Er warf den Zwanziger auf den Tresen
und hoffte, daß er seine Rechnung abdeckte. Dann rutschte er
leicht schwankend von seinem Barhocker.
Leonard Betts verfolgte, wie der Mann mit dem langen,
zottigen Bart aus der Bar wankte. So wie er rauchte und
hustete, gab Betts dem Bärtigen noch ein Jahr, höchstens zwei.
Und sie würden nicht angenehm verlaufen. Chemotherapie.
Medikamente. Operationen. Betts zog einen Fünfer aus seiner
Brieftasche und biß die Zähne zusammen. Er freute sich nicht
auf das, was er gleich tun würde. Es kostete schrecklich viel
Kraft und Konzentration. Sein neuer Daumen war noch immer
nur ein fleischiger Stummel – es würde noch Tage dauern, bis
er wieder voll einsatzfähig war.
Betts stand auf und folgte dem bärtigen Mann. Als er auf die
Straße trat, wurde er von der Helligkeit des Nachmittags
vorübergehend geblendet. Immerhin hatte er mehrere Stunden

54
in der abgedunkelten Bar gesessen. Doch nach ein paar
Wimpernschlägen entdeckte er Gillnitz, der in Schlängellinien
auf einen Pickup zuging. Betts eilte ihm nach und steckte seine
heilende Hand in die Manteltasche. Vorsichtig sah er sich um
und stellte befriedigt fest, daß der Parkplatz menschenleer war.
Der betrunkene Mann fummelte immer noch an der Tür seines
Trucks herum.
„Verzeihen Sie“, sagte Betts ruhig, um die Aufmerksamkeit
des Bärtigen auf sich zu lenken.
Gillnitz drehte sich um und starrte den Fremden an. Er kannte
diesen Gesichtsausdruck aus Schuld und Reue – ein Ausdruck,
auf den er selbst spezialisiert war. Er grunzte und wandte sich
ab.
„Es t-tut mir leid“, stotterte Betts. „Sie haben etwas, das ich
brauche.“ Betts schüttelte das Skalpell aus seinem linken
Ärmel und fing es mit seiner unverletzten Hand auf. Als er
nach vorn stürzte, blitzte die Klinge in der Sonne auf. Sein
Angriff erfolgte schnell und brutal – binnen Sekunden war
alles vorüber.

55
9
Die Durchsuchung von Elaine Tanners Haus hatte drei
Stunden gedauert, und seit ihrer Enthüllung, daß Gott ihren
Sohn am Leben erhalten wolle, hatte die alte Frau
währenddessen kein weiteres Wort mehr gesagt. Die Polizei
war dabei, die Regale wieder einzuräumen. Mulder polterte die
Treppe herunter und suchte nach seiner Partnerin.
„Scully?“
Scully kam aus dem Wohnzimmer. „Haben Sie etwas
gefunden?“ flüsterte sie. Mrs. Tanner saß in Hörweite, und
Scully wollte nicht, daß sie etwas Wichtiges erfuhr und an
ihren Sohn weiterleitete.
„Keine Spur von ihm“, flüsterte Mulder zurück. „Nicht mal
eine alte Socke. Nur das hier.“ Mulder zeigte ihr die Quittung
eines U-Keep-It-Storage.
„Ein Möbellager?“
„An seinem Schlüsselring befindet sich ein Schlüssel mit der
eingravierten Nummer 112.“
Scully sah zur anderen Seite des Raums hinüber, wo Mrs.
Tanner plötzlich den Kopf gedreht hatte und sie aufmerksam
beobachtete. „Überprüfen wir’s.“
Durch eine Ritze in der geschlossenen Lagerhaustür fiel ein
schmaler Lichtstrahl auf Leonard Betts’ Rücken und warf die
Silhouette seines nackten Körpers an die Wand. Das matte
Leuchten um seinen Kopf erhellte das Blut auf seinen Lippen.
Seine Haut war von einem glänzenden Schweißfilm überzogen,
seine Augen traten aus den Höhlen.
Betts war vor Schmerz halb wahnsinnig.
Er senkte den Kopf und kämpfte mit etwas in seinem Inneren.
Es bewegte sich in seinem Unterleib, zerrte an seinen Muskeln,
dehnte seine Haut. Das Knacken brechender Knochen erfüllte
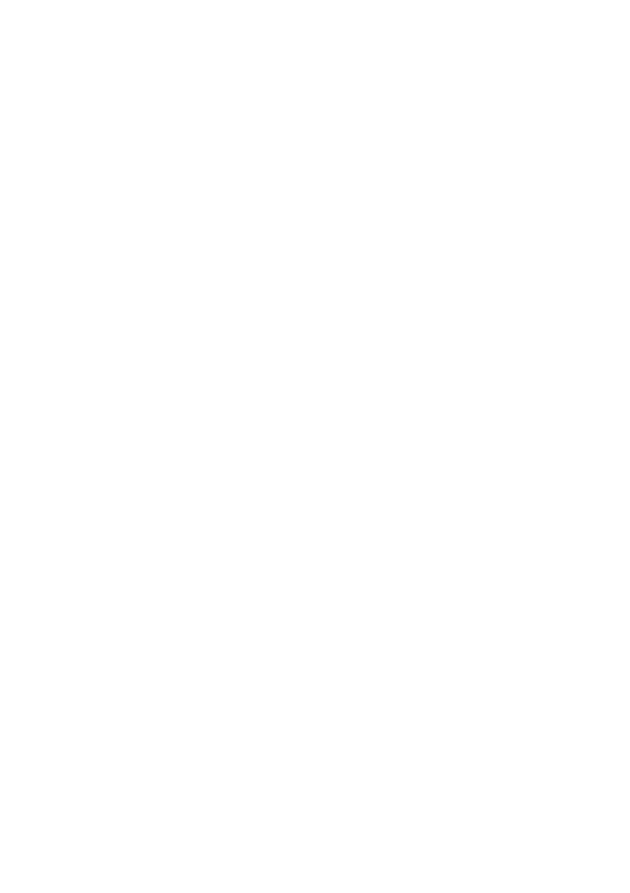
56
den kleinen Raum. Seine Kehle blähte sich. Betts warf den
Kopf in den Nacken und öffnete – einer Python ähnlich, die ein
Schwein verspeist – seinen Mund so weit, wie es keinem
normalen Menschen möglich war. Doch Betts versuchte nicht,
etwas zu verschlingen. Er gebar etwas – er gebar einen neuen
Leonard Betts.
Während er schmerzgepeinigt schrie, bahnte sich der
Klumpen in seiner Brust den Weg nach draußen, durch
zerrissenes Fleisch und den gebrochenen Kiefer von Leonard
Betts’ bisherigem Mund. Der alte Kopf fiel ab. An seinem
Platz befand sich jetzt ein unfertiger Ersatz, bleich und
konturenlos wie an dem Tag, als man ihn fast in seiner eigenen
Badewanne überrascht hatte.
Mulder steuerte den gemieteten Sedan an einem Schild mit
der Aufschrift U-Keep-It-Storage vorbei und bog auf den
Parkplatz des Lagerkomplexes, einer Ansammlung von
Klinkerschuppen mit Metallrolladentüren. Er fuhr weiter, bis er
die garagengroße Einheit mit der Nummer 112 über der Tür
fand. Mulder hielt, und die Partner stiegen aus und näherten
sich mit leisen Schritten dem Eingang.
Gerade als Mulder den Schlüssel aus der Tasche nahm,
bemerkte er es.
„Scully!“
Sie folgte seiner Blickrichtung. Blut quoll durch den unteren
Türspalt. Behende zog Scully ihre Pistole und ging neben der
Tür in Deckung.
Mulder griff ebenfalls nach seiner Waffe, bückte sich und
schloß leise die Tür auf. Als er sie nach oben drückte, spürte er
einen leichten Widerstand, und dann – fiel ihm eine Leiche
entgegen. Der Mann schien Ende Vierzig zu sein und hatte
einen langen, ergrauenden Bart. Noch bevor Scully die
klaffende Wunde in der Brust des Mannes näher in
Augenschein nehmen konnte, hörten sie aus der Lagereinheit

57
das Aufheulen eines Automotors.
Mulder warf Scully einen kurzen Blick zu und schob die Tür
vollends nach oben. Helles Tageslicht überflutete den
Garagenboden, der von leeren Kunststoffbeuteln,
Styroporkühlboxen und Organtransplantatbehältern übersät
war. Ein paar Schritte weiter, im Hintergrund des Lagers,
röhrte ein Pickup auf, und zum ersten Mal erhaschten Mulder
und Scully einen Blick auf den lebenden Leonard Betts. Hinter
das Lenkrad geduckt starrte Betts die beiden Agenten an, ließ
den Motor aufheulen und drückte aufs Gaspedal. Mit
quietschenden Reifen raste das Fahrzeug auf die Agenten zu.
Mulder warf sich auf Scully und riß sie zur Seite, während der
Truck den leblosen Körper des bärtigen Mannes überrollte.
Als der Truck aus dem Schuppen schoß, zwang Betts das
Lenkrad hart nach rechts und raste auf die Ausfahrt des
Lagerkomplexes zu. Sofort waren Scully und Mulder wieder
auf den Beinen. Mulder drückte ab, und das Fenster im Fond
des Pickups zersplitterte.
Scullys Kugel traf den Benzintank, und die Explosion erfolgte
augenblicklich. Der Pickup wurde einen Meter in die Höhe
geschleudert und landete dann wieder auf dem Boden – ein hell
auflodernder Sarg für Leonard Betts.

58
10
Die Leiche von John Gillnitz lag unter dem kalten Licht einer
Autopsielampe in der Leichenhalle des Monongahela
Hospitals. Bis auf die beiden FBI-Agenten befand sich
niemand in der sterilen Gruft. Scully trug Autopsiekleidung
und beugte sich über die Leiche, während sie Mulder über ihre
Erkenntnisse informierte. Was sie bei der Untersuchung
festgestellt hatte, beunruhigte sie.
„Mr. John Gillnitz“, begann Scully. „Der Tod trat durch
massiven Blutverlust nach einer – wie es scheint – äußerst
professionell durchgeführten Entfernung seines linken
Lungenflügels ein.“
„Betts“, erklärte Mulder nachdrücklich.
„Warum sollte er das getan haben?“
„Ich bin mir da absolut sicher, Scully – dieser Mann hatte
Lungenkrebs, und Leonard Betts brauchte dringend sein
krankes Organ.“
Scully zog die Brauen zusammen. „Und woher konnte Betts
das wissen?“
„Michele Wilkes erzählte mir, daß er die außergewöhnliche
Fähigkeit hatte, Krebs per Augenschein zu diagnostizieren“,
berichtete Mulder. „Vielleicht hat er eine Art sechsten Sinn
entwickelt.“
Scully schüttelte den Kopf. „Er hat diesen Mann also
kaltblütig ermordet. Aber warum? Um seinen Hunger zu
stillen?“
„Nicht direkt seinen Hunger... Aber Betts war hinter
speziellen Nährstoffen her. Möglicherweise hat die
Regeneration all seine Reserven aufgezehrt und ihn zu dieser
verzweifelten Maßnahme getrieben.“
Scully seufzte. Sie war es leid, mit Mulder über seine
abstrusen Theorien zu streiten. Sie musterte Betts’ verkohlten

59
Leichnam, der neben Gillnitz’ sterblichen Überresten lag. Wie
bei den Leichen anderer Brandopfer waren die Arme vor der
Brust erhoben und die Hände zu Fäusten geballt, als hätte das
Opfer seine letzten Momente damit verbracht, gegen die Flam-
men zu boxen. Der Körper selbst war eine Masse aus
rotverschmortem Gewebe und geschwärzter Haut, die jedes
Mal, wenn sie ihn bewegen mußten, fetzenweise am
Autopsietisch kleben blieb. Sein ganzes Haar war verbrannt...
obwohl sich Scully nicht des Eindrucks erwehren konnte, daß
sein Kopf – und insbesondere sein Gesicht – erstaunlich unver-
sehrt waren.
„Nun“, sagte sie schließlich, „was immer Betts auch vorhatte
– er hat sein Geheimnis mit ins Grab genommen.“
„Ja, zum zweiten Mal“, brummte Mulder. Scully runzelte die
Stirn. Mulders Tonfall deutete an, daß der Fall vielleicht doch
noch nicht abgeschlossen war.
„Mulder, Leonard Betts ist tot. Dessen bin ich mir absolut
sicher. Und er wird nicht zurückkehren.“
„Das hätten Sie auch über Albert Tanner gesagt“, konterte
Mulder.
„Ich verstehe nicht.“
„Vor sechs Jahren wurde Albert Tanner bei einem Autounfall
getötet und von seiner Mutter beerdigt. Vor mehreren Tagen
taucht derselbe Mann als Leonard Betts wieder auf. Erklären
Sie mir das.“
„Offensichtlich hat hier jemand gelogen“, erwiderte Scully
gereizt, aber ohne ihre Stimme zu heben. „Oder der erste Tod
war inszeniert.“
„Darauf können Sie wetten.“
Scully konnte sich nicht vorstellen, wie sie den Gewinner
dieser Wette ermitteln sollten – doch der Ausdruck in Mulders
Augen verriet ihr, daß er wieder einmal eine Idee hatte, die ihr
ganz und gar nicht gefallen würde.

60
Wenn man für das FBI arbeitete, genoß man unter anderem
den Vorteil, die Mühlen der lokalen Bürokratie beschleunigen
zu können, wenn man es eilig hatte. In diesem Fall hatte
Mulder nur zwei Tage gebraucht, um von einem Richter die
Genehmigung für das zu bekommen, was er vorhatte, und er
hatte noch einen weiteren Tag harter Arbeit investiert, um
dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. Scully verbrachte die
meiste Zeit in ihrem Hotelzimmer, erledigte den Papierkram
und gab die Ermittlungsergebnisse im Fall Leonard Betts – den
sie für abgeschlossen hielt – in ihren Laptop ein.
Scully wollte sich gerade die Lokalnachrichten ansehen, als
Mulder sie anrief und bat, in die Leichenhalle des
Monongahela Hospitals zu kommen.
Sie traf Mulder und einen jungen gerichtsmedizinischen
Assistenten neben einem schmutzverkrusteten Sarg an. Scully
konnte kaum fassen, daß Mulder es wirklich getan hatte. Er
hatte den Leichnam Albert Tanners exhumieren lassen!
Außerdem hatte er dafür gesorgt, daß die sterblichen Überreste
von Leonard Betts wieder auf einem der Autopsietische
plaziert worden waren. Was er damit bezweckte, blieb Scully
zunächst schleierhaft. Sie verfolgte, wie der Assistent Albert
Tanners Sarg öffnete und dann Platz für die beiden Agenten
machte. Scully trat näher.
Die Leiche im Sarg, vor sechs Jahren bei einem Autounfall
verbrannt, war in derselben Faustkampfhaltung erstarrt wie
Leonard Betts – doch die Ähnlichkeit der beiden Körper war
damit noch lange nicht erschöpft. Obwohl das Gesicht
ebenfalls vom Feuer geschwärzt und leicht mumifiziert war,
gehörte es eindeutig demselben Mann. Befriedigt bemerkte
Mulder den verblüfften Ausdruck in Scullys Miene.
„Würde der echte Leonard Betts bitte aufstehen?“ fragte er
jovial.
Doch Scully war nicht so leicht zu überzeugen. „Mulder, es
könnte sich bei diesen beiden Männern auch nur um
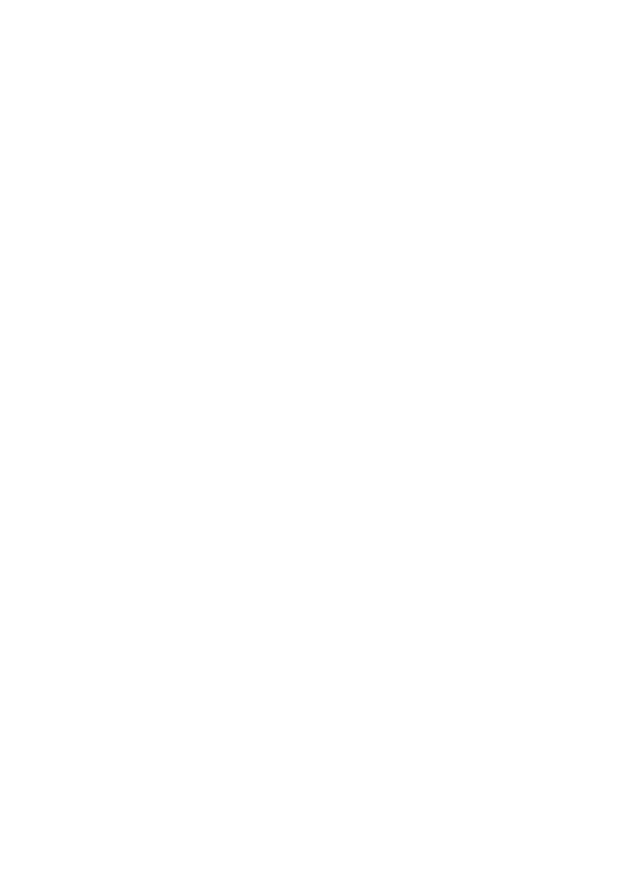
61
monozygotische Zwillinge handeln.“
Mulder sah sie ernst an. Er hatte in den letzten drei Tagen
sorgfältig nachgedacht. „Das denke ich nicht, Scully. Ich
denke, daß das, was wir hier sehen, weit über die Regeneration
eines Daumens oder Gliedes oder sogar eines neuen Kopfes
hinausgeht.“
„Mulder!“
„Überlegen Sie doch mal“, forderte Mulder. „Wie entsteht
Krebs, Scully?“
„Rapides und unkontrolliertes Zellwachstum führt zu
Tumoren – einer Masse biologisch diffuser zellularer Materie.“
Mit dieser Antwort hatte Mulder gerechnet, und er nickte
zustimmend. Er wollte lediglich, daß seine Partnerin bereits auf
dem richtigen Weg war, wenn er ihr seine Theorie darlegte.
„Also eine Art Regeneration“, faßte Mulder zusammen. „Eine
asexuelle Reproduktion. Wäre das kein evolutionärer Vorteil?“
Doch Scully war noch immer nicht bereit, ihm diese
Hypothese abzukaufen. „Mulder“, wandte sie ein, „was Sie
beschreiben, ist im Grunde genommen prä-evolutionär.
Reproduktion durch simple Zellteilung.“
„Ich habe ja nicht behauptet, daß es Spaß macht“, spottete
Mulder.
Scully warf die Hände in die Luft. „Ich weiß nicht, worauf
Sie hinauswollen. Die Regeneration eines ganzen Körpers...
Ich weiß nicht, warum ich mir das überhaupt anhöre.“
„Weil“, erwiderte Mulder und nagelte sie mit Blicken fest,
„ich glaube, daß der Autounfall, bei dem dieser Mann starb,
eine List war, ein Täuschungsmanöver. Und weil ich glaube,
daß der Mann, der hier liegt, sich reproduziert hat und noch
immer am Leben ist.“

62
11
„Ich habe Angst, Schatz.“ Elaine Tanner drückte den
Schwamm aus, den sie in der Hand hielt, und eine rötlich-
orangene Flüssigkeit tropfte heraus. Sie beugte sich über die
mit Povidon-Jod gefüllte Badewanne und preßte den kühlen
Schwamm gegen die lilienweiße Haut ihres einzigen Kindes.
„Das FBI scheint alles über dich zu wissen“, setzte sie hinzu.
Wieder tauchte sie den Schwamm in die Lösung und drückte
ihn diesmal über dem Rücken ihres Sohnes aus.
Er schauderte, sagte aber nichts.
„Sie haben den Sarg ausgegraben. Sie haben deinen...“ Mrs.
Tanner zögerte. Sie wußte nicht, wie sie es nennen sollte. „...
deinen Freund gefunden“, sagte sie schließlich.
Mrs. Tanner versuchte verzweifelt, ihrem Sohn zu beweisen,
wie stark sie sein konnte. Ein Teil von ihr wollte weinen – um
ihn, um sich selbst –, doch sie wußte, was sie zu tun hatte.
Wenn Leonard spürte, daß sie sich ihrer Entscheidung nicht
hundertprozentig sicher war, würde er nicht tun, was er tun
mußte, um sein Überleben zu sichern.
„Ich glaube nicht, daß sie dich von jetzt an in Ruhe lassen
werden“, flüsterte Mrs. Tanner. „Am Haus fahren ständig
Streifenwagen vorbei und kreisen um den Block. Ich glaube,
sie beobachten uns auch in diesem Moment.“
Leonard regte sich in der kühlen Flüssigkeit. Er betrachtete
seine Hände. Selbst mit Povidon würde es noch Tage dauern,
bis ihm Fingernägel wuchsen – Wochen, bis er Fingerabdrücke
hinterließ. In diesem Stadium der Regeneration war seine Haut
konturenlos. Leonard hörte seiner Mutter zu. Sie war der
einzige Mensch auf Erden, dem er trauen konnte.
„Du bist schwach, Leonard. Du mußt erst wieder zu Kräften
kommen.“ Mrs. Tanner wartete einen Augenblick und ließ ihre
Worte wirken. „Du weißt, was du zu tun hast“, setzte sie dann

63
nach.
Leonard schwieg und schüttelte nur den Kopf. Er wollte nicht
tun, was sie verlangte, er wollte es nicht einmal hören. Aber, so
dachte er, es gibt keinen anderen Ausweg.
Mrs. Tanner rang sich ein Lächeln ab. „Du hast eine Aufgabe
zu erfüllen, und du mußt weiterleben“, fuhr sie fort, während
sie mit dem Schwamm über den haarlosen Schädel ihres
Sohnes fuhr. Er blickte zu ihr auf. Seine Augen waren bis auf
zwei winzige rosafarbene Pupillen weiß, und obwohl sich seine
Gesichtszüge – Ohren, Nase, Mund – nur erahnen ließen, sah
sie den Sohn vor sich, den sie liebte.
„Ich bin deine Mutter“, erinnerte sie ihn, „und es ist die
Pflicht einer Mutter, ihrem Sohn zu helfen.“
Leonard Betts konnte die fürsorglichen Blicke seiner Mutter
nicht länger ertragen. Er wandte sich ab und erhaschte im
glänzenden Metall des Wasserhahns sein unförmiges Spie-
gelbild, das einen Ausdruck unendlicher Traurigkeit hatte.
Einen halben Block weit von Elaine Tanners Haus entfernt
saßen Mulder und Scully in ihrem gemieteten Sedan. Mulder
hatte angeboten, das Haus allein zu überwachen – er wußte,
daß seine Partnerin es für sinnlos hielt –, doch Scully hatte
darauf bestanden, ihn zu begleiten. Mulder argwöhnte, daß sie
dabei sein wollte, wenn sich seine Theorien als falsch
erwiesen.
Trotz der eintönig verrinnenden Zeit behielt Mulder das Haus
stur im Auge. Er war sicher, daß Leonard Betts – wenn er denn
noch am Leben war – nicht direkt durch die Vordertür
spazieren würde, und so konzentrierte er sich auf die Fenster
und die Schatten. Er verfolgte aufmerksam, wie die Lichter an-
und wieder ausgingen. Er berechnete die dazwischenliegende
Zeit und achtete auf alle Hinweise, die auf die Anwesenheit
einer weiteren Person im Haus hindeuten könnten.
Scully trank einen Schluck Kaffee und warf Mulder einen

64
Blick zu. „Selbst wenn dieser Mann existiert, wieso sollte er
dann ausgerechnet hierhin zurückkommen?“
Natürlich gehörte es zu den ehernen Gesetzen der
Verbrechensbekämpfung, daß ein Verbrecher stets an den
vertrauten Ort zurückkehrte, aber Scully fragte sich, ob
vielleicht noch mehr hinter Mulders Beharren steckte, das Haus
zu überwachen.
Mulder zuckte die Achseln. „Er geht wahrscheinlich davon
aus, daß er in den Augen des FBI tot ist. Und Betts’ einzige
Vertrauensperson ist seine Mutter. Wenn wir ihn überhaupt
noch einmal finden, dann durch sie.“
Scully akzeptierte seine Erklärung für die
Überwachungsaktion, doch die dahinterstehende Hypothese,
daß sich Betts auf irgendeine Weise einen völlig neuen Körper
regeneriert haben sollte, erfüllte sie nach wie vor mit äußerstem
Widerwillen.
Die nächsten dreißig Minuten schwiegen sie. Im Laufe ihrer
Dienstzeit hatte Scully zwar gelernt, sich nicht mehr über
Einsätze wie diese zu beklagen, sie hatte sich jedoch nicht
einreden können, daß Überwachungsaktionen aufregend waren.
In diesem Augenblick wurde die Stille der Nacht von einer
fernen, immer näherkommenden Sirene zerrissen.
Scully blickte zu Mulder hinüber und erkannte, daß auch er
nicht wußte, was das zu bedeuten hatte. Plötzlich schlingerte
ein Krankenwagen des Allegheny Catholic Hospitals mit
heulender Sirene um die nächste Ecke und blendete die beiden
FBI-Agenten für einen kurzen Moment mit seinen
Scheinwerfern. Während der Krankenwagen direkt auf Elaine
Tanners Haus zuraste, warf sein flackerndes Blaulicht verrückt
tanzende Schatten auf die Wände der alten Häuser.
Mulder war als erster aus dem Auto, dicht gefolgt von Scully.
Beide hatten ihre Waffen gezogen und rannten auf das
Fahrzeug zu. Krankenwagen bedeuteten Leonard Betts.
Mulder stellte sich vor den heranrasenden Krankenwagen, der

65
nur fünf Meter vor ihm zum Halten kam. Er nahm eine
Schußposition ein – Beine auseinander, Knie gebeugt, beide
Hände an seiner Pistole. Da die Scheinwerfer des
Krankenwagens verhinderten, daß er hinter der
Windschutzscheibe mehr als nur Schemen sehen konnte, zielte
er direkt auf das Lenkrad.
„Raus aus dem Wagen!“ bellte er.
Scully näherte sich aus einem etwas anderen Winkel. Sie
konnte zwei Gestalten im Wagen erkennen.
„Hände hoch!“ befahl sie und hob ebenfalls demonstrativ ihre
Waffe.
Doch die Personen in dem Krankenwagen reagierten nicht
schnell genug für Mulder.
„RAUS AUS DEM WAGEN!“ wiederholte er drohend.
Der Fahrer stieg zuerst aus, und obwohl Scully nicht viel
sehen konnte, bemerkte sie, daß er kahlköpfig war und etwa
dieselbe Größe wie Leonard hatte. „He, he“, begann der Mann
mit erhobenen Händen. „Was zum Teufel...?“
Mit zaudernden Schritten ging der Fahrer auf Mulder zu.
Scully umklammerte ihre Pistole fester, bereit, das Ziel bei der
ersten feindlichen Bewegung auszuschalten – doch als der
Mann in den Strahl der Scheinwerfer trat, erkannte sie, daß es
nicht Betts war. Sie entspannte sich ein wenig. Als nächstes
registrierte sie, daß der zweite Rettungssanitäter, der
mittlerweile aus der Beifahrertür gestiegen war, eine
hispanische Frau war.
„Was machen Sie hier?“ fragte Scully, ohne ihre Pistole zu
senken.
„W-w-wir haben einen Notruf erhalten“, stotterte die
Sanitäterin. Sie zeigte Scully ihre offenen Handflächen. „Eine
ältere Frau mit einem Brusttrauma und Blutverlust. 3108 Old
Bank Road.“
Die Rettungssanitäterin warf dem Fahrer einen nervösen
Blick zu. Sie hatte Angst um ihr Leben, aber auch um das der

66
Frau im Inneren des Hauses.
„Das ist alles, was wir wissen“, fügte der Fahrer hinzu.
Scully glaubte ihm. „Bleiben Sie hier“, befahl sie.
Mehr brauchte Scully nicht zu sagen; ihr Partner hatte schon
verstanden. Gemeinsam machten sie kehrt und spurteten den
Bürgersteig entlang zum Haus. Mulder sprang über einen
niedrigen Gartenzaun und war mit einem einzigen Satz die
Verandatreppe hinauf.
Er trat die Vordertür des dunklen Hauses auf und stürzte mit
der Waffe im Anschlag ins Wohnzimmer, während Scully ihm
den Rücken deckte. Als er sah, daß der Raum leer war, wandte
sich Mulder zu seiner Partnerin um – und innerhalb weniger
Sekunden hatten sie sich blickweise über das weitere Vorgehen
verständigt: Mulder steuerte die Küche im hinteren Teil des
Hauses an, während Scully vorsichtig die Treppe hinaufstieg.
Schon im nächsten Augenblick schob sich Mulder durch die
Schwingtür von Elaine Tanners Küche. Er hatte das
unbehagliche Gefühl, geradewegs in eine Falle zu tappen, diese
Empfindung verblaßte allerdings angesichts der Tatsache, daß
hier irgendwo eine Frau war, die ärztliche Hilfe brauchte.
Während er auf Zehenspitzen über den knarrenden
Linoleumboden schlich, horchte er angestrengt auf irgendein
verräterisches Geräusch, doch er konnte nur Scullys
leichtfüßige Schritte auf dem Boden über ihm hören.
Oben wurde Scully von einem ähnlichen Gefühl beschlichen
– daß hinter jeder Tür, die sie öffnete, ein Mörder lauern
konnte. Ein Mörder, sicher. Aber Leonard Betts – der Mann, an
dem sie zwei Autopsien vorgenommen hatte?
Ihr Verstand sagte ihr, daß es unmöglich war, doch dies war
nur ein kleiner Trost im Vergleich zu der Angst, die mit fast
greifbarer Macht an ihren Nerven zerrte. Scully hatte die Türen
zum Bade- und Schlafzimmer aufgestoßen; jetzt war es nur
noch ein Raum, den sie überprüfen mußte. Sie hielt die Smith
& Wesson hoch, drehte den Türknauf mit der freien linken

67
Hand und drückte.
Vor ihr auf dem Bett lag der Grund für die Anforderung des
Krankenwagens. Scully senkte ihre Waffe.
„Mulder!“ rief sie die Treppe hinunter. „Holen Sie die
Sanitäter!“
In irgendeinem fernen Winkel ihres Bewußtseins nahm sie
vage wahr, wie Mulder auf die Veranda rannte und die
Rettungssanitäter alarmierte, aber ihre Aufmerksamkeit war
jetzt ganz auf Elaine Tanner gerichtet. Die alte Frau lag
bewußtlos auf der Bettdecke. Eine Wunde in ihrer Brust in
Höhe des Brustbeins war fachmännisch mit einem
Druckverband verarztet worden, doch das Blut sickerte bereits
durch die Bandage. Scully beugte sich über die alte Frau. Als
sie den Verband vorsichtig anhob, hörte sie, daß Mulder hinter
ihr den Raum betrat. Beim Anblick der blutigen Öffnung in
Elaine Tanners Brust schnitt sie unwillkürlich eine Grimasse.
„Sie hat eine offene Wunde“, erklärte sie. Scully sah ihren
Partner an, der nicht im mindesten überrascht zu sein schien,
und fügte hinzu: „Ein chirurgischer Schnitt.“
Mulder biß die Zähne aufeinander. „Dreimal dürfen Sie raten,
was entfernt worden ist...“
Die Rettungssanitäter stürmten ins Zimmer, und Scully trat
zurück, um ihnen Platz zu machen. Die Folgerungen aus dieser
offensichtlichen Heimoperation bestätigten Mulders wilde
Theorie – daß Leonard Betts irgendwo dort draußen war und
daß er diesen Eingriff vorgenommen hatte.
Mulder war außer sich, daß es direkt vor ihrer Nase
geschehen war. „Er hat ihr das angetan“, schäumte er, „und
dann einen Krankenwagen gerufen.“
„Nach der Ankunftszeit zu urteilen, könnte er immer noch
hier sein“, schlußfolgerte Scully.
Mulder reagierte sofort und verließ das Schlafzimmer, um die
Durchsuchung des Hauses fortzusetzen. Scully wandte sich
wieder dem Bett zu, wo die Rettungssanitäter Elaine Tanner

68
behandelten. Im stillen fragte sie sich, ob Leonard ihr das
wirklich angetan hatte, oder ob es nicht vielmehr ein Opfer
war, das Mrs. Tanner für ihren geliebten Sohn dargebracht
hatte.

69
12
Fünf Minuten später hoben die Rettungssanitäter die Trage
mit Elaine Tanner hoch und brachten sie zum leeren
Krankenwagen, wo Scully Wache hielt. Nachdem Scully die
Sanitäter davon überzeugt hatte, daß sie ausgebildete Ärztin
war, überprüfte sie Mrs. Tanners Lebenszeichen. In diesem
Moment kehrte Mulder im Laufschritt zurück. Seine Suche war
vergeblich gewesen.
„Betts ist weg, Scully. Er muß zu Fuß geflohen sein.“
Scully deutete auf Mrs. Tanner. „Sie wird es schaffen,
Mulder“, sagte sie leise. „Sie ist zwar noch nicht über den
Berg, aber vielleicht kann sie uns verraten, wohin er
verschwunden ist.“
Mulder verarbeitete diese Information und entwickelte einen
Plan.
„Sie bleiben bei ihr, Scully.“ Mulder griff in seine
Jackentasche und zog sein Handy heraus. „Ich rufe das örtliche
Polizeirevier an und lasse die Umgebung absperren.“
„Okay“, nickte Scully. Sie stieg in den Fond des
Krankenwagens und setzte sich zu der Rettungssanitäterin.
Beide Frauen griffen nach je einem Flügel der Doppeltür und
schlugen sie zu. Die Sanitäterin rief dem Fahrer zu, er solle
Gas geben, und der Wagen raste los. Die Sirene heulte auf, als
Mulder die Einsatzzentrale der Polizei erreichte, und er mußte
sein Ohr abdecken, um den Operator zu verstehen. „Hier ist
Agent Mulder vom FBI.“ Er wartete auf die Bestätigung des
Operators und fuhr fort: „Ich habe hier einen Notfall und
brauche alle verfügbaren Einheiten in der 3108 Old Bank
Road. Ich suche nach einem Mordverdächtigen.“
Der Krankenwagen schoß durch die Vorstadtstraßen von
Pittsburgh, während Scully und die Sanitäterin Elaine Tanners
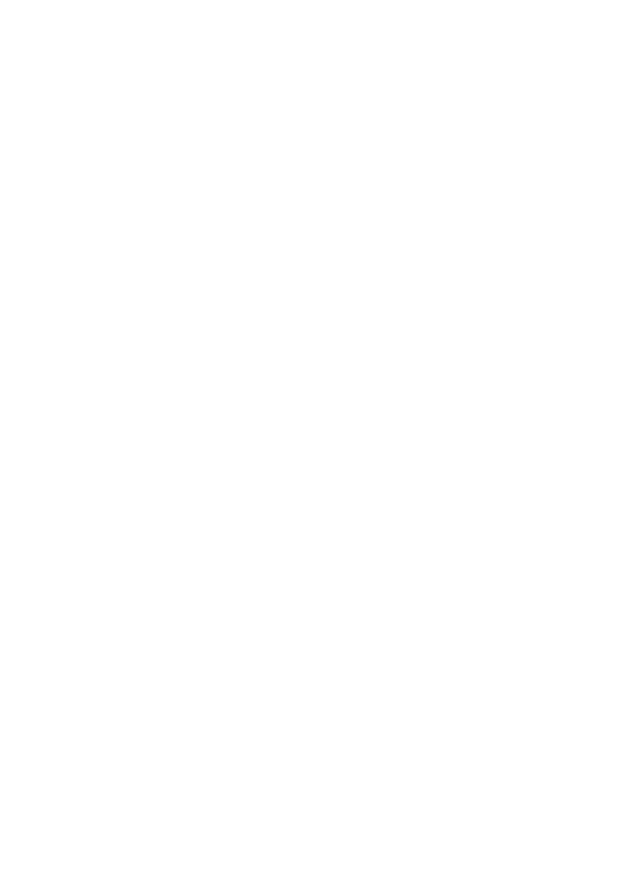
70
Herzfrequenz überwachten. Was sie sahen, gefiel ihnen nicht.
Um 4.20 Uhr erreichte der Fahrer den Eingang der
Notaufnahme des Allegheny Catholic Hospitals und hielt vor
dem einzigen erleuchteten Teil des Gebäudes. Er sprang aus
dem Wagen, lief zur Rückseite des Fahrzeugs und riß die
Doppeltür auf. Seine Partnerin hatte bereits die Räder der
Trage entriegelt und die Patientin für den Transport vorbereitet.
Mit geübten Bewegungen zog das Paar Mrs. Tanner aus dem
Krankenwagen und rollte die Patientin vorsichtig durch den
Krankenhauseingang. Scully blieb im
Fond des
Krankenwagens sitzen und bewunderte ihre Effizienz, dann
griff sie nach ihrem Handy, um Mulder Bericht zu erstatten. Er
nahm beim ersten Klingelzeichen ab.
„Mulder, ich bin’s.“ Ihr Atem war in der frostigen Nacht
sichtbar. „Mrs. Tanner ist auf dem Weg in die Notaufnahme,
aber sie hat während der Fahrt einen Herzstillstand erlitten. Sie
wurde defibrilliert, und ihr Herz schlägt wieder, aber es besteht
keine Chance, irgend etwas Zusammenhängendes aus ihr
herauszubekommen – nicht heute nacht. Wie sieht’s bei Ihnen
aus?“
Während er zuhörte, ging Mulder die Old Bank Road
hinunter. Drei Streifenwagen parkten am Straßenrand, und ihre
flackernden Blaulichter tanzten über die Hauswände, während
uniformierte Officers von Tür zu Tür gingen.
„Wir überprüfen gerade jedes Haus, Scully“, erklärte Mulder.
„Ich weiß nicht, was wir sonst tun können...“
In der Zwischenzeit stieg Scully von der hinteren Stoßstange
des Krankenwagens, das Handy immer noch fest an ihr Ohr
gedrückt. Sie beobachtete, wie im Krankenhaus ein Notarzt zu
den beiden Rettungssanitätern trat und die Patientin übernahm.
Scully wollte ihnen gerade folgen, als sie plötzlich spürte, wie
etwas ihren Kopf traf. Sie blieb stehen und griff nach ihren
Haaren.
„Wir haben einen County-Hubschrauber angefordert“, fuhr

71
Mulder fort, „aber bis der eintrifft, ist Betts wahrscheinlich
schon entkommen.“
Scully musterte ihre Fingerspitzen. Sie waren feucht.
Benetzt von einer rötlich-orangen Flüssigkeit.
Scully atmete tief ein, fuhr herum und sah ein dünnes Rinnsal
aus Povidon-Jod vom Dach des Krankenwagens laufen. An der
Stelle, wo das Rinnsal die Oberkante der Doppeltür erreichte,
tropfte es zäh und in einzelnen Tropfen auf das Pflaster. Noch
immer drang Mulders Stimme an ihr Ohr.
„Wenn er es geschafft hat, von einem Wagen mitgenommen
zu werden oder ein Auto zu stehlen, sehen wir ihn vermutlich
nie wieder, aber offenbar war sein Plan von langer Hand vorbe-
reitet. Wenn Sie irgend etwas aus Mrs. Tanner
herausbekommen könnten – selbst wenn es nur eine
Kleinigkeit ist...“
Scullys gepreßtes Flüstern unterbrach ihn. „Mulder, kommen
Sie her!“
„Was?“
„Kommen Sie sofort her!“
Mulder stellte keine weiteren Fragen. Er beendete das
Gespräch und rannte zu seinem Mietwagen.
Vor dem Krankenhaus steckte Scully ihr Handy ein. Sie zog
ihre Pistole und kletterte leise auf die hintere Stoßstange
zurück. Dann benutzte sie den Türgriff als Fußstütze und han-
gelte vorsichtig nach oben, um einen Blick auf das Dach des
Fahrzeugs zu werfen, wobei sie ihre Pistole schußbereit hielt.
Als sie ihren Kopf über die Dachkante schob, fand sie ihren
Verdacht bestätigt: Kleine Pfützen Povidon-Jod und zwei
rötlich-braune Handabdrücke waren auf dem hellen Lack des
Wagens deutlich sichtbar.
Scully wollte soeben wieder hinunterklettern, als jemand
ihren Fuß packte und vom Türgriff riß. Scully stürzte rücklings
in die Tiefe – doch sie landete nicht auf dem Boden. Die

72
Person, die ihren Fuß gepackt hatte, hielt jetzt ihre Hüften
umklammert und schleuderte sie in den Fond des
Krankenwagens. Scully prallte gegen einen Medizinschrank,
der durch die Erschütterung aufsprang. Verbandsmull, Spritzen
und Alkoholflaschen aus Plastik fielen heraus. Instinktiv
rappelte sich Scully wieder auf, riß mit einer Drehung ihre
Waffe hoch und zielte auf den Angreifer.
Es war Leonard Betts.
Oder zumindest eine Version von Betts. Er trug die Uniform
des Rettungsdienstes, doch sein unförmiges Gesicht hatte er
nicht verbergen können: Seine Züge schienen von einer grausig
aussehenden Schicht Mutantenfleisch bedeckt zu sein. Sie
zögerte einen Moment, bevor sie schoß – und diese Sekunde
reichte, damit ihr Betts die Pistole mit dem Rücken seiner
bläßlich weißen Hand aus den Fingern schlagen konnte. Betts
hob die Waffe auf, warf sie aus dem Krankenwagen und
versetzte Scully einen so kräftigen Stoß, daß sie nach hinten
kippte und hart mit dem Kopf gegen die Rücklehne des
Fahrersitzes prallte. Benommen blickte sie auf und mußte
hilflos mit ansehen, wie Betts die hinteren Türen zuschlug.
Sie war gefangen. In dem engen Raum konnte sie das
Povidon auf seiner Haut riechen. Dann hielt Betts etwas hoch.
Scullys Augen brauchten einen Moment, um sich an die Dun-
kelheit des Krankenwagens zu gewöhnen, doch als er sich zu
ihr umwandte und den Gegenstand ins Licht hielt, erkannte
Scully, um was es sich handelte – ein Skalpell. Betts zögerte
einen Moment und starrte auf sie hinunter.
„Es tut mir leid“, sagte er dann zu Scully, „aber Sie haben
etwas, das ich brauche.“
Scully sah ihm in die Augen. Seine Worte und die möglichen
Folgerungen, die sich daraus ergaben, machten ihr angst. Sie
hatte den seltsamen Eindruck, daß er es ehrlich meinte – daß
das, was er tun würde, ihm tatsächlich leid tat. Doch sie hatte
keine Zeit, genauer darüber nachzudenken. Betts stürzte sich

73
auf sie und zielte mit dem Skalpell direkt auf ihre Brust. Scully
gelang es, den Angriff abzublocken, Betts’ Waffenarm mit
ihrer linken Hand zu packen und die Klinge mit ihrem rechten
Unterarm abzuwehren. Er zog seinen Arm zurück und stach
wieder auf sie ein, doch Scully wehrte die Klinge erneut ab,
diesmal mit ihrem linken Arm. Gleichzeitig holte sie mit ihrer
freien Hand aus und versetzte Betts einen Kinnhaken, der ihn
ins Taumeln brachte. Während er schwankte, verpaßte ihm
Scully einen Fußtritt gegen die Brust, der ihn noch weiter
zurückweichen ließ. Jetzt konnte sie sich hochrappeln, doch
kaum war sie auf den Beinen, stürzte sich Betts erneut auf sie.
Diesmal war Scully auf den Angriff vorbereitet. Sie trat mit
aller Kraft zu und trieb ihren Absatz in Betts’ Achselhöhle. Er
stolperte zurück. Scullys zweiter Tritt traf ihn vor die Brust,
und ein leises Knacken verriet ihr, daß sie seine Rippen
gebrochen hatte. Die Wucht des Trittes schmetterte Betts gegen
die hintere Tür des Krankenwagens, wobei seine Hand mit dem
Skalpell das Fenster durchstieß. Glas splitterte.
Während Betts heulte und auf seinen aufgeschlitzten Arm
starrte, witterte Scully die Chance, ihn endgültig zu erledigen.
Doch als sie auf ihn losging, wirbelte Betts unerwartet herum
und verpaßte ihr einen Schwinger, der Scully von den Beinen
riß. Blut tropfte aus einer Platzwunde über ihrem Auge. Scully
rollte so weit von Betts weg, wie es der enge Laderaum des
Krankenwagens erlaubte. Sie drehte sich und keuchte entsetzt
auf, als Betts seinen Arm durch das zerschmetterte Fenster
hereinzog. Aus einem Dutzend Schnittwunden sprudelte Blut.
Schmerzgepeinigt sank Betts auf die Knie und hielt sich den
blutenden Arm, aber Scully sah, daß er das Skalpell noch
immer umklammert hielt. Fieberhaft blickte sie sich um und
suchte auf den Regalen nach einer Waffe – einem anderen
Skalpell, einer großen Spritze, einer Knochensäge, irgend
etwas. Was sie neben sich auf dem Boden fand, hätte sie
amüsiert, wenn es nicht um ihr Leben gegangen wäre – es war

74
schwerlich als Waffe zu bezeichnen. Sie schaltete die kleine,
eckige Einheit ein. Die Maschine summte, und Scully schickte
ein stilles Stoßgebet zum Himmel, daß sie sich schnell genug
aufladen würde.
Betts stemmte sich taumelnd hoch. Unvermittelt schien er
sich wieder an sein Vorhaben zu erinnern. Er stürzte durch den
Krankenwagen auf Scully zu und zielte mit der Klinge auf
ihren Hals.
Doch Scully war vorbereitet. Sie fing den Aufprall seines
Körpers mit den Fußsohlen ab, stieß ihn aber nicht zurück,
sondern ließ ihn näherkommen, bis sich ihre Gesichter fast
berührten. Als er erneut mit dem Skalpell nach ihrer Kehle
stieß, hob Scully die beiden Defibrillator-Pole und preßte sie
gegen Betts’ Schläfen.
Mit einem lauten Knattern zischten dreihundert Joules
Elektrizität durch Betts’ Schädel und schleuderten ihn
rücklings durch die Doppeltür des Krankenwagens. Wie eine
schlaffe Puppe schlug er auf dem Pflaster vor dem Eingang zur
Notaufnahme auf.
Scully hörte das Heulen näherkommender Polizeisirenen. Sie
setzte sich auf, die Defibrillator-Pole entglitten ihren Händen.
Keuchend starrte sie auf Betts’ reglose Gestalt. Sie ließ ihn
auch nicht aus den Augen, als zwei Rettungssanitäter und ein
Wachmann aus dem Gebäude stürmten und die Leiche
umringten.
Was hatte er noch gleich gesagt?
Sie haben etwas, das ich brauche.

75
13
Die elektrischen Türen des Eingangs zur Notaufnahme
zischten, als Mulder das Gebäude verließ, um seine Partnerin
zu suchen. Er überquerte den Parkplatz des Krankenhauses, der
jetzt von den flackernden Blaulichtern mehrerer Streifenwagen
erhellt war. Uniformierte Officers liefen umher und sicherten
den Ort des Geschehens.
Mulder fand Scully auf dem Beifahrersitz des Sedans. Er
bemerkte den abwesenden Ausdruck in ihren Augen. Mulder
hatte Scully gedrängt, sich ärztlich untersuchen zu lassen, und
der Schmetterlingsverband an ihrer Stirnwunde würde wahr-
scheinlich verhindern, daß eine Narbe zurückblieb. Scully
blickte auf, als er an den Wagen trat. Sie brauchte ihre Frage
nicht laut zu stellen.
„Sie haben Betts vor zehn Minuten für tot erklärt“, bestätigte
Mulder.
„Er ist wirklich tot?“
Mulder nickte knapp. Er wußte nicht genau, wie er die
Antwort formulieren sollte. „Soweit sich das sagen läßt.“
Er konnte erkennen, daß die Nachricht Scully erleichterte,
was ganz und gar nicht zu ihr paßte. Normalerweise zog sie es
vor, wenn die Täter hinter Gittern und nicht auf dem Friedhof
landeten. Mulder entschloß sich, mit etwas weniger düsteren
Informationen fortzufahren.
„Aber seine Mutter lebt. Hauptsächlich weil Betts die Wunde
sorgfältig verbunden hat. Sie wird durchkommen... zumindest
im Moment.“
Die Pause vor Mulders letztem Halbsatz beunruhigte Scully.
Sie bedeutete, daß Mrs. Tanner nicht mehr lange zu leben
hatte, selbst wenn sie die ,Operation’, die ihr Sohn an ihr
vorgenommen hatte, überstehen sollte. Scully glaubte den
Grund dafür zu kennen.

76
„Krebs?“ fragte sie.
Mulder nickte und warf einen Blick in sein Notizbuch.
„Metastasisches Rhabdomyosarkom, um genau zu sein. Sie
befand sich bereits in entsprechender Behandlung. Vor drei
Monaten hat man sie als gesund entlassen.“
Scully ließ die Informationen auf sich wirken und erinnerte
sich, was Mulder aus der Aussage von Michele Wilkes
gefolgert hatte – Betts verfüge über die außergewöhnliche
Fähigkeit, Krebs per Augenschein zu diagnostizieren. Mulder
hatte sogar spekuliert, daß er eine Art sechsten Sinn dafür habe.
Damals hatte sie die Theorie im besten Fall für weit hergeholt
gehalten. Jetzt war sie sich dessen nicht mehr so sicher. Zuviel
war passiert. Zuviel von dem, was Mulder vorhergesagt hatte,
war eingetreten.
Mulder spürte, daß seine Partnerin bedrückt war, und nahm
an, daß es mit dem Tod von Betts zusammenhing. „Sie haben
richtig gehandelt, Scully“, sagte er aufmunternd lächelnd. „Sie
sollten stolz auf sich sein.“
Scully hob den Kopf und starrte Mulder an, als sähe sie ihn
zum ersten Mal. Sie wußte seine Freundlichkeit zu schätzen,
konnte sich aber kein Lächeln abringen. Für einen Moment war
sie versucht, Mulder von dem zu erzählen, was Betts zu ihr
gesagt hatte, und sie fragte sich, ob er nicht sogar von selbst
darauf kommen würde. Er hatte die Berichte gelesen. Stellte er
sich bereits dieselben Fragen, die Scully nicht mehr aus dem
Kopf gingen? Warum hatte Betts Scully mit einem Skalpell
angegriffen? Warum hatte er nicht ihre Dienstwaffe benutzt, als
er die Chance dazu gehabt hatte? Was war das Motiv für seinen
Angriff? Schließlich war ihm bereits die Flucht vom Tatort
geglückt. Warum hatte er dieses Risiko auf sich genommen?
Für Scully gab es nur eine logische Antwort, und sie
erschreckte sie zu Tode.
Als Scully schließlich sprach, hoffte sie, daß sie nur erschöpft
klang. „Mulder“, sagte sie mit bebender Stimme, „ich will nach

77
Hause.“
Mulder nickte und verzichtete auf weitere Fragen. Wenn sie
dazu bereit war, würde sie ihm schon erzählen, was sie
belastete. Sacht schloß er die Beifahrertür des Mietwagens,
ging um das Fahrzeug herum und nahm hinter dem Lenkrad
Platz. Als sie den Parkplatz verließen, sah Scully im
Rückspiegel, wie das Krankenhaus langsam kleiner wurde.
Der einzige Schlaf, den Scully in den nächsten sechzehn
Stunden fand, war ein unruhiges Nickerchen an Bord des
Flugzeugs. Sie ging wieder zur Arbeit, obwohl dies weder
erwartet noch verlangt wurde. Aus irgendwelchen Gründen war
der Papierkram verlockender als die Aussicht, allein in ihrem
leeren Apartment herumzusitzen. Bevor sie ihren
Abschlußbericht zum Fall Leonard Betts schließlich abgab,
hatte sie ihn lange und durchdringend angestarrt und sich
gefragt, warum sie es vorzog, jene Worte zu unterschlagen, die
Betts im Fond des Krankenwagens zu ihr gesagt hatte.
Sie hatten nichts zu bedeuten – auf dem Weg nach Hause
wiederholte sie diesen Satz wie ein stummes Gebet, wieder und
immer wieder.
Als die Nachrichten der lokalen Fernsehstation zu Ende
waren, ging Scully zu Bett. Sie stellte den Wecker auf acht
Uhr, obwohl sie wußte, daß Mulder bereits den Großteil der
Washington Post gelesen haben würde, wenn sie am nächsten
Morgen ins Büro kam.
Als Scully erwachte, stand die Leuchtanzeige der Digitaluhr
auf 2:08. Sie blieb ein paar Minuten im Bett liegen und wurde
dann von einem Hustenanfall durchgeschüttelt. Zum scheinbar
hundertsten Mal in dieser Nacht drehte sie sich auf die Seite
und knipste die Nachttischlampe an. Vielleicht war es besser,
wenn sie ein wenig las. Nachdem sich ihre Augen an das Licht
gewöhnt hatten, bemerkte Scully etwas auf dem Kissen.
Bluttropfen.

78
Sie streckte die Hand aus, rieb über den Kissenbezug und
starrte das frische Blut an ihrem Finger an. Als sie sich nach
vorn beugte, spürte sie etwas Warmes auf ihren Lippen. Sie
berührte ihren Mund und entdeckte, daß Blut aus ihrer Nase
lief.
Dana Scully mußte nicht in einem der vielen medizinischen
Fachbücher nachschlagen, die die Regale ihres Apartments
füllten. Sie kannte die Symptome. Dies waren die ersten Anzei-
chen von Krebs.
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Akte X Novel 01 Heilige Asche
Akte X Novel 08 Der Parasit
Akte X Novel 03 Energie
Akte X Novel 15 Schatten
Akte X Novel 07 Mein Wille sei dein Wille
Akte X Novel 02 Eve
Akte X Novel 04 Unsere kleine Stadt
Akte X Novel 13 Verseucht
Sean Michael A Hammer Novel 14 Christmas Auction
wyklad 14
Vol 14 Podst wiedza na temat przeg okr 1
Metoda magnetyczna MT 14
wyklad 14 15 2010
TT Sem III 14 03
Świecie 14 05 2005
2 14 p
więcej podobnych podstron