032
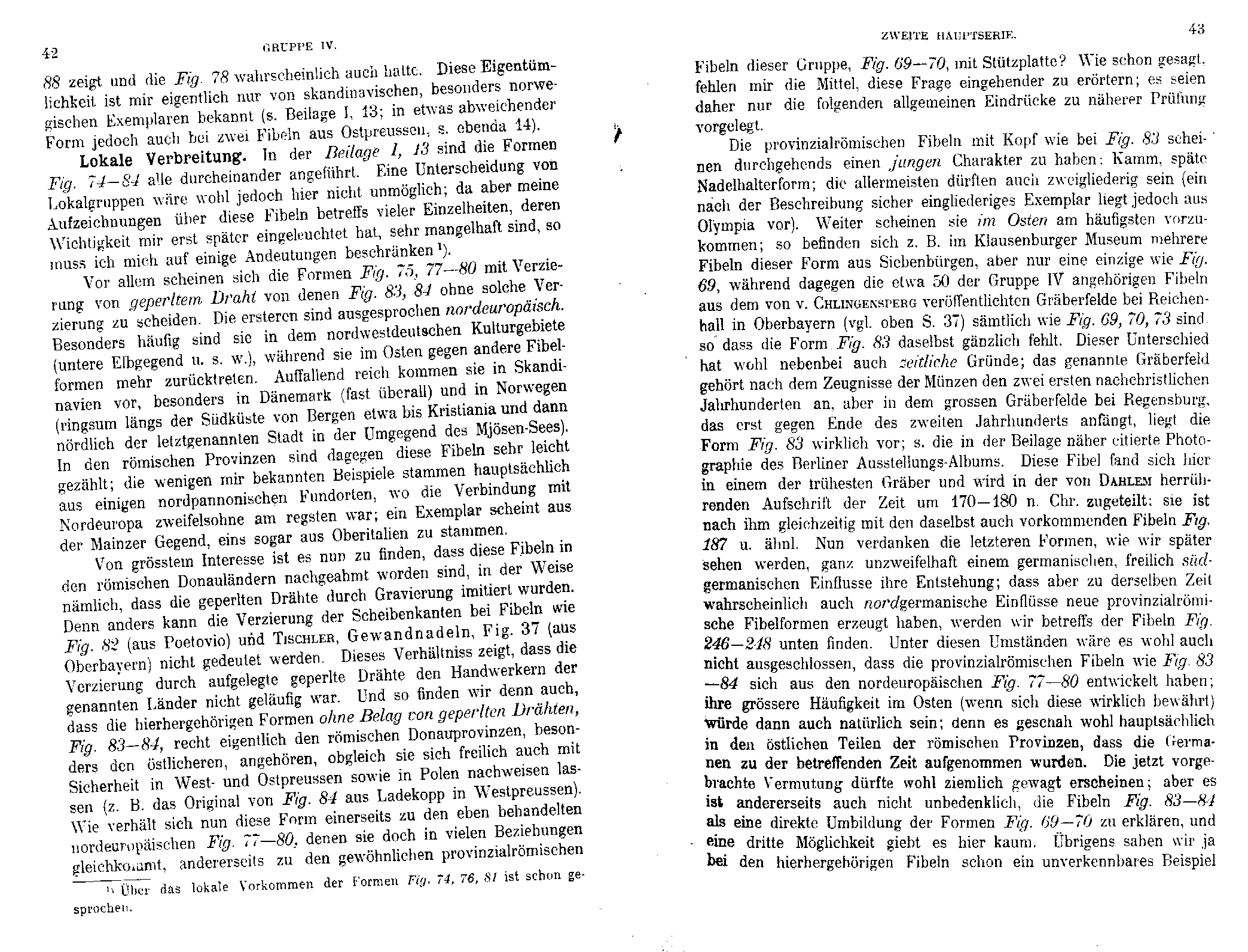
42 URUPPE IV.
88 zeigt und die Fig. 7 8 wahrscheinlich a u eh hal te. I)iese Eigentum-łichkeit ist mir eigentlieh nur von skandinayischen, besonders norwe-gischen Exemplaren bekannt (s. Beiiage I, 13; in etwas abweichender Form jedoch aucli boi zwei Fibeln aus Ostpreussen, s. ebenda 14).
Lokale Verbreitung. In der Beilage 2, J3 sind die Formen Fig. 74—84 ade durcheinander angefiihrt. Eine Unterscheidung von Lokalgruppen wnre wolil jedoch hier nicłit unmoglich; da aber meine Aufzeichnungen tiber diese Fibeln betreffs vieler Einzelheiten, dereń Wichtigkeit mir erst spater eingeleuchtet. hat, sehr mangelhaft sind, so muss ich mich auf einige Andeutungen beschranken !).
Yor allem scheinen sieli die Formen Fig. 7,5, 77—80 mit Verzie-rang von geperltem Draki von denen Fig. 83} 84 ohne solche Ver-zierung zu scheiden. Die ersteren sind ausgesprochen nordeuropaisch. Besonders haufig sind sie in dem nordwestdeutochen Kulturgebiete (untere Elbgegend u. s. w.), wahrend sie im Osten gegen andere Fibel-formen mehr zurucktrelen. AufTallend reicli kommen sie in Skandi-navien vor, besonders in Danemark (fast uberall) und in Norwegen (ringsum langs der Sudkiiste von Bergen etwa bis Kristiania und dann nordlich der letztgenannten Stadt in der Umgegend des Mjosen-Sees), In den romischen Provinzen sind dagegen diese Fibeln sehr leieht gezahlt; die wenigen mir bekannten Beispiele stammen hauptsachlich aus einigen nordpannonischen Fundorten, ivo die Verbindung mit Nordeuropa zweifelsohne ara regsten war; ein Exemplar scheint aus der Mainzer Gegend, eins sogar aus Oberitalien zu stammen.
Von grosstem Interesse ist es nun zu finden, dass diese Fibeln in den romischen Donaułandern nachgeahmt worden sind, in der Weise namlich, dass die geperlten Drahte durch Gravierung iraitiert wurden. Denn anders kann die Verzierung der Scheibenkanten bei Fibeln wie Fig. 82 (ans Poetovio) uńd Tjschler, Gewandnadeln, Fig. 37 (aus Oberbayern) nicht gedeutet werden. Dieses Verhaltniss zeigt, dass die Yerzierung durch aufgelegte geperlte Drahte den Handwerkern der genannten Bander nieht gelaufig war. Und so finden wir denn aueh, dass die hierhergehorigen Formen ohne Belag ton geperlten Drdhten, Fig. 83—84, recht eigentlieh den romischen Donauprovinzen, besonders den dstlicheren, angehoren, obgleich sie sieh freilich auch mit Sicherheit in West- und Ostpreussen sowie in Polen naehweisen las-sen (z. B. das Original von Fig. 84 aus Ladekopp in Westpreussen). Wie verhalt sich nun diese Form einerseits zu den eben behandelten nordeuropaischen Fig. 77—80. denen sie doch in vielen Beziehungen gleiehkommt, andererseits zu den gewohnlichen provinzialromischen
Ober das lokale Vorkommen der Formen Fig. 74, 76, SI ist schon ge-sprochen.
Fibeln dieser Grnppe, Fig. 69—70, mit Stiitzplattc? Wie schon gesagt. fehlen mir die Mittel diese Frage eingehender zu erórtern; es seien daher nur die folgenden allgemeinen Eindriieke zu naherer Prufung yorgelegt.
Die provinzialromisehen Fibeln mit Kopf wie bei Fig. 83 sdiei- ' nen durehgehends einen jungen Charakter zu haben; Kamra, spate Nadelhalterform; die allermeisten durften auch zweigliederig sein (ein nach der Beschreibung sicher eingliederiges Exemplar liegt jedoch aus Olympia vor). Weiter scheinen sie im Osten am haufigsten vorzu-kommen; so befinden sieli z. B. im Klausenburger Museum mehrere Fibeln dieser Form aus Siebenbiirgen, aber nur eine einzige wie Fig. 69, wahrend dagegen die elwa 50 der Cruppe IV angehorigen Fibeln aus dem von v. Chlingeesperg yeroiTentliehten Graberfelde bei Reichen-hall in Oberbayern (vgl. oben S. 37) samtlieh wie Fig. 69, 70, 73 sind so dass die Form Fig. 83 daselbst ganzlich fehlt, Dieser Unterschied hat wohl nebenbei aueh seitliche Griinde; das genannte Graberfeid gehbrt nach dem Zeugnisse der Miinzen den zwei ersten nachchristlichen Jahrhunderten an, aber in dem grossen Graberfelde bei Regensburg, das crst gegen Ende des zweiten Jahrhunderts anfangt, liegt die Form Fig. 83 wirklich vor; s. die in der Beiiage naher citierte Photo-graphie des Berlin er Ausstellungs-Alhums. Diese Fibel fand sich Jiier in einem der trtihesten Graber und wird in der von Dahlem herriili-renden Aufschrift der Zeit um 170—180 n. Chr. zugeteilt; sie ist nach ihm gleiehzeitig mit den daselbst auch vorkommenden Fibeln Fig. 187 u. abnl. Nun verdanken die letzteren Formen, wie wir spater sehen werden, ganz unzweifelhaft einem germaniści ien, freilich siki-germanischen Einflusse ihre Entstehung; dass aber zu derseiben Zeit wahrscheinHch auch ncmt/germanische Einfliisse neue provinzialrbmi-sche Fibelformen erzeugt haben, werden wir betreffs der Fibeln Fig. 246—248 unten finden. Unter diesen Umstanden wiire es wohl auch nicht ausgeschlossen, dass die provinzialromischen Fibeln wie Fig. 83 —84 sich aus den nordeuropaischen Fig. 77—80 entwickelt haben; ihre grossere Haufigkeit im Osten (wenn sieli diese wirklich bewahrt) wiirde dann auch naturlich sein; denn es gesenah wohl hauptsachlich in den ostlichen Teilen der romischen rrovinzen, dass die Germa-nen zu der betreflenden Zeit aufgenonimen wurden. Die jetzt vorge-brachte Vermutung diirfte wohl ziemlich gewagt erscheinen; aber es ist andererseits auch nicht unbedenklich, die Fibeln Fig. 83—84 ais eine direkte Umbildung der Formen Fig. 69—70 zu erklaren, und eine dritte Moglichkeit giebt es hier kaum, Ćbrigens sahen wir ja bel den hierhergehorigen Fibeln schon ein unverkennbares Beispiel
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
u OiRUPPE IV. 88 zeigt und die Fig 78 wahrscheinlich auch haltc. Diese Eigentum-łichkeit ist mir eig
52 GRUPPE V. Gruppe IV behandelten Fig. 74, von welcher sieh die Fig. 99 nur durcb das Feblcn des Fu
88 GRUPPE Vf. b) Die prouirmalromischen For men]). Wir haben schon oben auf die Form Fig. 187 hinged
Wórter und Wendungen:die Statistik zeigt... - statystykapokazuję 0 Die Statistik zeigt gro
32 Friedbcrt Fickcr 6 Fig. 3. Georgi Penćev, Sv.lvan Holzschnitt (Slg. Fr. Ficker) und die Ankl
52 GRUPPE V. Gruppe IV behandelten Fig. 74, von welcher sich die Fig. 99 nur durch das Fehlen des Fu
88 GRUPPE VI.b) Die provirmałr6inisden For men]). Wir haben sehon oben auf die Form Fig. 187 hingede
Skan# 2 2 Fig. 2. Richtung des Strahles, dann erfiillen seine Komponenten vx und v die Gleichung v2x
Moore und die wichtigeren Quellen darstellen. Zur Orientierung und zur Erkennung der morphologischen
Seite096 Fur dich, mein Haschen-> Geschenkdosen -Ti • 3 Dem Haschen die Nase a
IMG 33 (2) Destunis G. Die Schwererziehbarkeit und die Neurosen des Kindesalters. Einc psychopatholo
więcej podobnych podstron