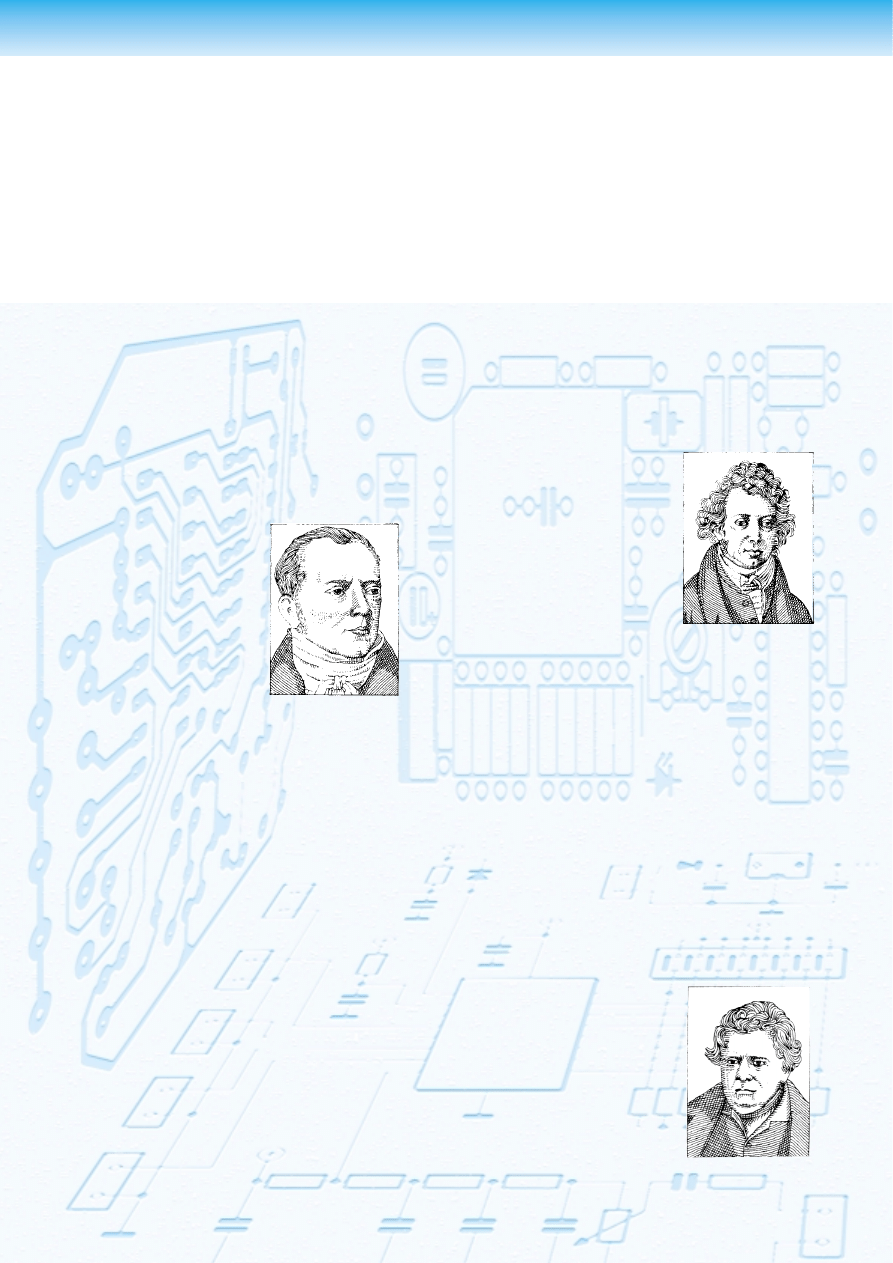
weiteres Hilfsmittel unverzichtbar: der wis-
senschaftliche Taschenrechner. Dieses
kostenlose Programm bietet neben den
bekannten Funktionen auch ein grafi-
sches Display sowie die Möglichkeit,
eigene Funktionen zu programmieren.
http://psido.exp.univie.ac.at/psimath/
Größe: 2 MB
Smartdraw
Ein einfach zu handhabendes Zeichen-
programm, geeignet zur Anfertigung
von Flußdiagrammen, Organisations-
plänen und ähnlichem mehr. Für Win-
dows 3.1 und Windows 95/98/NT existie-
ren zwei unterschiedliche Versionen.
http://www.smartdraw.com/
freecopy.htm
Größe: 1,8 MB
Wiring Diagram 2000
Nützliches und leicht bedienbares Pro-
gramm für die Erstellung und Dokumen-
tation von Verdrahtungsplänen. Der Platz-
bedarf auf der Festplatte ist mit 156 KB
äußerst bescheiden. Das Programm läuft
unter Windows ab Version 3.1.
http://www.geocities.com/SiliconValley/
Park/5228/apps.htm
Größe: 49 KB
(990011gd)
PC-P
LUS
———————————————————
Elektor
EXTRA
X-7 - 3/99
Die Geschichte der Elektronik (3)
Oersted und der Elektromagnetismus
Auffallend bei unserem Streifzug
durch die Geschichte der Elektronik
ist die Tatsache, daß nicht nur zielge-
richtetes Forschen die Entwicklung
vorantrieb, sondern häufig auch der
Zufall zu Hilfe kam. Welche Tragweite
zufällige Beobachtungen haben kön-
nen, beweist die Entdeckung des Elek-
tromagnetismus im Jahr 1819. In die-
ses Jahr fällt ein Experiment des däni-
schen Physikers Hans Christian
Oersted, das die Wissenschaft um eine
grundlegend neue Erkenntnis berei-
chern sollte. Oersted ließ einen Strom durch einen metallenen Draht
fließen, in dessen Nähe zufällig ein Magnetkompaß lag. Zur Über-
raschung aller Beteiligten änderte die Kompaßnadel spontan ihre
Richtung, als Oersted den Strom einschaltete. Ferner bestand kein
Zweifel daran, daß auch die Stromrichtung und der Abstand zwi-
schen Draht und Kompaß einen Einfluß auf den Ausschlag der
Nadel hatten. Das Experiment ließ sich sogar umkehren: Oersted
konstatierte, daß auch ein Magnet auf einen stromdurchflossenen
Leiter eine mechanische Kraft ausübt.
Die Kraftwirkung zwischen den Polen eines (Permanent-)Magneten
war Oersted lange bekannt; sie ließ sich sogar anhand des aus dem
Jahr 1785 stammenden Coulomb’schen Gesetzes leicht berechnen.
Deshalb zog Oersted aus seinem Experiment den Schluß, daß es eine
bisher unbekannte magnetische Kraft gibt, deren Ursache der elek-
trische Strom ist. Die Entdeckung galt damals als sensationell, denn
bis dahin war noch niemand auf die Idee gekommen, daß es zwi-
schen der Elektrizität und dem Magnetismus einen Zusammenhang
geben könnte.
Oersteds Entdeckung nahmen andere Wissenschaftler zum Anlaß,
weitere Experimente anzustellen. Um 1820 fiel dem französischen
Naturwissenschaftler Dominique Arago auf, daß ein gewöhnlicher
Eisenstab zum Dauermagneten wird, wenn man ihn mit einem
Draht umwickelt und eine Zeit lang einen Strom hindurchfließen
läßt. Besteht der Stab aus Weicheisen, so verliert er seine magneti-
schen Eigenschaften, sobald der Strom unterbrochen wird. André
Ampère, damals Lehrer am Pariser
Polytechnikum, fühlte sich berufen,
das Phänomen Elektromagnetismus
weiter zu ergründen. Bei seinen Expe-
rimenten stellte er fest, daß zwei Lei-
ter, durch die Ströme in gleicher Rich-
tung fließen, sich gegenseitig anziehen,
während sich die Leiter bei entgegen-
gesetzter Stromrichtung abstoßen. Die
Kraft, die die Leiter aufeinander aus-
üben, waren nach Ampères Beobach-
tung proportional zur Stromstärke
und umgekehrt proportional zum
Drahtabstand. Den mathematischen Zusammenhang faßte Ampère
in dem nach ihm benannten “Ampère’schen Gesetz” zusammen, das
später als Grundlage für die Definition der Stromstärke diente.
Ampère erfand auch ein Gerät zum Messen der Stromstärke. Es
bestand im wesentlichen aus einem überdimensionalen Perma-
nentmagneten, einer großen ringförmigen Spule und einer darin zen-
tral angeordneten Kompaßnadel. Ein durch die Spule fließender
Strom bewegte die Kompaßnadel aus ihrer Ruhelage, der Drehwin-
kel stand in direktem Verhältnis zur Stromstärke. Aus diesem “Ur-
Ampèremeter” entwickelte sich im Lauf der Zeit das auch heute
noch gebräuchliche Drehspulinstrument.
Was am Anfang des 19. Jahrhunderts fehlte, waren genormte Bezugs-
größen für die elektrischen Größen Strom, Spannung und Widerstand.
Doch diese für die Nachvollziehbarkeit von Experimenten so wichti-
gen Festlegungen waren nur noch eine Frage der Zeit. Dem bereits in
der vorangegangenen Folge unseres Streifzuges erwähnten Physiker
Humphrey Davy (Erfinder der elektrischen Lichtbogenlampe) fiel auf,
daß der elektrische Widerstand metallischer Leiter mit zunehmender
Temperatur ansteigt. Einige Jahre spä-
ter entdeckte der deutsche Naturwis-
senschaftler Georg Simon Ohm ein
anderes wichtiges Naturgesetz: Der
durch einen Draht fließende Strom ist
direkt proportional zur angelegten
Spannung und umgekehrt proportional
zum elektrischen Widerstand des Drah-
tes. Das von Ohm im Jahr 1826
bekanntgegebene “Ohm’sche Gesetz”
hat bis heute nichts von seiner Aktua-
lität eingebüßt...
(995024gd)
Hans C. Oerstedt (1777...1851).
André Marie Ampère
(1775...1836).
Georg S. Ohm (1787...1854).
R
ÜCK
-K
OPPLUNG
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Die Geschichte der Elektronik (15)
Die Geschichte der Elektronik (06)
Die Geschichte der Elektronik (17)
Die Geschichte der Elektronik (04)
Die Geschichte der Elektronik (14)
Die Geschichte der Elektronik (16)
Die Geschichte der Elektronik (08)
Die Geschichte der Elektronik (05)
Die Geschichte der Elektronik (02)
Die Geschichte der Elektronik (07)
Die Geschichte der Elektronik (11)
Die Geschichte der Elektronik (01)
więcej podobnych podstron