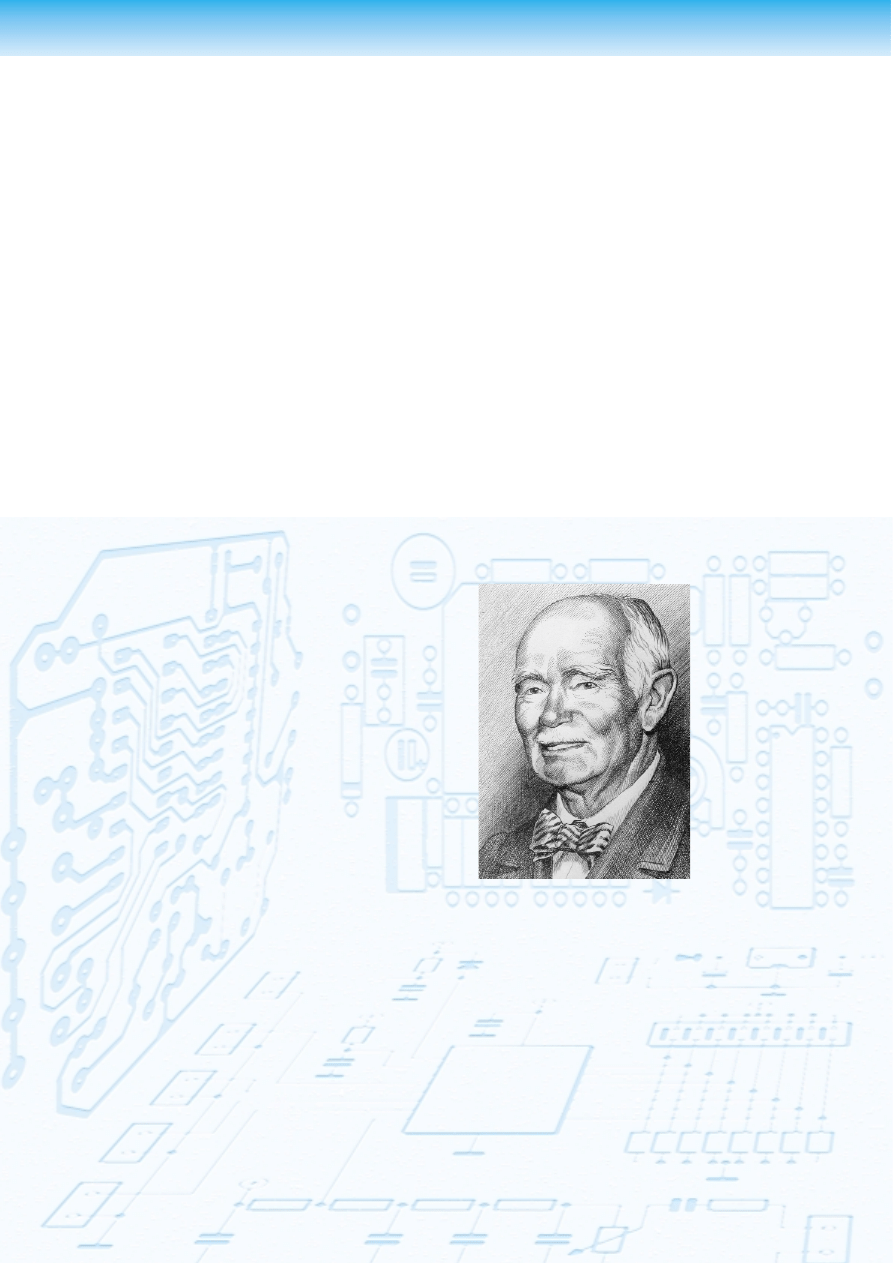
Die Geschichte der Elektronik (11)
Das Jahr 1907 gilt als das Jahr, in dem die Geburtsstunde der Elek-
tronik schlug, denn in diesem Jahr wurde die Verstärkerröhre erfun-
den. Der amerikanische Physiker Lee de Forest hatte sich mit der
Vakuum-Diode von Fleming ausgiebig beschäftigt und war auf die
Idee gekommen, zwischen dem Glühdraht und der Anode eine dritte
Elektrode in Form eines Metallgeflechts anzubringen, mit der mög-
licherweise der Elektronenstrom gesteuert werden könnte. Wenn man
an dieses ”Gitter” eine negative Spannung legt, so überlegte de
Forest, wird der Elektronenstrom in Abhängigkeit von der negativen
Spannung gebremst. Die Versuche im Jahr 1906 bestätigten die Rich-
tigkeit der Überlegungen. De Forest trat mit seiner Erfindung, von
ihm ”Audion” genannt, im März 1907 zum ersten Mal an die Öffent-
lichkeit, und noch im gleichen Jahr wurde ihm ein Patent erteilt. Das
”Audion” war der ”Triodenlampe” des Österreichers von Lieben bei
weitem überlegen. In den folgenden fünf Jahren musste noch eine
Menge Entwicklungssarbeit geleistet werden, doch schon im Jahr
1912 war es geschafft: Die Verstärkerröhre, nun ”Triode” genannt,
war tauglich für den praktischen Einsatz.
Auch in der Telefontechnik blieb die Entwicklung nicht stehen. Das
Ziel war im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts vor allem die
Automatisierung des Verbindungsaufbaus. Die erste automatische
Ortsvermittlungsstelle ging 1909 im Münchener Stadtteil Schwabing
in Betrieb, sie hatte 2500 Anschlüsse. Die Wähltechnik, die von Sie-
mens & Halske stammte, arbeitete mit weiterentwickelten Hebdreh-
wählern sowie mit einer zentralen Stromversorgung anstelle der
”Ortsbatterien” bei den Teilnehmern. Ferner konnte die Vermitt-
lungsstelle die Gespräche zur Gebührenerfassung und zu Kontroll-
zwecken vollautomatisch registrieren.
Eine Entdeckung der Physik, die auch in der modernen Elektronik
eine wichtige Bedeutung hat, ist die Supraleitung. Um das Jahr
1911 untersuchten die niederländischen Physiker Kamerlingh
Onnes und Gilles Holst das Verhalten verschiedener Stoffe bei Tem-
peraturen nahe des absoluten Nullpunkts. Sie entdeckten, dass
Quecksilber seinen elektrischen Widerstand völlig verliert und keine
Joule’schen Verluste mehr auftreten, wenn die Temperatur unter
4,2 K sinkt. Damals hatte
die Wissenschaft für die-
ses Phänomen noch keine
Erklärung. Die For-
schungsarbeiten wurden
nicht weiter fortgesetzt,
da kein praktischer Nut-
zen erkennbar war und
das flüssige Helium, das
man als Kühlmittel
brauchte, enorme Kosten
verursachte.
Die drahtlose Nachrich-
tentechnik war in den
ersten Jahrzehnten von
der rasanten Ausbreitung
der drahtlosen Telegrafie
geprägt. Die Frequenz-
bänder waren inzwischen
stark belegt, zumal die
damals eingesetzten Fun-
kenentladungssender sehr breitbandige gedämpfte Schwingungen
in den Äther schickten. Eine Erleichterung brachte das rotierende
Entladungsrad von Marconi im Jahr 1907. Eine metallene kreis-
förmige Scheibe drehte sich zwischen zwei fest montierten metalle-
nen Scheiben, wobei die rotierende Scheibe senkrecht zu den bei-
den äußeren Scheiben stand. Die rotierende Scheibe war elektrisch
über Kondensatoren und Spulen mit den äußeren Scheiben ver-
bunden. Die Schwingungserzeugung wurde durch kontinuierliche
Hochspannungsüberschläge aufrechterhalten. Im folgenden Jahr
stellte der Däne Valdemar Poulsen, der rund 20 Jahre zuvor das
erste brauchbare magnetische Tonaufnahmegerät konstruiert hatte,
seinen verbesserten Lichtbogensender vor. Bei diesem Sender war
eine feststehende Kohleelektrode gegenüber einem langsam rotie-
renden Kohlezylinder angebracht. Da sich der Kohlezylinder drehte,
fand der Lichtbogen ständig neue Kontaktpunkte, so dass er nicht
mehr einbrennen konnte.
R
ÜCK
-K
OPPLUNG
optimale Lösung des betreffenden Pro-
blems dar. Der hier abgedruckte Aus-
schnitt wurde aus Platzgründen um
einige weniger wichtige Kommentar-
zeilen gekürzt. Im Listing beginnen alle
Variablen-Namen, die der Compiler
erzeugt, mit einem Unterstrich; sie las-
sen sich dadurch von den Variablen-
Namen des Quellprogramms leicht
unterscheiden.
Bei dem Programm-Beispiel, das hier
etwas näher betrachtet werden soll,
geht es um eine Verkehrsampel-Steue-
rung. Der einfachste Weg, eine solche
Steuerung zu realisieren, ist die Ver-
wendung des Wait-Kommandos, nach-
dem die als ”Ampellichter” dienenden
LEDs umgeschaltet sind:
green = 0 ; Grün ausschalten
yellow = 0 ; Gelb ausschalten
red = 1 ; Rot einschalten
wait(3000) ; 3 Sekunden warten
Die Schaltung des Verkehrsampel-
Modells geht aus Bild 3 hervor. Bei der
praktischen Erprobung ist unbedingt zu
beachten, dass die zulässigen PIC-
Ströme nicht überschritten werden. Port
B kann insgesamt maximal 100 mA lie-
fern, die Obergrenze der einzelnen Port-
leitungen beträgt 20 mA. Die Werte der
Strombegrenzungswiderstände hängen
von den LED-Eigenschaften ab, sie müs-
sen zwischen 470
Ω und 1 k liegen.
Die Verkehrsampel läuft so lange in
einer Endlos-Schleife, bis die Betriebs-
spannung abgeschaltet wird. Das
Quellprogramm ist in Listing 1 wieder-
gegeben. Variable x wird bei jedem
Schleifendurchlauf inkrementiert, und
sobald x einen vorgegebenen Wert
erreicht, wird Variable y inkrementiert.
Die verhältnismäßig langen Schaltzeiten
der Ampel lassen sich nur mit einem
zweistufigen Schleifenzähler realisieren.
Zum Quellprogramm-Text ist noch anzu-
merken, dass die Klammern in den
if...then-Anweisungen nicht vom Com-
piler benötigt werden; sie dienen nur zur
besseren Lesbarkeit. Das Ergebnis der
Compilierung geht aus Listing 2 hervor.
Weitere auf der Diskette enthaltene
Demo-Programme sind eine zweite
Variante der Verkehrsampel-Steuerung
sowie die Steuerung eines LC-Displays.
Auch zu diesen Beispielen gehören
ausführliche Kommentare in den Quell-
programmen und natürlich die vom
Compiler erzeugten Assembler-Listings.
Syntax und Kommandos
Die vollständige Beschreibung der
Compiler-Kommandos und der Compi-
ler-Syntax findet man in dem 56-seiti-
gen Manual, das als Word-Dokumen-
ten-Datei auf der Compiler-Diskette mit-
geliefert wird. Außer dem Compiler
selbst (Dateiname: Compiler84.exe)
und den schon erwähnten Programm-
beispielen ist noch eine Readme-Datei
vorhanden, deren Text die Installation
beschreibt.
(000012)gd
X-16 - 1/2000 Elektor
EXTRA
——————————————————— PC-P
LUS
Lee de Forest (1873 bis 1961) erfand
1907 die Verstärkerröhre.
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Die Geschichte der Elektronik (15)
Die Geschichte der Elektronik (06)
Die Geschichte der Elektronik (17)
Die Geschichte der Elektronik (04)
Die Geschichte der Elektronik (14)
Die Geschichte der Elektronik (16)
Die Geschichte der Elektronik (08)
Die Geschichte der Elektronik (03)
Die Geschichte der Elektronik (05)
Die Geschichte der Elektronik (02)
Die Geschichte der Elektronik (07)
Die Geschichte der Elektronik (01)
więcej podobnych podstron