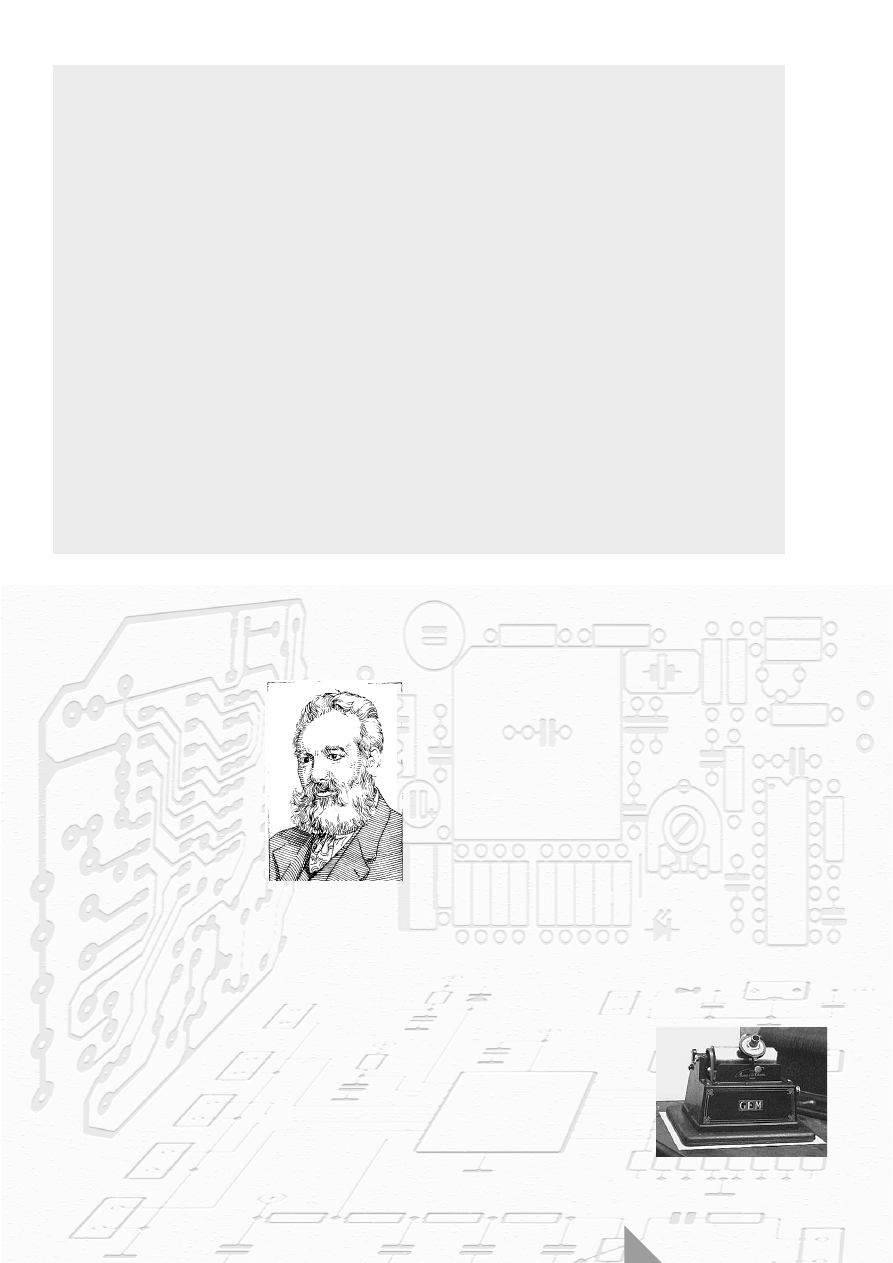
33
Elektor
9/99
Am einfachsten ist es, vom bekannten Aufbau eines analogen
PID-Reglers im kontinuierlichen Bereich auszugehen, um dann
eine diskrete Entsprechung zu finden. Im kontinuierlichen
Bereich wird der Regelalgorithmus des PID-Reglers durch fol-
gende Differentialgleichung beschrieben:
In dieser Gleichung bezeichnen K
PR
, K
DR
und K
IR
die (ein-
stellbare) Verstärkung der drei Regler (P-, D- und I-Regler) in
Bild 3. Die Gleichung kann durch Laplace-Transformationen
auch im Frequenz-Bereich dargestellt werden:
wobei angenommen wird, daß die Anfangsbedingungen 0 sind.
Die Verstärkungen der drei Teilregler (oft auch als Proportio-
nal-, Integrier- und Differenzierbeiwerte des PID-Reglers
bezeichnet) sind vom Entwickler je nach gewünschtem Regel-
verhalten festzulegen.
Im nächsten Schritt wird eine diskrete Entsprechung für den
in Gleichung (1) und (2) beschriebenen Regler gesucht. Die
rückwärtsgerichtete Differenz ist definiert als das diskrete
Zeitäquivalent für die kontinuierliche Zeitableitung einer Funk-
tion. Sie ergibt sich aus
wobei T die Periode des Abtastsignals (= Abtastzeitintervall) ist.
Der Summenwert ist definiert als das diskrete Zeitäquivalent
des kontinuierlichen Zeitintegrals einer Funktion. Sie ergibt
sich aus
Wenn man die in (3) und (4) gezeigten Beziehungen auf die
in den ersten beiden anwendet, erhält man die im Artikel ange-
gebene Gleichung für den Regelalgorithmus des digitalen
PID-Reglers:
Der Index k ist wieder der laufende Zähler der einzelnen Mes-
sungen:
e
(k-2)
ist demnach die Regelabweichung der vorvorigen Mes-
sung.
u
u
q e
q e
q e
k
k
k
k
k
=
+ ⋅ + ⋅
+ ⋅
−
−
−
(
)
(
)
(
)
1
0
1
1
2
2
f
T f a
T
f a
T
f b
a
b
( )
(
)
(
) . . .
( )
τ =
+ +
+
+ +
[
]
∫
2
∆f t
f t
f t
T
T
( )
( )
(
) /
=
− −
[
]
u s
K
e s
K
s e s
K
s e s
PR
DR
ID
( )
( )
( ) (
/ ) ( )
=
⋅
+
⋅ ⋅
+
u t
K
e t
K
de t dt
K
e
d
PR
DR
IR
t
( )
( )
( )/
( )
=
⋅
+
⋅
+
⋅
∫
τ τ
0
Konzeption eines digitalen PID-Reglers
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Die Geschichte der Elektronik (7)
Telefon, Phonograph und Glühlampe
Wichtige Erfindungen und Entwicklun-
gen folgten gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts immer schneller aufeinander.
Ein wichtiges Ereignis war die Erfin-
dung des Telefons.
Die erste Tonübertragung mit Hilfe
eines elektrischen Stroms gelang dem
deutschen Lehrer und Physiker Philipp
Reis bereits 1861 mit seinem Telephon
genannten Apparat, bei dem durch die
Schwingungen einer Membrane ein
Stromkreis unterbrochen wurde. Daß
sich seine Erfindung nicht durchsetzen
konnte, lag weniger an der (schlechten)
Übertragungsqualität als am Zeitpunkt.
Philipp Reis war wie viele andere Erfinder seiner Zeit zu weit voraus.
Der Durchbruch gelang erst Alexander Graham Bell im Jahr 1875.
Als elektroakustischen Wandler verwendete Bell ein trichterförmiges Gebilde,
dessen dünneres Ende von einer metallischen Membran abgeschlossen war.
Unmittelbar dahinter befand sich ein Stabmagnet mit einer aufgewickelten Spule.
Lautes Sprechen in den Trichter brachte die Membran in Schwingungen, so daß
sich der Abstand zwischen Membran und Stabmagnet änderte. Dadurch ent-
stand in der Spule eine zum Schalldruck proportionale Wechselspannung. Wur-
den zwei derartige ”Telefone” miteinander über eine Zweidrahtleitung verbun-
den, dann brachte die Spannung des ersten Apparats die Membran des zweiten
zum Schwingen. Die Sprache war leise, aber deutlich wahrnehmbar. Da zum
Sprechen und Hören die gleiche Vorrichtung diente, mußte sie beim ”Telefonie-
ren” mal vor den Mund und mal ans Ohr gehalten werden. Diese Unbequem-
lichkeit war durch Weiterentwicklungen des Bell’schen Telefons bald überwun-
den. Schon 1878 wurde in den USA das erste öffentliche Telefonnetz eröffnet.
Bells Erfindung gilt noch heute als Ursprung der modernen Telekommunikation.
Mit einer nicht weniger revolutionären Erfindung machte Thomas Alva Edison
im Jahr 1877 von sich reden. Edison hatte einen Apparat entwickelt, der Schall
mechanisch aufzeichnen und wiedergeben konnte. Auf einer von Hand in Rota-
tion versetzten hölzernen Walze befand sich eine Lage Blattzinn. Ein Stichel,
mechanisch gekoppelt mit einer Membran, wurde von einer Mechanik langsam
an der Walze vorbeigeführt. Auftreffende Schallwellen brachten die Membran
in Schwingungen, so daß der Stichel die Zinnschicht unterschiedlich tief einritzte.
Auf der Walze entstand eine spiralförmige ”Tonspur”. Bei der Wiedergabe tastete
der Stichel die Spur ab, und die Membran wandelte die mechanischen Schwin-
gungen in Schall zurück. Die Wiedergabequalität dieses von Edison als ”Phono-
graph” bezeichneten Apparats ließ noch viele Wünsche offen. Ein Jahr später
ersetzte Edison die Zinnschicht durch eine Schicht aus Wachs, und den Antrieb
übernahm nun ein Elektromotor. Die Wiedergabequalität wurde dadurch deut-
lich verbessert. Kurze Zeit später schlug Emile Berliner vor, den Stichel bei der
Aufnahme nicht in die Tiefe, sondern parallel zur Walzenoberfläche zu bewegen.
Berliner ersetzte 1888 die Walze durch eine runde Metallscheibe, auf der die Ton-
spur durch einen Ätzprozeß aufgebracht war. Diese Scheibe war der Vorläufer
der gepreßten mechanischen Schallplatte.
Eine dritte, nicht weniger revolutionäre Entwicklung war in dieser Zeit das elek-
trische Licht. Da die Fäden der bis dahin verfügbaren Glühlampen nach kurzer
Zeit durchbrannten, wurde das elektrische Licht mehr oder weniger als Spielerei
abgetan. Das änderte sich, als Josef Wilson Swan im Jahr 1879 eine Glühlampe
der Öffentlichkeit vorstellte, deren Kolben im Vakuum verschlossen worden war.
Der Glühfaden hielt nun allen damaligen Anforderungen an eine moderne
künstliche Lichtquelle stand. Leider hatte Swan das Pech, daß Edison eine der-
artige Lampe schon einige Monate früher zum Patent angemeldet hatte. Im Jahr
1882 nahm die ”Edison Lamp Com-
pany” die Produktion von Glühlam-
pen auf, deren Fäden aus japanischem
Bambus bestanden. Swan ließ sich bei
seinen Entwicklungen nicht beirren, er
erhielt 1880 ein britisches Patent auf
einen Glühfaden aus karbonisierter
Baumwolle. Auf dem europäischen
Kontinent nahm 1884 die Glühlam-
penfabrik ”Electriciteits Maatschappij
Systeem de Khotinskij” in Rotterdam
die Produktion auf.
(995073)gd
R
ÜCK
-K
OPPLUNG
Alexander Graham Bell
(1847...1922)
Edisons historischer
Phonograph
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Die Geschichte der Elektronik (15)
Die Geschichte der Elektronik (06)
Die Geschichte der Elektronik (17)
Die Geschichte der Elektronik (04)
Die Geschichte der Elektronik (14)
Die Geschichte der Elektronik (16)
Die Geschichte der Elektronik (08)
Die Geschichte der Elektronik (03)
Die Geschichte der Elektronik (05)
Die Geschichte der Elektronik (02)
Die Geschichte der Elektronik (11)
Die Geschichte der Elektronik (01)
więcej podobnych podstron