
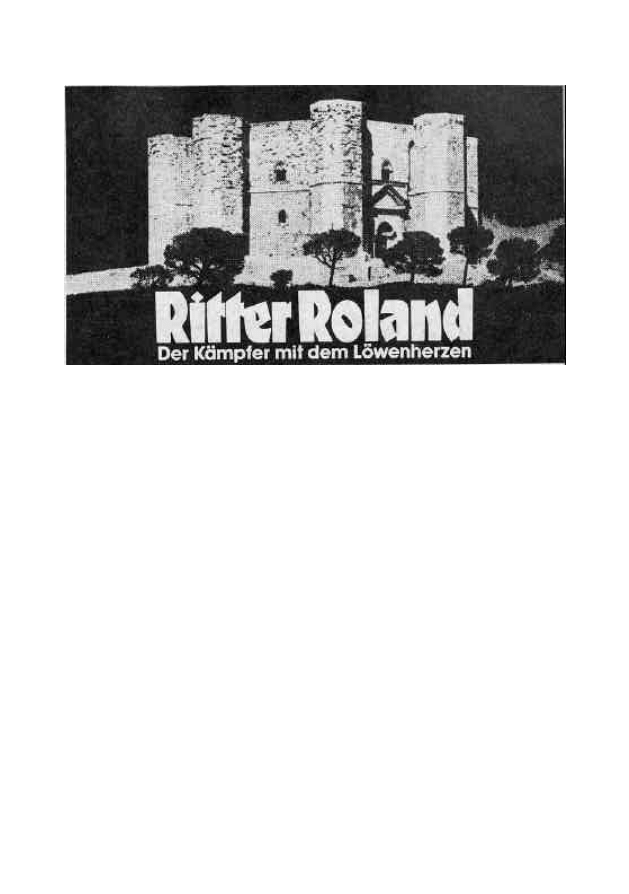
Wittich – der Schrecken
vom Hotzenwald
von Joachim Honnef
scanned by : horseman
kleser: Larentia
Version 1.0
Sebastian Müller fluchte. Ein Baumstamm blockierte den
Waldweg hinter der Biegung. Sebastian war ein erfahrener
Fuhrmann. Er handelte schnell und besonnen. Während er
das Gespann zügelte, warnte er den Fahrer des nächsten
Wagens mit einem Alarmschrei, damit der nicht auffuhr.
Es gelang Sebastian, den Wagen gerade noch vor der
hohen Barriere anzuhalten.
Die Begleitreiter des Transports hatten sofort bei
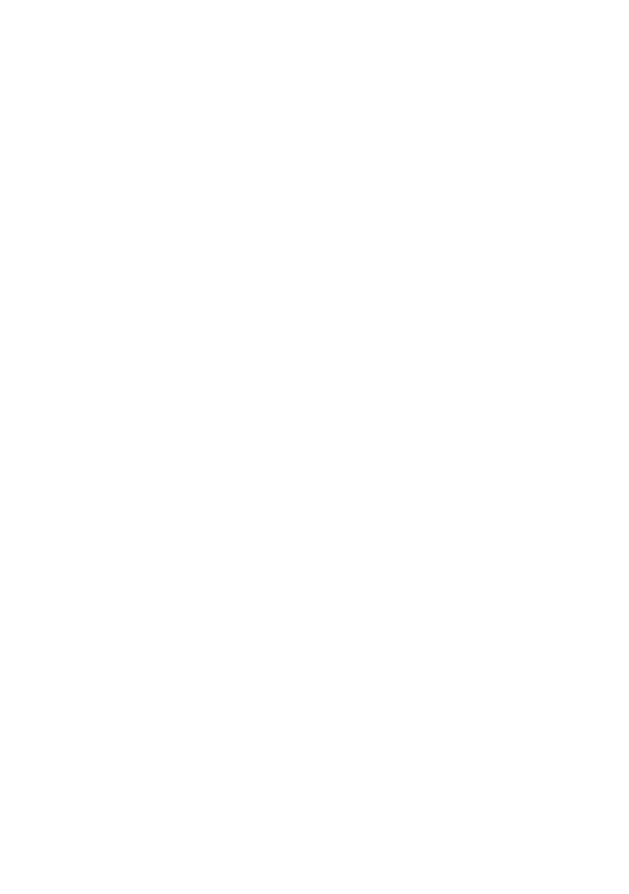
Sebastians Alarmschrei die Schwerter gezückt.
»Überfall!« schrie einer.

Die Blicke der Männer tasteten angespannt über die Hänge des
Hohlwegs.
Kein Räuber war zu sehen.
Eines der Gespannpferde wieherte. Dann herrschte plötzlich
gespenstische Stille. Staub senkte sich.
»Zurück!« rief Klaus Petereit, der Führer der vierköpfigen Eskorte.
»Und wie?« brüllte Sebastian, und er fügte ganz leise hinzu: »Du
Hornochse!«
Sein Ärger war berechtigt. Es gab keine Möglichkeit zum Wenden.
Sie steckten in der Falle.
*
Immer noch ließ sich niemand blicken. Nichts geschah.
Die Stille hatte etwas Unheimliches.
»Vielleicht ist das nur ein Zufall«, sagte Klaus Petereit mit rauher
Stimme. »Ein vom Blitz gefällter Baum ...«
Dummbeutel! dachte Sebastian.
»Habt Ihr schon mal erlebt, daß der Blitz einen Baum sauber
absägt?« rief er.
Sein Blick tastete nervös und angespannt über die Hänge. Nichts
rührte sich zwischen den Büschen und Bäumen.
Plötzlich ertönte ein Lachen. Ein seltsam schrilles Lachen.
Die Männer des Transports starrten nach rechts empor. Von dort
oben zwischen den Buchen war das Lachen erklungen.
Doch niemand war zu sehen. - Klaus Petereit fluchte lästerlich.
»Aber, aber«, erklang dann eine Stimme zwischen den Buchen.
»Wer wird denn so etwas Böses von sich geben!« Wieder war das
schrille Lachen zu hören.
Klaus Petereit verlor die Nerven. Oder er wollte allen seine
Tapferkeit beweisen.
»Attacke!« schrie er seinen Männern zu, trieb sein Roß wild an
und jagte mit hocherhobenem Schwert zwischen die Büsche am
Wegesrand. Tollkühn wollte er den Hang hinauf, geradenwegs zu

den Buchen, wo er den Wegelagerer wußte.
Er kam nicht weit.
Sein Pferd brach, von einem Pfeil getroffen, zusammen. Wiehernd
stürzte es den Hang hinunter. Wild zuckten die Hufe.
Klaus Petereit flog in hohem Bogen aus dem Sattel, überschlug
sich im Sturz und prallte gegen das Vorderrad von Sebastians
Wagen. Er schrie auf, als er sich den Kopf stieß.
Dann verstummte der Schrei wie abgeschnitten. Ein Pfeil ragte
plötzlich aus seiner Brust.
Klaus Petereit, der längst das Schwert verloren hatte, umklammerte
unbewußt den Pfeilschaft mit beiden Händen. Ein Zittern durchlief
seinen Körper. Er bäumte sich noch einmal auf, dann sank er mit
einem röchelnden Laut in den Staub.
Sebastian starrte entsetzt. Ebenso die anderen Fahrer und die
Männer der Eskorte, die sofort ihre Rösser pariert hatten.
Klaus Petereit hatte sich während der langen Fahrt als großer
Meister und Besserwisser aufgespielt, der mit seinem ständigen
Herumkommandieren allen Kutschern und Begleitreitern auf die
Nerven gegangen war. Doch ein solches Ende hatte er gewiß nicht
verdient.
»Werft eure Schwerter und Messer weg, oder ihr seid alle des
Todes!« ertönte die Stimme von den Buchen her.
Als wollte der Mann seinen Worten Nachdruck verleihen, flogen
jetzt weitere Pfeile heran. Von allen Seiten, wie es schien. Jenseits
des Baumstamms tauchte eine Gestalt auf, zu beiden Seiten des
Hohlwegs und sogar hinter dem letzten Wagen war ein Bogenschütze
zu sehen.
Pfeile schwirrten heran. Sebastian zuckte zusammen und erschrak
bis ins Mark, als ihm ein Pfeil den Schlapphut löcherte.
Zögernd ließen die Männer der Eskorte ihre Waffen fallen.
Sebastian dachte an Frau, Geliebte und Kinder und hob
unaufgefordert die Hände. Andere Fahrer folgten seinem Beispiel.
Der Räuber oben bei den Buchen lachte.
»So ist's brav, Leute. So dürft ihr noch ein bißchen am Leben

bleiben. Nicht lange, aber ein bißchen ist besser als gar nichts.«
Abermals erklang das seltsam schrille Lachen.
Den Männern des Transports lief ein kalter Schauer über den
Rücken. Trotz der schwülen Sommerhitze, die ihnen an diesem Tag
so sehr zu schaffen gemacht hatte ...
*
Sie hieß Helga Altenmayer, und sie war das bezauberndste Geschöpf,
das Ritter Roland auf dem langen Ritt in den Schwarzwald
kennengelernt hatte. Nun, er war nicht unterwegs, um sich die
Schönen dieser Gegend anzusehen. Die Zeit drängte. Die Knappen
Louis und Pierre erwarteten ihn in Peterzell. Sie hatten eine heiße
Spur im Fall der vielen verschollenen Menschen und ebenso spurlos
verschwundenen Frachtwagen.
Doch daran dachte Roland im Augenblick nicht.
Helga nahm ihn mit ihrem Liebreiz gefangen.
Sie war von anmutiger Gestalt, klein und grazil, und wenn sie
lächelte, funkelten ihre graublauen Augen, und um die Winkel ihrer
sinnlich geschwungenen Lippen bildeten sich lustige Grübchen.
So wie jetzt.
Roland hatte sie am Ufer des Wildbaches weinend angetroffen,
einsam und verloren wie ein verirrtes Täubchen. Natürlich gebot es
Roland die Ritterpflicht, die arme Maid zu trösten.
Sie war voller Scheu, ja Furcht gewesen, verständlich nach dem,
was ihr widerfahren war. Irgendein Haderlump hatte ihr Roß
gestohlen, während sie Pilze gesammelt hatte. Nun, ihre Tränen
waren schnell versiegt, als Roland ihr galant angeboten hatte, sie auf
seinem Roß bis nach Peterzell mitzunehmen.
Und ebenso schnell hatte sie ihre Scheu verloren.
Nie hätte Ritter Roland die betrübliche Lage dieser Maid
ausgenutzt. Nie hätte er Hand an diesen zarten Mädchenkörper gelegt
- wenn er nicht das Gefühl gehabt hätte, daß sie ihn dazu ermunterte.
»Ein Ritter seid Ihr?« Sie musterte ihn prüfend, als er sich

vorgestellt hatte. Ihm waren die Zweifel in ihrem Blick und Tonfall
nicht entgangen.
»So ist es, schöne Frau.«
Erst jetzt fiel ihm ein, daß er sich in Peterzell eigentlich als
Händler hatte ausgeben wollen, und er ärgerte sich. Helga hatte ihn
verwirrt. Er nahm sich vor, sie unterwegs um Stillschweigen zu
bitten.
Ihre Wangen röteten sich leicht ob seines Kompliments. Ein kurzes
Auf und Ab der langen Wimpern, und dann senkte sie den Blick.
Ritter Roland hatte Gelegenheit, einen weiteren Blick auf ihre
Gestalt zu werfen, auf die kleinen, lockenden Hügel unter ihrer
dünnen Leinenbluse, auf den Schwung ihrer Hüften, um die sich der
lange braune Rock spannte.
Als sie aufblickte, kam er sich wie ein ertappter Sünder vor, denn
sie hatte noch seinen Blick aufgefangen.
»Mich dünkt, Ihr seid ein Mannsbild wie jedes andere«, sagte sie,
und es klang leicht tadelnd. »Ritter reiten in blitzender Rüstung, mit
Schild und Schwert und Knappen im Gefolge ...«
»Nicht immer«, erwiderte Roland lächelnd. »Ich werde Euch
unterwegs erzählen, weshalb ich wie ein Krämer gekleidet bin.«
Dann wollte er ihr galant auf sein Roß helfen, und dabei geschah es
dann.
Als er sie hochhob, sank sie ihm gegen die Brust. Fast hatte Ritter
Roland das Gefühl, sie werde in seinen Armen ohnmächtig. Sie
zitterte wie ein frierendes Vögelchen, obwohl es heiß und schwül an
diesem Sommertag war. Er nahm den Duft ihres Haares wahr, spürte
ihren geschmeidigen Körper, und ein prickelndes Gefühl stieg in ihm
auf.
Er wußte nicht, was über ihn kam. Vielleicht wollte er ihr die
Angst nehmen, das Zittern.
Jedenfalls küßte er diese weichen, schwellenden Lippen.
Zunächst wurde sie stocksteif. Doch das Zittern hörte auf. Dann
erwiderte sie den Kuß. Heftig atmend bog sie dann den Kopf zurück.
»Ein Mannsbild wie jedes andere«, seufzte sie.

Ihr Blick verwirrte ihn. Es lag etwas Wissendes in diesen Augen,
etwas Erfahrenes, obwohl sie doch noch recht jung war.
»Verzeiht, ich bitte Euch ...«
»Oh, Ihr bittet?« In ihren Augen schienen plötzlich Funken zu
tanzen.
Er vermochte sich keinen Reim auf ihre Worte und ihre Miene zu
machen. Erst jetzt wurde ihm bewußt, daß er sie immer noch auf den
Armen hielt. Sie war leicht wie eine Feder - wie die Poeten zu
übertreiben pflegten.
»Ja ... ich wollte nicht...« Ritter Roland ärgerte sich über seine
Verlegenheit. Dieser Blick! Er schien bis in die Tiefen seiner Seele
zu dringen und seine geheimen Gedanken zu erraten.
Ihr Gesäß, das er mit einer Hand untergefaßt hatte, bewegte sich.
Dann streckte sie die Beine aus und stellte sich auf den Boden.
Sie spielte mit dem obersten Knopf ihrer Bluse. Leise sagte sie:
»Ihr seid verschwitzt und staubig vom Ritt. Ihr solltet Euch im Bache
baden, bevor wir ... reiten.«
Sie errötete von neuem und senkte den Blick.
»Ich werde derweil meinen Korb mit Pilzen holen, den ich im
Walde zurückließ«, fügte sie hinzu.
Und flugs eilte sie mit anmutigem Gang davon.
Ritter Roland blickte ihr ein wenig benommen nach.
Mit heftig pochendem Herzen fragte er sich, wie sie ihre Worte
gemeint hatte. Er glaubte noch, ihre weichen warmen Lippen auf
seinem Mund zu spüren. Ihr Blick, ihr Lächeln waren fast einladend
gewesen. Oder hatte sie ihn zum Bade aufgefordert, weil er nach
Schweiß und Pferd roch und ihr das nicht gefiel, wenn sie mit ihm
auf einem Roß saß?
Er blickte an sich hinab. Er war in der Tat staubig und verschwitzt.
Ein langer Ritt lag hinter ihm. Er hatte ebenso wie die Knappen eine
Spur verfolgt - allerdings ohne Erfolg. Nur kurz dachte er daran, daß
Louis und Pierre ihn erwarteten. Aber er mußte seinem Roß ohnehin
noch eine Pause gönnen. Warum nicht hier? Und ein Bad konnte
gewiß nicht schaden.

Gedacht, getan.
Er genoß das erfrischende klare Wasser des Baches, als Helga
zurückkehrte. Sie trug einen Korb aus geflochtener Weide.
Lächelnd blickte sie zu ihm herüber. Roland tauchte schnell etwas
tiefer ins Wasser. Noch war er sich nicht ganz im klaren, wie sie ihre
Worte gemeint hatte. Noch geziemte es sich nicht, den nackten Ritter
zu zeigen.
Doch im nächsten Augenblick verloren sich seine Zweifel.
»Ich komme gleich zu dir«, rief sie, während sie mit leicht
schwingenden Hüften zu Rolands Roß schritt.
Ritter Roland frohlockte.
Seine Haut kabbelte im kühlen Naß, und sein Puls beschleunigte
sich. Der Zufall hat es gut gemeint, dachte er voller Vorfreude.
Eine dunkle Wolke schob sich vor die Sonne. In der Ferne war ein
dumpfes Grollen zu vernehmen. Ein Gewitter zog herauf. Es würde
Abkühlung nach der drückenden Schwüle bringen.
Ritter Roland lächelte.
Dann erstarb sein Lächeln von einem Augenblick zum anderen.
Er sah, wie Helga behende auf sein Roß stieg, das tänzelnde Tier
mit hartem Zügeldruck parierte und dann zum Galopp trieb.
»He, was ...«, begann er.
»Bade wohl, du Schmutzfink!« rief Helga.
Und lachend galoppierte sie davon.
Zurück blieb nur der Korb mit ein paar Pilzen.
Und Ritter Roland, der sich in diesem Augenblick reichlich dumm
vorkam.
Die ersten Regentropfen fielen.
*
»Das gibt ein Gewitter«, murmelte der Knappe Pierre mit einem
Blick zum wolkenverhangenen Himmel.
»Wurde auch Zeit nach diesen Hundstagen«, brummte Louis und
wischte sich über die schweißnasse Stirn. »Diese Affenhitze ist ja

nicht auszuhalten.«
»Die Affen müßten sich darin doch wohlfühlen«, bemerkte Pierre
mit einem anzüglichen Grinsen.
Louis kratzte sich am schwarzen Bart. »Freut mich, daß es dir
gutgeht«, brummte er. »Ich schwitze jedenfalls.«
Der Himmel weinte die ersten Regentropfen.
»Möchte wissen, wo Roland bleibt«, sagte Pierre. »Ob er unsere
Botschaft nicht erhalten hat?«
Louis zuckte mit den breiten Schultern. »Vielleicht hat er selbst
eine heiße Spur gefunden. Wir können nur warten.«
In der Ferne, im Norden, grollte Donner.
»Der Regen wird alle Spuren auslöschen«, murmelte Pierre.
»Wir wissen immerhin, wo der letzte Transport verschwand«,
sagte Louis. »Wenn Roland eintrifft, suchen wir von dort aus
weiter.«
Pierre erhob sich vom Rand des Brunnens auf dem Marktplatz.
»Ich schlage vor, wir nehmen in der Schenke einen zur Brust«,
sagte er.
»Gute Idee«, brummte Louis. Dann fiel ihm ein, daß er sich mit der
drallen blonden Krämerstochter Almuth verabredet hatte. Um drei
Uhr bei der Brücke am Bach. Außerhalb des Ortes. Diskret. Auf
einen Spaziergang in allen Ehren - so hatte Louis gesagt, doch
Almuths Blick und ihr Lächeln hatten ihn mehr erhoffen lassen.
Hoffentlich fällt das Stelldichein nicht ins Wasser, dachte Louis
mit einem besorgten Blick zum Himmel.
»Geh nur schon zur Schenke, Pierre«, sagte Louis. »Ich komme
nach.« Und als er Pierres fragenden Blick auffing, fügte er hinzu:
»Ich will mich noch ein wenig beim Krämer umhören. Ich vergaß ihn
zu fragen, wer von dem Transport wußte, der auf dem Weg hierhin
spurlos verschwand.«
Der Vorwand klang reichlich dünn, doch Pierre schien es nicht zu
bemerken.
»Soll ich mitkommen?« fragte Pierre.
»Nein, nein«, sagte Louis hastig. »Ich schaff das schon alleine.

Geh nur und nimm dir einen Schoppen Wein zur Brust.«
Ich nehme mir derweil etwas anderes zur Brust, dachte er
vergnügt.
»Du bist sehr pflichtbewußt«, sagte Pierre mit anerkennendem
Blick.
»Nun ja, man tut, was man kann, lieber Pierre.« Louis grinste.
»Und mach dir keine Sorgen, wenn es etwas länger dauert.«
»Nimm dir nur Zeit«, sagte Pierre lächelnd. Er schlenderte zur
Schenke hinüber. »Und grüß mir Almuth«, rief er über die Schulter,
bevor er die Schenke betrat. »Ihr solltet einen Schirm mitnehmen.«
Louis blickte verdutzt.
»Woher weiß er ...?« murmelte er und kratzte sich am Bart.
Er konnte nicht wissen, daß Pierre durch Zufall den Flirt der
beiden in der Kammer hinter dem Krämerladen belauscht hatte, als
sie bei dem Krämer Erkundigungen über den verschwundenen
Warentransport eingeholt hatten. Der Krämer war in seine Wohnung
gegangen, um die Liste der bestellten Waren zu holen. Pierre hatte
sich müßig im Laden umgesehen und dabei gehört, wie Louis und
die Krämerstochter die ersten zarten Bande geknüpft hatten ...
Louis zuckte mit den Schultern und ging über die Straße.
Er ahnte nicht, daß er Pierre so bald nicht wiedersehen sollte.
*
Vier Männer hielten sich in »Wöhrles Gasthof« auf. Sie waren
schäbig gekleidet und wirkten wie wilde Gesellen. Vermutlich
Holzfäller, dachte Pierre.
Ihr Gespräch verstummte bei Pierres Eintreten, und sie musterten
ihn mit finsteren Blicken.
Pierre sah zum Schanktisch. Von Wöhrle, dem Wirt mit dem
rosigen Mondgesicht, war nichts zu sehen.
Pierre setzte sich an einen der blankgescheuderten Eichentische
unter die Galerie der Hirschgeweihe, die die Wand zierten. Zwei
Hirschköpfe blickten irgendwie vorwurfsvoll auf Pierre hinab. Den
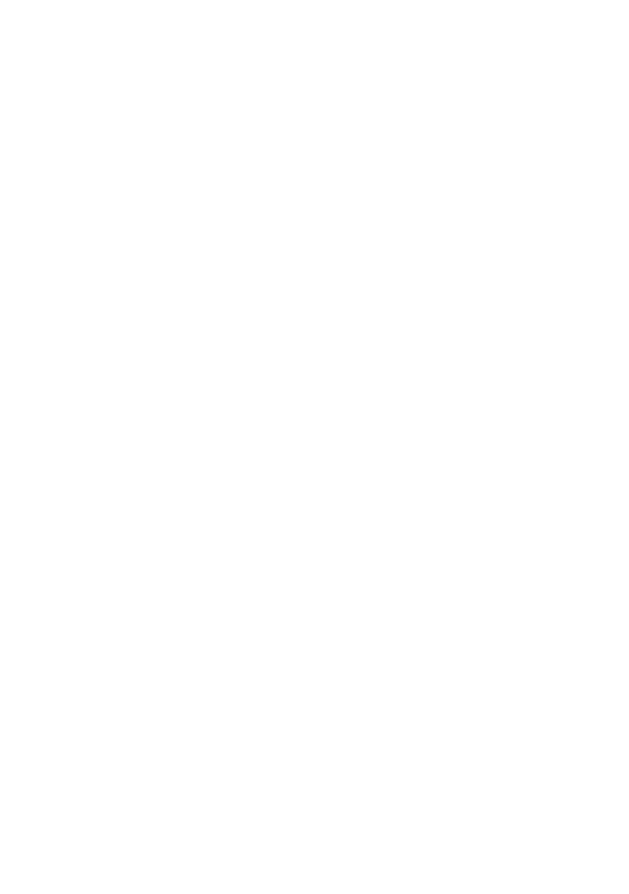
Eindruck hatte Pierre schon gehabt, als er zusammen mit Louis zum
ersten Mal diese kleine gemütliche Schenke besucht hatte.
»Na klar blicken die ärgerlich«, hatte Louis lachend gesagt, als
Pierre ihm von seinem Eindruck erzählt hatte. »So würdest du auch
glotzen, wenn, sie deinen Schädel an die Wand nageln.«
Pierre schreckte aus seinen Gedanken und blickte auf. Ein Mann
war an seinen Tisch getreten. Nicht der Wirt, sondern einer der
Holzfäller.
Ein graubärtiger Riese mit rotgeäderter Knollennase und kleinen
grünen Augen.
»Wo ist der andere?« fragte der Hüne mit rauher Stimme.
»Welcher andere ...?« begann Pierre. Dann blieb ihm das Wort im
Halse stecken.
Der Graubart hielt plötzlich wie durch Zauberei einen Dolch in der
Faust.
»Quatsch nicht«, zischte er. »Wo ist der Schwarzbart, mit dem du
hier herumschnüffelst?«
Pierre starrte auf den Dolch, den ihm der Kerl drohend vor die
Brust hielt und schluckte.
Schlagartig wurde ihm klar, daß der Mann kein Holzfäller war und
daß er auf sie gewartet hatte. Schließlich hatten er und Louis in
diesem Gasthof eine Kammer genommen, und früher oder später
hätten sie sich dort ohnehin blicken lassen müssen.
Angst stieg in Pierre auf.
Sie hatten vorsichtig Ermittlungen angestellt, doch irgend jemand
mußte geplaudert haben. Oder sie hatten gar in Unkenntnis einem
Mitglied der Räuberbande Fragen nach den verschwundenen
Menschen und Transporten gestellt. Oder die Bande hatte Spitzel im
Ort. Oder ...
Pierres Gedanken jagten sich.
»Ich weiß nicht ...«, begann er. Dann wurde er stocksteif.
Der Graubart hielt ihm jetzt den Dolch an die Kehle!
Aus den Augenwinkeln heraus sah Pierre, wie sich die anderen drei
Kerle grinsend erhoben, und schlagartig erkannte er, daß von ihnen
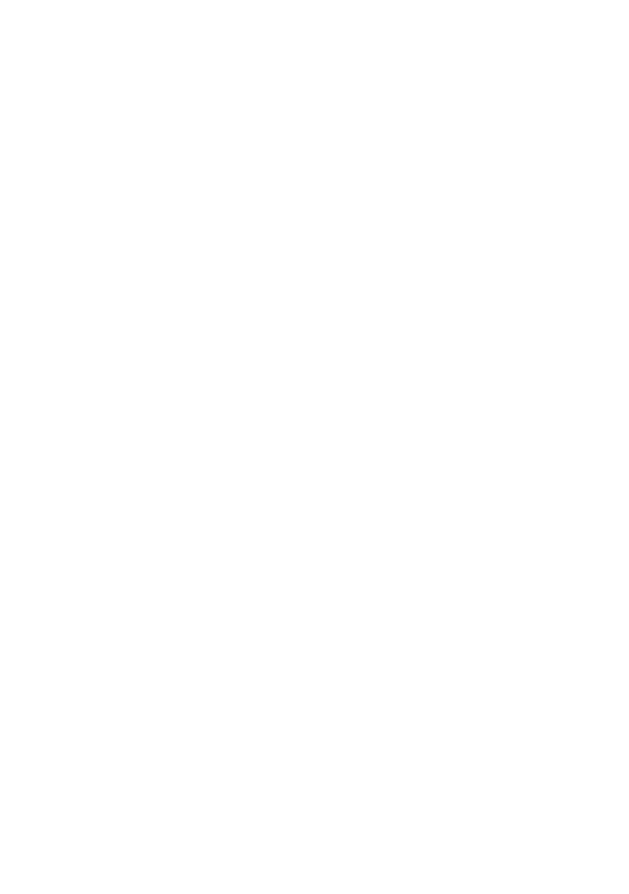
keine Hilfe zu erwarten war: Es mußten Kumpane des graubärtigen
Hünen sein.
Grüne, kalte Augen starrten Pierre drohend an. Pierre verspürte ein
flaues Gefühl im Magen. Als krabbelten Ameisen darin herum.
»Ich frage nicht noch einmal«, zischte der Mann, und die
Dolchspitze ritzte Pierres Haut.
»Alfons, beeil dich«, sagte einer der anderen. »Der Wirt könnte
aufwachen.«
»Dann verpaß ihm noch eine!« sagte Alfons gereizt.
»Es könnten auch Gäste kommen«, sagte einer der Männer, der
sich bei der Tür postiert hatte und hinausspähte. »Am besten nehmen
wir ihn mit und kitzeln ihn, bis er ...«
Alfons wandte sich ärgerlich dem Mann zu, der ihn zur Eile
gemahnt hatte. Unbewußt hatte er dabei die Hand mit dem Dolch
herumgeschwenkt, fort von Pierres Kehle.
Und in diesem Moment handelte Pierre mit dem Mute der
Verzweiflung.
Er konnte sich vorstellen, was der Kerl mit »Kitzeln« meinte. Und
er war kitzlig. Deshalb setzte er alles auf eine Karte.
Er ließ sich mitsamt dem Stuhl hintenüber fallen und riß dabei die
Stiefelspitze hoch.
Er traf Alfons am Handgelenk. Brüllend ließ der Kerl den Dolch
fallen.
Pierre prallte zu Boden, rollte sich herum und sprang auf.
Der Knappe wollte weg, nichts wie weg.
Doch da schnellte Alfons schon auf ihn zu. Im Hechtsprung wollte
er sich auf Pierre werfen.
Der Knappe wich gedankenschnell aus. Alfons konnte seinen
Schwung nicht mehr abfangen. Er konnte nur noch schützend die
Arme vor den Kopf reißen, dann krachte er auch schon auf die
Dielen der Schenke. Er schrammte ein Stück über den Boden und
schlug gegen ein Tischbein. Benommen blieb er liegen und überlegte
wohl, wie er dort hingekommen war.
Pierre blieb keine Zeit zum Aufatmen. Er konnte weder flüchten,

noch sein Messer ziehen. Denn indessen waren die anderen drei
Kerle heran.
Einer hatte einen Stuhl hochgerissen und schwang ihn jetzt wie
eine Keule. Instinktiv riß Pierre noch seinen Kopf zur Seite. Doch
ganz schaffte er es nicht mehr. Ein Stuhlbein streifte ihn an der
Wange und brach ab. Pierre schwankte und war sekundenlang vor
Schmerzen wie betäubt.
Ein Fußtritt schleuderte ihn zu Boden.
Pierre riß in seiner Verzweiflung das Messer aus der Lederscheide
am Gürtel. Ein Stiefel traf ihn am Arm. Das Messer entglitt ihm.
Einer der Angreifer riß es an sich.
Wie durch einen blutigen Schleier nahm Pierre das verzerrte
Gesicht des Kerls über sich wahr. Er sah, wie der Mann mit dem
Messer ausholte.
»Nein!«
Er wußte nicht, daß er es in Todesangst schrie.
Die Messerklinge stieß auf ihn zu.
Aus! durchfuhr es den Knappen.
Dann schienen Blitz und Donner seinen Schädel zu sprengen, und
Messer und Mann verschwammen vor seinen Augen und gingen in
tiefe Finsternis über.
*
»Haaar, ihr vierbeinigen Schnecken! Schneller, ihr lahmen
Mistviecher! Schneller, sonst geraten wir mitten in das Gewitter!«
Paul Ockenfels trieb das Gespann mit der Peitsche an.
Paul ließ seinen Blick durch das grüne Tal gleiten. Der Fahrweg
führte am Ufer des plätschernden Baches entlang und wand sich
durch einen Kiefernwald. Es war ein idyllischer Anblick, doch Paul
hatte keinen Blick für die Schönheiten der Natur. Besorgt schaute er
zurück. Dunkle Wolken zogen heran. In der Ferne grollte Donner.
Wind war aufgekommen. Paul bezweifelte, es bis Peterzell zu
schaffen, bevor das Unwetter losbrach.

Die Gespannpferde streckten sich. Die Kutsche schlingerte über
den ausgefahrenen Weg. Ein Reh brach voraus aus seiner
Waldschneise, äugte zu dem herandonnernden Etwas hin und sprang
flugs in die Sicherheit des Waldes zurück.
Paul ließ von neuem die Peitsche knallen.
Die Passagiere werden ganz schön durchgerüttelt, dachte er, und
sein faltiges Gesicht verzog sich zu einem Grinsen.
Dann sah er die Passagiere vor seinem geistigen Auge, und sein
Grinsen wurde noch breiter.
In der Kutsche saßen drei Damen.
Und was für welche.
Nun, der Begriff »Dame« paßte nicht so ganz genau. Sagen wir
eher Weiber! dachte Paul schmunzelnd. Eine Hellblonde, eine
Schwarze und eine Rothaarige - wenn man nur mal nach der
Haarfarbe ging. Eine war groß und schlank, eine klein und mollig
und eine war besonders vollbusig - das war die Blonde.
Sie alle trugen Nonnenkleidung, doch Paul wußte, daß sie keine
Nonnen waren. Schließlich hatte er sie abgeholt, und das Haus, in
dem sie lebten, war gewiß kein Kloster. Und auch ihre Herrin, die sie
als »Mutter« bezeichneten, war alles andere als eine Schwester
Oberin.
Sie hatten die Verkleidung aus Sicherheitsgründen gewählt. In
letzter Zeit war es gefährlich, im Schwarzwald zu reisen. Kutschen
verschwanden spurlos mitsamt den Passagieren. Wagen
verschwanden mit Fahrern und Fracht als hätte sie der Erdboden
verschlungen. Manch abergläubische Seele dachte an bösen Zauber
und Übernatürliches. Andere Leute vermuteten, daß eine
Räuberbande ihr Unwesen trieb. Doch auch sie konnten sich nicht
erklären, weshalb die Menschen spurlos verschwanden. Niemals
hatte es irgendeine Lösegeldforderung gegeben. Arm und Reich,
Jung und Alt waren verschwunden, überwiegend Männer, doch in
letzter Zeit auch einige Frauen.
Die Angst ging um im Schwarzwald.
Deshalb hatten sich die drei Damen als Nonnen verkleidet. Selbst

die hartgesottensten Räuber würden eine Dienerin des Herrgotts
verschonen - oder?
Die Blonde gefiel Paul am besten. Vielleicht lag das auch daran,
daß sie ihm bei der Abfahrt einen Zusatzlohn versprochen hatte. Und
das war ein gar nicht nonnenhafter Vorschlag: Er durfte eine Nacht
lang ihr Gast sein ...
Paul dachte an die üppige Blondine in der Nonnentracht -
Roswitha hieß sie - und freute sich auf das Ende der Fahrt.
Dann traf ihn der Pfeil, und er freute sich nicht mehr.
Der Pfeil ratschte ihm nur über die Schulter, riß eine blutige
Furche und knallte hinter ihm in den Sitz. Doch Pauls Schreck war
groß, und als er die finsteren Gestalten zwischen den Bäumen am
Wegesrand hervorspringen sah, erkannte er jäh, daß aus der Nacht
mit Roswitha wohl nichts mehr werden würde.
Er sah, wie einer der Kerle, die vielleicht fünfzig Klafter voraus
aufgetaucht waren, von neuem einen Pfeil auf die Sehne legte und
den Bogen spannte. Außerdem funkelten Schwerter im Schein der
grellen, stechenden Sonne, die für einen Augenblick zwischen
düsteren Gewitterwolken hervorbrach, als wollte sie einen schnellen
Blick auf das erhaschen, was sich dort auf Erden tat.
Paul beeilte sich, das erschreckte Gespann zu zügeln.
»Gnade!« rief er. Und noch flehender: »Gnade!«
Mit einem Ruck hielt die Kutsche.
Paul drehte die Bremse fest und reckte die Arme in die Höhe.
»Gnade!« flehte er von neuem. »Ich bin nur ein armer Fuhrmann
mit Weib und Kindern und fahre drei Nonnen zum Kloster.«
Im Nu war die Kutsche von wilden Gesellen umringt. Einer von
ihnen, ein hagerer Bursche mit einem wuchernden braunen Vollbart
und einer auffällig spitzen, leicht gekrümmten Nase, lachte schrill
und rief:
»Nonnen, äh?«
Paul nickte und schickte ein Stoßgebet zum Himmel, daß die Kerle
auf die Verkleidung hereinfielen und sie verschonten.
»Na, dann steigt mal aus, ihr scharfen Nönnchen, auf daß wir euch

begutachten können!«
Wieder lachte der Mann schrill.
Trotz der Schwüle vor dem nahenden Gewitter überlief es Paul
kalt. Das hatte ja gerade geklungen, als wüßte der Haderlump bereits
Bescheid!
Paul wandte den Kopf und schaute bangen Herzens zu, wie die drei
vermeintlichen Nonnen aus der Kutsche stiegen, nachdem der
Räuber den Schlag geöffnet und sie zum Aussteigen aufgefordert
hatte.
Roswitha kletterte als erste aus der Kutsche. Die schwarze
Nonnentracht verbarg zwar ihre Formen, doch es war nicht zu
übersehen, daß sie von üppiger Gestalt war. Ihr Busen hob und
senkte sich unter aufgeregten Atemzügen. Auf ihren Wangen waren
hektische rote Flecke.
Zornig blickte sie die Räuber an. Sie ignorierte die Blicke der
Männer, die sie grinsend anstarrten.
»Der Herr sei mit euch«, sagte sie. »Auch wenn ihr verirrte Kinder
Gottes seid, so werden wir für euch beten.«
Die Kerle lachten.
Roswitha schluckte. »Wir sind arme Schwestern des Herrn ...«
Der Bandit mit dem braunen Bart lachte wieder, so gräßlich und
schrill, daß Roswitha und ihre beiden Gefährtinnen
zusammenzuckten.
»He, Schwester, so ärmlich siehst du mir nicht aus. Eher mächtig
reich, wenn ich mir das so ansehe.«
Und dann tat er etwas, das bis auf ihn alle auf dem Waldweg
überraschte. Seine Hand schoß vor, krallte sich in den schwarzen
Stoff, und bevor Roswitha zu einer Regung fähig war, riß der Räuber
den Stoff vom Kragen bis zum Bauchnabel herunter.
Grinsend starrte er auf Roswithas entblößten Oberkörper.
Einer der Räuber, ein noch recht junger Bursche mit hungrigem
Blick, rief: »He, Paul, sollen wir gleich mal eine kleine Kostprobe...«
»Halt's Maul, du Nonnenschänder. Alles zu seiner Zeit.«
Er stieß wieder sein seltsam schrilles Lachen aus.

Da habe ich aber einen verdammten Namensvetter, dachte Paul
Ockenfels, der Kutscher.
Roswitha raffte die zerfetzte Nonnentracht zusammen, um ihren
Busen zu bedecken. Sie blickte hilfesuchend und voller Angst zu
Paul Ockenfels.
Paul zuckte mit den Schultern. Er konnte nichts tun. In
ohnmächtiger Wut ballte er die Hände.
»Ihr lustigen Nönnchen könnt wieder einsteigen«, sagte der Räuber
Paul, nachdem er alle drei der Reihe nach gemustert hatte.
Wie ein Viehhändler Kühe auf einem Markt ansieht, dachte Paul
Ockenfels angewidert.
Sein übler Namensvetter drängte Roswitha und ihre Freundinnen
in die Kutsche zurück. Roswitha schrie auf, als er sie hart am Arm
packte.
Der Räuber lachte nur.
»So zimperlich warst du doch nicht in dem Kloster, in dem du bis
jetzt gearbeitet hast«, sagte er spöttisch. »Falls du mich nicht mehr
wiedererkennst, ich hab' mal vor Monaten bei dir gebetet. Hat mich
meine ganze Barschaft gekostet. Und als ich von deiner Reise erfuhr,
dachte ich mir, daß mir für damals noch eine Entschädigung
zusteht.« Er stieg hinter Roswitha in die Kutsche.
Sie wissen also Bescheid! dachte Paul Ockenfels.
Ein anderer Räuber kletterte zu ihm auf den Kutschbock.
Er drückte Paul sein Schwert in die Seite.
Paul schrie schmerzerfüllt auf.
»Nun wein mal nicht, du Nonnenfahrer«, sagte der Kerl grinsend.
»Fahr zu!«
»Aber - wohin?« fragte Paul benommen.
»In die Hölle, mein Freundchen. In die Hölle! Aber erst mal
geradeaus. Ich sag dir dann schon, wo's langgeht.«
In diesem Augenblick schrie Roswitha gellend in der Kutsche.
Das schrille Lachen des Räubers folgte.
Und Paul Ockenfels lief ein Schauer über die Wirbelsäule.
Voller Angst löste er die Bremse und trieb das Gespann mit den

Zügelenden an.
Die ersten Regentropfen fielen.
*
Louis hielt derweil Almuth in den Armen. Sie war ein heißblütiges
Frauenzimmerchen, voller Lebenslust und origineller Einfälle.
Es war ihr Vorschlag gewesen, auf den Hochsitz am Rande der
Waldlichtung zu steigen, um Schutz vor dem Gewitter zu haben.
Nur zu gerne war Louis auf die Anregung eingegangen. Es hatte
ihn von Anfang an nicht sonderlich interessiert, mit Almuth nur
spazierenzugehen, und schon gar nicht im strömenden Regen.
Auf dem Hochsitz war es recht eng, doch sie brauchten nicht viel
Platz. Der Wind peitschte Regentropfen hinein, und Almuth drängte
sich dicht an den großen Knappen, um nicht vom Regen naß zu
werden.
Sie war eine dralle Zwanzigjährige, hellblond und blauäugig und
langbeinig. Letzteres sah Louis, als er ihr aus dem Rock half -
höflich, wie es sich für einen galanten Kavalier geziemt.
»Damit er nicht zerknittert und schmutzig auf dem Hochsitz wird«,
wie Almuth nach Louis' ersten Küssen gesagt hatte.
Nun, Almuth war eine recht offene Maid, und sie zierte sich nicht
lange.
»Du hast mir gleich gefallen, als du in den Laden kamst«, seufzte
sie in Louis Armen, und ihr Blick wurde ob Louis' Zärtlichkeiten ein
wenig verschleiert.
»Du hast so etwas Wildes ... Abenteuerliches ... Fast wie ein
Räuber«, sagte Almuth.
Darauf erwiderte Louis nichts. Sie brauchte nicht zu wissen, daß er
in der Tat sogar ein Räuberhauptmann gewesen war, bevor er Ritter
Rolands Knappe geworden war.
Louis lenkte sie mit gekonntem Liebesspiel von diesem Thema ab,
und die Wonnen, die er Almuth bereitete, brachten ihr heißes Blut so
in Wallung, daß sie sich und alles andere vergaß.

Diese Almuth war voller Feuer. Doch bevor Louis es löschen
konnte, brach der Hochsitz zusammen.
Almuths Ekstase war wohl zuviel für ihn gewesen.
Ein Bersten und Krachen als hätte der Blitz eingeschlagen - und
pardautz knallte das wackelige Ding zu Boden.
Das trübte ein wenig die lustvolle Stimmung.
Zwischen den Trümmern des Hochsitzes fanden sich Louis und
Almuth immer noch in tiefer Umarmung im nassen Grase wieder. Es
war alles so schnell gegangen und sie waren so heftig miteinander
beschäftigt gewesen, daß sie wie von einer rosaroten Wolke zur Erde
gestürzt waren.
Nun, es gab keine rosarote, sondern nur dunkel dräuende Wolken
am finsteren Himmel, und der Regen prasselte auf ihre nackte Haut.
»Oh Gott«, seufzte Almuth auf Louis' Schoß und barg die Wange
an seinem Bart. »Hab' ich mich erschrocken!«
Ein Blitz zuckte über den Himmel.
»Hast du dir wehgetan?« fragte Louis besorgt.
Almuth lachte leise. »Nein, ich bin ja weich gefallen, aber es war
halt doch ein mächtiger Stoß, als wir zu Boden plumpsten.«
Louis grinste leicht säuerlich und rieb sich über den Hintern, mit
dem er im nassen Gras gelandet war.
»Und du?« fragte Almuth und musterte ihn voller Zärtlichkeit.
»Es geht«, sagte er und küßte sie. »Dieser verdammte Hochsitz!
Komm, laß uns in den Wald gehen. Hier im Regen holen wir uns
noch einen Hexenschuß.«
Er packte sie an den Po-Backen und hob sie von seinem Schoß.
Sie klaubten ihre Kleidungsstücke zwischen den Trümmern des
Hochsitzes hervor. Almuths Rock war nun doch schmutzig
geworden, und ihre Bluse war sogar eingerissen. Auch Louis Hose
sah nicht zum Besten aus.
Als sie dann unter einer mächtigen Fichte im Moos lagen, waren
sie klatschnaß vom Regen. Doch bald verdampften die Regentropfen
auf ihren Körpern unter der Glut ihrer Leidenschaft.
Ein Eber, der sich nur ein paar Dutzend Klafter entfernt unter eine

andere Fichte gestellt hatte, um Schutz vor dem Regen zu haben,
spähte neugierig zu den Zweibeinern hinüber. Sein Herz begann zu
hämmern, und er grunzte erregt bei diesem Anblick. Vortreffliche
Position! dachte er. Und flugs lief er durch den Wald davon - heim
zu seiner Sau.
Louis und Almuth hörten es nicht einmal.
Sie hörten weder den Gewitterdonner, noch das Rauschen des
Regens.
Irgendwann hörte Louis dann doch etwas. Zunächst einmal
Almuths von Wonne erfüllte Stimme:
»Oh ... mein Louis ... oh ...«
Und dann war da noch etwas anderes zu vernehmen. Ein
Trommeln, das nichts mit dem Gewitterdonner zu tun hatte.
Louis verharrte.
»Louis«, seufzte Almuth und umklammerte ihn fester. »Bitte ...«
Dann erkannte Louis das Geräusch.
Hufschlag von Norden.
Er spähte über die Lichtung.
Da sah er den Reiter. Nein, es war eine Reiterin, wie er an den
fliegenden langen Haaren erkannte. Tief über den Pferdehals gebeugt
jagte die Reiterin in gestrecktem Galopp über die Lichtung, vom
Regen gepeitscht. Das Pferd flog förmlich über einen niedrigen
Busch hinweg. Die Reiterin hatte ihm kein Kommando gegeben. Der
Sprung überraschte sie offensichtlich. Sie ruckte hoch, schwankte
leicht im Sattel und fing sich wieder. Louis sah, daß ihre völlig
durchnäßte dünne Bluse wie durchsichtig auf ihrem Busen klebte.
Doch nicht dieser Anblick ließ ihm den Atem stocken.
Das Pferd!
Es gab keinen Zweifel: Es war Ritter Rolands prächtiges Roß!
Die Reiterin preschte nur ein Dutzend Klafter entfernt an ihnen
vorbei und hielt auf den Waldweg zu, der zum nahen Ort führte.
»Louis, was ist...?« Verlangend preßte sich Almuth gegen ihn. Er
löste sich mit sanfter Gewalt von ihr und sprang auf.
»Halt!»brüllte Louis und hetzte auf die Lichtung. Erschrocken

setzte sich Almuth auf. Sie hatte den Hufschlag zuvor gar nicht
wahrgenommen. Jetzt sah sie die Reiterin und blickte verwundert zu
Louis, der ihr nachschrie und heftig gestikulierte. Die Reiterin warf
einen Blick zurück, zuckte zusammen, warf den Kopf wieder herum
und trieb Ritter Rolands Roß heftig an. Im Grunde war ihre Reaktion
verständlich. Welche anständige Reiterin würde schon anhalten,
wenn ein bärtiger nackter und nasser Mann in einsamem Wald sie
brüllend und wie der Leibhaftige gestikulierend dazu auffordert?
Allerdings kann sie nicht ganz so anständig sein, wenn sie ein Pferd
reitet, das ihr nicht gehört, dachte Louis und knurrte seinen wildesten
Fluch. Zum Glück hörte Almuth es nicht, weil es just donnerte und
irgendwo der Blitz einschlug. Der Hufschlag verklang im Rauschen
des Regens. Louis kehrte zu Almuth zurück. »Hast du mit mir nicht
genug?« sagte sie schmollend.
Er blickte auf sie hinab. Sein Zorn verrauchte schnell.
»Doch«, versicherte er ihr.
»Dann komm«, sagte sie mit einem verliebten, lockenden Lächeln
und breitete die Arme aus, um ihn zu empfangen.
Louis kämpfte mit sich. Ritter Roland hätte längst eintreffen
müssen. Doch jemand anders ritt sein Roß. Was war da passiert?
Sein Gefühl sagte ihm, daß irgend etwas geschehen sein mußte. Die
Reiterin war völlig durchnäßt. Vielleicht rastete sie im Ort. Wenn er
sich beeilte, konnte er sie vielleicht noch erwischen und ihr ein paar
harte Fragen stellen ...
»Es - es geht jetzt nicht«, sagte Louis mit belegter Stimme.
Almuths Lächeln erlosch. Ihr Blick glitt prüfend an seinem Körper
hinunter.
»Wieso nicht?« fragte sie erstaunt. In ihren Augen blitzte es auf,
oder vielleicht war das auch nur der Widerschein eines wahren
Blitzes, der am Himmel aufzuckte.
»Wer war diese Reiterin?« fragte sie mißtrauisch. »Was hast du
mit ihr?« Sie schluchzte auf.
Louis nahm Almuth in die Arme. »Ich habe ein Hühnchen mit ihr
zu rupfen«, sagte er. Und dann erklärte er ihr kurz, weshalb er sich

beeilen mußte.
Das besänftigte sie. Sie war zwar ein bißchen enttäuscht, weil er
sie verlassen wollte, doch er versprach ihr, sie in der Nacht, wenn
alle sonst im Haus des Krämers schliefen, in ihrer Kammer zu
besuchen.
Da leuchteten ihre schönen Augen wieder, und sie lächelte voller
Vorfreude.
Sie ahnte nicht, daß sie eine schlaflose einsame Nacht verbringen
würde, weil Louis sein Versprechen nicht halten konnte...
*
Sie kann doch nicht einfach verschwunden sein! dachte Thomas
Himperich verzweifelt.
Seit vier Tagen suchte er seine Tochter Edeltraut. Sie war mit drei
Begleitern auf dem Weg nach Peterzell gewesen, wo er sie bei
Verwandten erwartet hatte. Der Kommandant der Stadtgarde zu
Freiburg hatte seine dienstfreien Tage wie fast jedes Jahr in Peterzell
verbringen wollen. Dort war er geboren, dort lebten seine
Verwandten.
Voller Freude hatte er auf seine einzige Tochter gewartet.
Sie war nicht gekommen.
Nach zwei Tagen des Wartens hatte Thomas Himperich es nicht
mehr in Peterzell gehalten. Voller Sorge war er nach Freudenstadt
geritten, wo seine Tochter im Hause eines Arztehepaares arbeitete.
Dort hatte er erfahren, daß Edeltraut wie abgesprochen von den drei
jungen Freunden abgeholt worden war, und daß sie pünktlich von
dort losgeritten waren.
Thomas Himperich ahnte Schlimmes.
Voller Sorge ritt er über den Weg nach Peterzell zurück.
Einer der Begleiter war Himperichs Neffe, und auch die beiden
anderen kannte er gut genug, um ihnen zu vertrauen. Dennoch
machte sich der Kommandant der Stadtgarde jetzt Vorwürfe, daß er
seine Tochter nicht selbst abgeholt hatte. In diesen Zeiten war es

gefährlich, im Schwarzwald zu reisen.
Aber er hatte erst verspätet in die Sommerfrische fahren können.
Zweimal hatte er den Termin verschieben müssen. Der
stellvertretende Kommandant, Briegel, war erkrankt
-
Lungenentzündung - und dann auch noch der Stellvertreter des
Stellvertreters - er war beim Apfelpflücken vom Baum gefallen und
hatte sich ein Bein gebrochen, diese Pfeife! So war Thomas
Himperich im Amt geblieben. Er war ein pflichtbewußter Mann ...
Bei einem Köhler, etwa zwanzig Meilen nördlich von Peterzell,
erfuhr Thomas Himperich, daß seine Tochter und ihre Begleiter dort
die Pferde getränkt und gerastet hatten. Irgendwo auf den letzten
zwanzig Meilen bis Peterzell mußten sie verschwunden sein.
Voller Sorge ritt Thomas zurück gen Peterzell.
Etwa acht Meilen von dem Ort entfernt fand er dann die Brosche
seiner Tochter. Es war Zufall, daß er sie entdeckte.
Sie lag am Rande des Weges, halb vom Sand verdeckt, und er hätte
sie gewiß übersehen wie alle anderen Leute bisher, die des Weges
gekommen waren, wenn er nicht ausgerechnet ein paar Schritte
entfernt zu einer Rast angehalten hätte, um ein Schmalzbrot zu essen
und kalten Pfefferminztee aus der Flasche zu trinken.
Sofort vergaß er sein Schmalzbrot. Kein Zweifel, das war die
Brosche seiner Tochter. Eine feine Arbeit. Ein güldenes Herz mit
einer Rose darüber. Die kunstvolle Arbeit eines Goldschmiedes. Er
hatte sie ihr zum 20. Geburtstag geschenkt. Edeltraut war nach dem
Tode ihrer Mutter für Thomas Himperich ein und alles.
Er schaute sich genauer um. Dann entdeckte er die Spuren, die
vom Weg fort in ein Waldstück hineinführten. Sieben oder acht
Reiter waren dort vom Weg abgebogen, genau war das nicht zu
erkennen. Ihre Rösser hatten tiefe Hufabdrücke im weichen Boden
hinterlassen.
Thomas wurde immer unruhiger. Er wußte, daß in den letzten
Wochen einige Reisende spurlos verschwunden und Warentransporte
nie an ihrem Ziel eingetroffen waren.
Edeltrauts Brosche und die Fährte der Reiter!

Es wurde Thomas heiß und kalt zugleich. Er spürte, daß er einem
Geheimnis auf der Spur war.
Er folgte der Fährte.
Sie führte über einen Waldweg, dann aus dem Waldstück hinaus
und durch eine tiefe Schlucht, in der ein Wildbach rauschte. Bei einer
Weggabelung fand er dann einen Schuh von Edeltraut.
Allmächtiger! dachte er. Was ist mit meinem Kind passiert?
Einen Augenblick lang zögerte er. Er mußte sich zwingen, den Ritt
fortzusetzen. Er befürchtete, am Ende der Fährte etwas Grauenvolles
zu finden.
Edeltraut war ein schönes Mädchen. Wenn sie Räubern in die
Hände gefallen war ... Er wagte kaum, den Gedanken fortzusetzen.
Nach einer halben Stunde verloren sich die Spuren. Er war so mit
seinen quälenden Gedanken beschäftig gewesen, daß er gar nicht
bemerkt hatte, wann die Fährte aufgehört hatte. Er überlegte, ob er
zurückreiten sollte. Möglicherweise waren die Reiter irgendwo
abgebogen.
Dann sah er auf einem Busch etwas Rosafarbenes. Er ritt hin. Es
war Edeltrauts Seidentüchlein. Ihre Initialen waren aufgestickt.
Es gab keinen Zweifel mehr für Thomas: Edeltraut war in der
Gewalt dieser Reiter, und sie hatte Brosche, Schuh und Seidentuch
nicht verloren. Sie hatte damit den Weg markieren wollen, den ihre
Entführer eingeschlagen hatten.
Ungeduld und Sorge trieben Thomas weiter. Schon lange war er
bis auf die Haut vom Gewitterregen durchnäßt. Es kümmerte ihn
nicht. Er gönnte sich keine Pause. Der Regen würde die Spuren
auslöschen, und dann war alles aus.
Dann konnte er Edeltraut niemals wiederfinden - oder ihre
Leiche...
Er erschauerte bei diesem Gedanken.
Er fand wieder Spuren, doch bald waren sie zu Ende. Sie hörten in
einem Gestrüpp zwischen mächtigen Felsen auf.
Thomas zügelte das erschöpfte Roß und saß ab. Er untersuchte den
Boden. Er umrundete das Gestrüpp, sein Blick tastete über den

Felsen und suchte nach einer Fortsetzung der Fährte. Doch er konnte
keine finden.
Es war, als wären die Reiter davongeflogen.
Unfug! dachte Thomas. Er war ein, in langen Jahren Dienstzeit als
Kommandant der Stadtgarde, erfahrener Mann. Er glaubte nicht an
Hexerei. Des Rätsels Lösung mußte irgendwo zwischen diesen
Felsen liegen, irgendeine versteckte Spalte, der verborgene Zugang
zu einer Schlucht oder einem Tal.
Dann entdeckte er einen abgeknickten Zweig im wuchernden
Gestrüpp. Der Zweig war noch nicht lange geknickt. Der Knick war
noch grün. Sein Blick tastete den Boden ab. Dann entdeckte er einen
Fußabdruck. Regenwasser sammelte sich darin, doch der Abdruck
war deutlich zu erkennen.
Er wischte sich unbewußt eine triefendnasse Haarsträhne aus der
Stirn.
Erregung erfaßte ihn.
Zugleich warnte ihn eine innere Stimme.
Er lauschte und blickte angespannt in die Runde. Er glaubte im
Rauschen des Regens einen Kuckucksschrei vernommen zu haben,
doch er war sich nicht ganz sicher. Sein Roß schnaubte und
schüttelte den Kopf, als wollte es sich darüber beschweren, daß er es
im Regen, stehenließ.
Ein Blitz zuckte über den Himmel und tauchte alles in grelles,
gespenstisches Licht. Donner hallte zwischen den Bergen wider.
Thomas zögerte. Unbewußt griff er in die Hosentasche, und seine
Hand schloß sich um das Taschenmesser. Für einen Augenblick
bedauerte er, daß er sein Schwert bei den Verwandten in Peterzell
gelassen hatte. Aus Sorge um seine Tochter war er übereilt
aufgebrochen. Er hatte nicht mal bedacht, daß der Ritt durch die
Einsamkeit der Wälder auch für ihn, einen einzelnen Reiter,
gefährlich sein konnte.
Dann schalt er sich einen Narren.
Wenn seine Tochter von einer Räuberbande entführt worden war,
dann hatte er allein auch mit noch so vielen Schwertern keine Chance

gegen die Übermacht. Er mußte Hilfe holen. Das Versteck der Bande
finden, die Kerle beobachten und dann Verstärkung holen. Vielleicht
gab es im Schutz der Dunkelheit sogar eine Möglichkeit, Edeltraut
heimlich zu befreien. Wenn sie noch lebte ...
Von neuem schluckte er hart.
Dann gab er sich einen Ruck und bahnte sich entschlossen einen
Weg durch das nasse Gestrüpp.
Er kam genau fünf Schritte weit.
Er nahm noch ein schemenhafte Bewegung zu seiner Rechten wahr
und zuckte herum, dann traf ihn das Schwert in die Brust.
Thomas Himperich taumelte zurück und war schon tot, bevor er zu
Boden stürzte. Die Wasserlache unter ihm färbte sich mit seinem
Blut...
Der Mörder schritt heran. Ein großer, breitschultriger Mann in
einem ledernen Umhang und einem schwarzen Schlapphut, von dem
der Regen tropfte.
»Der ist hin, Franz«, rief er.
Eine zweite Gestalt tauchte hinter ihm auf.
Der Mörder zog das Schwert aus der Brust des Toten und wischte
die blutige Klinge an der nassen Hose der Leiche ab.
»W-wwer ist dddas, Heinrich?« stammelte Franz. Er stotterte,
wenn er aufgeregt war. Er sah auf die gebrochenen Augen des
Mannes, die weit aufgerissen waren und blicklos in den Regen
starrten.
»W-wweiß iich doch nicht«, äffte Heinrich ihm nach.
Franz machte sich nichts daraus. Er war es gewohnt, von den
Kumpanen verspottet zu werden. Von diesen üblen Kerlen war kein
Verständnis und Mitgefühl zu erwarten.
»Sieh dich mal in der Nähe um«, sagte Franz im Kommandoton
und untersuchte die Taschen des Toten.
»Du meinst, es kö-könnten noch mehr in der Näh-Näh- ... Gegend
sein?« fragte Franz verdattert.
»Papperlapapp. Wir haben doch nur einen Reiter gesehen. Hol sein
Roß.«
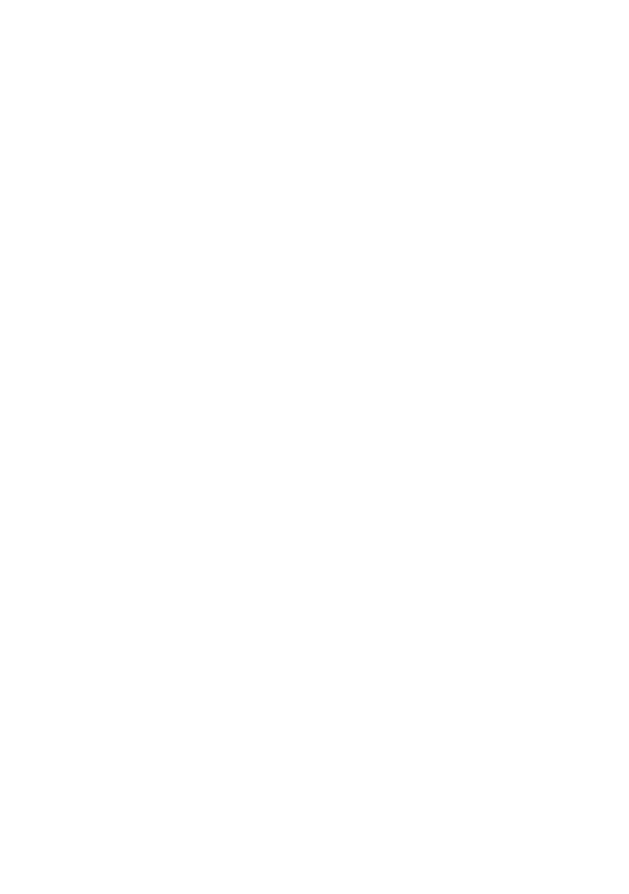
Franz nickte eifrig und eilte davon.
Nach fünf Minuten kehrte er zurück.
»Kein Gaul zu finden«, meldete er und wischte sich Regen aus
dem Gesicht. »Muß weggelaufen sein.«
Heinrich zuckte nur mit den Schultern. Das Roß des Toten
interessierte ihn herzlich wenig. Sie hatten genügend Pferde in letzter
Zeit erbeutet. Er hatte Franz nur weggeschickt, um in Ruhe die
Leiche fleddern zu können. Er teilte nicht gern mit Kumpanen ...
*
Louis betrat den Stall neben der Schmiede. Wenn die Reiterin in
Peterzell eine Rast einlegte, ließ sie das Pferd vielleicht im Stall
versorgen.
Eine Lampe verbreitete schwaches Licht. Die Kerze in dem
verrußten Glas war fast heruntergebrannt und flackerte.
Ein Pferd wieherte, als ein Blitz den Stall für einen
Sekundenbruchteil in Licht tauchte.
Louis hielt vergebens nach dem Stallburschen Ausschau, der sonst
hier seinen Dienst versah. Er nahm die Lampe vom Haken am
Pfosten und leuchtete damit in die Boxen.
Er sah Pierres Roß und dann sein eigenes. Sie hatten die Pferde bei
ihrer Ankunft der Obhut des Stallburschen übergeben.
Drei andere Tiere standen in den Boxen, doch Louis hielt
vergebens nach Ritter Rolands prächtigem und unverkennbaren Roß
Ausschau.
Er wandte sich ab. Am besten fragte er Pierre, ob er die Reiterin
gesehen hatte.
In diesem Moment ging das Stalltor auf. Vier Männer betraten den
Stall. Louis sah an der Spitze der vier den fuchsgesichtigen
Stallburschen.
»Da ist er ja«, sagte der Stallbursche und bliebt abrupt stehen. Er
wirkte erschrocken. Einer der anderen schob ihn zur Seite.
Louis blickte verwundert.

»Sucht ihr mich?« Er musterte die Männer kurz. Finstere
Gestalten. Einer von ihnen, ein Graubart, trat näher.
»Grüß Gott«, sagte er höflich. »Wir sollen Euch Grüße von Eurem
Freund bestellen.«
Louis entspannte sich. »Pierre ...?«
Dann verstummte er.
Denn der Graubart zog blitzschnell einen Dolch hervor. Sein
Bartgestrüpp klaffte auf, und er zeigte grinsend eine Zahnlücke und
einen braunen Zahnstummel.
Doch Louis sah es nicht. Es war nicht das erste Mal, daß er in
Gefahr war, und in seiner Zeit als Räuberhauptmann hatte er so
einiges gelernt, was ihm auch später als Knappe zugute gekommen
war.
Er war fast so schnell wie der Blitz, der gerade am Himmel
aufzuckte.
Fast ansatzlos warf er dem Graubart die Lampe ins grinsende
Gesicht. Die Lampe traf den Kerl an der Nase. Glas klirrte, ein
Schrei ertönte, und zugleich hallte Donner durch das Prasseln des
Regens auf dem Stalldach.
Der Graubart, der sich wieder einmal überschätzt hatte, taumelte
zurück, Blut schoß aus seiner Nase. Die Reste der Lampe waren zu
Boden gefallen, die Kerze drohte zu erlöschen, doch dann fand die
Flamme Nahrung im Streu und züngelte auf.
Louis war mit einem Satz bei dem Graubart, packte das
Handgelenk des immer noch überraschten Mannes und verdrehte es.
Zum zweiten Mal jaulte der Kerl auf und ließ den Dolch fallen. Und
bevor er wußte, wie ihm geschah, packte Louis ihn am Kragen und
schleuderte ihn gegen seine Kumpane, die angreifen wollten. Der
Graubart prallte gegen einen Mann und riß ihn mit sich zu Boden.
Der andere wich geschickt aus.
Louis sah noch, wie der Kerl ein Messer aus der Lederscheide am
Gürtel riß. Dann hatte der Stallbursche das Feuer ausgetreten, und es
war völlig dunkel im Stall.
Louis schnellte sich zur Seite.

Gerade noch in letzter Sekunde. Er hörte etwas zischen und
vernahm dann einen dumpfen Einschlag. Der Kerl hatte sein Messer
geworfen.
Ein Blitz erhellte den Stall, und Louis sah huschende Gestalten.
Das Dumme war, daß sie ihn ebenfalls sahen.
Louis wich einem heranstürmenden Schatten aus und packte zu. Er
erwischte den Kerl, riß ihn hoch und schleuderte ihn aus der Drehung
heraus von sich. Etwas klirrte, und Louis erkannte, daß er den Mann
aus dem Fenster geworfen hatte.
Pferde wieherten erschreckt und stampften mit den Hufen.
Mit einem Schrei sprang Louis auf die nächste Gestalt zu, die er
nur schemenhaft im Dunkel ausmachen konnte.
Wilder Zorn erfüllte den Knappen.
Wer immer diese Haderlumpen auch sein mochten und was auch
immer sie vorgehabt hatten, sie sollten sich verrechnet haben!
Der Mann vor ihm bewegte sich, und dann traf etwas Hartes des
Knappen Schulter. Ein Besen, über den der Kerl gestolpert war und
den er flugs hochgerissen hatte. Doch das sah Louis erst, als wieder
das Licht eines Blitzes den Stall kurz erhellte.
Louis strauchelte. Seine Stiefel waren naß und schlammig nach
seinem Ausflug mit Almuth. Er rutschte aus.
Sofort war einer der Kerle über ihm. Hände krallten sich um des
Knappen Hals. Er packte die Handgelenke und befreite sich mit
einem heftigen Ruck aus der Umklammerung.
Der andere schlug mit dem Besen auf ihn ein.
Kurz dachte Louis mit Groll daran, daß er ebenso wie Pierre das
Schwertgehenk im Gasthof gelassen hatte. Mit seinem Schwert hätte
er den Kampf schnell beendet. Doch sie hatten sich als die Burschen
eines Händlers ausgegeben, um ohne Aufsehen ermitteln zu können.
Fremde mit Schwertern fielen in einem kleinen Ort auf. Auch Roland
würde nicht in Kettenhemd, mit Schild und Schwert kommen,
sondern sich als Händler ausgeben, auf den sie warteten. Es galt das
Verschwinden der Menschen und Transporte aufzuklären und die
Nachforschungen unauffällig zu betreiben, auf daß der oder die
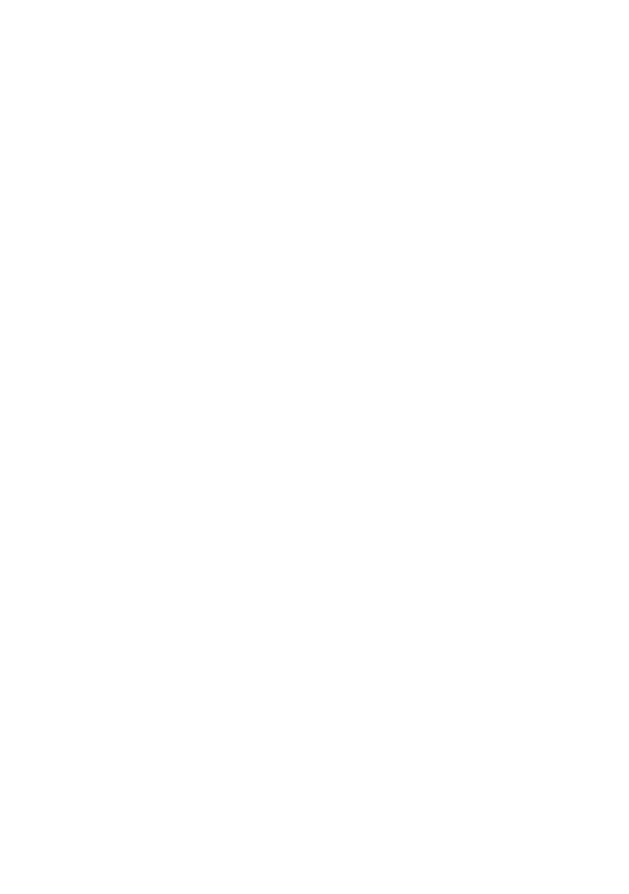
Missetäter nicht gewarnt wurden.
Doch man hatte offenbar den Braten gerochen.
Louis warf den Mann von sich, der ihn von neuem umklammern
wollte. Wieder streifte ihn ein Besenhieb. Louis sprang auf. Er
dachte keine Sekunde lang an Flucht. Zornig wollte er sich den Kerl
schnappen und ihm den Besen um die Ohren schlagen.
Doch dazu kam es nicht mehr.
Etwas Spitzes bohrte sich schmerzhaft zwischen seine
Schulterblätter, und ein scharfe Stimme zischte ihm in den Nacken:
»Wenn du auch nur laut atmest, hast du das Messer im Kreuz, du
Hundsfott!«
*
Zum Teufel mit Helga! Das hatte Ritter Roland oft genug auf seinem
langen Fußmarsch gedacht. Das Gewitter hatte ihn überrascht. Bevor
er sich irgendwo hätte unterstellen können, war er bis auf die Haut
durchnäßt gewesen. Da hatte er darauf verzichtet, irgendwo das Ende
des Gewitters abzuwarten. Seit zwei Stunden marschierte er
klatschnaß gen Peterzell, und er war von wildem Grimm erfüllt.
Oh, wie sie ihn hereingelegt hatte! Ihn, den berühmten Ritter mit
dem Löwenherzen. Eine kleine Pilzsammlerin. Es nagte an seinem
Stolz, daß er auf ihren simplen Trick hereingefallen war.
»Wenn ich dieses Luder wiederfinde...« knurrte er.
Dann blieb er stehen und blinzelte durch den Regenschleier.
Ein Roß stand dort am Wegesrand und drehte schnaubend den
Kopf, als es ihn witterte.
Ein schönes Tier, dunkelbraun mit einer schneeweißen Stirnblesse
und vier, fast gleichmäßigen weißen Strümpfen.
Wo war der Reiter?
Roland näherte sich dem Tier. Das Roß lief ein Stück zwischen das
Farnkraut und die Büsche. Roland redete mit sanften, dunklen
Worten beruhigend auf den Braunen ein und hatte Erfolg. Das Roß
blieb stehen, und Roland konnte die Zügel ergreifen. Er tätschelte
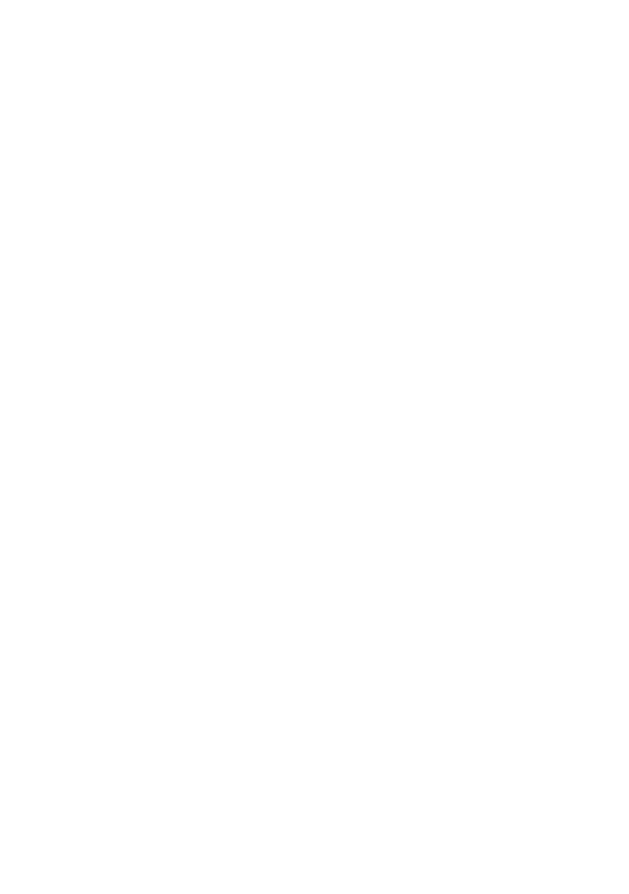
das nasse Fell am Hals und band das Tier an den Stamm einer Birke.
Dann hielt er Ausschau nach dem Besitzer.
Er fand niemand in der näheren Umgebung. Er rief und lauschte,
doch nur Donnergrollen und das Rauschen des Regens antworteten
ihm.
Er hockte sich unter eine Blutbuche, wo er vor Wind und Regen
geschützt war und wartete unschlüssig.
Wo mochte der Reiter sein? Wenn er im Gewitter abgeworfen
worden war und jetzt irgendwo verletzt und hilflos im Regen lag ...
Der Gedanke ließ Ritter Roland keine Ruhe. Von neuem begab er
sich auf die Suche. Fast eine Stunde lang durchstreifte er die
Umgebung, doch er fand nichts.
Vielleicht war der Braune entlaufen? Roland kramte in den
Satteltaschen. Er fand ein angebissenes Schmalzbrot, eine Flasche
mit Tee, Verbandszeug, eine Kerze und Schwefelhölzer. Nichts, was
auf den Besitzer Aufschluß gegeben hätte.
Im Grunde war es Ritter Roland ganz recht, daß kein
Pferdebesitzer da war. So brauchte er nicht lange zu bitten, daß man
ihn bis Peterzell mitnahm, ein Ansinnen, das leicht ausgeschlagen
werden konnte. Doch andererseits widerstrebte es Roland, sich das
Roß einfach zu nehmen. Er war ein Ritter und kein Pferdedieb.
Er wartete noch eine Weile, doch dann war sein Entschluß gefällt.
Er hinterließ einen Zettel an der Birke am Wegesrand, genau an der
Stelle, an der er das Roß gefunden hatte. Sollte der Besitzer das Tier
suchen, würde er erfahren, daß er es im Stall von Peterzell gut
versorgt wiederfinden würde.
So saß Ritter Roland auf und ritt zu dem Ort.
Als er dort eintraf, war es Abend. Das Gewitter war vorüber
gezogen, und der Schein der Lampen erhellte die Fenster der Häuser.
Es war ein Anblick, der Behaglichkeit versprach. Roland war
hungrig. Bis auf das halbe Schmalzbrot hatte er seit dem Frühstück
nichts mehr gegessen. Er freute sich auf trockene Kleidung, eine
warme Mahlzeit und ein Bier im Dorfkrug. Und er war gespannt
darauf zu erfahren, was die Knappen zu berichten wußten.

Ein Mann trat aus einem der Häuser und starrte ihn an wie einen
Geist. Ritter Roland blickte an sich hinab und lächelte. Er sah in
seiner durchnäßten und vom Ritt verschmutzten Kleidung und den
schlammbedeckten Stiefeln gewiß nicht sehr vertrauenerweckend
aus.
Roland grüßte den Mann höflich und fragte ihn nach dem Stall.
Immer noch starrte ihn der Mann offenen Mundes an. Stumm wies er
dann mit zitternder Hand die Straße entlang.
Bevor sich Roland bedanken konnte, warf sich der Mann herum
und verschwand im Haus. Die Tür knallte zu.
Seltsamer Kauz, dachte Roland und ritt weiter. Er passierte die
Schenke, die einladend erhellt war. Er wäre gern gleich dort
eingekehrt, doch erst wollte er das Pferd abliefern.
Flüchtig dachte er an sein prächtiges Roß und Helga. Natürlich
würde er nichts unversucht lassen, um seinen Hengst
wiederzufinden. Gleich wollte er dem Stallmann Roß und Reiterin
beschreiben und fragen, ob man sie in Peterzell gesehen hatte.
Roland ritt in den dunklen Stall und rief nach dem Pferdepfleger.
Nur durch das scheibenlose Fenster fiel ein Streifen schwachen
Lichts von einer Laterne herein. In den Winkeln des Stalls nistete die
Dunkelheit.
Rolands Ruf war noch nicht verklungen, als aus dem Dunkel rechts
von ihm eine aufgeregte Stimme sagte: »Keine Bewegung, oder du
bist des Todes!«
Roland zuckte zusammen. Er blieb stocksteif im Sattel sitzen, doch
dann drehte er den Kopf, langsam, ganz langsam, denn er wollte
nicht des Todes sein.
Er sah einen großen, stämmigen Mann, der ein Schwert in der
vorgereckten Hand hielt.
»Nimm die Hände hoch, du Lump!« sagte der Mann. Seine
Stimme klang angespannt.
Ein nervöser Mann mit einem Schwert in der Hand war eine
Gefahr, die nicht unterschätzt werden durfte. Roland gehorchte.
Gewiß handelte es sich um ein Mißverständnis, und der Bursche

würde sich bald entschuldigen müssen.
Während Roland langsam die Hände hob, zog er die Füße aus den
Steigbügeln.
»Begrüßt du immer so deine Kunden?« fragte Roland.
»Solche Kunden wie dich sollte man auf der Stelle aufhängen«,
sagte die Stimme aus dem Dunkel.
Langsam stieg Unmut in Ritter Roland auf.
»Mäßige deine Worte«, sagte er ruhig. »Was immer dieses
Spielchen zu bedeuten hat - es gefällt mir nicht. Nun nimm das
Schwert weg und erkläre mir, was dein garstiges Betragen zu
bedeuten hat.«
»Der Mann trat einen Schritt näher. »Runter mit dir!«
Der unfreundliche Gesell beging einen Fehler, indem er das Roß
umrunden wollte, um den Reiter beim Absitzen im Auge behalten zu
können.
Roland handelte schnell und entschlossen.
Er stieß dem Roß die Hacken in die Flanken. Das Tier machte
einen Satz und rammte den völlig überraschten Mann.
Mit einem Aufschrei stürzte er zu Boden.
Und jetzt saß Roland ab. Doch anders, als der Mann es sich
gedacht hatte. Roland schnellte sich aus dem Sattel, flog auf den
benommenen Mann zu und fegte ihm mit einem Hieb aufs
Handgelenk das Schwert aus der Hand. Bevor der Mann wußte, wie
ihm geschah, hielt Roland das Schwert in der Hand und tippte ihm
die Klinge auf die Brust.
Der Mann schrie, als hätte Roland bereits zugestoßen. Doch das
wäre dem Ritter nie in den Sinn gekommen. Es verstieß gegen die
Ritterehre, einem wehrlosen Gegner den Todesstoß zu versetzen.
»Hör mit dem Gebrüll auf und erkläre mir ...«
Roland wirbelte herum, denn er vernahm ein Geräusch bei der Tür.
Ein Schatten sprang in den Stall, holte mit einem Arm aus. Roland
duckte sich geistesgegenwärtig. Die Keule streifte ihn dennoch an
der Schläfe. Roland taumelte zurück. Der Mann am Boden vergaß
seine Angst und sprang Roland von hinten an. Roland stürzte zu

Boden.
Aus der Drehung heraus schlug er mit dem Schwert zu. Der
Gegner gab einen röchelnden Laut von sich und erschlaffte auf
Roland. Roland stieß ihn mit dem Ellenbogen von sich und sprang
auf.
Der andere Angreifer stürmte heran. Vermutlich sah er im Dunkel
das Schwert in Rolands Faust nicht. Denn sonst hätte er lebensmüde
sein müssen. Fast wäre er in die Klinge hineingerannt. Er verdankte
es dem Großmut des Ritters, daß sein Bauch nicht aufgeschlitzt
wurde. Blitzschnell drehte Roland die Klinge zur Seite, und der Kerl
prallte nicht gegen das Schwert sondern gegen Roland.
Roland hatte keine Lust, lange mit dem Angreifer herumzutändeln.
Er schlug den Mann mit der Breitseite der Klinge nieder.
Dann atmete er auf. Die Gefahr war gebannt. Ein unerfreulicher
Empfang, der ihm da zuteil geworden war.
Der Mann, der Roland mit dem Schwert so unfreundlich begrüßt
hatte, regte sich. Roland piekte ihm die Schwertspitze in die rechte
Gesäßbacke.
»Steh auf!«
Schwankend richtete sich der Mann auf.
»Gibt es in diesem Stall eine Lampe?« fragte Roland.
Der Mann wies wortlos zur Seite.
»Na los, worauf wartest du? Zünde sie an!«
Der Mann gehorchte.
Schließlich fiel der Schein der Lampe auf sein Gesicht. Es war ein
rundes Gesicht mit Pausbacken, einem Doppelkinn, einer breiten
Nase und wulstigen Lippen. Angst flackerte in den Augen des
Mannes, die auf das Schwert in Rolands Hand gerichtet waren. Dann
irrte sein Blick an Roland vorbei zu der reglosen Gestalt des zweiten
Mannes.
»Erbarmen!« sagte er voller Furcht und wich von Roland fort.
»Darüber können wir reden«, sagte Roland. »Aber erst wirst du
mir einige Fragen beantworten. Wer bist du?«
»Ich bin der Besitzer dieses Stalles.«

»Hast du auch einen Namen?«
»Waldemar Esch.«
»Gut, Waldemar. Und wer ist der andere unfreundliche Patron?«
Roland wies mit dem Schwert zu dem Bewußtlosen.
»Das ist Hohkeppel - der Polizist.«
Roland blickte verblüfft.
»Und was wollte er? Weshalb ging er wie ein Räuber auf mich los?
Weshalb empfingst du mich mit dem Schwert?«
»Das fragst du noch?«
»So ist es. Und jetzt will ich endlich eine Erklärung.«
In diesem Augenblick regte sich der Polizist. Stöhnend setzte er
sich auf und betastete seinen Kopf. Dann setzte wohl seine
Erinnerung ein. Krächzend fragte er:
»Waldemar, hast du dem Hundsfott einen über den Latz geknallt:
»Nein«, bekannte Waldemar bekümmert. »Er ließ mich nicht.«
Der Polizist wandte den Kopf, und erst jetzt sah er anscheinend
wieder ganz klar. Er fluchte.
Dann besann er sich offenbar auf sein Amt, setzte eine grimmige
Miene auf und erklärte mit einem wütenden Blick von unten herauf:
»Du bist verhaftet!«
Roland mußte lächeln. »Und warum?«
Der Polizist blinzelte mit seinen kleinen schwarzen Äuglein.
»Warum? Das fragst du noch? Was hast du mit Thomas Himperich
gemacht?«
»Wer ist Thomas Himperich?« fragte Roland.
»Der Besitzer des Pferdes, das du gestohlen hast.«
Jetzt fiel es Roland wie Schuppen von den Augen.
Bald klärte sich alles auf. Das auffällige Pferd war in Peterzell
ebenso bekannt wie der Kommandant der Stadtgarde zu Freiburg.
Sofort bei Rolands Eintreffen hatte man den Polizisten und den
Stallbesitzer alarmiert. Noch bevor er nach dem Stall gefragt hatte.
Man wußte, daß Himperich voller Sorge um seine Tochter losgeritten
war, und jetzt kam ein Fremder auf seinem Pferd in den Ort! Der
Fremde mußte ein Pferdedieb sein, wenn nicht gar schlimmeres.

Roland erklärte, daß er das Pferd reiterlos gefunden hatte. Er
erzählte, daß man ihm das eigene Roß gestohlen hatte und beschrieb
Pferd und Reiterin. Nein, beide waren nicht in Peterzell gesehen
worden.
Das Mißtrauen der beiden Männer verschwand offensichtlich. Sie
glaubten Roland, Jedenfalls hatte es den Anschein. Sie überlegten
mit bangen Mienen, was mit Himperich geschehen sein könnte.
Roland beteuerte, daß er nach dem Besitzer des Pferdes gesucht
hatte. Er beschrieb die Stelle, an der er das Pferd gefunden hatte und
bot sich an, den Polizisten dorthin zu führen.
Nachdem alles geklärt war, fragte Roland nach Louis und Pierre.
Er gab sich als Händler aus, der seine zwei Burschen vorausgeschickt
hatte.
Ja, die beiden waren in Peterzell bekannt.
»Sie haben Peterzell mit einem Wagen verlassen«, sagte
Waldemar.
»Mit einem Wagen?« fragte Roland verwundert.
»Ja, so hörte ich in der Wirtschaft.«
Roland nagte an der Unterlippe. Es war fest abgemacht, daß die
Knappen auf ihn warteten und nichts auf eigene Faust unternahmen,
wenn sie eine Spur finden sollten. Sie mußten schon einen triftigen
Grund gehabt haben, mit einem Wagen wegzufahren. Gewiß hatten
sie beim Wirt des Gasthofes eine Nachricht für ihn hinterlassen. Er
wollte sogleich dorthin gehen.
Hohkeppel, der übrigens wie ein Landmann gekleidet war, streckte
die Hand aus.
»Jetzt, da alles aufgeklärt ist, braucht Ihr das Schwert nicht mehr«,
sagte er höflich und mit einem freundlichen Lächeln.
Roland nickte und reichte ihm das Schwert ohne Argwohn.
Das hätte er besser nicht getan.
Denn schlagartig veränderte sich die freundliche Miene des
Mannes. Er drückte Roland die Schwertspitze gegen die Brust, in
Höhe des Herzens, und sagte mit boshaftem Grinsen:
»Ha, hab ich dich reingelegt, du Lump! Du Dieb und Mörder! Am

Galgen sollst du hängen und in der Hölle für deine Untaten büßen!«
*
Hohkeppel war kein Polizist. Es gab gar keinen in dem kleinen Ort.
Doch das erfuhr Ritter Roland erst viel später.
Auf einen Pfiff Hohkeppels hin tauchten ein halbes Dutzend
Männer auf. Sie schlugen Roland nieder, fesselten ihn an Händen
und Füßen und schleppten ihn aus dem Stall.
Sie sperrten ihn in irgendeinen Keller. Als er zu sich kam,
umgaben ihn tiefe Finsternis und modriger Geruch. Etwas huschte
über sein Bein. Eine Maus? Eine Ratte? Er bäumte sich in den
Fesseln auf. Vergebens. Sie hatten ihn so fest verschnürt, daß ihm die
Stricke in die Haut schnitten.
Lange lag er dort auf dem Steinboden und hing seinen Gedanken
nach.
Mit Helga hatte alles angefangen. Vermutlich war sie jetzt mit
seinem Roß über alle Berge.
Vermutlich würde er das Roß auch nicht mehr brauchen ...
Sie wollten ihn aufhängen!
Man hielt ihn für einen Pferdedieb und Mörder. Er konnte nur
hoffen, daß der Besitzer des auffälligen Pferdes bald auftauchte und
sich alles aufklärte. Natürlich konnte man ihm keinen Mord
beweisen. Im Grunde nicht mal einen Pferdediebstahl. Er hatte das
reiterlose Roß, das durch die Wälder irrte, mitgenommen, um es im
nächsten Ort abzuliefern.
Dennoch hatte Roland ein äußerst unbehagliches Gefühl. Die
Männer waren aufgeregt und voller Feindschaft gewesen, eine
wütende Horde, die offenbar nur einen Schuldigen suchte ...
Und wo waren die Knappen? Wie anders wäre alles verlaufen,
wenn sie zur Stelle gewesen wären!
Schließlich fielen Roland doch die Augen zu. Alpträume quälten
ihn in unruhigem Schlaf.
Irgendwann weckten ihn Geräusche.

Etwas knirschte und quietschte, dann fiel eine Tür zu.
Blinzelnd öffnete er die Augen und drehte den Kopf.
Lampenschein näherte sich und geisterte über kahle Wände. Schritte
hallten dumpf über den Gang bis zum Keller.
Es war Hohkeppel mit vier anderen Männern.
Hohkeppel blieb drei Schritte von Rolands Stiefelspitzen entfernt
stehen und hob die Hand mit der Lampe.
»Willst du ein Geständnis ablegen?« fragte er. »Wo hast du die
Leiche verscharrt?«
Roland bemühte sich um einen ruhigen Tonfall. Er schilderte noch
einmal, was er im großen und ganzen schon gesagt hatte. Stumm
hörten Hohkeppel und die anderen zu. Roland sah Hohkeppel an den
Augen an, daß ihm der Mann kein Wort glaubte. Und einer der
anderen sprach aus, was gewiß auch Hohkeppel dachte:
»Er lügt das Blaue vom Himmel herunter. Thomas ist ebenso
verschwunden wie seine Tochter. Er war auf der Suche nach ihr und
ist gewiß in eine Falle geraten. Der Kerl da ist einer der Räuber. Er
hat Thomas umgebracht und sich sein Roß genommen. Wir sollten
ihn auf der Stelle aufknüpfen!«
»Dann erfahren wir nichts«, wandte Hohkeppel besonnen ein,
schien aber grundsätzlich nichts gegen das Aufknüpfen zu haben.
»Ich könnte schon dafür sorgen, daß er wie eine Nachtigall singt«,
sagte einer der Männer, tauschte einen bedeutungsvollen Blick mit
den anderen und putzte sich mit einem Messer die Fingernägel. Dann
sah er Hohkeppel erwartungsvoll an.
Hohkeppel starrte nachdenklich auf Roland nieder.
»Du hast es gehört. Also mach das Maul auf, oder Philipp
bearbeitet dich mit dem Messer.«
»Das würdest du zulassen?« fragte Roland. Und bitter fügte er
voller Verachtung hinzu: »Feiner Polizist!«
»Ich bin kein Polizist«, sagte Hohkeppel, hakte die Daumen hinter
die Hosenträger und wippte auf den Zehenspitzen. »Das hat
Waldemar nur gesagt, um dich zu täuschen. Er dachte sich, du
würdest geschwind das Weite suchen, wenn du etwas von Polizei

hörst. Ich bin ein Schwager von Himperich, den du ermordet hast,
um dir sein schönes Pferd zu nehmen oder weil er hinter dir her war.
Denn er ist Polizist. Wo sind übrigens die ändern?«
»Welche anderen?«
»Deine Räuberkumpane. Du willst uns doch wohl nicht
weismachen, du treibst dich allein hier in den Wäldern herum?«
Hohkeppels kleine Augen blickten lauernd. »Vielleicht lassen wir
dich am Leben, wenn du uns euer Versteck verrätst.«
»Ich bin kein Räuber, ich bin ...« Roland verstummte. Es hatte
keinen Sinn. Er spürte, daß er diese Männer nicht überzeugen konnte.
Hohkeppel gab Philipp einen Wink.
Philipp näherte sich. Die Messerklinge funkelte im Schein der
Lampe.
»Wer nicht reden will, muß fühlen«, sagte Philipp.
Rolands Gedanken jagten sich, Verzweiflung erfaßte ihn. Kurz
spielte er mit dem Gedanken, seine Rolle als Händler aufzugeben
und preiszugeben, daß er Ritter Roland war. Doch hätte ihm das
etwas genützt? Das konnte schließlich jeder behaupten. Erst vor zwei
Monaten hatte man einen Zechpreller und seine beiden Kumpane
entlarvt, die durch die Lande gezogen waren und sich als Ritter
Roland und seine Knappen ausgegeben hatten. Obwohl sie gar nicht
mal so ähnlich ausgesehen hatten, waren sie in abgelegenen
Ortschaften reich bewirtet worden, bevor sie sich aus dem Staub
gemacht hatten ...
»Fangen wir mit dem kleinen Finger an«, sagte Philipp in Rolands
Gedanken hinein, und Roland spürte, wie der Kerl die Messerklinge
ansetzte.
»Ich sage euch alles, was ich weiß«, erklärte Roland hastig.
Hohkeppel atmete hörbar auf. Auch Philipp wirkte erleichtert.
Roland spürte, daß die Männer ihn nur einschüchtern und ihre
Drohung vielleicht gar nicht wahrmachen wollten.
Es waren Bürger des Ortes und keine Verbrecher. Ihr
ungesetzliches Vorgehen war nicht zu entschuldigen, doch Roland
spürte, daß sie in Sorge um einen der ihren handelten. Und wenn er
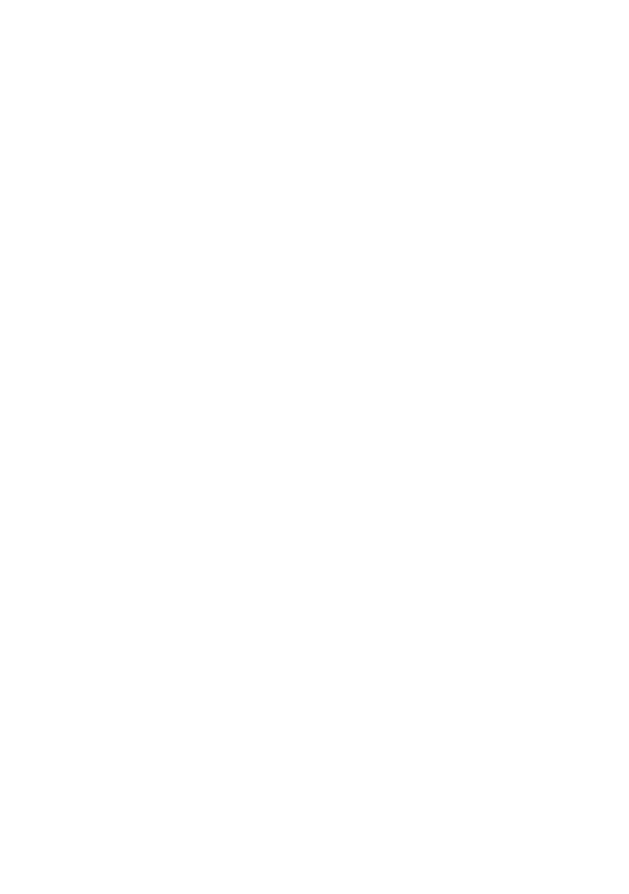
gerecht war, mußte er zugeben, daß es schon sonderbar war, daß ein
Fremder auf einem Pferd in den Ort ritt, dessen Besitzer auf der
Suche nach seiner verschollenen Tochter ebenfalls verschwunden
war. Dazu das spurlose Verschwinden von vielen Menschen und
Transporten, das die Leute im Schwarzwald in Angst und Schrecken
versetzte ...
Roland tat, was er versprochen hatte. Er sagte alles, was er wußte.
Das war natürlich so gut wie nichts, aber dabei versuchte er noch
einmal, die Männer zu überzeugen.
»Wenn ich ein Pferdedieb wäre, dann hätte ich mich doch über alle
Berge gemacht. Dann wäre ich doch nicht hergeritten. Ich hätte doch
damit rechnen müssen, daß jemand das auffällige Pferd und dessen
Besitzer kennt.«
»Da ist was dran«, murmelte Hohkeppel.
»Ach was. Ich sage euch, der Kerl will uns einen Bären
aufbinden!« Philipp schnitt seine finsterste Miene und fuchtelte mit
dem Messer herum.
In diesem Augenblick ging die Tür auf, und Schritte polterten über
die Kellertreppe heran.
»Hohkeppel?« rief eine aufgeregte Stimme.
»Ja?«
Ein kleiner, schmächtiger Mann eilte so hastig die Treppe herunter,
daß er fast gestolpert wäre.
»Wir haben ihn gefunden«, sagte er atemlos.
»Wen?« fragte Hohkeppel.
»Euren Schwager.«
Roland atmete auf. Der Besitzer des Pferdes war gefunden worden.
Jetzt würde sich alles aufklären.
Doch da sagte der kleine Mann in die erwartungsvolle Stille:
»Er lag tot in der Nähe der Stelle, wo der Kerl angeblich das Pferd
reiterlos gefunden hat.«
*

Wittich spießte eine Scheibe des saftigen Wildschweinbratens mit
der Gabel auf und schob sie in den Mund. Eine Weile kaute er
schmatzend und trank dazu Wein aus einem silbernen Becher.
Der Schein des Lagerfeuers zuckte über sein Gesicht. Es war einst
ein gutaussehendes Gesicht gewesen. Jetzt war es von Brandnarben
entstellt. Doch von den Narben war so gut wie nichts zu sehen, denn
ein dichter schwarzer Bart bedeckte Wangen und Kinn, und dazu
trug er die schwarzen Haare lang wie eine Frau. Bis auf die Schultern
fielen die Haare und umrahmten sein scharfgeschnittenes Gesicht,
das von grünen Augen beherrscht wurde.
Es waren schöne, weiche, glänzende Haare. Frauenhaare. Wittich
trug eine Perücke auf dem kahlen Schädel, der mit roten, wulstigen
Narben bedeckt war. Der Bart war ebenfalls nicht sein eigener. Er
war unter der Perücke befestigt und verdeckte die Brandnarben an
den Wangen, auf denen keine Haare mehr wuchsen.
Auch am Körper hatte Wittich Narben davongetragen. Fast wäre er
damals bei lebendigem Leibe verbrannt. Damals, in jener
schrecklichen Nacht, in der das Feuer all seine Träume und sein
Glück zerstört hatte ...
»Was ist, Liebling, schmeckt es dir nicht?« fragte er und sah kurz
zu dem Mädchen, das bei ihm auf einer Decke beim Feuer saß. Das
Mädchen hatte keinen Bissen gegessen. »Gefällt es dir nicht in
meiner Gesellschaft? Möchtest du lieber für meine Männer tanzen
wie Roswitha?«
Sein Blick glitt durch das Lager zu den anderen Feuern, an denen
finstere Gestalten hockten und die Frau anstarrten, die zum Klang
einer Laute tanzte.
Die Frau war in zerfetzter Nonnentracht in das Versteck der
Räuberbande gebracht worden.
Jetzt mußte sie nackt tanzen.
Das Mädchen, das abseits von den anderen mit Wittich allein am
Lagerfeuer saß, folgte Wittichs Blick und schluckte.
»Es gefällt mir in Eurer Gesellschaft«, versicherte sie hastig. »Ich
möchte nicht tanzen.«

Wittich lächelte. »Dachte ich mir. Du bist keine Hure wie die da.
Du bist zu schade für diese ungehobelten Kerle. Du bist genau die
Richtige für mich.«
Wohlgefällig tastete sein Blick über Edeltrauts Körper, und ihr
Anblick erregte ihn mehr als die nackte Roswitha.
Denn sie ähnelte Beatrix.
Beatrix, die einzige Frau, die er jemals von Herzen geliebt hatte.
Beatrix, die damals bei dem Feuer ums Leben gekommen war.
Edeltraut hatte das gleiche madonnenhafte Gesicht mit großen
haselnußbraunen Augen, die so seelenvoll blickten, die gleichen
feingeschwungenen Lippen, das gleiche blonde Haar und den
schlanken, doch wohlgerundeten Körper.
Bald würde sie ihm gehören. Bald ...
Er hätte sie mit Gewalt nehmen können, doch das widerstrebte
ihm. Er hätte das Gefühl gehabt, Beatrix etwas Böses zu tun, der
sanften Beatrix, um derentwillen er damals ein anständiges Leben
begonnen hatte. Ja, er war glücklich mit ihr gewesen, hatte geglaubt,
nach der dunklen Vergangenheit eine selige Zukunft vor sich zu
haben. Bis die Feuersbrunst alles vernichtet hatte.
Es war ihm, als lebte Beatrix in Edeltraut weiter ...
Edeltraut hatte ihm ihr Wort gegeben, ihn zu ehelichen, wenn dies
hier alles vorüber sein würde. Vielleicht hatte sie es aus Angst getan,
er könnte ihr Gewalt antun oder sie seinen wilden Mordgesellen
überlassen wie die drei falschen Nonnen und die vier anderen
Mädchen, die seine Männer nebenbei entführt hatten, um eine
Abwechslung in der Einsamkeit dieses Verstecks zu haben.
Sein Blick glitt zu den Feuern, in dessen Schein Roswitha unter
Zwang tanzte. Die Männer johlten und hatten ihren Spaß. Sollten sie.
Geld, Weiber und Saufen - mehr kannten sie nicht. Was wußten diese
verkommenen Kerle schon von wahrer Liebe! Die konnten keine
echte Perle von einer falschen unterscheiden. Hätte er Edeltraut
ihnen überlassen, so wäre das Perlen vor die Säue geworfen ...
Diese Männer Waren für Wittich Pöbel, dessen er sich bediente,
solange er es noch brauchte.

Wenn erst der Schatz gehoben war ...
Er schaute über die Feuer hinaus zu dem dunkel gähnenden
Schlund in der Felswand. Dort, oberhalb des Lagers gab es eine
große Höhle. Wie ein Kerker der Natur. Darin waren die
Gefangenen. Vierunddreißig Männer, die tagsüber den Staudamm
bauten. Es konnte allenfalls noch zwei Wochen dauern, bis der
Damm fertig war, bis der sagenhafte Schatz im dann trockengelegten
See aus dem Schlick ausgegraben werden konnte...
In seinen Augen leuchtete es auf.
Dann kehrte sein Blick zu Edeltraut zurück. Ja, sie würde ihm
gehören. Er würde ihre Bedingung erfüllen und alle Gefangenen
freilassen, bevor er sich mit ihr für immer davonmachen und irgend-
wo weit fort ein neues Leben beginnen würde, reich wie ein König ...
»Du wirst meine Königin sein«, sagte er mit belegter Stimme.
Edeltraut hielt seinem Blick stand.
»Ja, ich werde Eure Königin.«
»Wir werden reich und glücklich sein«, fügte er hinzu wie so oft,
in einem beschwörenden Tonfall, als müßte er nicht nur sie, sondern
auch sich selbst überzeugen.
Er blickte sie durchdringend an, als sie schwieg.
»Ja, wir werden reich sein ...« sagte sie hastig.
»Und glücklich. Du wirst mich lieben wie ...«
Wie Beatrix hatte er sagen wollen, doch er unterbrach sich schnell.
Davon durfte sie nichts wissen. Das war sein Geheimnis für alle
Zeiten.
Um Edeltrauts Mundwinkel zuckte es kaum merklich. Furcht war
in ihren Augen aufgeflackert, als er von »lieben« gesprochen hatte.
»Ich bitte Euch«, sagte sie beschwörend, »laßt mir noch Zeit, auf
daß sich meine Gefühle entwickeln können. Noch kenne ich Euch
erst eine Woche.«
Er ergriff ihre feingliedrige Hand und drückte sie leicht. Die
Berührung weckte ein prickelndes Gefühl in ihm. Seit Beatrix hatte
es keine andere Frau mehr für ihn gegeben.
»Nenn mich Wittich und sprich nicht so förmlich«, sagte er und

drückte ihre Hand fester.
»Ja, Wittich.«
Sie senkte scheinbar demütig den Kopf.
Er streichelte über ihr blondes Haar, das rötlich im Schein des
Feuers schimmerte. Unmerklich zog sie den Kopf zurück.
Scheu wie damals Beatrix, als ich sie kennenlernte, dachte er.
Sie war jung, und er mußte ihr Zeit lassen, sie weiterhin
umwerben. Sie hatte ja recht. Liebe auf den ersten Blick konnte er
nicht verlangen. Er mußte sie nach und nach für sich gewinnen. Und
wenn sie erst den Schatz sah ... Nichts erobert das Herz einer Frau
leichter als Reichtum, dachte er.
»Du sollst nicht mehr bei diesen verkommenen Weibern in der
Hütte schlafen«, sagte er mit belegter Stimme und zog seine Hand
von ihrem Haar. »Du wirst fortan mit mir die Hütte teilen, wie es
sich für eine zukünftige Herrin geziemt.«
Sie blickte auf, überrascht, aber auch ein bißchen erschrocken, wie
er fand.
Er lächelte sie beruhigend an. »Ich werde dich nicht drängen. Mein
Wort gilt.«
Ein Lächeln huschte über ihre schönen Züge.
Ein zärtliches Lächeln, dachte er, doch es war ein Lächeln der
Erleichterung.
»Sag mir noch einmal, daß auch dein Wort gilt«, forderte er, und
seine Stimme klang voll angespannter Erwartung.
»Mein Wort gilt, wenn Ihr ... du ... deines hältst«, beteuerte sie
schnell.
»Du wirst mir gehören, sobald ich den Schatz habe.«
»Ja«, sagte sie. »Sobald du den Schatz hast.«
Sie lächelte dabei, doch es kostete sie unsagbare Beherrschung,
nicht in Tränen auszubrechen.
Sie betete des Nachts, daß es noch lange dauern würde, bis der
Staudamm fertig sein würde. Sie betete, daß ihr Vater auf der Suche
nach ihr die Zeichen finden würde, die sie hinterlassen hatte. Daß er
mit einem ganzen Reiterheer kommen und sie und ihre ebenfalls

entführten Begleiter und all die anderen Gefangenen befreien würde.
Sie konnte nicht wissen, daß ihr Vater tot war, ermordet von einem
der Wachtposten am unteren Zugang zur Schlucht. Sie war nicht
dabei gewesen, als der Räuber Wittich von dem Eindringling
berichtet und gefragt hatte, was mit dem Toten geschehen solle ...
Wittich hatte befohlen, die Leiche in die Schlucht zu bringen und
damit allen Gefangenen zu zeigen, daß niemand lebend in das
Versteck hinein oder heraus kam. Doch dann hatte Heinrich die Habe
des Toten gezeigt - abzüglich der unterschlagenen Dinge. Es war so
üblich, daß die Beute abgeliefert wurde und daß Wittich dann einen
Teil an seine Räuber abgab. Sie ordneten sich ihm widerspruchslos
unter. Es waren Kerle, von denen die meisten weder lesen noch
schreiben konnten, und sie kuschten, solange er sie gut entlohnte. Sie
waren wie Wölfe, die sich dem Leitwolf unterordneten. Und in
früheren Zeiten hatte er bewiesen, daß er kampfstark und gerissen
war und zu führen wußte.
Wittich hatte den Wachen großzügig die paar Dinge von Wert
überlassen, die Heinrich nicht unterschlagen hatte. Nur flüchtig hatte
er den Brief angeschaut, den Heinrich bei der Leiche gefunden hatte.
Dann war sein Blick auf den Namen Edeltraut gefallen. Er kannte
ihre Schrift. Sie hatte für ihn ein Gedicht aufgeschrieben, das er ihr
diktiert hatte.
Es gab keinen Zweifel: Der Tote war ihr Vater.
Sie durfte nicht erfahren, daß seine Räuber ihn umgebracht hatten.
Sie würde ihn hassen, wenn sie die Wahrheit erfuhr ...
Wittich hatte Heinrich den Auftrag gegeben, die Leiche irgendwo
außerhalb der Schlucht zu begraben. Für Wittich war Edeltrauts
Vater für immer verschwunden ...
Von alledem konnte Edeltraut nichts ahnen.
Sie hatte diesem Verbrecher, der ihr mit seinem sonderbaren Getue
und Gerede wie ein Wahnsinniger vorkam, nur ihr Wort gegeben, um
ihn hinzuhalten. Sie hatte in ihm die Hoffnung genährt, sich mit
einem Schatz kaufen zu lassen.
Eher wollte sie sterben, als diesem widerwärtigen Kerl zu Willen

zu sein. Sein Gerede von wahrer Liebe! Er verachtete die üblen
Burschen, die seine Befehle ausführten, und hielt sich für etwas
Besseres. Dabei war er der Schlimmste von allen.
Sie erschauerte unter seinen Berührungen, und der Gedanke, mit
ihm die Hütte teilen zu müssen, erfüllte sie mit Übelkeit.
Aber sie mußte alles tun, um diesen Verbrecher in seiner fixen Idee
zu bestärken. Nur so gab es vielleicht die Rettung für sie und die
anderen Gefangenen ...
Er hob den Becher mit dem Wein, prostete ihr zu und sagte mit
theatralischer Gebärde:
Glücklich preise sich der Mann, der, ohne daß er's lang besann ein
liebend Weib für sich gewann.
Beifallheischend blickte er sie an. Sie zwang sich zu einem
Lächeln.
»Ihr seid ... du bist ein wahrer Dichter«, sagte sie in gespielter
Anerkennung. Sie wußte, daß er Anerkennung wollte, wenn er
irgendwelche Verse zum Besten gab.
Wittich nickte geschmeichelt. Und er nahm sich vor, den alten
Sigismund nach weiteren galanten Versen zu fragen. Sigismund war
einer der Gefangenen. Ein echter Poet. Von ihm stammten die Verse,
die Wittich bei Edeltraut als seine eigenen ausgab.
Der gute alte Sigi, dachte Wittich, der Mann aus dem
Südschwarzwald, den man auch Hotzenwald nannte.
Ihm verdankte er praktisch alles. Ohne ihn hätte er nie von dem
gewaltigen Schatz aus dem Morgenland erfahren, der auf dem
Grunde des Sees nur darauf wartete, geborgen zu werden ...
Der Kuckucksruf riß ihn aus seinen Gedanken.
Er blickte zum südlichen Zugang zur Schlucht. Hufschlag klang
auf. Der Schatten eines Reiters schälte sich aus dem Dunkel. Dann
folgten weitere berittene Männer.
Sie brachten zwei Gefangene.
Die Gefangenen hockten mit verbundenen Augen gefesselt auf
abgetriebenen Pferden.
Wittich erhob sich und blickte ihnen entgegen.

Der kleine Trupp hielt beim Feuer.
»Weitere Arbeiter, Alfons?« fragte Wittich den graubärtigen
Anführer des Trupps.
Der Graubart blickte grinsend zu den anderen Feuern. Roswitha
beendete dort ihren Tanz, weil die Laute verstummt war. Einige
Getalten erhoben sich und schlenderten herbei.
»He, wo habt ihr denn diese Vögel her?« fragte einer und lachte
schrill. Es war Paul, neben Alfons der zweite Unterführer der Bande,
die insgesamt außer Wittich siebzehn Räuber zählte.
»Spann mich nicht auf die Folter«, sagte Wittich grollend. »Wer
sind die beiden?«
Alfons kratzte sich am Bart. »Sie schnüffelten in Peterzell herum.
Der Blonde da heißt Pierre, der mit dem schwarzen Bart schimpft
sich Louis. Sie gaben sich als Mitarbeiter eines Händlers aus, der
Sorge um seine Fracht hat. Doch wir belauschten einige Fragen, die
sie im Ort stellten. Für mich gibt es keinen Zweifel - sie wollten
herausfinden, wer die Leute und die Warentransporte gekapert hat.«
»Verdammte Brut!« rief Paul. Er trat an einen der Gefangenen
heran, packte ihn und riß ihn vom Roß. Es war Pierre, der unsanft auf
dem Boden aufschlug. Obwohl Pierres Hände hinter dem Rücken
gefesselt waren, rollte er sich geschickt von den Hufen des
scheuenden Pferdes fort.
Wieder ertönte Pauls schrilles Lachen, das manchem der
Gefangenen einen Schauer über den Rücken gejagt hatte, als sie
überfallen worden waren.
Zwei andere Männer warfen Louis vom Pferd.
Dann schauten alle abwartend zu Wittich - bis auf einen, der nur
Augen für Edeltraut hatte, die wie erstarrt am Feuer saß und auf die
beiden neuen Gefangenen starrte.
»Erzähle genauer«, forderte Wittich den Graubart auf.
Alfons zuckte mit den Schultern. »Da gibt es nicht viel zu
erzählen. Wir haben die Schnüffler flachgelegt, unauffällig in einen
Wagen verfrachtet, und einer von uns hat im Wirthaus erzählt, die
beiden Fremden seien abgereist. Wir sind dann zu unserem Freund

Rainald gefahren. Er war es übrigens, der uns informierte, daß sich
zwei Fremde in Peterzell herumtreiben und Fragen stellen. Auf
Rainalds Hof haben wir den Wagen zurückgelassen, sind auf Pferde
umgestiegen, und hier sind wir.«
»Habt ihr alle Spuren beseitigt?« fragte Wittich.
»Wie immer, Herr«, versicherte Alfons unterwürfig.
Wittich nagte an seiner Unterlippe. »Habt ihr sie schon - befragt?«
erkundigte er sich lauernd.
Alfons grinste. »Sie behaupten stur und steif, sie arbeiteten nur für
einen Händler. Ich hielt es für das Beste, Sie verschwinden zu
lassen.«
»Ja, das war in der Tat das Beste«, sagte Wittich nachdenklich und
blickte finster zu den beiden Männern, die am Boden lagen.
»Sie werden uns schon erzählen, wer sie geschickt hat.« Paul
lachte schrill. »Ich schlage vor, wir unterhalten uns ein bißchen mit
ihnen.« Er zog sein Messer aus der Scheide am Gurt.
Wittichs Blick glitt zu Edeltraut, die eine Hand auf den Mund
preßte.
»Geh in meine Hütte«, sagte er mit einem gezwungenen Lächeln.
Sie erhob sich zögernd. Mit einem besorgten Blick zu den beiden
Gefangenen raffte sie ihr Kleid und schritt davon.
Wittich blickte ihr immer noch nach, und diesmal war sein Lächeln
echter.
Dann gewahrte er, daß auch die anderen dem Mädchen mit
funkelnden, begehrlich glitzernden Augen nachschauten, und seine
Miene verfinsterte sich.
»Steht nicht herum und haltet Maulaffen feil!« fuhr er sie an.
»Werft die beiden ins Feuer, bis sie uns sagen, wer sie geschickt hat
und was sich da gegen uns zusammenbraut!«
*
Derweil lag Ritter Roland in einem Kastenwagen, der gen Freiburg
rollte. Er war gefesselt und lag im Dunkel allein mit seinen

quälenden Gedanken.
Eigentlich konnte er von Glück sagen, daß man ihn nicht auf der
Stelle in Peterzell am nächstbesten Baum aufgehängt hatte.
Er glaubte noch das Toben der aufgebrachten Bürger zu hören:
»Mörder! Mörder!«
»Hängt ihn auf!«
Wie ein Lauffeuer hatte sich in dem Ort und in der Umgebung die
Kunde verbreitet, daß der Fremde den angesehenen Sohn des Ortes
ermordet hatte: Thomas von Himperich, den Kommandanten der
Stadtgarde zu Freiburg, der in Peterzell wie fast jedes Jahr zur
Sommerfrische geweilt hatte, bevor er sich auf die Suche nach seiner
Tochter begeben hatte. Für die empörten Verwandten und die
meisten Einwohner des Ortes gab es keinen Zweifel: Der Fremde
war ein Mörder und Pferdedieb. Vermutlich sogar ein Mitglied der
Bande, die für die Überfälle und das spurlose Verschwinden von
Menschen in der letzten Zeit verantwortlich war.
Die Volksseele hatte gekocht, und man hatte kurzen Prozeß mit
Roland machen wollen. Und Ritter Roland wäre wohl des Todes
gewesen, wenn sich nicht zwei Menschen für ihn eingesetzt hätten:
Almuth und der Pater.
Almuth, voller Enttäuschung darüber, daß Louis sein Versprechen
nicht eingehalten hatte, hatte für den Gefangenen gesprochen. Sie
hatte zwar nichts von dem Hochsitz-Abenteuer mit Louis erzählt -
die Tochter des Krämers galt in Peterzell als wohlbehütete keusche
Jungfer - doch sie hatte sich an das erinnert, was Louis ihr außer
Liebesworten geflüstert hatte. Außerdem hatte sie berichtet, daß sie
beim Spaziergang im Walde eine Reiterin wilder Jagd gesehen hatte,
auf dem Pferd, das dem Gefangenen gehörte. Louis hatte ihr ja die
Zusammenhänge in groben Zügen erklärt.
Ihre Worte lösten zumindest bei einigen besonneneren Bürgern
leichte Zweifel an der Schuld des Fremden aus. Doch die
Scharfmacher hätten sich gewiß durchgesetzt, wenn nicht der Pater
mit der Heiligen Schrift in der Hand und Worten daraus im Munde
zur Vernunft gemahnt hätte. Die meisten der Einwohner von

Peterzell waren sehr fromm, und plötzlich hatte sich keiner mehr
gefunden, der gegen das Gebot verstoßen wollte: Du sollst nicht
töten.
»Dann lassen wir das eben andere erledigen«, hatte Wöhrle, der
Wirt, in der allgemeinen Ratlosigkeit, pfiffig gesagt. »So geschieht
Gerechtigkeit, und wir waschen unsere Hände in Unschuld.«
Damit war auch der Pater einverstanden gewesen, und so hatte man
flugs beschlossen, den fremden Hundsfott nach Freiburg zu bringen
und dem Gesetz zu übergeben.
Bevor Roland in den Wagen geworfen worden war, hatte er noch
einen Reiter in den Ort traben sehen. Ein großer Mann auf Rolands
prächtigem Hengst.
Doch Roland war es versagt geblieben, sein Roß auch nur länger
als drei Sekunden zu sehen. Bevor er etwas hatte sagen können, hatte
man die Tür des Wagens zugeknallt, der Wagen war losgefahren,
und keiner hatte sich um Rolands Rufe gekümmert.
Roland dachte an die Knappen. Wo mochten sie jetzt sein?
Der. Weg nach Freiburg war lang, und wenn Louis und Pierre nach
Peterzell zurückkehrten und erfuhren, was inzwischen geschehen
war, würden die wackeren Knappen gewiß alles Menschenmögliehe
tun, um ihn zu befreien oder seine Unschuld zu beweisen.
In Freiburg würde man ihn nicht gleich aufhängen. Das Gesetz
würde ihm die Rechte gewähren, die man jedem armen Teufel
zubilligte. Man würde ihn zumindest anhören und nicht so voller
Vorurteile sein wie die wütenden Leute von Peterzell...
Bei diesen Gedanken wurde Ritter Roland von neuer Zuversicht
erfüllt.
Wie konnte er auch ahnen, daß sich des Satans Mächte gegen ihn
verschworen hatten!
*
Pierres Hosenboden war angesengt. Flammen züngelten über das
Hosenbein. Es roch verbrannt. Verzweifelt wollte sich Pierre aus der

Glut des Lagerfeuers fortwälzen, doch zwei Räuber hielten ihn fest.
Louis erging es nicht besser. Ihn mußten allerdings drei Kerle
bändigen, obwohl seine Hände gefesselt waren. Der ehemalige
Räuberhauptmann war in seinem Zorn kaum zu halten.
Die Knappen mußten die Zähne zusammenbeißen, um nicht
aufzuschreien.
Die Räuber weideten sich mit kaltem Grinsen an ihrer Qual. Es
waren völlig verrohte Burschen, die kein Mitleid kannten.
»Wer hat euch geschickt?« wiederholte Wittich mit drohender
Stimme und starrte finster auf Louis hinab.
»Fahr zur Hölle!« brüllte Louis und bäumte sich auf.
Wittich zuckte zusammen, als Louis ihm ins Gesicht spuckte.
»Feuer nachlegen!« brüllte Wittich.
»Nein!« Der helle Schrei hallte durch die Schlucht.
Wittich und die Räuber wandten die Köpfe.
Edeltraut lief aus der Hütte des Räuberhauptmanns. Sie hatte vom
Fenster aus alles gesehen und konnte den schrecklichen Anblick der
gepeinigten Gefangenen nicht länger ertragen. Ihr blondes Haar flog,
als sie zum Feuer lief.
»Habt Gnade mit diesen Männern!« flehte sie. »Ihr könnt sie doch
nicht bei lebendigem Leibe ...»Sie verstummte schluchzend. Wittich
nagte an der Unterlippe. Er stellte sich vor sie und verdeckte die
Sicht auf die Gefangenen. »Geh wieder in die Hütte. Das ist kein
Anblick für dich«, sagte er mit rauher Stimme. »Zieh den Vorhang
vors Fenster!«
»Es ist grausam, das darfst du nicht tun!« Voller Empörung
funkelte sie ihn an. »Du bist ein ...«
Fast hätte sie in der Erregung hinausgeschrien, was sie von ihm
hielt. Vielleicht warnte sie das Aufblitzen in seinen Augen. Oder ihr
weibliches Gespür.
»... König«, fuhr sie jedenfalls nach kurzem Zögern fort. »Und das
ist eines großmütigen Königs nicht würdig.«
Der ärgerliche Ausdruck verschwand sofort aus seinen Augen.
»Diese Männer wollen nicht zugeben, daß sie im Auftrag von

jemanden herumschnüffeln«, sagte er. »Und dieser Jemand könnte
möglicherweise zu einer Gefahr für mich werden - und für dich.
Deshalb gilt es, Vorkehrungen zu treffen ...«
»Ich bitte, ich flehe ...»Und Edeltraut fiel auf die Knie, ohne daran
zu denken, daß das Gras abseits des Feuers noch feucht vom
Gewitterregen war. Sie war voller Menschlichkeit und wollte einfach
helfen. Wittich schaute auf sie hinab, und es gefiel ihm, wie sie
demütig vor ihm verharrte wie eine Dienerin. Seine Dienerin. »Ein
paar kleine Brandwunden sind nicht so schlimm«, sagte er mit
plötzlich weicherer Stimme, und er dachte an seine Narben. Bald
würde Edeltraut sie sehen und vielleicht erschrecken. Es war gut,
wenn er sie schon ein wenig darauf vorbereitete. Die Situation
forderte geradezu dazu heraus.
»Auch ich habe einige Brandmale davongetragen, als ich eine arme
Frau aus tobender Feuersbrunst errettete. Du wirst sie sehen, diese
Male der Tapferkeit und Barmherzigkeit!«
Es war eine Lüge, doch das wußte nur er. Er war im Vollrausch
gewesen, als das Feuer vom Wind gepeitscht im Wald getobt hatte,
als die Hütte lichterloh in Flammen gestanden hatte. Er hatte nicht
daran gedacht, Beatrix zu retten. Er war zu betrunken gewesen, um
überhaupt einen klaren Gedanken fassen zu können. Da waren nur
das tobende Feuer gewesen, die Hitze, der Rauch. Er wußte nicht
mehr, wie er sich auf die Lichtung geschleppt hatte. Irgendwann war
er halbtot von einem Kräutersammler gefunden worden. Ihm hatte er
sein Leben zu verdanken. Doch Beatrix war nicht mehr zu retten
gewesen. Bei ihrem Anblick war etwas in ihm zerbrochen. Früher
war er ein kaltberechnender Räuber gewesen, der um der Beute
willen zu jeder Schandtat bereit gewesen war, sofern sie nicht mit zu
großem Risiko behaftet war. Doch seit Beatrix' Tod hatte er sich
verändert. Er schreckte zwar nicht vor Schandtaten zurück, doch das
Risiko war ihm im Grunde genommen gleichgültig. Sein ganzes
Denken galt allein Beatrix, seinem Traum. Und jetzt war Beatrix für
ihn in Edeltraut wieder auferstanden. Für ihn war es kein Zufall, daß
seine Männer sie gefangengenommen hatten. Nein, sie war nicht

gefangengenommen worden. Sie war aus dem Jenseits
zurückgekommen ...
All das ging ihm in sekundenschnelle durch den Kopf. Es war ein
verwirrter Kopf, doch ihm selbst war das gar nicht klar.
Ebensowenig den abgestumpften Räubern. Sie wunderten sich
gelegentlich über das sonderbare Verhalten ihres Anführers, doch sie
wußten nichts von Beatrix. Sie dachten, Wittich hätte einfach die
seiner Meinung nach schönste der Weiber für sich ausgesucht, wie es
einem Anführer zustand ...
Einer der Gefangenen schrie. Es war Pierre, aus dessen Hose
Flammen schlugen.
»Ich habe damals nicht geheult wie diese Jammerlappen«, sagte
Wittich verächtlich, und das war eine weitere Lüge. »Ich habe ...«
Er wollte sich noch ein wenig brüsten, doch da sprang Edeltraut
auf und warf sich ihm an die Brust. Sie umklammerte ihn, und er
spürte ihren Körper und glaubte Beatrix in den Armen zu halten.
»Gebiete Einhalt!« Edeltraut schrie es fast.
Da gab Wittich seinen Männern einen schroffen Wink. Sie zogen
die Gefangenen aus dem Feuer.
Wittich drückte Edeltraut fest an sich und küßte sie.
Sie spürte seinen seltsam weichen Bart, roch seinen Atem, und ihr
wurde fast übel, als er seine Lippen auf ihren Mund preßte.
Doch es ging vorüber.
Die Männer hatten die Gefangenen vom Feuer weggezerrt. Auf
einen Befehl Wittichs hin klopften sie die Flammen an der Kleidung
aus. Sie machten sich einen Spaß daraus, recht heftig zu klopfen, und
die Knappen trugen außer Brandwunden auch noch blaue Flecke
davon. Doch das Feuer war gelöscht.
»Schafft sie mir aus den Augen«, sagte Wittich mit einer
herrischen Geste. »Arnold soll ihnen Salbe auf den Hintern
schmieren, und morgen früh werden sie mit den anderen am
Staudamm arbeiten.«
*

Gunzelin von der Traube war an diesem Morgen mürrischer Laune.
Er war der Stellvertreter des Stellvertreters von Kommandant
Himperich, und er mußte mit geschientem Bein Dienst versehen,
weil der gerade von der Lungenentzündung genesene Briegel von
neuem erkrankt war. Der Bader konnte noch nichts Genaues sagen,
außer daß Briegel hohes Fieber hatte und das Bett hüten mußte.
Deshalb mußte Gunzelin ihn jetzt vertreten, zwar nur bei unerledigter
Schreibarbeit, doch gerade das war Gunzelin verhaßt.
Die Pest wünschte er Briegel an den Hals!
Ärgerlich saß Gunzelin hinter dem Sekretär aus Eiche und quälte
sich mit Amtsgeschreibe. Jeden Mann der Garde, der sich blicken
ließ, hatte er schon angeschnauzt. Das Resultat war, daß sich keiner
mehr in die Amtsstube wagte ...
Gunzelins Laune besserte sich dann etwas, als gegen Mittag die
Kunde eintraf, daß Kommandant Himperich Opfer eines
Raubmordes geworden sei. Der Wagen mit dem Mörder sei auf dem
Wege nach Freiburg; ein Bote war ihm vorausgaloppiert.
Gunzelin trauerte nicht lange um Himperichs Tod. Der Vorgesetzte
war ihm nie sympathisch gewesen. Gunzelin dachte vielmehr daran,
daß der Posten jetzt frei war und daß Briegel nach
Lungenentzündung und neuer Krankheit gewiß noch einige Zeit
dienstuntauglich sein würde. Zeit, in der es galt, genügend Ansehen
zu sammeln, um sich als Himperichs Nachfolger zu empfehlen.
Briegel war schon älter und in den letzten zwei Jahre kränklich.
Außerdem waren ihm einige Fehler passiert. Vielleicht raffte ihn gar
das Fieber dahin ...
Gunzelin sah sich mit einem Schlag ganz oben auf der Leiter des
Erfolges ...
Dann dachte er an die verdammte Leiter, deren oberste Sprosse
unter seinen Füßen zusammengebrochen war, als er auf dem
Apfelbaum gewesen war, und seine Miene wurde säuerlich als hätte
er zum Frühstück statt des Hagebuttentees Essig getrunken.
Flugs wandte er sich erfreulicheren Gedanken zu.
Im Grunde konnte er sich jetzt schon als stellvertretender

Kommandant fühlen - derzeit sogar als Kommandant!
Eigentlich konnte er dem Schicksal – sprich Himperichs Mörder -
recht dankbar sein. Aber es würde keinen Pardon für diesen
nichtswürdigen Kerl geben! Gut, daß man ihn gleich erwischt hatte.
Jetzt brauchte er, Gunzelin, nur noch dafür zu sorgen, daß genügend
Ruhm für ihn abfiel, wenn er den Mordfall so schnell zu einem
Abschluß bringen konnte.
Ganz Freiburg würde bei der Hinrichtung zugegen sein, und er
konnte sich gut dem Volke und den Oberen bekannt machen, bevor
Briegel die Chance zu nutzen vermochte.
Bei diesem Gedanken lächelte Gunzelin von der Traube vergnügt
vor sich hin und zwirbelte seinen dünnen Schnauzbart.
Er sah sich schon als neuer Kommandant ...
*
Der Reiter kam am frühen Nachmittag in die Schlucht. Es war einer
der Räuber, die sich ständig in der weiteren Umgebung des Verstecks
und in den umliegenden Ortschaften herumtrieben und unauffällig
Erkundigungen einholten.
Diesmal brachte der Mann Wittich keine erfreuliche Kunde von
einem Warentransport, der leicht überfallen werden konnte. Dabei
mußten die Vorräte für all die vielen Esser ergänzt werden. Beim
letzten Überfall hatten die Räuber zwar zwei Wagen mit Salz
erbeutet - eine äußerst kostbare Beute - doch von Salz allein ließ sich
nicht leben. Die Gefangenen arbeiteten hart und brauchten kräftige
Nahrung. Es wurde Zeit, daß wieder für Proviant gesorgt wurde.
Doch in dieser Hinsicht brachte der Mann keine Neuigkeiten. Er
berichtete, daß man Thomas Himperichs Leiche unweit des
Verstecks der Bande gefunden hatte.
Voller Zorn ließ Wittich den Räuber Heinrich zu sich kommen, der
den Auftrag gehabt hatte, den Toten zu begraben.
»Du solltest die Leiche für immer verschwinden lassen«, grollte
Wittich.

»Jaja«, stammelte Heinrich, dem Schlimmes schwante.
»Und wie erklärst du dir, daß man die Leiche doch gefunden hat?«
»Das war so. Ich ...«
Fast ansatzlos schlug Wittich mit dem Handrücken zu. Mit einem
Aufschrei taumelte Heinrich zurück.
Wittich schlug die weite Tuchjacke zurück. Langsam, fast
bedächtig zog er die Peitsche hervor, die um seine Hüfte gewickelt
war. Er rollte die Peitsche aus. Die lange, geflochtene Lederschnur
ringelte über den Boden wie eine Schlange.
Heinrich starrte voller Furcht darauf.
»Du solltest dir schnell eine Entschuldigung einfallen lassen!«
zischte Wittich.
»Das war so. Ich ...«
Die Peitsche knallte dicht vor Heinrichs Nasenspitze, und
erschrocken sprang er zurück.
»Eine knappe, vernünftige Antwort, die mich vielleicht versöhnlich
stimmen könnte!« sagte Wittich und holte drohend mit der Peitsche
aus.
Und Heinrich sprudelte die Worte förmlich hervor:
»Ich wollte tun, was mir befohlen, Herr. Doch da tauchten Reiter
auf. Aus Peterzell. Ich habe den Schmied erkannt. Sie suchten nach
der Leiche. Da versteckte ich mich schnell. Mir blieb keine Zeit
mehr, um auch die Leiche zu verstecken. Sie hätten mich erwischt
und dann ...« Er griff sich an den Hals, als schnürte ihm ein
unsichtbarer Galgenstrick die Luft ab.
»Wie konnten sie in der Nähe unseres Verstecks nach der Leiche
suchen?« fragte Wittich zweifelnd.
Heinrich wußte keine Erklärung darauf. Doch sein Kumpan
Wenzel kam ihm zu Hilfe.
Er berichtete, was er in Peterzell erfahren hatte. »Der Mann, der
den Gaul mitnahm, hat ihnen die Stelle beschrieben, wo er ihn fand.«
Und er erzählte, daß man den Fremden des Pferdediebstahls und
Mordes verdächtigte und nach Freiburg brachte, auf daß er dort am
Galgen hänge.

Wittichs Augen hatten einen nachdenklichen Ausdruck
angenommen. »Sagten nicht die beiden Schnüffler, sie hätten in
Peterzell auf einen dritten Mann gewartet, angeblich auf einen
Händler?«
Sowohl Wenzel als auch Heinrich nickten.
»Und der dritte Mann fragte in Peterzell nach seinen beiden
Burschen, wie ich hörte«, sagte Wenzel.
In Wittichs Augen leuchtete es auf. »Dann ist dieser dritte
höchstwahrscheinlich ebenfalls ein Schnüffler. Jedenfalls gehört er
zu den beiden. Und man will ihn hängen?«
Wenzel nickte. »In Freiburg, wenn die Beweise reichen, sagte der
Pater in Peterzell.«
Wittich überlegte kurz, dann klaffte sein falscher Bart auf, und er
zeigte grinsend ein kräftiges Gebiß, dessen Schneidezähne ein wenig
schiefgewachsen, doch sehr weiß waren.
»Wir werden dafür sorgen, daß die Beweise reichen«, murmelte er.
»Der Schnüffler wird als Mörder baumeln. So vermeiden wir, daß
hier noch jemand nach Spuren oder sonstwas herumsucht. Es ist
immer gut, wenn man einen Sündenbock präsentieren kann.«
Er dachte an Edeltraut, seine neue Beatrix. Irgendwann konnte sie
erfahren, daß ihr Vater in der Nähe der Schlucht ermordet worden
war. Da war es gut, wenn man damit aufwarten konnte, daß der Täter
ein fremder Pferdedieb gewesen war, der am Galgen gestorben war.
So würde sie nie den Mord mit ihm oder seinen Männern in
Zusammenhang bringen ...
»Ja, wir werden dafür sorgen, daß der Mann aufgehängt wird«,
murmelte Wittich.
»Aber wie?« fragte Wenzel neugierig.
»Das laß mal meine Sorge sein«, erklärte Wittich. »Ich habe schon
einen Plan.«
Dann heftete er seinen Blick auf Heinrich, und seine Miene
verfinsterte sich wieder.
»Auf jeden Fall hast du Fehler begangen. Du hättest das Roß des
Eindringlings suchen müssen.«

Heinrich wäre am liebsten im Erdboden verschwunden. Er vergaß
in seiner Aufregung, seinem Kumpan Franz in diesem Punkt die
Schuld zu geben.
»Und du hast die Leiche nicht verschwinden lassen«, fuhr Wittich
mit dumpfer Stimme fort.
Er wandte sich um und gab einigen Räubern, die müßig um ein
Feuer saßen und herüberblickten, einen Wink. Sofort eilten sie
herbei.
Wittich faßte einen Hünen mit blondem Bart ins Auge. »Josef,
beklagtest du dich nicht, daß Heinrich dich neulich beim Würfeln um
sieben Dukaten betrog? Wolltest du ihm nicht den Schädel
einschlagen, was ich verbot, weil ich bei den vielen Gefangenen auf
keinen Mann verzichten kann?«
Der Hüne warf einen wütenden Blick zu Heinrich und nickte ein
paarmal.
»Nun, du kannst dich mit Heinrich beschäftigen«, sagte Wittich.
»Er hat Patzer begangen, die uns in Schwierigkeiten hätten bringen
können. Und du weißt, was ich von Versagern halte.«
Josef grinste erfreut, ballte die massigen Hände zu Kürbisfäusten
und rieb sich über die Knöchel. Er blickte zu Heinrich, als wolle er
schon Maß nehmen.
Wittich hielt ihm die Peitsche hin. »Du darfst ihm dreißig Hiebe
verpassen.«
Josef nahm die Peitsche. Er wußte nichts Rechtes damit
anzufangen, und der kurze Stiel verschwand fast in seiner
Kürbisfaust. Unschlüssig blickte er auf die Lederschnur. Man sah
ihm an, daß er sein Mütchen an Heinrich lieber mit den Fäusten
gekühlt hätte.
»Schafft Heini weg«, sagte Wittich zu den anderen. »Hinten zum
Staudamm, damit Josef ungestört seines Amtes walten kann.«
Er wollte vermeiden, daß Edeltraut zusah. Sie lag ihm ständig in
den Ohren und bettelte, er möge auf Gewalt verzichten. Die sanfte
liebe Edeltraut. Sie hatte ein gutes Herz wie Beatrix . ., Zwei Männer
packten Heinrich. Er ließ sich widerstandslos von seinen eigenen

Kumpanen wegführen, denn der Hüne Josef drohte, ihn sonst
zusammenzuschlagen.
»Josef?« rief Wittich ihm nach.
»Ja, Herr?«
Wittich grinste kalt. »Heinis Schädel sollst du dranlassen, doch
sonst brauchst du dich nicht in Zurückhaltung zu üben.«
Josef nickte und folgte mit der Peitsche in der Hand den anderen.
Er ließ die Peitsche ein paarmal knallen, um ein bißchen zu üben.
Wittich wandte sich derweil an Wenzel. »Hör zu, ich will dir
erklären, was wir tun werden ... «
Louis und Pierre sahen bei der Arbeit am Staudamm auf. Sie
hörten einen gräßlichen Schrei und ein Klatschen. Dann sahen sie,
wie einer der Räuber einen anderen auspeitschte, hörten die
grauenvollen Schreie und beobachteten dann, wie der gepeinigte
Mann zusammensank und verstummte. »Mein Gott, der schlägt ihn
tot«, flüsterte Pierre und starrte entsetzt hin.
Louis zuckte mit den Schultern. »Es ist einer der Räuber. So leid er
einem auch tun kann, es wäre das Beste für uns, wenn sich die
Dreckskerle gegenseitig totschlagen. Besonders diesen Wittich, der
uns hier wie Sklaven schuften läßt.«
Er hatte so leise gesprochen, daß nur Pierre und einer der anderen
Gefangenen ihn hatte hören können.
»Ganz meine Meinung«, raunte der andere Gefangene neben
Louis. Es war Paul, der Kutscher, der mit den drei als Nonnen
verkleideten Mädchen den Räubern in die Hände gefallen war.
Auch er hatte leise gesprochen, doch einer der Aufseher, die mit
vorgereckten Lanzen dastanden, die Gefangenen bewachten und
ständig zur Arbeit antrieben, wurde aufmerksam.
»Was ist, wollt ihr auch die Peitsche spüren?« rief er.
»Weiterarbeiten und Schnauze halten, oder ihr seid reif!«
Die Knappen und Paul arbeiteten weiter. Sie hatten erlebt, was mit
Gefangenen geschah, die aufmuckten. Das wollten sie sich ersparen.
Pierre tastete einmal über sein schmerzendes Hinterteil. Die Salbe
hatte die Schmerzen gelindert, doch es brauchte noch einige Zeit bis

zur Heilung.
Während der Arbeit dachte er mit Wehmut an seine Zeit als Page
auf Schloß Camelot. Wie so oft bedauerte er, die seidenen Sessel bei
Hofe gegen das harte Handwerk des Knappen eingetauscht zu haben,
das ihn schon in viele Gefahren geführt hatte. Und er dachte
schweren Herzens an Ritter Roland.
Wie sollte Roland sie hier finden? Gewiß war er längst in Peterzell
eingetroffen und wartete auf sie.
Daß es anders war, erfuhr Pierre später.
Louis hatte einen Aufseher gefragt, weshalb einer der Räuber
ausgepeitscht worden war.
Grinsend erzählte der Mann, was er inzwischen erfahren hatte. Und
er hatte hinzugefügt: »Euren Freund, den Händler könnt ihr übrigens
vergessen. Der liegt in Freiburg im Kerker und wartet auf seine
Hinrichtung. In spätestens drei Tagen wird er baumeln, euer
Freund!«
*
Rolands Hoffnung, daß sich alles aufklären würde, hatte sich in
Nichts aufgelöst wie Morgennebel in der Sonne.
Gunzelin von der Traube hatte all seine Aussagen pedantisch
genau zu Papier gebracht, obwohl er von Anfang an keinen Hehl
daraus gemacht hatte, daß er von Rolands Schuld überzeugt war. Aus
seinen Äußerungen hatte Roland erkannt, daß der ehrgeizige Mann
nur zu gerne die Lorbeeren anderer eingeheimst hätte, die eigentlich
gar keine waren. Ein aufsehenerregender Mordfall, eine prompte
Aufklärung und eine prächtige Hinrichtung für das Volk, das gerne
ein Schauspiel genoß - all das konnte ihm von Nutzen in seinem Amt
sein.
»Ein Ritter wollt Ihr sein«, hatte er spöttisch gefragt und die
höflichere Anrede gewählt, obwohl er zuvor Roland wie einen
Strolch herablassend geduzt hatte. »Nun, ich bin bereit, das zu
überprüfen. Derweil biete ich Euch meine Gastfreundschaft. Leider

kann ich nicht mit einem Schlosse dienen. Ihr müßt schon mit dem
Kerker vorlieb nehmen.«
Das tat Roland nun seit zwei Tagen.
Dann brachte ihm Gunzelin die niederschmetternde Kunde: »Zwei
völlig untadelige Herren haben gegen dich ausgesagt, Ritter.« Das
hatte er genüßlich und spöttisch betont. »Sie haben dich beobachtet,
wie du Thomas Himperich heimtückisch auflauertest und ihn
ermordetest. Sie haben die Schwurhand gehoben und den heiligen
Eid auf ihre Aussage geschworen. Du wirst hängen, Ritter.« Und im
Selbstgespräch hatte er hinzugefügt: »Vielleicht wäre es ganz gut,
wenn er wirklich ein Ritter wäre. So erhielte das dumme Volk einen
Beweis, daß vor dem Gesetz alle gleich sind ...«
Dann war Roland allein mit der Dunkelheit, bei Wasser und Brot
in einem kahlen Verlies der Kommandantur.
Er dachte an die Knappen. Wo blieben sie nur? Aber was konnten
sie überhaupt tun, wenn sie in Peterzell von den Ereignissen erfahren
hatten? Sie konnten nichts gegen den Schwur zweier untadeliger
Herren tun, wie Gunzelin sie bezeichnet hatte.
Weshalb hatten die Kerle einen Meineid geleistet? Vermutlich
hatten sie das im Auftrag der Bande getan, die Menschen und
Frachttransporte verschwinden ließ. Sie mußten herausgefunden
haben, daß man Nachforschungen anstellt, was ja nur zu erwarten
war, aber vor allem, wer versuchte, ihnen auf die Schliche zu
kommen. Und sie hatten schnell gehandelt, bevor die
Nachforschungen überhaupt zu einem Resultat geführt hatten ...
Die Knappen! Sie hatten eine Spur gefunden, wie sie ihm
mitgeteilt hatten. Dann waren sie mit einem Wagen aus Peterzell
fortgefahren. Ob sie in eine Falle getappt waren?
Roland überlegte, ob es einen Zusammenhang zwischen dem
Diebstahl seines Hengstes und den anderen Ereignissen geben
konnte. Helga hatte ihn raffiniert hereingelegt. Im Auftrag der
Bande? Damit sie ihm ein anders Pferd förmlich aufdrängen konnten,
das auffällige Roß eines hohen Polizisten, der ermordet worden war?
Damit sie ihm zum Mörder stempeln konnten?

Er glaubte Helga vor sich zu sehen, und seine Gefühle waren
zwiespältig.
Die Überlegungen führten zu nichts. Selbst wenn er eine Erklärung
für alles fand, konnte er nichts tun. Er lag zwar nicht in Ketten
gefesselt, doch es gab kein Entrinnen aus dem Kerker.
Er konnte nur noch hoffen.
*
Nun, Wunder sind recht rar, und auch auf eine gute Fee kann man oft
recht lange warten, selbst wenn man fest davon überzeugt ist, daß es
sie gibt.
In Ritter Rolands Fall gab es eine. Und sie war schon emsig damit
beschäftigt, für das Wunder zu sorgen.
Gunzelin betrachtete wohlgefällig die hübsche, grazile Maid.
Rotblonde Locken lugten unter dem buntkarierten Kopftuch hervor.
Gunzelins Blick streifte kurz die kleinen, neckisch spitzen Hügel, die
sich unter der dünnen Bluse abzeichneten. Nicht allzuviel, dachte er,
doch fest und knackig.
Sie lächelte, und um ihre Mundwinkel bildeten sich lustige
Grübchen.
Das Lächeln gefiel Gunzelin. Er war Junggeselle, und wenn ihn
eine Maid anlächelte, noch dazu eine solch hübsche, dann überlegte
er manchmal, ob er immer einer bleiben mußte. Nicht, daß er auf alle
Freuden des Lebens verzichtet hätte - im Gegenteil, er kaufte sich so
einige leibliche Genüsse. Doch meist blieben dann nicht genug
Dukaten übrig, um auch die Plagen des Lebens aus der Welt zu
schaffen: Zum Beispiel Kochen, Putzen, Flicken, Aufräumen und all
die anderen Unannehmlichkeiten, die einen sonst recht zufriedenen
Junggesellen auf den Gedanken bringen konnten, das Angenehme
mit dem Nützlichen zu verbinden. Ja, bisweilen spielte er mit dem
Gedanken, in den Hafen der Ehe zu segeln, wie die Seefahrer zu
sagen pflegten.
Gunzelin war also ob des Lächelns der Maid recht angetan und
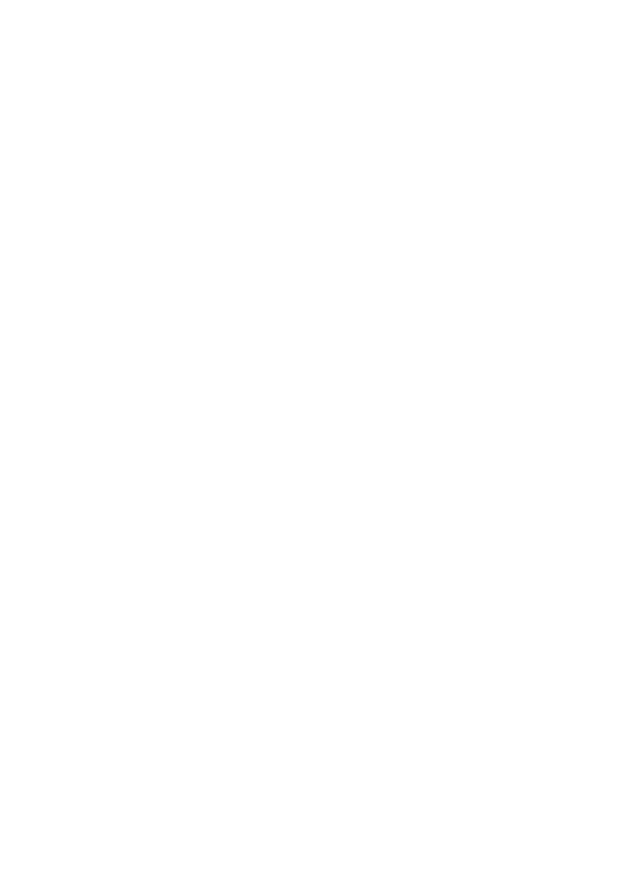
ihren Wünschen aufgeschlossen.
»Was kann ich für Euch tun, schöne Dame?« fragte er galant und
lächelte ebenfalls.
»Ich habe einen Wunsch, Kommandant.« Die langen Wimpern
flatterten scheu.
Der »Kommandant« ging Gunzelin herunter wie Bienenhonig von
süßesten Waldblumen. Er verzichtete darauf, zu erklären, daß es
noch nicht ganz soweit war und sagte statt dessen mit einem tiefen
Blick in ihre Augen:
»Aber jeder Wunsch von Euch ist mir Befehl, schöne Dame!«
»Dann laßt mich bitte zu dem Gefangenen.«
Ihre Hand spielte nervös mit dem Zipfel des blauweißkarierten
Tuchs, das den Korb aus Weidenrute abdeckte, den sie auf den
Schreibtisch gestellt hatte.
Gunzelin blinzelte ein wenig enttäuscht. Er zwirbelte seinen
Schnauzbart.
»Zu welchem Gefangenen? Wir haben derzeit drei Haderlumpen,
die ...«
»Zu dem Mann, der als Mörder und Pferdedieb aufgehängt werden
soll. Roland heißt er.«
Sie lächelte zaghaft, doch diesmal freute sich Gunzelin nicht so
sehr darüber. Das war es also! Deshalb hatte sie ihn so flammend
angeschaut. Aus purer Berechnung! Diese Weiber! Womöglich war
sie gar ein Liebchen von diesem Kerl...
Gunzelin bereute, so voreilig versichert zu haben, ihr Wunsch sei
ihm Befehl.
»Wie gerne würde ich Eure Bitte erfüllen«, sagte er mit einem
säuerlichen Lächeln. »Jedoch, mir sind die Hände gebunden.
Vorschriften, versteht Ihr? Niemand darf mit dem Gefangenen
sprechen, es sei denn ...«
»Es sei denn?« hakte sie hoffnungsvoll nach.
Abermals bereute Gunzelin seine Voreiligkeit.
»Es sei denn, Ihr wärt eine nahe Verwandte.«
»Das bin ich ... eine sehr nahe Bekannte ...« Und als sie Gunzelins

bedauerndes Kopfschütteln sah, fügte sie hastig hinzu:
»Ich bin seine Braut.«
Gunzelin unterdrückte ein Seufzen. Die miesesten Kerle haben so
oft die nettesten Weiber, dachte er mißmutig und ein wenig neidisch.
»Ihr hättet gewiß einen Besseren verdient«, sagte er. »Ich rate
Euch, schöne Dame, vergeßt diesen Mann. Es gibt genügend gute
und anständige Männer in Freiburg.« Er reckte sich in Positur.
»Wenn Ihr erlaubt, werde ich Euch helfen, diesen Unwürdigen zu
vergessen ...«
Sie errötete leicht. »Ja, ich werde sehr einsam sein nach seinem
Tode. Ich werde in meiner Kammer in der Hubergasse sitzen und mir
die Augen ausweinen. Und ich werde ewig mit dem Schicksal
hadern, weil ich ihn nicht ein letztes Mal sehen konnte...« Sie
verstummte schluchzend.
»Gemach, gemach«, sagte Gunzelin hastig, und er notierte im
Geiste »Hubergasse«. »Wenn Ihr seine Braut seid, kann ich vielleicht
eine Ausnahme machen. Schließlich führe ich hier das Kommando.«
»Oh, das würdet Ihr tun? Ihr würdet mich seine letzte Nacht mit
ihm teilen lassen?«
»Nun, keine ganze Nacht«, schwächte Gunzelin ab. Das gönnte er
dem Kerl nicht. »Aber ich werde Euch genügend Zeit lassen, von
ihm Abschied zu nehmen.«
»Oh, ich danke Euch für Euer gutes Herz! Das werde ich Euch nie
vergessen.«
Hoffen wir es, dachte Gunzelin.
»Führt Ihr mich jetzt zu ihm?« fragte sie.
»Ich kann schlecht gehen mit meinem geschienten Bein«, sagte er.
»Mein Adjutant wird Euch begleiten.«
Er erhob sich schwerfällig und rief nach einem gewissen
Mühlberger.
Die junge Frau nahm den Korb vom Schreibtisch. Es entging
Gunzelin nicht, daß sie wiederum nervös mit dem Zipfel des Tuches
spielte, das den Inhalt des Korbes abdeckte.
Da ist doch was faul! dachte Gunzelin.

Er humpelte zu ihr. Er ergriff ihre feingliedrige Hand und zog sie
von dem Tuch fort. Dabei hielt er die Hand länger, als es nötig
gewesen wäre und schaute ihr tief in die Augen.
Sie lächelte, doch sie wirkte sichtlich angespannt. Die Hand zitterte
leicht in seiner.
Er nahm ihr den Korb ab und stellte ihn auf die Schreibtischplatte.
»Was ist denn da drin?« fragte er wie beiläufig.
Sie erschrak.
»Oh, nur etwas zu essen und trinken«, sagte sie schnell. »Die -
Henkersmahlzeit, wenn Ihr so wollt.«
Er schüttelte den Kopf. »Es ist verboten, etwas zu den Arrestierten
mitzunehmen.« Während er sich sorgfältig den Inhalt des Korbes
ansah, fügte er im Tonfall eines Vaters, der einer dummen Tochter
etwas erklären möchte, hinzu: »Man könnte ihm eine Waffe
einschmuggeln oder...«
»Eine Waffe?« Es klang bestürzt.
Ein Mann betrat die Amtsstube.
In diesem Augenblick zog Gunzelin einen Dolch aus dem Korb.
Die Krümel von Sandkuchen klebten an der Klinge.
Triumphierend hielt er den Dolch hoch.
»Nun, was haben wir denn da?« fragte er mit einem breiten
Grinsen.
»Ein Dolch!« Die junge Frau schlug die Hand vor den Mund. Es
sollte wohl überrascht klingen, doch Gunzelin sah ihr das schlechte
Gewissen an.
»Ein Dolch!« sagte fast gleichzeitig Mühlberger, der Adjutant.
»Erraten.« Es war Gunzelin anzumerken, daß er die Situation und
seine Überlegenheit genoß.
»Diese Dame wollte ihn zu dem Gefangenen schmuggeln«,
erklärte er seinem Adjutanten, der verwundert vom Dolch in
Gunzelins Hand zu der jungen Frau blickte.
»Nie hätte ich ...« begann die Maid, doch sie erkannte wohl selbst,
daß das reichlich schwach klang und verstummte.
Tadelnd schüttelte Gunzelin den Kopf. »Ihr werdet mich gewiß

nicht für dumm gehalten haben, schöne Dame.«
»Aber gewiß nicht!«
»Nun, dann will ich zu Euren Gunsten annehmen, daß jemand den
Dolch ohne Euer Wissen in den Kuchen gesteckt hat. Ich will noch
einmal gnädig sein. Ihr sollt Eurem Bräutigam Lebewohl sagen
dürfen. Wie lautete noch Eure Wohnadresse, schöne Dame?«
»Hubergasse, neben der Spenglerei, Kommandant... wieso?«
»Nun, es könnte ja sein, daß ich mal zufällig hereinschaue bei
Euch - um zu kondolieren. Vielleicht erinnert Ihr Euch dann meiner
Großherzigkeit.«
Sie nickte benommen. Sie ließ die Schultern hängen, senkte den
Kopf und schien den Tränen nahe zu sein.
Gunzelin trat zwei Schritte zur Seite und winkte seinen Adjutanten
zu sich.
Im Flüsterton sagte er: »Bring sie zu dem Gefangenen, der morgen
hängen soll. Sie ist seine Braut. Beobachte die beiden durch den
verborgenen Sehschlitz und erzähle mir, was sie so getrieben haben.«
»Jawohl, beob ...«
Mit ärgerlichem Wink und Blick schnitt Gunzelin seinem
Adjutanten das Wort ab.
»Ich gewähre der Dame zwei Stunden«, sagte er und warf einen
Blick zu ihr. »Das müßte doch reichen oder?«
Sie senkte erneut den Kopf. Sie wirkte immer noch wie eine
ertappte Sünderin.
Gunzelin blickte ihr dann lächelnd nach, als sie mit Mühlberger
hinausging. Er pickte eine Rosine aus dem Kuchen und schob sie
sich in den Mund.
Du kleines Dummerchen, dachte er. Mit einem simplen Trick
wolltest du mich hereinlegen!«
Er schüttelte grinsend den Kopf. Er war sehr stolz auf sich.
*
Schritte näherten sich auf den Gang. Ein Schlüssel rasselte.

Roland öffnete blinzelnd die Augen und blickte zur dicken
Eisentür des Kerkers, die er in der Dunkelheit nur an den Geräuschen
erahnen konnte.
Der Schlüssel drehte sich im Schloß.
Kamen sie, um ihn abzuholen? Um ihn zum Galgen zu schleppen?
Er hatte jedes Zeitgefühl in der Dunkelheit und Stille verloren.
Mit leisem Quietschen schwang die Tür auf. Einer von Gunzelins
Männern tauchte in der Tür auf. In einer Hand hielt er ein Schwert, in
der anderen eine Lampe. Roland war aufgesprungen. Doch er wußte,
daß er keine Chance hatte. Und selbst wenn es ihm gelang, den Mann
zu überwältigen, gab es keine Entkommen für ihn. Es gab weitere
Wachen.
Mühlberger grinste ihn an.
»Da will sich jemand verabschieden«, sagte er und gab jemand auf
dem Gang einen Wink. Dann sah Roland die Maid, die den Kerker
betrat.
»Helga!« entfuhr es ihm überrascht.
Und dann war er noch überraschter. Denn Helga lief auf ihn zu und
umarmte ihn stürmisch.
»Geliebter!« rief sie dabei.
Sie küßte und herzte ihn.
Bevor Ritter Roland einen klaren Gedanken fassen konnte, sagte
Mühlberger mit anzüglichem Grinsen: »Dann viel Spaß.«
Er stellte die Lampe ab und zog die Tür zu. Der Schlüssel drehte
sich im Schloß. Schritte entfernten sich, verstummten aber
erstaunlich schnell.
Sofort löste sich Helga von Roland.
»Wir werden beobachtet, wisperte sie. »Ich erkläre Euch gleich
alles. Küßt mich!«
Nun, das tat Ritter Roland. Er war aber so verwirrt, daß er gar
keinen rechten Genuß dabei fand, obwohl Helga sich voller
Leidenschaft gebärdete.
Schließlich bog Helga den Kopf zurück, hielt immer noch die
Arme um seinen Nacken und blickte zu ihm auf.

»Es hat leider nicht geklappt, Liebling«, sagte sie laut, zwinkerte
ihm dabei beschwörend zu und schickte ein trockenes Schluchzen
hinterher. »Er - hat den Dolch gefunden, den ich dir bringen wollte.
Jetzt kann ich dir nichts als meine Liebe geben.«
Sie löste sich von ihm. Sie streifte das Kopftuch ab und schüttelte
ihr Haar aus.
Dann zog sie die Bluse aus!
Roland blickte verdutzt.
Und sie knöpfte den Rock auf! Sie zog ihn langsam an den Hüften
hinunter!
»Sagt kein Wort«, wisperte sie kaum hörbar.
Es hatte ihm ohnehin die Sprache verschlagen. Er starrte sie
gebannt an, nahm ihre Schönheit in sich auf - und dann sah er noch
etwas anders: Der Knauf eines Messers ragte aus ihrem seidenen
Unterhöschen!
»Nimm mich in die Arme«, sagte sie laut und schmiegte sich an
ihn.
Das tat Roland nur zu gerne.
Er hatte zwar keine Vorliebe für Damen mit Messern im Schlüpfer,
doch in diesem Fall hatte er das Gefühl, Helga sei ihm samt Messer
vom Himmel geschickt worden.
Mit einer Waffe konnte er sich eine Chance erhoffen. Zum
Beispiel, wenn sie ihm die Henkersmahlzeit brachten ...
Er nahm Helga in die Arme. Ihr Körper war weich und warm und
anschmiegsam, doch das Messer drückte gegen seinen Schoß.
Mit einem schnellen Blick vergewisserte sich Ritter Roland, daß
Helga mit dem Rücken zur Tür stand und somit die Sicht auf ihn
verdeckte. Wir werden beobachtet, hatte sie gesagt. Es galt also,
vorsichtig zu sein. Aber allzuviel war im schwachen Schein der
Lampe ohnehin nicht zu erkennen, erst recht nicht, wenn man sie in
inniger Umarmung sah.
Mit geschickten Fingern zog er das Messer aus ihrem Höschen,
langsam und tastend, damit er ihr nicht mit der scharfen Klinge die
seidene Haut verletzte, und schob es unauffällig in seinen

Stiefelschaft.
»Danke«, flüsterte er. »Ihr kommt mir vor wie eine gute Fee.«
»Ich hörte, was Euch widerfahren ist - gewissermaßen durch meine
Schuld. Mein Bruder, den ich mit Eurem Roß zum nächsten Ort
schickte, berichtete mir alles.« Sie blickte ihn verlegen an, doch
offenbar genierte sie sich nicht wegen ihres entblößten Busens, denn
sie traf keinerlei Anstalten, die Bluse zuzuknöpfen.
»Ich dachte mir, wenn Euch etwas an dem Roß liegt, spaziert Ihr
zum nächsten Ort. Aber ich getraute mich nicht selbst dorthin. So
schickte ich meinen Bruder. Es tut mir alles so leid. Nicht
auszudenken, wenn Ihr durch meine Schuld am Galgen geendet
hättet! Deshalb ritt ich mit meinem Bruder sofort nach hier um das
Schreckliche zu verhindern.«
»Ihr glaubt mir also, daß ich kein Mörder bin«, stellte Roland fest,
und ein warmes Gefühl durchflutete ihn. Es tat gut, Vertrauen zu
spüren, nachdem er Feindseligkeit und Mißtrauen, ja gar Haß
ausgesetzt gewesen war. »Ich danke Euch für Euer Vertrauen.«
»Ich Weiß, daß Ihr unschuldig seid«, bekräftigte sie.
»Aber woher?« Roland war verblüfft. Diese Helga wartete doch
immer wieder mit Überraschungen auf. »Niemand war dabei, als ich
das reiterlose Pferd fand. Ich habe es nicht getan, aber rein
theoretisch hätte ich den Besitzer töten können, um mir sein Pferd
anzueignen.«
»Laßt uns nicht untätig herumstehen«, flüsterte sie. »Ich sagte
schon, wir werden beobachtet. Deshalb mußte ich auch mein frivoles
Spiel treiben.« Jetzt war sie wirklich verlegen, das spürte er. Sie
blickte wieder auf. »Aber es geht um Euer Leben.«
Er nahm sie in die Arme, und wie von selbst sanken sie zu Boden.
Roland hielt sie in den Armen.
»Ihr seid der ruhmreiche Ritter Roland«, flüsterte Helga. »Nie
hätte ich gedacht, Euch jemals kennenzulernen. Aber es ist so. Und
Ihr haltet mich in Euren starken Armen ...«
Nun, so stark fühlte sich Ritter Roland im Kerker nicht, obwohl er
im Augenblick das Gefühl hatte, die Mauern des Verlieses mit

bloßen Händen einreißen zu können.
»Ihr seid hier, um das Verschwinden der Menschen und Frachten
aufzuklären«, fuhr Helga fort.
»Hat sich das herumgesprochen?« fragte Roland verdutzt.
»Nein. Doch die beiden Männer, die in Peterzell waren und sich als
die Burschen eines Händlers ausgaben, sind Eure Knappen. Mein
Bruder hat mal mit Ihnen gezecht, damals, als er sich im Bayerischen
Wald als Holzfäller verdingt hatte, während Ihr dem Schrecken vom
Höllensteinsee das Handwerk legtet. Eure Knappen kamen zu uns
auf den Hof und sprachen mit meinem Bruder. Er versprach ihnen,
nichts zu verraten. Und dann sah er in Peterzell, wie man Euch mit
einem Wagen wegbrachte. Er erkannte Euch wieder. Doch er konnte
nichts für Euch tun. Zudem verlor er viel Zeit, weil er nach Euren
Knappen suchte.«
»Hat er sie informiert?« fragte Roland angespannt.
Sie schüttelte den Kopf. Ihr Haar streifte seine Wange.
»Sie waren nirgends zu finden. Aber ich habe einen von ihnen
gesehen. Ich erkannte ihn wieder, denn ich sah die beiden zuvor, als
sie auf unserem Hof mit Albert sprachen - Albert ist mein Bruder.
Erst später, als er mir alles berichtete, sagte er: >Die Knappen waren
die beiden, die auf unserem Hof waren<. Da wurde mir klar, daß ich
einen von ihnen im Wald gesehen hatte, als ich vor Euch flüchtete.«
»Im Wald? Was taten die Knappen denn da? Sie sollten doch in
Peterzell auf mich warten.«
»Es war nur einer, der Große mit dem schwarzen Vollbart.«
»Louis.«
»Ich weiß nicht, wie sie heißen« erwiderte Helga. »Aber es war
zweifellos einer der Männer, die mit Albert gesprochen hatten und
die er hinterher als Eure Knappen bezeichnete ... Und was er tat?
Nun, er war völlig nackt...«
»Dann wird er keine Pilze gesammelt haben«, bemerkte Roland,
und er verspürte einen leichten Groll auf Louis, der sich offenbar im
Walde vergnügt hatte, anstatt auf ihn zu warten wie verabredet.
»Vermutlich nicht«, sagte Helga mit einem leisen Lachen. »Er

wollte mich aufhalten. Sicherlich hat er Euer Pferd erkannt. Doch zu
diesem Zeitpunkt wußte ich ja nicht, daß er Euer Knappe ist, nicht
einmal, daß es einen Zusammenhang zwischen Euch und ihm gibt.
Mir fuhr der Schreck in alle Glieder, als ich so ein großes, nacktes
Mannsbild auftauchen sah.«
»Ja, Louis ist ziemlich kräftig gebaut«, sagte Roland und lächelte
das grazile Mädchen an.
»Ihr sagtet, Ihr seid vor mir geflüchtet, warum eigentlich?«
»Ich - hielt Euch für einen Räuber. Für genauso einen Kerl wie
den, der mir das Pferd stahl. Er wollte mir Gewalt antun, doch ich
überredete ihn zu einem Bade, bevor es zum Schlimmsten kommen
Sonnte, und ich konnte ihm mit knapper Not entkommen. Dann
tauchtet Ihr auf. Ihr habt zwar erst galant geredet, doch das Getue
kennt man ja. Oh, ich habe gemerkt, wie ihr mich begehrlich ange-
starrt habt. Und als Ihr mich dann einfach auf die Arme genommen
und geküßt habt, da dachte ich, ihr seid genauso wie der andere. Ich
hielt Euch für einen, der nur auf andere Weise zum Ziel kommen
will, der sich nur verstellte, um mich zu täuschen und dann über
mich herfallen wollte, wenn ich nicht Willens sein sollte ...« Sie
lächelte entschuldigend. »Ich konnte doch nicht wissen, daß Ihr
wirklich ein Ritter seid und mich ohne Hintergedanken mitnehmen
wolltet. So wandte ich zum zweiten Mal meine List an und machte
Euch Hoffnung, um mich retten zu können.«
»Ja, ein wenig Hoffnung hatte ich«, bekannte Roland.
Immer noch hielt er sie in den Armen, und er hatte in den letzten
Minuten der geflüsterten Unterhaltung ganz vergessen, daß er sich in
einem Kerker befand und daß nach wie vor der Galgen auf ihn
wartete.
»Wie habt Ihr erreicht, daß man Euch zu mir ließ?« fragte er.
»Das war ganz leicht.« Helga lachte leise. »Dieser Möchtegern-
Kommandant ist ein eitler Affe, der mir versteckte Angebote machte.
Ein schmieriger Kerl. Er will mich nach Eurem Tod trösten, deutete
er an. Wie ein verliebter Gockel benahm er sich - aber wesentlich
verschlagener. Aber er fiel prompt darauf herein, als ich ihm den

Dolch in dem Kuchen präsentierte. Er war so stolz auf seinen
vermeintlichen Scharfsinn, daß er ganz vergaß, mich nach einem
zweiten Messer abzutasten.«
»Gute Idee«, sagte Roland. »Ich muß schon sagen, Ihr habt
originelle Einfälle, Helga.«
Sie lächelte, und um ihre Mundwinkel bildeten sich neckische
Grübchen. »Es war eine Idee von Albert. Auch, daß ich mich als
Eure Braut ausgeben sollte, damit man mich zu Euch ließ.«
Täuschte er sich, oder schoß ihr jetzt das Blut in die Wangen?
Genau war es im schwachen Schein der Lampe nicht zu erkennen,
zumal sie mit dem Rücken zum Licht an ihn geschmiegt war.
»Ein raffinierter Einfall«, sagte Roland.
»Ich - mußte Euch küssen und alles ...« Sie bedachte ihn mit einem
schnellen, verlegenen Blick. »Man darf keinen Verdacht schöpfen.
Wir müssen so tun, als ob wir uns liebten.«
»Das ist die beste aller Ideen«, sagte Roland, zog sie fester an sich
und küßte sie auf die lockenden Lippen.
»Fast zwei Stunden lang«, hauchte sie, und es klang wie ein
Seufzen.
Roland, war recht erregt, doch nie hätte er diese Situation schamlos
ausgenutzt. Helga war als gute Fee gekommen, um ihm zu helfen.
Und wenn auch die Umstände dieses pikante Spiel erforderlich
machten, so mußte er sich zur Ordnung mahnen. Helga tat alles nur,
um sein Leben zu retten ...
»Ich danke Euch«, sagte er mit belegter Stimme. »Verzeiht mir,
daß ich Euch in den Armen halte ...«
»Es muß echt wirken«, seufzte sie und schmiegte sich an ihn.
»Und daß ich euch küßte ...«
»Man könnte sonst argwöhnisch werden.«
Jetzt küßte sie ihn auf die Lippen und schloß dabei die Augen.
Sein Herz pochte noch heftiger, und er spürte, wie ihr Kuß
Verlangen in ihm weckte.
Doch es konnte nicht sein. Es durfte nicht sein!
Sanft schob er sie von sich, so schwer es ihm auch fiel. Auch sie

war erregt. Er erkannte es an ihren Augen, an ihrem heftigen Atem.
Es war, als sei ein Funke zwischen ihnen übergesprungen und hätte
erst ein zartes Flämmchen und dann ein Feuer entfacht. Es war süß
und prickelnd - doch zugleich empfand er es als grausam. Denn es
war nur ein Spiel, zu dem sie gezwungen waren. Ein Spiel, das Helga
nur trieb, um ihn vor dem Galgen zu retten. Seine Ritterehre gebot
ihm Zurückhaltung.
Er dachte an das Messer im Stiefelschaft. Die Wachen waren
äußerst aufmerksam gewesen. Doch mit dem Messer gab es
vielleicht eine Möglichkeit, wenn man Helga hinausließ ...
Helga berührte mit sanfter Hand seine Wange und riß ihn aus
seinen Gedanken. Es war, als flatterte ein Schmetterling über seine
Haut. Ihr Blick tauchte tief in seinen.
»Und ich hielt dich für einen Räuber«, wisperte sie.
»Und ich wünschte dich zum Teufel«, murmelte er leise, und es
fiel keinem von beiden auf, daß sie zum vertrauten Du übergegangen
waren.
»Aber - ich hatte gar nicht mal so unrecht...« fuhr Helga versonnen
fort. »Du scheinst mir wirklich ein Räuber zu sein. Ein Ritter, der mir
das Herz raubt...«
»Ich wollte nicht... ich würde niemals ...« begann Roland verwirrt
und fühlte sich gemüßigt, ihr zu beteuern, daß er die Situation nicht
auszunutzen gedachte.
Zärtlich strich sie ihm mit einem Finger über die Lippen. »Sag
nichts, Roland. Sag nichts und versprich nichts, was wir beide nicht
mehr halten können. Es ist zu spät dazu. Mach lieber die Lampe aus.
Oder willst du, daß man uns von jetzt an noch zuschaut?«
*
»Schläfst du?« flüsterte Pierre in der dunklen Höhle.
»Wie könnte ich das«, brummte Louis leise. »Erstens tut mir
verdammt der Hintern weh, und auf dem Bauch kann ich schlecht
schlafen, es sei denn, ich habe eine weiche, warme Unterlage.« Er

lachte leise. »Und zweitens muß ich dauernd an Roland denken«,
fügte er mit schwerer Stimme hinzu.
»Ich auch«, seufzte Pierre.
»Nie hätte ich gedacht, daß ich mal so an ihm hängen würde«, fuhr
Louis leise fort.
»Ich auch nicht.«
Eine Weile herrschte Schweigen. Einige der anderen Gefangenen
schnarchten. Einer schien im Traum die Arbeit des Tages
fortzusetzen und dicke Buchenstämme durchzusägen.
Die Knappen hingen ihren Gedanken nach. Sie wußten, daß auf
Ritter Roland der Galgen wartete, und sie wußten, daß sie nichts zu
seiner Rettung unternehmen konnten. Sie waren selbst Gefangene
und vermutlich ebenso zum Tode verurteilt wie Roland.
Es gab kein Entkommen aus der Schlucht. Im Gegensatz zu den
Räubern waren sie waffenlos. Des Tags wurden sie streng bewacht,
und selbst wenn einer flüchten würde, liefe er nur den Wachen an
den Zugängen der Schlucht in die Arme. Nach der Schufterei am
Staudamm bekamen sie Essen und mußten über die Strickleiter in die
Höhle hinaufsteigen, die hoch in der Felswand als ihr Gefängnis
diente. Zwei Räuber hielten unten am Fuß der steilen Wand Wache.
Ein Abstieg war unmöglich, und jedes Geräusch würde zudem von
den Wachen gehört werden. Einer hatte versucht, dennoch den
Abstieg zu wagen. Er war abgestürzt und hatte sich das Genick
gebrochen.
Wittich, der Mann vom Hotzenwald hatte sich abgesichert.
Und es war kaum damit zu rechnen, daß Hilfe von außen kam. Das
Versteck der Bande lag fernab von allen Pfaden, und jeder
Eindringling würde früh genug bemerkt werden. Die anderen
Gefangenen hatten den Knappen erzählt, wie sorgfältig die Räuber
ihre Spuren zum Versteck verwischt hatten. Sie hatten sogar die
gekaperten Wagen weit genug entfernt verbrannt und die
nichtbrennenden Teile in einer tiefen Felsspalte versteckt, bevor sie
die Gefangenen und die Beute ins Versteck gebracht hatten. Die
Zugänge zu der großen Schlucht, die nach Norden zu steil anstieg

und von einem tosenden Wasserfall begrenzt wurde, waren für
Wagen unpassierbar. Es waren schmale, gewundene Felsspalten, gut
getarnt von Gestrüpp, die gerade ein Pferd aufnehmen konnten.
Aber der Bau des Staudammes muß doch bemerkt werden«, hatte
Louis verständnislos eingewandt. »Das Hämmern, das Bäumefällen,
das Sägen und die anderen Geräusche aus der Schlucht. Wir sind hier
doch nicht auf dem Mond!«
»Man könnte es aber meinen«, hatte einer der Gefangenen erklärt.
»Keiner hat uns bisher hier entdeckt. Und wenn einer die Axtschläge
des Tags von irgendeinem der weit entfernten Wege vernimmt oder
ein Pilz- oder Beerensammler sie hört, wird er denken, Holzfäller
seien an der Arbeit und sich nicht weiter darum kümmern. Zumal die
Zugänge zur Schlucht so versteckt sind, daß nur ein Eingeweihter sie
finden kann. Außerdem verschluckt das Rauschen des Wasserfalls
die meisten Geräusche, und zudem behaupten die Einheimischen,
hier hausten böse Geister, und kaum jemand wagt sich deswegen
her.«
Und der Mann hatte sich mit furchtsamem Blick bekreuzigt,
obwohl er doch wußte, daß die bösen Geister aus Fleisch und Blut
waren. Außer Wittich und seinen Spießgesellen hatte sich bisher
jedenfalls niemand blicken lassen.
Pierre bewegte sich auf dem harten Boden und stöhnte leise auf.
Auch sein Hinterteil schmerzte noch, und er lag wie Louis auf dem
Bauch. Zudem hatte er von der harten Arbeit Schwielen und Risse an
den Händen, die mit Harz verklebt waren.
»Woran denkst du, Louis?« fragte Pierre nach einer Weile.
»An den Schatz«, murmelte Louis.
»Almuth?«
»Quatscht«, brummte Louis, obwohl Pierre ihn ertappt hatte, als
könnte er Gedanken lesen. »An den Schatz aus Gold und
Edelsteinen, den dieser Schweinehund Wittich heben will«, sagte er
schnell.
Auch Pierres Gedanken beschäftigten sich jetzt mit diesem Schatz
aus dem Morgenland. Herzog von Wittgenstein sollte ihn mit seinen

Mannen auf einem Kreuzzug im Morgenland erbeutet haben. Dreißig
Packpferde hatte man benötigt, um diesen unermeßlichen Reichtum
zu befördern. Auf dem Heimweg war der Herzog mit seinen Mannen
in ein Unwetter geraten. Der Wildbach war zu einem reißenden
Strom angeschwollen und hatte die schwergerüsteten Männer erfaßt.
Ein Erdrutsch hatte den Reitern den Rückweg abgeschnitten. Bei
Donner und Blitz waren der Herzog und seine Reiter mit Mann und
Maus - sprich Schatz - von den Fluten verschlungen worden.
Auch oberhalb der Schlucht hatte die Erde gebebt. Niederstürzende
Felsen und entwurzelte Bäume hatten eine Barrikade errichtet, und
davor war ein See entstanden. Der See wurde von Wasserfall und
Wildbach gespeist und hatte nur einen schmalen Abfluß, ein ruhiges
Bächlein, das sich fast durch die gesamte Schlucht schlängelte, dann
unterirdisch weiterfloß und irgendwo südlich des Berges wieder zu
Tage trat. Diesen tiefen Bergsee wollte Wittich trockenlegen lassen,
indem er mit einem Damm die Zufuhr, den Wildbach, staute und die
vom Wasserfall schnell anschwellenden Wassermassen um die
Schlucht herumleitete oder in einem weiteren höher gelegenen See
sammelte. Dann brauchte er nur noch den Abfluß des tiefer
gelegenen Sees zu vergrößern, damit das Wasser schneller abfloß,
und da der See nicht mehr gespeist wurde, würde er bald zumindest
so flach werden, daß gute Schwimmer tauchen und den Grund
absuchen konnten.
»Glaubst du, daß der Schatz tatsächlich in dem See liegt?« fragte
Pierre aus seinen Gedanken heraus.
»Sigismund, der Poet, der mit uns schuften muß, hat die
Aufzeichnungen des Herzogs mit eigenen Augen gesehen. Daraus
geht genau hervor, mit welcher Kriegsbeute und auf welchem Weg
der Herzog und seine Mannen unterwegs waren. Bis zum letzten Tag
ist alles beschrieben, bis zur letzten Etappe, die hier zu Ende ging.
Der Herzog schrieb sogar von einem heraufziehenden Unwetter in
seinem Tagebuch.«
»Was glaubst du, wird Wittich mit uns machen, wenn er den
Schatz hat?« fragte Pierre sorgenvoll. »Meinst du, er läßt uns

wirklich frei, wie er behauptet?«
»Ich traue diesem Dreckskerl alles zu«, murmelte Louis. »Aber
noch ist es nicht soweit. Es kann gut und gerne noch eine Woche
dauern, bis der Damm fertig ist. Und bis dahin läuft noch viel Wasser
in den See.«
Wieder herrschte eine Weile Schweigen in der finsteren Höhle.
Einer der Schnarcher schien die Säge gewechselt und einen anderen
Baumstamm in Angriff genommen zu haben. Es klang jetzt, als
rasselte er eine mitteldicke knorrige Eiche durch.
»Vielleicht ist Roland jetzt schon tot«, murmelte Pierre schließlich
dumpf. »Wenn wir doch wenigstens etwas tun könnten!«
»Vielleicht können wir etwas tun«, sagte eine leise Stimme aus
dem Dunkel.
Louis und Pierre erschraken. Einer der Gefangenen mußte sie
belauscht haben.
»Wer bist du?« fragte Louis raunend.
»Ich bin Sebastian Müller. Nur ein alter Kutscher, den diese
Hundesöhne entführt haben. Ich habe mein Leben lang nur Wagen
und Kutschen gefahren, doch ich bin dabei nicht verblödet.«
»Hat ja auch keiner behauptet«, murmelte Louis.
Ein leises Lachen ertönte. »Ich will damit nur sagen, daß ich noch
zwei und zwei zusammenzählen und ein bißchen denken kann.«
»Freut mich für dich«, erwiderte Louis schlechtgelaunt.
»Sprich nicht so laut. Du könntest die Schläfer wecken. Ich komme
zu euch.«
Ein Scharren war zu hören. Dann fluchte Pierre unterdrückt.
»Paß auf, wo du hinfaßt!«
Eine tastende Hand hatte ihn am schmerzenden Hintern berührt.
»Entschuldige.«
Dann lag der Mann zwischen Louis und Pierre.
»Hört zu, was ich mir so gedacht habe«, flüsterte Sebastian Müller.
»Ich gehe schon geraume Zeit mit der Idee schwanger, doch ich
wagte nicht, mich jemand anzuvertrauen. Man weiß nicht, ob es
Verräter unter uns gibt oder Spitzel der Bande. Aber bei euch beiden

bin ich unbesorgt. Schließlich habe ich belauscht, daß ihr hier raus
wollt, richtig?«
»Richtig«, gab Louis zurück.
»Wir drei könnten es schaffen«, sagte Sebastian Müller.
»Und wie?« fragte Pierre zweifelnd. »Wir haben doch schon alles
überlegt.«
»Um diesen See trockenzulegen, bauen wir einen Staudamm,
richtig?«
»Richtig.«
»Und dieser Staudamm schafft einen neuen, höhergelegenen See,
der vom Wasserfall und Bach gespeist wird und schnell ansteigt, weil
nicht so viel Wasser in den See abläuft wie zufließt, richtig?«
»Komm zur Sache«, drängte Louis.
»Was glaubt ihr, was passiert, wenn dieser Damm bricht und sich
all die gewaltigen Wassermassen in den See ergießen?«
»Dann wird der See anschwellen, über den Abfluß hinaus ...«
»Richtig. Und wenn diese Bresche in der Barriere noch vergrößert
wird?«
»Dann wird es eine kleine Überschwemmung in der Schlucht
geben«, antwortete Pierre.
»Kleine Überschwemmung?« Sebastian Müller kicherte leise. »Die
Fluten werden die ganze Schlucht überschwemmen und die Ratten
ersäufen, die sich darin aufhalten, richtig?«
»Und uns mit, richtig?« Louis äffte den Tonfall des Mannes nach,
dessen Gedanken ihn interessierten, dessen dauerndes »richtig« ihm
jedoch auf die Nerven ging.
»Hier in der Höhle sind wir sicher, wenn die Fluten wie eine
Lawine in die Schlucht hinabdonnern«, erklärte Sebastian Müller.
»Nur ein alter Kutscher«, murmelte Louis nach verblüfftem
Schweigen. »Mich dünkt, du bist ein richtiger Fuchs, Sebastian.«
Und grinsend fügte er hinzu: »Richtig?«
Sebastian kicherte leise.
»Richtig. Natürlich gibt es noch viele Wenn und Aber und manche
Unwägbarkeit bei der Sache. Doch hört mal zu, wie ich mir die

Höllenfahrt dieser verdammten Bande vorstelle ...«
*
Der Schüssel drehte sich im Schloß. Mit leichtem Quietschen
schwang die schwere Tür auf. Das grinsende Gesicht von
Mühlberber tauchte im Lichtstreifen auf, der hinter ihm vom Gang
her in das Verlies fiel. Mühlberger hielt eine brennende Fackel in der
Linken und sein Schwert in der Rechten.
»Die Zeit ist um«, erklärte er und tat überrascht. »Oh, Verzeihung,
schöne Maid. Wußte nicht, daß Ihr nackt...«
Weiter kam er nicht mehr. Sekundenlang hatte er Helga angestarrt,
die in der Tat in ihrem Naturkleid war, und als ihm dann auffiel, daß
der Gefangene nicht zu sehen war, war es zu spät.
Roland sprang hinter der Tür hervor und hielt ihm das Messer an
die Kehle.
»Keinen Laut!« zischte er, während er dem überraschten Mann das
Schwert abnahm.
Mühlberger erholte sich erstaunlich schnell von seinem Schreck.
Vielleicht bemerkte er in der Aufregung das Messer nicht, vielleicht
handelte er auch aus Panik, denn er wollte schreien.
»Hil...«
Roland schlug mit dem Schwert zu. Der Schrei verstummte im
Ansatz, und Mühlberger brach zusammen. Roland fing die schlaffe
Gestalt auf und ließ sie zu Boden gleiten. Er schob die brennende
Fackel, die dem Mann aus der Hand geglitten war, mit der
Stiefelspitze zur Seite, damit nicht die Kleidung des Bewußtlosen in
Brand geriet.
Helga kleidete sich bereits an.
»Du hast ihn gut abgelenkt«, lobte Roland. »Schade, daß der
Bursche nicht vernünftig war. Jetzt müssen wir warten, bis er zu sich
kommt.«
Helga lächelte Roland an. Ein glückliches Leuchten war in ihren
Augen.

Roland wollte Gunzelins Adjutant als Geisel mitnehmen. Es gab ja
die anderen Wachen, und nur mit Mühlbergers Hilfe konnte es ihnen
gelingen, sie zu täuschen.
Helgas Bruder Albert wartete draußen mit einem Wagen. Dieser
Albert mußte ein findiger Bursche sein. Er hatte alles sorgsam
bedacht. Er war sogar so klug gewesen, die beiden »untadeligen
Herrn« zu beobachten, die einen falschen Schwur geleistet hatten.
Zwei Dukaten hatte es ihn gekostet, um von einem Gardisten alle
Einzelheiten zu erfahren; die würde er doppelt und dreifach
zurückbekommen. Roland hoffte, daß Albert ihm sagen konnte, wo
die beiden Lumpenkerle zu finden waren. Von ihnen konnte er
vielleicht etwas erfahren, was ihm weiterhelfen würde ...
Doch zunächst galt es, erst einmal in Freiheit zu gelangen. Und
dazu mußte Mühlberger mitspielen. Roland tätschelte die Wangen
des Mannes. Wenn es zu lange dauerte, konnten die Wachen
Verdacht schöpfen.
Mühlberger kam zum Glück rasch zu sich. Und erspielte mit. Er
hatte Weib und Kind, und als Roland ihm mit grimmiger Miene
erklärte, daß er zu allem entschlossen sei, schlotterte Mühlberger vor
Angst und tat, was Roland verlangte.
Den beiden Wachtposten hinter der Tür am Ende des Ganges fiel
nicht auf, daß Mühlbergers Stimme seltsam gepreßt klang, als er
behauptete, alles sei in Ordnung, er bringe die Dame zurück zu
Gunzelin, sie sollten öffnen.
Roland überrumpelte die beiden Posten. Keiner sonst begegnete
ihnen auf dem Weg zur Amtsstube.
Gunzelin saß hinter dem Schreibtisch und tauchte gerade die Feder
ins Tintenfaß, als die Tür aufging.
Er wandte den Kopf und sah seinen Adjutanten in der Tür
auftauchen, hinter der der Gang zum Gefängnis führte. Die »Braut«
folgte.
Im schwachen Licht der Lampe, die auf dem Schreibtisch brannte
und deren Schein nicht ganz bis zur Tür reichte, sah Gunzelin nicht,
daß sein Adjutant bleich und verstört war und sich wie eine

Marionette bewegte.
Gunzelin schrieb den Satz zu Ende und blickte lächelnd auf.
»Nun, schöne Dame ...«
Er verstummte jäh.
Roland fegte Mühlberger zur Seite, daß er gegen die Wand
taumelte und daran herabsank. Mit vorgerecktem Schwert stürmte
Roland auf Gunzelin zu.
Gunzelin riß sein Schwert aus dem Gehenk. Er war erstaunlich
schnell und geistesgegenwärtig, das mußte man ihm lassen. Doch er
überschätzte sich, als er mit Roland die Klinge kreuzen wollte.
Roland mochte nicht mit einem Mann kämpfen, der mit dem
geschienten Bein behindert war. Außerdem durfte er keine Zeit
verlieren. Er schlug Gunzelin mit einem wuchtigen Hieb das Schwert
aus der Hand und förderte es mit einem schnellen Tritt weit fort.
Gunzelin war unbeholfen mit seinem geschienten Bein. Bei Rolands
Hieb verlor er das Gleichgewicht und fiel zu Boden.
Der Weg war frei. Sie brauchten nur noch durch die Tür oder falls
sie verschlossen war, durchs Fenster der Amtsstube hinaus in die
Gasse, in der der Wagen warten mußte, wenn alles, wie von Albert
geplant, abgelaufen war.
»Nichts wie weg«, rief Roland Helga zu. Doch Helga verharrte
noch bei Gunzelin, der am Boden lag und sich abmühte, mit dem
geschienten Bein aufzustehen.
»Schmutzfink«, sagte sie verächtlich. Dann riß sie das Tintenfaß
vom Tisch und kippte Gunzelin den Inhalt ins Gesicht.
Von einem Augenblick zum anderen verfärbte sich Gunzelin blau,
und weil er gerade den Mund zu einem Alarmschrei aufgerissen
hatte, schluckte er ein wenig Tinte. Statt des Schreies kam nur ein
würgender Laut hervor, der wie »Haaaaahr« oder so klang. Als
Gunzelin den Mund zum zweiten Mal aufriß, wohl mehr um nach
Luft zu schnappen, warf Helga das Tintenfäßchen hinterher. Und sie
hatte gut gezielt. Das kleine Faß flog Gunzelin in den Mund.
»Du Schmierlappen, der im Amt einer Dame zweideutige
Angebote macht, wirst niemals Kommandant«, rief Helga. Dann

folgte sie Roland, der die Tür unverschlossen fand und sie aufriß.
Helga sollte mit ihren Worten Recht behalten. Gunzelin, der in
diesem Augenblick noch an dem Tintenfaß schluckte, sollte später an
dem Verweis schlucken, den ihm Briegel, der neue Kommandant der
Stadtgarde, ob seines jämmerlichen Versagens gab. Schnell sprach
sich bei den Oberen herum, daß Gunzelin ein schlechter
Stellvertreter des Stellvertreters gewesen war, und sein
Karrieretraum war ausgeträumt. Und wiederum später machte man
ihm gar den Vorwurf, völlig unfähig zu sein, weil er einen
unschuldigen Ritter an den Galgen hatte bringen wollen. Daß dabei
auch andere Beamtete mitgewirkt hatten, übersah man geflissentlich.
Ein Sündenbock kam gerade richtig ...
Indessen hetzte Roland mit Helga durch die dunkle Gasse. Der
Wagen war da.
»Albert?« rief Roland gedämpft, als er ihn erreicht hatte.
»Ja«, erwiderte der Schatten auf dem Kutschbock mit Baßstimme.
»Unter die Plane mit euch beiden. Schnell!«
Eile war in der Tat geboten. Denn aus der Amtstube stürmte
Mühlberger auf die Gasse hinaus und schrie auf Geheiß seines Noch-
Vorgesetzten Alarm.
Roland kletterte auf die Ladefläche des flachen Wagens. Er half
Helga hinauf. Sie hatten noch nicht die Plane über sich gezogen, als
der Wagen schon losfuhr. Wild trieb Albert die beiden
Gespannpferde an.
Der Wagen rumpelte aus der Gasse hinaus und bog in eine breitere
Straße ein.
»Der Wagen! Sie flüchten mit dem Wagen!«
Mühlberger schrie aus Leibeskräften, unterstützt von dem tintigen
Gunzelin, der sich des Tintenfäßchens entledigt hatte, zur Tür
gehumpelt war und blauen Kopfes seinen Zorn hinausschrie.
»Mörder! Mörder!« brüllte er und wandte gleich die Mehrzahl an.
»Faßt sie!«
Und bald darauf war der Teufel los.
»Der Wagen, da ist der Wagen!« schrie ein Bürger aufgeregt.

»Mörder, Mörder!«
So machte es alsbald die Runde, und schnell war die Jagd in
vollem Gang.
Albert raste in halsbrecherischer Fahrt durch die Stadt und tat sein
Bestes, um die Verfolger abzuschütteln. Doch Reiter hatten die
Verfolgung aufgenommen. Es schien auf einmal in der Stadt von
Gardisten nur so zu wimmeln. Es war nur noch eine Frage der Zeit,
wann man den Wagen stellte.
Albert donnerte durch eine Seitengasse. An deren Ende tauchten
Schatten auf.
»Halt! Halt!« brüllte einer der Männer und stieß seine Lanze vor.
»Wir haben sie!« schrie ein anderer triumphierend. »Hierher,
Männer!«
Dann schrien alle vier oder fünf Männer am Ende der Gasse
gleichzeitig auf, denn Albert dachte nicht daran, anzuhalten. Er
donnerte mitten durch die kleine Schar, die geradezu akrobatisches
Talent bewies, als sich die Männer im Hechtsprung aus der Bahn
warfen.
Albert lachte dröhnend auf dem Kutschbock. Doch Roland, der die
Plane von sich gezogen hatte und umherspähte, wußte, daß es keinen
Grund zur Freude gab. Er sah, wie sich die Schatten links und rechts
der Gasseneinmündung aufrappelten, als der Wagen vorbeigerast
war, und er hörte Schreie und Hufschlag. Die Verfolger schienen
überall zu sein.
Blieb nur eines: Aussteigen!
Auch Albert hatte wohl die Gefahr erkannt.
»Ihr müßt weg, Ritter!« rief er über die Schulter. »Ich versuche,
die Kerle noch eine Weile zu beschäftigen. Hier in der dunklen
Gasse solltet Ihr abspringen. Wir treffen uns beim Gasthaus zum
Goldenen Pflug am Südrand der Stadt.«
»Und was wird aus euch beiden?«
»Das laßt mal meine Sorge sein. Los jetzt! Sie dürfen nicht sehen,
wo Ihr den Wagen verlaßt.«
Helga tastete im Dunkeln nach Roland. Im nächsten Augenblick

spürte er ihre Lippen auf seinem Mund.
»Paß auf dich auf«, sagte sie.
»Los jetzt!« drängte Albert.
Und Ritter Roland löste sich von Helga.
»Wenn wir uns wiedersehen ...« hörte er Helga noch sagen. Dann
warf er das Schwert, das er Mühlberger abgenommen hatte, vom
Wagen und sprang nach einem schnellen Blick und einem
Abschätzen des Tempos vom Wagen ab.
Fast hätte er sich verschätzt. Er landete zwar gut und konnte sich
über die Schulter abrollen, doch sein Schwung war zu groß und die
Gasse zu schmal, und so prallte er gegen die Wand. Obwohl der
Himmel von einer dichten Wolkendecke überzogen war, sah Ritter
Roland einen Augenblick lang Sternchen. Er überlegte einen
Moment lang, wo er war und weshalb ihm Schulter, Knie und
Schädel schmerzten.
Dann hörte er Hufschlag und entfernte Rufe.
Sofort setzte die Erinnerung ein.
Er rappelte sich auf und schob sich in einen Spalt zwischen zwei
Häusern. Da stank es, als hätte dort jemand seine Notdurft verrichtet,
doch das kümmerte Roland im Augenblick nicht. Er lauschte mit
angehaltenem Atem dem Klappern der Hufe, das sich rasch näherte.
Reiter galoppierten heran und sprengten dicht an ihm vorbei.
»Da vorn ist der Wagen abgebogen!« schrie einer von ihnen.
»Gleich haben wir ihn!«
Roland wartete, bis der letzte Reiter vorbei war und sich der
Hufschlag entfernte. Dann spähte er vorsichtig in die Gasse.
Niemand mehr zu sehen.
Er huschte aus dem Spalt zwischen den Häusern und lief zu seinem
Schwert. Es mußte vielleicht ein Dutzend Klafter tiefer in der Gasse
liegen. Zum Glück hatte es in der Dunkelheit keiner der Reiter
bemerkt.
Er fand es erst ein gutes Stück weiter als angenommen und
erkannte daran, in welch höllischem Tempo Albert gefahren war,
während er - Roland - vom Wagen gesprungen war.
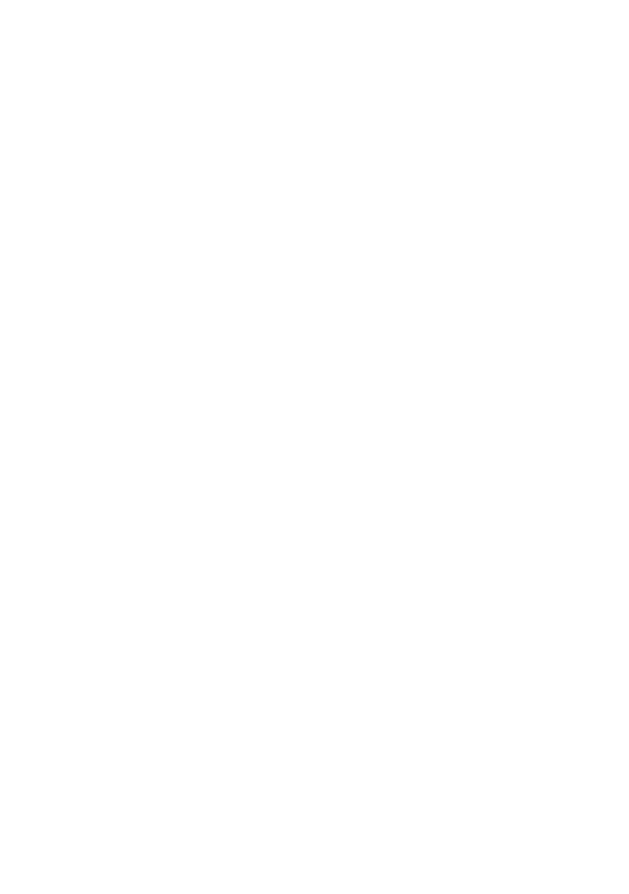
Roland bückte sich nach dem Schwert. Da gewahrte er eine
Bewegung zu seiner Rechten. Er wirbelte herum. Ein Schatten
sprang aus dem Dunkel einer halb offenstehenden Haustür.
Ein Keulenhieb schleuderte Roland zur Seite. Er stürzte neben sein
Schwert. Benommen streckte er die Hand danach aus. Doch bevor er
es ergreifen konnte, stieß der Schatten das Schwert mit einem
Stiefeltritt aus seiner Reichweite.
»Hab ich dich, du Lump!« sagte die dunkle Gestalt triumphierend.
»Ich hab genau beobachtet, wie du vom Wagen sprangst. Da
brauchte ich nur noch zu warten, bis du dein Schwert holtest. Das
habe ich eigens als Köder liegenlassen. Und prompt hast du
angebissen. Ich wette, es gibt eine hübsche Belohnung, wenn ich
dich abliefere, du Galgenvogel!«
Er fühlte sich siegessicher und war offenbar ein Mann der vielen
Worte. Während er bedächtig mit der Keule ausholte, erklärte er, was
er vorhatte:
»Ich werde dir jetzt ein bißchen den Schädel plätten und dich dann
der Stadtgarde ...»Dann schrie er auf und wankte zurück. Ritter
Roland hatte nicht vor, sich den Schädel plätten zu lassen. Er wollte
auch nicht der Stadtgarde ausgeliefert werden. Dann würde der
Galgen auf ihn warten. Ritter Roland kämpfte um sein Leben.
Während der triumphierenden Worte des schwatzhaften Mannes
hatte er in der Dunkelheit unauffällig das Messer gezogen, das noch
nach Helgas Schlüpfer duftete. Fast ansatzlos hatte er das Messer
geschleudert. Es traf den Mann irgendwo am Oberarm und die Keule
fiel ihm aus der zum Schlag erhobenen Hand. Der Kerl brüllte aus
Leibeskräften. »Hierher! Hier ist der Mörder! Hilfe!«
Und schon näherten sich aufgeregte Rufe, Hufschlag, die Schritte
von rennenden Männern. Die ganze Stadt schien auf den Beinen zu
sein, um einen vermeintlichen Mörder zu jagen.
Roland nahm sich nicht mal mehr die Zeit, das Schwert
aufzuheben. Es hätte ihm gegen diese Übermacht ohnehin nichts
genutzt. Und es kam auf jede Sekunde an. Hinten in der Gasse
tauchten die Silhouetten von Männern auf. Fackelschein war zu

sehen. Blieb nur der Fluchtweg in die andere Richtung.
Roland hetzte los.
Hinter ihm blieb der schreiende Mann zurück. Er hatte sich eine
Belohnung verdienen wollen, und jetzt mußte er mit dem Messer im
Arm vorlieb nehmen.
Roland erreichte das Ende der Gasse und hetzte nach links um die
Hausecke. Niemand war in der breiteren Gasse zu sehen. Licht fiel
aus einigen Fenstern.
Roland bemühte sich, im Schatten zu bleiben.
Dann tauchte vor ihm aus einer Seitengasse eine Gestalt auf.
Zugleich sah Roland am Ende der breiteren Gasse einen laufenden
Mann, der offenbar an der Jagd teilnahm und von falschem Alarm in
eine andere Richtung gelockt worden war oder sich noch an der Jagd
nach dem Wagen beteiligte.
»Da läuft er!« brüllte Roland und wies auf den Mann. »Schnell
ihm nach!«
Der Mann blickte in die angewiesene Richtung rannte sofort los. Er
merkte gar nicht, daß Roland in die Seitengasse einbog, aus der er
gerade gekommen war.
Schon stürmten Rolands Verfolger heran, und alle folgten dem
Mann, der aufgeregt Rolands Worte aufnahm: »Da läuft er! Da läuft
er!«
Roland lächelte schwach. Eine Zeitlang würde man einen anderen
jagen, bis sich das Mißverständnis aufklärte. Er drückte sich an die
Hauswand neben den Lichtschein eines Fensters und lauschte den
Schritten, die sich eilig entfernten.
Dann zuckte er zusammen. Das Fenster wurde aufgestoßen, und
eine junge Frau tauchte im Lichtschein auf. Sie neigte sich mit einer
brennenden Kerze in der Hand aus dem Fenster und blickte in die
Gasse. Gähnend murmelte sie: »Möchte wissen, was der Lärm zu
bedeuten hat.« Dann erfaßte ihr Blick Roland, und ihre Stimme
verlor alle Schläfrigkeit.
»Huch!« stieß sie hervor und ließ vor Schreck die Kerze fallen.
»Ein Mann!«

Es klang zwar erschrocken, doch keineswegs entsetzt, und vor
allem war es leise, fast geseufzt. Die Maid trug ein Nachthemd und
eine weiße Schlafhaube. Offenbar hatte sie geschlafen und wußte
noch nicht, was in der Stadt los war.
»Was tut Ihr da?« fragte sie mißtrauisch.
Noch schrie sie nicht Zeter und Mordio. Und Roland mußte
versuchen, es zu verhindern. Denn er hörte bereits weitere Männer
nahen.
»Ihr müßt mir helfen - bitte!« sagte er schnell mit sanfter Stimme.
Er hob die Kerze auf und reichte sie ihr mit einer Verbeugung.
»Was ist denn los? Was hat der Lärm zu bedeuten? Ist ein Feuer
ausgebrochen?«
»Kein Feuer«, sagte Roland. »Räuber sind unterwegs.«
»Oh Gott! Und ich bin ganz allein im Haus.«
»Ich werde Euch beschützen«, sagte Roland. »Geht vom Fenster
fort, damit man Euch nicht sieht.«
Sie tat es, ohne nachzudenken, ohne sich klarzumachen, daß der
fremde Mann eine Gefahr hätte bedeuten können. Sie war jetzt nicht
mehr schläfrig, und sie mußte schon recht einfältig sein, einen
fremden Mann ohne Protest und Hilfeschreie durch ihr Fenster
einsteigen zu lassen.
Sie schloß das Fenster sogar eifrig hinter ihm und zog den Vorhang
zu.
Dann schritt sie mit der Kerze zu einem kleinen Tisch und steckte
sie in einen Halfter. Sie wandte sich um und musterte Roland von
Kopf bis Fuß und wieder zurück. Seine Statur und sein Lächeln
schienen ihr zu gefallen. Sie lächelte ebenfalls.
»Ich träumte gerade«, sagt sie und wies zu dem Bett in der
Kammer. »Ein großer starker Prinz drang bei mir ein.«
Vermutlich ein Wunschtraum, dachte Roland, und er sah, daß die
Maid recht prall, doch nicht gerade die schönste war.
»Nun, groß und stark seht Ihr aus, und eingestiegen seid Ihr auch,
doch wie ein Prinz seht Ihr mir nicht gerade aus.«
»Ich bin auch keiner«, sagte Roland und bedachte sie mit einem

charmanten Lächeln. »Ich bin ein Ritter, und eine wilde Bande ist
hinter mir her. Sie suchen nach mir. Ich bitte Euch, mich nicht zu
verraten.«
Ihre Kulleraugen blickten interessiert. »Fast wie in meinem
Traum«, sagte sie. Sie schritt zu dem Bett und setzte sich auf die
Kante. Dann wies sie neben sich und forderte ihn auf: »Kommt zu
mir und erzählt mir das ganze Abenteuer. Gewiß werde ich Euch
nicht verraten.«
Mit etwas gemischten Gefühlen nahm Roland neben ihr Platz. Sie
legte eine Hand auf seinen Arm und rückte etwas näher an ihn heran.
»Ihr müßt wissen, daß ich seit Wochen allein bin«, sagte sie mit
einem Seufzer des Selbstmitleids. »Da ist man empfänglich für jedes
Abenteuer.«
Ihre Worte und ihr Lächeln sagten ihm alles. Vermutlich hätte
diese Maid in ihrer Not sogar einen üblen Räuber in ihrer Kammer
versteckt, um nicht so einsam zu sein.
Roland horchte kurz in sich hinein und kam zu dem Schluß, daß sie
ihm nicht gefiel. Aber er mußte noch eine Weile bei ihr bleiben und
mit einem kleinen Abenteuer aufwarten, um sich dann in
Freundschaft zu verabschieden, wenn die Jagd nach ihm beendet sein
würde - wenn man zumindest nicht mehr in der Nähe nach ihm
suchte.
Er wollte gerade eine abenteuerliche Geschichte einleiten, die sie
sicherlich befriedigt hätte, als die Tür zum Nebenraum aufflog. Ein
großer rotgesichtiger Mann tauchte in ihrem Rahmen auf. Mit allen
Anzeichen von Zorn.
Roland sprang auf. Unbewußt tastete er zu der Lederscheide an
seinem Gurt, doch sein Messer war ja weg.
Doch er brauchte auch keine Waffe. Der Mann beachtete ihn gar
nicht.
»Hab ich dich erwischt, mein Weib!« röhrte er. »Du treulose
Schlampe!« zornig sprang er auf die erschrockene abenteuerlustige
Frau zu. »Ich wußte, daß du mich betrügst!«
Und schon gab er ihr eine Ohrfeige.

»Kaum ist man auf Reisen, da holst du dir schon irgendeinen Kerl
ins Bett!« Klatsch.
»Aber - er ist bei mir eingestiegen!« schluchzte sie.
»Lüg nicht!« Klatsch. »Ich habe dich nebenan belauscht!« Klatsch.
»Du hast wohl nicht damit gerechnet, daß ich eher zurückkomme,
was? Du hast dir den Kerl von der Straße geholt!«
Er riß den Schürhaken aus dem Holzkorb neben dem Ofen und
fuhr herum. »Und jetzt zu dir, du verdammter ...«
Doch Ritter Roland hatte sich grußlos aus dem Fenster entfernt,
nachdem er die Familien Verhältnisse erfahren hatte. Er gedachte
nicht, sich in einen Kampf verwickeln zu lassen. Noch waren die
beiden miteinander beschäftigt. Noch brüllten sie nicht die Stadt
zusammen.
Doch das geschah kurz darauf. Zu schnell.
Der eifersüchtige Mann schrie röhrend in die Gasse hinein:
»Haltet den Lump!«
Und verschiedene Leute, die bereits die Lust an der ergebnislosen
Suche aufgegeben hatten, wurden von neuem Jagdfieber erfaßt.
»Ich hole meinen Hund«, rief einer. »Der wird ihn fassen!«
Roland hetzte davon, fort von den Schreien, den Männern, die
durch die Gassen rannten.
Atemlos verharrte er in einem Durchgang zwischen zwei Häusern.
Er spähte um die Ecke. Die Verfolger näherten sich. Fackelschein
geisterte durch die Gasse.
»Er muß hier irgendwo sein!« rief eine rauhe Stimme. »Riegelt die
Straßen ringsum ab!«
Roland zog sich tiefer in den Durchgang zurück. Am Ende der
Passage sah er Lichtschein. Roland verharrte. Eine Tür klappte.
»Wir fahren gleich los«, sagte eine näselnde Stimme. »Sonst wird
es zu spät, um die Sachen zu liefern.«
Roland schob sich weiter durch den Durchgang und riskierte einen
Blick. Ein Hof. Ein Wagen mit eingeschirrtem Pferd. Etwas
Viereckiges war auf der Ladefläche festgebunden. Keine
Menschenseele war zu sehen.

»Ich seh mal nach, ob er hier zwischen den Häusern durch ist«, rief
jemand von der Gasse her. Eine Hand mit einer Fackel reckte sich in
den Durchgang.
Roland zögerte keine Sekunde. Er schob sich um die Hausecke in
den Hof und huschte auf Zehenspitzen zum Wagen. Hinter ihm im
Durchgang erklangen Schritte. Und jeden Augenblick konnte der
Besitzer des Wagens auftauchen und losfahren, wie er gesagt hatte.
Aber vielleicht war das die Chance, den Häschern zu entkommen...
Roland schlich hinter den Wagen und kletterte schnell hinauf. Die
Laterne im Hof spendete nur wenig Licht, doch jetzt erkannte
Roland, daß die längliche schwarze Kiste auf dem Wagen ein
schmaler Schrank oder so etwas war. Er tastete darüber. Ein
Schlüssel steckte in der Tür.
Wieder klappte irgendwo eine Tür. Ein Mann in Tischlerkleidung
tauchte im hellen Viereck der Tür auf.
»Hilf mir, die Kommode zum Wagen zu tragen«, rief er und schritt
auf einen Anbau des Hauses zu.
Roland überlegte schnell. Sie mußten ihn unweigerlich entdecken,
wenn sie eine Kommode auf den Wagen luden. Er mußte sich
verstecken, warten, bis sie losfuhren und dann auf den Wagen
springen ...
Stimmen näherten sich dem Hof. Irgendwo kläffte ein Hund.
»Frag mal Friedhelm, ob er den Kerl gesehen hat«, rief jemand von
der Gasse her.
Rolands Blick fiel auf den Schrank. Er war mit einem Strick
befestigt, damit er während der Fahrt nicht auf der Ladefläche hin
und herrutschte.
Mit fliegenden Fingern löste Roland den Strick. Er drehte den
Schlüssel und zog die Tür auf.
Schritte ertönten vom Anbau her.
Flugs stieg Roland in den Schrank und zog die Tür über sich zu.
Gerade noch rechtzeitig, denn er hörte jetzt die seltsam gedämpfte
Stimme eines Mannes dicht neben dem Wagen.
»Verdammt schwer, die Kommode.«

»Dafür wird Meininger auch schwer bezahlen«, erwiderte die
näselnde Stimme, und ein Kichern war zu hören.
Roland lauschte mit angehaltenem Atem. Sie luden die Kommode
auf den Wagen.
»Du hast den Schrank nicht richtig festgebunden«, sagte die
näselnde Stimme vorwurfsvoll.
Roland stockte der Atem. Hoffentlich banden sie den Schrank und
damit ihn nicht zu fest!
Schritte entfernten sich nach vorne zum Wagen.
»Der wird doch durch die Kommode an Ort und Stelle gehalten«,
sagte eine Stimme neben dem Wagen.
Roland hätte jubeln mögen. Jetzt brauchte er nur noch unterwegs
auszusteigen und ...
In diesem Augenblick hörte er ein knirschendes Geräusch.
Der Schlüssel drehte sich im Schloß der Schranktür!
Es war ein Geräusch, das Roland das Blut in den Adern erstarren
ließ.
Er war in dem Schrank gefangen!
*
Der Fluchtversuch mißlang. Sieben Gefangene hatten ihre Bewacher
angefallen, bevor man sie nach der Tagesarbeit in die Höhle
hinaufsteigen ließ, und waren durch die Schlucht geflüchtet.
Es waren Männer, die von Sebastian Müller und den Knappen ins
Vertrauen gezogen worden waren. Sie spielten eine wichtige Rolle in
dem Plan.
Fast eine halbe Stunde hielten die vermeintlichen Ausbrecher die
Räuber in Atem. Sie lockten sie zum Südende der Schlucht, und
einige flüchteten im allgemeinen Durcheinander auch in Richtung
Staudamm. Sie wußten, daß sie nicht entkommen konnten, doch das
war auch nicht der Sinn dieser Aktion. Schließlich waren sie allesamt
wieder gefaßt.
»Ihr könnt von Glück sagen, daß ich euch noch für die Arbeit

brauche«, sagte Wittich - wie erwartet - als seine Räuber die sieben
Männer zur »Bestrafung« brachten. Jeder bekam Peitschenhiebe.
Doch sie nahmen sie erstaunlich gelassen hin, obwohl sie dabei zum
Steinerweichen brüllten.
Louis und Sebastian Müller hatten ihnen mit einem Zwinkern zu
verstehen gegeben, daß das Ablenkungsmanöver gelungen war.
Während alle Räuber in der Schlucht mit der Jagd auf die
vermeintlichen Ausbrecher beschäftigt gewesen waren, hatten Louis
und Sebastian unbemerkt ihre Vorbereitungen treffen können.
Sebastian hatte sich wohlüberlegt am Staudamm zu schaffen
gemacht. Pierre hatte ein langes Stück Seil des behelfsmäßigen
Pferchs erbeutet, in dem die Räuber die Pferde hielten. Ein
überflüssiges Stück Seil, das die Räuber einfach um einen Pfosten
geschlungen hatten, weil es zu lang gewesen war.
Sebastian Müller hatte ein gutes Beobachtungsvermögen.
Jetzt galt es, nur noch auf einen günstigen Zeitpunkt zu warten.
Dann sollten Wittich und seine Räuber von den Fluten
verschlungen werden ...
*
Derweil war Alberts Wagen von Reitern umringt. Sie hatten ihn
südlich der Stadt gestellt.
Der Anführer des Reitertrupps gab stimmgewaltig Befehle. Die
Reiter reckten ihre Lanzen vor.
»Runter vom Wagen, du Hundsfott!« befahl der Stadtgardist. Er
war äußerst schlecht gelaunt. Denn der Fahrer des Wagens hatte ihn
und seine Männer fast eine halbe Stunde lang genarrt. Immer wieder
war er durch Sperren gebrochen und hatte den Verfolgern ein
Schnippchen geschlagen. Drei Männer waren bei der wilden Jagd
verletzt worden.
Der Führer des Trupps gab zweien seiner Männer einen Wink. Sie
saßen ab, kletterten auf den Wagen und suchten. Sie fanden nur eine
Plane auf der Ladefläche. Sie sprangen vom Wagen und schritten zu

dem Fahrer, der in einem weiten schwarzen Umhang neben dem
Wagen stand.
Einer der Männer schlug die Gestalt.
»Wo ist der Mörder, dem du zur Flucht verhalfst?«
Ein heller Aufschrei und ein Schluchzen waren die Antwort.
»Eine Frau?« entfuhr es dem Mann, der geschlagen hatte.
Die beiden Gardisten tauschten einen Blick und sahen dann
ratsuchend zu ihrem Vorgesetzten.
»Ihr seid eine Frau?« rief der Mann und parierte sein nervös
tänzelndes Pferd. »Zieht mal den Mantel aus, damit ich Euch besser
sehen kann.«
Helga nahm den schwarzen Umhang ab. Und jetzt sahen es alle im
silberfarbenen Schein des Mondes, der eine Wolke zur Seite boxte
und vergnügt auf Helga niederspähte: Sie hatten eine Frau gestellt.
Gevatter Mond hatte das meiste der wilden Jagd gesehen und sich
darüber amüsiert, wie Helga und ihr Bruder die Meute zum Besten
gehalten hatte. Er wußte ja, daß es einem guten Zweck diente ...
»Ob wir den falschen Wagen ...?« überlegte einer der Reiter und
kratzte sich am Kinn.
»Papperlapapp!« unterbrach ihn der Vorgesetzte gereizt. »Es ist
der richtige Wagen, so wahr ich Gotthilf Burger heiße.«
Burger heftete seinen Blick auf Helga.
»Wie kommt Ihr auf den Wagen?«
»Ich bin hinaufgestiegen«, sagte Helga ehrlich.
Einer der Gardisten kicherte, doch ein wütender Blick von Burger
ließ ihn schnell verstummen.
»Ihr habt einem Mörder zur Flucht verholfen«, sagte Burger
barsch. »Ihr solltet den Ernst der Lage erkennen und keine Scherze
mit mir treiben! Also, wo ist der Kerl?«
Da begann Helga herzzerreißend zu schluchzen. Sie weinte so
gekonnt, daß einige der Reiter ihren Vorgesetzten bereits mit
tadelnden Blicken betrachteten und fast alle voller Mitleid mit der
Maid waren.
»So beruhigt Euch doch«, bat Burger.

Der Mann, der Helga zuvor einen Schlag versetzt hatte, weil er sie
für einen »Hundsfott« gehalten hatte, hob jetzt den Umhang auf, den
Helga wie unabsichtlich fallen gelassen hatte.
Er wollte ihn ihr um die schmalen Schultern legen, doch sie wich
in gespielter Furcht vor ihm zurück. »Nein - nicht schlagen! Nicht
schlagen!« stammelte sie.
Der Mann blieb mit dem Umhang in der Hand bekümmert stehen.
»Es tut mir leid«, murmelte er. »Ich wußte ja nicht ... «
»Genug des Palavers!« rief Burger gereizt. »Ich verlange eine
Erklärung!«
Die gab Helga ihm, von Schluchzern untermalt.
Demnach war sie nichtsahnend mit dem Wagen auf dem
Nachhauseweg gewesen, als sie Lärm in der Kommandantur gehört
hatte. Sie hatte angehalten, und dann waren ein Mann und eine Frau
auf den Wagen gesprungen. Der Mann hatte sie mit einem Schwert
bedroht und gezwungen, loszufahren. Unterwegs sei das Paar vom
Wagen gesprungen.
»Wo?« fragte Burger angespannt.
»Im Norden der Stadt. Ich mußte kreuz und quer fahren, wie man
verlangte ...«
»Schon gut. Wo im Norden der Stadt?«
»Da war eine Herberge mit einer grünen Lampe ...«
»Die Grüne Laterne«, murmelte einer der Reiter.
»Haben die beiden etwas gesagt?« fragte Burger. »Ich meine
irgend etwas, was Aufschluß über ihre Fluchtpläne geben könnte?«
»Nein, das heißt...« Helga tat, als überlegte sie angestrengt. »Ja,
doch. Die Frau und der Mann stritten sich. Die Frau wollte sich in
der Herberge verstecken und dort nächtigen, doch der Mann meinte,
sie sollten dort nur bleiben, bis die Stadt schläft und noch in der
Nacht nach Westen weiter flüchten, über den Rhein.«
»Da schnappen wir sie!« frohlockte Burger. »Aber Eile ist
geboten!« Er gab seinen Männern einen Wink. »Vorwärts!«
Um Helga kümmerte sich keiner mehr.
Sie sah dann dem Reitertrupp nach, der von neuem Jagdfieber

erfaßt davonsprengte. Sie würden zur Grünen Laterne und von dort
aus vermutlich zum Rhein reiten. Ein langer, vergeblicher Ritt.
So konnten sich Roland und Albert, der schon bald nach Roland
vorn Wagen gesprungen war, nachdem er seiner Schwester den
Umhang und die Zügel übergeben hatte, ungestört beim Goldenen
Pflug treffen ...
*
Doch Roland lag noch in dem Schrank. Er kam sich vor wie in einem
Sarg. Die Luft wurde ihm knapp. All seine Versuche, die Tür
hochzustemmen, waren fehlgeschlagen. Es war eine solide Hand-
werksarbeit mit einem schweren Schloß, das sich nicht sprengen ließ.
Es war bedrückend eng in dem schmalen Schrank, der nach
frischer Farbe roch. Bald war Roland schweißgebadet. Panik erfaßte
ihn in der völligen Dunkelheit und Enge. Er glaubte, ersticken zu
müssen.
Und genau das würde geschehen, wenn die Fahrt lange währte.
Er schrie, so laut er konnte. Nichts geschah. Auch sein
verzweifeltes Pochen gegen die Schrankwand, sein Treten gegen den
Fuß des Schrankes wurden nicht gehört. Die Geräusche gingen im
Rasseln der Räder und im Hufschlag und Fahrtwind unter.
Bald war Ritter Roland heiser vom Schreien. Sein Herz hämmerte,
und in seinem Kopf war eine seltsame Leere. Er preßte die Zähne
aufeinander. Er durfte nicht ohnmächtig werden. Vielleicht hielt der
Schreiner bald, vielleicht wurden seine Rufe und sein Pochen doch
noch gehört! Schleier schienen vor seinen Augen zu wogen, obwohl
es völlig dunkel war. Panische Angst erfaßte ihn, die Angst zu
ersticken.
Nie hatte er sich so hilflos und verzweifelt gefühlt.
Ritter Roland erlitt Höllenqualen.
Da hielt der Wagen. Obwohl Roland es herbeigesehnt hatte,
brauchte er einen Augenblick, um zu erkennen, daß die
Fahrgeräusche verstummt waren. Mit einem Ruck blieb der Wagen

stehen. Ein Pferd wieherte. Dann herrschte einen Moment lang
Totenstille.
Roland lauschte angespannt. »Macht auf!« flehte er, und seine
Stimme kam ihm selbst fremd vor.
Dann vernahm er Schritte und gedämpfte Stimmen wie aus weiter
Ferne. Eine Tür klappte.
»Schönen Abend, Herr Meininger«, sagte die näselnde Stimme.
»Wir bringen den Schrank und die Kornmode.«
»Reichlich spät kommt ihr«, antwortete eine tiefe Stimme.
»Friedhelm, Luitpold, helft beim Abladen!«
Jemand kletterte auf den Wagen. Roland setzte zu einem Schrei an.
Jetzt mußten sie ihn hören! Selbst wenn sie ihm Schwerter an die
Kehle setzten, wenn er ausstieg - er wollte lieber gefangengenommen
werden als elendiglich ersticken.
»Mensch, ist das Ding schwer«, sagte eine Stimme.
»Solide Eiche«, antwortete die näselnde Stimme des Schreiners.
»Und das zu Vorzugspreisen. Und das beste Schloß ohne Aufpreis.«
Jemand drehte den Schlüssel, und Roland verzichtete noch auf den
Schrei, denn jemand sagte: »Erst die Kommode, dann kommen wir
besser an den Schrank ran!«
Roland schöpfte neue Hoffnung. Zumindest zwei der Männer
würden mit der Kommode beschäftigt sein. Vielleicht konnte er
sogar das Unerhoffte schaffen und unbemerkt aus dem Schrank
klettern, wenn die anderen mit der Kommode im Haus waren.
Er hörte, wie die Kommode über die Ladefläche geschoben und
abgeladen wurde.
»Wartet, ich zeige euch, wo sie aufgestellt werden soll«, ertönte
eine Frauenstimme. Schritte entfernten sich.
Es kostete Roland Überwindung, noch einen Augenblick zu
warten. Dann drückte er die Schranktür hoch, langsam, vorsichtig.
Nichts tat sich.
Aber der Schreiner hatte doch wieder aufgeschlossen, oder?
Roland bemühte sich heftiger.
Ohne Erfolg. Entweder war noch abgeschlossen, oder die Tür

klemmte!
Eine letzte verzweifelte Anstrengung. Mit all seiner Kraft stemmte
sich Roland gegen die Schranktür hoch. Ein Ruck, und aus dem
langsamen, vorsichtigen wurde nichts mehr. Die Tür flog förmlich
empor und knallte zur Seite gegen das Wagenbrett.
Mit dem wilden Hochstemmen war Roland in den Schrank
zurückgefallen, doch als er jetzt den schrillen Schrei des Entsetzens
hörte, sprang er auf.
Wie der Teufel aus der Kiste.
Sein Gesicht war krebsrot, seine Haare hingen in wirren Strähnen
in die schweißnasse Stirn, er hatte eine blutige Schramme an der
Wange und seine Kleidung war nach allem, was er durchgemacht
hatte, schmutzig und verschwitzt. Alles in allem mußte er in diesem
Augenblick tatsächlich wie der Leibhaftige ausgesehen haben.
Während er gierig nach Luft schnappte, erfaßte er die Situation mit
einem Blick. Der Mann in der Tischlerkleidung stand neben dem
Wagen. Er starrte ihn mit geöffneten Mund an wie einen Geist.
Verständlich, denn er hatte keinen Mann in seinen schönen, soliden
Schrank eingebaut. Eine Frau schrie auf und bekreuzigte sich. Die
Männer, die keuchend die Kommode trugen, waren bei dem Schrei
stehengeblieben. Ihre Köpfe ruckten herum. Sie sahen einen Mann
aus dem Schrank springen und ließen vor Schreck die Kommode
fallen. Dann brüllte auch einer von ihnen los, doch nicht vor Schreck,
sondern vor Schmerz - die Kante der Kommode war auf seinen
dicken Zeh gefallen.
Ein älterer Mann tauchte in der offenstehenden Tür der Kate auf.
Offenen Mundes starrte er Roland an, und er befürchtete schon, den
Alten würde der Schlag treffen. Doch wie von Furien gehetzt, warf
sich der Mann herum und verschwand im Haus.
Es tat Roland leid, diese Leute zu erschrecken, doch es ging
schließlich um sein Leben. Vermutlich hätte er es keine Sekunde
länger in dem Schrank ausgehalten, ohne ohnmächtig zu werden.
Er wollte gerade eine Erklärung abgeben und die Gemüter
besänftigen, doch da kreischte der Schreiner beim Wagen:

»Der Mörder! Der entsprungene Mörder!«
Und aus der Kate stürmte der Alte, der sich trotz seiner Jahre als
äußerst kampffreudig erwies. Vermutlich hatte er in seinem Leben
manche Schlacht geschlagen. Er schwang ein großes
Schlachtermesser, das er wohl flugs aus der Küche geholt hatte.
»Ein Mörder?« rief er, und sein Blick zuckte zu Roland.
»Sie suchen ihn in der Stadt«, schrie der Gehilfe des Schreiners.
Sofort setzte sich der Alte mit dem Schlachtermesser in Bewegung.
Und die beiden anderen rannten ins Haus, entweder um sich in
Sicherheit zu bringen oder um sich mit irgend etwas zu bewaffnen.
Da verzichtete Roland auf eine Erklärung.
Mit drei langen Sätzen sprang er über die Ladefläche, warf sich auf
den Wagenbock, ergriff die Zügel und trieb das Pferd mit einem
wilden Schrei und Zügelschlägen an.
Das Roß war offenbar ebenso erschrocken wie alle anderen. Sofort
jagte es los.
Der Schreiner sprang zur Seite wie zwei Hühner, die bisher
gackernd auf dem Hof gepickt hatten und sich von der Aufregung der
Menschen nicht hatten stören lassen.
Der Alte mit dem Schlachtermesser war zwar finster entschlossen,
doch nicht mehr schnell genug. Zudem wirbelten ihm die Räder
Staub ins Gesicht. Er blieb stehen und rieb sich mit der freien Hand
über die Augen.
Roland warf einen schnellen Blick zurück. Er sah durch den
Staubschleier die Gestalten, die wie erstarrt verharrten und ihm
offenen Mundes nachstarrten. Dann reckte der Schreiner drohend die
geballte Faust in die Luft und begann zu fluchen.
Roland fuhr nicht weit mit dem Wagen. Die Stadt war auch nicht
so fern, wie er während der scheinbaren Ewigkeit der
Gefangenschaft im Schrank angenommen hatte. Er konnte schon die
Lichter sehen.
Am Stadtrand ließ er den Wagen zurück und setzte den Weg zu
Fuß fort. Er hielt sich im Schatten und wählte Schleichwege.
Nach einiger Suche fand er dann den Goldenen Pflug.

Helga wartete bei der Tür. Sie entdeckte ihn, bevor er sie sah. Sie
umarmte und küßte ihn. Sie hatte schon bangen Herzens gewartet
und befürchtet, er sei doch noch geschnappt worden.
Helga führte ihn dann zu ihrem Bruder Albert, der sich ein Zimmer
in dem Gasthof genommen hatte.
Im Schein der Lampe sah Roland dann Helgas Bruder zum ersten
Mal richtig. In der Dunkelheit hatte er ihn ja nur schemenhaft auf
dem Wagenbock gesehen.
Albert ähnelte Helga nicht sehr, und das war gewiß gut so für
Helga. Albert sah zum Fürchten aus, was man von Helga weiß Gott
nicht behaupten konnte. Seine Nase war enorm breit und vermutlich
mal gebrochen gewesen. Dichte schwarze Koteletten bedeckten seine
Wangen. Der schwarze Schnurrbart hing über die Mundwinkel
hinab. Am wuchtigen, bartlosen Kinn hatte Albert eine rote Narbe
von einem Schwert oder Messerhieb zurückbehalten.
Albert drückte Roland die Hand, und Roland ging fast in die Knie.
Er mochte einen festen Händedruck, doch bei dem bulligen Albert
mit den Holzfällerhänden mußte man hinterher nachschauen, ob noch
alle Finger an der Hand oder ob der eine oder andere zermalmt
worden war.
Albert zeigte grinsend sein Gebiß, das gewisse Ähnlichkeit mit
dem eines Pferdes hatte, als er sah, wie Roland seine Hand rieb.
»Grüß Euch Gott, Ritter«, sagte er mit seiner Baßstimme.
Und dann wartete er mit einer Überraschung auf.
Albert hatte sich die beiden falschen Zeugen geschnappt, die
Männer, die in Wittichs Auftrag mit ihrem Meineid Ritter Roland an
den Galgen bringen sollten.
Albert hatte sich ein wenig mit ihnen »unterhalten« - wie er es
nannte, und die beiden waren äußerst gesprächig geworden.
Vermutlich waren sie von seinem Händedruck so beeindruckt
gewesen ...
*

»Wenzel und Otto kommen zurück«, sagte einer der Wachtposten am
nördlichen Zugang der Schlucht, nachdem er die beiden Reiter an der
Kleidung und den Rössern erkannt hatte.
Dann würfelte er weiter mit seinem Kumpan. Die beiden blickten
nur noch einmal kurz auf, als einer der beiden Reiter einen
dreifachen Kuckucksschrei ausstieß. Es war die Parole. Sie würfelten
weiter, und einer freute sich über sein Wurfglück, während der
andere ärgerlich furzte.
Für die beiden war klar, daß die beiden Reiter ihre Kumpane
waren. Alles stimmte: Kleidung, Rösser und das vereinbarte Signal.
Doch die beiden Reiter waren keine Räuber.
Es waren Roland und Albert.
Sie hätten glatt an den Wachtposten vorbeireiten können, ohne daß
man Verdacht geschöpft hätte.
Doch sie ritten nicht vorbei.
Sie warfen sich von den geliehenen Pferden auf die würfelnden
Räuber und schlugen die völlig überraschten Männer nieder, bevor
sie einen Laut von sich geben konnten.
Albert nahm dann den Würfelbecher und würfelte. Zwei Sechser
und eine Eins. Er drehte die Eins herum und sagte grinsend:
»Drei Sechser. Na, hab ich's nicht gesagt: Frechheit siegt!«
Ritter Roland war keineswegs pessimistischer Natur, doch er hatte
große Zweifel gehabt, daß ihr Plan gelingen konnte. Es war schon ein
dreistes Stück, einfach in die Höhle des Löwen zu reiten. Sicher, sie
trugen die Kleidung der beiden Räuber - übrigens recht vornehme
Sachen, da die Kerle als »Zeugen« einen guten Eindruck hatten
machen wollen - und sie ritten ihre Rösser, einen Muskatschimmel
und einen Rappen mit weißer Stirnblesse. Zudem hatten sie die Hüte
tief in die Stirn gezogen, und ihre Gesichter waren in der
Abenddämmerung gewiß nur aus nächster Nähe zu erkennen. Doch
wenn die Posten aufmerksamer gewesen wären, hätte der Streich
kaum so glatt gelingen können.
Doch es war gutgegangen. Jetzt galt es, den nächsten Teil des
Plans zu erledigen. Sie entkleideten die bewußtlosen Räuber bis auf

das Unterzeug und fesselten und knebelten sie. Dann versteckten sie
die Männer in einer Felsspalte. Anschließend zogen Roland und
Albert sich um. Die Kluft der Räuber paßte nicht ganz, doch in der
Dunkelheit würde das nicht so auffallen.
Albert führte die Pferde aus der Schlucht und band sie im Wald am
Fuße der Felswand an. Er kehrte mit sieben Männern zurück. Es
waren Freunde von Albert, die sich bereit erklärt hatten, bei dem
gewagten Spiel mitzumachen. Roland hatte überlegt, ob er Gardisten
um Hilfe bitten sollte, sich dann jedoch dagegen entschieden. Die
beiden Räuber brauchten ihr Geständnis nur zu widerrufen, und
schon wäre Roland wieder ein Gefangener gewesen ...
Roland erklärte noch einmal seinen Plan. Es sollte alles lautlos
ablaufen. Schließlich hatten Wittich und seine Räuber jede Menge
Geiseln. Es galt zuallererst die Gefangenen zu befreien. Erst wenn
sie in Sicherheit waren, sollten die anderen Männer in die Schlucht
eindringen und die Räuber im Schlaf überraschen.
»Viel Glück«, murmelte einer der Männer, als Roland und Albert
sich in der Dunkelheit auf den Weg begaben.
»Können wir brauchen«, murmelte Albert. »Hoffentlich stimmen
die Angaben der beiden Haderlumpen.«
Die Angaben stimmten. In ihrer Todesfurcht hatten die beiden jede
Einzelheit ausgeplaudert. Sie hatten sogar eine Skizze angefertigt,
auf der alle Örtlichkeiten angegeben waren.
Roland und Albert wußten, in welcher Hütte Wittich schlief, wo
die männlichen und weiblichen Gefangenen waren, wie viele
Wachen es gab und wann sie abgelöst wurden und eine Fülle
weiterer Einzelheiten.
Nur eines konnten sie nicht wissen: Daß bereits andere einen
anderen Plan in die Tat umsetzten. Ein Plan, der vorsah, daß die
Schlucht zu einem nassen Grab für Wittich und die meisten seiner
Räuber werden sollten.
Und diese Männer konnten wiederum nicht wissen, daß zwei
andere Männer zu ihrer Rettung in die Schlucht eingedrungen waren.
So nahm das Verhängnis seinen Lauf...

*
»Vorsicht«, flüsterte Louis und duckte sich hinter einen Felsbrocken
oberhalb des Staudammes, zu dem nur ein schmaler Pfad an der
Felswand entlang aus dem Grund der Schlucht hinaufführte. »Die
Wachen kommen runter.«
»Die Ablösung müßte doch erst später sein«, wisperte Sebastian
Müller. »Na, ihr Pech. Dann ersaufen sie mit.«
»Geht schneller, ihr Haderlumpen«, flehte Louis leise.
Die Zeit drängte. Jeden Augenblick konnte Wittich Edeltrauts
Verschwinden bemerken, nach ihr Ausschau halten und feststellen,
daß es keine Wachen mehr unten an der Felswand unter der Höhle
gab.
Das war einer der schwächsten Punkte des Plans. Doch sie konnten
Edeltraut nicht in den Fluten umkommen lassen.
Sie war jetzt wie die anderen weiblichen Gefangenen bei den
Männern in der Höhle hoch oben in der Felswand.
Bisher hatte alles gut geklappt.
Wie jeden Abend nach getaner Arbeit hatten die Gefangenen über
die Strickleiter hinauf zur Höhle klettern müssen. Die Strickleiter
war fest verankert am Zugang der Höhle. Irgendeiner der Räuber
mußte sich von hoch oben einmal abgeseilt haben und die Leiter
befestigt haben, damit die Höhle als Versteck und später als
natürlicher Kerker genutzt werden konnte. Wie jedes Mal hatten es
sich dann die beiden Wachtposten unten neben der Strickleiter
bequem gemacht. Es war unmöglich, daß einer der Gefangenen nach
unten oder oben floh. Selbst wenn Hilfe von oben gekommen wäre,
wenn sich jemand abgeseilt hätte, wären die Geräusche bemerkt
worden.
Die beiden Wachtposten hatten später auch etwas gehört, doch
alles war zu schnell gegangen. Ein Felsbrocken war an einem Seil
herabgesaust, und beide Männer waren zu Boden gesunken, ohne zu
wissen, was sie da getroffen hatte. Es war ein Felsbrocken, der oben
in der Höhle aus dem Gestein gebrochen war und den die

Gefangenen an dem Seil befestigt hatten, das Louis zuvor besorgt
hatte.
Louis war dann in die Schlucht hinabgeklettert. Er hatte ein Messer
und ein Schwert der bewußtlosen Wachtposten genommen. Zwei
weitere Männer waren über die Strickleiter hinabgeklettert um die
bewußtlosen Räuber nach oben zu befördern. Sebastian Müller hatte
gemeint, sie sollten ruhig mit ertrinken, doch Louis hielt es für
besser, sie als Gefangene in der Höhle zu halten - falls der Plan nicht
gelingen sollte.
Louis war dann an der dunklen Felswand entlang in die Schlucht
hinab zu den drei Hütten geschlichen. Der Posten vor der Hütte, in
der die weiblichen Gefangenen waren, hatte vor sich hingedöst.
Diese Wache hielten die Räuber für überflüssig. Die Hütte war des
Nachts verriegelt, und selbst wenn die Mädchen hinausgelangten,
konnten sie nicht aus der Schlucht entkommen. Louis hatte dem
dösenden Kerl auf den Schlapphut geklopft und die Mädchen aus der
Hütte geholt. Edeltraut war planmäßig zur Stelle gewesen und mit
den anderen Mädchen bis zur Strickleiter unter der Höhle
geschlichen und hinaufgeklettert. Edeltraut war im Laufe des Tages
bei der Essensausgabe von Pierre in den Plan eingeweiht worden. Sie
hatte dafür gesorgt, daß Wittich an diesem Abend besonders viel
Wein getrunken hatte, und sie hatte sich zum verabredeten Zeitpunkt
aus der Hütte geschlichen. Sie wartete jetzt wie die anderen Mädchen
und das Gros der männlichen Gefangenen oben in der Höhle und
hoffte, daß Wittich tatsächlich eingeschlafen war und ihr
Verschwinden nicht bemerkt hatte.
Louis und Sebastian Müller schauten den beiden Schatten nach, die
sie für Räuber hielten. Es waren Roland und Albert, die jetzt mit der
Dunkelheit am Fuße der Felswand verschmolzen.
»Schnell jetzt«, raunte Sebastian.
Louis legte einen Pfeil auf die Sehne des Bogens, den er einem der
Wachtposten abgenommen hatte. Er bedauerte, was er tun mußte,
doch es blieb ihm keine Wahl.
Das Leben vieler Menschen stand auf dem Spiel.

Wittich hatte sich zu einer unbedachten Äußerung hinreißen lassen.
Der Kerl dachte höchstwahrscheinlich nicht daran, die Gefangenen
freizulassen, wenn er den Schatz gehoben hatte. Aus seinen
Andeutungen war hervorgegangen, daß er die Gefangenen zwar nicht
töten wollte, sie jedoch dort oben in der Höhle lassen wollte - ohne
Strickleiter! Damit er einen genügend großen Vorsprung haben
würde, um mit dem Schatz auf Nimmerwiedersehen zu
verschwinden. Und das konnte genausogut ihr Todesurteil sein.
Wenn niemand sie fand, würden sie dort oben in der Höhle
verhungern.
Louis zielte sorgfältig auf die Kruppe des Pferdes. Es tat ihm um
die Rösser leid, die eine Rolle in ihrem Plan spielen mußten, doch es
waren Tiere. Er mußte an das Leben der vielen Menschen denken.
Er schoß den Pfeil ab. Das Pferd machte einen erschrockenen Satz
und wieherte. Es wollte durchgehen, doch es war mit einem soliden
Strick an einen Stamm des Staudammes angebunden. Den Stamm
hatte Louis angesägt, während der vermeintliche Ausbruch der
sieben Gefangenen die Räuber abgelenkt hatte...
Louis legte bereits den nächsten Pfeil auf die Sehne. Schnell
spannte er den Bogen abermals, zielte auf das zweite Pferd und
schoß den Pfeil ab. Auch dieses Roß traf er, gerade so, daß es in
Schrecken versetzt wurde, wie er hoffte. Die Männer selbst konnten
diesen Teil des Plans nicht erledigen. Natürlich fehlte ihnen die
Kraft, aber es wäre auch zu riskant für sie gewesen. Sie hätten sich
nicht so schnell in Sicherheit bringen können. Wenn die Tiere die
angesägten Stämme einrissen, konnten sie den Strick losreißen und
über den Pfad entkommen, der am See vorbei an der Felswand
entlang in die Schlucht hinabführte. Unten in der Schlucht hatten die
Rösser dann eine Überlebenschance, wenn ihr Instinkt sie zum
südlichen Zugang der Schlucht trieb und wenn sie schnell genug
waren.
Beide Rösser zerrten an den angesägten Streben des Staudammes.
»Es klappt nicht!« fluchte Louis leise. »Der Damm hält!«
Sein Gefühl sagte ihm, daß Sebastians Plan irgendeinen

entscheidenden Fehler enthielt. Allen Beteiligten war klar, daß es
viele Unwägbarkeiten gab und daß sie eine Menge Glück haben
mußten. Wenn es Louis und Sebastian zum Beispiel nicht gelang, die
Wachen am Nordende der Schlucht zu überwältigen, dann brauchten
die Kerle nur zu warten, bis das Wasser abgeflossen war, und sie
hatten nach wie vor die Gefangenen in der Höhle. Ebenso war der
Plan gefährdet, wenn die ausgesuchten Männer nicht schnell genug
zum südlichen Zugang der Schlucht schwimmen konnten, wo
ebenfalls zwei Räuber Wache hielten. Sebastian hatte zwar
behauptet, die beiden würden wie der Rest der Brut ertrinken oder
aus der Schlucht geschwemmt werden, doch Louis fand das alles ein
bißchen zu optimistisch.
Immer wieder hatten sie überlegt, ob der Plan gelingen konnte.
Und schließlich hatten sie sich entschlossen, es zu versuchen. Dies
war eine dunkle Nacht, und der Staudamm war fast fertig. Wittich
konnte auf die Idee kommen, alles zu beschleunigen, indem er den
Abfluß des Sees einfach vergrößern ließ. Bei der gedrosselten
Wasserzufuhr würde der See dann schnell flach genug sein, so daß
gute Schwimmer nach dem Schatz tauchen konnten.
In diesem Augenblick bezweifelte Louis, daß alles so ausgehen
würde, wie Sebastian fest glaubte und wie er, Louis hoffte.
Immer noch zerrten die Rösser an den Stricken. Plötzlich war ein
knirschendes Geräusch zu vernehmen. Dann ein Bersten und Reißen,
als neigte sich ein gefällter Baum. Eines der Pferde riß sich los und
jagte über den Pfad zwischen See und Felswand schluchtabwärts.
Das andere Roß bäumte sich auf. Dann knickte der Stamm ein, an
der Schnittstelle, wo es angebunden war. Das Tier riß sich mit einem
gewaltigen Ruck los und preschte hinter seinem Artgenossen her.
Der Pfeilschaft wippte in der Kruppe auf und ab. Louis hoffte, daß
der Pfeil nicht tief eingedrungen war.
Gutes Pferd! dachte er. Du schaffst es wie das andere! Ihr werdet
das beste Futter bekommen, das je ...
Seine Augen weiteten sich. In seiner Panik rutschte das Roß vom
Pfad ab und stürzte in den See. Wasser spritzte hoch auf, dann

schwamm das Roß.
In diesem Augenblick hielt der Damm dem Druck des gestauten
Wassers nicht mehr stand. Es war nur eine schmale Bresche, die von
den Pferden gerissen worden war, doch das genügte. Ein gewaltiges
Bersten und Gurgeln war zu hören. Stämme senkten sich wie
umgeknickte Streichölzer, und die Bresche riß auseinander. Mit
ohrenbetäubendem Rauschen schoß das gestaute Wasser durch den
aufgerissenen Damm und toste in den tiefergelegenen See hinab. Ein
Schrei hallte durch die Schlucht, doch er ging in dem Tosen und
Branden fast unter. Stämme brachen und klatschten in den See hinab
und wurden wie von einer gigantischen Faust durch das wirbelnde
Wasser gefegt. Der See schwoll schnell an.
Das Pferd, das im See schwamm, wurde von der Strömung rasch
auf den Überlauf zugetrieben. Es prallte gegen den Abfluß in dem
Staudamm der Natur, der damals bei dem Unwetter und dem
Erdrutsch entstanden war, wodurch sich der See gebildet hatte.
Hoffentlich stimmen Sebastians Schätzungen, und dieser natürliche
Damm wird schnell genug überflutet! dachte Louis.
Seine Hoffnung erfüllte sich. Das Roß half dabei mit, was
Sebastian gar nicht bedacht hatte. Er war überzeugt davon, daß der
Druck der herabstürzenden Wassermassen groß genug war, um den
Abfluß des Sees aufzureißen oder zumindest zu vergrößern.
Zusammen mit dem Wasser, das über den natürlichen Damm
schießen würde, mußte sich der Bach dann in einen reißenden Strom
verwandeln und wie eine Lawine in den unteren Teil der Schlucht
donnern.
Das Roß half mit. Es prallte in seiner Panik mehrmals gegen die
Barriere beim Abfluß des Sees, auf den es die Strömung zugetrieben
hatte. Dann wurde es von einem enormen Wasserstrudel erfaßt und
von einer Sturzflut aus dem See geschleudert.
Wiederum erfüllte ein Bersten und Krachen die Schlucht. Hoch
gichtete das Wasser an dem einst schmalen Ablauf des Sees, der jetzt
zu einer breiten Bresche geworden war. Schlamm und Geröll wurden
von den Fluten erfaßt, die durch die Öffnung schössen. Ein halb

vermoderter Baumstamm wurde emporgewirbelt und brach in viele
Stücke. Eine schäumende, quirlende Wassermasse ergoß sich tosend
in den tiefergelegenen Teil der Schlucht.
Louis legte einen Pfeil auf die Bogensehne und wartete
angespannt. Jeden Augenblick konnten die Wachen vom Pfad
oberhalb des eingebrochenen Staudammes auftauchen, um
nachzusehen, was geschehen war. Dann mußten Sebastian und er sie
ausschalten. Doch keiner ließ sich blicken. Besorgt sah Louis zu den
beiden Felsschultern links und rechts des Staudammes empor. Dort
waren tagsüber zwei Bogenschützen postiert, die mit Argusaugen
darüber wachten, daß keiner der Gefangenen in den Stausee sprang
und schwimmend das Weite suchte. Wenn die Wachen nicht wie
erhofft in die Schlucht liefen, sondern statt dessen dort oben
hinaufstiegen ...
Louis wurde aus seinen Gedanken gerissen. Ein Schatten tauchte
auf dem Pfad auf, der durch den schmalen Zugang nach Norden aus
der Schlucht hinab, beziehungsweise hinaufführte.
Louis konnte nicht ahnen, daß es keiner der Räuber, sondern einer
der Männer war, die zu ihrer Rettung gekommen waren.
Er traf den Mann, der mit seinen Gefährten vom Krachen und
Bersten und Tosen alarmiert worden war. Brüllend taumelte der
Mann mit einem Pfeil in der Schulter zurück. Die anderen zogen ihn
schnell in die Felsspalte in Sicherheit.
»Mein Gott«, murmelte einer entsetzt. »Der Damm ist gebrochen.
Und Albert und Roland sind in der Schlucht!«
*
Roland und Albert waren überrascht, keine Wachtposten unterhalb
der Höhle zu finden.
»Vielleicht haben uns die beiden Vögel einen Bären aufgebunden«,
raunte Albert. »Soll ich rauf klettern und mit den Gefangenen
reden?«
Roland blickte auf den Felsbrocken, an den ein Seil gebunden war.

Sein Gefühl warnte ihn. »Warte lieber. Ich sehe mich bei den drei
Hütten um.« Er glitt lautlos in der Dunkelheit davon.
Bei der Hütte, in der die weiblichen Gefangenen sein mußten,
wenn die beiden Räuber die Wahrheit gesagt hatten, rechnete Roland
mit einem Wachtposten. Er verharrte hinter der Hütte im Dunkel und
lauschte. Irgendwo am Nordende der Schlucht wieherte ein Pferd,
dann herrschte wieder Stille. Roland schlich an der Hüttenwand nach
vorne. Kein Wachposten, nichts. Dann sah Roland, daß die Tür der
Hütte nur angelehnt war. Er riskierte einen schnellen Blick hinein.
Keine Atemzüge, kein Schemen im Dunkel - die Hütte mußte leer
sein.
Hatten die beiden Räuber, Wenzel und Otto, gelogen?
In diesem Augenblick ging die Tür der zweiten Hütte auf. Ein
Mann mit einer Laterne tauchte auf. Roland erkannte ihn im Schein
der Laterne sofort nach der Beschreibung:
Wittich!
Der Räuberhauptmann verharrte und hielt die Laterne hoch.
»Edeltraut?« rief er fragend. »Wo bist...«
Er verstummte jäh. Er hatte die dunkle Gestalt aus der Hütte
huschen sehen.
»Was machst du bei den Weibern?« rief er grollend.
Roland gab keine Antwort. Er zwang sich langsam weiterzugehen.
»Antworte!«
Noch sechs Schritte bis zu Wittich. Noch hielt der Kerl ihn für
einen seiner Räuber.
Roland nuschelte etwas Unverständliches.
Geräusche drangen vom Nordende der Schlucht heran, ein Bersten
und Hufschlag.
Wittichs Blick zuckte an Roland vorbei.
»Alaaarm!« schrie er dann mit sich überschlagender Stimme.
Roland glaubte, der Räuberhauptmann hätte trotz der Verkleidung
erkannt, daß er keiner der Räuber war. Das war nicht der Fall, doch
es änderte nichts.
Der Plan war gescheitert. Jetzt saßen zumindest er und Albert in

der Falle. Und Roland überlegte nicht lange. Tollkühn setzte er alles
auf eine Karte. Er mußte Wittich schnappen, ihm das Schwert an die
Kehle setzen, bevor die anderen Räuber zur Stelle waren, und freien
Abzug verlangen.
Er riß das Schwert hoch und hetzte auf Wittich zu.
Der Räuberhauptmann wirkte für einen Augenblick wie erstarrt.
Er reagierte erst, als Roland nur noch zwei Schritte von ihm
entfernt war. Mit einem wilden Schrei schleuderte er die Lampe und
sprang vor Rolands vorstoßendem Schwert zurück. Roland duckte
sich mitten im Lauf, doch es war zu spät. Die massiv eingefaßte
Laterne traf Roland an der Schläfe, und er hatte das Gefühl, von
einem auskeilenden Pferdehuf getroffen worden zu sein.
In seinen Ohren rauschte und krachte und toste es, seltsam
gedämpft, und alles verschwamm vor seinen Augen. Er stürzte.
Er fiel fast vor Wittichs Füße.
Er hörte Schreie, immer noch das seltsam entfernte Brausen und
dazwischen ein Hämmern wie Hufschlag und ein Tosen, als
peitschten Fluten durch die Schlucht.
»Ein Schwert!«
Wittich rief es einem der Räuber zu, die aus ihrer Hütte stürmten.
Einer der Männer warf es ihm zu. Wittich wollte es auffangen, um
damit dem Eindringling, der benommen am Boden lag, den Todes-
stoß zu versetzen. Doch im letzten Augenblick zuckte sein Kopf
herum, und seine Augen weiteten sich vor Entsetzen. Das Schwert
fiel neben ihm zu Boden.
Wittich sah Pferde auf sich zurasen und erkannte erst jetzt, daß
eine Sturzflut in die Schlucht schoß. Zuvor hatte er im Dunkel nicht
viel erkannt, und nur aus dem Hufschlag und den anderen
Geräuschen geschlossen, daß jemand in die Schlucht eingedrungen
sein mußte.
Jetzt vergaß er die Gestalt am Boden und wirbelte herum. Gehetzt
blickte er um sich. Seine Männer starrten ebenso voller Entsetzen zu
der herandonnernden Lawine.
Zuerst drohte die Gefahr von den Pferden. In ihrer Panik rasten die

Tiere geradenwegs auf die Räuber zu. Ein Pferd preschte keine
Handbreit an der Gestalt vorbei, die noch benommen am Boden lag.
Die Räuber sprangen vor den herandonnernden Pferden zur Seite, in
Deckung ihrer Hütte. Einer schaffte es nicht mehr. Er geriet unter die
wirbelnden Hufe.
»Weg!« brüllte Wittich gegen das Tosen an, das die Schlucht
erfüllte. Er hatte erkannt, daß nur die Flucht durch den südlichen
Zugang der Schlucht die Rettung bringen konnte. Und er handelte
wie ein in die Enge getriebenes Wild - instinktiv und schnell Das
Pferd, das einen der Räuber gerammt hatte, scheute bei dem
gellenden Schrei des Mannes, drehte ab und stieg auf die Hinterhand.
Mit zwei langen Sätzen war Wittich bei dem Tier. Als das Roß
wieder weiterrasen wollte, warf sich Wittich mit einem wahren
Panthersatz auf den ungesattelten Rücken des Pferdes. Fast wäre er
auf der anderen Seite wieder hinuntergefallen, doch er krallte sich in
der Mähne fest, zog sich hoch und blieb auf dem Pferd.
Das Tier preschte mit reiterlosen Rössern auf den Zugang der
Schlucht zu.
Wittich warf einen schnellen Blick zurück. Die Wasserlawine
wälzte heran. Rasend schnell. Nur noch Sekunden, dann mußte sie
den Mann erreichen, der sich gerade am Boden aufstemmte. Der
verdammte Kerl, der mit dem Schwert auf ihn losgegangen war,
sollte ersaufen wie eine Ratte! Es grenzte schon an ein Wunder, daß
er nicht von den Pferden niedergetrampelt worden war.
Wittichs Kopf ruckte wieder herum.
Er schätzte die Entfernung ab. Das Pferd flog förmlich auf den
Zugang der Schlucht zu. Das war die Rettung! Nur noch etwa
zwanzig Klafter.
Ein reiterloses Pferd war vor Wittich an der trichterförmigen
Öffnung, die sich nach einer Weile zu einer schmalen Felsspalte
verengte.
Wittich prallte mit dem Roß aus voller Karriere gegen das
reiterlose Pferd, dem ein anderes Tier in der Felsspalte den Weg
blockierte. Wittich flog wie von einem Katapult geschleudert über

den Pferdehals.
Beatrix! schrie eine Stimme in ihm.
Dann krachte er gegen die Felswand und verlor das Bewußtsein.
*
Roland kämpfte sich auf die Beine. Die Benommenheit ließ nach.
Das Rauschen hinter ihm schwoll an. Ein Roß galoppierte an ihm
vorbei. Rolands Blick suchte Wittich. Von dem Räuberhauptmann
war nichts mehr zu sehen. Pferde, im Dunkel nur schemenhaft zu
erkennen, jagten auf den Ausgang der Schlucht zu. Schreie gellten
durch das Rauschen, das Roland immer noch nicht zu deuten wußte.
Dann sah er es. Doch bevor er etwas tun konnte, riß ihn schäumendes
Wasser von den Beinen. Er hatte das Gefühl, der Boden würde ihm
unter den Füßen weggespült. Er fiel, schluckte Wasser, überschlug
sich und wurde im gurgelnden gischtenden Naß weitergewirbelt. Er
versuchte zu schwimmen, doch es gelang ihm nicht. Eine Woge
erfaßte ihn und schleuderte ihn hoch. Er landete hart und glaubte,
von der Flutwelle zu Boden geschmettert zu sein. Doch das war nicht
der Fall.
Er sah unter sich das Dach einer Hütte, und die Hütte wurde gerade
umgerissen. Die nördliche Wand senkte sich nach Süden unter dem
Anprall eines gewaltigen Brechers, und die Hütte krachte zusammen
wie ein Kartenhaus. Hoch spritzte das Wasser auf, silbrig im
Schwarz der Schlucht. Roland wurde über das Dach gespült.
Verzweifelt klammerte er sich am Rand fest und zog sich wieder
hoch. Ein Schwall schmutzigen Wassers peitschte ihm ins Gesicht
und warf ihn wieder an den Rand des Daches, das aus Planken
bestand, die auf zwei Streben genagelt waren. Abermals schluckte
Roland Wasser. Teile der Hütte trieben auf dem schäumenden
Wasser. Eine Woge, die sich an einem stehengebliebenen Eckpfosten
brach, spülte über Roland hinweg. Die Bretter unter ihm wurden
hinabgedrückt und wieder emporgehoben. Etwas krachte durch das
Gurgeln und Rauschen. Das Dach war gegen irgendein Hindernis

geknallt. Ein Teil brach ab. Eine Woge erfaßte Roland und
schleuderte ihn mitsamt dem halben Dach weiter. Ein Schrei neben
ihm ging im Tosen unter. Roland sah eine hochgereckte Hand, die in
einem Wasserwirbel verschwand. Ein Schatten trieb vorbei. Ein
schwimmendes Pferd rammte gegen das Stück des Daches, auf dem
er sich festklammerte. Irgendein Pfahl oder Pfosten wirbelte hoch
und schlug neben Roland ein.
Er fühlte sich auf dem Stück Dach wie auf einem winzigen Floß
inmitten einer sturmgepeitschten See. Und dann ging ein gewaltiger
Stoß durch das Floß. Roland wurde emporgewirbelt. Er sah eine
dunkle Wand förmlich auf sich zurasen und riß im Reflex noch die
Arme vors Gesicht. Dann prallte er auf, und schlagartig wurde es
noch dunkler um ihn. Totenstille umgab ihn.
Er spürte nicht mehr, wie er auf das Stück Dach zurückfiel, das
gegen die Felswand gekracht war und jetzt nur noch halb so groß
war...
*
Ein Plätschern und Rauschen. Wasser.
Roland überlegte, wo er sein mochte. Vermutlich auf See. Er
dachte nach, wie er dahin gekommen sein mochte. Irgendwo lachte
eine helle Stimme. Roland öffnete blinzelnd die Augen. Er glaubte
eine Nixe zu sehen. Eine lächelnde Nixe mit Grübchen in den
Mundwinkeln. Dann erschrak Roland. Ein furchterregendes Gesicht
tauchte über ihm auf. Ein Seeungeheuer? Ein Klabautermann?
»Na also«, sagte der Klabautermann zufrieden. »Er ist wieder auf
der Erde.«
Erde? Roland öffnete die Augen weit. Das Schwindelgefühl ließ
nach. Jetzt verspürte er Schmerzen. Unbewußt tastete er zum Kopf.
Eine große Beule an der Stirn. Auch Arme und Schultern
schmerzten.
Was war geschehen?
Er blickte sich um. Der Klabautermann grinste. Die Nixe strahlte
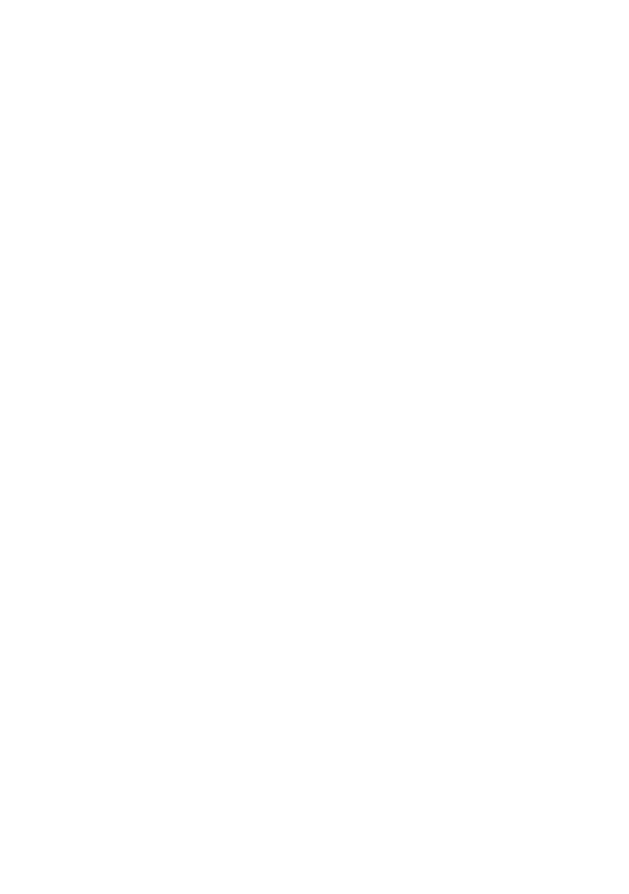
ihn an. Und da waren noch zwei Seefahrer, die ihm irgendwie
bekannt vorkamen. Einer trug einen weißen Turban, auf dem sich ein
rötlicher Fleck abzeichnete - Blut. Doch der schwarzbärtige Kerl
feixte auf Teufelkommraus. Und der andere, der mollige Blonde, sah
ihn an wie ein Kind, das gerade ein besonders schönes
Geburtstagsgeschenk bekommen hat - halb hingerissen zwischen
Lachen und Freudentränen.
Das Gesicht kannte er. Das war doch - »Pierre!« murmelte Roland
und wunderte sich, daß seine Stimme so krächzend klang.
»Ich bin auch da«, brummte der Schwarzbart Louis.
Und der Klabautermann zauberte von irgendwoher eine Flasche
und setzte sie Roland an die Lippen. Roland schluckte und mußte
husten. Das war kein Wasser, sondern ein scharfer Obstschnaps.
Rolands Augen füllten sich mit Tränen ob des starken Gebräus.
»Ritter heulen nicht«, sagte der Klabautermann grinsend, und jetzt
fiel Roland ein, daß es Albert war. Und die Nixe ...
Helga kniete sich neben ihn und legte eine sanfte Hand auf seine
Stirn.
»Ich dachte - wir dachten - du seist - tot«, stammelte sie. Ihr Kopf
sank auf seine Brust, und ihre Schultern zuckten.
Jetzt fühlte sich Roland auf einmal recht lebendig.
Seine Erinnerung setzte ein.
»Nun erdrück ihn nicht noch«, sagte Albert, umfaßte seine
zierliche Schwester und zog sie von Roland fort. »Laß ihn lieber
noch einen hiervon zur Brust nehmen.«
Er setzte Roland wieder die Flasche an die Lippen. Diesmal war
Roland gewarnt. Er trank einen tiefen Schluck. Eine wohlige Wärme
durchflutete ihn. Erst jetzt merkte er, daß seine Kleidung naß war
und auch die anderen aussahen, als seien sie in voller Montur baden
gegangen.
Er stemmte sich auf, als Albert die Flasche zurückzog.
»Wer hat mich aufgefischt?« fragte er.
»Ich«, erklärte Albert grinsend. »Du hattest eine Menge Wasser
geschluckt und warst ziemlich lädiert.«

»Danke«, sagte Roland.
Er fühlte sich noch schwach auf den Beinen.
»Und Wittich?« fragte er.
»Tot«, sagte Albert. »Nicht genau zu sagen, ob er sich den Schädel
einschlug oder ertrank. Vermutlich beides. Du kannst ihn dir
ansehen, wenn du willst.« Er wies aus der Höhle.
Erst jetzt bemerkte Roland, daß es draußen hell und längst Tag
war.
»Ich habe lange hier gelegen«, stellte er fest.
»Ein paar Stunden schon«, sagte Albert. »Aber mein
Schwesterherz war bei dir. Sie hat uns sofort gerufen, als du dich
regtest. »Erzähle«, forderte Roland Albert auf.
»Dieser Anblick spricht wohl für sich«, sagte Albert und wies aus
der Höhle. »Es ist alles vorbei.« Er gab Louis und Pierre einen Wink.
»Laßt euren Ritter mal gucken.«
Roland war noch wacklig auf den Beinen. Louis und Pierre
stützten ihn. Sie führten ihn bis zum Rand der Höhle.
Der Anblick sprach in der Tat für sich.
Ein glatter ruhiger See füllte die gesamte Schlucht aus. Er wurde
von Wasserfall und Bach gespeist und floß durch den südlichen
Zugang der Schlucht ab. Auf der Wasseroberfläche schwammen
Baumstämme. Auf die Stämme waren Männer gefesselt. Die Räuber.
Sie lagen mit dem Rücken auf den Stämmen und blickten gen
Himmel.
»Unsere besten Schwimmer haben sie aufgefischt«, erklärte Albert.
»Es gab keinen Kampf mehr. Die Kerle waren von der Sturzflut zu
sehr durcheinandergewirbelt. Wir wollten dich nicht in der Höhle
stören, deshalb lagerten wir sie erst einmal hier. Sie werden gleich
abgeholt. Meine Freunde werden sie bei der Polizei abliefern, auf
daß sie für ihre Missetaten büßen.«
Rolands Augen weiteten sich, als sein Blick auf einen der Männer
fiel. Der kahle Schädel des Mannes war voller blutroter wulstiger
Narben. Als sei der Mann im Feuer umgekommen. Eingetrocknetes
Blut bedeckte sein Gesicht, das eine verformte Masse mit kaum noch

erkennbaren Zügen war.
»Das ist - beziehungsweise war Wittich«, erklärte Albert, der
Rolands Blick gefolgt war. »Sieht schlimm aus, nicht wahr? Als ich
ihn aus dem Wasser zog, hielt ich plötzlich seine Perücke und einen
falschen Bart in der Hand. Noch einen Schluck? Er hielt Roland die
Flasche hin. Roland trank. Er fühlte sich unsagbar erleichtert. Das
Grauen war vorüber.
*
In Peterzell, in Wöhrles Gasthof, gab es ein rauschendes Fest mit
bestem Speis und Trank und Tanz. Ganz Peterzell nahm an der Feier
teil, und man war froh, daß Ritter Roland nicht nachtragend war und
allen verzieh, wie übel man ihm mitgespielt hatte. Zu vorgerückter
Stunde, nach Spätzle vom Brett und gefüllten Kalbsröllchen mit
Pfifferlingen, nach Zwiebelkuchen, badischem Wein und Bier und
Met, nach viel Musik und Tanz und Frohsinn, ergriff plötzlich der
Kutscher Paul das Wort. Er hatte den ganzen Abend über mit
Roswitha geschäkert, die wie ihre Gefährtinnen diesmal keine
Nonnentracht trug und sich auch nicht wie eine Betschwester
benahm. In weinseliger Laune hielt Paul eine kleine Ansprache. Es
war fast wie eine Ballade von Volker vom Hohentwiel, dem
berührten Minnesänger. Doch Paul sang sie nicht zum Klang einer
Fiedel oder Laute. Er konnte weder singen noch fiedeln, und seine
Schilderungen waren recht derb in der Sprache. Doch die gebannt
lauschenden Zuhörer sahen großzügig darüber hinweg. Zu spannend
und unfreiwillig komisch war Pauls Schilderung. Er berichtete von
falschen Nonnen und richtigen Räubern, von Wittich und seinen
Missetaten und von allem, was ihnen in der Gefangenschaft
widerfahren war. Dann dankte er den Rettern, was Hochrufe zur
Folge hatte, fügte scherzend hinzu, daß die Retter durch ihr
unerwartetes Auftauchen beinahe alles vermasselt hätten, was
Buhrufe zur Folge hatte, und sagte anschließend mit vom Wein
schwerer Zunge: »Und jetzt, Freunde, brauchen wir uns nur noch den

Schatz zu holen.«
Es wurde so still, daß man einen der Zecher furzen hören konnte,
der ganz leise und heimlich einen Wind hatte ablassen wollen.
Empört blickte der Furzer seinen Nebenmann an, auf den sich darob
die tadelnden Blicke konzentrierten.
Dann starrten alle Paul an, und er grinste in die Runde wie ein
Hahn, der sich gerade als der Neue auf einem Hühnerhof vorgestellt
hat.
Ein Heidenspektakel entstand. Alle redeten aufgeregt
durcheinander. Die Aufregung drehte sich um den sagenhaften
Schatz aus dem Morgenland. Mancher der Gefangenen hatte ob der
Freude, frei zu sein, gar nicht mehr an den Schatz gedacht - ein
Beweis dafür, daß das Leben wichtiger ist als alle Schätze der Welt.
Und die Bewohner von Peterzell wußten noch gar nichts davon. Alle
wurden wie von einem Fieber erfaßt. Man schmiedete Pläne, wie der
Schatz zu heben sei. Man wollte einen neuen Staudamm bauen, und
man teilte bereits den Reichtum auf, was manchen Streit vom Zaun
brach.
Schließlich verschaffte sich ein Mann Gehör. Er trat hervor und
hob eine Hand, bis alle verstummten.
»Hört, was euch Sigismund, der Poet, zu sagen hat!« rief er.
Er war ein mittelgroßer, lustig aussehender Mann. Er hatte einen
roten Vollbart, der von weißen Haaren durchzogen war. Im
Gegensatz zu seiner Bartfülle war das dünne Haupthaar schon ein
wenig gelichtet, und an einigen Stellen schimmerte die Kopfhaut
rosig hervor. Die grünbraunen Augen funkelten listig.
Er lächelte, schwieg noch einen Augenblick, wohl um die
Spannung zu steigern, und sagte dann in die erwartungsvolle Stille:
»Es gibt keinen Schatz.«
Verblüffung, Betroffenheit, Ungläubigkeit.
»Woher wollt Ihr das denn wissen?« fragte Roswitha.
»Weil ich den Schatz nur erfunden habe«, sagte Sigismund.
Stille.
»Nun werdet ihr euch alle fragen, warum ich das getan habe«, fuhr

Sigismund heiter fort »Ich will es euch sagen. Zum einen habe ich
den Schatz erfunden weil ich ein Dichter bin, und Dichter erfinden
nun mal die tollsten Dinge.«
Einige der Zuhörer lachten.
»Und zum anderen...«, fuhr Sigismund fort, und seine Miene
wurde ernst, »...weil ich nicht sterben wollte.«
Er legte eine wohlberechnete Pause ein, bevor er weitersprach.
»Ich war einer der ersten Gefangenen Wittichs. Genau gesagt der
dritte. Wittichs Räuber schnappten mich beim Beerensammeln und
schleppten mich zu ihrem Anführer. Er wollte gerade zwei Männer
umbringen lassen, zwei Kutscher, deren Wagen mit der Fracht von
seinen Haderlumpen erbeutet worden war. Und mich hätte er dazu
getötet, weil ich sein Versteck kannte. Da erzählte ich ihm das
Märchen, das ich zu Papier gebracht hatte - die Geschichte vom
Schatz aus dem Morgenland. Ich tat zerknirscht und behauptete, ich
sei auf der Suche nach diesem Schatz gewesen. Ich bot ihm die
Aufzeichnungen gegen mein Leben. Wittich konnte lesen, und er las,
was ich erfunden hatte. Er ließ mich und die beiden Kutscher am
Leben und schickte seine Mannen fortan aus, um Gefangene zu
machen, die den Staudamm errichten sollten. So hatte ich mir das in
meiner Not natürlich nicht gedacht, doch es ließ sich nicht
rückgängig machen. Ich konnte nur hoffen, daß uns irgendwann
jemand befreite - bevor Wittich und seine Räuber zwangsläufig
festgestellt hätten, daß ich sie hereingelegt hatte.«
Er zog einige gefaltete Papiere aus seinem Wams und hielt sie
hoch. »Dies ist die Geschichte, die ich zu Papier brachte. Für einen
Dukaten schreibe ich sie jedem ab, der sich dafür interessiert.«
Die allgemeine Spannung löste sich. Die beiden ersten Gefangenen
Wittichs drückten dem Dichter bewegt die Hand. »Ich zahle fünf
Dukaten für die Geschichte«, rief einer. Und bald wurde Sigismund
mit Bestellungen nur so überhäuft.
»Das erste Mal, daß jemand für meine Dichtung anständig
bezahlt«, sagte Sigi grinsend.
»Der wird noch ein berühmter Mann«, brummte Louis und

zwinkerte Almuth zu. Sie hatten sich für später im Walde verabredet.
»Einfallsreich ist er«, murmelte Pierre und lächelte Edeltraut an. Er
hatte sich angeboten, sie später nach Hause zu begleiten, und zum
ersten Mal seit sie vom Tode ihres Vaters erfahren hatte, hatte sie
wieder gelächelt.
»Und auch geschäftstüchtig«, sagte Ritter Roland zu Helga.
»Möchtest du, daß ich ein Exemplar bestelle und dir schenke?«
»Danke, Roland. Lieber jedoch möchte ich, daß du mich gleich
zum Hof begleitest und mir etwas anders schenkst.«
Und ihr Lächeln ließ keinen Zweifel daran, an welches Exemplar
sie dachte.
ENDE

Die Blutbestie
war ein übergroßer Aar, der im Frankenland sein Unwesen trieb.
Er raubte Schafe und andere Tiere und wagte sich auch an
Menschen heran. Mütter ließen in dem fränkischen Bergdorf
Mainsfeld ihre Kinder nicht mehr nach draußen zum Spielen, die
Gefahr war für die Halbwüchsigen zu groß.
Als König Artus von der mörderischen Blutbestie erfuhr, schickte er
sofort den berühmten Ritter Roland ins Frankenland. Er sollte der
Bedrohung durch den übergroßen Aar ein Ende setzen.
Gemeinsam mit seinen Knappen Pierre und Louis machte
sich Ritter Roland auf die Jagd nach der Blutbestie.
Liebe Abenteuer-Freunde, erleben Sie in 14 Tagen Ritter
Roland, den Kämpfer mit dem Löwenherzen, in Aktion. Holen
Sie s ich den Band 22 bei Ihrem Zeitschriftenhändler. Lassen
Sie sich die nächsten Bände reservieren. DM 1,60
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Ritter Roland 08 Joachim Honnef Gorgar der Tyrann
Ritter Roland 10 Joachim Honnef Die Siegesfeier der Banditen
Ritter Roland 24 Joachim Honnef Verrat!
Ritter Roland 18 Joachim Honnef Hochzeit mit dem Mordgesellen
Ritter Roland 13 Joachim Honnef Das rothaarige Luder
Ritter Roland 25 Joachim Honnef Die Bluthochzeit
Ritter Roland 16 Joachim Honnef Die Bärenfalle
Ritter Roland 23 Joachim Honnef Ein Engel als Köder
Ritter Roland 07 Joachim Honnef Überfall im Morgengrauen
Ritter Roland 19 Günther Herbst Der Racheschwur
Ritter Roland 09 Götz Altenburg Der falsche König Artus
Ritter Roland 03 Ekkehart Reinke Der Kampf mit dem Drachen
Ritter Roland 26 Götz Altenburg Im Rausch der Macht
Ritter Roland 28 Ekkehart Reinke Roland und der Meuchelmörder
Ritter Roland 11 Günther Herbst Bauernaufstand
Ritter Roland 17 Götz Altenburg Hassos wilde Horde
Ritter Roland 06 Günther Herbst Die geteilte Herzogskrone
Ritter Roland 02 Ekkehart Reinke Im Waffenzelt
Ritter Roland 30 Ekkehart Reinke Die Schlacht um Camelot
więcej podobnych podstron