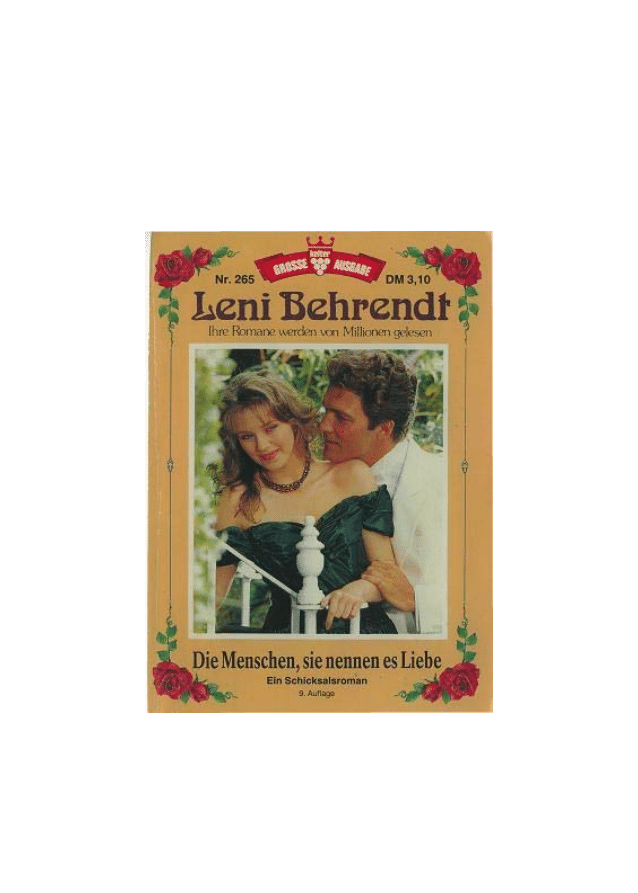
Die Menschen, sie nen-
nen es Liebe
Roman von Leni Behrendt

Diese Ausgabe erscheint alle 4 Wochen im Martin Kelter Verlag (GmbH & Co.), Mühlenstieg 16-22
2 Hamburg 70, Postfach 70 10 09,
Telefon: Sa.-Nr. (040) 68 28 95-0, Fernschreiber: 213.126, Telefax: (040) 68 28 95 50 Verantwortlich:
Verleger Otto Melchert. Im Verkaufspreis ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
Gesamtherstellung: Eisnerdruck, Berlin
Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte übernimmt der Verlag keine Gewähr.
Abgebildete Personen auf dem Umschlag stehen in keinem Zusammenhang mit dem Roman.
Diese Ausgabe darf weder in Leihbüchereien verliehen noch in Lesezirkeln geführt oder zum gewerbsmäßi-
gen
Umtausch bzw. Wiederverkauf verwendet werden.
Printed in Germany

Die Engel, sie nennen es Himmelsfreud, die Teufel, sie nennen es
Höllenleid, die Menschen – sie nennen es Liebe
Heinrich Heine
Der Frühling war gekommen mit lachendem Ungestüm.
Hatte alles hinweggefegt, was noch von dem grimmen
Winter übriggeblieben war, und führte jetzt ein gar lustiges
Regiment. Auf dem großen See, den noch vor kurzer Zeit
eine glitzernde Eisdecke überzog, flutete nun glasklares
Wasser, in dem sich die Bläue des Himmels spiegelte. Über
den Wiesen lag es wie ein grüner Hauch, unterbrochen von
zarten Schneeglöckchen. Im Wald steckten Leberblümchen
sowie Buschwindröschen ihre Köpflein aus dem Moos, und
auf den Gartenbeeten blühte der Krokus.
Und nicht nur in der Natur wirkte der Frühling, er pochte
auch an die Herzen der Menschen und begehrte Einlaß.
Kein Wunder also, daß die junge Reiterin, die mit verhäng-
ten Zügeln durch das sprossende Land ritt, mit jauchzender
Stimme sang:
»Der Frühling ist gekommen mit all seiner Pracht.«
Und ebenso jauchzend kam von irgendwoher die Fortset-
zung des Liedes:
»Es läuten die Glocken fern und nah, sie wollen frohlok-
ken, der Lenz ist da!«
Verblüfft schaute das Mädchen, das gerade in den Wald
reiten wollte, um sich, aber nirgends konnte es einen Men-
schen entdecken.
Doch bevor es sich noch von seiner Verblüffung erholen
konnte, rief eine Männerstimme neckend:
»Such mich doch, du kühne Amazone! Oder bist du gar die
Elfenkönigin in Person, die blonde Frau auf deinem wei-
ßen Roß?«
»So sehe ich gerade aus!« rief sie zurück. »Und jetzt treten
Sie endlich in Erscheinung!«
»Das kann ein Waldgeist nur um Mitternacht. Wenn du
dich dann herbemühen wolltest, du bezauberndes Men-

schenkind.«
»Dann würde ich wohl die Bekanntschaft eines kecken Er-
densohnes machen«, unterbrach sie ihn lachend – und
horchte auf, als dieses Lachen wie ein fröhliches Echo zu-
rückklang. Also mußte sich in der Gesellschaft des Mannes
auch noch ein weibliches Wesen befinden. Allein, so große
Mühe sich die Reiterin auch gab, die beiden Menschen in
ihrem Versteck zu erspähen, es gelang ihr nicht. Das wurde
ihr denn doch zu gruselig. Also machte sie kehrt, ritt davon
und hinter ihr lachte man ein herzliches Duett. Dann hob
der Mann in dem Versteck das Fernglas und schaute lange
der Reiterin nach.
Er ließ das Glas sinken. »Wohin mag es gehören?«
»Das wirst du schon noch erfahren«, entgegnete seine Be-
gleiterin achselzuckend. »Und jetzt komm endlich hier
heraus, du närrischer Kerl. Warum überhaupt das ganze
Versteckspiel?«
»Schwesterchen, sei nicht so ungehalten«, lachte er ver-
gnügt. »Du weißt doch, daß wir uns auf Schleichpfaden
bewegen müssen.«
»Na, schön«, gab sie gleichfalls lachend zurück. »Also
schleichen wir. Aber zuerst einmal aus diesem Dickicht
heraus.«
Kurz darauf hatten sie die glatte Straße erreicht, auf der nun
die Reiterin ihr Roß nach den heimatlichen Gefilden lenk-
te. Auf dem großen Gutshof eilte ihr ein Stallbursche ent-
gegen, der den rassigen Trakehner in Empfang nahm.
»Reibe ihn gut ab, Heinz, ich glaube, er hat es nötig.«
»Wird besorgt, Komteß«, verhieß der Jüngling eifrig.
»Komm, Schloh, sollst eine Handvoll Hafer extra haben.«
Damit trollte er mit seinem Schützling dem Stall zu, indes
die Herrin zum Schloß ging. Auf dem weiten Rasen sprühte
eine Fontäne glitzernd empor.
Ein feudales Zuhause, das die Komteß Thorbrandt ihr eigen
nannte, sich dessen jedoch nicht so recht bewußt war, weil
vom ersten Schrei an diese Atmosphäre sie behütend um-
schloß.

Gemächlichen Schrittes stieg sie die Freitreppe hinauf,
durchquerte die riesige Halle und betrat ein weites Ge-
mach, in dem ihre Angehörigen geruhsam saßen. In dem
Marmorkamin flackerte ein helles Feuer; denn trotz der
milden Frühlingsluft draußen war es in den hohen Räumen
immer noch kühl.
»Grüß Gott, ihr Stubenhocker!« rief sie fröhlich. »Wie kann
man nur bei dem herrlichen Frühlingswetter im weichen
Pfühl des Sessels ruhen! Drückt lieber den Sattel, wie auch
ich es tat.«
»Das tun wir schon an den Arbeitstagen zur Genüge.« Der
Vater betrachtete schmunzelnd sein holdes Töchterchen.
»Heute jedoch ist Sonntag, mein Fräulein Naseweis.«
»Na, schön«, meinte sie friedfertig, indem sie in der trauten
Runde Platz nahm. »Und nun hört, was ich erlebte.«
»Mutig hast du dich gerade nicht benommen, Schwester-
lein. Anstatt das Versteck des Kecken aufzuspüren, sahst du
dein Heil in der Flucht.«
»Dafür bin ich ja auch ein Mädchen«, gab sie schlagfertig
zurück. »Denen steht es schon zu, die Vorsicht als Mutter
der Wahrheit zu betrachten.«
»Recht so, Marjellchen«, bekräftigte der Vater. »Was man
sieht, dem darf man sich beherzt stellen. Was im Versteck
lauert, dem geht man am besten aus dem Wege.«
»Will ich meinen«, nickte die Gattin, eine Dame von noch
jugendlichem Aussehen. Die Gestalt wirkte mädchenhaft
das Antlitz zart und fein. Durch das wohlfrisierte Haar von
sattem Blond zog sich noch kein grauer Faden, die Augen
leuchteten in tiefem Blau.
Jedenfalls war Gräfin Herma die passende Ehehälfte zu
ihrem distinguierten Gatten, dem rassigen Herrenmen-
schen in edlem Sinne. Der Sohn, sein verjüngtes Ebenbild,
würde nach drei Jahrzehnten wahrscheinlich genauso aus-
sehen wie sein Vater heute. Auch charakterlich glichen sie
sich auffallend mit ihrem herrischen Wesen und den har-
ten Köpfen, wie Frau Herma lachend behauptete.
Trotzdem hatte es noch keine ernstliche Differenz zwischen

Vater und Sohn gegeben. Dazu achteten und liebten sie
aneinander viel zu sehr, waren die besten Freunde und
Kameraden. Und nur deshalb, weil der ältere klug genug
war, auch einmal dem jüngeren da nachzugeben, wo ihre
Ansichten sich teilten.
Da nun auch die Gatten eine gute Ehe führten, wuchsen
ihre beiden Kinder in einer Atmosphäre voll Harmonie auf.
Sie waren stolz auf ihre schönen, wohlgeratenen Kinder
und diese wiederum stolz auf ihre Eltern. Die Seele des
Hauses war die Mutter, der Verzug jedoch das liebreizende
Töchterlein mit dem feinen Gesichtchen und den sonnen-
hellen Haaren. Wie ein Vöglein auf dem Ast wuchs es auf,
stets frohgemut und guter Dinge. Treu behütet und umhegt
von den Eltern und dem um zehn Jahre älteren Bruder.
Sich und ihren Kindern ein trauliches Zuhause zu schaffen,
danach hatte das gräfliche Paar gestrebt. Wer weiß, was das
Schicksal für sie in Bereitschaft hielt und wo Elternliebe
nicht mehr ausreichte, um sorgend einzugreifen. Da sollten
wenigstens ihre lieben beiden die ersten Jahrzehnte ihres
Daseins unbekümmert durchleben.
Die Eltern hatten sich auch vorgenommen, in die Heirats-
absichten ihrer Kinder nicht dreinzureden. Mochten sie die
Wahl nach ihrem Ermessen treffen. Daß sie auf Unwürdige
fallen würden, war ihrer ganzen Veranlagung gemäß kaum
zu befürchten. Um Geld freien sollten sie nicht. Hatte Graf
Albrecht es ja auch nicht getan, obwohl es gerade damals
um die Herrschaft Güldenrode, den ausgedehnten Besitz
der Grafen Thorbrandt, nicht gut stand und sich der Freier
eigentlich nach einer reichen Erbin hätte umsehen müssen.
Er folgte seinem Herzen. Eine glückliche Ehe, die dreißig
Jahre währte.
Graf Albrecht, dem sein Vater einen verschuldeten Besitz
hinterließ, mußte sich arg plagen, um ihn halten zu kön-
nen. Aber er verzagte nicht, rang verbissen um das Erbe
seiner Väter. Später erwuchs ihm in seinem Sohn ein treuer
Helfer, und sie schafften es so weit, daß Soll und haben
einigermaßen die Waage hielten. Was nur irgend ging,

wurde in den Besitz gesteckt, für das Leben der Familie nur
soviel verbraucht, wie es einer verfeinerten Lebensart ent-
sprach und einem kultivierten Menschen zukam.
Nun waren der junge Graf Randulf bereits achtundzwanzig
Jahre und das Komteßchen Heidgar achtzehn Jahre alt ge-
worden. Es wäre manches Mädchen gern als junge Herrin
in das Schloß eingezogen, sogar eine schwerreiche Erbin
befand sich darunter. Auf des Vaters Frage, ob ihm das
Goldfischchen denn gar nicht genehm sei, antwortete er
ironisch:
»Wenn ich mich schon vor Gold beugen soll, dann nur vor
dem Gold im Herzen, und davon dürfte die junge Dame
wenig aufzuweisen haben. Außerdem bist du mir ja bei der
Wahl deiner Eheliebsten mit gutem Beispiel vorangegan-
gen, Vater.«
»I, du Schlingel!« hatte der schmunzelnd gedroht und ge-
rade in dem Augenblick deutlich gespürt, wie sehr der Sohn
Blut von seinem Blut war.
Komteßchen Heidgar hatte sich über die Liebe noch nie
ernstlich ihr reizendes Köpfchen zerbrochen. Noch ganz
unberührt von dem Gefühl, das, ganz den Umständen ge-
mäß, höchste Seligkeit oder tiefsten Schmerz heraufbe-
schwören konnte, lebte es dahin. Es war vor etwa vier Jah-
ren, als die Kleine zu den Ihren trat und der Mutter ein
Büchlein hinhielt, in dem allerlei Aussprüche standen.
Darunter auch dieser, auf den der rosige Finger tippte:
Die Engel, sie nennen es Himmelsfreud,
die Teufel, sie nennen es Höllenleid,
die Menschen – sie nennen es Liebe.
»Warum das, Mutti? Ist Liebe denn nicht einfach Liebe?«
hatte die Vierzehnjährige gefragt, und zärtlich hatte die
Mutterhand über die reinen, klaren Augen gestreichelt.
»Um das zu begreifen, bist du noch zu jung, mein Liebling.
Der Herrgott möge geben, daß du dieses allmächtige Ge-
fühl nur als Himmelsfreud kennenlerntest.«

»Hast recht, Mutti, das ist mir auch wirklich zu hoch«, er-
folgte die lachende Antwort. »Wirst leben, wirst sehen, sagt
Nanni, somit tue ich also.«
Nanni war etwas, was aus der Familie Thorbrandt einfach
nicht weggedacht werden konnte, ebensowenig wie ihr
Mann und deren beider Tochter Annette. Man hatte Nanni
einst als Pflegerin zu dem Baby Randulf ins Schloß geholt,
das sie so lange liebevoll betreute, bis sich der Abc-Schütze
stolz der gar zu betulichen Obhut der Getreuen entzog.
Und als diese tiefbetrübt von dannen ziehen wollte, bot ihr
der Diener Herz und Hand, und man gewann mit David
und Nanni ein treues Dienerehepaar, das seiner Herrschaft
mit jedem Tropfen Blut ergeben war. Nannis Freude war
grenzenlos, als ihre vergötterte Frau Gräfin mit ihr zugleich
niederkam und gleich ihr einem Mädchen das Leben gab.
Ehrensache für Nanni, das Komteßchen mit dem eigenen
Töchterchen zusammen an die treue Brust zu nehmen, die
beiden Kindlein zu hegen und zu pflegen. Auch jetzt be-
trachtete sie Heidgar immer noch als ihr »Kindchen«, liebte
sie ebenso wie ihre Tochter Annette, die gutgeschult, als
niedliche Zofe vorbildlich treu ihr Amt versah, während die
Frau Mama als Beschließerin fungierte.
So lagen die Verhältnisse an dem Tage, da Heidgar von
Thorbrandt ihr kleines Erlebnis am Rand des väterlichen
Waldes hatte.
Der griesgrämige April, begann sich langsam zurückzuzie-
hen, um den Mai jubelnd zu empfangen. Es blühte in dem
Park von Güldenrode verschwenderisch. Die Zeit war ge-
kommen, da sich an Sonnentagen das Leben auf der Ter-
rasse abspielte, wo man die Mahlzeiten einnahm und sich
in den Ruhestunden auf Liege- oder Schaukelstühle wohlig
rekelte.
Dieses konnten sich die beiden Grafen Thorbrandt aller-
dings nur an Sonntagen oder während der Ruhepausen der
Alltage erlauben. Sonst gab es für sie strammen Dienst im
Wirtschaftsbereich, weil die Frühjahrsbestellung der Äcker
drängte. Vater und Sohn kamen kaum aus dem Sattel, denn

wo das Auge des Herrn fehlte, da werden die Kühe nicht
fett, sagte eine alte Bauernregel.
Danach hatte sich Graf Albrecht stets gerichtet, und der
Sohn Randulf folgte seinem Beispiel. Sie taten es beide
gern, und was man gern tut, wird nie zur Last, schon gar
nicht, wenn man dem Beruf eines Landwirts mit Leib und
Seele verfallen ist.
Also ein Glück für Güldenrode, daß auch der junge Gebie-
ter der geborene Landwirt war. Und sehr günstig obend-
rein, daß er nebst der landwirtschaftlichen Hochschule
auch die für Tierheilkunde absolvierte. Sogar den »Dr. med.
vet.« durfte er führen, worauf er jedoch keinen Wert legte.
Die Hauptsache für ihn war, daß er das erkrankte Vieh
fachmännisch betreuen und daher manch eine Mark an
Tierarztkosten sparen konnte. Das kam Güldenrode sehr
zugute.
»Unser junger Graf hat nicht nur einen schönen, sondern
auch einen klugen Kopf«, pflegte Nanni zu sagen, wobei ihr
der Stolz nur so aus den Augen leuchtete. Auch etwas
Überheblichkeit zeigte sich dabei. War sie es doch, die ihr
»Dulfchen« in seinen ersten Lebensjahren betreute.
Und gar ihr »Heidchen«, dem sie Amme sein durfte! Na, so
was Herzliches, Schönes und Kluges wies die Welt zum
zweitenmal nicht auf.
Augenblicklich lag dieses »Wunder« auf der Terrasse im
Schaukelstuhl, wippte darin vergnügt und summte ein
Liedlein vor sich hin. Mutter und Sohn ruhten in Liege-
stühlen, hielten die Augen geschlossen und ließen sich von
der Frühlingssonne bescheinen. Hauptsächlich Randulf
genoß die Ruhe des Sonntagnachmittags mit allen Sinnen.
Im Park zwitscherten die Vögel, von den Weiden her klang
das gemütliche Brummen der Rinder.
»Oft schon erlebt und doch immer wieder neu – o du son-
nige, wonnige Frühlingszeit!«
»Das laß ich mir gefallen«, riß eine frohe Männerstimme
die drei vor sich hin duselnden Menschen hoch. Im Nu
stand die Gräfin auf den Füßen, lächelte den Gatten an, der

sie liebreich umfing.
»Albrecht, wir haben dich erst morgen erwartet.«
»Das klingt ja fast bedauernd«, lachte er herzlich. »Laß gut
sein, dein treuer Vasall sehnte sich nach seinem trauten
Zuhause und entfloh daher der landwirtschaftlichen Ta-
gung, als sie abgeschlossen war. Gern überließ ich den an-
deren die feuchtfröhliche Feier danach.«
Mit einem behaglichen Schnaufer ließ er sich in den näch-
sten Liegestuhl sinken.
»Wie war's, Vater?« fragte Randulf. »Gibt es was Besonderes
zu berichten?«
»Was uns Landwirte im eigensten Interesse betrifft, wohl
kaum«, kam die Antwort gemächlich. »Die klugen Reden,
die da verzapft wurden, sind längst überholt. Aber hinter-
her gab es etwas, das die Gemüter sämtlicher Landwirte in
unserem Kreis bewegte – und zwar, daß Marstein wieder
einmal den Besitzer gewechselt haben soll.«
»Und wer ist das?« fragte der Sohn interessiert dazwischen.
»Ein Mann namens Nor aus Chile, wie einige es ganz genau
wissen wollten – hauptsächlich unser Präses der >Clique<,
und der pflegt erst etwas zu verbreiten, was er genau weiß.
Also wird es schon stimmen. Und der Mann heißt Nor.«
»Du meinst doch nicht etwa, Albrecht…?«
»Genau das meine ich, Herma. Setze die Silbe >hell< davor,
dann gibt es den Namen Hellnor.«
»Und der sagt dir was, Paps?« Das Komteßchen, dem die
Neugierde förmlich aus den Augen sprang, gab dem Schau-
kelstuhl so einen Schwung, daß er fast vornüber gekippt
wäre.
»Ja, dann muß ich wohl«, seufzte der Vater, »obwohl ich
ungern die alte und traurige Geschichte aus ihrer Versen-
kung hebe. Aber es ist wohl besser, wenn auch du es weißt,
was vor fast fünf Jahrzehnten die Gemüter der Menschen
hier im Umkreis bewegte und erregte, was mein damaliges
Kinderhirn allerdings noch nicht ganz zu fassen vermochte.
Was ich daher erzählen werde, weiß ich von meinem Vater.
Schon zehn Jahre vorher, es mögen auch elf sein, gab es in

unserer Gegend schon eine Sensation, von der ich persön-
lich gar nichts weiß, weil ich damals ja noch gar nicht ge-
boren war.
Aber ich will der Reihe nach erzählen:
Schon von altersher hielten die Thorbrandts und die Hell-
nors miteinander nicht nur treue Freundschaft, sondern sie
versippten sogar, weil vor sechs Generationen ein Thor-
brandt eine Hellnor freite. Erstere saßen auf Goldenrode,
letztere auf Marstein, das, wie du siehst, an unsern Besitz
grenzt. Allein, diese Grenze blieb unbeachtet, weil man
sich als große Familie betrachtete.
Bis dann diese herzliche Gemeinschaft in Haß umschlug –
und zwar, als mein Vater und Eitel Hellnor gemeinsam in
Liebe zu einem Mädchen entbrannten. Die Heißumstritte-
ne zog den leichtlebigen und liebenswürdigen Eitel vor,
wahrscheinlich, weil er ihr mehr bieten konnte, als Heri-
bert Thorbrandt, dessen Vater Güldenrode durch seinen
Leichtsinn heruntergewirtschaftet hatte, während die Herr-
schaft Marstein gut fundiert dastand.
Kurz und gut: Seit dem Tage, da Eitel Hellnor die Liebste
heimführte, lebten die Vettern, die bisher ein Herz und
eine Seele gewesen, in erbitterter Feindschaft. An der Gren-
ze zwischen Güldenrode und Marstein wuchs eine unsich-
tbare Mauer empor. Wo sie sich als Nachbarn nur schädi-
gen konnten, taten sie es.
Das war vor sechs Jahrhunderten und nun weiter:
Ein halbes Jahr später als sein Vetter Eitel, heiratete auch
mein Vater ein gutes, sanftes Geschöpf, das die liebeleere
Ehe mit rührender Geduld ertrug. Ich entsinne mich mei-
ner Mutter nur schwach, da sie sechs Jahre später, nachdem
sie ihre Pflicht getan und dem alten Geschlecht den Erben
geboren hatte, ihre müden Augen für immer schloß. Ich
lebte nun an der Seite des verbitterten, wortkargen Mannes
freudlos dahin.
Warum mein Vater den Haß gegen den Vetter immer weiter
nährte, werde ich nie begreifen können. Es hätte ihm doch
eine Genugtuung sein müssen, daß die junge Herrin von

Marstein gewiß nicht das ideale Wesen war, als das seine
blindverliebten Augen es einst betrachteten. Denn nach
und nach entpuppte sich die schöne Jenny als oberflächli-
che, leichtsinnige Frau, die es sogar fertig bekam, das gut-
fundierte Marstein durch ihre Verschwendungssucht zu
ruinieren. Als es so weit war, verschaffte sie sich Geld auf
ihre Art, wechselte oft ihre Galane, bis man sie eines Tages
im Park von Marstein erschossen auffand…«
»Großer Gott, das tat doch nicht etwa ihr Mann!« rief
Heidgar entsetzt dazwischen.
»Das nahm man allgemein an, mein Kind, natürlich auch
dein Großvater. Als sein Vetter ihn in der Verzweiflung
aufsuchte, wies er den verstörten Mann mit den Worten
von sich, daß es ihm als Edelmann nicht anstehe, einen
Mörder zu schützen, worauf der Beschimpfte ihn verfluchte
und davonrannte.
Tags darauf war er mit seinem Sohn spurlos verschwunden.
Was Wunder, wenn sich der Verdacht um ihn verdichtete,
bis man den richtigen Täter faßte. Es war einer von Jennys
Galanen, der in blindwütiger Eifersucht die treulose Gelieb-
te niederschoß und, als man ihn verhaften wollte, sich
selbst eine Kugel ins Hirn jagte.«
»Und der Großvater?« fragte Heidgar.
»An ihm fraß die Reue, und das Gewissen peinigte ihn Tag
und Nacht. Wie er mir erzählte, hat er alles versucht, um
Eitel Hellnor, an dem er sich so schwer versündigte, aus-
findig zu machen, aber der Mann und sein Kind blieben
verschollen.
Da Marstein schwer verschuldet war, taten sich die Gläubi-
ger zusammen, verkauften den Besitz und teilten den Erlös.
Die kleinen Gläubiger blieben unbeachtet. Jahre später
wurden sie restlos abgefunden, und zwar durch einen An-
walt aus Chile.
Marstein jedoch wechselte sehr oft den Besitz, und aus dem
einst so prachtvollen Gut wurde langsam das verwahrloste
Anwesen. Wenn also dem neuen Besitzer etwas daran gele-
gen ist, wird er sehr viel Geld hineinstecken müssen.

So, und jetzt hol mir mal einen Kognak, Randulf.«
Nachdem er zwei getrunken und eine zweite Zigarre ange-
steckt hatte, schaute er lächelnd zu dem Töchterchen hin.
»Nanu, Kleines, du bist ja ordentlich blaß geworden. Was
bewegt denn dein weiches Herzchen, hm?«
»Ach, Paps«, kam die Antwort kläglich. »Ich möchte am
liebsten weinen. Wie konnte Großvater nur so hart sein.«
»Ja, Kind, so ist nun einmal das Menschenherz, für das von
Liebe bis zum Haß nur ein kleiner Schritt ist. Aber was dein
Großvater gefehlt, das hat er auch gebüßt, das darfst du
nicht vergessen. Es tut mir leid, daß ich dein sonniges Ge-
müt mit so Traurigem belaste, aber es muß sein, damit du
gleich die richtige Einstellung zu dem neuen Besitzer von
Marstein und dessen Anhang findest. Denn es wird sich bei
so naher Nachbarschaft eine Begegnung nicht vermeiden
lassen. Schon damals hieß es in der Umgegend nicht an-
ders als >Thorbrandt contra Hellnor< und es wird wieder
aufleben, sofern ein Hellnor Marstein bezieht. Also ist
größte Zurückhaltung geboten, mein Kind. Man weiß näm-
lich nicht, wie groß der Haß auf uns noch ist. Dir gegenü-
ber brauchte ich das nicht extra zu betonen, nicht wahr,
mein Sohn?«
»Bestimmt nicht, Vater. Um mit Nanni zu sprechen: Wer-
den wir leben, werden wir sehen. Erstens einmal ist es noch
gar nicht gewiß, daß dieser Herr Nor ein Nachkomme des
Hellnor-Marstein ist. Und wenn, kann es sich höchstens
um den Sohn des Baron Eitel handeln; denn dieser dürfte
kaum noch leben. Außerdem weiß man nicht, ob der Sohn
über das tragische Geschick seines Vaters überhaupt unter-
richtet ist, ob er ihm den Haß gegen unser Geschlecht ein-
geimpft hat. Also bin ich dafür, erst einmal abzuwarten.«
»Randulf hat recht«, bekräftigte Heidgar. »Ich jedenfalls
fühle mich frei von aller Schuld. Ich kann ja schließlich
nichts für die Sünden meiner Väter.«
Es kam so komisch heraus, daß die anderen lachen muß-
ten. Und dann sprach der junge Mund das aus, was das
Hirn blitzartig durchzuckte:

»Nun weiß ich auch, was die Engel Himmelsfreud, die Teu-
fel Höllenleid und die Menschen Liebe nennen. Armer
Großvater, du hast die Bezeichnung des Teufels an dir er-
fahren müssen.«
Es schien dem neuen Käufer von Marstein viel daran gele-
gen zu sein, Ordnung auf dem verwahrlosten Anwesen zu
schaffen, denn es wurde emsig darauf gearbeitet. In dem
verwilderten Park herrschte die Axt. Sie schlug alles um,
was da wucherte. Auf hohem Gerüst, das sich um das
schloßartige Herrenhaus zog, standen Maurer und Maler.
In den weiten, hohen Räumen wirkte ein Innenarchitekt
mit seinen Gehilfen, der große Gutshof wurde von allem
Gerumpel befreit – kurz und gut: Es wurde gründlichste
Generalreinigung gehalten.
Natürlich erregte das alles die Gemüter derer, die im Um-
kreis von Marstein wohnten. Man brannte darauf, den
Mann kennenzulernen, der viel Geld haben mußte, um aus
dem verkommenen Besitz einen feudalen zu machen.
Aber ach, zur Betrübnis der Neugierigen blieb dieser Nabob
erst einmal unsichtbar – bis er dann endlich eines Tages
doch in Erscheinung trat: Ein vornehmer Fünfziger, mit
dem sicheren Auftreten des Weltmannes.
Und nun ging das Rätselraten erst recht los. »Was wollte
der mit einem Gut? Darauf gehörte doch ein Landwirt, kein
Geldmann der Börse aus Chile. Sollte er etwa so einen
Spleen haben, einen großen Besitz in Deutschland zu er-
werben?«
Das alles war so aufregend, so sensationell, aber was dann
kam, setzte allem die Krone auf – als dieser »Amerikaner«
sich plötzlich als Sohn des Eitel von Hellnor entpuppte.
Und nun wurden die Großväter des Landkreises plötzlich
zu Helden des Tages. Was sie da erzählten, war einfach
überwältigend. Thorbrandt contra Hellnor, wie prickelnd
interessant! Was nun? Sollte man sich auf die Seite der Gra-
fen Thorbrandt oder auf die der Barone Hellnor stellen?
Am klügsten, man verhielt sich vorläufig neutral.
Denn mit den Thorbrandts, die nun einmal tonangebend
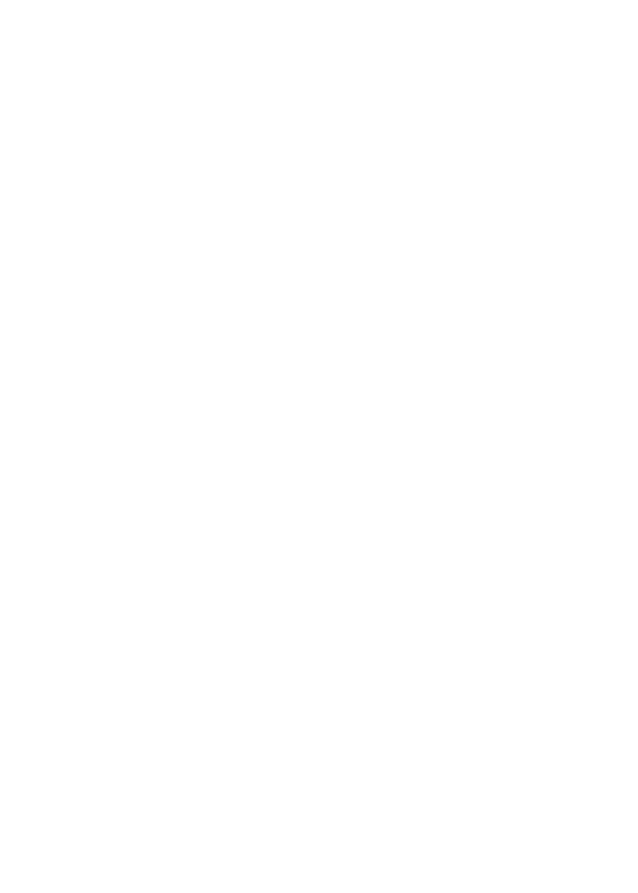
im Landkreis waren und außerdem noch zu der beneideten
»Clique« gehörte, durfte man es auf keinen Fall verderben,
aber mit den Hellnors durfte man es wiederum auch nicht.
Nun, die Qual der Wahl blieb den Leutchen vorerst einmal
erspart; denn es vergingen Sommer und Herbst und immer
wußten sie noch nicht, was eigentlich zwischen den beiden
im Brennpunkt des Klatsches stehenden Familien los war.
Haßten sie sich, waren sie sich gleichgültig – oder standen
sie sich gar freundschaftlich gegenüber?
Sie waren sich keins von allen, sie waren sich zuerst einmal
vollkommen fremd, auch denen, die im Umkreis von Mar-
stein und Güldenrode auf ihren Besitzungen saßen. Selbst
den Großagrariern, die zu der vielbeneideten »Clique« ge-
hörten, ein Kreis der Bevorzugten, wie von einer Felswand
fest ummauert. Würde man die Marsteiner in den exklusi-
ven Kreis aufnehmen? Darüber mußte man sich wieder den
Kopf zerbrechen. Wenn man die »Amerikaner« erst einmal
zu Gesicht bekommen würde! Aber die verkrochen sich ja
auf ihrem jetzt so feudalen Marstein wie der Fuchs in sei-
nem Bau.
Aber es kam auch die Zeit, da man die Vielbesprochenen,
um die sich bereits ganze Märchen zu spinnen begannen,
näher beäugen konnte: Den Herrn von Marstein, der un-
verkennbar alle Anzeichen seines alten Geschlechts trug,
seine Frau, noch jugendlich wirkend und die wirkliche
Dame kennzeichnend, den Sohn, der kein bißchen »ameri-
kanisch«, sondern vielmehr ein echter Hellnor, die Tochter,
ein Bild von Mädchen, elegant gekleidet, aber kein bißchen
übertrieben.
Wie man jetzt genau wußte, besaßen alle vier ihr eigenes
kleines Auto, und den großen Mercedes in Luxusausfüh-
rung steuerte ein hochnäsiger Chauffeur in zwar unauffälli-
ger, aber schmucker Livree. Wo die Marsteiner auch auftau-
chen mochten, überall dienerte man vor ihnen.
Der älteste Sohn des Gisbert Hellnor war aus der Art ge-
schlagen. Der beugte sich vor dem Geld. Daher hatte er die
Angehörigen auch nicht nach Deutschland begleitet, son-

dern war in Chile geblieben und nannte sich nach wie vor
»Nor«. Durch die Mitgift seiner Frau, einer schwerreichen
Erbin vornehmer spanischer Eltern, befand er sich in der
Lage, unabhängig von seinem Vater zu werden. Und als
dieser seiner »Sentimentalität« nachgab und den Entschluß
faßte, das Erbe seiner Väter anzukaufen, um darauf seßhaft
zu werden, da zuckte der Geschäftsmann Frank Nor nur
mitleidig lächelnd die Achsel. Nun, des Menschen Wille ist
sein Himmelreich.
In der Korrektheit, die ihm eigen war, setzte er sich mit
dem Vater auseinander. Er übernahm das Bankhaus, alle
weiteren Unternehmen und zeigte sich durchaus damit
einverstanden, daß der Vater stiller Teilhaber blieb und es
fortan halb auf halb ging. Daß Frank Nor die zweite Hälfte
nie übervorteilen würde, dafür bürgte sein vornehmer Cha-
rakter und die Art des fairen Geschäftsmannes.
Ohne Bedauern ließ er Eltern, Bruder und Schwester zie-
hen. Sie bedeuteten ja nicht sein Glück. Das gipfelte in sei-
ner Arbeit, im Geldverdienen, allenfalls noch im Besitz
seines kleinen Sohnes, des Nachfolgers, und in dem seiner
Frau.
Seltsamerweise schien ihr der Abschied von den Angehöri-
gen ihres Mannes nahezugehen. Es war ihr ernst damit, als
sie versprach, diese in der neuen Heimat bald zu besuchen.
Eben las Gisbert Hellnor einen Brief der Schwiegertochter
vor, dabei über das drollige Deutsch schmunzelnd. Sie be-
diente sich gern der Umgangssprache ihrer Anverwandten,
obwohl ihre deutschen Schwiegereltern das Spanisch tadel-
los beherrschten, deren Kinder ja in Chile geboren waren.
Aber da die kapriziöse Donna Florence geheiratet hatte
»eine deutsche Mann«, und zwar aus Liebe, paßte sie sich
den Gewohnheiten des Hauses Nor mit rührendem Eifer
an. Die Nors sprachen unter sich nur Deutsch.
So wurde in dem Brief betont, daß »ich haben Bangigkeit
nach die liebe Familie«, und wenn ihr Frank nicht wäre, »so
ein schreckliches Geldermensch«, dann würde er »fliegen
mit mich und die Baby in die neue Haus zu Paps und alle

andere Lieblings von meine Herz.«
»Habe ich nicht immer gesagt, daß Florence verkehrt ver-
heiratet ist«, lachte Roger, der zweitgeborene Sohn, nach-
dem der Vater den drolligen Brief gelesen hatte. »Mich hätt
sie nehmen sollen, dann säße sie jetzt unter >aller Lieblings
von ihr Herz<.«
»Wundern würde ich mich nicht, wenn Florence eines Ta-
ges hier anrückt«, meinte Sidonie, die Tochter des Hauses,
ein schönes, rassiges Geschöpf mit dem selbstsicheren Auf-
treten einer reichen Erbin. Gertenschlank gewachsen und
hochbeinig, besaß sie einen trotzigen Mund, der so bezau-
bernd lächeln konnte. Das Haar, von der Farbe dunkelge-
tönten Bernsteins, umbauschte in natürlichen Wellen den
feinen Kopf und ringelte sich zwanglos über den Nacken
hinab. Die Augen kristallklar und blau, anmutend wie der
Spiegel eines kühlen Bergsees, beherrschten das reine Ant-
litz.
Sie konnte manchmal recht hochmütig wirken, die bezau-
bernde Sidonie von Hellnor. Aber um es wirklich zu sein,
hätte sie in einem anderen Hause aufwachsen müssen.
Wer Eitel von Hellnor gekannt hatte und nun dessen Enkel
Roger sah, wäre über die frappante Ähnlichkeit verblüfft
gewesen. Denn genauso hatte Eitel im Alter von sechsund-
zwanzig Jahren ausgesehen. Auch dessen sanguinisches
Temperament hatte Roger mitgekriegt, nur nicht dessen
Leichtsinn. Den merzte das Blut der Mutter, die mütterli-
cherseits einer deutschen Senatorenfamilie entstammte,
aus. Und von diesem Blut hatte der Sohn Frank am meisten
abbekommen.
Frau Cornelia bedeutete in der Familie den Pol, um den
sich alles drehte. Elegant, war sie dem Gatten eine prächti-
ge Ehefrau und den Kindern eine gute Kameradin. Ihr Sohn
Frank nannte sie korrekt Mama, weil es ihm zu respektlos
vorkam, sie einfach Nel zu nennen, wie Bruder und Schwe-
ster es taten. Auch der Vater meinte, daß diese Bezeichnung
ihm allein gebühre. Er hatte zuerst versucht, seine beiden
jüngsten Kinder immer wieder darauf hinzuweisen, doch
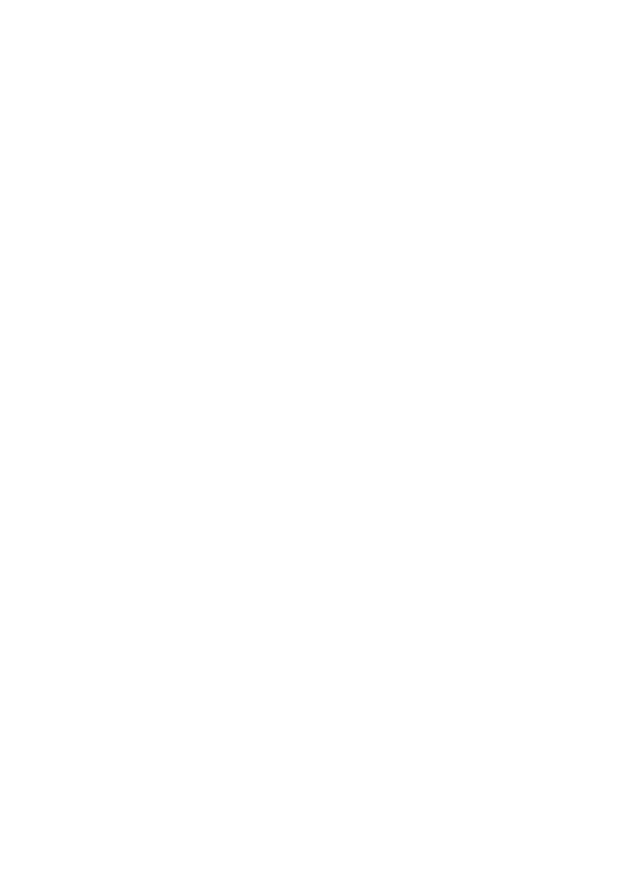
umsonst, sie hielten hartnäckig daran fest. »Mama«, das
besagte ihnen gar nichts. Aber »Nel«, das war etwas, zu
dem man gehen konnte in all seinen Freuden, Nöten, sogar
Torheiten. Der Paps, den man selbstverständlich auch lieb-
te und verehrte, fand doch noch dafür ein strafendes Wort,
einen mißbilligenden Blick, aber Nel, nein, die lächelte
nur. Und dieses Lächeln hatte seine Nuancen: Stolz, kühl,
ironisch, amüsant, gütig, zärtlich – oder auch, wie man es
für einen Menschen findet, der einem herzlich leid tut.
Dieses Lächeln war allein wie ein Schlag ins Gesicht. Sie
brauchte kein Wort zu sagen, die Nel, sie brauchte nur zu
lächeln, dann wußten alle, was die Glocke geschlagen hat-
te.
Gisbert von Hellnor vergötterte seine feine, liebenswerte
Frau, die überhaupt nicht alterte, sondern mit ihren fünfzig
Jahren immer noch wie eine Schwester unter ihren Kindern
wirkte. Er liebte seine Nel heute fast noch mehr als vor ei-
nunddreißig Jahren, da er sie zum erstenmal sah. Spontan
entschied sich sein Herz für sie, der Tochter des deutschen
Konsuls, der seit einem halben Jahr in Chile amtierte. Da er
Witwer war, repräsentierte die Tochter Cornelia in seinem
Hause und stand dann plötzlich verlassen da, als ein Herz-
schlag dem Leben des Vaters ein Ende setzte. Schon einige
Wochen nach dem Tode des Konsuls erschien Gisbert Nor
bei der schönen Cornelia von Saß und bot ihr Herz und
Hand, was sie beides freudig ergriff und sich davon leiten
ließ in ein glückliches Leben hinein. Es wurde eine Ehe voll
inniger Liebe und treuer Kameradschaft.
Cornelia war es auch, die dem Gatten immer wieder zure-
dete, seiner Sehnsucht nachzugeben, indem er das Erbe
seiner Väter zurückerwarb und dorthin übersiedelte. Allein,
diese Zeit hielt er noch nicht für gekommen, weil er das,
was sein Vater und er hier aufbauten, nicht im Stich lassen
wollte. Jedenfalls nicht eher, bis ihm in seinem Sohn Frank
ein würdiger Nachfolger erwuchs, dem er die stattlichen
Unternehmen geben konnte.
Und sie stellte sehr viel vor, die gesamte Firma Nor und

Sohn. Gisberts Vater hatte es nicht schwer gehabt, sie auf
diese stolze Höhe zu bringen. Denn als er damals von Mar-
stein nach Chile floh, zu einem Verwandten der Hellnors,
den gleich ihm eine Skandalgeschichte aus der Heimat
trieb, stand schon die Firma Nor sicher da. So setzte er sich
gleich ins warme Nest, indem er die Tochter des Hauses
und einzige Erbin heiratet. Was tat's, daß sie schon zwei-
mal geschieden und elf Jahre älter als er war? Ihm lag dar-
an, für sich und seinen damals zehnjährigen Sohn Gisbert
ein behagliches Heim zu schaffen und ein Betätigungsfeld
zu haben. Es wurde weder eine glück- noch unglückliche
Ehe, bis der Tod sie nach sieben Jahren schied. Und als
auch kurz danach der schon recht betagte Schwiegervater
die Augen für immer schloß, hinterließ er Eitel Nor, der
viel dazu beigetragen hatte, dem Unternehmen einen tüch-
tigen Aufschwung
ÄU
geben, neben dem gutfundierten
Bankhaus noch zwei riesige chemische Fabriken.
Natürlich wußte Gisbert um das, was seinen Vater aus der
Heimat trieb, und verachtete gleich ihm den Grafen Thor-
brandt, der einen Verzweifelten, der in höchster Not Hilfe
erflehte, hohnlachend von sich wies, ihn einen Mörder und
Ehrlosen nannte. Das hatte das ferne Leben des Eitel Nor
wie ein schwarzer Faden durchzogen. Die Sehnsucht nach
der Heimat tat ein übriges, so daß der Mann nie mehr froh
werden konnte. Gisbert, der das alles mitmachte, lernte den
Namen Thorbrandt verachten, wie es auch später seine Frau
und seine Kinder taten.
Bevor Eitel Nor starb, mußte der Sohn ihm versprechen,
Marstein zurückzukaufen und den Namen Hellnor wieder
zu dem zu machen, was er früher in der Heimat bedeutete:
ein Name von gutem, altem Klang. Da Gisbert selbst Sehn-
sucht nach der Stätte empfand, wo er geboren und zehn
Jahre gelebt, gab er das Versprechen gern.
Bis er es einlösen konnte, vergingen noch zehn Jahre. Dann
war es endlich soweit. Sein Sohn Frank lächelte zwar, tat
jedoch bereitwillig, was der Vater von ihm verlangte.
Und die beiden anderen Kinder? Sie sahen den Vater sehr

erstaunt an, als er ihnen die Wahl ließ, in ihrem Geburts-
land zu bleiben oder mit den Eltern zu gehen.
Nun saß man in Marstein gemütlich zusammen. Es machte
allen keine Mühe, sich zu akklimatisieren, denn Deutsch-
land war ihnen nicht fremd. Schon als die Kinder noch
klein waren, hatten die Eltern fast jedes Jahr mit ihnen ei-
nige Wochen in Deutschland verlebt, und zwar in Bädern.
Und als sie erwachsen waren, studierten die Söhne einige
Semester in Heidelberg. Frank Jura, Roger Volkswirtschaft,
und Sidonie weilte ein Jahr in einem deutschen Pensionat.
Also kannten sie bereits ein schönes Stück des Geburtslan-
des ihrer Eltern, nur die nähere Heimat des Vaters nicht.
Wenn die Thorbrandts und Hellnors auch gegenseitig
strengste Zurückhaltung übten, es keinem einfiel, eine An-
näherung zu suchen, so konnten sie es dennoch nicht ver-
meiden, einander zu begegnen, sei es in der Stadt, an der
Grenze ihrer Besitze, bei den Ritten auf neutralem Gelände
und so fort. Vom Sehen kannte man sich also bereits, aber
das war auch alles.
Als der Herbst kam und somit die Geselligkeit auf dem
Lande einsetzte, geriet man auf den umliegenden Gütern in
die Klemme. Die Frage wurde aufgeworfen: Sollen wir die
Marsteiner nun einladen oder nicht? Wenn einer das mit
der Bemerkung abtat: Meiner Ansicht nach sind wir nicht
dazu verpflichtet, weil sie noch keinen Antrittsbesuch ge-
macht haben, versuchte ein anderer das damit zu motivie-
ren: Vielleicht wissen sie nicht, daß es hier so üblich ist.
Andere Länder, andere Sitten. Dann wurde man wieder
unschlüssig, riet hin und her, bis es einem pensionierten
Oberst, der jetzt auf dem Stammgut lebte, denn doch zu
bunt wurde.
»Da haben wir's mal wieder!« polterte er los, die Gäste, die
miteinander versippt und verschwägert waren und sich im
Gutshaus von Prangen zwanglos zu einem Kaffeeplausch
zusammengefunden hatten, so grimmig dabei ansehend,
als wolle er damit einen Feind in die Flucht schlagen.
»Wenn sich mal zwei Menschen zusammenfinden, gibt es

gleich zwei Köpfe und sieben Sinne. Ich mache diesmal
den Anfang mit dem Klimbim, lade die üblichen Gäste ein
und dazu die Marsteiner mit Kind und Kegel. Basta!«
»Meinst du, Wilhelm, daß es geht?« fragte seine zierliche
Gattin, die so zerbrechlich aussah und doch mit ihrem
Hünen in dreißig Ehejahren durch dick und dünn gegan-
gen war.
»Natürlich geht das, Sudchen«, nickte er ihr herzlich zu.
»Und die Güldenroder?« fragte der Vorhöfer Gutsherr
Heinrich von Bessolt, ein Dicker, dem die Gemütlichkeit
sozusagen in allen Nähten saß.
»Die werden natürlich auch eingeladen. Oder meinst du
etwa, daß ich denen plötzlich die kalte Schulter zeigen
werde?«
»Aber, Wilhelm, du kannst die feindlichen Parteien doch
unmöglich zusammenbringen«, meldete sich nun seine
Schwester, die bei ihm zu Hause lebte. Sie war ein verhut-
zeltes altes Fräulein, das immer vor etwas Angst haben
mußte, wenn es sich wohl fühlen sollte. Deshalb bekam
die Klothilde auch keinen Mann, weil jeder Angst vor ihren
Ängsten hatte, behauptete der Bruder. Er liebte »Hutzel-
chen«, wie er die Schwester nannte.
»Was heißt hier können oder nicht!« Er durchbohrte förm-
lich mit seinen Blicken, die unter den buschigen Brauen
hervorschossen, das verhutzelte Persönchen, das ihn
ängstlich ansah. »Meinst du etwa, daß die Herren sich an
den Schlips kriegen und die Damen sich in die Haare fah-
ren könnten? Wir haben es doch schließlich mit kultivier-
ten Gesellschaftsmenschen zu tun, nicht mit Banausen.
Wenn sie sich gegenseitig das nachtragen wollen, was ihre
Väter und Großväter verbrachen, ist es ihr Privatvergnügen.
Ein >Thorbrandt contra Hellnor< gibt es in der >Clique<
nicht, verstanden? Wenn die Marsteiner noch nicht wissen
sollten, wie es in unserer Gemeinschaft zugeht, muß man
ihnen das beibringen. Und was haben die anderen dagegen
einzuwenden?«
Die anderen waren zuerst einmal die Tochter des kurzan-

gebundenen Obersten von Orsen-Prangen, die den Leut-
nant von Blüthner gefreit, dessen Eltern, dann die Frau des
gemütlichen Dicken, Agathe von Bessolt, die in ihrer
gleichfalls gemütlichen Rundlichkeit so schön zu dem Ehe-
gespons paßte, deren Sohn, den man als kreuzfideles Haus
bezeichnen konnte, die Tochter Edeltraut, ein frisches
Landkind, hübsch und liebenswert – sie alle gehörten zur
Sippe des Obersten von Orsen, der jetzt grimmige Blicke in
die Runde schickte, die Edeltraut absolut nicht einschüch-
terten.
»Onkelchen, wenn du uns so militärisch musterst, bleibt
uns ja nichts anderes übrig, als >Jawohl< zu sagen.«
»I du Strolch«, mußte er gleich den anderen lachen. »Also,
ich eröffne die Wintersaison, fange mit der Einladung an.
Leisten die Marsteiner ihr Folge, geht alles in Ordnung. Tun
sie es nicht, werden sie die Konsequenzen tragen müssen.«
*
»Da haben wir die Bescherung!« sagte Baron Gisbert, als er
eine Einladung erhielt, zu den Seinen. »Dieser Oberst von
Orsen-Prangen scheint ein verflixt kurzangebundener Herr
zu sein; denn diese Einladung sagt nichts anderes als: Ent-
weder – oder! Entweder ihr fügt euch unserer Gemeinschaft
oder ihr seid für uns erledigt.«
»Na, wenn schon«, meinte Roger achselzuckend. »Wir sind
doch wahrhaftig von keinem hier abhängig.«
»Denkst du, mein Sohn, aber ich werde dich gleich eines
anderen belehren. Ich habe mich nämlich genau über die
Verhältnisse hier orientiert und erfuhr folgendes: Die Besit-
zer der acht großen Güter in der Umgegend – dazu gehört
auch Marstein – halten schon seit Jahrzehnten fest und treu
zusammen. Der Älteste ist stets der Präses, also jetzt der
Oberst von Orsen. Clique – diese Bezeichnung prägte ver-
ächtlich ein neidischer Landwirt, den man wegen seiner
unsauberen Geschäfte in den festgefügten Kreis nicht auf-
nahm. Der Oberst, der ein ganz besonders strenges Regi-
ment als Präses führt, griff diese Bezeichnung mit Begeiste-
rung auf. Clique – so wollte man fortan diese treue Ge-

meinschaft nennen, die nur Menschen umschließt, welche
über ein blütenweißes Chemisettchen verfügen. In diesen
Kreis aufgenommen zu werden, heißt Ehre. Werden wir
nun aufgefordert, uns der Gemeinschaft anzuschließen,
und lehnen wir es ab, sind wir für die >Clique< erledigt –
und somit würden wir auch von den gewöhnlichen Sterbli-
chen gemieden werden. Und uns anschließen, heißt den
Thorbrandts auf Schritt und Tritt begegnen. Und was sagst
du nun, mein Sohn?«
»Verflixt.« Er kratzte sich den Kopf. »Wenn das man gut-
geht.«
»Ach was«, tat Sidonie einfach ab. »Wir verreisen und
kommen erst zurück, wenn die Gesellschaft in Prangen
vorüber ist.«
»Das wäre nur ein Aufschub, Sido«, lächelte der Vater. »Be-
denke, daß die anderen aus der >Clique< – dazu gehören
übrigens auch noch der Landrat von Blüthner, der die
Tochter des Obersten zur Frau hat, und deren Schwiegerel-
tern – dem Beispiel ihres Präses folgen und uns am laufen-
den Band einladen werden. Wenn wir da jedesmal verrei-
sen sollten, würde selbst der Harmloseste stutzig werden.
Also mitgefangen, mitgehangen, da hilft uns alles nichts.«
»Da bin ich aber neugierig, wie sich die Goldenroder ver-
halten werden. Ob sie uns auch einladen?«
»Wahrscheinlich, mein Junge.«
»Dann streike ich«, begehrte Sidonie auf. »In das Haus die-
ser…«
»Stopp ab, Sido«, unterbrach der Vater sie gelassen. »Dir
möchte ich es besonders ans Herz legen, dich den Thor-
brandts gegenüber zu keiner Unbedachtsamkeit hinreißen
zu lassen. Vergiß nicht, daß wir im Brennpunkt der Neu-
gierde stehen.«
»Ich mag diese hochmütigen Menschen nicht. Der junge
Graf scheint arrogant zu sein.«
»Dann sei froh, daß du mit dieser Arroganz nichts zu tun
hast, mein Kind. Und was ist mit unserer lieben Nel? Die
schweigt sich ja aus in tausend Sprachen.«

»Ich höre und staune über diesen Sturm im Wasserglas«,
lächelte sie amüsiert. »Abwarten, meine Lieben, abwarten.«
»Das ist wieder einmal unsere Nel.« Der Gatte griff nach
der feinen Frauenhand und drückte schmeichelnd seine
Lippen darauf. »Unser ruhender Pol, unser Fels in der
Brandung. Kinder, was können wir glücklich sein, daß es
unsere Nel gibt.«
Die Gäste, die Oberst von Orsen nebst Frau zu sich ins
Haus lud, kamen bereitwillig der Einladung nach. Da war-
en erst einmal die Versippten, also seine Tochter mit Gatten
und Schwiegereltern, das Ehepaar von Skalden-Wittauren
mit Sohn, Domänenpächter Glade mit Frau und Tochter –
der Sohn war noch nicht gesellschaftsfähig –, das junge
Ehepaar Galt-Dieden und das gleichfalls junge Ehepaar
Karsten-Achthuben.
Wenn man nun die Thorbrandt-Güldenrode, die Hellnor-
Marstein und die Gastgeber selbst dazu rechnete, war der
Kreis der »Clique« geschlossen.
Die weiteren Gäste, so zwanzig an der Zahl, setzten sich
aus Menschen zusammen, denen gegenüber man sich ver-
pflichtet fühlte, sie wenigstens einmal im Jahr einzuladen.
Das waren die »Offiziellen« aus der naheliegenden Kreis-
stadt.
Also: Der Oberst rief, und alle, alle kamen. Und zwar voller
Neugierde, wenigstens die aus der »Clique«. Sie erschienen
rechtzeitig, weil sie sich nichts davon entgehen lassen woll-
ten, wenn die Verhandlung Thorbrandt contra Hellnor ein-
setzte. Wie eine Welle von Spannung lag es über dem gro-
ßen Raum.
Aha, da rückten die Güldenroder an, vornehm und reser-
viert wie gewöhnlich. Die Herren elegant im Frack und
Lack, die Damen mit auserlesenem Geschmack gekleidet.
Entzückend war sie anzuschauen, die kleine Komteß in
ihrer lichten, klaren Schönheit, die Mutter distinguiert wie
immer. Mit konventionell liebenswürdigem Lächeln be-
grüßten sie die Anwesenden, die ihnen alle bekannt waren,
plauderte mit ihnen, bis ihre Mienen wie zu Eis erstarrten.

Und nun war der Moment der Hochspannung für alle
Neugierigen erreicht; denn soeben erschienen die Marstei-
ner. Der Gastgeber machte sie mit den anderen Gästen be-
kannt. Das interessierte jedoch weniger – aber jetzt – jetzt -.
Nun, die Herren kriegten sich nicht »am Schlips«, die Da-
men sich nicht »bei den Haaren«, sondern sie begrüßten
sich sehr höflich, sehr formell. Die Herren neigten sich
artig über die Hand der Damen, die beiden jungen Mäd-
chen taten bei der Gräfin und der Baronin desgleichen.
Dann reichten die Herren sich die Hände – und der Höf-
lichkeit ward in tadelloser Form Genüge getan.
Die Sensationslüsternen waren enttäuscht. Auch über die
Aufmachung der »Amerikaner«. Wohl waren sie mit ausge-
suchter Eleganz gekleidet, aber durchaus nicht extravagant.
Während der Tafel geschah nichts Außergewöhnliches, zu-
mal die Gastgeber den beiden im Brennpunkt der Neugier-
de stehenden Familien »Städter« als Tischpartner zugesellt
hatten, die von dem Thorbrandt contra Hellnor wenig oder
gar nichts wußten.
Nun hofften die Enttäuschten noch auf den Tanz. Würde
man ganz einfach die Pflichttänze ignorieren, oder?
O nein, man tat den Leutchen nicht den Gefallen. Man
benahm sich sehr reserviert beim Tanz.
Eben verneigte Graf Thorbrandt, der junge, sich vor der
Baronesse Hellnor, die bereitwillig seinen Arm nahm und
sich auf die Tanzfläche führen ließ, ebenso verhielten sich
die anderen drei Paare. Man tanzte, wie eben formgewand-
te Menschen miteinander tanzen.
Allerdings, bei dem Pflichttanz blieb es. Die beiden Fami-
lien gingen sich fortan aus dem Wege, aber das geschah
unauffällig. Ohne jeden Mißklang verlief das Fest, das Fa-
milie Thorbrandt zuerst verließ. Nach und nach verab-
schiedeten sich auch die anderen Gäste. Nur die »Sippe«
hielt beharrlich aus. Als man unter sich war, meinte der
Oberst schadenfroh:
»Ihr sitzt ja da wie die bedripsten Hühner, denen man den
Futternapf wegnahm.«

»Aber, Papa, du tust ja so, als ob wir die ärgsten Klatschba-
sen wären«, verwahrte sich die Tochter lachend. »Was wir
den beiden Familien entgegenbringen, ist nichts weiter als
menschliches Interesse.«
»Na, wenn man, Marjellchen. Jedenfalls habe ich euch be-
wiesen, daß die Marsteiner gewillt sind, sich den unge-
schriebenen Gesetzen der >Clique< zu unterwefen, und
daß die Güldenroder einer lächerlichen Fehde wegen diese
Gesetze nicht verletzen wollen. Die sind viel zu gut erzo-
gen, als daß sie diese Fehde im Beisein anderer austragen
würden. Wenn ihnen daran liegt, werden sie es immer nur
unter vier Augen tun, verlaßt euch darauf.«
»Und doch kreuzten sich ihre Blicke wie scharfe Klingen«,
schmunzelte der gemütliche Papa Bessolt. »Donner noch
eins, die haben es in sich, die Güldenroder und die Mar-
steiner. Elitemenschen, das muß man sagen, stolz, unnah-
bar und kalt wie Eis. Ich möchte ja lachen, wenn die Glut
der Liebe das Eis bei den jungen Paaren schmelzen würde.
Ja, was hast du denn, Hutzelchen?« fragte er verwundert
das alte Fräulein, das aufgeregt an seinem Ärmel zog.
»Großer Gott, davon habe ich doch in der vergangenen
Nacht geträumt«, eröffnete sie weinerlich. »Ich habe solche
Angst…«
»Angst?« unterbrach sie der Bruder mit dröhnendem La-
chen. »Freuen müßtest du dich darüber schon deshalb, weil
das Geld der Hellnors den Thorbrandts zu einem beque-
meren Leben verhelfen würde. Hut ab vor den beiden Gra-
fen, die aus dem verschuldeten Güldenrode einen Besitz
machten, der bestehen kann. Dafür mußten sie sich aber
auch arg genug schinden und plagen. So auf Posten wie sie,
ist kein anderer Landwirt hier im Umkreis. Und wenn ih-
nen noch ein bißchen mehr Geld zur Verfügung stände,
würden sie aus Güldenrode ein Mustergut machen.«
»Meiner Ansicht nach besteht deren Reichtum als zweites
Hindernis.«
»Wie meinst du das, Klärchen?« fragte der Oberst die ältere
Frau von Blüthner, als diese verlegen schwieg.

»Nun, ich kann mich ja täuschen«, sprach sie zögernd wei-
ter. »Aber soweit ich den Grafen Randulf beurteile, wird er
um Geld niemals freien.«
»Seht ihr, mein Traum!« rief Hutzelchen aufgeregt dazwi-
schen. »Die Baronesse Sidonie wollte den Grafen Randulf
so gern haben, aber er wies sie kaltschnäuzig ab.«
»Na, Hutzelchen, dein Traum in Ehren«, lachte der Landrat.
»Aber wie ich die Baronesse Sidonie einschätze, geht eher
ein Kamel durchs Nadelöhr, als sie mit einem Heiratsant-
rag auf den Grafen los. Das ist nämlich ein verflixt stolzes
Mädchen.«
»Will ich meinen«, schmunzelte sein Vater, der Regierungs-
rat von Blüthner. »In der kleinen Baronesse steckt Rasse
drin, olala! Bei ihrem Anblick wird selbst mir altem Kna-
ben noch ganz heiß unter der Weste.«
»Klärchen, laß dich scheiden«, tat der Oberst empört, und
der gemütliche Papa Bessolt liebkoste seine Glatze.
»Kinder, ihr begebt euch auf ein gefährliches Gebiet. Be-
denkt: Thorbrandt contra Hellnor – und ihr tragt euch mit
Kupplerabsichten. Euer Glück, daß es der Randulf nicht
hört.«
»Hast recht, Mann«, bekräftigte seine Ehehälfte. »Denn die
Menschen, die man hier als Marionetten betrachtet, bei
denen man nur am Strippchen zu ziehen braucht, um sie
zu dirigieren, sind stolze, unnahbare Lebewesen. Vergeßt
das bitte nicht.«
So debattierte man hin und her – und lächelnd spann Frau
Norne ihre Fäden.
Es war an einem Tag im November, als Sidonie von Hell-
nor in der Stadt, wo sie Einkäufe gemacht hatte, am Steuer
ihres kleinen Zweisitzers Platz nahm, um nach Hause zu
fahren. Grau und schwer hingen die Wolken am Himmel.
Ein eisiger Wind fegte die Straßen entlang. Trotzdem fuhr
Sidonie davon, und kaum hatte sie die Chaussee erreicht,
warfen die Schneewolken ihre eisige Last ab, schütteten sie
auf die Erde nieder.
Huuuiiii! orgelte und pfiff es hohnlachend dabei, so daß es

Sidonie angst und bange wurde. Sie stieg aus, bemühte
sich, das Verdeck hochzuschlagen, aber es gelang ihr nicht.
Sie zerrte und riß voll Ungeduld, klemmte sich dabei die
Finger, daß sie bluteten, bis sie es dann doch aufgab und
sich an das Steuer setzte. Die Schneeflocken, mit Hagelkör-
nern vermischt, peitschten ihr ins Gesicht, in die Augen.
Der weiße Wirbel nahm ihr die Sicht.
Also ein Ding der Unmöglichkeit, den Wagen zu steuern.
Dem Weinen nahe, saß sie da, fror erbärmlich, daß ihr die
Zähne klapperten – und nirgends ein Mensch zu entdek-
ken.
Sollte sie einfach den Wagen stehen lassen und zu Fuß
nach Hause gehen?
Wenn sie doch nur das Verdeck hochkriegen könnte, dann
wäre ja alles andere ein Kinderspiel. Sie ließ die Scheiben-
wischer surren, die wohl die Scheibe klar machten, aber
von oben schlug ihr das Schneegestöber ins Gesicht.
Also noch einmal hinaus und versucht, das störrische Ver-
deck hochzukriegen. Eisig schlugen die Hagelkörner durch
die hauchdünnen Strümpfe auf die Haut. Die feinen Schu-
he waren im Nu durchnäßt, und naß klebte ihr das Haar
um Stirn und Nacken. Sidonie zitterte an allen Gliedern
vor Kälte. Die Hände erstarrten, die sich mit dem Verdeck
abmühten.
Umsonst, der Mechanismus rührte sich nicht.
Nun kamen ihr doch die Tränen vor Ratlosigkeit, und ge-
rade, als sie mit der blutenden Hand über das Gesicht fuhr,
um die glitzernden Tropfen wegzuwischen, hielt ein Auto
neben ihr. Erwartungsvoll sah Sidonie ihrem Retter entge-
gen.
Sie zuckte zusammen, als dieser Retter sich als der unwill-
kommenste, den sie sich nur denken konnte, entpuppte.
Vor ihr stand nämlich Randulf Thorbrandt.
»Um Gott, Baronesse, was ist Ihnen geschehen!« rief er
erschrocken. »Sie bluten ja – und weinen außerdem.«
»Ach, das sieht nur so aus«, kam die Antwort in einem Ton,
wie er einem Retter gewiß nicht gebührte. »Die nassen Haa-

re tropfen mir ins Gesicht, und das Blut rührte von der
Hand her, die ich mir am Verdeck klemmte.«
»So, so«, sagte er, weiter nichts. Und doch hätte sie ihm ins
Gesicht schlagen mögen, als sie das ironische Lächeln be-
merkte, das in seinen Augen blitzte, in seinen Mundwin-
keln hockte.
»Danke, Herr Graf, bemühen Sie sich nicht. Ich werde auch
allein fertig.«
Schroff wandte sie sich ab, glitt dabei mit den leichten,
hochhackigen Schuhen aus und wäre hingeschlagen, wenn
der Graf diesen Fall nicht rasch verhindert hätte. Und da er
das Mädchen nun schon einmal im Arm hielt, zog er es mit
sich fort zu seinem Wagen hin, öffnete den Schlag.
»Bitte, Baronesse, nehmen Sie Platz«, erklärte er kurz, aber
sie rührte sich nicht. Doch ehe sie sich dessen versah, hatte
er sie schon um die Hüften gefaßt und mit seinen stähler-
nen Armen auf den Sitz gehoben, an dessen anderem Ende
Heidgar saß.
Jetzt kam Sidonie wieder zur Besinnung. Ihre Augen fun-
kelten den Mann an, der ruhig vor dem Wagen stand und
wieder dieses Lächeln zeigte, das Sidonie unsagbar reizte.
»Was fällt Ihnen denn ein, Herr Graf!« rief sie empört. »Ist
es etwa ihre Art, mit einer Dame so zu verfahren?«
»Wenn die Dame unvernünftig ist, dann ja«, war die gelas-
sene Antwort. »Ich verstehe vollkommen, daß meine und
meiner Schwester Gegenwart Ihnen lästig ist, Baronesse.
Wir würden sie Ihnen auch gewiß nicht aufdrängen, wenn
Sie nicht augenblicklich ein Mensch wären, der unserer
Hilfe bedarf. Und die haben wir Thorbrandts noch keinem
versagt.«
»So, keinem?« kam es gedehnt von den spottgeschürzten
Lippen, und da biß der Mann die Zähne so fest zusammen,
daß die Wangenmuskeln spielten. Als Sidonie jedoch Mie-
ne machte, den Wagen zu verlassen, fuhr er sie herrisch an:
»Baronesse, was Sie jetzt tun wollen, ist ein frevelhaftes
Spiel mit Ihrer Gesundheit. Ich ersuche Sie, sich nicht wei-
ter wie ein ungezogenes Kind zu benehmen, sondern sich
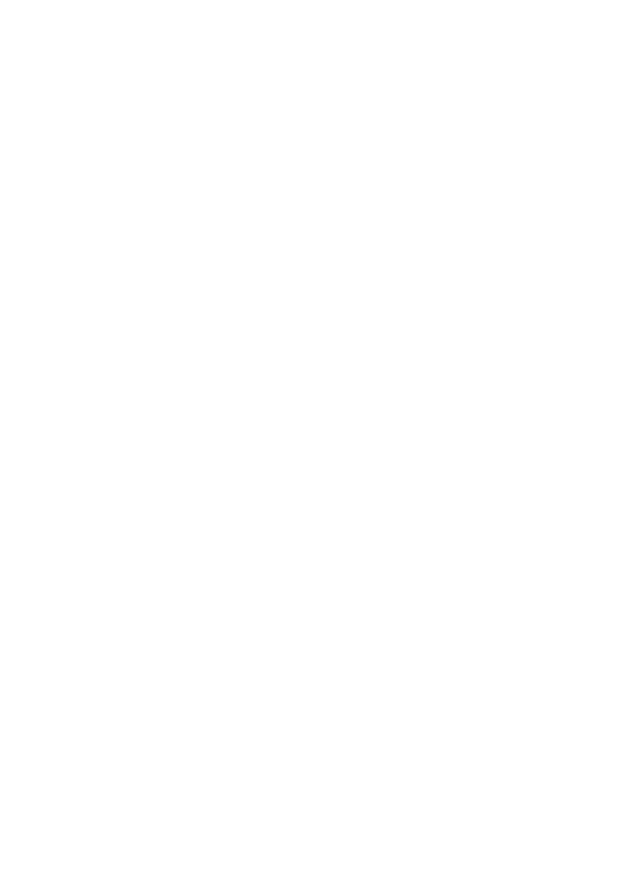
unsere Hilfe gefallen zu lassen, die nichts weiter als Men-
schenpflicht ist.«
Das klang so scharf und kalt, daß sie die Beine, die schon
draußen steckten, wieder in den Wagen zurückzog.
»Hier, Heidgar, nimm mein Taschentuch und trockne da-
mit der Baronesse die nassen Haare, so gut es geht«, gebot
er. Schweigend nahm die Schwester das Tuch aus der Män-
nerhand, doch schon zog es Sidonie an sich.
»Danke, das erledige ich lieber allein«, sagte sie schroff und
begann dann ihren Kopf zu bearbeiten, als wäre es nicht
ihr eigener. Unwillig sah sie auf, als der Graf ihr ein Glas
mit Kognak hinhielt.
»Trinken Sie, Baronesse!« herrschte er sie an. »Der Kognak
soll kein Freundschaftstrunk sein, den ein Thorbrandt einer
Hellnor kredenzt, er soll nur verhindern, daß Sie sich eine
Lungenentzündung holen.«
»Wie wichtig!« ironisierte sie. »Sind Sie etwa ein Arzt?«
»Gewiß, und zwar Tierarzt, der mit jedem störrischen Ras-
sepferdchen fertig wird.«
Da sah sie ihn mit einem Blick an, der ihn eigentlich hätte
in Grund und Boden schmettern müssen, nahm ihm aber
schroff das Glas aus der Hand und leerte es in einem Zuge.
Und während sie ob des scharfen Getränks zuerst nach Luft
rang und sich dann schüttelte, zog ihr Widersacher ihr die
nassen Schuhe aus, nahm eine Decke und hüllte das Mäd-
chen, das nun halbberauscht in dem Polster ruhte, völlig
ein.
»Wirst du den Wagen bei dem Schneegestöber auch lenken
können, Heidgar?« fragte er kurz.
»Ja«,“kam es ebenso kurz zurück. »Was wirst du tun?«
»Den Wagen der Baronesse nach Marstein steuern.«
»Wird es dir gelingen, das Verdeck hochzuschlagen?«
»Bestimmt.«
»Schön, dann warte ich so lange, bis du startbereit bist. Es
ist mir lieber, wenn du vorfährst.«
»Geht in Ordnung, Schwesterlein.«
Der Schlag flog zu, und Sidonie zuckte erschrocken zu-

sammen. Sie schnellte hoch, ließ sich jedoch wieder in das
Polster zurücksinken, weil ihr Köpfchen süß benebelt war,
was natürlich nicht ausbleiben konnte, wenn ein junges
Mädchen ein Doppelglas besten Kognaks ruckartig in das
zarte Kehlchen kippte. Wie Feuer brannte das scharfe Ge-
tränk im Magen. Mit einem zufriedenen Seufzer drückte die
stolze, eigenwillige Baronesse Hellnor den flimmernden
Kopf in das Polster. Augenblicklich war ihr alles egal – ganz
egal.
Heidgar dagegen, die hellwach am Steuer saß, steckte den
Kopf durch das geöffnete Wagenfenster und sah gespannt
zu, wie der Bruder sich an dem Verdeck des Zweisitzers zu
schaffen machte. Und siehe da, ihm gehorchte es sofort. Er
nahm in dem fremden Wagen Platz, fuhr an, und die
Schwester folgte seinem Beispiel. Ganz einfach war es nicht
für sie, den Wagen durch das Schneegestöber zu steuern,
doch die Schlußlichter des voranfahrenden Autos zeigten
ihr den Weg.
Ab und zu warf sie einen Blick auf ihre Nachbarin, die sich
ganz ruhig verhielt. Der Motor brummte, die Scheibenwi-
scher surrten, einschläfernd wirkte das. Allein, das Mäd-
chen am Steuer blieb hellwach. Denn es galt ja, nicht nur
sich allein ungefährdet durch das Unwetter zum Ziel zu
bringen, sondern auch das Mädchen, das der Bruder unbe-
denklich der jungen Schwester anvertraute. Ob sie es gern
tat oder nicht, spielte für den stets hilfsbereiten Mann keine
Rolle.
Die Augen des Mädchens verfinsterten sich, die Hände um-
spannten das Steuer fest. Thorbrandt contra Hellnor. Noch
nie hatte die Komteß dessen Bedeutung so gespürt wie
jetzt, da sie eine Hellnor durch das Unwetter fahren mußte.
Und diese Hellnor hatte die Geschwister Thorbrandt ihre
Verachtung spüren lassen.
Dieses: So, keinem? war wie ein Schlag ins Gesicht gewe-
sen. Sie bewunderte den Bruder, daß er die aufsässige Ba-
ronesse nicht einfach ihrem Schicksal überließ.
Aber kaum gedacht, schämte Heidger sich auch schon die-

ses unschönen Gedankens.
Die wenigen Kilometer hätte man sonst bequem in zehn
Minuten zurückgelegt, doch bei dem Unwetter brauchte
man dreifach so viel Zeit. Und alles wegen dieser hochfah-
renden Baronesse.
Pfui, Heidgar, schäm dich! rief sie sich gleich wieder zur
Ordnung. Der Körper spannte sich, die zarten Hände hiel-
ten krampfhaft das Steuer. Und dann war endlich das mü-
hevolle Werk geschafft, die beiden Wagen hielten vor dem
Portal des Marsteiner Herrenhauses. Der Schlag des schwe-
ren Wagens öffnete sich, und eine gelassene Männerstimme
sprach:
»Bitte, Baronesse, Sie sind zu Hause.«
»Wie – was?« fuhr die Angesprochene auf, schaute nicht
sehr geistreich um sich, riß die Decke vom Körper, sprang
aus dem Wagen, schüttelte sich ob des Unwetters und lief
dann auf Strümpfen davon. Sie prallte an der Portaltür fast
mit dem verblüfften Diener zusammen und war dann ver-
schwunden.
Da mußten die Geschwister denn doch lachen:
»Der gute Kognak scheint seine Wirkung getan zu haben«,
schmunzelte Randulf, indem er am Steuer seines Wagens
Platz nahm. Ehe der Diener sich noch von seiner Verblüf-
fung erholt hatte, rollte das fremde Auto schon davon.
Das war nun etwas, das in das Hirn des intelligenten, gut-
geschulten Dieners denn doch nicht hineinging. Verständ-
nislos starrte er auf den schmucken Zweisitzer der Barones-
se und ging dann kopfschüttelnd ins Haus.
Sidonie jedoch rannte immer noch davon, als müßte sie im
Wettlauf den ersten Preis gewinnen. Sie stoppte erst ab, als
sie das Zimmer erreichte, in dem die Ihren geruhsam sa-
ßen.
»Sido, wie siehst du denn aus!« rief die Mutter. »Du bist ja
ganz naß – und auf Strümpfen – und blutbesudelt das Ge-
sicht!«
Ihre Unruhe steigerte sich noch, als die Tochter sich in den
nächsten Sessel fallen ließ, die Hände vor das Gesicht

schlug und weinte. Aber Cornelia hätte ja nicht die kluge,
behutsame Nel sein müssen, wenn sie nicht bald das aus
Sidonie herausgelockt hätte, was zur Aufklärung nötig war.
Als dann die verweinten Mädchenaugen sich hoben und
zaghaft das Gesicht der Mutter suchten, hockte in den
Mundwinkeln das Lächeln.
»Nel, Nel, warum sagst du denn nichts?«
»Ja, was soll ich da sagen?« kam die Antwort gedehnt.
»Doch nur, daß du dich nicht rühmlich benommen hast.«
»Das ist es ja eben!« Der Mädchenkopf senkte sich be-
schämt. »Aber du hättest nur das aufreizende Lächeln des
Grafen sehen sollen, diese Eiseskälte spüren müssen, die
von ihm ausströmte.«
»Nun, sehr warm wirst du ja auch nicht geströmt haben«,
entgegnete die Mutter trocken. »Ich kenne dich doch, Sido-
nie.«
»Und dann das fürchterliche Getränk, das der gräßliche
Mensch mir aufzwang. Ich mußte den Inhalt des Glases
leeren, das fast so groß war wie ein Bierseidel.«
Jetzt mußte die Mutter lachen, und erleichtert fielen die
beiden Herren ein, denen der Schreck nicht zu knapp in die
Glieder gefahren war.
»Hm, und dann?« forschte die gründliche Nel weiter.
»Dann ließ ich halbbenebelt alles über mich ergehen und
fühlte mich noch wohl dabei«, bekannte sie trotzig.
»Wer fuhr den großen Wagen, in dem du saßest?«
»Die Komteß.«
»Und deinen?«
»Wahrscheinlich der Graf.«
»Wahrscheinlich – sehr aufschlußreich.«
Sie klingelte nach dem Diener, der sofort eintrat. Der junge
Mensch gehörte auch zum Stab der treuerprobten Bedien-
steten, die man aus Chile mitbrachte.
»Robert, hast du vielleicht eine Ahnung, wo das Auto der
Baronesse ist?«
»Sehr wohl, Frau Baronin. Als ich den Wagen vor dem Por-
tal stehen sah, habe ich dem Chauffeur Bescheid gesagt, der

ihn dann in die Garage fuhr.«
»Sehr umsichtig, Robert, besten Dank.«
Er zog sich zurück, und Cornelia wandte sich wieder der
Tochter zu, die sich bemühte, dem gefürchteten Blick trot-
zig standzuhalten.
»Das ist nun meine Tochter, die ich gut erzogen glaubte«,
sprach sie gelassen. »Sie läßt Menschen, die ihr trotz – hm
– ungehörigen Benehmens dennoch halfen, einfach stehen
und läuft ohne ein Wort des Dankes davon. Interessant.«
Jetzt flammte der Eigenwille des Mädchens auf, gegen den
die Mutter von jeher gekämpft und den sie trotzdem nicht
hatte ganz ausrotten können.
»Ei, Sidonie, schlucke das rasch hinunter, was du zu sagen
gedenkst«, warnte Cornelia ruhig. »Deinen Stolz lasse ich
mir gefallen, aber nicht deinen Eigenwillen. Das müßtest
du mit deinen nahezu neunzehn Jahren schon begriffen
haben.«
Da senkte das Mädchen den Kopf und brummte:
»Was hätte ich wohl anders machen sollen, Nel, etwa zwei
von den Thorbrandts in unser Haus bitten?«
»Nein, mein Kind, das erwarteten die Geschwister gewiß
nicht von dir. Aber ein >Dankeschön< haben sie nun wirk-
lich verdient. Sie haben dich schließlich nicht ohne eigene
Gefahr durch das Unwetter nach Hause gebracht. Haupt-
sächlich der Komteß wird es nicht leicht gefallen sein, bei
dem beinahe orkanartigen Sturm den Wagen zu steuern.
Meinst du nicht auch, daß die junge Dame viel lieber unter
dem Schutz des Bruders gefahren wäre bei diesem Schnee-
gestöber? Aber sie…«
»Nel, sprich nicht weiter! Ich weiß auch so, was du sagen
willst.«
»Na schön, dann weißt du ja Bescheid. Wo hast du übri-
gens deine Schuhe?«
»Die zog mir dieser unausstehliche Mensch von den Füßen,
bevor er mich in eine Decke hüllte.«
»Das war doch sehr fürsorglich, Kleines«, meldete sich nun
auch der Vater, der sich bisher aus der Debatte gehalten

hatte.
»Das schon, Paps, aber wie er es tat.«
»Wahrscheinlich so, wie man es bei Widerspenstigen tut,
die sich durchaus nicht helfen lassen wollen«, lachte Roger,
dem die Schwester eigentlich leid tat. Denn das Lächeln der
Nel, obwohl es ihm gar nicht galt, war ihm recht unbehag-
lich gewesen. »Was sagte denn die Komteß zu dem heiteren
Spiel?«
»Nichts. Die ist genauso eiskalt wie ihr Bruder.«
Sie brach ab und sah dem Diener entgegen, der das Zim-
mer betrat und ein Paar Schuhe in der Hand hielt – zierli-
che durchweichte Damenpumps.
»Meine Schuhe!« rief Sidonie. »Wer gab sie dir, Robert?«
»Ein Bote, Baronesse.«
»Woher kam er?«
»Das weiß ich nicht, Baronesse. Er gab nur die Schuhe ab
und verschwand eiligst.«
Nachdem der Diener gegangen war, lachte Nel amüsiert.
»Oh, Sido, genau so wie die Schuhe aussehen, hast du dich
benommen.«
Auch in Güldenrode sprachen die Geschwister zu ihren
Eltern über das Erlebnis mit der Baronesse, wobei Heidgar
deren beleidigende Äußerung, dieses höhnende: »So – kei-
nem -?« nicht unerwähnt ließ. Darauf zuckte der Vater die
Achsel.
»Laßt es euch genügen, Kinder, daß ihr einen in Unbill
geratenen Menschen trotz seines beleidigenden Benehmens
eure Hilfe dennoch nicht versagtet.«
Damit ging man zur Tagesordnung über und vergaß bald
diesen Zwischenfall.
Zwischen Güldenrode und Marstein befand sich eine An-
höhe, auf der man sich im Winter auf den Skiern zu tum-
meln pflegte. Und da durch diesen kleinen Berg ausgerech-
net die Grenze lief, hatte man, als die Feindschaft der
Nachbarn begann, einen Stacheldrahtzaun gezogen, damit
man nicht mit einem halben Fuß feindliches Gebiet betre-
ten konnte.

An einem Tag, Anfang Dezember, schwang sich Heidgar,
die gleich ihrem Bruder eine vorzügliche Übung im Skilauf
besaß, im schneidigen Telemark über das Gelände, hackte
dabei mit den Brettern an den ominösen Zaun, verlor das
Gleichgewicht und kugelte mit beängstigender Geschwin-
digkeit hinunter. Das sah schlimmer aus, als es war und
ließ den Geschwistern Hellnor, die jenseits des Zaunes am
Abhang standen, fast das Herz stillstehen vor Schreck.
Blitzschnell warfen sie die Skier ab, setzten in kühnem
Schwung über den Draht, und als erster kniete Roger neben
dem regungslosen Bündel.
»Komteß, haben Sie sich verletzt?« rief er angstvoll, den
Mädchenkörper dabei behutsam auf den Rücken legend –
und da strahlten ihn zwei blaue Augen an.
»Gott sei Dank«, atmete der Mann auf. »Was haben wir für
einen Schreck gekriegt!«
»Ich auch!« Heidgar wollte die Männerhände, die noch
immer auf ihrer Schulter lagen, schroff abstreifen. Doch da
fiel ihr Blick auf Sidonie – und die ließ ihre helfenden
Hände, wo sie waren. Denn so benehmen, wie die Baro-
nesse es vor zwei Wochen tat, wollte sie sich wahrlich
nicht, obwohl auch sie über ein eigenwilliges Köpfchen
verfügte.
»Haben Sie Schmerzen, Komteß?«
»Keine Spur, Herr Baron«, gab sie zwar kühl, aber nicht
unfreundlich zurück. »Wenn Sie die Güte haben wollten,
mich von den verhakten Brettern zu befreien, werde ich
gleich wieder obenauf sein.«
Und tatsächlich stand sie gleich darauf, von vier hilfreichen
Händen emporgehoben, wieder aufrecht da.
»Geht's?« fragte Sidonie bang.
»Danke – ausgezeichnet. Eine Schande, daß mir altem Ski-
hasen das überhaupt passieren konnte.«
»Was heißt hier Schande«, protestierte Roger. »Das Wort
sollten wir doch lieber streichen. Soll ich nach Hause lau-
fen und einen Schlitten holen, Komteß?«
»Wozu denn? Mir fehlt doch nichts, Herr Baron.«

Damit griff sie nach den Brettern, legte sie an, ergriff die
Stöcke und lächelte den Geschwistern zu.
»Besten Dank für tatkräftige Hilfe, sonst wäre ich jetzt noch
nicht auf den Beinen.«
Damit glitt sie davon, dorthin, wo der Schloßturm sich in
den Himmel streckte. Die Geschwister sahen der grazilen
Gestalt nach. Dann sagte Roger:
»Die benahm sich anders als du damals, Schwesterlein.
Zwar spürte man aus ihrem ganzen Gebaren das reservierte
>Rührmichnichtan<, aber sie blieb sich doch gleich in ihrer
konventionellen Freundlichkeit.«
Der Widerspruch, auf den er wartete, blieb aus. Nur die
Augen blitzten ihn abweisend an. Und als sie dann nebe-
neinander auf den Skiern dahinglitten, meinte der Bruder
gutmütig:
»Laß gut sein, Sido, die Eltern brauchen ja nichts zu erfah-
ren.«
»Gerade!« Der Kopf flog in den Nacken. »Wenn ich auch
manche Fehler haben mag, aber feige bin ich nicht.«
Eine halbe Stunde später wußten die Eltern um den Zwi-
schenfall, wobei Sidonie offen zugab, daß sie die Haltung
der Komteß bewunderte. Nel sagte nichts, die Hand fuhr
nur liebkosend über den Kopf ihres Kindes.
Als Sidonie jedoch dem Vater sagte, daß der Stacheldraht
zwischen der Abhanggrenze für den Skilauf doch sehr hin-
derlich sei, schoben sich die Brauen in dem Männerantlitz
finster zusammen, und der Mund sprach hart:
»Der Zaun bleibt. Denn nicht euer Großvater war es, der
ihn errichten ließ, sondern der der Geschwister Thor-
brandt.«
Fast dieselben Worte wie Sidonie gebrauchte auch Heidgar,
nachdem sie Eltern und Bruder von ihrem Mißgeschick
erzählt hatte. Auch hier sprach ein harter Mund:
»Der Zaun bleibt. Denn nicht euer Großvater ließ ihn er-
richten, sondern sein Nachbar Eitel von Hellnor. Es steht
uns darum nicht an, da eine Änderung zu schaffen.«
Und der Zaun blieb – ebenso das »Thorbrandt contra Hell-

nor.« Nicht sichtbar den anderen, nur spürbar denen, die es
betraf.
Und wie Baron Gisbert den Seinen vorausgesagt, so ge-
schah es: Die »Clique« betrachtete die Marsteiner bereits zu
den Ihren und lud sie nacheinander in ihr Haus. Obwohl
es überall dasselbe war, man immer mit denselben Men-
schen zusammenkam, es überall fast die gleichen Speisen
und Getränke gab, dieselben Tänze getanzt, die gleichen
Gespräche geführt wurden, kam man den Einladungen
nach. Das gesellige Zusammensein durchbrach den Alltag,
brachte Abwechslung, und die konnte man hauptsächlich
im Winter auf dem Lande wohl gebrauchen. Schon allein
die festliche Kleidung hob über den Alltag hinweg, die
blumengeschmückte Tafel – überhaupt das ganze festliche
Drum und Dran.
An das »Thorbrandt contra Hellnor« gewöhnte man sich,
gab es auf, ihm neugierig nachzuspüren. Die acht davon
betroffenen Menschen benahmen sich eben so korrekt, daß
selbst der kritischste Beobachter an ihrem Benehmen nichts
auszusetzen fand. Sie sprachen miteinander, tanzten, und
wenn sie dabei stets reserviert blieben, lag das wohl an ih-
rer Veranlagung. Bei den Thorbrandts war man ja längst
daran gewöhnt, daß sie nie so recht aus sich herausgingen,
und die Hellnors schienen Art von ihrer Art zu sein.
Mittlerweile war es Ende Februar geworden und das obliga-
te Winterfest in sechs Familien der »Clique« vorüber. Jetzt
wartete man auf die Einladung nach Güldenrode, und man
fragte sich: Werden die Marsteiner auch dabei sein?
Und Frau Norne spann – und lächelte gütig dabei. Sie legte
in dem prunkvollen Haus in Chile ein Töchterlein in die
bereitgehaltene Wiege, bei dessen Taufe die Großeltern,
Tante und Onkel nicht fehlen durften. Sie reisten ab – und
eine Woche später lud Graf Thorbrandt die üblichen Gäste
zum Winterfest in sein Haus. Daß die Marsteiner gerade
verreist sein mußten, war eben ein Zufall – oder war es
mehr? Jedenfalls sollte die kluge Nel recht behalten:
Kommt Zeit, kommt Rat.

Wieder einmal war es Frühling, und wieder begann die
stramme Arbeit für den Landwirt. Da Baron Hellnor und
sein Sohn keine Ahnung von der Landwirtschaft hatten,
stellte man auf Marstein einen tüchtigen Verwalter ein, der
sich keine Mühe verdrießen ließ, die verlodderten Lände-
reien zu kultivieren. Das gab eine Menge Arbeit. Bald war-
en die Äcker, die zu Marstein gehörten und bisher in ihrer
Verwahrlosung wie ein Schandfleck in dem ringsum so
blühenden Land angemutet hatten, von den andern nicht
mehr zu unterscheiden.
Roger wich dem Verwalter kaum noch von der Seite; denn
das Blut seiner Ahnen, die alle, bis auf Großvater und Va-
ter, gute Landwirte gewesen waren, begann sich mächtig zu
regen. Zwar hatte er Volkswirtschaft studiert, um sie bei der
Firma Nor gut anwenden zu können, aber seitdem er auf
Marstein lebte, tat es ihm leid, nicht lieber die landwirt-
schaftliche Hochschule besucht zu haben. Er fühlte die
Liebe zur eigenen Scholle ständig in sich wachsen, was sei-
nen Vater mit Genugtuung erfüllte. Jetzt wußte er, daß sein
Sohn Roger ein echter Hellnor war, der in Marstein das
Erbe der Väter ehrte.
Denn bisher hieß es immer noch abwarten, ob sein Zweit-
geborener sich in der neuen Heimat wohl fühlen und sich
nach seinem Geburtsland zurücksehnen würde, worin er
sechsundzwanzig Jahre seines Lebens verbrachte.
Dasselbe befürchtete er auch bei Sidonie. Daher beobachte-
te er seine beiden Kinder scharf, als er ihnen eröffnete, daß
man zur Taufe von Franks Töchterlein nach Chile reisen
würde, und erschrak dann über die strahlenden Augen von
Sohn und Töchterlein. Auch während der Wochen, da sie
in der altgewohnten Umgebung weilten, setzte der Vater
die Beobachtung fort. Ach, wie waren sie glücklich, als Alt-
vertrautes sie umfing. Demnach schienen sie den Auf-
enthalt in Marstein als längere Ferien betrachtet zu haben.
Nun, Gisbert von Hellnor war ein viel zu guter Vater, um
seinen Kindern Zwang aufzuerlegen. Sie sollten glücklich
sein. Mochten seine beiden Jüngsten in der alten Heimat

bleiben, genau so wie Frank, der Älteste. Sollten Sie sich da
ihr eigenes Nest bauen, fern von ihm. Er war ja trotzdem
nicht verlassen, ihm blieb ja noch Nel.
Und als er dann zur Abreise rüstete, stellte er seinen Zweit-
geborenen sowie das Töchterlein vor die Wahl: Wollt ihr
hierbleiben oder wieder mit mir und Nel nach Marstein
zurückkehren? Als sie ihnen das erstemal so bereitwillig
dahin folgten, war das wohl der Reiz der Neuheit gewesen,
aber jetzt kannten sie ja das Leben dort. Ganz frei sollten
sie sich für Chile oder Marstein entscheiden, ohne dabei
auf die Eltern Rücksicht zu nehmen.
Zuerst hatten sie ihn verblüfft angesehen und dann entrü-
stet losgelegt: Hierbleiben ohne ihn und Nel? Was er sich
denn eigentlich so dachte! Man würde sich ja vorkommen
wie ein losgelöstes Blatt vom Baum. Man hätte Marstein
bereits so lieb gewonnen, daß man gern dahin zurückkehr-
te. Und wenn man tatsächlich Sehnsucht nach hier verspür-
te, reiste man eben wieder hin. Aber wohlgemerkt: Nicht
ohne die Eltern, die einem mehr bedeuteten als alles auf
der Welt.
Oh, wie wurde es dem Vater das Herz so leicht und froh!
Nel zerdrückte sogar heimlich ein Tränchen.
Und Frank lächelte. Allerdings schien das Lächeln nicht
ganz echt zu sein. Was er dachte und empfand? Nun, das
würde man bei diesem zugeknüpften Menschen ja doch nie
ergründen.
Florence jammerte in ihrem drolligen Deutsch, daß sie »die
Lieblings nicht begleiten könne in die fremde Land, weil
die Baby, die neue, sein noch zu klein.«
Doch als man ihr versprach, recht bald wiederzukommen,
lachte sie schon wieder wie ein Kind, dem Lachen und
Weinen in einer Tasche steckt. Daher nahm man das süße,
puppenhafte Persönchen erst gar nicht ernst und trennte
sich von ihm in lächelnder Gelassenheit.
Frank blieb bei dem Abschied kühl und gemessen, was
allerdings auch eine Tarnung seines Gefühls sein konnte.
Marstein lag ja schließlich nicht aus der Welt.

Als die vier Menschen dort ankamen, umfing sie das Ge-
fühl des Nachhausekommens wie mit linden Armen. Man
brauchte sich erst gar nicht wieder einzugewöhnen, man
war es längst.
So lebte man denn in schönster Harmonie dahin, hatte
immer so viel vor, daß man nie Langeweile empfand. Die
Stadt lag ja so nah, die mancherlei Zerstreuung bot für den,
der sie suchte. Allein, den Hellnors lag gar nicht so viel
daran. Sie fanden in Marstein Abwechslung genug.
Da sie schon in Chile Reitpferde besaßen, schafften sie
wieder welche an. Vier rassige Trakehner, von denen haupt-
sächlich Sidonies Fuchswallach »Goldlack« ein Pracht-
exemplar seiner Art bedeutete.
Auch auf Gebrauchspferde legte man Wert. Daher wurden
die »alten Kracken«, wie der Verwalter sie verächtlich nann-
te, verkauft, und an ihrer Stelle traten gepflegte Tiere. Eine
Stute davon war tragend, und Sidonie freute sich auf das
Fohlen. Es verging kein Tag, an dem sie ihren Schützling
nicht besuchte.
Auch der Verwalter brachte der Stute großes Interesse ent-
gegen, die, wenn auch nicht ganz rasserein, so doch man-
cherlei edle Merkmale zeigte. Dazu war der Beschäler bester
Abstammung. Also durfte man auf das Fohlen schon ge-
spannt sein.
An einem Sonntag im April, der ausnahmsweise schönes
Wetter brachte, machte die Familie Hellnor einen Ausflug,
um auch die weitere Umgebung der neuen Heimat ken-
nenzulernen. Roger wurde aufgefordert, recht langsam zu
fahren, damit man sich in aller Ruhe die Gegend ansehen
konnte. In einem Gasthaus aß man zu Mittag, trank in ei-
ner Waldschenke Kaffee und machte sich dann auf den
Rückweg.
Diese Fahrt ins Blaue war gewiß nichts Außergewöhnliches,
und doch hatten die verwöhnten Menschen ihre Freude
daran. Das war doch mal was anderes, und alles andere ist
nun einmal reizvoll. So recht zufrieden langten sie in Mar-
stein an, fuhren durch ein Seitentor auf den Hof, wo sie vor

dem Pferdestall ein Auto stehen sahen, das ihnen bekannt
vorkam. Roger stoppte ab, man stieg aus.
»Wenn ich nicht irre, ist es der Güldenroder Wagen«, sagte
er, gleich den andern unangenehm berührt. »Was soll das
bedeuten?«
Darauf konnte ihnen der Verwalter Antwort geben, der
soeben in der Stalltür sichtbar wurde. Als er seinen Gebie-
ter nebst Familie erblickte, eilte er auf sie zu und verkünde-
te.
»Eben ist ein gesundes Fohlen angekommen. Ein prächtiger
Kerl, mit allen Anzeichen edler Rasse. Hab' mir doch gleich
gedacht, als ich das Muttertier kaufte…«
»Was bedeutet der Wagen?« fragte der Baron kurz in die
Begeisterung des Mannes hinein.
»Tja, das ist nun so 'ne Sache, Herr Baron. Die Angelegen-
heit mit dem Fohlen ging gar nicht so einfach vor sich, so
daß ich gezwungen war, einen Tierarzt zu bestellen. Aber
unser Herr Doktor war nicht zu Hause, zwei weitere auch
nicht. Die Stute begann bereits schlappzumachen, so daß
ich mir keinen anderen Rat wußte, als den Herrn Grafen
Thorbrandt herzubitten, damit er sich das Tier, das mir gar
nicht gefiel, einmal mit fachmännischen Augen ansehen
sollte. Wenn die Herrschaften erreichbar gewesen wären,
hätte ich gewiß nicht so eigenmächtig gehandelt.«
»Versteht denn der Herr Graf etwas davon?«
»Und wie, Herr Baron!« Die Augen in dem wetterharten
Gesicht strahlten. »Er ist doch studiert, ist sogar Doktor. Er
betreut jedoch nur die eigenen Tiere, springt aber auch hie
und da hilfsbereit ein, wenn es durchaus sein muß. Sonst
lehnt er es ab, um dem Herrn Tierarzt nicht ins Handwerk
zu pfuschen.«
»Und er kam auf ihren Anruf sofort, Herr Verwalter?«
»Ehrensache, Herr Baron. In zehn Minuten war er hier. Wo
es nämlich was zu helfen gibt, da sind die Güldenroder
immer gleich zur Stelle.«
Rot flammte es auf der Stirn Hellnors auf.
»In Ordnung«, sagte er dann wie abschließend. »Ich sehe

ein, daß Sie sich arg in der Klemme befanden, Herr Verwal-
ter. Ist Graf Thorbrandt noch im Stall?«
»Jawohl, Herr Baron. Er hat der Stute beistehen müssen.«
»Ist gut, Herr Klissat«, winkte er kurz ab und sah dann die
Seinen an, die so dastanden, als sei es ihnen gar nicht wohl
in ihrer Haut. Als man gerade überlegte, wie man sich ver-
halten sollte, trat der Graf aus der Stalltür. Auch er schien
von dem Anblick der Familie Hellnor unangenehm berührt
zu sein. Und nun galt es für Gisbert von Hellnor etwas zu
tun, was bitter schwerfiel. Ganz langsam, als hätte er Blei
an den Füßen, ging er auf den Mann zu und reichte ihm
die Hand.
»Ich danke Ihnen, Herr Graf, für die tatkräftige Hilfe. Wie
mir der Verwalter erzählte, stand es sehr ernst um die Stu-
te.«
»Ja, es war höchste Zeit«, kam die Antwort knapp. »Daher
griff ich auch ein, was ich nur tue, wenn ein Tier wirklich in
Gefahr steht und kein Tierarzt zu erreichen ist, was ja auch
hier der Fall war. Gottlob kam ich noch nicht zu spät. Bei-
de Pferde sind wohlauf, Herr Baron.«
»Und das verdanke ich Ihnen.«
Er hielt erschrocken inne, denn aus dem Stall kam ein Auf-
schrei. Während die beiden Herren miteinander sprachen
und die andern gespannt zuhörten, hatte Sidonie sich un-
bemerkt entfernt, um sich das Fohlen anzusehen. Sie betrat
den Verschlag, wo die Stute auf einer Schütte Stroh lag und
ihr aus schon wieder klaren Augen entgegenschaute. Vor
ihr stand das Fohlen, die langen, staksigen Beine breit ge-
spreizt. Es konnte kaum daraufgehen, so zitterten die drol-
ligen Stelzen. Denn als Sidonie sich arglos niederbeugte
und das putzige Tierchen streichelte, keilten die Hinterbei-
ne aus, wobei die Fürwitzige etwas abbekam. Sie schrie auf,
mehr vor Schreck als vor Schmerz, denn es war noch
glimpflich abgegangen, obgleich Blut aus der Wunde floß.
Randulf, der Sidonie am nächsten stand, war zuerst bei ihr.
Mit einem Blick hatte er die Sachlage erfaßt, griff nach der
Instrumententasche und holte blutstillende Watte hervor.

Und als nun auch die andern erschrocken herbeieilten,
hielt er die Baronesse bereits umfaßt, drückte mit der Lin-
ken ihren Kopf gegen seinen stützenden Arm, während die
Rechte den Wattebausch gegen die Mädchennase preßte.
»Um Gott, Sido, was ist dir geschehen?« rief die Mutter
entsetzt, doch der Graf winkte beruhigend ab.
»Kein Grund zur ernstlichen Besorgnis, Frau Baronin, eine
Nase blutet bald.«
»Wie konnte das passieren?« fragte der Vater, dem der
Schreck noch in den Gliedern saß. Und da die Tochter,
durch die Watte gehindert, keine Antwort geben konnte,
sprach Randulf wieder:
»Wahrscheinlich ist die junge Dame dem Fohlen zu nahe
gekommen, das nach beliebter Art dieser kleinen
Nichtsnutze auskeilte. Stimmt's, Baronesse?«
Ein Nicken des Mädchenkopfes, und ängstlich fragte Cor-
nelia:
»Ist die Nase am Ende gar gebrochen, Herr Graf?«
»Gottlob nicht, Frau Baronin. Nur ein wenig lädiert, was
jedoch schon in wenigen Tagen behoben sein dürfte.«
Behutsam zog er die Watte fort, schaute prüfend auf die
Nase, die nur mäßig geschwollen war und auch nicht mehr
blutete. Da gab er das Mädchen frei und sagte sachlich:
»Bitte jetzt rede Erschütterung zu vermeiden, Baronesse.
Am besten, Sie legen sich flach und geben dem Naschen
kühlende Umschläge. Wenn es wider Erwarten doch noch
bluten sollte, legen Sie dieses darauf.«
Er reichte ihr ein Päckchen mit Watte.
»Haben Sie Dank für Ihre Hilfe, Herr Graf.«
»Einer Selbstverständlichkeit gebührt kein Dank, Barones-
se«, wehrte er höflich ab, indem er von ihr fort trat.
»Na, Sido, du schaust ja reizend aus«, neckte der Bruder.
»Man muß schon sagen, daß dein Fohlchen dir eine lie-
benswürdige Begrüßung zuteil werden ließ.«
»Laß sie in Ruhe, du Spötter«, gebot die Mutter lachend.
»Dir hätte es genauso ergehen können. Nehmen Sie auch
meinen Dank hin, Herr Graf. Sie scheinen ein Meister zu
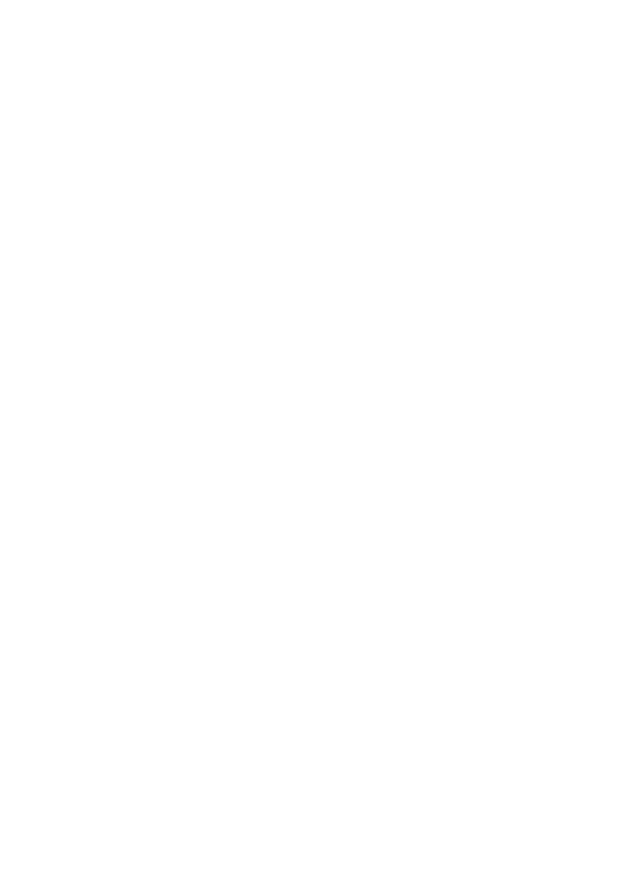
sein in der Behandlung vierbeiniger und zweibeiniger –
Gäulchen.«
Da zuckte ein Schmunzeln um den Männermund. Man
lachte, während Sidonie ein rotes Köpfchen bekam.
»Ist das vielleicht nett von dir, Nel?« fragte sie vorwurfsvoll.
»Naja, wer den Schaden hat…«
Dann drohte sie zu dem Fohlen hin, das, fest an die Mutter
geschmiegt, das Menschenkind aus so sanften Augen an-
sah.
»Tu nur so fromm!« lachte Sidonie. »Na warte, ich werde
dich später gehörig an die Kandarre nehmen.«
»Recht so, Baronesse, das hat der nichtsnutzige Schlingel
auch verdient«, bekräftigte der Verwalter, der jetzt wieder
über das ganze Gesicht strahlte. Gott sei Dank war alles viel
besser gegangen, als er befürchtet hatte. Friedlich unterhielt
sich seine Herrschaft mit dem befehdeten Nachbarn. Als
Cornelia ihn jedoch bat, mit ihnen ins Haus zu kommen
und sich an einem guten Trunk zu stärken, lehnte er ab.
»Verbindlichsten Dank, Frau Baronin werden verstehen,
daß ich mich als Autofahrer vorsehen muß.«
Nachdem er noch einmal den Dank der Familie Hellnor
und den des Verwalters entgegengenommen hatte, stieg er
ins Auto. Kaum war dieses abgefahren, wurde ein anderes
sichtbar. Ihm entstieg der Tierarzt.
»Komme ich noch zur Zeit, oder hat mir mein gefürchteter
Konkurrent wieder einmal ins Handwerk gepfuscht?«
»Er hat, er hat!« gab der Verwalter vergnügt zurück. »Mutter
und Kind sind wohlauf.«
»Gott sei Dank! Stand es schlimm mit der Stute?«
»Allemal, Herr Doktor. Sonst hätte ich bestimmt Ihr Kom-
men abgewartet, das mir am Fernsprecher zugesagt wurde,
und nicht den >Notnagel< herzitiert.«
»Notnagel ist gut«, schmunzelte der Arzt. »Bleibt mir somit
nichts anderes übrig, als die böse Stute, samt ihrem Nach-
wuchs in Augenschein zu nehmen.«
Nachdem er das getan, trat er wieder zu den anderen.
»Geht alles in Ordnung, meine Herrschaften. Ein prächtiges
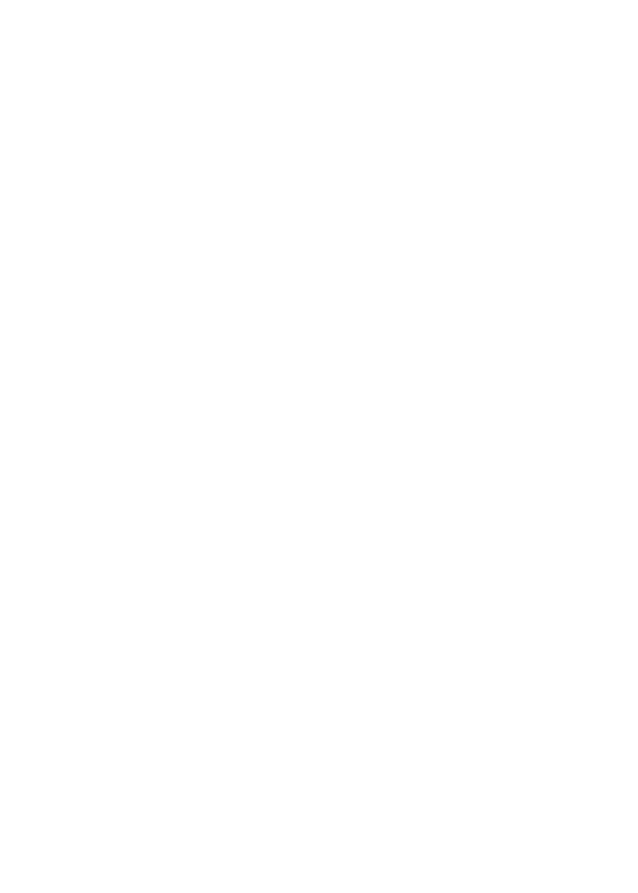
Kerlchen, das Füllen.«
»Hat sich auch schon glänzend bewährt«, meinte der Baron
trocken und erzählte das kleine Mißgeschick seiner Tochter,
was den Arzt wieder schmunzeln ließ.
»Das nennt man Pech, Baronesse. Aber der Schreck ist wohl
größer gewesen als das Unheil.«
»Wie steht es nun mit dem Honorar, Herr Doktor?« fragte
Hellnor gespannt.
»Das steht dem Doktor Thorbrandt zu, Herr Baron. Da er
jedoch nie Gebrauch davon macht, bitte ich in seinem
Namen, das ihm Zustehende an den Tierschutzverein zu
überweisen.«
»Wird das immer so gehalten?«
»Jawohl. Der Graf springt ja auch nur in den dringendsten
Fällen ein, wo Eile Not tut und ich oder einer meiner Kol-
legen nicht erreichbar sind. Natürlich gab es auch Schlaue,
die das ausnutzen wollten und billig dabei wegzukommen
gedachten. Sie zogen hinterher lange Gesichter, wenn sie
trotzdem auf Heller und Pfennig an den Tierschutzverein
zahlen mußten«, schloß er lachend, und die anderen freu-
ten sich mit ihm.
Auch der Tierarzt lehnte ab, als er gebeten wurde, sich an
einem Trunk zu laben, weil er zu einem erkrankten Tier
mußte. So fuhr er denn ab. Der Verwalter sah noch einmal
nach der Stute, und Familie Hellnor ging ins Haus. Auf der
Mutter Zureden legte sich Sidonie auf den Diwan und
kühlte die Nase.
»Es ist doch wie ein Verhängnis, daß wir diesem Randulf
Thorbrandt immer mehr verpflichtet werden«, sagte der
Vater unbehaglich zu den Seinen. »Und daß man fortlau-
fend Eigenschaften an ihm entdecken muß, die allen Lobes
wert sind.«
»Jetzt schäm dich aber mal, mein lieber Mann«, lachte
Cornelia. »Nur damit du recht behältst, sollen die Thor-
brandts Banausen sein? Die benehmen sich doch wahrlich
so reserviert wie möglich, selbst den alteingesessenen
Nachbarn gegenüber.«

»Wenn wir nur davon verschont bleiben würden!« brumm-
te der Gatte, und vom Diwan her kam es mißmutig:
»Tatsächlich. Dieser Mann ist gerade immer dann zur Stel-
le, wenn ich mich in kläglicher Verfassung befinde. Daß
mir das heute in seiner Gegenwart passieren mußte, ist
einfach eine Blamage. Aus der Haut könnte man fahren
und muß statt dessen noch >Dankeschön sagen.«
»Viel zu wenig, Schwesterchen«, ulkte Roger. »Einen Blu-
mentopf mußt du ihm schicken als Anerkennung für erste
Hilfe bei Unglücksfällen. Um dir das zarte Gebilde hohnla-
chend an den Kopf zu werfen, dazu ist der Mann viel zu
sehr Kavalier.«
»Nein, aber vor der Tür stehen lassen würde er es«, ergänzte
die Mutter trocken. »Warum zerbrecht ihr euch den Kopf
über Unmöglichkeiten? Es kommt ja doch alles so, wie es
kommen soll. Und wenn wir alle nach Chile zurückkehren
wollten, so würde uns selbst dort dieser Thorbrandt als
Retter erscheinen, wenn das Schicksal es will.«
Die Landwirte hatten in den vergangenen Wochen schwer
auf Posten sein müssen, aber nicht umsonst. Es wurde
glänzend belohnt. In den langen Scheunen der umliegen-
den Gehöfte türmte sich knistertrockenes Heu, gehaltvoll
und üppig, wie schon seit Jahren nicht mehr. Man rechnete
schmunzelnd aus, was dieser reiche Segen an klingendem
Wert einbringen würde, allein, man soll immer nur mit
dem Spatzen rechnen, den man in der Hand hält, niemals
mit der Taube auf dem Dach.
Diese Taube flog denn auch davon – und zwar von dem
Scheunendach auf Güldenrode. Darauf setzte sich nun der
rote Hahn.
Im Nu loderten die Flammen hoch, war es für sie doch ein
lockernder Fraß, der unter dem Dach steckte. Wie bei
leichtem Plunder leckte die züngelnde Glut sich durch das
trockene Heu.
»Feuer!!!« gellte das Horn und »Feuer!!!« rief es entsetzt
durch die Umgebung. »Auf Güldenrode brennt es!!!«
Und dann ging es los. Die Besitzer der größeren Güter, die

über Spritzen verfügten, zogen sie rasselnd aus dem Ge-
wahrsam. Wer keine hatte, eilte dennoch zur Brandstätte.
Vater und Sohn Hellnor, die aus der Stadt kamen und sich
unweit von der Allee befanden, die nach Güldenrode führ-
te, schauten betroffen auf den blutroten Schein. Das konn-
te doch keinesfalls Abendrot sein! Erstens war es dazu noch
zu früh, und dann leuchtete das Rot doch so anders.
»Paps, es brennt auf Güldenrode!« rief Roger entsetzt. Die
Augen der beiden Männer trafen sich – und schon trat der
junge Mann auf den Gashebel, daß der Wagen ruckartig
vorschoß. Scharf um die Ecke herum, die Allee entlang,
und schon wenig später raste das Auto auf den großen
Gutshof.
Doch da schien alles in Ordnung zu sein. Wenn auch von
dem Flammenschein rot beleuchtet, so standen die langen
Stallgebäude sowie die riesige Hauptscheune unversehrt da.
Aber da hinten, auf dem Nebenhof, da loderte es hell. Und
als das Marsteiner Auto an der Brandstätte hielt, waren die
beiden Gutsspritzen bereits in Tätigkeit gesetzt. Nicht auf
die lange brennende Scheune schoß der Wasserstrahl. Das
hatte bei dem Holzbau keinen Zweck mehr. Aber die
Hauptscheune, die der brennenden gegenüber lag, sowie
die beiden massiv gebauten Ställe, die rechts und links den
Hof zu einem Viereck abschlossen, das alles mußte vor
dem sprühenden Funkenregen geschützt werden. Uner-
müdlich arbeiteten die beiden Spritzen. Dann rasselten
auch die der Nachbargüter von allen Seiten herbei und
zuletzt noch die große aus der Stadt. Viele helfende Hände
fanden sich, um das Wasser aus dem See hochzupumpen.
Die beiden Hellnors standen untätig in dem Tumult, hat-
ten dessen nicht acht, daß ein Wasserstrahl sich auch ein-
mal verirrte und über sie sprühte. Zu helfen gab es nichts
für sie, da jeder Platz bereits besetzt war. Das Vieh befand
sich gottlob auf der Weide, und das wenige, das noch im
Stall war, zerrte man eben heraus.
Mit einem der Zuchtstiere plagten sich die beiden Grafen
ab, aber der zweite stand noch im Stall, wie man sich von

allen Seiten aufgeregt zurief. Der würde wohl dran glauben
müssen. Nicht durch die Flammen. Die konnten dem mas-
siven Gebäude, das andauernd berieselt wurde, nichts
mehr anhaben, aber der Rauch, der durch die Tür drang,
war gefährlich. Man hörte das Brüllen, das Rasseln der Ket-
ten, an denen das aufgeregte Tier zerrte und riß. Schon da-
durch allein konnte es zu Schaden kommen. Wenn nun der
wertvollste der Zuchtbullen einging, würde es für Gülden-
rode einen schweren Verlust bedeuten. Doch wer wagte
sich an das Tier heran, das ohnehin schon böse war, durch
den Tumult und die Flammen erschreckt wie rasend tobte.
Großer Gott, da waren die beiden Grafen schon wieder im
Stall verschwunden. Das gibt ein Unglück, hörte man die
Frauen, die schon aus Neugierde auf der Brandstätte nicht
fehlten, klagen und jammern.
Jetzt lief auch noch der Oberinspektor nach – und dann,
wer war das, der auf den Stall zueilte? Tatsächlich, der jun-
ge Baron aus Marstein! Scheue Blicke streiften den Vater,
der blaß aber aufrecht dastand und den starren Blick auf
die Stalltür gerichtet hielt. Es waren nur Frauen, die dem
allen zuschauten; denn die Männer waren vollauf beschäf-
tigt.
Auch die Gräfin und ihre Tochter befanden sich in dem
Tumult. Aber gewiß nicht aus Neugierde, sondern um et-
waige Verletzte zu betreuen, die es gottlob bis jetzt noch
nicht gab.
Und dann stand die Gräfin Thorbrandt vor dem Baron
Hellnor, todblaß, in den Augen flackernde Angst.
»Herr Baron, rufen Sie Ihren Sohn zurück«, flehte sie. »Er ist
erst kurze Zeit Landwirt und weiß daher nicht, wie gefähr-
lich ein Stier bei Feuer sein kann. Es ist ein frevelhaftes
Spiel mit dem Leben, das er treibt.«
»Bitte, Herr Baron, tun Sie es doch«, flehte sie auch das an
allen Gliedern zitternde Komteßchen. »Ich habe ihn schon
gewarnt, aber er hörte nicht auf mich…«
Ehe Hellnor noch antworten konnte, gab es ein ohrenbe-
täubendes Getöse, das von der Feuerstelle her kam. Und

gerade, als die Balken der brennenden Scheune krachend
zusammenbarsten und das Feuer sich nunmehr auf den
Boden beschränkte, wurde der Stier sichtbar. Der junge
Graf zog den Stock, an dem der Nasenring befestigt war,
der Vater hielt an einer, der junge Baron an der anderen
Seite je ein Horn des Bullen umklammert, und an den
Lenden schob der Oberinspektor nach. Das gereizte Tier
schnaufte vor Zorn, bemühte sich auszubrechen, doch die
acht Hände, die es hielten, waren eisenhart. Verbissen
kämpften sie mit dem blindwütigen Tier, bis Verstärkung
kam, und zwar durch den Oberschweizer. Er hatte mit sei-
nen Gehilfen auf einer Weide die Kühe gemolken und den
Flammenschein erst gar nicht bemerkt. Jetzt jedoch kamen
sie angerannt und brachten den mutigen Männern Hilfe.
Der Oberschweizer ergriff den Stock und redete dem aufge-
regten Tier, das bei der vertrauten Stimme seines Pflegers
die Ohren spitzte, gütlich zu:
»Na, na, Alter, man nicht so ungemütlich. Sei froh, daß du
noch lebst. Kennst mich nicht, du Dussel? Ich bin doch
dein Freund.«
Und tatsächlich ließ das Toben des Tieres nach. Noch eini-
ge Sprünge, wie die eines Stiers in der Arena, dann stand
der prächtige Bursche, der ein kleines Vermögen wert war,
friedlich da.
»Wohin mit ihm, Herr Graf?« fragte der Oberschweizer.
»Zuerst einmal in den vorderen Stall, wo auch der kleinere
Bulle steht. Jedenfalls so lange, bis sich der Rauch verzogen
hat.«
Ganz zufrieden ließ sich der Stier von seinem Betreuer ab-
führen, und die vier tapferen Männer holten zuerst einmal
tief Luft. Sie waren rauchgeschwärzt, die Hände bluteten,
die jetzt in das Zigarettenetui griffen, das der Baron Gisbert
ihnen schweigend hinhielt. Sie fuhren alle erschrocken
zusammen, als Heidgar angstvoll rief:
»Herr Baron, Sie sind ja verletzt!«
Jetzt wurden auch die anderen aufmerksam und starrten
auf den blutdurchtränkten Ärmel des seidenen Sporthem-

des, das Roger trug. Das Gesicht darüber war blutleer.
Behutsam rollte Randulf den Ärmel hoch, der jetzt eine
vielleicht zehn Zentimeter lange klaffende Wunde freigab,
aus der unaufhörlich Blut sickerte.
»Vater, einen Arzt«, stieß der junge Graf durch die Zähne.
»Herr Oberinspektor, Sie helfen mir den Verletzten ins
Haus tragen. Fassen Sie die Beine, und Sie, Herr Baron,
stützen bitte den Rücken.«
So bewegte sich der traurige Zug dem Schloß zu – und be-
treten sahen ihm die Menschen nach. Die Gräfin und ihre
Tochter waren schon vorangelaufen, um dem Verletzten ein
Lager zu richten, auf das man den durch den Blutverlust
ohnmächtig gewordenen Mann behutsam legte. Randulf
eilte davon und kam mit einem Medikamentenkasten zu-
rück. Er desinfizierte zuerst die Wunde, dann legte er ein
blutstillendes Mittel darauf. Aber das Blut rieselte weiter:
»Es muß eine Ader verletzt sein«, stieß Randulf hervor.
»Wenn doch erst der Arzt hier wäre…«
Eben betrat Graf Albrecht das Zimmer und fuhr sich nervös
durch die Haare.
»Nun, Vater, wie ist's?«
»Zum Wahnsinnigwerden!« knirschte er hervor. »Vier Ärzte
rief er an. Einer verreist, einer bei einer Gebärenden, einer
über Land, einer selbst krank – es ist tatsächlich, als ob sich
alles gegen uns verschworen hätte!«
»Es muß aber ein Arzt her!« verlangte Randulf. »Die Wunde
muß schnellstens genäht werden, sonst verblutet der Ver-
letzte. Ruf das Krankenhaus an, Vater.«
»Einen Moment, bitte«, schaltete sich nun der Baron ein,
der zwar blaß, aber bewunderswert gefaßt war. »Bis der
Krankenwagen hin und zurück ist, bis im Krankenhaus die
Formalitäten erledigt sind, dürfte es für meinen Sohn leicht
zu spät sein. Sie als so guter Tierarzt müßten doch auch
von der Behandlung der Menschen etwas verstehen, nicht
wahr, Herr Graf?«
»Das schon, Herr Baron, zumal ich noch einige Semester
davon mitnahm. Aber das reicht nur für den Hausge-

brauch.«
»Das genügt. Wollen Sie die Wunde nähen?«
»Nein, Herr Baron.«
»Herr Graf, bis Hilfe kommt, verblutet mein Sohn. Das
sehe ich selbst als Laie. Und ich liebe diesen Sohn sehr…«
Da straffte sich die hohe Männergestalt, ein tiefes, zittern-
des Atemholen.
»Gut, auf Ihre Verantwortung, Herr Baron. Komm, Vater,
drücke die Wunde mit diesem desinfizierten Tuch zusam-
men. Du, Heidgar, wirst die Narkose geben.«
»Das kann ich nicht, Randulf.«
»Du mußt!« herrschte er sie an. »Es geht hier um ein Men-
schenleben!«
Und dann ging alles sehr schnell. Alle spannte Randulf,
dessen Antlitz hart und blaß war, zu Handreichungen ein,
selbst die Mutter – und alle folgten seinen knappen Befeh-
len. Heidgar, die unter seiner scharfen Beobachtung die
Narkose gab, mußte sich eisern zusammenreißen, damit sie
nicht schlapp machte. Angstgefoltert starrte sie in das blei-
che Männerantlitz, das dem eines Toten glich. Heiß tropf-
ten ihre Tränen darauf hernieder.
Aber sie hielt sich tapfer. Erst, als alles vorüber war und der
verletzte Arm sauber genäht und vorschriftsmäßig verbun-
den in der Binde ruhte, sank Heidgar lautlos in sich zu-
sammen.
Als sie wieder zu sich kam, hielt der Bruder ihr eine stark-
riechende Essenz unter die Nase.
»Schäm dich, Schwesterlein, so schlapp zu machen!« sagte
er zärtlich. »Geht's jetzt schon wieder?«
»Ja, Randulf, ich schäme mich wirklich. Aber weißt du, ich
habe mich so entsetzlich aufgeregt – und – ich kann doch
so schlecht – Blut sehen…«
»Du brauchst dich gar nicht zu entschuldigen, Marjell-
chen«, griff der Vater ein. »Hast dich tapfer genug gehalten.
Aber du kennst ja unseren Randulf. Er meint, alle müßten
Nerven aus Stahl und Eisen haben, wie er.«
Die Mutter trat heran und hielt der Tochter ein Glas stär-

kenden Weines an die Lippen.
»Trink, mein Herzblatt. Das wird dir guttun. Ich habe auch
schon davon getrunken, und es hat mich wunderbar be-
lebt.«
»Und ich als Hauptperson soll leer ausgehen?« kam eine
Stimme vom Diwan her. Überrascht trat man hinzu, und
Roger lachte sie vergnügt an.
»Junge, da bist du ja!« sagte der Vater freudig. »Wie geht es
dir, hast du Schmerzen?«
»Ach, woher denn? Ein bißchen schlapp bin ich, weiter
nichts. Was ist denn eigentlich mit meinem Arm?«
»Das müßtest du doch wohl am besten wissen, mein Sohn.
Wie kamst du überhaupt zu dieser Wunde?«
»Keine Ahnung! Es ging mit dem blindwütigen Bullen so
heiß her, daß man gar nicht zur Besinnung kam. Ich fühlte
es nur plötzlich heiß an meinem Arm rinnen – und dann
habe ich wohl schlapp gemacht.«
»Kein Wunder, bei dem starken Blutverlust. Es muß eine
Ader getroffen sein, und du wärest wahrscheinlich verblu-
tet, bis ärztliche Hilfe zugegen gewesen wäre.«
»Und wer hat die Wunde genäht?«
»Hier, der Herr Graf.«
»Donnerwetter!« sagte Roger verblüfft. »Das scheint ein
Mann zu sein, der alles kann. Da muß ich Ihnen wohl von
ganzem Herzen danken.«
»Ich glaube, der Dank gebührt Ihnen, Herr Baron. Es war ja
schließlich unser Bulle, der Sie verletzte – und auch wir, für
die Sie Ihr Leben aufs Spiel setzten.«
»Na, so genau wollen wir das nicht austüfteln«, wehrte Ro-
ger verlegen ab. »Bekomme ich nun ein Glas Wein? Ich
habe es doch eher verdient als die Komteß, will ich mei-
nen.«
»Sagen wir, ihr beide habt es euch redlich verdient«, lachte
der Vater, der ja so froh war, seinen Jungen so munter zu
sehen. »Deinetwegen klappte die junge Dame zusammen,
die während der ganzen Prozedur dem Bruder hat assistie-
ren müssen.«

»Um Gott, Komteß, das tut mir aber leid.« Seine Augen
suchten das Mädchengesicht, das unter dem mitleidigen
Blick heiß errötete. Dann trat sie auf ihn zu, umspannte
seinen Kopf weich mit den Händen und hob ihn behutsam
an, damit der Mann das Glas leeren konnte, das ihm die
Gräfin an die Lippen hielt.
»Was geht es mir doch gut!« brummte er zufrieden, als er
wieder im Kissen lag. »Aber ich glaube, Paps, wir müssen
gehen, damit die Herrschaften, die ja an diesem Tage so
mancherlei geleistet haben, zur Ruhe kommen können.«
»Damit werden Sie sich noch ein wenig gedulden müssen«,
erklärte Randulf gelassen. »So lange, bis der Arzt hier gewe-
sen ist und Ihren Arm in Augenschein genommen hat.«
»Womöglich rücken alle Ärzte an, die ich bestellte«, sagte
Graf Albrecht erschrocken, doch der Sohn winkte ab.
»Keine Angst, Vater, ich habe sie bereits abbestellt. Nur
unsern guten Dr. Butte erwarte ich.«
Es dauerte aber doch noch eine gute Weile, bis der Arzt
erschien. Nachdem er den Arm des Kranken untersucht
hatte, sagte er sachlich:
»Alles in Ordnung, ich hätte es nicht besser machen kön-
nen.«
»Ist mein Sohn transportfähig, Herr Doktor?«
»Das schon. Aber man muß vorsichtig dabei zu Werke ge-
hen, damit nicht womöglich eine erneute Blutung eintritt.
Was meinen Sie dazu, Herr Graf?«
»Das weiß ich nicht«, kam die Antwort knapp. »Ich bin
allenfalls Tierarzt.«
»Na, nun tun Sie man nicht so«, lachte der alte Herr behag-
lich, der Randulf bereits auf die Welt geholt hatte und als
lieber, guter Hausarzt von der gräflichen Familie sehr ge-
schätzt wurde. »Sie wissen ganz genau, was los ist. Ist eine
erneute Blutung zu befürchten?«
»Ich glaube nicht.«
»Na, also! Am besten wäre allerdings ein Krankenwagen…«
»Das fehlte gerade noch!« wehrte Roger sich entrüstet. »Ich
bin doch schließlich kein bleichsüchtiges Fräulein, sondern

ein sportgestählter, abgehärteter Mann, dem ein kleiner
Aderlaß bestimmt nichts schadet. Krankenwagen – daß ich
nicht lache! Meine Mutter und meine Schwester würden
schon erschrecken, wenn ich so einem angsteinflößenden
Gefährt entstiege. Wo sind sie überhaupt, Paps?«
»Zu Hause, mein Junge. Ich habe angerufen und gesagt,
daß es spät werden würde, bis wir nach Hause kämen.«
»Weiß Nel, was los ist?«
»Nein, das erfährt sie, wenn sie dich sieht.«
»Recht hast du, und nun werde ich mich aus meinem wei-
chen Pfühl erheben.«
Schon griffen hilfreiche Hände nach ihm, und obwohl sich
Roger nach dem argen Blutverlust geschwächt fühlte, hielt
er sich tapfer. Wohlverwahrt saß er auf dem hinteren Sitz
des Autos, der Vater neben ihm, und Randulf steuerte. Graf
Albrecht folgte im eigenen Wagen, der ihn und den Sohn
von Marstein nach Hause zurückbringen sollte. Die weni-
gen Kilometer waren zurückgelegt, die beiden Thorbrandts
waren noch behilflich, Roger in die Halle zu bringen. Dann
verabschiedeten sie sich mit den besten Wünschen – und
mit Dank für geleistete Hilfe während des Brandes.
»Das war doch wohl selbstverständlich!« entgegnete Roger.
»Daß mir dabei das kleine Malheur passiert ist, eben mein
persönliches Pech. Dafür habe ich ja auch genug Aufregung
verursacht«, schloß er lachend. »Also dürften wir quitt
sein.«
»Wenn Sie es so auffassen, fällt uns ein Stein vom Herzen«,
lachte Graf Albrecht mit ihm, während Randulf dem Baron
Gisbert ein Röhrchen mit Tabletten reichte.
»Geben Sie dem Herrn Sohn eine davon, Herr Baron, falls
sich Wundfieber einstellen sollte. Steigt es hoch, bitte Dr.
Butte sofort zu verständigen, der die Behandlung über-
nommen hat.«
Damit gingen die beiden Herren, während Vater und Sohn
das Zimmer betraten, in dem Cornelia und Sidonie saßen.
Als erstere Roger sah, schrie sie entsetzt auf.
»Junge, was ist dir geschehen?«

»Bitte, Nel, keine Aufregung«, beschwichtigte der Gatte.
»Sie ist jetzt nicht mehr erforderlich. Komm, sei mir behilf-
lich, den Jungen bequem zu betten, dann will ich dir alles
erklären.«
Da fragte sie nicht weiter. Erst, als Roger auf dem Diwan lag
und vor Erschöpfung eingeschlafen war, erstattete der Vater
Bericht. Angsterfüllt hörten die beiden Damen zu, dann
sagte Cornelia leise:
»Dem Herrgott sei Lob und Dank, daß alles noch so glimp-
flich ablief. Und wir saßen hier so ahnungslos.«
»Ein Glück, daß ihr ahnungslos wart, da ist euch viel Aufre-
gung erspart geblieben. Ich habe um unsern Jungen vor
Angst gezittert, das darfst du mir schon glauben, Nel. Aber
weiß der Kuckuck, dieser Randulf Thorbrandt strömte so
viel zuversichtliche Ruhe aus, daß man an ein Unglück gar
nicht zu denken wagte. Ich hätte keinem andern als ihm
die Behandlung des Verletzten so vertrauensvoll in die
Hände gelegt.«
»Ja, er scheint ein Mensch zu sein, wie man ihn selten fin-
det«, entgegnete Cornelia versonnen. »Der sagt nicht viel,
der handelt – und immer nur nach Ehre und Gewissen.
Aber auf unsern Jungen können wir stolz sein, Gisbert.«
»Da hast du recht, Nel. Obgleich ich um sein Leben zitterte,
war ich wiederum stolz, daß er so kühn den blindwütigen
Stier anging. Ich glaube nicht, daß Frank es zuwege ge-
bracht hätte.«
»Das wohl kaum, aber dafür hat er andere Qualitäten«,
nahm die Mutter ihren Ältesten in Schutz. »Und zwar die
des fairen, tüchtigen Geschäftsmannes. Jedenfalls können
wir über unsere Kinder glücklich sein.«
»Auch über mich?« fragte Sidonie kläglich. »Ich bin ja aber
auch nur ein Mädchen.«
»Und ein recht eigenwilliges dazu«, schmunzelte der Vater.
»Laß gut sein, Kleines. Wir sind trotzdem stolz auf dich.
Jedenfalls bin ich von Herzen froh, unsern Jungen so fried-
lich schlafend vor mir zu sehen. Übrigens bat mich die
Gräfin, Roger aus dem Stall zu rufen, und auch die kleine
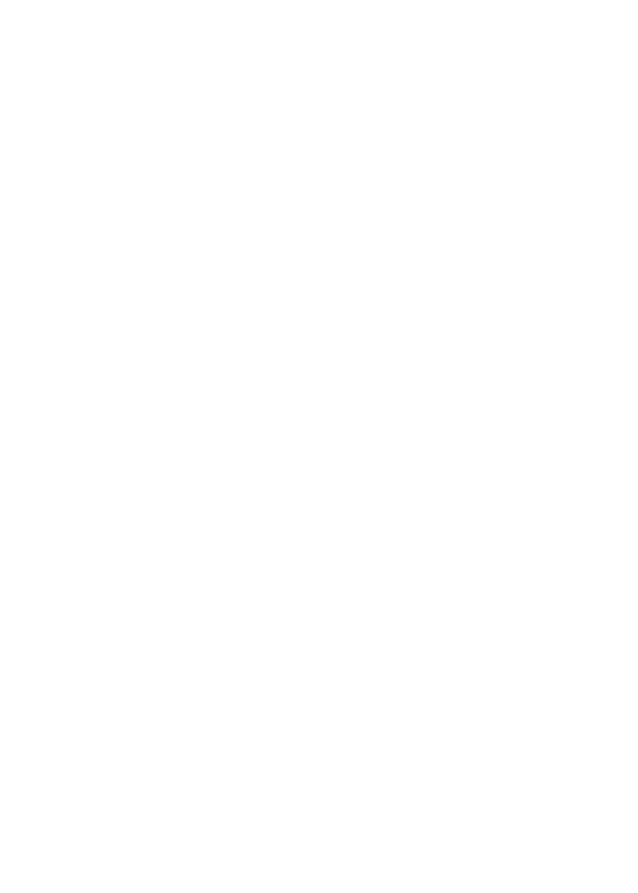
Komteß flehte mich darum an. Sie hätte ihn bereits ge-
warnt, aber nichts damit erreichen können. Habt ihr denn
wirklich nichts von dem Brand gemerkt, Nel?«
»Nein, Gisbert. Sido und ich fuhren eine Stunde später als
ihr zur Stadt, aus der wir erst kurz vor dem Abendessen
zurückkehrten. Als du anriefst, wußte ich ja nicht, woher
du sprachst. Und von der Dienerschaft hat niemand zu uns
von dem Brand gesprochen. Wie habt ihr das Feuer be-
merkt?«
»Auf dem Wege nach Hause, dort, wo wir ja, aus der Stadt
kommend, an der Allee, die nach Güldenrode führte, vor-
bei müssen…«
Er erstattete nun über den Brand ausführlichen Bericht und
hob immer wieder den Mut der vier Männer hervor, mit
dem sie den blindwütigen Stier angingen. Er klärte ihnen
auch, wie störrisch sich sämtliche Tiere bei Feuer beneh-
men – und gar noch ein Bulle. Dann kam er auf die Verlet-
zung Rogers zu sprechen, der damit ihn und die Thor-
brandts in Angst und Schrecken versetzt hatte.
»Und wie benahm sich die Komteß bei alledem?« – wollte
Sidonie wissen.
»Die zitterte natürlich vor Entsetzen. Aber ohne Gnade
mußte sie, wie wir andern auch, dem Bruder assistieren. Als
sie das nicht wollte, fuhr er sie hart an.«
»Dieser abscheuliche Mensch!« empörte Sidonie sich. »Mir
hätte er nur so kommen müssen!«
»Dann hättest du bestimmt getan, was von dir verlangt
wurde«, fiel der Vater trocken ein. »Denn es ging ja um ein
Menschenleben. Sie mußte Roger die Narkose geben. Erst,
als alles vorüber war, brach sie zusammen.«
»Fuhr der Bruder sie etwa auch da an?«
»O nein, mein Kind, da ging er sogar recht zärtlich mit ihr
um«, entgegnete der Vater lächelnd. »Die Hände, die zu
gegebener Zeit hart zupacken, können auch weich und be-
hutsam sein, die herrische Stimme kann überaus zärtlich
klingen.«
»Und wie wurde es mit dem Brand, Gisbert? Denn die aus

dem Schloß haben sich wohl nicht weiter um ihn küm-
mern können, da unser Junge sie alle in Atem hielt.«
»Das tat er, Nel. Trotzdem wurde der Oberinspektor, der
Roger ins Schloß tragen half, vom Grafen Albrecht beor-
dert, draußen nach dem Rechten zu sehen. Dafür zu sor-
gen, daß die Menschen, die beim Brand halfen, mit Speise
und einem guten Trunk gelabt wurden. Du siehst, so leicht
verliert man auf Güldenrode die Nerven nicht.«
Der Brand sorgte dafür, daß man in der Nachbarschaft
interessanten Gesprächsstoff hatte. Die »Versippten« fan-
den sich in Prangen zusammen, um das Ereignis von allen
Seiten zu beleuchten. Der Held des Tages war natürlich der
junge Baron.
»Kinder, ich an eurer Stelle würde Marstein stürmen und
mir von dem jungen Helden Autogramme geben lassen.
Gewiß hat er sich schneidig benommen, aber das taten
andere auch. Sein Pech, daß er die nötige Vorsicht bei ei-
nem blindwütigen Bullen außer acht ließ, wahrscheinlich
deshalb, weil er die Tücken eines solch kraftstrotzenden
Tieres noch nicht kennt. Aber der Aderlaß scheint eurem
>Helden< nicht weiter geschadet zu haben. Wie mir der
Vater, den ich fernmündlich um das Ergehen seines Sohnes
befragte, nämlich verriet, geht es seinem Sprößling glän-
zend. Die Wunde heilt gut, der Patient ist fidel. Meine Be-
sorgnis kreist um ganz andere Dinge, und zwar, daß der
Brand der Scheune den Güldenrodern ein schwerer Schlag
auf ihren Geldbeutel ist.«
»Verstehe ich nicht, Vater.« Der Schwiegersohn zuckte die
Achsel. »Das Gebäude ist doch wahrscheinlich versichert.«
»Gewiß, aber soviel kommt da nie heraus. Schon das ver-
brannte Heu allein wird nie voll bewertet werden.«
Wohl zahlte die Versicherung, aber erst nach langen Unter-
suchungen und Palavern, wie, warum, wozu und wodurch
der Brand entstehen konnte. Vielleicht hätte jemand ein
Streichholz, eine brennende Zigarette oder gar…
So ging es hin und her, bis dem Grafen Thorbrandt sen. die
Geduld riß und er den neunmalklugen Herren in scharfen

Worten erklärte, daß er nun nicht länger mitmache. Sie von
Güldenrode wären weder Brandstifter noch sonstige Ha-
lunken.
Da endlich bequemten sie sich und zahlten, aber nur mä-
ßig. Jedenfalls reichte es nicht aus, um die Scheune wieder
aufzubauen und das verbrannte Heu zu kaufen. Ergo: Der
Besitzer mußte zusetzen, was tatsächlich ein harter Schlag
auf den Geldbeutel war.
Als sollten sie für die korrekte Handlung belohnt werden,
hatte das Gut eine so üppige Getreideernte, wie sie kein
anderes ringsum verzeichnen konnte. Schier überwältigend
war dieser reiche Segen, so daß die Scheunen ihn nicht
bergen konnten und ein Teil davon bereits auf dem Feld
ausgedroschen werden mußte. Selbst der Wettergott zeigte
sich gnädig und ließ keinen Regentropfen fallen, bis der
Wind über die Stoppeln fegte.
Also wurde auch diese Ernte eine gute, und so kam man
denn auf Güldenrode mit dem berühmtem »blauen Auge«
davon. Darüber herrschte natürlich Freude, und die Genug-
tuung, trotz des Verlustes, den der Brand gebracht hatte, es
wieder einmal geschafft zu haben.
Darüber unterhielten sich die vier Thorbrandts, als man an
einem Tag im Oktober geruhsam beisammen saß. Draußen
regnete es, aber der Regen war gut für die neue Saat.
»Na, Junge, das hätten wir wieder einmal gut hingekriegt«,
sagte der Vater, behaglich seine Zigarre rauchend. »Wäre
der Brand nicht gewesen, hätten wir diesmal eine ganz net-
te Rücklage machen können, aber man muß zufrieden sein.
Es bleibt sogar noch soviel übrig, um uns eine kleine Ab-
wechslung zu gönnen. Wie wäre es, wenn wir beim Einset-
zen des Winterwetters einen Winterkurort aufsuchen wür-
den? Verdient habt ihr es, meine Lieben.«
»Meinetwegen braucht es nicht zu geschehen«, meinte die
Gattin lächelnd. »Aber für die Kinder wäre so eine Reise
gut. Randulf hat doch schon manches von der Welt gese-
hen, aber Heidgar so gut wie nichts.«
»Was mir bestimmt nicht leid tut«, gab die Tochter fröhlich

zurück. »Nanni sagt, die Welt sei schlecht. Also will ich sie
erst gar nicht kennenlernen.«
»Eine einfache Philosophie!« lachte der Bruder. »Hast recht,
Kleines, bleiben wir unter unserm schützenden Dach, wo
wir uns glücklich fühlen.«
»Ihr kommt dort aber unter Menschen«, beharrte der Vater.
»Hört und seht vieles, könnt euch beim Sport tummeln,
könnt euch amüsieren bei Tanztees und sonstigen Veran-
staltungen, könnt dort sogar euren Lebenspartner finden.«
»Auf den bin ich auch gerade neugierig!« brachte Heidgar
so drollig heraus, daß sie lachen mußten. »Womöglich so
einen Salonhelden.«
»Nun, es wird ja auch noch andere geben.« Der Vater besah
sich schmunzelnd sein holdseliges Töchterlein. »Zum Bei-
spiel die Sportler. Das sind doch kühne, anständige Kerle.«
»Mag sein, aber die verlangen dann auch, daß ich ihre
Sportleidenschaft teile, und das kann ich nicht. Für mich
muß der Sport ein Vergnügen sein, nicht in Anstrengung
oder gar Strapazen ausarten. – Das der Sport! Und die fest-
lichen Veranstaltungen? Nun, die fangen doch im Novem-
ber hier wieder an. Allein schon in der >Clique<, dann in
der Stadt, außerdem die vergnüglichen Schlittenfahrten,
Theater, Kino, Konzerte, das dürfte doch wohl ausreichend
sein, oder nicht?«
»Uns schon«, lächelte die Mutter, die sich über die vernünf-
tigen Ansichten ihres jungen Kindes herzlich freute. »Aber
du mit deinen jetzt neunzehn Jahren hättest ein Recht auf
mehr. Gleichfalls Randulf.«
»Du meinst wohl, Muttchen: Der Mann muß hinaus ins
feindliche Leben«, lachte der Sohn. »Laß nur! Die Wochen,
die ich bereits in Winterkurorten verbrachte, in den Bergen,
an der See und in fremden Ländern, haben gereicht, um
Welt und Menschen kennenzulernen, dabei feststellen zu
können, daß überall auch nur mit Wasser gekocht wird.
Auch die Mädchen sind die gleichen, gute und schlechte.
Wenn ich mir also eines aussuchen will, finde ich auch
hier, was ich brauche.«

»Frauchen, was haben wir doch für vernünftige Kinder!«
schmunzelte der Vater. »Waren wir in dem Alter etwa auch
so?«
»Gewiß – «, gab sie schlagfertig zurück. »Sonst hätten wir
uns ja nicht geheiratet.«
Diese Feststellung löste herzliches Lachen aus, und man
war sich wieder einmal wundervoll einig. Auch als zwei
Wochen später ein Brief eintraf, wo schlicht auf Bütten zu
lesen stand, daß Baron Hellnor und Frau sich beehren und
so weiter.
»Also sind sie es, die diesmal die Winterfeste eröffnen«,
sagte Graf Albrecht unbehaglich. »Seht ihr, Kinder, hättet
ihr auf mich gehört und die vorgeschlagene Reise akzep-
tiert, wären wir jetzt genau so fort wie die Hellnors im vor-
igen Jahr, als wir unsere Gesellschaft gaben. Dann wäre es
ihnen genau so erspart geblieben, uns einzuladen, wie es
uns damals erspart blieb.«
»Meinst du, Paps, daß es ihnen wirklich so schwer gefallen
ist, uns einzuladen?«
»Bestimmt, Heidgar. Denn das >Thorbrandt contra Hell-
nor< besteht immer noch, obwohl sich der junge Baron
beim Brand so selbstlos für uns einsetzte, was gewiß nicht
uns persönlich galt, sondern nur seiner Hilfsbereitschaft
entsprach. Hilfsbereit sind die Hellnors. Wo es was zu hel-
fen gibt, stehen sie an erster Stelle. So hat auch der Baron
erst kürzlich eine größere Summe gestiftet, die zu der Aus-
besserung der Nebenstraßen dienen soll. Natürlich singen
diese Leute das Lob der Hellnors, und auch in der >Clique<
ist ihr Ansehen himmelhoch. Also, meine Lieben, schmei-
ßen wir uns in Wichs und leisten der Einladung brav Fol-
ge.«
»Na, wenn schon.« Randulf zuckte die Achsel. »Zusam-
mengekoppelt sind wir durch die >Clique< mit den Hell-
nors sowieso, also traben wir lustig Seite an Seite mit ih-
nen.«
»Wie recht du hast, Junge«, bekräftigte die Mutter, und
Heidgar lachte:
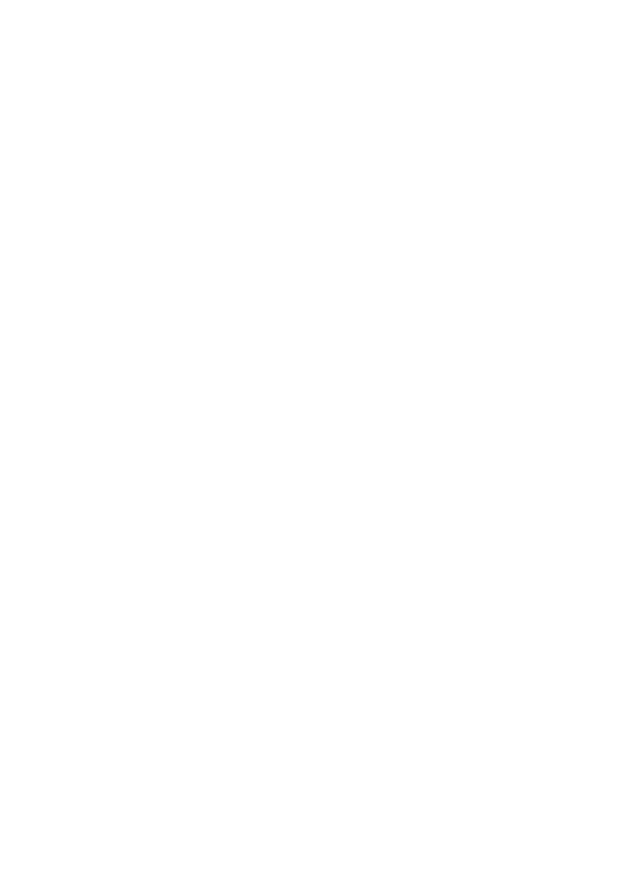
»Wenn es nur nicht den Kopf kostet, dann mache ich alles
mit. Was ich dabei denke – nun, die Gedanken sind frei.«
»Kinder, was sind wir doch für eine harmonische Familie!«
schmunzelte der Senior. »Also, dann auf ins feindliche La-
ger, und somit beginnt der Komödie zweiter Teil. Denn
durch den ersten haben wir uns im Schöße der >Clique<
bereits mit Talent hindurchgespielt.«
*
Die Gesellschaftsräume im Herrenhause von Marstein ers-
trahlten in hellem Lichterglanz, und diese Räume waren
schön.
Unter den Gästen befand sich auch ein gutes Dutzend
»Neulinge«, ein Zeichen, daß die Marsteiner ein größeres
Haus zu machen gedachten, als es in der »Clique« üblich
war. Es waren jedoch alles Menschen, die in den Kreis hi-
neinpaßten.
Daß auch die Güldenroder zu dem Fest erscheinen würden,
war einfach Ehrensache. Schon allein deshalb, weil der
junge Baron sich beim Brand so selbstlos gezeigt hatte.
Damit bewies er, daß die Fehde von ihm ignoriert wurde,
wie auch die Seinen es taten. Wie gut, daß er den verletzten
Arm wieder so gebrauchen konnte wie vordem.
Die Begrüßung zwischen den beiden Familien hätte aller-
dings herzlicher ausfallen können, aber Herzlichkeit war ja
den Güldenrodern ein fremder Begriff, und die Marsteiner
schienen auch nicht aus ihrer kühlen Haut herauszukön-
nen.
Aber, daß der Randulf die Sidonie und der Roger die Heid-
gar zu Tisch führte, das versöhnte die Nörgelnden restlos.
Auch, daß man die anderen Tischpartner so gesetzt hatte,
von denen man sagen konnte: Gleich und gleich gesellt
sich gern. Die Marsteiner hatten eben in der Gesellschafts-
führung »was weg«, was sie in der Achtung der »Clique«
noch steigen ließ.
Selbst der Oberst war beeindruckt, und das wollte schon
was heißen. Er führte die Gastgeberin zu Tisch, der Gastge-
ber Frau Suschen, eine Ehrung, die man anerkennen muß-

te.
Bei der Tafel ging es auch nicht anders zu als bei den übli-
chen Festtafeln. Und doch, irgendwie fiel sie aus dem ge-
wohnten Rahmen. Es gab Delikatessen, die man kaum dem
Namen nach kannte. Die Getränke waren einfach ein »Ge-
dicht«. Überall machte sich der Segen des Geldes bemerk-
bar.
Zuerst ging es an der Tafel noch ein wenig beklommen zu,
aber der alte schwere Wein löste allmählich die Zungen.
Und wie benahm sich die »Jugend« von Marstein und Gül-
denrode? Nun, recht ordentlich, wie man zu seiner Genug-
tuung feststellte. Die beiden jungen Paare unterhielten sich
friedlich, ihr Benehmen war einfach über jede Kritik erha-
ben.
Sie sahen aber auch bezaubernd aus, die jungen Damen,
und die Herren konnten sich neben ihnen durchaus sehen
lassen. Hauptsächlich der junge Graf, den nun einmal das
Fluidum des vornehmen Herrenmenschen umwob. Über-
haupt hatten die beiden Familien etwas an sich, worauf die
»Clique« mächtig stolz war.
So war man allgemein zufrieden, aß, trank und unterhielt
sich prächtig. Es befand sich auch nicht einer unter den
Gästen, der das Ende der Tafel herbeisehnte – nahm man
an.
O ja, gute Lebensart ist etwas, das jeder Situation gewach-
sen ist. Daher konnte es kommen, daß die beiden jungen
Paare sich so tadellos benahmen. Niemand merkte ihnen
an, daß hier Stolz gegen Stolz stand. Der Stolz, einer dem
anderen auch nicht um ein kleines entgegenzukommen.
Thorbrandt contra Hellnor, o nein, so leicht konnte man
darüber nicht hinweg. Äußerlich war man durch die Ver-
hältnisse dazu gezwungen, sich friedlich zu stellen, sich zu
vertragen, wie der Präses der »Clique« es kategorisch ver-
langte, doch innerlich stand die Fehde der Großväter
hemmend wie eine dichte Mauer zwischen ihnen.
Nach dem Essen kam dann der Tanz, dem man auf jeder
Geselligkeit zu huldigen pflegt.

Eben verneigte sich Randulf vor Sidonie und Roger vor
Heidgar – schon zum zweitenmal, wie die Aufpasser wahr-
nehmen konnten. Und wie die beiden Paare tanzten.
Wahrlich eine Augenweide! Beneidenswert, wen die Natur
mit einem so bestechenden Aussehen bedacht!
Ob sie sich selbst auch so beneidenswert vorkamen? Nun,
das ließ sich nicht ergründen. Jedenfalls tanzten sie sehr
korrekt.
Und dabei sang die Geige doch so süß.
Später wurde dann eine längere Pause eingelegt, damit die
Musiker sich stärken konnten. Was nun? Darauf wußte der
Oberst sofort die Antwort:
»Ein Pfänderspiel, das gehört doch nun einmal dazu.«
Man nahm es begeistert auf, und bald war das lustige Spiel
im Gange, wobei man sich köstlich amüsierte. Selbst Hut-
zelchen tat eifrig mit und bewies sich dabei als gar nicht
ängstlich.
Eben rief sie Sidonie zu:
»Baronesse, wie hieß der erste Kutscher? Eins, zwei, drei –
Sie wissen es nicht, bitte Pfand zahlen. – Graf Randulf, wie
hieß der erste Kutscher?«
»Leid«, entgegnete er lachend. »In der Bibel steht: Mit Leid
sollst du in die Grube fahren.«
»Bravo! Der nächste Frager!«
Das war der Oberst, dessen Fragen es genau so in sich hat-
ten wie die seiner Schwestern. Schmunzelnd nahm er den
Sohn des Hauses aufs Korn:
»Herr Baron, haben Sie schon einen Ziegenbock mit Hör-
nern gesehen?«
»Natürlich!« war die erstaunte Antwort.
»Falsch! Frau Gräfin bitte.«
»Ich sehe ihn mit den Augen«, kam es vergnügt zurück.
»Aber meinen Sie nicht auch, meine Herrschaften, daß man
solche Fragen nicht unsern Gastgebern stellen sollte, die
Neulinge auf dem Gebiet dieses Spiels sind?«
Das sah man ein, und fortan wurden ihnen nur solche Fra-
gen zugeworfen, die keine Spitzfindigkeiten aufwiesen.

Doch den Spielkundigen stellte man nach wie vor eine
Falle, in die sie trotz aller Routine dennoch hineintappten,
sogar der Oberst. Denn als Heidgar ihn mit einem spitzbü-
bischen Lächeln fragte: »Herr Oberst! Wie hieß der erste
Koch?« Da schwieg er verblüfft und mußte Pfand zahlen.
»Fräulein von Orsen, bitte?«
Auch Hutzelchen wußte es nicht, auch nicht Papa Bessolt,
der sich kopfschüttelnd über die Glatze fuhr. Und da jeder
Frager nur an drei Personen dieselbe Frage richten durfte,
sah man Heidgar gespannt an.
»Nun mal raus mit der Sprache, Komteßchen!« verlangte
der Dicke energisch. »Wie hieß denn dieser Koch?«
Sie legte das Köpfchen schief und blinzelte in die Runde.
Ganz allerliebst sah das aus.
»König David, denn er dämpfte die Amalekiter.«
Das gab nun ein kaum endenwollendes Gelächter.
Da man nun genug hatte des »grausamen Spiels«, ging man
dran, die Pfänder auszulösen. Daß der Oberst dabei als
Richter fungierte, war einfach Ehrensache. Bei verbundenen
Augen gab er den Richterspruch, und wenn er manchmal
unter der Binde hervorschielte, tat er das sehr geschickt.
Als Gehilfen hatte ihm das Los Hutzelchen zugesprochen,
das sich ob dieses Ehrenamtes sehr wichtig vorkam und
nicht einmal Angst vor ihrer Wichtigkeit hatte. Ganz rote
Bäckchen hatte es vor Eifer, das verhutzelte Persönchen.
Eben hielt es einen Wappenring hoch, den der Richter
durch das Tuch natürlich nicht sehen und so ein unbefan-
genes Urteil sprechen konnte oder sollte.
»Herr Richter, was spricht er, was soll derjenige tun, dessen
Pfand ich in meiner rechten Hand halte?«
»Hutzelchen, das ist die Linke«, hätte der »blinde« Richter
beinahe widersprochen, besann sich jedoch noch im letz-
ten Moment und tat streng:
»Er soll die Dame küssen, die neben ihm steht.«
Und diese Dame, o Schreck, war ausgerechnet Sidonie von
Hellnor. Schweigen und atemlose Spannung. Was würde er
tun? Das Antlitz des Mädchens schien wie zu Eis erstarrt.

Die Augen blitzten den Mann drohend an.
Randulf Thorbrandt jedoch lächelte, legte den Zeigefinger
der Rechten auf seinen Mund und brachte dann diesen
Finger den Lippen des Mädchens ganz nahe.
»Wann weiß der sich mal nicht zu helfen!« Papa Bessolt
klatschte sich vergnügt auf seine Glatze, und der »blinde«
Richter schmunzelte in sich hinein.
Es gab noch manche drollige Situation, bis jeder sich dem
Richterspruch unterworfen und sein Pfand zurückbekom-
men hatte. Es schien dem Sohn des Hauses direkt ein Ver-
gnügen zu bereiten, als er vor Heidgar niederknien und das
zierliche Füßchen küssen mußte. Jedenfalls strahlte er über
das ganze Gesicht, während das Mädchen heiß errötete.
Das waren die beiden Paare, die der Richterspruch am här-
testen traf. Mit den andern verfuhr der Gestrenge glimpfli-
cher. Er war direkt erfinderisch im Ausdenken der Strafen,
die so harmlos und doch so lustig waren, daß jeder ver-
gnügt mitmachte.
Es kamen noch einige Stunden voll Fröhlichkeit, bis man
an den Aufbruch zu denken begann. Denn der Morgen
graute schon, und einmal muß ja doch geschieden sein.
Doch bevor es geschah, wurde Heidgar von dem Oberst
beordert, sein Lieblingslied zu singen. Sie sträubte sich erst
gar nicht, weil sie das für zwecklos hielt. Sie schritt zum
Flügel und bat den dort sitzenden Musiker um seine Beglei-
tung. Das Vorspiel begann, und die süße Stimme, für den
Hausgebrauch geschult, setzte ein:
»Alle Tage ist kein Sonntag, alle Tage gibt's keinen Wein,
aber du sollst alle Tage recht lieb zu mir sein.«
Man lauschte mit Genuß dem innigen Lied, das so alt und
doch immer wieder neu ist. Zumal dann, wenn es so
schlicht und lieb vorgetragen wurde, wie die junge Komteß
mit den sonnenhellen Haaren und den strahlenden Blau-
augen es tat. Verträumt kam es von der jungroten Lippen:
»Verschnei'n unser Garten, wie warten, wir zwei, und glau-
ben alle Tage die Mainacht herbei.«
Still und nachdenklich ging man auseinander, noch lange

die süße, zärtliche Stimme im Ohr.
Es war wohl das einzige, offizielle Fest, das die Hellnors in
diesem Winter gaben, aber die »Clique« lud man noch ei-
nige Male zum zwanglosen Beisammensein ein. Daß die
Güldenroder stets dabei waren, hielt man für eine Selbst-
verständlichkeit. Sie vertrugen sich ja auch blendend, die
Nachbarn, lebten in Frieden, wie es ihre Vorfahren einst
taten, bis auf zwei. Sie hatten das »Thorbrandt contra Hell-
nor« mit aller Gelassenheit aus der Welt geschafft – nahm
man an. Doch was man als Friede ansah, war nur ein auf-
gezwungener Waffenstillstand.
An einem Tage im Januar schien die Sonne so hell und
klar, daß sie die Geschwister Thorbrandt hinauslockte auf
die spiegelblanke Eisfläche des Sees. Auch durch diesen
ging die Grenze der beiden Güter, und es war ein Wunder,
daß die verbissenen Nachbarn sie nicht mit Heulbojen
versehen hatten. Also kennzeichnete nur je ein großer Stein
an den Ufern die Grenze, die man jedoch von der Mitte des
Sees nicht erkennen konnte.
Und so geschah es denn, daß sich die Geschwister Hellnor
auf ihren Schlittschuhen vergnügt auf Güldenroder Gelän-
de tummelten, als das andere Geschwisterpaar hinzukam.
»Was machen wir nun?« fragte Heidgar. »Kehren wir um?«
»Damit würden wir uns nur lächerlich machen«, gab der
Bruder achselzuckend zurück. »Sie haben uns bereits ers-
päht.«
Also schnallten sie die Schlittschuhe an, nahmen sich bei
den Händen und glitten elegant und sicher über die glit-
zernde Eisfläche. Da die andern es auch taten, ließ sich eine
Begegnung nicht vermeiden. Man begrüßte sich, wie es
Nachbarskindern zukommt, und da sie es unhöflich fan-
den, streng getrennt voneinander ihre Bahn zu ziehen,
blieben sie zusammen.
Entzückend waren sie anzuschauen, die beiden Mädchen in
ihren schicken Eiskostümen. Wer von ihnen war nun schö-
ner? Ja, da stand man nun in der Qual der Wahl. Gleichalt-
rig, rassig, taufrisch – das Haar der einen wie heller, das der
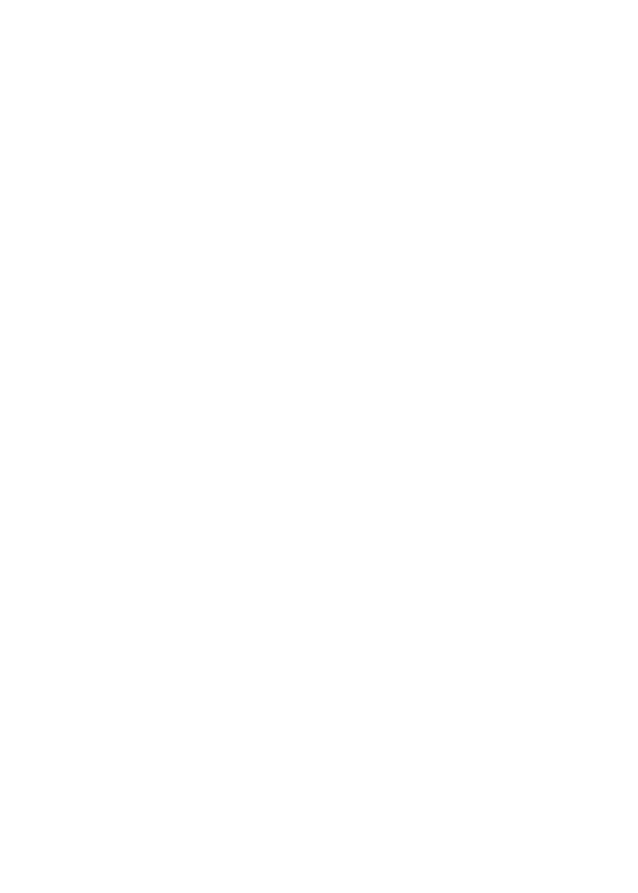
anderen wie dunkelgetönter Bernstein. Beide hatten sie
strahlende Blauaugen und klare, ein wenig hochmütige
Gesichter und ein eigenwilliges Köpfchen dazu.
Die beiden Herren konnten sich auch sehen lassen in ih-
rem feschen Dreß. Auch ihr Aussehen hatte manches ge-
meinsam. Schon die hochgewachsenen Gestalten, die rassi-
gen Gesichter. Jedenfalls waren es beides Männer, von de-
nen ein Mädchenherz schon träumen konnte.
Eine ganze Weile lief man in kühnsten Bogen und sonsti-
gen Kapriolen dahin. Und als Heidgar sich im Walzertakt
zu drehen begann, blitzte es in den Augen Rogers, dem
sowieso der Schalk im Nacken saß, übermütig auf. Er kram-
te aus der Hosentasche eine zwar kleine, aber gewiß nicht
primitive Mundharmonika hervor und blies darauf kunst-
gerecht den Walzer »Gold und Silber« von Lehar. Und als
Heidgar überrascht stehenblieb, verneigte sich der Schwe-
renöter vor ihr galant und führte sie zum Tanz.
Flott war der Tanz, dem das andere Paar zuerst zuschaute.
Dann trafen sich die Augen kühl fragend, bis es in denen
des Mannes humorvoll aufzuckte. Er verneigte sich, ein
kurzes Zögern des Mädchens, und dann klirrten auch die
Schlittschuhe des zweiten Paares im Walzertakt über das
Eis. Als hätte die liebe Sonne ihre Freude an diesem Spiel.
Auch Frau Norne lächelte wieder einmal. Lächelte nach-
sichtig über diese törichten Menschenkinder, die da glaub-
ten, ihr Schicksal selbst meistern zu können.
»Nun schau dir das an«, sagte Graf Albrecht zu seiner Frau,
die neben ihm am Ufer stand. Auch sie hatte das herrliche
Winterwetter hinausgelockt, auch sie wollten sich gleich
ihren Kindern auf dem Eis tummeln. Nun standen sie da,
sahen mit gemischten Gefühlen dem flotten Tanz der bei-
den Paare zu und lauschten den lustigen Klängen. Das Ge-
sicht des Mannes verfinsterte sich, ein schwerer Seufzer hob
seine Brust.
»Das sollte man kaum für möglich halten! Was nun?«
»Laß sie gewähren, liebster Mann. Wollten wir brüsk ein-
greifen, würden wir nur unsere Kinder blamieren, von de-

nen wir wissen, daß sie nur gezwungenermaßen mitma-
chen, wie sie ja so vieles mitmachen müssen, seit die Hell-
nors auftauchten, was umgekehrt übrigens auch der Fall
sein dürfte. Ich glaube nämlich nicht, daß die Geschwister
die Gesellschaft unserer Kinder suchten. Und nun schau
nicht so finster drein, sondern tu das Klügste, was dir zu
tun übrigbleibt: Mitmachen.«
So tanzte denn ein wenig später auch dieses Paar flott da-
hin, zuerst einmal unbemerkt von den andern. Doch als
man sie sah, glitt man zu ihnen hin und klatschte Beifall.
»Alterchen, ihr seid ja glänzend in Form«, lachte der Sohns
»Komm, Muttchen, versuchen wir es mal!«
Prächtig ging es, ebenso bei Vater und Tochter, die vergnügt
loswalzten. Später wechselten dann die Paare, bis Roger
erklärte, daß ihm bei dem pausenlosen Spielen schon »der
Mund ausgefranst wäre«. Da ging es ohne Musik weiter, bis
man endlich, müde geworden, Schluß machte. Man verab-
schiedete sich um eine Nuance herzlicher als gewöhnlich.
Dann glitt man den gegenseitigen Ufern zu, wobei die Ge-
schwister Hellnor eine bedeutend längere Strecke zurückzu-
legen hatten.
»Du, Sido, ich glaube, wir haben uns ausschließlich auf
Güldenroder Gelände getummelt«, stellte der Bruder, als sie
stehenblieben, um ein wenig zu verschnaufen, unbehaglich
fest. »Soviel ich weiß, führt die Grenze mitten durch den
See. Und da die anderen sich bereits am Ufer befinden,
sind wir an unserem längst noch nicht. Peinliche Angele-
genheit.«
»Die du dir allein zuzuschreiben hast«, gab sie zurück.
»Hättest du deine Mundharmonika in der Tasche gelassen,
wäre das Spiel gar nicht erst zustande gekommen.«
»Es wirkte aber auch so aufreizend, als sich die Komteß so
graziös im Walzertakt drehte«, bekannte er kläglich, und da
mußte sie lachen.
»Dann trage auch die Konsequenzen, du Nichtsnutz.«
Dieselben Worte gebrauchte auch Nel, als man ihr und
dem Vater von dem Tanz auf dem Eis erzählte. Sie setzte

hinzu:
»Na, wenn schon! Ihr müßt ja so oft mit der feindlichen
Seite friedlich tun, da kommt es auf ein bißchen mehr oder
weniger schon gar nicht mehr an.«
»Och, mir macht das nichts aus«, bekannte Roger offen. »Ist
es nicht lächerlich, sich heute noch dafür zu befehden, was
ein Großvater mal dem andern vor x-Jahren antat?«
Die Blicke der Eltern kreuzten sich und suchten dann das
Gesicht der Tochter, das einen hochmütigen Ausdruck auf-
wies. Ein Zeichen, daß sie die Ansicht des Bruders nicht
teilte, jedoch auch wiederum nicht gewillt war, die ihre
preiszugeben. Denn sie konnte zu gegebenen Zeiten sehr
verschlossen, sehr abweisend sein,' die stolze, eigenwillige
Baronesse von Hellnor.
Das sollte auch Randulf Thorbrandt einige Tage später wie-
der einmal erfahren, als er Sidonie in der Stadt begegnete.
Sie hatte sich durch das herrliche Winterwetter dazu verlei-
ten lassen, einen Ritt in die Stadt zu machen, was dann
auch zum Vergnügen wurde. Aber nur so lange, bis die
strahlende Sonne sich plötzlich hinter den Wolken ver-
kroch, die sich zu einer grauen Decke zusammenballten
und nun schneeschwer am Himmel hingen. Es dauerte
auch nicht lange, da gab es ein heftiges Schneetreiben, und
ein eisiger Wind machte sich auf. Ein Zustand, der dem
rassigen Trakehner durchaus nicht behagte, was er durch
Widerspenstigkeit kundtat. Er schnaubte, warf den Kopf
hoch und tänzelte über die Fahrstraße, so daß die Lenker
der Gefährte sowie die Fußgänger bereits aufmerksam wur-
den.
Und siehe da, ein Retter nahte – und zwar derselbe, der die
Baronesse schon einmal aus einem Schneesturm heraus-
holte.
Also, auf in den Kampf!
Und es wurde einer.
Der gute Pferdekenner, der mit einem Blick erfaßte, in wel-
cher Gefahr sich die Reiterin befand, fuhr den Schlitten
scharf rechts an den Bordstein, stieg aus, befestigte die Lei-

ne am Peitschenhalter und trat zu der Reiterin, die das ner-
vöse Pferd kaum noch zügeln konnte.
»So geht es ja nun nicht, Baronesse«, sagte er in seiner ge-
lassenen Art, wobei er in die Zügel griff und mit harter
Faust das tänzelnde Tier zum Stillstand zwang. Zuerst sah
Sidonie verblüfft auf den Mann, dann flog der Kopf in den
Nacken.
»Sind Sie schon wieder mal da?« fragte sie böse, und ge-
mütlich erfolgte die Antwort:
»Jawohl. Ich scheine von einem gütigen Geschick dazu be-
stimmt zu sein, in gefährlichen Situationen bei Ihnen als
Retter zu erscheinen, Baronesse. Ich würde Ihnen den guten
Rat geben, abzusitzen, wenn Sie nicht zu Schaden kommen
wollen.«
Da war wieder der Ton, der Sidonie so reizte, das Lächeln,
das sie niederträchtig fand. Aber nicht wie damals, als die-
ser Mann sie aus dem Schneesturm holte und durch seinen
herrischen Willen in sein Auto zwang, benahm sie sich
jetzt. Sie tat also keineswegs wie ein vertrotztes Kind, son-
dern versuchte es mit Hochmut.
»Ob ich zu Schaden kommen will, ist allein meine Angele-
genheit, Herr Graf. Geben Sie mir bitte den Weg frei.«
»Wie Sie wünschen.« Er lockerte die Zügel, worauf »Gold-
lack« einen Sprung tat, der die augenblicklich unaufmerk-
same Reiterin beinahe aus dem Sattel geworfen hätte. Ab-
sichtlich ließ der Mann den ungebärdigen Goldfuchs noch
einige seiner Kapriolen fortsetzen. Dann ein Ruck an der
Kandare, und das Tier stand zitternd still.
»Nun, Baronesse, immer noch so hochmütig?« fragte er
ironisch. »Es ist mir zwar bekannt, daß Sie eine vorzügliche
Reiterin sind und den ungezogenen Burschen hier sonst
glänzend meistern, aber jetzt reicht Ihr zartes Händchen
nicht aus, jetzt kann nur eine eiserne Männerhand den
Ungebärdigen zügeln. Sitzen Sie bitte ab.«
Da saß sie ab und schritt an der Seite des Mannes her, der
das Pferd am Zügel führte und auf den Schlitten zuging.
Für den bitterbösen Blick des Mädchens hatte er nur ein

Achselzucken.
»Und was nun?« fragte sie schroff.
»Nun wollen wir beraten, was sich am besten tun läßt. Ich
mache Ihnen einen Vorschlag, Baronesse, den >Goldlack<
hier zu lassen und in meinem Schlitten Platz zu nehmen.«
»Und wo soll das Tier bleiben?«
»In dem Stall des Hotels, das auch unseren Pferden bei
besonderen Fällen gastlich Obdach bietet.«
»Goldlack bleibt aber in keinem fremden Stall«, entgegnete
sie abweisend. »Und dann: begreifen Sie es doch endlich,
Herr Graf, daß ich mir nicht immer von Ihnen helfen las-
sen will.« Sie funkelte ihn feindselig an – und er lächelte.
»Gerade von mir nicht?« tat er verwundert. »Warum denn
nicht? Bin ich denn etwas Besonderes?«
»Nein, aber – aber…«
»Aber was? Sprechen Sie sich ruhig aus.«
»Lieber nicht, es könnte Ihnen in die falsche Kehle kom-
men.«
Da lachte er sein herzliches Jungenlachen, das Sidonie zum
erstenmal hörte. Überrascht sah sie ihn an und bemerkte,
daß seine sonst so herrischen kühlen Augen mitlachten.
»Darauf nehmen Sie gerade Rücksicht!« sagte er amüsiert.
»Gerade Sie, um Ihre Redewendung von vorhin zu gebrau-
chen. Nun seien Sie bitte friedlich, und lassen Sie sich von
mir helfen. Ich tu es ja nicht um Ihretwillen, sondern aus
purer Menschlichkeit – oder als gefälliger Nachbar. Genügt
Ihnen das, Sie unglaublich stolzes, eigenwilliges Fräulein?«
»Ach, lassen Sie mich!« wehrte sie schroff ab. »Mit Ihnen
werde ich ja doch nicht fertig.«
»Na, also!« meinte er gemütlich. »Warum nicht gleich so?
Nehmen Sie bitte im Schlitten Platz und halten Sie das
Pferd, damit es nicht, sofern ich es aus den Augen lasse,
ausbricht. Wenn es auch nicht gerade solch ein Nichtsnutz
ist wie Ihr >Goldlack<, aber ein Lamm ist es wiederum
auch nicht.«
Da setzte sie sich wie gottergeben in den Schlitten, wäh-
rend er das Pferd abführte, das sich unter seiner Faust eini-

germaßen fügte.
Sidonie, die jetzt erst spürte, wie sehr sie fror, kroch, so gut
es ging, unter die schützende Pelzdecke. Zwar war die Reit-
hose und auch die Jacke, die sie trug, mit weichem Fell
gefüttert, aber der schneidende Wind ging hindurch.
Leichtsinnigerweise hatte sie keine Mütze auf den Kopf
gesetzt, der nun schutzlos der Kälte und dem eisigen
Schneesturm ausgesetzt war.
Zehn Minuten später stand dann wieder der Mann vor ihr,
dessen ganze Art ihren Widerspruch weckte und dem sie
letzten Endes doch nachgeben mußte, was sie unsagbar
reizte und zu Torheiten hinriß, über die sie sich dann spä-
ter ärgerte. Er nahm neben ihr Platz, ergriff die Zügel und
fuhr in eine Seitenstraße, die augenblicklich fast menschen-
leer war. Er hielt, stieg aus und suchte aus dem hinteren
Kasten des Schlittens warme Hüllen hervor, mit denen er
zu Sidonie trat.
»So, das wollen wir doch lieber ohne Zuschauer tun, falls
das eigenwillige Köpfchen wieder rebellisch werden sollte«,
meinte er lächelnd, indem er den Oberkörper des Mäd-
chens warm einzupacken begann. Für den Kopf gab es so-
gar eine Pelzmütze. Die Pelzdecke wurde bis zum Nacken
hochgezogen, vorn bis unter die Arme. Dann besah er zu-
frieden sein Werk.
»So, Baronesse, jetzt sitzen Sie warm und weich wie in >Ab-
rahams Schoß<. Wenn Sie nun noch ein freundliches Ge-
sicht machen wollten, wäre ich restlos glücklich.«
»Sie und glücklich!« Der Mädchenmund kräuselte sich
spöttisch. »Dafür sind Sie ja viel zu kalt und herrisch.«
»Hm«, schmunzelte er. »Aber ein Herz werde ich wohl
dennoch mein eigen nennen.«
Damit setzte er sich neben sie, steckte die Shagpfeife in
Brand, und fort ging's mit lustigem Schellengeläut. Hurtig
griff das Pferd aus, den warmen Stall und die wohlgefüllte
Krippe witternd. Sidonie verharrte zuerst in eisigem
Schweigen, bis es sich dann wie widerwillig von ihren Lip-
pen rang:

»Was macht >Goldlack<?«
»Der ist gut untergebracht. Ganz friedlich ließ er sich in
den warmen Stall führen. Der Mann, der ihn betreut, ist
erprobt zuverlässig, also können Sie ohne Besorgnis sein,
Baronesse.«
Wieder Schweigen – und dann etwas, das wie eine Ent-
schuldigung gegen sich selbst klang:
»Wie konnte ich aber auch ahnen, daß das Wetter so jäh
umschlagen würde! Sonst wäre ich gewiß nicht zur Stadt
geritten.«
»Ist zu verstehen, da Sie ja aus Chile gebürtig sind, Baro-
nesse, und daher die Tücken des Winters hier nicht ken-
nen.«
»Ich bin gar nicht so fremd in Deutschland, Herr Graf.
Schon von Kindheit an weilte ich mit meinen Angehörigen
fast jedes Jahr einige Wochen im Geburtsland meiner El-
tern, war sogar ein Jahr lang in einem deutschen Pensio-
nat.«
»Aber gewiß nicht in Ostpreußen.«
»Nein, das mied mein Vater aus erklärlichen Gründen.«
»Also!«
»Gar nicht also.« Seine Gelassenheit begann sie wieder zu
reizen. »Ich habe bereits einen Winter hier verlebt.«
»Soviel ich weiß, reisten Sie mit Ihren Angehörigen im vor-
igen Jahr Anfang Februar nach Chile«, gab er zu bedenken.
»Und gerade der Februar hat's hier in sich, wie man so sagt.
Also haben Sie die ärgste Wetterperiode nicht mitgemacht.
Als Sie nämlich nach Marstein zurückkehrten, war es Früh-
ling.«
Jetzt funkelten die Augen ihn an. Empört stieß sie hervor:
»Müssen Sie immer das letzte Wort haben, Herr Graf!«
Zum zweitenmal lachte der Mann sein mitreißendes La-
chen, das man leider viel zu selten von ihm hörte.
»Das gefällt dem Trotzteufelchen wohl nicht, wie? Aber
recht müssen Sie mir dennoch geben, nicht wahr?«
»Nein! Im Januar, dem kältesten Monat, war ich im vorigen
Jahr hier. Oder wollen Sie da etwa auch noch widerspre-

chen?«
»O nein, ich habe Angst!« Es zuckte ihm verdächtig um
Augen und Lippen. »Lenken wir das Gespräch in friedliche-
re Bahnen, sprechen wir über das Wetter.«
»Da stecken wir ja mitten drin.«
»Eben, gerade deshalb läßt sich viel darüber sagen.«
»Nicht sehr geistreich.«
»Darauf erhebe ich auch keinen Anspruch.«
»Herr Graf, Sie sind…«
»Na, was denn, bitte?«
»Ein herrischer, arroganter, rechthaberischer Mensch, wie er
mir in meinem Leben noch nicht vorgekommen ist!« brach
es aus ihr heraus, wobei Tränen in ihren Augen blitzten.
Tränen des Zornes. Doch wenn sie glaubte, ihn mit ihren
beleidigenden Worten zu treffen, dann irrte sie. Er zuckte
nur die Schulter und meinte gelassen:
»Sie sind nicht das erste Mädchen, das mir das an den Kopf
wirft, Baronesse. Aber ich fühle mich recht wohl dabei.«
Da sagte sie nichts mehr, sondern verharrte in eisigem
Schweigen, bis der Schlitten vor dem Portal des Marsteiner
Herrenhauses hielt. Nun fragte sie kurz:
»Wo befindet sich >Goldlack< überhaupt?«
»Im Stall des Hotels Kaiserhof.«
»Danke – und Dank für Ihre Hilfe.«
»Bitte sehr, es war mir ein Vergnügen.«
Er sagte es recht höflich, doch als sie dabei in sein Gesicht
sah, hätte sie am liebsten eine kindliche Rüpelei begangen
und ihm die Zunge herausgestreckt, so weit es nur ging.
Selbstverständlich unterließ die stolze Baroneß Sidonie
das, wandte sich kurz ab, ging ins Haus – mit einem Gefühl
ohnmächtigen Zornes geladen bis zur Halskrause.
*
Als Sidonie das Zimmer betrat, in dem die Angehörigen
schon voll Unruhe ihrer harrten, hatte sie sich soweit beru-
higt, um gleichmütig erscheinen zu können.
»Da bist du ja endlich, mein Kind«, atmete der Vater er-
leichtert auf. »Ich habe dir, als das Unwetter begann, einen

Schlitten entgegengeschickt? War's recht so, Sidolein?«
»Einen Schlitten?« fragte sie verwundert. »Ich bin ihm nicht
begegnet.«
»Mädchen, dann bist du doch nicht etwa auf dem nervösen
>Goldlack< bei dem Wetter hergeritten?« Die Mutter um-
faßte ihr Töchterlein, als müßte sie es jetzt noch vor Unbill
schützen. »Das war ein sträflicher Leichtsinn von dir, Lieb-
herz.«
»Nel, nun mach bloß nicht so entsetzte Augen!« Sidonie
zwang sich zu einem Lachen. »Ich sitze ja gesund und
munter vor dir. Ich bin nicht auf >Goldlack< hergekom-
men.«
»Sondern?« fragten die anderen wie aus einem Mund.
»Sondern im Schlitten des Grafen Thorbrandt junior. Er
kam gerade daher, als >Goldlack<, den das jäh aufsteigen-
de Unwetter maßlos erschreckte, seine Kapriolen machte.
Nun, ihr kennt diesen Herrenmenschen ja. Er fragt nicht, er
handelt. Ehe ich mich so recht versah, saß ich in seinem
Schlitten, und er brachte den störrischen >Goldlack< in
den Stall des Hotels Kaiserhof, wo man manchmal auch
die Güldenroder Pferde unterstellt. Dann fuhr er in eine
Nebenstraße, und so konnte es wohl kommen, daß ich
unseren Schlitten verpaßte, den ihr mir entgegengeschick-
tet. Denn der Kutscher suchte mich wahrscheinlich in der
Hauptstraße. Na ja, der Graf packte mich warm wie ein
Baby ein und fuhr mich hierher. Das ist alles.«
Alles, Sidonie? fragte die Stimme in ihrem Innern, die sich
Gewissen nennt. Aber trotzig wurde sie zum Schweigen
gebracht. Was wollte dieses unbequeme Ding denn über-
haupt! Sie log ja nicht, sie verschwieg nur ihr eigenwilliges
Benehmen, worüber sie sich jetzt ärgerte. Wenn Nel das
wüßte, hätte sie gelächelt, und dieses Lächeln vertrug Sido-
nie jetzt nicht.
Trotzdem lächelte Nel, aber nur amüsiert, während Roger
die Schwester neckte:
»Ich sage ja, dieser Randulf scheint vom Schicksal auserse-
hen zu sein, bei meinem Schwesterlein, um mit Schillers

>Bürgschaft< zu sprechen: Als Retter willkommen zu er-
scheinen.«
Lachend pfuschte er dem großen Dichter ins Handwerk,
indem er die Fortsetzung des Gedichtes für seinen Zweck
im Stegreif ummodelte:
»Des rühme der schneidige Randulf sich nicht, der Sidonie
das aufgezwungen als Pflicht, was geschah nicht aus Liebe
und Treue.«
Man lachte herzlich über ihn, dem der Schalk wieder ein-
mal im Nacken saß, und Sidonie konnte statt des gefürch-
teten, ein zärtliches Lächeln ihrer Nel einstecken.
Auch Randulf sprach zu den Seinen über die Gefälligkeit,
die er der Baronesse erweisen konnte. Hier war es Heidgar,
die lachend feststellte:
»Du scheinst vom Schicksal ausersehen zu sein, immer
dann in Erscheinung zu treten, wenn die Baronesse sich in
einer Klemme befindet. Sie aus dem Schneesturm zu holen,
scheint deine Spezialität zu sein. Man wird dir nächstens
die Rettungsmedaille anheften müssen.«
»Und dir dein flinkes Zünglein stutzen«, gab er gleichfalls
lachend zurück. Die Eltern sagten gar nichts. Sie resignier-
ten wieder einmal über des Zufalls Tücke, die ihren Sohn
immer wieder der Baronesse seine Gefälligkeit aufdrängen
ließ. Daß dieses abweisende Mädchen die Hilfe eines
Thorbrandt nur widerwillig in Anspruch nahm, daran hegte
man keinen Zweifel.
Anfang März, als der Schnee noch fest auf den Straßen lag,
luden die Hellnors die »Clique« zu einer Schlittenfahrt ein.
Gleich nach dem Mittagessen sollte man sich im eigenen
Schlitten in Marstein einfinden, dann würde eine lustige
Fahrt ins Blaue beginnen.
Mit dem größten Vergnügen rückten die Eingeladenen zur
festgesetzten Stunde an: in sechs Viersitzern und zwei
Zweisitzern, welche die beiden jungen Ehepaare ja nur be-
nötigten. Damit man sich nicht erst aus den warmen Hül-
len zu schälen brauchte, sollten Diener einen warmen
Trunk in den Schlitten reichen. Doch da kam man bei dem

Präses der Gesellschaft schlecht an. So, wie man saß, los-
fahren? Kam ja gar nicht in Frage! Man wollte ja schließlich
auch mal ein anderes weibliches Wesen an seiner Seite ha-
ben als die eigene Frau. Wen man bekam, sollte das Los
entscheiden. Also kleine Zettel geschrieben, die dann gezo-
gen wurden. Zuerst von den Damen, mit den Namen der
Herren darauf und umgekehrt. Damit jede Mogelei aus-
blieb, wollte er die Sache leiten.
Wie ein grimmiger Stratege hielt er Umschau und sah in
lachende Gesichter. Na also! Jetzt kam Zug in die Kolonne!
Um die Lose zu schreiben, mußten ihm einige zur Hand
gehen, die der »Herr vom Ganzen« bestimmte. Die Gastge-
ber sollten nur ruhig bei den Gästen bleiben. Er deichselte
die Sache schon mit Frau, Tochter und Hutzelchen.
Lachend ließ man ihm den Willen und hatte keine Ah-
nung, daß man damit gewissermaßen den Bock zum Gärt-
ner machte. Als man nämlich in einem Zimmer die Zettel
schrieb, gebot der Gestrenge im Kommandoton:
»Die von den jungen Thorbrandts und Hellnors schreibe
ich, verstanden?«
»Wilhelm, was hast du vor?« fragte Hutzelchen weinerlich.
»Ich habe solche Angst.«
»Dann marsch nach Hause!« schnauzte er. Seine Tochter
jedoch lachte hellauf.
»Papa, was bist du bloß für ein Gauner!«
»Du, werde nicht frech, Marjellchen!« drohte er. »Ihr habt
weiter nichts zu tun, als Order zu parieren.«
O ja, er war schon ein Gauner, der Herr Oberst, aber einer,
der nichts Böses, sondern Versöhnliches im Schilde führte.
Wie er die Zettel kennzeichnete, blieb sein Geheimnis. Tat-
sache jedenfalls war, daß sie lieb und brav gezogen wur-
den, genau so, wie er es wünschte.
Blieb man wirklich harmlos, als man die Namen las? Oder
tat man nur so? Randulf bestimmt, denn sein falkenschar-
fes Auge erspähte das, was den anderen vielleicht entging.
Das »Baronesse Sidonie« war nämlich so geschrieben, als
hätte man sich dabei keiner Feder, sondern einer Gabelzin-

ke bedient. Folge davon war, daß die Schrift durch das Pa-
pier drang. Da der Oberst seine Schreibart kannte, war es
ihm ein leichtes, sie mühelos auch in Spiegelschrift zu ent-
ziffern.
Ob die Zettel alle so geschrieben wurden? Wie Randulf mit
diskretem Blick feststellen konnte, war das nicht der Fall.
Die anderen Namen waren fein säuberlich geschrieben.
Nur noch drei trugen die gleichen Anzeichen, und die drei
waren die Partner von Sidonie, Heidgar und Roger.
Was bezweckte der Oberst damit? Glaubte er etwa Vorse-
hung spielen zu müssen? O nein, mein lieber Herr, zwar
gutgemeint, aber Verschwendung am ungeeigneten Objekt.
Prüfend ging Randulfs Blick zu Sidonie hin. Ob sie stutzig
wurde? Wenn ja, ließ sie sich jedenfalls nichts anmerken,
wie auch Heidgar und Roger nicht. Man machte eben gute
Miene zum bösen Spiel, wollte kein Spielverderber sein.
Es gab bei den anderen beim Lesen der Zettel manch herz-
liches Lachen. Bei zwei Paaren hatte man den Ehepartner
erwischt, den man mit unterdrücktem Lachen rasch aus-
tauschte.
Und wen hatte das liebe verhutzelte Hutzelchen?
»Meinen Bruder!« rief sie wie in höchster Not und zog vor
Angst den Nacken ein, als wollte man ihr an Kopf und Kra-
gen. Niemand dachte daran, am wenigsten der Bruder. Der
machte ein Gesicht, als hätte man ihm die Butter vom Brot
geleckt.
Und da lachte Randulf auf. So übermütig, so voller Scha-
denfreude klang das Lachen, daß es die anderen dabei mit-
riß, obwohl niemand wußte, warum er eigentlich lachte.
Doch bald hatte der Oberst sich von seinem Schrecken
erholt. Er kommandierte mit einer Lautstärke, als hätte er
ein Regiment Soldaten vor sich. Und als er in seinem Eifer
gar »Stillgestanden!« rief, wollte man sich schier ausschüt-
ten vor Lachen.
»Ruhe!« gebot er. »Mal herhören! Die jungen Paare neh-
men die Zweisitzer!«
»Gehöre ich auch dazu?« rief Cornelia lachend dazwischen.

»Mein Partner ist nämlich der junge Bessolt.«
»Und meiner der junge Skalden«, meldete sich Muttchen
Bessolt.
»Und ich führe Fräulein Glade«, tat der Regierungsrat von
Blüthner forsch.
»Und glaubt ihr etwa, ich sei nicht mehr jung?« Papa Bes-
solt schlug sich an die Brust. »Kommen Sie, Frau Gräfin,
wir belegen den Zweisitzer!«
»Ihr benehmt euch alle wie ausgelassene Kinder!« donnerte
der Herr Oberst los. »Es stehen nur zwei kleine Schlitten
zur Verfügung. Hinein mit euch, ihr Nachbarskinder!«
»Das sind wir alle!« rief der junge Bessolt keck. »Alle Kinder
der Nachbarschaft, vereint euch zu fröhlichem Tun!«
Und ehe der Oberst sich recht versah, saß der fidele junge
Mann mit der lachenden Cornelia im ersten Schlitten.
Heidgar und Roger folgten. Im zweiten nahmen blitz-
schnell Randulf und Sidonie Platz, mit ihnen Frau von
Bessolt und der junge Skalden. Den dritten belegte Doris
Glade mit ihrem Partner, Edeltraut von Bessolt fand sich
mit Baron Gisbert Hellnor dazu. Und somit waren alle
Nachbarskinder dem Befehl des Herrn Kommandanten
nachgekommen. Wollte er auch jetzt noch die beiden be-
wußten Paare in die Zweisitzer beordern, wäre seine Strate-
gie selbst von dem Harmlosesten durchschaut worden. Er
hatte heute eben Pech, der Präses der »Clique«, der es sich
nun einmal in den harten Kopf gesetzt hatte, Vorsehung zu
spielen. Und bis er seinem Ärger über den mißglückten
Plan hinunterwürgte, waren alle Schlitten besetzt. Nur in
einem der Zweisitzer war ein Platz noch frei, und zwar der
neben Hutzelchen. Daß der Herr Oberst jetzt nicht wie ein
Landsknecht fluchte, war aller Ehren wert.
Nachdem man sich an einem warmen Trunk, der wie Feuer
durch die Adern floß, gelabt, klingelten die Schlitten vom
Hof. Und als hätte der Wettergott seine Freude an der ver-
gnügten Schar, schickte er den Wind zur Ruhe und ließ die
Sonne scheinen.
»Ei, Komteß, lassen Sie den Pelzkragen da, wo er ist. Die
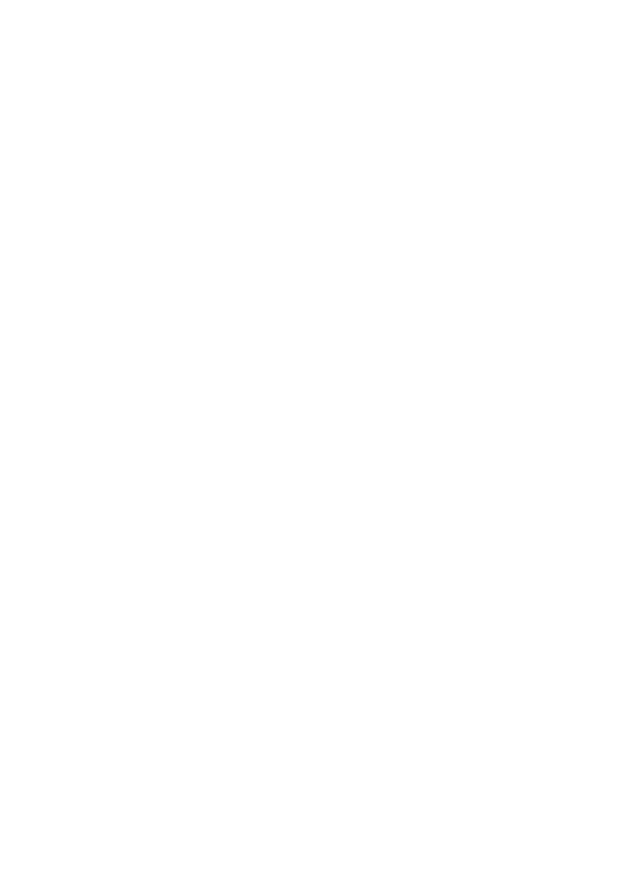
Märzsonne trügt, das müßten Sie als ostpreußisches Mar-
jellchen doch am besten wissen.«
»Junge, wie kann man nur so ungalant sein«, verwies Cor-
nelia, die mit ihrem jungen Kavalier im hinteren Sitz saß,
lachend, und auch Heidger winkte vergnügt ab.
»Ich bin ja auch ein ostpreußisches Marjellchen, Frau Ba-
ronin. Aber ich will meinem Nachbarn trotzdem gehor-
chen.«
»Wie gnädig«, lachte er in ihre strahlenden Augen hinein.
Was Wunder, wenn es dem jungen Mann heiß unter der
Pelzweste wurde.
Die Gastgeber wurden immer wieder mit Fragen bestürmt,
wohin es eigentlich gehen sollte, doch sie schwiegen.
»Hutzelchen, sie entführen uns!« rief der Präses, der sich
damit abgefunden hatte, ausgerechnet das verhutzelte Alt-
jüngferlein als Partnerin zu haben. »Und wenn du jetzt
sagst, du hast Angst, werfe ich dich den Wölfen vor zum
Fraß.«
»Huuuuch!« schrie Hutzelchen. »Bruder, du bist ein Bar-
bar!«
»Besser als ein Leisetreter, Herrschaften, jetzt wird es mir
aber langsam zu bunt. Wo geht's hin?«
»In den weiten Märchenwald«, sang Sidonie neckend.
»Da sind wir doch schon längst. Frau Baronin, ich erhei-
sche eine präzise Antwort.«
»Aber, Herr Oberst, Sie scheinen mir am neugierigsten zu
sein«, kam es lachend zurück. »Schweigen Sie und dulden
Sie, es wird sich lohnen.«
»Es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich so manches im
Leben«, sang Jochen von Bessolt, der sich mit seiner Nach-
barin schon recht gut angebiedert hatte. Der fidele junge
Mann, der so ganz der Sohn seiner ebenso fidelen Eltern
war, machte ihr solchen Spaß, daß sie sich mit ihm neckte,
mit ihm lachte und plauschte, als wäre sie eben noch so
jung wie er.
»Nel, du bist doch eine prachtvolle Frau«, wandte Roger
den Kopf, sie mit einem zärtlichen Blick umfassend. »Habe

ich nicht eine fabelhafte Mutter, Komteß?«
»So fragt man Leute aus, mein Sohn«, antwortete Cornelia
statt des Mädchens vergnügt. »Wenn die junge Dame nun
das Gegenteil kundtut?«
»Ei, Komteß, wagen Sie es nicht!« drohte er mutwillig.
»Dann tu ich das, was unser Präses dem Hutzelchen ver-
hieß.«
»Mich aus dem Schlitten werfen – den Wölfen vor zum
Fraß?«
»Eben das.«
»Pfui, Junge, wie abscheulich! Nehmen Sie ihn bei den
Ohren, Komteß!«
»Die sind leider durch die Pelzmütze geschützt, Frau Baro-
nin«, gab das Mädchen lachend zurück. Und so vergnügt,
wie es in diesem Schlitten zuging, geschah es auch in den
anderen. Es war eine kleine Schar unbekümmerter Men-
schen, die voll froher Erwartung einem unbekannten Ziel
zufuhren. Diese Fahrt durch den herrlichen Winterwald
war allein schon Freude genug.
Es sollte aber noch mehr Freude kommen, und zwar, als
der erste Schlitten, den Roger führte, stoppte und so auch
die anderen zum Stillstehen zwang. Neugierig spähten die
Menschen umher und entdeckten ein Haus, das in seiner
winterlichen Umrahmung verträumt dalag. Soweit man
sich erinnern konnte, hatte bisher hier eine halbverfallene
Hütte gestanden. Und nun dieses neue Gebäude?
Ein Sturm von Fragen ging auf die Gastgeber los, die Baron
Gisbert schmunzelnd beantwortete:
»Ja, da staunen Sie, meine Herrschaften, wie? In aller
Heimlichkeit ist es entstanden, das neue Forsthaus >Corne-
lia<.«
Voll Erwartung ging man auf das schmucke Haus zu, in
dessen Tür ein junger Förster stand und die Gäste seines
Herrn mit strahlendem Gesicht willkommen hieß. Auch
die Frau Försterin stellte sich ein jung, hübsch und froh.
Stolz präsentierte sie ihr Heim. Es war wirklich schmuck,
das neue Forsthaus. Und was befand sich hinter der großen
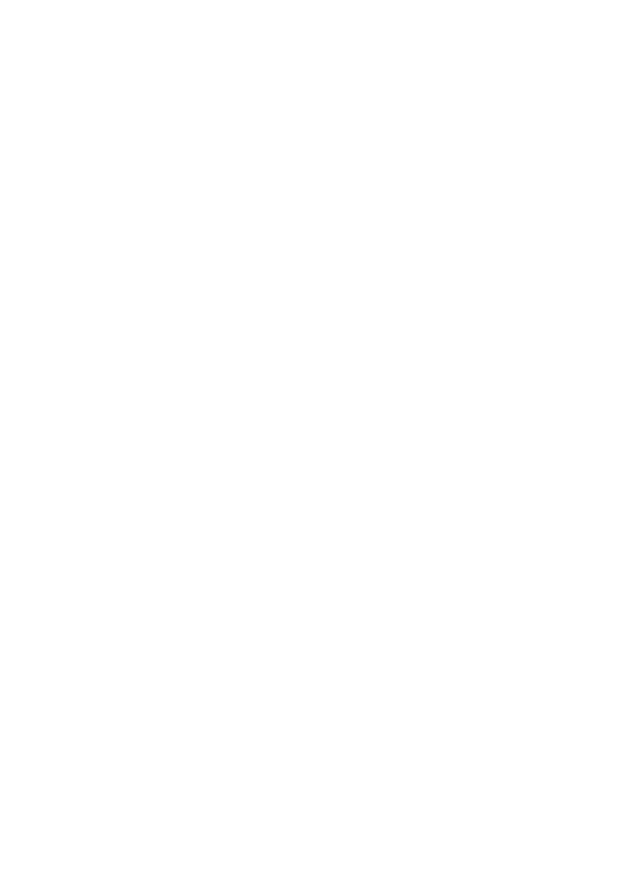
Flügeltür?
»Ahs« und »Ohs« der Überraschung wurden laut, als sich
das Geheimnis lüftete. Vor den staunenden Menschen lag
ein Saal, in dessen Mitte eine lange Tafel stand, auf der sich
Berge von Kuchen häuften. Oben an der Decke baumelten
Papiergirlanden und lustig bunte Lampions. In der Mitte
hing ein Kronleuchter, weitere Leuchter waren an den
Wänden angebracht. In der Ecke stand ein Plattenspieler
mit dem Radioapparat darauf.
»Ja, diese Försterei wurde notwendig«, sprach nun der
Gastgeber in die andächtige Stille hinein. »Denn das Revier
der nächsten ist so weit, daß von dort aus dieser Teil des
Waldes nicht genügend bewirtschaftet werden konnte. Der
Saal soll dazu dienen, all den Grünröcken Festlichkeiten
unter sich zu ermöglichen. Aber Sie, meine verehrten Gäste,
sollen den Saal einweihen. Und so biete ich, und auch
meine Familie, Ihnen allen ein herzliches Willkomm.«
Das gab nun ein freudiges Hallo. Froh bewegt, nahm man
an der Tafel Platz und sprach eifrig den süßen Genüssen
zu. Die Weiblichkeiten, die zur Unterstützung der Frau
Försterin für diesen Tag gemietet waren, gossen aus riesigen
Kannen den Kaffee ein. Wenn ein Kuchenteller geleert war,
stand schon ein neuer da. Auch das Kaffeeschnäpschen
fehlte nicht, bei dem der Präses eine Rede hielt:
»Ihr lieben Gastgeber, was seid ihr doch für Heimlichtuer!
Aber brav gemacht, sehr brav! Mit herzlichem Dank leeren
wir dieses Gläschen auf das Wohl unserer prachtvollen
Hellnors. Sie sollen leben – gesund und fidel -!«
Man erhob sich, trank ex und sah dann erwartungsvoll den
Oberst an, der noch etwas auf dem Herzen zu haben
schien. Und schon kam es, was sie alle herzlich lachen ließ.
»Noch einmal die Gläser füllen! Ihr dürft euch setzen.«
»Jawohl, Herr Lehrer!« rief Edeltraut von Bessolt, was ihr
einen strafenden Blick des Onkels eintrug. Nachdem der
feine Likör erneut in den Gläschen funkelte, warf der Herr
Oberst einen Feldherrnblick über seine Schar.
»So, ihr lieben Leute, dieses Glas leeren wir auf unsere be-

rühmte >Clique<, die von so manchem beneidet wird.
Warum? Weil wir zu einer Gemeinschaft gehören, die aus
einem Topf ißt. Jawohl! Auf daß es immer so bleibe! Prosit
-!«
Man lachte Tränen über diese Rede, die wahrlich aus der
Schablone fiel. Schmunzelnd steckte der Redner das von
allen Seiten gespendete Lob ein und fühlte sich als Held
des Tages. Die Frau Försterin erschien und bat, es sich in
dem Wohnzimmer gemütlich zu machen, damit der Saal
umgeräumt werden könnte, denn ein Tänzchen sollte doch
wohl steigen.
Bis man sich in dem Nebenraum, der gewiß nicht klein
war, placiert hatte, gab es manch fröhliches Gelächter.
Denn achtundzwanzig Menschen unter einen Hut zu brin-
gen, wie man so sagt, ist nicht so einfach. Man drängte sich
auf dem breiten Sofa zusammen, zwängte sich zu zweit in
den Klubsessel, schwang sich ausgelassen und voller
Übermut auf die Seitenlehnen, Stühle, Fußbänkchen,
Ofenbank, Fensterbretter.
Natürlich gab es auch hierbei was zum Lachen. Erst einmal
über Papa Bessolt, dessen Körperfülle ausgerechnet auf
dem kleinsten Fußbänkchen thronte, während die mollige
Gattin, in einen Sessel gezwängt, Heidgar halb auf dem
Schoß hielt.
Und der Oberst? An dem klebte Hutzelchen heute zäh wie
Pech. Warum von dem Arm des Gestrengen, der ja auch
über eine respektable Breite verfügte, umschlungen,
quetschte sich Hutzelchen selig lächelnd an sein Herz und
ließ Angst eben Angst sein. Man lachte wieder Tränen über
das Paar.
»Ich kann nicht mehr!« Edeltraut hielt sich die Seiten.
»Onkelchen, dich so knipsen dürfen!«
»Untersteh dich!« schnauzte er. »Schaut euch lieber selber
an, die ihr auf euren komischen Sitzen auch nicht gerade
dekorativ wirkt, und lacht nicht so respektlos euren Präses
aus.«
»Ich finde mich niedlich«, renommierte Papa Bessolt, dabei

geschickt auf seinem Stühlchen balancierend. »Und meine
Alte kann sich auch sehen lassen, mit dem süßen Marjell-
chen an der treuen Brust. Wie Madonna mit Kind.«
»Und uns beachtet ihr überhaupt nicht«, beklagte sich Cor-
nelia, die auch auf einem Fußstühlchen saß und zu deren
Füßen Jochen Bessolt schmachtete. »Seladon und Schäfe-
rin, ist das vielleicht gar nichts?«
»Nichts von Bedeutung«, schmunzelte der Gatte, der auf
dem Sofa wie ein Pascha saß, rechts Frau von Skalden,
links Frau Glade im Arm. »Seht her, dann habt ihr eine
wahre Augenweide.«
»Ehrensache, Paps«, bestätigte Sidonie, die sich neben die
auch nicht gerade grazile Frau Glade zwängte und so das
Ende des Sofas besetzt hielt. Auf die Seitenlehne hatte Ran-
dulf sich placiert, gewiß nicht absichtlich, sondern durch
Zufall, der sich ja ein Vergnügen daraus machte, die Baro-
nesse immer wieder in seine Nähe zu listen. Das feine Par-
füm, das ihren Kleidern entströmte, duftete schmeichelnd
zu ihm empor.
Sie horchten alle auf, als aus dem Saal ein schmissiger Wal-
zer klang. Man strebte zur Tür und erblickte nun ein völlig
verändertes Bild. Die lange Tafel war weggeräumt, während
die Mitte des Raumes eine geräumige Tanzfläche bot. Eine
Bar prunkte in der Ecke, in der anderen der Plattenspieler.
Und das alles wurde überstrahlt von den elektrischen Lam-
pions die ein farbenfrohes Licht verströmten.
»Das ist ja wie in Tausendundeine Nacht«, schmunzelte
Papa Bessolt. »Da wird aber mal meine Glatze in allen Far-
ben spiegeln. Muttchen, wollen mal gleich losscherbeln.«
Sprach's, nahm die getreue Ehehälfte um die mollige Mitte
und walzte mit ihr davon.
»Das ist meine Dame!« protestierte der junge Skalden eifer-
süchtig, wurde jedoch vom Präses beschwichtigt.
»Laß sie, mein Sohn, sie tanzen ja nur eine Ehrenrunde.«
So standen denn alle und sahen dem Solotanz zu. Man
mußte staunen, wie leichtbeschwingt die Wohlbeleibten
tanzten, wobei ihnen nicht einmal die Puste ausging. Sie

machten erst Schluß, als die Platte abgelaufen war, und
nahmen den reichlich gespendeten Beifall vergnügt entge-
gen.
Und nun begann der allgemeine Tanz. Die Herren, die
gleich den Damen Pullover trugen, warfen mit Genehmi-
gung des zarten Geschlechts bald ihre Jacken ab, damit sie
nicht gar zu sehr zu schwitzen brauchten. Nun leuchtete
das Bunt der Wolle mit dem der Lampions um die Wette,
die weiten Röcke der Damen kreisten verwegen. Lustig
tanzte man nach der Schallplattenmusik und sang bald die
Weise mit.
Hutzelchen fühlte sich wie im siebenten Himmel. Sie war
auch mal jung gewesen. Hatte geschwärmt, geliebt, gehofft,
wie jedes andere Mägdlein. Daß sich kein Freier für sie
fand, war Pech.
Eben hing sie dem Grafen Randulf im Arm wie eine Fle-
dermaus in den Fängen des Adlers. Verliebt schaute sie zu
ihm auf, der sich darob köstlich amüsierte. Daß sie ihm oft
auf die Füße trat, machte ihm gar nichts aus.
»Sie sind ein Mann, Herr Graf!« stellte sie ganz unmotiviert
fest, was ihn zuerst verblüffte, dann aber herzlich lachen
ließ.
»Das weiß ich doch schon längst, gnädiges Fräulein.«
»Dann soll es unser Geheimnis bleiben, nicht wahr, Herr
Graf?« versuchte sie einen schelmischen Blick, was bei dem
Altjüngferlein gar komisch wirkte.
»Aber, Hutzelchen, Sie sind heute ja gar nicht ängstlich!
Haben Sie am Ende der Bar öfter einen Besuch abgestattet?«
»Nur zweimal«, verriet sie verschämt. »Mehr darf ich nicht.
Mein Bruder behauptet, ich hätte einen schlechten
Rausch.«
Da lachte der Mann, so mitreißend fröhlich, daß er die
anderen damit ansteckte. Der Gastgeber, der soeben mit
Herma tanzte, sagte schmunzelnd: »Ich habe ja gar nicht
gewußt, Frau Gräfin, daß Ihr Sohn so mitreißend lachen
kann.«
»Das tut er auch nur selten, Herr Baron, viel zu selten –

leider. Er ist ja so schwerblütig, der Junge, nimmt alles so
entsetzlich ernst. Heute geht er einmal so recht aus sich
heraus.«
»Und das Fräulein Tochter, ist es ebenso?«
»Nein, sie ist fröhlich, aufgeschlossener und als Mädchen
natürlich nicht so hart. Aber ein hartes Köpfchen und einen
festen Willen hat sie dennoch.«
Da die Musik schwieg, brach auch das Gespräch ab, das
ihnen beiden eigentlich unerwünscht gewesen war. Aber
heute war ja alles so anders. Man befand sich in einer
Stimmung, in der man hätte die ganze Welt umarmen mö-
gen.
Daher wagte auch Roger, der Heidgar zum nächsten Tanz
holte, mit der Musik um die Wette zu singen, mitten in die
leuchtenden Augen seiner Partnerin hinein:
»Mädchen mit den blauen Augen
und dem sonnenhellen Haar,
weißt du auch, daß ich dich liebe,
gestern, heut und immerdar.«
Der abweisende Blick, der ihn traf, ließ ihn zur Besinnung
kommen. Beschämt fragte er:
»Böse?«
»Nein, nur erstaunt. Waren Sie nicht zu kühn, Herr Baron?«
»Das scheint mir auch.«
Da mußte sie lachen, und der Schwerenöter war wieder
obenauf.
Der nächste Tanz war ein Tango, zu dem Randulf die Baro-
nesse holte. Aber dieses Paar blieb auch heute kühl bis ans
Herz hinan, obwohl die Männerstimme auf der Platte so
zärtlich sang, die Geigen schluchzten. Man lächelte sich
wohl zu, sprach auch miteinander, aber nichts Persönli-
ches.
Es wurde mit Hallo begrüßt, als die Frau Försterin verkün-
dete, daß nebenan Speise und Trank warteten. Man fand
auf den langen Tischen alles das, was das Auge ergötzte

und der Magen begehrte.
Es war viel amüsanter, sich die Bestecke und Teller selbst zu
holen, sie zu füllen und sich zwanglos an den Tischen im
Saal zu gruppieren.
Papa Bessolt, der mehr das Kompakte liebte, holte sich
Eisbein und ließ sich dazu von der Frau Försterin Kartof-
feln nebst Sauerkraut geben.
Nach dem Essen gab es eine Überraschung, die Begeiste-
rung hervorrief. Es wurden Lose gezogen, wobei niemand
leer ausgehen sollte; denn jedes Los gewann. Die Gastgeber
riefen die Nummern aus, der Gewinner bekam ein Päck-
chen ausgehändigt, das natürlich nicht immer Passendes
für ihn barg. Das erhöhte noch den Reiz und gab lustiges
Lachen.
»Für mich wie geschaffen!« Regierungsrat von Blüthner
hielt ein zierliches Damentäschchen hoch, das aus feinstem
Goldgespinst gearbeitet war, und schon hatte er das
Schwiegertöchterlein an der Seite.
»Gib es mir, Papachen, bitte!«
»Halt!« rief der Gastgeber lachend. »Ordnung muß sein.
Womit sind Sie bedacht, gnädige Frau?«
»Mit einem wunderbaren Parfüm.«
»Also etwas für die Dame. Tut mir leid, meine Gnädigste,
aber Sie sind somit abgefunden. Es kommen nur die Herr-
schaften heran, die Unpassendes in der Hand halten. Sie
dürfen mit den Schlittenpartnern tauschen. Welche Dame
war es, Herr Regierungsrat?«
»Fräulein Glade.«
»Herrlich!« jubelte die neunzehnjährige bildhübsche Doris.
»Tauschen wir, Onkel Blüthner. Denn für Manschetten-
knöpfe habe ich keinen Bedarf.«
Also wurde getauscht. Die Kleine war glücklich über das
reizende Täschchen und der Herr Regierungsrat über die
gewiß nicht billigen Knöpfe.
»Nun sagen Sie, Frau Gräfin, was halten Sie in der Hand?«
erkundigte sich Papa Bessolt bei seiner Schlittendame, die
ihm lachend eine Pfeife hinhielt.

»Na also!« schmunzelte er. »Schauen Sie mal diese Spit-
zendingerchen an, die da in dem feudalen Kästchen prun-
ken. Da hätte sich aber meine Nase gewundert, wäre ich ihr
mit so etwas Duftigem zu nahe gekommen.«
Also ging auch hier der Tausch glatt vonstatten.
»Das hat mir gerade noch gefehlt!« Der Oberst besah ein
Halstüchlein, zart wie ein Hauch, ein Musterstück der We-
bekunst. Dann nahm er seine Schwester aufs Korn.
»Was hast du, Schlittendame Hutzelchen?«
»Eine Tabakdose«, entgegnete sie kläglich. »Du meine Güte,
was soll ich damit anfangen!«
»Herkommen und tauschen!« schnauzte er. Gleich bewun-
derte das alte Fräulein das Tuch, das so war, wie sie ein
solches noch nie besessen, während der Präses die Tabaks-
dose verliebt betrachtete. Somit war auch das dritte Paar
beglückt.
Bei fünf anderen hatte das Los richtig entschieden. Zwei
Damen tauschten unter sich, zwei Herren taten also, somit
standen noch vier Paare mit acht Tauschobjekten aus.
Darunter Roger, der kopfschüttelnd ein Medaillon besah.
Dann trat er zu Heidgar, die ein dickes in Leder gebunde-
nes Buch in den zarten Händchen jonglierte.
»Ist das etwas für Sie, Komteß?«
»Ich glaube nicht, Herr Baron«, gab sie lachend zurück.
»Lexikon für die Landwirtschaft, zu hoch für mich.«
»Das paßt ja herrlich«, schmunzelte er. »Tauschen wir.«
»Bitte nicht!« wehrte sie erschrocken, als er ihr das Medail-
lon hinhielt. »So ein kostbares Schmuckstück darf ich als
Gastgeschenk nicht annehmen.«
»Gastgeschenk – eben«, betonte er scharf. »Wollen Sie Ihre
Gastgeber beleidigen, Komteß?«
»Um Gott nicht!« wehrte sie hastig, ihn hilflos dabei anse-
hend. Das rührte den Mann, der nun herzlich sagte:
»Beugen wir uns dem Wahlspruch unseres verehrten Präses:
Mitgefangen, mitgehangen.«
Da griff sie nach dem Medaillon, er klemmte das Buch un-
ter den Arm, und die Sache ging in Ordnung.

Randulf hingegen zog unbehaglich die Schultern hoch, als
er das kleine Etui betrachtete. Als er es öffnete, lagen, in
rotem Samt gebettet, ein goldener Fingerhut und eine mit
Steinen besetzte Schere. Sein Blick suchte Sidonie, die ihm
abwartend entgegensah. Da straffte er seine Gestalt, als
gelte es, einen Kampf auszutragen, und ging zu ihr hin.
»Baronesse, gebührt das einem Mann?«
»Nein, Herr Graf«, entgegnete sie mit einem entzückend
schelmischen Lächeln. »Schauen Sie, was ich hier habe. Ein
Kästchen, das einen Drehstift mit Minen dazu birgt, für
eine Mädchenhand zu schwer, für eine Männerhand gerade
richtig. Folgen Sie dem Beispiel der anderen, tauschen wir.«
Das geschah denn auch ohne jeden weiteren Kommentar.
Die letzten beiden Paare wurden rasch miteinander einig,
und beglückt steckte man die Gaben ein. Als sie sich be-
danken wollten, wehrte Baron Gisbert lachend ab.
»Bitte, meine Herrschaften, keinen Dank. Die kleinen Ga-
ben sollen eine Erinnerung an das heutige Fest bedeuten.
Und so wollen wir weiter fröhlich sein. Wollen noch die
Stunden genießen, die unser Zusammensein uns schenkt.«
Dazu war man gern bereit. Man tanzte ohn' Unterlaß und
feuchtete die Kehle, wenn sie trocken wurde. So leichtbe-
schwingte Stunden mußte man auskosten bis zur Neige.
Hei, wie konnte das Leben schön sein, eigentlich viel zu
schön, um wahr zu sein. Als schließlich die Stunde des
Abschieds schlug, war die Freude noch nicht zu Ende. Es
kam noch die Heimfahrt durch den Winterwald, der so viel
Köstlichkeiten in sich barg, wie sie das Menschenauge gar
nicht fassen konnte. Der Mond, in blanker Scheibe sich-
tbar, wies den Weg, den die Schlitten fuhren. Wohlig in das
Pelzwerk geschmiegt, ließ es sich so herrlich träumen. Die
Glöcklein am Geschirr läuteten, die Pferde griffen munter
aus. Auch sie waren ja zu Gast gewesen bei dem großzügi-
gen Gastgeber Hellnor. Hatten sich im warmen Stall am
Hafer gelabt und aus den Eimern wohltemperiertes Wasser
getrunken. Da liefen sie gern, daß die Beine nur so flogen,
waren genauso lustig wie die Menschen.

Und wenn die Menschen lustig sind, dann singen sie. Ob
gut oder schlecht, das ist ihnen egal.
Und was wird wohl am meisten besungen? Natürlich der
Lenz und die Liebe, die selige, goldige Zeit.
Es wurde auch bereitwillig aufgenommen, als die junge
Doris Glade, deren Herzchen auch schon was zu spüren
bekam von dem »himmelhochjauchzend, zu Tode be-
trübt«, melancholisch anstimmte:
»Sag, Mutter, was ist mit mir geschehen,
warum wollen die Tage so gar nicht vergehn,
warum sind mir die Nächte so lang,
warum ist mir das Herz so bang?
Die Mutter spricht gütig: Lieb Tochter mein,
was dir jetzt geschieht, das muß so sein,
Gott wünscht, daß es immer so bliebe:
Die Engel, sie nennen es Himmelsfreud,
die Teufel, sie nennen es Höllenleid,
die Menschen – sie nennen es Liebe.«
Nachdem der letzte Ton verhallt, war es zuerst einmal un-
ter den Menschen still. Jeder dachte wohl darüber nach,
wieviel Weisheit dieses alte Lied enthielt, wie es in schlich-
ten Worten das kennzeichnete, was so viel tiefes Leid und
wiederum so viel höchste Seligkeit in sich bergen konnte.
Aber da dieser fröhliche Tag auch so enden sollte, gab es
gleich wieder etwas zum Lachen. Und zwar über Hutzel-
chen, das auch während der Rückfahrt neben dem so bär-
beißig tuenden, in Wirklichkeit jedoch so gutherzigen Bru-
der saß, ganz warm und weich von seinem Arm umschlun-
gen. Durch das eben verklungene Lied angeregt, erinnerte
sich das alte Fräulein wohl der eigenen Jugendzeit, der
Herzensnot, gebracht von dem, was die Menschen Liebe
nennen. Wehmütig sang Hutzelchen mit ihrer wie eingero-
steten Stimme:
»Ach wärst du doch ein Ritter,

ein Ritter vom Goldenen Vließ,
o Lieb, wie bist du bitter,
o Lieb, wie bist du süß.«
Das klang bei dem verhutzelten Altjüngferlein gerade
schon komisch genug. Als jedoch der Bruder gar mit Tenor-
stimme seinen Kommentar dazu gab:
»Gib man nicht so an, Hutzelchen, das ist ja schon lange
her«, da brach ein Lachen auf, das kein Ende nehmen woll-
te.
»Dieses Geschwisterpaar ist köstlich!« Gräfin Herma wisch-
te sich die Lachtränen aus den Augen. »So bärbeißig unser
Präses mit der Schwester auch tut, so scheint er dennoch
sehr an ihr zu hängen.«
»Wenn auch auf ganz besondere Art«, schmunzelte Papa
Bessolt. »Er schnauzt mit ihr herum, wie mit Soldaten auf
dem Kasernenhof. Aber wehe, wenn ein anderer das Hut-
zelchen angreift! Der kriegt seinen Grimm zu spüren.«
»Hast recht«, bestätigte die Oberstgattin, die in demselben
Schlitten saß, lachend. »Wenn man Hutzelchen von ihm
trennen wollte, würde er Barrikaden um es errichten. Aber
schnauzen muß er, sonst ist ihm einfach nicht wohl.«
Mittlerweile hatte man Marstein erreicht, wo die Trennung
kam. Nach herzlichem und begeistertem Dank an die Gast-
geber nahmen die Familien im eigenen Schlitten Platz, um
nach Hause zu fahren.
Nicht nur in der »Clique« sprach man noch tagelang von
der Schlittenfahrt, sondern auch dort, wo man davon hör-
te. Und da ja immer übertrieben wird, im Bösen wie im
Guten, so wurde aus dem zwanglosen Fest eine glanzvolle
Fete, die Gastgeschenke zu sagenhaften Kostbarkeiten, und
der Reichtum der Hellnors wuchs ins Gigantische. Roger,
dem in der Stadt von alledem eine ganze Menge zu Ohren
gekommen war, erzählte es lachend zu Hause, und der
Vater schmunzelte.
»Na, laß die Leutchen doch! Sie wollen ja schließlich auch
ihr Vergnügen haben. Besser so, als wenn sie boshaft wer-

den.«
Es sollte übrigens in diesem Jahr die letzte Schlittenfahrt
gewesen sein, denn schon einige Tage später setzte die
Schneeschmelze ein.
Es war nun schon zum zweitenmal, daß man unter dem
neuen Besitzer von Marstein den Acker bestellte, und im
Sommer wurden es zwei Jahre, daß die Hellnors Einzug in
das Herrenhaus hielten. Florence schrieb enttäuschte Briefe,
daß die Anverwandten, die sie dieses Jahr in Chile erwarte-
te, nicht kommen wollten. In ihrem drolligen Deutsch gab
sie den Kommentar dazu: »Ihr schlecht sein, ihr Böse, daß
ihr nur kommen, wenn ich gekriegen hab ein Kind. Alle
Jahr will ich aber nicht haben eine, da kommen eben ich
mit Babys beide.«
»Um Gottes willen, Gisbert, sie tut's!« lachte die Gattin.
»Da ist es am besten, wenn du und Roger, hinfahrt und sie
holt.«
»Liebe Nel, verschone mich!« Der Sohn hob abwehrend die
Hände. »Erstensmal kann ich, wenn die Frühjahrsbestel-
lung losgeht, hier nicht fort, und dann habe ich keine Lust,
mich während der Reise mit zwei kleinen Kindern abzu-
plagen, was meine liebe Schwägerin einfach von mir ver-
langen würde. Laßt sie dort, wo sie ist. Sie fühlt sich in die-
sen Verhältnissen bestimmt nicht wohl und würde nach
vier Wochen wieder abreisen, nachdem sie alles auf den
Kopf gestellt hätte.«
»Recht hat er«, bekräftigte der Vater. »Also werde ich ihr
schreiben, daß es hier Wölfe und weiteres böses Getier gibt,
die sie und die Kinder bestimmt fressen würden. Ferner,
daß es hier gräßlich kalt wäre. Dann keine Autos, keine
Reitpferde, keine Amüsements, eine Einöde, wo sich noch
nicht einmal die Füchse gute Nacht sagen.«
»Dann schreibe ihr das auch noch auf gut Deutsch, und der
Erfolg wird erschütternd sein«, lachte die Tochter. »Dann
holt sie sich bestimmt alle Wörterbücher zusammen und
tüftelt so lange darin herum, bis sie das Gegenteil feststellt
– und kommt gerade, weil es hier am Ende gar sensationell

sein könnte. Wenn du ihr also schon Märchen aufbinden
willst, dann tu es bloß auf Spanisch, Paps.«
»Kinder, warum viel Lärm um nichts?« lächelte Nel. »Kennt
ihr Frank denn so wenig? Laßt euch gesagt sein, daß er sie
niemals hierherfahren läßt. Die würde überall landen, bloß
nicht hier.«
»Dann rückt sie aus.«
»Das glaube ich nicht, mein Sohn. Wenn Frank dem kapri-
ziösen Persönchen auch viel den Willen läßt, aber in gewis-
sen Dingen hört diese Nachsicht auf. Das weiß Florence
ganz genau und wird es daher nicht wagen, ihre Ehe aufs
Spiel zu setzen.«
Und doch erschien die kleine Frau eines Tages ganz überra-
schend. Lachend, strahlend, quicklebendiger denn je stand
sie plötzlich da, brachte sogar die beiden Kinder mit, aber
auch ihren Mann.
Das gab nun ein frohes Begrüßen! Ganz rührend war die
Freude der kleinen Frau, und auch in den Augen des immer
so gemessenen Frank stand ein warmes Leuchten.
»Florence war von einer Hartnäckigkeit, die mich schließ-
lich mürbe machte«, erzählte er lachend. »Sogar mit Schei-
dung hat sie mir gedroht. Und da ich sie nicht allein reisen
lassen wollte, so mußte ich sie wohl oder übel begleiten.
Ich habe mir diese Ausspannung ja auch redlich verdient«,
setzte er wie entschuldigend hinzu, »zumal meine Mitarbei-
ter sehr zuverlässig sind. Also, meine Ferien bedeuten für
das Geschäft kein Risiko.«
»Recht tatest du, mein Sohn.« Cornelia umarmte ihren Äl-
testen. »Ach, Kinder, wie bin ich glücklich, euch hier zu
haben.«
»Das haben aber gekostet was«, lachte Florence, ein aller-
liebstes Persönchen. Zierlich, mit einem süßen Puppenge-
sichtchen, zwar dunkelhaarig, aber mit Augen wie grauer
Samt. Also nicht mehr ausgesprochen spanisch, die kleine
Donna, denn in ihren Adern floß von der Urgroßmutter
her deutsches Blut. Die Haare waren auch mehr braun als
schwarz. Der kleine Mund sprudelte förmlich über.

»Ach, was haben ich hinter mich bringen für schreckliches
Zeit. Frank sein gewesen lieblos zu mich, und ich haben
immer weinen tun, immerzu.«
»Florence, dein Deutsch ist ja geworden so verstanderlich«,
neckte der Schwiegervater, und sie strahlte.
»Oh, ich haben gelernt viel bei Schwester Hanni, der Nurse
von Grace«, bekannte sie stolz. »Ich wollen mich nicht
schämen bei euch in die Deutsche Land.«
Die beiden Kinder sahen dem allen mit ängstlichen Augen
zu. Der dreijährige Ronald, ein entzückendes Kerlchen,
hielt sich am Rock der Kinderschwester, die das süße Püpp-
chen Grace auf dem Arm hielt. Neben ihnen stand die Zofe
und strahlte.
»Lizzi sein euch ja bekannt«, sprudelte Florence wie ein
Wasserfall. »Aber das sein das neue Schwester von Baby.
Das alte nicht mehr gut sein, und ich haben es schmeißen
weg.«
»Oh, Florence, wo hast du denn die Bezeichnung aufgega-
belt!« jubelte Sidonie. »Steht die etwa auch im Wörter-
buch?«
»Na, heißen das nicht so?«
»Kann man auch sagen«, fuhr Roger ihr in den Wuschel-
kopf, was ihm einen Klaps auf die Finger eintrug.
»Lassen das sein, du Jung, du verrücktes.«
Vergnügt stimmte sie in das herzliche Lachen der anderen
ein. Dann mußte der kleine Ronald das sagen, was man
ihm als Begrüßungsworte einstudiert hatte. Es war unver-
kennbar ein kleiner Hellnor, der da stand, und hätte viel
eher der Sohn von Roger als von Frank sein können. Selbst
der Schalk schien ihm im Nacken zu sitzen, genau wie bei
seinem Onkel.
»Ich sein euch alle lieb, ich…«
»Habe«, verbesserte seine Pflegerin. »Und das letzte Wort
war übrig, Ronny.«
»Aber er hat doch so recht, der Schelm!« Cornelia hob ihn
auf den Arm und küßte das reizende Gesichtchen. »Es ist
uns ja allen lieb. Ach, was bist du doch für ein molliges

Stückchen.«
Noch einen Kuß auf das dralle Bäckchen, dann wandte sie
sich dem Enkeltöchterchen zu, das sich ängstlich an die
Pflegerin klammerte. Da ließ sie das Kind in Ruhe und
sorgte erst einmal dafür, daß die unverhofften und so sehr
lieben Gäste gut untergebracht wurden. In dem weiten
Hause war das kein Problem. Es standen Zimmer genug zur
Verfügung. Sogar Kinderbettchen waren vorhanden, in de-
nen einst die Hellnorkinder dem Leben entgegenträumten.
Ein sonniges Kinderzimmer kam zustande, und nebenan
befand sich ein reizendes Stübchen für die Pflegerin. Die
jungen Gatten legten auf getrennte Schlafzimmer keinen
Wert und bekamen zu dem gemeinsamen noch einen klei-
nen Salon. Für die Zofe Lizzi wurde auch gesorgt.
Die Gesellschaft brachte Leben in die Bude. Am meisten
Florence, mehr noch als die Kinder. Was gab es alles zu
erzählen! Der Mund stand nicht still. Selbst Frank war leb-
hafter, als man ihn kannte.
Als die Kinder zur Ruhe gebracht waren und die andern das
Abendessen eingenommen hatten, saß man im trauten
Wohngemach gemütlich beisammen. Wie ein schnurrendes
Kätzlein kauerte Florence im Sessel. Immer wieder beteuer-
te sie, wie glücklich sie doch war, nun zu sein »bei ihre
Lieblings alle.«
Florence bediente sich gern der deutschen Sprache, nur
wenn ihr etwas schwierig wurde, griff sie zum Spanisch.
Und wie sie die Ihren ansprach, so erhielt sie auch Antwort.
Sie war ein liebes Menschenkind, die zierliche Florence.
Wenn auch kapriziös und ein kleiner Rappelkopf, so gli-
chen andere gute Eigenschaften das wieder aus. Jedenfalls
durfte Frank mit seiner Frau zufrieden sein und war es
auch. Über ihre Drollerie mußte er manchmal sogar herz-
lich lachen, was bei dem sehr ernsten Menschen schon
allerlei bedeutete.
Während die drei Damen miteinander lachten und
plauschten, wobei Roger natürlich nicht fehlte, unterhielt
sich der Vater mit seinem Ältesten. Der gab einen Bericht,

woraus sich entnehmen ließ, daß die Geschäfte außeror-
dentlich gut florierten.
»Wie schön, daß du auch ohne mich so gut vorankommst,
mein Junge«, sagte der Vater warm. »Du bist eben der gebo-
rene Geschäftsmann und tust das gern, was ich nur ge-
zwungenermaßen tue.«
»Hast dich dabei aber glänzend bewährt«, lachte der Sohn.
»Sonst hätte unsere Firma das wohl nicht werden können,
was sie heute ist. Bist du nun hier glücklich?«
»Ja.«
»Schade, Vater, ich hatte die stille Hoffnung, daß die Sehn-
sucht nach der Heimat deiner Väter gestillt sein würde,
sofern du eine Zeit darin verweiltest. Daß du wieder nach
deinem Geburtsland zurückfändest, wo du mehr als dein
halbes Leben verbrachtest. Denn ehrlich gesagt, vermisse
ich euch Lieben sehr. Man ist mit seiner Familie eben zu
sehr verwachsen. Das lernt man erst kennen, wenn man ihr
fern ist.«
»Nun, mein Junge, du bist nun zuerst einmal hier«, entgeg-
nete der Vater gütig. »Da wollen wir unser Zusammensein
aus vollem Herzen genießen. Ich bin neugierig, wie lange
Florence es hier aushalten wird.«
»Das bin ich auch«, lächelte Frank. »Ich glaube, es war nur
der Reiz des Unbekannten, was sie mit aller Gewalt herzog;
denn ihre ganze Seligkeit schien davon abzuhängen. Ganz
entsetzlich quälte mich die kleine unvernünftige Frau mit
der Reise. Sie wollte sich ja sogar von mir scheiden lassen.«
»Und das hat dich wohl so eingeschüchtert, daß du nach-
gabst und dich sogar zur Mitreise entschloßt«, schmunzelte
der Vater, und er lachte.
»Sie hätte wohl ein Schnutchen gezogen, falls ich sie beim
Wort hätte nehmen wollen. Sie ist eben ein großes Kind,
aber ein liebes, gutherziges. Ich möchte sie gar nicht anders
haben.«
Diese Unterredung mit dem Ältesten gab Gisbert wieder,
als er sich mit seiner Frau im Schlafzimmer befand. Sie
lächelte gütig dazu und sagte:

»Ich habe ja gewußt, daß Frank gar nicht so kühlgemessen
ist, wie er scheint. Wenn er es auch nicht so zeigt, so liebt
er seine Frau und ist in der Ehe glücklich. Ich wünschte,
unseren anderen beiden Kindern würde, wenn auch nicht
gerade himmelstürmendes, so doch ein ruhiges, friedliches
Glück zuteil. Aber ich fürchte, sie werden noch durch viel
Herzeleid hindurchgehen und schließlich doch entsagen
müssen.«
Die Augen der Gatten trafen sich, die Herzen wurden ihnen
schwer. Bisher hatten diese beiden Menschen ihre geliebten
Kinder vor Leid und Kummer bewahren können, aber jetzt
konnten sie es nicht mehr, jetzt sprach das Schicksal.
Ein Menschenkind wie Florence lebt sich rasch ein, zumal
dann, wenn es alles um sich hat, was sein Herz umschließt.
Dazu kam der Reiz der Neuheit, für den die kleine Frau
sehr empfänglich war. Am liebsten wäre sie den ganzen Tag
im Auto herumgejagt, um all das Unbekannte schnell ken-
nenzulernen. Doch da streikte selbst Sidonie, die dazu aus-
ersehen war, die Schwägerin herumzuführen, weil sie die
meiste Zeit hatte. Zwar verfügte man in Marstein über eine
gutgeschulte Dienerschaft, die von der Hausherrin geleitet
wurde, damit alles wie am Schnürchen lief, doch bei so
anspruchsvollen Gästen mußte manches umgemodelt wer-
den. Natürlich belastete das auch Cornelia, die wohl nicht
mit den Händen, aber um so mehr mit dem Kopf arbeiten
mußte, um geschickt zu disponieren, damit in dem großge-
führten harmonischen Hauswesen keine Stockung eintrat.
Daher konnte sie sich nicht ausschließlich Florence wid-
men, und Roger lehnte es ab, weil er im landwirtschaftli-
chen Betrieb seiner Arbeit nachging.
»Was tun du eigentlich arbeiten, wenn du immer auf die
Pferd sitzt?« fragte sie naiv. »Reiten sein doch ein Amüse-
ment. Überhaupt arbeiten, wenn da sein dein Schwager
liebes, das mußt du fahren in die Welt. Dazu sein ich hier,
und haben zu stimmen alles.«
»Na eben!« spottete er. »Wenn sein das Majestät Florence
hier, müssen sich stellen auf die Kopf die ganze Marstein.«

»Du sein ein ungezogenes Jung!« entrüstete sie sich. »Wenn
Ronny es sein, gibt's Klaps.«
»Du wirst doch nicht handgreiflich werden?« Der Schwager
fuhr ihr in die Löckchen, sprang aber rasch aus der Gefah-
renzone, weil er wußte, wie leicht das Händchen ausrutsch-
te.
Die anderen hatten ihren Spaß an der Neckerei der beiden
vergnügten Menschen. Sie hätten gut zueinander gepaßt,
aber danach fragte die Liebe nicht.
Der Vater widmete sich am meisten seinem Ältesten, mit
dem er sich jetzt so richtig nahekam. Und da Frank die
Geruhsamkeit liebte, legte er keinen Wert darauf, im Eil-
tempo alles Neue zu erfassen. Warum auch! Er kam auch
so zum Ziel.
»Wann sein ihr eigentlich bei den Nachbars zu Gast?« er-
kundigte sich Florence an einem Tage im April, als es drau-
ßen regnete und stürmte, so daß es selbst die springleben-
dige kleine Frau vorzog, im wohltemperierten Zimmer zu
sitzen. Und da man sich ihrer Muttersprache bediente,
wenn man ihr etwas plausibel machen wollte, tat es der
Schwiegervater auch jetzt.
So erfuhr sie wie treu die »Clique« zusammenhielt, lernte
aus seinen Erzählungen die dazu gehörigen Menschen
kennen und war begeistert, daß sie alle zu sehen wünschte.
»Na, nun mal langsam, mein kleiner Firlefanz«, schmunzel-
te der Schwiegervater. »Wenn das unwirtliche Wetter an-
hält, wollen wir morgen nach Prangen zu unserem Präses
fahren, um ihn und seine Familie auch sicher zu Hause
anzutreffen.«
»Warum denn das, Paps?« fragte sie verständnislos. »Sind
die Herrschaften denn so viel auf Reisen?«
»Das nicht, Florence. Sie arbeiten in der Landwirtschaft.«
Das leuchtete ihr sofort ein. Denn der Beruf des Mannes
war etwas, wovor sie Ehrfurcht besaß.
Als hätte der Himmel ein Einsehen mit der kleinen Frau,
hielt das Aprilwetter an, so daß man die Besuche in der
Nachbarschaft machen konnte, die bereits erwartet wurden.

War doch jeder neugierig, die »Chiler« ganz aus der Nähe
zu betrachten.
In Prangen fingen die Besuche an und setzten sich schema-
tisch fort. Überall fand man mit der reizenden Florence den
richtigen Kontakt, überall war man von ihr entzückt.
Der letzte Besuch galt den Thorbrandts. Man tot es absich-
tlich, damit Florence sich erst einmal an deutsche Art ge-
wöhnen sollte, bevor sie in den Kreis der stolzen, zurück-
haltenden Menschen trat. Baron Gisbert fragte sogar erst
fernmündlich an, ob sein und seiner Familie Erscheinen
genehm sei, und wurde daraufhin von der Gräfin sozusa-
gen mit Kind und Kegel liebenswürdig zum Kaffee eingela-
den.
Frank wußte natürlich um die nachbarliche Fehde, Florence
jedoch war völlig ahnungslos. Erstens einmal konnte sie ihr
Schnäbelchen schlecht halten, und dann ging sie als Ange-
heiratete diese Fehde auch nichts an. Also trat sie völlig
harmlos in den exklusiven Kreis und bezauberte durch ihre
charmante Natürlichkeit sofort. Und sonderbar, hier fühlte
Florence sich am wohlsten, obwohl ihr auch die anderen
Familien durchweg gut gefallen hatten. Doch dieses waren
Menschen, die sie bei sich als einfach vornehm bezeichne-
te, dazu stolz, zurückhaltend und traditionsverbunden. Das
Ehepaar fand sie distinguiert, die Komteß bezaubernd, und
den jungen Grafen bezeichnete sie instinktiv als das, was
man einen Ritter sonder Furcht und Tadel nennt. Bei ihm
wagte das kapriziöse Persönchen nicht einmal einen harm-
losen Flirt, dem es sonst nie abgeneigt war.
Die Menschen sowie die ganze Umgebung imponierten
Florence wohl sehr, verursachten ihr jedoch keine Hem-
mungen. Sie plauderte in ihrer drolligen Art und machte
sich, ohne es zu wollen, zum Mittelpunkt der kleinen Ge-
sellschaft.
Als man sich bei ihrem Erscheinen ihrer Muttersprache
bediente, die man nicht beherrschte, lachte sie verschmitzt:
»Oh, bitte sehr, ich sprechen gut Deutsch. Sitzen ich doch
in eine deutsche Nest und wollen lernen viel. Verstehen ich

alles tu, nur tuen mir fehlen bei manches die Worte.«
»Das ist uns aber neu, Florence, daß dir einmal die Worte
fehlen«, neckte Cornelia.
»Ich sehe, Frau Baronin, Sie haben viel zu leiden«, schmun-
zelte der Hausherr, doch sie winkte vergnügt ab.
»Ich tu mich schon wehren.«
Jedenfalls sorgte Florence dafür, daß es frohe Stunden wur-
den, die man miteinander verlebte. Und als man sich ver-
abschiedete, lud sie ganz ungeniert die Gastgeber nach
Marstein ein. Ehe diese sich äußern konnten, sagte Corne-
lia rasch gefaßt:
»Ich schließe mich der Bitte meiner Schwiegertochter an.
Wann dürfen wir die Herrschaften erwarten?«
»Je nachdem wie das Wetter wird«, entgegnete der Haus-
herr, ein amüsiertes Lächeln über die Eigenmächtigkeit der
kleinen Frau unterdrückend. »Läßt das Regenwetter nach,
haben wir Landwirte nur am Sonntag Zeit.«
»Dann Sonntag!« entschied Florence kurz und bündig. »Ich
mich auf Ihre Besuch schon freuen tu.«
»Na also!« lachte der Schwiegervater. »Mehr können Sie
doch wahrlich nicht verlangen, meine Herrschaften.«
Während der kurzen Fahrt im Auto stand das Plappermäul-
chen nicht still. In Marstein angelangt, ging es dann weiter:
»Ich finden sie noblig, die Grafen Thorbrandt, mehr wie
die andern alle. Sie sind mir gut auch, aber nicht wie diese
Pack.«
»Halt ein, Florence!« gebot der Gatte und übersetzte ihr das
letzte Wort, worauf sie in das Lachen der andern einfiel.
»Oh, wenn ich so sagen zu Grafen, dann sie mich wohl
schmeißen weg.«
»Rausschmeißen, heißt es«, tat Roger ernsthaft, worauf der
Bruder ihm in den blonden Schopf fuhr.
»Na warte, du übermütiger Schlingel! Wenn du schon ver-
besserst, dann tu es wenigstens richtig.«
»Was der sagen, tu ich glauben nicht«, tat Florence großar-
tig ab. »Er sein eine Mensch aus Ulk. Heißen es nicht
schmeißen weg, Frank?«

Er machte es ihr plausibel, und sie lachte hellauf.
»Oh, da wären sein lustig. Da lachten die Grafen alle. Die
Randulf sagt, ich sprechen gut Deutsch, und er lieben
mich.«
»Na, hör mal, Florence, dabei wird er sich doch wohl an-
ders ausgedrückt haben.« Der Schwiegervater schmunzelte.
»Übersetz mal, was er sagte.«
Es kam heraus, daß, als sie ihm erzählte, wie lieb man ihr
bei den Besuchen in der Nachbarschaft entgegengekom-
men wäre, er lächelnd meinte, einem so zutraulichen Men-
schenkind könne man nicht anders als lieb begegnen.
»Das hört sich schon anders an!« lachte Cornelia. »Es hätte
mich auch baß erstaunt, wenn gerade dieser stolze, ver-
schlossene Mann dir gleich eine Liebeserklärung gemacht
hätte, dazu noch als Frau eines andern.«
»Ja, er scheint aus der Familie am unzugänglichsten zu
sein«, bestätigte Frank, »obwohl die andern trotz aller Lie-
benswürdigkeit auch nicht gerade aufgeschlossen sind. Ich
glaube nicht, daß man jemals so richtig warm mit ihnen
werden könnte. Und doch gefallen sie mir gut.«
In diesem Augenblick wurde Florence von der Kinder-
schwester abgerufen, und so konnte Frank auch über das
sprechen, was er in Gegenwart seiner Frau unterlassen hät-
te. Er knüpfte da an, wo er aufhörte:
»Sehr gut sogar gefallen sie mir. Ich freue mich, meine Lie-
ben, daß ihr nicht so unvernünftig seid, euch einer alten
Feindschaft wegen mit den Nachbarn zu befehden, son-
dern mit ihnen Freundschaft haltet.«
»Mein lieber Junge, was du da Freundschaft nennst, ist
nichts weiter als ein nachbarlicher Verkehr, gewissermaßen
auf Kommando«, entgegnete der Vater achselzuckend. »Ich
erzählte dir doch schon von den ungeschriebenen Gesetzen
der >Clique<, die oft stärker sind als verbriefte und versie-
gelte. Also blieb uns Hinzugezogenen nichts anderes übrig
als mitzumachen, wollten wir von den Nachbarn nicht
gemieden werden. Als wir die Antrittsbesuche hinauszöger-
ten, fackelte der Präses nicht lange und lud uns samt den

andern zu einer Gesellschaft in sein Haus ein. Das hieß
nichts anderes als: Entweder – oder!«
»So hat Florence wohl einen Lapsus begangen, als sie kur-
zerhand die Familie Thorbrandt zu uns einlud?«
»Nein, das war gut so. Da wir bei ihnen zum Kaffee waren,
kommen sie Sonntag zu uns, und wir sind quitt.«
Schon am nächsten Tag hörte der Regen auf, und der Wind
fuhr trocknend über die Felder. Also konnte der Landmann
wieder mit der Arbeit beginnen. Die war Florence neu und
somit hochinteressant. Sie ließ Sidonie keine Ruhe, bis
diese mit ihr hinausritt ins Freie. Sie kamen an einem Acker
vorüber, wo ein Mann den Pflug führte. Tief holte die Scha-
le die dunkle Erde herauf, schnurgerade liefen die Furchen.
Ach, wie war das für Florence aufregend neu! Sie überhäuf-
te die Schwägerin mit Fragen, die diese nicht alle beantwor-
ten konnte, weil sie in der Landwirtschaft ja auch noch
nicht firm war.
»Du, dort reitet Graf Randulf!« Sie verfiel vor Eifer in ihre
Muttersprache. »Was macht er da?«
»Das weiß ich doch nicht.«
»Gehört der Acker denn nicht zu eurem Besitz?«
»Nein, das ist bereits Güldenroder Boden. Schau mal dort
den großen Stein, der kennzeichnet die Grenze.«
Sie schaute jedoch gar nicht hin, sondern verfolgte auf-
merksam den Reiter, der jetzt eine Wendung machte, die
Damen ins Blickfeld bekam, den Hut zog, und schon war
die kleine Frau auf und davon.
»Florence, wo willst du hin? Florence, so höre doch!« rief
Sidonie ärgerlich hinterher, doch ohne Erfolg. Jetzt begrüß-
te die kapriziöse kleine Donna bereits den Grafen, so daß
der Schwägerin nichts anderes übrigblieb, als nachzureiten.
Sie war ernstlich böse auf Florence und ihre Miene durch-
aus nicht freundlich, als sie dazukam. Am liebsten hätte sie
ihr gehörig die Meinung gesagt, was in Gegenwart des
Mannes natürlich unterblieb. Sie begrüßte ihn mit kühler
Zurückhaltung.
»Komm, Florence, wir müssen weiter«, gebot sie kurz, doch

diese dachte nicht daran.
»Ich will nicht!« erklärte sie einfach, Randulf dabei anstrah-
lend. »Ich will reiten mit Sie, Herr Graf, ja?«
»Aber bitte sehr, Frau Baronin«, lächelte er amüsiert. »Wo-
hin soll es denn gehen?«
»Ich lassen mich fuhren.«
»Dann also nach Güldenrode!« Es zuckte ihm um Augen
und Lippen. »Es treffen dort Pferde ein, die ich abmustern
muß.«
»Siehst du, Florence, dann hat der Herr Graf für dich keine
Zeit.« Sidonie fiel ein Stein vom Herzen. »Komm, damit du
ihn nicht noch länger aufhälst.«
Damit glaubte Sidonie gewonnenes Spiel zu haben – hatte
aber dabei nicht mit dem Eigensinn der Schwägerin ge-
rechnet.
»Oh, ich sein ihm nicht lästig«, lachte sie fröhlich. »Ich
Pferde gut sein und will sehen zu.«
Punktum! hätte man darunter setzen können. Sidonie hat-
te das Gefühl, als müßte sie dem eigensinnigen Persönchen
in das strahlende Gesicht schlagen. Statt dessen mußte sie
nachgeben, wollte sie keine Szene heraufbeschwören. So
ritt sie denn neben ihnen, die miteinander wie alte Bekann-
te plauschten.
Zehn Minuten später war der Gutshof von Güldenrode
erreicht, wo schon die Pferde standen, darunter ein Pony,
das Florence's hellstes Entzücken hervorrief. Im Nu war sie
aus dem Sattel, liebkoste das Tierchen.
Nachdem der Graf die beiden Pferde abgemustert, sie für
gut befunden und die Männer, die sie gebracht, abgefertigt
hatte, trat er zu der glückstrahlenden Frau.
»Gefällt Ihnen das Tierchen, Frau Baronin?«
»Oh, ich haben in mich so viel Freude, daß ich müssen
weinen«, strahlte sie ihn an. »Das sein ein Pferd für meine
kleiner Sohn. Was muß es kosten füre Geld?«
»Florence!« rief Sidonie, die neben den Reitpferden stand,
empört. »Du weißt doch gar nicht, ob der Herr Graf das
Pony verkaufen will.«

»Will schon!« beharrte sie eigensinnig. »Er nichts kann fan-
gen an mit klein Pferd, wo hat er kein Kind. Und ich hab
eine und sie machen glucklich.«
Nun gab Sidonie es auf. Denn diese eigensinnige Frau jetzt
zur Vernunft zu bringen, hieße Wasser mit Sieben schöp-
fen. Es war ihr wie ein Schlag ins Gesicht, als der Mann
sagte:
»Verkäuflich ist das Pferdchen leider nicht, Frau Baronin,
weil ich es selbst nicht bezahlte, sondern als Zugabe erhielt.
Aber wie wäre es, wenn ich das Tierchen Ihrem kleinen
Sohn zum Geschenk machte, hm?«
Jetzt fällt sie ihm um den Hals, dachte Sidonie verzweifelt.
Doch gottlob, es unterblieb. Sie machte nur ihrem Entzük-
ken dadurch Luft, daß sie die Hand des Mannes mit ihren
beiden ergriff und sie kräftig schüttelte. Und als sie gar hör-
te, daß noch ein kleines Pferdegeschirr und ein Pony wagen
– was hier doch nur unbenutzt herumstehe – vorhanden
sei, da jubelte die kleine Donna.
Was aus Sidonie und den Pferden wurde, war doch Floren-
ce egal. Sie zappelte förmlich vor Ungeduld, bis das Pony
angeschirrt und vor den Wagen gespannt war. Stolz nahm
sie darin Platz, ergriff die Leine und wollte loskutschieren.
»Halt, Frau Baronin, so geht es ja nun nicht«, lachte Ran-
dulf amüsiert. »Sie können unmöglich allein durch die
Ihnen noch fremde Gegend fahren, dazu mit einem Pferd,
das Sie noch nicht kennen. Wohl ist es fromm, aber im-
merhin.«
»Dann Sido müssen mit«, entschied sie einfach.
»Und die Reitpferde?« fragte diese kurz zurück.
»Die hierbleiben, Herr Graf sie schicken nach.«
»Richtig«, bestätigte er und trat dann zu Sidonie, die ihm
abweisend entgegensah.
»Richten wir uns also nach den Befehlen der energischen
Dame.« Es blitzte humorvoll in seinen Augen auf. »Haben
Sie keine Sorge um die Pferde, Baronesse, ich schicke sie
durch zuverlässige Leute nach Marstein.«
»Das mag ich aber nicht«, entgegnete sie schroff, und er

zuckte die Achsel.
»Kann ich mir denken. Aber was tut's? Die kleine Frau ist
stärker als Sie. Gönnen Sie ihr doch die kindliche Freude.«
Da wandte sie sich brüsk ab und ging zum Wagen. Mit ei-
nem Gesicht, das wie vor Hochmut erstarrt schien, nahm
sie in dem zierlichen Gefährt Platz. Kein Dankeswort fand
sie für den Mann, der herantrat, um sich zu verabschieden.
Doch Florence machte das wieder gut. Sie überschüttete
ihn förmlich mit Dank. Dann rollte der Wagen davon.
Florence hatte keine Ahnung, was in der Schwägerin vor-
ging. Sie lachte und schwatzte, pries den hochherzigen Ge-
ber.
Auf dem Gutshof von Marstein kam Roger dem kleinen
Gefährt entgegen.
»Wo habt ihr denn das niedliche Gespann her?« fragte er
erstaunt, worauf Florence ihm wortreich Auskunft gab. Da
verfinsterte sich sein Gesicht.
»Konntest du das nicht verhindern, Sido?« fragte er kurz.
»Lieber Roger, du scheinst deine Schwägerin immer noch
nicht zu kennen.« Und während Roger sich um die Unterb-
ringung des Gespanns kümmerte, wobei ihm Florence
nicht von der Seite wich, eilte die Schwester zu den Ihren.
»Was hast du denn, Liebherz?« fragte die Mutter beunruhigt
auf die verstimmte Tochter schauend. Diese ließ sich in
einen Sessel sinken, steckte eine Zigarette in Brand und
erstattete dann Bericht, dem die andern betroffen zuhörten.
»Sie benahm sich wie ein ungezogenes Kind«, schloß Sido-
nie erbittert. »Man muß sich tatsächlich ihrer schämen.
Macht mit ihr was ihr wollt, ich jedenfalls habe von ihr
genug.«
Damit drückte sie die halbgerauchte Zigarette in die
Aschenschale, sprang auf und eilte aus dem Zimmer.
Unter den Zurückbleibenden war es zuerst einmal be-
klemmend still. Dann ergriff der Senior das Wort.
»Fatal – anders kann man diese Angelegenheit nicht be-
zeichnen. Was machen wir nun, Nel?«
»Nichts, weil da nichts zu machen ist«, entgegnete sie ärger-

lich. »So wie Sido es schilderte, hat Florence den Grafen
direkt dazu gezwungen, ihr das Gespann zu schenken. Ich
kann mir denken, wie unserer stolzen Tochter dabei zumu-
te war. Das alles muß ihr wie ein Schlag ins Gesicht gewe-
sen sein.«
»Ob man dem Grafen für das Gespann nicht doch einen
Gegenwert bieten soll?« fragte Frank, der vor den Kopf ge-
schlagen war. Doch der Vater hob abwehrend die Hand.
»Um Gottes willen, Junge, laß das bleiben! Du würdest den
Mann beleidigen. So ein verflixter Racker. Ich habe nicht
geglaubt, daß sie uns solch eine Blamage bereiten könnte.
Und dabei kann man ihr noch nicht einmal einen Vorwurf
machen, weil sie keine Ahnung hat, wie wir zu den Thor-
brandts stehen. Hätte ihr zum Beispiel ein anderer Nachbar
das kleine Gespann geschenkt, wäre das gar nicht schlimm.
Aber ausgerechnet Randulf Thorbrandt. Der wird einen
guten Begriff von unserer Schwiegertochter bekommen
haben, Nel.«
»Kann man wohl sagen. Na, geschehn ist geschehn, da hilft
nun alles nichts. Ich möchte euch raten, Florence nicht zu
schelten und ihr dabei womöglich noch klarzulegen, war-
um wir gerade den Thorbrandts nicht verpflichtet sein wol-
len. Die bekommt es nämlich fertig und erzählt ihnen das
wieder.«
Ehe sie weitersprechen konnte, kam Florence angewirbelt,
vor Freude halb närrisch. Das Zünglein überschlug sich
beim Erzählen, wobei sie sich natürlich ihrer Muttersprache
bediente, wie stets, wenn ihr das Herz überlief.
»Was ist dieser Graf Randulf doch nur für ein fabelhafter
Mensch«, schwärmte sie wie ein Backfisch. »Ich hätte ihn
für das Geschenk umarmen mögen, wagte es aber nicht.
Der Mann hat nämlich etwas an sich, was man nicht in
Worte fassen kann. Ich finde ihn aufregend interessant.«
»Was wirst du nicht!« neckte der Schwiegervater, dabei dem
Sohn, der nicht gerade freundlich auf seine quicklebendige
Frau schaute, einen warnenden Blick zuwerfend. »Hoffent-
lich hast du ihm nicht offen gezeigt, wie gut er dir gefällt.«

»Das weiß er auch so«, tat sie unbekümmert ab. »Aber nun
müssen wir überlegen, wie ich mich für das Geschenk re-
vanchieren kann. Er lehnte zwar jede Bezahlung ab, aber
das geschah wohl nur pro forma. Schreibe ihm einen
Scheck aus, Paps, und schicke ihn ihm zu. Er wird das Geld
gut gebrauchen können, da er ja arm ist, wie ich von euch
weiß.«
»Das hat uns gerade noch gefehlt! Tust du nur so naiv, Flo-
rence, oder bist du es wirklich noch?«
»Ja, was hast du denn, Paps?« fragte sie verständnislos. »Ich
will dem Grafen doch nicht schaden.«
»Laß das!« winkte er kurz ab. »Ich sehe schon, mit dir
ernsthaft zu reden, hat keinen Zweck. Wo bleibt da bei dir
der sprichwörtliche Stolz der Spanier, kleine Donna, und
ihr Taktgefühl? Wir Deutsche haben aber auch unseren
Stolz, der bei den Thorbrandts besonders stark ausgeprägt
ist. Wenn ich also dem Grafen Randulf einen Scheck zuge-
hen lassen will, kann ich statt dessen auch nach Güldenro-
de fahren und ihm ins Gesicht schlagen, das wäre für den
Mann ungefähr dasselbe.«
Mit erschrockenen Augen hatte Florence die Worte gehört,
die in einem Ton gesprochen wurden, den sie nicht vertrug.
Trotzig warf sie die Lippen auf.
»Du meine Güte, was habe ich denn schon Böses verbro-
chen, daß du mich so abkanzeln mußt, Paps?«
»Schau mal an, die kleine Donna!« ironisierte er, und da
flammte sie auf.
»Paps, ich verbitte mir diese Anzüglichkeit! Es gefällt mir
hier nicht mehr, ich will nach Hause. Komm, Frank, wir
packen sofort deine Sachen. In einem Hause, wo man dei-
ne Frau beleidigt, können wir nicht länger bleiben.«
»Tu, was du nicht lassen kannst«, entgegnete er seelenruhig.
»Ich bleibe mit den Kindern hier.«
Florence kannte ihren Mann genau und wußte daher, daß
er zu seinem Wort stand.
»Frank, sei doch nicht so hartherzig«, schluchzte sie wie ein
Kind. »Tu ich dir denn gar nicht leid?«

»Gewiß tust du mir leid, weil du dich so kindisch be-
nimmst.« Da funkelte sie ihn böse an und lief aus dem
Zimmer. Aber nicht um ihre Sachen zu packen, sondern
um ihr Söhnchen zu holen und ihm sein Geschenk zu zei-
gen. Der Junge, der darüber genauso begeistert war wie
seine kleine Mama, stieß auf keinen Widerstand, als er
stürmisch verlangte, mit dem niedlichen Gespann zu fah-
ren. So saßen denn Mutter und Sohn bald in dem Wägel-
chen und fuhren glückselig davon. Ihr Jubel drang bis zu
den drei Menschen hin und lockte sie ans Fenster.
»Ganz Florence!« Frank mußte widerwillig lachen. »Eben
noch drohte sie schwer gekränkt mit der Abreise, und nun
kutschiert sie quietschvergnügt in die Gegend. Man darf sie
einfach nicht ernst nehmen.«
»Damit tust du recht, mein Sohn«, bekräftigte der Vater.
»Ein Glück, daß sie trotz ihrer Flatterhaftigkeit ein liebens-
wertes Menschenkind ist und ihre guten Eigenschaften die
Fehler überwiegen.«
»Denen setze ich schon die nötige Energie entgegen«, lä-
chelte Frank. »Wenn es hart auf hart kommt, ist sie in ihrer
Gutherzigkeit letzten Endes immer die Nachgebende. Sie
wird mit den Jahren ja auch vernünftig werden.«
»Hoffen wir es«, lachte die Mutter. »Nun, wie dem auch sei,
jedenfalls gehört unsere Florence zu den Menschen, denen
man nicht lange ernstlich böse sein kann.«
*
Als Florence zu der Abendtafel sichtbar wurde, hatte sie
längst die Zurechtweisung des Schwiegervaters vergessen,
auch daß sie nach Hause fahren wollte. Begeistert schilder-
te sie die Fahrt im Ponywagen, das Entzücken des kleinen
Ronald – und pries den Grafen Randulf in allen Tonarten.
Am Sonntag erschienen dann die Thorbrandts zum Nach-
mittagskaffee, und an der Art, wie sie Florence begrüßten,
konnte man erkennen, wie gut sie ihnen gefiel. Und wie
man dem Gespräch entnehmen konnte, war sie mit dem
Söhnchen in Güldenrode gewesen, damit es sich für das
Geschenk persönlich bedanken konnte. Sie war so harmlos

wie ein Baby, als sie die Frage der Gräfin, ob sie und ihr
Söhnchen gestern gut nach Hause gekommen wären, be-
antwortete:
»Sehr gut, Frau Gräfin. Das Pferdchen sein fromm, und ich
sein eine gute Chauffeur.«
Diese Bezeichnung gab nun wieder was zu lachen. Cornelia
hatte recht. Man konnte dem kapriziösen Persönchen nicht
böse sein.
Florence sorgte dafür, daß es ein frohes Zusammensein
wurde.
Als man nach Kaffee gemütlich beisammen saß, holte sie
die kleine Grace herbei, um sie voll Stolz den Gästen zu
zeigen. Entzückt betrachtete man das süße Geschöpfchen,
das, sich auf dem Arm der Mutter sicher fühlend, die Frem-
den zutraulich anlachte. Und als man in einem der Neben-
zimmer den kleinen Ronald wie am Spieß schreien hörte,
setzte Florence dem Grafen Randulf, neben dem sie saß,
kurzentschlossen das Töchterchen auf den Schoß und eilte
davon.
Da saß nun der Mann, dem so etwas in seinem Leben noch
nicht passiert war, mit einem so verblüfften Gesicht da, daß
man Mühe hatte, nicht loszulachen. Es wäre Cornelia oder
auch Sidonie ein leichtes gewesen, ihn von dieser uner-
wünschten Last zu befreien, doch sie taten es nicht, weil
das komische Bild sie zu sehr ergötzte. Als hätte auch das
Baby seinen Spaß daran, krabbelte es hoch, stellte sich auf
drallen Beinchen, bekam den Mann mit einem Händchen
beim Schlips und patschte ihm mit dem andern ins Ge-
sicht. Und der, dem das geschah, schickte so verzweifelte
Blicke umher, daß es mit der Beherrschung der anderen zu
Ende war. Eine Lachsalve brandete auf, die selbst den ei-
gensinnigen Ronald, dem die Mutter gütlich zusprach, die
Ohren spitzen ließ. Neugierig lief er der Stätte der Belusti-
gung zu, und die nicht minder neugierige Mama hintend-
rein.
»Oh, Herr Graf, Sie haben die Baby!« klatschte sie jubelnd
in die Hände. »Sehen aus wie Ulk mit so was.«

»Na, mir ist gar nicht so ulkig zumute«, mußte er wohl
oder übel mit den andern lachen. »Ich bitte Sie, Frau Baro-
nin, mich endlich von der aufdringlichen jungen Dame zu
befreien, die mir im wahrsten Sinne des Wortes an Kopf
und Kragen geht.«
»O Randulf, hätte ich dich doch vorhin knipsen können!«
rief die Schwester ihm neckend zu, der, nachdem er das
Baby losgeworden war, sich anschickte, dessen Handgreif-
lichkeiten zu beseitigen. Der mißhandelte Schlips wurde
gerade gezogen, das zerwühlte Haar geglättet.
»Schade, Herr Graf, Sie sahen vorhin viel netter aus«, stellte
Roger fest. »Florence, gib ihm noch einmal das Baby.«
»Erbarmen, Frau Baronin!« flehte Randulf sie an. »Jedes
andere weibliche Wesen, nur nicht das rabiate kleine Fräu-
lein.«
Lachend gab die Mutter ihr Töchterlein an die Kinder-
schwester, die an der Tür wartend stand, und nun mit ih-
rem Schützling abzog.
»Aber brüll nicht wieder!« drohte sie auf gut Deutsch, was
der kleine »Caballero« auch ohne weiteres verstand.
»Warum schrie er denn vorhin so mörderisch, Florence?«
wollte der Schwiegervater wissen.
»Weil er ein ganz eigensinnig Jung sein. Er wollte fahren
mit Purrpurr.«
»Ach, sieh mal an, den Spezialausdruck kennst du auch
schon?« neckte Roger. »Woher hast du den denn?«
»Von dich!« erfolgte prompt die Antwort. »Du sagst Purr-
purr sein Pferd.«
»Was bist du bloß für eine gelehrige Schülerin, geliebte
Schwägerin.«
»Du sein bloß still! Hast getreibt mit mich viel Ulk in deine
Sprach.«
Randulf schien heute für Kinder ein Magnet zu sein, denn
auch Ronald schmiegte sich an sein Knie.
»Junge, was hast du vor?« fragte er abwehrend, worauf das
Kind ihn ganz erstaunt ansah.
»Nichts, du gefällst mir.«

»Schon verdächtig, mein Lieber. Deinem Schwesterlein
gefiel ich nämlich auch.«
»Komm zu mir, Ronald«, lockte Heidgar lachend. »Ich habe
keine Angst vor dir wie der Onkel da.«
»Du großes Mann hast Angst vor kleines Jung?« tat das Bür-
schlein verächtlich, das die Sprachen seiner Eltern gleich-
zeitig erlernt hatte und sie daher ohne Mühe sprach, wenn
auch noch mit einigen Schnitzern, die bei seinen drei Jah-
ren verständlich waren. »Dann sein du nicht mein Freund.«
Damit wandte er sich Heidgar zu, die ihn auf den Schoß
nehmen wollte.
»O nein«, wehrte er großartig. »Ein Mann setzt sich nicht
auf Damens Schoß, der nimmt sie auf den Schoß, sagt
mein Papa.«
»Na, Frank, du bringst ja deinem Sohn was Gutes bei«,
lachte der Senior der Familie gleich den andern herzlich.
»Junge, du blamierst mich ja. Wann habe ich das zu dir
gesagt?«
»Als ich mich setzen wollte auf Schloß von Grace.«
»Na also!« schmunzelte Frank. »Bin ich nun rehabilitiert
oder nicht?«
Man erkannte es an und amüsierte sich über das ernsthafte
Kerlchen immer weiter. Plötzlich tippte das Fingerchen auf
Heidgars Hals.
»Was ist das?«
»Ein Medaillon, Ronald.«
»Kann ich nicht sprechen aus. Warum hängt da dran so'n
Ulk? Das von Mami ist schöner. Hast schenkt kriegt?«
»Ja.«
»Wer tat das?«
»Jetzt halt ein, du kleiner Fragekasten«, erlöste Cornelia das
Mädchen von dem kleinen Quälgeist. »Komm zu mir und
verhalte dich ruhig, sonst mußt du aus dem Zimmer.«
»Das muß er sowieso«, entschied der Vater. »Kleine Jungen
haben unter Erwachsenen nichts zu suchen. Troll ab, mein
Sohn, zu Schwester Hanni.«
Wohl verzog sich das Gesichtchen, aber der Kleine erhob

keinen Widerspruch. So was durfte man bei Mama, aber
bei Papa niemals, das wußte das aufgeweckte Bürschlein
ganz genau.
Also trollte er ab, der kleine Mann, lenkte seine Schritte
jedoch nicht zu seiner Betreuerin, sondern zu dem Pony,
das sein ganzes Herzchen besaß. Er hatte Glück und konnte
sich ungehindert dem Gegenstand seiner Sehnsucht nä-
hern.
Das an und für sich gutmütige Tier, dazu noch an Kinder
gewohnt, tat dem kleinen Jungen gewiß nichts zuleide, als
er es umhalste und liebkoste. Es hielt auch geduldig still,
als sein Herrchen bemüht war, auf den Pferderücken zu
gelangen. Aber das Fell war glatt, die Beinchen des Dreijäh-
rigen kurz und keiner da, der ihm bei seinem Bestreben
hätte behilflich sein können.
Ein weniger hartnäckiges Kind wäre des nutzlosen Bemü-
hens langsam müde geworden, doch Ronald ließ nicht so
leicht locker. Er setzte es sich in sein eigensinniges Köpf-
chen, auf dem geliebten Pony zu reiten, und damit holla!
Immer wieder versuchte er es, und was dann geschah, war
unausbleiblich. Der Kleine rutschte ab, verlor das Gleich-
gewicht, die Hände griffen ins Leere, der Kopf schlug hart
auf die Krippe und landete schließlich mit der Nase auf der
Erde. Zuerst lag der Junge, vom Schreck betäubt, da. Dann
rappelte er sich hoch, sah Blut und rannte dem Herrenhau-
se zu.
Das geschah alles ganz lautlos. Der kleine Nichtsnutz brüll-
te erst los, als er im Zimmer stand, den Menschen damit
einen gehörigen Schreck einjagend.
»Ronny!« schrie Florence angstgefoltert auf. Sie sah Blut,
und das genügte, um sie laut jammern zu lassen. Die an-
dern standen ängstlich dabei.
Nur Randulf nicht, dessen geübtes Auge sofort die Sachlage
erfaßte. Er trat zu dem brüllenden Jungen, trug ihn zum
Diwan, legte den Körper flach, den Kopf tief und sah ge-
spannt auf das geschundene Naschen, das langsam zu blu-
ten aufhörte.

»Ruhig liegen!« gebot er kurz, als Ronald sich mit Händen
und Füßen wehrte. »Sonst gibt es einen Klaps, verstehst
du?«
Eingeschüchtert durch diese schroffe Behandlung, gehorch-
te das verwöhnte Kind sofort. Auf Randulfs Frage, ob blut-
stillende Watte im Hause wäre, eilte Sidonie davon und
kam sehr rasch mit dem Gewünschten zurück. Die Hand
zitterte, mit der sie ihm die Watte reichte. Ihren angstvoll
fragenden Blick gab er mit einem Lächeln zurück, da atme-
te sie auf. Nun wußte sie genau, daß dem Jungen nichts
Ernstliches passiert war.
Dieser wagte nicht zu mucken, als der »böse Mann« ihm
Wattepfropfen in die Nase steckte. Nun noch das Köpf-
chen, auf dessen Stirn eine respektable Beule prangte, auf
das Kissen gelegt.
Florence, die ja die größte Angst um ihren Sohn ausstand,
hatte dem allen mit starren Augen zugesehen. Jetzt fiel
Randulfs Blick auf sie. Ohne viel zu fragen, hob er die
leichte Gestalt hoch und legte sie zu dem Jungen.
»Auf alle Fälle, Frau Baronin«, meinte er gelassen. »Damit
Sie nicht umsinken. Blaß genug sehen Sie aus. Wie kann
man nur so die Nerven verlieren! Wissen Sie, was dem
Söhnchen fehlt? Das Höschen stramm zu ziehen, nichts
weiter.«
»Großer Barbar!« entrüstete sie sich, und er lachte.
»Na also, da sind wir ja schon wieder munter. Nun lassen
Sie sich mal von dem Herrn Sohn erzählen, wie es zu dem
harmlosen Unfall kam. Gewiß nicht bei der Pflegerin, wo-
hin ihn sein Vater schickte.«
Unter den zärtlichen Worten der Mutter gestand der kleine
Nichtsnutz, was er getan hatte, und da jammerte Florence
erst recht: Was da hätte alles passieren können – wie nun –
wenn – was – und dann bis es dem Schwiegervater zuviel
wurde.
»Jetzt hör endlich auf!« gebot er nervös. »Laß alle >Wenn<
und >Aber<, sei froh, daß du deinen unnützen Jungen so
vor dir siehst. Der Herr Graf hat recht. Man müßte ihm das

Höschen stramm ziehen für seinen Ungehorsam.«
»Paps, du sein eine verbrecherische Mensch, genauso wie
der Graf!« fuhr sie empört auf und wurde es noch mehr, als
befreiendes Gelächter aufstieg.
»Jetzt wissen wir wenigstens, was wir sind, Herr Graf«,
schmunzelte der Hausherr. »Und damit unsere Damen
nach dem Schreck wieder Blut in die Wänglein kriegen,
werden wir einer Flasche Wein den Hals brechen.«
»Ich will eine Doktor her für meine Sohn!« begehrte Flo-
rence auf, und er zuckte die Achsel.
»Schön, sollst du haben. Aber um unsern guten Tropfen
bringst du uns dennoch nicht.«
Während Frank sich beeilte, fernmündlich einen Arzt her-
beizurufen, sorgte sein Vater dafür, daß der Wein bald in
den Gläsern funkelte. Er hätte es gewiß nicht getan, wenn
Randulf sich anders verhalten hätte. Aber da dieser sich
nicht weiter um den Knaben kümmerte, gab es keine Be-
denken. Sein Vertrauen zu dem Mann war groß, ebenso das
der andern. Nur die Eltern des Kindes, die Randulf erst we-
nig kannten, sehnten voll Unruhe den Arzt herbei und
waren ihren Angehörigen gram, daß sie so seelenruhig
Wein tranken. Die jungen Gatten machten große Augen, als
Dr. Butte, vom Diener geführt, eintrat und schmunzelnd
sagte:
»Ach, unser Randulf ist hier! Dann hat es mit dem Patien-
ten keine Not. Was fehlt ihm denn, Herr Graf?«
»Er hat sich eine Beule geschlagen, die Nase zerschunden
und den verdienten Schreck gekriegt«, war die lachende
Antwort. »Weiter ist ihm zum Glück nichts passiert.«
»Nun, für einen echten Jungen gehört sich das so«, fiel But-
te in das Lachen ein und trat dann zu dem Patienten. »Laß
mal sehen, kleiner Mann.
Aha, da hat mir der >Viehdoktor< wieder einmal bei einem
Zweibeiner ins Handwerk gepfuscht. Geht in Ordnung. Das
Blut ist gestillt, die Beule verliert sich von selbst.
Und was ist mit Ihnen, Frau Baronin? Sind vor Schreck die
Knie weich geworden, wie? Ruhig liegen bleiben.«

»Ist denn bei dem Kind keine Gehirnerschütterung zu be-
fürchten, Herr Doktor?« fragte Frank immer noch besorgt.
»Ach woher denn! Da würde der Junge anders aussehen.
Du lieber Himmel, wenn alle Bengels, die sich eine Beule
schlagen, gleich Gehirnerschütterung kriegen würden, wäre
es traurig um den männlichen Nachwuchs bestellt.«
»Bravo, Herr Doktor!« rief der Hausherr lachend. »Sie ha-
ben den Sinn erfaßt. Reihen Sie sich ein in die gemütliche
Runde und stoßen Sie mit uns an.«
Schmunzelnd kam der Arzt der Aufforderung nach und ließ
das köstliche Naß genießerisch über die Zunge rinnen.
»Donnerwetter, das ist ein Weinchen! Wohl dem, der's
hat.«
Die Gläser haben guten Klang, und dann stellte der Senior
der Familie gemütlich fest:
»Das wäre also schon das zweite Naschen, das der > Vieh-
doktors wie Sie als Arzt der Menschen ihn nennen, in unse-
rer Familie behandelt hat. Vor einiger Zeit das meiner
Tochter, heute das meines Enkelsohnes. Und auch sonst
hat er sich immer wieder als treuer Helfer bei uns bewie-
sen. Ruhig und gelassen erscheint er, ist bangen Herzen wie
ein Fels in der Brandung. Leeren wir dieses Glas auf den
Mann, den nichts erschüttern kann.«
Man tat's, und Randulf stieg das Rot der Verlegenheit ins
Gesicht.
»Wie kann man Kleinigkeiten nur so aufbauschen!« Er zog
unbehaglich die Schultern hoch. »Was tat ich denn schon
viel? Nur, was Menschenpflicht gebietet.«
»Bescheiden ist er auch noch, das sieht ihm ähnlich!«
schmunzelte der Arzt. »Nun ja, das soll wohl eines echten
Mannes würdig sein.
Und nun muß ich wandern, weil Patienten auf mich war-
ten, bei denen ich einen klaren Kopf behalten muß. Also
leere ich dieses unweigerlich letzte Glas mit den Dichter-
worten: Ergeht's euch wohl, so denkt an mich und danket
Gott so warm, als ich für diesen Trunk euch danke.«
Er verabschiedete sich vergnügt, und gleich hinterher bra-

chen auch die Gäste auf. Man trennte sich im besten Ein-
vernehmen, ohne sich innerlich auch nur um ein kleines
nähergekommen zu sein – glaubte man. Und wieder lä-
chelte Frau Norne nachsichtig.
Der Mai war gekommen, und es blühte an allen Ecken und
Enden. Mit verhängten Zügeln ritt Heidgar durch den
Wald, der ihr wie neu erschien in seiner Frühlingsherrlich-
keit. Sie war in so selbstvergessenem Schauen versunken,
daß sie den Reiter erst gewahr wurde, als er dicht vor ihr
hielt.
»Toitoitoi, wie haben Sie mich erschreckt, Herr Baron!«
fuhr sie zusammen, und er lachte.
»So schreckhaft, Komteß?«
»Im allgemeinen nicht, aber der Wald ist voller Wunder.«
Sie hielt inne unter seinem seltsamen Blick.
»Ja, der Wald ist voller Wunder«, wiederholte er leise und
setzte hinzu: »Aber etwas anderes auch.«
»Sie wollen doch nicht etwa anfangen zu philosophieren?«
unterbrach sie ihn rasch. »Das sieht Ihnen gar nicht ähn-
lich.«
»Da haben Sie recht, Komteß, ich bin alles andere, nur kein
Philosoph. Darf ich fragen, wohin der Weg Sie führt?«
»Nach Marstein.«
»Dann herzlich willkommen.«
»Herr Baron, Sie scheinen zu den Menschen zu gehören,
die einen anderen nicht aussprechen lassen. Nicht in das
Herrenhaus will ich, sondern in die Rentmeisterei, um den
Pachtzins zu bezahlen.«
»Wofür denn?« fragte er verwundert.
»Für den Streifen Acker, der sich zwischen Ihrem und unse-
rem Gelände hineinfrißt.«
»Hineinfrißt – das ist die rechte Bezeichnung dafür«, gab er
mit kurzem Lachen zurück. »Wie hoch ist denn der Zins?«
»Vier Mark pro Jahr.«
»Überwältigende Summe, auf die sich unsere Großväter
geeinigt haben. Meinen Sie das nicht auch, Komteß?«
»Es steht mir nicht zu, das Tun meines Großvaters zu korri-
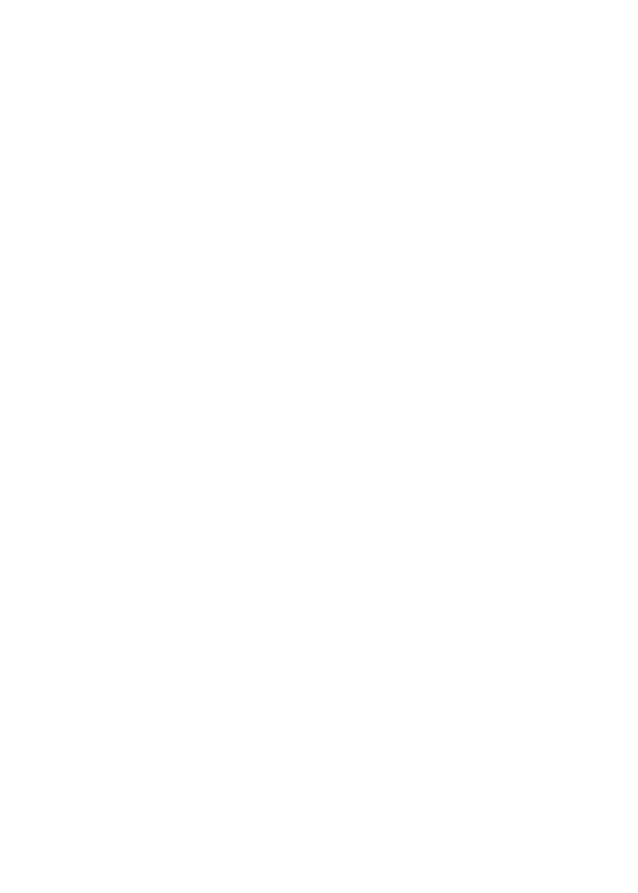
gieren.« Das feine Naschen hob sich hochmütig. »Auf Wie-
dersehen, Herr Baron.«
»Nun, wenigstens das >Wiedersehen< klingt verheißungs-
voll, Komteß. Sie hätten ja auch >Adieu< sagen können.«
»Das ist veraltet.«
»Eben, wie manches andere auch.«
Unschlüssig, was sie tun sollte, hielt Heidgar den Schimmel
Schloh, der unruhig tänzelte, und auch der braunglänzende
Trakehner wurde mißmutig. Den Baron um seine Beglei-
tung bitten, nein, das bekam die Komteß nicht über sich.
Außerdem war der Mann heute so anders als sonst, so kurz
angebunden, fast herrisch. Wenn sie ihn doch loswerden
könnte!
»Bitte, Herr Baron, darf ich Ihnen das Geld geben?« fragte
sie zaghaft. »Dann bleibt mir der Weg nach Marstein ers-
part.«
»Erspart – sehr richtig, Komteß. Aber darf ich fragen, war-
um diese überwältigende Summe nicht einfach an die
Rentmeisterei von Marstein überwiesen wird?«
»Weil – ja, weil – es gegen – die Vereinbarung – unserer –
Großväter wäre«, stotterte sie und senkte dann das heißer-
glühte Gesicht unter seinem merkwürdigen Blick.
»Wunderbar, diese Vereinbarung vor mehr als einem hal-
ben Jahrhundert. Na schön, respektieren wir sie, denn
nichts geht über den Respekt gegen längst verstorbene
Großväter. Aber, daß ich Sie jetzt nach Marstein begleite,
dagegen dürften selbst diese gestrengen Herren nichts ha-
ben, nicht wahr, Komteß Thorbrandt?«
Unsicher sah sie auf, mitten in seine Augen hinein. Es war
wohl kein Zufall, daß gerade in diesem Moment die beiden
Menschen sich des Liedes erinnerten, das man auf der letz-
ten Schlittenfahrt des Winters gesungen hatte. Hauptsäch-
lich des letzten Satzes: Die Menschen – sie nennen es Lie-
be.
Rauschte es nicht in den hohen Bäumen des Waldes, zwit-
scherten es nicht die Vögel von den Ästen, nickten es nicht
die Blumen, die auf dem moosigen Grund wuchsen? Und

nun sprach es auch der Mann neben dem Mädchen, ganz
leise klang es, kaum hörbar dem Ohr:
»Die Menschen – sie nennen es Liebe.«
Oder hatte Heidgar sich getäuscht, hatte Roger das gar
nicht gesagt?
Sein Gesicht zeigte doch einen harmlosen Ausdruck, die
Augen schauten gleichmütig drein.
»Bitte, Komteß, reiten wir nach Marstein«, schlug nun seine
gelassene Stimme an ihr Ohr. »Oder wollen Sie das nicht,
weil Sie mich so abweisend ansehen?«
»Ich wüßte nicht, warum«, entgegnete sie hochmütig, zog
die Kandare leicht an. Er tat desgleichen. Munter trabten
die Rosse und das Gespräch wurde friedlicher. Aber nur
deshalb, weil der Mann zu dem leichten Plauderton zu-
rückfand und das Mädchen sich nicht mit Abweisung zu
wappnen brauchte.
»Reiten Sie öfters allein durch den Wald?« erkundigte er
sich jetzt, und sie schüttelte den Kopf.
»Nein, nicht oft, und dann nur kurze Strecken, seitdem…«
Sie erzählte ihr kleines Erlebnis vor zwei Jahren, und da
lachte Roger so herzlich, daß sie ihn erstaunt ansah.
»Was erheitert Sie denn so, Herr Baron? Etwa, weil ich feige
Reißaus nahm? Ich konnte ja nicht wissen, welch ein
Mensch sich im Gebüsch versteckt hielt.«
»Und der war doch so harmlos, genau wie ich.«
»Wieso, kennen Sie ihn denn?«
»Wie mich selbst.«
»Und wer war es?«
»Ich. Sehen Sie mich nicht so mißbilligend an, Komteß, ich
war es wirklich. Bevor mein Vater sich nämlich entschloß,
Marstein zu kaufen, hielten wir uns zuerst einmal inkogni-
to in der Stadt auf, um ganz heimlich die Gegend auszu-
kundschaften. Wir befanden uns sozusagen auf Schleich-
wegen. Daher wollten meine Schwester und ich uns nicht
von der Amazone erspähen lassen, schlugen uns seitwärts
in die Büsche.«
»Und da Ihnen wie gewöhnlich der Schalk im Nacken saß,

trieben Sie Ihren Scherz mit mir«, fiel Heidgar ihm lachend
ins Wort. »Das sieht Ihnen ähnlich!«
»Nicht wahr?« strahlte er sie an, als hätte sie etwas ganz
Liebes gesagt. Und da er sich auch weiter harmlos gab, ver-
gnügt mit ihr plauderte, so wurde dieser Ritt für sie zur
Freude. Ein heller Schein lag über dem feinen Gesichtchen.
Die Augen leuchteten darin wie zwei Sonnen. Die Sonnen-
strahlen, die über die Stämme der Waldriesen huschten,
verfingen sich auch in ihrem Haar und ließen Goldfunken
darüber sprühen. Die grazile Gestalt saß mit einer Lässig-
keit im Sattel, wie sie nur durch langjähriges Training er-
reicht werden kann.
Der Mann konnte den Blick nicht von diesem holden Mäd-
chenwunder wenden und hatte keine Ahnung, daß er selbst
mit der rassigen Reitergestalt und dem kühnen Antlitz ei-
nen herzerfreuenden Anblick bot. Auch er saß im Sattel, als
sei er mit ihm verwachsen. Zwei junge Menschenkinder,
die von der Natur sehr bevorzugt waren.
»Schade«, sagte der Mann. Was es jedoch bedeutete, verriet
er nicht, nämlich, daß Marstein vor ihnen lag und somit
der Ritt beendet war und die friedliche Zweisamkeit, die
ihm wie eine Feierstunde erschien.
Und tatsächlich wich der frohe Schein aus den Augen des
Mädchens, als sie Marstein erspähten. Es war jetzt wieder
ganz die Komteß Thorbrandt und er nichts weiter als der
Baron Hellnor. Ein Gefühl des Zorns stieg in dem Mann
auf, das er nur mit Mühe unterdrücken konnte.
Gleich darauf ritten sie in Marstein ein und saßen vor der
Rentmeisterei ab. Nachdem Roger die Pferde einem Stall-
burschen übergeben hatte, betraten die beiden Menschen
einen großen Raum, in dem sich augenblicklich keiner der
Gutsbeamten aufhielt.
»Bitte sehr, Komteß, der Hellnor ist bereit, den Pachtzins
der Thorbrandt entgegenzunehmen.«
Heidgar, der diese Ironie wie ein Schlag ins Gesicht war,
preßte die Lippen zusammen, damit ihnen kein rasches
Wort entschlüpfen konnte. Schweigend holte sie aus der
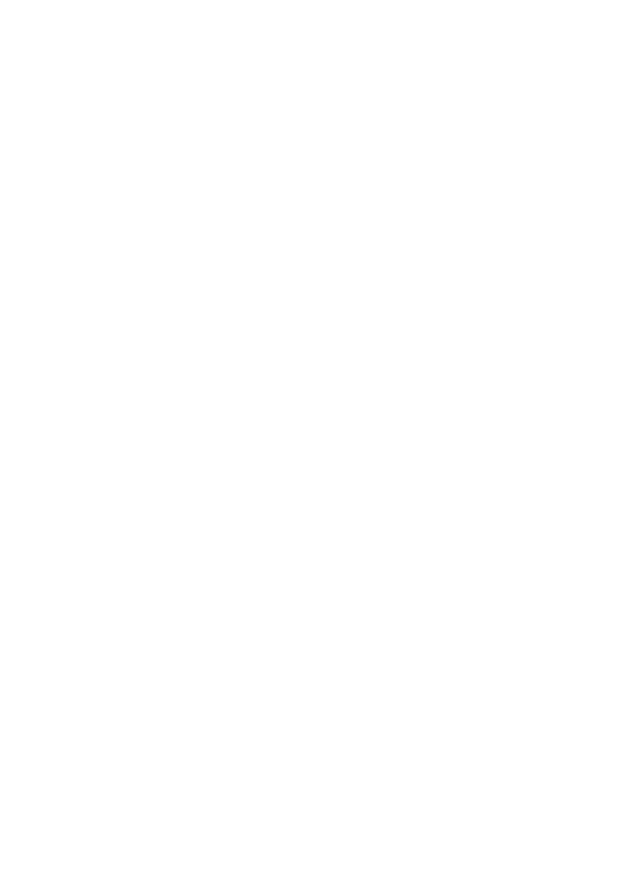
Tasche der Reithose ihr Täschchen hervor, entnahm ihm
das Geld und legte es auf den Schreibtisch, an dem Roger
die Quittung ausschrieb. Achtlos steckte Heidgar sie in die
Tasche, dabei des Mannes Blick ausweichend, der mit ei-
nem rätselhaften Ausdruck auf ihr ruhte.
»Danke, Herr Baron, somit wären wir quitt.«
»Natürlich, Komteß, ich habe es auch nicht anders erwar-
tet.«
Kurz und knapp fiel jedes Wort. Wie Feinde standen sich
die beiden Menschen gegenüber, die noch vor einer Viertel-
stunde vergnügt plaudernd durch den Wald geritten waren.
Es war wieder da, hob drohend das Haupt, dieses »Thor-
brandt contra Hellnor.«
Doch, daß es gleich wieder gemildert wurde, dafür sorgte
Florence. Denn als Heidgar aus der Tür der Rentmeisterei
trat, ging die junge Frau gerade vorüber.
»Ach, Sie sein hier, Komteß!« rief sie entzückt. »Das sein
aber mal hübsch.«
Zutraulich schob sie ihren Arm unter den des Mädchens
und zog es mit sich fort, dem Herrenhause zu. Ob es wollte
oder nicht, war Florence höchst egal. Sie ließ die andere
auch nicht zu Wort kommen, lachte und sprudelte wie ein
Wasserfall.
Roger sah ihnen amüsiert nach und kehrte dann in die
Rentmeisterei zurück, wo er unter den wohlgeordneten
Akten bald das fand, was er suchte. Er schlug die Akte auf
und konnte darin lesen, daß Graf Thorbrandt-Güldenrode
dem Baron Hellnor-Marstein für ein Stück Pachtland einen
jährlichen Pachtzins von vier Mark zu entrichten hätte.
Und zwar wäre dieses Geld vom Grafen persönlich oder
einem Familienmitglied zur Rentmeisterei Marstein zu
bringen. Was der Baron damit bezweckte, war aus der Akte
nicht ersichtlich. Wahrscheinlich wollte er seinen Widersa-
cher oder einen der Angehörigen dazu zwingen, wenigstens
einmal im Jahr feindliches Gelände zu betreten, was sie
auch brav taten, bis auf den heutigen Tag und immer wei-
ter tun würden, denn der Pachtvertrag lief neunundneunzig

Jahre.
Auch bei den vier Mark war es geblieben, die jetzt, nach
mehr als einem Jahrhundert, natürlich nicht mehr dem
Geldwert von damals entsprachen. Aber Vertrag ist Vertrag,
daran gibt es nichts zu drehen und zu deuteln.
Da nun Rentmeister eintrat, steckte Roger die Akte weg und
übergab die vier Mark.
»Hier ist das Geld für den Güldenroder Pachtzins, die Quit-
tung habe ich ausgestellt.«
»Danke, Herr Baron, wer brachte das Geld?«
»Komteß Thorbrandt.«
»Geht in Ordnung, werde es gleich vermerken.«
Was nun geschah, wunderte Roger nicht wenig. Denn der
Beamte holte die bewußte Akte und vermerkte darin, daß
Komteß Thorbrandt heute den Pachtzins von vier Mark
brachte. Datum darunter – erledigt.
Da diese sonderbare Buchung dem Rentmeister selbstver-
ständlich schien, sagte Roger nichts dazu und ging mit
freundlichem Gruß hinaus. Man könnte über den Unfug
lachen, den zwei haßerfüllte Männer vor Jahrzehnten an-
stellten, wenn er nicht zwei Generationen danach in Mit-
leidenschaft gezogen hätte. Überall stieß man auf dieses
verwünschte »Thorbrandt contra Hellnor«, und darüber
konnte man nun wirklich nicht lachen. Wenigstens Roger
nicht.
Auch Baronesse Sidonie und Graf Randulf trafen fast zu
derselben Stunde zusammen wie das andere Paar, in dem-
selben Wald, und auch beide hoch zu Roß. Nur daß Sido-
nie keinen Pachtzins in Güldenrode abzuliefern hatte, son-
dern zu ihrem Vergnügen dahin ritt. Sie erschrak auch nicht
über den Reiter, weil sie ihn bemerkte, bevor er heran war.
»Wohin des Wegs?« fragte der Mann nach der höflichen
Begrüßung.
»Wohin die Nase führt.«
»Die führt nach Güldenrode.«
»Dahin will ich nun gerade nicht.«
»Schade. Aber dafür reite ich nach Marstein. Das überrascht

Sie, Baronesse, nicht wahr?«
»Allerdings.«
»Meine Schwester ist nämlich dorthin geritten, um in der
Rentmeisterei eine geschäftliche Angelegenheit zu regeln.
Und da meine Mutter gerade vor einer Stunde von Überfäl-
len las, wurde sie ängstlich, was man ihr nicht verdenken
kann. Zu ihrer Beruhigung reite ich nun meiner Schwester
entgegen.«
»Dann komme ich mit Ihnen, weil es mich jetzt allein im
Walde gruselt«, lachte sie. »Schade, ich reite so gern allein
durch den grünen Dom, aber die Menschen müssen einem
ja alles verleiden.«
»Da haben Sie recht, Baronesse. Wie sagt doch der Dichter:
Die Welt ist schön, überall, wo der Mensch nicht hin-
kommt mit seiner Qual.«
Eine kurze Strecke ritten sie schweigend dahin. Verstohlen
ging des Mädchens Blick an der Männergestalt hoch, die so
elegant, so sicher im Sattel saß. Die Hand hielt lässig die
Zügel, und doch spürte das Pferd die nervige Faust, die so
hart zupacken und wiederum so schmeichelnd berühren
konnte, wie Sidonie, wenn der Mann als Retter bei ihr in
Erscheinung trat, hatte er erfahren müssen. Das Gesicht war
stolz und kühl, wie aus bräunlichem Marmor gemeißelt.
Die Augen blitzten kalt wie Kiesel.
Sidonie glaubte das alles ganz heimlich in sich aufnehmen
zu können und schrak zusammen, als sein Blick sie traf,
spöttisch und humorvoll zugleich, als wollte er fragen:
Nun, ist die Musterung gut ausgefallen?
Verwirrt senkte sie den Kopf, und heißes Rot stieg ihr bis
zur Stirn hinauf, über der sich das eigenartig schöne Haar
lockte. Sie sah plötzlich so rührend jung aus, die stolze
eigenwillige Baronesse Hellnor.
Ein Lächeln huschte um den Männermund, der ihn weich
erscheinen ließ, ganz weich und zärtlich.
Aber dann preßte der Mund sich zusammen, und was er
hinterher sprach, klang kühl und sachlich:
»Welches ist nun die schönste Zeit für den Wald, Barones-

se? Ist es der Frühling, der Sommer, der Herbst oder der
Winter?«
»Ja, das zu entscheiden, fällt schwer«, antwortete sie, immer
noch verlegen. Je länger sie sprach, um so sicherer wurde
sie.
»Vielleicht ist es der Frühling, weil dann die Natur erwacht,
während der Herbst und der Winter…
Ach, ich weiß es nicht«, wich sie lachend aus. »Ich finde
den Wald immer schön, überhaupt die ganze Natur.«
»Dann gehören Sie nicht zu den jungen Damen, die einer
Waldwiese den Asphalt der Straße, dem Rauschen der
Bäume das Gebimmel der Bahnen und dem Sternenhim-
mel Lichtreklame vorziehen?« fragte er langsam, und sie
sah ihn offen an.
»Alles zu seiner Zeit, Herr Graf. Wenn ich auch das Landle-
ben durchaus vorziehe, so atme ich auch Stadtluft mal ganz
gern. Aber nur auf Stunden, dann zieht es mich wieder
nach Marstein zurück.«
Sie hatten wohl beide die gleichen Gedanken, daß sie sich
noch nie, wenn sie allein waren, so friedlich unterhalten
hatten wie heute. Das kam wohl daher, daß der Mann bei
dem Mädchen diesmal nicht als unwillkommener Retter in
Erscheinung trat, sondern als willkommener Begleiter.
»Wo meine Schwester nur bleibt!« Randulf sah beunruhigt
nach der Armbanduhr. »Wir müßten ihr längst begegnet
sein. Hoffentlich ist ihr nichts passiert.«
»Wer wird denn gleich so schwarze Gedanken haben!« be-
ruhigte Sidonie. »Die Komteß wird bei uns in Marstein
hängenbleiben. Oder meinen Sie, daß sie das für unter
ihrer Würde hält?«
»Ei, Baronesse, nicht wieder spitzzüngig werden!« warnte
er. »Sie waren bis jetzt so friedfertig, also bleiben Sie es
auch bitte weiter.«
Da senkte sie beschämt den Kopf. Doch auch diesmal half
der Mann ihr mit passenden Worten über ihre Verlegenheit
hinweg, und im besten Einvernehmen erreichten sie Mar-
stein, wo man erfuhr, daß die Komteß im Herrenhaus wei-

le.
»Nun, Herr Graf, wer hat recht?« fragte Sidonie lachend.
»Natürlich Sie, Baronesse, wie immer.«
»Na, soll ich Sie jetzt vor Ihrer Ironie warnen, wie Sie mich
vorher vor meiner Spitzzüngigkeit?« blitzte sie ihn an, und
da mußte er lachen.
»Jetzt haben Sie aber ganz bestimmt recht.«
»Also! Wie ist es nun, kommen Sie mit ins Haus?«
»Gern.«
Wie gnädig! Wäre es ihr beinahe entschlüpft, aber es gelang
ihr gerade noch, damit zurückzuhalten. Ein Stallbursche
nahm ihnen die Pferde ab, und einträchtig gingen die bei-
den Menschen dem Herrenhause zu. Dort wurden sie mit
»Hallo« empfangen.
»Wir haben Sie bereits erwartet, Herr Graf«, begrüßte der
Hausherr ihn frohgelaunt. »Denn als Ihr Schwesterlein zu
Hause Bescheid sagte, daß man sich nicht um sie sorgen
solle, wenn sie später zurückkehre, erfuhr sie, daß der gro-
ße Bruder ihr entgegengeritten wäre.«
»Es war gescheit von dir, Heidgar, die Eltern anzurufen«,
lobte Randulf. »Du weißt, daß unser Muttchen sehr besorgt
um ihre Kinder ist.«
»Deshalb tat ich es ja auch«, gab sie fröhlich Antwort. Sie
hielt Grace auf dem Schoß. »Schau mal, Randulf, ist sie
nicht süß?«
»Das schon, aber diese Süßigkeit sehe ich mir lieber aus der
Ferne an«, gab er schmunzelnd zurück, »denn ihre Nähe ist
mir zu aufregend.«
Die Ankommenden nahmen in Korbsesseln Platz, von de-
nen auf der Terrasse, wo man des herrlichen Wetters wegen
saß, genügend vorhanden waren. Ronald, auch zugegen,
machte sich sofort an Randulf heran, und so bot man all-
gemein ein friedliches Familienidyll.
»Ich sollte dich gar nicht mehr leiden«, meinte das Kerl-
chen vorwurfsvoll. »Du warst böse bei meinem Unfall.«
»Unfall – wie übertrieben, mein Junge«, kam es ungerührt
zurück. »Sei froh, daß du keinen hattest.«

»Er sein aber darauf sehr glücklich«, lachte Florence. »Er
kommen sich vor wie ein Held. Sein ja auch sein erstes
Unfall.«
»Also doch Unfall. Na, schön, bleiben wir dabei«, gab er
friedfertig nach und schaute dann verblüfft auf Grace, die,
von Heidgar gehalten, plötzlich vor ihm stand und ver-
gnügt auf sein Knie patschte.
»Olala, du kleine Dame, man nicht zu intim. Es will mir
fast scheinen, als ob ich für die holde Weiblichkeit Anzie-
hungskraft besäße.«
»Will ich meinen!« schmunzelte der Hausherr. »Seien Sie
doch nicht so hartherzig, und nehmen Sie Ihre Anbeterin
hoch.«
»Lieber nicht«, wehrte er lachend, »Heute habe ich nämlich
keinen Schlips, an dem sie mich nehmen, und keinen Kra-
gen, an den sie mir gehen kann.«
»Komm, Gracelein, der Onkel taugt nichts.« Heidgar nahm
die Kleine auf den Arm, die es ausgerechnet auf die Ge-
schwister Thorbrandt abgesehen zu haben schien. Denn
auch der Komteß war sie vorhin entgegengestrebt wie jetzt
dem Grafen.
Jetzt erschien auch die Kinderschwester, um ihre Pfleglinge
zu holen. Es war Zeit für sie, abgefüttert und ins Bettchen
gebracht zu werden. Als auch die Geschwister sich verab-
schieden wollten, protestierte man heftig.
»Sie bleiben natürlich zum Abendessen«, entschied Corne-
lia, worauf Randulf zu verstehen gab, daß man im Reitdreß
nicht gut zur Tafel gehen könne.
»Ach was!« tat sie energisch ab. »Das ist nun mal der Anzug
des Landwirts. Zu Ihrer Beruhigung bleiben die anderen
hier, die ihn tragen, auch so.«
Also gab es für die Geschwister keine Ausrede mehr. Es
wurde ein fröhliches Mahl, das man auch auf der Terrasse
einnahm. Hinterher saß man dann noch bei einem Glase
Wein zusammen.
Blutrot versank die Sonne am Horizont, ein Zeichen, daß
der kommende Tag wieder schönes Wetter bringen würde.

Und als dann der Mond wie eine blanke Scheibe am Him-
mel stand, nahmen die Geschwister Abschied.
»Wie ist es, meine Lieben, wollen wir unseren Gästen nicht
bis Güldenrode das Geleit geben?« schlug Cornelia vor,
und begeistert war man einverstanden. Wer nicht im Reit-
dreß war, schlüpfte flugs hinein, indes die Pferde gesattelt
wurden. Da Roger sich an Heidgars Seite schlängelte, blieb
es dem andern jungen Paar nicht erspart, nebeneinander zu
reiten. Auch die beiden Ehepaare blieben zusammen.
Es herrschte eine Stimmung, die sich nicht beschreiben
läßt. Der helle Mond tauchte alles ringsum in ein fast un-
wirkliches Licht, der herbe Ruch der dampfenden Erde stieg
würdig empor, irgendwo schluchzte eine Nachtigall.
Man hatte absichtlich nicht den Weg durch den Wald ge-
wählt, weil seine Düsternis ihnen allen unheimlich war. So
ritt man denn durch die sprossenden Felder, die, vom
Dunst eines mäßigen Nebels umhüllt, wie mit hauchdün-
nen Schleiern bedeckt schienen. Von den nahen Weiden
her kam das gemütliche Brummen des gesättigten Viehs,
von den Koppeln freudiges Wiehern der Jungpferde. Das
Sattelzeug knirschte, die Reitpferde schnaubten, und
unentwegt schluchzte die Nachtigall ihr sehnsüchtiges,
verträumtes Lied.
Die acht Reiter sprachen kein Wort. Selbst der Plapper-
mund der redseligen Florence stand still. Man ließ sich
einspinnen von dieser wundersamen Abendstunde. Die
Herzen öffneten sich weit, und in sie hinein raunte eine
lockende, werbende Stimme: »Die Menschen nennen es
Liebe.«
Als das Güldenroder Schloß erreicht war, verabschiedete
man sich leise, weil man das Gefühl hatte, daß jedes laute
Wort den Zauber dieses unwirklich schönen Maiabends
verscheuchen müßte. Mit leisem Dank verabschiedeten sich
die Geschwister von den Gastgebern, die ebenso leise um
ein baldiges Wiederkommen baten, und auch Florence
wagte nicht, ihrer lebhaften Art nachzugeben.
Während die Hellnors kehrtmachten, betraten die Ge-

schwister das Schloß. Es war gut, daß die Eltern beim mil-
den Schein der Ständerlampen saßen. Ein helles Licht hätte
den Eintretenden jetzt weh getan, auch jedes laute Wort.
Als ob die Eltern wüßten, was in der Seele ihrer Kinder vor-
ging, empfingen sie diese mit liebevoller Zärtlichkeit.
»Da seid ihr ja«, sagte die Mutter gütig. »War's schön?«
»Ja, Muttilein«, entgegnete der Sohn lächelnd. »Hauptsäch-
lich der Nachhauseritt, bei dem uns die gesamte Familie
Hellnor das Geleit gab. So ein Abend im Mai hat's tatsäch-
lich in sich.«
»Ja, es war wunderschön«, sagte nun auch Heidgar ver-
träumt, sich dabei an die Mutter schmiegend. Weich legten
sich die Mutterhände um das flimmernde Köpfchen und
drückten es an das Mutterherz, das, von banger Sorge er-
füllt, in der Brust schlug. Der Vater jedoch schaute prüfend
zu seinem Jungen hin. Das Gesicht war hart und verschlos-
sen, in den Augen brannte ein düsteres Licht.
Nun ist es also da, was wir befürchteten – schienen die
Augen der Eltern, die sich jetzt trafen, zu sagen. Jetzt ist
unsere Macht zu Ende, jetzt können wir in das Geschick
unserer geliebten Kinder nicht mehr helfend eingreifen.
Auch im Hause des nächsten Nachbarn bangten Elternher-
zen. Sie waren so still, ihre beiden Jüngsten. Aus allen Ek-
ken schien es zu raunen, was ein Dichter so wahr und tref-
fend kennzeichnete: »Die Engel, sie nennen es Himmels-
freud, die Teufel, sie nennen es Höllenleid, die Menschen –
sie nennen es Liebe.«
Und diesmal hatte der Teufel recht.
Florence hatte es sich in ihr kapriziöses Köpfchen gesetzt,
ein Frühlingsfest zu veranstalten, so ein Frühlingsfest mit
allem Drum und Dran. Bei Mondenschein im Park, mit
magischer Beleuchtung und kleinem Feuerwerk. Man ver-
suchte ihr klarzumachen, daß die Landwirte jetzt keine Lust
zum Feiern hätten, daß sie müde von des Tages Last lieber
ins Bett gingen.
»Das ist ja gar nicht wahr!« triumphierte sie. »So müde
kann kein Mensch sein, um so etwas Lustiges nicht mitzu-

machen. Mit Freuden kommen sie, kein einziger wird ab-
sagen, soll ich euch das beweisen?«
Und sie bewies es, denn auf keine Einladung kam eine Ab-
sage. Oh, wie war die muntere Florence da in ihrem Ele-
ment! Sie wollte den Gästen schon zeigen, daß sie Feste zu
arrangieren verstand, die einfach märchenhaft waren. Und
zu einem Märchen gehört auch ein Elfenreigen. Wieviel
Personen waren es, die sich dazu eigneten? Sie selbst natür-
lich, dann Sidonie, Heidgar, Edeltraut, Doris, die junge
Frau von Blüthner, die junge Frau Galt und die junge Frau
Karsten. Also acht Stück, das genügte.
»Vergiß bloß Hutzelchen nicht«, erinnerte Roger, und sie
machte ihm eine niedliche Faust.
»Sei still, du!« gab sie in deutscher Sprache zurück, derer
man sich, in nicht schwierigen Fällen, ihr gegenüber ab-
sichtlich bediente.
»Ganz still sein«, wiederholte sie. »Ich mit dir haben was
vor.«
»Erbarmen!« Er hob flehend die Hände. »Ich sehe mich
schon als Bärenführer.«
»Waren auch nicht übel.« Sie lächelte verschmitzt. »Aber
wer will machen die Bar? Keiner, weil in die Wärme sein
alle das Fell zu heiß.«
»Beruhige dich«, schmunzelte der Schwiegervater. »An dem
bewußten Abend wird es wie mit Kannen vom Himmel
gießen.«
»Wird nicht, das Gott vom Wetter sein meine Freund.«
»Und wie wird es mit den Kostümen zu deinem Elfen-
tanz?« wollte Sidonie wissen.
»Die stiften ich. Auch die Tanz übe ich ein. Aber für mich
allein, ohne euch Spotters.«
Allmählich ließ man sich von dem Eifer der kleinen Frau
anstecken und tat dann ebenso eifrig mit. Fröhlich wurden
die Vorbereitungen zu dem Fest getroffen, und als wäre der
Wettergott tatsächlich der Freund der munteren Florence,
so gab es an dem Festabend zu Anfang Juni bei schönstem
Mondenschein das schönste Wetter. Dazu brachten die

Gäste die schönste Laune mit, und Florence strahlte.
Man hatte das Fest auf den Sonnabend gelegt, damit man
am Sonntag gut ausschlafen konnte. Die Damen erschie-
nen in Sommerkleidern, die Herren in hellen Sommeran-
zügen. Nur die »Clique« war eingeladen. Man wollte ganz
unter sich sein, wie damals bei der Schlittenfahrt.
Das Abendessen wurde an kleinen Tischen eingenommen,
die zwanglos gruppiert standen. Auf der Terrasse gab es
lange Tafeln, die mit allem bestellt waren, wonach die
Zunge lechzte und was den Magen freute. Damit man in
die richtige Stimmung kam, ließ man gleich die Pfropfen
knallen.
So blieb die leichtbeschwingte Fröhlichkeit auch nicht lan-
ge aus.
Nachdem man sich an Speise und Trank gelabt, hatte man
Lust zu einem Tänzchen und begab sich zur Tanzfläche, die
in magischer Beleuchtung lag, wie überhaupt der Teil des
Parkes, in dem man sich bewegte. Die Leuchtkörper waren
so geschickt angebracht, daß man nicht wußte, woher sie
ihren farbigen Schein spendeten.
Auch die kleine Musikkapelle war unsichtbar. Man hörte
nur die schmeichelnden Klänge, die in der märchenhaften
Umgebung traumhaft anmuteten.
Solch ein traumhaft schönes Fest hatte es in der »Clique«
noch nie gegeben. Da schossen die Marsteiner gewisserma-
ßen wieder einmal den Vogel ab. Das ließ auch der Präses
in seiner Rede, die er kurz und originell, wie gewöhnlich
hielt, durchblicken. Und als er hörte, daß Florence die ei-
gentliche Gestalterin des Festes war, ließ er sie begeistert
hochleben.
Oh, wie strahlte die kleine Frau da vor Genugtuung. Wie
glänzend war das alles widerlegt, was die Ihren skeptisch
angezweifelt hatten.
Nachdem man eine Weile vergnügt das Tanzbein ge-
schwungen, gab es eine Polonaise mit Kappen, die alle das
Gesicht einer Märchengestalt trugen. Und da diese originel-
len Kopfbedeckungen verlost wurden, konnte es nicht aus-

bleiben, daß sich der Zufall als Kobold erwies.
So zierte das Haupt des Präses ein zartes Elfengesichtlein,
und Hutzelchen zeigte oberhalb ihrer verschrumpelten
Physiognomie das allerliebste Köpfchen des Dornröschens.
Die sanfte Frau des Oberst schaute heute als Isegrim drein,
auf Heidgars Köpfchen drohte ein Drache. Roger prahlte
sich als Gretel, und den Hansel hatte Muttchen Bessolt er-
wischt, während der Gatte sich das Schneewittchen stolz
auf seine Glatze setzte.
Florence wollte sich über den Riesen totlachen, der gar
grimmig über ihrem Puppengesichtchen thronte. Selbst mit
dem korrekten Frank trieb der Zufall sein Possenspiel.
Denn zu dem paßte Eulenspiegel mit seiner Narrenkappe
nun doch wahrlich ebenso wenig wie die Hexe aus dem
Pfefferkuchenhäuschen zu der charmanten Cornelia und
der Höllenhund zu ihrem Eheliebsten, der böse Zauberer
zu Gräfin Herma und der Zwerg zu dem Gemahl.
Bei den anderen zeigte sich der Zufall in nicht ganz so lä-
cherlicher Form, wenn ihre Häupter auch manch komische
Gebilde zierten, wie Rotkäppchen, die Großmutter, der
gestiefelte Kater, der Froschkönig, die Pechmarie, Hans im
Glück, der Swinegel, die goldene Gans, Reineke Fuchs und
manches andere mehr. Nur bei Sidonie und Randulf, da
hätte man annehmen können, daß während der Verlosung
gemogelt worden war. Denn erstere zeigte die wählerische
Prinzessin und letztere den König Drosselbart. Allein, es
war alles mit rechten Dingen zugegangen. Der Zufall hatte
es so gewollt.
Als man sich dann, so herrlich geschmückt, in Augenschein
nahm, wollte das Gelächter kein Ende nehmen. Florence
mußte ordentlich energisch werden, bis die Paare sich, den
Kopfbedeckungen angepaßt, endlich gruppierten. Die ma-
gische Beleuchtung ließ alles noch unwirklicher erscheinen,
so daß man sich tatsächlich in die alten Märchen versetzt
fühlte.
Unter den fröhlichen Klängen der Musikkapelle ging die
Polonaise los, die natürlich nicht frei von Hindernissen

war. Da gab es Stühle zu übersteigen, unter Tischen hin-
durchzukriechen, niedrige Barrikaden zu nehmen und so
fort. Für die jungen Menschen war das ein Kinderspiel, aber
die älteren, hauptsächlich wohlbeleibte Herrschaften, muß-
ten sich schon tüchtig anstrengen. Es gab manch drolligen
Anblick, aber keiner schloß sich aus, alle machten vergnügt
mit.
Nun hätte man annehmen müssen, daß es für das rundli-
che Ehepaar Bessolt unmöglich war, über die Hindernisse
zu kommen. Aber mitnichten, sie kugelten sich glänzend
darüber hinweg. Auch der stattliche Oberst, der hünenhafte
Skalden, sowie der sehr große Glade entledigten sich forsch
ihrer Aufgabe, nur Hutzelchen eckte überall an. Ängstlich
schaute sie drein, das süßlächelnde Gesichtlein des Dorn-
röschen über ihrem Haupt.
»Hutzelchen, kriech! Hutzelchen, spring!« kommandierte
dann der gestrenge Bruder. Und sie kroch und sprang, was
so überwältigend komisch aussah, daß man sich die Seiten
hielt vor Lachen. Aber Hutzelchen nahm nichts übel, Hut-
zelchen lachte vergnügt mit.
Nach der Polonaise kam dann der Tanz, wobei es wieder
etwas zu lachen gab, weil die Kappen die Paare durchei-
nander brachten. So tanzten denn Oberst-Elflein mit dem
dazugehörigen baumlangen Oberst-Glade, das Hutzelchen-
Dornröschen mit ihrem Prinzen, unter dessen schönem
Antlitz das lachende von Frau von Skalden sichtbar wurde.
So gab es noch manches komische Paar. Nur König Dros-
selbart nebst Prinzessin wirkten distinguiert und elegant.
Wie zwei königliche Vögel unter allerlei Getier.
Daher wurden sie auch einstimmig als Zierde des Märchen-
landes anerkannt und mußten es sich gefallen lassen, daß
man ihnen die Preisträgerkrone aufs Haupt drückte. Dann
wurde das königliche Paar feierlich zur Tanzfläche geführt,
wo schon, wie durch Zauberschlag, eine würdige Gestalt
auftauchte, die Majestäten mit märchenhaften Worten trau-
te. Dann bildeten die Untertanen einen Kreis, schunkelten
im Walzertakt dahin, und mittendrin tanzte das souveräne

Paar des Märchenreiches. Zwar kam es sich da recht depla-
ciert vor, aber was tat's! Man durfte hier kein Spielverderber
sein. Mitgefangen, mitgehangen.
Anschließend gab es zuerst einmal eine Pause, in der man
sich ausruhen und an Getränken laben konnte. Dabei wur-
de eines gereicht, das Florence geheimnisvoll als Zauber-
trank bezeichnete. Es sollte alle Anwesenden die Liebe ins
Herz senken, es mit einem anderen zusammenschmieden
für jetzt und immerdar.
»Ja, Hutzelchen, welches Herz wird nun deines umklam-
mern?« Der Bruder war tiefbekümmert. »Hast du am Ende
gar eine heimliche Liebe hier?«
»Den Grafen Randulf«, lächelte sie verschmitzt.
»Aber Hutzelchen, dessen Herz klebt doch schon an dem
seiner Königin. Willst du gar so ruchlos sein und eine kö-
nigliche Ehe auseinanderbringen?«
»Wenn er nur will – ich will es schon gern.«
Jetzt brach ein Sturm lachender Entrüstung los, den zwei
junge Paare unterbrachen. Hand in Hand, mit glückstrah-
lenden Augen standen sie da.
»Bei uns hat der Zaubertrank schon gewirkt«, sprachen sie
im Chor in die plötzlich so andächtige Stille hinein. »Und
da wir getreue Untertanen des Märchenkönigs sind, erbit-
ten wir von seiner Majestät, dem König Drosselbart, den
Segen.«
Gespannt sah man auf den Mann, ob er den Scherz mitma-
chen oder ablehnen würde. Seiner ganzen Art nach tippte
man auf letzteres und war freudig überrascht, als er lä-
chelnd vortrat und die jungen Paare niederknien ließ. Auf
die Kappen deutend, sprach er mit seiner sonoren Stimme,
die nie ganz den herrischen Klang verlor:
»Froschkönig und goldene Gans, Reineke Fuchs und gestie-
felter Kater, ihr paßt nicht zusammen. Daher erhebe ich
meinen Zauberstab und verwandle euch in Menschenkin-
der. Edeltraut von Bessolt und Armin von Skalden, Doris
Glade und Jochen von Bessolt, ich gebe euch meinen kö-
niglichen Segen, auf daß ihr euch liebt, euch treu bleibt,

jetzt und immerdar. Ein Hoch auf die verlobten Paare!«
Jetzt gab es einen jubelnden Tumult, der kaum noch zu
überbieten war. Die Kapelle spielte einen Tusch, kräftige
Männerarme hoben die Gefeierten empor und sangen dazu
aus voller Kehle:
»Hoch soll'n sie leben!«
Nachdem sich endlich der Freudensturm gelegt hatte,
sprach der Präses. Man hatte Mühe, beim Anblick des zar-
ten Elfengesichtleins über dem frischen, grobgeschnittenen
Männerantlitz ernst zu bleiben. Der gestrenge Herr Oberst
mußte erst seine Rührung meistern, bevor er sprechen
konnte:
»Ich sehe, ihr freut euch alle mit mir über die Verlobung
der vier Kinder aus unserer so verächtlich gemachten, bes-
pöttelten und beneideten >Clique<. Mögen die Leute re-
den, was sie wollen! Wenn wir nur wissen, wie treu wir
zusammenstehen. Dafür sind diese beiden Verlobungen
ein schlagender Beweis. Möge uns das Band der Zugehörig-
keit immer fester umschlingen, für jetzt und immerdar.
Und jetzt gebt mir etwas zu trinken.«
*
In dem Park von Marstein herrschte augenblicklich tiefe
Stille, denn die Menschen warteten gespannt der Dinge, die
da kommen sollten. Sie saßen vor dem Rasen, der in ge-
heimnisvolles Licht getaucht war.
Und plötzlich huschte es aus dem Gebüsch. Von allen Ek-
ken schwebten sie herbei, die zarten Elflein in ihren zart-
grünen Gazekleidchen, einen Rosenkranz in den Locken.
Musik setzte ein, süß, zart und überirdisch schön. Mildes
Licht verströmte einen farbigen Schein, in dem die Mär-
chenkinder sich leicht und graziös im Reigen drehten. Die
leichtbeschuhten Füßchen schienen kaum den Boden zu
berühren, die grazilen Körper hoben sich mühelos, als
würden sie von Flügeln getragen.
Und jetzt sangen sie noch dazu, diese traumhaften Wesen.
Wie die Töne von Äolsharfen, so zart und süß, klang es zu
den Menschen hin, die wie verzaubert dasaßen. Sie fühlten

sich wie von einem wundersamen Traum umfangen, aus
dem sie zuerst gar nicht herausfinden konnten, als der Ra-
sen, vom Mond beschienen, ruhig dalag.
Verweht das holde Bild, verstummt der liebliche Gesang
und die weichen Harfenklänge.
Und in diese andächtige Stille hinein die brummende
Stimme des Oberst:
»Warum weinst du denn eigentlich Hutzelchen?«
»Aber Wilhelm, so laß mich doch weinen, so was Wunder-
schönes sah ich noch nie.«
»Bei Wunderschönem lacht man, verstanden!« schnauzte
er, und da wurden auch die anderen munter. Im Park
flammte farbiges Licht auf, die Musikkapelle spielte eine
flotte Weise.
Aus der Traum – oder nicht? Denn da kamen sie ange-
hüpft, die Elflein, zauberhaft anzuschauen in ihren zarten
Kleidchen. Elflein Heidgar schmiegte sich an die Mutter,
die liebevoll die Löcklein, die sich unter dem Kränzchen
hervorstahlen, aus der erhitzten Stirn streichelte.
»Du bist so heiß, mein Herzblatt. Randulf, hole bitte ihren
Mantel!«
»Oh, ich das machen ganz anders«, lachte Elflein Florence
fröhlich. »Warum sein ich Königin von Elfen? Da sein ich
Macht in Zauber viel, die sein voll Märchen.«
Sie hob die zierlichen Füßchen, schwang die Arme über
den Kopf und drehte sich in wirbelndem Kreis. Dann
klatschte sie in die Hände, und blitzschnell kamen aus dem
nahen Gebüsch weiße Jäcklein geflogen, die das grazile
Persönchen hurtig einsammelte und damit zu den Elfen
trat.
»Da, zieht an, das kommt aus Elfen seinem Reich. Sein
Andenken an die heutige Fest.
Oh, ich lassen mich nicht kranken!« drohte sie, als Heidgar
nicht gleich zugriff. »Dann sein ich böse, und das sein
schlimm.«
Da griff die Komteß lachend zu, und die anderen Elflein
folgten ihrem Beispiel. Es waren Bolerojäckchen aus ganz

leichtem weißen Fell, mit glänzender weißer Seide gefüt-
tert. Die weiten Ärmel bauschten sich bis zum Ellenbogen.
»Na, Komteß Elflein, du nicht mehr frieren, was?« fragte
Florence lachend. »Schon sein wie ein Wunder holds. Und
alle Elflein so bleiben bis Ende, sag ich.«
»Basta«, setzte der Schwiegervater schmunzelnd hinzu. »Al-
so, Elflein, ergebt euch freiwillig, sonst setzt euch eure ra-
biate Königin die Pistole auf die Brust.«
»Aber Paps, Elfen und Pistolen, das paßt doch nun wirklich
nicht zusammen!« widersprach Roger lachend. »Für die
zarten Wesen genügt schon ein rosenumwundenes Stöck-
lein.«
»Sagen Sie mal, Frau Baronin, warum haben Sie mich so
ungerecht übergangen!« beklagte sich Papa Bessolt. »Ich
hätte mich als Oberon so wunderbar gemacht, so wohlge-
staltet, wie ich bin. Und dann das Kränzlein auf meiner
bildschönen Glatze…«
»Und dazu Hutzelchen als Titanie!« schwärmte er weiter.
»Nein, Frau Baronin, Sie haben Ihre Elflein nicht gut ge-
wählt.«
»Hör bloß auf, Wilhelm, ich kann nicht mehr!« hielt die
Gattin sich die Seiten vor Lachen. Nun, wenn Lachen ge-
sund sein soll, dann hatten die Menschen im Park heute
Erhebliches für ihre Gesundheit geleistet.
Und es war noch nicht zu Ende. Es fand sich immer noch
etwas, das zur Heiterkeit Anlaß gab.
Die Gastgeber fanden es nun an der Zeit, ihre Gäste mit
Speise und Trank zu laben. Obwohl man meinte, gar nicht
hungrig zu sein, kam der Appetit beim Essen.
Es war eine herrliche Juninacht, so daß man im Park, der
von den hohen Bäumen geschützt lag, kein Lüftchen spür-
te. Wem es trotzdem kühl wurde, zog eine Jacke über. Die
leichtbekleideten Elflein fühlten sich in ihren Pelzjäckchen
sowieso mollig warm, und so gab es nichts, was dieses
zauberhaft schöne Fest beeinträchtigen konnte.
Nach dem Essen kam dann wieder der Tanz. Eben schritt
man im eleganten Tango dahin. Doch während es die an-

deren leichtbeschwingt taten, war vier Menschen das Herz
voll bittersüßen Wehs gefüllt bis zum Rande. Es ging nicht
mehr, sich frei in die Augen zu schauen. Dazu machte die
märchenhafte Umgebung zu träumerisch, die Geige sang
zu süß. Der Text des Tangos schien zu warnen, den man
allgemein mitsang:
»Du hast in deinen Augen
den Himmel und das Glück,
und wer zu tief hineingeschaut,
für den gibt's kein Zurück.«
Nein, man durfte sich nicht tief in die Augen schauen. Aber
einen verstohlenen Blick auf den Partner werfen, das durfte
man sich erlauben. Doch sooft Sidonie das stolze Männer-
antlitz diskret musterte, die glitzernden Augen, den harten
Mund, zog sich jedesmal ihr Herz schmerzend zusammen.
Aber das durfte sie nicht zeigen, sondern mußte ihr Mie-
nenspiel fest in Gewalt haben. Denn noch besaß sie ihren
Stolz.
Das Antlitz, in das Heidgar verstohlen schaute, war nicht
ganz so hart, dafür umzuckte aber den Mund ein bitteres
Lächeln. Die düster umschatteten Augen starrten unver-
wandt auf das Medaillon, das auf dem zarten Hals des
Mädchens gleißte und funkelte. Ob es ein Bild verbarg in
seiner Kapsel?
Natürlich, schien das kalte Gold zu höhnen. Aber bestimmt
nicht deines, das bilde dir nur nicht ein. Vergiß bitte nicht,
daß deine Partnerin eine Thorbrandt ist, Baron Hellnor.
Der Tango war beendet, doch ehe man abtreten konnte,
riefen die Musiker lachend:
»Damenwahl!«
»Was heißt hier wählen!« tat der Oberst forsch. »Ich gefalle
meiner Dame. Oder wollen Sie das etwa abstreiten, Frau
Baronin?«
»Und wie Sie mir gefallen, Herr Oberst!«
»Na, also! Nehmt ihr andern euch ein Beispiel an uns und

tanzt geschlossen weiter.«
Fröhlich kam man dem Befehl nach und sang die schmei-
chelnde Walzerweise mit, die soeben aufklang:
»Ich hab dich lieb, du Süße,
du meine Lust und Qual,
ich habe dich lieb und grüße
dich tausend-, tausendmal.«
Sollte es etwa bei dem Refrain des Liedes bleiben? Nein,
jetzt jauchzten die Geigen:
»Und setzt ihr zwischen mich und sie
auch Berge, Täler, Hügel,
gestrenge Herrn, ihr trennt uns nie
die Lieb, die Lieb hat Flügel.
Ich habe dich lieb, du Süße.«
Zuckte da nicht ein Hoffnungsstrahl in vier liebebangen
Herzen auf? Nein, nur in dreien. Randulf Thorbrandt resig-
nierte:
Lieber Emanuel Geibel, du warst ein Dichter und lebtest in
deiner romantischen Welt. Sonst hättest du wissen müssen,
daß es Scheren gibt, die Flügel stutzen.
Nach diesem Tanz gab es wieder eine Pause, in der die Gä-
ste gebeten wurden, ihre Plätze vor dem Rasen einzuneh-
men. Und wieder wartete man gespannt der Dinge, die da
kommen sollten.
Und plötzlich schien da der Rasen wie in Sonnenglanz
getaucht. Die Kapelle spielte eine feurige Weise. Schließlich
wirbelte das Paar über die samtene Fläche – Florence und
Roger, in der kleidsamen Tracht der Spanier. Hei, wie flo-
gen die Beine, wie lustig klapperten die Kastagnetten! Da
war Schwung drin, Grazie und Schneid. Man sah förmlich
Barcelona vor sich, spürte auf der Zunge den roten Tarra-
gona.
Was war nun schöner? Dieser feurige Tanz oder der äthe-

risch zarte der Elfen? Ach, wozu da vergleichen. Beide war-
en einmalig.
So plötzlich, wie das Tänzerpaar auftauchte, war es auch
wieder verschwunden. Man klatschte Beifall, daß die Hand-
flächen brannten. Florence wirbelte herbei, bedankte sich
strahlend vor Freude für den stürmischen Applaus. Roger
jedoch hatte einen bitteren Geschmack auf der Zunge –
und ein noch bitteres Gefühl im Herzen.
Mit dem Feuerwerk, das auch einen einzigartigen Anblick
bot, ging dann das Fest seinem Ende zu. Wo waren nur die
vielen Stunden geblieben? Kaum zu glauben, daß am Hori-
zont schon das Frührot aufzog. Also höchste Zeit, aufzu-
brechen, so schwer es auch fiel. Aber was am Abend zau-
berhaft schön ist, kann das Tageslicht oft nüchtern beleuch-
ten. Also es nicht erst darauf ankommen lassen, sondern
die zauberhaften Bilder ungetrübt in Erinnerung behalten.
Es dauerte aber dann doch noch eine Weile, bis die Gäste
in ihren Wagen saßen. Es gab ja noch so vieles zu sagen,
sich immer wieder für die vielen unvergeßlich schönen
Stunden zu bedanken. Und als die Autos dann abrollten,
stieg die Sonne sieghaft am Horizont empor.
Zu Hause winkte dann das Bett, auf das man behaglich die
müden Glieder streckte. Kaum getan, schlief man auch
schon ein.
Nur bei vier Paaren kam der Schlummer nicht so bald.
Zwei flimmernde Mädchenköpfe drückten sich in die Kis-
sen, die von Tränen naß wurden, zwei Männer bissen die
Zähne zusammen in verhaltenem Schmerz – und zwei
Ehepaare lagen nebeneinander und konnten vor banger
Sorge um ihre Kinder nicht einschlafen.
»Dieses >Thorbrandt contra Hellnor< ist einfach eine Lap-
palie gegen das andere«, brummte der Baron. »Da gibt es
jetzt weit schwierigere Hindernisse. Roger wagt um Heidgar
nicht zu werben, weil er eine Abweisung fürchtet, und
Randulf wird um Sidonie deshalb nicht freien, weil er nicht
als Mitgiftjäger gelten will.«
»0 ja, so töricht ist der Mann!« seufzte Cornelia. »Er ist von

einem Stolz, der beinahe schon an Hochmut grenzt. Wenn
man da doch ein wenig Vorsehung spielen könnte! Aber
die ganze Angelegenheit ist so unantastbar, so zart, daß
man kaum wagt, sie in Worte zu fassen.
Unsere armen Kinder! Hätte man das gedacht, daß sie noch
einmal in so tiefe Herzensnot geraten könnten? Und wie
tapfer sie diese tragen. Wir haben allen Grund, stolz auf sie
zu sein, Gisbert.«
»Ach was – stolz«, knurrte er verbissen. »Leid können sie
einem tun. Ich wünschte, wir wären nie hergekommen.
Dann hätten unsere Kinder noch ihr unbeschwertes La-
chen.«
Auch in einem anderen Schlafgemach gab es bedrückte
Elternherzen.
»Um Heidgar sorge ich mich nicht so sehr«, sagte die Mut-
ter leise. »Da ist das Hindernis nicht ganz so hoch wie zwi-
schen Randulf und Sidonie. Dieses >Thorbrandt contra
Hellnor< spielt schon längst keine Rolle mehr, das andere
ist weit schlimmer. Roger hat einfach nicht den Mut, um
unsere so stolz-ablehnende Tochter zu freien, und unser
stolzer Junge fürchtet in Sidonie die reiche Erbin.«
»Leider, so ist es«, brummte der Gatte. »Ich wünschte, die
Hellnors wären nie nach Marstein gekommen. Dann wüß-
ten unsere Kinder jetzt nichts von dem, was die Teufel mit
Höllenleid bezeichnen.«
So trugen zwei Paare bitteres Herzeleid, zwei weitere bittere
Sorgen – und wieder einmal lächelte Frau Norne dazu.
Zwei Wochen waren seit dem fröhlichen Gartenfest vergan-
gen, und die Landwirte schickten sich an, das Heu zu mä-
hen und in den Scheunen zu bergen. Es würde wieder eine
gute Ernte werden, wobei auch die Güldenroder diesmal zu
profitieren gedachten. Denn jedes Jahr pflegt ja eine voll-
gepfropfte Scheune nicht abzubrennen.
Vater und Sohn Thorbrandt gehörten in der Umgebung zu
den Landwirten, die am meisten auf Posten waren. Einmal
mußte es doch glücken, eine größere Rücklage machen zu
können. Sie hatten ja schon viel geschafft, hatten die Herr-

schaft Güldenrode, die Graf Albrecht von seinem Vater
schwer verschuldet übernahm, soweit hochgebracht, daß
sie gesichert dastand.
So gönnten sie sich kaum eine freie Stunde, tummelten
sich draußen, und ihr Herrenauge war überall. Randulf
hatte also keine Zeit, seiner Liebe, die wie Feuer in seinem
Herzen brannte, nachzugeben. Am Tage waren seine Ge-
danken bei der Arbeit, und wenn er abends todmüde ins
Bett sank, fielen ihm die Lider auch schon zu.
Um so mehr Muße hatte Heidgar, über ihre Herzensnot
nachzudenken. Zwar verbrachte sie ihre Tage durchaus
nicht müßig, aber es waren alles Arbeiten, bei denen man
andere Gedanken nicht ausschalten konnte. Das Ge-
sichtchen wurde schmal und blaß, die Augen blickten
übernatürlich groß und sehr, sehr traurig.
»Frau Gräfin, was ist mit unserem Herzenskind los?« fragte
Nanni eines Tages besorgt. »Und auch der Herr Graf hat
ganz schmale Wangen bekommen, und der Mund ist so
hart. Sollten sie etwa…«
Fragend sah sie ihre Herrin an, die traurig nickte.
»Ja, Nanni, das ist's. Und wir können den Kindern nicht
helfen. Sie müssen mit sich allein fertig werden.«
»Und wer tut denn unseren Kindern so weh?« fragte die
Gute empört. »Die soll doch gleich der rote Kuckuck ho-
len!«
»Dann braucht er nicht weit zu fliegen«, lächelte Herma
schmerzlich. »Nur bis Marstein.«
Zuerst war Nanni starr vor Staunen, doch dann schlug sie
jammernd die Hände zusammen.
»Großer Gott, Frau Gräfin, das hat unseren Kinderchen
gerade noch gefehlt! Was machen wir da bloß?«
»Nichts, Nanni, wir können alles nur dem Schicksal über-
lassen.«
»Besser schon dem lieben Gott«, meinte die Brave skep-
tisch. »Mit dem Schicksal hab' ich nicht viel im Sinn, das
hat so seine Tücken.«
Jetzt mußte die Gräfin denn doch lachen.

»Aber, Nanni, unser Herrgott ist es doch, der die Geschicke
der Menschen leitet.«
»Eben. Und ich werde ihn bitten, daß er für unsere Kinder-
chen alles zum besten wendet. Und wenn ich bitte, dann
tut er's.«
So von ihrer Person durchdrungen, zog sie ab, und die Her-
rin sah ihr belustigt nach.
Und so wie Nanni die Gräfin gefragt, so fragte Frank seine
Mutter:
»Was ist denn mit Sido und Roger los? Sie sind so unlustig,
so blaß und resigniert, haben ihr goldenes Lachen ver-
lernt.«
»Leider«, seufzte die Mutter. »Laß nur, mein Junge, man
kann ihnen nicht helfen.«
Florence, die gerade das Zimmer betreten wollte, hörte die
Worte der Schwiegermutter und sah auch deren versorgtes
Gesicht. Eine Sensation witternd, verbarg sie sich hinter der
Tür und lauschte weiter.
»Sind sie etwa verliebt, Nel?«
»Verliebt, mein Sohn, ist wohl nicht die richtige Bezeich-
nung für dieses tiefe, alles umfassende Gefühl.«
»Wer ist's?«
»Die Geschwister Thorbrandt.«
»Na, und?« fragte er verständnislos. »Wenn die Liebe so tief
ist, wie du sagst, darf sie sich doch nicht um die Fehde der
Großväter scheren.«
»Ach, das ist schon längst zur Farce geworden«, winkte sie
müde ab. »Hier geht es um weit mehr, nämlich: Um vier
stolze Herzen.«
»Und worin bestehen die Hemmungen?«
»Roger fürchtet, von der unnahbaren Heidgar abgewiesen
zu werden, und ein Mensch wie Randulf freit um keine
Erbin, weil er zu wenig ihrem Reichtum in die Waage zu
werfen hat.«
»Na, eine Herrschaft wie Güldenrode kann man nun wirk-
lich nicht als wenig bezeichnen«, entgegnete er trocken.
»Dazu seine hervorstechende. Persönlichkeit, sein alter,

untadeliger Name. Ich weiß ja nicht, ob das alles Sidos
Mitgift nicht aufwiegt. Liebt er sie?«
»Man könnte es annehmen.«
»Und Sido ihn?«
»Ja, leider.«
»Und Roger die Komteß?«
»Da muß ich wieder sagen: Leider.«
»Aber, Nel, da muß man doch nachhelfen können!« Er
wurde ganz eifrig, doch wieder winkte sie müde ab.
»Vorsehung bei diesen stolzen Menschen spielen, hieße
mehr verderben als nützen.«
Vorsehung spielen – das hakte sich in Florences Köpfchen
fest. Da wollte sie doch gleich mal im Wörterbuch nachse-
hen, was das auf Spanisch bedeutete. Sie sollte es jedoch
einfacher haben, denn in der Halle stieß sie auf Roger, den
sie denn auch gleich um Auskunft bat. Verwundert erteilte
er sie ihr, worauf sie wegwerfend meinte:
»Ach, das ist es! Nun, da müßte sich doch was machen
lassen. Wenn sich alle davor scheuen, ich wag's.«
Lachend eilte sie davon, und der Schwager sah ihr kopf-
schüttelnd nach. Sie war doch manchmal zu närrisch, die
gute Florence.
Hätte er nur gewußt, was in dem kapriziösen Köpfchen vor
sich ging, wäre er nicht so gelassen gewesen. Und in diesem
Köpfchen arbeiteten die Gedanken fieberhaft und kamen
dann zu dem Entschluß: Erst einmal die Lage peilen.
Also setzte Florence sich aufs Pferd und ritt nach Gülden-
rode, wo sie nur die Gräfin nebst Tochter antraf, da die
Herren auf dem Felde waren. Man mochte sie gern, die
muntere Florence, und freute sich daher über ihren Besuch.
Es kam auch gleich eine lebhafte Unterhaltung in Gang, die
durch das Eintreten Nannis unterbrochen wurde. Als diese
die Baronin sah, wollte sie sich mit einer Entschuldigung
zurückziehen.
»Was gibt's, Nanni?« fragte die Herrin.
»Ich wollte nur das Medaillon bringen, das unser Herzchen
heute vermißte.«

»O Nanni, wie schön!« Heidgar griff erfreut danach. »Wo
hast du es gefunden?«
»Im Pullover hing es. Hat sich wahrscheinlich innen fest-
gehakt, als du das Dings übern Kopf zogst.«
»Nannilein, du bist doch die Beste!« Die feine Mädchen-
hand streichelte zärtlich über die pralle Wange der Frau, die
dann das streichelnde Händchen küßte.
»Oh, die sein aber gut!« sagte Florence, als die Dienerin
gegangen war. »Lieben sehr das kleine Herrin, ja?«
»Das kann man wohl sagen«, lächelte die Gräfin. »Eine
treue Seele, die Nanni. Wir möchten sie nicht mehr missen.
Sie war Heidgars Amme.«
»Oh, dann weißen ich viel. Hab auch gehabt son Amme.
Als sie sein tot, hab ich weinen schrecklich.«
Fortan war Florence nicht mehr so recht bei der Sache, weil
ihre Gedanken sich mit dem Medaillon beschäftigten, das
am Hals der Komteß funkelte. In solch einer Kapsel pflegte
ein Bildchen von Menschen zu stecken, die man liebt.
Ihr zweiter Gedanke war Nanni. Wie konnte sie sich der
Frau nähern, ohne daß es auffiel?
Und siehe da, der Zufall war ihr hold. Oder war es mehr als
einer, mischte sich da schon die Vorsehung ein? Jedenfalls
entdeckte Florence, als sie nach Hause reiten wollte, die
gute Nanni, die mit einem Korb feiner Wäsche über den
Rasenplatz kam, der hinter dem Hof lag.
Nun habe ich mir so den Kopf zerbrochen, wie ich dich
heimlich erwischen könnte, du liebes Frauchen, lachte Flo-
rence in sich hinein, und nun kommst du mir sogar entge-
gen.
Sie zügelte das Pferd, saß ab und wartete auf die Näher-
kommende, die mit einem höflichen Gruß an ihr vorüber
wollte.
»Sein fleißig, Nanni?« fragte sie in ihrer gewinnenden Art.
»Man muß schon, Frau Baronin.«
»Ich weiß, daß Sie sein mal die Amme von Komteß, die
Ihnen sein lieb?«
»Sehr lieb, Frau Baronin.«

»Dann sein Sie mein Verbundenes und sagen, was drin sein
füre Bild in Medaillon von Komteß.«
»Das weiß ich nicht, Frau Baronin.« Nanni wurde sehr zu-
geknöpft.
»Ei, Nanni, nicht lugen. Ich nicht Neugier sein, ich helfen
will das Herz von Ihre Liebling.«
Nanni warf einen forschenden Blick in das Gesicht der jun-
gen Frau, aus dem die Augen so treuherzig schauten.
»Nanni, ich es gut meinen.«
Der ergraute Kopf senkte sich, die Lippen preßten sich zu-
sammen.
»Nanni, ich sein so traurig um die armes Komteß. Sein
meine Liebling, ich haben will viel gern als Schwager.«
Jetzt mußte Nanni lachen, wurde jedoch gleich wieder
ernst. Sie sah Florence mit einem Blick an, als wolle sie ihre
Seele ergründen.
»Haben Frau Baronin die Komteß wirklich lieb?«
»So Gott mir helfe.«
Da war Nanni besiegt. Denn mit dem Wort des Höchsten
auf den Lippen sprach man die Wahrheit und meinte es
gut.
»Ich weiß nicht, Frau Baronin, ob ich es sagen darf, was
unser Komteßchen als Geheimnis hütet.«
»Sie es kennen?«
»Ja.«
»Dann sagen schnell.«
»Nun, der Herrgott wird es mir verzeihen«, sagte Nanni
leise. »Es ist ein kleines Bildchen von Herrn Baron Roger,
das in der Kapsel steckt.«
»Oh, das sein gut!« lachte Florence fröhlich. »Da werden
bald lachen Augen von Ihre Liebling.«
Einen zärtlichen Klaps auf die Wange der Frau, dann
schwang Florence sich vergnügt in den Sattel. Sie ritt in
schlankem Trab nach Marstein und suchte dort den Schwa-
ger, den sie endlich in seinem Arbeitszimmer fand.
»Roger!« rief sie aufgeregt in ihrer Muttersprache. »Roger,
ich bringe dir das Glück!«
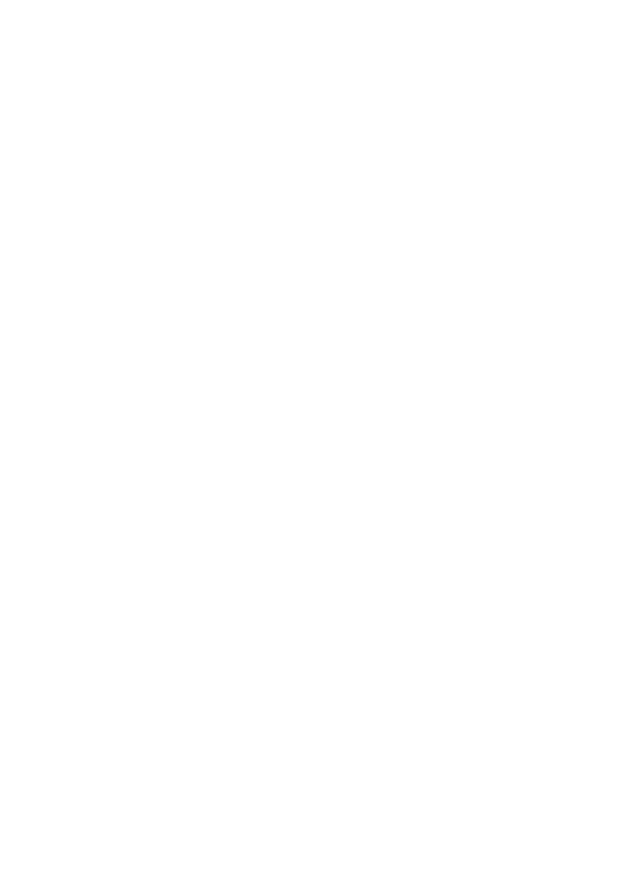
»Das wird schon was Gutes sein!« brummte er, machte
jedoch große Augen, als Florence das heraussprudelte, was
sie ausgekundschaftet hatte.
»Und was sagst du nun?« lachte sie vergnügt. »Sie liebt
dich, mein guter Junge, sonst würde sie dein Bild nicht im
Medaillon tragen. Und jetzt nicht lange gefackelt! Auf nach
Güldenrode, mit dem Grafen gesprochen, und dann die
Braut ans Herz genommen.«
»So einfach, wie du es dir in deinem Tollkopf zurechtlegst,
ist es ja nun nicht«, erwiderte er skeptisch. »Zuerst muß ich
wissen, ob die Komteß mich auch wirklich liebt, bevor ich
bei ihrem Vater um sie anhalte.«
»Meine Güte, was bist du Draufgänger plötzlich zaghaft
geworden!« spottete sie. »Also gut, machen wir es anders.
Ich bitte die Komteß fernmündlich zu mir, weil ich ihr
etwas Wunderschönes zeigen möchte«, lachte sie ihn spitz-
bübisch an. »Denn was Wunderschönes bist du für sie.«
»Florence, ich weiß nicht.«
»Du mußt wissen!« trumpfte sie nun auf. Und in der An-
nahme, daß es ihm noch besser einginge, setzte sie auf
Deutsch hinzu: »Ein ganz feiges Jungsein du.«
Damit griff sie zum Hörer, wählte eine Nummer und
sprach bald darauf mit Heidgar, die sie bat, sofort nach
Marstein zu kommen, weil sie eine Überraschung für sie
hätte. Ohne Zögern sagte die Komteß zu, und Florence
strahlte.
»Ganz arglos ist sie in die Falle gegangen, mein lieber
Schwager. Paß mal auf, du gehst jetzt in den Pavillon. Ich
passe die Komteß ab und schiebe sie dir zu. Und wehe,
wenn du unverlobt herauskommst! Dann kann ich dich als
Mann nicht mehr achten.«
»Du kannst einen ja förmlich einschüchtern.« Er mußte
jetzt lachen. »Willst du nicht lieber deutsch mit mir spre-
chen?«
»Das könnte dir so passen. Nein, mein lieber Junge, das ist
mir jetzt viel zu umständlich. Außerdem will ich momen-
tan ernst genommen sein. Später kannst du dann wieder
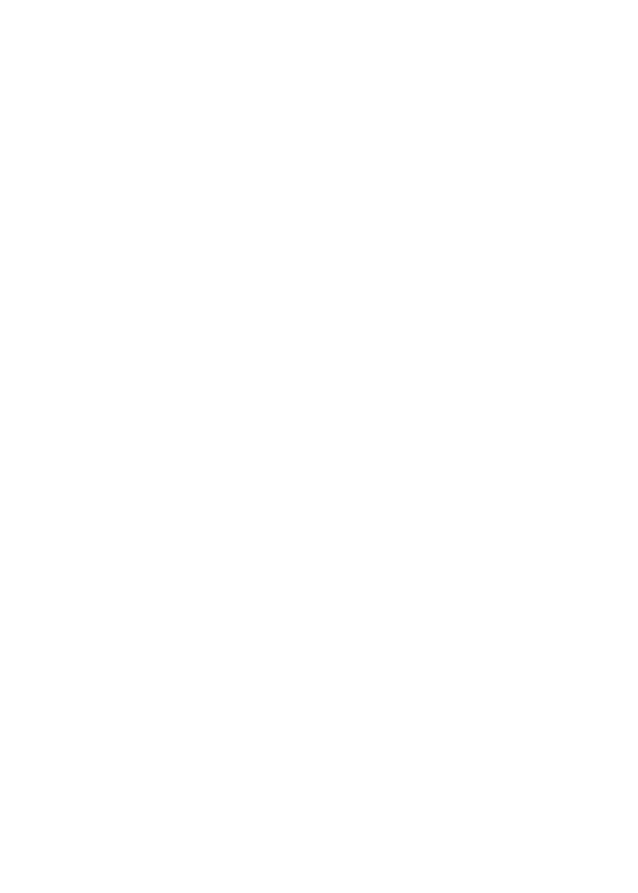
deinen Ulk mit mir treiben.«
Schon eine halbe Stunde später begrüßte sie Heidgar mit
strahlender Liebenswürdigkeit.
»Oh, ich will Ihnen zeigen was Schönes, daß Sie lachen
tun, oh, wie sehr.«
Arglos ließ sich die Komteß zum Pavillon führen, ordent-
lich neugierig, was Florence ihr wohl zeigen würde. Diese
schob sie über die Schwelle – und was Heidgar da erblickte,
ließ ihr das Herz wie ein Hammer in der Brust klopfen. Sie
sah sich nach der jungen Frau um, doch die hatte bereits
die Tür von draußen zugemacht und sogar noch den
Schlüssel umgedreht. Besser ist besser.
»Was hat das zu bedeuten, Herr Baron?« fragte sie empört.
»Erklären Sie es mir bitte!«
Unter dem zürnenden Blick stieg ihm das Blut ins Gesicht.
Es klang unsicher, als er sagte:
»Komteß, ich bitte um Verzeihung – aber ich muß Sie spre-
chen.«
»Dazu hätten Sie mich nicht herzulocken brauchen«, kam
es eisig zurück. »Sie wissen ja, wo ich wohne. Was wün-
schen Sie?«
»Komteß, ich liebe Sie.«
Jetzt war es ein hilfloser Blick, der ihn traf – und der gab
ihm Mut. Er ging auf sie zu, griff nach ihrer Hand, die eis-
kalt in der seinen zitterte, und drückte seine Augen darauf.
»Komteß, machen Sie es mir doch nicht so schwer!« bettel-
te er wie ein Knabe. »Oder können Sie sich nicht dazu ent-
schließen, meine Frau zu werden, weil das >Thorbrandt
contra Hellnor…«
»Ach, das hat doch schon längst keine Gültigkeit mehr!«
unterbrach sie ihn hastig. »Aber…«
»Was für ein >Aber<, Komteß? Sehen Sie, darauf können
Sie mir keine Antwort geben. Mehr als Ihnen mein Herz
anbieten, kann ich doch nicht. Das ist doch das Höchste,
was ein Mensch dem andern in die Hände geben kann.
Oder mögen Sie mein Herz nicht? Bitte, Komteß, sehen Sie
mich doch einmal an!« sagte er schon ganz verzweifelt.

Da hob sie endlich den Blick, und was er darin las, ließ ihn
nicht mehr länger zögern. Fest umschlossen seine Arme
den grazilen Körper. Seine Lippen preßten sich auf den
Mund, der so holdlächelnd zu ihm emporblühte.
Und draußen wartete Florence mit einer Geduld, die sonst
ihre schwache Seite war. Wie ein Zerberus bewachte sie die
Tür, hinter der sich zwei liebende Herzen fanden. Doch
dann konnte sie es vor Neugierde nicht mehr länger aus-
halten, drehte leise den Schlüssel und steckte vorsichtig den
Kopf durch den Türspalt.
»Oh, wie schon!« jubelte sie hellauf, wirbelte in den Raum
und umfaßte beide gleichzeitig mit den Armen. Küßte
rechts und links die Wangen und benahm sich närrisch vor
Freude.
»Meine Schwager, mein liebes – mein Gott, was sein ich
glucklich!«
»Ein arger Schelm bist du!« fuhr Roger, der ganz gerührt
über so viel Freude war, ihr in die Locken. »Nun erzähle
mal deine Schandtat!«
Übermütig sprudelte es über die Lippen, und da mußte
Heidgar lachen.
»Also regelrecht überrumpelt haben Sie mich, Frau Baro-
nin…«
»Aber so doch nicht sagen auf Schwager liebes«, unterbrach
Florence sie vorwurfsvoll. »Da sein man doch intim. Und
nun kommt bei Eltern…«
»Bitte, nicht«, fiel Heidgar hastig ein. »Ich möchte erst mit
meinen Eltern sprechen. Und dann – Randulf. Es wird ihm
weh tun, daß ich so glücklich bin, während er…«
Jetzt war es in dem Raum, den Florence eben noch durch-
jubelte, bedrückend still. Sie dachten alle an den Mann, bei
dem der Stolz über das Herz ging.
»Du hast recht«, sagte Roger leise, »wenn man doch etwas
finden könnte, um seinen Stolz zu brechen.«
»Liebt Sidonie ihn?« fragte Heidgar, der die Augen voll Trä-
nen standen.
»Ja, und sie leidet sehr unter ihrer Liebe, so wie ich es vor

einer Stunde ja auch noch tat. Es ist für die Hellnors nicht
leicht, zu den Thorbrandts zu finden. Doch mir stand es ja
als Mann zu, um meines Herzens Heiligtum zu werben.
Das kann aber ein Mädchen nicht.«
»Oh, ich kannen aber«, lachte Florence spitzbübisch. »Hab'
ja bei euch kannen auch.«
»Ei, Florence, laß das bleiben!« warnte Roger. »Du könntest
dich dabei in die Nesseln setzen. Denn so einfach wie bei
uns ist es nicht, weil Sidonie ja kein Medaillon trägt«, setzte
er schmunzelnd hinzu, die errötete Liebste an sich ziehend,
die nun mit Augen und Lippen bat:
»Wollen wir unsere Verlobung noch so lange geheimhal-
ten, bis auch Sidonie und Randulf sich gefunden haben?«
»Willst du dabei alt und grau werden?«
»Roger, bitte!«
»Na schön, leicht fällt es mir zwar nicht, aber ich möchte
dir die erste Bitte, die du an mich stellst, nicht abschlagen.
Aber eine Bedingung: Ich muß dich jeden Tag sehen dür-
fen.«
»Oh, da sorgen ich!« lachte Florence. »Ich sein guter Passer
auf.«
»Das vielleicht, aber du kannst schlecht dein Schnäbelchen
halten.«
»Pfui, abscheulich! Sein ein unartig Junge, du! Ich ab jetzt,
damit ihr küssen wollt. Aber nur fünf Minutes.«
Lachend wirbelte sie hinaus, und Roger zog glückselig die
Liebste in die Arme.
*
Florence befand sich auf Schleichpfaden der Liebe, aber
nicht für sich, sondern für andere. Doch es waren schon
drei Tage vergangen, nachdem sie Heidgar und Roger zu-
sammenlistete, und noch immer hatte die eifrige kleine
Frau nichts auskundschaften können. Und dabei tat ihr
doch Sidonie so leid, die so blaß und still war und kaum
noch lachte. Und der Graf? Nun, bei dessen Anblick tat
Florence direkt das Herzchen weh. Still und verschlossen
ging er seiner Wege, schien wie um Jahre gealtert zu sein.

Das konnte und wollte die resolute kleine Frau nicht mehr
länger mit ansehen.
Also tat sie etwas, worüber sie sich selber schämte. Sie
spionierte in Sidonies Zimmer herum, als diese ausgeritten
war. Und siehe da, endlich fand sie, was sie brauchte.
Nämlich ein Bild im Silberrahmen, das ganz offen in der
Schreibtischschublade lag, die Sidonie wahrscheinlich ab-
zuschließen vergessen hatte. Wie konnte sie auch ahnen,
daß jemand in ihrem Zimmer spionieren würde.
Und dieses Bild zeigte Randulf Thorbrandt mit der Krone
des Königs Drosselbart. Ganz heimlich mußte Sidonie ihn
geknipst und das Bild vergrößert haben. Und es war gut
geworden; denn das war der Mann, wie er leibte und lebte
– elegant, nonchalant stand er da, ein amüsiertes Lächeln
um den harten Mund.
Florence hätte am liebsten laut gejubelt über diesen inter-
essanten Fund, was sie jedoch lieber bleiben ließ, weil sie
sich ja auf Schleichwegen befand. Wenn es mit dem Me-
daillonbild so geklappt hatte, mußte es mit diesem genau-
so klappen. Jetzt aber auf nach Güldenrode, das Bild Heid-
gar gezeigt und mit ihr beraten, was am besten zu tun sei.
Und so unbedacht, wie die kleine Frau manchmal handel-
te, so tat sie es auch jetzt. Sie lief, das Bild offen in der
Hand, die Treppe hinunter – und direkt Sidonie in die Ar-
me. Wie das personifizierte schlechte Gewissen stand die
eine da, wie eine unbarmherzige Ritterin die andere.
»Woher hast du das Bild, und was willst du damit?« flamm-
te Sidonie vor Empörung auf, und Florence stotterte vor
Schreck das, was sie gar nicht zu tun beabsichtigte:
»Es – es – dem Grafen Randulf – zeigen.«
»Bist du denn plötzlich ganz närrisch geworden?« schrie
Sidonie, halb sinnlos vor Schmerz und Scham über ihr
entdecktes Geheimnis, sie an. Da öffnete sich unten eine
Tür, und Cornelia wurde sichtbar.
»Sidonie, was fällt dir ein! Du schreist ja durchs Haus, daß
es schallt. Was soll die Dienerschaft von dir denken?
Komm sofort ins Zimmer!«

Zitternd vor Empörung kam Sidonie dem Befehl nach, und
Florence folgte wie ein begossener Pudel, das Bild immer
noch offen in der Hand tragend, auf das nun drei Augen-
paare starrten – Franks und die seiner Eltern.
»Woher hast du das Bild, Florence?« fragte der Schwiegerva-
ter drohend in die lähmende Stille hinein.
»Aus Sidonies Schreibtisch.« Die kleine Frau wurde jetzt
trotzig.
»Und was wolltest du damit?«
»Es dem Grafen Randulf zeigen!« trotzte sie weiter. Nun
gerade.
»Ja, hast du denn überhaupt noch deine gesunden Sinne
zusammen!« flammte jetzt auch in dem Mann Empörung
hoch. »Hast du denn keine Ahnung, wie sehr du Sidonie
damit bloßstellen würdest?«
Da weinte das Mädchen heiß auf, und erbarmend umfaßte
die Mutter den zitternden Körper ihres verzweifelten Kin-
des.
»Komm, Liebherz«, bat sie mit erstickter Stimme, »setz dich
in den Sessel! So, und nun beruhige dich. Es ist ja noch
nichts geschehen. Du hast die Torheit Florence' ja noch
rechtzeitig verhindern können.«
»Doch, Nel, doch«, kam es unter Herzstößen hervor. »Ich –
schäme mich.«
Mit großen erschrockenen Augen sah Florence auf das, was
sie angerichtet, und sie hatte es doch so gut gemeint. Und
da sie weiter keinen Rat wußte, weinte sie mit.
»Du hast es nötig, du Tunichtgut!« herrschte der Schwie-
gervater sie an. »Gib das Bild her! So, und nun mach, daß
du mir aus den Augen kommst! Man muß sich ja deiner
schämen, du Kupplerin.«
Wie unter einem Peitschenhieb zuckte sie zusammen.
Dann schlich sie verstört hinaus. So böse hatte sie den
Schwiegervater noch nie gesehen. Sie hatte Angst vor ihm,
bebende Angst.
Und was nun, was sollte sie jetzt machen? Bei Frank Zu-
flucht suchen? Das hatte keinen Zweck. Der zürnte ihr ge-

nau wie die anderen. Und wenn er zürnte, hatte sie auch
vor ihm Angst. Dann konnte er genau so böse Augen ma-
chen wie sein Vater. Aber vielleicht wußte Heidgar Rat.
Also aufs Pferd, und nach Güldenrode galoppiert, wo sie
Heidgar jedoch nicht antraf. Die ritt in diese Stunde mit
dem Liebsten durch den Wald. Die Augen, die der erregten
Frau entgegensahen, gehörten Randulf und seinen Eltern.
»Um Gott, Frau Baronin, was ist Ihnen geschehen?« Ran-
dulf sprang auf und eilte dem sonst so kecken und jetzt so
verstörten Persönchen entgegen. Und da dieses wirklich
nicht mehr aus noch ein wußte, schlangen sich die Arme
um den Hals des Mannes, und unter bitterlichem Schluch-
zen kam das heraus, was ihn und seinen Eltern fast erstar-
ren ließ vor Schreck.
»Und ich habe es doch so gut gemeint!« schluchzte das
Elendsbündel nun in seiner Müttersprache, die den andern
ziemlich geläufig war, am Hals des Mannes weiter. »Ich
konnte es schon gar nicht mehr mit ansehen, wie sehr Si-
donie um ihre Liebe litt. Ich wollte ihr doch helfen, und
nun wird das so falsch aufgefaßt. Jetzt ist mein Schwieger-
vater so böse, wie ich ihn noch nie sah. Aus den Augen
sollte ich ihm gehen – welch eine Schande für mich. Und
Sidonie weint so furchtbar und schämt sich, weil man nun
weiß, daß sie Sie heimlich knipste, Herr Graf, und dieses
Bild wie ein Heiligtum hütete. Wie oft mag sie es geküßt
haben, so ganz für sich allein. Ich tat es ja auch, als ich
meinen Frank heimlich liebte.«
So traurig das auch war, aber nun mußten die drei Men-
schen denn doch lachen. Es klang aber auch gar zu kläg-
lich, das letzte Bekenntnis.
»Kommen Sie, Frau Baronin, beruhigen Sie sich erst ein-
mal«, sprach Randulf ihr gütlich zu. Willig ließ sie sich von
ihm in einen Sessel drücken und leerte das Glas Wein, das
die Gräfin ihr reichte.
»Besser, kleine Frau?« fragte Randulf, und sie nickte, ihn
dabei mit den verweinten Augen treuherzig ansehend.
»Ist es wirklich so verwerflich, was ich tat, Herr Graf?«

»Wie man's nimmt, Frau Baronin.« Er zwang sich die Ant-
wort ab.
»Um Ihnen das richtig klarzumachen, dafür bin ich in der
spanischen Sprache nicht firm genug.«
»Das habe ich gemerkt«, lachte sie nun schon wieder ganz
vergnügt. »Aber sprechen Sie ruhig deutsch, ich verstehe
jedes Wort, nur zu sprechen, ist es mir in dieser Verfassung
zu beschwerlich.«
»Dann geht es Ihnen genauso wie mir«, lächelte er. »Also
sprechen wir, wie es ums Herz ist. Verstehen werden wir
uns schon.«
»Das ist hübsch gesagt. Was werden Sie tun, Herr Graf?«
»Nur das, was mir zu tun übrigbleibt«, entgegnete er gelas-
sen. »Denn ein Mädchen, wie Baronesse Sidonie, faßt die
Liebe anders auf als Sie munteres Vögelchen.«
»Oh, wie schön!« Sie klatschte begeistert in die Hände. »Sie
machen ja Komplimente, Herr Graf.«
»Danach ist mir jetzt auch gerade zumute!« entgegnete er
trocken. Und dann zu den Eltern hin, die dem allen mit
gemischten Gefühlen gefolgt waren:
»Behaltet die kleine unvernünftige Frau hier, damit sie
nicht noch weiter Unheil stiften kann.«
»Was wirst du tun?« fragte der Vater.
»Genau das, was du an meiner Stelle auch tun würdest«,
kam die Antwort knapp zurück.
»Dann geh mit Gott, mein Junge.«
»Danke, Vater. Und du mach nicht so angstvolle Augen,
Muttchen. Ich bringe diese heikle Angelegenheit schon in
Ordnung.«
Damit ging er, und gleich darauf hörte man ihn im Neben-
zimmer sprechen:
»Hier spricht Randulf Thorbrandt, Herr Baron. Darf ich Sie
um eine Unterredung bitten? Danke, in einer halben Stun-
de bin ich bei Ihnen.«
Dann suchte er sein Ankleidezimmer auf. Er klingelte dort
nach dem Diener, den er beauftragte, vom Gärtner einen
Strauß roter Rosen zu besorgen, und fuhr dann nach Mar-

stein, wo ihn der Baron bereits erwartete. Kaum, daß sie
sich begrüßt hatten, sagte Randulf formell:
»Ich bitte um die Hand Ihrer Tochter Sidonie, Herr Baron.«
»Das ehrt mich, Herr Graf. Aber darf ich wissen, warum Sie
sich so unerwartet rasch entschieden haben?«
Nachdem Randulf mit knappen Worten Bericht erstattet
hatte, stieg dem andern die Zornesröte ins Gesicht.
»Da soll doch dieser und jener! Die Florence ist von einem
Starrsinn, der alles überbietet. Und was nun, Herr Graf?
Glauben Sie etwa, es genügt mir, daß Sie aus Ritterlichkeit
um meine Tochter werben, die Sie liebt?«
»Und dennoch bitte ich Sie, Herr Baron, die Zukunft Ihrer
Tochter vertrauensvoll in meine Hände zu legen«, kam es
knapp zurück.
»Bleibt mir ja auch nichts anderes übrig«, lachte der Ältere
bitter auf. »Aber darf ich Sie darauf aufmerksam machen,
daß meine Tochter einen unbändigen Stolz besitzt und sich
nichts schenken läßt?«
»Das weiß ich, Herr Baron.«
»Mann, Sie können einen mit Ihrer eiskalten Gelassenheit
ja rasend machen!« brauste der besorgte Vater jetzt auf.
»Ich lehne jede weitere Verhandlung ab. Sehen Sie zu, wie
Sie allein mit meiner Tochter fertig werden. Ich schicke sie
Ihnen hierher.«
Damit ging er, und bald darauf trat Sidonie ein, mit Stolz
und Ablehnung gepanzert.
»Sie wünschen, Herr Graf?«
»Ich bitte Sie, meine Frau zu werden, Baronesse.«
Sie erblaßte bis in die Lippen. Zornig flammte es in ihren
Augen auf.
»Wollen Sie mich beleidigen, Herr Graf?«
Jetzt umzuckte ein amüsiertes Lächeln seinen Mund.
»Ich habe bisher noch nicht gewußt, daß ein ehrenwerter
Antrag eine Beleidigung für eine Dame bedeutet.«
»Schön, und was haben Sie mir zu bieten?«
»Mich selbst, Baronesse, mich und mein Herz.«
Es kam ihr so unerwartet, daß sie ihn fassungslos anstarrte.

Röte und Blässe wechselten auf ihrem Gesicht in rascher
Folge, und dann füllten sich ihre Augen mit Tränen.
»Sidonie«, klang nun seine sonst so herrische Stimme
weich und zärtlich an ihr Ohr, »schauen Sie mal, was ich
Ihnen überreiche: rote Rosen. Und rote Rosen sind die
Blumen der Liebe. Muß ich noch weiter sprechen, Sie un-
glaublich stolzes Mädchen?«
Hilflos war der Blick, der jetzt zu ihm hinging, ganz rüh-
rend hilflos. Die Hand, die nach den Rosen griff, zitterte.
Und nun wieder diese Männerstimme, so weich, so aus
herzklopfender Tiefe herauf:
»Sido, wollen wir uns nicht länger quälen. Das Schicksal
hat gesprochen, und das ist stärker als wir. Meinen Sie
nicht auch, daß unsere gegenseitige Liebe für eine glückse-
lige Ehe ausreicht?«
Da ging sie zu ihm hin. Seine Arme umschlossen sie fest,
und mit einem glückseligen Lächeln legte sie den Kopf an
seine Brust.
War das eine Freude, als das junge Paar Hand in Hand das
Zimmer betrat, wo die Eltern voll banger Sorge ihrer harr-
ten und Frank nervös zu werden begann, was bei ihm
schon viel zu bedeuten hatte. Während Sidonie sich in den
Arm der Mutter schmiegte, klopfte der Vater seinem so
hochwillkommenen Schwiegersohn den Rücken.
»Junge, du bist mir lieb«, bekannte er mit schwankender
Stimme. »Daß du meine Tochter glücklich machen wirst,
das weiß ich. Sie hat mit dir gewissermaßen das große Los
gezogen. Wenn nur Roger…Na, man darf vom Glück nicht
zuviel verlangen.
Und nun komm her, Marjellchen, laß dich anschauen.
Strahlende Augen, das lobe ich mir. Sahst in letzter Zeit
auch gar zu miesepeterig drein. Kannst es schon wieder
finden, dein goldenes Lachen – bei dem Mann, ja«, schloß
er ernst.
Indes stand Randulf vor seiner Schwiegermutter.
»Nun, Nel?« blitzte es in den Augen auf, da warf sie la-
chend ihre Arme um seinen Hals.
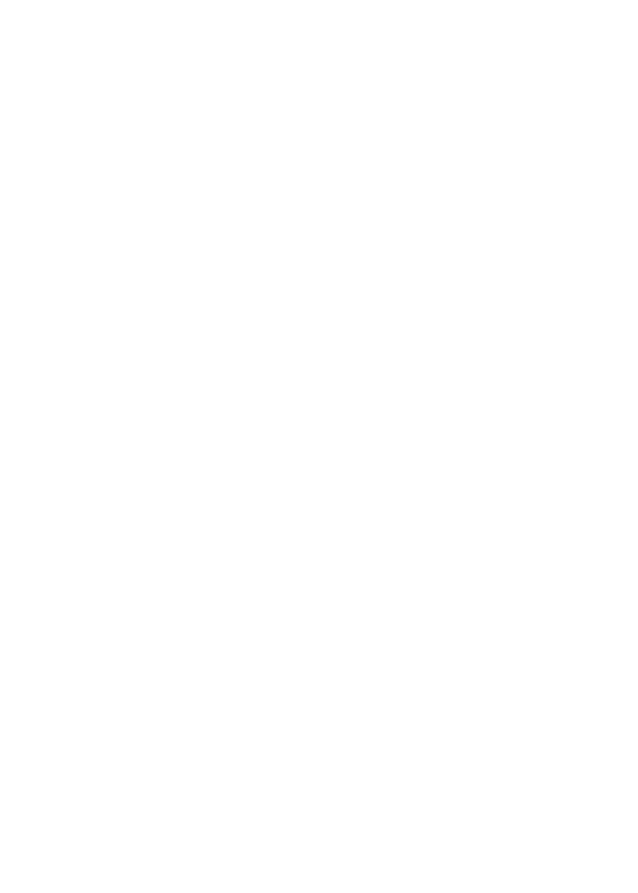
Frank benahm sich so närrisch, wie man ihn noch gar nicht
kannte. Er klopfte dem Schwager den Rücken, schüttelte
seine Hände und beteuerte immer wieder, wie froh er sei,
daß die Wahl seiner Schwester gerade auf einen Thorbrandt
gefallen wäre. Denn dieser Name bürge direkt für Glück.
Und dann kam es über die Schwelle – zuerst zaghaft, dann
mit Hallo. Das gräfliche Paar, Florence, Heidgar und Roger.
Man lachte, weinte vor Rührung, umarmte sich, war so voll
Freude, wie es bei solchen Anlässen eben üblich ist.
Aber dann wurden sie alle wie mit einem Schlage still. Wo
noch eben freudiges Hallo geherrscht, gab es jetzt eine be-
tretene Stille. Aller Augen suchten Heidgar und Roger, die
etwas abseits standen.
Und warum lachte Florence plötzlich so ausgelassen, als
amüsiere sie sich köstlich? Angesichts der beiden Men-
schen, die wie ausgeschlossen aus dem glücklichen Kreis
dastanden, gab es doch wirklich nichts zu lachen. Beküm-
mert ging Baron Gisbert zu Roger, legte ihm die Hand auf
die Schulter, der gleichmütig tat.
»Junge, immer noch so zaghaft?« fragte er leise.
»Das habe ich gar nicht nötig!« tat er großartig ab. »Ich
brauche nur meinem Glück zu winken, dann kommt es.«
Und tatsächlich flog ihm Heidgar um den Hals, lachend,
strahlend. Verblüfft schauten die andern sich an. Nur Flo-
rence klatschte jubelnd in die Hände. Sprühend vor Über-
mut, erzählte sie, wie sie auch dieses Paar zusammengeli-
stet hatte, und da brach befreiendes Lachen aus.
»Komm her, du Strick!« Der Schwiegervater öffnete die
Arme, doch sie schüttelte das kapriziöse Köpfchen.
»Nein, du sein ein schreckliches Mann. Hast gepudelt mich
ab, als sein ich der Teufel.«
»Wenn auch das nicht gerade, so doch eine Kupplerin,
wenn auch eine reizende«, schmunzelte Gisbert, und da
schmiegte sie sich lachend in seine Arme.
Nachdem sich der Freudensturm gelegt, setzte man sich
gemütlich zusammen. Einmütig wurde beschlossen, daß
die beiden Verlobungen ganz geheim gehalten werden soll-

ten. Dafür wollte man ein glänzendes Hochzeitsfest veran-
stalten. Die »Clique« sollte vor Überraschung »aus den
Schlorren kippen«, wenn sie die Einladung dazu erhielt.
Und sie tat es, allerdings nur bildlich genommen. Und als
dann die beiden Paare zum Altar der kleinen Güldenroder
Kirche schritten, war die »Clique« so stolz, als gehörten die
vier Menschen zur Familie jedes einzelnen.
Es wurde eine erhebende Feier, bei der es fast ein herzliches
Lachen gegeben hätte, als der Oberst sein Hutzelchen, das
so bitterlich weinte, ziemlich laut und vernehmlich fragte:
»Warum weinst du denn, Hutzelchen? Etwa weil dein Ran-
dulf heiratet?«
»Aber laß mich doch weinen, Wilhelm. Ich bin doch so
glücklich.«
»Dann geh 'raus und weine weiter.«
Und die Rede, die später der Präses an der Festtafel hielt,
wurde immer wieder von stürmischer Heiterkeit unterbro-
chen. Da sich nämlich der Oberst vor lauter Freude über
»seine« Hochzeit ziemlich die Nase begossen hatte, war
das, was er sagte, gerade das Gegenteil von dem, was er
meinte. Demnach sollten die jungen Paare sich ständig in
den Haaren liegen und sich gegenseitig betrügen.
Dann hielt Florence eine Rede, die vor Drollerie nur so
strotzte:
»Menschen seid still, jetzt sagen ich! Ich sein Frau von
Gluck von meine Lieblings, habe sie gekuppelt ein, wie sagt
Paps. Und ich will haben Dank. Soll reisen auf Hochzeit
meine Lieblings, aber nur eine Monat. Dann müssen
kommen nach Chile, wo ich machen will sie glucklich
Haus.«
Daß man auch über diese Rede Tränen lachte, war gewiß
kein Wunder. Es wurde überhaupt eine fröhliche Hoch-
zeitsfeier, weil man ja alle Veranlassung dazu hatte, fröh-
lich zu sein. Hauptsächlich die beiden jungen Paare nebst
ihren Angehörigen. Hatte doch alles das, was zuerst so
traurig erschien, sich in Glück aufgelöst. Denn man war
jetzt eine glückliche und große Familie, die, außer Frank
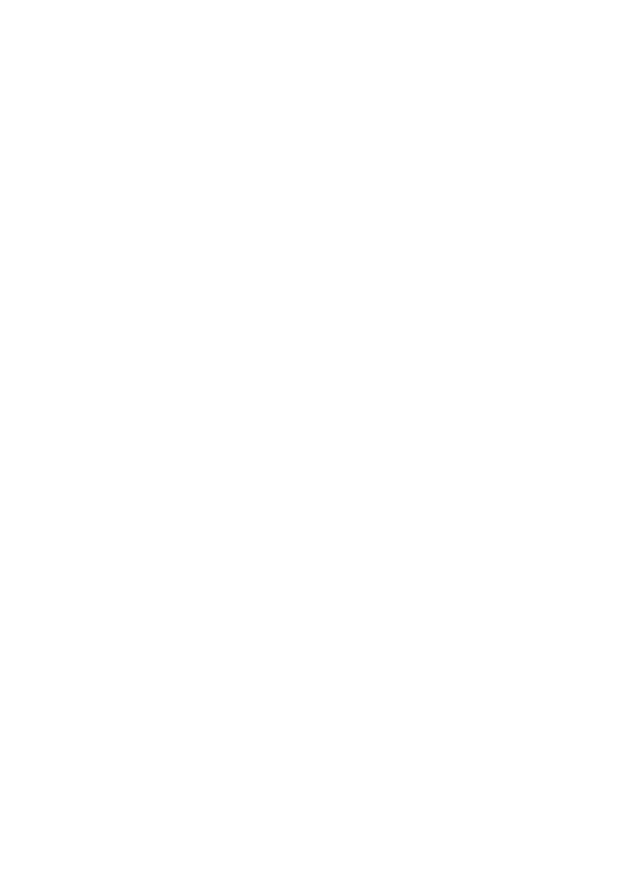
mit Frau und Kindern, treulich beisammenblieb. Sidonie
und Heidgar brauchten nur die Häuser zu wechseln und
blieben dennoch Eltern und Geschwistern ganz nahe. Das
allein war schon ein großes Glück für sie.
»Schaut euch mal unsere Kinder an!« schmunzelte Gisbert,
der nach Aufhebung der Tafel mit seiner Frau und den
Schwiegereltern etwas abseits stand. »Das sind die richtigen
Hochzeitsaugen, die sie haben. Und wie zärtlich unser
Randulf sich seine Sidonie betrachtet. Weiß der Kuckuck,
der Junge hat's in sich, ganz warm kann einem bei seiner
verflixten Art ums Herz werden. Kein Wunder, daß unsere
stolze, eigenwillige Sido bei dem Mann ihren Meister fand.
Ganz klein ist sie geworden in ihrer Liebe.
Und das andere Paar? Bei dessen Anblick geht einem, weiß
Gott, das Herz auf. Ist aber auch ein trautes Marjellchen,
die Heidgar. Ich glaube, die wird mein Verzug.«
»Und meiner der Randulf«, lachte Cornelia. »An dem habe
ich nun mal einen Narren gefressen.«
»Na, Muttchen, und wo bleiben wir?« fragte Albrecht ver-
gnügt. »Wähle dir Roger als Idol, und ich tu es bei Sido,
somit hätten wir alle etwas Spezielles fürs Herz.«
»Ist schon geschehen, mein lieber Mann«, gab Herma la-
chend zurück. »Für den Jungen besitze ich längst eine
Schwäche. Aber auch für Florence und Frank. Sie sind ge-
wiß so liebenswert wie die anderen, jeder auf seine Art.
Schade, daß wir sie nicht auch in unserem Nest haben.
Wann wollen sie abreisen?«
»Möglichst bald«, gab Cornelia Antwort. »Und jetzt will ich
auch verraten, was Florence ausgeheckt hat. Wenn die
Hochzeitsreisenden in Chile eintreffen, sollen sie uns dort
vorfinden. Warum machst du so ein saures Gesicht, Alb-
recht?«
»Weil ich auf diese Reise werde verzichten müssen. Denn
sie fällt in die Roggenernte, und da kann ich schlecht von
Güldenrode fort.«
»Du hast's nötig«, spottete Gisbert gutmütig. »Mann, die
Schinderei hört jetzt auf, sage ich dir, jetzt wirst du dir mal

mehr Ruhe gönnen und der Randulf auch. Friß mich bloß
nicht. Ich bin ein schwerer Happen und würde dir be-
stimmt im Hals steckenbleiben. Bei uns heißt es jetzt: Mit-
gefangen, mitgehangen. Wir werfen alles in einen Topf und
werden dabei wunderbar satt werden. Und wenn du jetzt
noch etwas sagst, hetze ich Florence auf dich.«
»Erbarmen!« Albrecht hob lachend die Hände. »Dann will
ich schon lieber klein beigeben.«
»Was wird denn für ein Familienrat gehalten?« Roger trat
hinzu, gefolgt von den anderen, die zu der harmonischen
Familie gehörten. »Geht lieber zu den Gästen und macht
mit ihnen schön, damit wir Hochzeiter uns heimlich ver-
drücken können. Erspart uns auch einen rührseligen Ab-
schied. Wir wollen heute keine Tränen in den schönen Au-
gen unserer Frauen sehen.«
»Hach, wie besorgt!« lachte Heidgar ihn lieblich an, trat
dann aber rasch hinter den Schwiegervater, weil die Hand
des neugebackenen Ehegemahls nach dem rosigen Ohr-
läppchen zielte.
»Roger, du zerreißt mir den Schleier!«
»Na, wenn schon! Mit dem Gürtel, mit dem Schleier, reißt
der schöne Wahn entzwei, sagt Schiller.«
»Kinder, jetzt benehmt euch mal!« lachte Cornelia. »Nehmt
euch ein Beispiel an dem anderen Paar. Das ist viel seriö-
ser.«
»Versteht sich!« tat Sidonie würdig, und ihre Augen strahl-
ten. »Dafür sind wir ja auch seriöse Thorbrandts und ihr
übermütige Hellnors, nicht wahr, mein Herr Gemahl?«
Und siehe da, dem gelang es, was dem anderen versagt
blieb. Seine Hand zupfte an dem niedlichen Ohrläppchen.
»0 Randulf!« jubelte Florence. »Und du sollen seriös sein?«
»Kinder, jetzt macht Feierabend!« lachte Gisbert gleich den
anderen herzlich. »Ihr hetzt uns ja die ganzen Gäste auf
den Hals. Ab mit euch, und hinein in die Hochzeitsreise!
Bleibt gesund und glücklich. Das soll mein Wunsch für
euch sein.«
Jetzt schwankte seine Stimme doch ein wenig, und rasch

zogen die beiden Ehemänner ihre Frauchen mit sich fort.
Und es war die höchste Zeit; denn schon nahten einige
Gäste. Die Gastgeber wischten verstohlen ein Tränchen
fort, und dann ging es vergnügt ans Feiern.
Indes fuhren zwei junge, glückselige Paare im Auto davon,
jedes einem anderen Ziel zu. Und Frau Norne lächelte sehr,
sehr gütig. Sie hatte es geschafft, hatte den von ihr bevor-
zugten Menschenkindern das in ihr Schicksalkleid gewebt,
was die Engel Himmelsfreud und die Menschen Liebe nen-
nen.
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Behrendt, Leni Kelter Grosse Ausgabe 0005 Die barmherzige Lüge
Behrendt, Leni Kelter Grosse Ausgabe 0394 Die Ehe auf Abbruch
Behrendt, Leni Kelter Grosse Ausgabe 0001 Die Herrin von Schlehdorn
Behrendt, Leni Kelter Grosse Ausgabe 0034 Die drei Wünsche
Behrendt, Leni Kelter Grosse Ausgabe 0030 Als die Rosen blühten am Rosenhaus
Behrendt, Leni Kelter Grosse Ausgabe 0398 Krafft von Broede
Behrendt, Leni Kelter Grosse Ausgabe 0286 Wo du nicht bist, kann ich nicht sein
Behrendt, Leni Kelter Grosse Ausgabe 0390 Was wird stärker sein
Behrendt, Leni Kelter Grosse Ausgabe 0003 Nichts weiter als ein Herz
Behrendt, Leni Kelter Grosse Ausgabe 0009 Wohin soll das wohl führen
Behrendt, Leni Kelter Grosse Ausgabe 0032 Das Haus im grünen Grund
Behrendt, Leni Kelter Grosse Ausgabe 0287 Törichte Herzen
Behrendt, Leni Kelter Grosse Ausgabe 0270 Das häßliche Entlein
Behrendt, Leni Kelter Grosse Ausgabe 0395 Um das Erbe der Väter
Behrendt, Leni Kelter Grosse Ausgabe 0031 Durch Gewitter und Sturm
więcej podobnych podstron