

2
Dan Roberts
Der rote Agent
Apache Cochise
Band Nr. 35
Version 1.0

3
Prolog
Ihr Land war es, in das Mexikaner und Amerikaner
eindrangen. Das Land ihrer Väter. Karstig und elend,
wasserarm und unfruchtbar schmorte es unter heißer
Arizonasonne. Wüste, bizarre Klippen, himmelansteigende
Berge und Giftschlangen. Trotzdem verteidigten sie es mit der
Stärke ihrer Seele und dem wilden Schlag ihrer Herzen. Zu
diesem Zeitpunkt waren sie längst keine Athapasketi mehr,
sondern deren Nachfahren: Apachen.
Sie selbst nannten sich T'Inde – Volk, auch Naizhan – Unsere
Rasse. Und sie besiedelten ein Land so groß wie Deutschland
und Frankreich zusammen. In diesen ihren Jagdgründen
leisteten sie Eindringlingen Widerstand und verteidigten jeden
Fußbreit Boden mit ihrem Herzblut.
Zur Zeit der Handlung unserer Geschichte APACHE
COCHISE lebten 6000-7000 Apachen, die in Arizona und
Neumexiko Angst und Schrecken verbreiteten, besonders im
amerikanisch-mexikanischen Grenzgebiet und weit in Sonora,
bis hinunter zur Sierra Madre Occidental.
Ihren Haß gegen die Nachfahren der Spanier und den
Erzfeind, die Comanchen, übertrugen sie auf ihre neuen
Unterdrücker. Von ihnen ist die Rede in unserer Serie. Sie ist
die historiengetreue Basis der Thematik APACHE COCHISE.

4
***
Nepatana schreckte hoch. Er kämpfte mit den Fetzen des
Traumes, die in seinem Kopf umhergeisterten.
Der Ruf einer Spottdrossel schallte durch die Dunkelheit.
Geschmeidig glitt der Apache von seinem Lager und huschte
zum Fenster.
Da, ein Schatten vor der Hütte. Ein Mann auf einem Pony.
Nepatana verzog die Lippen zu einem harten Lächeln.
Bitterkeit quoll in ihm auf, wenn er daran dachte daß er in
dieser Nacht wieder einen Mann seiner eigenen Rasse töten
mußte.
Langsam ging er zur Tür, öffnete sie und sagte halblaut: »Du
bist mein Gast, Krieger.«
Der Indianer saß ab, führte den Mustang zur Seite und lief
ins Haus.
Es war ein Mimbrenjo, und seine schwarzen Augen
funkelten triumphierend.
»Sieh, Träumer«, sagte er und schwenkte einen Stab, an dem
zwei Skalps hingen, zwei frische Skalps.
»Gut, sehr gut«, murmelte der Pinaleno Apache, der sich von
seinem Volk losgesagt hatte und eine Farm betrieb. »Wo hast
du sie getötet, Krieger?«
»Im Süden, weit von hier«, erwiderte der Mimbrenjo. »Sie
trugen Münzen aus dem gelben Metall bei sich. Hier, dafür
bekommen wir zwei Kisten Patronen. Cochise weiß nicht, daß
ein Teil der Krieger die Waffen der Bleichgesichter besitzt.
Cochise ist ein altes Weib geworden. Er will Frieden mit den
Landräubern. Victorio und Geronimo suchen den Kampf. Wir
werden kämpfen, wir werden siegen, Träumer.«
Nepatana nickte ernst und erwiderte: »Du bist ein großer
Krieger, Mimbrenjo, ich will dich ehren. Kennst du das

5
brennende Wasser der Bleichgesichter?«
Begehrlich funkelten die Augen des anderen Apachen, und
das war für Nepatana Antwort genug. Er ging zu dem
einfachen Schrank aus ungehobelten Brettern, öffnete die Tür,
nahm mit der Linken die Whiskyflasche und mit der anderen
Hand den Dolch heraus, den er geschickt unter seinem
Lederhemd verbarg.
»Trink, Mimbrenjo«, sagte Nepatana, und reichte dem
Krieger die Flasche.
Als er das Glas an die Lippen setzte, zuckte die Rechte des
Träumers blitzschnell vor. Der kalte Stahl grub sich in den
Oberkörper des Kriegers.
Geschickt fing Nepatana mit der linken Hand die
Whiskyflasche auf. Er hörte nicht auf die verzerrten,
röchelnden Worte des Mimbrenjos, der den Pinaleno
fassungslos anstierte.
Der Blick des Kriegers ging weg, verschwamm. Der
Kämpfer aus Victorios Stamm sank zusammen. Er war tot,
getötet von Nepatana, dem Träumer, von dem Mann, der sich
von seinem Stamm losgesagt hatte, und hier, östlich des
Graham Peaks, eine Farm betrieb.
Nepatana blickte auf den Toten, sah die Goldmünzen, die
beiden Skalps.
»Das darf nicht länger geschehen«, murmelte der Apache.
»Meine eigenen Leute kämpfen und töten die Weißen. Die
Mimbrenjos sind noch schlimmer. Victorio ist wie ein Teufel,
von dem die Padres sprechen. Nein, es muß ein Ende haben,
wenn wir Indianer überleben wollen.«
Für Sekunden versank Nepatana in seinen Traum.
Ja, in seinen Visionen sah er, wie Weiße und Apachen
friedlich nebeneinander lebten. Und das war sein Ziel: den
unaufhörlichen Kampf zwischen den beiden Rassen endgültig
zu beenden.
Mörder wie dieser Mimbrenjo mußten sterben.

6
Napatana leerte die Taschen des Kriegers, der allein auf
Raubzug ausgeritten war. Die Waffen ließ er ihm, denn ein
Mann sollte mit seinen Waffen begraben werden, damit er im
jenseitigen Reich auf die Jagd gehen konnte, damit er den
weißen Büffel hetzte, wie es in den Legenden der Uralten
erzählt wurde.
Der kräftige Farmer legte sich den Toten über die Schultern
und löschte die Kerosinlampe. Als er die Tür öffnete, blieb er
witternd stehen. Nichts warnte ihn, kein Feind lauerte in der
Dunkelheit.
Und doch spürte Nepatana, daß die friedliche Zeit auf dieser
Farm dem Ende zuging. Er ahnte, witterte, daß eine andere
Aufgabe auf ihn wartete, eine Aufgabe, die ihn seinem Ziel,
dem Frieden zwischen Apachen und Bleichgesichtern,
näherbrachte. Aber dieses Ziel war weit entfernt. Um es zu
erreichen, mußten noch viele Menschen sterben.
Der Pinaleno Apache trug den Leichnam ins Maisfeld. Die
starken Pflanzen raschelten, zischend rieben die Blätter
gegeneinander. Endlich erreichte der Träumer das freie Stück,
legte den Toten zu Boden und zerrte die Schaufel unter den
ausgedörrten Stengeln hervor, die auf einem Haufen lagen.
Es dauerte nicht lange, bis Nepatana das Grab geschaufelt
hatte und der tote Mimbrenjo in dieser flachen Grube lag.
Düster blickte der Pinaleno auf den jungen Apachen hinab, ehe
er die erste Schaufel Dreck in das Loch zurückwarf. Niemand
würde den Krieger hier entdecken. Nepatana genoß das
Vertrauen der Weißen genauso, wie das der roten Menschen,
denn er war ein Träumer, der an eine Visionen glaubte.
Im Osten glänzte der Horizont grau. Ein schmaler Streifen
war es nur, der die Dunkelheit aufriß. Und doch kündete er
vom neuen Tag, der in weniger als einer Stunde die Nacht
verdrängen würde.
Nepatana versteckte die Schaufel und stapfte zum Ranchhaus
zurück. Er bewegte sich wie ein weißer Mann, achtete nicht
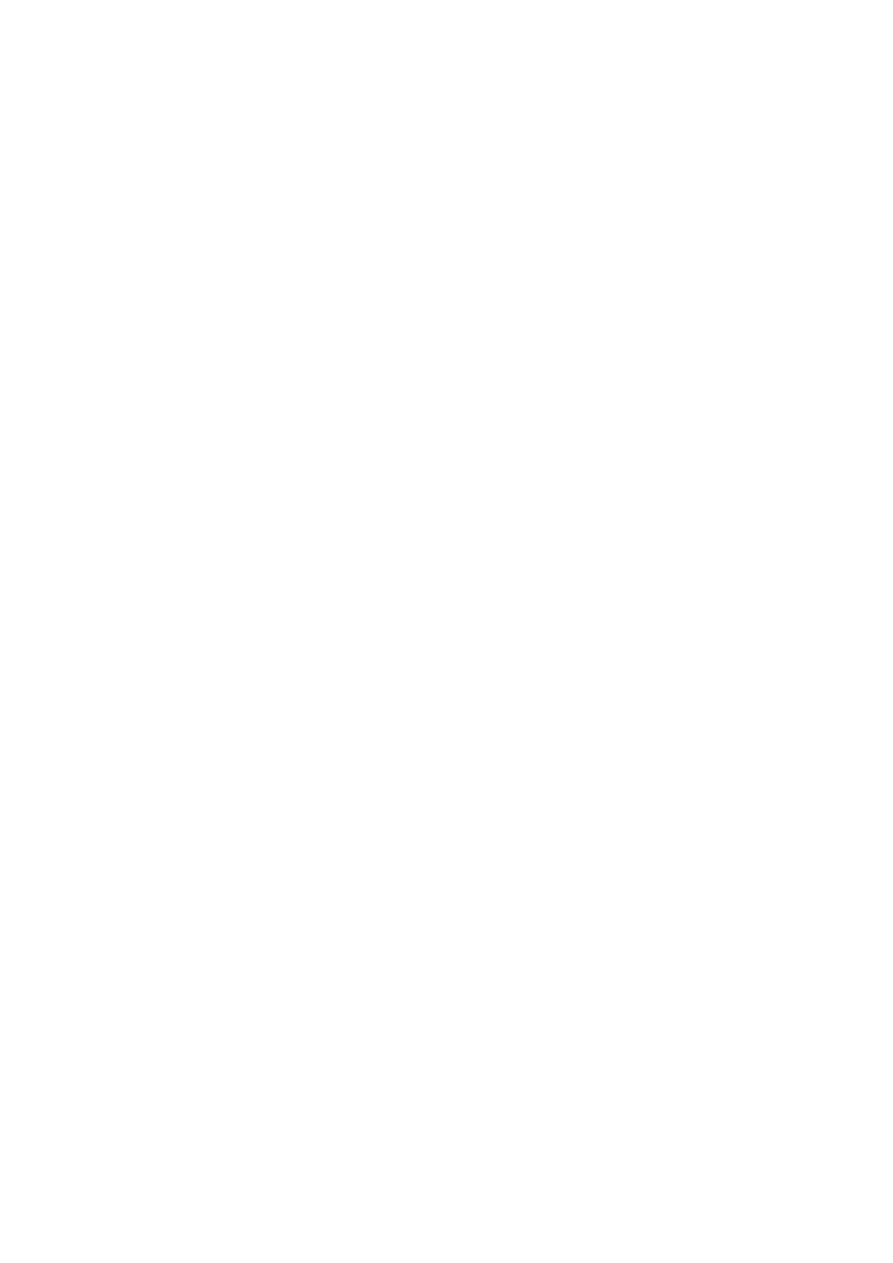
7
darauf, wohin er seine Füße setzte. Maisstroh knirschte und
knackte unter den Lederstiefeln des indianischen Farmers,
während er zurückging.
Der Traum!
Wieder zogen Gedankenfetzen, Bruchstücke, an Nepatanas
Augen vorbei. Er lächelte und wußte, daß die Zeit nicht mehr
fern war, von der er geträumt hatte. Ja, es war möglich, daß
Bleichgesichter und Apachen friedlich zusammenlebten. Und
er, Napatana, würde das Werkzeug sein, das der Große Geist
ausersehen hatte. Im kleinen Stall muhten die drei Kühe. Sie
mußten gemolken werden. Die Milch holte jeden Tag ein Bote,
der von Fort Grant zur Farm ritt. Die Frauen der Soldaten
hatten kleine Kinder. Sie brauchten diese Milch, und sie
zahlten gut dafür. Der Zahlmeister des Forts kaufte dem
indianischen Farmer Mais, Weizen, Schafe und Wolle ab.
Nepatana war ein wohlhabender Mann, gemessen am
Einkommen jener Zeit. Und er war ein Feind der wilden,
blutrünstigen Krieger, die aus ihrer engen Welt ausbrachen und
den Tod zu Weißen und Mexikanern brachten.
Der Apachenfarmer setzte sich in den Schaukelstuhl, der auf
der Veranda stand. Noch besiegte die Dämmerung nicht die
Nacht. Und diese Stunde, die Zeit vor dem Sonnenaufgang,
liebte Nepatana. Er blickte nach Osten. Dort erschien jeden
Morgen die Sonne, die Spenderin jeglichen Lebens, und
tauchte die Halbwüste in ihren Gluthauch.
Nepatana sah den blutroten Streifen am Horizont. Der
Apachenfarmer versank in seinen Traum. Zum erstenmal hatte
er eine Vision von sterbenden Männern. Blut, überall rann es
rot umher. Angst kroch in das Herz des Pinaleno. Würde er
scheitern? War es nicht möglich, seinen Traum zu erfüllen?
Irgendwo klapperten Hufeisen über Gestein. Abrupt
erwachte Nepatana, starrte noch ein paar Sekunden auf den
drohend verfärbten Horizont und stand schließlich auf.

8
*
John Haggerty lag am Ufer des Sees in den Dragoon
Mountains. Der ehemalige Scout fühlte sich wieder gesund.
Seine Füße schmerzten nicht mehr. Der Marsch durch das
Indianerland verschwamm allmählich zur Erinnerung.
Haggerty lächelte, als er an Tla-inas Worte dachte, nachdem
sie seine zerschundenen Füße gesehen hatte.
»Ein Falke fliegt«, hatte Cochises Schwester gesagt. »Ich
weiß nichts davon, daß er durch den heißen Sand läuft.«
Und Naiche, der Sohn des großen Häuptlings, hatte schallend
dazu gelacht. Selbst die einfachen Krieger konnten ihren
gutmütigen Spott nicht unterdrücken.
John fühlte sich auf eine merkwürdige Art zu Hause in der
Apacheria des Stammes. Er spürte, fühlte, daß er anerkannt
wurde. Zwar galt er noch immer als Weißer, und daran würde
sich nichts ändern im Laufe der Zeit. Aber die Apachen unter
Cochise hatten erkannt, daß der Falke wirklich ein Mann war,
der zu seinem Wort stand, der Frieden wünschte und den
Menschen der roten Rasse nicht feindlich gegenüberstand.
Haggerty blickte auf die blaue Wasserfläche. Sie war der
kostbarste Besitz des Stammes. In den zerklüfteten Felsen der
Dragoon Mountains bot dieses Wasser eine gute
Überlebenschance. Das schmale, langgestreckte Tal konnte von
den US-Truppen nicht eingenommen werden. Zwei Dutzend
Krieger hingegen vermochten eine ganze Armee aufzuhalten.
Um Cochises Schlupfwinkel zu stürmen mußte Artillerie
eingesetzt werden. Bis die Batterien jedoch in Stellung standen,
hätten zahllose Rotten von Apachen die Kanoniere getötet.
Doch warum sollte General Howard diese Apacheria stürmen
lassen? Er dachte gar nicht daran, war froh, daß der
schwankende Friede im Südwesten durch Cochise und
Haggerty immer wieder gerettet wurde.
John schloß die Augen. Ein leichter Wind strich durch die

9
Zweige und Blätter der Büsche. Das Rascheln wirkte
einschläfernd, und nach wenigen Minuten versank der
ehemalige Scout in einen Dämmerschlummer.
Auf einmal hörte er Schritte. Ein Mensch näherte sich, ging
leichtfüßig, erreichte die Sträucher und wand sich hindurch.
Tla-ina, dachte John mit geschlossenen Augen. Ja, das ist ihr
Schritt.
»Ich freue mich, daß du kommst, Sanfter Wind«, sagte
Haggerty leise. »Setz dich zu mir und laß uns ein wenig
träumen, Tla-ina.«
Sie schwieg zu lange, fand John. Er richtete sich auf, öffnete
die Augen und hörte Naiches Stimme.
»Falke, Freund meines Vaters«, sagte der Sohn des
Häuptlings. »Nicht nur deine Füße haben auf dem Marsch
gelitten, auch deine Ohren. Oder geht die Schwester meines
Vaters so wie ich?«
Haggerty seufzte und erwiderte: »Naiche, ich war davon
überzeugt, daß der Sanfte Wind kam. Du bist mir ebenso
willkommen, wenn auch auf eine andere Weise.«
Cochises Sohn lachte kurz und sagte: »Weißer Falke, es geht
mich nichts an, was Tla-ina tut. Cochise ist damit
einverstanden, und er ist der Führer des Stammes. Aber sage
mir, Falke, was aus dir und dem Sanften Wind wird. Sage mir,
ob du ganz, auch in deinem Denken, ein Apache werden
kannst?«
Naiche kauerte sich neben Haggerty ans Ufer des Sees.
»Dies sind Dinge«, erwiderte John ernst, »die alle Gedanken
zerstören können. Tla-ina sagte mir vor einiger Zeit, daß ich
nicht an die Zukunft denken soll. Wir leben heute, jetzt, sagte
sie, und danach richte ich mich. Wenn auch in meinem Herzen
ein schwarzer Vogel fliegt, der auf den Tod wartet. Und dieser
Vogel ist die Summe meiner Gefühle, Naiche.«
Cochises Sohn schwieg. Er war beeindruckt. Der Falke hatte
ihm klar und offen geantwortet, hatte seine Zweifel, seine

10
Furcht vor der Zukunft mit Tla-ina, nicht verborgen.
»Mein Vater möchte dich sprechen«, sagte Naiche und stand
auf. »Der Jefe möchte deine Meinung hören, Falke.«
Haggerty zog die Socken an und schlüpfte in die
Apachenstiefel. Sie waren weicher, bequemer als die der
Weißen. Und doch schützten diese kniehohen Wildlederstiefel
der Wüstenvölker genausogut vor Schlangenbissen,
Speerdornen und Kakteenstacheln.
John fragte nicht, was Cochise von ihm wollte. Das würde
der Chief ihm selbst sagen.
Schweigend gingen die beiden so verschiedenen Menschen
zum eigentlichen Lager der Apachen. Die Feuer glommen
rauchlos vor den Wicky-ups. Es roch nach Bratfleisch, aber
John vermochte nicht zu unterscheiden, ob die Squaws Stücke
vom Eselhasen, Weißschwanzhirsch, Gabelbock oder
Maultierfleisch brieten.
Ulzana, einer der bedeutendsten Unterhäuptlinge der
Chiricahuas, saß Cochise gegenüber. Der knorrig wirkende
Apache haßte die Weißen. Er war für den Kampf, würde mit
Geronimo gegen die verhaßten Bleichgesichter ziehen, wenn
nicht Cochises Worte ihn immer wieder zurückgehalten hätten.
Haggerty setzte sich und sagte: »Jefe, ich bin gekommen. Du
hast mich holen lassen.«
»Du kennst Ulzana«, erwiderte Cochise. »Er ist nicht damit
einverstanden, daß ich die weißen Wüstenwölfe
niedergekämpft habe, Falke. Er denkt, daß Victorio Rachepläne
ausbrütet, daß er die Mimbrenjos wieder einmal ausschickt und
alle Weißen sterben sollen.«
Aufmerksam betrachtete Haggerty den Unterhäuptling. Seine
Augen wirkten kalt und leer, wie Kohlenstücke.
John lachte leise und sagte: »Ulzana hofft, daß der Kampf
ausbricht. Er will seine Krieger zu Ruhm und Ehre, zu Beute
und Skalps führen.«
Der Unterhäuptling verzog das Gesicht für einen Moment. Es

11
wirkte voller Hohn und Spott.
»Victorio wird nicht hinnehmen, daß Cochise wieder als
großer Kämpfer dasteht«, sagte der kleinwüchsige Apache. »Er
ist anderer Meinung, Falke. Er vertritt die richtige Meinung,
und die ist, daß alle Weißen aus diesem Land vertrieben
werden müssen.«
»Alle?« fragte John langsam und starrte dem Chiricahua in
die Augen.
»Ja, alle, auch du, Falke, der du dich Cochises Freund
nennst«, erwiderte Ulzana heftig. »Ihr verderbt mit euren
Gedanken den Geist der Apachen, lenkt die großen Führer in
die falsche Richtung. Wir müssen kämpfen, Cochise. Das ist
unsere einzige Hoffnung.«
Haggerty schüttelte den Kopf und erwiderte: »Du vergißt die
Macht meiner Rasse, Ulzana. Einzeln sind die meisten Weißen
schwach und unfähig, in diesem heißen Wüstenland zu
überleben. Das gebe ich zu. Aber vergiß nicht die
Pferdesoldaten, die Hotchkiss-Kanonen und die Gatling-Guns.
Und wenn diese Waffen feuern, ist es, als wären sie an einem
Tag geladen worden, und würden drei Tage lang den bleiernen
Tod ausspucken. Mit Kanonen aus dem Krieg zerstören die
Blauröcke jede Apacheria. Und das wird geschehen, wenn
unbedachte Menschen wie du oder Victorio zum großen Kampf
aufrufen.«
Ulzana preßte die Lippen zusammen. Er war fest davon
überzeugt, daß die Apachen den Weißen überlegen sein
würden, kam es zur großen, zur entscheidenden
Auseinandersetzung. Denn die Krieger der Halbwüste
verschmolzen mit ihr. Sie beherrschten alle Listen, sämtliche
Tricks, die zum Überleben und für siegreiche Überfälle nötig
waren.
»Der Falke spricht wahr«, sagte Cochise müde. »Du selbst
warst dabei, als wir den Bleichhäutigen unterlagen, vor langen
Wintern, Ulzana. Und damals haben die Kanonen der Weißen

12
den Kampf entschieden. Erinnere dich daran.«
Ulzana schwieg. Er war anderer Meinung, dachte, daß
damals die Führung des Häuptlings an der Niederlage schuld
war, denn der Unterhäuptling konnte nicht sehen, daß die
Krieger der vereinigten Stämme durch die Überlegenheit der
Bleichgesichter geschlagen worden waren. Haggerty verstand,
warum ihn Cochise bei der Unterredung in der Nähe haben
wollte. Ulzana war unzufrieden, war der Anführer der wilden
Krieger, denen Skalps, Blut und Beute mehr bedeuteten, als
Frieden oder das Überleben der Apachen.
Es galt, den Unterhäuptling zu besänftigen, so zu beruhigen,
daß kein offener Konflikt entstand, daß keine Rotte
Chiricahuas aus der Apacheria ausbrach und auf Raubzug ging.
Haggerty lächelte und sagte: »Jefe, dann sollen Ulzanas
wilde junge Männer nach Norden ziehen. Als Späher werden
sie schon entdecken, wenn Victorio den Krieg mit den Weißen
wieder schüren will.«
Cochise blickte zu den zerklüfteten Felsengipfeln der
jenseitigen Talwand hinauf. Ein undeutbarer Ausdruck lag im
Gesicht des Chiefs. Es schien, als mischten sich Trauer,
Gewißheit und Zorn und Verzagtheit in diesem Gesicht des
größten Führers der Apachen. Es schien, als wüßte Cochise
etwas, das kein anderer auch nur ahnte.
Ulzana hingegen vermochte seinen Triumph kaum zu
unterdrücken. Er setzte zweimal zum Sprechen an, und erst
beim zweiten Versuch gelang es.
»Gut, Falke«, sagte der Unterhäuptling, »wenn dies dein Rat
ist, so ist es ein kluger Rat. Wenn Cochise befiehlt, daß die
Krieger spähen sollen, so werden sie reiten.«
Erwartungsvoll blickte der kleinwüchsige Ulzana den Chief
an. Cochise kehrte aus weiter Ferne zurück. Für eine Sekunde
irrte sein Blick von John zu Ulzana.
»Sie sind verloren, wenn sie nach Norden reiten«, sagte der
Jefe ausdruckslos. »Ich warne dich, Ulzana, diese Krieger

13
kehren nie zurück. Ich weiß es.«
»Sollen meine Männer die Mimbrenjos beobachten?« wollte
der Unterhäuptling wissen.
»Ich halte sie nicht zurück, auch dich nicht«, erwiderte
Cochise ruhig.
Ulzana stand auf und ging langsam davon. Deutlich sah ihm
John an, daß er am liebsten gelaufen wäre. Hatte Ulzana doch
einen Sieg über den großen Cochise errungen.
»Was ist das, was du eben sagtest?« wollte Haggerty wissen.
»Woher nimmst du die Gewißheit, mein Bruder?«
Düster antwortete Cochise: »Frage mich nicht, Falke. So wie
du bestimmte Dinge siehst und erkennst, was daraus entstehen
mag, so weiß ich, daß Ulzanas Krieger in den Tod reiten.«
Der Jefe starrte in die schwache Glut des Feuers.
»Sollen wir den Kriegern folgen?« wollte John wissen.
»Vielleicht können wir ihnen helfen, einige retten.« Es dauerte
sehr lange, ehe Cochise erwiderte: »Nein, mein Bruder. Ulzana
muß erkennen, daß er nicht der große Führer ist, für den er sich
hält. Es zerschneidet mir das Herz, daß Kinder meines Volkes
sterben müssen. Sterben deswegen, um einem Mann, dessen
Herz durch Krieg und Feindschaft vergiftet ist, seine Fehler zu
zeigen. Wir müssen warten, Falke. Erst wenn wir die Nachricht
vom Tod der Krieger erhalten, brechen wir auf.«
Haggerty sah, daß es sinnlos war, weiter auf Cochise
einzureden. Er würde dem Drängen seines weißen Freundes
nicht nachgeben.
»Ich sehe mir die Krieger an, die Ulzana ausschickt«, sagte
John und stand auf.
Langsam ging er zu den Pferden. Zehn Chiricahuas legten
ihren zähen, struppigen Mustangs die Graszügel auf, die
Decken auf den Rücken. Die Augen der Krieger glänzten
erwartungsvoll. Ulzana stand ein wenig abseits. Er hielt die
Arme vor der Brust gekreuzt und blickte voller Stolz auf den
Spähtrupp.

14
Die Männer waren gut bewaffnet. Sie trugen die
Ulmenholzbögen, Lederköcher voller Pfeile, die Tomahawks,
Dolche und moderne Gewehre.
Spöttisch blickten die Krieger zu dem Falken hinüber. Ihr
ganzes Gehabe ließ John fühlen, daß sie ihn für einen Feigling
hielten. Warum ritt er nicht mit nach Norden?
Minuten darauf trabten die Ponys über die Felsenwege, die
aus der Apacheria hinausführten.
*
Nepatana stand am Balkengeländer der kleinen Veranda. Seine
Hände lagen auf dem Oberholz der Stützpfosten.
Pferdesoldaten ritten heran. Es mußte eine ganze Schwadron
sein. Die Fahne der Weißen flatterte im Wind. Vier Längen vor
dem Unteroffizier trabte ein herrlicher Apfelschimmel.
Nepatana verzog das Gesicht. Er kannte das Tier. Vor drei
Monden hatte der Träumer das Pferd einem Offizier verkauft,
der in Fort Grant stationiert war. Captain Hagman war ein
Draufgänger. Er vertrat die Meinung, daß die Lösung des
Apachenproblems ganz einfach war.
»Wenn deine roten Brüder nicht friedliche Ackerbauern oder
Schafzüchter werden«, hatte Hagman vor drei Monaten zu
Nepatana gesagt, »müssen wir sie eben zur Hölle befördern.
Egal wie, wir bringen sie um. Und danach herrscht Ruhe im
Südwesten.«
Nepatana hatte damals wenig gesagt, nur zugegeben, daß die
jungen Krieger wild und verrückt nach Kämpfen waren. Er
wußte, daß Victorio die Weißen haßte wie eine tödliche
Krankheit, daß auch Geronimo die Meinung vertrat, die
Hellhäutigen müßten erbarmungslos getötet und vertrieben
werden.
Und auf solche Männer hörten die Krieger. Denn sie waren
Männer des Kampfes, dazu erzogen, zu rauben, Beute zu

15
machen und zu töten. Das friedliche, ja, unwürdige Leben im
San Carlos Reservat ließ die Sehnsucht nach dem freien
Umherschweifen in der Halbwüste immer stärker werden. Nur
zu gern hörten die Krieger auf Victorio, der immer wieder den
Kampf gegen die weißen Eindringlinge schürte.
Joshua Hagman zügelte den Apfelschimmel eine Länge vor
der Veranda. Der Sergeant hatte wohl schon vorher seine
Befehle bekommen. Er ließ die Reiter einen Kreis bilden, der
das Farmhaus einschloß.
Für Sekunden verspürte Nepatana Furcht. Wollten sie seinen
Besitz überrennen, ihn in Brand setzen?
»Willkommen, Captain Hagman«, sagte der Träumer.
Der Offizier grinste, saß ab und sprang mit einem Satz auf
die Veranda.
Er schaute sich um, blickte durch die geöffnete Tür in den
Wohnraum und sagte beiläufig: »Schön hast du's hier, Mann.
Wäre doch schade, wenn das alles zum Teufel ginge.«
Hagmans Grinsen gefror, als er in die schwarzen Augen des
Pinaleno-Apachen blickte. Der Captain wußte, daß dieser
Stamm verdammt kriegerisch war und sich einen Dreck um die
Gesetze der Weißen scherte.
Für eine Sekunde empfand Hagman, eine Spur zu weit
gegangen zu sein. Aber er mußte den eingeschlagenen Weg
weitergehen.
»Du hast keine Wahl, Apache«, fuhr der Offizier fort.
»Entweder nimmst du meinen Vorschlag an, oder wir machen
hier alles dem Erdboden gleich. Die Soldaten sind hier alles
Sträflinge. Ich führe eine Strafschwadron. Jeder einzelne dieser
Kerle hat gegen das Gesetz verstoßen. Sie führen jeden Befehl
von mir aus, denn ich bin ihre einzige Chance, sich zu
bewähren. Verstehst du das Jack?«
Nepatana wußte genug von den Weißen, um begreifen zu
können. In den hellen Augen des Offiziers entdeckte er das
Versprechen, die Drohung wahrzumachen.
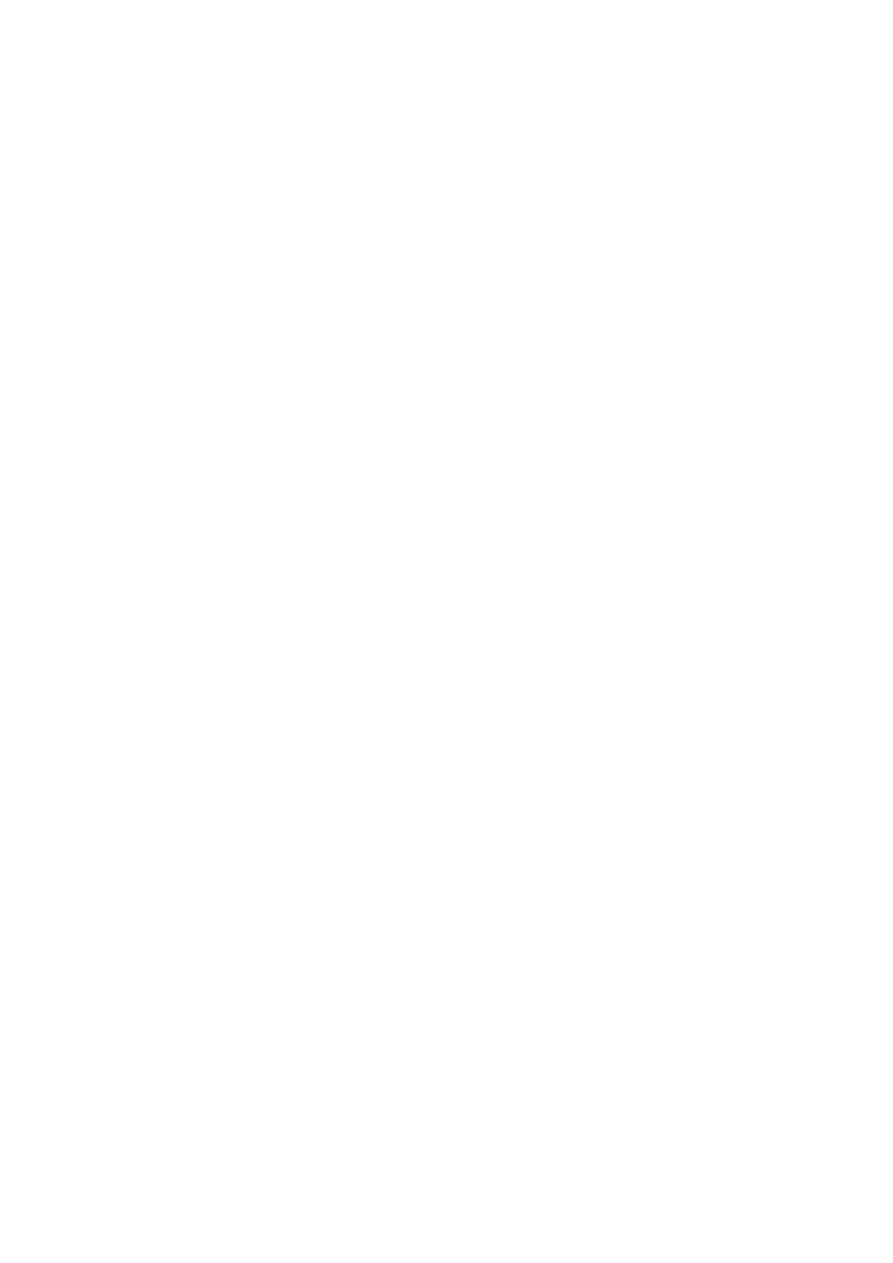
16
»Was willst du, weißer Mann?« fragte der Träumer kehlig.
»Dies ist mein Land. Es gehört mir. Und alles was hier steht,
habe ich mit meinen Händen aufgebaut. Ich befolgte die
Befehle des einarmigen Generals. Ich bin ein friedlicher
Ackerbauer.«
»Jack, du bist ein Narr«, erwiderte Hagman. »Du weißt
genau, daß kein Apache auch nur einen Fußbreit Boden
besitzen darf. Wenn es mir paßt, jage ich dich davon und setze
mich in dein Haus.«
»Mein Name ist Nepatana, nicht Jack«, antwortete der
Träumer. »Und wenn du mein Haus stiehlst, mein Land, dann
nehme ich dir deinen Skalp.«
Der Captain lachte halblaut und sagte: »Du bist also gar nicht
so friedlich, wie du dich gibst. Genau das habe ich mir gedacht.
Und Nepa-was-weiß-ich ist mir zu lang. Du heißt Jack. Und ich
will dich auch nicht von hier vertreiben oder dir Schaden
zufügen. Ich habe einiges über dich gehört, Jack, und mir so
meine Gedanken gemacht.«
Nepatana schwieg. Mit ausdruckslosem Gesicht starrte er den
Weißen an, wartete auf dessen Vorschlag.
»Du wirst Träumer genannt«, fuhr Hagman fort. »Du träumst
von Frieden zwischen den verdammten Apachen und uns
Weißen. Das ist genau das, was wir alle wollen. Aber ich
denke, wir haben den falschen Weg eingeschlagen. Wir müssen
dort anfangen, wo alles wirklich beginnt: in den Jacales. Wenn
wir die Krieger, die nicht im Reservat bleiben, erwischen, ist
das Problem bald gelöst.«
Nepatana hielt den Atem an. Seine schwarzen Augen
funkelten erregt. Dieser weiße Offizier, er war die Chance des
Träumers, seine große Vision zu verwirklichen. Denn er dachte
genau das, was auch Nepatana sich überlegt hatte, nachdem er
zum erstenmal seinen gewaltigen Traum vom friedlichen
Miteinander der roten und weißen Menschen geträumt hatte.
»Und was willst du von mir?« fragte der Träumer.

17
»Du sollst mein Scout sein«, antwortete Hagman sofort. »Du
mußt uns führen, uns zeigen, wo die Ausbrecher aus der
Reservation zu finden sind. Ich werbe dich ganz normal als
Scout an. In Wahrheit jedoch arbeitest du mit mir an dem Plan,
den Kampf zu beenden.«
Nepatana schaute zum Horizont. Sein Blick wirkte verloren,
in endlose Weiten gerichtet, die der Captain nicht wahrnehmen
konnte.
Er versuchte, seinen Traum mit dem Tod vieler Krieger in
Einklang zu bringen. Denn er wußte, daß die unruhigen,
abenteuerlustigen Kämpfer sterben würden. Sie gaben sich
niemals geschlagen, kämpften bis zum Tod.
»Ich habe mich entschieden, Captain«, sagte Nepatana nach
einiger Zeit. »Ich werde dein Scout sein. Deine und meine
Gedanken haben sich irgendwo getroffen. Unsere Gründe sind
verschieden, aber wir wollen beide den Frieden. Erzähle mir,
was du vorhast.«
Hagman zügelte seinen Triumph. Er sah alles vor sich,
wußte, daß er Erfolg haben würde, denn mit einem
zuverlässigen Apachenscout war einer Schwadron fast nichts
unmöglich.
Der Captain entwickelte Nepatana seinen Plan. Der Späher
sollte frei im Land umherstreifen, Kontakt zu den Horden
aufnehmen und anschließend Hagman berichten. Weiterhin
mußte Jack, wie ihn der Offizier einfach nannte, die Soldaten
in Hinterhalte führen.
»Wir müssen nach Apachenart kämpfen, Jack«, sagte
Hagman. »Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.«
Nepatana sah zu den Soldaten hinüber und grinste flüchtig.
Er deutete mit der Rechten auf die blinkenden Metallteile an
den Sätteln und Geschirren und sagte: »Wie sollen diese
Soldaten nach unserer Art kämpfen? Sie verratet sich schon
durch den Geruch ihrer Pferde, des Leders, ja, durch ihren
eigenen Geruch.« Der Captain winkte ab und erwiderte: »Es ist

18
deine Aufgabe, unsere Stellungen so auszuwählen, daß wir im
Vorteil sind. Eine Rotte Krieger, die auf Raubzug reitet oder
zurückkehrt, wendet doch nicht alle Listen an, benimmt sich
nicht so, als ob sie auf Beute lauert.«
»Gut, gib mir eine Medaille«, sagte Nepatana. »Wenn ich auf
Pferdesoldaten stoße, muß ich ohne Gefahr weiterreiten
können.«
Hagman fingerte aus der Tasche des Uniformrockes eine
Medaille heraus, wie sie die Apachenscouts trugen. Auf der
einen Seite war das Bildnis des Präsidenten zu sehen, und auf
der anderen standen die Worte »Indian Scout of Southwest
Territory«. Diese Medaille diente den Apachenspähern als
Ausweis gegenüber Soldaten und Zivilisten.
»Was wird aus deiner Ernte? Was machst du mit deinem
Vieh?« fragte Hagman scheinbar besorgt.
»Laß die Ernte vertrocknen«, erwiderte der Träumer. »Das
Vieh können deine Männer zum Fort treiben. Der Zahlmeister
soll mir mein Geld aufbewahren. Ich brauche es jetzt nicht. Wo
treffen wir uns, Captain?«
Hagman wollte einen ständigen Posten auf Nepatanas Farm
einrichten. Die Soldaten sollten sich selbst verpflegen und
waren nur dazu da, um Meldungen an den Captain
weiterzuleiten.
Joshua Hagman war mit sich zufrieden. Er sah sich im Geiste
bereits als strahlender Sieger, als den Mann, der den Südwesten
befriedet hatte. Das mußte doch Orden und eine Beförderung
einbringen. Immerhin war er keiner jener
Bürgerkriegsoffiziere,
die durch Tapferkeit und
Draufgängertum ihre Sterne erhalten hatten.
Nein, Joshua Hagman war Absolvent der Kriegsakademie,
war Berufssoldat. Und er fand es an der Zeit, etwas für seinen
Ruf zu tun.
*

19
Rabenführer ritt vor dem kleinen Trupp her. Er drehte sich
nicht um. Hoch aufgerichtet saß er auf der bunten
Schweißdecke seines Mustangs, war sich der großen Ehre
bewußt, die ihm Ulzana erwiesen hatte. Denn der
Unterhäuptling hatte ihn als Anführer des Spähtrupps
eingeteilt. Und das bedeutete, daß weitere große Dinge auf ihn
warteten.
Neun der tapfersten Krieger folgten dem Rabenführer. Sie
alle hatten sich in zahllosen Kämpfen und Überfällen bewährt,
kannten alle Tricks und Listen der Apachen und waren auf der
Hut.
Rabenführer verhielt sein Pferd auf einer Hügelkuppe,
blickte hinab auf das Gelände, das mit Speerdornbüschen und
kleinen Kakteen übersät war. Ein mächtiger, uralter
Joshuabaum streckte seine stachelbewehrten Zweige in alle
Richtungen aus.
Und plötzlich ritt hinter dieser Deckung ein Indianer hervor.
Im leichten Trab kam sein Pony auf die Rotte Chiricahuas
zu.
Rabenführer zügelte seinen Mustang und spähte argwöhnisch
zu dem fremden Apachen hinüber.
»Es ist der Träumer«, sagte der Chiricahua nach einigen
Sekunden. »Warum reitet er durch diese Gegend?«
Die neun Krieger rissen an den Graszügeln. In weitem
Halbkreis umgaben die Kämpfer ihren Anführer, schützten ihn.
Nepatana lächelte, als er sein Tier zwei Längen vor dem
Rabenführer zügelte.
»Was suchen die Krieger der Chiricahuas so weit im
Norden?« fragte der Scout des Captains. »Wollen Cochises
Männer freiwillig in die Verbannung der Reservation gehen?«
Rabenführer lag eine scharfe Antwort auf der Zunge. Er
beherrschte sich mühsam und dachte daran, daß Nepatana viel
mit den Bleichgesichtern zu tun hatte. Vielleicht konnte er
ihnen einen Hinweis über Victorios Einfälle geben. Denn

20
genauso, wie der Träumer das Vertrauen der Bleichgesichter
besaß, vertrauten ihm auch die Menschen der eigenen, der
roten Rasse.
»Träumer«, erwiderte Rabenführer, »wir streifen durch das
Land. Wir suchen Männer, die Krieg führen wollen.«
»Und wenn ihr sie findet?« fragte Nepatana.
»Dann berichten wir Ulzana, und er berichtet Cochise«,
erwiderte Rabenführer. »Der große Jefe will keinen Krieg mit
den Bleichgesichtern. Er sagt, daß wir mit den Weißen leben
sollen.«
Der Träumer grinste listig und fragte: »Und was wollen
Ulzanas Männer? Seid ihr Weiber oder seid ihr Krieger?«
Die neun Begleiter des Anführers murmelten aufgeregt ihre
Zustimmung. Denn keiner von ihnen wollte sich ein Weib
schimpfen lassen. Sie alle gehörten dem Bund der fünfzig
Tapfersten an. Und das bedeutete, daß sie selbst in
aussichtslosen Situationen bis zum Tode kämpften.
»Ich sehe, daß ihr Krieger seid«, sagte Nepatana
salbungsvoll. »Nun, ich verrate euch ein Geheimnis.«
Erwartungsvoll zerrten die Chiricahuas an den Zügeln, ließen
ihre Ponys näher herangehen und blickten den Träumer der
Pinaleno-Apachen auffordernd an. Er schien sich verwandelt
zu haben, war nicht mehr der friedfertige Farmer, der den
Boden bearbeitete, schien zum Kämpferischen zurückgekehrt
zu sein.
»Ein weißer Offizier kam zu mir«, begann Nepatana. »Er
nannte mich Mörder, Tier und hinterlistiger Halunke.«
Zorn, Vorwurf und gerechte Empörung schwang in der
Stimme des Träumers mit. Er schien sich im Recht zu fühlen
mit seiner Empörung.
»Und dann«, fuhr er fort, »gab er seinen weißen Halunken
den Befehl, mein festes Jacale niederzubrennen. Alle Pferde
trieben die Diebe ab, metzelten meine Rinder und Schafe
nieder, verbrannten den Mais auf den Feldern und leiteten den

21
Fluß um.«
Der Träumer atmete schwer, starrte blicklos in die
Halbwüste, als sehe er dort seine Farm, die Pflanzen, die kurz
vor der Ernte standen.
»Bei meinem Volk gelte ich als der Träumer«, sagte
Nepatana. »Ich weiß, daß mir niemand helfen wird. Ich folgte
allein der Spur der Bleichgesichter, und ich weiß, wo sie
lagern. Wir alle sind Apachen, gehören zusammen, und wenn
ein Krieger Ruhm und Ehre sucht, so kann er mir folgen. Ich
erlaube ihm, an meiner Rache teilzunehmen. Ihr seid
Chiricahuas, die besten und tapfersten Krieger unserer
Stämme. Folgt ihr mir? Helft ihr mir, meine Rache zu
vollenden?«
Zwei Sekunden war es still, totenstill, und dann brüllten die
zehn Krieger ihre Begeisterung heraus.
Rabenführer gewann als erster die Beherrschung zurück. Er
fragte halblaut: »Wo lagern die Blaubäuche, Nepatana?
Können wir sie überraschen? Wieviel Männer sind es, die wir
töten werden? Erhält jeder von uns Ruhm, Ehre und Skalps?«
»Ihr werdet kämpfen wie Apachen«, erwiderte Nepatana
würdevoll. »Mehr als hundert Blauhosen lagern am Wasser,
das den Namen Blaues Gras hat. Wenn ihr mir folgt, führe ich
euch. Einer mag mit mir reiten, um den weißen Pferdesoldaten
den Rückweg abzuschneiden. Sie sitzen in einer Falle, in einem
kleinen Tal, das nur zwei Ausgänge hat. Der Angriff von vorne
wird ihre Aufmerksamkeit erregen. Ich und einer der Krieger
greifen von hinten an, bringen Tod und Verwirrung in die
Reihen der Bleichgesichter und zerstören sie. Wer reitet mit
Nepatana, den seine Freunde den Träumer nennen, der aber
nun ein erbarmungsloser Kämpfer sein wird, denn sein Traum
wurde ihm von den Bleichhäutigen genommen und zerstört.«
Rabenführers Augen glommen in unheilvollem Feuer. Er sah
im Geiste die verkrümmten Körper der Soldaten vor sich,
zählte bereits die Skalps und die Beute. Denn hundert

22
Pferdesoldaten waren keine Gegner für elf Apachen.
Rabenführer selbst ritt mit Nepatana. Der Träumer leitete
sein Pony durch zerklüftetes, unwegsames Gelände. Endlich
verhielt er sein Tier auf einer Felsenklippe, wandte sich um
und lächelte den Chiricahua an.
»Dies ist das Ende deines Weges als Krieger«, sagte
Nepatana ruhig.
Ehe Ulzanas Kämpfer auch nur eine Bewegung der Abwehr
machen konnte, grub sich die Klinge zwischen seine Rippen.
Rabenführer verspürte einen grellen Schmerz, der alle anderen
Empfindungen auslöschte. Und plötzlich wurde es dunkel vor
seinen Augen. Er kippte vom Rücken des Mustangs. Als der
Kämpfer auf dem Boden aufschlug, war er schon tot.
Nepatana saß ab, holte seinen Dolch zurück und stand reglos
wie eine Bildsäule am Abgrund.
Unten galoppierten die übrigen neun Chiricahuas in die
Falle, die der Träumer ihnen gestellt hatte.
Die Karabiner der Soldaten peitschten scharf. Keiner der
Apachen gab auch nur einen Schuß ab. Ein Hagel aus Blei
löschte sie einfach aus.
Nepatanas Gesicht wirkte wie aus Stein gemeißelt, als er die
tapferen Krieger sterben sah. Sie alle hatten den Kampf
gesucht, die Beute, die Skalps. Und die Aufgabe des Träumers
war, die wilden Kämpfer in den Tod zu führen.
*
John Haggerty blickte zum Lager zurück. Tla-ina stand neben
dem Jacale des großen Häuptlings. Sie sah dem Mann nach,
den sie liebte.
Cochise selbst saß am Feuer. Er schaute dem Falken nicht
nach. John spürte, daß er reiten mußte. Er witterte, daß im
Norden etwas vorging, das den schwankenden Frieden
zwischen den Apachen und den Weißen gefährdete. Darum

23
verließ er die Apacheria. Cochise ließ ihn ziehen. Nichts im
Verhalten des Häuptlings wies darauf hin, daß er Haggertys
Befürchtungen teilte.
Aber als der Falke, wie er von dem Jefe genannt wurde,
zwischen den von Wind und Wetter zerfressenen Felsen
verschwand, lief ein Krieger zu den Mustangs. Kurze Zeit
später tackten die Hufe des Ponys über das Gestein. Doch
davon wußte Haggerty nichts.
Er ritt auf einsamen Wegen nach Norden, vermied sorgfältig
jeden Kontakt zu anderen Weißen oder zu Soldaten und
gelangte nach langer Zeit in das Gebiet zwischen den Pinaleno
Mountains und den Galiuro-Bergen.
Eureka Springs hieß die kleine Stadt, in der er Station
machte.
Die Ansiedlung lag am Aravaipa Creek. Von dort aus mußte
Haggerty noch etwa dreißig Meilen reiten, ehe er die San
Carlos Reservation erreichte.
Als John in der Mitte des staubigen Fahrweges ritt, überkam
ihn die Sehnsucht nach einem Bett. Er überlegte sich, daß er
ruhig übernachten konnte. Es kam nicht auf einen Tag mehr
oder weniger an.
Die ersten Häuser wirkten wenig vertrauenerweckend. Sie
standen windschief, aus Brettern erbaut, zu beiden Seiten der
Straße. Ein Stück weiter entdeckte Haggerty das Hotel. Dieses
Gebäude sah etwas besser aus. Direkt daneben stand der
einzige Saloon, der nicht mal einen Namen trug.
Zwei Dutzend Pferde waren am Hitchrack angebunden. Die
schweren McClellan-Sättel verrieten dem ehemaligen Scout,
daß es Tiere der Soldaten waren.
Eine merkwürdige Warnung schwang in John auf. Seine
Sinne signalisierten Gefahr, eine Drohung, die von diesen
Pferden ausging.
John leitete seinen Rappen an den Haltebalken und saß ab.
Steifbeinig stapfte er auf den Sidewalk, erreichte die geteilte

24
Pendeltür und stieß die Hälften zurück.
Niemand achtete auf den Fremden, der den Saloon betrat und
langsam zum Tresen ging.
Eine Menge Gäste stand an der Theke. Das Blau der
Kavallerie überwog, aber dazwischen mischte sich die
Kleidung der Zivilisten.
Haggerty sah eine Lücke und drängte sich hinein. Der dürre
Barkeeper, der einem halbverhungerten Geier glich, sah den
neuen Gast fragend an.
»Ein Bier«, bestellte John.
Es dauerte nur Sekunden, bis das Glas vor ihm stand.
Haggerty trank einen großen Schluck, wischte sich den
Schaum von den Lippen und wollte das Glas auf den Tresen
setzen, als der Soldat neben ihm plötzlich mit beiden Händen
in der Luft herumfuchtelte.
»Es war ganz einfach«, lallte der Uniformierte. »Der Kerl
lockte sie in die Falle und brachte selbst einen um. Wir hatten
prächtiges Büchsenlicht, und die roten Stinker fielen wie
Hasen.«
Die rechte Hand des Soldaten wischte Haggertys Glas zu
Boden. Es zersplitterte, und das Bier sickerte in die Ritzen
zwischen den Bodenbrettern.
Der Kavallerist stieß hörbar auf, wandte den Kopf und starrte
John unsicher an.
»Mister, ich schulde Ihnen ein Bier«, murmelte der Mann,
der sichtlich Mühe hatte, den Kopf über dem Whisky zu
behalten.
»Macht nichts, Soldat«, erwiderte Haggerty sanft. »Erzählen
Sie nur weiter. Es interessiert mich, wie Sie die roten Kerle zur
Hölle geschickt haben.«
Der Soldat grinste erfreut. Er war bereit, den Kampf noch
mal zu schildern.
»Es war 'ne Rotte Chiricahuas, wie uns der rote Scout später
sagte«, erklärte der Uniformierte. »Warum sie ausgerechnet

25
nach Norden ritten, werden wir wohl niemals herausfinden. Sie
liefen uns ins offene Messer, Mann. Und wir werden noch
mehr von diesen Kerlen zur Hölle schicken. Denn unser Scout
ist wirklich ein As.«
Haggerty verspürte die Gewißheit, daß er am Ziel war. Das
Gefühl, das ihn nach Norden getrieben hatte, die schwache
Ahnung, erhielt durch die Worte des Soldaten Bedeutung. Die
Krieger des Weißenhassers Ulzana waren tot, niedergekämpft
von einer Patrouille. Aber warum?
Die Apachen hatten nur den Auftrag, die Mimbrenjo zu
beobachten. Aus welchem Grund gerieten sie in einen Kampf
mit den Unionssoldaten?
Ehe der Uniformierte fortfahren konnte und Haggerty fragen
konnte, drängten sich zwei andere Soldaten zwischen den
Gästen am Tresen durch. Sie legten dem Betrunkenen die
Hände auf die Schultern, zogen ihn langsam, aber beharrlich
weg und führten ihn zur Tür.
Haggerty verlangte ein neues Bier und bekam es. Scheinbar
kümmerte er sich überhaupt nicht um die Uniformierten. Er
bemerkte jedoch, daß sie alle den Saloon verließen.
Die Soldaten wirkten auf John nicht wie einfache Reiter,
sondern eher wie Verschwörer, die etwas zu verbergen hatten.
Mit diesen Männern stimmte irgendwas nicht. Haggerty
spürte das deutlich. Noch wußte er nicht genug, um nach Fort
Grant reiten zu können. Sicherlich waren die Soldaten dort
stationiert. Was hatten sie vor? Welcher indianische Scout
hatte sie so geführt, daß sie die Chiricahuas in eine Falle locken
konnten?
Oder war es so, daß Ulzanas Männer einen Überfall
begangen hatten, daß sie ihre Freiheit für einen Raubzug
benutzten?
Haggerty trank sein Bier, zahlte und wollte zur Tür gehen,
als eine Frau aufschrie.
John wandte den Kopf. An einem Tisch neben der Treppe
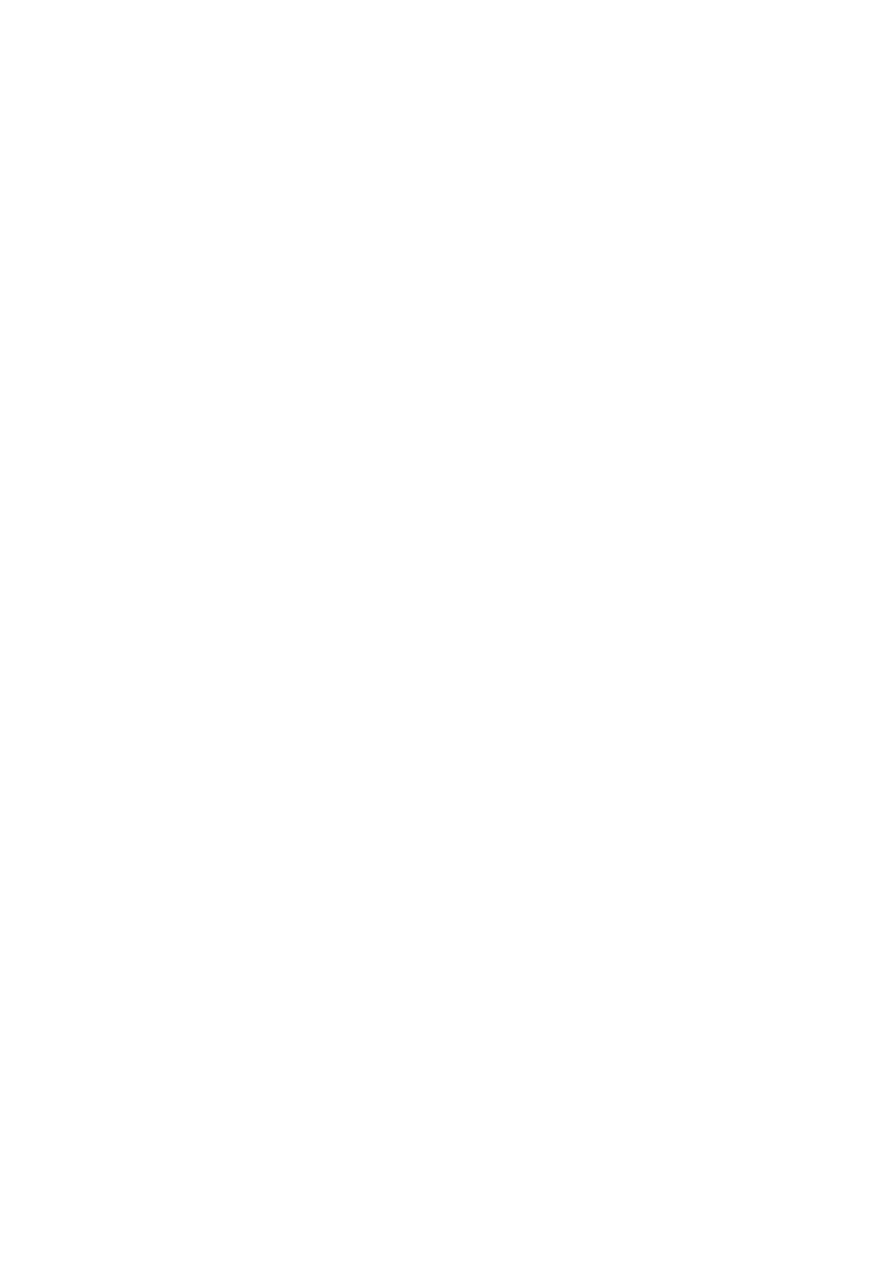
26
hielt sich eine Flitterlady beide Arme vor das Gesicht. Ein Kerl
stand auf der anderen Seite des Tisches, halb darübergebeugt,
und holte erneut aus.
Blitzschnell sah sich Haggerty um. Die Gesichter der Gäste
wirkten merkwürdig verlegen. Sie bemühten sich alle, nicht in
die Ecke an der Treppe zu starren.
John schüttelte den Kopf und marschierte hinüber. Es
klatschte laut, als der Kerl dem Mädchen die flache Hand an
den Kopf hieb.
Sie wimmerte halblaut, versuchte, unter den Tisch zu
kriechen, aber der angetrunkene Bursche riß an der Platte und
warf das Möbel einfach zur Seite.
»Du verfluchtes Miststück!« brüllte er. »Dich mache ich
fertig. Ich werde dir helfen, mir die Dollars aus der Tasche zu
angeln.«
»Ich denke, es reicht jetzt«, sagte Haggerty scharf.
Der Kerl fuhr hoch, stierte den Fremden wild an und sagte
drohend: »Was willst du, Hombre? Warum mischst du dich
ein? Oder bist du der Beschützer dieser Saloonschwalbe? Dann
kommst du mir gerade recht.«
»Mister, wenn Sie Ihre Dollars zurückhaben, sollten Sie die
Lady in Ruhe lassen«, sagte John. »Es ist doch 'ne verdammte
Schande, sich an einer Frau zu vergreifen.«
Der Angetrunkene lachte höhnisch, trat einen Schritt zurück
und brüllte: »Das ist keine Frau, Mann, das ist eine Drei-
Dollar-Hure, klar? Und sie wollte mich bestehlen. Nun
bekommt sie die Quittung dafür. Und wenn du jetzt nicht
verschwindest, mußt du deinen Colt ziehen, verstanden?«
Haggerty grinste bitter und erwiderte: »Nur zu, Mann,
versuch's doch.«
Der andere krümmte sich nach Art der zweitklassigen
Coltschwinger zusammen. Seine Rechte war nur einen halben
Inch vom Griff des Revolvers entfernt.
»Jetzt!« sagte der Kerl scharf und packte zu.

27
Als er die Waffe hochschwang, starrte er bereits in die
Mündung von Haggertys Revolver.
»Weiter, los, schieß doch«, peitschte Johns Stimme.
Aber er hatte dem anderen den Mut abgekauft. Er sackte in
sich zusammen, bewegte sich ganz langsam und vorsichtig, als
er die Waffe wieder zurücksteckte.
Unsicher ging er an Haggerty vorbei, warf der Frau noch
einen haßvollen Blick zu und stürmte auf einmal zur Pendeltür.
Wie ein Geschoß sauste er ins Freie. Die Türhälften klappten
knarrend wieder zu.
John steckte den Revolver weg und beugte sich zu der Frau
hinab. Sie starrte ihn mit einer Mischung aus Verwunderung
und Angst an, schien unsicher, konnte es nicht fassen, daß ein
anständiger Mann ihr geholfen hatte.
»Kommen Sie, Lady«, sagte Haggerty und half ihr auf.
»Wohin kann ich Sie bringen? Sie wollen doch sicher nicht
länger hierbleiben, oder?«
Das Mädchen schüttelte den Kopf. John glaubte Angst in
ihren Augen zu erkennen.
»Ich heiße Lily«, murmelte sie und stützte sich schwer auf
seinen Arm. »Ja, bring mich nach Hause, Mister. Ich wohne am
Stadtrand, im Osten. Für heute reicht's mir wahrhaftig.«
Niemand sprach ein Wort. Haggerty kam die Stille
merkwürdig, fast feindselig vor. Er schaute sich nicht um, als
er mit der Frau zur Tür ging.
Die Saloonschwalbe wirkte angespannt, verkrampft. Und sie
lockerte sich erst, als sie mehr als hundert Yards entfernt
waren. John spürte, wie sie aufatmete.
Und dann drängte sie sich eng an ihn, ließ Haggerty die
Wärme ihres Körpers fühlen.
»Ich möchte dir richtig danken«, murmelte Lily. »Du gehst
mit rein, wenn ich zu Hause bin, ja? Ich habe einen guten
Whisky. Den bekommen nur Freunde von mir, Mister. Und
danach zeige ich dir, wie dankbar ein Mädchen sein kann.«

28
John schwieg. Irgend etwas störte ihn, aber er wußte nicht,
was es war.
»Hast du etwas gegen Girls mit meinem Beruf?« fragte Lily
unsicher.
»Absolut nicht«, erwiderte Haggerty freundlich. »Also gut,
ich bringe dich nach Hause und du gibst mir einen Whisky,
Lily.«
Es dauerte nicht lange, bis sie ein flaches Holzhaus
erreichten, das unmittelbar am Stadtrand stand. Lily sperrte
auf, entzündete eine Kerosinlaterne und ließ Haggerty
eintreten.
Er sah sich um. Die Haustür führte direkt in die Küche.
Gegenüber war eine Tür zu einem weiteren Zimmer.
John setzte sich auf einen der Holzstühle am Küchentisch
und schaute Lily zu, die eine Flasche und zwei Gläser aus
einem Schrank holte. Sie schenkte ein, sie tranken, und danach
verschwand das Girl durch die andere Tür.
Haggerty konnte sich vorstellen, auf welche Weise Lily ihren
Dank abstatten wollte. Er suchte verzweifelt nach einer
Möglichkeit, dem zu entgehen. Denn er hatte keine Lust, mit
dieser Schwalbe ins Bett zu hüpfen.
*
Captain Hagman fluchte halblaut. Das Lagerfeuer warf
seltsame Schatten und Lichtzungen auf das Gesicht des
Offiziers.
»Männer, so was darf einfach nicht geschehen«, sagte
Hagman laut. »Gut, ihr sollt euren Whisky haben. Die
Menschen hier in der Gegend können auch wissen, daß wir was
gegen die verfluchten Apachen unternehmen. Aber ihr dürft
euch nicht so besaufen, daß ihr völlig Fremden etwas erzählt.«
Irgendwas an der Beschreibung des hochgewachsenen
Mannes im Saloon kam dem Captain bekannt vor. Er konnte

29
sich nur nicht erinnern, wer dieser Kerl war.
Nur gut, dachte Hagman, daß ich Sanders losgeschickt habe.
Vielleicht bringt der Bursche was heraus. Er ist ein geschickter
Mann, sobald er Zivil trägt. Als Soldat taugt er nicht viel.
Einige Zeit verging. Der Captain saß am Feuer und starrte in
die lodernden Flammen. Er hoffte, daß Jack ihm bald die
Nachricht gab. Denn die Aktionen mußten Schlag auf Schlag
erfolgen. Die roten Hunde sollten spüren, daß es für sie keine
Gnade gab.
Hagman hob den Kopf und lauschte in die Dunkelheit. Trotz
des Feuers, der knackenden Äste in der Glut, hörte er
Hufschlag.
»Halt, Parole!« rief einer der Posten.
»Mach dir nicht die Hose naß«, erwiderte ein Mann. »Ich
bin's, Sanders.«
Hagman preßte die Lippen zusammen und hätte am liebsten
geflucht. Der Kerl lernte es nie. Er war furchtbar
undiszipliniert, eine Schande für die ganze Kavallerie.
Wahrscheinlich würde er seine gesamte Dienstzeit in einer
Strafschwadron verbringen, wenn er sich nicht änderte.
Ein paar Sekunden danach schwang Sanders ein Bein übers
Sattelhorn und glitt zu Boden. Steifbeinig stiefelte er auf das
Feuer zu und legte nachlässig die Rechte an den Stetsonrand.
»Da bin ich wieder, Captain«, sagte Hugh Sanders.
»Raus mit der Sprache, was ist das für ein Kerl, der sich für
den Kampf mit den Chiricahuas interessierte?« fragte Hagman
scharf. »Ich habe Sie in Zivil mitgeschickt, damit Sie
beobachten. Berichten Sie, Sanders.«
»Sieht nicht gut aus«, antwortete der Mann.
Hagman holte tief Luft und hielt den Atem an.
»Der Kerl ist jetzt bei Lily«, fuhr Hugh fort. »Ich habe mit
ihr 'ne Show abgezogen, sie geschlagen, und prompt griff der
Fremde ein. Ich ließ mich beim Ziehen schlagen, und er
marschierte mit Lily davon. Sie weiß, was sie zu tun hat. In

30
einer Stunde oder so können wir den Burschen bei ihr
abholen.«
Pfeifend atmete Hagman aus und fragte gepreßt: »Warum
direkt mit harten Mitteln, Sanders? Sie vergessen wohl, daß wir
uns auf mächtig unsicherem Boden bewegen. Ein Fehler, und
wir alle sind erledigt.«
Hugh lachte hart und erwiderte: »Und wenn's gutgeht, wird
uns allen die Strafe erlassen, und Sie bekommen die Streifen
eines Majors, Cap. Nun, ich will Ihnen sagen, warum wir
diesen Burschen aus dem Verkehr ziehen müssen. Ich habe ihn
schon mal gesehen. Früher war ich in Fort Buchanan. Er kennt
mich nicht, aber ich weiß, wer er ist.«
Sanders schwieg, und Hagman hätte dem Kerl am liebsten
ein brennendes Holzscheit über den Kopf gezogen.
»Das ist der ehemalige Chiefscout John Haggerty«, sagte
Hugh gelassen. Es dauerte eine Weile, ehe Captain Joshua
Hagman wie ein Maultiertreiber fluchte.
»Ausgerechnet Haggerty«, stieß er hervor, »dieser verfluchte
Apachenfreund. Was hat er hier zu suchen? Soll er doch mit
seinem Cochise in eine Hütte kriechen. Sollen sie sich
gegenseitig versichern, daß sie alle nette und friedliche
Menschen sind und nicht an Krieg denken. Dieser verdammte
Hurensohn!«
Hugh hatte den Flüchen interessiert gelauscht. Der Captain
schien ein Experte auf diesem Gebiet zu sein, denn ungefähr
ein halbes Dutzend Ausdrücke waren Sanders neu.
»Was fangen wir mit Haggerty an, Sir?« wollte er wissen.
»Lily wird ihn nicht die ganze Nacht bei sich haben wollen. Sie
muß Geld verdienen.«
»Bringt ihn her!« befahl Hagman langsam. »Er darf nicht
merken, wo er ist. Ich denke mir was aus, wo wir ihn sicher
unterbringen können.«
Sanders nickte, drehte sich um und hatte eine Idee.
»Captain«, sagte er gedehnt, »was ist mit unserem Scout?

31
Der kennt die Gegend doch wie seine Westentasche. Soll er
doch diesen Apachenfreund umlegen oder verstecken.«
Joshua Hagman starrte den Soldaten in Zivil an und rief:
»Bei Gott, Mann, das ist die richtige Idee. Ja, Jack soll ihn
wegschaffen. Wir wissen von nichts, kennen das Versteck
nicht, in dem er liegt. Aber töten soll er ihn nicht. Das bringt
uns General Howard in den Nacken. Ich habe den Eindruck,
daß Haggerty noch immer mit Einarm in Verbindung steht,
obwohl er seinen Abschied als Chiefscout nahm. Los, holt ihn
her, sorgt dafür, daß er bewußtlos ist. Ich muß versuchen, mit
Jack Verbindung aufzunehmen.«
Sanders marschierte davon, suchte sich zwei Soldaten aus,
die murrend ihre Pferde sattelten und Hugh folgten.
Die Strecke nach Eureka Springs konnten sie in einer halben
Stunde zurücklegen.
*
John verspürte einen seltsamen Geschmack im Mund.
Mißtrauisch starrte er die Whiskyflasche an. Nein, dachte er,
das ist nicht möglich. Lily hat ebenfalls getrunken.
Die Tür des anderen Zimmers öffnete sich. Das Mädchen trat
einen Schritt vor. Es war nackt. Die weiße Haut glänzte im
Schein der Kerosinlampe verlockend.
»Komm, mein Freund«, sagte Lily lockend. »Ich zeige dir,
wie dankbar ich bin.«
Sie streckte beide Arme aus, stand kerzengerade vor
Haggerty und ließ ihn alles sehen, was er nur sehen wollte.
Zögernd stand er auf. Er schien Lily nicht entkommen zu
können. Verdammt, warum war er nach dem Whisky nicht
einfach verschwunden?
»Bring die Flasche mit«, sagte das Girl.
John tastete nach dem Whisky, den Gläsern, und für einen
Moment verschwamm der Tisch vor seinen Augen. Die

32
Kerosinlaterne schien zwei Flammen zu haben.
Was ist mit mir? dachte John überrascht. Irgendwas stimmt
nicht, paßt nicht zusammen. Ist der Schnaps doch vergiftet?
Lily schritt mit wiegenden Hüften auf den Tisch zu, lachte
auffordernd und sagte: »Bist du überrascht, Mister? Wann hast
du zum letztenmal eine Frau gehabt? Es gibt nur wenige in
diesem Land, nicht wahr?«
Sie nahm die beiden Gläser, als Haggerty endlich den
Flaschenhals erwischt hatte. Lily ging in das dunkle Zimmer
zurück. John starrte ihr nach. Das Weiß der Haut schimmerte
schwach, beleuchtet durch die Lichtfinger der Kerosinlampe.
Zwei Gläser klirrten leise, und eine Sekunde darauf
raschelten Decken.
»Komm, ich warte auf dich«, sagte Lily halblaut. »Bring den
Whisky mit.«
Abermals verschwamm die Einrichtung der Küche vor Johns
Augen. Die Tür ins Schlafzimmer verschob sich, glitt
auseinander und wirkte gewölbt wie ein riesiger Schild.
Unsicher tappte Haggerty in den Nebenraum, stieß mit den
Knien gegen das Bett und verlor das Gleichgewicht. Er landete
auf Lilys festem, geschmeidigem Leib.
»Langsam, mein Freund«, sagte das Girl lachend. »Zuerst
will ich noch einen Schluck trinken. Gib mir die Flasche.«
Sie tastete nach dem Whisky, drehte sich unter John weg und
hob die beiden Gläser vom Boden auf.
Haggerty hatte das Gefühl, das Bett wollte ihn umklammern.
Plötzlich rutschte es zur Seite, schien den Mann abzuschütteln,
und John krallte sich in den Decken fest. Endlich wurde die
Welt wieder normal. Er richtete sich auf, setzte sich und nahm
das Glas, das Lily ihm reichte.
»Trink, es tut dir gut«, murmelte das Mädchen. »Du hättest
vorhin beinahe einen Mann erschossen. Ich weiß, daß dir deine
Nerven nun einen Streich spielen. Das geht jedem so, wenn er
nicht gerade ein abgebrühter Killer ist. Trink das, Mann, und

33
gleich geht's dir besser.«
Unsinn, wollte John rufen, das ist Quatsch. Aber er brachte
keinen Laut heraus. Zum Teufel, dachte er, ich trinke den
Whisky, und danach schlafe ich ein. So komme ich wenigstens
um dieses Abenteuer herum.
Er leerte das Glas mit einem Schluck. Ein merkwürdiger
Nachgeschmack blieb in seinem Mund zurück, ein Aroma, das
er nicht kannte.
Er spürte, daß er schwächer wurde. Alle seine Glieder
fühlten sich schwer wie Blei an. Und in seinem Kopf tobte ein
Wirbelsturm, der alle Gedanken durcheinanderfetzte, die
Bruchstücke zu sinnlosen Ketten zusammenfügte.
Er spürte Lilys Hände an seiner Kleidung. Sie durchsuchte
ihn gründlich.
Das also ist ihr Trick, dachte Haggerty in den letzten
Sekunden seines klaren Bewußtseins. Sie hat die Gläser mit
einem Mittel präpariert und raubt ihre Opfer aus.
Und dann versank er in tiefe Bewußtlosigkeit.
Lily zerrte Papiere hervor und ging in die Küche. Im Schein
der Lampe las sie und holte tief Luft.
»Hoffentlich gibt das keinen gewaltigen Ärger«, murmelte
das Girl. »Der Bursche ist John Haggerty und reitet im Auftrag
von General Howard durch das Land.«
Lily überlegte sich, was Hugh wohl mit dem bewußtlosen
Mann vorhatte. Sie wußte genug über die Schwadron des
Captain Hagman, hatte genug erfahren, aber sie war zu klug,
um darüber zu sprechen. Die Männer dieser Strafabteilung
brauchten Erfolge, um wieder normale Soldaten zu werden.
Darum gingen sie hart und grausam gegen alle Apachen vor,
die sie erwischten.
Wenn dieser Haggerty jedoch im Auftrag des Kommandeurs
durch den Südwesten trailte, wirbelte sein Tod gewaltigen
Staub auf. Und dann kam Cochise mit seinen wilden
Chiricahuas über die Weißen. Denn Haggerty war ein guter
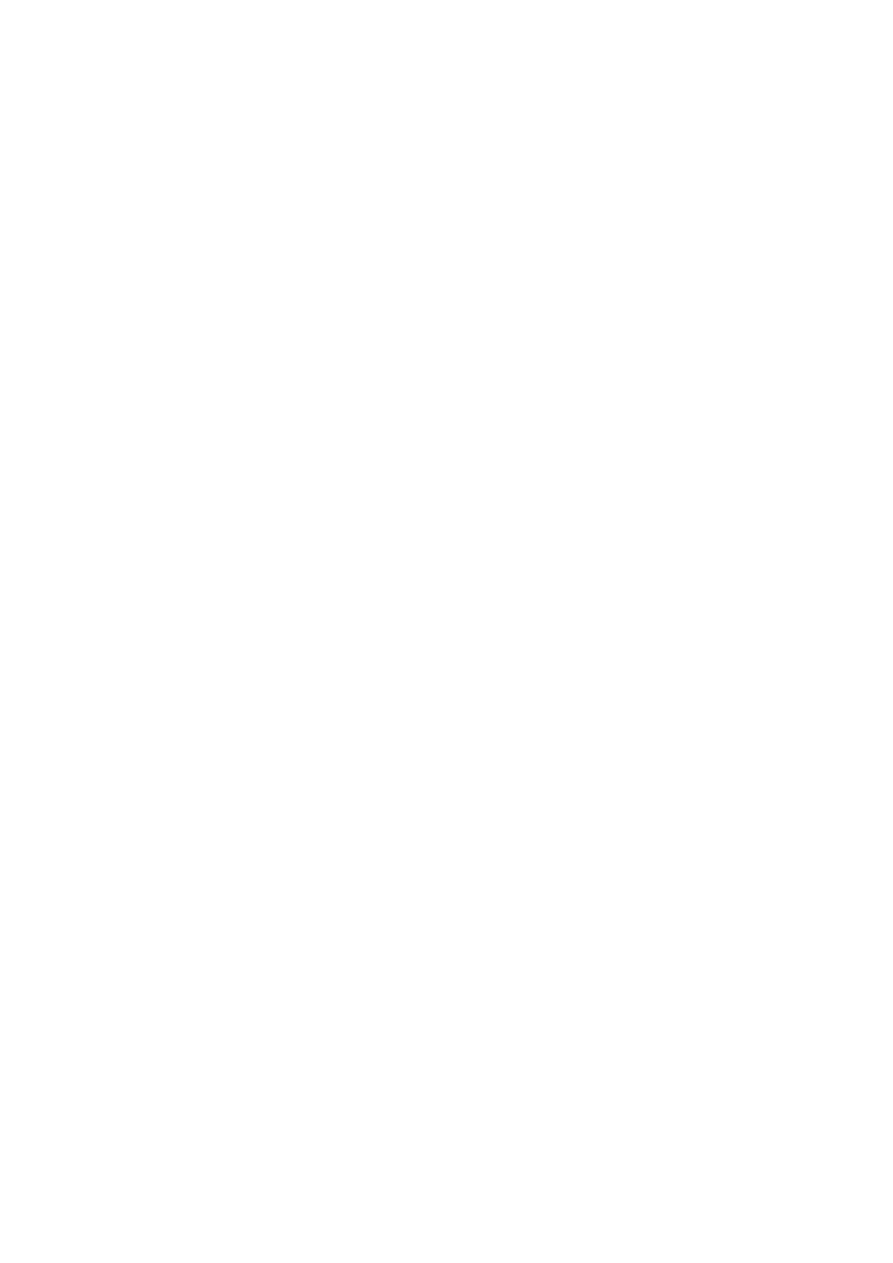
34
Freund des Chiefs. Und diesen Horden hatte Captain Hagman
nichts entgegenzusetzen.
Ein paar Minuten starrte die junge Frau die Papiere an und
überlegte. Fand Sanders diese Unterlagen, mußte er Haggerty
töten. Denn der Scout würde alles daransetzen, Hagmans Pläne
zu vereiteln.
»Ich verstecke die Sachen«, murmelte Lily.
Sie schob John nur die Entlassungsurkunde der Kavallerie in
die Tasche zurück und hoffte, daß die Soldaten den Mann nicht
sofort umbrachten. Die übrigen Papiere schob sie hinter den
einfachen Küchenschrank.
Hufschläge klangen draußen auf. Lily lauschte und
unterschied drei Pferde. Sekunden später klopfte es an der Tür.
»Ich bin's, Hugh«, rief der Mann draußen. »Bist du fertig?
Hast du Haggerty unter Laudanum gesetzt?«
Das Girl öffnete die Tür und trat zur Seite. Sanders kam
herein, gefolgt von zwei Soldaten, die Lily grinsend musterten.
Sie kannte beide gut genug, um keine Scheu zu haben. Sie
hatten schon manchen Dollar bei ihr gelassen.
»Auf dem Bett«, sagte sie, »er ist vollkommen hinüber. Ich
habe ihm eine Portion verabreicht, die sogar einen Bison in
Schlaf versetzt hätte. Vor morgen nachmittag wacht er nicht
auf.«
»Gut gemacht«, erwiderte Sanders grinsend. »Was hat er in
den Taschen?«
»Nur die Entlassungsurkunde der Army«, antwortete das
Girl. »Dazu den üblichen Kram, den ihr Männer immer
mitschleppt.«
»Keine anderen Papiere?« fragte Hugh verwundert. »Na, soll
sich der Captain darüber den Kopf zerbrechen.«
Er wandte sich den beiden Soldaten zu und sagte: »Los,
nehmt ihn mit. Ich komme gleich nach. Reitet nicht zu schnell,
damit ich euch einhole.«
Grinsend stiefelten die Uniformierten ins Schlafzimmer,

35
hoben den bewußtlosen Haggerty an Armen und Füßen hoch
und trugen ihn hinaus.
»Einen Whisky?« fragte Lily und winkte Sanders zum Bett.
»Sicher, aber nicht von der gefährlichen Sorte«, antwortete
der Mann lachend.
»Du Narr«, sagte Lily, »doch nicht für dich.«
Wenig später verließ auch Hugh Sanders das kleine Haus.
Lily lag auf dem Bett und dachte nach. Sie verspürte
Unbehagen, ja, beinahe Angst. Aber nun war es zu spät. Sie
konnte nur abwarten und hoffen, daß Hagman den Scout nicht
töten ließ.
Aber der dachte gar nicht daran.
Er hatte außerhalb des Camps drei kleine Feuer entzündet,
deren Glutaugen durch die Nacht leuchteten. Dies war das
Zeichen, mit dem er den Pinaleno-Apachen herbeirufen konnte.
Erst drei Stunden vor dem Morgengrauen glitt Nepatana wie
ein Schatten an den Posten vorbei und hockte sich vor das Zelt
des Offiziers.
»Ich bin hier, Captain«, sagte der Indianer ruhig.
Hagman hatte einen leichten Schlaf. Er fuhr sofort hoch und
huschte ins Freie.
»Verdammt, schlafen die Posten?« fragte er ärgerlich.
Nepatana lächelte und erwiderte: »Sie sind keine Apachen,
Pferdesoldaten. Wie könnten sie mich hören? Was willst du?
Ich war auf dem Weg zu Victorios Männern, als ich dein
Zeichen sah.«
Hagman sagte: »Ich habe John Haggerty gefangen, Jack.«
»Den Falken!« stieß Nepatana hervor. »Er ist Cochises
Freund. Es gibt Krieg, wenn der Falke stirbt, Captain. Was hast
du vor?«
»Du bringst Haggerty weg, in Sicherheit«, antwortete
Hagman. »Er soll nicht sterben, wenigstens noch nicht. Du
mußt ihn sicher unterbringen, Jack. Er darf auf keinen Fall
entkommen, denn er ahnt irgendwas. Wenn uns Cochise in die

36
Quere kommt, müssen wir aufgeben. Unser Plan ist dann zum
Scheitern verurteilt.«
Nepatana dachte lange nach. Ihm war es nicht recht, daß der
Falke aufgetaucht war. Er gehörte zu den wenigen Weißen, die
fast so gut wie ein erfahrener Apachenkrieger waren. Zudem
kämpfte er gemeinsam mit dem großen Jefe für den Frieden,
verfolgte also das Ziel, das auch Nepatana sich gesetzt hatte.
Allerdings hatten Cochise und der Falke nicht gut genug
nachgedacht – so glaubte Nepatana. Denn er war davon
überzeugt, daß nur er den richtigen Weg eingeschlagen hatte.
Die aufsässigen Krieger, denen das Blut vor Kampfeslust heiß
durch die Adern jagte, mußten vernichtet werden. Das war die
einzige Lösung.
»Gut, ich nehme ihn mit«, sagte der Pinaleno. »Wo ist sein
Pferd?«
Hagman starrte den mittelgroßen Apachen an und fluchte.
»Nicht hier«, fuhr Nepatana fort, »auch gut. Wo endet seine
Spur?«
»In der Stadt, in Eureka Springs«, erwiderte Hagman. »Dort
steht auch Haggertys Gaul. Die Fährte in der Stadt ist tot, Jack.
Mach dir keine Sorgen. Wohin bringst du diesen Spinner?«
Nepatana lächelte geheimnisvoll und erwiderte: »An einen
Ort, von dem selbst der Falke nicht entkommen wird. Er müßte
schon Flügel besitzen wie das Tier, dem er seinen Narnen
verdankt.«
»Wo ist das?« drängte Hagman. »Vielleicht brauchen wir
den Kerl mal und ich muß ihn holen lassen.«
»Nein«, sagte Nepatana entschieden, »dieser Ort bleibt mein
Geheimnis. Wenn du den Falken brauchst, so mußt du mich
holen, Captain Hagman. Ich sage dir nur so viel: es ist im
Berggipfel der Felsen, in denen meine Heimat liegt.«
Hagman gab auf. Er spürte, daß er nicht mehr aus dem
Apachen herausholen würde.
Nepatana lud Haggerty vor sich auf den Rücken des

37
Mustangs und ritt in die Nacht.
Erleichtert blickte der Offizier seinem Scout nach. Eine
große Gefahr war beseitigt. Hoffentlich kam Cochise nicht auf
den Gedanken, nach Haggerty zu suchen. Dann schwärmten
die Krieger der Chiricahuas aus und drehten jeden Stein um.
*
Niemand sah ihn, kein Mensch hörte ihn. Lautlos wie eine
Schlange war der Krieger nahe genug gekrochen, um die Worte
Nepatanas und die des Weißen hören zu können.
Wolfsbruder verharrte regungslos, als der Träumer mit seiner
Last davonritt. Besorgt dachte der Chiricahua über das
Versteck nach, von dem Nepatana gesprochen hatte. Wenn
dem Falken etwas zustieß, würde Cochise unberechenbar sein.
Aber Wolfsbruder durfte dem Träumer nicht folgen. Denn er
ritt in das Land seines Stammes. Und dort war ein einzelner
Chiricahua verloren. Zudem überlegte sich der Späher, daß der
Häuptling selbst diese Sache sicher aufklären wollte.
Wolfsbruder wußte nur, daß schlimme Dinge vorgingen.
Nepatana arbeitete mit den Pferdesoldaten zusammen, gab sich
als Scout her. Das mußte der große Chief erfahren. Nichts,
außer dem Leben des Falken vielleicht, war wichtiger. Und
dessen Leben war nicht gefährdet, wenigstens vorerst nicht.
Alles im Camp der Soldaten blieb ruhig. Der Offizier kroch
wieder in sein Zelt. Einige Minuten später verrieten
gleichmäßige Atemzüge, daß der Weiße eingeschlafen war.
Wolfsbruder zog sich zurück. Geschickt kroch er über den
Boden, verursachte kein Geräusch und glitt so dicht an einem
Posten vorbei, daß er ihn hätte berühren können, wenn er
gewollt hätte.
Dem Chiricahua stand nicht der Sinn nach einem Skalp,
obwohl er eigentlich gerne sein Jacale mit den Haaren eines
Bleichgesichtes geschmückt hätte.

38
Wichtiger war nun, daß er nach Süden ritt. Sein Mustang
mußte so schnell sein, wie ein Pfeil flog. Denn niemand konnte
voraussagen, wie lange der Falke am Leben blieb!
Der Chiricahua erreichte sein Pony, sprang auf und preßte
dem zähen Tier die Hacken in die Flanken. Das Pferd hetzte
los. Unermüdlich stampften seine Hufe über Wege, die jedem
Weißen zu gefährlich gewesen wären. Aber diese Trails führten
direkt nach Süden, vermieden die guten Fahrstraßen der
Bleichgesichter und lagen immer in Deckung.
Als im Osten die Sonne über den Horizont kletterte, erreichte
der Späher eine Wasserstelle der Apachen. Zuerst ließ er sein
Tier saufen, bevor er selbst vier Schlucke Wasser nahm.
Danach hetzte das Pony weiter. Noch immer ging sein Atem
ruhig und gleichmäßig. Es gehorchte willig dem Druck der
Schenkel seines Reiters und zeigte keine
Ermüdungserscheinungen. Die Mustangs der Apachen waren
genauso zäh, wie die Krieger selbst.
Wolfsbruder sah in der Ferne die zerklüfteten Felsen der
Dragoon Mountains. Er wußte, daß ihn die Späher schon
gesehen hatten und war sicher, daß Cochise bereits über seine
Rückkehr informiert wurde.
Der Krieger trieb sein Pony noch einmal an. Geschickt
kletterte es über Pfade, die nach Meinung der Weißen gerade
für Bergziegen ausreichten.
»Der Jefe erwartet dich, Bruder«, sagte ein Wächter zu
Wolfsbruder, als sein Mustang ein ebenes Gelände erreichte.
Wie ein Schemen verschwand der Posten wieder im Schatten
einiger Gesteinssäulen, die wie Finger aufragten. Von einer
Felskanzel aus vermochte der Wächter weit in die Halbwüste
zu blicken. Kein Gegner konnte sich unerkannt
heranschleichen, selbst kein Apachenkrieger. Denn die Männer
der Chiricahuas kannten alle Tricks und Listen, waren
tausendfach im Kampf bewährt und wußten die Zeichen der
Natur zu deuten.

39
Wolfsbruder ritt weiter, achtete nicht auf die Umgebung.
Hier war er sicher vor jeglichen Feinden, denn die
Apachenfestung in den Dragoon Mountains war gut geschützt.
Der Späher erreichte das Grasland. Er roch den Rauch der
Kochfeuer. Die Squaws bereiteten ein köstliches Mahl, stellte
Wolfsbruder fest. Er witterte Maultierfleisch, und das gehörte
zu den Delikatessen.
Noch einmal trieb der Späher seinen Mustang an. Er sollte
schnell zu Cochises Jacale gelangen, damit sein Reiter noch
etwas von diesem wundervollen Essen bekam.
Der Jefe hockte mit untergeschlagenen Beinen vor dem
Eingang seines Wicky-ups. Tla-ina, seine Schwester, briet
Fleisch an einem Spieß aus Hartholz über den Flammen.
Wolfsbruder saß ab, grüßte den Chief und setzte sich auf die
andere Seite des Feuers.
»Sprich, Krieger«, sagte Cochise sanft. »Berichte, was du
über den Falken zu erzählen hast. Ich weiß, daß schlechte
Dinge aus deinem Mund kommen werden, aber es ist nicht
deine Schuld, Wolfsbruder.«
Der Späher holte tief Luft und sagte: »Der Falke ist
gefangen, Jefe. Nepatana, der Träumer der Pinalenos, bringt
ihn in ein Versteck. Nepatana scheint gemeinsame Sache mit
den Bleichgesichtern zu machen. Eine Gruppe Pferdesoldaten,
es sind zwölf mal zehn Finger, lauert im Norden vor der San
Carlos Reservation. Der Anführer ist ein Captain. Mehr weiß
ich nicht, Chief. Von Ulzanas Kriegern habe ich nichts gesehen
und nichts gehört. Aber ich glaube, ihre Seelen sind von Bù ins
Reich des Todes gebracht worden. Der Falke ritt in eine Stadt,
blieb eine Weile in einem Jacale aus Holz und kam mit einer
weißen Squaw heraus. Danach folgte er ihr in ihr Jacale. Es
dauerte eine Weile, bis Pferdesoldaten kamen und den Falken
wegschleppten. Sein Geist war nicht auf dieser Welt. Die
Blauhosen brachten ihn in das Lager der Soldaten. Dort holte
ihn der Pinaleno und versprach, ihn sicher zu verstecken. Der

40
Ort liegt in den Heimatbergen des Stammes, am höchsten
Gipfel. Mehr kann ich dir nicht sagen, Jefe.«
Cochise entließ den Späher mit einer Handbewegung und
blickte seine Schwester an. Tla-ina, der sanfte Wind, vergaß
den Bratspieß zu drehen. Es roch nach verbranntem
Mulifleisch. Das Gesicht der schönen Apachin war eine Maske
der Furcht.
»Meine Schwester«, sagte Cochise lächelnd, »willst du, daß
ich hungrig dem Falken folge und ihn befreie?«
Erschrocken sog die Squaw die Luft ein, roch das verbrannte
Fleisch und schnitt schnell mit ihrem Messer die verkohlten
Stücke ab.
Gleichmäßig drehte sie den Bratspieß. Sie sah Naiche an,
ihren Neffen, der hinter der Hütte hervortrat und ein düsteres
Gesicht zog.
»Mein Vater«, sagte Cochises Sohn bedrückt, »ich sehe, daß
du reiten wirst. Dein Leben setzt du für den Falken ein. Was
ist, wenn du in das Totenreich eingehst? Was wird aus unserem
Stamm, aus dem Frieden?«
Lächelnd erwiderte der große Häuptling: »Naiche, mein
Sohn, du wirst die Chiricahuas führen. Sei unbesorgt, noch
habe ich Bus Ruf nicht vernommen. Der Falke ist mein Bruder.
Du weißt es. Und du weißt auch, daß es meine Pflicht ist,
meinem Bruder zu helfen. Ich reite, wenn ich gegessen habe.«
Tla-ina nahm den Hartholzspieß vom Feuer und stach die
Klinge ihres Messers prüfend ins Fleisch. Es war gar.
Nahlekadeya, Cochises zweite Frau, brachte aus dem Jacale
eine große Holzschale voller Wildgemüse. Schweigend setzten
sich der Jefe, sein Sohn Naiche, der zweite Sohn Nachise, der
zu dieser Zeit noch keine zehn Winter zählte, und Tla-ina und
Nahlekadeya vor das Jacale und aßen.
Sanfter Wind war zuerst fertig. Tla-ina sah auf, blickte in die
dunklen Augen ihres Bruders und sagte halblaut: »Ich reite mit
dir. Mein Herz ist schwer, denn der Falke ist in Gefahr. Ein

41
Krieger unseres Volkes bringt ihn in ein Versteck. Und das
bedeutet, daß der Falke dem Tod gegenübersteht, sollte dieser
Krieger zurückkehren.«
Cochises Gesicht blieb unbewegt, als er antwortete: »So sei
es, Schwester. Ich weiß, daß du wie ein Tiger kämpfst, wenn es
nötig ist. Und ich weiß, daß du eine echte Tochter unseres
Stammes bist.«
Naiche wollte etwas einwenden, aber ein Blick seines Vaters
ließ ihn schweigen. Der athletische Sohn des Jefe befolgte auch
die unausgesprochenen Befehle seines Vaters.
Er stand auf und ging zu den Pferden. Tla-ina und
Nahlekadeya richteten Proviant her. Cochise überprüfte seine
Waffen und sah zu, wie seine Schwester einen Dolch und einen
Revolver nahm und Ersatzpatronen einpackte.
Naiche führte den Pinto des Chiefs am Graszügel heran.
Daneben schritt eine prachtvolle Fuchsstute, die für Tla-ina
war.
Ernst sahen Cochises Frau und seine beiden Söhne zu, wie
der Häuptling der Chiricahuas und seine Schwester
davonritten. Sie wollten nach Norden, dem Falken helfen,
jenem Weißen, den der Häuptling Bruder nannte, und den seine
Schwester liebte.
*
Haggerty wußte nicht, wo er war. Er schlug die Augen auf, sah
aber nichts. Obwohl er bis in sein Innerstes erschrak, blieben
seine Gefühle gedämpft.
War er blind geworden? Was war geschehen? Er erinnerte
sich nur an die nackte Lily, an das Glas Whisky, das er auf
ihrem Bett getrunken hatte. Und danach war es dunkel um ihn
geworden.
Ein dumpfer Schmerz umklammerte seinen Kopf. Behutsam
tastete John sein Gesicht ab. Es fühlte sich kalt und fremd an,

42
als ob es einer steinernen Figur gehörte und nicht ihm selbst.
Langsam schloß Haggerty die Augen wieder, versank in
einen Dämmerschlaf, den er sich nicht erklären konnte.
Als er abermals erwachte, ging es ihm etwas besser. Er
spürte die Wärme der Sonne, den hellen Schein und atmete
kräftig durch. Der dumpfe Druck in seinem Kopf war einem
stechenden Schmerz gewichen. Übelkeit quoll vom Magen her
auf, ließ Haggerty würgen. Er schluckte krampfhaft, um dieses
widerwärtige Gefühl zu unterdrücken. Als er den Brechreiz
überwunden hatte, verspürte er gewaltigen Hunger.
Zuerst muß ich herausfinden, was geschehen ist, wo ich bin,
dachte John und schlug erneut die Augen auf.
Er atmete auf. Mit seinen Augen war nichts geschehen. Als
er zum erstenmal erwachte, war Nacht gewesen. Dazu lag er in
einem Talkessel, dessen Grund tief zwischen Felsen eingebettet
war. Die Wände ragten so hoch empor, daß nur für wenige
Stunden die Sonne herabschien.
»Zum Teufel, ich weiß überhaupt nichts«, sagte Haggerty
halblaut und wunderte sich über seine rauhe Stimme.
Hatte er die ganze Flasche Whisky bei Lily ausgetrunken?
Nein, das war unmöglich. Auf jeden Fall endete seine
Erinnerung im Schlafzimmer der Saloonschwalbe, die er vor
einem zudringlichen Kerl bewahrt hatte. Oder war das alles
gespielt gewesen?
Ein ungeheurer Gedanke stieg in Haggerty auf.
Wenn dieses alles eine abgekarterte Sache war? Wenn Lily
gar nicht in Gefahr geraten war, wenn sie und dieser andere
Kerl das nur gespielt hatten?
Aber warum?
Dumpf ahnte John, daß alles irgendwie zusammenhing. Er
brachte es nur nicht fertig, die Teile des Ganzen
zusammenzusetzen. Dazu wußte er zu wenig.
»Zuerst muß ich was gegen meinen knurrenden Magen
unternehmen«, murmelte Haggerty.

43
Er stand auf, musterte seine Umgebung, und entdeckte zwei
Dutzend Yard entfernt einen handbreiten Wasserlauf, der aus
einem Loch in den Felsen rann und nach einigen Yards im
Boden versickerte.
Dicht neben dem schmalen Bach lag ein Proviantpacken.
Eine bunte Decke war mit einigen rohledernen Riemen
verschnürt. Und zwischen diesen Riemen steckte ein Messer,
dessen Klinge im Sonnenlicht aufblinkte.
John lachte grimmig auf. Er sollte weder verhungern, noch
verdursten. Aber er war ein Gefangener. Ehe er sich
daranmachte, diesem Talkessel zu entfliehen, mußte er essen
und trinken.
Sorgfältig knotete er die Riemen auf, denn er wußte nicht, ob
er die zähen Lederseile noch gebrauchen konnte. Die Decke
fiel herab. Trockenfleisch und eine Art Pemmikan waren in der
Umhüllung, weiter nichts. Die Menge reichte für mindestens
zwei Wochen, sogar für drei, wenn er sparsam aß.
Nachdenklich schnitt Haggerty ein Stück von der
Fleischpastete ab. Sie enthielt Kräuter, Beeren, getrocknete
Fleischfasern und Tierfett und schmeckte wunderbar.
John kaute langsam. Er wollte seinem hüpfenden Magen
nicht zuviel zumuten. Aber nachdem er dreimal geschluckt
hatte, spürte er wohlige Erleichterung.
Einige Zeit später packte er die Vorräte wieder sorgfältig in
die Decke. Nur der Teufel wußte, wie lange er hier aushalten
mußte. Er ging zu dem schmalen Bachlauf, legte sich auf den
Bauch und trank. Das eiskalte Wasser vertrieb den letzten Rest
Nebel aus seinem Kopf.
So, dachte Haggerty, nun will ich mir mal mein Gefängnis
ansehen. Es müßte doch mit dem Satan zugehen, wenn ich
nicht rauskomme.
Nun, es ging mit dem Satan zu. Nur, daß der Satan in diesem
Fall aus einem halben Dutzend armdicker Klapperschlangen
bestand.

44
John entdeckte eine Art Leiter in der nördlichen Felswand.
Löcher in regelmäßigen Abständen boten sich geradezu an,
dort hinaufzuklettern. Aber er war mißtrauisch. Er suchte sich
ein paar lange Zweige und stocherte in diesen Öffnungen. Die
ersten vier waren in Ordnung. Aber schon in dem fünften Loch
klang plötzlich das scharfe Rasseln von Hornklappern auf.
Ein handgroßer Kopf schnellte aus dem Loch. Die gespaltene
Zunge zuckte blitzschnell hin und her.
Obwohl sich das Reptil nur zu einem Drittel seiner
Körperlänge aus dem Loch gleiten lassen konnte, wich John
zurück. Verlor die Schlange den Halt, rutschte sie herab, so
besaß Haggerty nur das Messer, um sich gegen den giftigen
Wurm zu verteidigen.
Das Halfter war leer, und nirgendwo entdeckte er seine
Winchester.
Es dauerte Minuten, ehe sich das gereizte Tier wieder
zurückzog.
Nachdenklich betrachtete John den Zweig, entdeckte das
grüngelblich schillernde Gift vorne am Holz und unterdrückte
ein Schaudern.
Vielleicht gelang es ihm, überlegte sich Haggerty, dieses
Loch zu vermeiden, wenn er hinaufkletterte. Vorsichtig hob er
den Ast und stieß ihn in die sechste Öffnung, die wesentlich
größer war.
Er hatte den Urgroßvater aller Klapperschlangen
aufgescheucht!
Das Biest war dicker als Johns gespannter Bizeps. Ein solch
mächtiges Vieh hatte der erfahrene Westmann in seinem
ganzen Leben bisher noch nicht gesehen. Die Giftzähne
stachen aus dem weit geöffneten Maul hervor. Die Schlange
machte sich gar nicht erst die Mühe, die Zunge vorzuschnellen.
Für sie war alles, was in die Höhlung eindrang, ein Feind.
»Das war es also!« dachte Haggerty laut. »Diese einladende
Leiter ist für Idioten gedacht. Aber die haben's auch nicht

45
besser verdient.«
Yard für Yard suchte er die Steilwände ab. Er fand keine
Möglichkeit, die mächtigen Felsbarrieren zu überwinden und
fragte sich, wie er hierhergekommen war.
Es mußte doch eine Möglichkeit geben, den Kessel zu
betreten. Und wenn er daran dachte, daß er selbst
besinnungslos gewesen war, so mußte einfach ein sicherer
Einstieg vorhanden sein.
Geistesabwesend kratzte sich John unter den Armen.
Irgendwas scheuerte in seinen Achselhöhlen. Auf einmal
wurde er ziemlich nachdenklich und zog sein Hemd aus.
Haggerty mußte den Kopf verdrehen, um die roten,
wundgescheuerten Stellen zu sehen.
Sie haben mich an einem Seil herabgelassen, dachte er
enttäuscht. Es gibt also keinen Weg nach oben. Es sei denn,
man dreht jeder verdammten Klapperschlange den Hals um.
Das ist ein perfektes Gefängnis. Nur ein Apache kann sich so
was ausdenken.
Haggerty wußte, daß es müßig war, darüber nachzudenken.
Er brachte einfach keine Verbindung zwischen der Drei-Dollar-
Hure Lily und den roten Wüstenkämpfern zustande.
Dagegen war es wichtig, daß er sich die Nahrung einteilte. Er
wußte nicht, wann sich seine Gefängniswärter wieder sehen
ließen. Und er hatte ganz sicher nicht die Absicht, zu dieser
Zeit tot zu sein.
Einige Zeit verging, bis John den Pemmikan und das
Trockenfleisch in fünfzehn Portionen geteilt hatte. Es war
gerade so viel, daß er halbwegs bei Kräften blieb. Was nach
dieser Zeit geschah, konnte er jetzt noch nicht sagen.
Dämmerlicht lag im Felskessel, als Haggerty fertig war. Er
sah zur Sonne hoch und entdeckte, daß nur noch der obere
Rand der gleißenden Scheibe über die Felskanten leuchtete.
Der Kessel lag also sehr tief in einer Gesteinsformation
eingegraben. Sein Grund war so tief, daß die untergehende

46
Sonne bereits am Nachmittag verschwand.
Haggerty konnte sich auf sein Zeitgefühl verlassen. Er wußte
zwar nicht, wie lange er ohne Besinnung gewesen war, aber im
Tagesablauf kannte er zumindest ungefähr die Stunde. Nach
Einbruch der Dunkelheit konnte er sich Gewißheit verschaffen.
Denn wie die meisten Menschen, die überwiegend im Freien
lebten, orientierte er sich an den Sternen.
John suchte abermals den Talboden ab. Er mußte wissen, ob
die Klapperschlangen auch den Grund selbst als ihren Besitz
ansahen, ob es Gilatiere oder Giftspinnen gab, die ihn beißen
und töten konnten.
Aber der Boden war sauber. Lediglich zwei Chuckawallas
entdeckte Haggerty. Die Echsen zwängten sich in Erdspalten
und bliesen sich derart auf, daß keine Gewalt der Welt sie
herauszerren konnte, ohne die harmlosen Eidechsen zu
zerreißen.
Halbwegs beruhigt legte sich John neben seine Vorräte in das
weiche Gras und zog die Decke über sich. Sie war bunt gefärbt
und bestand aus verschiedenen Wollstreifen. Plötzlich wußte
er, daß ein Pinaleno-Apache mit der Sache zu tun hatte. Denn
die Farbabstufungen waren charakteristisch für diesen Stamm.
Auch die Federn der Pfeile waren in diesen Farben getönt
und wiesen den Kundigen auf den Apachenstamm hin, der sie
angefertigt hatte.
Was nutzt mir das, dachte John. Was kann ich mit dem
verdammten Messer gegen eine Horde Pinalenos unternehmen,
wenn sie an den Talrändern auftauchen?
*
Tla-ina kannte die Wüsten und die Berge, die Natur, das
Wasser und die Pferde. Und sie vermochte sich am Stand der
Sonne und der Sterne zu orientieren.
Lange, stundenlang, schwieg Cochises Schwester, während

47
der Chief neben ihr ritt.
Endlich brach es aus ihr heraus: »Bruder, wohin führst du
mich? Wir reiten nicht in Richtung Winter, nicht dorthin, wo
der Falke in Not ist.«
Der Jefe lächelte und erwiderte: »Schwester, willst du in die
Stadt der Bleichgesichter reiten und nach Haggerty fragen?
Willst du zu der weißen Squaw gehen und forschen, was aus
dem Falken geworden ist? Glaubst du wirklich, daß die
Bleichgesichter uns wieder ziehen lassen, wenn wir unsere
Fragen gestellt haben? Glaubst du, daß sie uns antworten?«
Tla-ina starrte ihren Bruder an, erkannte seine Belustigung
und wußte, daß er recht hatte. Sie war so voller Sorge um den
Mann, den sie liebte, daß sie nicht richtig denken konnte. Aber
ein solcher Fehler vermochte leicht tödlich zu sein in der
Wildnis.
»Was hast du vor, Bruder?« fragte Sanfter Wind leise.
»Wir reiten zu Hellauge«, erwiderte Cochise. »Er wird uns
helfen, denn Falke ist auch sein Freund. Und stehen sich
Freunde in der Zeit der Not nicht bei?«
Die schöne Apachin konnte sich vorstellen, was ihr Bruder
vorhatte. Er würde einen Weißen losschicken, der sich nach
dem Mann erkundigte, den seine Rassegenossen John Haggerty
nannten. Und Cochise und Tla-ina würden lauschen, denn sie
verstanden die Sprache der Weißen gut genug, um auch die
Zwischentöne aufzunehmen, jene Dinge zu erkennen, die nicht
gesagt wurden.
»Vergiß nicht, Schwester«, sagte der Häuptling bedächtig,
»daß Pferdesoldaten an der Sache beteiligt sind. Wolfsbruder
hat den Falken zuletzt im Lager der Blauhosen gesehen. Ich
fühle, daß etwas Schlimmes geschieht. Etwas, das den Krieg
wieder aufflammen lassen kann. Und dann sterben unsere
Brüder und Schwestern zu Hunderten. Die Kinder werden
getötet, damit sie nicht eines Tages zu Kriegern heranwachsen
und Rache nehmen. So denken die Bleichgesichter, Tla-ina.«

48
Die junge Frau hörte die Worte ihres Bruders und fühlte
Angst in ihrem Herzen. Sie wußte genau, daß der Frieden
schwach war. Daß wenige Ereignisse genügten, um den
erbarmungslosen Kampf zwischen Rot und Weiß wieder
aufflammen zu lassen.
Unter den Kriegern gärte es. Viele waren nicht damit
einverstanden, im Reservat zu leben, sich unter den Befehlen
der Bleichgesichter zu ducken. Waren sie denn nicht die
Herren der Wüste? Die Krieger, die alle Listen beherrschten?
Hatten sie denn nicht seit ungezählten Monden den
Gelbhäutigen aus dem Süden, den Texanern, den Comanchen
standgehalten?
Sollten sie vor den blassen Menschen zurückweichen, die mit
aller Macht in den heißen, trockenen Südwesten eindrangen?
In der Ferne kam der Apachen-Paß in Sicht. Er war die
wichtigste Verbindung zwischen dem Osten und dem Südwest-
Territorium. Städte wie Tucson und Tombstone waren auf
diese Paßstraße angewiesen. Thomas Jeffords, der Postmeister,
hatte Cochise die Erlaubnis abgerungen, dort oben, bei den drei
Quellen, eine Station errichten zu dürfen. Dort gab es das
einzige Wasser weit und breit. Die Kutschen der Butterfield
Overland Mail legten auf der Höhe eine Rast ein. Pferde
wurden gewechselt, Tiere getränkt, ehe es in die Ebene
zwischen den beiden Bergketten hinabging.
Und dieses Gebiet zwischen den Dragoon und den
Chiricahua Mountains war Cochises Land. Hier lag die Heimat
seines Stammes. Er hatte sich nie gebeugt, vielmehr durch
kluge Verhandlungen vermieden, in eine Reservation gepfercht
zu werden.
Die Ponys trabten unermüdlich weiter. Tla-ina hob den Kopf.
Sie hörte fremde Geräusche. Holz knarrte, und Metall kreischte
auf. Eine der schweren Kutschen rollte die Straße herab. Der
Fahrer hatte die Bremse angezogen, und der Kloben radierte
über die Eisenreifen der Räder.
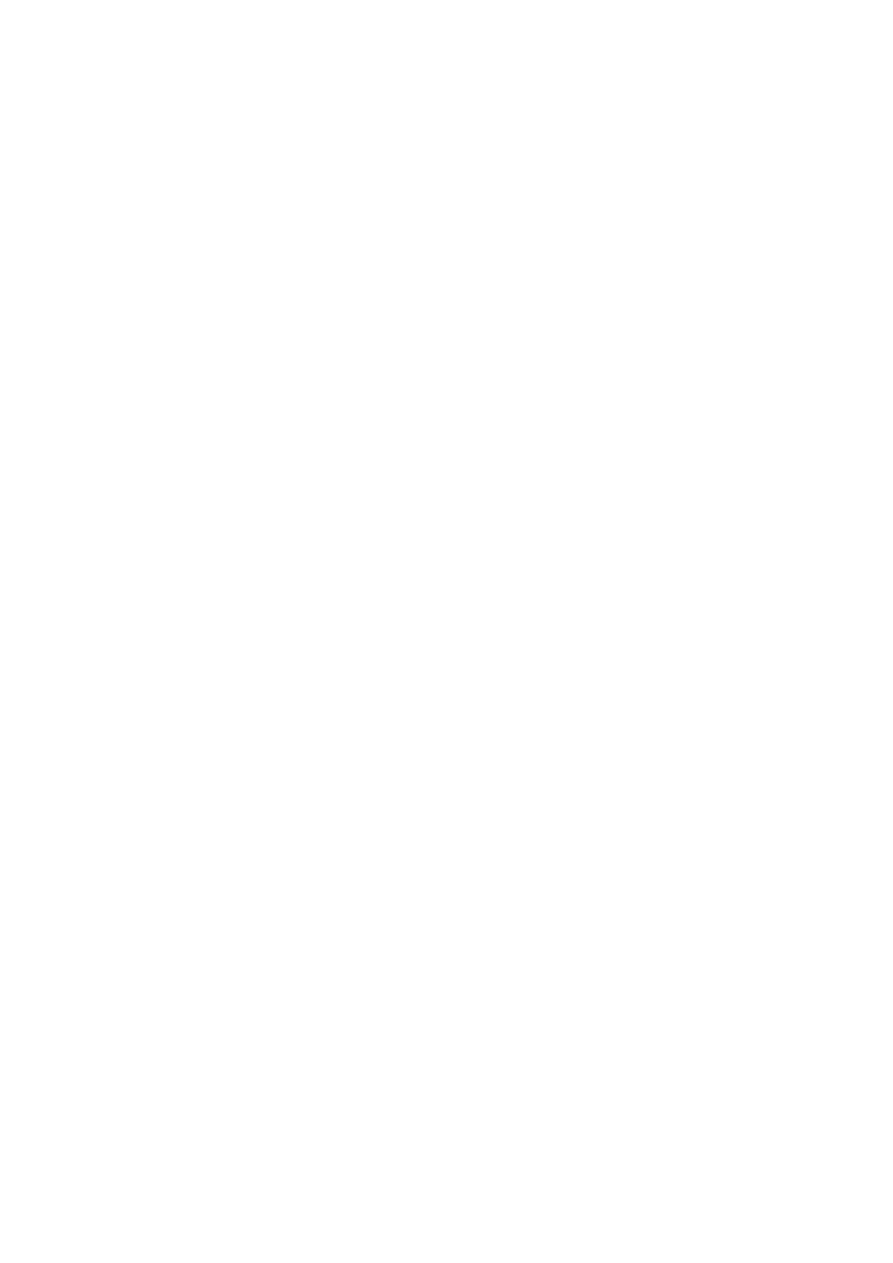
49
Cochise leitete seinen Mustang zur Seite, verharrte neben
dem Fahrweg. Tla-ina zügelte ihren Fuchs neben dem Pinto.
Stolz sahen die beiden Apachen auf den Wagen.
Sie wußten wohl, welche Angst sie hervorriefen, doch das
kümmerte sie nicht.
Der Kutscher griff zur Winchester, als er die Indianer sah.
Mißtrauisch blickte er hinüber. Seine weißen Brauen schienen
sich zu sträuben, und der Texasschnurrbart zitterte.
Und dann erkannte der Fahrer den Häuptling.
Floyd Pearson zog die Bremse an, ließ das Gewehr in die
Halterung zurückrutschen und zügelte das Sechsergespann.
Knarrend kam der Wagen zum Stehen. Der Beifahrer starrte
Floyd an, als sei der Alte verrückt geworden.
Sah man in diesen Zeiten Apachen, gab es nur zwei
Möglichkeiten: entweder zuerst und besser schießen, oder aber
so schnell davonjagen, wie die Pferde nur konnten.
»Was ist los?« gellte eine Frauenstimme aus dem
Wagenkasten.
»Apachen!« brüllte ein Mann, »los, die Colts raus, Leute, die
Rothäute greifen an!«
Pearson schwang sich vom Bock, zerrte die alte Hose hoch
und stiefelte auf Cochise zu.
»Macht nur keinen Unsinn, ihr verdammten Narren!« brüllte
der Fahrer über die Schulter zurück. »Das ist Cochise. Und er
hat mir vor einigen Wochen das Leben gerettet. Wenn einer
von euch auch nur spuckt, treibe ich ihm seinen Schädel mit
drei Hieben in den Magen.«
Der Jefe unterdrückte ein Lächeln. Er hatte den Kutscher
sofort erkannt. Vor Wochen hatten Naiche und der Häuptling
den alten Mann und einen Passagier vor einem Mimbrenjo-
Angriff gerettet und bis an den Stadtrand von Tucson gebracht,
obwohl sie schwer verwundet waren.
»Häuptling«, sagte Floyd Pearson schwerfällig. »Ich schulde
dir mein Leben. Ich kann keine großen Worte machen. Aber du

50
sollst wissen, daß ich dir dafür danke.«
Und damit war auch der Dank des alten Fahrers erschöpft.
Cochise lächelte und erwiderte: »Weißer Mann, Worte sagen
nichts. Aber ich sehe dein Herz, und das sagt mir mehr. Du bist
kein Feind der roten Menschen, wie so viele andere. Und das
hat nichts damit zu tun, daß ich dir das Leben gerettet habe. Du
warst auch vorher kein Feind. Doch genug davon. Ist mein
Freund Hellauge auf dem Paß? Ich brauche ihn.«
Pearson fluchte kräftig und erwiderte:
»Nein, Häuptling. Jeffords ist heute mit der Gegenkutsche
nach Osten gefahren, nach Sonnenaufgang, meine ich. Auf der
Station sind nur Burt Kelly, Norbert Walker und die beiden
Revolverschwinger. Tinatra und Osborne langweilen sich. In
den letzten Wochen ist es ziemlich ruhig geworden, und sie
reiten nicht mehr regelmäßig die Strecken ab.«
»Ich danke dir«, sagte Cochise. »Meine Schwester und ich
reiten zum Paß.«
Floyd starrte die schöne Frau an und schluckte. Sie sah
wahrhaftig nicht wie eine Apachensquaw aus, glich eher einer
schönen weißen Frau, die nur zufällig bronzefarbene Haut
hatte.
Pearson riß sich den alten Deckel vom Kopf und vollführte
eine ungelenke Verbeugung. Tla-ina wußte genug über die
Sitten der Weißen, um richtig zu reagieren. Sie lächelte
freundlich und neigte den Kopf ein wenig, als sie vorbeiritt.
Floyd glaubte die beiden außer Hörweite, als er sagte:
»Heiliger Jason, wenn ich zwanzig Jahre jünger wäre, und ich
das Geld hätte, mir ein Rasiermesser zu kaufen, dann würde ich
mich glatt auf 'nen Gaul schwingen und Haggerty diese schöne
Frau ausspannen.«
Tla-ina lachte so leise, daß nur ihr Bruder es hörte. Auch
Cochise grinste breit, vor allem, als er die Antwort des
Beifahrers hörte.
»Wenn du zwanzig Jahre jünger wärest, du alter Narr, hättest

51
du immer noch sechzig Sommer auf dem Buckel. Und das
Rasieren nutzt deinem Gesicht nichts. Besser, du läßt es
bleiben. Es sei denn, du ziehst dir das Messer quer über den
Hals, aber kräftig.«
Floyd starrte den jungen Hüpfer grimmig an und mußte ein
paar Sekunden darauf selbst lachen.
»Fahren wir, Mann«, rief der Kutscher. »Aber eines sage ich
dir, sobald wir in Tombstone sind, überquere ich die Allan
Street und gehe zu den süßen Flittergirls.«
Cochise wandte sich nicht um, als die Räder wieder knarrten.
Der Jefe dachte an die beiden jungen Kämpfer, die für Jeffords
die Strecken absicherten. Buck Tinatra und Larry Osborne
waren gute Kämpfer, schnell mit den Revolvern und
treffsicher. Einer von beiden würde dem Jefe folgen, wenn er
darum bat. War doch Haggerty, der Falke, in Gefahr. Und nur
seine und Hellauges Freundschaft zu Cochise garantierten den
Frieden im Südwesten.
Die Mustangs trabten die Straße hinauf, als wären sie heute
noch nicht gefordert worden. Die ersten Gebäude waren zu
sehen. Alles blieb still. Cochise lächelte, denn er kannte die
Weißen. Sie lauerten in guter Deckung und warteten ab.
Aber nun schwang die Tür des Stationshauses zurück.
Tinatra und Osborne kamen ins Freie und begrüßten den
Häuptling, verbeugten sich ebenfalls vor Tla-ina und blickten
sie bewundernd an.
»Meine Schwester, die den Namen Sanfter Wind trägt«,
sagte Cochise, »ist besorgt. Der Falke ist gefangen. Und Tla-
ina will ihm helfen. Und da John Haggerty mein Bruder ist,
reite ich mit ihr.«
Schlagartig verwandelten sich die beiden jungen Weißen in
lauernde Revolverkämpfer.
»Willkommen, Jefe«, sagte Osborne ruhig. »Berichte, was
geschah. Jeffords ist nicht hier. Du weißt es schon, denke ich.
Können wir euch helfen? Wir wissen, was wir alle John

52
Haggerty zu verdanken haben.«
Cochise saß ab. Tla-ina glitt geschmeidig vom Pferderücken
und unterdrückte ein Lächeln, als sie Buck Tinatras
verträumten Blick sah.
Kelly und Walker kamen aus dem Stall, begrüßten die
Apachen und führten die Pferde zur Tränke.
Der Häuptling berichtete mit wenigen Sätzen, was er wußte.
»Die verfluchten Soldaten«, sagte Buck Tinatra grimmig.
»Jetzt ist einer von den Blauröcken übergeschnappt. Ich wette,
da ist 'ne ganz große Schweinerei im Gange.«
»Paß auf, Partner«, erwiderte Osborne. »Du bleibst hier, paßt
auf die beiden alten Narren auf. Und ich reite mit dem Jefe und
seiner Schwester. Wenn Haggerty in der Falle sitzt, holen wir
ihn raus.«
»Wieso du?« erwiderte Buck hitzig, »ich reite mit, klar?«
Entschieden schüttelte Larry den Kopf und antwortete: »Du
nicht, mein Freund. Du bringst es fertig und machst dem Jefe
einen Heiratsantrag.«
Verblüfft starrte Buck seinen Freund an und erwiderte:
»Wieso ihm? Höchstens seiner Schwester, du Dummkopf.«
Grinsend erwiderte Osborne: »Siehst du, eben darum bleibst
du hier.«
Larry holte sein Pferd von der Koppel, die Deckenrolle aus
dem Stationsgebäude und war wenige Minuten später fertig.
»Wir können reiten, Chief«, sagte der Revolverkämpfer.
*
Nepatana verhielt sein Pony. Lauschend wandte der Träumer
den Kopf.
Er stand mitten in den Quartsite Mountains, nicht weit von
der Grenze der San Carlos Reservation entfernt.
Zahllose Wege führten durch diesen Gebirgszug. Mit den
Sinnen eines Marines, der sich fast vollkommen der Natur

53
angepaßt hatte, witterte Nepatana, daß er nicht allein war.
Er saß ab, blieb neben dem Kopf des Mustangs stehen und
lächelte.
Auf einmal sah er die Schatten von Pferden zwischen den
Bäumen. Eine starke Horde beobachtete den Träumer.
»Kennt ihr mich nicht, Brüder?« fragte Nepatana laut.
Ein Mimbrenjo trieb seinen Mustang an, ritt bis auf zwei
Längen heran und erwiderte: »Wir kennen dich, Träumer. Und
wir fragen uns, was du hier suchst. Du bist doch ein Mann mit
dem Herz eines Bleichgesichtes geworden. Warum bist du
nicht auf deinem Land und zählst Maiskörner?«
Nepatana holte Luft und erwiderte: »Pferdesoldaten kamen
und vertrieben mich, Vetter. Sie behaupteten, daß kein Apache
auch nur so viel Land besitzen dürfte, wie sein Fuß bedeckt.«
Der Träumer hatte die blauen und schwarzen Streifen im
Gesicht des Mimbrenjos gesehen und wußte, daß die Krieger
auf Raubzug gingen.
»So bist du wieder Apache?« fragte der Mimbrenjo.
»Du sprichst wahr«, antwortete Nepatana, »ich suche mein
Volk, denn ich will kämpfen, die Pferdesoldaten töten und die
anderen Bleichgesichter vertreiben.«
Die Augen des Mimbrenjos funkelten, als er erwiderte:
»Cochise hat Frieden geboten, weißt du das nicht?«
»Der große Häuptling weiß nicht, daß Apachen vertrieben
werden«, sagte der Träumer bitter. »Cochise und seine
Chiricahuas streifen frei im Land umher. Keiner von ihnen
weiß, was uns die Bleichgesichter antun, Vetter. Nein, das
Wort des Jefe stört mich nicht. Ich will die Sklaps von
Pferdesoldaten an meinen Gürtel binden.«
Der Mimbrenjo grinste derart, daß die Farbstreifen seinem
Gesicht etwas Furchterregendes verliehen.
»Und wo findet der Träumer die Blauhosen?« erkundigte
sich der Krieger aus Victorios Stamm.
»Nicht weit von hier«, erwiderte Nepatana. »Das ist der

54
Grund, warum ich die Männer meines Stammes suche. Sie
sollen wissen, daß der Träumer wieder kämpft. Sie sollen
teilhaben an der Beute.«
»Deine Brüder sind in Richtung Winter geritten«, sagte der
Mimbrenjo gelassen, obwohl das eine Lüge war. »Teilst du die
Beute auch mit uns?«
Scheinbar besorgt antwortete Nepatana: »Vetter, dein Stamm
lebt im Reservat der Bleichgesichter. Finden sie heraus, daß
Mimbrenjos wieder getötet haben, so müssen deine Brüder
darunter leiden.«
Verächtlich erwiderte der Anführer der Rotte: »Nur Victorio
weiß, daß Schneller Hirsch mit seinen Kriegern nicht mehr im
Land der Gefangenen reitet. Wir sind Männer, Krieger, und wir
wollen leben, wie unsere Ahnen. Dies ist unser Land, Vetter.
Der Boden verdirbt, setzt ein Bleichgesicht seinen Fuß darauf.
Wir sorgen dafür, daß die Weißen nicht viel Boden verderben.«
Der Mimbrenjo gab seinen Männern ein Zeichen. Sie ritten
aus den Deckungen. Nepatana sah, daß zwanzig junge Krieger
den Anführer folgten. Die Männer wirkten kräftig und gesund
und schienen förmlich einem Kampf entgegenzufiebern.
Nepatana wußte, daß es genau diese Krieger waren, die
immer wieder Unruhe in die Reihen der Apachen trugen.
Schneller Hirsch saß ab und kauerte sich vor eine kleine,
glatte Fläche. Der Träumer ging vor, nahm einen Zweig und
zeichnete auf dem Boden die Umrisse der Pinaleno Mountains.
»Hier, in diesem Tal lagern die Blauhosen«, sagte er. »Es
sind fünfmal zehn Männer. Vier habe ich getötet. Darum
bleiben sie dort, warten auf mich, denn ihre Herzen sind heiß
vor Rache.«
Der Mimbrenjo kannte das Gebiet gut genug. Nachdenklich
blickte er auf die einfache Zeichnung und sagte: »Wenn die
Blauröcke im Tal lagern, finden sie keinen Weg zum
Entkommen. Wir müssen spähen, Vetter. Ich selbst reite mit
dir. Meine Krieger folgen uns langsam. Sie warten dort am

55
schlechten Wasser.«
Dieses war ein Ort, an dem ein flacher See mitten in den
Bergen lag. Der Boden sonderte Mineralien ab, die das Wasser
für Mensch und Tier bitter und ungenießbar machten.
Nepatana war einverstanden und stand auf.
»Reiten wir, Vetter«, sagte er und saß auf.
Schneller Hirsch gab seine Befehle, schwang sich auf sein
Pony, und die beiden Männer ritten davon. Erregt sprachen die
zwanzig Krieger aufeinander ein. Fünfzig Blauröcke, das
versprach reiche Beute an Waffen und Pferden. Wenn auch die
Tiere der Soldaten lange nicht so gut wie die Mustangs der
Apachen waren, so boten sie doch dem Stamm für einige Zeit
ausreichend Fleisch.
Nepatana und Schneller Hirsch leiteten ihre Ponys über die
kaum erkennbaren Pfade der Apachen nach Süden. Der
Träumer hoffte, daß der weiße Offizier mit seinen Soldaten
bereits die Berge erreicht hatte. Es war besprochen, daß die
Schwadron dort lagern sollte, bis Nepatana neue Nachricht gab.
Am Rand der Pinalenos marschierten die Mustangs über
grasbewachsene Felsbänder, auf die der Wind Erde und Samen
abgelagert hatte. Bergkräuter glänzten mattgrün, und ihr
Geruch wurde stärker, wenn die Hufe der Pferde sie zertraten.
Endlich führte der Weg abwärts. In weiten Biegungen
schlängelte er sich entlang des Hanges in ein breites Tal.
Nepatana zügelte sein Pony auf einer Felsplatte und deutete mit
der Rechten hinab.
»Sieh, Vetter, dort lagern unsere Skalps«, sagte der Pinaleno-
Apache.
Schneller Hirsch trieb sein Pferd ein paar Schritte vor, spähte
hinab und erwiderte: »Das sind mehr als fünf mal zehn
Soldaten. Sie haben Verstärkung geholt, Vetter.«
Schneller Hirsch zählte mehr als hundert Bleichgesichter. Als
er sich zu dem Träumer umwandte, hielt der seinen
Schädelbrecher in der Rechten.

56
Der Mimbrenjo starrte Nepatana an und sagte langsam: »Du
bist ein Verräter, Träumer. Du kämpfst für die Bleichgesichter.
Warum willst du uns Krieger in den Tod führen?«
Nepatana erwiderte gelassen: »Die Männer mit dem heißen,
wilden Blut müssen sterben. Wenn die Stämme erst ruhiger
werden, ist der Kampf schnell vorbei, Vetter. Solange ihr aber
immer wieder auszieht, um Weiße zu berauben und zu töten,
werden die Bleichgesichter Jagd auf alle Apachen machen.«
»Du Mörder!« schrie Schneller Hirsch und riß die Linke
hoch.
Grell reflektierte die Sonne auf der Klinge seines Messers. Er
holte aus, wollte werfen, aber in diesem Moment grub sich
Nepatanas Dolch in seinen Oberkörper.
Der Mimbrenjo war sofort tot. Er fiel von seinem Pony und
schlug schwer auf den Boden auf.
Der Träumer schleppte den Toten in eine Felsspalte und trieb
den Mustang ins Tal. Die Soldaten beobachteten den Apachen
mißtrauisch. Er kümmerte sich nicht um die Blicke der
Weißen, sondern ritt zum Zelt des Captains.
Joshua Hagman stand nicht auf, als er seinen Scout sah. Der
Pinaleno ließ die Graszügel des zweiten Pferdes los und sagte:
»Zwanzig Krieger folgen mir. Du hast zwei Stunden Zeit,
Captain. Deine Männer sollen sich nicht sehen lassen. Die
Waffen müssen schußbereit sein, wenn wir noch weit entfernt
sind. Ich führe die Mimbrenjos in dieses Tal.«
Hagman nickte erfreut. Endlich ging es weiter. Obwohl er
sich wegen John Haggerty Sorgen machte, ließ der Offizier
nicht von seinem verrückten Plan ab. Er sah wirklich nur diese
eine Chance für seine Männer, für sich und für den Frieden im
Südwesten. Hagman kam überhaupt nicht auf den Gedanken,
daß er nicht den Überblick besaß, um eine solche Entscheidung
zu treffen. Er war sicher, allein den Ruhm davonzutragen,
wenn er seine Idee verwirklichen konnte.
Die ganz große Gefahr, die eines allgemeinen Aufstandes,

57
zog der Captain gar nicht erst in Erwägung.
Nepatana trieb seinen Mustang an und galoppierte davon.
Hagman rief Sergeant Kenny und gab seine Befehle.
Innerhalb weniger Minuten saßen die Kavalleristen in den
unbequemen McClellan-Sätteln und ritten weiter in die Berge
hinein.
Der Träumer ließ sein Pony im Galopp laufen. Es dauerte
etwa eine Stunde, ehe er auf die Rotte Mimbrenjos stieß.
Mißtrauisch blickten ihn die Krieger an.
»Schneller Hirsch beobachtet die Bleichgesichter«, erklärte
Nepatana. »Es sah so aus, als wollten sie aufbrechen. Ich soll
euch zum Tal führen. Hören wir nichts von Schneller Hirsch,
folgen wir den Weißen durch das Tal.«
Die Krieger waren einverstanden. Nepatana spürte ihre
Kampfeslust fast körperlich. Er setzte sich an die Spitze des
Trupps und ließ sein Pony traben. Endlich erreichten sie das
Tal, das die Berge durchschnitt. Lange verharrten die Apachen,
lauschten, musterten die Umgebung, und witterten Unheil,
ohne jedoch einen Grund für dieses Gefühl zu erkennen. Es
war so, daß ihre Kämpferinstinkte sie warnten.
Der Träumer trieb schließlich sein Pferd an und rief halblaut:
»Ich reite voraus, Krieger. Folgt mir in zehn Längen Abstand.«
Argwöhnisch blickten die Mimbrenjos hinter dem Mann her,
der so lange Zeit in der Nähe der Weißen verbracht hatte.
Führte er sie in eine Falle? Wenn ja, warum tat er das?
Nepatana spürte, wie die Stimmung unter den Kriegern
umschlug. Sie waren nicht mehr bereit, ihm einfach zu folgen.
Darum hieb er seinem Pony die Hacken in die Flanken, trieb es
in Galopp.
Der Träumer hörte die Hufe hinter sich und war zufrieden.
Und auf einmal schimmerten blaue Tuchfetzen auf. Die
Mimbrenjos stießen ihre Kriegsschreie aus und brüllten:
»Zastee! Tötet!«
Aber keiner der Männer kam zum Schuß. Eine verheerende

58
Salve mähte die Kämpfer aus der San Carlos Reservation
nieder.
Nepatana wandte sich nicht um. Er ließ sein Pferd
weitergaloppieren und suchte Captain Hagman. Der Offizier
hockte auf einem Felsband und hielt die Doppelröhre des
Fernglases vor die Augen. Als er den Hufschlag hörte, blickte
er hinab. Geschickt kletterte Hagman ins Tal und wartete auf
Nepatana.
»Sie sind alle tot, alle«, sagte der Captain. »Wenn das so
weitergeht, wagt sich bald kein Mimbrenjo mehr auf den
Kriegspfad, Träumer. Ich muß meine Schwadron zum Fort
führen. Ich weiß nur nicht, ob ich über die beiden Kämpfe
Bericht erstatten soll.«
Nepatana dachte nach und erwiderte: »Wenn du unseren Plan
nicht in Gefahr bringst, dann berichte. Bleiben Männer von dir
auf meiner Farm?«
»Ja, ich lasse eine halbe Abteilung zurück. Hugh Sanders ist
bei ihnen. Er wird ab und zu nach Eureka Springs reiten. Ich
habe ein mächtig übles Gefühl, wenn ich an Haggerty denke.«
Nepatana lächelte flüchtig und sagte: »Er ist sicher, weißer
Mann. Ich suche meinen Stamm. Folgen mir Krieger in den
Kampf, so gebe ich dir Nachricht.«
Plötzlich peitschten Schüsse.
Pferdehufe trommelten über den Boden. Nepatana riß sein
Pony herum und starrte einem Mimbrenjo nach, der
zusammengesunken auf einem Pony hockte.
»Verflucht«, stieß Hagman heraus, »das fehlt uns noch.
Hoffentlich verreckt der Kerl, ehe er in die Reservation
gelangt.«
Nepatana untersuchte die Spuren und meldete: »Er hat viel
Blut verloren. Der Mann ist schwer getroffen, mindestens
zweimal. Er kommt nicht lebend zu Victorio.«
Hagman atmete auf. Diese Gefahr war beseitigt. Er ließ zum
Sammeln blasen, und wenige Minuten später formierte sich die

59
Strafschwadron.
Der Träumer leitete seinen Mustang in die Schluchten der
Pinaleno Mountains, die den Namen seines Stammes trugen.
*
»Chief, warum willst du in Eureka Springs Nachforschungen
anstellen?« fragte Larry Osborne, als sie die Pferde unweit der
Ansiedlung zügelten.
Cochise blickte aus leicht zusammengekniffenen Augen zu
den Gebäuden hinüber. Sein Gesicht wirkte trotz aller
Verschlossenheit kühn und mutig.
»Soldaten haben mit der Sache zu tun«, erwiderte der Jefe.
»John ist General Howards Mann. Das weißt du, Larry
Osborne. Selbst, wenn es der Offizier dieser Soldaten hier nicht
weiß, so kennt er doch Haggerty. Er ist ein Freund der
Apachen. Und das macht ihn zum Feind des Soldaten, wenn ihr
Anführer üble Dinge vorhat.«
Osborne nickte nachdenklich. Sicher, der Jefe wußte nicht
viel, nur das, was sein Späher herausgefunden hatte. Aber diese
Nachrichten reichten völlig aus, um den Chief zu beunruhigen.
»Gut, ich reite in die Stadt«, sagte Larry. »Ich gebe mich als
Revolvermann aus, der John Haggerty sucht. Mal sehen, was
dann passiert.«
Als Osborne anreiten wollte, rief Cochise leise hinter ihm
her: »Vergiß nicht, daß wir dem Falken helfen müssen. Es
nutzt nichts, wenn du getötet wirst.«
Larry hockte etwas zusammengesunken im Sattel. Er ließ
sein Pferd genau auf der Straßenmitte gehen. Fast körperlich
spürte der junge Mann die argwöhnischen Blicke der Städter.
Sie kannten Männer seiner Art wohl und waren vorsichtig.
Vor dem Saloon zügelte Osborne sein Tier und glitt aus dem
Sattel. Mit einer gewohnheitsmäßig wirkenden Bewegung
rückte sich der Kämpfer den Coltgurt zurecht, ehe er mit der
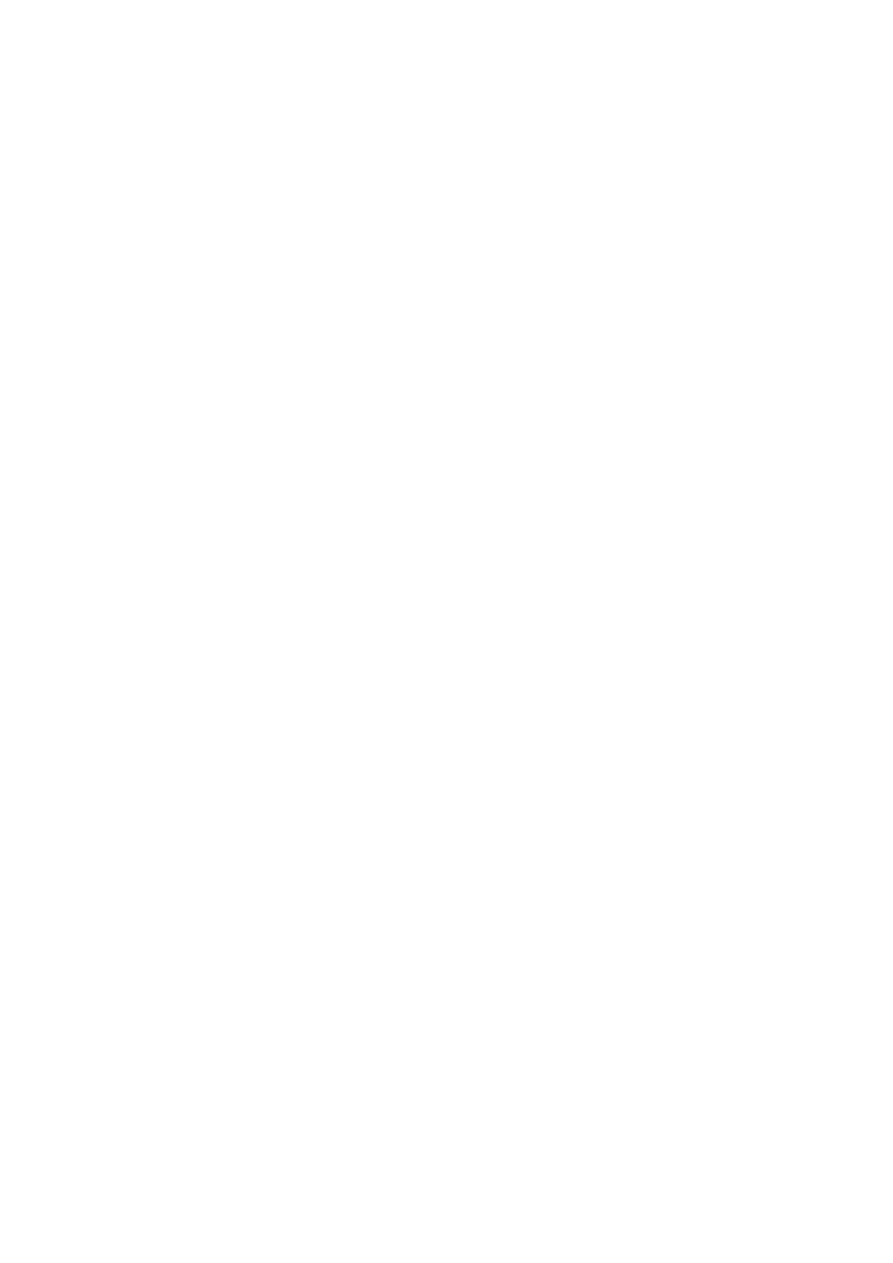
60
Linken gegen die Hälfte der Pendeltür stieß und sich geschickt
durch die Öffnung drehte.
Larry überblickte den Raum, musterte die Ecken, die
wenigen Gäste an den Tischen und die beiden Männer am
Tresen.
Neben der Treppe, die ins obere Stockwerk führte, stand ein
Tisch. Dort saß eine Frau, angemalt wie ein Apachenkrieger,
neben einem Mann, der sofort Larrys Aufmerksamkeit
gefangen nahm.
Instinktiv wußte Osborne, daß diese Frau Lily sein mußte.
Mit geschmeidigen Schritten ging Larry zum Tresen, warf
eine Münze auf die Platte und sagte: »Whisky.«
Der Keeper sah angestrengt an dem Burschen vorbei und
wünschte den neuen Gast zum Teufel. Er gehörte zu den
Kerlen, die Verdruß bereiteten. Fingen sie nicht selbst Streit an,
so wurden sie doch zumeist in eine Auseinandersetzung
hineingezogen.
Larry trank sein Glas aus, warf eine weitere Münze daneben
und schob das Glas zum Keeper.
Als der Mann eingeschenkt hatte, sagte Osborne: »Ich suche
einen Mann. Er ist sechs Fuß groß, schlank und hat breite
Schultern. Sein Haar ist braun und gewellt, und er trägt eine
Lederjacke nach Art der Spurenleser. Haben Sie diesen Mann
hier gesehen?«
Der Keeper verfehlte mit dem Korken die Flaschenöffnung.
Interessiert sah Larry auf die zitternden Hände des Mannes und
war seiner Sache sicher.
»Was wollen Sie denn von ihm?« brachte der Bartender
schließlich heraus, nachdem er den Korken in die Flasche
gefingert hatte.
»Ich werde diesen Mann töten«, erwiderte Osborne
gleichgültig. »Warum er sterben muß, geht Sie nichts an.
Haben Sie ihn gesehen?«
Die letzten vier Worte wirkten irgendwie scharf, schneidend,

61
obwohl sie nicht laut gesprochen worden waren.
»Er war hier, gestern oder vorgestern«, murmelte der Keeper
und umkrampfte die Flasche mit beiden Händen. »Er trank ein
Bier und ging wieder. Seitdem habe ich ihn nicht mehr
gesehen.«
Larry nickte, nahm einen Schluck Whisky und fragte: »Ging
er allein? Oder war er in Begleitung?«
Ehe der Barmann antworten konnte, scharrte ein Stuhl. Aus
den Augenwinkeln blickte Osborne zum Tisch an der Treppe
hinüber. Das Gesicht der Frau war bleich wie ein Laken. Der
Mann glitt um den Tisch herum und kam mit katzenhaften
Schritten näher.
»Jetzt reicht's uns aber«, sagte er scharf, als würde er für alle
Gäste sprechen. »Kerle von deiner Sorte brauchen wir hier
nicht, Mister. Was geht's dich an, wer hier war und wer nicht?
Trink aus und verschwinde.«
Larry lächelte schmal und freudlos, als er fragte: »Was
sonst?«
»Sonst packe ich dich und werfe dich hinaus, du
Coltschwinger«, brüllte der andere.
»Nein«, erwiderte Larry nur und nahm einen weiteren
kleinen Schluck.
Hugh Sanders blieb stehen, als wäre er vor eine Mauer
geprallt. Diese ruhige Gewißheit in diesem einen Wort machte
den Soldaten unsicher. Er fing sich wieder, dachte an sein
Trumpf-As und wußte auf einmal, daß er diesen fremden
Revolvermann schlagen konnte.
»Nein? Du Narr, ich habe schon ganz andere Kerle
fertiggemacht, als dich«, erwiderte Hugh.
Er mußte auf diesem Weg weitergehen. Es war wichtig, daß
der Fremde nicht erfuhr, wer mit Haggerty losgezogen war.
Denn Lily würde sicher nicht den Mund halten, wenn dieser
hartgesichtige Pilger sie bedrohte.
»Gut, dann versuch es doch«, sagte Osborne kalt.

62
Er wußte, daß er sich mit dem Kerl schießen mußte. Und
Larry rechnete mit einem hinterhältigen Trick. Denn dieser
Mann sah nicht so aus, als wäre er ein gleichwertiger Schütze.
»Wie du willst«, erwiderte Hugh Sanders.
Er griff zum Revolver, und als er die Holzschalen berührte,
hielt er plötzlich ein Bowie-Messer in der Linken und warf die
schwere Klinge aus dem Handgelenk heraus.
Larry steppte blitzschnell zur Seite, zog flüssig und glatt und
drückte ab, als der andere seine Waffe gerade hochschwang.
Sanders war sofort tot.
Wie gelähmt blickten die übrigen Gäste den blonden
Fremden an, der scheinbar eiskalt die Hülse aus der Trommel
stieß und eine neue Patrone hineinschob.
Nachdem Osborne den Colt gehalftert hatte, ging er zum
Tisch neben der Treppe. Lily stand auf, trat zurück, versuchte,
sich in der dunklen Ecke zu verkriechen, aber es gab keinen
Fluchtweg für sie.
Larry lächelte und sagte: »Du bist Lily, nicht wahr?«
Das Girl nickte nur. Seine Augen schimmerten, zeigten die
Angst, die das Mädchen empfand.
»Gehen wir, Lily, ich heiße Larry. Ist doch nett, oder? Lily
und Larry, ja, das hört sich gut an. Komm jetzt.«
Die junge Frau blickte zu Boden, als sie langsam um den
Tisch herumging. Osborne wartete, bis sie neben ihm stand und
begleitete sie zur Tür, deren Flügel er höflich aufhielt.
Ohne daß sie ein Wort wechselten, führte das Mädchen den
fremden Coltmann zu ihrem kleinen Haus am Stadtrand.
Mit zitternden Fingern sperrte Lily auf. Sie hatte Angst.
Angst vor diesem eiskalten, harten Burschen. Er würde sicher
nicht zögern, aus ihr herauszuprügeln, was sie wußte.
Lily ging in die Küche, stützte sich mit einer Hand auf den
einfachen Tisch und atmete schwer.
Osborne trat hinter ihr ein und schloß die Tür.
»Warum«, fragte das Girl krächzend und schluckte. »Warum

63
wollen Sie Haggerty umbringen, Mister? Er ist doch ein guter
Mann.«
Larry lächelte und erwiderte: »Du weißt also, wer der
Bursche war. Ich wette, du weißt noch eine Menge mehr, Lady.
Rück schon raus damit.«
»Ich habe ihm Laudanum in den Whisky gegeben«,
murmelte Lily.
»Hugh Sanders wollte das so. Er hatte im Saloon den Scout
erkannt. Und die Soldaten prahlten am Tresen damit, wie sie
die Apachen niedergemacht hatten. Hugh gehörte auch zu
ihnen, aber er tauchte immer ohne Uniform in Eureka Springs
auf. Er war so was wie ein Spion für seinen Captain. Und
Haggerty könnte ihnen alles durcheinanderbringen, sagte
Hugh.«
Larry dachte angestrengt nach. Tatsache war, daß die
Soldaten den ehemaligen Chiefscout weggeschleppt hatten.
Aber fanden sie auch seine Papiere? Wußten sie, daß John
Haggerty direkt im Auftrag des Generals handelte?
»Los, weiter, da ist doch noch was«, sagte Osborne hart.
Lily stieß sich von der Tischkante ab und zerrte am Schrank.
Knirschend rutschte er ein Stück nach vorn. Argwöhnisch sah
Larry zu, wie das Girl in die Lücke griff. Und als sie die Hand
zurückzog, hielt Osborne seinen Colt schußbereit in der
Rechten.
»Keine Waffe«, sagte Lily, »nur Papiere. Haggertys Papiere.
Ich fand sie, ehe die Soldaten mit Hugh kamen. Ich ließ dem
Mann nur seine Entlassungsurkunde.«
Larry starrte das Mädchen an und fragte: »Warum hast du
das getan?«
»Ich weiß nicht«, murmelte sie. »Ich weiß überhaupt nicht
viel, nur, daß Sanders mit seinem Captain eine schmutzige
Sache unternimmt. Und ich wollte nicht am Tod eines
Menschen schuldig sein. Darum versteckte ich diese
Unterlagen.«

64
Osborne halfterte den Colt und nahm die Papiere entgegen.
Dabei verlor der junge Kämpfer nichts von seiner
Wachsamkeit. Er blätterte in den Unterlagen und war
beeindruckt.
»Lady«, sagte er, »du hast Haggerty wahrscheinlich das
Leben gerettet. Und wenn alles so ist, wie Cochise denkt, hängt
es an einem Haar, ob die Apachen jeden Weißen umbringen
oder nicht.«
Entsetzt fragte Lily: »Cochise? Der oberste Häuptling aller
Apachen?«
Statt zu antworten ging Osborne zur Tür, öffnete sie und
sagte laut: »Kommt herein. Es ist alles in Ordnung, denke ich.«
Wie aus dem Boden gewachsen tauchten zwei Gestalten auf.
Ein geradezu riesiger Indianer trat zuerst ein. Seine schwarzen
Augen musterten Lily prüfend.
Hinter dem muskulösen Mann schritt die schönste Frau, die
Lily jemals gesehen hatte, in ihr kleines Blockhaus. Das
Flittergirl konnte keinen Blick von Tla-ina abwenden, und es
machte überhaupt nichts, daß sie eine Indianerin war.
»Wir haben gehört«, sagte der Jefe. »Der Falke ist noch nicht
in Gefahr. Gut. Ich muß nachdenken. Wo ist das Pferd des
Falken?«
»Im Mietstall«, flüsterte Lily und sah zu Boden. »Mir fällt
noch etwas ein. Hugh Sanders sagte einmal, daß alle Männer
der Schwadron Sträflinge seien. Mehr weiß ich aber wirklich
nicht.«
Larry pfiff schrill und sagte anschließend: »Das ist die
Erklärung, Chief.«
Cochise sah den Revolverkämpfer verwundert an.
»Die Soldaten sind zu einer Strafschwadron
zusammengestellt«, erklärte Larry. »Sie bekommen die
schwersten Aufgaben, müssen ständig ihr Leben aufs Spiel
setzen, um sich so zu bewähren, damit sie wieder ihre Ehre
zurückerlangen.«

65
Der Häuptling begriff nach diesen Worten sofort.
Grimmig sagte er: »Und ihr Captain will ihnen diese
Möglichkeit geben. Er läßt Apachenkrieger in die Falle locken,
die Männer töten und prahlt vor seinem Chief mit diesen Taten.
Weiß der Mann denn nicht, daß er einen Krieg damit auslöst?
Der Große Geist muß sein Gehirn verwirrt haben.«
Tla-ina sah sich neugierig um. Sie kannte kaum die
Behausungen der Bleichgesichter, und alles erschien
unzweckmäßig. Wo konnte man denn einem Hasen, das Fell
abziehen? Wo warf man die Federn hin, wenn die Krieger ein
Wermuthuhn brachten?
Nein, ein solches Jacale war nicht nach dem Geschmack der
Apachen-Squaw.
»Schwester, du bleibst hier«, befahl Cochise. »Larry
Osborne, du bist als Kämpfer bekannt geworden.«
Der Jefe lächelte als er das sagte und nickte dem
Revolvermann zu.
»Du hast richtig gehandelt, Larry Osborne«, fuhr der Chief
fort. »Denn der tote Mann ist dieser Sanders. Wenn er seinem
Captain Nachrichten gebracht hätte, wäre das Leben des Falken
nichts mehr wert. Du bleibst auch hier, Larry Osborne. Meine
Schwester ist zwar so gut wie jeder Krieger der Chiricahuas,
aber es ist besser, daß ein weißer Mann in der Nähe wacht.
Zuvor möchte ich der weißen Squaw danken. Sie hat umsichtig
gehandelt, und ich bitte sie, meiner Schwester und dir
Gastfreundschaft zu gewähren.«
Lily wußte nicht, wie ihr geschah.
Dieser mächtige Indianer sprach wie ein großer Mann, ein
Senator oder ein Fürst aus dem weit entfernten Europa. Er
strahlte Würde und Sicherheit aus. Er schien alles zu wissen
und zu erkennen.
»Selbstverständlich, Häuptling«, stammelte das Flittergirl.
»Deine Schwester und Mr. Osborne sind willkommen.«
Cochise lächelte, nahm Larry die Papiere aus der Hand und

66
schritt zur Tür.
»Moment mal, Chief«, sagte Osborne. »Wie geht's jetzt
weiter? Was hast du vor? Ich will helfen, John Haggerty zu
befreien. Ich kämpfe dafür, daß kein Krieg zwischen uns
ausbricht, wenn es sein muß.«
Cochise sah Larry ernst an und sagte langsam: »Du gehörst
zu den wenigen weißen Männern, die gerecht denken und
gerecht handeln. Du bist so wie Hellauge, wie der Falke. Und
ich bin froh, daß es Männer wie dich gibt. Denn nur sie helfen,
das Blutvergießen zu vermeiden. Ich reite jetzt, Larry Osborne.
Ich befreie den Falken. Gemeinsam werden wir den Verräter
stellen und nach dem Gesetz der Apachen bestrafen.
Anschließend muß der Falke mit den Jefes der Pferdesoldaten
sprechen. Und ich glaube, daß dies eine schwere Aufgabe sein
wird. Wir kehren zurück, sobald der Zwist beigelegt ist.
Beschütze die Squaws, Larry Osborne. Und vergiß nicht, daß
die eine das Leben des Falken rettete und die andere meine
Schwester ist, die den Falken liebt.«
Das war eine lange Rede für Cochise.
Er glitt aus dem Haus, verschwand, als hätte ihn die
zerrissene, ausgetrocknete Erde verschluckt.
Scheu blickte Lily die Apachin an. Tla-ina lächelte, trat
neben die Weiße und sagte stockend in der fremden Sprache:
»Zeig mir, was eine weiße Frau tut.«
Tla-ina verstand nicht, warum Larry Osborne sarkastisch
lachte. Aber auch er wunderte sich in den nächsten Stunden.
Denn Lily erwies sich als Mensch, der sich mit den Dingen des
täglichen Lebens genausogut auskannte, wie mit den Männern,
denen sie ihre Dollars verdankte.
*
Captain Joshua Hagman ritt drei Längen vor seiner Schwadron.
Der Offizier brütete über den Worten, die er in seine Berichte

67
schreiben wollte. Die Situation war schwierig. Einmal mußte
jetzt schon erscheinen, daß sich die Strafabteilung
hervorragend geschlagen hatte, und zum zweiten durfte nichts
darauf hinweisen, daß die Gefechte provoziert waren. Ja, daß
sie von Nepatana geradezu herbeigeführt worden waren.
Sergeant Kenney trieb sein grobschlächtiges Pferd an, bis er
neben dem Captain ritt. Weder Hagman noch Kenney waren
strafversetzt. Sie hatten die schwierige Aufgabe übernommen,
die Strafschwadron zu leiten.
»Sir«, sagte Kenney respektvoll, »wenn ich einen Vorschlag
machen dürfte?«
Hagman sah den Unteroffizier an und stellte bei sich fest,
daß er mehr denn je einem gereizten Bullen glich.
»Los, raus mit der Sprache, Kenney«, forderte der Captain
seinen Sergeanten auf.
»Sir, es erscheint mir sinnvoll, wenn Sie in Ihren Berichten
schildern, daß uns die Apachen überraschend angriffen. Mir ist
klar, Sir, was Sie vorhaben. Die meisten Männer in der
Schwadron sind gute Soldaten, die einmal über die Stränge
schlugen. Sie müssen sich bewähren, um wieder normalen
Dienst tun zu dürfen. Und darum denke ich, daß die Kämpfe
mit den roten Kriegern so geschildert werden sollten.
Entschuldigen Sie bitte, wenn ich meine Meinung so offen
vortrage, Captain.«
Hagman atmete auf. Sergeant Kenneys Worte bestärkten ihn
in seinem Entschluß, die Kämpfe mit den beiden
Apachenhorden so zu schildern, wie der Unteroffizier
vorschlug.
Natürlich hatte Hagman keine Ahnung von der Tatsache, daß
Kenney vom Kommandanten des Fort Grant eine ganz
besondere Aufgabe erhalten hatte.
Richard Kenney sollte ein privates Tagebuch führen, das er
auf Anforderung des Colonels vorlegen mußte. Und der Befehl
lautete, daß der Unteroffizier sorgfältig jegliche Tatsachen
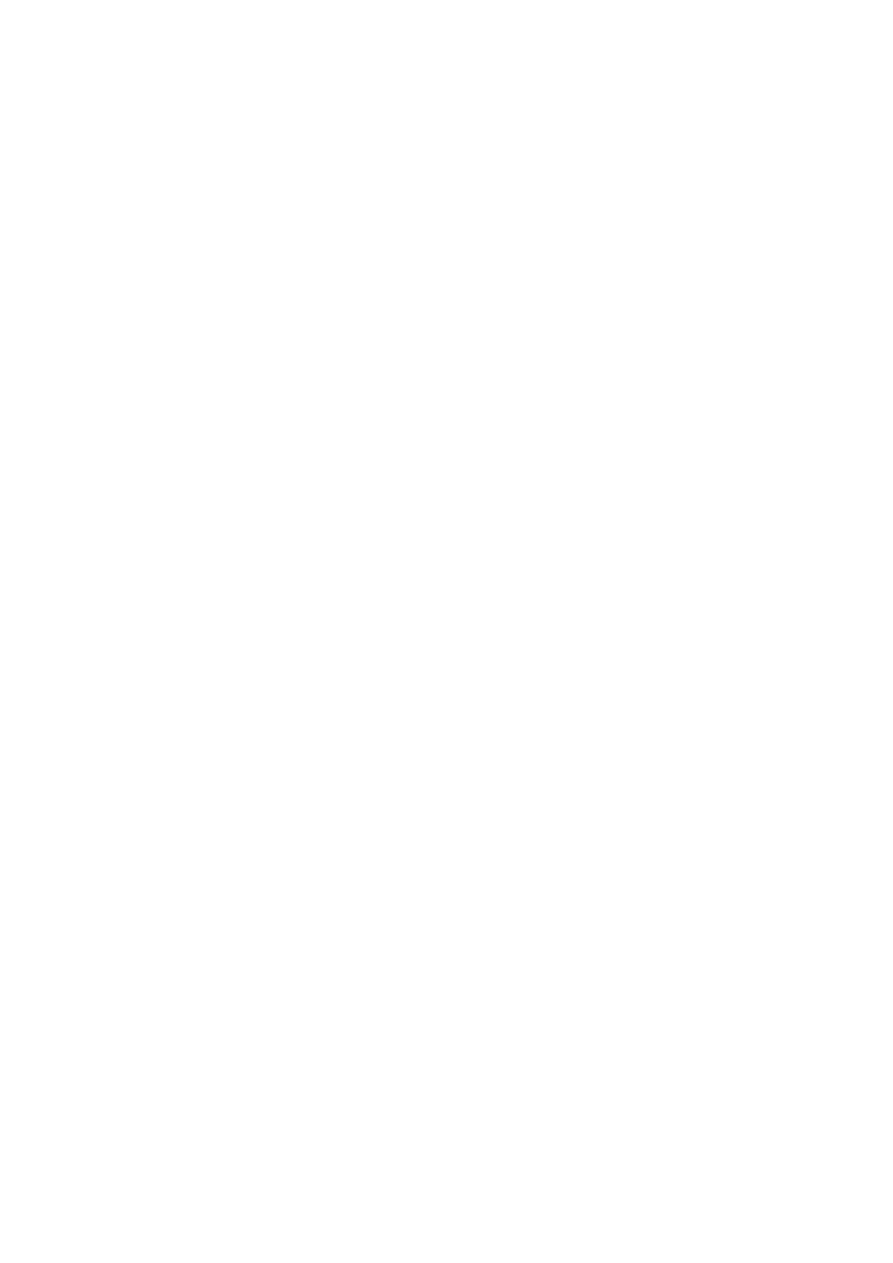
68
aufzeichnen sollte.
Captain Hagman saß gelassen im Sattel und führte die
Strafschwadron zum Fort zurück.
Endlich sah er die Palisaden in der Ferne. Das Sternenbanner
flatterte im leichten Nachmittagswind.
In vorbildlicher Haltung ritten die Kavalleristen in
Doppelreihe auf das Tor zu. Der Posten gab sein
Trompetensignal. Die schweren Flügel schwangen auf, aber
niemand stand auf dem Appellplatz, um die zurückkehrende
Schwadron zu begrüßen.
Hagman preßte die Lippen zusammen. Diese Situation störte
ihn ungeheuer. Als freiwilliger Führer der Ausgestoßenen
nahm er wenigstens für sich in Anspruch, den normalen
militärischen Regeln unterworfen zu sein. Aber das sah das
Reglement nicht vor.
»Absitzen!« befahl der Captain. »Die Tiere sind zuerst zu
versorgen. Anschließend kann sich die Mannschaft
zurückziehen. Die Alarmbereitschaft bleibt bestehen. Vergeßt
nicht, wo ihr seid!«
Schweigend saßen die Männer der Strafschwadron ab. Sie
kümmerten sich um ihre Gäule, blickten nicht nach links und
rechts, wußten, daß sie unter den normalen Soldaten Geächtete
waren, die nur zu Besuch in Fort Grant verweilen durften.
Denn bewährten sich die Sträflinge, die alle gegen das
Militärgesetz verstoßen hatten und verurteilt waren, durften sie
in den normalen Dienst der Kavallerie zurückkehren.
Eine Ordonnanz rannte über den Appellplatz, baute sich vor
Hagman auf, salutierte, und der junge Korporal sagte: »Sir, der
Kommandant wünscht Sie zu sprechen.«
»In Ordnung«, erwiderte Joshua Hagman. »Ich wasche mich,
ziehe eine saubere Uniform an und melde mich beim Colonel.«
Verwundert blickte der Captain den Korporal an, der noch
immer vor ihm stand und steif salutierte.
»Was ist denn, Mann, verschwinden Sie, zittern Sie ab!«
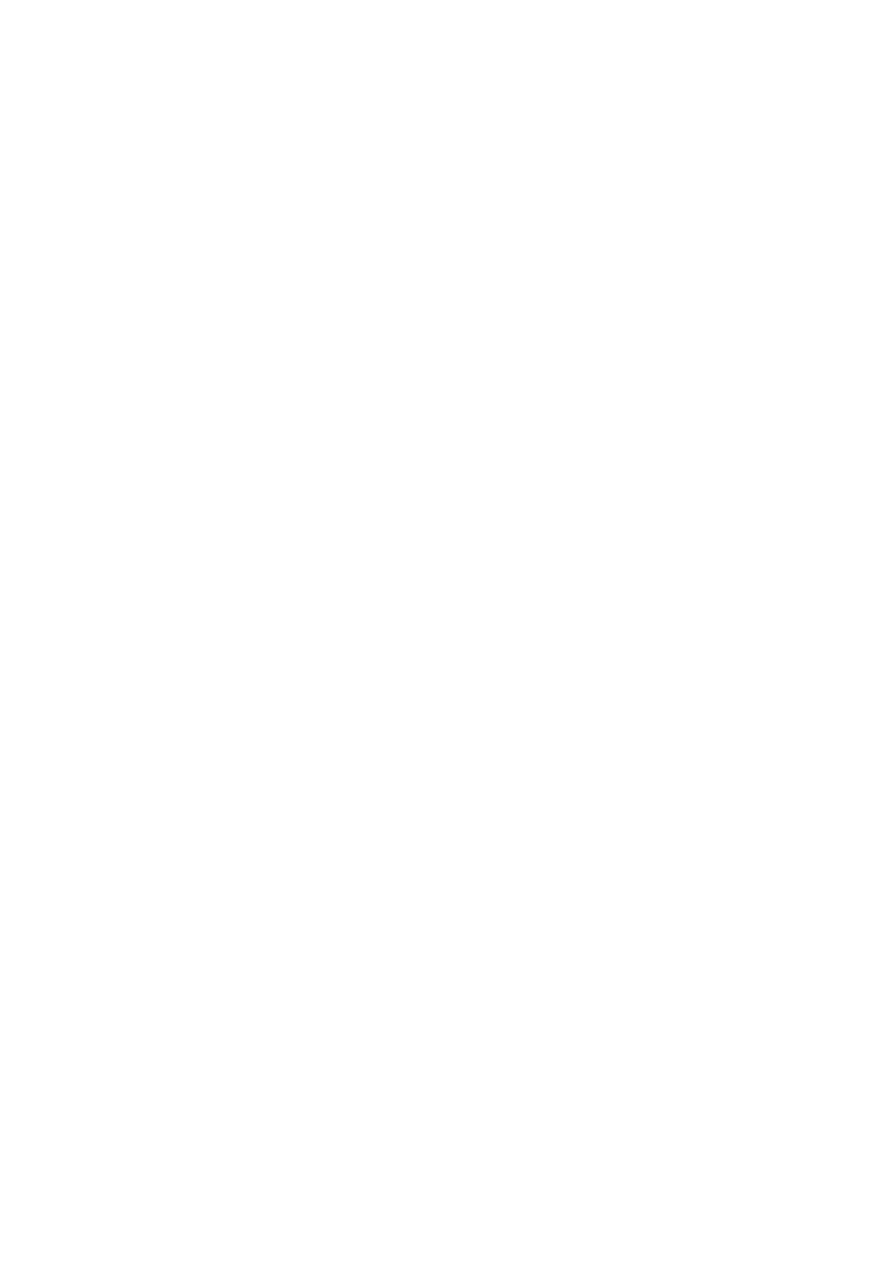
69
sagte Hagman.
»Verzeihung, Sir, der Kommandant möchte Sie sofort
sprechen«, preßte der Korporal heraus.
Hagman staunte und fragte: »Ist das der ausdrückliche Befehl
des Colonels?«
»Jawohl, Sir!« schmetterte der Korporal.
»Gut, gehen Sie voraus!« befahl Hagman und verbarg seine
Unruhe.
Was wollte Colonel Kilgore von ihm? Sicher, Hagman war
zum erstenmal länger als einen Tag mit der Strafschwadron
unterwegs gewesen. Aber konnte das ein Grund sein, sich
unverzüglich beim Kommandanten des Forts zu melden?
Der Korporal hielt dem Captain die Tür zur Kommandantur
auf. Hagman marschierte ins Allerheiligste und salutierte.
»Ihre Meldung, Captain«, forderte der Colonel. »Immerhin
waren sie länger als drei Tage mit diesem Verbrecherhaufen
unterwegs. Ich bin immer noch der Meinung, daß diese Horde
nichts in unserem Krisengebiet zu suchen hat.«
»Sir, keine besonderen Vorkommnisse«, erwiderte Hagman.
»Ich habe einen Scout angeworben für meine Schwadron. Es
ist der Pinaleno-Farmer, der bisher das Fort mit Mais, Getreide
und Fleisch belieferte.«
»Ah, Nepatana, der Träumer«, sagte Colonel Kilgore. »Wie
haben Sie das geschafft?«
Hagman lächelte und antwortete: »Ich habe ihm erzählt, daß
meine Männer sehr schnell in Zorn geraten und seine Farm
abbrennen könnten. Er war sofort bereit, für mich als
Kundschafter zu reiten. Und wir waren froh, daß der Kerl für
uns spähte.«
Kilgore beherrschte sich. Diese Methoden mochte er nicht.
Eigentlich müßte er dem Hauptmann einen gewaltigen Rüffel
erteilen. Aber der letzte Satz hatte den Kommandeur neugierig
gemacht.
»Los, erzählen Sie«, sagte er.

70
»Wir wurden zweimal in Kämpfe verwickelt«, sagte
Hagman. »Zuerst stießen wir auf eine Rotte von Chiricahuas,
zehn Krieger. Sie griffen sofort an und brüllten ihr Zastee, als
ob sie im Rausch wären. Einen Tag später rannten zwanzig
Mimbrenjos gegen uns an. Ich weiß wirklich nicht, was in den
Köpfen dieser Spinner vorgeht, Sir. Mit zehn oder zwanzig
Kriegern gegen eine ganze Schwadron vorzugehen, ist doch
verrückt.«
Colonel Kilgores Gesicht blieb unbewegt. Auf einmal hatte
er jedoch das Gefühl, fürchterliche Kopfschmerzen zu
bekommen. Irgendwas stimmte an dem Bericht des Captains
nicht. Und Kilgore würde auch herausfinden, was der
Schwadronführer verschieg. Immerhin war da noch Sergeant
Richard Kenney.
»In Ordnung, Captain, ich denke, Sie haben richtig
gehandelt«, sagte der Kommandeur. »Niemand kann von
unseren Reitern verlangen, daß sie sich von den Apachen
abschlachten lassen.«
Kilgore starrte ein paar Sekunden auf die Tischplatte und
überlegte.
»Wenn sich die Männer bewähren«, fuhr er fort, »befürworte
ich ihre Überstellung in normale Kompanien. Sagen Sie ihnen
das, Hagman.«
Der Hauptmann konnte seinen Triumph nicht unterdrücken.
Genau das wollte er erreichen. Diese Worte hatte er erwartet.
Er bemerkte nicht, daß ihn der Colonel aus den
Augenwinkeln genau beobachtete und deutlich den Triumph
sah.
Hagman salutierte und vollführte eine exakte Kehrtwendung
wie auf dem Exerzierplatz und marschierte davon.
Der Korporal hielt ihm die Tür auf. Also hatte der Bursche
gelauscht. Nicht nur das. Er trat unaufgefordert in das Zimmer
des Colonels und setzte sich auf den Besucherstuhl.
»Ihre Vermutung trifft offenbar zu«, sagte der Korporal und

71
zündete sich eine Zigarette an.
»Sieht so aus, Brent«, murmelte Kilgore. »Es war eine
verdammte Idee von Sherman, gerade uns im Südwesten die
verfluchte Strafabteilung in den Pelz zu setzen. Das paßt doch
alles zusammen, Mann. Hundertzwanzig Reiter, die Dreck am
Hosenboden haben, verurteilt sind, die sich bewähren müssen.
Dazu ein ehrgeiziger Kerl wie Hagman, den ich bisher ruhig
halten konnte. Das gibt gewaltigen Ärger, Brent.«
»Was ist mit Sergeant Kenney, Sir?« fragte der Korporal, der
in Wirklichkeit ein Lieutenant aus dem Hauptquartier General
Shermans war.
Die Verlegung einer kompletten Strafschwadron in den
Südwesten war eine Idee des Indianerhassers gewesen. Er
glaubte, daß die Verurteilten wie die Teufel gegen die Apachen
vorgehen würden.
Kilgore kritzelte etwas auf ein Stück Papier und reichte es
über die Tischplatte.
»Suchen Sie Kenney«, befahl der Colonel. »Er soll Ihnen
berichten. Ich will alles wissen, die Tatsachen, Brent!«
Und als der junge Lieutenant, der in Fort Grant Ordonnanz
und Schreiber des Colonels spielte, nach einer Stunde
berichtete, hieb Kilgore seine rechte Faust auf den
Schreibtisch.
»Dieser Idiot!« brüllte der Oberst, »ich lasse ihn an die Wand
stellen! Wissen Sie, was das bedeutet? Krieg, Brent, einen
dreckigen, gemeinen Krieg, der voller Grausamkeiten sein
wird. Was glauben Sie, unternimmt Old Vic, wenn der
entkommene Mimbrenjo ihm erzählt, daß die Pferde Soldaten
Apachentrupps in die Falle locken und niedermachen?«
Lieutenant Brent war mehr als besorgt. Er kannte die
Situation im Südwesten genau und wußte, daß diese beiden
Gemetzel an Apachen den schwelenden Konflikt wieder
auflodern lassen konnten.
»Wir müssen Haggerty finden«, drängte Brent. »Nur er kann

72
helfen. Wenn er Cochise holt, vermeiden wir vielleicht den
Krieg.«
Kilgore lachte hart auf und erwiderte:
»Eines Tages hat auch der große Cochise die Nase von uns
voll. Er kann doch nicht immer nur nachgeben. Er verliert sein
Gesicht vor den anderen Stämmen. Und wie sollen wir den
Exscout finden? Sie haben doch selbst berichtet, daß Nepatana
den Mann an sicherer Stelle untergebracht hat. Oh, Mann,
welch eine riesige Schweinerei. Wie sollen wir da bloß wieder
rauskommen?«
*
Der Krieger hing mehr auf dem Mustang, als daß er saß.
Schlangentöter spürte, wie das Leben, wie seine Kraft aus ihm
herausrann. Er wußte, daß er niemals seinen eigenen Stamm
erreichte. Victorio würde nicht erfahren, daß der Träumer sich
gegen die eigenen Rassegefährten gewandt hatte.
Nepatana hatte schon vor Jahren merkwürdige Worte
gepredigt, davon gefaselt, daß sie mit den Weißen in Frieden
zusammenleben müßten. Die meisten Krieger hatten
verständnislos diesen Worten gelauscht und den Träumer
anschließend als Verrückten betrachtet.
Er verließ endlich seinen Stamm und lebte wie ein Weißer
als Farmer und Viehzüchter. Er machte sogar Geschäfte mit
den Eroberern.
Schlangentöter wußte, daß die Pinaleno-Apachen in diesen
Bergen lagerten. Dies war ihre Heimat, und vor einigen
Wintern war er im Dorf der Vettern gewesen.
Er mußte sie erreichen. Denn bis zu Victorio und den
Mimbrenjos war der Weg zu weit. Der schwer verwundete
Krieger wußte, daß Bù, der Bote, der die Seele eines Apachen
ins jenseitige Land brachte, bereits unsichtbar über seinem
Kopf schwebte. Es dauerte nicht mehr lange, bis der

73
schreckliche Vogel sichtbar wurde.
Schlangentöter zupfte am Graszügel. Der Mustang blieb
stehen. Angestrengt lauschte der Apache auf das keuchende
Atmen des Pferdes. Als er sich zur Seite beugte, wäre er
beinahe vom Rücken des Tieres geglitten. Zwei breite,
blutverkrustete Streifen zogen sich über die Flanke des Ponys.
Es schien viel Blut verloren zu haben.
Der Mimbrenjo überlegte, ob er ein Signalfeuer anzünden
sollte. Aber dann fiel ihm Nepatana ein, und Schlangentöter
verzichtete auf den Notruf. Denn der Träumer würde zuerst in
die Nähe kommen. Und das wäre das Ende des sterbenden
Apachen. Er hätte keine Chance mehr, die Pinalenos vor dem
Verräter zu warnen.
Langsam stapfte der Mustang weiter, als er den schwachen
Druck der Hacken in seinen Seiten spürte.
Dichte Kiefernkronen beschatteten den Boden. Vereinzelt
schimmerten die braunen herabgefallenen Nadeln in goldenen
Sonnenflecken, die durch die Kronen der Bäume drangen.
Zerklüftete Felsen ragten über einen Windbruch. Die
Stämme lagen wirr durcheinander. Ein Wintersturm hatte sie
entwurzelt und wie dünne Späne geknickt.
Als Flügel aufrauschten, hob der Mimbrenjo den Kopf. Die
Umgebung verschwamm vor seinen Augen. Aber er entdeckte
doch die große Eule, die aus dem Gewirr der Äste aufgestiegen
war.
Bù, der Todesbote, flog langsam vor dem Krieger her.
Schlangentöter wußte, daß es an der Zeit war. Er holte tief
Luft und sang mit spröder Stimme die ersten Worte seines
Sterbegesangs. Allmählich wurde seine Stimme fester,
sicherer. Aus irgendeiner verborgenen Quelle strömte noch
einmal Kraft in den Körper des Apachen. Er fühlte sich leicht
und merkwürdig stark, und wußte doch, daß dies der Tod war,
der in ihm kroch.
Bald ritt er im jenseitigen Land auf einem prachtvollen

74
Mustang hinter den weißen Hirschen her und erlegte sie mit
neuen, kostbaren Waffen.
Das Pony hörte die Worte seines Reiters, spürte keinen
Schenkeldruck mehr und suchte sich selbst seinen Weg.
Zwischen Beerensträuchern und Maulbeerbäumen
marschierte das Tier durch, durchquerte noch einen
Kiefernwald und knickte zwischen den letzten Bäumen mit
beiden Vorderbeinen ein.
Ein klägliches Wiehern durchbrach die Stille. Der Atem ging
schnarchend rauh, und Schlangentöter prallte zu Boden, ohne
daß er einen Schmerz verspürte.
Die Eule segelte mit lautlosem Flügelschlag über den
sterbenden Krieger, kreiste und stieß einen schaurigen Ruf aus.
Der Mimbrenjo sang weiter. Er wußte, daß Usen, der große
Geist der Apachen, nicht zuließ, daß die Pinalenos gewarnt
wurden.
Plötzlich klatschten die Flügel des Vogels laut. Er wurde
schneller, und verschwand zwischen einigen dichten
Kiefernkronen.
Drei rote Männer glitten aus dem Unterholz. Schweigend
verharrten sie vor dem sterbenden Rassegenossen,
respektierten sein Todeslied.
Und als Schlangentöter endlich die letzten Worte gesungen
hatte, sah er die Pinalenos.
Lächelnd flüsterte er: »Brüder, Usen ist gerecht. Ich bin
verraten worden. Ein Mann eures Stammes steht im Dienst der
Bleichgesichter. Euer Jefe soll ihn jagen und töten, wie es das
Gesetz verlangt. Sein Name ist Nepatana, und er will seinen
Traum wahrmachen. Er führte zwanzig Krieger der
Mimbrenjos vor die Gewehre der Pferdesoldaten. Und alle
zwanzig Seelen werden bald im Land des Todes sein.«
Die Pinalenos starrten den Sterbenden an, und der Anführer
der drei Männer sagte: »Brüder, wir bringen dich zu unseren
Jacales. Du mußt deine Worte vor unserem Jefe wiederholen.«

75
Schlangentöter schüttelte leicht den Kopf und antwortete:
»Ich gehe ins Land der Seelen ein, ehe wir euer Dorf erreichen.
Bù wartet bereits in den Kiefern, Freunde. Ich bin zufrieden.
Mein Sterbegesang ist gesungen, und Usen weiß, daß ich ein
tapferer Krieger war.«
Schlangentöter lag reglos. Die Kraft hatte ihn verlassen. Alle
drei Pinalenos zuckten zusammen, als die Eule aufstieg, über
die Lichtung segelte und mit kräftigen Flügelschlägen nach
Westen flog.
Der Mimbrenjo war tot.
»Wir nehmen ihn mit«, entschied einer der drei. »Er soll
nach den Gebräuchen der Apachen begraben werden.«
»Nepatana«, sagte ein anderer grimmig. »Er ist wie der Zahn
einer Giftschlange. Kommt, Brüder. Der Chief muß erfahren,
was der Mimbrenjo gesagt hat. Und wenn es stimmt, dann wird
der Träumer unter Martern sterben.«
*
Cochise streifte durch die Bergwälder. Die unbeschlagenen
Hufe des Pintos verursachten kein Geräusch auf den Moosen
und Kiefernnadeln. Aufmerksam spannte der Jefe all seine
Sinne an, lauschte auf die Geräusche der Natur, roch in den
leichten Wind und musterte jeden Felsen, jeden Baum und
jeden Strauch.
Plötzlich zügelte er den Schecken und blickte zu Boden.
Kaum sichtbar zeichneten sich im feuchten Moos Hufspuren
ab. Eine Rotte Krieger war hier vorbeigezogen. Cochise
schätzte die Horde auf ungefähr zwanzig Männer. Die Fährte
war einige Stunden alt, lag für ihn aber genauso da, als wären
die Apachen erst vor Minuten vorbeigeritten.
Der Chief zupfte am Graszügel, leitete seinen Mustang in die
neue Richtung und folgte der Spur. Nach einer Weile erreichte
Cochise das Tal, in dem die Soldaten die Mimbrenjos

76
niedergemetzelt hatten.
Forschend blickte der hochgewachsene Häuptling zu den
Bäumen an den Hängen, sog prüfend die Luft ein und roch den
Tod, der in diesem Tal seine blutige Ernte eingebracht hatte.
Unbewegten Gesichtes ritt Cochise weiter. Er sah die
Mimbrenjos, zählte achtzehn Krieger und starrte ausdruckslos
auf die Toten. Eine Fährte führte aus dem Tal hinaus. Das Pony
war galoppiert. Blutspuren bewiesen dem Chiricahua-
Häuptling, daß entweder das Pferd oder der Reiter verwundet
war.
Ein Mimbrenjo war also dem grausamen Abschlachten
entkommen. Denn anders konnte man die Vernichtung der
Kriegerhorde nicht nennen. Cochise störte nicht die Art, wie
die Kämpfer zu Tode gekommen waren. Er trauerte vielmehr
um die Männer seiner Rasse. Es wurden ständig weniger. Und
gerade die Mimbrenjos unter Victorio wollten nicht nachgeben,
konnten nicht mit den Weißen in Frieden leben.
Der Jefe trieb seinen Pinto an, ritt durch das Tal. Ein
Dutzend Ponys graste zwischen den Büschen. Cochise fing
eines der Tiere ein. Wenn er Haggerty fand, brauchte der Falke
ein Pferd.
Der Apachenführer stieß auf die Spur eines einzelnen
Reiters. Der Mann hatte sich keine Mühe gegeben, seine Fährte
zu verbergen. Ein sicherer Instinkt leitete den Häuptling zum
Graham Peak, dem höchsten Gipfel der Pinaleno Mountains,
der über zehntausend Fuß hoch aufragte.
Und dort fand er die gleiche Fährte wieder. Das Pony hatte
eine große Last getragen, zwei Reiter vielleicht?
Besorgt blickte Cochise auf die Hufabdrücke. Wenn der
Falke tot war, wenn sein Körper in irgendeiner Felsspalte lag,
war es um den Frieden geschehen. Denn so, wie der große
Chief die Apachen halbwegs ruhig hielt, so arbeitete Haggerty
bei den Weißen. Es gab unter Offizieren der Pferdesoldaten
erbarmungslose Indianerhasser, die am liebsten mit Kanonen

77
und Gatling Guns die gesamte Bergwelt in Trümmer
geschossen hätten.
Langsam marschierte der Pinto auf der Fährte des einzelnen
Indianers. Der Weg führte bergauf. Die Kiefern wuchsen nicht
mehr so hoch, hörten ganz auf und machten Krüppelgewächsen
Platz, die wie ein kniehoher Strauchwall den Boden bedeckten.
Ein Gesteinsband führte fast waagerecht nach Westen. Ohne
Zögern ließ Cochise seinen Mustang auf diesem Felsenweg
reiten, der plötzlich endete.
Geschmeidig saß der Häuptling ab, trat an die Kante und
blickte in den Talkessel.
Gras wucherte unten. Ein kleiner Wasserlauf ließ alle
möglichen Kräuter wuchern. Und dort unten saß der Falke!
Er blickte auf ein Bündel Trockenfleisch und Pemmikan.
Warum hatte der einzelne Krieger den weißen Mann nicht
getötet, sondern in dieses natürliche Gefängnis gebracht?
Der Jefe entdeckte zahlreiche Löcher in den Wänden des
Felskessels. Und er sah auch die winzigen Spuren der
Klapperschlangen. Der Falke saß in der Falle. Er konnte nicht
wie sein Namenstier die Flügel ausbreiten und hinauffliegen.
»Sage mir, mein Bruder«, fragte Cochise laut und etwas
spöttisch, »warum du dich dort unten versteckst? Ist dir meine
Freundschaft nicht mehr genug, Falke?«
Haggerty sprang nach den ersten beiden Worten bereits auf
und starrte zu den Talkanten hinauf. Cochises mächtige Gestalt
hob sich gegen den hellen Hintergrund ab.
Erleichtert antwortete John: »Jefe, steige die Löcher herab,
und du spürst, warum ich mich nicht selbst befreit habe.«
»Ich weiß, daß du nicht mit den Giftwürmern sprechen
kannst«, antwortete der Häuptling. »Aber sie sind auch so
gereizt. Warte ein wenig, Falke, ich ziehe dich hoch.«
Innerhalb weniger Minuten hatte der Chiricahua ein paar
lange Lederriemen zusammengeknotet und ließ sie hinab.
Haggerty knüpfte die Schlinge, die er sich um den Oberkörper

78
legte.
Fast mühelos zog Cochise seinen weißen Freund Hand über
Hand hoch. Endlich schwang sich John über die Felskante,
stand auf und legte dem Jefe die Linke auf die Schulter.
»Du bist mein Bruder«, sagte Haggerty, »mein Leben gehört
dir. Erzähle, was geschieht hier eigentlich?«
Cochise saß auf, und auch Haggerty schwang sich auf das
Pony, das der Chief mitgebracht hatte. Es scheute etwas, denn
der Geruch des Weißen störte das Tier.
Während die Freunde zurückritten, berichtete der Häuptling.
»Eine Strafschwadron, so eine Verrücktheit«, stieß John
hervor. »Nur ein Narr kann auf solch eine Idee kommen.«
»Oder ein Weißer, der die Apachen mit den Banditen seiner
Rasse bekämpfen will«, erwiderte Cochise ernst.
Widerwillig nickte Haggerty. Ja, auch das war möglich. Und
wenn der Indianerfresser Sherman dahintersteckte, bekam die
Strafschwadron im Südwesten einen Sinn.
»Lily«, sagte John grimmig, »sie hat mir etwas in den
Whisky gekippt. Die ganze Geschichte ist abgekartet. Als der
Kerl bei ihr hörte, wie der Soldat mit den toten Chiricahuas
prahlte, als er mich erkannte, handelte er sofort. Gar nicht so
ungeschickt, der Bursche. Aber wie ich in dieses Felsenloch
kam, weiß ich nicht.«
»Lily hat dir trotzdem das Leben gerettet«, sagte der Jefe und
zog unter seinem Rehlederhemd Johns Papiere heraus. »Sie
war so klug, diese sprechenden Blätter zu verstecken.«
Haggerty sah die Unterlagen flüchtig durch und verstaute sie
in seiner Jacke. Wenn er doch nur wüßte, was hinter dieser
merkwürdigen Geschichte steckte? Eine Rotte Mimbrenjos in
die Falle geführt und niedergemacht. Die zehn Chiricahuas, die
auf Ulzanas Befehl gehört hatten, was bedeutete dies alles? Die
Krieger ließen sich doch nicht von weißen Soldaten in eine
Falle locken? Und sie waren auch nicht so verrückt, gegen eine
ganze Schwadron offen anzukämpfen.

79
»Laß deine Gedanken, Falke«, riet der Häuptling. »Wir
reiten zurück zu den festen Jacales. Tla-ina wartet, und Larry
Osborne wollte auch für dich kämpfen. Dein Pferd hat der
Coltmann inzwischen sicher geholt. Wir reiten zum Fort Grant.
Der Offizier dort muß wissen, was vorgeht.«
Je weiter sie nach Westen kamen, desto stärker verspürte
Haggerty eine merkwürdige Unruhe in sich. Auch der Jefe
blickte ständig in Richtung Sonnenuntergang und wirkte nicht
sonderlich gelassen, obwohl er dies zu verbergen suchte.
Auf einmal zügelte Cochise seinen Mustang und wandte den
Kopf. Haggerty brachte sein Pony zum Stehen und lauschte
ebenfalls, konnte jedoch nichts hören.
»Schüsse, Falke«, sagte der Jefe. »Sie fallen im Westen.«
Nach wenigen Schritten jagten die Mustangs in wilder
Karriere auf Eureka Springs zu. Denn Cochise und John
vermuteten, daß Larry Osborne, Tla-ina und Lily bis zum Hals
in Schwierigkeiten steckten.
Der Häuptling und Haggerty verhielten ihre Tiere auf einem
Hügel. Von der Kuppe aus konnten sie die Stadt erkennen. Alle
Straßen waren wie leergefegt. Nirgendwo regte sich etwas. Nur
aus dem Haus am Stadtrand flammten Mündungslichter auf.
Von drei Stellen aus wurde das Feuer erwidert. Haggerty sah
den Chief an, der mit dem Kinn nach Norden deutete und
seinem Schecken die Hacken in die Flanken hieb.
John würde von Süden angreifen.
Eine Winchester hämmerte in rasender Folge. Die Tür des
Hauses flog auf. Osborne hetzte im Zickzack ins Freie, rollte
sich zusammen und kugelte über den Boden.
Er stach den Colt vor, feuerte dreimal und sprang hinter zwei
große Fässer, die ihm als Deckung ausreichten. Sicher
versuchte der Kämpfer der Postlinie, sein Pferd zu erreichen
und die Halunken vom Sattel aus zu erwischen.
Haggertys Hut tanzte an der Windschnur im Nacken, als er
das Pony im Galopp zur Deckung des Angreifers trieb. Der

80
Kerl wurde durch den Hufschlag gewarnt, schnellte hoch und
drehte sich wie eine Pantherkatze in der Luft.
Seine Winchester spuckte Feuer und heißes Blei. Haggerty
riß am Graszügel. Der Mustang stemmte die Vorderhufe in den
Boden und pflügte drei Yard weit die Erde auf, ehe er
stillstand.
John hielt das Gewehr an der Schulter und feuerte. Eine
Kugel genügte. Der Kerl, der die blaue Uniform der
Yankeesoldaten trug, brach zusammen.
Von Norden her peitschte Cochises Winchester zweimal. Ein
gellender Schrei bewies, daß der Häuptling einen der Angreifer
nur verwundet hatte.
Sofort trieb Haggerty seinen Mustang an. John wollte den
Verwundeten lebend, wollte aus ihm rausholen, aus welchem
Grund sie die Hütte von Lily angriffen.
Cochise verhielt seinen Pinto bereits neben dem schwer
verletzten Soldaten. Der Kerl lag am Boden, starrte angstvoll in
das maskenhaft starre Gesicht des großen Apachen und zitterte,
daß die Zähne aufeinanderschlugen.
Haggerty glitt von der Decke des Pferdes, kniete sich neben
den Sterbenden und fragte eindringlich: »Mann, du gehst
gleich über den Jordan. Warum habt ihr angegriffen?«
Der Kerl holte schwer Luft und sagte undeutlich: »Wir haben
schon lange auf Sanders gewartet. Als er nicht kam, machten
wir uns auf den Weg. Nur Ed ist auf der Farm des Indianers
zurückgeblieben.«
Schweiß rann über das Gesicht des Soldaten. Die Lippen
zuckten unkontrolliert, verzerrten sich derart, daß sie wie eine
offene Wunde wirkten.
»Gehört ihr zur Strafschwadron?« fragte John.
»Sicher, was denn sonst«, keuchte der Sterbende. »Sanders
gehörte auch dazu. Er sollte in Zivil auftreten, hier in der Stadt.
Wir hörten von seinem Tod und kamen zu Lily. Und auf
einmal wußten wir, was los war. Die verdammte Drei-Dollar-

81
Hure Lily hat uns verraten. Die Squaw wehrte sich, als Jack
nach ihr greifen wollte. Und dann tauchte der verfluchte
Revolvermann auf…«
Der Soldat bäumte sich auf, sein Körper spannte sich wie das
Holz eines Bogens und fiel schlaff zurück.
Der Mann war tot.
»Nun wissen wir mehr, Falke«, sagte Cochise unbewegt.
»Die bestraften Soldaten haben einen Plan. Reden wir mit
Larry Osborne.«
*
Der Revolverkämpfer kam hinter den Fässern hervor, grinste
schief und lud seinen Colt auf, ehe er die Waffe halfterte.
»Ihr seid genau zur richtigen Minute gekommen«, sagte
Larry. »Die verdammten Halunken hätten es beinahe geschafft.
Ohne Tla-inas Deckungsfeuer wäre ich niemals ins Freie
gekommen.«
John saß ab, führte das Pony hinter das Haus und begrüßte
seinen Rappen, der freudig schnaubte. Erstaunt bemerkte
Haggerty, daß sich der Indianermustang zwischen den Rappen
und John drängte. Das Tier hatte Vertrauen zu dem Fremden
mit dem unvertrauten Geruch gefaßt.
»Gehen wir ins Haus«, sagte Haggerty. »Sind Tla-ina und
Lily in Ordnung, Larry?«
»Keine Sorge, Boß«, erwiderte Osborne grinsend, »Sie haben
sich verdammt gut gehalten, sogar Lily, obwohl sie mächtig
Angst hatte.«
»Jeffords ist Ihr Boß, Larry«, erwiderte John lächelnd.
»Im Moment nicht«, sagte Osborne trocken. »Jetzt sind
entweder Sie oder Cochise der Mann, der die Befehle gibt. Und
wer die gibt, ist mein Boß, Ist doch klar, oder?«
Sie gingen ins Haus. Lily blickte verlegen an Haggerty
vorbei. Er aber ging auf sie zu und sagte: »Schon gut, Lily, ich

82
trage dir nichts nach. Immerhin hast du meine Papiere in
Sicherheit gebracht. Ich bitte dich nur darum, daß du nicht über
meine Vollmachten sprichst. Zu keinem Menschen.«
Tla-ina trat vor den Falken, legte ihm ohne Scheu die Arme
um den Hals und küßte ihn, ehe sie sich eng an ihn schmiegte.
Cochise lachte auf einmal laut und bekam dafür von Lily
einen empörten Blick. Denn sie war immer gerührt, wenn sie
richtige Liebe entdeckte.
Aber der Jefe erzählte mit einigen Sätzen die Begegnung mit
dem Kutscher Floyd Pearson und schloß: »Du siehst also,
Falke, daß Tla-ina auch auf andere weiße Männer Eindruck
macht. Du solltest vorsichtig sein.«
Sekunden später war der Spaß vergessen. Sie unterhielten
sich über die drei toten Soldaten, die der Strafschwadron
angehört hatten.
»Ich muß nach Fort Grant«, sagte Haggerty entschlossen.
»Wenn überhaupt, erfahre ich nur dort etwas. Was ist mit
diesem Indianer, der eine Farm haben soll, wie der Sterbende
erzählte? Weiß einer von euch etwas darüber?«
»Ein Krieger der Pinalenos«, erwiderte Cochise, »trennte
sich von seinem Stamm. Er wollte mit den Bleichgesichtern in
Frieden leben. Sein Name ist Nepatana, und das heißt: der
Träumer. Sein Traum ist, daß rote und weiße Menschen keinen
Krieg mehr gegeneinander führen. Er hat sich als Farmer
niedergelassen und handelt mit den Soldaten aus Fort Grant.
Falke, mein Bruder, mir kommt ein schrecklicher Gedanke:
Wenn nun Nepatana mit Gewalt versucht, den Frieden zu
bringen. Wenn er mit dem Offizier der bestraften Soldaten
gemeinsam gegen die kriegerischen Apachen vorgeht?«
Haggerty verspürte ein Frösteln zwischen den
Schulterblättern. Nein, das war doch zu weit hergeholt.
Aber hatte der Häuptling mit seinen kühnen Überlegungen
nicht oft genug recht behalten? War er vielleicht besser als
John in der Lage, die Gedanken der roten und weißen

83
Menschen miteinander zu verknüpfen?
Haggerty dachte gradlinig. Er vermochte sich zwar in die
Gedanken anderer hineinzuversetzen, aber seine Anständigkeit
hinderte ihn oft daran, die schurkischen Pläne der Weißen mit
den Listen und Tricks der Apachen zu verbinden.
»Eine Antwort«, sagte John darum, »bekommen wir nur in
Fort Grant. Also reiten wir hin, Jefe.«
Sofort stand der Häuptling auf. Er war bereit.
»He, und ich, und wir?« fragte Larry Osborne. »Sollen wir
hier abwarten, bis wir die Meldung von eurem Tod
bekommen?«
Grinsend erwiderte John: »Dazu wird es nicht kommen. Oder
mein Bruder Cochise hätte Vorahnungen. Nein, Larry, Sie
bleiben hier. Ich habe so das Gefühl, daß hier irgendwas
passieren wird. Und ein guter Coltschütze ist nicht mit etwas
anderem aufzuwiegen.«
Larry Osborne grinste matt. Er wußte, daß Haggerty seine
Fähigkeit als Kämpfer schätzte. Und er wußte auch, warum der
ehemalige Scout ihn hier in diesem Haus lassen wollte. Es ging
um Tla-ina. Sie sollte geschützt werden. Dabei hatte Osborne
den Eindruck, daß sich Sanfter Wind verdammt gut selbst
helfen konnte. Denn mit der Winchester war sie eine
Meisterschützin.
»Okay, Boß, reitet nur«, sagte Osborne. »Laßt den armen
Larry allein mit zwei gefährlichen Frauen zurück. Alles was
passiert, habt ihr euch selbst zuzuschreiben.«
Cochise grinste breit und erwiderte: »Wenn dir die weiße
Squaw zu nahe tritt, Larry Osborne, wird dir Tla-ina helfen.«
Lily wurde trotz ihrer Erfahrung, trotz ihres Berufes, rot. Und
Cochises Schwester lächelte.
Der Chief und John verließen das Blockhaus. Der
Mimbrenjo-Mustang prustete empört, als der Weiße auf den
Rappen kletterte.
Cochise und Haggerty trieben die Tiere an. Die Freunde

84
hatten das Gefühl, daß sie keine Zeit verlieren durften.
Irgendwie drängte alles zusammen. Und ein winziger Funke
genügte, um den gesamten Südwesten in Aufruhr zu versetzen.
Die Pferde galoppierten nach Osten. Fort Grant lag südlich
der Pinaleno Mountains. Haggerty kannte den Namen des
Kommandanten und hoffte, daß er mit diesem Mann vernünftig
reden konnte.
Cochise sollte ihn begleiten. Der Jefe trat für den Frieden ein.
Selbst Victorio, der die Weißen haßte wie die Pest, schickte
seine Krieger nicht mehr in offene Kämpfe mit den
Bleichgesichtern.
Cochises Einfluß war groß. General Howard hatte das
erkannt. Und in Haggerty hatte der Oberbefehlshaber des
Southwest-Territoriums einen ausgezeichneten Unterhändler.
Die beiden Reiter durchquerten die Ausläufer der Pinalenos.
Felsige Hügel ragten auf. Das kahle Gestein schimmerte
stumpf in der Sonne. Vereinzelt wuchsen Kiefern, denen der
kärgliche Boden genügend Nahrung bot.
Und die Pinaleno-Apachen nannten sich selbst: Volk-aus-
der-Kiefernschonung.
Die Pferde erreichten eine sandige Grasfläche, die den Hügel
vorgelagert war. Cochise hob witternd den Kopf. Auch
Haggerty verspürte das Gefühl, nicht mehr allein zu sein.
Hinter einer Biegung zügelten sie die Pferde.
Neben einem umgestürzten, kahlen Baum verhielten sieben
Indianer ihre Ponys. Der vorderste Reiter saß auf einem
braunweiß gescheckten Mustang. Der rote Krieger trug
kniehohe Wüstenstiefel und einen großen Federkopfschmuck.
In der Rechten hielt er eine gefiederte Lanze.
Cochise trieb seinen Pinto ohne Zögern zu den Indianern
herüber. John folgte mit einer Länge Abstand.
»Ich grüße dich, Häuptling der Pinalenos«, sagte der Chief
mit volltönender Stimme.
»Cochise kommt zur richtigen Zeit«, erwiderte der

85
Apachenführer grimmig. »Wir kämpfen nicht gegen die
Bleichgesichter. Wir sind auf dem Kriegspfad, um einen
Verräter zu bestrafen.«
Der Pinaleno blickte Haggerty argwöhnisch an.
»Das ist Falke, mein Bruder«, sagte Cochise. »Er denkt sehr
oft wie ein Apache, Gelber Adler.«
Haggerty ließ sein Pferd etwas vorgehen und verhielt es auf
gleicher Höhe mit Cochises Tier.
»Ich grüße dich, Gelber Adler«, sagte John in der Sprache
der Apachen. »Mein Herz ist schwer, und ein Schmerz lebt in
meinen Eingeweiden. Denn in deinem Gebiet geschieht etwas,
das den Frieden zwischen unseren Rassen zerstören kann.«
Cochise machte eine kaum merkliche Handbewegung, und
Haggerty schwieg.
»Wir fanden tote Chiricahuas«, sagte der große Jefe. »Wir
fanden Mimbrenjokrieger, die von den Kugeln weißer Soldaten
zerfetzt wurden. Sprich, Gelber Adler, der Falke wird die
weißen, Pferdesoldaten bestrafen. Und ich bin hier, um die
Stämme vom Kriegspfad abzuhalten.«
Der Pinaleno lächelte verzerrt. Es schien ihm schwerzufallen,
seine Worte zu wählen.
»Ein Mimbrenjo kam in unser Gebiet«, sagte er schließlich.
»Er berichtete von einem Überfall der Soldaten. Die Blauhosen
wurden von einem Abtrünnigen meines Stammes geführt. Du
kennst seinen Namen. Er ist Nepatana, und die Gedanken des
Träumers sind bei allen Stämmen bekannt.«
»Also doch«, entfuhr es Haggerty. »Mein Bruder hat besser
und genauer gedacht als ich.«
Gelber Adler begriff nicht, und Cochise erklärte mit wenigen
Worten seine Vermutung, die nun zur Tatsache geworden war.
»Nepatana wird sterben«, versprach der Chief der Pinalenos
grimmig. »Er ist ein Verräter und dem Gesetz des Stammes
verfallen.«
Cochise hob die Linke und erklärte: »Der Falke und ich

86
reiten zu den Blauhosen im Fort. Wir werden herausfinden,
was eigentlich geschieht. Später kehren wir zurück. Wir helfen
dir, daß der Träumer gefaßt und bestraft wird. Das Gesetz der
Apachen ist richtig und gut für uns. Und kein weißer Mann
wird Gewalt über den Verräter bekommen.«
Gelber Adler war zufrieden. Seine Macht, seine Ehre wurde
durch den großen Chief der Chiricahuas nicht angetastet.
*
Weder Cochise noch die Pinalenos ahnten, daß sie von dem
Mann beobachtet wurden, den sie jagten.
Nepatana hatte seinen Mustang weit zurückgelassen, als er
die Rotte Krieger unter Führung des Gelben Adlers entdeckte.
Nur mit den Waffen der Apachen versehen, war der Träumer
zu Fuß aufgebrochen. Im Wolfstrab hatte er die Ausläufer der
Berge durchquert, und nur die Tiere hatten ihn gesehen.
Nepatana lag unter dem Wurzelballen einer halb
umgestürzten Pinie. Die Deckung war hervorragend, denn ein
Berg abgefallener brauner Nadeln verbarg den Scout, der im
Sold der Weißen stand.
Der Träumer verstand jedes Wort, das die Männer
wechselten. Und er zog seine Schlüsse daraus, wußte, daß er
kaum Zeit hatte. Trotzdem wartete er lange. Die Pinalenos
verschwanden wie Schatten. Es schien, als ob sie sich der
Umgebung anpaßten, mit ihr förmlich verschmolzen.
Cochise und Haggerty gerieten außer Sicht. Da erst kroch
Nepatana aus seinem Versteck und starrte blicklos in die weite
Ebene hinab.
Sekunden nur trauerte der Verräter seinem Traum nach, der
ihm – seiner Meinung nach – direkt von Usen geschickt
worden war. Nepatana wußte, daß er nur eine Möglichkeit
besaß: er mußte völlig zu den Bleichgesichtern überlaufen.
Und das bedeutete, daß er vor Cochise und dem Weißen in

87
Fort Grant ankommen mußte.
Nepatana war nicht schlaff geworden in den Jahren, in denen
er die Farm bewirtschaftete. Noch immer waren seine Muskeln
geschmeidig, und das zähe Durchhalten der Apachen war seine
Natur.
So rannte er unter Einsatz seiner ganzen Kraft zu den Bergen
zurück. Das Pony graste auf der Lichtung zwischen den
Kiefern. Mit einem Sprung gelangte der Träumer auf den
Rücken des Tieres, hieb ihm die Fersen in die Weichen und
packte den Graszügel fester.
Der Mustang stürmte los, als wollte er ein Rennen gewinnen.
Sicher galoppierte er über die schmalen Felsenwege, sprang
über Schluchten, Abgründe und durchquerte eiskalte Creeks,
die aus den Pinaleno Mountains rannen.
Es war, als ob der Gedanke an die letzte große Tat den
Träumer beflügelte. Denn er wollte nicht einfach hinnehmen,
daß er gescheitert war.
Den großen Plan, die Vernichtung aller kämpferischen
Apachen, konnte Nepatana nicht mehr weiterführen. Das war
ihm klar. Aber ihm blieb noch die Rache an seinem Stamm.
Die Vergeltung gegenüber jenen Kriegern, die ihn verlacht
hatten, als er vor langen Jahren zum erstenmal von seinem
Traum gesprochen hatte.
Und das Werkzeug dieser Vergeltung würde die
Strafschwadron unter Captain Hagman sein.
Es dunkelte bereits, als der Träumer in der Ferne die
Palisaden des Forts sah. Lange Zeit verharrte Nepatana in der
Deckung einiger Hügel und beobachtete das Fort.
Er wollte die Dunkelheit abwarten, ehe er die letzten
achthundert Yards zurücklegte. Niemand sollte sehen, daß der
Träumer zu den Blauhosen ritt. Denn wurden die Pinalenos
gewarnt, konnten sie ihre Fallen aufstellen, und Nepatanas
Rache blieb unvollendet.
Der Apache hockte zusammengesunken auf seinem Pony. Im

88
Trab hielt das Tier auf das mächtige Balkentor zu. Die Posten
waren aufmerksam. Nepatana hörte ihre Stimmen. Ein Wächter
rief nach dem Sergeanten.
»Was willst du, Mann? Wer bist du?« fragte eine irisch
gefärbte Stimme.
»Ich bin Scout Nepatana«, erwiderte der Träumer. »Ich muß
zu Captain Hagman. Es ist wichtig.«
Sekundenlang blieb es still.
»Miller, mit einem Halbzug hinter das Tor«, befahl der
Unteroffizier. »Die Waffen schußbereit halten. Wenn das ein
Trick ist, feuert ihr ohne Befehl, klar?«
Stiefel trampelten über die Planken des Laufganges.
Gewehrschlösser rasselten metallisch. Und dann schwangen
die Flügel des Tores gerade so weit zurück, daß ein Reiter
durch die Öffnung auf den Appellplatz gelangen konnte.
Nepatana ließ sein Pony im Schritt gehen. Deutlich sichtbar
hielt er die Zügel mit beiden Händen hoch. Keiner der
Blauröcke sollten annehmen, daß der Krieger eine List
versuchte.
»Tor schließen«, rief der Sergeant. »Sicherungsbalken
vorlegen.«
Der Träumer zupfte am Zügel. Willig marschierte der
Mustang nach links, auf die Unterkünfte der Offiziere zu.
»Halt, Scout!« befahl der Anführer des Halbzuges. »Zuerst
will ich deine Medaille sehen. Oder hältst du uns für komplette
Narren?«
Nepatana zügelte sein Tier und fingerte das Metallstück aus
seinem Lederhemd und reichte es dem Soldaten.
»In Ordnung«, sagte der Mann. »Zwei meiner Leute
begleiten dich bis zu Captain Hagmans Unterkunft.«
Die Soldaten marschierten vor dem Träumer her, klopften an
eine Tür und warteten, bis der Captain öffnete.
»Nepatana«, sagte Hagman erstaunt, »was führt dich zu mir?
Komm rein, berichte.«

89
Die beiden Soldaten vollführten eine exakte Kehrtwendung,
nachdem sie salutiert hatten, und stampften davon.
Der Pinaleno glitt vom Pferd und verschwand mit Hagman in
dessen Räume.
»Was ist geschehen?« fragte der Captain ahnungsvoll.
Er war schon den ganzen Nachmittag unruhig gewesen, hatte
gespürt, gewittert, daß etwas schiefgegangen war. Und jetzt
tauchte der Träumer im Fort auf.
»Cochise reitet durch die Berge«, sagte Nepatana schwer.
»Er wird herkommen und mit deinem Chief reden, Kapitän.
Der große Jefe hat Haggerty befreit. Mein eigenes Volk jagt
mich inzwischen. Unser Plan ist gescheitert, Joshua Hagman.«
Der Captain preßte die Lippen zusammen, daß sie wie zwei
blasse Striche wirkten. Damit hatte er nicht gerechnet. Warum
zum Teufel mußte sich Cochise gerade jetzt hier im Norden
herumtreiben?
»Noch ist nicht alles verloren«, murmelte der Apache, und
seine dunklen Augen funkelten im Schein der Kerosinlampe.
»Sprich«, forderte Hagman ihn scharf auf. »Ein einziger
Erfolg bringt uns vielleicht doch noch weiter.«
»Mein Volk jagt mich«, sagte der Träumer. »Laß deine
Soldaten sofort reiten. Ich habe dir gemeldet, daß die Pinalenos
auf dem Kriegspfad sind. Du willst sie vernichten.«
Hagman grinste wölfisch und fuhr selbst fort: »Und in
Wirklichkeit beschäftigen wir uns mit Cochise und Haggerty.
Sind die beiden erst mal tot, sieht's für uns wieder besser aus.
Denn deine Leute, Jack, werden sich bestimmt nicht hier
beschweren.«
Nepatana nickte zufrieden. Hagman hatte sofort begriffen.
Nun kam es darauf an, daß die Schwadron schnellstens das
Fort verließ.
Der Captain rannte zur Tür, riß sie auf und stürmte zu den
Unterkünften der Strafschwadron.
»Sergeant, Alarm«, brüllte Hagman. »Wir rücken sofort aus.

90
Mein Scout bringt mir gerade die Nachricht, daß die Pinalenos
auf dem Kriegspfad sind. Sie wollen in die San Carlos
Reservation einfallen und gegen die Mimbrenjos vorgehen.«
Innerhalb einer Minute wirbelte in den Bretterbaracken alles
durcheinander. Es dauerte nicht lange, bis die Soldaten
antraten. Hagman scheuchte sie zu den Stallungen, und nach
insgesamt fünfzehn Minuten stand die Strafschwadron
abmarschbereit.
Colonel Kilgore trat aus der Kommandantur, ging auf
Hagman zu und fragte scharf: »Captain, was hat das zu
bedeuten? Können Sie mir keine Meldung machen, ehe Sie den
Befehl zum Aufbruch geben? Ich denke, noch bin ich der
Kommandant dieses Forts.«
Hagman entschuldigte sich wortreich und sagte: »Sir, ich
wollte erst die Schwadron in den Sätteln haben. Die Pinalenos
sind auf einem Kriegspfad gegen die Mimbrenjos. Wir müssen
sie aufhalten, bevor sie die San Carlos Reservation erreichen.
Sonst bricht die Hölle aus. Denn Victorio wird sich grausam
wehren.«
»Reiten Sie«, erwiderte Kilgore und drehte sich um, ging in
die Kommandantur zurück.
Er fühlte, daß irgendwas nicht stimmte. Er hatte jedoch keine
Möglichkeit, Hagmans Angaben jetzt nachzuprüfen.
Besorgt horchte der Colonel auf den Hufschlag der Pferde,
als die Strafschwadron das Fort verließ.
*
Nepatana ritt an der Spitze. Er führte die Blauhosen zu seiner
Farm. Natürlich war ihm klar, daß die mehr als hundert Reiter
nicht unbemerkt das Land durchqueren konnten. Irgendwo
lagerten die Späher der Pinalenos.
Sollten sie doch. Sie mußten erst ihrem Chief und Cochise
melden, was sie gesehen hatten. Die Zeit reichte aus, um in die

91
Berge einzudringen und das Dorf zu vernichten.
Aber zuerst wollte Hagman die fünf Männer holen, die er auf
Nepatanas Farm zurückgelassen hatte. Die Schwadron mußte
jetzt zusammenbleiben. Außerdem nutzten die Soldaten im
Blockhaus des Indianers nichts mehr. Sie gerieten höchstens in
Gefahr, von Pinalenos umgebracht zu werden.
Der Captain spielte eine Weile mit diesem Gedanken.
Eigentlich war es doch gar nicht so schlecht, wenn die
Apachen ein paar Soldaten töteten. Das gab seiner Aktion doch
erst die richtige Farbe.
Hagman kam von dieser Überlegung wieder ab. Solange
Cochise und Haggerty frei waren, mußte er alles daransetzen,
diese beiden Männer auszuschalten. Sie würden die Wahrheit
herausfinden, und dann war die Karriere des Captains
schlagartig zu Ende.
Nepatana trieb sein Pony an. Der Apache wollte so weit von
der Schwadron wegreiten, daß ihn die Geräusche nicht mehr
störten. Die Bleichgesichter umgaben sich mit Metallteilen,
knarrendem Lederzeug und hatten die Tiere selbst nicht in der
Gewalt.
Obwohl die Soldaten der Meinung waren, daß sie sich fast
lautlos weiterbewegten, klang es für einen Apachen so, als
rattere eine Maschine durch die Halbwüste.
Der Träumer verhielt sein Tier zwischen einigen
grasbewachsenen Hügeln, und lauschte angespannt. Er spürte,
daß die Späher seines Stammes unterwegs waren, daß sie die
Blauhosen beobachteten, aber er vermochte nicht festzustellen,
wo sich die Pinaleno-Krieger verbargen.
Es war gleichgültig, entschied Nepatana. Sobald das Dorf des
Stammes brannte, die Pferde getötet und Frauen und Kinder
niedergemacht worden waren, würden sich die Krieger schon
stellen. Und vielleicht gelang es, Cochise und Haggerty in dem
Kampfgetümmel ebenfalls zu töten.
Nepatana spürte nicht, daß sich sein Geist verwirrte. Er

92
dachte nicht mehr an den Traum, an sein Ziel. Er brannte vor
Rache, denn dies war das einzige, das er noch erreichen
konnte.
Lange dauerte es nicht mehr, bis die Schwadron seine Farm
erreichte. Die fünf Soldaten schlossen sich dann an, und er
würde Hagman vorschlagen, nach Norden vorzustoßen und aus
Richtung Winter in die Pinalenos einzudringen.
Denn das erwartete der Stamm sicherlich am wenigsten,
einen Überfall von Norden. Natürlich galt es vorher, die
meisten Späher des Gelben Adlers zu töten.
Nepatana starrte mit ausdruckslosem Gesicht in die
Dunkelheit. Die Sterne schimmerten silbrig und kalt am
Himmel. Im Herzen des Träumers aber loderte ein Feuer,
dessen Gluthauch jede normale Regung verschlang.
Er trieb seinen Mustang an, jagte zurück zur Truppe und
meldete Joshua Hagman: »Sie beobachten uns, aber sie werden
nicht angreifen, Captain.«
Hagman war zufrieden. Er lauschte dem Vorschlag des
Scouts, den Stamm von Norden anzugreifen, nachdem die
Schwadron die Berge umgangen hatte.
Der Offizier war beeindruckt. Dieser Apache hätte ein guter
Heerführer werden können. Denn diese Überlegung, diese
Taktik würde die Späher in Sicherheit wiegen. Sie mußten
annehmen, daß die Blauhosen in die San Carlos Reservation
zogen. Der plötzliche Schwenk nach Süden und der schnelle
Vorstoß in die Pinaleno Mountains würde die Krieger
überraschen. Wenn dazu Nepatana noch die Späher des
Stammes abfing und tötete, mußte der Schachzug erfolgreich
sein.
Die Gebäude der Farm waren nicht mehr weit entfernt.
Nirgendwo schimmerte Licht. Hagman war zufrieden. Seine
Männer lagen auf der Lauer.
Auf seinen Befehl hin ließen die Soldaten die Pferde traben.
Das Sattelzeug jankte, und die Gewehre klirrten gegen eiserne

93
Ringe und Haken.
»Sanders, Miller«, rief der Offizier, als er nur noch ein
halbes Dutzend Pferdelängen vom Haus entfernt war. »Ich
bin's, Captain Hagman. Machen Sie sich zum Abritt fertig.«
Die Tür schwang zurück. Zwei Männer traten auf die
Veranda. Hagman erkannte keinen der beiden. Das Sternenlicht
war zu schwach.
»Meldung«, forderte Hagman. »Wo sind die anderen?«
»Sir, Reiter Jones und Reiter Bolton«, sagte einer der beiden.
»Sanders war nach Eureka Springs geritten. Als er nicht
zurückkam, ritten Miller, Archer und Nash ihm nach. Aber
auch sie sind seit heute morgen überfällig.«
Der Captain saß reglos im Sattel. Was bedeutete das?
Nepatana hatte gemeldet, daß Haggerty frei war. Er und
Cochise mußten über die Vorgänge in der Stadt etwas erfahren
haben.
Woher sollte Hagman auch wissen, daß John Haggerty zuerst
allein nach Norden geritten war, daß der große Jefe ihm einen
Späher der Chiricahuas auf die Fährte gesetzt hatte, weil er sich
Sorgen um den Falken machte?
»Wir reiten nach Eureka Springs«, befahl der Captain.
»Zuerst muß ich wissen, ob wir den Rücken frei haben.
Anschließend umgehen wir die Berge und greifen die Pinaleno-
Apachen an.«
Minuten später jagten die Soldaten nach Westen. Weder sie
noch Nepatana sahen, daß sich drei Krieger aus der
Vorratsscheune stahlen. Wie Schatten huschten die Apachen
geduckt davon, rannten im Wolfstrab in das Maisfeld des
abtrünnigen Stammesgenossen. und schwangen sich auf die
Ponys, die zwischen den hohen Stauden gestanden hatten.
Im Galopp jagten die Reiter auf die Berge zu. Dort warteten
Gelber Adler, Cochise und der Falke auf die Nachricht der
Späher.
Es dauerte nicht lange, bis die Krieger das Versteck

94
erreichten. Sie sprangen von den Pferden, liefen in die Senke,
in der die Führer lagerten und berichteten.
Gelber Adler stand auf, als seine Krieger alles erzählt hatten.
»Der Große Geist ist mit uns«, rief der Häuptling der
Pinalenos zufrieden. »Wir werden die Pferdesoldaten
vernichten und große Beute machen. In unseren Jacales werden
die Skalps der Blauhosen trocknen, und noch in hundert
Wintern erzählen die Alten von den Taten unserer Krieger.«
Haggerty stand auf, trat zu Cochise, der mit vor der Brust
verschränkten Armen an einem Felsen lehnte.
»Bruder, das darf ich nicht zulassen«, murmelte John.
»Sicher, es ist eine Strafschwadron. Und ihr Anführer heckte
einen hinterhältigen Plan aus. Aber Gelber Adler wird
vernichtet, wenn er angreift. Wenn nicht von diesen Soldaten,
dann von anderen. Warne ihn, Cochise!«
Der Chief trat vor, hob beide Hände und sagte laut: »Meine
Brüder, hört mich an. Es ist richtig, daß wir uns wehren,
greifen uns die Bleichgesichter an. Aber ich habe Frieden
geschworen, und jeder Apache weiß das. Wollt ihr jetzt
Cochises Wort brechen? Zieht nach Süden, geht zu den
Gelbhäutigen, die unsere alten Feinde sind. Ich sage euch, was
geschieht. Mit Usens Wille werdet ihr die Pferdesoldaten
vernichten. Doch in zwei oder drei Sonnen kommen die
anderen Blauhosen mit ihren Kanonen und den Gewehren, die
ohne Pause feuern. Sie durchkämmen die Berge, töten Frauen
und Kinder und junge Männer, die an der Schwelle zum
Krieger stehen. Und dann sind die Apachen wieder einmal
geschwächt.«
Der Häuptling machte eine Pause und lauschte. Die
Pinalenos schwiegen. Cochise verspürte keine Feindschaft, die
von den Kriegern ausging. Natürlich wollten sie Beute machen
und Skalps nehmen. Aber in dieser Lage war ein solches
Vorhaben zu gefährlich.
»Es ist wichtig, daß unsere starken Krieger überleben«, rief

95
der oberste Führer der Stämme. »Es ist wichtig, daß in hundert
Wintern noch immer Apachen hier leben. Und ein sinnloser
Kampf tötet unser ganzes Volk. Ich will, daß meine Kinder
leben. Geht es nicht darum, einen Verräter nach den Gesetzen
des Stammes zu bestrafen? Reitet ihr nicht aus diesem Grund,
meine Brüder? So beschränkt euch darauf und führt das Leben,
wie wir es seit ungezählten Wintern führen. Ich habe
gesprochen.«
Gelber Adler lachte kaum hörbar. Der große Jefe hatte sehr
geschickt gesprochen. Er bewahrte die Pinalenos vor Verlusten
und wies sie an, nach der Art ihrer Väter zu leben. Das hieß,
listig und trickreich gegen alle Eindringlinge zu kämpfen,
Beute zu machen, Skalps zu nehmen, wo es nur ging.
John Haggerty preßte die Lippen zusammen. Auch der Scout
verstand Cochises Absicht genau. Aber vielleicht gab es
wirklich keine andere Möglichkeit, die kriegerischen Pinaleno-
Apachen vor dem Überfall auf die Strafschwadron abzuhalten.
»Mein Bruder«, sagte der Jefe, »wir trennen uns hier. Ich
ziehe mit Gelber Adler und seinen tapferen Kämpfern hinter
den Soldaten her. Du mußt nach Fort Grant reiten und den
Vater der Pferdesoldaten holen. Es ist besser, wenn sich die
Blauhosen gegenseitig bekämpfen, als daß Apachen töten.«
Gelber Adler lachte laut auf. Diese List gefiel ihm
ausnehmend gut. Haggerty grinste. Cochise war ein gerissener
Fuchs. Wehrten sich die Männer der Strafschwadron, so
mußten die anderen Soldaten auf sie schießen. Und die
Apachen brauchten nur zuzusehen, wie sich ihre Feinde
gegenseitig niedermachten.
»Ich reite sofort los«, sagte John und lief zu seinem Rappen.
Mit einem Satz gelangte der ehemalige Chiefscout in den
Sattel. Er jagte los, nach Südosten, in Richtung Fort Grant.
Cochise und Gelber Adler würden die Pinaleno-Apachen
nach Eureka Springs führen. Haggerty machte sich mächtige
Sorgen um Tla-ina, Larry Osborne und auch Lily. Wenn der

96
Kommandant der Schwadron verrückt genug war, konnte er die
drei als Druckmittel benutzen. Und Cochise würde nicht mal
auf seine Schwester Rücksicht nehmen, wenn es galt, die Ruhe
herzustellen.
Die Hufe des Rappen hämmerten über den Boden. Wie eine
Maschine jagte das Pferd in gleichmäßigem Galopp voran. Ein
Blick zu den Sternen sagte John, daß in etwa drei Stunden die
Morgendämmerung über den Horizont kriechen würde.
Hoffentlich war der Kommandant des Forts kein Sturkopf!
Sonst würde Gelber Adler doch noch mit seinen Kriegern die
Strafschwadron angreifen.
Wie ein dunkler Klumpen wirkten die Palisaden und die
Wachtürme des Forts gegen den helleren Sternenhimmel.
Haggerty ritt auf das Tor zu.
»Halt! Parole!« brüllte ein Posten, und John hörte das
metallische Knacken von Gewehrhähnen.
»Ich muß zu Colonel Kilgore«, erwiderte Haggerty. »Ich bin
John Haggerty. Ich komme im Auftrag von General Howard.
Öffnen Sie, Soldat!«
John verwünschte den Kerl auf dem Laufgang, denn er ließ
sich eine Menge Zeit. Endlich schwangen die Torflügel zurück,
gaben so viel Raum frei, daß der Rappe gerade hindurchpaßte.
»Absitzen!« befahl ein Mann, »legen Sie die Waffen ab und
kommen Sie mit zur Kommandantur. Der diensthabende
Offizier wird sich mit Ihnen beschäftigen.«
Haggerty holte tief Luft und brüllte plötzlich los: »Sind Sie
verrückt, Mann? Ich will sofort zu Kilgore. Und Sie sorgen
dafür, daß in spätestens zehn Minuten Alarm gegeben werden
kann. Die gesamte Besatzung wird aufbrechen.«
Haggerty war früher schon in Fort Grant gewesen. Er trieb
den Rappen an, auf das Gebäude zu, in dem der Colonel
residierte.
»Stehenbleiben, oder ich schieße Sie aus dem Sattel!« brüllte
der Mann hinter John.

97
»Sie sind ein Narr«, erwiderte Haggerty. »Kerle wie Sie
sollte man in West Point zum Säubern der Latrinen einsetzen.
Im Indianerland haben Sie nichts zu suchen, Sie
Paragraphenreiter!«
Die Tür der Kommandantur flog auf. Im Lichtviereck stand
Colonel Kilgore. Hinter ihm sah John einen jungen Lieutenant,
den er nicht kannte.
»Erledigt, Redford«, sagte der Colonel scharf. »Kommen Sie
rein, Haggerty. Wie sind Sie der Falle entkommen?«
John atmete auf. Der Colonel schien also zumindest etwas zu
wissen, und Haggerty brauchte nicht alles zu erzählen.
Etwa zehn Minuten später fluchte Kilgore schauderhaft und
ließ Alarm geben. Innerhalb einer Viertelstunde waren
anderthalb Schwadronen angetreten.
Kilgore baute sich auf der Veranda der Kommandantur auf
und rief: »Soldaten, wir haben eine üble Aufgabe. Die
Strafschwadron unter Führung von Captain Hagman hat
versucht, einen Krieg anzuzetteln. Die Pinaleno-Apachen sind
schon unterwegs. Es wird ein fürchterliches Gemetzel geben,
wenn wir nicht für Ruhe und Ordnung sorgen. Trompeter,
Signal zum Abmarsch! Wir reiten nach Westen, nach Eureka
Springs.«
Haggerty und Lieutenant Brent, der sich nicht länger als
Korporal ausgab, übernahmen die Spitze der langen Reihe von
Reitern.
Und Brent berichtete, daß er als Beobachter im Auftrag des
Oberkommandos hier war. General Sherman hielt den Versuch
mit der Strafschwadron im Apachenland für lohnenswert.
»Nicht einmal General Howard weiß, daß diese Männer
Verurteilte sind«, sagte Brent. »Er hat sich nur gefreut, daß er
endlich von Sherman wenigstens eine Schwadron mehr
bekam.«
Haggerty schwieg lange, aber dann erwiderte er: »Sherman
mag vielleicht ein hervorragender Offizier sein. Meiner

98
Meinung nach ist sein Indianerhaß aber noch größer als seine
militärischen Fähigkeiten. Es ist Irrsinn, so etwas zu
versuchen.«
*
Das Hügelland im Osten der Stadt bot den Soldaten
ausreichend Deckung. Hagman selbst führte eine Patrouille an.
Nepatana ritt voraus. Zwischen einigen halbhohen
Speerdornsträuchern verhielt er sein Pony und sagte zu dem
Captain: »Warte hier, Soldat. Ich spähe. Ich komme bald
zurück.«
Der Pinaleno glitt vom Pferd und schien mit dem Boden zu
verschmelzen. Nach zwei Sekunden konnte Hagman den
Indianer nicht mehr sehen. Der Offizier hob das Fernglas vor
die Augen, stellte es scharf ein und suchte langsam die Häuser
ab. Endlich erschien ein Blockhaus in der Optik, das ziemlich
abseits stand. Bis zu den nächsten Gebäuden lagen mehr als
hundert Yard freies Gelände zwischen den Häusern.
Hagman fühlte, daß in dieser Hütte etwas vorging, das mit
ihm zu tun hatte. Aufmerksam beobachtete er das vordere
Fenster. Er entdeckte ein Gesicht.
Ein Indianer steckte im Blockhaus!
Hagman holte tief Luft. Plötzlich hatte er das Gefühl, in eine
riesige Falle zu laufen. Er wußte noch nicht, wie recht er mit
diesem Eindruck hatte.
Der Indianer bewegte sich zur Seite. Das war ja eine Frau.
Eine Squaw. Widerwillig gestand sich der Offizier ein, daß
diese Rothaut selbst nach den Begriffen der Weißen eine
Schönheit war.
Nun sah er einen Mann, einen jungen Burschen, dessen
Gesicht hart wirkte. Ein Kämpfer vielleicht?
Das mußte die Hütte des Freudenmädchens sein, dachte
Hagman, die Behausung dieser Lily, die Sanders geholfen

99
hatte. Wer war die Squaw? Welcher Weiße hatte sich dort
einquartiert?
Für den Bruchteil einer Sekunde entdeckte der Captain in der
Optik Nepatana. Er wieselte von dem kleinen Stall zum Haus
hinüber und preßte sich an die Seitenwand.
Aufatmend setzte Hagman das Glas ab. Der Apache würde
schon herausfinden, wer im Blockhaus hockte. Vielleicht
nutzten ihm die drei Menschen sogar etwas, wenn er sie
geschickt in seine Pläne einbaute.
Scheinbar endlos dehnten sich die Minuten. Immer wieder
spähte der Offizier zur Hütte hinüber. Plötzlich richtete sich
Neptana zwei Schritte neben ihm auf, als würde er aus dem
Boden wachsen.
»Was hast du erfahren?« fragte Hagman mühsam beherrscht.
»Wer ist die Squaw?«
Der Pinaleno lächelte grausam und erwiderte: »Captain,
vielleicht haben wir doch noch nicht verloren. Die Squaw ist
Tla-ina. Das heißt in deiner Sprache Sanfter Wind. Und sie ist
Cochises Schwester.«
Hagman atmete tief durch. Unglaubliche Erleichterung
wallte in ihm auf. Cochises Schwester. Mit ihr als Druckmittel
konnte er die Apachen in die Knie zwingen.
»Der Mann, wer ist das?« fragte der Captain.
»Die weiße Frau ist Lily«, fuhr Neptana fort. »Und der
Weiße Larry Osborne. Er ist ein Wächterreiter der Postlinie.
Was unternimmst du, Captain Hagman?«
Er lachte grimmig auf und rief: »Wir holen uns die drei. Was
denn sonst? Cochise wird seine Schwester nicht gefährden.
Wenn er die Pinalenos anführt, muß er zurückweichen. Jack,
wir werden Glück haben. Die Kämpfer deines Stammes
sterben. Ich fühle das ganz sicher.«
Der Captain gab seine Befehle. Sofort ritten vier
Soldatengruppen an. Sie trennten sich nach wenigen Yards,
schwenkten ein und umzingelten das kleine Blockhaus. Die

100
fünfte Abteilung bildete eine Sperre gegen die eigentliche
Stadt. Aber dort ließ sich kein Bürger sehen.
Vier Männer ritten offen vor die Hütte.
»Rauskommen!« brüllte einer der Soldaten. »Hände über die
Köpfe und nacheinander rauskommen!«
Nichts rührte sich.
Der Kavallerist zog den Revolver und feuerte auf das
Fenster. Die Glasscheibe zersplitterte in tausend Stücke. Im
Haus wummerte ein Colt. Der Soldat brüllte auf, wurde vom
Einschlag der Kugel rücklings aus dem Sattel geworfen und
rappelte sich mühsam wieder hoch.
Seine rechte Schulter war rot vor Blut.
»Das werdet ihr bereuen«, rief einer der anderen.
Sie hielten die Gewehre schußbereit.
»Wieso?« fragte Larry Osborne. »Ihr marschiert hier auf,
bedroht uns, jagt 'ne Kugel durchs Fenster und benehmt euch
wie Strauchdiebe. Was sollte uns denn passieren?«
»Wir wissen, daß sich eine Apachenrebellin hier versteckt«,
behauptete einer der Kavalleristen. »Und wenn ihr euch mit
den roten Stinkern so gut versteht, habt ihr auch Dreck am
Stecken. Entweder kommt ihr jetzt freiwillig raus, oder wir
zünden euch das Dach über dem Kopf an.«
Larry beriet sich mit den beiden Frauen. Lily wollte natürlich
ihr Blockhaus nicht zerstören lassen. Und auch Tla-ina wußte,
daß sie sich nicht lange gegen eine ganze Schwadron Soldaten
verteidigen konnten.
»Also gut«, rief Osborne. »Wir kommen raus. Aber eine
Minute später will ich euren Kommandeur vor mir sehen.«
»Keine Sorge, der kommt schon«, erwiderte der Soldat
grinsend.
Wachsam belauerten die Uniformierten die Tür. Als erste trat
Lily ins Freie, ging ein paar Schritte zur Seite und machte Tla-
ina Platz.
»Da ist ja die verdammte Rothaut«, grölte einer der Reiter.

101
»Am besten hängen wir sie direkt an, den nächsten Ast.«
Larry Osborne glitt mit geschmeidigen Schritten aus der
Hütte. Die Soldaten schwiegen und musterten den gefährlich
wirkenden Kämpfer aus zusammengekniffenen Augen.
Joshua Hagman trieb sein Pferd an.
Eine Länge vor seinen Gefangenen verhielt der Captain das
Tier und blickte die beiden Frauen und Larry verächtlich an.
»So sieht also ein Mann aus, der mit den Rothäuten
gemeinsame Sache macht«, sagte Hagman. »Ein Verräter an
unserer Rasse.«
Larry lachte belustigt und erwiderte: »So sieht also ein
kompletter Narr aus, der einen Krieg anzetteln will.«
Der Captain beherrschte sich nur mühsam. Am liebsten hätte
er diesen überheblichen jungen Kerl einfach niedergeknallt.
Aber es gab noch eine andere Möglichkeiten!
»Slicker, Potts, Culbert«, rief Hagman. »Entwaffnet den
Kerl. Wir übergeben ihn bei nächster Gelegenheit einem
Richter.«
Larry spürte eine dumpfe Vorahnung kommenden Unheils,
besaß aber nicht die Spur einer Chance. Denn mehr als ein
halbes Dutzend Mündungen waren auf seinen Oberkörper
gerichtet.
Die drei Soldaten saßen ab, stiefelten um ihn herum und
zogen den Colt aus dem Halfter. Zwei rissen Larrys Arme hart
nach hinten und fesselten die Handgelenke.
Auf einen Wink des Captains hin bauten sich zwei weitere
Uniformierte neben Osborne auf.
»Wo ist Haggerty?« fragte Hagman. »Wo treibt sich Cochise
herum? Raus mit der Sprache, Mister.«
»Was denn?« fragte Larry spöttisch. »Wollen Sie mich etwa
durchprügeln lassen, wenn ich schweige? Und so ein Schwein
durfte Offizier werden!«
Joshua Hagman grinste höhnisch.
»Schnappt euch die Weiber«, befahl er. »Zieht ihnen die

102
Sachen aus, aber schön langsam. Und dann soll einer der
Männer, der mit 'ner Peitsche umgehen kann, anfangen.«
Osborne wurde kreidebleich. Nein, das durfte nicht
geschehen!
Die drei Kerle marschierten grinsend auf die Frauen zu.
Stolz, unbewegten Gesichtes stand die Indianerin neben der
Weißen. Lily konnte ihre Furcht nicht unterdrücken. Sie zitterte
am ganzen Körper. Die Apachin legte der Weißen den Arm um
die Schultern und sprach leise auf sie ein.
»Los, fangt schon an«, rief Hagman. »Wie ist es, Mister,
willst du nicht doch reden?«
Aber Osborne grub die Zähne in die Unterlippe und schwieg.
Als die drei Kerle die Hände ausstreckten, grinsend nach der
Kleidung der Frauen faßten, geschah es.
Der vierte Mann, der mit einer Peitsche in der Rechten heran
stiefelte, hob den Riemen, ließ ihn durch die Luft sausen und
scharf knallen.
In diesen Knall mischte sich das Krachen einer Winchester.
Der Kerl mit der Peitsche stand reglos. Zwischen seinen
Augen war plötzlich ein häßliches Loch zu sehen. Und dann
kippte der Bursche langsam nach vorne.
Etwas schwirrte durch die Luft, sauste mit zischendem
Geräusch heran, und drei dumpfe Schläge klangen auf. Die drei
Soldaten vor den Frauen brachen zusammen. Jeder hatte einen
gefiederten Pfeil genau ins Herz bekommen.
»Apachen!« gellte eine Stimme auf. »Die Roten greifen an!
In Deckung, Männer, ehe sie uns das Fell abziehen!«
Hagman behielt die Nerven. Er hieb seinem Pferd die
Absätze in die Weichen. Es sprang aus dem Stand wie eine
Katze vor, rammte mit der Brust die Frauen, die zu Boden
taumelten.
»Schnappt sie euch!« brüllte Hagman. »Haltet sie vor euch!«
Er ritt ein paar Schritte zur Seite, blickte forschend in das
Hügelland, entdeckte jedoch keinen einzigen Krieger.
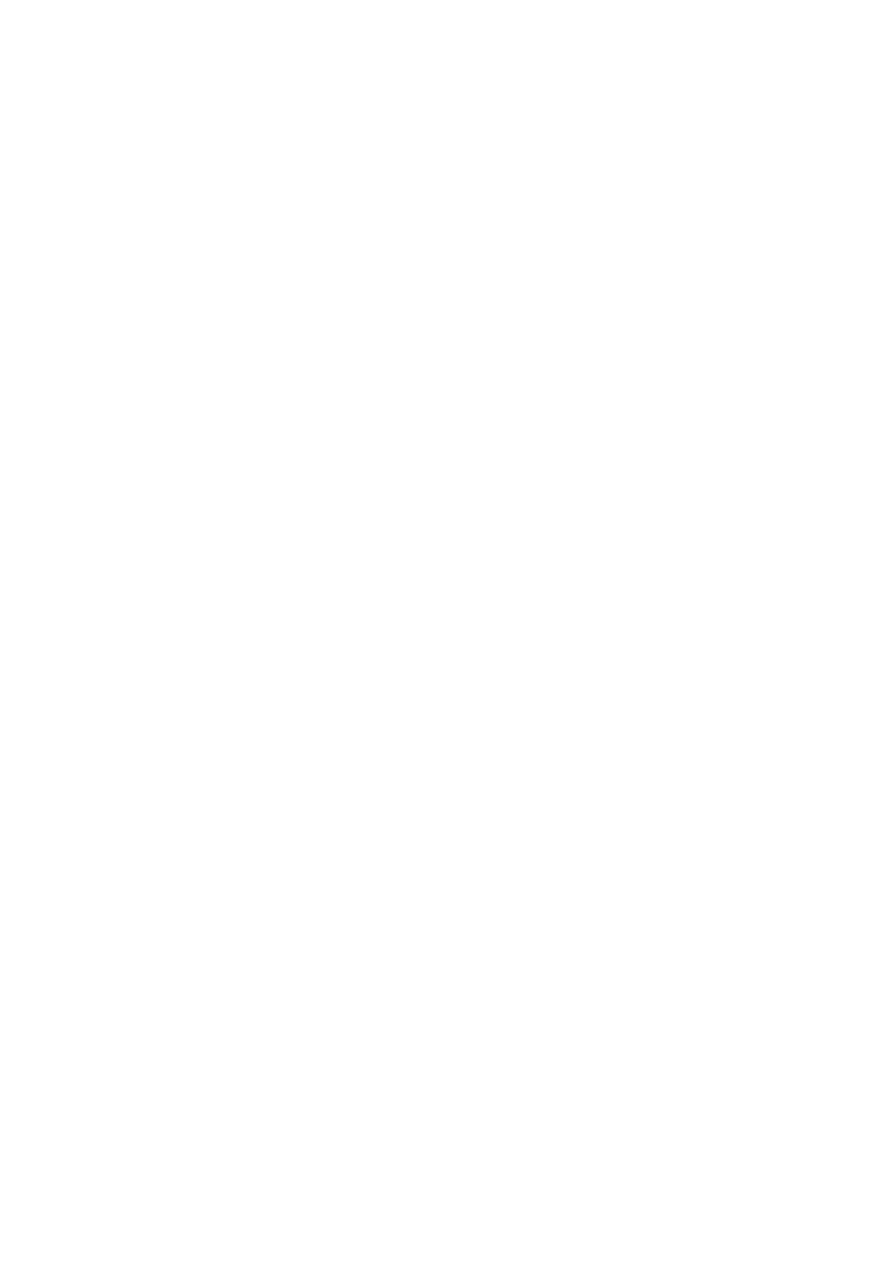
103
»Hört zu!« brüllte der Captain. »Die Squaw ist Cochises
Schwester. Sie stirbt, wenn ihr weiterhin angreift. Was der
Häuptling später mit euch anstellt, weiß ich nicht. Überlegt
euch die Sache gut!«
Hagman zog den Spencer-Karabiner aus der Sattelschlinge
und lud durch.
Nun stand die Partie ausgeglichen, dachte der Captain. Aber
er kannte eben die Apachen noch nicht gut genug.
*
Cochise saß auf seinem Pinto und blickte mit steinernem
Gesicht zu den Gefangenen hinüber. Gelber Adler befahl
seinen Kriegern, vorläufig nicht mehr zu feuern.
»Jefe«, sagte der Pinaleno, »wie lange willst du warten, bis
wir die Blaujacken töten?«
Für ihn war klar, daß Cochise weder seine Schwester noch
die beiden Weißen schonte. Apachen ließen sich nicht auf diese
Art zurückdrängen. Für jeden Menschen kam eines Tages der
Tod. Und es war wichtig, daß ein Krieger im Kampf starb,
seine Ehre nicht verlor.
Auch Cochise wollte weiter angreifen, dachte jedoch an eine
List. Es war sinnlos, und gefährlich, die Pferdesoldaten der
Reihe nach niederzumachen. Vielleicht gab es doch eine
Möglichkeit, Tla-ina, Larry Osborne und der weißen Squaw zu
helfen, sie zu retten.
»Höre, Gelber Adler«, sagte der Jefe bedächtig. »Vielleicht
weißt du, daß Tla-ina und Falke ein Jacale bauen möchten.«
Der Pinaleno verzog das Gesicht zu einer Grimasse und
murmelte: »Ich habe davon gehört. Aber es geht nicht,
Cochise.«
»Ich möchte nicht, daß der Falke meine Schwester tot findet,
wenn er hier eintrifft«, fuhr Cochise fort. »Ich möchte nicht,
daß die anderen Pferdesoldaten auf deine Krieger feuern, wenn

104
sie erscheinen. Denn das müssen sie, wie du weißt. Schick
zwei Späher los. Sie sollen in Richtung Sonnenaufgang reiten
und nach den Soldaten Ausschau halten.«
Gelber Adler nickte und gab seinen Befehl. Der kriegerische
Chief der Pinaleno-Apachen wußte, daß Cochise recht hatte.
Und es war auch richtig, daß sich die Blaujacken untereinander
bekämpften.
»Na, was habt ihr euch überlegt?« rief Hagman höhnisch.
»Verschwindet, gebt auf, aber vorher will ich Cochise hier
sehen. Ich wette, daß er bei euch ist. Los, zeig dich, großer
Häuptling. Schau dir deine Schwester noch einmal an. Sobald
ihr angreift, ist sie tot!«
Der Jefe preßte dem Schecken die Absätze in die Flanken.
»Zwei Adlerschreie, wenn die Blauhosen in der Nähe sind«,
sagte der Anführer der Pinalenos schnell, und Cochise nickte
nur.
Im Schritt marschierte der Pinto aus der Deckung heraus.
Innerhalb Gewehrschußweite verhielt der Jefe seinen Mustang
und blickte zu den Soldaten hinüber.
»Da ist er ja«, brüllte Hagman. »Na, wie hast du dich
entschieden?«
»Kämpfe, mein Bruder!« rief Tla-ina. »Töte diese
Bleichgesichter. Sie müssen sterben. Unser Leben ist
gleichgültig. Töte sie, Bruder!«
Cochise lächelte ein wenig, als auch Osborne schrie: »Los,
macht sie nieder. Das sind keine Soldaten, das ist Abschaum,
Jefe. Diese Kerle geben niemals Ruhe in diesem Land!«
Da! Zwei durchdringende Adlerschreie klangen auf!
Der Falke kam mit der übrigen Truppe. Cochise brauchte
nicht zu entscheiden. Und er war dankbar dafür.
*
Captain Hagman schien zu wittern, daß sich etwas veränderte.

105
Er ließ sein Pferd tänzeln, gab eine Reihe von Befehlen, und
zwei Dutzend seiner Soldaten trieben ihre Tiere an,
galoppierten zwischen die Hügel, um Ausschau zu halten.
Es dauerte nur Sekunden, bis einer der Kavalleristen
heranpreschte, das Pferd hart vor dem Captain zügelte und
meldete: »Sir, anderthalb Schwadronen sind im Anmarsch.«
Cochise legte den Kopf in den Nacken und rief dreimal wie
ein Jagdfalke. Haggerty mußte dieses Zeichen hören und
wissen, daß größte Gefahr bestand.
Kurz nach dem dritten Falkenschrei schmetterte eine
Trompete das Angriffssignal der Kavallerie.
Pferdehufe dröhnten plötzlich auf, trommelten über den
Boden, und eine gewaltige Staubwolke wirbelte zwischen den
Hügeln hoch.
»Einen Kessel bilden!« brüllte Hagman. »Um die
Gefangenen herum. Eine Abteilung auf die Stadt zu. Ihr fallt
den Angreifern in die Flanke. Eine zweite Abteilung nach
Süden, los, schnell, wenn wir eine Chance haben wollen!«
Fassungslos sah der Captain, daß die Soldaten nur zögernd
gehorchten.
Was war mit den Kerlen auf einmal los? Sie mußten doch
wissen, daß es keine andere Möglichkeit mehr gab, als die
Truppen aus Fort Grant niederzukämpfen. Sie alle waren doch
verurteilte Verbrecher, die zur Bewährung in eine
Strafschwadron gesteckt worden waren.
Gaben sie jetzt auf, würden neue Verhandlungen stattfinden,
und die meisten Soldaten mußten befürchten, daß ihre Strafen
verlängert wurden.
»Los, schneller!« brüllte Hagman. »Wenn sie uns
einschließen, ist es aus. Dann haben wir keine Chance mehr.
Zeigt ihnen, wie stark wir sind, daß wir kämpfen werden. Dann
verhandeln sie vielleicht mit uns. Und wenn geschossen wird,
knallt Cochise ab.«
Die Abteilung, die auf die Stadt zuritt, vollführte eine

106
Wendung. Die Pferde trabten zum Blockhaus, wurden
gezügelt, und was dann geschah, ließ Hagman die Augen aus
den Höhlen treten.
Die Soldaten saßen ab und legten ihre Waffen auf einen
Haufen, ehe sie sich auf die Stufen der Veranda setzten.
»Diese Narren«, stöhnte der Captain, »diese elenden
Narren.«
Verbittert sah er, wie sich die übrigen Uniformierten
zurückzogen. Er stand allein.
Wieder schmetterte die Trompete. In Schlachtordnung
preschten die Pferde der Angreifer aus den Hügeln heraus.
Hagman glaubte, ab und zu einen kleineren Mustang zu
erkennen, auf dem eine rotbraune Gestalt hockte.
Verbündeten sich die Pinalenos, die doch harte Gegner der
Weißen waren, hier mit den Bleichgesichtern?
Er erkannte Haggerty auf seinem Rappen und stieß einen
gemeinen Fluch aus. Dieser verdammte Indianerfreund hatte
alles ruiniert.
Nepatana trieb sein Pony an, bis er das Tier neben Hagmans
Pferd verhielt und sagte: »Es ist vorbei, Captain. Unser großer
Plan ist gescheitert. Wir bringen keinen Frieden in dieses Land.
Und dein Wunsch nach mehr Sternen auf deiner blauen Jacke
bleibt für immer unerfüllt.«
»Und was machen wir jetzt?« fragte Flagman böse.
»Wir werden sterben wie Männer, wie Krieger«, erwiderte
Nepatana gleichmütig. »Usen wird unsere Seelen aufnehmen,
denn wir haben gekämpft wie Krieger und sterben wie sie.«
Captain Hagman erkannte Colonel Kilgore. Er trieb sein
Pferd an, galoppierte zwischen Hagman und die Gefangenen
und versperrte dem Offizier das Schußfeld.
»Hagman, geben Sie auf«, rief Kilgore. »Was haben Sie sich
eigentlich bei der Geschichte gedacht? Sind Sie auf einmal
übergeschnappt?«
Joshua mußte es einfach noch mal versuchen.

107
»Nein«, schrie er zurück. »Aber ihr seid alle verrückt. Die
Apachen können wir nur befrieden, wenn wir ihre Kämpfer
töten. Sonst nehmen die Aufstände nie ein Ende. Mein Scout
hatte den gleichen Plan. Wir wollten die kriegerischen
Rothäute nach und nach in Fallen locken und vernichten. In
spätestens einem Jahr würde kein Apache mehr die Waffen
gegen uns erheben. Begreifen Sie das denn nicht?«
Colonel Kilgore schwieg lange. Bedauern lag in seiner
Stimme, als er endlich antwortete.
»Hagman, mit Ihnen ist irgendwas nicht in Ordnung«, sagte
er laut. »Ich bringe Sie ins Fort zurück. Ihre Männer haben
aufgegeben. Sie sind ein Stück schlauer als Sie. Ich schicke Sie
nach Osten, Hagman. Die Ärzte werden sich mit Ihnen
beschäftigen.« Hagman riß die Spencer hoch und feuerte. Dicht
an Kilgore vorbei sauste das Blei und schlug irgendwo in den
Hügel ein.
Cochise wandte sich im Sattel um. Gelber Adler verhielt sein
Pony eine halbe Länge hinter ihm. Ein Dutzend Krieger hielt
die schweren Maulbeerholzbögen bereit. Die Pfeile lagen auf
den Sehnen.
»Der erste Krieger tötet Hagman«, sagte Cochise, und eine
Sehne schnalzte gegen das Handgelenk eines Pinaleno-
Kriegers.
Hagman kam nicht zum zweiten Schuß. Plötzlich erstarrte er
im Sattel. Als er aus dem Sattel kippte, war er bereits tot. Ein
Pfeil hatte sein Herz getroffen.
Kilgores Kopf zuckte herum. Argwöhnisch musterte der
Oberst die Apachen, die sich langsam zusammenfanden.
Gelber Adler blieb hinter Cochise, erkannte so den Oberbefehl
des großen Häuptlings an.
Colonel Kilgore blickte zu den Männern der Strafschwadron.
Keiner der Soldaten hielt eine Waffe in den Händen.
Abwartend standen sie da, starrten zu Boden und erwarteten
das Strafgericht.

108
Haggerty preschte an dem Kommandanten vorbei, er sprang
aus dem Sattel, zog das Messer aus dem Stiefelschaft und
befreite zuerst Tla-ina, die ihm für einen Moment ihre Lippen
bot.
Lilys Zittern verebbte allmählich. Unsicher ging sie zu ihrem
Haus hinüber, sah furchtsam die Soldaten an, die beiseite
rückten, als die Frau kam und in der Blockhütte verschwand.
Larry Osborne grinste und sagte: »Nun, John, es ist ganz gut,
daß Sie nicht eine Stunde später kamen, denke ich.«
Er holte sich seinen Colt, der auf dem Boden lag und
überprüfte die Trommel, ehe er die Waffe halfterte.
Kilgore ritt zu den wartenden Sträflingen in Uniform.
»Männer«, sagte der Colonel ruhig, »ich habe gesehen, daß
ihr Befehle ausgeführt habt. Das ist die Pflicht eines Soldaten.
Aber es wäre auch eure Pflicht gewesen, mich über die
verrückte Absicht des Captains zu unterrichten. Ich weiß
wahrhaftig nicht, was ich mit euch machen soll.«
Haggerty ritt heran, musterte die Uniformierten und faßte
einen Entschluß.
»Colonel«, sagte er laut. »Sie kennen die Vollmachten, die
mir General Howard gab?«
»Sicher, Mr. Haggerty«, erwiderte der Kommandeur.
»Dann empfehle ich, diese Männer nicht weiter zu
bestrafen«, sagte John laut. »Sie sollen ihren Dienst
weitermachen. Und Sie und Lieutenant Brent sorgen dafür, daß
die Strafschwadron entweder nach Osten verlegt oder aber
aufgelöst wird. Wir haben hier im Südwesten wahrhaftig genug
Probleme und können nicht auch noch eine solche Abteilung
beaufsichtigen.«
»Einverstanden«, erwiderte Kilgore, blickte die Soldaten
scharf an und ließ aufsitzen.
»Lieutenant Brent übernimmt das Kommando über die
Schwadron«, rief der Colonel.
Die Männer sammelten sich, nahmen ihre Waffen wieder auf

109
und saßen auf. In exakter Doppelreihe warteten sie auf den
Lieutenant.
»Zurück zum Fort!« befahl Kilgore. »Wir kommen bald
nach. Wenn wir mit den Pinalenos keinen Ärger bekommen.«
»Keine Sorge, Colonel«, sagte Haggerty. »Cochise hat die
Führung übernommen. Und Gelber Adler ist nicht so verrückt,
mit seinen Kriegern eine kampfbereite Schwadron
anzugreifen.«
»Wer hat den Befehl gegeben, Captain Hagman zu töten?«
wollte Kilgore leise wissen.
»Cochise«, murmelte John, »und ich denke, es war richtig,
Sir.«
»Was fangen wir mit dem Träumer an?« fragte der Colonel.
»Das ist nicht unsere Sache«, wehrte Hagman ab. »Er wird
nach dem Gesetz der Apachen bestraft. Mischen Sie sich um
Gottes willen nicht ein. Das könnte einen Aufstand auslösen,
Sir.«
*
Cochise redete mit dem Gelben Adler. Der hochgewachsene
Häuptling nickte schließlich, nahm etwas vom Führer der
Pinalenos entgegen und betrachtete es ein paar Sekunden lang.
Nun saß der Chief ab. Mit gemessenen Schritten ging er auf
Nepatana zu, der reglos auf seinem Pony saß.
Cochise blieb stehen und sagte in der Sprache der Apachen:
»Du bist kein Krieger mehr, Nepatana. Dein Stamm stößt dich
aus. Gelber Adler hat erklärt, daß du den Gesetzen der Pinaleno
verfallen bist.«
Langsam hob Nepatana das Bein über den Rist des Pferdes
und glitt an der Seite des Tieres herab. Der Mann sah so aus,
als wäre er schon tot. Er bewegte sich unendlich langsam, als
müßte er sich zu jeder Bewegung zwingen.
»Was geschieht jetzt?« fragte Colonel Kilgore leise.

110
»Sie erleben das Urteil und seine Vollstreckung«, erwiderte
Haggerty.
Cochise reichte dem Träumer den Gegenstand, den der Jefe
vorhin vom Führer der Pinaleno-Apachen bekommen hatte.
Nepatana hielt den Gegenstand einige Zeit in der Hand.
Schließlich öffnete er den Tuchfetzen, betrachtete mit
ausdruckslosem Gesicht, was er enthielt und kauerte sich fünf
Schritte neben seinem Mustang auf die Fersen.
Mit beiden Händen bedeckte Nepatana die Augen.
»Was bedeutet das?« fragte Kilgore flüsternd.
Haggerty deutete auf den Gelben Adler, der langsam näher
glitt. Lautlos schritt der Häuptling über den Sand.
»Nepatana hat einen kleinen Tomahawk bekommen«,
erklärte John leise. »Er ist das Zeichen des Todes. Entweder
nimmt er das Urteil an, oder er flieht. Dadurch verlängert sich
sein Leben höchstens um Stunden. Denn jeder Apache wird ihn
sofort töten, wenn er ihn sieht. Aber Nepatana hat das Urteil
angenommen.«
Gelber Adler trat seitlich neben den Träumer, hob den
Schädelbrecher, der aus einem lederbezogenen Ulmenholzstab
bestand, an dessen vorderem Ende ein fast runder Stein
befestigt war, der ebenfalls mit Leder umhüllt war.
Und dann schlug Gelber Adler zu. Der Verräter war tot.
Die Pinalenos ritten heran, hoben den Leichnam auf und
galoppierten in die Hügelketten. Minuten später erinnerte nur
noch etwas Blut auf dem Sand an den Tod des Träumers, der
eben diesem Traum sein Ende verdankte.
Haggerty, Cochise, Tla-ina und Larry Osborne wollten zu
den Mimbrenjos weiterreiten. Victorio sollte vom Tod seiner
zwanzig Krieger erfahren, sollte wissen, daß sie gerächt waren.
Denn in seinem Zorn über diese Tatsache könnte der
Weißenhasser sonst zu einem neuen Feldzug gegen die
Bleichgesichter aufrufen. Und sicher würden ihm viele Krieger
folgen.

111
Und gerade das versuchten Cochise und sein weißer Freund
Falke zu verhindern.
ENDE
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Apache Cochise 18 Letzte Huerde vor der Hoelle
Apache Cochise 09 Die Angst der Einsamen
Apache Cochise 03 Mit einem Stiefel in der Hölle
Apache Cochise 30 Brut der roten Woelfe
Apache Cochise 33 Rote Spaeher im Niemandsland
Apache Cochise 06 Die Fehde der Freunde
35?deralistyczna z ducha krytyka nacjonalizmu
AH 64 Apache [PKL 35 1997 05]
Apache Cochise 29 Blutsbrueder des Falken
Apache Cochise 13 Apachen kennen kein Erbarmen
Apache Cochise 25 Cochise in Noeten
Apache Cochise 26 Das wilde Rudel
Apache Cochise 07 bis zum bitteren Ende
May Karol Winnetou der rote gentelman
Apache Cochise 04 Cochise, die Geissel Gottes
Heinlein, Robert A Der rote Planet
Apache Cochise 12 Kein Apache stirbt allein
Apache Cochise 02 Mit dem Abend kam das Grauen
Apache Cochise 36 So long, Cochise
więcej podobnych podstron