

Alexander Calhoun
Duell im Blizzard
Apache Cochise
Band Nr. 11
Version 1.0

Prolog
Als die weißen Amerikaner Mitte des 19. Jahrhunderts den
Südwesten der USA zu besiedeln begannen, stießen sie auf ein
indianisches Volk, das bereits die Spanier und Mexikaner hatte
teuer dafür bezahlen lassen, daß sie unbefugt in ihre
Jagdgründe eingedrungen waren.
Die etwa ein Dutzend umfassenden Apachen-Gruppen und
Großsippen, am gefürchtetsten die Chiricahua-Apachen,
widersetzten sich der Niederwerfung durch die Weißen mit
allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln.
Sie überfielen zunächst Postkutschen, Frachtwagenzüge,
Armeepatrouillen, Farmen, abseits gelegene Ranches und
kehrten anschließend wieder zu ihren Stützpunkten in den
Bergen zurück, den sogenannten »Apacherias«, die bei den
Weißen der damaligen Zeit als uneinnehmbar galten.
Der Widerstand flammte zum blutigsten und grausamsten
Grenzkrieg der Indianergeschichte auf, als Cochise von
Mangas Colorados die Führung der Stämme übernahm.
Cochises Weitblick ließ ihn letztlich erkennen, daß der
Untergang der roten Rasse eine von den Weißen beschlossene
Sache war, die Anspruch erhoben auf alles Land zwischen den
Dragoon Mountains im Südosten, dem Mogollon-Rim im
Westen und der Gran Desierto im Süden.
Cochises Chiricahuas, die Kerntruppe seiner Streitmacht,
blieb im Angesicht der unaufhaltsamen Flut weißer Siedler,
Goldgräber und Desperados nur noch eine Devise: Raube,
ohne erwischt zu werden, töte, ohne getötet zu werden. Ein
Kampf ohne Erbarmen entflammte in den Canyons, Tälern und
Wüsten. Ein Kampf, dessen Schilderung in dieser Serie nicht
die ganze Brutalität wiedergeben kann, wie sie uns die
Geschichte überliefert hat.

1871 gelang es Cochise, die meisten Stämme der Apachen zu
einer einzigen Widerstandsfront gegen die Eindringlinge aus
Nord und Süd, Weiße und Mexikaner, zu vereinen. Die
blutigsten Massaker auf beiden Seiten waren die Folge.
Auf ihren flinken Ponys überfielen die Krieger in kleinen
Gruppen Wagenzüge und Posthaltereien im Norden, um am
nächsten Tag schon Farmer und Goldgräber im Süden oder
eine Patrouille der Army im Westen anzugreifen.
Militär und Siedler waren macht- und hilflos und ohne eine
Möglichkeit gezielten Widerstandes den ständigen
Apachenangriffen ausgesetzt.
Wenn 1870 General Sherman nach Washington schrieb:
»Wir führten einen Krieg gegen Mexiko, um Arizona zu
bekommen, wir sollten jetzt einen Krieg führen, um dieses Land
wieder loszuwerden«, so kennzeichnen diese Worte die
verzweifelte Hilflosigkeit des Militärs.
Diese nach authentischen Überlieferungen verfaßte Serie soll
dem größten aller indianischen Führer ein Denkmal setzen:
Cochise.
Dem Wirken dieses Mannes und seinem Weitblick für
politische Veränderungen ist es zu verdanken, daß diese Story
mit ihrer ganzen Dramatik wahrheitsnah niedergeschrieben
werden kann.
Unsere Autoren fühlen sich verpflichtet, neben der
Herausstellung der abenteuerlichen Charaktere, die in jener
Zeit Geschichte machten, auch der historischen Wahrheit die
Ehre zu geben.
Nichts soll verschwiegen, nichts hinzugefügt oder entstellt
werden.
Ihr Martin Kelter Verlag

***
Cochise war zwei Stunden vor der Dämmerung immer noch
wach. Der Wind wehte jaulend durch die Felsen und über das
Plateau. Er seufzte unten im Canyon wie die Seelen unzähliger
Gemarterter. Weit entfernt heulte ein Kojote.
Die meisten Lagerfeuer waren erloschen. Vereinzelt glühten
einige noch wie dämonische Augen in der Finsternis. Victorio,
der Mimbrenjo-Häuptling, warf seine Decken ab und stand auf.
Er fror, als er an den Rand des Plateaus trat und über die
karstige Gebirgslandschaft blickte, die grau und
verschwommen im Licht des Morgens lag.
Zwei Chiricahuas hielten in der Nähe Wache. Sie wußten,
daß Victorio angekündigt hatte, die Station ganz allein mit
seinen Kriegern anzugreifen. Die großsprecherische Art hatte
Nana und Chato nicht so recht gefallen.
Loco dagegen und Chihuahua, ein Krieger der Chiricahuas,
waren gegen Victorios Absicht gewesen. Loco deswegen, weil
er das Unsinnige des Vorhabens verurteilte, und Chihuahua,
weil er den Verlust von Beute und Skalps befürchtete.
Victorio starrte in den Canyon und schätzte die Stellungen
der Soldaten ein. Sehen konnte er nichts bei den Häusern. Alles
lag im Dunkel.
Cochise, der Victorio noch um einen halben Kopf überragte,
kam an seine Seite.
»Bruder, du gehst mit deinen Mimbrenjo-Kriegern einen
schweren Weg.«
Victorios Hand wedelte verächtlich.
»Ich überrenne sie beim ersten Ansturm, Koh Cheez. Die
gesamte Beute wird den Mimbrenjos zufallen, und die
Chiricahuas gehen leer aus.«
»How!« sagte Cochise.

»Zwei Stunden bis zum ersten Frühlicht«, fuhr Victorio fort.
Nana und Chato kamen ebenfalls heran und starrten hinunter
auf den Paß.
»In zwei Stunden wird es kein einziges Bleichgesicht mehr
hier oben geben. Das Land der Chiricahuas wird frei sein.«
»Du denkst an das, was du mir versprachst, Victorio? Der
weiße Häuptling und Thomas Jeffords werden verschont.«
Cochises Stimme klang sehr eindringlich, fordernd. Victorio
triefte förmlich vor Widerwillen und Abneigung. Er erinnerte
sich an sein gegebenes Wort und nickte.
»Ihnen wird kein Haar gekrümmt, Koh Cheez.«
»Und den drei Weißen, die von Süden kommen und zur
Station reiten, auch nicht?«
»Ich habe es versprochen, how!«
»How«, besiegelte Cochise den Bund. Er wußte, daß es dem
Mimbrenjo schwerfiel, ein solches Versprechen zu halten.
Unbeweglich standen die beiden Häuptlinge auf dem Plateau
hoch oben über dem Paß. Hinter ihnen bewegten sich graue,
verschlafene Gestalten und fachten die Feuer wieder an. Das
Lager erwachte.
»Der neue Tag bricht an.«
Cochise sagte es leise, wie zu sich selbst. Victorio und Nana
verstanden ihn jedoch. Ihre scharfen Ohren vernahmen selbst
den kleinsten Laut.
»Was wird er bringen?« fragte Chato.
Alle Unterhäuptlinge und Sippenanführer hatten sich
inzwischen eingefunden und hinter Cochise versammelt.
Chihuahua und Ulzana trugen Militärjacken, die sie gefallenen
Soldaten abgenommen hatten. Sie deckten mit ihren Leibern
Cochises Rücken.
Hier wurde deutlich, daß nicht immer Friede und Eintracht
zwischen den Stämmen herrschte. Oft hatten sie sich
gegenseitig bekriegt. Es war vielen Kriegern zur Gewohnheit
geworden, sich auch gegen Apachen anderer Gruppen oder

Stämme abzusichern.
Cochises hochragende Gestalt stand unbeweglich. Er blickte
zum Himmel. Ein seltsames grünes Licht ging von diesem
Sonnenaufgang aus. Cochise war wie fasziniert davon. Und
ganz plötzlich sagte er: »Ich sehe den Himmel und viele
Soldaten. Wie ein Heuschreckenschwarm stürzen sie aus
diesem gräßlichen Licht in unser Lager, die Köpfe voran, die
langen Messer in den Fäusten. Und sie führen etwas mit, das
ein breites Maul hat und Feuer speit. Nicht nur Feuer, auch
Stahl.«
Victorio drehte sich halb zu Cochise herum und sah ihn
ebenso erstaunt wie verwirrt an. Hatte Cochise eine Vision?
Selbst die Chiricahuas im Hintergrund zogen ängstlich die
Köpfe ein.
Zu viele Dinge waren schon von Medizinmännern und den
Alten vorausgesagt worden, und das Übel war, daß diese
Traumbilder auch eingetroffen waren. So nimmt es einen nicht
wunder, daß die Indianer felsenfest an die Wirklichkeit von
Visionen glaubten und sich danach verhielten.
Das Licht im Osten wurde greller, grüner, an den Rändern
gelb und rosa. Ein märchenhafter Sonnenaufgang. Für
Naturschönheiten hatte Cochise keinen Sinn, nicht in diesem
Augenblick, wo es um Gedeih oder Verderb der Apachen ging.
Das giftige Grün des Himmels veränderte sich zunehmend.
In seiner Mitte erschien ein violetter Punkt.
Die seltsame Farbenzusammenstellung ließ die
abergläubischen Apachen zurückschrecken. Der Punkt zerfloß,
löste sich in unzählige Einzelpunkte auf.
Waren das die Heuschrecken, die Cochise gesehen hatte,
bevor sie sichtbar wurden? Auch die Umgebung veränderte
sich. Die Berge schoben sich näher heran und schienen greifbar
zu werden. Doch alles war nur ein Trugschluß, eine optische
Täuschung.
Chihuahua stöhnte, wich seitlich aus, als Alchesay zur

Gruppe trat und einen langen, prüfenden Blick auf das seltsame
kalte Licht warf. Als wäre mit dem Erscheinen des Häuptlings
der Bann gebrochen, verschwand das grüne Licht schlagartig.
Die Sonne schob sich über den Rand der Berge.
Cochise drehte sich um. Die Krieger waren dabei, sich zu
bemalen. Gelb und zinnoberrote Farbe schmierten sie sich mit
der Spitze des Zeigefingers quer in die Gesichter und zogen
einen diagonal verlaufenden schwarzen Strich durch die
Bemalung.
Pferde waren nicht zu sehen. Victorio griff zu Fuß an, gemäß
der uralten Tradition der Apachen. Mit Messer und Kriegsbeil,
Steinschleuder und Bogen wollte er sie bekämpfen und
besiegen.
Um Cochises Mundwinkel zuckte es kaum merklich.
Als es immer heller wurde, sah man auch die armselige
Vegetation hier oben auf der winzigen Mesa: Agaven, Kakteen,
Disteln, und stachelige Manzanitas. Ein bißchen Sagebrush
wuchs ebenfalls, und der Duft, den die Blüten ausströmten, war
herb und lieblich zugleich.
Weiter hinten und in der Tiefe eines Seitencanyons wuchsen
Chollas und Mescal, an den Hängen Wacholder, verkrüppelte
Pinien und ein paar Korkeichen.
Cochises Blick wanderte weiter. Es hatte den Anschein, als
hätte er dieses, sein ureigenstes Land noch nie gesehen. Kein
Muskel regte sich in seinem wie aus Ton gebranntem Gesicht,
nur seine Augen blieben in Bewegung.
Geronimo wechselte seinen Platz am Feuer und trat zu dem
Jefe.
»Du hast Sorgen, Koh Cheez?«
»Goghlayeh, ich habe große Sorgen.«
»Die Heuschrecken kommen näher?«
Cochise nickte.
»Sie kommen und zerreiben die Apachen. Victorio ist loco,
total loco. Er wird den Untergang unseres Volkes

beschleunigen.«
Geronimo sah in Cochises Blickrichtung. Ein anderes Tal,
das im rechten Winkel auf die kleine Schlucht dort unten links
stieß. Dort gab es Douglasfichten, Pechtannen und noch mehr
Pinien.
Als sich Cochise wieder umwandte, war Victorio
verschwunden. Er sah ihn zwischen den Feuern hergehen, mit
beschwörenden Gesten.
Mit einem Schlag wurde es vollends hell. Ein gellender
Schrei brauste durch das Lager. Apachen sprangen auf die
Füße, schwangen Waffen und Rasseln, und das Gebrüll, das sie
ausstießen, wurde zu einem Inferno unheimlicher Laute.
»Zastee! Tötet!« schrie Victorio.
200 Stimmen fielen ein.
»Zastee!«
*
Captain Thomas Roberts erwachte kurz vor der
Morgendämmerung. Die Trommeln, die während der ganzen
Nacht nicht verstummt waren, wummerten immer noch.
Apachentrommeln…
Zermürbungstaktik, dachte Roberts. Thomas Jeffords trat auf
ihn zu. Er hatte in der ganzen Nacht kein Auge zugemacht. Ihm
ging es um die Existenz der Butterfield-Station, die schon
einmal der Wildheit von Apachen zum Opfer gefallen war.
Er drehte sich eine Zigarette und hielt dem Offizier dann den
Tabak hin.
»Wie war die Nacht, Captain?«
Roberts starrte auf den dunklen Canyon und zuckte mit den
Achseln.
»Still wie ein Grab, bis auf das Trommeln.«
Jeffords lächelte gequält. »Hübscher Vergleich.«
Roberts war mit Drehen fertig und zündete sich die Zigarette

an.
»Etliche meiner Leute benehmen sich recht sonderbar.«
»Was ist los mit ihnen?«
»Ich glaube, sie drehen durch. Einige beten, andere stammeln
wirres Zeug. Es können Psalme sein, die sie daherbrabbeln.
Wenn's an die Haut geht, werden sogar Hartgesottene fromm.«
»Es ist die Nervenbelastung, Captain. Die Apachen sind
Meister in der psychologischen Kriegführung. Ja, ja, das habe
ich fast erwartet. Ich sehe mich ein wenig um.«
Thomas Jeffords verließ den Captain und wandte sich der
Paßstraße zu. Hier draußen war das dumpfe Trommeln noch
lauter zu vernehmen. Er blieb stehen und starrte die Sterne an.
Sie verblaßten – ein Zeichen, daß der neue Tag nicht mehr
lange auf sich warten ließ.
Was mochte er bringen? Leben oder Tod. Eine weitere
Alternative hatten sie nicht. Diesmal konnte Cochise auch ihn
nicht schonen. Es war zuviel geschehen, als daß ihre
Freundschaft hätte noch Bestand haben können.
Achselzuckend kehrte Jeffords um und begab sich ins Haus.
Er hatte seine Männer angewiesen, nur zu schießen, wenn sie
von Indianern angegriffen wurden.
Captain Roberts beobachtete den Canyon. Von seiner
Position aus konnte er das ganze Gebiet beim Paß beherrschen.
Er warf einen Blick über die Schulter zurück. Die Front der
Verteidiger erstreckte sich zwischen Stall und Hauptgebäude.
Die Soldaten hatten Schanzen gebaut. Thomas Jeffords hatte
ihnen Holz dafür zur Verfügung gestellt, sich aber nicht an den
Arbeiten beteiligt. Die in den Boden gerammten drei Fuß
hohen Pfähle waren mit Steinen, Grassoden und Erde
ausgefüllt worden. Hinter der verhältnismäßig kugelsicheren
Deckung knieten oder lagen die Soldaten mit angeschlagenen
Gewehren.
Ein Teil von ihnen schlief. Nur die Geschützbedienungen
konnten sich in dieser Nacht keine Ruhe leisten. Sie hockten

hinter ihren Haubitzen, schwatzten und rauchten.
Roberts ging die Front ab und hatte für jeden Soldaten ein
gutes Wort. Peer Lanning ließ den Kopf hängen. Seine Finger
drehten die Perlen eines Rosenkranzes. Er betete stumm.
Roland Nettleton stand aufrecht, stemmte die geballten Hände
auf das Schanzwerk und starrte aus brennenden Augen in den
Canyon. Hurt Chester betete laut.
»Herr, du bist mein Hirte, mir wird es an nichts mangeln…«
Ein Stück weiter lag ein anderer Soldat auf den Knien, hielt
die gefalteten Hände zum Himmel hochgestreckt und rief laut
in die Finsternis: »Vergib mir meine Sünden, o Herr! Wenn ich
in dieser Nacht sterben muß, nimm mich gnädig in dein Reich
auf.«
Roberts ließ sie gewähren. Müde ging er weiter. Die
Bedienung des ersten Geschützes richtete sich auf, als sie ihn
kommen sah.
»Morgen, Jungs! Nur nicht verzagen, wir schaffen es. Wenn
sie angreifen, dann kommen sie in breitgezogenen Wellen.
Haltet die Rohre tief und laßt die Kartätschen vor ihnen
detonieren. Alles klar?«
»Jawohl, Captain, alles klar.«
Es klang nicht begeistert, eher gedrückt. Roberts verstand die
jungen Leute. Freiwillige. Sie hatten sich den Krieg ganz
anders vorgestellt. Nun sollten sie die rauhe Seite einer
Auseinandersetzung kennenlernen, von der sie keine
Vorstellung hatten.
»Flach schießen«, sagte Roberts noch einmal. »Ganz flach.
Verstanden?«
»Well, Sir, flach. Wir werden sie mit Feuer und Eisen
begrüßen, wenn sie kommen, Sir.«
»Recht so. Immer drauf, was die Rohre halten.«
Er ging weiter. Die stammelnden Gebete, die Flüche und das
Fäusteschütteln rissen nicht ab. Niedergeschlagenheit und stille
Auflehnung waren die beharrlichen Begleiter der stark

dezimierten Truppe.
Plötzlich roch Roberts etwas.
Schnaps? Er schüttelte den Kopf. Schnaps gab es hier oben
nicht. Bereits vor Wochen hatte er ein striktes Alkoholverbot
ausgesprochen.
Und doch… Er stieß auf die Schanzenwache. Zwei Soldaten,
die sich lautstark und mit schwerer Zunge unterhielten. Ward
Hesters fuhr herum, blickte in das strenge Gesicht des
Offiziers.
»Sie haben kein Recht, sich an uns heranzuschleichen«,
knurrte er.
Roberts sah die Flasche. Groß, bauchig und halbvoll stand
sie zwischen den Uniformierten.
Roberts beschrieb in der Dunkelheit mit der Hand einen
Halbkreis.
»Sie stehen so nahe an der Schanze, daß es einem Chiricahua
gelingen könnte, Ihnen ein Messer in den Rücken zu jagen,
bevor sie ihn überhaupt riechen. Dazu sind Sie noch zu
betrunken, Hesters.« Roberts musterte den anderen. Der
Gefreite Hanish konnte kaum noch auf seinen Füßen stehen.
Volltrunken trat er mit erhobenen Fäusten auf den Captain zu.
Roberts lächelte. »Tun Sie nichts, Hanish, was Sie später
bereuen könnten.«
Der Soldat ließ die Arme sinken. Er stützte sich auf sein
Gewehr, das neben ihm an der Schanzverkleidung gelehnt
hatte, und lallte mit bleischwerer Zunge: »Zum Teufel damit,
Captain, wir gehen doch allesamt vor die Hunde. Warum sollen
wir es uns mit einem gehörigen Schuß Alkohol nicht leichter
machen?«
Roberts bückte sich, nahm die Flasche und schleuderte sie im
hohen Bogen ins Vorfeld hinaus. Klirrend zerbarst sie. Hanish
fuhr hoch.
»Du Hund!« keifte er. »Mußt du uns auch noch das letzte
Vergnügen nehmen, bevor wir allesamt in die Hölle fahren?«

Gelassen drehte sich der Captain um. »Wache!« rief er. Ein
Unteroffizier mit zwei Mann tauchten auf. Roberts deutete auf
die beiden Betrunkenen.
»Nehmen Sie sie fest, Corporal Sutter! Ins Haus damit. Mr.
Jeffords wird Ihnen einen Raum zur Verfügung stellen. Der
Posten wird sofort abgelöst.«
»Yes, Sir. Ich melde es Lieutenant Hegemann.«
Roberts nickte und ging am Schutzwall entlang bis zur
nächsten Haubitze. Die Geschützbedienung rauchte und
unterhielt sich leise. Jeweils zwei beobachteten den Canyon.
Wenn ihnen die Augen brannten oder die Müdigkeit sie zu
übermannen drohte, wechselten sie sich ab.
Als sie den Kommandeur der behelfsmäßigen Festung sahen,
standen sie stramm. Der Richtkanonier machte Meldung.
Roberts nickte.
»Schießt flach, wenn sie kommen, Jungs. Und laßt die
Kartätschen vor ihnen krepieren. Wir selbst können sie sicher
nicht aufhalten, aber unsere Kanonen. Alles hängt von euch ab,
Männer. Gute Nacht!« Er lachte. »Man kann schon guten
Morgen sagen, nicht wahr? Bald ist es soweit.«
Er drehte sich um und verschwand in der Dunkelheit.
*
Morgan Rosswell kniff die Lider zusammen, als er zum
Canyon starrte. Er konnte keine Apachen entdecken, aber er
wußte genau wie seine beiden Leute hinter ihm, daß sie dort
draußen waren. Vielleicht besetzen sie die Nebencanyons
weiter unten, vielleicht jagen sie über ihnen auf der Mesa.
Lieutenant Hegemann hatte die betrunkenen Posten
festnehmen und in Ketten legen lassen. Statt ihrer hatte er mit
zwei Soldaten diesen Platz übernommen. Rosswell war
Corporal, einer von vielen in der Armee. Als Freiwilliger war
er mit Leib und Seele Soldat. Aber was sich dort draußen in der

Dunkelheit herumtrieb, entsprach nicht seinem Geschmack von
der Armee.
Er hatte sich das anders vorgestellt. Gutes Essen, Trinken.
Gelegentlich mal einen Schuß aus dem Gewehr abfeuern, um
sich danach den bitteren Pulvergeschmack mit Whisky
wegzuspülen.
Aber Indianer? Dazu Apachen, Chiricahuas und die
blutdürstigen Tontos, von denen man auch in Kalifornien
gehört hatte, die dort draußen wie Katzen herumschlichen,
unsichtbar, unhörbar, und die lautlos töteten. Nein.
Im Osten wurde es grau. Über den Canyonrand flackerte ein
geisterhaftes Licht, das den neuen Tag ankündete.
»Jetzt heißt es aufpassen, George, Busby«, sagte Rosswell,
ließ die brennende Zigarette fallen und trat sie aus.
»Geht's los, Corporal?«
»Ich schätze, ja. Augen auf, Mund zu und Hände ganz ruhig
am Gewehr.«
Die Soldaten lachten. »Wußte gar nicht, daß du auch Witze
machen kannst«, sagte Busby. »Wohl die Angst, was? Hosen
schon voll, Corporal, oder nur halb?«
»Schnauze! Paß lieber auf und halte keine Predigten.«
Ein Stück weiter saß ein Soldat mit dem Rücken am
Schanzkleid, Beine ausgestreckt auf der Erde. Die Bibel lag
geöffnet auf seinem Schoß. Es war zu dunkel, um zu lesen,
doch er kannte den Text auswendig und war überzeugt, von
Gott aus dieser Lage befreit zu werden.
Graues Dämmerlicht füllte die Schluchten. Etwas bewegte
sich unten an der Paßstraße. George sah das katzengewandte
Gleiten zuerst. Er sagte es Morgan Rosswell. Zu dritt starrten
sie hin.
Der Corporal zuckte zusammen, wollte sich aber erst
vergewissern, bevor er Alarm schlug. Das Schweigen wurde
plötzlich durch den scharfen Knall eines Gewehrschusses
durchbrochen. Das Echo hallte von den Steilwänden zurück.

»Angriff!« schrien Roberts und Hegemann aus dem
Hintergrund. »Alle Mann auf die Posten!«
Stiefel wühlten den knirschenden Sand auf. Die Soldaten
nahmen hinter der Brüstung Deckung und suchten nach Zielen.
Sprungbereit standen die Geschützbedienungen hinter ihren
Kanonen.
Hegemann schnallte seinen Revolvergurt um. »Karabiner
überprüfen!« befahl er. »Corporal Rosswell!«
»Yes, Sir.«
»Hastings!«
»Hier!«
»Reynolds!«
»Yes, Sir, am Drücker!«
»Hayes!«
Keine Antwort. Hegemann ließ den Blick über die deutlich
erkennbaren Gestalten streifen. »Hayes!« rief er aufgebracht.
Wieder keine Antwort. Der Lieutenant schob den Feldhut aus
der Stirn.
»Rosswell, wo ist der Corporal Hayes?«
»Keine Ahnung, Sir.«
»Hat ihn jemand gesehen?« fragte Hegemann.
Wieder erhielt er keine Antwort.
Thomas Roberts kam heran. »Ist der Hundesohn vielleicht
desertiert? Weit kommt er bestimmt nicht. So ein Narr.«
»Niemand könnte es ihm verdenken, bei diesen lauernden
Halsabschneidern«, sagte ein Mann in der Nähe.
»Maul halten!« schnarrte Hegemann und…
Alle Diskussionen über eine mögliche Desertation rissen
unter einem gewaltigen Donnerschlag ab. Das erste Geschütz
hatte gefeuert. 100 Yards weiter krepierte die Granate auf der
Paßstraße und streute Eisensplitter nach allen Seiten. Sofort
rief Roberts: »Feuer einstellen! Es wird nur auf meinen
ausdrücklichen Befehl geschossen!«
Weiter unten in der noch immer dräuenden Dunkelheit,

kreischte es so schrill wie von tausend gequälten Katzen. Das
in den Ohren schmerzende Geschrei brach schlagartig ab.
»Volltreffer!« sagte Corporal Reynolds stolz. »Los, ihr
Strauchdiebe, nachladen!« In das Maul der Haubitze wurden
von flinken Händen Kartusche und Granate gestopft.
»Sie kommen!« brüllte jemand weiter hinten an der
Abwehrfront. »Aufgepaßt, sie kommen!«
Thomas drängte an die Barrikade. Die grauen Gestalten
hüpften, krochen und sprangen heran.
»Schießt auf alles, was keine Uniform trägt!« befahl der
Captain. Hegemann, der neben ihm stand, sah ihn verwundert
an.
»Sir, erwarten Sie in dieser Richtung Soldaten?«
»Einen«, antwortete Roberts grob, »Hayes. Es könnte doch
sein, daß er etwas auf eigene Faust unternommen hat. Oder er
ist rausgegangen, um sich die Hosen zu wenden. Achten Sie
darauf, Hegemann. Ich will nicht, daß aus Versehen einer
unserer eigenen Leute erwischt wird.«
Die Mimbrenjos kamen näher. Ein vernichtender Hagel aus
Gewehr und Revolverkugeln schlug ihnen entgegen. Sämtliche
Kanoniere an den Kanonen starrten auf Captain Roberts
herüber.
»Seht ihr den Kerl mit den langen Haaren?« schrie eine helle
Stimme. »Das ist bestimmt Cochise.«
»Er ist es nicht«, sagte Thomas Jeffords, der bei den ersten
Schüssen aus dem Haus gekommen war und hinter Roberts
stand. »Wenn Sie nichts dagegen haben, Gentlemen, werden
Sie in den Genuß kommen, höchstpersönlich von Victorio
skalpiert zu werden.«
Der Captain wirbelte auf den Absätzen herum.
»Woher wissen Sie das, Mr. Jeffords? Der Kerl da vorn kann
doch recht gut Cochise sein, oder nicht?«
»Nein«, erwiderte Jeffords bestimmt. »Ich kenne Cochise.
Und ich kenne auch diesen Indianer. Es ist der Mimbrenjo-

Häuptling Victorio. Er wird nach seiner gewohnten
Kampfesweise angreifen, heimlich und schleichend, das
Messer zwischen den Zähnen, die Streitaxt oder die Schleuder
in den Händen.«
»Lieber Himmel, Mr. Jeffords, sind Sie Hellseher?«
»Sie meinen, Sie wissen nicht, woran ich das erkenne?«
»So ist es.«
»Sehen Sie die Krieger ganz vorn?«
»Well. Und?«
»Erkennen Sie den Unterschied?«
»Ich weiß nicht, was Sie meinen?«
»Apachen, die in den Nahkampf gehen, flechten ihr langes
Haar zu Zöpfen. Verstehen Sie jetzt?«
Thomas Roberts nickte. »Danke für den Hinweis, Mr.
Jeffords.«
»Keine Ursache.«
Sie blickten auf die minütlich heller werdende Paßstraße.
Man konnte bereits weiter als 200 Yards sehen. Über die
gesamte Paßbreite verteilt, stürmten zwei Reihen
furchterregend bemalter Krieger heran. Sie verschwanden, als
hätte sie der Erdboden verschluckt, sprangen wieder auf und
liefen gebückt weiter.
»Achtung!« schrie Roberts. »Auf Kommando Salvenfeuer…!
Feuer!«
Es krachte und peitschte.
»Laden!« befahl Lieutenant Hegemann und rannte über den
Platz zwischen den Bauwerken. »Los, Jungs, laden!«
Die Salve hatte keine große Wirkung gezeigt. Die erwartete
Panik unter den Rothäuten war ausgeblieben. Die meisten
Schüsse hatten kein Ziel gefunden, weil sich die Indianer
einfach hingeworfen hatten, als sie den Befehl gehört hatten.
Wie eine graue bewegliche Wand stürmten die Mimbrenjos
heran. Ihr Kriegsgeschrei schien das Blut der Weißen zu Eis
erstarren zu lassen. Allen voran Victorio mit seinen

Unterhäuptlingen Chato und Loco. Nana war zurückgeblieben.
Er war für einen solchen Sturmangriff nicht mehr jung und
beweglich genug, und er legte keinen Wert mehr auf Skalps.
»Erstes Geschütz feuerbereit!« rief Captain Roberts.
»Geschütz gerichtet und bereit zum Feuern, Sir.«
»Feuer!«
Der Abschuß machte die Soldaten vorübergehend taub. Als
sich der Pulverrauch verzog, sahen sie die verheerende
Wirkung der Schrapnellgranate. Mehr als zwanzig Apachen
wälzten sich auf dem Boden.
Das sporadische Einzelfeuer der Kavalleristen und
Infanteristen streckte manche der Rothäute nieder, die im
Schutz von Gesteinsbrocken und Büschen herankrochen.
Unbekümmert stürmte die Spitzengruppe vor. Victorio war
nur noch 20 Yards von dem Vorbau entfernt. Hinter ihm
rannten die beiden anderen, schwangen ihre Waffen und
brüllten, als wollten sie die Weißen mit ihrem Kriegsgeschrei
lähmen.
»Zweites Geschütz feuerbereit!«
»Gerichtet, Sir.«
»Feuer!«
Der Richtkanonier hatte den Lauf fast nach unten gestellt und
ein Ziel anvisiert, das gefährlich nahe der Barrikade lag, hinter
der die Soldaten die Köpfe einzogen.
Die Explosion der Kartätsche riß etliche Apachen von den
Beinen. Aber das spontane Triumphgeschrei erstickte in den
Soldatenkehlen, als sie drei Indianer vor sich auftauchen sahen,
deren Ziel das zweite Geschütz war.
Lieutenant Hegemann griff sich drei oder vier Leute und lief
zur Unterstützung der Geschützbesatzung hinüber. Mit einem
Riesensprung flog Victorio über die Schutzwand. Chato und
Loco folgten und schwangen ihre Kampfbeile. Der erste Soldat
beim Geschütz, der sie abwehren wollte, mußte dafür mit
seinem Leben bezahlen.

Ehe sich die drei Indianer über die restliche Bedienung
hermnachen konnten, war Hegemann mit seiner Gruppe heran.
»Schlagt sie nieder!« fauchte er. »Ich will sie lebend!«
Chato warf sich ihm entgegen. Ein Kampf von Mann zu
Mann trieb den Offizier immer weiter zurück. Hegemann
ahnte, daß ihm der Mimbrenjo im Nahkampf weit überlegen
war, und griff zur Waffe.
Der Gefreite Jack Eving, drehte sein Gewehr herum, hob den
Kolben hoch und schlug damit auf Victorio ein, der mit Loco
die Geschützbedienung attackierte. Victorio brach zusammen
und rührte sich gar nicht mehr.
Im Hintergrund der Szene donnerte das zweite Geschütz,
schossen die Soldaten in unregelmäßigen Abständen. Chato sah
die Mimbrenjos reihenweise fallen. Das war Hegemanns
Rettung. Der Unterhäuptling rief Loco ein paar Worte zu, ließ
von Hegemann ab und sprang über die Wehrmauer zurück.
»Feuer einstellen!« befahl Roberts und lief zu Victorio.
Hegemann kniete gerade bei dem Häuptling am Boden und
untersuchte ihn. Er sah auf, als Roberts herankam.
»Muß einen Schädel aus Eisen haben«, sagte er. »Er kommt
bald wieder zu sich. Wir fesseln ihn besser, Captain, sonst geht
er uns noch durch die Lappen wie die anderen beiden.«
»Wer schlug ihn zu Boden?« fragte Roberts und drehte sich
im Kreis.
Jack Eving trat vor. »Ich, Sir.«
Roberts ging auf ihn zu, klopfte ihm begeistert auf die
Schulter.
»Das bringt Ihnen das Verdienstkreuz ein, Eving, und eine
Beförderung.«
»Danke, Sir.«
Zwei Soldaten verschnürten Victorio kunstgerecht. Jeffords
kam herüber und starrte düster auf den Mimbrenjo, der die
ersten Lebenszeichen von sich gab.
»Wo sollen wir mit ihm hin?« wandte sich einer der

Blauröcke an Hegemann.
»Laßt ihn erst mal liegen. Er wird sich nicht gleich 'nen
Schnupfen holen.«
Er und Captain Roberts gingen zusammen bis zur Schanze.
Kein Apache war mehr zu sehen, weder ein lebender noch ein
Toter. Auf dem Paß war es taghell und warm geworden.
Zufällig warf Roberts einen Blick auf die Höhe.
»Großer Gott!« rief er aus. »Sehen Sie nur dort oben,
Hegemann!«
Der Lieutenant folgte der Aufforderung. Als er die Gestalt
erkannte, lief ein kaltes Rieseln über seinen Rücken.
»Cochise!«
»Ja, Cochise. Wenn er mit seinen Chiricahuas über uns
kommt, haben wir nichts mehr zu bestellen.«
»Wir schlugen ihn schon einmal, Sir.«
»Im Paß, sicher, außerhalb seiner gewohnten Kampfesweise.
Ein solcher Fehler wird Cochise nicht wieder passieren. So
tölpelhaft Victorio in die Schlünde unserer Kanonen rannte, so
gerissen wird Cochise seinen Angriff vorbereiten. Machen wir
uns nichts vor, wir sind in einer schlechten Position.«
*
Cochise beobachtete den Angriff von der erhöhten Plattform
aus. In seiner Konzentration bemerkte der Jefe nicht, wie sich
ihm von hinten Naiche, Ulzana und Chihuahua näherten.
Die Gruppe stellte sich hinter Cochise auf, wagte ihn aber
nicht zu stören. Sie alle sahen die verheerende Wirkung der
Haubitzen und erkannten, daß Victorio viel zuviel versprochen
hatte.
Die ersten Krieger strömten rückwärts, um aus dem
Gefahrenbereich der Kanonen zu kommen. Victorio und die
beiden Unterführer der Mimbrenjos stürmten wie schnaubende
Bisonbullen weiter. Victorios heldenhafter Einsatz endete mit

seiner Gefangennahme. Die beiden anderen Apachen konnten
fliehen.
Es wurde still dort unten im Paß. Kein langes
Triumphgeschrei der Weißen, keine weiteren Schüsse. Sie
sparten Munition und verhielten sich disziplinierter als
Apachenkrieger. Cochise nahm jede Phase des Geschehens in
sich auf. Grimm durchflutete ihn. Nicht etwa Grimm auf die
Langmesser, sondern auf Victorio.
Das sinnlose Anrennen hatte die Mimbrenjos über 100
Krieger gekostet, ein unersetzbarer Verlust für die
Apachenstreitmacht. Cochise drehte sich um. Er sah verstörte
Gesichter in seiner Umgebung, geballte Hände, mühsam
zurückgehaltenen Zorn und sagte nichts.
Es gab nichts zu sagen. Der Blutzoll war für die Apachen zu
hoch gewesen. Sie würden lange Zeit brauchen, um ihrem
Kriegerstamm neue Leute zuzuführen.
Cochise setzte sich mit hängendem Kopf an das noch immer
brennende Feuer. Niemand störte ihn. Zweimal hatten die
Apachen trotz gewaltiger Übermacht den Kampf gegen das
kleine Häuflein Soldaten verloren, und das stimmte sie
nachdenklich, machte sie mürrisch und unberechenbar.
Verwundete und gesunde Mimbrenjos gingen zum Plateau
zurück. Sie schleppten Tote und Schwerverletzte. Irgendwo
wummerte eine Baumtrommel. Die dumpfen Töne hallten laut
durch die Gebirgswelt, ließen die Weißen beim Paß
aufhorchen.
Nana kam herangeschlürft. Er konnte sich aufgrund seines
vorgerückten Alters erlauben, den Jefe in seiner Meditation zu
stören. Er blieb stehen, breitete die Arme aus und blickte auf
die gegenüberliegenden Bergspitzen.
»Der Große Geist hat sein Angesicht vor den Apachen
verborgen und seine segenden Hände den Bleichgesichtern
zugewandt.«
Cochise sah auf. Er erkannte den ganzen Jammer in der

gebeugt stehenden Gestalt des alten Kriegers und
Sippenführers.
»In vielen Jacales wird es Heulen und Wehklagen geben.
Unsere Squaws werden ihre Köpfe mit der reinigenden Asche
des Feuer bestreuen und im Winter von Wurzeln und Pflanzen
leben müssen. Kein Fleisch wird in ihren Töpfen sein und die
Kinder nähren.«
Nana war noch nicht zur Sache gekommen. Mit dem Pathos
seiner Rasse fuhr er langatmig und von vielen Gesten begleitet
fort: »Victorio, unser Anführer, sorgte stets für übervolle
Fleischtöpfe. Victorio ist von den Bleichgesichtern
gefangengenommen worden und erleidet Qualen unter ihren
Martern. Wie lange soll der Anführer der Mimbrenjos noch…«
Cochise sprang so schnell auf, daß er den alten Krieger aus
dem Konzept brachte.
»Nana, mäßige dich! Victorio wird nicht gemartert. Die
Bleichgesichter strafen ihre Gefangenen nicht mit Marter,
sondern mit Tod.«
»Wie kann ich mich mäßigen, wenn das Maß übervoll ist?«
»Du bist alt genug, um es gelernt zu haben.«
»Ich bin noch nicht alt genug, um mit anzusehen, wie mein
Volk hungern muß, weil…«
Wieder wurde er unterbrochen. Cochises Entschluß stand
längst fest, doch er wollte sich die eigene Entscheidung nicht
aus der Hand nehmen lassen und erst darüber sprechen, wenn
seine Pläne ausgereift waren.
»Schweig und gehe! Victorio wird befreit werden. Geh
jetzt!«
Eskaminzin und Alchesay standen mit einigen Kriegern in
der Nähe. Sie warfen erstaunte Blicke auf den Jefe. Manchmal
verstanden sie ihn nicht mehr. In der Regel dann, wenn er
dabei war, ganz bestimmte Entscheidungen zu treffen.
Nana schlich mit gesenktem Kopf davon. Cochise hatte ihn
zurechtgewiesen, das kränkte ihn. Schließlich war er kein

einfacher Krieger, der auf einen Fingerzeig des Häuptlings
gehorchte.
Alchesay wandte sich an Cochise: »Du willst Victorio
befreien lassen?«
»Ich selbst werde ihn befreien. Nur Naiche wird mich
begleiten. Naiche ist mein Sohn und ein großer Krieger. Warte,
bis es Nacht wird.«
»Apachen kämpfen nicht während der Dunkelheit.«
»Ich will und werde nicht kämpfen, Alchesay. Nur Victorio
befreie ich, danach ziehe ich mich mit Na-Cheez zurück.«
»Hast du keine Angst, daß die Bleichgesichter hier
heraufkommen?«
Cochise schüttelte den Kopf.
»Nein, Alchesay. Sie sind wie Hunde, die ihre Wunden
lecken. Kein weißer Mann wird sich hier oben sehen lassen.«
Naiche hatte die Worte seines Vaters gehört und kam zum
Feuer, setzte sich mit untergeschlagenen Beinen und starrte in
die Glut. Cochise saß ihm wie in Trance gegenüber. Seine
Gedanken waren weit fort.
»Naiche, du willst mich sprechen?«
»Ich wollte dir sagen, Koh Cheez, daß ich mit meiner ganzen
Kraft helfen werde, Victorio zu befreien. Heute abend?«
»Zwei Stunden nach Dunkelwerden. Um diese Zeit sind sie
vollgegessen und faul. Die Posten schwatzen miteinander und
sind unaufmerksam. Halte dich um diese Zeit bereit, Na-
Cheez.«
Wie schon so oft bewunderte der Sohn den Vater, der
Krieger den Anführer, der Paladin den König. Langsam stand
Naiche auf.
*
»Old Vic«, wie ihn die Weißen nannten, lag
zusammengeschnürt unter dem offenen Dach der Schmiede

und starrte wütend auf den Vorplatz. Soldaten biwakierten
zwischen den Gebäuden, lachten und scherzten, beachteten ihn
kaum. Es ging auf Mittag zu. An einem Feuer wurde in einem
großen Kessel eine Mahlzeit gekocht. Der Duft von Fleisch
ließ ihn spüren, daß er seit vielen Stunden nichts gegessen
hatte.
Keiner der weißen Häuptlinge war erschienen, um ihn zu
demütigen. Auch das Bleichgesicht, das die Station befehligte,
hatte er noch nicht zu Gesicht bekommen.
Ein grimmiges Lächeln umspielte Victorios Mund. Damals
hatte er mit mehr Erfolg die Station angegriffen und sie
teilweise vernichtet. Diesmal aber war es ihm trotz seiner
Großsprecherei nicht gelungen, und das wurmte ihn.
Cochise und seinen Chiricahuas hatte er imponieren, ihnen
beweisen wollen, daß ein Chiricahua längst nicht das
vollbrachte, was ein Mimbrenjo konnte.
Die Weißen hatten den Angriff abgeschlagen, ihn gefangen
und seine Krieger in die Flucht getrieben.
Langsam dämmerte die Wahrheit über seine Niederlage in
ihm. Die Geschütze waren es gewesen, die ihnen diese böse
Überraschung beschert hatten. Seine Krieger waren trotz ihres
Heldenmuts im Eisenhagel der Feuerschlünde verblutet.
Mit dieser Erkenntnis kam ihm eine zweite. Waren die
Kanonen dann nicht in der Paßstraße schuld an Cochises
Niederlage gewesen? Hatte er dem Jefe Unrecht getan?
Knirschende Schritte vertrieben seine Gedankengänge. Er
blickte den drei Bleichgesichtern entgegen. Thomas Jeffords,
Captain Roberts und Lieutenant Hegemann blieben vor ihm
stehen. Victorio musterte sie aufmerksam. Er sah keinen
Triumph in ihren Augen, und sie weideten sich auch nicht an
seiner Hilflosigkeit.
»He, Old Vic!« sagte Jeffords leutselig. »Pech gehabt, was?«
Victorio gab keine Antwort. Er betrachtete das Gesicht des
Häuptlings der Pferdesoldaten. Roberts lächelte.
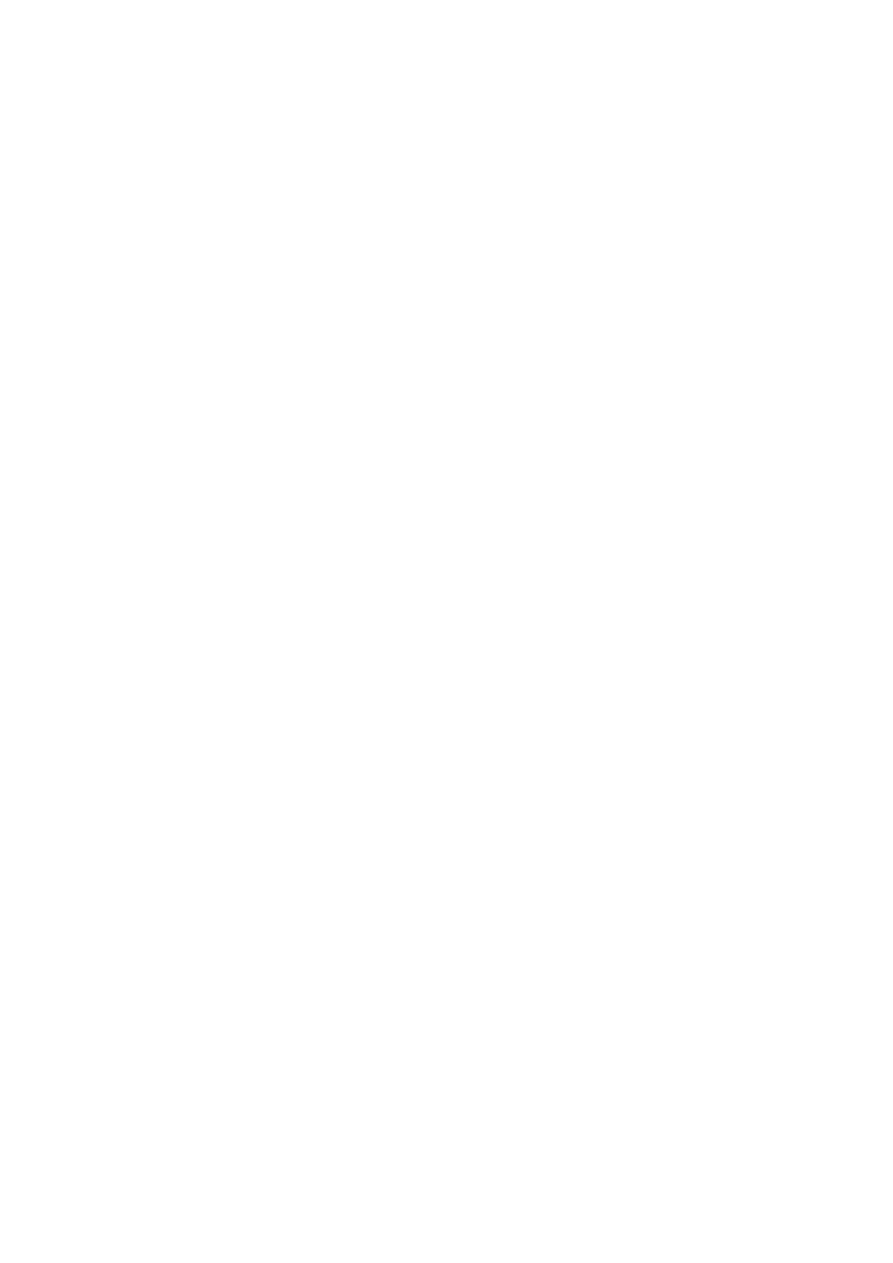
»Ist der tapfere Häuptling der Mimbrenjos vor Angst stumm
geworden?« bohrte Jeffords vorsichtig weiter.
Victorio spuckte aus.
»Kein Weißer flößt einem Mimbrenjo Angst ein,
Bleichgesicht. Was willst du?«
»Mit dir reden, was denn sonst. Du und deine Krieger seid
geschlagen worden. Die Mimbrenjos sind geflohen, ihr
Häuptling ist Gefangener der Armee. Was glaubst du, was mit
dir geschieht?«
Der Häuptling spuckte wieder verächtlich aus.
»Martert mich, ihr werdet keinen Laut der Klage hören. Tötet
mich, ich werde euch verlachen. Was also, Bleichgesicht, willst
du von mir?«
»Wir werden dich nicht martern und auch nicht töten, Old
Vic. Ich will mit dir Frieden schließen und einen Vertrag
machen.«
»Ein sprechendes Papier?«
Jeffords nickte. »Ein sprechendes Papier, wie ihr Indianer
sagt. Wenn du auf das eingehst, was ich will, bist du frei und
kannst gehen, wohin du willst.«
»Sage mir, was du willst. Victorio hört zu.«
»Friede, Häuptling. Die Garantie, daß keine Überfälle auf
meine Station und Kutschen mehr erfolgen. Für diese Zusage,
die mit der Friedenspfeife besiegelt werden soll, wirst du frei
und kannst zu deinen Kriegern zurückkehren.«
»Und wenn ich dir diese Zusage nicht gebe?«
Jeffords machte eine gleichgültig wirkende Handbewegung.
Er war aber alles andere als gleichgültig.
»Dann überlasse ich dich den Pferdesoldaten, Old Vic. Sie
bringen dich nach San Carlos, dort wirst du vor ein Gericht
gestellt und verurteilt.«
»Wie verurteilt? Zu was verurteilt?«
Thomas Jeffords machte eine ernste Miene.
»Man wird dich am Hals aufhängen und strampeln lassen, bis

du tot bist. Weißt du, wie das ist, wenn ein rauher Hanfstrick
dir die Luft abschnürt und du ganz langsam an Luftmangel
zugrunde gehst? Victorio, dieses Schicksal möchte ich einem
tapferen Häuptling der Mimbrenjos ersparen.«
Victorios glühende Kohlenaugen musterten den weißen
Mann, der ihm mit dem Blick gedroht hatte. Wütend zischelte
er: »Ihr habt mich gefangen, meine Krieger getötet oder in die
Flucht geschlagen. Es gelang mir nicht, euch zu vertreiben oder
wie Ungeziefer zu vernichten. Ich habe so hart gekämpft, wie
ich es vermochte. Meine Krieger fielen rings um mich und
starben. Es war mein Schicksal, von euch gefangen zu werden.
Es war eine trübe Sonne, die am Morgen aufging und heute
abend in einer dunklen Wolke versinken wird. Es war die letzte
Sonne, die auf Victorio niederschien. Sein Herz ist tot, und
seine Seele ist ihm vorausgeeilt in die Ewigen Jagdgründe.
Tötet mich, Bleichgesicht. Tötet nicht nur meine Seele,
sondern auch meinen Körper. Ich habe nichts getan, für das
sich ein Apache schämen müßte. Du, Bleichgesicht, kennst
unseren Grund zu kämpfen. Die Weißen sollen sich schämen,
nicht wir. Die Weißen verachten die Indianer und vertreiben sie
von ihren Jagdgründen. Sie nennen uns Heiden, Bastarde,
Ratten und Ungeziefer. Weißt du, wer die Ratten und das
Ungeziefer sind?«
Thomas Jeffords ließ beschämt den Kopf sinken, dann sagte
er: »Ich bin Cochises Freund. Warum verfolgst du mich mit
deinem Haß?«
»Schrei Haß in den Wind, weißer Mann. Und wenn er dir
antwortet, weißt du, warum ich dich aus diesem Land
vertreiben will. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Gib den
Langmessern den Befehl, mich zu hängen.«
»Cochise ist mein Freund«, wiederholte Jeffords, beeindruckt
von der Standfestigkeit des Mimbrenjos.
Der spuckte den Weißen an.
»Du warst dabei, als ein anderer weißer Häuptling Cochises

Bruder und Neffen aufhängen ließ. Sei verdammt,
Bleichgesicht! Cochise haßt dich genauso, wie ich dich hasse.«
Thomas Jeffords drehte sich um.
»Gehen wir«, sagte er. »Sein Haß gegen alles Weiße macht
ihn blind und unvernünftig. Kommen Sie, Captain, ich sage
Ihnen, was wir tun werden.«
Sie gingen ins Haus zurück und setzten sich in den
Speiseraum, wo die Passagiere sonst abgefertigt wurden.
Thomas ließ heißen Kaffee und Tassen kommen und bediente
die Offiziere aus Kalifornien.
»Was schlagen Sie vor, was mit ihm geschehen soll, Mr.
Jeffords? Ich bin gern bereit, ihn bis Fort Bowie
mitzunehmen.«
Jeffords trank aus dem Blechbecher.
»Nein, das geht nicht«, sagte er. »Die Armee wird ihn
verurteilen, hängen oder in die Sümpfe nach Florida schicken.
Was meinen Sie, Gentlemen, was das für böses Blut in diesem
Land geben würde? Nicht ein einziger Apache ließe sich mehr
in der Reservation halten.«
»Sie können ihn aber nicht ewig gebunden dort draußen
liegen lassen.«
»Das ist nicht meine Absicht, Captain. Sehen Sie, ich muß
mit den Indianern zusammen leben. Nicht nur das, ich bin für
die Fahrgäste der Gesellschaft und für den reibungslosen
Ablauf der Linie verantwortlich. Wenn ich ihm ein Haar
krümme, wäre ich hier oben am Paß keine Minute lang meines
Lebens sicher.«
»Nun gut, das sehe ich ein. Aber…«
Jeffords unterbrach ihn.
»Ich lasse ihn heute nacht laufen.«
Hegemann sah den Postmeister ungläubig an.
»Eine merkwürdige Diplomatie, Sir. Meinen Sie nicht
auch?«
»Aber zweckmäßig und geeignet, Indianer und Weiße zu

versöhnen.«
Roberts fragte zweifelnd: »Sie glauben daran, Mr. Jeffords?«
»Ganz fest.«
Plötzlich wurde es vor dem Haus laut. Jubelnde Stimmen
waren zu vernehmen.
»Was hat das zu bedeuten?« fragte Hegemann ahnungsvoll.
Jeffords zuckte mit den Achseln.
»Gehen wir nachsehen, Gentlemen. Etwas Schlimmes ist es
jedenfalls nicht.«
Sie verließen das Haus und blieben auf dem Treppenpodest
stehen. Durch den Paß ritten drei Männer. Einer von ihnen
hatte einen Stern auf der Brust, war verwundet und mußte von
den anderen im Sattel gestützt werden. Seine Begleiter kannte
Jeffords. Insgeheim atmete er auf, denn er hatte sich um
Osborne und Tinatra wahrlich genug Sorgen gemacht.
Burt Kelly, der Posthelfer, und Norbert Walker kamen über
den Vorplatz. Jeffords gab Anweisung, ein Krankenlager für
den verwundeten Gesetzesmann herzurichten.
Umjubelt von den Soldaten ritten die drei auf das
Stationsgelände und hielten vor dem Haupthaus ihre Pferde an.
*
Die Sonne war längst untergegangen. Ein kühler Wind pfiff
durch den Sattel. Victorio hatte Essen und Trinken verweigert
und die beiden Stationshelfer verspottet. Er hatte sich
vorgenommen, lieber zu verhungern, als von den
Bleichgesichtern Almosen anzunehmen.
Über den schmalen Ziegenpfad vom Plateau herunter in den
Seitencanyon bewegten sich zwei gleitende Gestalten, die mit
traumwandlerischer Sicherheit in der absoluten Dunkelheit
ihren Weg fanden.
Naiche folgte Cochise. Vom Pfad aus hielten sie auf die
Paßstraße zu. Nichts rührte sich. Das Schweigen hing wie eine

Glocke über dem Canyon.
Der Häuptling hielt an einer Stelle an, wo ein Felsvorsprung
dunkle Schatten auf die Paßstraße warf. Sand und Geröll
glitzerten. Ein paar Büsche warfen Schlagschatten.
Cochise und Naiche beobachteten das Umfeld, die
Canyonsohle. Sie sah so leer aus wie ein Mondkrater. Etwas
drängte den Jefe, umzukehren. Victorio war nicht gerade einer
seiner Anhänger, aber er war Apache. Und nur das zählte für
einen anderen Apachen.
Cochise huschte über den Pfad und nutzte jede noch so
kleine Deckung aus. Oberhalb einer Gruppe von Silberdisteln
blieb er stehen. Er lockerte das Messer in der Scheide, gab
Naiche ein Zeichen und schlich den Hang hinunter. Wie ein
Panther auf der Jagd.
Cochises Nerven waren aufs äußerste angespannt. Er nahm
den scharfen Geruch der Disteln wahr, den etwas süßlicheren
der Kakteenblüten, die noch immer die Tageswärme
ausstrahlten. Er rührte sich nicht. Nur seine Augen bewegten
sich, als er die trostlose Landschaft vor sich beobachtete.
Seine Nasenflügel vibrierten, als er die Luft prüfend einsog.
Etwas verwirrte ihn und machte ihn vorsichtig. Die Soldaten
waren keine 100 Yards von ihm entfernt und unterhielten zwei
kleine Wachfeuer. In seinem Rücken, vernahm er die kaum
wahrnehmbaren Geräusche des ihm folgenden Naiche.
Er war stolz auf seinen Sohn, nachdem er seinen ältesten
Sohn Taza bei einem Coup in Sonora verloren hatte. Naiche
entwickelte sich ganz nach dem Geschmack eines
Apachenkriegers.
Alle seine Söhne – Taza, Naiche und Nachise – waren von
seiner ersten Frau Sho-shu-li, die eine der Töchter des großen
Mimbrenjo-Häuptlings Mangas Coloradas war. Sho-shu-li war
tot. Seine zweite Frau, Nahlekadaya, war noch jung und
stammte von den Nedni-Apachen in Sonora ab. Yuh war ihr
Vater, und Yuh war der Häuptling der Nednis.
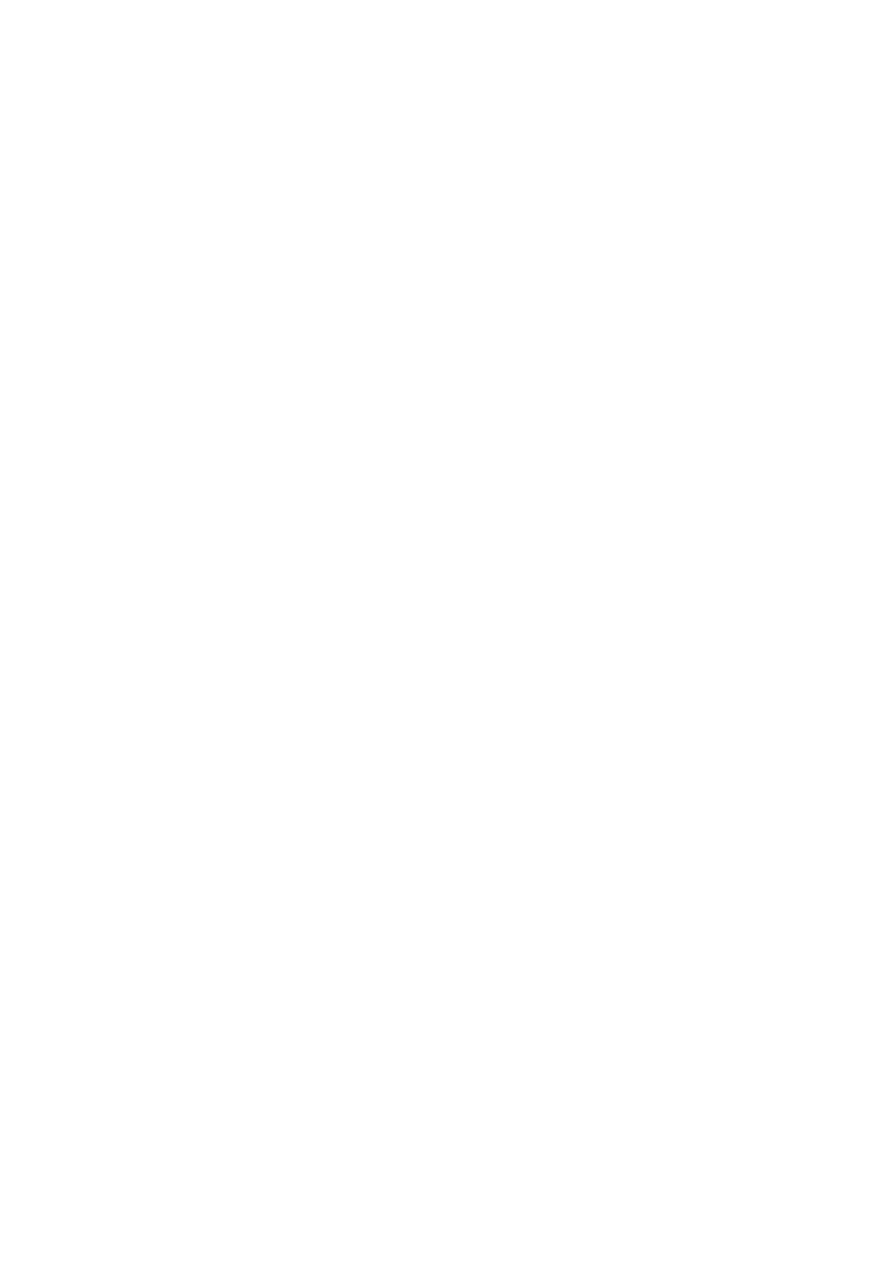
An all das dachte Cochise, während Naiche an ihm
vorbeiglitt und die Spitze übernahm. Cochise kannte die
stumme Sprache der Apachen auf dem Kriegspfad so gut wie
jeder andere Chiricahua. Naiche orientierte sich nach vorn.
Cochise dagegen sollte den Flankenschutz übernehmen.
Ihm war es recht. Junge Büffel müssen sich die Hörner
abstoßen, ehe sie erwachsen werden. Naiche tat es, und er
machte seine Sache nicht einmal schlecht, wie der Jefe mit
Befriedigung feststellte.
Wie Schlangen glitten sie durch den Schutz der Schatten an
der Felswand. Naiche blieb klugerweise links von der Straße.
Das gab ihm Gelegenheit, von hinten auf das Grundstück der
Station zu gelangen. Auch das registrierte Cochise mit
Befriedigung.
An den Wachfeuern patrouillierten Soldaten. Sie waren blind
und taub wie alle Weißen während der Nacht. Und wenn sie
plötzlich überfallen wurden und starben, wußten sie nicht
einmal, wer sie getötet hatte.
Die beiden Apachen duckten sich noch tiefer auf den Boden
und nutzten jede noch so kleine Deckung aus. Sie gelangten
hinter den Stall. Dort verschnauften sie zunächst. Cochise
orientierte sich. Vom Plateau aus hatte er gesehen, wie die
Offiziere und Jeffords Victorio in der Schmiede besucht hatten.
Vom nächsten Wachfeuer ertönte lautes Lachen. Einer der
Soldaten hatte wohl einen Witz erzählt. Mochten sie lachen,
um so leichter gelangten die beiden Krieger in die Schmiede.
Kaum zehn Yards trennten sie noch von dem offenen
Gebäude. Sie konnten Victorio nicht sehen, weil es zu
gefährlich war, die Köpfe zu heben.
Cochise tat es zwischen zwei Atemzügen doch. Jemand hatte
dort vorn gewütet. Brandspuren und gewaltsame Zerstörungen
waren an jedem Haus zu erkennen. Thomas Jeffords hatte die
bei Victorios Angriff angerichteten Schäden zum Teil
reparieren lassen, aber es war nur notdürftig geschehen.

Der Häuptling setzte sich wieder in Bewegung. Ein Messer
und ungefähr zehn Yards standen zwischen ihm und der Hölle,
wenn einer der Posten herüberkam, um nach dem Gefangenen
zu sehen. Er hatte sein Ziel erreicht und keine andere Wahl,
Victorio zu befreien, wenn er das verlorene Vertrauen bei
seinen Chiricahuas wieder zurückgewinnen wollte.
Nur noch fünf Yards. Bevor Cochise und Naiche, der sich
hinter ihm hielt, Victorio sehen konnten, rochen sie ihn. Er lag
zwischen Amboß und Esse. Man hatte ihn gefesselt und einen
Knebel in den Mund geschoben.
Für Sekunden verspürte Cochise so etwas wie
Schadenfreude. Er kroch zwischen allerlei Unrat hindurch und
tippte Victorio auf die Schulter. Der Mimbrenjo zuckte
zusammen und wandte den Kopf.
Seine Augen wurden starr, als er Cochise ins Gesicht blickte
und Naiche sah. Er nickte. Glanz trat in seine Augen. Cochise
entfernte zunächst den Knebel. Als er anfing, die Knoten des
Lassos aufzuknüpfen, mit dem sie den Mimbrenjo gebunden
hatten, regte sich etwas beim Haupthaus.
Die Tür ging auf. Ein breiter Lichtstreifen beleuchtete die
Treppe, auf der ein Mann erschien. Sein rötlicher Bart
kontrastierte mit dem braunen Gesicht. Thomas Jeffords kam
die Treppe herunter und näherte sich der Schmiede. Cochises
Finger wurden schneller. Die ersten Knoten und Schlingen der
Fessel fielen.
Victorio war frei, als Jeffords noch 20 Yards entfernt war. Er
kroch hinter die Esse und richtete sich dort halb auf. Jeffords
erschien im angeleuchteten Rechteck zwischen Dach, Erde und
den Pfosten.
Verwundert blieb er stehen, als er Victorio nicht mehr an
seinem Platz fand. Er bückte sich, nahm das Seil auf und drehte
es in den Händen. Langsam und furchtlos drehte er sich um
und blickte auf die gewaltige Esse mit dem Rauchabzug. Sie
war das einzige Versteck, hinter dem sich ein ausgewachsener

Mensch verbergen konnte.
Jeffords zog keinen Revolver. Er erhob seine Stimme nicht
und brüllte einen Warnschrei in die Nacht. Cochise, der ihn
beobachtete, bewunderte ihn in diesem Augenblick. Statt die
Posten zu alarmieren, flüsterte Thomas: »Old Vic, ich kam, um
dir die Freiheit zu geben. Du kannst gehen. Es wird dir nicht
das geringste geschehen.«
Jeffords hörte den Nachtwind, der durch die Büsche strich.
Und das Lachen der Soldaten bei den Feuern. Knistern. Ein
leises Knacken.
»Victorio, ich sagte, du bist frei. Es ist nicht nötig, daß du
mir eine der Rundstangen über den Schädel schlägst«
Das Knistern wurde zu einem leisen Schürfen. Mokassins
glitten über den gestampften Lehmboden. Eine Gestalt tauchte
auf und schob sich zwischen Jeffords und den Amboß.
»Niemand wird dich schlagen, Hellauge.«
Thomas glaubte seinen Ohren nicht trauen zu können.
»Cochise?«
Der Häuptling kam auf ihn zu. Er überragte Jeffords um
Haupteslänge.
»Ich bin es«, sagte der Jefe gedämpft.
Naiche erhob sich aus seiner kauernden Stellung, kam heran
und blieb hinter seinem Vater stehen. Nur Victorio ließ sich
nicht blicken. Scheinbar traute er dem Friedensangebot des
Weißen nicht. Mußte er nicht die Rache der Stationsbewohner
fürchten, die er angegriffen und deren mühsam errichtete
Bauten er zerstört hatte? Es war ein paar Monate her, aber
Victorio wußte, daß die Bleichgesichter ein gutes Gedächtnis
hatten.
Cochise deutete auf den jungen Krieger.
»Mein Sohn Naiche, Hellauge. Du kennst ihn, und er kennt
dich.«
»Ich bin dein guter Freund, Naiche. Sei herzlich willkommen
auf der Station.«

Naiche verneigte sich genauso hoheitsvoll wie sein Vater.
»Du willst Victorio die Freiheit geben?«
»Er ist bereits frei, ich brauche sie ihm nicht mehr zu geben.«
Keine Frage nach der Anwesenheit des Chiricahua-
Häuptlings und seines Sohnes. Jeffords war der geborene
Taktiker, der sich nichts anmerken ließ, weder Erstaunen noch
Neugier.
»Der weiße Häuptling ist damit einverstanden?«
»Du meinst Captain Roberts? Ja, der Vorschlag ging von ihm
aus. Er ist nicht blutrünstig und ein Freund der Apachen.«
»Er schützte mein Leben, ich weiß es.«
»Wo ist Old Vic? Ich sehe ihn nirgends.«
Cochise drehte sich um. Er sagte etwas in seiner kehligen
Sprache in die Dunkelheit, aber nichts rührte sich. Ein wenig
erstaunt ging er hinter die Esse.
»Victorio zog es vor, sein Schicksal selbst in die Hand zu
nehmen.«
»Traut er dem Wort eines Weißen so wenig, Jefe?«
Cochise gab keine Antwort. Beim Haus ging die Tür wieder
auf. Roberts kam ins Freie, um die Wachtposten zu inspizieren.
Ein Schatten glitt in seiner Nähe aus einem Gestrüpp. Etwas
Geschmeidiges sprang hoch und stürzte sich auf den Offizier.
Captain Roberts wurde von dem Anprall zu Boden gerissen
und stieß einen unterdrückten Warnschrei aus. Indianer wie
Weiße unter dem Dach der Schmiede sahen hinüber. Mit einem
grunzenden Laut setzte sich Cochise in Bewegung.
In langen Sätzen lief er über den gerodeten Platz zwischen
Haupthaus und Schmiede. Er stürzte sich auf die miteinander
Ringenden. Für den nächsten Augenblick sahen Jeffords und
Naiche nur wirbelnde Körper, zuckende Gliedmaßen,
Mokassins und Stiefel.
Eine in Blau gekleidete Gestalt wurde aus dem Knäuel
herauskatapultiert und zur Seite geschleudert. Mühsam und
keuchend erhob sich Captain Roberts. Dessen Rolle hatte

Cochise eingenommen. Victorio wehrte sich verzweifelt, hatte
aber gegen die gewaltigen Kräfte des Chiricahua keine Chance.
Cochise richtete sich auf, zerrte den angeschlagenen Victorio
mit auf die Füße. Die Blicke der Indianer kreuzten sich wie
Klingen.
»Der Hund, der seinen Herrn beißt, der ihm Futter reicht, soll
erschlagen werden.«
Victorio fuhr auf. Seine Augen funkelten vor Haß.
»Kein Mimbrenjo hat einen Herrn. Seit wann sind
Bleichgesichter Herren der Indianer?«
»Sie sind es nicht. Sie werden es auch niemals sein. Aber
Dankbarkeit kann man auch einem Weißen zollen, zumal man
sich in seiner Gefangenschaft befindet.«
»Wofür Dankbarkeit?«
»Er ließ dich frei, Victorio.«
Der spuckte Cochise verächtlich vor die Füße.
»Ich hätte mich selbst befreit und verzichte auf einen
Gnadenerweis durch ein Bleichgesicht. Rühr mich nie wieder
an, Koh Cheez.«
Er sprach es und war verschwunden. Cochise wandte sich
Roberts zu, der an der Hauswand lehnte und seinen gewürgten
Hals hielt.
»Wir sind quitt, Hellhäutiger. Cochise zieht im
Morgengrauen mit seinen Kriegern ab.«
Er hob grüßend die Hand und ging in Richtung Schmiede.
Thomas Jeffords trat ihm entgegen.
»Cochise, ich danke dir für deine Hilfe. Ohne dich wäre
Captain Roberts vermutlich verloren gewesen.«
»Das war ich ihm schuldig. Cochise vergißt nie eine gute
Tat.«
Die alten Freunde sahen sich lange an. Sie versuchten in den
Augen des jeweils anderen verborgene Gedanken zu lesen.
Beide waren ohne Falsch. Sie gehörten verschiedenen Rassen
an, aber es gab überall und zu jeder Zeit aufrechte Männer,

denen ein gegebenes Wort noch etwas galt.
Cochise und Jeffords waren Freunde, trotz allem, was
passiert war, und sie wußten es. Naiche räusperte sich und trat
an die Seite seines Vaters.
»Unsere Aufgabe ist erfüllt. Laß uns gehen.«
Der Häuptling nickte und wandte sich an Jeffords: »Werden
uns die Soldaten zurückhalten, Hellauge, oder…?«
Thomas unterbrach ihn hastig. »Der Jefe aller
Apachenstämme kam als freier Mann hierher, er geht auch als
freier Mann. Im Haus seines Freundes Hellauge ist er stets
willkommen. How!«
Cochise neigte dankend sein Haupt. Es war eine
majestätische Bewegung.
»Mein Wickiup ist auch dein Zuhause, Hellauge. Dein Weg
in meine Apacheria ist geschützt und für dich so sicher wie die
große Wüste im Süden. How!«
*
Burt Kelly und Norbert Walker kamen von den Ställen. Sie
stanken auch nach Stall. Das Haus lag düster und grau im
Bodennebel. Im Osten wogte es grün über dem Gebirge. Ein
seltsames Himmelslicht tauchte die Berge in einen
faszinierenden Glanz glasgrüner Magie.
Kelly blieb stehen und blickte nach Osten. Das Licht
wechselte in Schwefelgelb über. Drei Tage lang war das Licht
im ganzen Land beobachtet worden, und seit drei Tagen hielt
es die Menschen in Angst und Schrecken.
War es ein Naturschauspiel oder indianische Zauberei?
Niemand wußte es, weil es in diesem südlichen Land noch
nicht gesehen worden war. Auch Jeffords hatte keine Ahnung,
was es zu bedeuten hatte.
»He, Chief! Sieht miserabel aus, was?«
Kelly deutete nach Osten und machte ein betretenes Gesicht.
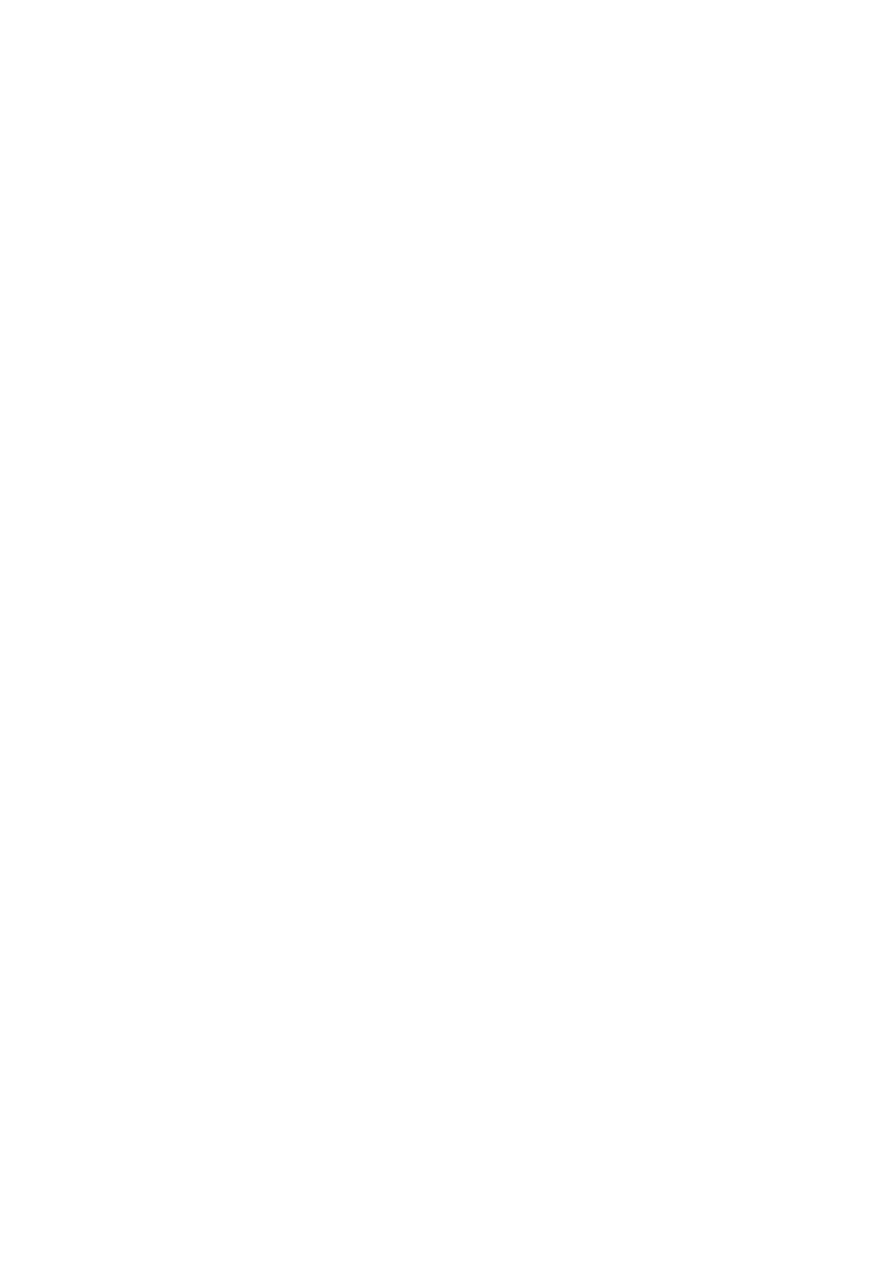
»Irgend etwas kommt, Chief. Wenn's keine Rothäute sind,
die uns den Garaus machen, dann ein Naturereignis oder
indianischer Hokuspokus.«
Thomas blieb stehen und lachte schallend.
»Burt, rede keinen Unsinn. Doch nicht schon so früh am
Morgen. Was für ein indianischer Zauber soll das sein, Junge?«
»Die roten Brüder kennen Dinge zwischen Himmel und
Erde, die wir nicht wissen. Das ist so ein verdammter Zauber
von ihnen.«
Jeffords und Walker grinsten. Sie konnten nicht sagen, ob
Kelly nur scherzte oder tatsächlich okkultische Neigungen
besaß. Von dieser Seite kannten sie den Freund und Mitarbeiter
der Butterfield-Line nicht.
»Ich frage mich, ob das Erscheinen der Apachen einen
Knacks bei dir ausgelöst hat, Burt. Beruhige dich wieder.
Cochise ist schon lange weg, und morgen verlassen uns die
Soldaten. Dann wird wieder Ruhe einkehren in unsere einsame
Klause.«
Thomas klopfte Burt freundschaftlich auf die Schulter und
ging davon. Es war bald Herbst. Wenn die Tage auch noch
sonnenerfüllt und heiß waren, die Nächte wurden zu
bitterkalten Vorahnungen auf den Winter.
Auf den Höhen ringsum war kein Indianer mehr zu sehen.
Cochise hatte Wort gehalten und war am Morgen nach der
ereignisreichen Nacht mit seinen Kriegern abgezogen.
Captain Roberts kam vom nächsten Biwakfeuer und bot
Jeffords die Hand. Hegemann, der gerade heißen Kaffee
empfing, winkte leutselig.
»Herrlicher Morgen, was, Mr. Jeffords? Sind wir sie
endgültig los, oder greifen sie uns unterwegs noch einmal an?«
Thomas wußte, wen der Offizier meinte.
»Sie greifen nicht mehr an. Cochise bricht nie sein gegebenes
Wort.«
»Kommen Sie doch her, Jeffords, und trinken Sie einen

starken Kaffee auf Kosten der Army.«
Lachend ging Thomas zum Feuer, gefolgt von Captain
Roberts, der im Scherz sagte: »Gehen Sie nicht so leichtfertig
mit dem Armeevermögen um, Hegemann. General Carleton
reißt uns sonst den Kopf ab.«
Jeffords nahm den Kaffee entgegen und blies in die heiße
Brühe.
»Sie sind sicher, daß sich keine Apachen mehr in der Nähe
aufhalten?«
»Ja, Lieutenant. Meine Streckenreiter kämmten das ganze
Gebirgsmassiv durch und sahen weder Spuren noch eine
einzige Rothaut. Wenn die beiden Jungs etwas in die Hand
nehmen, tun sie das gründlich. Die Truppe kann sich fest auf
diese Angaben verlassen.«
»Danke«, sagte Hegemann und warf Roberts einen fragenden
Blick zu. Der Captain schüttelte den Kopf. »Noch eine Tasse
Kaffee, Mr. Jeffords?«
Thomas wurde vom Knarren der Tür hinter sich abgelenkt.
Er richtete sein Augenmerk auf die Treppe. U.S.-Marshal
Marley kam herunter. Seine linke Schulter war dick bandagiert.
Den Arm trug er in einer Schlinge. »Hallo!« grüßte Jeffords.
»Guten Morgen!« erwiderte der knorrige Marshal.
»Wie geht's, Blechstern?«
»Danke, Mr. Jeffords. An Ihnen ist ein guter Samariter
verlorengegangen.« Marley warf einen prüfenden Blick auf die
Höhe. »Endgültig verschwunden oder noch in der Nähe?«
Thomas wies mit einer Kopfbewegung nach Nordosten.
»Weit weg. In ihren uneinnehmbaren Bergfestungen lecken
sie ihre Wunden und brüsten sich mit ihren Heldentaten. Für
eine Weile haben wir vor ihnen Ruhe.«
»Ich hörte von einem Ihrer Leute, daß Sie eine Kutsche
erwarten?«
»Ja, von Duncan nach Tombstone. Die Route führt über den
Paß. Wollen Sie uns schon wieder verlassen?«

»Es wird Zeit, Mr. Jeffords.«
»Trotz schwerer Verwundung auf der Menschenjagd?«
»Menschenjagd? Was soll das heißen? Bin ich ein
Skalpjäger? Mann, das sind hartgesottene Outlaws, die an den
Galgen gehören.«
Jeffords war einen Moment verwirrt, Roberts lachte
schallend. Er wehrte ab.
»War doch nicht wörtlich gemeint, Marshal. Um Himmels
willen, wir alle wissen, welche Arbeit Sie sich in diesem
menschenfeindlichen Land aufgehalst haben. Wenn Sie mich
fragen… Um die Outlaws zu finden, brauchen Sie nicht weit zu
reiten. Gelichter zieht sich in Notzeiten in die Städte zurück.
Dort ist es unter der Masse der Bürger anonym und schwer
aufzuspüren. Tubac oder Tombstone käme sicherlich…«
Marley winkte mit der gesunden Hand ab.
»Vergessen Sie's, Mr. Jeffords, und halten Sie mich bitte
nicht für undankbar, wenn ich Sie unterbrach. Das weiß ich
natürlich alles. Leider kann ich Ihre freundliche
Gastfreundschaft nicht länger in Anspruch nehmen. Die Fährte
ist noch heiß, ich muß ihr folgen.«
»Wie Sie wollen, Marshal. Wenn Sie Unterstützung
brauchen, ist sie Ihnen durch die Butterfield Overland
gewährt.«
Sie standen sich gegenüber – ein Mann mit einem Stern auf
der Brust, mit hellen Augen und einem Texasschnurrbart. Auf
dem Kopf einen verschwitzten Bibi, die langen Beine in derben
Hosen und Stiefeln.
Auf der anderen Seite ein breitschultriger und blauäugiger
Typ in derber Kleidung, mit einem freundlichen Lächeln auf
den Lippen und einem rötlichen Bartansatz.
Sie nahmen beide Einblick in fremde Seelen, lange und
ausdauernd, und sie verstanden sich. Marley gab Jeffords die
Hand. In dem Händedruck lag alles, was sich wahre Männer zu
sagen hatten. Marley drehte sich um und ging ins Haus zurück.

»Ist er beleidigt?« wollte Hegemann wissen.
Jeffords schüttelte den Kopf. Er musterte den blonden
Offizier und fügte höflichkeitshalber hinzu: »Keineswegs,
Lieutenant. Er wollte die Fronten klären, und das ist ihm
bestens gelungen.«
»Wir ziehen morgen weiter, Mr. Jeffords«, sagte Captain
Thomas Roberts. »Ich kann Ihnen gar nicht deutlich genug
ausdrücken, wie dankbar wir sind, daß Sie unserer
zusammengeschrumpften Truppe Unterschlupf gewährten.«
»Davon kann keine Rede sein«, Jeffords winkte ab, »weder
von Dankbarkeit noch von der Gewährung des Unterschlupfes.
Als Weiße sind wir zur gegenseitigen Hilfeleistung
verpflichtet. So, morgen wollen Sie schon weiterziehen? Tut
mir leid. Ihre Jungs könnten bestimmt noch ein paar Ruhetage
brauchen«
»Die Pflicht, Sir. Sie verstehen?«
Die Männer lachten und gingen auseinander.
*
Die Concord kam mit einer Stunde Verspätung die Paßstraße
herauf. Thomas Jeffords trat aus dem Haus und ging ihr
entgegen. Burt Kelly und Norbert Walker, die die Stellen der
getöteten Stationsbediensteten Culver und Wallace
eingenommen hatten, kamen von den Ställen herüber und
standen abwartend hinter Jeffords.
Der Kutscher lenkte das schwere Gefährt vor das Gebäude,
zog die Bremsen an und schwang sich mit dem bewaffneten
Begleitmann vom Bock.
»Hallo, Custer! Gute Fahrt gehabt?« rief Jeffords und öffnete
den Schlag.
»Mierda!« fluchte der Bärtige und spuckte aus. »Gute Fahrt?
Höllenfahrt auf einem höllischen Trail. Bald hab' ich die
Schnauze gestrichen voll.«

Die Fahrgäste, zwei würdige Herren in Schwarz und eine
Matrone unbestimmbaren Alters watschelten zum Haus und
verschwanden hinter der Tür. Thomas hatte Zeit, sich um die
Sorgen des Fahrers zu kümmern. Der Begleitmann stand neben
Custer und musterte die Umgebung mit unsicheren Blicken.
»Reden Sie, Custer. Was ist passiert?«
»Südlich von Fort Bowie wurden wir von Apachen
angegriffen. Wir können Gott danken, daß es nur eine kleine
Gruppe von fünf Kriegern war und Bill O'Neyill so gut
schießt.« Custer deutete mit dem Daumen auf den
Begleitmann.
Jeffords machte ein ernstes Gesicht. Geriet der Krieg mit den
Indianern wieder außer Kontrolle? Nahm Cochise wie im Jahr
zuvor wieder den Guerillakampf auf? Kleine, heimliche
Überfälle, Brandschatzung, grausame Morde an Farmern,
Goldsuchern und Trappern? Sollten wieder ganze Dörfer und
Städte in Arizona und Sonora dem Erdboden gleichgemacht
werden?
»Sonst noch Neuigkeiten? Zeitungen?«
Custer nickte, zwirbelte den Walroßschnurrbart und stelzte
steifbeinig zum Bock. Er reichte ein verschnürtes Paket über
die Schulter und sprang vom Vorderrad.
»Gehen Sie hinein, machen Sie sich frisch und essen Sie erst
mal vernünftig. In einer halben Stunde müssen Sie weiter«,
sagte Jeffords und löste den Bindfaden von dem Zeitungspaket.
Captain Roberts kam über den Platz gestiefelt.
»Schlechte Nachrichten, wie? Ist Ihrem Gesicht abzulesen.«
»Apachen griffen die Kutsche an. Ich kann noch nicht sagen,
ob es schlechte Nachrichten werden. Kommen Sie, Captain, ich
habe einen Berg Zeitungen bekommen, die ich kurz
überfliegen will.«
Sie gingen in Jeffords' Büro. Hier waren sie ungestört. Der
Postmeister suchte die beiden jüngsten Ausgaben heraus, die
anderen legte er zusammen.

»Ich lasse mir immer den ›Daily Epitaph‹ kommen«, sagte
Jeffords. »Die anderen Provinzblätter sind uninteressant.«
Thomas blätterte eine Seite um, las, hob den Kopf und schob
Roberts die Zeitung über den Tisch.
»Lesen Sie, Captain – hier.« Er deutete mit dem Finger auf
einen bestimmten Artikel. »Zwei Männer überfielen die Bank
in Bisbee. Ein toter Clerk und einen angeschossenen Kunden.
Das Blatt schreibt, sie wären nach Fort Huachuca geflüchtet.
Das wird unseren Deputy-Marshal bestimmt interessieren.«
Roberts las den kurzen Artikel, gab die Zeitung zurück und
schürzte die Lippen.
»Sie meinen…«
Jeffords nickte. »Die Nachricht wird ihn schnell auf die
Beine bringen. Was meinen Sie, Captain?«
»Schon möglich.«
»Sorgen, Captain?«
»Nicht wegen dieser Gauner, aber der Angriff auf die
Kutsche gibt mir zu denken. Mein Ziel ist zunächst Fort Bowie.
Ich mache mir Sorgen um meine Leute, Mr. Jeffords. Einem
zweiten massierten Angriff der Apachen haben wir nichts mehr
entgegenzusetzen.«
Thomas sagte: »Ich glaube nicht, daß Sie noch einmal
angegriffen werden. Cochise wird sich auf keine offene
Feldschlacht mehr einlassen. Dazu mußte er viel zuviel Federn
lassen. Die Apachen, die die Concord belästigten, sind
Reservationsindianer, die hin und wieder mal ausbrechen und
auf alles schießen, was sich bewegt.«
Es klopfte. Drew Marley kam herein.
»Störe ich, Gentlemen?«
»Durchaus nicht, Marshal. Kommen Sie, machen Sie es sich
bequem.«
Marley nahm an der anderen Seite des Tisches Platz. Jeffords
schob ihm die Zeitung hinüber und sagte: »Bitte, Marshal,
lesen Sie das. Ich denke, es handelt sich in diesem Artikel um

Ihre Freunde. So im Vorbeireiten nahmen sie eine Bank hoch
und hinterließen einen Toten und einen Schwerverletzten.«
Marley überflog den Text, hob den Kopf und runzelte die
Brauen.
»Sie haben unzweifelhaft recht, Mr. Jeffords. Morgen früh
reite ich. Diesmal entgehen sie mir nicht wieder, das
verspreche ich.«
Jeffords nickte ohne Kommentar, stand auf, ging zum
Wandschrank und nahm eine Flasche und Gläser heraus. Als er
eingeschenkt hatte, hob er sein Glas und prostete den beiden
Männern zu. Sie tranken.
Jeffords sah Roberts und Marley an.
»Also dann, auf eine gute Reise für Sie beide und vollen
Erfolg. Sie entschuldigen mich für einen Augenblick. Die
Passagiere sind zur Kutsche gegangen, und ich möchte sie
verabschieden.«
Er verließ das Office, war aber bald darauf wieder zurück.
Der Nachmittag verging mit Gesprächen und einem Schluck
Feuerwasser dann und wann. Vor dem Dunkelwerden kam
auch noch Lieutenant Hegemann dazu. Die fröhliche Runde
endete gegen Mitternacht.
Jeffords ging mit seinen Gästen hinaus und blieb im
Sternenlicht stehen. Eine Weile sah er zu den leuchtenden
Pünktchen hinauf und schnüffelte dann schließlich wie ein
Jagdhund.
»Riechen Sie was, Captain?«
»Was meinen Sie?«
»Frost.«
»Unsinn! Doch nicht in dieser Jahreszeit.«
»Wir werden Schnee und Kälte bekommen, so wahr ich
Thomas Jeffords heiße. Die Jahreszeit spielt dabei keine Rolle.
Ich will nicht sagen, daß es schon Winter wird. Um Himmels
willen, nein. Möglicherweise kriegen wir einen Blizzard, der
das Land ein paar Tage lang mit Schnee und Kälte bedeckt.

Seien Sie sicher, etwas bereitet sich in den Bergen dort drüben
vor. Die seltsamen Sonnenaufgänge in den letzten Tagen gaben
mir schon zu denken. Das ist nicht normal. Solche Lichter
kennt man nur im Norden unseres Landes. Roberts betrachtete
den Himmel und sah keinerlei Anzeichen für einen
Wetterumschwung. »Ein Orkan würde mir wenig schmecken,
Mr. Jeffords. Trotzdem vielen Dank für die Warnung. Wann,
meinen Sie, wird der Blizzard kommen?«
»Kann man nicht mit Sicherheit sagen, Captain.«
Hegemann schaltete sich ein. »Sollen wir nicht besser noch
ein paar Tage abwarten, Sir? Hier oben sind wir sicher. In der
Ebene dagegen werden wir schwer zu kämpfen haben.«
Roberts zögerte mit der Antwort. Nach einer Weile sagte er:
»Hm, es ist unsere Pflicht, zuerst an unsere Leute zu denken.
Wir bleiben hier, bis das Unwetter sich ausgetobt hat. Sind Sie
damit einverstanden, Mr. Jeffords?«
Thomas lächelte. »Und ob ich einverstanden bin. Bessere
Gesellschaft kann ich mir gar nicht in dieser Einsamkeit
wünschen.«
Jeffords und Marley trennten sich von den Offizieren und
gingen gemeinsam zum Haus.
»Sie haben etwas auf dem Herzen, mein Freund? Was ist
es?« fragte Thomas. »Ich merke die ganze Zeit, daß Ihnen
etwas auf der Seele liegt. Raus damit!«
Marley verzog sein verwittertes Gesicht.
»Das merkten Sie? Alle Wetter, das ist erstaunlich. Ich hätte
da gern was mit Ihnen besprochen. Haben Sie ein paar Minuten
Zeit für mich?«
»Für Sie immer. Mann, kotzen Sie's aus!«
Sie standen unter der Sturmlampe, die Burt Kelly über der
Tür aufgehängt hatte, um den Soldaten die Orientierung zu
erleichtern. Marley deutete auf seine bandagierte Schulter und
sagte gedrückt: »Ich schaff's nicht allein, Jeffords. Es ist –
verdammt noch mal – eine Achillesferse. Mit einem solchen

Handikap wird es mir nicht möglich sein, die Strolche zu
verhaften. Ich bin noch nicht richtig an sie herangekommen
und schon tot, weil sie meine Schwäche erkennen.«
»Das sehe ich ein«, entgegnete Jeffords. »Kann ich Ihnen
irgendwie helfen, Marshal?«
»Bei der Verhaftung sicher nicht. Das wird diesmal nicht
leicht sein, denn sie wissen, daß sie am Galgen landen. Sie
haben ein paar ausgezeichnete Jungs in Ihrer Mannschaft. Ich
hätte sie mir gern von ihnen ausgeliehen, Mr. Jeffords. Sie
werden vereidigt und erhalten zwei Dollar Lohn pro Tag und
freie Verpflegung.«
»Wie bitte?« fragte Thomas erstaunt.
»Ich rede von Osborne und Tinatra. Ich habe sie
kennengelernt und schätze die beiden jungen Männer. Sie
werden mir mit Freuden behilflich sein.«
»Die beiden reiten die Strecke ab und kommen
voraussichtlich erst morgen gegen Mittag. Nun gut, wenn ich
Ihnen helfen kann, verzichte ich gern auf den Schutz, den die
Station durch sie hat. Fragen müssen Sie die beiden aber
selbst.«
»Danke«, sagte Marley und seufzte erleichtert. »Sie sollen es
nicht umsonst tun. Ich bin berechtigt, für die Verhinderung von
Verbrechen und Verhaftung von steckbrieflich gesuchten
Banditen außer dem Tagesbonus eine gewisse Prämie
auszuzahlen. Die sollen sie außerdem noch erhalten.«
Jeffords lachte. »Nicht meine Sache«, sagte er. »Machen Sie
das nur mit Larry und Buck aus. Wie kommen Sie gerade auf
die beiden?«
»Sie schießen schnell und sicher und sind charakterlich
einwandfrei.«
»Wie lange werden Sie unterwegs sein?«
»Drei Tage, denke ich. Für Proviant sorge ich schon.«
Jeffords nickte. »Okay.«

*
Der Santa Cruz war stellenweise so trocken, daß Geröll und
kleine Sandbänke aus dem Wasser ragten. Am östlichen
Himmel verriet gelber Lichtschein den baldigen Aufgang des
Mondes. Conan Pearce warf einen Blick über die Schulter. Er
konnte die verschwommenen Umrisse der zerklüfteten
Bergkette hinter sich sehen.
Den ganzen Nachmittag war er das Gefühl nicht
losgeworden, verfolgt oder beobachtet zu werden. Sein Pferd
schnaubte und spielte mit den Ohren. Sergeant Pearce hob die
behandschuhte Linke und ließ die Kolonne hinter sich
anhalten. Corporal Bill Hastings kam nach vorn und zügelte
sein nervöses Pferd neben Pearce.
»Was ist los, Conny? Warum läßt du anhalten?«
Pearce zuckte mit den Achseln und starrte auf das seichte
Wasser des Flusses, als hätte die erwartete Gefahr von dort
kommen müssen.
»Da draußen treibt sich etwas in der Nacht herum. Verdammt
sei der Tag, an dem ich mich entschloß, in die Armee zu
gehen.«
»Was erwartest du? Indianerangriff?«
»Möglich, ich weiß es nicht. Wir müssen wachsam sein.
Gateway ist unser bester Kundschafter. Er soll absitzen und das
Flußbett durchqueren. Siehst du die Büsche am anderen Ufer?
Die müssen gründlich durchsucht werden. Klar? Joe soll von
Nord nach Süd gehen und keinen Strauch auslassen.«
Corporal Bill Hastings winkte Gateway. Der Gefreite kam
heran und folgte mit Blicken dem ausgestreckten Arm des
Corporals.
»Es bewegt sich was dort drüben, Joe«, erklarte Hastings
ihm. »Chief Conan meint, daß sich am anderen Ufer zwei
Büffel verlaufen haben. Sieh mal nach, was dran ist.«
»Büffel«, echote Joe Gateway gedehnt. »Du meinst Apachen,

Corporal?«
»Ich bewundere dich, Joe. Du bist ein Genie. Sei vorsichtig,
Junge. Und wenn's dir unter dem Skalp juckt, kehrst du um,
verstanden?«
Joe steckte sich grinsend den kleinen Finger ins rechte Ohr
und begann zu schütteln.
»Mann, Bill, du machst mir die roten Halunken aber
besonders schmackhaft. Okay, wenn ich auf welche stoße, lade
ich sie zu einem Drink ein.«
»Aber nicht hier bei uns«, sagte Conan Pearce grinsend.
»Unsere Damen könnten sich vor ihnen fürchten und die Flucht
ergreifen.«
Joe Gateway schwang sich aus dem Sattel, schob das Gewehr
in den Scabbard und verschwand so lautlos wie ein Apache.
»Wird Zeit, daß dem Jungen mal ein Orden verliehen wird«,
sagte Corporal Hastings. »Immer willig und einsatzbereit.
Mach dich dafür mal 'n bißchen stark, Conan.«
»Das verspreche ich dir. Gib acht, er ist fast drüben.«
Der Halbzug hinter Pearce war abgestiegen. Die Soldaten
waren unruhig und hielten ihre Pferde fest am Zügel. Nervös
verfolgten sie Gateways Weg über den fast ausgetrockneten
Santa Cruz.
Soldat Joe Gateway blieb vor dem anderen Ufer stehen und
starrte die Randbüsche wie feindliche Ungeheuer an. Joe
entdeckte eine Lücke in dem Strauchwerk, drehte sich um und
winkte beruhigend. Fast alle hoben die Hände und schwenkten
sie über dem Kopf. Joes Stiefel machten ein Geräusch auf dem
Geröll, als bewegte sich eine Armee durch das Flußbett. Mit
einem Sprung stand er auf dem erhöhten Flußufer. Die Blätter
der Manzanitas und des Speerdorns glänzten mit ihrer
Oberseite fast schwarz, ihre Unterseiten aber strahlten ein
seltsames fluoriszierendes Licht ab, das Joe als Orientierung
diente.
Er drang in die Büsche ein. Alles um ihn herum war

unheimlich still. Ein dicker Kloß schien dem wagemutigen
Soldaten plötzlich im Hals zu stecken. Er schluckte, ging
weiter, blieb ab und zu stehen, lauschte und sog prüfend die
Luft ein. Modergeruch des faulenden Humusbodens drang ihm
in die Nase.
Der Soldat aus Fort Buchanan gelangte auf eine Lichtung.
An ihrem Rand blieb er spähend stehen, sah nichts und setzte
sich wieder in Bewegung. Jenseits des Freiplatzes drang er in
den Grüngürtel ein. Hinter Joe schnellten die dornigen Zweige
zusammen.
Eine Art Wildwechsel kreuzte seinen Weg. Als Joe Gateway
aufblickte, sah er eine Gestalt vor sich. Unbeweglich stand sie
vor ihm und starrte ihn an.
Zu Tode erschrocken wich Joe einen Schritt zurück. Er kam
nicht auf den Gedanken, seinen Revolver zu ziehen. Es hätte
ihm auch nichts mehr genutzt. Der große Indianer glitt so
lautlos auf ihn zu, als schwebte er.
Kurz vor Gateway blieb er stehen. Gebieterisch streckte er
die Hand nach dem Weißen aus. Links und rechts neben Joe
raschelte es in den Büschen, ehe ihm bewußt wurde, daß er den
Apachen in die Falle gegangen war.
Cochise sagte nur ein einziges Wort: »Zastee!«
Etwas Dunkles wand sich aus den Büschen. Eine Klinge
drang von hinten in Joes Körper. Im Fallen erstickte Joes
Warn- und Angstschrei.
Eine Gruppe Apachen tummelte sich auf dem schmalen
Wildpfad. Im Nu war der Tote entkleidet. Nackt ließen sie ihn
liegen. Cochise gab mit gutturaler Stimme Befehle. Er handelte
nach einem Plan und trieb die Krieger an.
Ein Chiricahua streifte sich die blaue Uniform über und
preßte den Feldhut auf die langen Haare. Sein dunkles Gesicht
hatte er mit Kalk hell gefärbt. Cochise musterte den Mann. Von
weitem konnte man ihn für ein Bleichgesicht halten. Er nickte
dem Krieger zu, der sich umdrehte und dem Wildwechsel in

Flußrichtung folgte.
Hinter den Randbüschen verharrte der Krieger. Mehr als 20
Apachen lauerten in der Nähe. Die Rothaut in Uniform trat vor
die Sträucher, winkte zur anderen Seite hinüber und
verschwand wieder in dem Dickicht. Die Indianer
beobachteten, wie sich die Soldaten unterhielten, wie sie
gestikulierten und zögerten.
Einer legte die Hände trichterförmig an den Mund und
brüllte: »He, Joe, ist die Luft rein?«
Cochise sagte dem verkleideten Krieger, was der Weiße
gerufen hatte. Die Rothaut trat noch einmal vor und ruderte
wild mit den Armen. Dann winkte er wieder und deutete auf
das bewachsene Ufer.
Sergeant Conan Pearce ließ sich tatsächlich täuschen. Er sah
Hastings an und sagte: »Mann, was redest du für'n dummes
Zeug? Das ist Joe, der uns das Zeichen gibt. Los, reiten wir.«
Er trieb sein Pferd in den Fluß. Der Halbzug, bestehend aus
zwölf Mann, folgte. Von Joe Gateway war im Augenblick
nichts mehr zu sehen. Hätte Pearce auf seinen Instinkt vertraut
und nicht auf eine Ungewisse Optik in der Sternennacht, wäre
das Massaker am Santa Cruz wahrscheinlich nicht erfolgt. Er
aber hörte nicht auf seine innere Stimme und führte die
Patrouille aus Fort Buchanan in den Tod.
Corporal Hastings und die Soldaten Clymer und Geer
drangen zuerst in die Büsche. Ihre Pferde schnaubten aufgeregt
und unwillig. Bill Hastings wollte ein Tier parieren, gewarnt
durch sein seltsames Gebahren, aber Conan Pearce drängte von
hinten nach und schob den Corporal förmlich in das Dickicht.
Von Gateway war nichts zu sehen. Pearce legte die Hände an
den Mund und rief Joes Namen. Keine Antwort. Nur das leise
Klirren der Gebißstangen und das unruhige Stampfen der
Pferde durchdrang die Nacht.
Pearce trieb seinen Wallach auf einem kaum sichtbaren Pfad
tiefer in das Dickicht und wollte sich dann irgendwo außerhalb

der Vegetation nach Süden wenden. Tubac war das Ziel der
Patrouille. Und wenn sie die kleine Ansiedlung erreicht hatten,
konnten sie wieder umkehren und nach Nordosten reiten.
Der Sergeant näherte sich der Lichtung, die schon Gateway
zum Verhängnis geworden war, kreuzte den Wildwechsel,
folgte ihm so lange, bis sein Pferd zitternd und ängstlich
schnaubend steilte und ihn fast abwarf.
Das deutliche Alarmzeichen übersah Pearce nicht. Aber es
war zu spät. Als er zum Revolver griff, sah er eine grau und
weiß gekleidete Gestalt wie ein Schemen auf dem Weg
auftauchen. Der Indianer trug ein weißes Stirntuch, Kittelhemd
aus grauem Kaliko, Tuchhosen und kniehohe Mokassins.
Pearce wußte, wer ihm eine Falle gestellt hatte: Cochise.
Er stand vor ihm, richtete den Arm auf den Weißen und rief:
»Zastee! Tötet!«
In dieser Nacht schien alles zur Lautlosigkeit erstarrt zu sein.
Geräuschlos wie Katzen brachen Apachen aus den Büschen.
Mit pantherähnlichen Sprüngen glitten sie hinter die Soldaten,
töteten sie und skalpierten sie.
Nach einer halben Minute war alles vorbei. Niemand aus der
Patrouille lebte mehr. Cochise befahl, die Pferde der Weißen
wegzuführen und die Toten zu entkleiden.
Als der Mond hinter der Wolkenbank hervorlugte, wurde das
schauerliche Bild indianischen Strafvollzugs deutlicher
sichtbar.
Von Cochises Chiricahuas war weit und breit nichts mehr zu
entdecken. Der zweite Guerillakrieg des Häuptlings hatte mit
einer Bluttat begonnen, die schlagartig wieder Furcht und
Grauen in die Herzen der Weißen einziehen ließ.
Der Chief aller Apachenstämme war zu seiner anerzogenen
und naturgegebenen Kampfesweise zurückgekehrt und
bekämpfte die Weißen von nun an nicht mehr in offener
Feldschlacht.

*
Die Sonne war in einer Farbenpracht untergegangen, wie man
sie selbst im äußersten Südwesten von Arizona nur selten zu
Gesicht bekam. Tiefe Schatten lagen über den Minen von
Tombstone und den engen Canyons. Die Hitze hing noch
immer zwischen den Wänden.
Die drei Pferde trotteten hinter dem Felsvorsprung hervor
und verschwanden in der gewundenen Schlucht, die aus dem
Minengebiet führte. Fledermäuse verließen ihre Verstecke und
flatterten durch die heraufziehende Dunkelheit, verfolgt von
grell pfeifenden Nachtfalken, die sie erbarmungslos jagten.
Kaninchen krochen aus ihren Bauten und suchten ihre
Wasserlöcher auf. Kleine Füchse und andere Raubtiere strichen
lauernd und witternd auf der Suche nach Nagetieren umher.
Das nächtliche Karussell des Fressens und Gefressenwerdens
hatte begonnen. Das große Töten unter den Sternen begann.
Die Schwächeren wurden von den Stärkeren überrascht, die
später dann selbst zur Beute von noch Stärkeren wurden. Die
Nacht in der Wüste war die Zeit der Jäger und legte zu keiner
Stunde eine Pause ein.
Marshal Drew Marley wischte sich den Schweiß von der
Stirn. Larry Osborne schob den Priem in die andere Backe und
spuckte einen langen Tabakstrahl auf einen Nacht-Gecko,
dessen lange, klebrige Zunge nach Insekten angelte.
»Ich hatte gehofft, die beiden Hundesöhne in Tombstone
anzutreffen«, sagte Marley, dessen linke Schulter noch dick
verbunden war. »Fehlanzeige. Wenigstens etwas habe ich
erreicht, und das ist für mich schon ein Erfolg.«
Buck Tinatra grinste breit. Er warf seinem Busenfreund
Larry einen verschmitzten Blick zu und fragte scheinheilig:
»Was, lieber Blechstern, ist dir so Freudiges begegnet? Eine
Jungfrau im Schlafrock oder die Friedenstaube mit einem
Palmzweig im Schnabel?«

»Weder noch, Witzbold. Larry, nimm dir deinen
Busenfreund mehr zur Brust. Es gehört sich nicht, wie er mit
einem Vorgesetzten spricht.«
»Ach, du dickes Ei! Jetzt ist er schon unser Vorgesetzter.
Und das bei zwei Dollar pro Tag und einer mageren Prämie im
Erfolgsfalle.« Larry schniefte laut und strich gespielt liebevoll
über sein Abzeichen, das auf seiner Weste prangte.
»Buck, schmeißen wir ihm die rostigen Orden vor die Füße
und verduften, bevor er sich zum lieben Gott erhebt und uns
gar nichts mehr zahlt.«
Buck Tinatra lachte lauthals. »Seien wir gnädig mit ihm, dem
Stolzen, Eingebildeten, und behalten wir die Sterne noch einige
Tage. Wurden sie uns doch von einem Unwürdigen verliehen.«
»Nur auf Zeit«, wehrte Marley kichernd ab. »Glaubt ja nicht,
daß ich euch einen Sündenlohn zahle, nur damit ihr mit 'nem
Blechstern in den Städten angeben könnt. Die Dinger nehme
ich euch wieder ab, sobald wir die beiden Kerle gefaßt haben.«
»Dachte ich's mir doch«, seufzte Tinatra. »Gesetz und seine
Vertreter sind so geizig wie unsere Regierung. Ich hab's mir
anders überlegt, Larry. Komm, wir verduften. Ich bin's sowieso
leid, mir den lieben langen Tag die beiden Dollar vorwerfen zu
lassen, die er uns zahlen will. Der verdammte Jammerlappen
legt sich vor Geiz noch krumm.«
»Der Himmel pfeift euch Halunken was.« Marley lachte.
»Jetzt reiten wir erst einmal durch die Hölle. Was glaubt ihr,
wohin es geht? Zu einem Tanzplatz für liebestolle Cowboys?
Irrtum!«
Marley deutete auf die dunklen Dragoons, die wie eine Wand
vor ihnen aus der Finsternis stiegen.
»Wenn wir diesen Gebirgsstock hinter uns haben, wißt ihr,
was die Hölle ist. Ihr werdet wunde Hintern vom Reiten haben,
die Zunge wird euch meilenweit aus dem Hals hängen, und
wenn ihr nur ein bißchen Glück habt, werdet ihr wie
Stachelschweine in Fort Huachuca einziehen.«

»Wie Stachelschweine? Warum denn das?«
Drew Marley lachte scheppernd.
»Wieso? Mann, hast du 'ne Ahnung. Die Apachen werden
uns so voller Pfeile spicken, daß wir wie Stacheltiere aussehen
werden. Sie werden uns…«
»Nichts«, unterbrach Buck Tinatra ihn grinsend, »gar nichts
werden sie. Und weißt du warum? Weil sie uns nicht zu
Gesicht bekommen werden.«
»Da wirst du dich aber wundern, mein Junge«, sagte der
Marshal. »Die haben uns längst entdeckt. Cochise hat seine
Späher überall, und gerade die Dragoons hält er fest im Griff.
Ein Weißer, der in die Chiricahuas oder in die Dragoons
eindringt, ist so gut wie tot, wenn er nur seinen Fuß auf
Apachengebiet setzt.«
»Unsere Abzeichen…«
»… nützen uns keinen Deut, wenn er sie nicht respektiert«,
unterbrach Andrew Marley ihn.
»Dir hat's doch auch geholfen.«
»Ja, mir.« Mehr sagte der Marshal nicht.
Mit dem Fortschreiten der Nacht war es kühler geworden.
Kalte Winde fegten von den schneebedeckten Berggipfeln und
ließen die Reiter frösteln.
»Wann machen wir Lager?« fragte Buck Tinatra.
»Kein Camp.« Marley schüttelte den Kopf. »Wenn wir eine
kurze Frühstückspause einlegen, reicht das. Wir sind dann
gegen Mittag in Huachuca.«
»Denkst du altes Streitroß auch an unsere Pferde?« schaltete
sich Larry Osborne trocken ein.
»Wir reiten im Schritt oder im Trab. Das halten sie einen Tag
und eine Nacht durch.«
Von nun an ging der Ritt ohne Gespräche weiter. Die
Gegend wurde von Minute zu Minute wilder, zerklüfteter. Kein
Laut war zu hören.
Die Nacht verlief ereignislos. Gegen Morgen zeigten die

Pferde doch Ermüdungserscheinungen. Marley beschloß, eine
Pause einzulegen, um sie zu füttern und zu tränken. Als erstes
Frühlicht in die Täler drang, stießen sie auf einen Talkessel, der
zum Lagern geeignet war. Der Marshal stieg ab und führte sein
Pferd zu einem verfilzten Gebüsch. Er leinte es an, sattelte ab
und gab dem Braunen erst einmal zu saufen. Dann hing er ihm
den Futtersack vor.
»Feuer?« fragte Larry. »Ein kleines Feuerchen, großer Boß?
Eine Tasse Kaffee würde unsere Lebensgeister wecken.«
»Kein Feuer«, antwortete der Gesetzeshüter. »Ihr seid wohl
lebensmüde, wie? Rauch riechen Apachen auf eine Meile.
Wollt ihr unbedingt, daß unsere Skalps in der Mittagssonne vor
irgendeinem Jacale trocknen?«
»Ich denke, Cochise ist dein Freund? Er wird uns schon
nichts tun.«
»Er vielleicht nicht«, erwiderte Marley grob, »aber seine
Krieger. Die kümmern sich einen Dreck darum, was der
Häuptling will oder nicht will. Laßt's sein, ich warne euch,
Jungs.«
Nach zwei Stunden Pause drängte Drew Marley schon
wieder zum Aufbruch. Ausgeruht griffen die Pferde wacker
aus. Die Schlucht stieg an und endete auf der Mesa. Eine ganz
zerklüftete und ineinander verschachtelte Bergwildnis tat sich
nun vor ihnen auf.
Gegen Mittag hatten sie die Mesa unter sengender Sonne
überquert und standen vor einem gewundenen Canyon, der sich
wie ein Wurm in die Gebirgswelt hineinfraß. Sosehr die drei
Weißen auch suchten, es gab keinen Abstieg in die Tiefe.
»Nach Südwesten«, sagte Marley und deutete in die
Richtung.
Er und Buck Tinatra ritten an, doch Larry hielt sein Pferd
zurück und neigte lauschend den Kopf. Von irgendwoher
drangen Geräusche zu ihnen herauf. Zuerst war es nur ein
lautes Knirschen, das in Rollen und Mahlen überging. Dann

vernahmen sie alle die heiseren Rufe, Peitschenknallen,
Schüsse und schließlich das schrille Kriegsgeschrei der
Apachen.
Eine sechsspännige Kutsche fegte um eine Kurve. Das
Gespann wurde durch gezielte Peitschenhiebe des Fahrers
erbarmungslos getrieben. Der Begleitmann auf dem Bock war
tot. Er hing über der Armstütze, zwei Pfeile in seinem Rücken.
Aus dem Kasten fielen in sporadischen Abständen laute
Revolverschüsse, die kaum Schaden unter den verfolgenden
Apachen anrichteten. Mehr als zehn schreiende Krieger folgten
auf ihren flinken Ponys dem Gefährt.
»Jesus? Können wir den armen Teufeln nicht helfen?«
Marley schüttelte den Kopf. »Nicht von hier oben aus. Seht
doch selbst.« Er stieß die Worte aufgeregt hervor. Die Concord
hatte das Ende der Geraden erreicht, rollte langsamer, um in
der Kurve nicht umzustürzen.
Die ersten indianischen Reiter nutzten den toten Winkel des
feuernden Revolvers aus, um die Kutsche zu überholen und
aufzuspringen. Zwei andere Krieger hielten die Leitpferde an.
Von da an waren es nur Sekunden, bis die Tragödie vorüber
war.
Die Todesschreie im Canyon waren lange verhallt, als
Marley mit seinen beiden Freunden einen Abstieg fand, den
auch steifbeinige Pferde benutzen konnten.
Als sie die Stätte des Dramas erreichten, gab es für sie nichts
mehr zu tun.
Der Fahrer hing tot und skalpiert auf dem Bock. Den
bewaffneten Begleitmann hatten sie ebenfalls skalpiert, obwohl
er lange vorher gestorben war. Von den vier Insassen lebte
niemand mehr. Den beiden Frauen hatte man das Kopfhaar
gelassen, aber ihre männlichen Begleiter hatten das gleiche
Schicksal wie Kutscher und Beifahrer erlitten.
Das Fahrzeug brannte. Marley, Buck und Larry löschten die
Flammen mit Sand. Die Apachen hatten die Pferde

mitgenommen. Ebenso alles andere, was ihnen von Wert
erschien.
*
Am frühen Nachmittag war alles getan. Buck und Larry hatten
in einer Sandmulde ein Grab geschaufelt und die Toten auf
eine Decke gebettet. Marley sprach ein Gebet. Danach wurde
das Grab mit Steinen und breiten Felsstücken zugedeckt. Über
den Hügel schaufelte man Sand.
Der Marshal hatte bei den Grabarbeiten ständig die Gegend
beobachtet. Er wirkte nervös und zeigte es auch ganz deutlich.
Larry fragte ihn: »Was ist los, Blechstern? Hast du Schiß?
Die kommen bestimmt nicht wieder.«
»Rede nicht solch ein dummes Zeug, Armleuchter. Ich und
Schiß? Sieh doch mal zu der Stelle hoch, wo wir vor ein paar
Stunden noch standen.«
Larry und Buck hoben gleichzeitig die Köpfe. Sie richteten
sich auf und standen starr wie Ölgötzen.
»Ich werde verrückt!« keuchte Larry. »Das ist doch… Ist das
nicht Cochise?«
»Er ist es«, bestätigte Marley, nahm die Schaufel, die er im
Wagenkasten der Kutsche gefunden hatte, und warf sie weit
von sich.
»Er beobachtet uns«, sagte Buck ahnungsvoll. »Mann, Drew,
mir juckt's unter der Kopfhaut, als wenn da tausend Ameisen
rumkrabbelten.«
»Habe ich euch nicht gesagt, daß ihr die Hölle kennen
werdet, wenn wir die Dragoons hinter uns haben?«
»Du hast uns nicht gesagt, daß wir von Cochise persönlich
beobachtet werden.«
Der Marshal grinste und zwirbelte seinen Texasschnurrbart.
»Laß ihn nicht merken, daß du die Hosen voll hast, Junge. Er
kommt sonst runter und nimmt dich persönlich vor. Los, auf

die Gäule! Wir machen uns aus dem Staub und suchen eine
Gegend auf, wo die Luft nicht so eisenhaltig ist.«
Sie warfen einen letzten Blick nach oben. Der Häuptling
stand reglos auf einem erhöhten Punkt und starrte zu ihnen
herunter. Mit keinem Zeichen ließ er erkennen, daß er Marley
kannte. Fast übergangslos war die imposante Gestalt plötzlich
verschwunden, von einem Augenblick zum anderen.
Marley und die beiden Freunde schwangen sich auf ihre
Pferde. Mit einem letzten Blick auf die Stätte des Grauens
folgten sie dem Weg durch den Canyon.
»Ich glaube, Drew, der Apache hat das Kriegsbeil gegen den
weißen Mann wieder ausgegraben«, sagte Larry Osborne
gedrückt. »Was geschieht jetzt und in Zukunft?«
»Krieg nach seiner Art.«
»Was verstehst du unter seiner Art?«
»Heimlich, unsichtbar aus Deckungen heraus, leise und
schleichend wie Raubkatzen.«
»Guerillakrieg?«
Marley nickte. »Der Canyon öffnet sich, Jungs. Noch vor
Dunkelwerden sind wir in Fort Huachuca.«
*
Der Mond färbte die Fronten der flachen Adobehäuser hell, die
Straße fast schwarz. Scharf umrissen hoben sich die Fenster-
und Türöffnungen von den Wandflächen ab. Gehsteige gab es
in der alten spanischen Stadt nicht, die während der Besiedlung
des Nordens Festung und stehende Garnison gewesen war.
Marshal Drew Marley stand mit dem Rücken gegen eine
Hauswand gelehnt und starrte den wie Quecksilber glänzenden
Himmel an, durch den der fast volle Mond wie ein
eingedrücktes Lampion segelte.
Aber in dieser Nacht sah er noch etwas anderes auf der
Anhöhe im Süden des breiten Tales, in dem Huachuca lag: ein

Licht mit rötlichem Widerschein, der in der Dunkelheit zu
pulsieren schien wie ein Dämonenauge, das sich öffnete und
schloß.
Der Nachtwind trieb einen ungewohnten Geruch in die
Town. Nicht den von Mesquite, Wacholder und Pinien,
sondern von Rauch und schmorendem Fleisch.
Was dort weit im Süden brannte, wußte jeder in der Town.
Die Menschen kauerten hinter verschlossenen Türen auf den
Knien und flehten zu ihren Heiligen, den bitteren Kelch eines
Apachenangriffs vorübergehen zu lassen.
Die Stille in der kleinen Ansiedlung wirkte unheimlich und
drückte die große Angst vor einem Überfall aus. Man hatte von
Städten und Dörfern in Sonora gehört, die binnen weniger
Stunden dem Erdboden gleichgemacht worden waren.
Huachuca bestand überwiegend aus »zahmen« Indianern und
Mexikanern, denen das Herz schon bei dem Wort Apachen in
die Hosen rutschte.
Die Beklemmung, die jeder spürte, ergriff auch Marley.
Der Gestank von verkohltem Fleisch und schwelbrändigem
Holz zog wie eine Vorankündigung des bleichgesichtigen
Todes durch die Straßen Huachucas. Er drang durch Fenster
und Türen, lähmte die Menschen und erfüllte sie mit Entsetzen.
Nur aus der Cantina »La Tunas« klangen verhaltene Akkorde
einer Gitarre.
Marshal Drew Marley stieß sich von der Wand ab und ging
wieder in die Kneipe zurück. Die war bis auf den Wirt, Larry
Osborne und Buck Tinatra sowie die beiden mexikanischen
Musikanten und der Tänzerin leer.
Larry und Buck hockten in der hintersten Ecke, der eine
Pulque vor sich, der andere Baconora. Marley hatte sich ein
Bier bestellt, bevor er rausgegangen war.
Er setzte sich, warf einen flüchtigen Blick auf das Podium.
Der Gitarrist, der auch Geige und Trompete bediente, war
kleinwüchsig. Der andere mit der Handtrommel zwischen den

Knien war unzweifelhaft ein Indio, die Tänzerin seine Tochter.
Hinter dem Tresen bewegte sich der Wirt, ein fetter
Mexikaner mit Schweinsaugen und Pomadenhaar. Er ließ die
Sternträger nicht aus den Augen.
Huachuca war als Schmugglernest und Zufluchtsstätte für
Outlaws aus dem Grenzgebiet bekannt, und man war
mißtrauisch und äußerst vorsichtig, wenn ein Mann des
Gesetzes unerwartet auftauchte.
Als Marley mit dem Finger winkte, schlurfte Sancho
Principales auf seinen Strohsandalen wachsam näher.
»Setz dich, Greaser!«
Der Mexikaner nahm sich einen Stuhl zwischen die Beine.
Seine Knopfaugen musterten die harten Züge der drei
Americanos. Er hatte Angst. Man sah es ihm an. Angst
deswegen, weil er nicht wußte, was die Beamten bei ihm
suchten.
Marley deutete nach Süden.
»Was ist in dieser Richtung, Spic?«
»Was meinen Sie, Senor? Land oder bestimmte
Ansiedlungen?«
»Beides.«
»Der Huachuca Canyon öffnet sich zur Grenze hin zu einem
breiten Tal. Größere Städte gibt es nicht, es sei denn, Sie
meinen Naco an der Grenze. Aber das wurde von den Apachen
zerstört. Im Tal liegen ein paar Haziendas. Die größte und
nächste ist die von Petrus Juan de Goma. Seine Vaqueros
kommen an den Wochenenden in meine Cantina.«
»Dann lebst du sicher nicht schlecht«, sagte Marley und
grinste.
Buck warf ihm einen belustigten Blick zu und zeichnete mit
der Fingerspitze Figuren in die Schnapslache unter seinem
Glas.
»Wieviel Einwohner hat Huachuca?«
»Zweihundert, Senor. Gute Christen, die regelmäßig in die
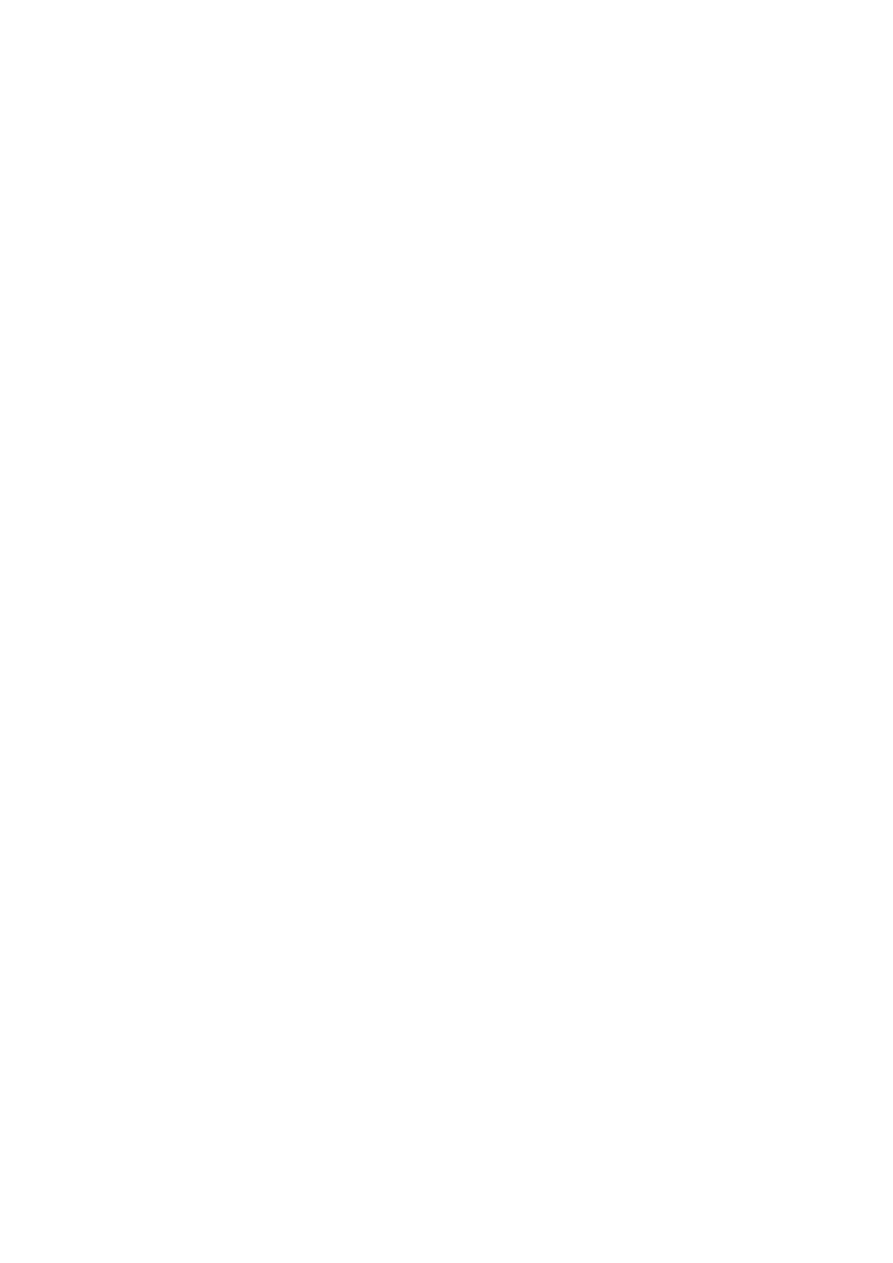
Kirche gehen und an Sonntagen eine Messe für ihre
Verstorbenen lesen lassen.«
»Und die vom Schmuggel leben und Banditen Unterschlupf
gewähren.«
Der Mexikaner zuckte zusammen und wand sich wie ein Aal.
Also doch.
Die Gesetzesmänner waren gekommen, den Bewohnern der
Ansiedlung näher auf die Finger zu sehen.
»Die Menschen müssen leben«, rechtfertigte er seine
Landsleute. »Wir haben Kinder und alte Menschen hier, die
nicht mehr arbeiten können, Senor. Von Banditos, die hier ein
Versteck suchen, weiß ich nichts, und das bißchen Schmuggel
tut doch keinem weh.«
»Das kümmert mich auch nicht«, sagte Marley lächelnd,
während die beiden anderen Sternträger sich ruhig verhielten
und den Wirt beobachteten. »Mich interessiert, wo du die
beiden Mörder und Bankräuber versteckt hältst, die vor einigen
Tagen nach Huachuca kamen.«
Die Knopfaugen schlossen sich unter krampfhaft zuckenden
Lidern.
»Ich weiß nichts von Banditos, Senor. Sie können mein Haus
durchsuchen und werden nirgendwo einen fremden Gringo
finden.«
»Und einen bekannten Gringo?«
»Nein, Senor, auch keinen bekannten. Ich schwöre bei allen
Heiligen Mexikos, keine Banditos zu beherbergen.«
»Laß mal die Heiligen aus dem Spiel, Greaser«, sagte Marley
spöttisch. »Die haben Besseres zu tun, als dir zu helfen. Wo
sind die beiden Kerle?«
»In diesem Haus sind sie nicht.«
Marley zwinkerte Buck und Larry mit dem rechten Auge zu.
»Seht euch mal ein bißchen um, Jungs. Aber vorsichtig. Das
Örtchen ist im Freien.«
Tinatra und Osborn erhoben sich sporenklirrend und

verließen den Schankraum durch die Hintertür. Das Haus war
nicht groß, hatte höchstens zwei Zimmer neben der Küche.
Buck kam wieder herein, zuckte mit den Achseln. Als er sich
setzte, legte er vor Marley eine leere Zündholzschachtel auf
den Tisch. Larry, der zur Toilette und zu einem Schuppen
gegangen war, kam schließlich auch und schüttelte den Kopf.
Andrew Marley nahm die Schachtel in die Hand. Der
Aufkleber zeigte einen Cowboy auf einem bockenden Pferd
und die Aufschrift »CLAPP & MURRAY MATCHES –
KANSAS CITY«.
»Wo hast du das gefunden?«
»Unter dem Bett im Hinterzimmer, Drew.«
Marley schob dem Mexikaner das Ding über den Tisch.
»Wie kommt es hierher? Streichhölzer dieser Art benutzen
die Gringos aus dem Mittelwesten.«
Der Mann wurde bleich wie ein Leinentuch. Dicke
Schweißtropfen perlten von seinem feisten Gesicht. Seine
Wurstfinger verschlangen sich ineinander und zitterten.
Marley stieß ihm den Ellbogen zwischen die Rippen und
fragte jovial: »Na, Fatty, wo sind sie? Raus mit der Sprache!
Ich verspreche dir, daß ich unser Gespräch sofort vergessen
werde.«
»Keine Verhaftung, keine Anzeige, Senor?«
»Keine. Nun?«
»Sie waren hier. Ein bösartig blickender Mann mit einem
rotbraunen Bart und ein anderer, der seinen Colt sehr tief trug.
Ein Gringo-Pistolero, der das Reden dem anderen überließ.«
»Übernachteten sie bei dir?«
Der Mexikaner warf Buck Tinatra einen ängstlichen Blick zu
und nickte.
»Aber nur eine Nacht, Senor. Am nächsten Morgen ritten sie
wieder davon, und ich dankte anschließend den Heiligen, daß
sie es taten.«
»Wohin ritten sie?«

»Der Bärtige sprach von Tombstone, aber ich glaube es
nicht.«
»Warum nicht?«
»Weil sie von dort kamen. Christina belauschte sie. Sie
sprachen von Tubac und einer Bank, die sie berauben wollen.«
»Wer ist Christina?«
Der Mexikaner deutete mit dem Daumen auf die Sängerin,
die ihre Kastagnetten in den Fingern hielt, als wären sie
eingerostet. Auch die Musiker starrten zu dem Tisch herüber
und vergaßen ihre Instrumente.
»Tubac also«, murmelte Marley nachdenklich. »Tubac,
hm…«
Larry fragte: »Ist was mit Tubac? Ein kleines Drecknest wie
jedes andere im Südwesten.«
Marley nickte, massierte sein hageres Kinn, nickte dem
Mexikaner zu und murmelte: »Du kannst gehen, Greaser. Ich
halte mein Wort und sperre dich nicht ein, weil du
langgesuchte Verbrecher beherbergt hast. Bring mir noch ein
Bier und gib deinen Musikanten einen Baconora auf meine
Rechnung.«
»Gracias, Senor. Auch Christina?«
»Wenn sie mag…«
»Bleiben wir die Nacht über hier?« wandte sich Larry an
Marley.
»Nein, wir kampieren draußen. Bis Tubac am Santa Cruz ist
es noch ein gutes Stück. In einem Tag werden wir es nicht
schaffen, bleibt uns nur die Nacht, wenn wir nicht wieder die
Spur verlieren wollen.«
»Hast du Angst, die Nacht hier zu verbringen?«
»Das ist es nicht, Larry. Nein, es ist was ganz anderes. Weiße
in einem Krieg oder in einem Zweikampf zu bekämpfen ist
eine andere Sache als gegen Apachen anzutreten. Ich habe
gehört, wie sie ihre Gefangenen behandeln. Mir wird übel,
wenn ich nur daran denke. Ich bin kein Feigling, das wißt ihr

beide, aber…«
»Aber?« unterbrach Buck Tinatra und sah den Marshal
interessiert an.
»Ihr habt sie noch nicht von ihrer blutigsten Seite
kennengelernt«, fuhr Marley fort. »Ich zwar auch nicht, doch
ich habe im Mittelwesten Zeitungen gelesen. Und was die über
die Chiricahuas berichteten, war mehr als haarsträubend. Ich
kann als Soldat einen Sturmangriff gegen feindliches
Artilleriefeuer anführen, kann einen Gegner im Nahkampf
ausschalten, im Duell einen Mann erschießen, aber deswegen
bleibe ich doch ein Weißer. Aber dies hier zermürbt mich.
Immer auf dem Sprung, einem lautlosen Pfeil, einem
geschleuderten Stein oder einem geworfenen Messer
auszuweichen – das macht mich schlapp und weich. Das ewige
Warten, das Schweigen. Das Sterben von Menschen, die ihnen
hilflos ausgeliefert waren. Es ist fast so, als stünde der Tod
hinter jedem Strauch und griffe mit seiner Knochenhand zu,
um den nächsten von uns an der Schulter zu berühren. Du
könntest der nächste sein, Buck, oder ich, Larry oder sonstwer.
Trinkt aus, wir reiten aus der Stadt. Draußen haben wir mehr
Sicherheit und können ausweichen, wenn sie im Morgengrauen
angreifen.«
Der Mexikaner brachte das bestellte Bier. Drew Marley warf
einen Dollar auf den Tisch, trank gierig das Glas aus, als hätte
er tagelang keine Flüssigkeit zu sich genommen, stand abrupt
auf und ging hinaus.
Die beiden Sternträger Larry und Buck folgten ihm. Ein
sichtbares Aufatmen ging durch die vier zurückbleibenden
Menschen.
*
Tubac hatte einen Sheriff. Als Teil des Cochise-Gebietes
vertrat er die Belange des Sheriffs aus Tombstone. Als die drei

Sternträger in die Town ritten, lehnte Hot Clymer am Hitchrail
vor der »Tubac First National Bank« und bohrte mit einem
abgebrochenen Zahnstocher in seinen hohlen Zähnen.
Er wurde erst munter, als er die Abzeichen von U.S.-
Beamten erkannte. Er löste sich von dem Halfterbalken und
ging den Reitern entgegen.
»Hallo, Sheriff! Heißer Tag heute, wie? Gibt's Neuigkeiten?«
Clymer tippte sich an den Hut.
»Hallo, Marshal! Neuigkeiten? Kommt darauf an, was Sie
hören wollen. Steigen Sie doch ab und kommen in mein Büro.«
»Zuerst die Pferde, Sheriff. Wo ist der Mietstall?«
»Hinter dem Store, drei Häuser weiter. Gehört sozusagen
dazu. Well, ich erwarte Sie.«
Marley und seine Freunde brachten die ermüdeten Pferde in
den Stall, rieben sie ab und versorgten sie mit Wasser und
Körnerfutter. Breitbeinig schlurften sie durch den Staub der
Main Street und suchten das Office.
Sie fanden es in einem niedrigen Adobebau. Das Holzschild
über der Tür war verblichen, die Scheiben waren blind vom
Staub und die Vorhänge so gelb wie die Zähne eines
Kettenrauchers.
Als sie eintraten, erhob sich Hot Clymer von seinem
wackligen Stuhl hinter dem total eingestaubten Schreibtisch.
Marley sah sich um. Steckbriefe zierten die Wände. Neben
dem Schreibtisch stand ein Gewehrständer mit drei Flinten.
Am Huthaken hing ein Revolvergurt mit einem schweren 45er.
Der Aktenschrank war leer – bis auf drei Whiskyflaschen.
Clymer schien eine Vorliebe für starke Getränke zu haben.
»Was führt Sie in dieses armselige Kaff, Gentlemen?« fragte
Clymer und bot den drei Besuchern Stühle an.
»Ich bin Drew Marley, U.S.-Marshal. Meine Deputys Larry
Osborne und Buck Tinatra. Sie sind Hot Clymer, nicht wahr?«
»Ja. Sie kennen mich?«
»Nicht persönlich, Sheriff. Ist doch klar, daß ich nur von

Ihnen gehört habe. Ich suche nach zwei Outlaws, die sich Gus
Gilkenny und Claude Atkins nennen.«
Clymer dachte nach, schüttelte den Kopf, hielt damit inne
und nickte schließlich.
»Die Bankräuber von Bisbee, stimmt's? Die Burschen sind
mir nicht unbekannt. Aber die Steckbriefe vom Bezirksgericht
in Tombstone sind noch nicht da. Was ist mit denen?«
»Sie sind in Tubac.«
Clymer fuhr auf.
»Ausgeschlossen! In den letzten zwei Wochen kam kein
Fremder in die Stadt – außer Ihnen, selbstverständlich.«
»Die sind aber hier, oder sie halten sich irgendwo in der
Nähe auf. Wie sieht die Umgebung aus, Sheriff?«
»Bis nach Nogales hinunter menschenleer und trocken.
Ödland.«
»Keine Farmen oder Ranches?«
»Zwei oder drei, die uns hier mit Fleisch und Gemüse
beliefern. Ich kann Ihnen wahrscheinlich da nicht weiterhelfen,
Marshal.«
Marley ließ sich nicht beirren. Er bohrte weiter: »Gibt es in
der Umgebung von Tubac Bergwerke, Minen oder
Schürfstellen, die von Diggern betrieben werden?«
Bevor Clymer antworten konnte, krachten auf der Straße
Schüsse. Laute Männerstimmen. Harte Stiefel trommelten auf
dem festgetretenen Boden. Erneut peitschte es. Dröhnender
Hufschlag entfernte sich.
Drew Marley schlug sich vor die Stirn. Ahnungsvoll stand er
auf.
»Wenn das mal nicht…«
Die Tür zum Office wurde aufgestoßen. Ein am Kopf
blutender Mann kam hereingewankt, hielt sich am
Aktenschrank fest und stammelte schreckensbleich: »Die Bank
wurde überfallen, Sheriff! Herrgott, die Bank…«
Er brach zusammen und wurde ohnmächtig. Marley und

seine beiden Freunde rannten hinaus.
Vor der Bank ein großer Menschenauflauf. Alles schrie
durcheinander, jeder wollte jedem Erklärungen geben. Der
Marshal griff sich einen vorbeirennenden Mann und fragte
hastig: »Haben Sie die Kerle gesehen, Bruder? Wie sahen sie
aus? Wie viele waren es?«
Der Mann wollte sich losreißen, sah aber den Stern auf
Marleys Brust und beruhigte sich.
»Es waren zwei, Sir. Der eine hatte einen roten Bart, der
andere sah aus wie ein Gentleman aus dem Osten. Lassen Sie
mich jetzt los.«
Er hastete weiter, als wäre die Hölle mit all ihren Teufeln
hinter ihm her. Sheriff Hot Clymer kam angestaubt und mußte
die Notbremse ziehen, um nicht die Gruppe um Marley zu
überrennen.
»Etwas herausgefunden, Marshal?«
»Ja, zwei Mann. Es sind die Strolche, die ich suche.«
»Ich stelle ein Aufgebot zusammen, Marshal, und das…«
Andrew Marley wehrte ab.
»Bis dahin ist die Fährte schon wieder kalt. Außerdem halte
ich nichts von einer Posse, die mehr an Spuren zertrampelt als
sie Erfolg verspricht. Los, Jungs, wir folgen ihnen!«
Aus dem Bankhaus stürmte ein völlig aufgelöster dicker Typ.
Sein Haar war zerrauft, die Krawatte offen, und sein rechtes
Auge prangte in den Farben eines Sonnenaufgangs.
»Ich bin bestohlen worden!« jammerte er. »Zwanzigtausend
Dollar! Mein Gott, das bedeutet meinen Ruin! Ich zahle
demjenigen eine Prämie von Zweitausend, der mein Geld
zurückbringt.«
Marley stieß dem Sheriff sanft mit dem Ellbogen an.
»Der Bankier?« fragte er.
»Ja, Marshal. Wenn Sie frische Pferde brauchen, gebe ich
Ihnen welche. Gute, ausgeruhte Tiere, absolut gebirgsfest und
zuverlässig. Wollen Sie?«

»Okay, beeilen Sie sich, Sheriff. Wir bringen Ihnen die
Pferde gelegentlich zurück.«
Eine Viertelstunde danach ritten die drei Sternträger am
Santa Cruz entlang nach Süden. Kaum hatten sie die Häuser
von Tubac hinter sich gelassen, hielt Marley an und sprang aus
dem Sattel. Aufmerksam suchte er den Boden ab.
Larry und Buck blickten inzwischen über den Fluß. Larry
sagte ziemlich trübsinnig: »Mann, Bruderherz, bei diesem
vielen Wasser ist es ein Wunder, daß den Menschen in Tubac
noch keine Flossen gewachsen sind.«
Buck Tinatra verstand den Freund. Ein Witz bleibt immer ein
Witz, auch wenn er auf maßlose Übertreibung basiert. Der
Santa Cruz war nämlich so trocken wie die Kehle eines
Säufers, der auf Enthaltsamkeit gesetzt worden war.
»Wolltest du schwimmen, Larry? Tu's nur, du hast Zeit.
Unser Marshal sucht inzwischen nach der Fährte, und das
dauert bei ihm 'ne Weile.«
»Trottel der Nation. Worin soll ich denn baden?«
Marley unterbrach die Frotzelei der beiden.
»Kommt doch mal von euren Kleppern runter und helft mir
suchen. Wir müssen einen großen Kreis schlagen, Jungs. Larry
links und Buck rechts herum.«
»Hört, hört, sein großes Hühnerauge weint!«
Sie stiegen ab und halfen dem Marshal bei der Suche nach
der Spur. Larry fand sie weiter entfernt. Die zwei Banditen
waren am Fluß entlanggeritten und dann nach Osten
abgebogen. Nach ungefähr 400 Yards hatten sie wieder die
Richtung geändert und waren nach Norden geritten.
Auf diesem Weg mußten sie wieder an der Town
vorbeikommen, deren Bank sie beraubt hatten.
»Unverschämtheit!« brummte Marley, beschattete die Augen
mit der Hand und starrte in nördliche Richtung.
Wohin wollten die Kerle? Im Norden lag weiter nichts als
das Green Valley, eine von Canyons und Arroyos zerrissene

Landschaft. Um zu entkommen, mußten sie Wasser haben, und
gerade das gab es dort oben nicht.
Gut, kurz hinter dem Green Valley lag Sahuarita, ein Nest,
das ausschließlich von Mexikanern und »zahmen« Indios
bewohnt wurde. Hier konnten sie Unterschlupf finden und
abwarten, bis Gras über die Geschichte gewachsen war.
Aber der Ritt über das Gebirge war weit mehr als nur eine
Strapaze. An der ganzen Grenze wurde erzählt, daß das Land
zwischen dem Santa Cruz und dem Sienega bis weit hinauf zu
den Wildhorse Mountains von Apachen durchstreift wurde.
Nicht nur Chiricahuas trieben sich hier herum, sondern auch
Tontos, Netdahe, Pinal-Apachen und Mimbrenjos. Marley
überlegte weiter. Nach Westen konnten sie nicht ausweichen.
Auf der anderen Seite des Santa Cruz erstreckten sich 30
Meilen weit die Sierrita Mountains, steinig und trocken wie der
Mond.
Marley stieg auf sein Pferd. Wie ein Feldherr vor der
Schlacht gab er das Richtungszeichen an.
*
Vor Sonnenuntergang stießen die drei Männer des Gesetzes auf
eine Patrouille von über 20 Mann. Sie wurde von einem älteren
Lieutenant angeführt, dem man die Trunksucht vom Gesicht
ablesen konnte.
Beide Trupps hielten an. Marley stellte sich und seine beiden
Gefährten vor und erfuhr, daß der Offizier Koschewsky hieß,
15 Dienstjahre auf dem Buckel hatte und das Saufen von
seinen Eltern, die aus Polen gekommen waren, gelernt hatte.
Nach dem üblichen Woher und Wohin erfuhr Marley, daß
Häuptling Cochise tatsächlich überall zugeschlagen hatte, am
frühen Morgen in Sonora eine mexikanische Stadt dem
Erdboden gleichmachte und abends im oberen San-Pedro-Tal
einen Farmer oder eine Militärpatrouille überfiel. Seine

Chiricahuas waren überall, und sie gaben weder Pardon noch
verlangten sie welchen.
»Gestern überfielen diese roten Bestien Naco, töteten über
dreißig Mexikaner und griffen wenige Stunden später einen
Warenzug an. Der wollte nach Tubac, kam aber nicht mal bis
fünf Meilen hinter die Grenze.«
»Das hört sich nicht gut an, Lieutenant«, sagte Marley
zurückhaltend.
Daß er und seine Freunde tags zuvor noch ganz in der Nähe
der Überfälle gewesen waren, verschwieg er.
»Unsere Armeeleitung und die Zivilverwaltung in Sonora
sind ratlos. General Howard rauft sich die Haare und muß sich
von Sherman Grobheiten sagen lassen. Es ist offensichtlich,
daß die Armee mit der roten Plage nicht mehr fertig wird.«
Der Marshal ließ den geschwätzigen Offizier weiterreden. Er
unterbrach ihn nicht mal mit einer Handbewegung.
»Arizona hat mit Sonora ein Abkommen getroffen, um der
Apachenplage Herr zu werden. U.S.-Truppen dürfen bei der
Verfolgung von Chiricahuas die mexikanische Grenze
überschreiten und weit ins Land vordringen. Ist das nicht ein
gewaltiger Fortschritt, Marshal?«
»Ein ganz gewaltiger«, antwortete Drew Marley
nachdenklich. »Sagen Sie, Lieutenant, sind Ihnen unterwegs
zwei Reiter begegnet? Ich meine, haben Sie welche gesehen,
die nach Norden reiten?«
Lieutenant Koschewsky schüttelte den Kopf.
»Verfolgen Sie die beiden?«
»Es sind Bankräuber und Mörder, und sie haben keine
Stunde Vorsprung. Bis hierher verfolgte ich ihre Spuren.«
»Und jetzt haben Sie die Fährte verloren?«
»Nein. Ich stieß auf Sie. Ich möchte nur wissen, ob Sie die
Kerle sahen.«
»Nein, Marshal, an uns ist niemand vorbeigekommen. Es
kann sein, daß sie sich versteckten, als sie uns bemerkten.

Aber…«
»Danke«, sagte Marley und tippte an den Hut. »Wir müssen
weiter. Das Kriegsglück sei Ihnen hold, Lieutenant. Adios!«
Marley ritt mit seinen Deputys an der Kolonne Blauhemden
vorbei, die die Pause dazu benutzt hatten, sich Zigaretten zu
drehen oder Pfeifen anzuzünden. Neugierige Blicke streiften
die Sternträger.
Eine Weile später stießen sie wieder auf die Fährte. Marley
stieg aus dem Sattel und betrachtete sie. Als er aufblickte, lag
ein grimmiger Glanz in seinen Augen.
»Sie sind der Truppe ausgewichen und wieder auf den Weg
gestoßen. Die Spur ist kaum eine Stunde alt. Ihnen nach,
Jungs!«
Larry klopfte sich auf den Bauch.
»Leer wie die Hosentasche eines Tramps. Wie wär's mit
einem gemütlichen Lagerplatz, einem warmen Essen und
einem Eimer voll heißem Kaffee, Sternschlepper?«
»Während wir essen, gehen sie uns durch die Lappen.«
»Kein Gedanke daran, Mann des rostigen Ordens. Niemand
geht uns durch die Lappen. Was hilft's, wenn ich vor Schwäche
aus dem Sattel falle?«
»Allmächtiger Manitu! Hast du das gehört, Bucky? Dein
Spezi will die schöne Welt schon wieder verlassen, kaum erst
angekommen. Später, Freßsack. Jetzt reiten wir erst mal
weiter.«
Die Gegend wurde felsiger und öder. Anspruchslose Disteln,
Mesquite und Agaven wuchsen an Stellen, wo der Wind Sand
zusammengetragen hatte. Die Sonne stand eine Handbreit über
dem Gebirgszug im Westen und blinzelte trübe aus einem
Lichthof.
»Was haltet ihr davon?« fragte Marley und wies auf das
Himmelsgestirn.
»Ziemlich ungewöhnlich«, erwiderte Larry Osborne. »Ist mir
auch schon aufgefallen. Verdammt will ich sein, wenn das
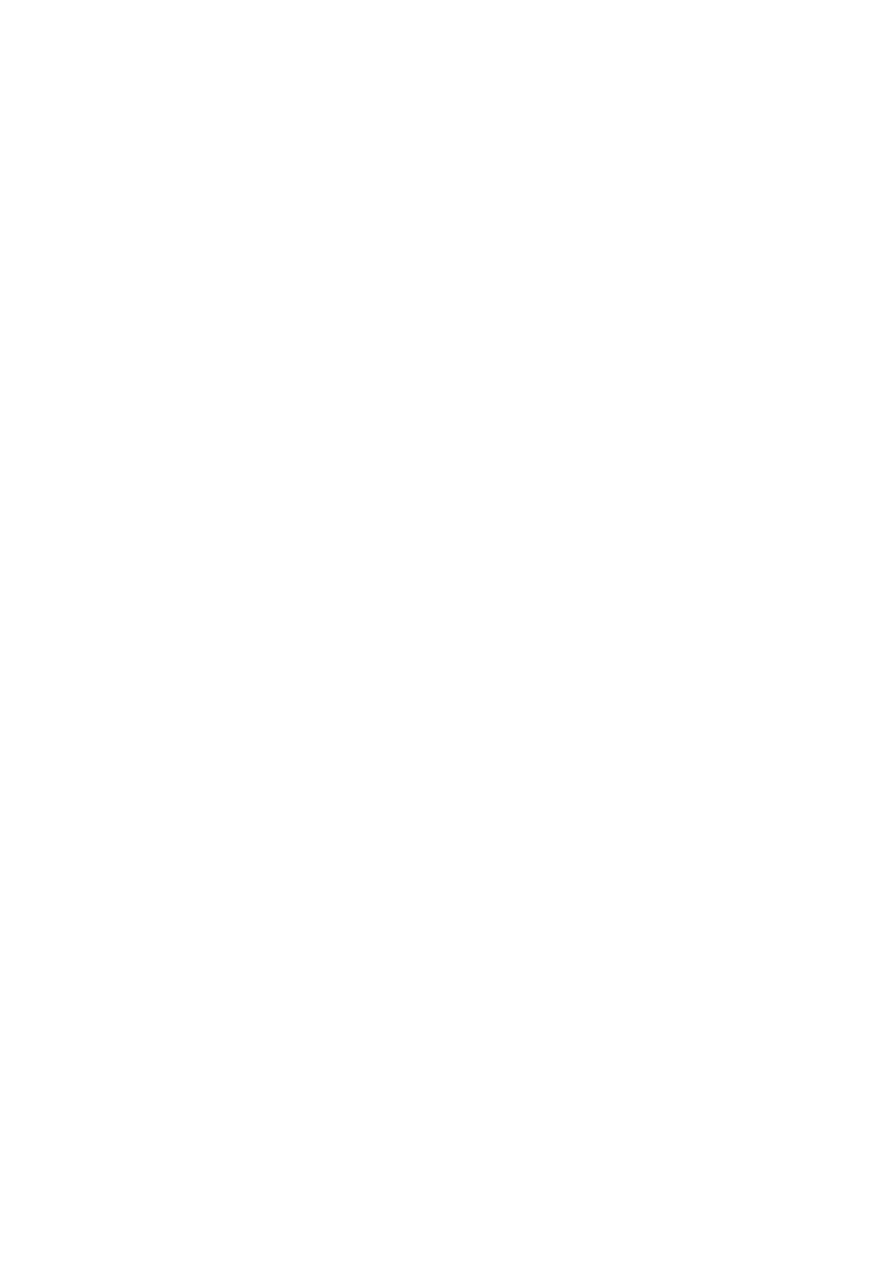
nichts zu bedeuten hat.«
»Was könnte es bedeuten?«
»Orkan, Blizzard, Schnee, was weiß ich.«
»Es ist spürbar kälter geworden.« Buck betrachtete den
Himmel. »Das grüne Licht will mir nicht aus dem Kopf. Bei
jedem Sonnenaufgang, und das den dritten Tag.«
Larry Osborne sagte: »Suchen wir uns besser eine Höhle
oder einen geschützten Unterschlupf.«
Marley sog prüfend die Luft ein. Er zuckte mit den Achseln
und schüttelte dann den Kopf.
»Weshalb eigentlich? Mann, wir haben Spätsommer. Um
diese Jahreszeit bläst im Südwesten kein rauher Wind, weder
im Himmel noch in der Hölle.«
Aber auch er machte ein besorgtes Gesicht. Ständig drehte er
den Kopf oder sah sich um. Es gab keinen Schutz in der kargen
Landschaft. Kalt und abweisend wirkten Grate und Zinnen auf
die Reiter.
Die fahle Sonne zog sich weiter in einen Vorhang aus
Wasserdampf zurück und ließ Grün nachfließen. Es strahlte
etwas Unheimliches aus, das selbst hartgesottene Männer wie
Marley und die beiden Freunde das Fürchten lehrte.
»Wenn wir nicht an Tempo zulegen, geraten wir in einen
furchtbaren Schlamassel«, sagte Buck mit einem Seitenblick
auf die Sonne.
»Wozu beeilen?« sagte Larry. »Schutz finden wir nirgendwo.
Es ist also gleich, wo uns das Unwetter überrascht.«
Es war Spätnachmittag.
Um diese Zeit schien sonst die Sonne heiß wie ein Backofen.
Es dunkelte bereits.
Der Weg führte aufwärts. Die Pferde prusteten und
schnaubten. Es war, als wäre die Luft dünner geworden.
Larry Osborne warf einen Blick auf Buck Tinatra. Der
Freund hatte dunkle Ringe unter den Augen. Sein Gesicht war
schweißgenäßt und angespannt.

Die Situation der kleinen Gruppe verschlechterte sich von
Minute zu Minute. Drew Marley kauerte vornübergebeugt im
Sattel und fühlte, wie der Schweiß über sein Gesicht lief und
seine Haut zu jucken begann. Es wurde immer dunkler. Das
Geräusch der Pferdehufe entsprach dem trägen Rhythmus
seiner Gedanken, die sich um die beiden Verbrecher vor ihnen
drehten.
Larry hielt manchmal den Atem an und betete zu Gott in
seiner stummen, aber eindringlichen Sprache, daß der Weg
bald ein Ende haben möge, auch daß das Unwetter ausbliebe.
Aber das Unwetter kam.
Auffrischender Wind trieb Sand, trockenes Unkraut und
Tumbleweeds in den Hohlweg. Die Pferde wurden unruhig. Es
war wieder still geworden, unheimlich still. Kein Lufthauch
bewegte die dünnen Gräser und Unkrautstengel. Der Marshal
warf einen verzweifelten Blick zum Himmel. Von der Sonne
war nichts mehr zu sehen. Auch das Grünlicht war weg, wie
von einem nassen Lappen vom Himmel gefegt.
Wo die Sonne stehen mußte, kreiste ein Loch in der
schwarzen Wand. Es drehte sich schneller, immer schneller,
mit einer wahnwitzigen Geschwindigkeit und wurde von einer
unsichtbaren Kraft vorwärtsgetrieben.
Larry und Buck blickten verzweifelt in die Runde. Es gab
keinen Unterschlupf. Der Hohlweg, durch den sie ritten, schien
kein Ende zu nehmen. Wie ein dünner Schlauch schnitt er sich
in die Berge hinein und führte ständig aufwärts.
Das Unwetter setzte mit einem ohrenbetäubenden Schlag ein.
Man hatte den Eindruck, als wäre damit der Weltuntergang
angekündigt worden. Kaum war das Dröhnen verebbt,
kündigten sich die ersten Zeichen des Unwetters an. Ein
gigantischer Windstoß fegte über die Reiter hinweg. Die
Wände des Hohlwegs hielten das meiste von ihnen ab, aber sie
bekamen auch so noch genug zu spüren.
Die Tagesschwüle verwandelte sich in eisige Kälte, die von

den Bergen herunterfegte und Menschen und Tieren das Mark
in den Knochen zu gefrieren drohte.
»Gleich geht's los«, sagte Marley keuchend.
»Was, zum Teufel, geht los?«
»Ich hab's in Montana erlebt«, antwortete Andrew Marley
auf Larrys Frage. »Das ist ein ausgewachsener Blizzard,
Jungs.«
»Was losgeht, will ich wissen.«
»Schneesturm, Eishagel, Orkan.«
Der Sturm orgelte über ihnen und peitschte sie mit Sand und
pflanzlichem Unrat. Die Reiter zogen die Köpfe ein und die
Hüte fester.
Emsig klapperten die Eisen der Hufe auf der Steigung. Es
ging immer höher hinauf. Neben ihnen, auf dem rechten Hang,
bogen sich Korkeichen, Pinien und Wacholder im Orkan. Der
Sturm wurde so heftig, daß das Atmen zur Qual wurde.
Und dann tat sich das reinste Inferno auf.
Faustgroße vereiste Brocken fielen vom Himmel, schlugen
Beulen und Wunden, rissen lange Schrammen in die
unterkühlte Haut. Pferde und Reiter stöhnten unter dem
höllischen Stakkato des Himmels, der alle seine Schleusen
öffnete, Eis und Schnee wie das Strafgericht Gottes auf die
Erde schleuderte.
»Allmächtiger!«
»Weiter!«
Die Worte wurden ihnen von den Lippen gerissen. Grelle
Blitze zuckten durch die Finsternis, zerfaserten sich wie
Seilenden, fuhren krachend in Gipfel und Bäume und
zerschlugen wie der Hammer Luzifers alles, was sich von der
Erde abhob.
Nebeneinander kämpften sich die Männer in dem breiter
werdenden Hohlweg zur Mesa hinauf. Schnee knirschte unter
den Tieren, und Schnee verklebte ihnen die Augen und Ohren.
Der Temperatursturz machte allen jedoch am meisten zu

schaffen. Die Zähne der Männer klapperten, ihre Hände
zitterten, und ihre Füße schienen wie abgestorben.
Der Orkan holte Atem und ließ eine Pause eintreten.
Sie waren fast oben auf der Mesa, aber alles, was sie sahen,
war eine sterile weiße Fläche, aus der sich Klippen und Grate
wie weiße Nasen verkappter Riesen abhoben.
Der Marshal zügelte überrascht sein Pferd. Wie gesagt, der
Orkan holte nur Atem. Durch die dünne Schneewand, die den
Hohlweg von dem Plateau wie mit einem Vorhang trennte, sah
er etwas Bewegliches. Eine farblose Masse stand wie ein
mächtiger Klumpen in der düsteren Landschaft.
»Großer Gott! Hat sich heute alles gegen uns verschworen?«
»Ruhe!« befahl Marley. »Keine Panik, Jungs, das sind
Apachen.«
»Greifen sie uns an?«
»Ich bin kein Hellseher. Aber wenn ich nicht irre, ist Cochise
bei ihnen. Und was der nach den vielen Massakern an Weißen
und Mexikanern tun wird, wissen die Götter.«
Tatsächlich war Häuptling Cochise bei dem Pulk grimmig
dreinblickender Wasserspeiergesichter. Wie aus Ton modelliert
standen sie in der Schneenacht und starrten auf die Weißen.
Ein einzelner Mann trat zur Seite. Groß und mächtig in der
Statur, gab er mit Handzeichen Befehle.
Wie ein Spuk verschwanden die Chiricahuas, und der
Schnee, der wieder in großen Flocken einsetzte, verhüllte sie.
»Mann, Mann. Noch nie in meinem Leben habe ich so
gezittert.«
Das sagte Larry. Es klang wie eine Befreiung von einem
Alpdruck, wie das Amen nach einem langen Gebet.
»Sie sind weg«, murmelte der Marshal. Er rieb sich die
Augen, als hätte er noch nicht glauben können, daß sie wirklich
allein in der verschneiten Wildnis waren.
Sosehr er aber rieb und die Nässe des tauenden Schnees aus
seinem Gesicht entfernte, das Bild blieb.

Kein Apache stand mehr auf der Anhöhe vor ihm.
*
»Sind sie noch hinter uns?« fragte Gus Kilkenny.
»Bestimmt«, erwiderte Atkins kühl. »Der Sternträger gibt nie
auf.«
»Wir müssen nach einem Unterschlupf suchen, Claude.
Wenn der Orkan schlimmer wird, sind wir hier draußen
erledigt.«
»Das Risiko zu erfrieren oder erschossen zu werden, bleibt
uns immer, Gus. Wenn sie uns in einer Höhle oder einem
ähnlichen Versteck aufstöbern, können wir uns nicht mal
wehren.«
»Also weiter?«
Atkins nickte. Vor sich auf dem Pferd hatte er die prallen
Satteltaschen mit dem geraubten Geld liegen. Er hielt sie so
fest, als hätte seine Seligkeit von dem Besitz des Geldes
abgehangen.
Kilkenny sah es.
»Wirst du ehrlich mit mir teilen, Claude?«
»Wie es vereinbart war: ehrlich und wahrhaftig.«
»Ich glaube dir nicht.«
Atkins zuckte mit den Achseln. »Dann laß es bleiben. Ich
sagte ehrlich, wie es vereinbart wurde. Glaubst du, ich betrüge
dich?«
Er lenkte sein Pferd zu einer Nische im Fels, deren
Überdachung wenigstens für kurze Zeit Schutz von oben bot.
Er schwang sich aus dem Sattel. Sein Pferd führte er zu der
abschließenden Felswand und füllte ihm den Futtersack.
Hinter ihm knirschte das Geröll. Er fuhr herum, als eine
mächtige Faust gegen sein Kinn prallte. Atkins fiel zurück und
schlug mit dem Schädel gegen einen Stein. Fast wäre er noch
von seinem eigenen Pferd getreten worden, das vor Angst

auskeilte.
Als er sich aufrichten wollte, drückte ihn Kilkenny mit dem
schweren Stiefel am Brustkorb nieder. Claude stöhnte, rollte
zur Seite und richtete sich auf die Knie, als der Bandit wieder
angriff. Kilkennys Fäuste, hart wie Granit, schlugen wie
Hämmer zu. Er wurde wieder gegen die Wand getrieben. Sein
Kopf prallte davon ab. Er hob die Fäuste und versuchte eine
schwache Abwehr.
»Du Hundesohn«, zischelte Gus Kilkenny, »höllischer
Bastard! Du willst mich um meinen Anteil betrügen. Das
prügele ich dir aus deinem verdammten Hohlkopf.«
Atkins überlegte, ob er ziehen und schießen sollte. Er tat es
nicht. Die Verfolger konnten schon nahe heran sein und sofort
vermuten, daß bei den Flüchtenden etwas nicht stimmte.
Kilkenny tänzelte vor ihm wie ein Boxer herum und fintete
mit den Fäusten. Wieder schlug er eine Dublette nach Atkins.
Der fing sie mit dem linken Arm ab. Kilkenny wurde durch den
eigenen Schwung nach vorn gerissen, wobei sein rechtes Auge
mit der Rechten von Atkins Bekanntschaft machte. Ein
Schwinger fegte unter seine Gürtellinie und ließ ihn
schwanken. Er stolperte mit rudernden Armen nach hinten, und
Atkins setzte sofort nach.
Ein gewaltiger Uppercut traf den kräftigen Outlaw am Kinn.
Der Bandit sank nach vorn – in einen wuchtigen
Aufwärtshaken. Er seufzte, verdrehte die Augen und ging
vollends zu Boden.
Atkins wich etwas zurück.
»Du elender Narr«, fauchte er, »was fällt dir eigentlich ein?«
Kilkennys Hand zuckte zum Revolver. Atkins war schneller.
Er trat dem Banditen die Waffe aus der Hand, packte ihn und
schlug ihm zweimal ins Gesicht. Dann zog er den Colt und
drückte den Lauf gegen Kilkennys Bauch.
»Du Schwein«, flüsterte er. »Es wäre mir ein Vergnügen,
dich abzuknallen. Warum hast du mich angefallen?«

»Du willst mich betrügen.«
»Du erhältst genau die Hälfte von der Beute, wie es zwischen
uns abgemacht war.«
»Lügner! Ich beobachtete, wie du die Satteltaschen
krampfhaft festhieltest. Du willst den Zaster alles für dich.«
»Den Teufel will ich.«
Atkins trat zur Seite, den Colt im Hüftanschlag. Der bullige
Kerl hatte ihn angeschlagen, und Claude merkte, wie seine
Knie weich wurden.
»Warum hast du das getan? Weißt du Idiot nicht, daß wir
aufeinander angewiesen sind?«
Kilkenny starrte ihn aus blutunterlaufenen Augen an.
Bitterkeit umspielte seinen zerschlagenen Mund.
»Das war der richtige Augenblick für dich, mich im Stich zu
lassen und mit dem Geld zu verschwinden. Du hast es so
geplant.«
Atkins schüttelte den Kopf. War Kilkenny nicht mehr ganz
richtig in seinem Oberstübchen? Er hatte nichts derartiges
geplant. Nur die Flucht hatte er im Auge gehabt. Die Flucht
nach Norden. Er konnte sich denken, daß eine Posse hinter
ihnen her war. Außerdem folgten noch drei Sternträger ihrer
Fährte.
Kilkenny richtete sich mühsam auf, lehnte sich mit dem
Rücken gegen den kalten Fels.
»Tut mir leid«, murmelte er unter Schmerzen. »Da habe ich
sicher was mißverstanden. Glaubst du, daß wir von hier
wegkommen?«
»Natürlich, du Dummkopf. Wenn wir uns aber weiter
gegenseitig die Zähne einschlagen, bleiben wir auf der Strecke.
Sie können nicht weit hinter uns sein. Das Ausweichmanöver
beim Erscheinen der Soldaten hat uns zuviel Zeit gekostet, die
sich nur schwer aufholen läßt. – Steh auf!«
Kilkenny erhob sich unter Ächzen und Stöhnen. Ein
Gedanke zuckte Atkins durch den Kopf. Besser noch: eine

innere Stimme: Paß in Zukunft etwas besser auf, was hinter dir
ist, Claude.
»Du willst doch bei diesem Unwetter nicht weiterreiten,
Claude?«
»Meinst du, der Marshal läßt sich von einem Blizzard
abhalten, uns zu verfolgen? Trottel! Du machst es dir
verdammt leicht, Mensch, und träumst am hellichten Tag.
Junge, Junge, dein Gehirn ist nicht größer als das von einem
Spatz. Und nur nicht zuviel anstrengen. Wenn du nur auf
deinem fetten Hintern sitzen kannst…«
»Immer auf mich«, unterbrach Kilkenny ihn sauer. Er sah
aus, als hätte ihn ein Pferd getreten. »Warum ständig deine
Nörgelei, Claude?«
»Weil du ein dämlicher Hund bist, der sich nur auf seine
starken Beißwerkzeuge verläßt, dabei aber vergißt, daß andere
Hunde ebenfalls zupacken können. Wir reiten weiter.«
»Ist das ein Befehl?«
»Ich habe in unserer Partnerschaft nichts zu befehlen«,
erwiderte der Revolvermann kalt. »Ich jedenfalls möchte noch
eine ganze Weile leben. Und das kann ich nicht, wenn sie uns
schnappen. Na los, schwing dich auf deinen Zossen.«
Sie zogen sich in die Sättel und ritten in die schnee- und
sturmtosende Nacht, die wenigstens ihre Gesichtsblessuren
kühlte.
*
Marshal Drew Marley stieß mit seinen Deputys auf die vom
Weg abweichende Spur. Er hielt an, studierte die Hufabdrücke,
die sich im Schnee deutlich abzeichneten. Lange starrte er zur
Mulde in der Felswand hinüber. Sie lag wie eine aufgestellte
Muschel vor seinen Augen und ebenso offen.
Marley glitt trotz des Sturmes vom Pferderücken und ging zu
Fuß ein Stück weiter. Nach wenigen Yards stieß er auf die

zurückführende Fährte, die sich nach Norden entfernte.
Kühne Gedanken gingen dem Marshal durch den Kopf.
Logische Gedanken, die sich in erster Linie auf das geraubte
Geld bezogen.
Waren die Banditen der Last überdrüssig geworden?
Hatten sie das Geld dort drüben im Schutz der Wand
verscharrt?
Andrew reichte Larry die Zügel seines Pferdes und gab durch
Gesten zu verstehen, daß er zu Fuß unter die überdachte
Felswand gehen wollte. Aufmerksam blickte er sich um. Es
gab außer Steinen und den Spuren nichts zu sehen. Sie hatten
sich höchstens einige Minuten hier aufgehalten und waren
weitergeritten. Daß sie sich bedroht und geprügelt hatten,
konnte er auf dem harten Fels nicht erkennen.
Er ging zurück, bestieg steifbeinig sein Pferd und trieb es an.
Als hätte er damit ein Signal gegeben, setzte der Blizzard
wieder mit voller Wucht ein und warf Unmassen von Schnee
auf die drei Männer. Der Sturm heulte und orgelte wie die
Seelen unzähliger Gemarterter. Dazu zuckten Blitze vom
Himmel, als sollte die Welt in einer einzigen Nacht zerstört
werden.
Andrew Marley wischte die sich sinnlos im Kreis drehenden
Gedanken beiseite. Sein Kopf dröhnte und machte es ihm
schwer, logisch zu denken. Er starrte in die weiße Turbulenz
und fragte sich, warum es die Banditen nicht an dem relativ
sicheren Ort gehalten hatte.
Dann blickte er rechts hoch und glaubte seinen Augen nicht
trauen zu können.
Was sich dort aus der weißen Wand treibenden Schnees
langsam abhob, war ein Mensch mit einem Stirnband und
langen Haaren. Der Krieger wirkte durch die Verzerrung
überdimensional und fast so groß wie ein Riese.
»Cochise«, murmelte der Marshal. »Schon wieder Cochise.
Mein Gott, was will er nur von uns?«

Hinter ihm verwehte ein Zuruf Larrys im Sturm. Marley hob
die linke Hand und gab das Verstanden-Zeichen.
Der Häuptling stemmte sich dort oben auf der
Felsenplattform gegen den Orkan und blickte nach Norden.
Marley sah deutlich, wie er etwas über die Schulter rief.
Krieger tauchten wie aus dem Nichts auf. Viele Krieger. Sie
waren plötzlich da, als hätte sie der harte Fels einfach so
ausgespuckt. Die Gruppe von 30 oder mehr Chiricahuas nahm
Cochise trotz der erbarmungslosen Kälte in die Mitte, und alle
starrten nach Norden.
Was ist dort? fragte sich Marley. Er zügelte sein Pferd,
bedeckte die Augen gegen die harten Schneekristalle mit der
Hand und beobachtete die Apachen. Sie befanden sich kaum 60
Fuß über ihm. Wahrscheinlich war da eine Plattform, ein
Plateau aus Fels, das ihnen und ihren Pferden Raum bot. Aber
weshalb standen sie dort und setzten sich der Kälte und dem
Schneesturm aus?
Inzwischen war es eisig geworden. Die drei Weißen hatten
ihre Mackinaws aus der Deckenrolle gezogen und
übergestreift. Wie die Indianer auf dem Plateau die Kälte
ertrugen, war dem Marshal ein Rätsel. Sie trugen lediglich ihre
dünne Wüstenkleidung und dazu sehr hochschäftige
Mokassins, die bis an die Knie reichten.
Die Chiricahuas starrten noch immer in nördliche Richtung
und machten keine Anstalten, sich vor dem Schneesturm zu
schützen oder den erhöhten Punkt zu verlassen.
Buck Tinatra kam an Marleys Seite. Er beugte sich im Sattel
zur Seite und brachte seinen Mund nahe an Marleys Ohr.
»Haben die es auf uns abgesehen, Drew?«
»Glaube ich nicht. Cochise hat uns längst entdeckt. Er würde
sich nicht zeigen, wenn er etwas gegen uns unternehmen
wollte.«
»Ich glaube, daß nun alle unsere kleinen Probleme aus der
Welt geschafft werden. Mann, Drew, es wird mir ein

Vergnügen sein, die Apachen-Squaws zu beobachten, die sich
mit Feuer und Messer über die Banditen hermachen.«
Larry, der seinen Kopf rübergeneigt und mitgehört hatte,
erbleichte. Er biß sich auf die Unterlippe und wandte das
Gesicht wieder dem Orkan zu. Ein saurer Geschmack stieg in
seiner Kehle hoch.
*
Marley überdachte noch einmal die Chancen, die sie hatten, die
Banditen zu fangen. Sie hatten gut gestanden, bis die
Chiricahuas aufgekreuzt waren. Was Cochise beabsichtigte,
war nicht klar. Sein Verhalten war rätselhaft.
Hatte der Jefe es sich anders überlegt?
Wollte er auch die Männer des Gesetzes aus seinem Land
haben?
Ein dicker Eisenring schien Marleys Brust zu peinigen. Er
zog die Schultern in den dicken Mackinaw und richtete sein
Gesicht im aufkommenden Trotz dem Orkan entgegen. Harte
Schneekristalle marterten seine Haut, doch es störte ihn nicht.
Immer war es die Einbildung, die ihm und anderen Weißen
so große Schwierigkeiten bereitete. Das Ereignis selbst war
weniger furchterregend als der Gedanke daran. Und Cochise
hatte diesen schwachen Punkt bei den Weißen entdeckt.
Marley war es klar, daß der legendäre Häuptling jede nur
gegebene Chance ausnutzte, um sein Land von dem »weißen
Ungeziefer« zu befreien.
»Sie sind weg!« brüllte Larry.
Sie waren tatsächlich verschwunden. Marley sah nicht einen
einzigen Indianer dort oben und trieb sein Pferd wieder an. Je
höher sie kamen, desto stärker wurde der Orkan.
Und dann ritt der U.S.-Marshal, auf ein weites,
geröllbedecktes Feld, das sich voraus in der grauen
Dämmerung der Nacht ins Uferlose verlor. Vor seinen Augen

erstreckte sich die Fährte wie mit einer Schnur gezogen.
Marley warf einen flüchtigen Blick nach rechts. Keine
Rothaut war zu sehen. Sie waren verschwunden, als hätten sie
sich in Luft aufgelöst. Zuerst glaubte er an eine Halluzination.
Schließlich gelangte er zu der Überzeugung, daß er nicht mal
einen Hufabdruck von ihnen finden würde, wenn er danach
suchte.
Apachen verstanden es meisterhaft, sich unsichtbar zu
machen und alle Spuren zu verwischen. Selbst bei einer
fußhohen Schneedecke.
Marley parierte erneut sein Pferd. Buck und Larry schlossen
auf. Hier oben auf der Mesa tobte der Sturm mit
unverminderter Gewalt. Die Sicht betrug kaum zehn Yards.
»Wir müssen weiter!« brüllte Drew. »Weiter! Wenn der
Schnee die Spuren bedeckt, ist für uns die Jagd zu Ende.«
»Dann werden wir gejagt, Andrew«, schrie Larry zurück.
»Bei Gott, Drew, wenn sie mich je verwunden und lebend
erwischen sollten, hebe bitte eine Kugel für mich auf. Vergiß
es nicht.«
Marley nickte, deutete auf ein hervorragendes Felsmassiv,
das nur eine dünne Schneebedeckung aufwies. Der Orkan war
so stark hier oben, daß er die Eiskristalle wieder mit sich
fortriß. Am Fuße der Formation sah er eine schwache
Bewegung, die gleich darauf wieder vom Schneetreiben
verdeckt wurde.
»Wir haben sie!« stieß der Marshal begeistert hervor.
Der Orkan wurde schwächer und lichtete seinen Vorhang aus
weißen Kristallen. Für wenige Sekunden herrschte Stille.
Bevor der Blizzard wieder einsetzte, hatten die drei Sternträger
genug gesehen.
100 Yards hinter den Felsen standen über zwei Dutzend
Apachen in einem weiten Halbkreis. Unterhalb des wie eine
Kerze in den Himmel ragenden Gesteins lagen zwei tote
Pferde. Pfeile spickten die Kadaver. Dahinter lehnten zwei

Männer mit Gewehren in den Armbeugen an der glatten Wand.
Die Entscheidung war gefallen.
»Absteigen!« schrie Marley in den wütend aufheulenden
Sturm.
Larry packte seinen Arm, riß den Marshal zu sich herum.
Sein Gesicht wirkte bleich und verzerrt.
»Die rechnen damit, daß wir uns möglichst gegenseitig
umbringen, um dann über diejenigen herzufallen, die das Duell
überlebten.«
Drew schüttelte den Kopf. Die gnadenlose Kälte biß ihm in
die Haut und machte seine Finger klamm.
»Glaube ich nicht, Larry. Cochise hat sie für uns gestellt.
Sieh doch, die Rothäute denken nicht daran einzugreifen.
Wenn die Sache hier erledigt ist, verschwinden sie, ohne uns zu
belästigen.«
»Dein Wort in Gottes Ohr, Drew.«
»Cochise weiß, daß der Erfolg einer Verbrecherjagd bei
einem solchen Unwetter zweifelhaft ist. Er griff ein, um uns zu
helfen. Los, Jungs, wärmt eure Hände! Jetzt wird's ernst.«
*
50 Meilen östlich von jener Stelle, wo der Tod grinsend seine
Sense schärfte und mit dem Teufel um die Seelen der
Duellanten pokerte, stampften vermummte Posten durch das
Zeltlager, wo General Oliver O. Howard residierte.
Das große Lager duckte sich unter dem Sturm wie Hunde,
die die Peitsche ihres Herrn erwarteten. Nur in Howards Zelt
war noch Licht. Der schwache Schein der Kerosinlaterne drang
durch die schneebedeckten Wände wie eine Wintersonne durch
eine Wolkenbank.
Stimmen drangen aus dem Zelt – mürrische, verhaltene,
grobe und befehlende. Hin und wieder blieb der Posten auf
seinem Rundgang stehen, um zu lauschen. Es interessierte ihn

nicht, was der General mit seinen Offizieren zu besprechen
hatte, er lauschte nur aus Gewohnheit und um die Zeit
totzuschlagen. Lange hielt er es im Stehen sowieso nicht aus.
Wenn die Kälte in seinen Beinen hochkroch und sein Körper
steif zu werden drohte, mußte er sich wieder in Bewegung
setzen, um das Blut schneller durch die Adern zu pumpen.
»Lieutenant George Bascom hat mit einem unüberlegten
Streich alles zunichte gemacht, worum ich monatelang kämpfe,
Gentlemen.«
Howards Stimme klang gereizt. Er war es auch. Die
Meldungen über die zahlreichen Massaker an Weißen und
Mexikanern nahmen überhand und Formen an, die das
Blutvergießen des ersten Guerillakrieges weit in den Schatten
stellten.
Die grollende Stimme fuhr fort: »General Sherman will
wissen, wie wir die Lage an der Apachenfront wieder in den
Griff kriegen. Kennen Sie, meine Herren, eine Antwort
darauf?«
»Nein, Sir«, sagte Colonel White, während er seine
Stiefelspitzen anvisierte.
Walmann dagegen warf seinen markanten Schädel brüsk in
den Nacken und erwiderte ziemlich scharf: »Sir, von uns aus
war alles getan worden, was in unserer Macht stand. Mit
Verlaub… General Sherman soll sich an Brevet General West
und Colonel Brigham von Fort Buchanan wenden. Die beiden
sind für alles verantwortlich, was sich zur Zeit im Südwesten
abspielt.«
»Warum ausgerechnet Colonel Brigham? Ich halte ihn für
einen ausgezeichneten Offizier.«
»Er ist verantwortlich für diesen Lieutenant Bascom und den
Weißenhasser Ward. Es mußte ersichtlich gewesen sein, daß
Ward log.«
Howard ließ seinen gesunden Arm unwillig auf den Tisch
sinken.

»Gentlemen, Vorhaltungen bringen uns keinen Schritt weiter.
Die Armee beging Fehler, ohne Zweifel. An uns liegt es jetzt,
diese Fehler nicht fortzusetzen. Ich erwarte Ihre Vorschläge.«
Howard sah White an. Der schüttelte den Kopf. Howard ließ
seinen Blick kreisen. Walmann schüttelte ebenfalls den Kopf
und preßte die Lippen zusammen. Nur John Haggerty,
Chiefscout der Siebenten, wich diesem Blick nicht aus. In
seinen hellen Augen lag mehr als Trotz, schon fast Widerwillen
und Verachtung.
»Sie fragen mich, Sir?«
»Haggerty, ich frage Sie«, war die kurze Antwort des
Kommandierenden Generals. Howard hob kaum die Stimme,
wenn er es mit dem Scout zu tun hatte. Er wußte warum.
John Haggertys Verhältnis zu Cochise war schon immer
unklar gewesen und neuerdings durch Millers Eskapade bei der
Apacheria sehr gestört.
Wenn Cochise den Scout auch ehrenhalber »Falke« nannte,
so tat er dies nur im Kreis seiner Familie und nie vor seinen
Kriegern. Unbestreitbar war der Apachen-Häuptling ein
ausgezeichneter Diplomat und Heerführer. Eine verlorene
Schlacht bedeutete nichts. Auch weiße Generäle hatten
Schlachten verloren, ohne daß die Öffentlichkeit groß
Aufhebens davon gemacht hätte.
»Ich kann Ihnen nicht helfen, General. Wenn ich mich bei
Cochise blicken lasse, bin ich meinen Skalp schneller los, als
ich bis drei zählen kann. Tut mir leid, in die Chiricahuaberge
gehe ich nicht.«
Howard machte eine bedrückte Miene, was recht gut zu dem
Schweigen paßte, das sich im Zelt ausbreitete. Nur die Schritte
der Wachtposten im knirschenden Schnee und das Atmen und
Bullern des Kerosinofens in der Zeltecke waren zu hören.
Oliver Howards blaue Augen waren mit einem bittenden
Ausdruck auf Haggerty gerichtet. John ließ den Kopf hängen.
Er dachte an zwei Dinge, die ihn seit Wochen beschäftigten.

Curt Millers Tod am Marterpfahl wollte ihm nicht aus dem
Sinn gehen. Für was hatte sich Curt bereit erklärt, sein Leben
sinnlos zu opfern. Denn daß das Unternehmen glücken könnte,
konnte und durfte der erfahrene Scout nicht annehmen.
Aber da war noch etwas, was seine Gedanken fesselten:
Cochises Schwester Tla-ina. Das Gesicht dieses schönen
Apachenmädchens ging John nicht aus dem Kopf. Sie kannten
sich noch nicht lange und hatten auch nur einige Worte
miteinander gewechselt. Zu wenig, um mehr als eine Episode
daraus herzuleiten.
Trotzdem mußte John Haggerty ständig an dieses
wunderbare Mädchen denken. Im Wachen und im Schlafen
erschien sie ihm, lockte mit Fingerzeichen und mit der
stummen Augensprache. Ihm war klar, daß er sie wiedersehen
mußte, selbst wenn es ihm bei einem solchen Treffen ans
Leben ging.
Howards ruhige Stimme riß John Haggerty aus einer
Traumwelt, die nur wenig der abgehärteten Art dieses Mannes
entsprachen. John hob den Kopf und sah Howard an. Die
Offiziere neben ihm verhielten sich ruhig.
»In die Chiricahuas werden Sie nicht gehen, Mr. Haggerty?
Ich denke, das erübrigt sich auch. Cochise hat seine
Bergfestung in die Dragoons verlegt und sich mit dieser
Absetzbewegung zunächst den Rücken gegen
Überraschungsangriffe freigehalten.«
»Wer will ihn angreifen?«
»Wir, die Armee.«
»Ist das Ihre Absicht, General?«
»Nein. Aber das weiß er nicht. Er muß vermuten, daß wir
eine Strafexpedition in die Berge schicken. Immerhin hat er's in
den letzten Wochen zu toll getrieben. Ich würde mich nicht
wundern, wenn er kurz über lang in die Sierra Madre in Sonora
ausweicht und dort erst einmal abwartet, bis Gras über seine
Taten wächst.«

»Sie glauben also, daß ich so naiv bin, in die unwegsamen
Dragoons vorzustoßen, General? Großer Irrtum. Ich wüßte
nicht einmal, wo ich ihn zu suchen hätte.«
Howard bekam Oberwasser. Er war sich klar, daß Haggerty
in Lebensgefahr schwebte, wenn er in dem riesigen Gebirge
herumirrte und Cochises neue Bergfestung suchte. Aber der
Ton des Scouts hatte plötzlich nicht mehr so abweisend
geklungen, und diese Stimmungsänderung mußte er
schnellstens ausnutzen. Er griff in die Tasche seines
Uniformrocks und zog ein zusammengefaltetes Papier heraus.
»Von Fort Bowie und von Fort Buchanan trafen
gleichlautende Meldungen ein, Haggerty. Hier, lesen Sie.«
Er schob das Blatt dem Scout über den Feldtisch und
beobachtete ihn, während John die Nachricht las.
Haggerty berührte seinen Hals. Die Angst stand deutlich in
seinem Gesicht. Er legte das Papier auf den Tisch und starrte
die beiden Colonels an. White und Walmann senkten die
Blicke.
»Wir blasen aus dem letzten Loch, Chiefscout«, sagte
Howard beschwörend. »Wenn es uns nicht gelingt, Cochise zur
Räson zu bringen, ist es aus mit dem stolzen Apachenvolk.«
»Wollen Sie etwas Bestimmtes damit sagen, General?«
Howard nickte.
»Sherman und Sheridan tragen sich mit der Absicht, mich
durch General Crook ablösen zu lassen. Das sagt Ihnen doch
genug, oder nicht? Crook wird meine humane Linie nicht
weiterverfolgen. Er braucht Erfolge, wenn er im Südwesten
den Befehl übernimmt. Sie verstehen?«
Haggerty blinzelte müde und ein wenig gereizt in das
flackernde Kerzenlicht.
Draußen tobte der Blizzard. John hatte tiefe Ringe unter den
Augen, und die Wildlederkleidung hing schlaff um seinen
Körper.
»Wohin werden Sie in einem solchen Fall versetzt,

General?«
»Das Oberkommando will mich ins Sioux-Gebiet nach
Dakota schicken. Auch dort ist ein neuer indianischer Messias
auferstanden und schickt sich an, die Weißen aus seinem Land
zu vertreiben.«
»Das wäre schlimm, Sir, sehr schlimm für die Chiricahuas«,
sagte John schleppend. »Ich glaube, das hat Cochise auch nicht
verdient. Die Weißen machen ihn nur so schlecht, und er ist
durchaus nicht der reißende Wolf, für den sie ihn immer
hinstellen.«
Der General breitete die flachen Hände aus. Eine hilflose
Geste, ja, aber eine, die die Lage der Armee in diesem
Landesteil kennzeichnete.
»Sie, Haggerty, könnten die Situation vielleicht retten. Ich
verlange nicht von Ihnen, daß Sie allein oder mit einer
Handvoll indianischer Scouts in die Dragoons reiten. Nein,
nein, dazu ist mir Ihr Leben viel zu wertvoll. Ich denke
vielmehr an einen Mann, der mit dem Jefe noch enger
befreundet ist als Sie.«
John winkte ab. »Sie reden von Thomas Jeffords, nicht
wahr?«
»Richtig. Cochise und er sind so etwas wie Blutsbrüder,
oder?«
Haggerty lachte bitter. »Das war einmal, Sir. Nach den
Vorfällen beim Paß, als Bascom, dieser Grünschnabel,
Cochises männliche Sippe hängen ließ, und der verlorenen
Schlacht gegen die California Volunteers dürfte dem Häuptling
nicht mehr viel an der Freundschaft der Weißen gelegen sein.«
»Es muß einen Weg geben, Haggerty. Ich schilderte Ihnen
die Situation, die nie so ernst wie in diesem Augenblick war.
Der Schneesturm wird morgen oder übermorgen vorbei sein.
Für Schnee ist die Jahreszeit noch nicht weit genug
fortgeschritten. Reiten Sie hinauf zum Paß und sprechen Sie
mit Mr. Jeffords. Ich bitte Sie um diese Gefälligkeit, Mr.

Haggerty.«
»Eine Gefälligkeit, die mein Leben kosten kann, Sir.«
Johns Stimme klang düster und ablehnend.
»Ich bin keine Spielernatur, General. Aber möglicherweise
ist das Risiko immer noch besser, als hier zu sitzen und auf
etwas zu warten, was nie eintreffen wird.«
»Darf ich Ihre Worte als Zustimmung auffassen, John
Haggerty?«
Der Scout strich sich über sein gewelltes braunes Haar und
antwortete: »Bleibt mir ein anderer Weg, General? Ich glaube
nicht. Was die Armee versiebte, muß ein kleiner Scout wieder
in die Reihe bringen. Wenn sich der Blizzard gelegt hat, reite
ich zum Paß.«
White und Walmann standen auf und drückten Haggerty fest
die Hand.
*
Sturm und bittere Kälte hatten zugenommen, schnitten Weißen
wie Roten ins Fleisch und unterkühlten ihr pulsierendes Blut.
Larry Osborne hatte die Pferde nach hinten gebracht und an
dorniges Gestrüpp gebunden. Ihnen durfte nichts passieren.
Ohne Pferde waren sie dem Unwetter und dem rauhen Land
hilflos ausgeliefert.
Zu dritt stemmten sie sich gegen den Orkan und schützten
mit den Händen ihre Augen gegen die peitschenden Flocken.
Marley ging in der Mitte. Ein entschlossener Zug lag auf
seinem stoppelbärtigen Gesicht. Larry schien bleich unter der
gebräunten Haut zu sein. Ob vor Kälte oder aus Angst vor den
Apachen, wer wußte es schon. Buck Tinatra schienen weder
Kälte noch Indianer zu interessieren. Er stampfte wie ein Bulle
durch den hohen Schnee und hatte nur Augen für die Gegner.
Aber die Erkenntnisse, daß der sichere Tod in Form von
heißem Blei oder geschwungenen Skalpmessern auf sie

wartete, lähmte sie alle drei. Marley warf einen langen Blick zu
den Chiricahuas hinüber. Die Indianer standen mit starren
Mienen im Halbkreis und schienen nicht zu frieren.
Cochise war vor die Front getreten. Neben ihm stand Naiche.
Der Häuptling sah nicht zu ihnen herüber. Er blickte auf einen
Ring vereister Büsche, die am Fuß der aufragenden Felswand
wucherten.
Marley konnte sich nicht auf die Dinge konzentrieren, die
den Häuptling interessierten. Die Kälte drang ihm bis auf die
Haut. Er brachte es einfach nicht fertig, seine Gedanken zu
konzentrieren.
Höchstens noch 20 Yards trennten die Sternträger von den
Outlaws. 20 Yards, von denen jeder den Tod bringen konnte.
Inzwischen waren es nur noch 18 Yards. Die kurze Distanz bis
zum sicheren Verderben, wenn es ihnen nicht gelang, schneller
als die beiden Desperados zu sein.
15 Yards…
Cochise schien Marshal Marley zu fixieren. Was ging im
Gehirn des Häuptlings vor? Bewunderte er die Weißen, die in
diesem Land das Gesetz vertraten und sich für das Gute
einsetzten? Andrew wußte das nicht.
In diesen Situationen blieb nicht einmal die Zeit, darüber
nachzudenken, weil er sich nur auf das eine konzentrieren
mußte, auf das, was ihm bevorstand.
Das Duell im Blizzard nahm seinen Anfang. Wie mochte es
enden?
Gab es nicht doch noch eine Möglichkeit, die Schießerei zu
verhindern? Marley blieb stehen, hielt mit ausgetreckten
Armen Larry und Buck zurück. Er legte die Hände
trichterförmig an den Mund und rief: »Ergebt euch, Atkins!
Wenn ihr noch einen Funken Verstand im Kopf habt, dann laßt
die Gewehre fallen und kommt uns entgegen. Ich sichere
beiden eine faire Gerichtsverhandlung zu.«
»Und wenn wir das nicht tun?«

»Dann werden wir es hier und jetzt miteinander
ausschießen.«
»Ein für allemal, Blechstern.«
»Atkins, überlegt es euch! Ich gebe euch noch zehn
Sekunden Zeit, dann kommen wir und holen euch!«
Kilkenny schrie: »Geh zum Teufel, Blechstern! Lebend
kriegst du mich nicht.«
»Dann eben tot. Das Gesetz hat euch gestellt, und das Gesetz
wird euch richten, weil es in diesem Augenblick das Recht
vertritt.«
»Was willst du damit sagen?«
»Daß Recht und Gesetz eins sind, auch wenn keine Jury euch
aburteilt.«
»Ach, fahr zur Hölle, Bastard!«
Marley setzte sich wieder in Bewegung. Er spürte die Kälte
über seine Beine in den Körper kriechen. Der Gefahr,
unbeweglich zu werden, durfte er sich nicht aussetzen, wenn er
in diesem Duell überhaupt eine Chance haben wollte. Der
Revolverschwinger war schnell, und er verstand auch zu
treffen, selbst bei einem solchen Höllenwetter.
Kilkenny dagegen war nur ein brutaler Mörder, der selbst
noch einem verwundeten Hund in den Rücken schoß, weil er
Angst vor dessen Zähne hatte.
»Atkins, nimm deine Chance wahr und tritt wenigstens zur
Seite!« rief der Marshal. Der Sturm riß ihm die Worte förmlich
von den Lippen.
Atkins trat nicht zur Seite. Mit zusammengepreßten Lippen
schüttelte er den Kopf. Kilkenny verlor die Beherrschung und
schlug das Gewehr an. Atkins folgte diesem Beispiel und nahm
Druckpunkt.
Das war das Signal für die Sternträger.
Drei Hände zuckten blitzschnell nach unten. Drei Fäuste
kamen beinahe gleichzeitig mit den schweren Revolvern
wieder hoch. Drei Läufe richteten sich auf die Desperados.

Fünf Schüsse fielen gleichzeitig.
Das war alles.
Das Duell war zu Ende, ehe es richtig begonnen hatte. Atkins
war von Larrys Kugel gegen den Felsen geschleudert worden.
Das Gewehr fiel in den Schnee. Der Revolvermann versuchte
instinktiv den Revolver zu ziehen, um mit dieser Waffe eine
Wendung herbeizuführen. Doch der Tod war schneller. Der
Outlaw starb im Stehen.
Gus Kilkenny wurde von zwei Kugeln getroffen. Er knickte
ein, wollte das Gewehr noch einmal hochreißen, um
wenigstens einen der Gegner mit auf die lange Reise zu
nehmen. Doch es blieb bei der Absicht. Er eilte auf
unsichtbaren Füßen dem Teufel in die Hölle entgegen.
»Aufpassen!« warnte Marley schrill.
Buck und Larry wirbelten herum, die Revolver im
Hüftanschlag. Außer den Schneeflocken sahen sie nichts.
»Die Apachen!« schrie Drew Marley mit größter
Anstrengung, doch der Orkan schluckte jeden Laut. Buck und
Larry erkannten die Gefahr am wilden Gestikulieren des
Marshals.
Sosehr sie auch ihre Augen anstrengten, sie sahen keine
Apachen. Die Stelle, wo sie lauernd und abwartend gestanden
hatten, war leer.
»Sie – sie sind tatsächlich verschwunden«, stammelte Larry.
»Du hattest recht, Drew, du hattest wirklich recht. Cochise hat
ihnen nur den Weg verstellt, damit sie das Gesetz erreichen
konnte.«
Gemeinsam gingen sie zu den Toten. Atkins lag auf dem
Rücken. Seine gebrochenen Augen starrten in den wirbelnden
Flockentanz. Kilkenny war vornüber gefallen und lag auf dem
Gesicht. Buck drehte ihn herum. Noch im Tode klammerte er
sich an den Gewehrschaft, als wollte er die Waffe mit ins
Jenseits nehmen.
Marley sah ein Stück entfernt die Satteltasche mit dem

geraubten Geld im Schnee. Er ging hin, nahm sie auf und
reinigte sie. Als er sie öffnete, sah er die gebündelten Noten. Er
schloß sie wieder und stampfte zu seinem Braunen.
Mit drei Pferden am Zügel kam er zurück. Larry und Buck
blickten ihm entgegen. Buck deutete auf die Toten.
»Bringen wir's hinter uns, Andrew?«
»Wie?«
»Was meinst du?«
»Der Boden ist hart gefroren.«
»Machen wir ein Steingrab wie die Hokokams«, sagte Larry
und wölbte die Hände, um es deutlich zu machen.
Wegen des Sturmes standen sie eng an den Felsen
geschmiegt, trampelten mit den Füßen, um den Blutkreislauf
intakt zu halten, und schlugen die Hände um den Körper.
»Was weißt du von den Hokokams, Larry?«
»Eine ganze Menge, Drew. Man findet ihre Spuren überall in
Arizona und Neu Mexiko. Die Apachen nennen sie
ehrfurchtsvoll die Uralten. Machen wir's wie sie und bauen den
Lumpen ein Steingrab. Verdient haben sie es nicht, das weiß
ich, aber wir sind Christen und wollen als solche handeln.«
Marley nickte.
»Einverstanden«, sagte er. »Steine gibt's ja genug hier.«
Gegen Mitternacht flaute der Orkan ab. Das Orgeln und
Jaulen hörte auf und fing erst am frühen Morgen wieder an.
Marley und seine Freunde hatten die halbe Nacht gearbeitet
und die beiden Toten bestattet. Die andere Hälfte hatten sie
damit verbracht, ein kleines Feuer hundertmal anzuzünden und
zuzusehen, wie es der Sturm hundertmal wieder ausblies.
Es war eine mörderische Nacht, die ihnen die letzte Kraft
raubte. Am Morgen – es war keineswegs heller geworden –
gelang es ihnen, hinter aufgeschichteten Steinen ein Feuer
anzuzünden, um sich wenigstens eine heiße Tasse Kaffee
aufzubrühen.
Es gelang.

Eine Stunde später schwangen sie sich in die Sättel, nachdem
sie ihre Pferde tüchtig gefüttert hatten. Der Hohlweg nahm sie
wieder auf und schützte sie vor dem größten Schneetreiben.
Ohne Aufenthalt ritten sie nach Süden. Am Santa Cruz
stießen sie auf eine Militärpatrouille, die nach Fort Buchanan
zurückritt. Ein Captain führte sie an und war trotz des wieder
zunehmenden Orkans bereit, zu einem kurzen Gespräch
anzuhalten.
Als sie sich nach einer Viertelstunde trennten, war Marley
auch nicht schlauer als vorher. Er blickte den davonreitenden
Soldaten nach und ritt wieder an, als er sie aus den Augen
verlor.
Je weiter sie nach Süden kamen, desto mehr ließ der Orkan
nach. Der Schneefall aber setzte nicht aus. Große Flocken
trieben im Orkan waagerecht gegen die Reiter. Es war ein
Wunder, daß sie die Orientierung nicht verloren.
Noch vor der Abenddämmerung gelangten sie in die Nähe
der Stadt. Marley erkannte es an dem großen Arroyo, dessen
Kiesbett in den Santa Cruz mündete. Als er die ersten Häuser
vor sich sah, parierte er sein müdes Pferd.
»Ihr beide seid jetzt reiche Männer«, sagte er und klopfte auf
die Satteltasche.
Larry hielt neben ihm, Buck dahinter. Larry entgegnete: »Es
ist nicht unser Geld, Blechstern. Reite weiter.«
»Zehn Prozent davon gehören euch.«
»Zehn Prozent? Richtig, das war die Belohnung, die der
Bankier aussetzte. Dann aber zehn Prozent durch drei.«
Der Marshal zwirbelte seinen eisverkrusteten
Texasschnurrbart und lächelte.
»Ich bin Beamter und darf keine Belohnung annehmen. Aber
ihr, Jungs, habt es euch ehrlich verdient.«
»Okay, überlassen wir's dem edlen Spender«, murmelte Buck
von hinten. »Reiten wir, Freund. Ich brauche was Heißes in
meinen Magen, damit ich das Knurren nicht mehr hören muß.«

Larry drehte sich im Sattel um. Die Spannung, die ihn
während der Verfolgung im Indianerland im Griff gehabt hatte,
war gewichen. Der Schalk saß in seinen Augen.
»Immer nur fressen, fressen und wieder fressen. Das liegt
wohl an diesen zwei Köpfen, Buck? Zwei Köpfe, zwei Mäuler,
leider aber nicht zwei Gehirne.«
»Armleuchter! Wer hat zwei Köpfe?«
»Du.«
Buck tippte sich an die Stirn.
»Dich hat's wohl erwischt, he? Armer Kerl. Marshal, was
fangen wir mit dem kleinen Spinner an?«
Marley zuckte mit den Achseln und wartete auf Larrys
Pointe. Daß etwas kommen mußte, war ihm klar. Es kam.
»Wetten, daß du zwei Köpfe hast, Buck? Wette um etwas,
und ich werde dir anschließend beweisen, daß du der Spinner
bist und nicht ich.«
Buck tippte wieder an seine Stirn, ging jedoch auf den Spaß
ein.
»Okay, ich verwette meinen Anteil an der Belohnung und
stelle hiermit fest, daß ich nur einen Kopf habe, dazu einen
hübschen.«
Marley grinste still in sich hinein. Er war gespannt, wie sich
Larry aus der Affäre zog.
»Blechstern, hast du gehört? Einen hübschen, hat er gesagt.
Einen hübschen Holzkopf – klar. So, jetzt werde ich dir
beweisen, daß ich recht habe und danach deinen Anteil an dem
Zaster kassieren. Kopf und Kehlkopf, Junge – sind das keine
zwei Köpfe?«
»Hahahaha!« machte Buck bärbeißig.
Er trat vom Sattel aus nach Larry, der sein Pferd schnell aus
der Reichweite des Beines brachte.
»Kommt, Jungs, treibt euren Blödsinn im warmen Saloon.
Mir kriecht langsam der Frost ins Gebein.«
Marley trieb seinen Braunen an und sah wenig später die

ersten Häuser aus dem Schneetreiben auftauchen.
*
John Haggerty ging noch während der froststarren Nacht in
seine Unterkunft zurück. Der Auftrag gefiel ihm nicht. Wenn
Cochise sein Hauptquartier in den Dragoons aufgeschlagen
hatte, war es nicht leicht, das Versteck auf Anhieb zu finden.
Auch konnte John beim besten Willen nicht sagen, ob sich
Thomas Jeffords bereit erklärte, ihm zu den Chiricahuas zu
folgen. Jeffords' Verhältnis zu Cochise war seit Bascoms
Hängepartie beim Paß sicherlich nicht mehr so gut, daß er dem
Häuptling ohne Vorankündigung oder dessen Einwilligung
gegenübertreten konnte.
Wie auch immer, Haggerty fühlte sich nicht wohl in seiner
Haut. Zu viele Dinge waren in der letzten Zeit geschehen, die
alles außer Kontrolle brachten und das Verhältnis zwischen
Weiß und Rot trübten.
Cochises Niederlage beim Paß mußten ihm erneut
klagemacht haben, wie gefährlich die Weißen waren, und daß
sein Volk zum Untergang verurteilt war, ohne daß er oder die
Tapferkeit seiner Krieger diese Entwicklung aufhalten konnten.
Cochise mußte wieder seine alte Taktik anwenden und einen
Guerillakrieg führen. Aus dem Hinterhalt zu kämpfen lag den
Apachen mehr, als sich in offener Feldschlacht zu stellen. Sie
waren Wüsten- und Gebirgsbewohner und keine
Prärieindianer, die hoch zu Roß, die Streitaxt in der Faust,
gegen die Front der Widersacher anrannten.
John spürte die grausame Kälte, die ins Fleisch schnitt, den
Winddruck und den peitschenden Schnee, der auf seiner
Gesichtshaut prickelte. Und er hörte den gefrorenen Harsch
unter seinen Stiefeln knirschen.
Aber seine Gedanken waren weit fort. Vor seinem geistigen
Auge sah er ein schmales Gesicht, das sich braun und glatt über

den Wangenknochen spannte. Und er sah zwei volle, weiche,
nachgiebige Lippen. Er sah Tla-ina, Cochises Schwester, vor
sich.
Als John seine Unterkunft betrat, schlug ihm eisige Kälte
schmerzhaft entgegen. Er ging zum Kerosinofen und zündete
ihn an. Bald darauf strahlte die dünne Blechwand Wärme und
Geborgenheit aus. Er bewohnte sein Zelt allein und genoß die
Stille, die nur vom Heulen des Orkans unterbrochen wurde.
Müde und nachdenklich warf er sich auf sein Feldbett, ohne
die Stiefel auszuziehen. Zwei gute Gründe hatten ihn bewogen,
das Himmelfahrtskommando anzunehmen. Nicht die Weißen
und General Howard taten ihm leid. Nein, bewahre. Cochise
und dessen Kriegern galt sein Mitgefühl.
Die Weißen hatten diesen großen indianischen Heerführer,
dessen Name zu Lebzeiten bereits Legende war, gejagt,
verraten und gedemütigt. Und als er, dieses Lebens
überdrüssig, zurückschlug, wurde er als Wilder, als Barbar und
kaltblütiger Killer hingestellt.
John kannte die Geschichte der Chiricahuas. Er hatte sie vom
ersten Tag an miterlebt und zu steuern versucht. Er und Curt
Miller, der Scout, der einer Dummheit wegen sein Leben hatte
lassen müssen.
Miller war am Marterpfahl gestorben. Er, Haggerty, lebte
und war nicht bereit, einer zweiten Dummheit wegen ebenfalls
sein Leben einzubüßen. Cochise war nicht gut auf Weiße zu
sprechen, nachdem man fast seine ganze Sippe umgebracht
hatte.
John starrte auf die niedrige Zeltdecke und überlegte sich,
wann der Stoff unter der Schneelast zerreißen mochte. Die
Stunden vergingen qualvoll langsam. Seine Gedanken
erschöpften sich. Hatte es Sinn, ein Programm für sein
Vorgehen aufzustellen?
Er stand auf, ging zu einem flachen Schrank. John Haggerty
trank selten, aber in dieser sturmdurchtosten Nacht brauchte er

einen Drink. Er füllte sich das Glas halbvoll mit Red-Eye,
einem gewöhnlichen Soldatenwhisky. Mit einem einzigen
Schluck schüttete er den scharfen Alkohol hinunter.
Mit dem Glas in der Hand ging er zum Zelteingang, löste die
Verschlußspangen und öffnete die Klappe. Der Himmel war
heller geworden. Ein neuer Tag brach an. Was brachte dieser
Tag?
Die Front an der Indianergrenze war erstarrt. Von den nahen
Forts Buchanan und Bowie zogen Patrouillen durch die Lande.
Aber Chiricahuas waren nie dort, wo Patrouillen ritten.
Chiricahuas kämpften vom Gebirge aus, und dorthin ritten die
Langmesser nicht.
John zuckte unwillkürlich zusammen. Der Hornist blies zum
Wecken. Hell schmetterte das Trompetensignal durch den
aufglimmenden Morgen und wurde vom Orkan zerrissen.
Der Scout ging zum Küchenzelt, empfing seine
Morgenration an Kaffee, Brot und Fleisch, Fett und Jam, und
kehrte zufrieden in sein Zelt zurück. Als er gefrühstückt hatte,
verließ er seine Unterkunft und arbeitete sich stampfend zu den
Stallzelten im hinteren Teil des Lagers.
Der Corporal der Stallwache kannte ihn gut und sattelte
immer die besten Pferde für den Chiefscout.
»Heute ausreiten, Chief? Bei diesem Sauwetter?«
»Wenn der Sturm nachläßt, Wilson. Ist der Braune mit der
Blesse und der tiefen Brust frei?«
»Für Sie immer. Sie sagen mir rechtzeitig Bescheid, wenn
Sie ausreiten wollen. Wohin soll's denn gehen?«
»Zum Paß. Ich muß mit Thomas Jeffords ein paar Worte
unter vier Augen reden.«
»Ach? Sie sind befreundet, stimmt's?«
»Nun ja«, sagte Haggerty und grinste. »Jeffords ist schon ein
prima Kerl, wenn auch manchmal etwas eigenwillig. Also
dann, so long, Pferdebändiger!«
Sie lachten beide, Wilson laut und herzlich. John Haggerty

ging wieder und stemmte seinen Körper gegen den Sturm. Von
Norden sah er eine vierspännige Kutsche in das Lager rollen.
Sie kam bis zum Zentrum und hielt vor dem Besprechungszelt
der Offiziere.
John blieb stehen und bedeckte seine Augen gegen den
prickelnden Schnee mit der Hand. Der Kutscher stieg ab,
öffnete den Verschlag und ließ einen Offizier aussteigen.
Brevet General West.
»Zur Hölle mit dem Bastard!« murmelte Haggerty wütend.
Seit Millers Tod war John nicht mehr gut auf West zu
sprechen. Der Scout wußte, daß West vom Oberkommando
kam und einen ganzen Sack voll Weisheiten mitbrachte, die
nichts taugten. Die Lehren aus West Point waren an der
Indianerfront im Südwesten so sinnlos wie der ganze Krieg
gegen die Apachen.
Übernächtigt und müde suchte Haggerty sein Zelt auf und
legte sich auf das Feldbett.
*
Drei Sternträger staksten durch den hohen Schnee auf der
Main-Street. Die Adobe- und Feldsteinhäuser lagen klein und
geduckt unter den weißen Massen. Vor der Bank standen zwei
Männer und unterhielten sich trotz des kalten Wetters.
Als sie die drei Gesetzesvertreter sahen, wichen sie zurück
und lösten die Gruppe schnell auf. Marley betrat zuerst die
Bank. Er knallte die Satteltasche auf den Abfertigungstresen
und winkte den Clerk heran.
»U.S.-Marshal Andrew Marley, Sohn der großen
Geldscheine. Stell man 'ne Quittung über zweitausend Flöhe
aus. Dalli, Mann! Ich möchte nicht in diesem gottverlassenen
Kaff versauern.«
Der magere Clerk starrte ihn an, als hätte Marley ihm etwas
über die Beschaffenheit des Mondes erklärt.

»Zweitausend? Wofür, Marshal? Bei Gott, wir haben keine
fünfhundert Dollar mehr in unserem Geldschrank, wie soll ich
da zweitausend lockermachen?«
»Mach auf und zahl, Mensch!«
Er öffnete die Schatulle der Satteltasche und stülpte sie um.
Geldpäckchen rutschten heraus und häuften sich auf dem
Tisch. Der Clerk bekam Augen wie ein Karpfen auf dem
Trockenen, stieß einen Schrei aus und rannte davon. Kurz
darauf kam er mit einem Befrackten zurück, der die Schöße
seines Prince-Albert-Rocks wie einen Kometenschweif hinter
sich herwehen ließ.
Beide standen andächtig vor dem Geld und falteten die
Hände wie im Gebet. Marley fragte angewidert: »Kann ich
endlich die Quittung über Zweitausend unterschreiben?«
»Ich bin Martin Bellmann«, erklärte der Befrackte und
reichte Marley die Hand.
Der Marshal brummte: »Freut mich. Noch mehr freut es
mich aber, wenn Sie die zweitausend Mäuse auf den Tisch
blättern und…«
»O ja, Sir. Selbstverständlich. Ich bot eine Belohnung für die
Wiederbeschaffung der geraubten Summe. Die Banditen sind
also tot?«
Marley rieb mit Daumen und Zeigefinger. »Wird's bald?«
Bellmann hob abwehren die Hände. »Zuerst müssen wir das
Geld zählen, Sir. Das ist bei uns Prinzip. Schließlich sind wir
ein Bankunternehmen und kein Warenhaus.«
»Wie lange dauert das?«
»Eine Stunde – oder mehr, Sir.«
Marley registrierte das Zögern und den Widerwillen in dem
Bankier, von dem zurückgebrachten Geld eine Belohnung
abzweigen zu müssen. Wütend sagte er: »Verdammt und
zugenäht, so lange warte ich nicht. Ich habe Hunger. Kommt,
Jungs, lassen wir den Gentlemen sich am Zaster ergötzen, wir
schlagen uns inzwischen die Bäuche voll.«

Er warf einen mitleidigen Blick auf die beringten, gierig
zitternden Hände, die im Geld wühlten und die
Banknotenbündel zu stapeln begann. Der Marshal sagte
grimmig: »Mr. Bellmann, wir kommen in einer Stunde wieder?
Es gibt kein Kneifen und Verzögern. Kapiert? Zweitausend auf
den Tisch, dann erst sind Sie uns los.«
Der Bankier sah ihn lauernd an.
»Dürfen Gesetzesbeamte Prämien annehmen, Marshal?«
»Gesetzesbeamte nicht, aber meine beiden jungen Helfer
hier. Sie sind mitgeritten, weil ich verwundet bin, und sie
halfen, Ihr Geld wieder zurückzuholen. Bye, bye!«
Er stampfte wütend hinaus. Der Geiz des Bankiers erstickte
ihn förmlich. Auf der Straße zerrte der Orkan wütend an seiner
Kleidung und machte ihn noch wütender. In der Mitte der Main
Street blieb er stehen, deutete auf eine Cantina und zog fragend
die Brauen in die Höhe. Als Buck und Larry nickten, stampfte
er durch den Schnee und stieß die Schwingtür auf.
»Essen!« befahl er dem hereineilenden Wirt. »Viel Essen
und heiß wie die Hölle. Dazu einen Eimer voll Kaffee für
jeden! Dalli, Behüter voller Flaschen!«
»Si, Senor, si.«
Der mexikanische Wirt und eine alte Indianerin mit Zöpfen,
die fast zum Boden reichten, schleppten heran, was Küche und
Keller für verwöhnte Gringos hergaben.
Dazu gab es schwarzen Kaffee, der noch einen Schuß heißer
als das Höllenfeuer war, Baconora und Pulque. Besonders dem
Baconora sprachen die Freunde fleißig zu, und so blieb es nicht
aus, daß sie nach einer Stunde einen tüchtigen Rausch hatten.
Marley stand auf, zahlte und schwankte zur Tür.
Der Orkan hatte nachgelassen. Es schneite zwar noch, aber
nicht mehr so stark. Feiner, körniger Schnee bedeckte die Main
Street und rutschte hier und da unter Donnergetöse von den
schrägen Dächern auf die Straße.
Drew Marley steuerte die Bank an. Als er die Tür aufstieß,

kam ihm der Clerk strahlend entgegen.
»Liegt alles bereit, Sir, abgezählt und gebündelt. Die
Quittung unterschreiben Sie bitte.«
Er schob dem Marshal ein ausgefülltes Papier hin und hielt
einen Federhalter und Tinte bereit.
»Sachte, sachte, Junge«, sagte Marley und drückte die Hand
mit dem Federkiel zur Seite. Trunken wandte er sich um und
winkte Larry und Buck.
»Na los, trabt an, heut ist Zahltag!«
Arm in Arm, sich gegenseitig stützend und schiebend,
torkelten die beiden Streckenreiter an die Barriere.
Der Marshal schob ihnen die Banknotenbündel zu. »Zählen«,
sagte er trocken und mit schwerer Zunge. »Die beiden
Geldhaie trauten uns nicht, wir nicht ihnen. Zählt schnell,
damit wir herauskommen.«
»Aber Gentlemen, das ist doch nicht nötig«, sagte der Clerk
entrüstet. »Ich versichere Ihnen, das Geld stimmt bis auf den
letzten Schein.«
»Still, Junge, ganz still!« zischelte Marley. »Wenn ein
Scheinchen fehlt, schieße ich dir zuerst beide Ohren ab, dann
die Nase, schließlich noch…«
»Was noch?« lallte Larry, dem der Schalk schon wieder im
Nacken zu sitzen schien.
Torkelnd drehte sich Marley um. »Was noch…? Well, was
können wir ihm denn noch alles abschießen, Blutsbruder?
Das…«
»Nein, das nicht«, wehrte Larry grinsend ab. »Das braucht er
noch. Hmm, braucht er's wirklich? He, Junge, brauchst du es
noch? Sag die Wahrheit, Kleiner. Ich werde dann unserem
Meisterschützen sagen, daß er es genau trifft.«
»Jesus Christus!« stammelte der Mann schreckensbleich.
»Ich weiß wirklich nicht, wovon die Gentlemen sprechen.«
Larry stieß Marley die Fingerspitze gegen die Brust.
»Hast du gehört, Drew, er weiß nicht, wovon wir sprechen.«

Während sie sich unterhielten, torkelten sie hin und her und
hatten Mühe, sich halbwegs gerade auf den Beinen zu halten.
Buck zählte und zählte, verzählte sich und begann wieder von
vorn. Fluchend schob er schließlich die Banknotenbündel zu
Larry.
»Mach du's, Kleiner. Ich glaub, ich hab'n Schluck zuviel –
hick – zuviel – getrunken.«
Larry stieß Marley den Ellenbogen in die Seite, kroch am
Tresen entlang, nahm die Banknoten und stopfte sie in die
Satteltasche.
»Hast du das gesehen, Drew? Buck ist besoffen, genau wie
du.«
»Nur du bist nüchtern, eh?«
»Ich bin der einzige Nüchterne in dieser Runde, klar? Buck
kann nicht mal mehr das Geld zählen…«
»Du zählst es doch auch nicht«, unterbrach der Marshal ihn.
»Großer Gott, hat uns der verdammte Spitzbube was in den
Schnaps getan?«
»Was sagst du, zählen?« Larry drehte sich mühsam zu
Marley um. »Mensch, habe ich 'ne Meise unter meinem Pony?
Auf ein paar Flöhe kommt's doch nicht an. Wir gehen jetzt
zusammen in die Cantina und lassen die Puppen tanzen.«
*
Das Schneetreiben ließ nach. Der Sturm hatte sich ausgetobt.
Ein Reiter trabte durch den Schneematsch und nahm Richtung
auf den Apachen-Paß. Corporal Wilson hatte John Haggerty
das beste Pferd aus der Remuda gegeben. Der Fuchs trabte
ausgeruht in den hellen Tag und schnaubte höchstens mal
unwillig, wenn er in eine Pfütze trat und das Wasser bis zu
seinem Maul spritzte.
Ein Gewirr von Schluchten tauchte vor John auf, der im
Reiten seinen dicken Mackinaw auszog und hinter seinem Sitz

unter die Deckenrolle schob. Es wurde wieder warm, und der
viele Schnee, der gefallen war, taute in der stechenden Sonne.
Diesen Teil der Chiricahua Mountains kannte er nicht so gut
wie den südlicheren. Er war von Dos Cabezas aus in das
gleichnamige Vorgebirge der Chiricahuas eingedrungen und
sah Fort Bowie im Osten auf einer steinigen Anhöhe liegen.
Er lächelte. Bestimmt beobachteten sie ihn durch ihre Gläser
und fragten sich, was ein einzelner Weißer in dieser trostlosen
Bergwelt zu suchen hatte. Einmal glaubte er sogar die
Trompete zu hören, die zu irgend etwas blies. John tätschelte
dem Pferd den Hals und sprach ein paar Worte mit ihm. Es
spielte mit den Ohren.
John Haggerty ritt dem Mittag entgegen. Am Nachmittag
war er schon tief in der Stille der Bergwelt und hielt bei einer
Quelle an. Rechtzeitig genug fiel ihm ein, daß auch Apachen
Quellen aufsuchten.
John führte sein Pferd wieder zurück und steuerte einen
schmalen Seitencanyon an, vor dessen Eingang etwas
Manzanita und Mesquite wuchs. John trieb den Fuchs durch
das Dickicht, drang ein Stück in den Canyon vor, schwang sich
aus dem Sattel, beschwerte die Zügel mit einem Felsstück und
huschte davon.
An der Quelle war alles ruhig. John schlich ein Stück weiter,
suchte dabei den Boden ab. Außer Hasen- und Vogelspuren
gab es jedoch nichts an Abdrücken zu sehen.
Trotzdem…
Wie so oft in den letzten Monaten verspürte er ein seltsames
Druckgefühl in der Magengegend. Hinter einem
Wacholderbusch blieb er sichernd liegen. John hörte etwas,
war sich aber nicht klar darüber, was es sein mochte. Es klang
wie beschlagene Hufe auf hartem Grund – wie Glockenläuten.
Der Scout rührte sich nicht. Sein Ziel war der Apachen-Paß,
die Station der Butterfield Overland, Thomas Jeffords. Das
Wacholderkraut strömte einen würzigen Duft aus. Das Läuten

wurde lauter, deutlicher. Eine Karawane bog weit hinten in den
Canyon ein und nahm Richtung auf die Paßstraße.
Haggerty zählte sechs Mulis und vier Treiber. Sie waren
ausschließlich Mexikaner mit breiten Wagenrad-Sombreros,
kurzen Jacken und engen, geschlitzten Hosen.
»Burro!« schrien sie. »Burro! Burro!«
Sie zogen in kaum 100 Yards Entfernung an Haggertys
Versteck vorbei. Er blickte der kleinen Karawane lange nach.
Sie verschwand hinter dem langen Steinhang im Südwesten.
Das warme Gefühl wurde der Scout nicht los. Und dann sah
er das nahende Unheil. Lautlos bewegten sich die Chiricahuas
den Canyon hinunter, sichernd wie große Raubtiere auf der
Jagd. Sie hielten kurz an, bevor sie in das Buschwerk
eindrangen, das unterhalb des Hanges wuchs.
John wußte, daß die Tropa verloren war. Er konnte nichts für
die armen Teufel tun, die blind in ihr Unglück tappten. Er sah
jede Phase des Massakers, das sich dort drüben an der
Schrägwand anbahnte. Ein struppiger Schädel schob sich hinter
einem Gebüsch hervor. Ein Colt entlud sich krachend. Die
Kugel schleuderte den Apachen in das Dickicht zurück.
Haggerty preßte die Lippen zusammen. Das sinnlose Morden
ekelte ihn an. Er wollte seinen Revolver ziehen, unterließ es
aber, weil er sich die Gunst der Chiricahuas nicht verscherzen
durfte. Seine Mission stand im Vordergrund, ein Vorhaben, das
Hunderten von Weißen und Mexikanern das Leben retten
konnte.
Der Schuß des Tropaführers war Signal für den Kampf.
Schüsse fielen in schneller Reihenfolge, begleitet von den
vielfachem Echo in der Bergwelt. Pfeile zischten. Die Indianer
schrien: »Zastee! Tötet! Zastee!«
Tapferkeit und Mut halfen den mexikanischen Pistoleros
nichts. Der erste sank vom Pferd, von einem Pfeil tödlich
getroffen. Die restlichen drei verschanzten sich hinter toten
Mulis und deren Packen und eröffneten blindwütig das Feuer

auf die Apachen.
John warf einen Blick zur Anhöhe hinauf – und zuckte
zurück. Zwei graugekleidete Gestalten in hohen Mokassins und
Kittelhemden leiteten den Angriff und dirigierten ihre braune
Truppe so geschickt, wie es ein weißer Heerführer nicht besser
hätte machen können.
John sah noch einmal hin. Den Indianer neben Cochise hielt
er zuerst für Victorio. Doch schließlich erkannte er, daß es sich
um Chihuahua handeln mußte, einem der blutdürstigsten
Chiricahuas vom Stamm der Natdahe.
Wie gesagt, die Tapferkeit und der Todesmut halfen den
Mexikanern nicht viel. Unter wütendem Geheul setzten die
Rothäute zum Angriff an. Wie große Raubkatzen huschten sie
von Deckung zu Deckung.
Ein Messer zischte durch die Luft und traf einen Mexikaner.
Sein Finger krümmte sich um den Abzugbügel. Eine Kugel traf
seine Stirn, und er ging für immer zu Boden.
Wenige Minuten später war alles vorbei. Die Mexikaner
wurden skalpiert, die lebenden Mulis mit den Lasten
fortgetrieben, die Toten den Geiern und Bussarden überlassen.
Haggerty sah wieder nach oben. Mit Erschrecken stellte er
fest, daß Cochise ihn entdeckt hatte. Ihre Blicke kreuzten sich.
Eine drohende Kälte lag in dem des berühmten Häuptlings.
Wenn Cochise seine Hunde auf ihn losließ, war er verloren.
Übergangslos verschwand der Jefe auf der Anhöhe. Chihuahua
stand noch eine Weile und beobachtete das Gelände zu seinen
Füßen. Aber plötzlich war auch er wie vom Erdboden
verschluckt.
John Haggerty blieb eine lange Weile in seiner spärlichen
Deckung liegen und rührte sich nicht. Erneuter Hufschlag ließ
ihn ohne ersichtlichen Grund zusammenzucken.
Sie kamen, um auch ihn zur Hölle zu schicken. Aber dann
vernahm er das Traben beschlagener Hufe und seufzte
erleichtert. Blauröcke kamen durch den Canyon. Sie hielten

ihre Gewehre schußbereit in den Händen und sicherten
wachsam nach allen Seiten.
John zählte zwölf Dragoner unter Führung eines
milchbärtigen Offiziers, stand auf hinter seiner Deckung und
stieß einen gellenden Pfiff aus. Gut geschult drehten sich die
Soldaten zu ihm herum. John starrte in elf Gewehrmündungen
und in einen Revolverlauf.
»Kommen Sie her, Mann!«
Haggerty folgte dem Befehl. Die Patrouille war
wahrscheinlich aus Fort Bowie und kannte ihn nicht. Er mußte
vorsichtig sein, daß er nicht aus Versehen erschossen wurde.
Vor der Front der jungen Soldaten blieb John stehen. Der
Lieutenant war wirklich noch ein Milchbart und Greenhorn.
Aber er hatte einen älteren Corporal bei sich, der mindestens
seine zehn Dienstjahre an der Indianerfront auf dem Buckel
hatte.
»Ha, Mann, wer sind Sie? Haben Sie geschossen?«
Haggerty grinste. »So viel Schüsse auf einmal? Lieutenant,
ich gab nicht einen einzigen Schuß ab.«
»Aber wir hörten doch…«
»Ja, ja«, unterbrach der Scout ihn. »Alles hat seine
Richtigkeit. Reiten Sie nur ein Stück weiter, dann sehen Sie die
Bescherung.«
»Wer sind Sie, und wie kommen Sie allein in diese Einöde?«
»Ich bin John Haggerty, Chiefscout der Siebenten und auf
dem Weg zum Apachen-Paß.«
»Oh, Haggerty! Tut mir leid, Sir. Sie stehen im Rang eines
Captains, nicht wahr, wie Al Sieber?«
»Al ist Major, Lieutenant, und ich bin es ebenfalls. Aber
darüber wollen wir jetzt nicht reden. Haben Sie Spaten bei
sich?«
Der junge Offizier schüttelte den Kopf.
»Um ein paar tote Mexikaner zu begraben. Sie wurden von
Chiricahuas ausgelöscht. Wir werden ihnen ein Steingrab

machen. Einverstanden, Lieutenant?«
»Selbstverständlich, Sir. Wie Sie befehlen.«
»Nein, ich befehle nicht, das steht mir nicht zu. Ich bitte Sie
um diesen kleinen Liebesdienst.«
Der Offizier stieg vom Pferd und stellte sich vor: »Hank
Button, Sir. In Fort Bowie stationiert.«
Haggerty dankte mit einem Lächeln. Er sah, wie einige
Soldaten grinsten. Anscheinend stand der Offizier nicht sehr
hoch im Kurs bei ihnen.
»Wenn Sie einen Augenblick auf mich warten, Lieutenant…
Ich will nur mein Pferd holen.«
John ging los. Nach ein paar Minuten kam er mit seinem
Fuchswallach am Zügel zurück. Die Soldaten waren
abgestiegen und vertraten sich die Beine.
»Reiten wir oder gehen wir zu Fuß? Es sind nur ein paar
hundert Yards.«
»Wie Sie wünschen, Sir. Wir können auch zu Fuß gehen.
Nach einem Tagesritt schmerzen sowieso alle Knochen.«
»Und mein wundgescheuerter Hintern«, bemerkte ein Soldat.
Lieutenant Button warf ihm einen strafenden Blick zu, verkniff
sich aber eine Antwort.
Als die jungen Dragoner die skalpierten Mexikaner sahen,
schlugen sich einige in die Büsche und erbrachen sich. John
zog sein Gewehr aus dem Scabbard.
»Ich sehe mich um«, sagte er.
Lauernd strich er durch das Strauchwerk. Es raschelte um
ihn, aber kein Indianer war zu entdecken. Er ging weit in den
Canyon hinein. Aber auch dort waren keine Chiricahuas.
John kehrte zu den Soldaten zurück, die Steine
zusammentrugen.
»Haltet die Augen offen«, warnte er im Vorbeigehen den
Corporal. Der Mann richtete sich überrascht auf und zwirbelte
seinen irischen Schnurrbart. Überrascht war er deshalb, weil
ein Major ihn ansprach.
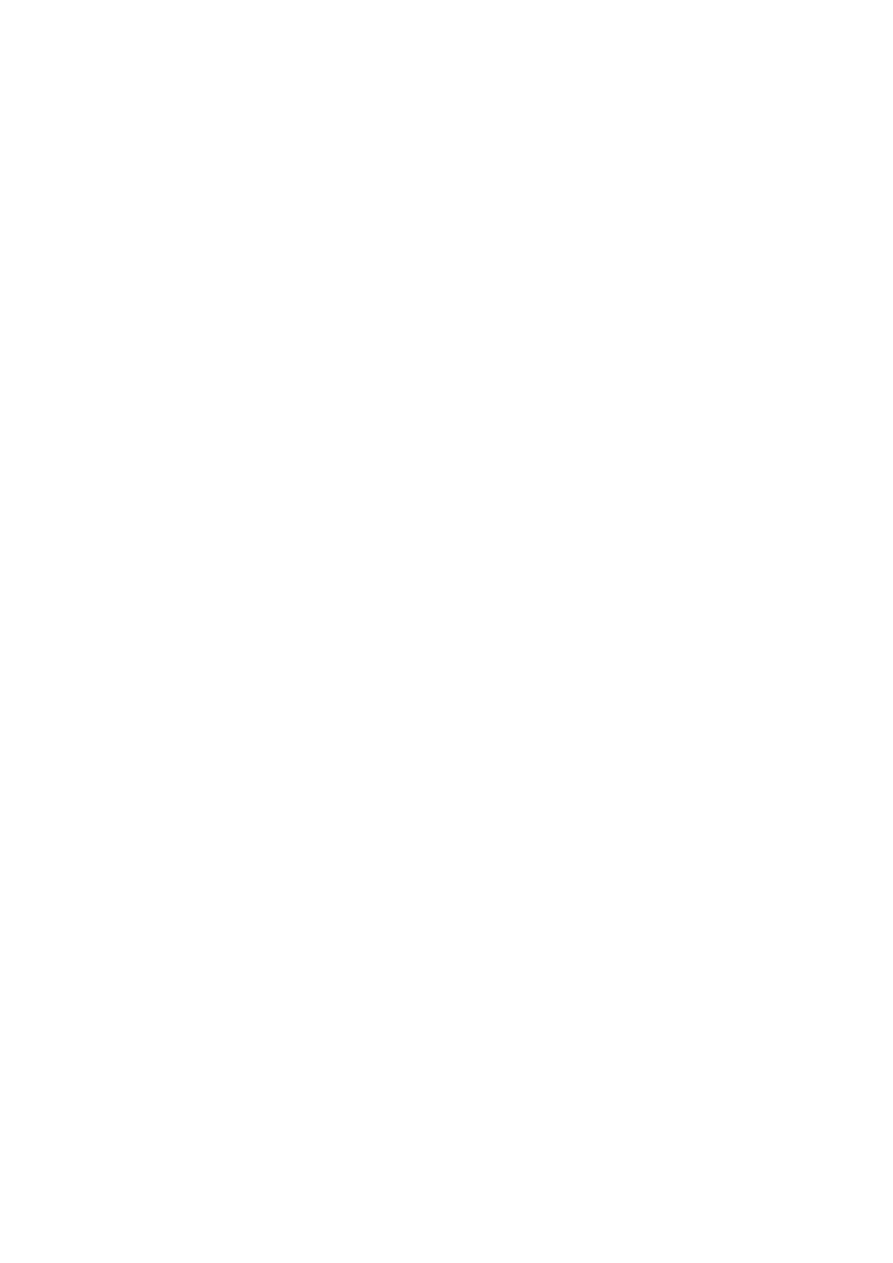
Als das Grab geschlossen war, nahmen die Männer ihre
Feldhüte ab.
Der Offizier sprach ein kurzes Gebet, und schloß mit den
Worten: »Der Himmel wird es den Wilden verzeihen, daß sie
die Menschen skalpieren. O Herr, nimm sie bitte gütig bei dir
auf.«
Das Grab wurde geschlossen. Lieutenant Hank Button
wandte sich an Haggerty: »Sie haben keine Angst, allein ins
Apachenland vorzudringen, Sir?«
»Sie haben doch auch keine, oder?«
»Doch, ich habe Angst. Und meine Männer ebenfalls. Wir
vertrauen darauf, daß die Rothäute eine so starke Militäreinheit
nicht angreifen, Sir.«
»Sie setzen Ihr Vertrauen auf eine vage Hoffnung, Mann.
Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Was sind ihre
zwölf Mann gegen die wilden Krieger Cochises? Der macht
Sie fertig, bevor Sie überhaupt merken, daß Chiricahuas in der
Nähe sind.«
»Sind die wirklich so schlimm?«
»Viel schlimmer. Apachen sehen Sie nur, wenn sie gesehen
werden wollen. Und dann ist es zu spät für Sie.«
»Großer Gott! Was kann ich tun, Sir? Wie muß ich mich
denen gegenüber verhalten?«
»Schicken Sie stets einen Reiter voraus, und sichern Sie Ihre
Flanken. Kein Allheilmittel, versteht sich, aber ein bißchen
hilft's doch. Tut mir leid, Lieutenant, ich muß weiter. Adios
und guten Ritt.«
John Haggerty schwang sich in den Sattel, schob das Gewehr
wieder in den Scabbard und ritt an. Vor ihm lagen die Berge im
blauen Dunst des tauenden Schnees. Er sah jeden Zacken,
jeden Grat in der klaren Luft, und er sah die tief in den Felsen
eingeschnittenen Canyons.
Fichten, Korkeichen und Wacholder neben Mesquite und
Manzanitas bedeckten die Hänge, und in diesem Augenblick,

als er dieses wilde Land weit voraus sah, überkam John
Haggerty ein kaltes Grauen vor seiner eigenen Verwegenheit.
Am liebsten wäre er umgekehrt, aber die Pflicht und seine
Aufgabe trieben ihn weiter. Gegen Abend sah er auf einer
Mesa einen dunklen Punkt. Er zog sein Glas und erkannte
einen Reiter, der dem Norden zustrebte. Als er sein Glas
schärfer einstellte, erkannte John den Stern auf der Brust des
Einsamen.
Auch Marshal Andrew Marley ritt neuen Aufgaben entgegen.
ENDE
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Apache Cochise 32 Geistertanz im Cheyenne Lager
Apache Cochise 33 Rote Spaeher im Niemandsland
Apache Cochise 29 Blutsbrueder des Falken
Apache Cochise 13 Apachen kennen kein Erbarmen
Apache Cochise 25 Cochise in Noeten
Apache Cochise 26 Das wilde Rudel
Apache Cochise 07 bis zum bitteren Ende
Apache Cochise 04 Cochise, die Geissel Gottes
Apache Cochise 12 Kein Apache stirbt allein
Apache Cochise 02 Mit dem Abend kam das Grauen
Apache Cochise 36 So long, Cochise
Apache Cochise 17 Apachen Poker
Apache Cochise 18 Letzte Huerde vor der Hoelle
Apache Cochise 01 Gefaehrlich wie eine Vipernbiss
Apache Cochise 05 Ein Pfeil als Lohn
Apache Cochise 09 Die Angst der Einsamen
Apache Cochise 03 Mit einem Stiefel in der Hölle
Apache Cochise 35 Der rote Agent
Apache Cochise 20 Cochises lange Jagd
więcej podobnych podstron